Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 21/15
|
|
|
- Lioba Möller
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 21/15 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen: Stichwort: 16 ArbEG; 398 BGB Reichweite der Abtretung von Vergütungsansprüchen unter Miterfindern nach Ablehnung einer Übernahme nach 16 ArbEG eines Miterfinders; Zuständigkeit der Schiedsstelle für abgetretene Ansprüche Leitsätze (nicht amtlich): 1. Überträgt der Arbeitgeber das Diensterfindungsschutzrecht einem übernahmewilligen Miterfinder gemäß 16 Abs. 1 ArbEG, und tritt der nicht übernehmende Miterfinder seine Rechte aus der Miterfinderschaft an dieser Diensterfindung nach deren Übertragung an den übernahmewilligen Miterfinder ab, so tritt dieser nur bezüglich der Ansprüche des nicht übernehmenden Miterfinders aus 9 ArbEG gegen den Arbeitgeber für den Zeitraum bis zur Übertragung gemäß 398 S. 2 BGB an dessen Stelle. 2. Die Mitübertragung des von dem nicht übernehmenden Miterfinder stammenden Schutzrechtsanteils an den übernahmewilligen Miterfinder stellt eine Schenkung des Arbeitgebers an diesen Miterfinder dar. 3. Über Ansprüche aus 16 ArbEG, die er dem übernehmenden Miterfinder hätte abtreten können, verfügte der nicht übernehmende Miterfinder nach Ablehnung der Übernahme gegenüber dem Arbeitgeber nicht mehr. 4. Soweit der übernehmende Miterfinder gegen den Arbeitgeber Ansprüche aus der Abtretung geltend macht, handelt es sich nicht um Ansprüche, die dem Antragsteller aufgrund seiner Arbeitnehmereigenschaft aus dem ArbEG zustehen, sondern um Ansprüche, die er losgelöst von seiner Arbeitnehmereigenschaft aufgrund eines Abtretungsvertrag mit einem anderen Arbeitnehmer geltend macht, weswegen die Schiedsstelle hierfür sachlich unzuständig ist.
2 Begründung: I. Sachverhalt Der Antragsteller ist Miterfinder zu 50 % der von der Antragsgegnerin im Jahr 2009 ( ) beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Erteilung eines Patents angemeldeten Diensterfindung ( ). Er ist Diplomingenieur Maschinenbau und war zum Zeitpunkt der Diensterfindung als Sachbearbeiter (technischer Planer) für den Funktionsbereich Produktionsplanung im Projekt Neuplanung ( ) eingesetzt. Die Antragsgegnerin benutzt die Diensterfindung seit Oktober Zum 15. Oktober 2013 hat sie die Patentanmeldung zu 100 % auf den Antragsteller übertragen, nachdem der zweite Miterfinder auf die Übertragung seines Anteils verzichtet hatte. Die Antragsgegnerin hat sich dabei ein Nutzungsrecht nach 16 Abs. 3 ArbEG vorbehalten. Streitgegenstand ist die angemessene Erfindervergütung für die Benutzung der Diensterfindung durch die Antragsgegnerin insbesondere für den Zeitraum Oktober 2009 bis Ende 2013, aber auch danach. Der Antragsteller geht davon aus, dass der Erfindungswert nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen zu ermitteln ist, da die Anwendung des durch die Patentanmeldung geschützten ( )werkzeugs ausschließlich intern im Rahmen der Fertigung erfolge und keinerlei Auswirkungen auf den Umsatz hätte. Denn durch den Einsatz der Diensterfindung würde kein höherer Umsatz generiert und sie hätte auch keine Auswirkung auf den Endproduktpreis. Es würde im Ergebnis allenfalls der Gewinn steigen. Der innerbetriebliche Nutzen berechne sich aus den spezifischen Fertigungskosten pro Baureihe, gerechnet in EUR pro Minute Fertigungszeit, der spezifischen Fertigungszeitreduzierung in Minuten pro Baureihe für den Verbau ( ) und der Anzahl der produzierten Endprodukte pro Baureihe. Insgesamt ergebe sich hierbei für den Zeitraum Oktober 2009 bis Ende 2013 eine Ersparnis von ,18, was mit dem Erfindungswert gleichzusetzen sei. Als Anteilsfaktor nimmt er 25 % an ( a=5, b=1, c=5 ). Daher betrage die Erfindervergütung ,05. Ihm sei nämlich der gesamte Erfindungswert zuzurechnen, weil der zweite Miterfinder mit Erklärung vom 28. März 2014 sämtliche Ansprüche im Zusammenhang mit der Diensterfindung an ihn abgetreten habe. Es sei lediglich vorläufig ein Risikoabschlag von 50 % in Abzug zu bringen, der bei Patenterteilung nachzuzahlen sei. Lediglich hilfsweise führt er aus, dass bei der Ermittlung des Erfindungswerts mit der Methode der Lizenzanalogie von einer Bezugsgröße von 7,5 und einem in der Branche
3 üblichen Lizenzsatz von 5 % auszugehen sei, woraus sich dann ein Erfindungswert von ,36 ergebe. Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass der Erfindungswert mit der Methode der Lizenzanalogie zu ermitteln sei, da die Endprodukte mit den erfindungsgemäß montierten Maschinenelementen für den Verkauf vorgesehen seien und deshalb durch die Erfindung zweifelsfrei ein Umsatzgeschäft betroffen sei. Sie hat deshalb davon abgesehen, die auf den erfassbaren betrieblichen Nutzen bezogenen Ausführungen im Detail zu kommentieren. Die angenommene Kostenersparnis akzeptiert sie jedoch ausdrücklich nicht. Als Bezugsgröße seien 6,25 pro Endprodukt anzusetzen, was den geschätzten Wertanteil der mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens montierten Maschinenelements darstelle. Als Lizenzsatz seien für die ( )industrie relativ hohe 0,8 % anzusetzen, die abzustaffeln seien. Man mache von dem nach 16 Abs. 3 ArbEG vorbehaltenen Nutzungsrecht Gebrauch und habe in diesem Zusammenhang auf eine Reduzierung des Lizenzsatzes um 20 % - 25 % verzichtet. Der Anteilsfaktor betrage 17 % ( a=2, b= 2,5, c=4 ). Hinsichtlich der Abtretungserklärung führt die Antragsgegnerin aus, dass der Miterfinder am 26. August 2013 anlässlich einer Übernahmeanfrage gemäß 16 Abs. 1 ArbEG mitgeteilt habe, kein Interesse an einer Übernahme der Patentanmeldung zu haben. Nachdem hingegen der Antragsteller die Übertragung verlangt habe, sei das Schutzrecht nur diesem am 15. Oktober 2013 vollständig übertragen worden. Die Abtretungserklärung sei daher hinsichtlich der Vergütungsansprüche, die Nutzungen nach der Übertragung betreffen, ohne jede Relevanz ( ) II. Wertung der Schiedsstelle 1. Vorbemerkung Gemäß 28 ArbEG hat die Schiedsstelle bei einem bestehenden Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber (Beteiligte) aufgrund des ArbEG nach Anhörung beider Seiten zu versuchen, eine gütliche Einigung herbeizuführen ( ). 2. Anwendbares Recht Auf das Schiedsstellenverfahren sind gemäß 43 Abs. 3 ArbEG die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung anzuwenden, da die Erfindung vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurde. 3. zur Abtretungsvereinbarung vom 28. März 2014 Der zweite Miterfinder, Herr Y, hat mit Schreiben vom 28. März 2014 seine Ansprüche aus der Diensterfindung an den Antragsteller abgetreten. Daher ist zunächst zu klären,
4 wie sich diese Abtretungserklärung in der Sache, aber auch auf das Schiedsstellenverfahren an sich auswirkt. a) Auswirkung in der Sache Nach 398 BGB kann eine Forderung vom Gläubiger auf einen anderen mit der Folge übertragen werden, dass der neue Gläubiger an die Stelle des bisherigen Gläubigers tritt. Voraussetzung für die Übertragung von Forderungen ist somit zunächst, dass solche auch bestehen. Im vorliegenden Fall kommen zwei derartige Forderungen in Betracht. aa) Forderung nach 9 ArbEG Unzweifelhaft hatte der Miterfinder Herr Y aufgrund der Benutzung der Diensterfindung einen Vergütungsanspruch gegen die Antragsgegnerin nach 9 ArbEG. Hinsichtlich der Abtretung ist zunächst der zeitliche Umfang dieses Anspruchs zu bestimmen. Der Vergütungsanspruch nach 9 ArbEG beruht auf der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung. Der Gesetzgeber versteht hierunter den durch die tatsächliche Verwertung der Diensterfindung realisierten Erfindungswert, der sich im vorliegenden Fall aus der Benutzung im eigenen Betrieb ergibt 1. Der Erfindungswert ist somit der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund einer Benutzung der Diensterfindung tatsächlich zufließt. Nachdem nach 2 ArbEG das gesamte Arbeitnehmererfinderrecht an eine patentfähige Erfindung des Arbeitnehmers anknüpft, kann auch der Erfindungswert keinen anderen Anknüpfungspunkt als das gemäß aus einem Patent resultierenden Monopolrecht ( 9 PatG) haben. Wenn ein Arbeitgeber eine Diensterfindung im eigenen Betrieb benutzt, ist der geldwerte Vorteil deshalb das, was der Arbeitgeber einem freien Erfinder für die Nutzung der geschützten technischen Lehre zahlen müsste, wenn ihm das Recht zur Nutzung der technischen Lehre nicht im Rahmen der 5 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden wäre. Der Arbeitgeber muss einem freien Erfinder für die Benutzung der erfindungsgemäßen Lehre aber nur solange etwas bezahlen, als zu dessen Gunsten eine Monopolsituation besteht. Entfällt die Monopolsituation des freien Erfinders, kann der Arbeitgeber die erfindungsgemäße Lehre als frei verfügbaren allgemeinen Stand der Technik ohne Gegenleistung nutzen. Deshalb fließt ihm bei einer in Anspruch genommenen Diensterfindung auch nur solange ein durch seinen Arbeitnehmer vermittelter geldwerter Vorteil zu, 1 Bundestagsdrucksache 1648 Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu 8.
5 als er über eine Monopolsituation hinsichtlich der erfindungsgemäßen Lehre verfügt. Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin die Patentanmeldung zum 15. Oktober 2013 auf den Antragsteller übertragen, so dass ihre aus dem Patentgesetz resultierende Vorzugsstellung zu diesem Zeitpunkt endete. Folglich endeten damit auch die Vergütungsansprüche der Arbeitnehmererfinder aus 9 ArbEG. Daher endeten auch die Vergütungsansprüche des Miterfinders Herr Y aus 9 ArbEG zu diesem Zeitpunkt. Gegenstand der Abtretung vom 28. März 2014 waren daher Forderungen aus 9 ArbEG, die den Benutzungszeitraum Oktober 2009 bis 15. Oktober 2013 betreffen. bb) Forderung nach 16 Abs. 3 ArbEG Darüber hinaus weist das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen dem Arbeitnehmererfinder in 16 Abs. 3 ArbEG einen weiteren von 9 ArbEG unabhängigen Vergütungsanspruch zu. Dieser Vergütungsanspruch hat jedoch zur Voraussetzung, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nach 16 Abs. 1 ArbEG die Patentanmeldung auf dessen Verlangen überträgt, wenn er selbst beabsichtigt, diese nicht mehr weiterzuverfolgen und sich ein nichtausschließliches Nutzungsrecht an der erfindungsgemäßen Lehre vorbehält und davon dann auch tatsächlich Gebrauch macht. Im vorliegenden Fall hat nur der Antragssteller die Übertragung der Patentanmeldung verlangt. Hingegen hatte der Miterfinder Herr Y am 26. August 2013 erklärt, kein Interesse an der Übernahme zu haben. Ausgangspunkt für die Klärung, welche Rechtsfolgen sich hieraus ergeben, ist 6 PatG, wonach mehreren Miterfindern das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zusteht. Miterfinder stehen somit gemäß 741 BGB hinsichtlich ihrer individuellen Anteile an der erfindungsgemäßen Lehre in einer Bruchteilsgemeinschaft nach 742 BGB. Dies hat zur Folge, dass der Arbeitgeber nach Meldung einer Diensterfindung nach 5 ArbEG jeden einzelnen Miterfinderanteil durch individuelle Inanspruchnahme dieses Miterfinderanteils gegenüber dem jeweiligen Erfinder gesondert auf sich überleiten muss, möchte er Alleinberechtigter an der Diensterfindung werden. Hat er dies getan, wird er nach 7 ArbEG Alleineigentümer der Erfindung und alleiniger Inhaber des Rechts auf das Patent, das nach 16 PatG eine Höchstschutzdauer von zwanzig Jahren aufweist. Möchte der Arbeitgeber das Recht auf das Patent vor Ablauf dieser Höchstschutzdauer fallen lassen, so ist er hierzu als Rechteinhaber im Rahmen
6 seiner unternehmerischen Dispositionsfreiheit grundsätzlich befugt. Da aber Ausgangspunkt des Rechts auf das Patent eine Erfindung von Arbeitnehmern war, soll 16 ArbEG verhindern, dass den Arbeitnehmern ihre dem jeweiligen Umfang ihres Miterfinderanteils entsprechende Partizipationsmöglichkeit an der Höchstschutzdauer des Patents durch die Aufgabe der Schutzrechtsposition durch den Arbeitgeber einseitig genommen wird. 16 ArbEG dient somit der Rückabwicklung des durch die 6, 7 ArbEG im Rahmen der Inanspruchnahme bewirkten Rechteübergangs. Das hat zur Folge, dass einem Arbeitnehmer im Rahmen dieser Rückabwicklung nur der Anteil an dem Patent bzw. hier der Patentanmeldung durch das Übernahmeverlangen zufällt, der seinem ursprünglichen Miterfinderanteil und damit seiner ursprünglichen Rechtsposition entspricht. Deshalb fallen ihm Anteile von Miterfindern auch dann nicht zu, wenn diese wie hier an der Übernahme des Patents bzw. der Patentanmeldung kein Interesse haben. Diese verbleiben zunächst im Eigentum des Arbeitgebers. Dieser Systematik folgt dann das nach 16 Abs. 3 ArbEG vorbehaltene nichtausschließliche Benutzungsrecht. Die für eine derartige Benutzung angemessene Vergütung unterliegt deshalb weiterhin den Berechnungsparametern des Anteilsfaktors und des Miterfinderanteils. Denn diese Parameter verändern sich durch die Rückabwicklung nicht, da nach 16 ArbEG ja lediglich der ursprüngliche Zustand, gegebenenfalls belastet durch ein nichtausschließliches Benutzungsrecht wieder hergestellt werden soll. Die Antragsgegnerin hat jeweils mit Schreiben vom 12. August 2013 dem Antragsteller und dem Miterfinder Herrn Y ihre Aufgabeabsicht nach 16 Abs. 1 ArbEG mitgeteilt. Mit Zugang dieser empfangsbedürftigen Willenserklärungen i.s.v. 130 BGB hat sie sich einseitig gebunden. Daraufhin hat der Antragsteller am 2. September 2013 erklärt, die Patentanmeldung weiterführen zu wollen und damit gemäß 16 Abs. 2 ArbEG die Übertragung verlangt, während der Miterfinder Herr Y am 26. August 2013 erklärt hat, kein Interesse an einer Übernahme zu haben. Diese Mitteilungen waren ebenfalls empfangsbedürftigen Willenserklärungen i.s.v. 130 BGB und sind mit Zugang bei der Antragsgegnerin bindend geworden. Ansprüche des Miterfinders Herrn Y sind deshalb bereits mit Zugang seines Schreibens bei der Antragsgegnerin, allerspätestens aber drei Monate nach Zugang des Angebots der Antragsgegnerin vom 12. August 2013 erloschen. Hingegen hat der Antragsteller mit seiner Erklärung in Form eines einseitigen Rechtsgeschäfts die schuldrechtliche Pflicht der Antragstellerin zur unverzüglichen Übertragung seines Miterfinderanteils an der Patentanmeldung begründet.
7 Folglich verfügte der Miterfinder Herr Y zum Zeitpunkt der Abtretungserklärung am 28. März 2014 über keine Ansprüche aus 16 ArbEG, welche er dem Antragsteller hätte abtreten können. Im Ergebnis ist der Antragsteller durch die Abtretungserklärung des Miterfinders Herrn Y nur hinsichtlich dessen Ansprüchen gegen die Antragsgegnerin aus 9 ArbEG für den bis zum 15. Oktober 2013 laufenden Nutzungszeitraum gemäß 398 S. 2 BGB an dessen Stelle getreten. b) formale Auswirkung auf das Schiedsstellenverfahren Nach 28 i.v.m. 37 Abs. 1 ArbEG ist die Schiedsstelle zuständig für Streitfälle zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über deren Rechte aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen. Soweit der Antragsteller Ansprüche aus der Abtretung geltend macht, handelt es sich aber nicht um Ansprüche, die dem Antragsteller aufgrund seiner Arbeitnehmereigenschaft aus dem ArbEG zustehen, sondern um Ansprüche, die er losgelöst von seiner Arbeitnehmereigenschaft aufgrund eines Abtretungsvertrag mit einem anderen Arbeitnehmer geltend macht. Insofern handelt es sich nicht um eine Streitigkeit, die der Antragsteller als Arbeitnehmer mit seinem Arbeitgeber hat, sondern um eine Streitigkeit, die der Antragsteller als sonstiger Anspruchsinhaber mit seinem Arbeitgeber hat. Dies hat zur Folge, dass die Schiedsstelle hierfür nicht zuständig ist. 4. Umfang des eigenen Rechts des Antragstellers aus 16 Abs. 3 ArbEG Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller allerdings nicht nur den ihm zustehenden Anteil an der Patentanmeldung, sondern die Patentanmeldung in Gänze gemäß 15 Abs. 1 S. 2 PatG übertragen. Soweit sie somit auch den den Miterfinder Herrn Y betreffenden Anteil übertragen hat, handelte sie nicht aus einer Verpflichtung aus 16 ArbEG heraus, sondern aus freien Stücken. Sie hat dem Antragsteller letztlich losgelöst von Verpflichtungen aus dem ArbEG den Anteil des Miterfinders geschenkt, der andernfalls in ihrem Eigentum verblieben wäre. Da dies somit unabhängig von einer Verpflichtung aus 16 ArbEG geschehen ist, kann der Antragsteller hieraus keine eigenen im ArbEG begründeten Rechte ableiten. Arbeitnehmererfinderrechtlich verbleibt es daher bei einem Vergütungsanspruch des Antragstellers nach 16 Abs. 3 ArbEG, der wie bereits ausgeführt Anteilsfaktor und Miterfinderanteil zu berücksichtigen hat. Weiterhin läge die Vergütung eigentlich rund % niedriger als vor der Schutzrechtsübertragung, da der Arbeitgeber nunmehr nur
8 noch über den geldwerten Vorteil aus einem einfachen Nutzungsrecht verfügt und nicht mehr über eine absolute Monopolstellung. Die Antragsgegnerin hat zu Gunsten des Antragstellers allerdings bislang darauf verzichtet, diesen Abschlag vorzunehmen. 5. Vergütungsanspruch nach 9 ArbEG Die Antragsgegnerin hat die Diensterfindung nach 6 ArbEG in Anspruch genommen. Damit sind die Rechte an dieser Diensterfindung gemäß 7 ArbEG vom Antragsteller auf die Antragsgegnerin mit der Folge übergegangen, dass die Antragsgegnerin über die Rechte an der Diensterfindung frei verfügen kann und der Antragsteller nach 9 ArbEG dem Grunde nach einen Vergütungsanspruch gegen die Antragsgegnerin hat. Die Höhe des Vergütungsanspruchs richtet sich nach 9 Abs. 2 ArbEG nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung. Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet. Die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung finden im Anteilsfaktor ihren Niederschlag. Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach 9 Abs. 1 ArbEG ist somit das Produkt aus Erfindungswert x Anteilsfaktor. Wenn die Erfindung wie vorliegend auf mehrere Miterfinder zurückgeht, ist dies bei der Bemessung der Vergütung ebenfalls zu berücksichtigen. 6. zum Erfindungswert Wie bereits unter Ziffer 3 a) aa) ausgeführt ist der Erfindungswert der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund einer Benutzung der Diensterfindung tatsächlich zufließt. Ausgangspunkt für die Ermittlung dieses Erfindungswerts ist der Umfang der aus dem Patent resultierenden Monopolstellung. Denn das Arbeitnehmererfinderrecht knüpft gemäß 2 ArbEG an eine patentfähige Erfindung des Arbeitnehmers und nicht an reine betriebliche Verbesserungen an, welche ohne jedes Vergütungsrecht bereits dem Arbeitgeber als Arbeitsergebnis zugewiesen sind. Wenn ein Arbeitgeber wie im vorliegenden Fall eine Diensterfindung im eigenen Betrieb benutzt, ist der geldwerte Vorteil deshalb das, was der Arbeitgeber einem freien Erfinder für die Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre zahlen müsste 2, wenn ihm das Recht zur Nutzung der dieser monopolgeschützten technischen Lehre nicht im Rahmen der 5 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden wäre. 2 BGH vom Az.: X ZR 104/09 antimykotischer Nagellack I.
9 Für die Ermittlung dieses geldwerten Vorteils kommen gemäß 11 ArbEG i.v.m. RL Nr. 3 grundsätzlich drei verschiedene Methoden in Betracht, nämlich die Ermittlung mit der Methode der Lizenzanalogie, die Ermittlung nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen oder eine freie Schätzung. Im Ergebnis wird letztlich bei allen drei Methoden der dem Arbeitgeber zugeflossene geldwerte Vorteil geschätzt, weshalb alle drei Methoden bei richtiger Anwendung zum gleichen Ergebnis führen müssen. Hierbei ist der Methode der Vorzug einzuräumen, bei der der Marktpreis der Erfindung und damit der Erfindungswert am genauesten geschätzt wird. Nur selten zielführend ist die Methode der reinen Schätzung. Sie kommt nur dann zum Einsatz, wenn die aufgrund der Diensterfindung zugeflossenen geldwerten Vorteile nicht in Bezug zu messbaren Größen gesetzt werden können, da sie in keinerlei Bezug zu Umsatzgeschäften stehen. Da dies hier nicht der Fall ist, scheidet diese Methode vorliegend von vornherein aus. Somit verbleiben die Methoden der Lizenzanalogie und der Erfassung des betrieblichen Nutzens. Erfahrungsgemäß führt allerdings bei Umsatzgeschäften im Zusammenhang mit der Erfindung regelmäßig die Lizenzanalogie zur genauesten Schätzung des Erfindungswerts 3. Denn üblicherweise werden freie Erfindungen im Wege der Lizenzerteilung verwertet. Wird eine Erfindung wie hier im Rahmen der Wertschöpfung von am Markt vertriebenen Produkten eingesetzt, dienen dabei regelmäßig erfindungsbezogene Nettoumsätze und ein marktüblicher Lizenzsatz als Bezugspunkte für einen Lizenzvertrag, der die Stärke der Monopolstellung des Schutzrechtsinhabers aufzeigt. Daher kann durch die fiktive Nachbildung eines solchen zwischen einem Unternehmen und einem freien Erfinder gedachten vernünftigen Lizenzvertrags (Lizenzanalogie) am Besten der Marktpreis ermittelt werden, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder zahlen müsste 4. Hingegen bereitet die vorliegend vom Antragsteller bevorzugte Methode der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen in der Umsetzung beträchtliche Schwierigkeiten und ist deshalb nicht so exakt, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. Denn auch sie kommt in ganz beträchtlichem Maße nicht ohne Schätzungen und Wertungen aus. Die Ermittlung des konkreten betrieblichen Nutzens erfordert nämlich einen Kosten- und Ertragsvergleich nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zwischen dem Zustand bei Einsatz der Erfindung und der fiktiven Situation ohne Erfindungseinsatz, wobei entscheidend hinzukommt, dass hinsichtlich der Situation ohne Erfindungseinsatz nicht vom Ist-Zustand im Unternehmen ausgegangen werden 3 Ständige Schiedsstellenpraxis und ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, vgl. zuletzt BGH vom Az.: X ZR 104/09 antimykotischer Nagellack I. 4 BGH vom , Az.: X ZR 137/07 Türinnenverstärkung; vom , Az.: X ZR 127/99 abgestuftes Getriebe; vom , Az.: X ZR 6/96 Copolyester II.
10 darf, sondern der allgemeine Stand der Technik fiktiv in den Sachverhalt hinein interpretiert werden muss, d.h. es ist zu bewerten, wie ein Kosten- und Ertragsvergleich nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aussehen würde, wäre der allgemeine Stand der Technik bereits im Unternehmen verwirklicht. Denn Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts ist bei allen Methoden zur Ermittlung des Erfindungswerts stets der Umfang der aus einem Patent resultierenden Monopolstellung. Daher ist auch bei der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen nur das Delta relevant, das den Abstand vom allgemeinen Stand der Technik ausmacht. Für den vorliegenden Fall bedeutet das, dass eben nicht einfach ein Vorher-Nachher-Vergleich hinsichtlich des Aufwands bei der Montage der Maschinenelemente angestellt werden darf. Zunächst müsste vielmehr überlegt werden, welcher Aufwand bei der Montage gegeben wäre, wäre der allgemeine Stand der Technik bei der Antragsgegnerin bereits verwirklicht gewesen. Darauf aufbauend hätte gemessen werden müssen, inwieweit der Einsatz der Diensterfindung zu einer weiteren Verbesserung geführt hat. An diesem Punkt kann dann eine Vielzahl von wirtschaftlichen Größen regelmäßig nur noch im Wege der Schätzung angesetzt werden und macht diese Methode entgegen des ersten Anscheins hochspekulativ mit dem Risiko einer erheblich größeren Schätzungenauigkeit als dies bei der Methode der Lizenzanalogie der Fall ist. Würde man hingegen, was wohl tatsächlich vergleichsweise einfach wäre, einen reinen tatsächlichen Vorher-Nachher-Vergleich anstellen, würde man in aller Regel in erheblichem Maße Verbesserungen bei der Ermittlung des Erfindungswerts berücksichtigen, die nicht in der durch die Erfindung vermittelten Monopolstellung gegenüber dem Stand der Technik, sondern im innerbetrieblichen Stand der Technik begründet sind. Vergütungspflichtig nach dem ArbEG ist aber nur die geschaffene Monopolsituation, nicht aber die umfängliche Verbesserung der Gesamtsituation. Im Ergebnis ist es oftmals so, dass der Einsatz einer Diensterfindung für das konkrete Unternehmen wie möglicherweise auch hier einen großen internen Vorteil bringt, dieser Vorteil aber gegenüber Mitbewerbern nicht sonderlich ins Gewicht fällt, weil dort ein vergleichbarer Effekt ebenfalls erzielt wird. Maßstab des Arbeitnehmererfindergesetzes ist aber vorrangig der durch die Monopolsituation vermittelte Vorteil gegenüber dem Mitbewerber. Bei ernsthafter Anwendung dieser Grundsätze ist die Methode der Lizenzanalogie auch nicht vorteilhafter für den Arbeitgeber oder nachteiliger für den Arbeitnehmer als die Methode nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen. Vielmehr führen dann beide Methoden zum selben Marktpreis der Erfindung und damit zum selben Erfindungswert. Die Schiedsstelle ist daher auch im vorliegenden Fall wie meist der Auffassung, dass nicht die Methode der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen, sondern die Methode der Lizenzanalogie dem Ziel, den Erfindungswert zu
11 ermitteln, am besten gerecht wird. Denn die für die fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags maßgebenden Faktoren Bezugsgröße und marktüblicher Lizenzsatz sind deutlich einfacher und belastbarer ermittelbar als der tatsächlich dem Monopolschutz geschuldete betriebliche Nutzen. Die Antragsgegnerin macht Umsatzgeschäfte mit Endprodukten. Der erfindungsgemäße Gegenstand wird zwar letztlich nicht Teil dieser Endprodukte, er kommt aber bei der Montage jedes einzelnen Endprodukts ganz konkret zum Einsatz. Damit drückt sich in den Endprodukten ein Vorteil aus, den die Diensterfindung verschafft hat, so dass es sachgerecht ist, die produzierten Endprodukte in einem in der Folge zu bestimmenden Umfang zur Bezugsgröße eines fiktiven Lizenzvertrags über die Diensterfindung zu machen 5. Der Antragsteller hat für den Fall einer Ermittlung des Erfindungswerts nach der Lizenzanalogie eine Bezugsgröße von 7,50 pro produziertem Endprodukt als sachgerecht angesehen. Die Antragsgegnerin ist hingegen von 6,25 pro Endprodukt ausgegangen. Die Beteiligten haben ihre Differenzen an diesem Punkt im Schiedsstellenverfahren jedoch nicht in einer technischen Diskussion weiter vertieft. Im Hinblick auf die Tatsache, dass die für sachgerecht angesehenen Werte nicht allzu weit auseinander liegen, schlägt die Schiedsstelle zu Vermeidung weiteren Streits vor, zu Gunsten des Antragstellers von 7,50 pro Endprodukt auszugehen. Der nunmehr festzulegende Lizenzsatz entspricht der Gegenleistung für die Überlassung der Erfindung, die vernünftige Lizenzvertragsparteien vereinbart hätten, wenn es sich bei der Diensterfindung um eine dem Arbeitgeber zur ausschließlichen Nutzung überlassene Erfindung eines freien Erfinders handeln würde. Es ist somit der marktübliche Lizenzsatz zu ermitteln. Die Antragsgegnerin ist im vorliegenden Fall davon ausgegangen, dass ein Lizenzsatz von 0,8 % marktüblich ist, der Antragssteller hingegen von einem Lizenzsatz von 5 %. Am einfachsten wäre die Ermittlung des marktüblichen Lizenzsatzes, wenn bereits ein konkret abgeschlossener Lizenzvertrag für die betreffende Erfindung bzw. das Schutzrecht im gleichen oder vergleichbaren Produktmarkt existieren würde, aus dem der zwischen den Lizenzvertragsparteien vereinbarte Lizenzsatz für eine bestimmte Bezugsgröße abgelesen werden könnte (konkrete Lizenzanalogie). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Daher muss mit Hilfe der abstrakten Lizenzanalogie bewertet werden, welcher Lizenzsatz für die Diensterfindung bei einer Lizenzvergabe an einen fremden Lizenznehmer 5 Vgl. BGH vom , Az.: X ZR 186/01 Abwasserbehandlung.
12 vernünftigerweise vereinbart werden würde. Dies setzt die Kenntnis von Lizenzverträgen auf dem Markt der mit der erfindungsgemäßen technischen Lehre hergestellten Produkte voraus. Lizenzsätze belasten die Preiskalkulation entsprechender Produkte. In welchem Maß der Preis eines Produkts mit Lizenzen belastbar ist, bestimmt wiederum die Marktsituation für die einschlägigen Produkte. Die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich daher auch in den für diesen Produktmarkt üblichen Lizenzsatzrahmen wieder. Ein Lizenzsatz ist deswegen dann marktüblich, wenn er sich in diesem konkreten Rahmen bewegt. Dementsprechend haben Produktsparten mit relativ geringen Margen ( ) tendenziell einen relativ niedrig liegenden marktüblichen Lizenzsatzrahmen, während Produktsparten wie z.b. die Medizintechnik, in welcher hohe Margen die Regel sind, einen deutlich höher anzusetzenden Lizenzsatzrahmen aufweisen. Nicht hilfreich bei der Bestimmung der marktüblichen Lizenzsätze sind die in RL Nr. 10 angegebenen Lizenzsatzrahmen, welchen der Antragsteller seine Vorstellungen möglicherweise entnommen hat. Diese spiegeln nämlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr den am Markt üblichen Rahmen wider, da sie im Wesentlichen aus den Richtlinien von 1944 übernommen wurden und somit zum Zeitpunkt des Erlasses der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 bereits veraltet waren. Darüber hinaus differenzieren sie nur nach Industriezweigen und nicht weiter nach Produktmärkten und können daher den typischen Kalkulationsspielräumen auf den einschlägigen Produktmärkten nicht immer hinreichend Rechnung tragen. Dementsprechend ist der marktübliche Lizenzsatz nach ständiger Schiedsstellenpraxis und der neueren Rechtsprechung des BGH unter Rückgriff auf Erfahrungswerte und die Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse erzielbaren Lizenzsätze zu ermitteln 6. Der vorliegend heranzuziehende Produktmarkt für die Bestimmung des marktüblichen Lizenzsatzes ist der der ( ), da die Antragsgegnerin Marktteilnehmerin in diesem Markt ist, die Diensterfindung bei der Herstellung von Produkten für diesen Markt benutzt und somit den in diesem Markt herrschenden wirtschaftlichen Gegebenheiten unterliegt. In diesem Markt ( ) kalkulieren die Unternehmen mit Blick auf den Ausbau von Marktanteilen oder, um zumindest dem Wettbewerbsdruck Stand zu halten, relativ knapp. Das hat zur Folge, dass innerhalb dieser knappen Kalkulation auch nur ein enger Spielraum für die auf ein Produkt entfallenden Kosten für Lizenzen verbleibt. Das zeigt sich auch daran, dass die EBIT- Marge ( ) im Schnitt kaum die 10 % erreicht und überwiegend deutlich darunter liegt. Davon ausgehend dürfte die Obergrenze für Erfindungskomplexe oder sehr wertvolle 6 BGH vom , Az.: X ZR 137/07 Türinnenverstärkung.
13 Einzelerfindungen um 2 % liegen. Dementsprechend hatte die Schiedsstelle einmal für ein Produkt, zu dem es keinerlei Alternativen auf dem Markt gab, einen Lizenzsatz von 2 % als marktüblich angesehen ( ) Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle bewegen sich mithin durchschnittliche marktübliche Einzellizenzsätze regelmäßig zwischen 0,5 % und 1 %, für Massenprodukte auch unter 0,5 % 7. In einem kürzlich von der Schiedsstelle zu entscheidenden Verfahren bewegten sich die Lizenzsätze für verschiedene ( )komponenten jeweils im Bereich um 1 %. Der Schiedsstelle ist überdies bekannt, dass sich Lizenzsätze tatsächlich in diesem Bereich abgeschlossener Lizenzverträge in aller Regel ebenfalls in einem Lizenzsatzrahmen von 0,1 % - ca. 2 % bewegen. Es handelt sich dabei um Lizenzsätze, die unter vernünftigen branchenangehörigen Mitbewerbern in redlichen kaufmännischen Verhandlungen u.a. vor dem Hintergrund vereinbart werden, dass man sich immer zweimal im Leben sieht und dass Lizenzgebühren auch dann zu bezahlen sind, wenn erfindungsgemäß herstellte Produkte die Gewinnzone nicht erreichen oder diese verlassen, gleichwohl aus anderen Gründen aber nicht vom Markt genommen werden können. Nicht repräsentativ und daher nicht hilfreich bei der Ermittlung marktüblicher Lizenzsätze sind hingegen hin und wieder überwiegend aus Patentverletzungsprozessen bekannt gewordene Werte, die zum Hintergrund haben, die unter Sanktionsgesichtspunkten die Gewinnabschöpfung zum Ziel hatten. Somit ist für den vorliegenden Fall nur noch zu klären, wo die vorliegenden Diensterfindung in einem Lizenzsatzrahmen anzusiedeln ist, der im Bereich um 2 % seine Obergrenze findet. Wo im Lizenzsatzrahmen eine Diensterfindung im Einzelfall anzusiedeln ist, hängt im Wesentlichen vom Ausschlusswert des technischen Schutzrechts ab. Je höher der Ausschlusswert gegenüber Mitbewerbern ist, umso höher liegt der Lizenzsatz, weil durch den Ausschlusswert der Marktanteil zunimmt. Im vorliegenden Fall ist aber nicht erkennbar, dass die streitgegenständliche Erfindung eine wesentliche Vorzugsstellung gegenüber Wettbewerbern vermittelt. Selbst der Antragsteller hat ausgeführt, dass die Erfindung wohl weder Auswirkungen auf den Umsatz noch auf den Endproduktpreis haben wird, sondern allenfalls den Gewinn um 1,50 bis 3 pro Endprodukt (bei Produktpreisen von weit über ) erhöhen wird. Aber selbst bei Letzterem ist zu berücksichtigen, dass diese Gewinnerhöhung nicht in vollem Umfang dem Abstand der erfindungsgemäßen Lehre vom Stand der Technik, sondern wohl überwiegend dem Abstand vom innerbetrieblichen Stand der Technik geschuldet ist. Soweit die Erfindung aber nur den innerbetrieblichen Stand der Technik, aber nicht den äußeren Stand der Technik verbessert, hat dies keine Auswirkungen auf 7 Eine Vielzahl von Nachweisen zur Schiedsstellen- und Gerichtspraxis findet sich u.a. in: Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 4. Auflage, 2017, S. 449 ff.; Trimborn, Lizenzsätze für Erfindungen in Deutschland ab 1995, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2009, S. 269.
14 den Wettbewerb und kann nicht in besonderem Maße lizenzsatzerhöhend wirken. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass es für das mit der Diensterfindung gelöste Problem hinreichend anderweitige Lösungen bei Mitbewerbern wie auch vermutlich im Unternehmen der Antragsgegnerin selbst gibt, selbst wenn diese nicht zu in gleicher Weise technisch eleganten Lösungen führen sollten. Andererseits soll nicht außer Acht bleiben, dass die hinter der Erfindung stehende Idee des Antragstellers der Antragsgegnerin tatsächlich Aufwand erspart. Dem wird aber durch einen für die einschlägige Branche vergleichsweise robusten Einzellizenzsatz von 0,8 % hinreichend Rechnung getragen. Die Schiedsstelle ist weiterhin der Auffassung, dass der vorgeschlagene Lizenzsatz nur dann marktüblich ist, wenn er auch der Abstaffelung unterliegt, das heißt, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduziert wird. Hierfür spricht bereits, dass auch die aus der Literatur zitierten Lizenzsätze ganz überwiegend der Abstaffelung unterlagen. Abstaffelung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduziert wird. Ausgehend von den mitgeteilten Zahlen ergibt sich bereits für den Zeitraum 2009 bis Ende 2014 bei einer Bezugsgröße von 7,50 pro Endprodukt und einer Stückzahl von Endprodukten ein erfindungsgemäßer Umsatz von Bei derartigen Stückzahlen ist die Abstaffelung der Ausgangslizenzsätze regelmäßig auch Gegenstand eines Lizenzvertrages 8. Dies hat den Hintergrund, dass ein vernünftiger Lizenzgeber seine Erfindung schon im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizenzieren wird, das aufgrund seiner Marktposition hohe bis sehr hohe Umsätze erwarten lässt. Damit verbunden ist dann auch das Zugeständnis im Lizenzvertrag zu einer Reduzierung (Abstaffelung) des Lizenzsatzes ab bestimmten Umsatzgrenzen, da ein solches Unternehmen eben nicht nur aufgrund der neuen technischen Lehre, sondern auch aufgrund seiner Marktposition in der Lage ist, hohe Umsätze zu generieren. Denn letztlich wird ein Lizenzgeber auf diese Art und Weise im Ergebnis gleichwohl höhere Lizenzeinnahmen erzielen, als wenn er seine Erfindung an ein nicht entscheidend im Markt verhaftetes Unternehmen lizenziert und dafür keine Abstaffelung des Lizenzsatzes vereinbart. Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach eine Abstaffelung zwar von der Üblichkeit in den verschiedenen Industriezweigen abhängig. Jedoch hat der BGH 9 deutlich gemacht, dass die Frage der Abstaffelung von hohen Umsätzen eine Frage der Angemessenheit der Vergütung i.s.v. 9 Abs. 1 ArbEG ist und die RL Nr. 11 insofern keine verbindliche Vorschrift darstellt, sondern ein Hilfsmittel, um die Angemessenheit zu 8 In der Praxis aus Gründen der vereinfachten Berechnung mit identischem Ergebnis rechnerische Ermäßigung der relevanten Umsätze für die Berechnung der Lizenzgebühr. 9 Entscheidung vom Az.: X ZR 71/86 Vinylchlorid.
15 erreichen und die Frage, ob eine Abstaffelung hoher Umsätze zur Erreichung einer angemessenen Vergütung angezeigt ist, somit auch unabhängig vom Nachweis der Üblichkeit im entsprechenden Industriezweig entschieden werden kann. Vor diesem Hintergrund ist es ständige Schiedsstellenpraxis, eine Kausalitätsverschiebung als Voraussetzung für eine Abstaffelung genügen zu lassen. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass bei hohen Umsätzen die Kausalität hierfür von der Erfindung weg zu anderen Faktoren verlagert sein kann. Dann wäre eine Erfindervergütung aus den ungekürzten vollen Umsätzen unangemessen, weil die Erfindung an sich hierfür nicht mehr die Ursache war. Die Antragsgegnerin zählt zu den größten Endproduktherstellern der Welt. Auf die Anzahl der abgesetzten Endprodukte hat die Erfindung, wie der Antragsteller selbst vorgetragen hat, keinerlei Einfluss. Gleichwohl partizipiert der Antragsteller an jedem verkauften Endprodukt. In einem solchen Fall setzt die Anwendung der Abstaffelungstabelle nach RL Nr. 11, die eine über die Jahre kumulierte Betrachtung der Umsätze vorsieht, den Erfindungswert in ein angemessenes Verhältnis zur Bedeutung der Erfindung. Im Übrigen bejahen die Instanzgerichte selbst für den Fall, dass weder die Üblichkeit einer Abstaffelung belegt ist, noch eine Kausalitätsverschiebung unterstellt werden kann, bei einer so beträchtlichen Umsatzhöhe wie hier eine Abstaffelung 10. Im Ergebnis hält es die Schiedsstelle für sachgerecht, den Erfindungswert aus einer Bezugsgröße von 7,50 pro hergestelltem Endprodukt und einem abzustaffelnden Lizenzsatz von 0,8 % zu ermitteln. Weiterhin ist vorliegend zu berücksichtigen, dass die Diensterfindung bislang nicht zur Erteilung eines Patents geführt hat, sondern nach wie vor lediglich den Status einer Patentanmeldung hat und wohl voraussichtlich nur eingeschränkt zu einem Patent führen kann. Daher wäre abhängig von den Aussichten auf Erteilung eines Patents ein deutlicher Abschlag von den marktüblichen Lizenzgebühren vorzunehmen. Wie hoch Lizenzgebühren ausfallen, hängt nämlich wie bereits ausgeführt vom von der der Erfindung vermittelten Ausschlusswert ab, und der ist bei reinen Patentanmeldungen deutlich geringer als bei erteilten Schutzrechten. Denn Patentanmeldungen bieten zwar einen ersten Anhaltspunkt über zukünftige eventuell unter Patentschutz stehende Technologien und weisen deshalb bereits einen höheren Ausschlusswert auf als gänzlich ungeschützte Erfindungen, wofür unter anderem der Entschädigungsanspruch des 33 PatG spricht. Gleichwohl weisen sie aber schon 10 OLG Düsseldorf vom Az.: I-2 U 15/13.
16 aufgrund der Tatsache, dass ein erheblicher Anteil der angemeldeten Patente nicht erteilt wird, einen deutlich niedrigeren Marktwert als erteilte Patente auf 11. Folglich würde sich ein freier Erfinder bei der Lizenzierung seiner Erfindung an ein Unternehmen, wenn die Erfindung zwar zum Patent angemeldet, aber noch kein Patent erteilt ist, zwar nicht auf Zahlungsbedingungen einlassen, durch die er das Risiko der bestandskräftigen Schutzrechtserlangung ganz alleine zu tragen hätte. Er wird aber gleichwohl auch keine Gegenleistungen von seinem Vertragspartner erreichen können, die seiner Ausschließlichkeitsstellung bei einem erteilten und bestandskräftigen Patent entsprächen. Wie hoch die Gegenleistung letztlich ausfallen würde, hängt von der Erteilungswahrscheinlichkeit ab. Die Schiedsstelle geht im Hinblick auf das im DPMA anhängige Prüfungsverfahren davon aus, dass der von der Antragsgegnerin in Ansatz gebrachte Risikoabschlag von 50 % den Antragsteller zumindest nicht benachteiligt. 7. Ergänzende Hinweise zur Berechnung des Erfindungswerts durch den Antragsteller Der Antragsteller ist davon ausgegangen, dass eine Ersparnis von im Schnitt 2 pro Endprodukt multipliziert mit der Anzahl der hergestellten Endprodukte den Erfindungswert ergibt. Hierzu ist über die bereits erteilten Hinweise zur Problematik der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen desweiteren noch anzumerken, dass die vom Antragsteller angestellte Berechnung an einem ganz wesentlichen Punkt unvollständig ist. Denn kein Unternehmen wäre bereit, einem freien Erfinder die gesamte Ersparnis als Entgelt zu bezahlen, die es mit Hilfe einer Erfindung erzielt. Andernfalls würde es zwar das unternehmerische Risiko des Erfindungseinsatzes tragen, aber gleichwohl keinen wirtschaftlicher Vorteil durch den Einsatz der Erfindung erlangen können. Deshalb wird ein Unternehmen nur dann in Betracht ziehen, für die Benutzung einer technischen Lehre etwas zu bezahlen, wenn Aussicht besteht, dass den damit verbundenen Kosten und Risiken ein hinreichender Gewinn oder eine hinreichende Ersparnis gegenübersteht. Nachdem der Erfindungswert nur das ist, was ein Unternehmen einem freien Erfinder bezahlen würde oder müsste, kann der Erfindungswert bei der Ermittlung nach dem betrieblichen Nutzen auch nur einen Bruchteil dessen betragen, was bei einem nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen durchgeführten Kosten- und Ertragsvergleich für das Unternehmen als Mehrwert übrig bleibt. Dieser Bruchteil wird mit einem Umrechnungsfaktor bemessen, der 1/8 bis 1/3 des Nutzens beträgt. Bei normalem 11 LG München I vom Az.: 14HK O 8038/06.
17 Schutzumfang und normaler Rechtsbeständigkeit eines Patents geht die Schiedsstelle von einem Regelumrechnungsfaktor von 1/5 aus. Das entspricht dann auch marktüblichen Lizenzverträgen, die sich üblicherweise nicht am betrieblichen Nutzen orientieren, sondern umsatzbezogen geschlossen werden. Denn nach Auffassung des OLG Düsseldorf kann wenn auch mit Vorbehalten vom Erfahrungssatz ausgegangen werden, dass die Höchstbelastung mit Lizenzsätzen bei 1/3 1/8, im Schnitt bei % der EBIT-Marge liegt 12. Somit wäre der Erfindungswert, wenn man denn die Methode der Erfassung des Erfindungswerts nach dem betrieblichen Nutzen in der vom Antragsteller berechneten Art und Weise der Ermittlung des Erfindungswerts zu Grunde legen wollte, nicht die volle Ersparnis, sondern 1/5 der Ersparnis. Das wären 40 ct pro Endprodukt. Bei der Ermittlung des Erfindungswerts mit der Methode der Lizenzanalogie ergeben sich 6 ct. pro Endprodukt. Das erscheint der Schiedsstelle nicht unschlüssig, sondern bringt vielmehr zum Ausdruck, dass die Erfindung zwar den innerbetrieblichen Stand der Technik nicht unerheblich verbessert, aber nur einen sehr geringen Abstand vom äußeren Stand der Technik aufweist. Hätte man diesem wesentlichen Punkt bei der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem betrieblichen Nutzen hinreichend Rechnung getragen, käme man voraussichtlich mit beiden Methoden zu vergleichbaren Ergebnissen. Überdies wäre auch bei der Methode der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen eine Abstaffelung vorzunehmen. Einzelheiten zu der hierzu von der Schiedsstelle entwickelten Systematik finden sich bei Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 4. Auflage, S. 507 ff.. 7. zum Anteilsfaktor Der Anteilsfaktor berücksichtigt den betrieblichen Anteil am Zustandekommen der Erfindung und gibt entsprechend in Prozenten ausgedrückt den auf den Arbeitnehmer entfallenden Anteil am Erfindungswert wieder Unter diesen Umständen gesteht die Schiedsstelle regelmäßig die Wertzahl a=2 zu. Der Antragsteller ist Maschinenbauingenieur und war zum Zeitpunkt der Erfindung dem Projekt Neuplanung ( ) zugewiesen, in welchem er sich als technischer Planer im Bereich Produktionsplanung einbringen sollte. Nach Auffassung der Schiedsstelle gehörte es in dieser Funktion zur arbeitsvertraglichen Kernpflicht, Innovationen wie die vorliegende einzubringen, weshalb die Wertzahl a=2 sachgerecht ist. 12 OLG Düsseldorf vom Az.: I-2 U 15/13.
18 Die Wertzahl b betrachtet die Lösung der Aufgabe und berücksichtigt, inwieweit beruflich geläufige Überlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel und Personal zur Lösung geführt haben. Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller die Wertzahl b=2,5 zugestanden, während dieser mehrfach auf der Wertzahl b=1 bestanden hat. Die Wertzahl c ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb. Nach RL Nr. 33 hängt die Wertzahl c davon ab, welche berechtigten Leistungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer stellen darf. Entscheidend sind die Stellung im Betrieb und die Vorbildung des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhältnis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je größer - bezogen auf den Erfindungsgegenstand - der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Erzeugung und Entwicklung im Unternehmen ist. Hierbei kommt es nicht auf die nominelle Stellung, sondern auf die tatsächliche Stellung zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Erfindung im Betrieb an. Soweit RL Nr. 34 hierbei Typisierungen zur Leistungserwartung an bestimmte Gruppen vornimmt, sind diese vor diesem Hintergrund zu sehen und können nicht statisch angewandt werden. Dem trägt auch RL Nr. 35 Rechnung, der ausdrücklich die Eingruppierung in höhere oder niedrigere Stufen vorsieht, um dem Ziel der RL Nr. 33 bestmöglich zu entsprechen. Ausgangspunkt für die Einordnung des Antragstellers ist somit zunächst seine Ausbildung als Maschinenbauingenieur. Die Vergütungsrichtlinien sehen hierfür höchstens die Wertzahl 5 vor. Weiterhin ist der Informationszufluss hinsichtlich der Konstruktion und Entwicklung im Unternehmen der Antragsgegnerin zu berücksichtigen, der dem Antragsteller aufgrund seiner betrieblichen Funktionen zu Gute kam. Da der Antragsteller vorliegend einerseits im Projekt Neuplanung ( ) eingesetzt war und andererseits die Erfindung sein Kerngebiet Produktionsplanung betrifft, geht die Schiedsstelle davon aus, dass der Antragsteller bezogen auf den Gegenstand der Diensterfindung über betriebliche Einblicke verfügte, die eine Korrektur auf die Wertzahl c=4 als sachgerecht erscheinen lassen. Aus den Wertzahlen a = 2 + c = 1 + c = 4 ergibt sich ein Anteilsfaktor von 13 %. Dass die Antragsgegnerin gleichwohl bereit ist, dem Antragsteller einen Anteilsfaktor von 17 % zuzubilligen, sieht die Schiedsstelle als entgegenkommend an. 8. Endergebnis Nachdem die Antragsgegnerin dem Antragsteller in mehrfacher Hinsicht entgegengekommen ist (Anteilsfaktor 17 %, kein Abschlag beim Vergütungsanspruch nach 16 Abs. 3 ArbEG) und die Schiedsstelle zudem die vom Antragsteller in Ansatz
19 gebrachte Bezugsgröße vorgeschlagen hat, empfiehlt die Schiedsstelle den Einigungsvorschlag anzunehmen und damit den Rechts- und Arbeitsfrieden wieder herzustellen und sich eine nach Auffassung der Schiedsstelle wirtschaftlich nicht sinnvolle, weil nicht Erfolg versprechende Weiterführung des Streits zu ersparen.
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 17/14
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 12.10.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 17/14 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 12.10.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 17/14 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 27/16
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 11.04.2018 Aktenzeichen: Arb.Erf. 27/16 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: für Veröffentlichung bearbeitete
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 11.04.2018 Aktenzeichen: Arb.Erf. 27/16 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: für Veröffentlichung bearbeitete
Quelle: 9 ArbEG Herleitung marktüblicher Lizenzsätze aus Second-Source- Lizenzverträgen
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 15.11.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 30/16 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 15.11.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 30/16 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 05/15
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 07.04.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 05/15 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 07.04.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 05/15 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Quelle: 613 a BGB, 9 ArbEG Vergütungsansprüche bei Betriebsübergang; Einbehaltung des Risikoabschlags bei Fallenlassen der Patentanmeldung
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 21.07.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 36/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 21.07.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 36/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 18/13
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 03.07.2015 Aktenzeichen: Arb.Erf. 18/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: 199
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 03.07.2015 Aktenzeichen: Arb.Erf. 18/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: 199
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 11/15
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 30.03.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 11/15 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 30.03.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 11/15 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 57/13
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 17.06.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 57/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: 9
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 17.06.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 57/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: 9
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 05/16
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 12.09.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 05/16 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 12.09.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 05/16 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 44/15
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 07.02.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 44/15 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 07.02.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 44/15 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
BGH-RECHTSPRECHUNG ARBEITNEHMERERFINDERRECHT
 BGH-RECHTSPRECHUNG ARBEITNEHMERERFINDERRECHT Herbstseminar 25. September 2012 Dr. Josef Linsmeier Übersicht 1. BGH Urteil v. 22.11.2011 - X ZR 35/09 - Ramipril II Erfindervergütung bei wirtschaftlicher
BGH-RECHTSPRECHUNG ARBEITNEHMERERFINDERRECHT Herbstseminar 25. September 2012 Dr. Josef Linsmeier Übersicht 1. BGH Urteil v. 22.11.2011 - X ZR 35/09 - Ramipril II Erfindervergütung bei wirtschaftlicher
ARBEITNEHMERERFINDERRECHT
 Dr. Enno Cöster Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz und Dipl.-Ing. (FH) Christian Heitzer Rechtsanwalt Ar b e i t n e h m e r e r f i n d e r v e r g ü t u n g Einleitung Die Praxis
Dr. Enno Cöster Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz und Dipl.-Ing. (FH) Christian Heitzer Rechtsanwalt Ar b e i t n e h m e r e r f i n d e r v e r g ü t u n g Einleitung Die Praxis
Inhaltsverzeichnis. Vorwort zur 2. Auflage Vorwort zur 1. Auflage Abkürzungsverzeichnis Weiterführende Literatur. I. Diensterfindung A.
 Vorwort zur 2. Auflage Vorwort zur 1. Auflage Abkürzungsverzeichnis Weiterführende Literatur III V XIII XV I. Diensterfindung A. Begriff 1. Was versteht man unter einer Diensterfindung? 1 2. Was ist der
Vorwort zur 2. Auflage Vorwort zur 1. Auflage Abkürzungsverzeichnis Weiterführende Literatur III V XIII XV I. Diensterfindung A. Begriff 1. Was versteht man unter einer Diensterfindung? 1 2. Was ist der
Inhaltsverzeichnis. Vorwort zur 2. Auflage... III Vorwort zur 1. Auflage... V Abkürzungsverzeichnis... XIII Weiterführende Literatur...
 Vorwort zur 2. Auflage... III Vorwort zur 1. Auflage... V Abkürzungsverzeichnis... XIII Weiterführende Literatur... XV I. Diensterfindung A. Begriff 1. Was versteht man unter einer Diensterfindung?...
Vorwort zur 2. Auflage... III Vorwort zur 1. Auflage... V Abkürzungsverzeichnis... XIII Weiterführende Literatur... XV I. Diensterfindung A. Begriff 1. Was versteht man unter einer Diensterfindung?...
Quelle: 2. Ein Vergütungsanspruch größer als Null ergibt sich dann im Falle der Ausübung dieses Benutzungsrechts.
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 07.05.2015 Aktenzeichen: Arb.Erf. 71/11 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 07.05.2015 Aktenzeichen: Arb.Erf. 71/11 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Quelle: Publikationsform: gekürzter Auszug. 28 ArbEG, 43 Abs. 3 ArbEG, 9 Abs. 1 ArbEG, 12 ArbEG, 16 ArbEG
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 11.12.2012 Aktenzeichen: Arb.Erf. 46/11 Dokumenttyp: Beschluss und Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 11.12.2012 Aktenzeichen: Arb.Erf. 46/11 Dokumenttyp: Beschluss und Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 20/13
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 16.07.2015 Aktenzeichen: Arb.Erf. 20/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 16.07.2015 Aktenzeichen: Arb.Erf. 20/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Quelle: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 07/14
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 12.10.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 07/14 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 12.10.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 07/14 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Quelle: Begründung: Der Antragsteller war von 1986 bis 2009 als Entwicklungsingenieur im Forschungsbereich eines großen Konzerns beschäftigt.
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 26.11.2014 Aktenzeichen: Arb.Erf. 65/09 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: Zusammenfassung Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 26.11.2014 Aktenzeichen: Arb.Erf. 65/09 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: Zusammenfassung Normen: Stichwort:
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 65/13
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 15.01.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 65/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 15.01.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 65/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Quelle: 9 ArbEG, 12 Abs. 1, 6 ArbEG Pauschalvergütung durch Erhöhung des Arbeitsentgelts - unvorhergesehene Beendigung des Arbeitsverhältnisses
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 18.01.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 67/14 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 18.01.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 67/14 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 73/13
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 09.12.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 73/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 09.12.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 73/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Quelle: 9 ArbEG Kausalität der Diensterfindung für einen Gewinn aus einem Forschungs- und Entwicklungsvertrag
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 14.10.2015 Aktenzeichen: Arb.Erf. 25/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 14.10.2015 Aktenzeichen: Arb.Erf. 25/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 04/14
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 28.09.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 04/14 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 28.09.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 04/14 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Quelle: Publikationsform: gekürzter Auszug
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 18.06.2015 Aktenzeichen: Arb.Erf. 17/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag, Zwischenbescheid Publikationsform: gekürzter
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 18.06.2015 Aktenzeichen: Arb.Erf. 17/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag, Zwischenbescheid Publikationsform: gekürzter
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 36/15
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 30.03.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 36/15 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 30.03.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 36/15 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 21/13
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 04.08.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 21/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 04.08.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 21/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Quelle: Begründung: Dem Schiedsstellenverfahren liegt im Wesentlichen folgender Sachverhalt zu Grunde:
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 09.03.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 39/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 09.03.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 39/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 26/12
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 05.08.2015 Aktenzeichen: Arb.Erf. 26/12 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 05.08.2015 Aktenzeichen: Arb.Erf. 26/12 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Quelle: 6 ArbEG, 8 ArbEG, 13 ArbEG, 16 ArbEG
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 29.06.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 62/16 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 29.06.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 62/16 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 61/10
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 18.12.2014 Aktenzeichen: Arb.Erf. 61/10 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 18.12.2014 Aktenzeichen: Arb.Erf. 61/10 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Kapitel 5 Gesetz über Arbeitnehmererfindungen Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG)
 ArbEG Kapitel 5 Gesetz über Arbeitnehmererfindungen Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG) 135 Problem Problem zwischen z.b. Patentgesetz: Die Erfindung gehört dem Erfinder (und nicht dem Betrieb) und dem
ArbEG Kapitel 5 Gesetz über Arbeitnehmererfindungen Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG) 135 Problem Problem zwischen z.b. Patentgesetz: Die Erfindung gehört dem Erfinder (und nicht dem Betrieb) und dem
Quelle: Publikationsform: gekürzter Auszug
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 24.02.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 02/14 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag und Zwischenbescheid Publikationsform: gekürzter
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 24.02.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 02/14 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag und Zwischenbescheid Publikationsform: gekürzter
Wissensreihe gewerblicher Rechtsschutz. Teil 4: Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
 Wissensreihe gewerblicher Rechtsschutz Von Dipl.-Ing. Stefan Brinkmann, Düsseldorf Patentanwalt und Vizepräsident der DASV Deutsche Anwalts- und Steuerberatervereinigung für die mittelständische Wirtschaft
Wissensreihe gewerblicher Rechtsschutz Von Dipl.-Ing. Stefan Brinkmann, Düsseldorf Patentanwalt und Vizepräsident der DASV Deutsche Anwalts- und Steuerberatervereinigung für die mittelständische Wirtschaft
Quelle: 43 Abs. 3 ArbEG, 9 Abs. 1 ArbEG, 12 ArbEG
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 19.03.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 55/12 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 19.03.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 55/12 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Quelle: 43 Abs. 3 ArbEG, 9 Abs. 1 ArbEG, 12 ArbEG, 16 ArbEG
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 09.01.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 16/10 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 09.01.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 16/10 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Arbeitnehmererfindungsrecht
 Arbeitnehmererfindungsrecht einschließlich Verbesserungsvorschlagswesen von Dr. Kurt Bartenbach * ;^! ' ;?' Rechtsanwalt -..J und Dr. Franz-Eugen Volz HH Luchterhand Vorwort des Herausgebers Abkürzungen
Arbeitnehmererfindungsrecht einschließlich Verbesserungsvorschlagswesen von Dr. Kurt Bartenbach * ;^! ' ;?' Rechtsanwalt -..J und Dr. Franz-Eugen Volz HH Luchterhand Vorwort des Herausgebers Abkürzungen
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 24/13
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 25.04.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 24/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 25.04.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 24/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 23/12
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 10.03.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 23/12 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 10.03.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 23/12 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
S. Rz. Vorwort Abkürzungen Schrifttum
 Vorwort Abkürzungen Schrifttum V XIII XXI Teil 1 Erläuterungen A. Einführung in das Recht der Arbeitnehmererfindung 3 1 I. Zielsetzung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) 3 1 II. Überblick
Vorwort Abkürzungen Schrifttum V XIII XXI Teil 1 Erläuterungen A. Einführung in das Recht der Arbeitnehmererfindung 3 1 I. Zielsetzung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) 3 1 II. Überblick
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 44/13
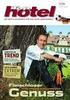 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 01.12.2015 Aktenzeichen: Arb.Erf. 44/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: 17
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 01.12.2015 Aktenzeichen: Arb.Erf. 44/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: 17
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 39/16
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 24.01.2018 Aktenzeichen: Arb.Erf. 39/16 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: für Veröffentlichung bearbeitete
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 24.01.2018 Aktenzeichen: Arb.Erf. 39/16 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: für Veröffentlichung bearbeitete
Quelle: 43 Abs. 3 ArbEG, 9 Abs. 1 ArbEG, 12 ArbEG, 16 ArbEG
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 19.06.2012 Aktenzeichen: Arb.Erf. 35/11 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 19.06.2012 Aktenzeichen: Arb.Erf. 35/11 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Quelle: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 14/13
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 08.12.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 14/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 08.12.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 14/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Quelle: Zwischenbescheid
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 15.06.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 60/13 Dokumenttyp: Zwischenbescheid Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 15.06.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 60/13 Dokumenttyp: Zwischenbescheid Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Quelle: 43 Abs. 3 ArbEG, 9 Abs. 1 ArbEG, 12 ArbEG
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 18.09.2012 Aktenzeichen: Arb.Erf. 22/11 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 18.09.2012 Aktenzeichen: Arb.Erf. 22/11 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 31/10
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 11.12.2014 Aktenzeichen: Arb.Erf. 31/10 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 11.12.2014 Aktenzeichen: Arb.Erf. 31/10 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Quelle: Publikationsform: gekürzter Auszug. 43 Abs. 3 ArbEG, 5 ArbEG, 6 ArbEG, 7 ArbEG, 8 ArbEG
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 17.09.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 13/12 Dokumenttyp: Beschluss und Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 17.09.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 13/12 Dokumenttyp: Beschluss und Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug
Quelle: 43 Abs. 3 ArbEG, 9 Abs. 1 ArbEG, 12 ArbEG
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 25.07.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 39/12 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 25.07.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 39/12 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
LANDESARBEITSGERICHT DÜSSELDORF BESCHLUSS
 2 Ta 767/10 5 BV 34/10 Arbeitsgericht Mönchengladbach LANDESARBEITSGERICHT DÜSSELDORF BESCHLUSS In dem Beschlussverfahren unter Beteiligung 1. des Betriebsrats der O. GmbH Betriebsrat der Firma O. GmbH
2 Ta 767/10 5 BV 34/10 Arbeitsgericht Mönchengladbach LANDESARBEITSGERICHT DÜSSELDORF BESCHLUSS In dem Beschlussverfahren unter Beteiligung 1. des Betriebsrats der O. GmbH Betriebsrat der Firma O. GmbH
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 23/13
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 06.07.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 23/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 06.07.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 23/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Quelle: Die Vergütungsbemessung nach 9 ArbEG ist dem arbeitsrechtlichen Institut der betrieblichen Übung regelmäßig nicht zugänglich.
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 22.12.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 48/14 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 22.12.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 48/14 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Deutsches Patent- und Markenamt
 Deutsches Patent- und Markenamt München, den 1. Juni 2010 Patentanwaltsprüfung II / 2010, Gruppen A C Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche Aufgabe Bestehend aus 3 Teilen; Bearbeitungszeit
Deutsches Patent- und Markenamt München, den 1. Juni 2010 Patentanwaltsprüfung II / 2010, Gruppen A C Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche Aufgabe Bestehend aus 3 Teilen; Bearbeitungszeit
Quelle: 43 Abs. 3 ArbEG, 9 Abs. 1 ArbEG, 12 ArbEG
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 05.03.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 57/11 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 05.03.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 57/11 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Quelle: 9 ArbEG Zeitliche Voraussetzung einer Vorratsvergütung für ein Gebrauchsmuster
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 15.09.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 63/14 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 15.09.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 63/14 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
9. Mittelbare Patentverletzung ( 10 PatG) 10. Arbeitnehmererfindungen
 9. Mittelbare Patentverletzung ( 10 PatG) Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, dürfen nicht an Dritte geliefert oder angeboten werden, wenn der Dritte weiß oder es offensichtlich
9. Mittelbare Patentverletzung ( 10 PatG) Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, dürfen nicht an Dritte geliefert oder angeboten werden, wenn der Dritte weiß oder es offensichtlich
Quelle: Anwendungsbereich des ArbEG; arbeitnehmerähnliche Person
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 17.01.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 32/14 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 17.01.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 32/14 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ
 IMPRESSUM Herausgeber: Apley & Straube Partnerschaft Patentanwälte Schatzenberg 2 D 77871 Renchen Partnerschaftsregister 700047 PR Nr. 1 www.patus.org Tel: 07843 993730 Fax: 07843 994716 Redaktion: Dr.
IMPRESSUM Herausgeber: Apley & Straube Partnerschaft Patentanwälte Schatzenberg 2 D 77871 Renchen Partnerschaftsregister 700047 PR Nr. 1 www.patus.org Tel: 07843 993730 Fax: 07843 994716 Redaktion: Dr.
Quelle: Verkauf eines Portfolios, Verkaufspreisschätzung aus Gesamtsumme, tatsächliche Schutzrechtslaufzeit
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 28.05.2014 Aktenzeichen: Arb.Erf. 49/12 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: RL
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 28.05.2014 Aktenzeichen: Arb.Erf. 49/12 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: RL
A könnte einen Anspruch auf Grundbuchberichtigung haben gem. 894 BGB.
 Lösung Fall 19: Das Berliner Grundstück Teil II A könnte einen Anspruch auf Grundbuchberichtigung haben gem. 894 BGB. Dann müsste das Grundbuch hinsichtlich eines dinglichen Rechts am Grundstück unrichtig
Lösung Fall 19: Das Berliner Grundstück Teil II A könnte einen Anspruch auf Grundbuchberichtigung haben gem. 894 BGB. Dann müsste das Grundbuch hinsichtlich eines dinglichen Rechts am Grundstück unrichtig
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 13/13
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 26.01.2015 Aktenzeichen: Arb.Erf. 13/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 26.01.2015 Aktenzeichen: Arb.Erf. 13/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Quelle: Zwischenbescheid
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 07.03.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 09/14 Dokumenttyp: Zwischenbescheid Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 07.03.2016 Aktenzeichen: Arb.Erf. 09/14 Dokumenttyp: Zwischenbescheid Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Quelle: 43 Abs. 3 ArbEG, 9 Abs. 1 ArbEG, 12 ArbEG, 14 Abs. 2 ArbEG
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 10.10.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 22/12 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 10.10.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 22/12 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Quelle: Publikationsform: gekürzter Auszug. 20 ArbEG, 22 ArbEG, 40 ArbEG
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 27.02.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 20/10 Dokumenttyp: Beschluss und Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 27.02.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 20/10 Dokumenttyp: Beschluss und Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug
Quelle: Publikationsform: gekürzter Auszug
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 22.07.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 40/11 Dokumenttyp: Beschluss und Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 22.07.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 40/11 Dokumenttyp: Beschluss und Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug
Quelle: Publikationsform: gekürzter Auszug. 2 ArbEG, 9 Abs. 1 ArbEG, 12 ArbEG, 42 Nr. 4 ArbEG. Einnahmen i.s.d. 42 Nr. 4 ArbEG
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 12.06.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 61/11 Dokumenttyp: Beschluss und Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 12.06.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 61/11 Dokumenttyp: Beschluss und Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 54/12
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 06.06.2014 Aktenzeichen: Arb.Erf. 54/12 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: 271
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 06.06.2014 Aktenzeichen: Arb.Erf. 54/12 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: 271
Quelle: 43 Abs. 3 ArbEG, 9 Abs. 1 ArbEG, 12 ArbEG, 23 ArbEG
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 17.04.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 11/11 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 17.04.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 11/11 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Diensterfindungen Arbeitnehmererfindungen
 Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das Logo einsetzen Diensterfindungen Arbeitnehmererfindungen David Kindt 1957 wurde das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (AEG) in Kraft gesetzt. Das
Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das Logo einsetzen Diensterfindungen Arbeitnehmererfindungen David Kindt 1957 wurde das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (AEG) in Kraft gesetzt. Das
Quelle: 43 Abs. 3 ArbEG, 41 ArbEG, 9 Abs. 1 ArbEG, 12 ArbEG
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 09.10.2012 Aktenzeichen: Arb.Erf. 39/11 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 09.10.2012 Aktenzeichen: Arb.Erf. 39/11 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Arbeitnehmer-Erfindungsgesetz
 Arbeitnehmer-Erfindungsgesetz, Frau Dipl.-Biologin, Projektmanagerin Transfer Folie: 1 Arbeitnehmererfinderrecht Interessenkonflikt Das Ergebnis der Arbeit gehört dem Arbeitgeber. Das Recht auf eine Erfindung
Arbeitnehmer-Erfindungsgesetz, Frau Dipl.-Biologin, Projektmanagerin Transfer Folie: 1 Arbeitnehmererfinderrecht Interessenkonflikt Das Ergebnis der Arbeit gehört dem Arbeitgeber. Das Recht auf eine Erfindung
Quelle: Rückforderungsverbot und Verrechnung von Vergütung
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 01.03.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 69/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 01.03.2017 Aktenzeichen: Arb.Erf. 69/13 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: bearbeiteter Auszug Normen:
Quelle: Publikationsform: gekürzter Auszug. 43 Abs. 3 ArbEG, 5 ArbEG, 6 ArbEG, 7 ArbEG, 9 Abs. 1 ArbEG, 12 ArbEG, 242 BGB
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 19.09.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 29/12 Dokumenttyp: Beschluss und Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 19.09.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 29/12 Dokumenttyp: Beschluss und Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug
Arbeitnehmererfindungen
 Arbeitnehmererfindungen Prof. Dr.-Ing. H. B. Cohausz Patentanwalt COHAUSZ HANNIG BORKOWSKI WIßGOTT Düsseldorf 8 Arbeitnehmererfindungen nach altem Recht Diensterfindung gilt für vor dem 1. Oktober 2009
Arbeitnehmererfindungen Prof. Dr.-Ing. H. B. Cohausz Patentanwalt COHAUSZ HANNIG BORKOWSKI WIßGOTT Düsseldorf 8 Arbeitnehmererfindungen nach altem Recht Diensterfindung gilt für vor dem 1. Oktober 2009
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN PATENTRECHT (OHLY) SEITE 37
 LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN PATENTRECHT (OHLY) SEITE 37 III. Inhaberschaft Lit.: Kraßer, 19-21; Götting, 15 18 a) Das Erfinderrecht und sein Schutz Erfinderprinzip und first-to-file -System
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN PATENTRECHT (OHLY) SEITE 37 III. Inhaberschaft Lit.: Kraßer, 19-21; Götting, 15 18 a) Das Erfinderrecht und sein Schutz Erfinderprinzip und first-to-file -System
Erfinder kann nur eine natürliche Person sein, keine Betriebserfindung (beachte aber die Inanspruchnahme
 33 3. Inhaberschaft Lit.: Kraßer, 19-21; Götting, 14-18 a) Das Erfinderrecht und sein Schutz Erfinderprinzip und first-to-file -System Das deutsche Patentrecht beruht auf dem Erfinderprinzip: Nicht der
33 3. Inhaberschaft Lit.: Kraßer, 19-21; Götting, 14-18 a) Das Erfinderrecht und sein Schutz Erfinderprinzip und first-to-file -System Das deutsche Patentrecht beruht auf dem Erfinderprinzip: Nicht der
SATZUNG ZUR VERGÜTUNG
 SATZUNG ZUR VERGÜTUNG VON ARBEITNEHMERERFINDUNGEN AN DER HOCHSCHULE ANHALT vom 24.01.2018 Auf der Grundlage des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen veröffentlicht als bereinigte Fassung im Bundesgesetzblatt
SATZUNG ZUR VERGÜTUNG VON ARBEITNEHMERERFINDUNGEN AN DER HOCHSCHULE ANHALT vom 24.01.2018 Auf der Grundlage des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen veröffentlicht als bereinigte Fassung im Bundesgesetzblatt
Technische Universität Dortmund Fakultät Maschinenbau Patentanwalt Jochen Meinke WS 2016/ Arbeitnehmererfinderrecht. I.
 Technische Universität Dortmund Fakultät Maschinenbau Patentanwalt Jochen Meinke WS 2016/2017 10 Arbeitnehmererfinderrecht I. Grundlagen Grundsätzlich ist allein der Erfinder berechtigt, eine Erfindung
Technische Universität Dortmund Fakultät Maschinenbau Patentanwalt Jochen Meinke WS 2016/2017 10 Arbeitnehmererfinderrecht I. Grundlagen Grundsätzlich ist allein der Erfinder berechtigt, eine Erfindung
Arbeitnehmererfindungsrecht
 Arbeitnehmererfindungsrecht www.bardehle.com Inhalt 5 1. Anwendbarkeit des ArbEG 5 1.1 Arbeitnehmer 5 1.2 Räumlicher Anwendungsbreich 5 2. Erfindungen nach dem ArbEG 6 2.1 Diensterfindungen 6 2.2 Freie
Arbeitnehmererfindungsrecht www.bardehle.com Inhalt 5 1. Anwendbarkeit des ArbEG 5 1.1 Arbeitnehmer 5 1.2 Räumlicher Anwendungsbreich 5 2. Erfindungen nach dem ArbEG 6 2.1 Diensterfindungen 6 2.2 Freie
Das Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg 5 hat die Klage abgewiesen.
 -1- Anspruch auf Erlaubnis zur Untervermietung von Wohnraum Der Anspruch des Wohnungsmieters auf Erteilung der Erlaubnis zur Untervermietung setzt nicht voraus, dass der Mieter in der Wohnung seinen Lebensmittelpunkt
-1- Anspruch auf Erlaubnis zur Untervermietung von Wohnraum Der Anspruch des Wohnungsmieters auf Erteilung der Erlaubnis zur Untervermietung setzt nicht voraus, dass der Mieter in der Wohnung seinen Lebensmittelpunkt
Quelle: 43 Abs. 3 ArbEG, 9 Abs. 1 ArbEG, 12 ArbEG
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 09.04.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 30/12 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 09.04.2013 Aktenzeichen: Arb.Erf. 30/12 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: Stichwort:
Quelle: Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG. Deutsches Patent- und Markenamt. Datum: Aktenzeichen: Arb.Erf. 41/12
 Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 06.08.2014 Aktenzeichen: Arb.Erf. 41/12 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: 6
Instanz: Schiedsstelle nach 28 ArbEG Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt Datum: 06.08.2014 Aktenzeichen: Arb.Erf. 41/12 Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: gekürzter Auszug Normen: 6
1 Kennziffer: Patentanwaltsprüfung III / 2017 Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe. Bestehend aus drei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden
 .1 Deutsches Patent- und Markenamt 1 Kennziffer: Patentanwaltsprüfung III / 2017 Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe Bestehend aus drei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden - 2 - Teil I Patentanwalt
.1 Deutsches Patent- und Markenamt 1 Kennziffer: Patentanwaltsprüfung III / 2017 Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe Bestehend aus drei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden - 2 - Teil I Patentanwalt
Kapitel 4 http://www.patentfuehrerschein.de Seite 1
 Kapitel 4 http://www.patentfuehrerschein.de Seite 1 4. Kapitel Nachdem wir uns in den vorherigen Kapiteln im Wesentlichen mit den Grundsätzen des Patentrechts sowie mit den Voraussetzungen für die Erteilung
Kapitel 4 http://www.patentfuehrerschein.de Seite 1 4. Kapitel Nachdem wir uns in den vorherigen Kapiteln im Wesentlichen mit den Grundsätzen des Patentrechts sowie mit den Voraussetzungen für die Erteilung
Unternehmensnachfolge und gewerblicher Rechtsschutz
 Unternehmensnachfolge und gewerblicher Rechtsschutz Dr. Christian Kau, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz www.rheinfolge.com www.preubohlig.de Relevante Themen Prüfung/Bewertung von Schutzrechten
Unternehmensnachfolge und gewerblicher Rechtsschutz Dr. Christian Kau, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz www.rheinfolge.com www.preubohlig.de Relevante Themen Prüfung/Bewertung von Schutzrechten
Jura Online - Fall: Hardy's Bikes - Lösung
 Jura Online - Fall: Hardy's Bikes - Lösung A. Anspruch B gegen R auf Herausgabe des Choppers gemäß 985 BGB B könnte gegen R einen Anspruch auf Herausgabe des Choppers gemäß 985 BGB haben. I. Besitz des
Jura Online - Fall: Hardy's Bikes - Lösung A. Anspruch B gegen R auf Herausgabe des Choppers gemäß 985 BGB B könnte gegen R einen Anspruch auf Herausgabe des Choppers gemäß 985 BGB haben. I. Besitz des
Eignungsprüfung III / 2015 Eignungsprüfung Wahlfach 2 ( 5 Abs. 3 Nr. 2 PAZEignPrG) Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden
 Eignungsprüfung III / 2015 Eignungsprüfung Wahlfach 2 ( 5 Abs. 3 Nr. 2 PAZEignPrG) Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden - 2 - Teil A Sachverhalt: Die drei Soldaten Oberst Stahl,
Eignungsprüfung III / 2015 Eignungsprüfung Wahlfach 2 ( 5 Abs. 3 Nr. 2 PAZEignPrG) Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden - 2 - Teil A Sachverhalt: Die drei Soldaten Oberst Stahl,
Richtlinie des BVSK zur Ermittlung des Restwertes
 Juli 2009 E N T W U R F fu-schw II 2803 RL-RW-2009 Richtlinie des BVSK zur Ermittlung des Restwertes Stand: VII/2009 I. Die Restwertermittlung im Haftpflichtschaden 1. Restwertangabe im Gutachten Unter
Juli 2009 E N T W U R F fu-schw II 2803 RL-RW-2009 Richtlinie des BVSK zur Ermittlung des Restwertes Stand: VII/2009 I. Die Restwertermittlung im Haftpflichtschaden 1. Restwertangabe im Gutachten Unter
Anwendungsbereich. Zielsetzung des ArbEG. ... aus Sicht der Arbeitnehmer. Meldepflicht
 51 Anwendungsbereich Nach 1 unterliegen diesem Gesetz Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im privaten und im öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten. Zielsetzung
51 Anwendungsbereich Nach 1 unterliegen diesem Gesetz Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im privaten und im öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten. Zielsetzung
BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL. in dem Rechtsstreit
 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES X ZR 127/99 Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein URTEIL in dem Rechtsstreit Verkündet am: 16. April 2002 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES X ZR 127/99 Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein URTEIL in dem Rechtsstreit Verkündet am: 16. April 2002 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Existenzgründungen aus der Wissenschaft Einführung in das Patentrecht
 Existenzgründungen aus der Wissenschaft Einführung in das Patentrecht 16.11.2016 Dr. Wolfgang Stille Forschung und Technologietransfer, Johannes Gutenberg-Universität Mainz Innovation strategische Ausrichtung
Existenzgründungen aus der Wissenschaft Einführung in das Patentrecht 16.11.2016 Dr. Wolfgang Stille Forschung und Technologietransfer, Johannes Gutenberg-Universität Mainz Innovation strategische Ausrichtung
Abschlussarbeiten im Betrieb. Mittwoch,
 Abschlussarbeiten im Betrieb Mittwoch, 15.06.2016 1 Wenn jemand dir sagt, er sei durch harte Arbeit reich geworden, frag ihn, durch wessen Arbeit. Unbekannt Dienst du dem Herrscher, so denke in erster
Abschlussarbeiten im Betrieb Mittwoch, 15.06.2016 1 Wenn jemand dir sagt, er sei durch harte Arbeit reich geworden, frag ihn, durch wessen Arbeit. Unbekannt Dienst du dem Herrscher, so denke in erster
Das Recht der Arbeitnehmererfindung im öffentlichen Dienst
 Das Recht der Arbeitnehmererfindung im öffentlichen Dienst von Dr. Franz-Eugen Volz Carl Heymanns Verlag KG Köln Berlb Bonn Mündien Vorwort Inhalt Literatur Abkürzungen VII IX XVII XXXV Einleitung ) A.
Das Recht der Arbeitnehmererfindung im öffentlichen Dienst von Dr. Franz-Eugen Volz Carl Heymanns Verlag KG Köln Berlb Bonn Mündien Vorwort Inhalt Literatur Abkürzungen VII IX XVII XXXV Einleitung ) A.
Leitsatz: Oberlandesgericht Dresden, 3. Zivilsenat Beschluss vom , 3 W 1439/07
 Leitsatz: Die Ausschlussfrist des 2 VBVG beginnt erst zu dem Zeitpunkt, in dem der Anspruch auf Betreuervergütung gem. 9 VBVG erstmals geltend gemacht werden kann. Oberlandesgericht Dresden, 3. Zivilsenat
Leitsatz: Die Ausschlussfrist des 2 VBVG beginnt erst zu dem Zeitpunkt, in dem der Anspruch auf Betreuervergütung gem. 9 VBVG erstmals geltend gemacht werden kann. Oberlandesgericht Dresden, 3. Zivilsenat
Einführung in das Arbeitnehmererfindergesetz (ArbNErfG)
 Einführung in das Arbeitnehmererfindergesetz (ArbNErfG) Praxisseminar Patente in der Forschung 20.11.2007, Universität Duisburg-Essen Dipl. Phys.-Ing. Rolf Klingelberger Patentanmeldungen in Deutschland
Einführung in das Arbeitnehmererfindergesetz (ArbNErfG) Praxisseminar Patente in der Forschung 20.11.2007, Universität Duisburg-Essen Dipl. Phys.-Ing. Rolf Klingelberger Patentanmeldungen in Deutschland
56 ESt Aufwendungen für eine Feier mit Arbeitskollegen
 56 ESt Aufwendungen für eine Feier mit Arbeitskollegen EStG 4, 19 Wenn anlässlich des Geburtstags oder eines anderen Anlasses eine kleine Feier ausgerichtet wird, an der (auch) Arbeitskollegen teilnehmen,
56 ESt Aufwendungen für eine Feier mit Arbeitskollegen EStG 4, 19 Wenn anlässlich des Geburtstags oder eines anderen Anlasses eine kleine Feier ausgerichtet wird, an der (auch) Arbeitskollegen teilnehmen,
LANDESARBEITSGERICHT DÜSSELDORF BESCHLUSS. - Klägerin - X. str. 21, E., - Beschwerdeführerin
 6 Ta 291/08 8 Ca 3198/07 Arbeitsgericht Essen LANDESARBEITSGERICHT DÜSSELDORF BESCHLUSS In dem Rechtsstreit der Frau L. Q., W. Str. 21, N., - Klägerin - Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin C. M. I.,
6 Ta 291/08 8 Ca 3198/07 Arbeitsgericht Essen LANDESARBEITSGERICHT DÜSSELDORF BESCHLUSS In dem Rechtsstreit der Frau L. Q., W. Str. 21, N., - Klägerin - Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin C. M. I.,
IFRIC Interpretation 18 Übertragung von Vermögenswerten durch einen Kunden
 IFRIC Interpretation 18 Übertragung von Vermögenswerten durch einen Kunden Verweise Rahmenkonzept für die Aufstellung und Darstellung von Abschlüssen IFRS 1 Erstmalige Anwendung der International Financial
IFRIC Interpretation 18 Übertragung von Vermögenswerten durch einen Kunden Verweise Rahmenkonzept für die Aufstellung und Darstellung von Abschlüssen IFRS 1 Erstmalige Anwendung der International Financial
