2013 Das Jahr der Kometen. Herbert Haupt AVR/IAS Astronomievereinigung Rottweil Zimmern o.r
|
|
|
- Reinhardt Beutel
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 2013 Das Jahr der Kometen Herbert Haupt AVR/IAS Astronomievereinigung Rottweil Zimmern o.r
2 Kometen historisch (1) Glücksbringer oder Unheilboten
3 Kometen historisch (2) Vom Unheilboten zur Naturerscheinung Kometen bewegen sich auf langgestreckten Ellipsenbahnen um die Sonne Kometen wurden bis ins 16. Jahrhundert als Erscheinung der Erdatmosphäre angesehen! 1577 Tycho Brahe: Kometen sind > 230 Erdradien entfernt und daher weit außerhalb der Erdatmosphäre! 1609 Keplersche Gesetze: Beschreiben die Bahnen von Planeten und Kometen 1682 Edmond Halley: Der Komet von 1531, 1607 und 1682 ist immer derselbe!
4 Was sind Kometen? Komet PanSTARRS C/2011 L4 Komet Lemmon C/2012 F6 Komet ISON C/2012 S1: beinahe ein Jahrhundertkomet Komet Linear C/2012 X1: ein kleiner Holmes Kometen: Lovejoy C/2011 W3 (1) und C/2013 R1 (2) Zusammenfassung / Literatur
5 Kometen (1) Kometen sind Urmaterie aus den Anfängen des Sonnensystems, die in Sonnenferne kondensierte Sie umkreisen die Sonne überwiegend außerhalb des Planetensystems im Kuiper-Gürtel und Oortscher Wolke Einige wurden abgelenkt nach innen: - langperiodisch (> 200 Jahre) aus Oortscher Wolke: statistisch verteilte Bahnneigungen gegen Ekliptik - kurzperiodisch (< 200 Jahre) aus Kuiper-Gürtel: vorwiegend nahe der Ekliptik Kometen haben das Wasser auf die Erde gebracht!
6 Kometen (2) Kern: schmutziger Schneeball Größe: meist 0,6 8 km (auch bis 100 km) geringe Schwerkraft, daher sehr porös (~ g/cm 3 ) und geringe mechanische Festigkeit bestehen aus Wassereis ( %), gefrorenen Gasen (CH 4, NH 3,..), adsorbierten Molekülen (CHONS), Staub (CHON- und Silikat-Teilchen: 0,1...5μm), und Felsbrocken Oberfläche: wegen Ausgasen sehr dunkle Kruste (cm, m) => Albedo 2...4% aktive Regionen nur ca. 1% der Gesamtoberfläche
7 Kometen (3) Koma: bildet sich bei Annäherung an die Sonne (< 4-5AE) Sublimation leichtflüchtiger Substanzen, die kleine Staubteilchen mitreißen: Abströmgeschwindigkeit m/s schwere Teilchen bleiben zurück => dunkle, poröse Kruste Ausbildung einer Koma, geschichtet: - innen (~10 4 km): Muttermoleküle - Mitte (~10 5 km): leichtere Tochtermoleküle - außen: neutrale Atome (vor allem H, durch Dissoziation abgespalten) ein Teil des Komagases wird ionisiert (Sonnenstrahlung, Stoß / Ladungsaustausch mit Sonnenwindteilchen) und von Sonnenwind ausgetrieben
8 Schweif: Ausbildung bei < 2AE Kometen (4) Gas-Schweif: leichte Teilchen = ionisiertes Gas werden von Sonnenwind mitgerissen, - mit bis zu 100 km/s! => gerade von der Sonne weg - Strukturen durch Magnetfelder - Schweiflänge: (bis 250!) Mio km Staub-Schweif: durch Strahlungsdruck der Sonne angetrieben: - sehr viel geringere Geschwindigkeit als bei Gasschweif => Krümmung des Schweifs wegen Kometenbewegung - leichtere Teilchen stärker angetrieben (~1/Gewicht) => Auffächerung des Schweifs Streifenbildung bei Rotation des Kometen
9 Komet Mc Naught Dirk Ewers Namibia Farm Hakos Blick zum Gamsberg
10 Komponenten und Schweifbildung Gas-/Staubjets durch Sonnenstrahlung ausgelöst und durch Sonnenwind und Strahlungsdruck in die Gegenrichtung abgetrieben Neutralgaswolke: für Amateure nicht sichtbar!
11 Kometen (5) Schwerkraft und Fluchtgeschwindigkeit an Oberfläche Schwerkraft: F o = - G M m R -2 = - m g Erde: R = 6370 km, M = kg g e = 1! Holmes: r = 1,7 km, m = kg g h für d 1 g/cm 3? Fluchtgeschwindigkeit: v o = (2 G M/R) 1/2 Erde: v eo = 11,2 km/s Holmes: v ho = 11,2 (m/m R/r) 1/2 = 1,3 m/s!! Also Vorsicht: Auf Kometen nur sehr langsam gehen!
12 Kometen (6) Kometen sind im Prinzip alle gleich, doch jeder ist anders!
13 2013 Das Jahr der Kometen PanSTARRS Lemmon LINEAR ISON Lovejoy
14 Komet PanSTARRS C/2011 L4 Perihel am : 0,33 AE Geschwindigkeit im P. 77 km/s Erdnähe am : 1,1 AE Bahnneigung gegen Ekliptik: 78 Umlauf um Sonne: J?? oder hyperbolisch? Max Helligkeit: 1,0 m
15 Die Bahn von PanSTARRS Sie steht nahezu senkrecht auf der Ekliptik (78 )
16 PanSTARRS Peter Knappert
17 PanSTARRS in der Abenddämmerung Dieter Willasch RSA
18 PanSTARRS Flug Richtung Sonne eine Woche vor Perihel AP/spaceweather.com Minoru Yoneto
19 Kernaktivität / Jets: PanSTARRS FFT Unscharfe Maske, 2013 Bernd Thinius, Inastars Observatorium Potsdam, Tage nach Perihel
20 PanSTARRS nach dem Perihel Michael Jäger Plasmaschweif: weist immer von der Sonne weg (schwach; rechts) Staubschweif: ist träger kann quer oder hinter dem Kometen laufen Auffächerung; Streifen im Staubfächer infolge Kernrotation
21 Komet PanSTARRS bei Andromeda M. Jäger Der Komet bewegt sich von der Sonne weg, mit dem Staubschweif voran, und etwas seitlich. Dadurch wird dieser auseinander gezogen! R. Dobesberger IAS
22 PanSTARRS beim Emissionsnebel NGC 7822 im Kepheus Michael Jäger
23 PanSTARRS am 13. Mai Michael Jäger vor Kepheus, auf dem Weg ins äußere Sonnensystem. Der breite Staubschweif verblasst, wächst aber noch. Der Komet hat einen ausgedehnten Gegenschweif gebildet - Staub, der dem Kometen auf seiner Bahn (links) hinterherzieht und mehr als 3 Grad umfasst. Bei ~ 1,6 AE von der Erde entspricht das einer Ausdehnung von über 12 Mio km.
24 PanSTARRS in UMi Michael Jäger Staubteilchengrößen: normaler Staubschweif: ~ 1 μm Gegenschweif: 100 μm - 1 mm
25 PanSTARRS C/2011 L4 Alter Hase: gibt Material gleichmäßig ab Seiichi Yoshida
26 Komet Lemmon C/2012 F6 Perihel am : 0,73 AE Aphel: 973 AE Erdnähe am : 0,99 AE Umlaufperiode: a Bahn-Neigung gegen Ekliptik: 83 Maximale Helligkeit: 4,5 m
27 Komet Lemmon bei KMW und KH 47 Tuc Dieter Willasch IAS - RSA
28 Lemmon: Schweifveränderung in 24 h 15. und 16. Mai 2013 D. Peach Schweifabriss am
29 Komet Lemmon: Schweifabriss P. Mortfield Im Gegensatz zu PanSTARRS besteht der Schweif überwiegend aus Gas
30 Komet LINEAR C/2012 L2 und X1 LINEAR X1: Perihel am in 1,6 AE Exzentrizität: 0,99 Erdnähe am in 1,6 AE Umlaufperiode: 1870 Jahre Überraschender Helligkeitsanstieg am morgens: 14 8m der kleine Holmes LINEAR: Lincoln Near Earth Asteroid Research
31 Komet C/2012 L2 Linear B.Thinius IOP
32 LINEAR C/2012 X Michael Jäger
33 Ausbruch von Komet LINEAR C/2012 X Unexpected outburst by comet C/2012 X1 although it is not clear whether the object is breaking up or whether a bright jet of material is simply blasting copious quantities of gas and dust into space. Seichi Yoshida Beispiel für die Unberechenbarkeit von Kometen!
34 Vergleich der Kometen Linear und Holmes Linear X1 Ende Oktober 2013: etwa 1/10 Vollmond-Durchmesser schaute aus wie eine kleine Ausgabe von Holmes doch großer Unterschied : Holmes erlitt den Ausbruch nach dem Perihel, während Linear noch gut vier Monate davon entfernt ist bleibt abzuwarten, was wird, wenn er näher an der Sonne kommt und sich weiter erwärmt.
35 LINEAR C/2012 X J.-F. Soulier Rohbild gestreckt 20 rotational gradient
36 Ursachen für Helligkeitsausbrüche die Kollision mit einem anderen Himmelskörper (Felsbrocken, Asteroiden) das Auseinanderbrechen des Kometen oder die Abspaltung von Fragmenten die plötzliche, explosive Freisetzung eines großen Reservoirs von eingeschlossenen, gefrorenen Gasen (Aufbrechen der Oberfläche)
37 LINEAR C/2013 X1 nach Ausbruch am Schwierigkeit der Vorhersage zur Helligkeitsentwicklung!! Seiichi Yoshida
38 Komet ISON C/2012 S1 Perihel am bei 0,012 AE - Abstand zur Sonnenoberfläche 1,1 Mio km Exzentrizität: e = 1! d.h. hyperbolisch Bahnneigung gegen Ekliptik: 62 Erdnähe am : 0,86 AE Max. Helligkeit (vor Perihel): - 4m
39 Komet ISON entdeckt am W. Newski, A. Nowitschonok ISON = Int. Scientific Optical Network Aufnahme vom : - zu diesem Zeitpunkt nur 18,8 m hell - ein schwaches Pünktchen im Krebs.
40 Komet ISON im Blick von Deep Impact 17./ US-Raumsonde Deep Impact am 17. / 18. Januar 2013: etwa 150 Bilder des Kometen obwohl noch ~ 5,1 AE von der Sonne entfernt, bereits Schweif erkennbar! Kometenkern schon aktiv setzt Gas und Staub frei muss ein großer Komet sein!
41 ISONs Bahn am Himmel Wikipedia: AstroFloyd
42 Komet ISON C/2012 S1 HST Spektrum.de ISON der nächste große Komet? Ende November 2013 wird ISON der Sonne extrem nahe kommen. Dabei könnte er sogar am Taghimmel sichtbar werden. Vor und nach diesem Datum zeigt sich ISON am Morgen- bzw. Abendhimmel. Andreas Kammerer
43 Umlaufbahn von ISON um die Sonne Grafik: BR, 09/2013 Am 28. November 2013 erreicht ISON sein Perihel, den sonnennächsten Punkt mit nur 1,7 Millionen Kilometern Abstand zur Sonne. Das könnte ihm zum Verhängnis werden: Mit ihrer ungeheuren Masse und den daraus resultierenden Gravitationskräften wird unser Stern den "Sonnenstreifer" durchkneten wie ein Stück Teig. Die Gezeitenkräfte der Sonne sind so stark, dass ISON einfach zerbrechen könnte.
44 Komet ISON in Leo Mount Lemmon Observatory
45 ISON Damian Peach Abstand zur Sonne ~ 0,2 AE
46 ISON MPIS Wendelstein-Observat. Nach Bildbearbeitung: im Kopf des Kometen zwei flügelartige Strukturen erkennbar, die an ein lang gezogenes U erinnern. Verursacht durch vom Kern abgebrochene Fragmente? Sprunghafter Anstieg der Helligkeit
47 ISON - ein frischer Komet?! ISON ist wohl erstmals im inneren Sonnensystem. Solche Kometen sind anfangs häufig ungewöhnlich hell und bleiben später hinter den Vorhersagen zurück. Auch ISON war bis in den November hinein fünf- bis zehnmal schwächer als nach den ersten optimistischen Prognosen. Doch dann stieg seine Helligkeit mehrmals sprunghaft an. Vermutlich sind kleinere Bruchstücke vom Kometenkern abgeplatzt und haben zu den Helligkeitsausbrüchen geführt. Rainer Kayser: Nachrichten
48 Komet ISON auf Bahn um die Sonne Movie: soho.nascom.nasa.gov/hotshots/index.html/ SOHO LASCO C Seine Größe wurde anfänglich weit überschätzt (~ 40 km): Ø real etwa eine Größenordnung kleiner! Auflösung bei Sonnenpassage (Lovejoy W3 war noch näher an der Sonne, aber kompakter!)
49 Komet ISON Fotomontage Größte Annäherung am um 19:30 Uhr bis auf 1,17 Mio km an die Sonnen-Oberfläche C an Kometen- Oberfläche ~ 3 Mio t Material pro Sekunde verloren?? Komet löste sich auf!! ESA/NASA/SOHO/SDO/GSFC Nach Passage wohl kein Kern mehr, nur noch zunehmend inaktiver Staub
50 ISONs letzte Minuten: Sein Schweif aus Sicht von SUMER (SOHO) links: gemessene Staubdichten rotes Kreuz ( ): ISONs Position Keinerlei Kern-Aktivität mehr!! Gesichtsfeld von SUMER ( nm)
51 : Keine Spur mehr von ISON! Jan Hattenbach
52 Komet ISON: Helligkeitsentwicklung Seiichi Yoshida
53 Entwicklung von Komet ISON ISON hatte schon Koma und Schweifansatz bei > 6 AE!! großer Komet (~ 40 km Ø) und kommt der Sonne sehr nahe (~ 1,1 Mio km über OF) Jahrhundert-Komet!! Bleibt dann aber weit hinter Helligkeitserwartungen zurück Es dämmert : Größe bei Marsbahn nur ~ 2 km Ø, wohl frischer Komet, der schnell sein Pulver verschießt Bei Annäherung an die Sonne: geringe Helligkeit, aber dann mehrere Anstiege Abbrüche legen frisches Material frei Helligkeitsmaximum bei - 4m, dann Abfall 8 h vor Perihel: letzter Staubausstoß; Ø nur noch um 100m!! nahe Perihel: Rest löst sich auf; Staubwolke bildet noch kleinen 2. Schweif; keine Aktivität mehr! Nach Perihel: keine Kernbruchstücke mehr erkennbar Das war der Jahrhundertkomet, beinah!!
54 Zum Vergleich: Komet Lovejoy (1) C/2011 W3
55 Lovejoy C/2011 W3 V. Tabur Bahndaten: - Perihel am : bei 0,0055 AE Annäherung an die Sonnen-OF bis km - Aphel bei ~ 150 AE - Exzentrizität: e = 0, Umlauf in ~ 600 Jahren - Max. Helligkeit: m Er überstand die große Sonnennähe, obwohl die Roche-Grenze überschritten war, wegen Rückstoßkraft durch seine starke Aktivität?
56 Komet Lovejoy (1) C/2011 W3 Aufnahme von der ISS NASA, Dan Burbank nach Sonnenpassage
57 Lovejoy C/2011 W3 im Sonnenwind Lovejoy im Anflug auf die Sonne: Diskontinuitäten im Schweif Gegen Ende: abgebrochener Teilkomet über Lovejoy Movie unter: Wikipedia C/2011 W3 (Lovejoy) NASA Stereo-A
58 Lovejoy C/2011 W Naskies
59 Lovejoy (1) nach Sonnenpassage
60 Helligkeitsentwicklung von Lovejoy (1) Typisch für Kometen bei naher Sonnenpassage Seiichi Yoshida
61 Lovejoy C/2011 W3: Historie seines Zerbrechens Z. Sekanina, P. Chodas Simulationen Vermutung des stufenweisen Zerbrechens - meist durch Gezeitenkräfte - im Nahfeld der Sonne: 467: Ein großer Komet zerbricht in mehrere Teile 1106: Der Hauptteil kehrt als der Große Komet von 1106 zurück 1329: Ein zweites Bruchstück - das auf eine länger-periodische Bahn geriet - erschien erst jetzt; dieses Teil wurde im Perihel weiter zerlegt 2200: Um dieses Jahr wird dessen Hauptteil wiederkehren, evtl. als Gruppe von Fragmenten 2013: Komet Lovejoy dürfte ein weiteres Teil davon sein, auf einer kürzerperiodischen Bahn Zusätzliche Bruchstücke sind in den nächsten Jahren zu erwarten
62 Komet Lovejoy (2) C/2013 R1: Bahndaten Perihel am ~ 47 km/s 0.81 AE Aphel: 486 AE Exzentrizität: 0,9983 Umlauf: a Neigung der Bahnebene gegen Ekliptik: 64 Max. Helligkeit: 4,8 m
63 Komet Lovejoy C/2013 R1 bei Präsepe (M44) D. Peach
64 Komet Lovejoy C/2013 R1 auf dem Weg zur Sonne Rudi Dobesberger IAS
65 Lovejoy C/2013 R1 Schweifdiskontinuitäten Mosaik V. Popov, E. Ivanov ν 1 Boo ν 2 Boo μ CrB
66 Lovejoy C/2013 R1 mit ζ-her und KH M13 auf dem Flug Richtung Sonne Michael Jäger Maximale Helligkeit (Dezember 2013): 4,5-5 m
67 Lovejoy C/2013 R1 bei 70 Her , nach der Sonnenpassage Osservatorio Astronomico Sormano Starker Gasschweif, von der Sonne weg
68 Lovejoy C/2013 R1 Helligkeitsentwicklung Abfall schon einen Monat vor dem Perihel am Seiichi Yoshida
69 Ausblick Kometen sind im Prinzip alle gleich, doch jeder ist anders!
70 Ausblick Kometen werden für uns erst sichtbar, wenn sie aus den Außenbereichen des Sonnensystems nach innen abgelenkt wurden Bis dahin haben alle in etwa die gleiche Zusammensetzung (Urmaterie) Diese ändert sich in Sonnennähe durch Ausgasen und dabei mitgerissenem Staub in Abhängigkeit von - Größe und Kompaktheit - Perihel-Nähe zur Sonne und Bahnexzentrizität - Zahl der erfolgten Umläufe
71 Ausblick Mechanische Einflüsse auf Struktur und Erscheinung: - Relativbewegung gegen Sonne und Erde - Rotation des Kometen - Zerbrechen im Gravitationsfeld von Sonne oder Planeten - Explosion bei innerem Gasüberdruck in Sonnennähe - Kollision mit anderem Kleinkörper Filamentbildung im Plasmaschweif durch Magnetfelder von Sonne und Sonnenwind Wenn Kometen erst einmal ins Innere des Sonnensystems gelenkt wurden, haben sie die längste Zeit gelebt!!
72 Lovejoy C/2013 R1 und LINEAR C/2012 X1 im sternenreichen Gebiet von Oph je ~ 8 m Abstand ~ 3 Michael Jäger
73 Quellen : Aktuelle Daten und Bilder zu Kometen Wikipedia: Kometen, Fragmentation History of Lovejoy 2011/W3 Schweifstern, Heft 151, Juni 2013, VdS-FG Kometen ASTROnews von SuW, Spektrum, ESA, NASA,... D. Fischer, F. Gasparini: Komet ISON, Oculum-Verlag 2013 Rainer Kayser: Nachrichten : Komet ISON ist zerbrochen soho.nascom.nasa.gov/hotshots/index.html/ ISON-Movies Ein Komet explodiert Ursachen? Paul Mortfield: Comet Lemmon (C/2012F6) (Fotoserie: , dokumentiert Veränderungen des Gasschweifs)
74 Quellen S. Yoshida s Homepage: Kometen-Helligkeitenverlauf Jan Hattenbach: ISON der verhinderte Jahrhundertkomet Sterne und Weltraum News Uwe Pilz: Komet ISON Die letzten Tage VdS-Journal IV 2014 W. Curdt: Das war ISON. Was bleibt? SuW , S.25 E. Wischnewski: Astronomie in Theorie und Praxis, 6. Auflage
75 2013 vorbei Danke!
Gliederung: 1.Definition 2.Eigenschaften/Merkmale/ Aufbau 3.Geschichte 4.Beispiele 5.Gefahr aus dem All?
 Wilde Wanderer im Weltraum Gliederung: 1.Definition 2.Eigenschaften/Merkmale/ Aufbau 3.Geschichte 4.Beispiele 5.Gefahr aus dem All? Definition: -griechisch: kométes =Haarstern - auch Schweifstern genannt
Wilde Wanderer im Weltraum Gliederung: 1.Definition 2.Eigenschaften/Merkmale/ Aufbau 3.Geschichte 4.Beispiele 5.Gefahr aus dem All? Definition: -griechisch: kométes =Haarstern - auch Schweifstern genannt
Einleitung Aufbau des Sonnensystems Entstehung des Sonnensystems. Das Sonnensystem. Stefan Sattler
 1 2 Allgemeine Struktur Zone der Planeten 3 Urknall Urwolke Entstehung der Planeten Planetensystem Planeten und ihre natürliche Satelliten Zwergplaneten Kometen, Asteroiden und Meteoriten Planetensystem
1 2 Allgemeine Struktur Zone der Planeten 3 Urknall Urwolke Entstehung der Planeten Planetensystem Planeten und ihre natürliche Satelliten Zwergplaneten Kometen, Asteroiden und Meteoriten Planetensystem
Komet Hale-Bopp auf dem Oldendorfer
 OsnabrückerNaturwissenschaftlicheMitteilungen Band 24, S. 19-30, 1998 Komet Hale-Bopp auf dem Oldendorfer Berg Erwin Heiser Kurzfassung: In der Zeit vom 5.9.96 bis 2.5.97 wurden die Veränderungen in der
OsnabrückerNaturwissenschaftlicheMitteilungen Band 24, S. 19-30, 1998 Komet Hale-Bopp auf dem Oldendorfer Berg Erwin Heiser Kurzfassung: In der Zeit vom 5.9.96 bis 2.5.97 wurden die Veränderungen in der
Astronomische Körper unseres Sonnensystems
 Astronomische Körper unseres Sonnensystems Das Sonnensystem beschreibt den gravitativen (anziehenden) Bereich der Sonne auf umgebende Himmelskörper. Es ist ein Planeten- und Einfachsternsystem. Für astronomische
Astronomische Körper unseres Sonnensystems Das Sonnensystem beschreibt den gravitativen (anziehenden) Bereich der Sonne auf umgebende Himmelskörper. Es ist ein Planeten- und Einfachsternsystem. Für astronomische
Gliederung. 1. Allgemeine Daten und Namensherkunft. 2. Entstehung und Entdeckung. 3. Aufbau und Struktur
 Gliederung 1. Allgemeine Daten und Namensherkunft 2. Entstehung und Entdeckung 3. Aufbau und Struktur 3.1. Zusammensetzung der Atmosphäre 3.2. Rotation und Bewegung um die Sonne 3.3. Gürtel und Zonen 3.4.
Gliederung 1. Allgemeine Daten und Namensherkunft 2. Entstehung und Entdeckung 3. Aufbau und Struktur 3.1. Zusammensetzung der Atmosphäre 3.2. Rotation und Bewegung um die Sonne 3.3. Gürtel und Zonen 3.4.
Per Anhalter durch das Sonnensystem
 Auch als Edgeworth-Kuiper Gürtel bezeichnet (postulierten 1947 und 1951 unabhängig voneinander die Existenz von Objekten jenseits der Neptun Bahn). Scheibenförmige Region zwischen 30 bis 50 AE von der
Auch als Edgeworth-Kuiper Gürtel bezeichnet (postulierten 1947 und 1951 unabhängig voneinander die Existenz von Objekten jenseits der Neptun Bahn). Scheibenförmige Region zwischen 30 bis 50 AE von der
Historie der Astronomie
 Kurzvortrag: Historie der Astronomie Astronomievereinigung Rottweil 27. Februar 2010, Zimmern o.r. Herbert Haupt Lehrerfortbildung, 2007 Oberjoch, 5-7 October 2006 Andrea Santangelo, IAAT, KC-Tü Historie
Kurzvortrag: Historie der Astronomie Astronomievereinigung Rottweil 27. Februar 2010, Zimmern o.r. Herbert Haupt Lehrerfortbildung, 2007 Oberjoch, 5-7 October 2006 Andrea Santangelo, IAAT, KC-Tü Historie
und Position Asteroide 1.Einführung 2.Die Bahnen
 und Position Asteroide 1.Einführung 2.Die Bahnen 3.Entstehung bzw Beschaffenheit 4.Das schärfste Bild eines Asteroiden bis 1992 5.Die Gefahr, die von den Asteroiden ausgeht 1.Einführung Asteroide, auch
und Position Asteroide 1.Einführung 2.Die Bahnen 3.Entstehung bzw Beschaffenheit 4.Das schärfste Bild eines Asteroiden bis 1992 5.Die Gefahr, die von den Asteroiden ausgeht 1.Einführung Asteroide, auch
Sonne Mond und Sterne
 etc. ien NASA, ESA, e ght-richtlin ammen von N gen Copyrig n Bilder sta n den jeweili verwendete unterliegen Sonne Mond und Sterne Bruno Besser Institut für Weltraumforschung Österreichische Akademie der
etc. ien NASA, ESA, e ght-richtlin ammen von N gen Copyrig n Bilder sta n den jeweili verwendete unterliegen Sonne Mond und Sterne Bruno Besser Institut für Weltraumforschung Österreichische Akademie der
Zusammenfassung des Vortrags vom 28. April 2012
 Kathrin Altwegg, Forschung im luftleeren Raum 31 Kathrin altwegg 1 Forschung im luftleeren Raum Zusammenfassung des Vortrags vom 28. April 2012 «Warum hat es im Weltraum keinen Sauerstoff?» (Sol, 11 Jahre).
Kathrin Altwegg, Forschung im luftleeren Raum 31 Kathrin altwegg 1 Forschung im luftleeren Raum Zusammenfassung des Vortrags vom 28. April 2012 «Warum hat es im Weltraum keinen Sauerstoff?» (Sol, 11 Jahre).
Astronomie für Nicht Physiker SS 2013
 Astronomie für Nicht Physiker SS 2013 18.4. Astronomie heute (Just, Fendt) 25.4. Sonne, Erde, Mond (Fohlmeister) 2.5. Das Planetensystem (Fohlmeister) 16.5. Teleskope, Instrumente, Daten (Fendt) 23.5.
Astronomie für Nicht Physiker SS 2013 18.4. Astronomie heute (Just, Fendt) 25.4. Sonne, Erde, Mond (Fohlmeister) 2.5. Das Planetensystem (Fohlmeister) 16.5. Teleskope, Instrumente, Daten (Fendt) 23.5.
Die Sonne. das Zentrum unseres Planetensystems. Erich Laager / Bern 1
 Die Sonne das Zentrum unseres Planetensystems Erich Laager 2011 18.09.2012 / Bern 1 Die Sonne das Zentrum unseres Planetensystems 2 Die Bild-Quellen zur Sonne: NASA: 08, 14, 19, 33 ESA / NASA SOHO: 29,
Die Sonne das Zentrum unseres Planetensystems Erich Laager 2011 18.09.2012 / Bern 1 Die Sonne das Zentrum unseres Planetensystems 2 Die Bild-Quellen zur Sonne: NASA: 08, 14, 19, 33 ESA / NASA SOHO: 29,
Namensherkunft. erst Hermes später von Römern umgewandelt zu Merkur
 Merkur Gliederung Allgemeine Daten Namensgebung Umlaufbahn Periheldrehung Oberflächenstruktur Atmosphäre und Temperatur Innerer Aufbau Ungewöhnliche Dichte Magnetfeld Monde Ist Leben auf dem Merkur möglich?
Merkur Gliederung Allgemeine Daten Namensgebung Umlaufbahn Periheldrehung Oberflächenstruktur Atmosphäre und Temperatur Innerer Aufbau Ungewöhnliche Dichte Magnetfeld Monde Ist Leben auf dem Merkur möglich?
Kometen. Kometen in der Geschichte. Ursprung der Kometen. Benennung. Der Nukleus. Das Koma, der Staubschweif und Meteoriten. Der Plasma-/Ionenschweif
 Kometen Kometen in der Geschichte Ursprung der Kometen Benennung Der Nukleus Das Koma, der Staubschweif und Meteoriten Der Plasma-/Ionenschweif Forschungsmissionen in der Vergangenheit und Zukunft Kometen
Kometen Kometen in der Geschichte Ursprung der Kometen Benennung Der Nukleus Das Koma, der Staubschweif und Meteoriten Der Plasma-/Ionenschweif Forschungsmissionen in der Vergangenheit und Zukunft Kometen
deutschsprachige Planetarien gute Gründe, das Ereignis nicht zu verpassen
 deutschsprachige Planetarien 5 gute Gründe, das Ereignis nicht zu verpassen Der Merkurtransit 2016 - darum gibt es gute Gründe, dieses Ereignis nicht zu verpassen! 5 http:// Weitere Links (eine kleine
deutschsprachige Planetarien 5 gute Gründe, das Ereignis nicht zu verpassen Der Merkurtransit 2016 - darum gibt es gute Gründe, dieses Ereignis nicht zu verpassen! 5 http:// Weitere Links (eine kleine
Aufbau des Sonnensystems
 Aufbau des Sonnensystems Gliederung Sonne Planeten: terrestrische Planeten iovianische Planeten Sonderfall Pluto Asteroidengürtel Kuipergürtel Oortsche Wolke Missionen Die Sonne Durchmesser 1,392 10 6
Aufbau des Sonnensystems Gliederung Sonne Planeten: terrestrische Planeten iovianische Planeten Sonderfall Pluto Asteroidengürtel Kuipergürtel Oortsche Wolke Missionen Die Sonne Durchmesser 1,392 10 6
Heliozentrische vs. Geozentrische Weltbilder
 Heliozentrische vs. Geozentrische Weltbilder Mars: 26. August 1988 bis 30. Oktober 1988, rückläufige Bahn Folie 1 Erklärung des Ptolemäus (ca. 140 n. Chr.): Almagest, 7 Himmelskörper (mit Sonne und Mond)
Heliozentrische vs. Geozentrische Weltbilder Mars: 26. August 1988 bis 30. Oktober 1988, rückläufige Bahn Folie 1 Erklärung des Ptolemäus (ca. 140 n. Chr.): Almagest, 7 Himmelskörper (mit Sonne und Mond)
Woher kam der Komet Chury? [26. Okt.]
![Woher kam der Komet Chury? [26. Okt.] Woher kam der Komet Chury? [26. Okt.]](/thumbs/54/35205947.jpg) Woher kam der Komet Chury? [26. Okt.] Der Komet 67P/Churyumov-Gerasimenko ("Chury") [1, 1a] entfernt sich gegenwärtig immer weiter von uns in Richtung des äusseren Sonnensystems [1], einem kalten, dunklen
Woher kam der Komet Chury? [26. Okt.] Der Komet 67P/Churyumov-Gerasimenko ("Chury") [1, 1a] entfernt sich gegenwärtig immer weiter von uns in Richtung des äusseren Sonnensystems [1], einem kalten, dunklen
Venus DER SCHWESTERPLANET DER ERDE
 Venus DER SCHWESTERPLANET DER ERDE Gliederung 1. Allgemeines 1.1 Namensherkunft 1.2 Daten zur Venus 1.2.1 Umlaufbahn und Venustransit 1.3 Aufbau 1.3.1 innerer 1.3.2 Oberfläche 1.3.3 Magnetfeld 1.3.4 Besonderheiten
Venus DER SCHWESTERPLANET DER ERDE Gliederung 1. Allgemeines 1.1 Namensherkunft 1.2 Daten zur Venus 1.2.1 Umlaufbahn und Venustransit 1.3 Aufbau 1.3.1 innerer 1.3.2 Oberfläche 1.3.3 Magnetfeld 1.3.4 Besonderheiten
VERGLEICH AMATEURAUFNAHMEN VERSUS PROFESSIONELLE ASTROFOTOS. von Rudolf Dobesberger
 VERGLEICH AMATEURAUFNAHMEN VERSUS PROFESSIONELLE ASTROFOTOS von Rudolf Dobesberger DIE KONTRAHENTEN Das Profiteleskop Internationale Amateur Sternwarte - Der Herausforder 0,5m Spiegel Keller Astrograph
VERGLEICH AMATEURAUFNAHMEN VERSUS PROFESSIONELLE ASTROFOTOS von Rudolf Dobesberger DIE KONTRAHENTEN Das Profiteleskop Internationale Amateur Sternwarte - Der Herausforder 0,5m Spiegel Keller Astrograph
Jenseits unseres Sonnensystems. Von Geried Kinast
 Jenseits unseres Sonnensystems Von Geried Kinast Inhalt 1. Einleitung 1.1 Kuipergürtel 1.2 Lichtjahr 2. Die Milchstraße 2.1 Sterne 2.2 Aufbau der Milchstraße 2.3 Der Galaktiche Halo 2.4 Das Zentrum der
Jenseits unseres Sonnensystems Von Geried Kinast Inhalt 1. Einleitung 1.1 Kuipergürtel 1.2 Lichtjahr 2. Die Milchstraße 2.1 Sterne 2.2 Aufbau der Milchstraße 2.3 Der Galaktiche Halo 2.4 Das Zentrum der
Die Entstehung unseres Sonnen Systems. Quelle Bilder und Daten: Wikipedia
 Die Entstehung unseres Sonnen Systems. Quelle Bilder und Daten: Wikipedia Unser Sonnensystem. Größenvergleich zwischen Merkur und Erde. { Aphel: 70 Mio. km Perihel: 46 Mio. km Merkur Jahr: 97,8 Tage Merkur
Die Entstehung unseres Sonnen Systems. Quelle Bilder und Daten: Wikipedia Unser Sonnensystem. Größenvergleich zwischen Merkur und Erde. { Aphel: 70 Mio. km Perihel: 46 Mio. km Merkur Jahr: 97,8 Tage Merkur
Das Sonnensystem und die terrestrischen Planeten
 STEOP: System Erde (LV 280001) Unterstützendes Handoutmaterial zum Themenkomplex 9: Das Sonnensystem und die terrestrischen Planeten Dieses Handoutmaterial ergänzt die Vorlesungsinhalte. Zur Prüfungsvorbereitung
STEOP: System Erde (LV 280001) Unterstützendes Handoutmaterial zum Themenkomplex 9: Das Sonnensystem und die terrestrischen Planeten Dieses Handoutmaterial ergänzt die Vorlesungsinhalte. Zur Prüfungsvorbereitung
Unsere Planeten. Kein Planet gleicht einem anderen Planeten. Kein Mond gleicht genau dem eines anderen Planeten.
 Unsere Planeten Um unsere Sonne kreisen 9 Planeten und um manche von diesen kreisen Monde, so wie unser Mond um den Planeten Erde kreist. Außerdem kreisen noch Asteroide und Kometen um die Sonne. Fünf
Unsere Planeten Um unsere Sonne kreisen 9 Planeten und um manche von diesen kreisen Monde, so wie unser Mond um den Planeten Erde kreist. Außerdem kreisen noch Asteroide und Kometen um die Sonne. Fünf
Wie lange leben Sterne? und Wie entstehen sie?
 Wie lange leben Sterne? und Wie entstehen sie? Neue Sterne Neue Sterne Was ist ein Stern? Unsere Sonne ist ein Stern Die Sonne ist ein heißer Gasball sie erzeugt ihre Energie aus Kernfusion Planeten sind
Wie lange leben Sterne? und Wie entstehen sie? Neue Sterne Neue Sterne Was ist ein Stern? Unsere Sonne ist ein Stern Die Sonne ist ein heißer Gasball sie erzeugt ihre Energie aus Kernfusion Planeten sind
sel Jupiters Stellung im Sonnensystem
 Astr rono omief freunde Wag ghäusel Jupiter, der König der Planeten sel Astr rono omief freunde Wag ghäu Jupiters Stellung im Sonnensystem sel Astr rono omief freunde Wag ghäu Jupiters Stellung im Sonnensystem
Astr rono omief freunde Wag ghäusel Jupiter, der König der Planeten sel Astr rono omief freunde Wag ghäu Jupiters Stellung im Sonnensystem sel Astr rono omief freunde Wag ghäu Jupiters Stellung im Sonnensystem
1 DER AUFBAU DES UNIVERSUMS
 6 Grundkurs Astronomische Jugendgruppe Bern 1 DER AUFBAU DES UNIVERSUMS 1.1 Unser Sonnensystem Unser Sonnensystem besteht aus einem durchschnittlichen Stern, der Sonne, und vielen kleineren Körpern, die
6 Grundkurs Astronomische Jugendgruppe Bern 1 DER AUFBAU DES UNIVERSUMS 1.1 Unser Sonnensystem Unser Sonnensystem besteht aus einem durchschnittlichen Stern, der Sonne, und vielen kleineren Körpern, die
Merkur Der schnellste Planet des Sonnensystems. Cibbizone Network
 Merkur Der schnellste Planet des Sonnensystems Cibbizone Network 1 Gliederung Einführung Entstehung des Planeten Aufbau des Merkurs Die Oberfläche Merkur und das Wasser Planetenerkundung Physikalische
Merkur Der schnellste Planet des Sonnensystems Cibbizone Network 1 Gliederung Einführung Entstehung des Planeten Aufbau des Merkurs Die Oberfläche Merkur und das Wasser Planetenerkundung Physikalische
drart Unser Sonnensystem
 Unser Sonnensystem Die Inneren Planeten Merkur - Apollo - Hermes Mittlere Entfernung zur Sonne: 57.910.000 km (0,38 AU) Durchmesser: 4.880 km Masse: 3,3 1023 kg Temperatur: -183-427 C Umlaufperiode: 89
Unser Sonnensystem Die Inneren Planeten Merkur - Apollo - Hermes Mittlere Entfernung zur Sonne: 57.910.000 km (0,38 AU) Durchmesser: 4.880 km Masse: 3,3 1023 kg Temperatur: -183-427 C Umlaufperiode: 89
MERKUR VORTRAG VON ANNABELLE JESCHE UND IREEN BRENDLER
 MERKUR VORTRAG VON ANNABELLE JESCHE UND IREEN BRENDLER GLIEDERUNG 1. Namensherkunft 2. Allgemeines 3. Oberflächenstruktur 4. Atmosphäre 5. Innerer Aufbau 6. Temperaturen 7. ungewöhnliche Dichte 8. Drehung/Rotation
MERKUR VORTRAG VON ANNABELLE JESCHE UND IREEN BRENDLER GLIEDERUNG 1. Namensherkunft 2. Allgemeines 3. Oberflächenstruktur 4. Atmosphäre 5. Innerer Aufbau 6. Temperaturen 7. ungewöhnliche Dichte 8. Drehung/Rotation
Der Mond des Zwergplaneten Makemake
 Der Mond des Zwergplaneten Makemake [22. Juni] Mithilfe neuer Beobachtungen haben Astronomen bei einem von fünf Zwergplaneten [1] im äusseren Bereich unseres Sonnensystems [1] einen kleinen, lichtschwachen
Der Mond des Zwergplaneten Makemake [22. Juni] Mithilfe neuer Beobachtungen haben Astronomen bei einem von fünf Zwergplaneten [1] im äusseren Bereich unseres Sonnensystems [1] einen kleinen, lichtschwachen
Uranus und Neptun VORTRAG VON STEVEN CUTI UND CLEMENS RICHTER
 Uranus und Neptun VORTRAG VON STEVEN CUTI UND CLEMENS RICHTER Gliederung Uranus Neptun Allgemeines Allgemeines Atmosphäre und Aufbau Aufbau Besonderheiten Umlaufbahn/Rotation Das Magnetfeld Monde Das Ringsystem
Uranus und Neptun VORTRAG VON STEVEN CUTI UND CLEMENS RICHTER Gliederung Uranus Neptun Allgemeines Allgemeines Atmosphäre und Aufbau Aufbau Besonderheiten Umlaufbahn/Rotation Das Magnetfeld Monde Das Ringsystem
Quasare Hendrik Gross
 Quasare Hendrik Gross Gliederungspunkte 1. Entdeckung und Herkunft 2. Charakteristik eines Quasars 3. Spektroskopie und Rotverschiebung 4. Wie wird ein Quasar erfasst? 5. Funktionsweise eines Radioteleskopes
Quasare Hendrik Gross Gliederungspunkte 1. Entdeckung und Herkunft 2. Charakteristik eines Quasars 3. Spektroskopie und Rotverschiebung 4. Wie wird ein Quasar erfasst? 5. Funktionsweise eines Radioteleskopes
Licht aus dem Universum
 Licht aus dem Universum Licht und Astronomie Sichtbares Licht: Geschichte/Methoden/... Neue Ergebnisse Radiowellen, Mikrowellen... (Andere) Teilchenstrahlung Thomas Hebbeker RWTH Aachen 28. Januar 2008
Licht aus dem Universum Licht und Astronomie Sichtbares Licht: Geschichte/Methoden/... Neue Ergebnisse Radiowellen, Mikrowellen... (Andere) Teilchenstrahlung Thomas Hebbeker RWTH Aachen 28. Januar 2008
Asteroid stürzt auf Jupiter!
 Asteroid stürzt auf Jupiter! Bezug auf den SuW-Beitrag Asteroideneinschlag auf Jupiter / Blick in die Forschung (SuW 5/2011) Olaf Hofschulz Im vorliegenden Material wird ein Arbeitsblatt für die Schüler
Asteroid stürzt auf Jupiter! Bezug auf den SuW-Beitrag Asteroideneinschlag auf Jupiter / Blick in die Forschung (SuW 5/2011) Olaf Hofschulz Im vorliegenden Material wird ein Arbeitsblatt für die Schüler
km/s 70,22 km/s 68,7 km/s 37,5 km/s 17 km/s 15 km/s 7,8 8,0 km/s 0,236 km/s 0,033 km/s
 Weltraum 31 1 6 Grössen im Weltraum Geschwindigkeiten im Vergleich Objekt Licht Raumsonde «Helios 1» und «Helios 2» Raumsonde «Giotto» Raumsonde «Rosetta» Raumsonde «Voyager 1» Raumsonde «Voyager 2» «Space
Weltraum 31 1 6 Grössen im Weltraum Geschwindigkeiten im Vergleich Objekt Licht Raumsonde «Helios 1» und «Helios 2» Raumsonde «Giotto» Raumsonde «Rosetta» Raumsonde «Voyager 1» Raumsonde «Voyager 2» «Space
Die Entstehung des Sonnensystems
 Die Entstehung des Sonnensystems Volker Ossenkopf SRON National Institute for Space Research, Groningen I. Physikalisches Institut der Universität zu Köln G. Buffon (1767) Köln, 14.2.2004 1 Was ist das
Die Entstehung des Sonnensystems Volker Ossenkopf SRON National Institute for Space Research, Groningen I. Physikalisches Institut der Universität zu Köln G. Buffon (1767) Köln, 14.2.2004 1 Was ist das
Mittel- und Oberstufe - MITTEL:
 Praktisches Arbeiten - 3 nrotationsgeschwindigkeit ( 2 ) Mittel- und Oberstufe - MITTEL: Ein Solarscope, Eine genau gehende Uhr, Ein Messschirm, Dieses Experiment kann in einem Raum in Südrichtung oder
Praktisches Arbeiten - 3 nrotationsgeschwindigkeit ( 2 ) Mittel- und Oberstufe - MITTEL: Ein Solarscope, Eine genau gehende Uhr, Ein Messschirm, Dieses Experiment kann in einem Raum in Südrichtung oder
Das Sonnensystem. Teil 2. Peter Hauschildt 6. Dezember Hamburger Sternwarte Gojenbergsweg Hamburg
 Das Sonnensystem Teil 2 Peter Hauschildt yeti@hs.uni-hamburg.de Hamburger Sternwarte Gojenbergsweg 112 21029 Hamburg 6. Dezember 2016 1 / 48 Übersicht Teil 2 Entstehung des Sonnensystems Exoplaneten 2
Das Sonnensystem Teil 2 Peter Hauschildt yeti@hs.uni-hamburg.de Hamburger Sternwarte Gojenbergsweg 112 21029 Hamburg 6. Dezember 2016 1 / 48 Übersicht Teil 2 Entstehung des Sonnensystems Exoplaneten 2
Die Milchstraße. Sternentstehung. ( clund Observatory, 1940er) Interstellare Materie (ISM) W. Kley: Theoretische Astrophysik 1
 Die Milchstraße ( clund Observatory, 1940er) Interstellare Materie (ISM) W. Kley: Theoretische Astrophysik 1 Die Galaxie M74 (NGC 628) Sternbild: Fische Abstand: 35 Mio. LJ. Rot: sichtbares Licht - ältere
Die Milchstraße ( clund Observatory, 1940er) Interstellare Materie (ISM) W. Kley: Theoretische Astrophysik 1 Die Galaxie M74 (NGC 628) Sternbild: Fische Abstand: 35 Mio. LJ. Rot: sichtbares Licht - ältere
Astronomie Unser Sonnensystem in Zahlen
 Ausgabe 2007-10 Astronomie Unser Sonnensystem in Zahlen Seite 1. Erde, Mond, Sonne in Zahlen 2 1.1 Die Erde als Himmelskörper 2 1.2 Der Erdmond 3 1.3 Die Sonne 4 2. Unser Planetensystem 5 1. Erde, Mond,
Ausgabe 2007-10 Astronomie Unser Sonnensystem in Zahlen Seite 1. Erde, Mond, Sonne in Zahlen 2 1.1 Die Erde als Himmelskörper 2 1.2 Der Erdmond 3 1.3 Die Sonne 4 2. Unser Planetensystem 5 1. Erde, Mond,
Prof. Dr. Werner Becker Max-Planck Institut für extraterrestrische Physik
 Prof. Dr. Werner Becker Max-Planck Institut für extraterrestrische Physik Email: web@mpe.mpg.de Worüber wir heute sprechen wollen: Warum interessieren sich die Menschen für Astronomie? Welche Bedeutung
Prof. Dr. Werner Becker Max-Planck Institut für extraterrestrische Physik Email: web@mpe.mpg.de Worüber wir heute sprechen wollen: Warum interessieren sich die Menschen für Astronomie? Welche Bedeutung
Diebesgut des Kometen Siding Spring [27. März] Erinnern Sie sich?
![Diebesgut des Kometen Siding Spring [27. März] Erinnern Sie sich? Diebesgut des Kometen Siding Spring [27. März] Erinnern Sie sich?](/thumbs/55/35677481.jpg) Diebesgut des Kometen Siding Spring [27. März] Erinnern Sie sich? Am 19. Oktober 2014 flog der Komet c/2013 A1 (Siding Spring) [1, 2] in einem Abstand von lediglich rund 140.000 Kilometern am Planeten
Diebesgut des Kometen Siding Spring [27. März] Erinnern Sie sich? Am 19. Oktober 2014 flog der Komet c/2013 A1 (Siding Spring) [1, 2] in einem Abstand von lediglich rund 140.000 Kilometern am Planeten
Gwendy Lisa. Christine
 Gwendy Lisa Christine Die Planeten Einführung Wenn wir den klaren Nachthimmel betrachten, erscheint uns die Anzahl der Sterne unendlich. Tatsächlich sind mit bloβem Auge aber nur einige tausend Sterne
Gwendy Lisa Christine Die Planeten Einführung Wenn wir den klaren Nachthimmel betrachten, erscheint uns die Anzahl der Sterne unendlich. Tatsächlich sind mit bloβem Auge aber nur einige tausend Sterne
Einführung in die Astronomie
 Einführung in die Astronomie Teil 2 Peter H. Hauschildt yeti@hs.uni-hamburg.de Hamburger Sternwarte Gojenbergsweg 112 21029 Hamburg part2.tex Einführung in die Astronomie Peter H. Hauschildt 30/10/2014
Einführung in die Astronomie Teil 2 Peter H. Hauschildt yeti@hs.uni-hamburg.de Hamburger Sternwarte Gojenbergsweg 112 21029 Hamburg part2.tex Einführung in die Astronomie Peter H. Hauschildt 30/10/2014
2. Planetensysteme 2.1 Objekte im Sonnensystem
 2. Planetensysteme 2.1 Objekte im Sonnensystem Sonne: 99.9% der Masse des Sonnensystems 8 Planeten: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun Monde, Satelliten: z.b. Erdmond, Io, Europa,
2. Planetensysteme 2.1 Objekte im Sonnensystem Sonne: 99.9% der Masse des Sonnensystems 8 Planeten: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun Monde, Satelliten: z.b. Erdmond, Io, Europa,
Neues aus Kosmologie und Astrophysik 1.0
 Neues aus Kosmologie und Astrophysik 1.0 Unser Universum Sterne und Galaxien Hintergrundstrahlung Elemententstehung Das Big-Bang-Modell Prozesse im frühen Universum Fragen und Antworten (?) Dunkle Materie
Neues aus Kosmologie und Astrophysik 1.0 Unser Universum Sterne und Galaxien Hintergrundstrahlung Elemententstehung Das Big-Bang-Modell Prozesse im frühen Universum Fragen und Antworten (?) Dunkle Materie
Meteor Spectroscopy, Aspekt 2015
 Meteor Spectroscopy, Aspekt 2015 Martin Dubs SAG, FMA Inhalt Meteorastronomie Terminologie Beobachtung Netzwerk Videobeobachtung: Hard- und Software Meteorspektroskopie Hard- Software Wavelength calibration
Meteor Spectroscopy, Aspekt 2015 Martin Dubs SAG, FMA Inhalt Meteorastronomie Terminologie Beobachtung Netzwerk Videobeobachtung: Hard- und Software Meteorspektroskopie Hard- Software Wavelength calibration
Die Sonne und ihre Planeten... 2 Die Asteroiden und Meteoriten... 4 Die Kometen... 4
 Unser Sonnensystem Inhaltsverzeichnis Die Sonne und ihre Planeten... 2 Die Asteroiden und Meteoriten... 4 Die Kometen... 4 Planetenkunde... 4 Was ist ein Planet?... 4 Umdrehung, Rotation... 5 Mit oder
Unser Sonnensystem Inhaltsverzeichnis Die Sonne und ihre Planeten... 2 Die Asteroiden und Meteoriten... 4 Die Kometen... 4 Planetenkunde... 4 Was ist ein Planet?... 4 Umdrehung, Rotation... 5 Mit oder
NEUTRONENSTERNE. Eine Reise in die Vergangenheit. Jochen Wambach Institut für Kernphysik TU Darmstadt
 NEUTRONENSTERNE Eine Reise in die Vergangenheit Jochen Wambach Institut für Kernphysik TU Darmstadt NEUTRONENSTERNE Eine Reise in die Vergangenheit Jochen Wambach Institut für Kernphysik TU Darmstadt Was
NEUTRONENSTERNE Eine Reise in die Vergangenheit Jochen Wambach Institut für Kernphysik TU Darmstadt NEUTRONENSTERNE Eine Reise in die Vergangenheit Jochen Wambach Institut für Kernphysik TU Darmstadt Was
Das Sonnensystem. Teil 11. Peter Hauschildt 6. Dezember Hamburger Sternwarte Gojenbergsweg Hamburg
 Das Sonnensystem Teil 11 Peter Hauschildt yeti@hs.uni-hamburg.de Hamburger Sternwarte Gojenbergsweg 112 21029 Hamburg 6. Dezember 2016 1 / 46 Übersicht Teil 11 Die äusseren Planeten Uranus + Monde Neptune
Das Sonnensystem Teil 11 Peter Hauschildt yeti@hs.uni-hamburg.de Hamburger Sternwarte Gojenbergsweg 112 21029 Hamburg 6. Dezember 2016 1 / 46 Übersicht Teil 11 Die äusseren Planeten Uranus + Monde Neptune
Einführung in die Astronomie und Astrophysik I
 Einführung in die Astronomie und Astrophysik I Teil 4 Jochen Liske Hamburger Sternwarte jochen.liske@uni-hamburg.de Themen Einstieg: Was ist Astrophysik? Koordinatensysteme Astronomische Zeitrechnung Sonnensystem
Einführung in die Astronomie und Astrophysik I Teil 4 Jochen Liske Hamburger Sternwarte jochen.liske@uni-hamburg.de Themen Einstieg: Was ist Astrophysik? Koordinatensysteme Astronomische Zeitrechnung Sonnensystem
Sicher kennst du den Merkspruch für die Planeten, an den wir uns so gut gewöhnt hatten:
 Was ist ein Planet? In der Antike wurden alle mit bloßem Auge sichtbaren Himmelserscheinungen als Planet bezeichnet, wenn sie sich vor dem Hintergrund des immer gleich bleibenden Himmels (Fixsternhimmel)
Was ist ein Planet? In der Antike wurden alle mit bloßem Auge sichtbaren Himmelserscheinungen als Planet bezeichnet, wenn sie sich vor dem Hintergrund des immer gleich bleibenden Himmels (Fixsternhimmel)
THEMENUEBERSICHT. Unser Sonnensystem: 1) Was gehört zum Sonnensystem? Wie entstand unser Sonnensystem? 2) Wie viele Planeten hat unser Sonnensystem?
 THEMENUEBERSICHT Unser Sonnensystem: 1) Was gehört zum Sonnensystem? Wie entstand unser Sonnensystem? 2) Wie viele Planeten hat unser Sonnensystem? 3) Informationen zu den 9 Planeten! Merkur S.3 Venus
THEMENUEBERSICHT Unser Sonnensystem: 1) Was gehört zum Sonnensystem? Wie entstand unser Sonnensystem? 2) Wie viele Planeten hat unser Sonnensystem? 3) Informationen zu den 9 Planeten! Merkur S.3 Venus
Der Wegweiser zu Planet Nine [23. März] äussere Planetensystem Kuiper-Gürtel
![Der Wegweiser zu Planet Nine [23. März] äussere Planetensystem Kuiper-Gürtel Der Wegweiser zu Planet Nine [23. März] äussere Planetensystem Kuiper-Gürtel](/thumbs/52/29394760.jpg) Der Wegweiser zu Planet Nine [23. März] Das äussere Planetensystem [1] ist uns bekannt und wiederum nicht. Am Rand des Sonnensystems [1], ausserhalb der Bahn des Planeten Neptun [1], befindet sich ein
Der Wegweiser zu Planet Nine [23. März] Das äussere Planetensystem [1] ist uns bekannt und wiederum nicht. Am Rand des Sonnensystems [1], ausserhalb der Bahn des Planeten Neptun [1], befindet sich ein
Parameter für die Habitabilität von Planeten - Atmosphäre
 Parameter für die Habitabilität von Planeten - Atmosphäre Gliederung Definition von Habitabilität Erdatmosphäre Zusammensetzung Aufbau Einfluss der Atmosphäre auf die Temperatur Reflexion Absorption Treibhauseffekt
Parameter für die Habitabilität von Planeten - Atmosphäre Gliederung Definition von Habitabilität Erdatmosphäre Zusammensetzung Aufbau Einfluss der Atmosphäre auf die Temperatur Reflexion Absorption Treibhauseffekt
Der Pistolenstern. der schwerste Stern der Galaxis?
 Der Pistolenstern der schwerste Stern der Galaxis? Der Name! Der Pistolenstern liegt in einer dichten Staub- und Gaswolke eingebettet nahe des galaktischen Zentrums. Die Form dieser Staub- und Gaswolke
Der Pistolenstern der schwerste Stern der Galaxis? Der Name! Der Pistolenstern liegt in einer dichten Staub- und Gaswolke eingebettet nahe des galaktischen Zentrums. Die Form dieser Staub- und Gaswolke
Facts zum Weltall und unserem Sonnensystem
 Facts zum Weltall und unserem Sonnensystem Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein [1879 1955]
Facts zum Weltall und unserem Sonnensystem Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein [1879 1955]
Der Tanz der Jupiter-Monde
 T.H. Der Tanz der Jupiter-Monde V1.1 Thomas Hebbeker 27.10.2012 Motivation Messung der Bahndaten der 4 Galileischen Jupitermonde Umlaufzeiten, Bahnradien Überprüfung des III. Keplerschen Gesetzes Berechnung
T.H. Der Tanz der Jupiter-Monde V1.1 Thomas Hebbeker 27.10.2012 Motivation Messung der Bahndaten der 4 Galileischen Jupitermonde Umlaufzeiten, Bahnradien Überprüfung des III. Keplerschen Gesetzes Berechnung
Astronomie im Chiemgau e.v.
 Astronomie im Chiemgau e.v. Pluto Planet mit Herz Das Sonnensystem... Neptun Saturn Uranus Jupiter Mars Erde Merkur Venus hatte am Anfang des 20. Jhd.s acht bekannte Planeten. Der neunte Planet Astronomen
Astronomie im Chiemgau e.v. Pluto Planet mit Herz Das Sonnensystem... Neptun Saturn Uranus Jupiter Mars Erde Merkur Venus hatte am Anfang des 20. Jhd.s acht bekannte Planeten. Der neunte Planet Astronomen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Der Weltraum. Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Der Weltraum Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Bestellnummer: Titel: Der Weltraum Reihe: Lernwerkstatt zur Freiarbeit
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Der Weltraum Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Bestellnummer: Titel: Der Weltraum Reihe: Lernwerkstatt zur Freiarbeit
Abplattung ein Designmerkmal kosmischer Objekte Olaf Fischer
 Abplattung ein Designmerkmal kosmischer Objekte Olaf Fischer Wenn es um die Größe der Erde geht, dann erfährt der Schüler, dass es einen Äquatorradius und einen Polradius gibt, die sich etwa um 0 km unterscheiden.
Abplattung ein Designmerkmal kosmischer Objekte Olaf Fischer Wenn es um die Größe der Erde geht, dann erfährt der Schüler, dass es einen Äquatorradius und einen Polradius gibt, die sich etwa um 0 km unterscheiden.
A1: Kennt Ihr alle Planeten unseres Sonnensystems? Zählt sie auf.
 Ihr braucht: Tablet oder Smartphone Arbeitsmappe A1: Kennt Ihr alle Planeten unseres Sonnensystems? Zählt sie auf. Tipp: Mein Vater Erklärt Mir Jeden Samstagabend Unseren Nachthimmel. A2: Öffnet das Programm
Ihr braucht: Tablet oder Smartphone Arbeitsmappe A1: Kennt Ihr alle Planeten unseres Sonnensystems? Zählt sie auf. Tipp: Mein Vater Erklärt Mir Jeden Samstagabend Unseren Nachthimmel. A2: Öffnet das Programm
25 Jahre Hubble Weltraumteleskop
 25 Jahre Hubble Weltraumteleskop Seit April 24, 1990!!!!!!! Ein Vortrag von: www.aguz.ch www.aguz-beobachter.ch Peter Englmaier Astronomische Gesellschaft Urania Zürich (AGUZ) Hubble: von der Idee zum
25 Jahre Hubble Weltraumteleskop Seit April 24, 1990!!!!!!! Ein Vortrag von: www.aguz.ch www.aguz-beobachter.ch Peter Englmaier Astronomische Gesellschaft Urania Zürich (AGUZ) Hubble: von der Idee zum
D A S U N I V E R S U M
 D A S U N I V E R S U M Die meisten Astronomen sind der Auffassung, daß das Universum vor etwa 10 bis 20 Milliarden Jahren bei einem Ereignis entstand, das häufig als Urknall oder Urblitz bezeichnet wird.
D A S U N I V E R S U M Die meisten Astronomen sind der Auffassung, daß das Universum vor etwa 10 bis 20 Milliarden Jahren bei einem Ereignis entstand, das häufig als Urknall oder Urblitz bezeichnet wird.
Kosmogonie. Entstehung des Sonnensystems
 Kosmogonie Entstehung des Sonnensystems Sonnensystem Dr. R. Göhring r.goehring@arcor.de VII-2 Quelle: NASA/JPL Bildung der protoplanetaren Scheibe Während des Kollaps eine großen interstellaren Wolke bilden
Kosmogonie Entstehung des Sonnensystems Sonnensystem Dr. R. Göhring r.goehring@arcor.de VII-2 Quelle: NASA/JPL Bildung der protoplanetaren Scheibe Während des Kollaps eine großen interstellaren Wolke bilden
Die Entwicklung des Universums vom Urknall bis heute. Gisela Anton Erlangen, 23. Februar, 2011
 Die Entwicklung des Universums vom Urknall bis heute Gisela Anton Erlangen, 23. Februar, 2011 Inhalt des Vortrags Beschreibung des heutigen Universums Die Vergangenheit des Universums Ausblick: die Zukunft
Die Entwicklung des Universums vom Urknall bis heute Gisela Anton Erlangen, 23. Februar, 2011 Inhalt des Vortrags Beschreibung des heutigen Universums Die Vergangenheit des Universums Ausblick: die Zukunft
Astronomie und Astrophysik. Der Planet Merkur. von Andreas Schwarz
 Astronomie und Astrophysik Der Planet Merkur von Andreas Schwarz Stand: 24.04.2016 1 0.0 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...3 2. Die Rotation des Merkur und die Oberflächentemperaturen...3 3. Die Oberfläche
Astronomie und Astrophysik Der Planet Merkur von Andreas Schwarz Stand: 24.04.2016 1 0.0 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...3 2. Die Rotation des Merkur und die Oberflächentemperaturen...3 3. Die Oberfläche
T.Hebbeker T.H. V1.0. Der Tanz der Jupiter-Monde. oder. Auf den Spuren Ole Rømers
 T.H. Der Tanz der Jupiter-Monde V1.0 oder Auf den Spuren Ole Rømers Thomas Hebbeker 25.06.2012 Motivation Messung der Bahndaten der 4 Galileischen Jupitermonde Umlaufzeiten, Bahnradien Überprüfung des
T.H. Der Tanz der Jupiter-Monde V1.0 oder Auf den Spuren Ole Rømers Thomas Hebbeker 25.06.2012 Motivation Messung der Bahndaten der 4 Galileischen Jupitermonde Umlaufzeiten, Bahnradien Überprüfung des
Merkur-Transit, eine Mini-Sonnenfinsternis VS4 Stiftung Jurasternwarte - Hugo Jost 1
 Merkur-Transit, eine Mini-Sonnenfinsternis 20160311-VS4 Stiftung Jurasternwarte - Hugo Jost 1 Der Planet Merkur 20160311-VS4 Stiftung Jurasternwarte - Hugo Jost 2 Steckbrief von Merkur Sonnennächster (innerer)
Merkur-Transit, eine Mini-Sonnenfinsternis 20160311-VS4 Stiftung Jurasternwarte - Hugo Jost 1 Der Planet Merkur 20160311-VS4 Stiftung Jurasternwarte - Hugo Jost 2 Steckbrief von Merkur Sonnennächster (innerer)
Sternentstehung. Von der Molekülwolke zum T-Tauri-Stern. Von Benedict Höger
 Sternentstehung Von der Molekülwolke zum T-Tauri-Stern Von Benedict Höger Inhaltsverzeichnis 1. Unterschied zwischen Stern und Planet 2. Sternentstehung 2.1 Wo entsteht ein Stern? 2.2 Unterschied HI und
Sternentstehung Von der Molekülwolke zum T-Tauri-Stern Von Benedict Höger Inhaltsverzeichnis 1. Unterschied zwischen Stern und Planet 2. Sternentstehung 2.1 Wo entsteht ein Stern? 2.2 Unterschied HI und
Hauptbestandteile der Atmosphäre: 96% Kohlendioxid, 3,5% Stickstoff, 0,1% Sauerstoff
 Merkur: erster Planet des Sonnensystems Anzahl der bekannten Monde: 0 Äquatorneigung: 0 Grad Äquatorradius: 2.439 km Dichte: 5,4 Gramm/Kubikzentimeter Hauptbestandteile der Atmosphäre: - Masse: 0,06fache
Merkur: erster Planet des Sonnensystems Anzahl der bekannten Monde: 0 Äquatorneigung: 0 Grad Äquatorradius: 2.439 km Dichte: 5,4 Gramm/Kubikzentimeter Hauptbestandteile der Atmosphäre: - Masse: 0,06fache
Rosetta. Landung auf einem Kometen. Berndt Feuerbacher. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Köln Ruhr-Universität Bochum 1 DLR
 Rosetta Landung auf einem Kometen Berndt Feuerbacher Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Köln Ruhr-Universität Bochum 1 DLR Rosetta: eine Kometenmission Der Rosetta-Stein war der Schlüssel
Rosetta Landung auf einem Kometen Berndt Feuerbacher Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Köln Ruhr-Universität Bochum 1 DLR Rosetta: eine Kometenmission Der Rosetta-Stein war der Schlüssel
Wechselwirkung mit dem Weltraum: Sonnenwind und kosmische Strahlung
 Numerische Plasma Simulation @ TU Braunschweig Wechselwirkung mit dem Weltraum: Sonnenwind und kosmische Strahlung Uwe Motschmann Institut für Theoretische Physik, TU Braunschweig DLR Institut für Planetenforschung,
Numerische Plasma Simulation @ TU Braunschweig Wechselwirkung mit dem Weltraum: Sonnenwind und kosmische Strahlung Uwe Motschmann Institut für Theoretische Physik, TU Braunschweig DLR Institut für Planetenforschung,
Der Komet im Cocktailglas
 Der Komet im Cocktailglas Wie Astronomie unseren Alltag bestimmt Bearbeitet von Florian Freistetter 1. Auflage 2013. Buch. 224 S. Hardcover ISBN 978 3 446 43505 6 Format (B x L): 13,4 x 21,1 cm Gewicht:
Der Komet im Cocktailglas Wie Astronomie unseren Alltag bestimmt Bearbeitet von Florian Freistetter 1. Auflage 2013. Buch. 224 S. Hardcover ISBN 978 3 446 43505 6 Format (B x L): 13,4 x 21,1 cm Gewicht:
Jahresvorschau Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam & International Meteor Organization. Urania-Planetarium Potsdam, 8.
 Das Astronomische Jahr 2014 Dr. Jürgen Rendtel Jahresvorschau 2014 Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam & International Meteor Organization Urania-Planetarium Potsdam, 8. Januar 2014 Das Jahr 2014:
Das Astronomische Jahr 2014 Dr. Jürgen Rendtel Jahresvorschau 2014 Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam & International Meteor Organization Urania-Planetarium Potsdam, 8. Januar 2014 Das Jahr 2014:
Kometen, Asteroide, Meteore und Meteoriten
 Kometen, Asteroide, Meteore und Meteoriten Kleine Objekte im Sonnensystem Axel Lindner, DESY Kinder des Weltalls 1 Unser Sonnensystem Unser Sonnensystem Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun
Kometen, Asteroide, Meteore und Meteoriten Kleine Objekte im Sonnensystem Axel Lindner, DESY Kinder des Weltalls 1 Unser Sonnensystem Unser Sonnensystem Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun
Bei den Planetenwegen, die man durchwandern kann, sind die Dinge des Sonnensystems 1 Milliarde mal verkleinert dargestellt.
 Distanzen und Grössen im Planetenweg Arbeitsblatt 1 Bei den Planetenwegen, die man durchwandern kann, sind die Dinge des Sonnensystems 1 Milliarde mal verkleinert dargestellt. Anders gesagt: Der Massstab
Distanzen und Grössen im Planetenweg Arbeitsblatt 1 Bei den Planetenwegen, die man durchwandern kann, sind die Dinge des Sonnensystems 1 Milliarde mal verkleinert dargestellt. Anders gesagt: Der Massstab
Klimawandel. Schiller-Gymnasium Hof Manuel Friedrich StR. Klimawandel. Holozän - Atlantikum Manuel Friedrich -
 Holozän - Atlantikum 5 Millionen Jahre 65 Millionen Jahre Ozonloch Verschiedene Proxy-Daten Kaltzeiten Ozonloch Messmethoden Delta-18-O-Methode wie die Ausbreitung der Eismassen gemessen werden kann -
Holozän - Atlantikum 5 Millionen Jahre 65 Millionen Jahre Ozonloch Verschiedene Proxy-Daten Kaltzeiten Ozonloch Messmethoden Delta-18-O-Methode wie die Ausbreitung der Eismassen gemessen werden kann -
Raumsonde Pioneer (1)
 Raumsonde Pioneer (1) Pioneer 10 fliegt am Saturn vorbei Vor etwa 50 Jahren begann man sich fñr die äußeren Planeten zu interessieren, Ñber die man bis dahin noch nicht viel wusste und nur verschwommene
Raumsonde Pioneer (1) Pioneer 10 fliegt am Saturn vorbei Vor etwa 50 Jahren begann man sich fñr die äußeren Planeten zu interessieren, Ñber die man bis dahin noch nicht viel wusste und nur verschwommene
DER GASRIESE UNSERES SONNENSYSTEMS JUPITER
 DER GASRIESE UNSERES SONNENSYSTEMS JUPITER GLIEDERUNG 1. Allgemeine Daten und Namensherkunft 2. Entstehung und Entdeckung 3. Aufbau und Struktur 3.1. Zusammensetzung 3.2. Rotation und Bewegung um die Sonne
DER GASRIESE UNSERES SONNENSYSTEMS JUPITER GLIEDERUNG 1. Allgemeine Daten und Namensherkunft 2. Entstehung und Entdeckung 3. Aufbau und Struktur 3.1. Zusammensetzung 3.2. Rotation und Bewegung um die Sonne
Benjamin Bahr Jörg Resag Kristin Riebe. Faszinierende Physik. Ein bebilderter Streifzug vom Universum bis in die Welt der Elementarteilchen
 Benjamin Bahr Jörg Resag Kristin Riebe Faszinierende Physik Ein bebilderter Streifzug vom Universum bis in die Welt der Elementarteilchen Die Sonne und ihr Magnetfeld 5 mit dem elektrisch leitenden Plasma
Benjamin Bahr Jörg Resag Kristin Riebe Faszinierende Physik Ein bebilderter Streifzug vom Universum bis in die Welt der Elementarteilchen Die Sonne und ihr Magnetfeld 5 mit dem elektrisch leitenden Plasma
ie S onne Ersteller: Max-Koch-Sternwarte Cuxhaven (Sonnengruppe) // Aktualisiert: 08.01.2014
 Die Sonne Es gibt 100 bis 200 Milliarden Sterne in der Milchstraße. Davon ist einer die Sonne. Sie ist ein Stern von nur bescheidener Größe. Viele Sterne sind mehrere hundert Mal größer als die Sonne.
Die Sonne Es gibt 100 bis 200 Milliarden Sterne in der Milchstraße. Davon ist einer die Sonne. Sie ist ein Stern von nur bescheidener Größe. Viele Sterne sind mehrere hundert Mal größer als die Sonne.
Schwarze Löcher in Zentren von Galaxien
 Schwarze Löcher in Zentren von Galaxien Zentrales Schwarzes Loch der Milchstrasse Zusammenhang SMBH-Bulge Einführung in die extragalaktische Astronomie Prof. Peter Schneider & Dr. Patrick Simon Zentrales
Schwarze Löcher in Zentren von Galaxien Zentrales Schwarzes Loch der Milchstrasse Zusammenhang SMBH-Bulge Einführung in die extragalaktische Astronomie Prof. Peter Schneider & Dr. Patrick Simon Zentrales
Wie entstand unser Mond?
 Wie entstand unser Mond? Wie entstand unser Mond? Der Anblick unseres Mondes am Nachthimmel ist für uns Menschen ein gewohnter Anblick. Wir empfinden dabei nichts besonderes Aber war der Mond eigentlich
Wie entstand unser Mond? Wie entstand unser Mond? Der Anblick unseres Mondes am Nachthimmel ist für uns Menschen ein gewohnter Anblick. Wir empfinden dabei nichts besonderes Aber war der Mond eigentlich
Kosmische Evolution: der Ursprung unseres Universums
 Marsilius Vorlesung Heidelberg 2012 Kosmische Evolution: der Ursprung unseres Universums Simon White Max Planck Institute for Astrophysics Sternkarte des ganzen Himmels bis 10,000 Lichtjahre IR-karte
Marsilius Vorlesung Heidelberg 2012 Kosmische Evolution: der Ursprung unseres Universums Simon White Max Planck Institute for Astrophysics Sternkarte des ganzen Himmels bis 10,000 Lichtjahre IR-karte
Astronomische Beobachtungen und Weltbilder
 Astronomische Beobachtungen und Weltbilder Beobachtet man den Himmel (der Nordhalbkugel) über einen längeren Zeitraum, so lassen sich folgende Veränderungen feststellen: 1. Die Fixsterne drehen sich einmal
Astronomische Beobachtungen und Weltbilder Beobachtet man den Himmel (der Nordhalbkugel) über einen längeren Zeitraum, so lassen sich folgende Veränderungen feststellen: 1. Die Fixsterne drehen sich einmal
Perigäum und Apogäum
 Perigäum und Apogäum Perigäum: Erdnächster Punkt einer elliptischen Planetenoder Kometenbahn. Apogäum Erdfernster Punkt einer elliptischen Planetenoder Kometenbahn. Perihel und Aphel Perihel ist der Punkt
Perigäum und Apogäum Perigäum: Erdnächster Punkt einer elliptischen Planetenoder Kometenbahn. Apogäum Erdfernster Punkt einer elliptischen Planetenoder Kometenbahn. Perihel und Aphel Perihel ist der Punkt
Einführung in die Astronomie und Astrophysik I
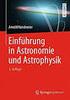 Einführung in die Astronomie und Astrophysik I Teil 5 Jochen Liske Hamburger Sternwarte jochen.liske@uni-hamburg.de Themen Einstieg: Was ist Astrophysik? Koordinatensysteme Astronomische Zeitrechnung Sonnensystem
Einführung in die Astronomie und Astrophysik I Teil 5 Jochen Liske Hamburger Sternwarte jochen.liske@uni-hamburg.de Themen Einstieg: Was ist Astrophysik? Koordinatensysteme Astronomische Zeitrechnung Sonnensystem
Jupiter und seine Monde im Vergleich zu Erde und Mond
 Jupiter und seine Monde im Vergleich zu Erde und Mond Material zum WiS Beitrag Jupiter, der Gasriese Plakate für Erde und Mond dienen zur Grundlage des Vergleichs Erde 70% der Erde ist mit Wasser bedeckt.
Jupiter und seine Monde im Vergleich zu Erde und Mond Material zum WiS Beitrag Jupiter, der Gasriese Plakate für Erde und Mond dienen zur Grundlage des Vergleichs Erde 70% der Erde ist mit Wasser bedeckt.
Doppler-Effekt und Bahngeschwindigkeit der Erde
 Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Doppler-Effekt und Bahngeschwindigkeit der Erde 1 Einleitung Nimmt man im Laufe eines Jahres
Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Doppler-Effekt und Bahngeschwindigkeit der Erde 1 Einleitung Nimmt man im Laufe eines Jahres
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Stationenlernen: Der Weltraum. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Stationenlernen: Der Weltraum Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Der Weltraum Reihe: Lernen an Stationen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Stationenlernen: Der Weltraum Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Der Weltraum Reihe: Lernen an Stationen
Kepler sche Gesetze. = GMm ; mit v = 2rπ. folgt 3. Keplersches Gesetz
 Kepler sche Gesetze 1. 3. Keplersche Gesetz (a) Wie kann man das 3. Keplersche Gesetz aus physikalischen Gesetzen ableiten? Welche vereinfachenden Annahmen werden dazu gemacht? (b) Welche Verfeinerung
Kepler sche Gesetze 1. 3. Keplersche Gesetz (a) Wie kann man das 3. Keplersche Gesetz aus physikalischen Gesetzen ableiten? Welche vereinfachenden Annahmen werden dazu gemacht? (b) Welche Verfeinerung
Unsere Sonne und die 8 großen Planeten
 Unsere Sonne und die 8 großen Planeten Die Sonne ist für uns Erdbewohner ein besonders wichtiger und interessanter (Fix-) Stern, da 1. ohne sie auf der Erde kein Leben möglich wäre, und 2. sie sich in
Unsere Sonne und die 8 großen Planeten Die Sonne ist für uns Erdbewohner ein besonders wichtiger und interessanter (Fix-) Stern, da 1. ohne sie auf der Erde kein Leben möglich wäre, und 2. sie sich in
RELATIVITÄTSTHEORIE. (Albert Einstein ) spezielle Relativitätstheorie - allgemeine Relativitätstheorie. Spezielle Relativitätstheorie
 RELATIVITÄTSTHEORIE (Albert Einstein 1879-1955) spezielle Relativitätstheorie - allgemeine Relativitätstheorie Spezielle Relativitätstheorie (Albert Einstein 1905) Zeitdilatation - Längenkontraktion =
RELATIVITÄTSTHEORIE (Albert Einstein 1879-1955) spezielle Relativitätstheorie - allgemeine Relativitätstheorie Spezielle Relativitätstheorie (Albert Einstein 1905) Zeitdilatation - Längenkontraktion =
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Der Weltraum. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: : Der Weltraum Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhalt Vorwort 4 Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: : Der Weltraum Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhalt Vorwort 4 Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kometen und Asteroiden Fallen auf die Erde
 Kometen und Asteroiden Fallen auf die Erde Agenda: 1. Planeten. Und weiter? 2. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. 3. VII: Very Important Impacts 4. Erde in Gefahr? 5. Mama, der Himmel brennt! 6. No Risk,
Kometen und Asteroiden Fallen auf die Erde Agenda: 1. Planeten. Und weiter? 2. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. 3. VII: Very Important Impacts 4. Erde in Gefahr? 5. Mama, der Himmel brennt! 6. No Risk,
Entstehung des Sonnensystems. Von Thorsten Seehaus Einführung in die Astrophysik Universtät Würzburg
 Entstehung des Von Thorsten Seehaus Einführung in die Astrophysik Universtät Würzburg 20.11.2007 Gliederung Daten des Theorie der Entstehung des Bildung der Planeten Entstehung des Mondes Das Sonnensystem
Entstehung des Von Thorsten Seehaus Einführung in die Astrophysik Universtät Würzburg 20.11.2007 Gliederung Daten des Theorie der Entstehung des Bildung der Planeten Entstehung des Mondes Das Sonnensystem
Urknall und. Entwicklung des Universums. Grundlegende Beobachtungen Das Big-Bang Modell Die Entwicklung des Universums 1.1
 Urknall und Entwicklung des Universums Thomas Hebbeker RWTH Aachen Dies Academicus 08.06.2005 Grundlegende Beobachtungen Das Big-Bang Modell Die Entwicklung des Universums 1.1 Blick ins Universum: Sterne
Urknall und Entwicklung des Universums Thomas Hebbeker RWTH Aachen Dies Academicus 08.06.2005 Grundlegende Beobachtungen Das Big-Bang Modell Die Entwicklung des Universums 1.1 Blick ins Universum: Sterne
Terra 2.0 Was macht einen Planeten eigentlich bewohnbar?
 Terra 2.0 Was macht einen Planeten eigentlich bewohnbar? Markus Röllig I. Physikalisches Institut, Universität zu Köln Saeger, 2013, Science, 340, 577 Motivation Bekannte Exoplaneten (Stand März 2013)
Terra 2.0 Was macht einen Planeten eigentlich bewohnbar? Markus Röllig I. Physikalisches Institut, Universität zu Köln Saeger, 2013, Science, 340, 577 Motivation Bekannte Exoplaneten (Stand März 2013)
