Für die inhaltliche und konzeptionelle Unterstützung bei der Gestaltung des Naturerlebnisweges Westerkappeln bedanken wir uns bei:
|
|
|
- Martin Otto
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 1
2 Für die inhaltliche und konzeptionelle Unterstützung bei der Gestaltung des Naturerlebnisweges Westerkappeln bedanken wir uns bei: Dagmar Völlmann Gudrun Schemme (Ortslandwirtin) Dieter Hehemann (Die Petrijünger e.v.) Elmar Woelm (Forstamt Steinfurt) Erich Avermann Friedhelm Scheel (Landschaftswart) Horst Meyer (Gästeführer) Wolfgang Teepe (Hegering) Naturschutzgruppe im Kultur- und Heimatverein/ ANTL Ortsgruppe Westerkappeln Herausgeber WeSpE e.v. Schulstr Westerkappeln Tel.: Inhalt und Layout Astrid Pflüger-Ott, WeSpE-Kinderbüro Friedhelm Wilbrand, Gemeinde Westerkappeln Druck Jugendamt Kreis Steinfurt 3. Auflage Januar 2012 Schutzgebühr 3,00 1
3 Lieber Naturfreund, bist du schon einmal der EULE, dem Logo des NATURERLEBNISWEGES WESTERKAPPELN, gefolgt? Gib dir doch einfach mal wieder einen Ruck und wandere los! Los geht s im Schulzentrum an der Grundschule und die Eule wird dir den Weg weisen. Auf einem Rundweg von 6,5 km Länge wirst du an 12 Stationen einen Einblick in die Lebensräume, die Nutzungsformen und die Vielfalt von Flora und Fauna in der nahen Umgebung von Westerkappeln bekommen und einiges zum Thema Natur erfahren und erleben. Diese BROSCHÜRE kann dir dabei ein hilfreicher Begleiter sein. Du erhältst zusätzliche Informationen und dazu viele Hinweise zum Entdecken, Erleben, Spielen, Beobachten, Experimentieren, Basteln und Werken Wir wünschen viel Freude auf dem Weg! 1
4 Inhalt Seite Grußwort... 1 Station 1 Insektennisthilfen... 3 Station 2 Bullerteichgraben... 6 Station 3 Landwirtschaftl. Flächennutzung Station 4 Streuobstwiese und Steinkauz Station 5 Tecklenburger Nordbahn Station 6 Königsteichgraben Station 7 Regenrückhaltebecken Station 8 Kläranlage Westerkappeln Station 9 NSG Düsterdieker Niederung Station 10 Kopfweiden Station 11 Mischwald und Sloopsteene Station 12 Präriesee Literaturverzeichnis
5 Station 1 Insektennisthilfen Insekten erfüllen wichtige Aufgaben im Ökosystem wie die Bestäubung von Pflanzen, Zerkleinerung abgestorbener Pflanzenteile und Jagd auf andere, oft als Schädlinge bezeichnete Tiere. So fressen zum Beispiel Marienkäfer und ihre Larven Blattläuse. Ein erwachsener Marienkäfer frisst durchschnittlich 150 Blattläuse am Tag und seine Larve in ihrer mehrwöchigen Entwicklungsphase bis zu 800 Blattläuse insgesamt. Übrigens Der Marienkäfer wurde zum Insekt des Jahres 2006 ernannt. Auch Wildbienen und Wespen haben sehr wichtige Funktionen im Naturhaushalt. Wildbienen sind unverzichtbare Bestäuber der meisten Pflanzen. Viele Wespen sind unermüdliche Insektenjäger, die Unmengen an Raupen oder Blattläusen jagen, um damit ihre Nachkommenschaft zu versorgen. Insekten haben unterschiedlichste Ansprüche und Bedürfnisse. Um viele verschiedene Tiere in einen Garten zu locken, müssen Nahrung sowie Rückzugs-, Nist-, und Überwinterungsplätze angeboten werden. Gerne angenommen werden Wildgehölzhecken, Totholz, Steinhaufen und -mauern, Feuchtbiotope und Wiesen. In strukturreichen, naturnahen Gärten mit vielen einheimischen Blütenpflanzen und Stäuchern werden Insekten immer Platz finden. In Gärten und an Häusern, wo solche Unterschlupfmöglichkeiten fehlen oder aus Platzgründen nicht möglich sind, kann man den Nützlingen durch Nisthilfen und Nützlingshäuser Unterschlupf bieten. 3
6 Insektennisthölzer, die ganz leicht selbst zu basteln sind, ersetzen hohle Baumstämme, Totholzhaufen und Trockensteinmauern. Ein Nützlingshaus oder "Insektenhotel" bietet Unterschlupf und Brutplätze für verschiedenste Insekten wie Wildbienen, Florfliegen, Ohrwürmer oder Laufkäfer. Unter einem Holzdach werden verschiedene Naturmaterialien wie Totholzbündel, Pflanzenstängel, Tonziegel oder unbehandelte Hartholzstücke (Holzblöcke, - äste oder scheiben von Eiche, Buche oder Esche) mit Löchern montiert und im Idealfall südseitig an einer regen- und windgeschützten Mauer aufgestellt. Übrigens Wer diesen Insekten hilft, muss keine Stechattacken befürchten. Die Tiere sind harmlos und friedlich, selbst in Terrassennähe angebrachte Nistkästen, Holunder- oder Schilfbündel stellen keine Gefahr dar. Im Gegenteil: In Ruhe kann man das Treiben beobachten, wenn die Bienen Baumaterial, Nahrung und Lehm zum Verschluss ihrer Brutröhren eintragen. Ohrwürmer Ohrwürmer sind ebenfalls wichtige Helfer im Garten, da sie eifrig auf Jagd nach Blattläusen, Spinnmilben und Insekteneiern gehen. Sie werden erst in der Dämmerung aktiv. Tagsüber schlafen sie und damit sie es richtig gemütlich haben, können wir ihnen ein Häuschen bauen und es an einem Baum mit Kontakt zum Stamm aufhängen. Darin bilden die Ohrwürmer große Schlafgesellschaften. Das Hineinlaufen in das Ohrwurmhäuschen vom Ast aus muss ganz leicht sein, denn Ohrwürmer können zwar fliegen, tun es aber nur sehr selten. Übrigens Die Tiere mit den langen, gebogenen Zangen sind die Männchen, die mit den kurzen, geraden Zangen die Weibchen. 4
7 und baue ein Ohrwurmhäuschen! Du benötigst einen Blumentopf, etwas Holzwolle oder Stroh, Bindfaden und einen kleinen Stock. Binde ein Ende des Fadens an dem Stock fest und fädele das andere Ende von innen durch das Loch im Boden des Blumentopfes. Mit der Holzwolle oder dem Stroh stopfst du den Topf um die Schnur herum aus. Dann ziehst du die Schnur stramm, so dass der Stock quer über dem Topfrand liegt. Bevor du den Topf aufhängst, lasse ihn einige Tage auf der Erde stehen, damit sich die Ohrwürmer darin sammeln können. Dann hänge den Topf kopfüber an einem Baumstamm auf. Wichtig dabei ist, dass der Topf Kontakt zum Holz hat damit die Ohrwürmer auch zwischen Häuschen und Baum wandern können. Spiel: Ohrwurm und Blattlaus Dieses Spiel macht auf eine verblüffende Art und Weise klar, wie Jäger und Gejagte, Räuber und Beute voneinander abhängig sind. Man braucht unbedingt ein festumrissenes Spielfeld Teilnehmer können gleichzeitig spielen. Es stellen sich alle mit verbundenen oder geschlossenen Augen in diesen Raum. Es werden 3 Teilnehmer zu Ohrwürmern und die anderen zu Blattläusen bestimmt. Nun gehen alle langsam und vorsichtig umher. Wenn jemand auf einen Mitspieler trifft, so sage ihm, ob du Ohrwurm oder Blattlaus bist. Je nach Konstellation des Zusammentreffens gelten folgende Regeln: 1. Trifft Blattlaus auf Blattlaus, bleiben beide Blattlaus. 2. Trifft Ohrwurm auf Blattlaus, wird auch die Blattlaus zum Ohrwurm. Der Ohrwurm bleibt Ohrwurm. 3. Trifft Ohrwurm auf Ohrwurm, verwandeln sich beide Ohrwürmer in Blattläuse. Wenn nun das Spiel von Zeit zu Zeit unterbrochen wird, kann man feststellen, dass die Zahl der Ohrwürmer und Blattläuse zwar schwankt, die Blattläuse aber nicht ausgerottet werden, es sei denn, die Zahl der Mitspieler ist zu gering. Meistens werden die Gejagten in der Überzahl sein. 5
8 Station 2 Bullerteichgraben Der Bullerteichgraben hat seine Quelle im Bullerteich auf dem Freibadgelände. Er führt unterirdisch bis zum Hanfriedenstadion und nimmt auf dem Weg schon Regenwasser aus dem Regenkanal auf. Ein Bach ist er erst ab dem Punkt, an dem er das Sonnenlicht erblickt. Denn Bachbett, Ufer mit Bäumen und Sträuchern sowie die Tiere im und am Wasser gehören zu einem Bach dazu. Hier am Fußweg wurde aus dem ehemals begradigten Wiesenbach ein Bach mit naturnah bepflanzten Ufern. Zwischen der Stoliner Straße und der Königsberger Straße wurde parallel zur Bebauung im Jahr 2003 der gerade Wiesenbach mit dem Bagger deutlich aufgeweitet und einseitig bepflanzt. Nun haben Gehölze und Uferrandpflanzen eine Chance zu wachsen und zu blühen. In der Strauchschicht fallen besonders die Weißdorn- und die Schneeballsträucher mit ihren Blüten und Früchten auf. Weißdorn Schwarzerlen haben sich von alleine angesiedelt. Sie wurzeln auch in das Wasser hinein und können das Ufer mit ihren Wurzeln vor Erosion durch Flutwellen schützen (siehe hierzu auch S. 21, Merkmale der Erle). Am Ufer sieht man im Sommer die blutroten Blüten des Blutweiderichs, das weißlich- gelbe, stark duftende Mädesüß und die gelben Blüten der Sumpfiris. Blutweiderich 6
9 Übrigens hättest du gedacht, dass das Wasser des Bullerteichgrabens im Rückhaltebecken Sandstraße/Ecke Königsteichstraße gesammelt wird und dann über die Düsterdieker Aa / Hauptgraben letztendlich in die Ems fließt? Bäume und Büsche am Bachufer sehr wichtig sind? Sie spenden Schatten und verbessern die Sauerstoffsituation des Wassers. Außerdem halten sie das Ufer fest (Erlen und Weiden) und sichern es gegen Abschwemmungen. der Eisvogel regelmäßig auf dem Nahrungsflug am Bullerteichgraben zu sehen ist? durch die Begradigung der Bachläufe und Schadstoffeinträge der Flusskrebs, der Eisvogel und mehr als die Hälfe aller im Bach lebenden Tierarten vom Aussterben bedroht sind? die erwachsene Prachtlibelle (dunkelblau-schimmernd) nur wenige Wochen lebt und es in dieser Zeit zur Paarung und Eiablage kommen muss? und erkunde die Wassertiere! Die Gewässergüte eines Gewässers lässt sich auch ohne aufwendige chemische Untersuchungen anhand der darin vorkommenden Kleinlebewesen bestimmen. Zu diesen Kleinlebewesen gehören beispielsweise Insekten wie Flohkrebse und Wasserasseln, Würmer wie Schlammröhren- und Strudelwürmer sowie Weichtiere wie Schnecken und Muscheln. Die Methode beruht darauf, dass bestimmte Tiere eine bestimmte Belastung des Gewässers mit toter organischer Substanz (fäulnisfähige Stoffe) anzeigen. Um diese kleinen Lebewesen im Wasser zu erkunden, brauchst du einen Kescher oder ein Küchensieb, eine Handlupe oder Becherlupe, feine Haarpinsel sowie ein flache, weiße Schale. Um einen besseren Einblick in die Unterwasserwelt zu bekommen, eignet sich auch ein Wasserbeobachtungsrohr. Wie du einen Kescher und ein Wasserbeobachtungsrohr selbst bauen kannst, zeigen dir folgende Bauanleitungen: 7
10 Kescher: Du brauchst einen 1,5-2m langen Bambusstab, Drahtkleiderbügel, Draht, Kneifzange, Nähnadel sowie Faden und Gardinenstoff. Aus dem Drahtkleiderbügel wird ein Ring von etwa 20cm Durchmesser geformt. Um den Ring zu verfestigen, werden die Drahtenden an der Kreuzungsstelle mit der Kneifzange fest verdreht. Die überstehenden, etwa 10cm langen Enden werden mit der Zange leicht miteinander verdreht, an das dünnere Ende des Bambusstabs angelegt und mit zwei Drähten fest daran befestigt. Für das Fangnetz wird ein etwa 70x30cm großes Stück Gardinenstoff benötigt. Eine Hälfte legst du auf die andere und nähst zwei Seiten zu, so dass ein Beutel entsteht. Die Beutelränder werden von außen um den Drahtring herumgeschlagen, so dass sie etwa 3cm überstehen. Nun werden die übereinander liegenden Stoffe miteinander vernäht. Wasserbeobachtungsrohr: Du brauchst größere Konservendosen, Dosenöffner, Klebeband, Klarsichtfolie und ein Gummiband. Von einer größeren Konservendose entfernst du mit einem Dosenöffner sorgfältig Boden und Deckel. Scharfe Kanten kannst du mit einem Klebeband abkleben. Über eine der Öffnungen legst du dann ein Stück Klarsichtfolie, das an den Seiten mindestens fünf Zentimeter überstehen sollte. Die Überstände werden umgeschlagen und mit einem Gummiband fest gemacht. Das Beobachtungsrohr kann nun vorsichtig ins Wasser gedrückt werden. Dabei sollte allerdings kein Wasser von oben hineinlaufen. Nun kannst du einen Blick in die Unterwasserwelt werfen. Sie wird durch das Beobachtungsrohr sogar vergrößert, weil sich die Folie durch den Wasserdruck nach innen wölbt. Beim Keschern solltest du darauf achten, dass du immer ein Gefäß mit Wasser gefüllt hast, damit die gefangenen Tiere wieder sofort in Kontakt mit Wasser kommen du den Kescher vorsichtig in das Wasser tauchst und durch das Wasser ziehst du den Kescher behutsam an Pflanzenstengeln entlang streift du die Tiere von der Unterseite von Steinen vorsichtig mit dem Pinsel ablöst die gefundenen Tiere durch Umstülpen des Keschers oder mit dem Pinsel in die mit Wasser gefüllten Gefäße gesetzt werden bei warmen Temperaturen die Gefäße nicht in der Sonne stehen gelassen werden du den Kescher nach dem Fang gründlich im Wasser ausspülst du nach der Betrachtung die Tiere wieder in das Gewässer zurücksetzt. Dabei die Gefäße nicht einfach ausschütten, sondern langsam ins Wasser tauchen und umstülpen. 8
11 Bestimmen der Gewässergüte Wenn du die gefangenen Kleinlebewesen mit einer Lupe betrachtest, findest du sie vielleicht in der folgenden Tabelle wieder. Dabei gibt es sogenannte Leitarten, durch die man die Wasserqualität sehr schnell grob einschätzen kann. Güteklasse 1 (unbelastet bis sehr gering belastet): Reines, stets annähernd sauerstoffgesättigtes Wasser, nährstoffarm, geringer Bakteriengehalt, mäßig dicht besiedelt. Güteklasse 2 (mäßig belastet): Mäßige Verunreinigung und noch gute Sauerstoffversorgung. Sehr große Artenvielfalt und Individuendichte: Algen, Schnecken, Kleinkrebse, Insektenlarven, insbesondere große Flächen mit Wasserpflanzen. Gewässer der Güteklasse 2 sind ertragreiche Fischgewässer. Güteklasse 3 (stark verschmutzt): Starke organische, sauerstoffzehrende Verschmutzung und dadurch meist niedriger Sauerstoffgehalt. Gewässer mit Güteklasse 3 bringen nur geringe Fischereierträge. Güteklasse 4 (übermäßig verschmutzt): Übermäßige Verschmutzung durch organische, sauerstoffzehrende Abwässer, Fäulnisprozesse sind vorherrschend. Sauerstoff ist über lange Zeiten nur in sehr niedrigen Konzentrationen oder gar nicht vorhanden. 9
12 Station 3 Landwirtschaftliche Flächennutzung Grünlandnutzung Grünland ist der Fachbegriff für landwirtschaftlich genutzte Flächen, auf denen Gras als Dauerkultur angebaut wird. Schaut man näher hin, so erkennt man, dass es eine Mischung vieler unterschiedlicher Gräser mit einigen Kleeund Kräuterarten ist. Der Fachmann erkennt an der Artenzusammensetzung, ob der Standort trocken oder feucht, gut gedüngt oder nährstoffarm, moorigsauer oder kalkhaltig ist. Hier haben wir eine durchschnittliche Viehweide mit mittlerer Nährstoffversorgung und mittlerer Wasserversorgung. Das oder der Hektar ist eine Maßeinheit der Fläche, die vor allem in der Land- und Forstwirtschaft verbreitet ist. Der Name Hektar besteht aus der verkürzten griechischen Vorsilbe Hekto für 100 und der Einheit Ar. Ein Hektar entspricht also 100 Ar oder einem Quadrathektometer. Ein Quadrat mit diesem Flächeninhalt hat eine Kantenlänge von 100 Metern. 1 ha = 100 a = 1 hqm = qm Damit entspricht ein Hektar der Fläche von 1,4 Fußballplätzen. Zum Vergleich: Ein durchschnittliches Baugrundstück hat rund 500 qm, ein Kinderzimmer oft nur 12 qm Fläche. Steckbrief Grünland Pflanzen Verwendung Standortansprüche Pflegemaßnahmen Ernte Größe der Fläche Gräser, Kleearten, Kräuter, Binsen Viehfutter in Form von Heu, Silage oder direkter Beweidung bzw. als Frischfutter Reichliche Wasserversorgung, der Nutzung angepasste Düngung, sehr anpassungsfähig Düngen, Walzen, Abschleppen, Pflegeschnitte, ggfls. Unkrautbekämpfung oder Nachsaat 5 bis 14 t Trockenmasse je ha und Jahr verteilt auf mehrere Mahdtermine oder Beweidungen. Der Ertrag reicht als Grünfutter für 2-3 Kühe für ein Jahr Die Weide nördlich der Straße ist 0,38 ha groß 10
13 Übrigens: Eine Milchkuh (18 Liter pro Tag) versorgt im Schnitt 21 Bürger mit: 18 Liter Trinkmilch oder 3,5 Päckchen Butter oder 2,2 Kilo Käse oder 19 Kilo Joghurt. Ackerbau am Beispiel Mais Die höher gelegenen Flächen wie auf dem Osterbecker Esch wurden seit Jahrhunderten ackerbaulich genutzt. Durch Drainagen konnte man auch die tiefer gelegenen Flächen so weit entwässern, dass Ackerbau möglich ist. So ist hier südwestlich der Sandstraße aus ehemaligem Grünland ein großer Ackerschlag auf Sandboden entstanden. Dort wird regelmäßig Getreide (Tritikale, Gerste), Zuckerrüben oder Mais angebaut. Da in unserem Klima Gemüsemais nicht sicher reif wird, handelt es sich bei dem hier angebauten Mais ausschließlich um Silomais oder Körnermais. Während bei Körnermais nur die Kolben geerntet werden, wird bei Silomais die ganze Pflanze zerkleinert und einsiliert, um als Futter für Schweine oder Rinder zu dienen. Steckbrief Mais Pflanzenart und Herkunft Verwendung Standortansprüche Pflegemaßnahmen Ernte Größe der Fläche Mais ist eine Grasart und stammt aus Mittelamerika Viehfutter in Form von Körnermais oder Silage der ganzen Pflanze. Mais für den menschlichen Verzehr (Zuckermais) benötigt höhere Temperaturen als die in Nordwestdeutschland üblichen Reichliche Wasserversorgung im Juli und August, hohe Temperaturen Schutz vor Unkraut (mechanisch oder chemisch), ein- oder zweimalige Düngung 15 t Trockenmasse je ha und Jahr reicht als Kraftfutter für 4 Kühe für ein Jahr Das Feld südlich der Straße ist 6 ha groß 11
14 Übrigens: Die Silage von einem Hektar Mais reicht aus, um den Jahresgrundfutterbedarf von 3 4 Kühen bereitzustellen. Dabei wird ca kg Milch erzeugt. Mit dem Mais von einem Hektar kann in einer Biogasanlage rechnerisch der Jahresstrombedarf für 5 Haushalte produziert werden. Zusätzlich wird in der Biogasanlage noch Wärme erzeugt, die für die Raumheizung genutzt werden kann. Leckereien aus Milch Joghurt Kaufe Joghurt ohne Frucht und mit lebenden Kulturen. Verrühre 3 Esslöffel davon in einem Liter 40 C warmer Milch. Heize deinen Backofen auf 50 C vor. Stelle die mit Joghurt geimpfte Milch in einer Schale oder in einem Glas in den Ofen und stelle ihn nach 15 min ab. Lass die Ofentür zu und nehme den Joghurt erst nach 5 bis 12 Stunden heraus. Je länger der Joghurt reift, desto mehr Milchsäurebakterien werden gebildet und desto ausgeprägter ist sein Geschmack. Quark Gebe 1 Liter Milch (1,5% Fett) in eine Schüssel und impfe sie mit 60ml Dickmilch. Verschließe die Schüssel und lasse sie bei Zimmertemperatur zwei Tage stehen. Erwärme die saure dicke Milch für eine Stunde auf 35 C. Das kannst du auf einer vorgewärmten, ausgeschalteten Herdplatte machen oder in einem auf 50 C vorgeheizten, abgestellten Backofen. Spüle mit kaltem Wasser ein Baumwolltuch aus, wringe es aus und breite es über einem Sieb aus. Das Sieb stellst du auf einen Topf. Inzwischen hat sich die Molke vom Quark getrennt. Schöpfe das ganze ins Tuch und hänge es über dem Topf auf. Nach etwa 2 Stunden ist genug Molke herausgetropft. Wenn der Quark zu bröselig geworden ist, kannst du ihn mit Sahne verrühren. Die Molke ist sehr wertvoll. Falls du sie nicht trinken magst, verwende sie z.b. zum Brotbacken. Sie hält sich im Kühlschrank eine Woche. 12
15 Station 4 Streuobstwiese und Steinkauz Der Anbau von Obst lässt sich zurückverfolgen bis in die Zeit der Römer. Streuobstwiesen mit ihren hochstämmigen Obstbäumen sind die traditionelle Form des Obstanbaus. Sie liegen wie hier oft direkt am Haus oder an den Dorfrändern. Besonders durch ihre Blütenpracht, durch den leuchtenden Fruchtbehang und ihre oftmals knorrigen Kronen tragen sie zur Bereicherung der Landschaft bei. Die Anzahl der Obstsorten ist in den letzten 100 Jahren deutlich zurückgegangen. Gab es um die Jahrhundertwende noch an die tausend Apfelsorten, beschränkt sich das Marktangebot heute auf wenige Apfelsorten. So sind Streuobstwiesen auch unter dem Gesichtspunkt der Erhaltung genetischer Vielfalt von großer Bedeutung. Im Tecklenburger Land findet man noch alte Bäume aus regionalen Obstsorten wie z.b. den Haferapfel, den doppelten Haferapfel, den westfälischen Gülderling oder die Pfundbirne. Übrigens Hast du vielleicht einen Obstbaum im Garten, deren Sorte du gerne wissen möchtest? Dann lass dir doch die Sorte von einem Fachmann, einem sogenannten Pomologen, bestimmen. Ein kompetenter Ansprechpartner ist die Baumschule Fels aus Westerkappeln, die ihren Schwerpunkt bei Obstgehölzen setzt. Am häufigsten sieht man Äpfel, aber es werden auch Birnen, Pflaumen, Zwetschgen, Süß- und Sauerkirschen sowie Walnüsse angepflanzt. Wer Äpfel am liebsten in flüssiger Form mag kann Tecklenburger Streuobstwiesenapfelsaft der ANTL kaufen. Hier werden ausschließlich Äpfel von Streuobstwiesen aus dem Tecklenburger Land vermostet und vermarktet. In den 70 er Jahre sind viele Obstbäume aufgrund einer EG- Verordnung gerodet worden. Im Tecklenburger Land sind uns zum Glück noch viele Obstwiesen erhalten geblieben. Ab den 80er Jahre wurde der Streuobstanbau wieder gefördert. Besonders durch die öffentlich geförderten Pflanzaktionen wurden wieder viele Obstwiesen angelegt. 13
16 Alte Obstbäume auf Obstwiesen beherbergen eine vielfältige Tierwelt. Sie sind oft das letzte Rückzugsgebiet für gefährdete Vogelarten. Auch für zahlreiche Säugetiere sind Obstwiesen wertvolle Biotope. Du kannst sie auf diesem Bild sehen, viele davon wirst du bei uns in Westerkappeln finden. 1) Steinkauz, 2) Neuntöter, 3) Wiedehopf, 4) Distelfink, 5) Grün- und Grauspecht, 6) Buntspecht, 7) Kleiber,8) Gartenbaumläufer, 9) Gartenrotschwanz, 10) Fledermaus, 11) Siebenschläfer, 12) Gartenschläfer, 13) Wiesel oder Hermelin 14) Mauswiesel, 15) Igel. Auch viele Insekten wie Schmetterlinge, Käfer, Wildbienen und Milben leben von und auf den Obstbäumen. Wird wie hier an der Sandstraße die Fläche beweidet, ist die Insektenvielfalt noch höher. Davon profitiert auch der Steinkauz, der in beiden Obstbeständen die künstlichen Nisthilfen als Ruhe- oder Nistmöglichkeit nutzt. Die Weidetiere nutzen im Sommer gerne den Schatten der ausladenden Baumkronen. 14
17 Die Eigentümer freuen sich über die Obsternte. Allerdings benötigt ein Obstbaum in den ersten Jahren einige Erziehungsschnitte und später alle paar Jahre einen Pflegeschnitt, wenn man Wert auf einen hohen Obstertrag und qualitativ hochwertige Früchte legt. Lässt man die Bäume ohne Schnitt wachsen erhält man sehr ausladende hohe Baumkronen mit im Laufe der Jahre immer dichter werdenden Kronen. Diese bringen nur noch kleine und oftmals beschädigte Früchte hervor und sind zudem sturmgefährdet. Auch in Fragen des Obstgehölzschnittes ist die Baumschule Fels in Westerkappeln ein sehr kompetenter Ansprechpartner. Über Schleiereule und Steinkauz Eulen besitzen eine sehr typische Gestalt. Als auf die nächtliche Jagd spezialisierte Vögel unterscheiden sich Eulen von anderen Vögeln durch spezifische anatomische Merkmale. Der Körper ist gedrungen und der Kopf, im Vergleich zu dem anderer Vögel, auffällig groß und rundlich. Der Schnabel der Eulen ist stark gekrümmt und mit scharfen Kanten ausgestattet. Die Augen der Eulen sind starr nach vorne gerichtet. Die Augen selbst sind unbeweglich, stattdessen können die Tiere ihren Kopf bis zu 270 drehen, wodurch das Gesichtsfeld stark erweitert wird. Da sie außerdem die Augenlider wie wir Menschen von oben nach unten über den Augapfel ziehen können, erscheint uns ihr Gesicht sehr menschlich. Weltweit gibt es 130 verschiedene Eulenarten. Auf dem europäischen Kontinent sind 13 Arten beheimatet. In unserer Region finden wir neben dem Waldkauz Schleiereulen und Steinkäuze. Der Steinkauz, unsere kleinste heimische Eule, ist auch tagsüber, vor allem aber in der Dämmerung aktiv. Ungefähr dreiviertel des deutschen Steinkauzbestandes ist in NRW zuhause, davon viele im Kreis Steinfurt. Der Steinkauz benötigt ein reichhaltiges Angebot an Bruthöhlen, Tagesverstecken und Sitzwarten. Da natürliche Baumhöhlen in Obsthochstämmen oder in Kopfbäumen nicht ausreichend zur Verfügung stehen, werden ihm heute zunehmend künstliche Niströhren angeboten. Dank der 15
18 Installation von Brutröhren durch ehrenamtliche Naturschützer und Landwirte konnte in den vergangenen Jahrzehnten der Bestand in unserer Region stabilisiert werden. In den Obstwiesen an der Sandstraße kann man die Niströhren auch ohne Fernglas gut erkennen. Der Steinkauz brütet von April bis Juni und legt im Durchschnitt 3 bis 5 Eier. Neben den Brutmöglichkeiten benötigt der Steinkauz auch geeignete Jagdmöglichkeiten. Da er die Bodenjagd bevorzugt, benötigt er Stellen mit kurzer Vegetation wie sie idealerweise auf beweideten Grünlandflächen zu finden sind. Zur Ansitzjagd sind Sitzwarten wie Erdhügel, Koppelpfähle, oder niedrige Leitungsmasten erforderlich. Hier ist er in der Dämmerung häufig zu sehen. Der Steinkauz frisst neben Mäusen insbesondere während der Eiablage und der Jungenaufzucht auch wirbellose Beutetiere wie Insekten und Regenwürmer. Die Schleiereule ernährt sich hingegen überwiegend von Kleinsäugern, die sie bevorzugt aus dem Flug heraus schlägt. Diese große Eule mit dem weißen Gesicht ist als Kulturfolger ebenfalls auf den Menschen angewiesen. Sie brütet vorwiegend in Kirchen, Häusern und Schuppen. Gerne nimmt sie künstliche Nistkästen an, die hinter dem Eulenloch in der Fassade angebracht sind. Der Bruterfolg der Schleiereule ist sehr vom Nahrungsangebot abhängig. Auch über Winter können lange Frostperioden mit hohem Schnee dazu führen, dass viele Schleiereulen verhungern. Im Gegensatz zum Steinkauz hat die Schleiereule weltweit ein sehr großes Verbreitungsgebiet in dem sie in vielen Unterarten vorkommt. Die Schleiereule ist im Tecklenburger Land ebenfalls durchaus noch häufig. Man bekommt sie aufgrund ihrer nächtlichen Lebensweise aber nur selten zu Gesicht. Tagsüber sitzt sie auf einem geschützten und versteckten Ruheplatz gerne in einer alten Scheune oder einem hohem Baum. Viele Hausbesitzer freuen sich wenn ihre Schleiereulen wieder erfolgreich viele Jungvögel aufgezogen haben. und wirf einen Blick durch die Guckröhren an Station 4. Du wirst entdecken, wo sich Schleiereule und Steinkauz in dieser Umgebung verstecken. 16
19 und öffne deine Augen! Streuobstwiesen haben im Laufe des Jahres viele verschiedene schöne Kleider. Das Frühlingskleid ist noch recht schlicht und bunt mit Gänseblümchen, Primeln oder Scharbockskraut. Wenig später, wenn der Löwenzahn blüht, erscheint sie in einem knallgelben Kleid. Danach siehst du sie ganz in weiß. Später trägt sie oft wieder ein gelbes Kleid, dann blüht der Hahnenfuß. Es blühen noch eine Menge anderer Wiesenpflanzen. Einige davon schmecken gut im Salat oder in der Suppe. Die Obstbäume auf der Wiese blühen der Reihe nach. Zuerst die Kirsche, dann die Pflaume und die Birne. Äpfel mögen es am wärmsten, wenn sie blühen, ist Vollfrühling. Wenn es warm ist, schwirrt, summt und brummt es auf der Wiese. Nun kannst du Bienen, Hummeln, Käfer und schöne bunte Schmetterlinge beobachten. Sie alle finden hier reichlich Nahrung. Nimm auf deine Wanderung ein handliches Bestimmungsbuch mit, schau nach, ob du einige Vögel, Wiesenpflanzen oder Schmetterlinge entdecken und bestimmen kannst. Kennst du fünf Vögel oder Schmetterlinge mit Namen? Kannst du sie beschreiben oder malen? Wie viele Wiesenpflanzen kennst du mit Namen? Schau in einem Rezeptbuch nach, über Wiesenpflanzen gibt es einfache und leckere Rezepte! (z.b. Brennnesselsuppe, Brennnesselpfannkuchen, Gierschgemüse, Gänseblümchen oder junger Löwenzahn als vitaminreiche Salatbeilage) Suche die Wiese vom Frühjahr bis zum Spätsommer häufiger auf, kannst du Veränderungen bemerken? Du kannst dein eigenes Pflanzenbestimmungsbuch anlegen, in das du gepresste Pflanzen klebst. Wer findet die meisten Wörter mit dem Wortstamm Apfel? 17
20 Leckeres von der Streuobstwiese Apfelblütenschaum Du brauchst: 1 Apfel, eine Hand voll Apfelblüten, 2 Teelöffel Zitronensaft drei Teelöffel Honig, 1/4 l Schlagsahne, Puderzucker So wird es gemacht: Raspele den Apfel mit Schale in eine Schüssel, den Zitronensaft unterrühren, damit der Apfel nicht braun wird. Sahne steif schlagen und vorsichtig unter den Apfelbrei mischen. Zum Süßen Honig einrühren. Die frisch gepflückten Apfelblüten kurz abspülen und zusammen mit etwas Puderzucker über den süßen Schaum streuen. Brombeer-Apfeltasche Du brauchst: 1 Apfel, reife Brombeeren, Puderzucker So wird es gemacht: Mit dem Apfelausstecher das Kerngehäuse entfernen. Brombeeren in Puderzucker wälzen, in die Apfelfüllung stecken. Den Apfel bei 190 Grad etwa 30 Minuten im Backofen überbacken. Statt Brombeeren kannst du auch Preiselbeeren aus dem Glas nehmen. Apfelringe Äpfel schälen, Kerngehäuse ausstechen. Äpfel in dünne Scheiben schneiden, auf Backblech auslegen und im Backrohr bei niedrigster Wärme leicht antrocknen. Danach die Apfelscheiben einzeln auffädeln und an der Luft (nicht in der Sonne!) zum Trocknen aufhängen. Spiel: Hören wie eine Eule Die Eulen sind nächtliche Jäger, die nach dem Gehör jagen. Auch bei diesem Spiel müsst ihr euch als Eulen ganz auf euer Gehör konzentrieren. Die Gruppe teilt sich in Eulen und Mäuse, wobei auf acht Eulen ungefähr eine Maus kommt. Die Eulen bilden einen Kreis und verbinden sich gegenseitig die Augen. Jede Eule hält dabei eine Armlänge Abstand zu seinem Nachbarn, so dass sich nur die ausgestreckten Hände berühren können. Von außen schleichen sich ein bis vier Mäuse in den Kreis, so leise, dass sie dabei nicht gehört werden! Meint eine Eule eine Maus zu hören, ergreift sie die Hand der neben ihr stehenden Eule und schließt den Durchgang in den Kreis - die Maus muss es an einer anderen Stelle probieren. 18
21 Station 5 Tecklenburger Nordbahn 1904 wurde die Tecklenburger Nordbahn ( T.N.B. ) zunächst als Schmalspurbahn (1000 mm) "Kleinbahn Piesberg - Rheine" gebaut. Auf einer Gesamtlänge von ca. 53km zweigt sie im Bahnhof Osnabrück- Eversburg von der Strecke der Oldenburger Südbahn ab und führt über Wersen, Westerkappeln, Mettingen und Recke weiter nach Altenrheine (Rheine) wurde sie auf Normalspur (1435 mm) umgebaut. Bis in die 50er Jahre hinein fuhren Dampflokomotiven auf der Tecklenburger Nordbahn, dann Triebwagen und Dieselloks. Am 28. Mai 1967 wurde der Personenverkehr eingestellt. Heute wird die Strecke ausschließlich für den Güterverkehr genutzt. Zwei Diesellokomotiven mit je 836 kw sind im Einsatz und befördern jährlich rund Tonnen für die RVM. Der moderne Schnellbus (S 10) hat inzwischen die Personenbeförderung mit täglich über 1000 Fahrgästen entlang der Hauptstrecke von Recke bis Osnabrück übernommen. Nur noch zu einigen Sonderfahrten mit historischen Sonderzügen zu Pfingsten und in der Weihnachtszeit können Passagiere die Bahnlinie befahren. Eine Reaktivierung für den Personenverkehr ist seit 1997 wieder im Gespräch. Der Hintergrund ist der Aufbau eines Stadtbahnsystems für Osnabrück und das Vorbild des reaktivierten Haller Wilhelm von Bielefeld nach Osnabrück. Wer Interesse hat, einen Streckenabschnitt der Tecklenburger Nordbahn im Maßstab 1:87 zu sehen, der nehme Kontakt auf zu den H0 Freunden Tecklenburger Nordbahn ( 19
22 Station 6 Königsteichgraben Der Königsteichgraben wird ebenfalls aus den Quellen am Freibadgelände gespeist. Er floss früher von dort aus offen nördlich des Hofes Schildkamp und dann im heutigen Verlauf als begradigter Wiesengraben in die Düsterdieker Niederung. Heute ist er ab Am Königsteich bis zur Unterquerung Sandstraße (Station 6) geradlinig und mit Betonhalbschalen in der Sohle ausgebaut. Da viele Siedlungsgebiete ihr Regenwasser in den Königsteichgraben schicken, gibt es häufig hohe Wasserstände und entsprechend große Fließgeschwindigkeiten. Die Halbschalen verhindern hier das Ausspülen des feinsandigen Untergrundes. Ab der Unterquerung der Tecklenburger Nordbahn ist das Bachbett breiter und auch deutlich tiefer eingeschnitten, da das Gelände höher liegt. Hier wurden am Bachufer Erlen und oben heimische Strauchgehölze angepflanzt. Übrigens Unter einheimischen Pflanzenarten verstehen wir Pflanzen, die in der Landschaft von Natur aus vorkommen und sich dort ohne Zutun der Menschen erhalten und vermehren. Und es gibt gute Argumente, die für die Pflanzung einheimischer Gehölze sprechen: Für einheimische Pflanzen ist unser Klima ideal. Dadurch sind sie relativ unempfindlich, wachsen schnell und sind leicht zu pflegen. Einheimische Pflanzen sind für viele Tierarten von großer Bedeutung. Einheimische Pflanzen sind durch ihre Unempfindlichkeit gerade dort willkommen, wo Kinder spielen. Für vergleichsweise wenig Geld sind einheimische Pflanzen zu bekommen. Die Erlen sichern mit ihren Wurzeln Ufer und Gewässersohle gut gegen Abschwemmungen. Ein Ausmähen des Baches, um genügend Durchfluss zu ermöglichen, ist bei einem beidseitig bepflanzten Bach nicht erforderlich. Das Wasser wird im Rückhaltebecken (Station 7) zwischengespeichert. Auch wenn bei uns im Jahresverlauf ausreichend Niederschlag fällt, ist die ortsnahe Versickerung und Speicherung von Niederschlägen für Trockenperioden besonders wichtig. 20
23 Merkmale der Erle An Bächen und Flüssen, auf gelegentlich überfluteten Flächen, aber auch an ganz trockenen Stellen finden wir die Erle. Durch ihr schnelles Wachstum gilt sie als Pionierpflanze, die als erste eine unbegrünte Fläche besiedelt. Das sich schnell zersetzende Laub leistet einen wichtigen Beitrag an Nährstoffen für Bodenlebewesen. Die Raschwüchsigkeit und Anpassungsfähigkeit der Erlen hängt auch mit dem Strahlenpilz (Actinorrhiza) zusammen, der in Symbiose, in gegenseitigem Nutzen, an den Wurzeln der Erle lebt. Diese kleinen, knöllchenartigen Verdickungen binden Stickstoff aus der Luft und verwandeln ihn zu Nitrat, das sie dem Baum als Dünger zuführen. Das Wasser eines Baches erwärmt sich von der Quelle an immer mehr und kann je wärmer es ist umso weniger Sauerstoff speichern. Ist zu wenig Sauerstoff im Wasser kann es zu einem Fischsterben kommen. Mit einem Thermometer kann die Erwärmung des Wassers bis zum Rückhaltebecken gemessen werden. Der Schatten von Ufergehölzen verhindert eine starke Erwärmung des Wassers. Geeignete Messstellen sind an der Straße Am Königsteich, hinter dem Durchlass Sandstraße und vor dem Regenrückhaltebecken. Vorsicht Am Königsteichgraben wächst an einigen Stellen der Riesenbärenklau. Er ist an den sehr großen eingeschnittenen Blättern und den großen weißen Blütenständen zu erkennen. Man sollte jeden Kontakt mit der Pflanze vermeiden, am besten nicht in die Nähe der Pflanzen gehen. Die Berührung der Pflanze kann in Kombination mit Sonnenlicht zu schweren Hautverbrennungen führen. Im Falle eines Hautkontaktes sollte die betroffene Stelle schnellstmöglich mit Wasser und Seife abgewaschen werden. 21
24 Station 7 Regenrückhaltebecken Im Jahr 1978 wurde es als das erste Rückhaltebecken der Gemeinde mit einem Rückstauvolumen von rund cbm erstellt. Es weist einen ständigen Wasserstand von 1,5 m und eine zusätzliche Aufstauhöhe von 1,70 m auf. Da sich ständig eine größere Wassermenge von rund cbm im Becken befindet und damit für Sportangler attraktiv ist, wurde schon 1980 ein Pachtvertrag mit dem Westerkappelner Sportfischerverein Die Petrijünger abgeschlossen. Einziger Zufluss ist der Königsteichgraben, der sein Wasser aus dem Bullerteich sowie überwiegend aus den Regenwasserkanälen der benachbarten Baugebiete erhält. Daher steigt der Wasserstand nach starken Regenfällen sehr schnell an. Übrigens Auf dem eigenen Grundstück kann man viel zur Versickerung von Niederschlag vor Ort durch Auffangzisternen und sickerfähige Bodenbeläge oder aber durch den Verzicht auf unnötige Versiegelung beitragen. Die Gemeinde honoriert dies bei der Niederschlagsgebühr. In Einzelfällen kommt es nach sehr starken Regenfällen zum Überlaufen im Bereich der dafür angelegten Überlaufbauwerke am Ostrand des Beckens. Ein Sand- und Schwimmstofffang vor dem Becken verhindert, dass mitgeführter Sand, Laub und auf dem Wasser schwimmender Müll aus dem Straßenkehricht in das Becken gelangen. Von der Brücke aus kann man die Funktion des Sand und Schwimmstofffangs gut beobachten. Hinter der breiten Schwelle am Einlaufbereich zum Rückhaltebecken ist ein beliebter Angelplatz, da einige Fischarten sich gerne in die dortige Strömung stellen. Im Becken finden sich Rotfedern und Rotaugen, die von Natur aus heimisch sind. Eingesetzt werden von den Petrijüngern neben Regenbogenforellen auch Zander, Karpfen und Schleie. Denk daran, wer seine Wischeimer verbotenerweise in den Regeneinlauf der Straße auskippt, sollte sich bewusst sein, dass das Wasser ungeklärt direkt im Rückhaltebecken ankommt. 22
25 Die Wälle mit dem Rundweg um das Becken wurden mit heimischen Gehölzen bepflanzt. Am Ufer sind nur wenige Röhrrichtbestände mit Schilf und Wasserschwertlilie zu finden. Neben der starken Beschattung ist auch der stark schwankende Wasserstand ein Grund für den schwachen Röhrichtbewuchs. Die ursprünglichen feuchten Niedermoorböden kann man noch gut auf dem benachbarten Erlen- und Birkenwald erkennen. Die trockeneren Stellen werden hier von der Birke besiedelt. Reste von Entwässerungsgräben weisen noch auf eine ehemalige wirtschaftliche Nutzung als Grünland hin. Im Wald sind im Herbst besonders reichlich Fliegenpilze (Achtung giftig!!) zu entdecken. und entdecke den Laich von Kröten und Fröschen Erdkröte Die Erdkröte ist neben dem Grasfrosch, dem Teichfrosch und dem Teichmolch die häufigste Amphibienart in Europa. Die Erdkröte ist ein wechselwarmes Tier, das im Allgemeinen dämmerungsaktiv ist. Tagsüber ruhen die Tiere unter Steinen, zerfallenen Mauern, Totholz, Laub, Gebüsch oder in selbst gegrabenen Erdlöchern. Als Landlebensräume besiedeln sie ein breites Spektrum von Biotopen, das von Wäldern über halboffene Landschaften aus Wiesen, Weiden und Hecken bis zu naturnahen Gärten reicht. Im Frühjahr verlassen sie in massenhaften Wanderungen ihr Winterquartier, um zur Fortpflanzung ein Laichgewässer aufzusuchen. An vielen Straßen werden mittlerweile Schutzmaßnahmen zugunsten wandernder Erdkröten und anderer Lurcharten durchgeführt. Dies können zeitlich begrenzte Krötenzäune aus Plastik sein, an denen die anwandernden Tiere entlanglaufen, bis sie in Sammeleimer fallen und von menschlichen Helfern über die Straße getragen werden. Manche Straßen werden für die Zeit der Hauptwanderung auch eigens gesperrt. Schließlich werden Tierdurchlässe 23
26 (Krötentunnel) unter der Fahrbahn eingebaut, zu denen die Kröten mittels fest installierter Zäune geleitet werden. Diese Art von Schutzmaßnahme können wir an der Osnabrücker Straße sehen. Der Laich wird nach mehreren Tagen Wasseraufenthalt in Form von Schnüren abgegeben, die fünf bis acht Millimeter dick und je nach Dehnung etwa zwei bis vier (fünf) Meter lang werden. Die schwarzen Eier sind in der Regel in zwei- bis vierreihigen Ketten innerhalb der Gallerte angeordnet. Aus dem Laich entwickeln sich die Kaulquappen. Diese sind bei der Erdkröte einheitlich schwarz gefärbt und werden zuletzt bis zu 40 Millimetern lang. Grasfrosch Im zeitigen Frühjahr bis Ende März finden sich die aus der Winterstarre erwachten Tiere im Laichgewässer ein. Das Fortpflanzungsgeschehen findet oft in vegetationsreichen und besonnten Uferabschnitten der Gewässer statt, 24
27 so dass dort Ansammlungen aus manchmal hunderten Laichklumpen auf mehreren Quadratmetern Fläche entstehen können. Die Laichballen des Grasfrosches sind besonders groß und weisen zwischen 1000 und 2500 Eier auf. Ein Weibchen legt meist nur einen Laichballen ab, selten zwei. Kaulquappen schlüpfen nach 3-4 Wochen und 3-4 Monate später gehen 1cm lange Fröschchen an Land, wo sie überwintern. Nach der Eiablage verlassen die erwachsenentiere meist sehr rasch das Gewässer und gehen zum Landleben über. Als Habitate werden nun beispielsweise Grünland, Saumbiotope, Gebüsche, Gewässerufer, Wälder, Gärten, Parks sowie Moore besiedelt. Nachts gehen die Frösche auf die Jagd nach Insekten, Würmern, Spinnen und Nacktschnecken, tagsüber verstecken sie sich an feuchten Plätzen zwischen Vegetation oder unter Steinen bzw. Totholz. Teichfrosch oder Wasserfrosch Teichfrösche sind ganzjährig relativ eng an Gewässer gebunden. Sie unternehmen aber auch längere Landgänge und überwintern in z.b. Erdhöhlen. Als Laich- und Wohngewässer werden offene Stillgewässer bevorzugt, vor allem Weiher und naturnahe Teiche, wo sich die Frösche am Uferrand oder auf Seerosenblättern sitzend sonnen und nach Insekten Ausschau halten können. 25
28 Bei Gefahr springen sie in typischer Wasserfroschmanier mit einem weiten Satz ins Wasser und verbergen sich im Schlamm. Die Paarungszeit des Teichfrosches liegt im Mai bis Juni und ist damit im Laich-Kalender der mitteleuropäischen Amphibien der späteste. Das Weibchen legt in 1-2 Tagen mehrere Laichballen mit je etwa 300 Eiern. Die Kaulquappen schlüpfen nach ca. 8 Tagen und entwickeln sich in 3-4 Monaten zu 2cm großen Fröschen. Station 8 Kläranlage Westerkappeln Durchschnittlich verbraucht jeder einzelne täglich 128 Liter Trinkwasser im Haushalt für Trinken und Kochen (3-6l) Körperpflege (10-15l) Baden und Duschen (10-20l) Wäsche waschen (20-40l) Geschirr spülen (4-7l) Toilette (30-40l) Wohnungsreinigung (5-10l). Nun verbringen wir aber nicht unsere ganze Zeit zu Hause, sondern auch in Schulen, Büros, Ämtern, Geschäften sowie bei Freizeit und Sport kommen wir ohne Wasser nicht aus. Und wer denkt schon daran, wenn er ein Glas Milch trinkt, dass etwa 1 Liter Wasser gebraucht wurde, um sie aufzubereiten? Bei einem Glas Bier sind es bereits 4 Liter. Die Tageszeitung benötigt zur Papierherstellung etwa 5 Liter Wasser, eine Illustrierte sogar 30 Liter. Nahezu jedes Produkt, das wir kaufen, hat zu seiner Herstellung Wasser benötigt. Verteilt man den Wasserbedarf der Gewerbe- und der Industriebetriebe gleichmäßig auf die Bevölkerung, so werden jeden Tag mehr als 1800 Liter Wasser pro Kopf der Bevölkerung im Durchschnitt bei uns gebraucht. All dieses Wasser fließt durch Wasserhähne und Rohre. Um unsere Bäche und Seen vor Verschmutzung zu schützen, werden die Abwässer unserer Haushalte, die Abwässer von Straßen und Plätzen, der öffentlichen Einrichtungen wie Schulen oder Rathaus und der Gewerbebetriebe unserer Gemeinde über ein weit verzweigtes Kanalsystem gesammelt und in die Kläranlage Westerkappeln geleitet. Dort wird es in verschiedenen Klärstufen gereinigt, bevor es wieder in die Natur abgegeben wird. 26
29 So funktioniert die Reinigung des Abwassers in der Kläranlage In der Kläranlage wird das Abwasser zuerst von den groben Bestandteilen befreit. Es fließt dazu durch Gitterstäbe, sogenannte Grobrechen, die alle großen Teile zurückhalten, die eigentlich gar nicht in den Ausguss oder die Toilette gehören. Im Sandfang, den das Abwasser dann langsam durchfließt, setzen sich Sand, Schotter oder Kies aus der Straßenkanalisation auf dem Boden ab. Im Vorklärbecken setzen sich die feinen Schmutzteilchen als Schlamm am Boden ab. Über dem Vorklärbecken fährt eine Räumerbrücke hin und her, die den im Wasser abgesetzten Schlamm zusammenschiebt, so dass er abgepumpt werden kann. Auch wird das sich an der Wasseroberfläche sammelnde Fett und Öl abgefischt. Die mechanische Reinigung ist damit abgeschlossen und hat dem Wasser etwas ein Drittel der Schmutzstoffe entzogen. Das Wasser sieht zwar jetzt schon klarer aus, aber ein Gewässer wie Bach oder Fluss könnte es noch nicht verkraften. Die meisten Abfallstoffe sind darin noch enthalten, zum Teil in gelöster Form. Um sie zu entfernen, wendet man einen Trick an, den man der Natur abgeschaut hat. Die komplizierte Arbeit müssen die Mikroorganismen übernehmen. Diese zersetzen im Belebungsbecken die gelösten Schmutzstoffe. Das Abwasser durchläuft das Belebungsbecken innerhalb einiger Stunden und fließt dann in das das Nachklärbecken ab. Hier setzen sich die Mikroorganismen vermischt mit den Rückständen als feiner Schlamm ab. Manchmal werden auch noch chemische Stoffe zur Reinigung hinzugegeben. Danach wird das Wasser in ein Gewässer geleitet. Übrigens: Zur Veranschaulichung der Arbeitsweise einer Kläranlage kann für Schulklassen ein Besuch bei der Zentralkläranlage Westerkappeln vereinbart werden. Ansprechpartner: Herr Etgeton, Tel
30 Kenndaten der Kläranlage in Westerkappeln Baujahr: 1981 Erweiterung: 1994; 2005 Trockenwetter Durchfluss: cbm/d Durchfluss bei Regenwetter:Hängt vom Regenereignis ab, teilweise bis zu 2500 cbm/tag Einlauf-, Hebebauwerk: 3x Schneckenpumpe mit einer Förderleistung von bis zu 240cbm/h Mechanische Reinigung: Ein Feinstufenrechen für die Grobstoffe Ein Absetzbecken mit Räumerbrücke Ein Sandwäscher Biologische Reinigung: 2 Belebungsbecken mit einem Volumen von je 1350cbm Chemische Reinigung: 1 Tank mit Eisen III Chlorid für die Phosphatfällung Nachklärbecken: 1 Becken mit einem Volumen von 1820cbm Schlammspeicher: 2 Schlammsilos mit einem Volumen von je 2070cbm Schönungsteiche: 2 nachgeschaltete Teiche mit einem Volumen von 3085cbm und benenne die einzelnen Säuberungsstufen des Abwassers in einer Kläranlage 28
31 und baue eine Mini-Kläranlage Material: Mehrere Blumentöpfe, Sand, Kies, Filtertüten, Watte, Glas Beim Bau deiner Mini-Kläranlage werden mehrere Blumentöpfe mit unterschiedlichen Substraten übereinander gestapelt. Auf den Boden der Blumentöpfe breitest du jeweils eine Schicht Watte aus, damit die Filtersubstrate nicht durch das Loch gelangen können. Die Töpfe füllst du je mit Filtertüte, Sand und Kies. Schmutzwasser Kies Sand Filter Glas 29
32 Nun kann verschmutztes Wasser in die Mini-Kläranlage gegossen werden. Dies kann beispielsweise Tee oder ein Wasser-Erde-Gemisch sein. Das Wasser läuft durch den Filter und tropft aus der Bodenöffnung des untersten Blumentopfes in das darunter stehende Glas. Hat sich das Wasser verändert? Sind die Filterergebnisse unbefriedigend, kann der Filter verändert werden. So können zum Beispiel die Stärke der Schichten oder die Zusammensetzung der Substrate verändert werden. Jeder Filter sollte nur einmal benutzt werden, damit die Ergebnisse nicht verfälscht werden. Möchtest du Filterversuche mit mehreren unterschiedlichen Wasserproben durchführen, musst du darauf achten, dass die Filter alle gleich aufgebaut sind. Wenn die Proben durchgelaufen sind, kannst du die Gläser nebeneinander stellen, um zu vergleichen, welches Wasser am saubersten gefiltert bzw. welche Stoffe aus dem Wasser herausgefiltert wurden. Station 9 NSG Düsterdieker Niederung Die Station 9 des Naturerlebnisweges befindet sich am südöstlichen Rande der Düsterdieker Niederung. Diese zählt zu den größten Feuchtwiesenschutzgebieten in Nordrhein- Westfalen und ist Teil des EU- Vogelschutzgebietes Düsterdieker Niederung und gehört somit zum europäischen Schutzgebietsnetz Natura Wegen der Grundwasserverhältnisse der teils sandigen, teils moorigen Böden ist hier ohne zusätzliche Entwässerung nur Grünlandnutzung und kein Ackerbau möglich. In der Düsterdieker Niederung konnten die Feuchtwiesen durch Unterschutzstellung gesichert werden. Seit Jahren werden in der Niederung Artenschutzmaßnahmen wie die Anlage von Blänken und Kleingewässern durchgeführt. Zahlreiche Flächen werden extensiv genutzt, so dass sich viele Tier- und Pflanzenarten wieder ausbreiten konnten. In den Feuchtwiesen brütet eine Vielzahl stark gefährdeter Vogelarten, darunter Großer Brachvogel, Bekassine, Kiebitz, Wachtelkönig, Schwarzkelchen und Steinkauz. Der Große Brachvogel ist durch seine lauten Rufe und aufgrund des langen gebogenen Schnabels eine imposante Erscheinung in den Feuchtwiesen. Wie viele andere Zugvögel ist er nicht ganzjährig, sondern nur von Februar bis Juli während des Brutgeschäfts, bei uns zu sehen. 30
33 Das unverkennbare Kennzeichen des Großen Brachvogels ist sicher der lange und stark nach unten gekrümmte Schnabel. Die Vögel sind etwas 50-60cm lang und haben ein regelmäßig beigebraun oder graubraun gebändertes und gestreiftes Gefieder. Die Stimme ist ein lauter wehmütiger Ruf, der wie "kuri li" klingt Die Bekassine ist mit einer Körperlänge zwischen 25 und 28 Zentimeter eine mittelgroße, einheimische Schnepfenart. Wie bei allen Schnepfen ist ihr Schnabel auffällig lang. Das Gefieder weist eine bräunliche Tarnfärbung mit markanten Längsstreifen auf Kopf und Rumpf auf. Der Kiebitz ist ein Charaktervogel der Wiesen- und Weidelandschaft der Niederungen. Er ist 28 bis 31 Zentimeter lang und hat eine Flügelspannweite von 70 bis 80 Zentimetern. Kiebitze sind während der Brutzeit sehr stimmfreudig, ihr Rufen klingt klagend schrill, wie kschäää oder kiju-wit, An der Station 9 hat die Biologische Station des Kreises Steinfurt eine Informationstafel zum Naturschutzgebiet Düsterdieker Niederung für den Naturerlebnisweg aufgestellt. Das Fenster daneben soll interessante Einblicke in diese typische Niederungslandschaft ermöglichen. Schaut man nach Norden, kann man über eine Anfang 2007 neu geschaffene Blänke hinweg in eine Vernässungszone des Vogelschutzgebiets aus dem Life- Projekt sehen. Mit einem Fernglas oder einem Spektiv gibt es dort immer etwas zu entdecken. Im Vogelschutzgebiet werden regelmäßig Exkursionen von der Biologischen Station ( oder der ANTL (Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land e.v. mit fachkundiger Führung angeboten. 31
34 Station 10 Kopfweiden Ihre Gestalt mit den kurzen knorrigen Stämmen und den weit ausladenden Kronen ist charakteristisch für viele Niederungsgebiete im Tecklenburger Land. In Westerkappeln stehen rund sogenannter Kopfbäume. Sie waren früher wertvolle Rohstofflieferanten für Flechtwerke (Körbe, Fischreusen, Fachwerkfüllungen, Möbel) und wurden als Brennmaterial sowie als Viehfutter in Form von Laubstreu genutzt. Kopfweiden bieten auf Viehweiden Schutz vor Sonne und Wind, können aber nicht von den Weidetieren abgefressen werden. Denn die Köpfe mit einer Vielzahl von Austrieben entstehen durch Kappen (Schneiteln) des Baumes in ca. 1,80m Höhe. So konnten die Austriebe vom Boden aus bequem geschnitten werden. An den Schnittstellen bilden sich immer wieder neue Austriebe und mit der Zeit verdickt sich die Schnittstelle zu einem Kopf. Neben Weiden wurden auch Pappeln, Eschen, Hainbuchen und sogar Eichen geschneitelt. Mitte des 20. Jahrhunderts hatten die Weiden ihre Funktion als Rohstofflieferant fast vollständig verloren und an die Stelle abgestorbener Bäume wurden keine neuen Setzlinge mehr gepflanzt. Mitte der 70 er Jahre entdeckten die Naturschützer ihr Interesse an den Kopfbäumen. Bieten sie doch als Kleinstbiotop mit Nischen, Höhlen und Totholz vielen Tieren wie Höhlenbrütern, Fledermäusen, Hornissen sowie einer Vielzahl von Insekten und sogar bis zu 76 Blütenpflanzenarten einen Lebensraum. In Westerkappeln nahmen sich Mitglieder des Kultur- und Heimatvereines sowie der Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land (ANTL) und insbesondere deren Mitglied und Landschaftswart Friedhelm Scheel der Kopfbäume an. Die Austriebe der Kopfbäume müssen in regelmäßigen Abständen alle 6 bis 10 Jahre geschnitten werden, da sie sonst auseinander brechen. Mit Motor- und Handsägen wurden vielen überfälligen Kopfbäumen bei den Pflegeeinsätzen zu Leibe gerückt. Auf Informationsveranstaltungen und in vielen Einzelgesprächen vor Ort wurde der Westerkappelner Bevölkerung der Wert der Charakterköpfe für Ökologie und Landschaftsbild im Tecklenburger Land näher gebracht. Nunmehr ist den meisten Eigentümern der Wert der Kopfbäume bewusst. Sie werden nicht mehr gefällt, sondern es werden Lücken 32
35 in vorhandenen Kopfweidenreihen bepflanzt bis hin zur Anpflanzung neuer Kopfbaumreihen. Seit den 80 er Jahren haben sich neue Nutzungen für das Weidenschnittgut entwickelt. Aus den Weidenruten werden in naturnahen Gärten Flechtzäune erstellt und für Kinder werden lebende Bauwerke aus Weidenruten in Form von Weidentipis, Weidenlauben und Weidentunneln erstellt, die heute in vielen Kindergartenfreigelände zu finden sind. Seit der Jahrtausendwende werden Kopfweiden in der Region auch vermehrt für künstlerische Großprojekte wie die riesigen Weidenskulpturen am Kloster Gravenhorst verwendet. Mit steigenden Brennstoffkosten wurde in den letzten Jahren auch die Kopfbaumpflege für die Eigentümer wieder interessant. Die Zukunft der Westerkappelner Charakterköpfe scheint also gesichert, wenn auch die nachfolgenden Generationen mit ihnen im Alltag aufwachsen. Hier am Standort wurden neben einer rund 20 Jahre alten Kopfweide im Herbst 2006 von der AG Natur des KVGs Mettingen weitere Setzlinge gesteckt. Dabei wird ein etwa 2,50m langer armdicker Ast ca. 80cm in die Erde gesteckt. Aufgrund der Wuchsform und Wuchskraft werden ausschließlich schmalblättrige Weiden als Steckholz verwendet. Das können die Silberweide (Salix alba), die Korbweide (Salix viminalis) oder die Purpurweide (Salix purpurea) sein. 33
36 Ist der Standort feucht genug, treiben die Weiden aus der Rinde heraus Wurzeln und schon im Herbst des ersten Jahres ist ein kleiner Kopf mit Austrieben entstanden. Nach 2 Jahren sollte man eine Kontrolle auf evtl. Stammaustriebe machen und diese bis unter den Kopf entfernen. Dann ist nach ca. 5 6 Jahren der erste Schnitt notwendig. Für Flechtzwecke kann man am besten die 1 2 jährigen Weidenruten nehmen, da sie noch sehr biegsam sind. Übrigens. Schon gewusst, dass das Korbflechten früher weit verbreitet war? Heute ist es zu einer seltenen Kunst geworden, nur noch wenige Menschen beherrschen das seltene Handwerk und können aus den biegsamen Weidenruten Einkaufs-, Blumen- oder Kartoffelkörbe herstellen. früher aus der Weidenrinde wirksame Medizin hergestellt wurde? Sie half bei vielerlei Beschwerden. die Wünschelrute des Wünschelrutengängers an Stellen, an denen Weiden gedeihen, besonders stark ausschlägt. eine Handvoll Weidenblätter oder Rinde in Wasser aufgekocht als wohltuendes Fußbad bei müden Füßen wirkt? mit der weichen Samenwolle, die im Frühjahr anfällt, kleine Schmusekissen für Kinder angefertigt wurden? Hierzu wurden zwei zusammengenähte Taschentücher mit der Samenwolle gefüllt, man nannte es das Arme-Leute Kissen. sich etwa 180 tierische Spezialisten in den Weiden befinden und vor allem der frühe Nektar der Weiden ein wichtiges Bienenfutter ist. die Raupen des gefährdeten Großen Schillerfalters sich von Blättern verschiedener Weidenarten ernähren. Nach ihrer zweiten Häutung leben sie so lange angesponnen an die Weidenzweige, bis sie sich zu einem fertigen Schmetterling entwickelt haben. 34
37 und gestalte mit Weiden! Türkranz Im Herbst kannst du aus dem unendlich großen Reichtum der Natur schöpfen und alles sammeln, was dir interessant erscheint: vertrocknete Blüten, Samenstände, Ranken von Kletterpflanzen, Hagebutten oder immergrüne Zweige. Außerdem benötigst du eine Rolle Blumendraht, Gartenschere, Drahtzange und Weidenruten. Die Weidenruten biegst du zu einem Weidenring. Wässere sie vorher, dann sind sie schön biegsam und lassen sich gut miteinander verdrehen. Lege dein gesammeltes Pflanzenmaterial bereit und schneide alles auf eine Länge von etwa 10cm zurecht. Nun fasse die Zweige zu kleinen Sträußchen zusammen und binde sie mit Draht folgendermaßen auf den Weidenring: Ein Sträußchen links, dann versetzt rechts, dann Mitte, dann links usw. Drehe den Kranz dabei immer ein Stück von dir weg, die Drahtrolle von innen nach außen geschlungen. Das letzte Sträußchen wird schließlich unter das erste geschoben. Weidentipi Was gibt es schöneres für Kinder, als einen eigenen Platz für sich im Garten zu haben. Das könnte ein selbst gebautes Tipi aus Weiden sein. Die Form des Weidentipis ist den Zelten der Prärie-Indianer entlehnt. Im Unterschied zu dem indianischen Wanderzelt soll das Weidentipi an Ort und Stelle Wurzeln schlagen und sich zu einem lebenden grünen Zelt entwickeln. Für den Bau eines Weidentipis von 2-3m Durchmesser benötigst du: Spaten, Gartenschere, kleine Säge, Schnur Ca. 30 Weidenäste 3-3,5m lang, 3-5cm dick 10 Bund (d=30cm) Flechtmaterial 1,5-2m lang, 1-2cm dick 1. Bauschritt: Markieren und Ausheben des Setzgrabens Du hebst am vorgesehenen Standort im Durchmesser von 2-3m einen kreisförmigen Setzgraben von 50-70cm Tiefe spatenbreit aus. Die ca. 50cm breite Eingangsstelle wird 35
38 dabei nicht ausgehoben. Eine eventuell vorhandene Grasnarbe stichst du ab und legst sie zur Seite. 2. Bauschritt: Setzen der Hauptgerüststäbe Zuerst setzt du drei stärkere Gerüststangen. Sie bilden das Grundgerüst und werden an ihrem Kreuzungspunkt mit einer stärkeren Schnur zusammen gebunden. 3. Bauschritt: Setzen der weiteren Gerüststäbe und Auffüllen des Grabens Drei weitere Gerüststäbe setzt du in die Zwischenräume der ersten 3 Weidenstäbe und verbindest sie am Kopfende mit den bereits stehenden Weidenstäben. Nun können alle anderen Weidenstäbe im Abstand von ca. 25cm eingefügt werden. Abschließend füllst du die Aushuberde schichtweise wieder ein und stampfst sie fest. Zuletzt deckst du den Setzgraben wieder mit der abgestochenen Grasnarbe ab. 4. Bauschritt: Ausflechten der Gerüststäbe Das Flechtmaterial wird wie beim Weben streifenweise bis in eine Höhe von ca. 1,20m in das Tipigerüst eingeflochten. Schiebe dabei das Geflochtene immer wieder dicht zusammen, um das Gerüst zu stabilisieren. Denke daran, den Eingangsbereich frei zu lassen. 5. Bauschritt: Weiterer Aufbau des Weidentipis Je nach den klimatischen Verhältnissen und der Beschaffenheit des Bodens setzt im Mai der Austrieb der Gerüststäbe ein. Nach dem ersten Vegetationsjahr biegst du die neuen Austriebe in etwa waagrecht herunter und flechtest sie in das Flechtwerk ein. Diese Aufbau- und Pflegemaßnahme solltest du 3-4 Jahre wiederholen werden, um so ein möglichst dicht verzweigtes Tipi zu erhalten. Die Kegelspitze wird dabei jeweils bis auf einen ca cm langen Austrieb zurück geschnitten. Nach den ersten Aufbaujahren kannst du einen jährlichen Rückschnitt des Tipis im Winter vornehmen, der verhindert, dass das Tipi im unteren Bereich verkahlt. 36
39 Station 11 Mischwald und Sloopsteene In den Wäldern Mitteleuropas ist die Buche die häufigste Laubbaumart. Früher nutzte man nicht nur deren Holz als Baumaterial oder zum Verfeuern, auch die Bauern trieben ihre Schweine zur Bucheckernmast wie auch zur Eichelmast in den Wald. Der Wald an den Sloopsteenen ist das Ergebnis möglicherweise Jahrtausende langer Beeinflussung und Nutzung des Waldes. Hier stocken die Bäume auf lehmigen und steinigen Sandböden auf denen natürlicherweise Eichen und Buchen die häufigsten Baumarten sind. Durch den Menschen wurden zusätzlich Kiefern und Fichten eingebracht. Zusammen mit Birken, Ebereschen und Faulbaum hat sich hier ein artenreicher Wald mit unterschiedlichen Altersklassen entwickelt. und gehe auf Gallwespensuche Wer das Laub der Eiche genauer betrachtet, wird an einzelnen Blättern etwa kirschgroße Kugeln entdecken, die Eichengallen. Sie sind mit dem Blatt verwachsen und fühlen sich weich an. Wir können einmal mit einem scharfen Messer (!) eine Kugel öffnen, um den Bewohner zu sehen. Mit etwas Glück finden wir eine kleine Larve, die es sich in ihrem runden, weichen Häuschen gut gehen lässt. Die Larve wird sich im Winter als Eichengallwespe ins Freie beißen, um sofort neue Eier in die Knospen der Eichen zu legen. Aus dem Ei schlüpft eine neue Larve, die herzhaft in das Blatt beißt. Daraufhin versucht der Baum, den Anbeißer zu verwachsen er bildet eine Galle. Genau das bringt der Larve Nutzen, da sie in diesem Gewebe genug Nahrung und Schutz findet, um sich in Ruhe entwickeln zu können. 37
40 Rezept für einen Baumblättersalat Du brauchst: 1 Hand voll junge, frisch ausgetriebene Eichen-, Birken-, Buchenblätter, 100g Käse, eine halbe Zwiebel, 50g gehackte Walnüsse, 2 TL Öl, etwas Zitronen- und Apfelsaft, etwas Honig, Salz und Pfeffer Zwiebel und Käse würfeln und zusammen mit den gewaschenen Blättern und gehackten Nüssen vermischen. Eine Marinade aus Zitronensaft, Apfelsaft, Öl, Pfeffer und Salz herstellen, unter den Salat mengen und gut ziehen lassen. Da der Wald um die Sloopsteene seit Jahrzehnten Naturschutzgebiet ist, findet man auch noch ausreichend Totholz. So bezeichnet man abgestorbene, stehende oder umgefallene Bäume oder Teile davon. Totholz dient einer Vielzahl von Organismen als Nahrung und Lebensraum. Die Insekten bilden mit Ameisen, Wildbienen, Wespen und Käfern die größte Gruppe. Die Larven der Hirschkäfer verbringen beispielsweise bis zu ihrer Entwicklung zum vollständigen Tier mehrere Jahre im Totholz. Die bekanntesten Totholz bewohnenden Tiere sind aber wohl die Spechte. Hier an den Sloopsteenen kommen Schwarz-, Grün- und Buntspechte vor. Schwarzspecht Grünspecht Buntspecht Spechte ernähren sich von Insekten, die sie unter der Baumrinde oder in morschem Holz finden. Dazu klettern sie an den Bäumen aufwärts und klopfen mit ihrem Schnabel die Baumrinde ab. An der Stelle, wo sie hohl klingt, befindet sich meist der Gang eines holzfressenden Insekts bzw. die Larve eines Borkenkäfers. 38
41 Der phantastische körpereigene Meißel (Schnabel) des Spechtes ist aber auch das Werkzeug, mit dem die Kinderstuben gezimmert werden. Er bearbeitet dafür Weich- und Harthölzer, meist in einer Höhe von vier bis sechs Metern. Von dem emsigen Bruthöhlenbau der Spechte profitieren auch andere Höhlenbewohner wie Fledermäuse, Baummarder und in Höhlen brütende Singvögel, die in verlassene Spechthöhlen einziehen. Eine weitere wichtige Funktion des Trommelns ist die Verteidigung des Reviers. Ein Buntspechtpaar benötigt ein Revier von Hektar, welches verteidigt werden muss. Die Reviergrenzen kennzeichnet der Specht durch das Trommeln. Dazu sucht der Specht häufig tote, trockene Äste oder Bäume, die für sein Trommelkonzert einen herrlichen Resonanzkörper darstellen. Das Trommeln wird von beiden Partnern ausgeführt, wobei sie eine Frequenz von 20 Schlägen pro Sekunde zeigen. Die Trommelfolge dauert allerdings nur etwa 0,6 Sekunden. Pro Minute kann der Specht aber acht bis zehn solcher Folgen erklingen lassen. Dabei bekommen sie trotz der Härte der Schläge und dieser hohen Frequenz keine Gehirnerschütterung, ja nicht einmal Kopfschmerzen. Diese erstaunliche Leistung wird durch eine anatomische Besonderheit möglich. Die Spechte verfügen über einen natürlichen Stoßdämpfer, weil Schnabel und Schädel elastisch miteinander verbunden sind. Spiel: Spechtmusik zur Partnersuche Für dieses Spiel müssen Bäume gesucht werden, die gute Resonanzkörper zum Trommeln darstellen. Die Spielleitung fertigt Lose an, wobei auf jedem Los ein bestimmter Rhythmus (z.b. 10x schnell hintereinander oder 5x langsam hintereinander klopfen) steht und Lose mit dem gleichen Rhythmus jeweils zweimal vorkommen. Die Lose werden so in zwei Töpfe verteilt, dass jeder Rhythmus in einem Lostopf nur einmal vorkommt. Zwei Gruppen werden gebildet. Eine Hälfte spielt männliche Spechte, von denen jeder aus einem Topf jeweils ein Los zieht und dann den notierten Rhythmus an einem geeigneten Baum klopft. Die anderen Mitspieler spielen weibliche Spechte, die auch jeweils ein Los aus dem anderen Topf ziehen und dann den Klopfrhythmen der Männchen lauschen. Dann suchen sie den auf ihrem Los notierten Rhythmus, um so ihren Partner zu finden. Dabei darf nicht gesprochen werden. 39
42 Wegen der vielen Baumarten und dem hohen Totholzanteil findet man hier auch viele Pilzarten vor. Zu beinahe allen Jahreszeiten findet man hier Pilzfruchtkörper, die meisten Arten allerdings im Herbst. Unterirdisch kann ein Pilz mit seinen vielen Verzweigungen, dem sog. Mycel, eine große Ausdehnung über viele Quadratmeter haben. Pilze spielen eine wichtige Rolle bei der Zersetzung organischer Substanz. Wer sich die Mühe macht in der Laubstreu zu suchen, wird Blätter in unterschiedlichen Zerfallsstadien finden. Einige bestehen nur noch aus einem dünnen Geflecht von Blattadern während die eigentliche Blattmasse schon durch unzählige kleine Organismen abgebaut wurde. Halb zerfallene Blätter kann man gut verwenden, wenn man selbstgeschöpftem Papier ein besonderes Aussehen geben will. Die frisch abgefallenen Blätter kann man gut zur herbstlichen Dekoration einsetzen. Wer auf die Herbstfärbung der Blätter achtet, wird feststellen, dass die Blätter einiger Arten gelb (Eberesche, Birke), rötlich (Spitzahorn, Blaubeere) oder aber braun (Buche) herabfallen. Das liegt daran, dass bestimmte Blattfarbstoffe in den Blättern verbleiben, während der grüne Blattfarbstoff (Chloroyphyll) im Herbst abgezogen wird. Baumarten unterscheiden sich auch sehr stark über die Rinde und die Holzfarbe. Viele werden die glatte Buchenrinde und die weißlich abblätternde Birkenrinde kennen. Helles Holz haben Birke und Ahorn. Das Eichenholz ist braun und sehr hart. Da das Holz der Buche rot-braun aussieht heißt die Buche auch Rotbuche. und erfahre mehr über Bäume Hier im Wald an den Sloopsteenen stehen verschiedene Baumarten. An der Würfel-Station kannst du einiges über Standortansprüche, Wuchs, Alter, Ökologie, Blatt, Blüte, Früchte, Wurzel, Rinde, Holz und Verwendung von vier Baumarten (Stieleiche, Rotbuche, Gemeine Kiefer, Sandbirke) erfahren. Lerne sie näher kennen und suche sie im Wald! 40
43 und löse das Waldtiere - Quiz der Station 11 a) Hornisse b) Maikäfer c) Abend Pfauenauge d) Großer Abendsegler e) Hirschkäfer f) Waldkauz g) Buntspecht h) Haselmaus i) Reh j) Dachs k) Rote Waldameise l) Iltis m) Kohlmeise n) Buchfink o) Eichelhäher p) Rotkelchen q) Habicht r) Kleiber s) Hermelin t) Steinmarder u) Baummarder v) Siebenschläfer w) Waldmaus 41
44 Sloopsteene In diesem Waldgebiet zwischen Wersen und Westerkappeln liegen die Großen Sloopsteene. Es handelt sich dabei um das am besten erhaltene Großsteingrab in Westfalen. Von den ursprünglich 4 Großsteingräbern in der Gegend sind nur noch die Kleinen Sloopsteene in Lotte- Halen erhalten geblieben. Die Großsteingräber sind in der Jungsteinzeit ( v. Chr.) entstanden und damit die ältesten Bauwerke der Menschheit in Europa. Ihre Erbauer gehören der Trichterbecherkultur an, die nach den typischen Tongefäßen, den Trichterbechern, benannt wurde. Bei einer Grabung am Seester Großsteingrab wurde ein solcher Trichterbecher aus Keramik gefunden. Eine Nachbildung des als Seester Fußvase bekannten Bechers ist in der Gastwirtschaft Schoppmeyer in Seeste aufbewahrt. Das Baumaterial des Grabes, die sog. Findlinge, sind Reste der Eiszeit aus Skandinavien und blieben nach dem Abschmelzen der Eismassen an Ort und Stelle liegen. Ursprünglich war das Grab außen mit einer Trockenmauer verschlossen und mit einem Erdhügel bedeckt. Da man sich nur sehr schwer vorstellen konnte, dass Menschen ohne heutige Maschinen solche großen Steine transportiert und aufgeschichtet haben könnten, glaubte man früher, die Gräber seien die Arbeit von Riesen (Hünen) gewesen und nannte die Gräber auch Hünengräber. Die Erbauer der Gräber waren jedoch Menschen wie wir und lebten von der Landwirtschaft. Vermutlich transportierten sie die Steine mit hölzernen Rollen und nutzten die schiefe Ebene, um die Grabkammer mit großen Steinen nach oben hin abzudecken. Man vermutet, dass die Gräber vielen Generationen einer Gemeinschaft als Grabstelle dienten. Nähere Informationen zu diesem Thema: Freilichtmuseum Oerlinghausen 42
45 und gehe auf Waldfühlung Spiel: Finde deinen Baum Material: Augenbinden Dies ist ein Spiel in Paaren. Verbinde die Augen deines Partners und führe ihn durch den Wald zu einem Baum, der dich anzieht. Hilf dem Blinden seinen Baum kennen zu lernen und sich Besonderheiten einzuprägen. Wenn er mit dem Baum gründlich Bekanntschaft gemacht hat, führe ihn wieder über kleine Umwege zum Ausgangspunkt zurück. Nun nimm die Augenbinde ab und lass deinen Partner seinen Baum wieder finden. Hat dein Partner seinen Baum gefunden, werden die Rollen getauscht. Spiel: Tuchgeheimnis Material: Tuch Einer von euch legt auf eine freie Fläche etwa 10 Dinge aus der Natur: ein Stück Borke, eine Feder, ein Birkenblatt, Kiefernadeln Darüber wird ein Tuch gelegt. Nun ruft er oder sie die anderen herbei. Das Tuch wird für eine halbe Minute abgedeckt und alle prägen sich die Gegenstände möglichst genau ein. Dann laufen alle los und suchen nach den gleichen Dingen. Wer kann sich an alle 10 Dinge erinnern und findet sie? Spiel: Blinde Raupe Material: Augenbinden Die Spieler verbinden sich mit Tüchern die Augen, stellen sich hintereinander auf und legen einander ihre Hände auf die Schultern. Der oder die erste hat die Augen nicht verbunden und führt nun die Raupe durch den Wald. Dabei sucht er oder sie einen Weg heraus, der besonders interessant zum Fühlen, Hören, Riechen ist. An besonderen Stellen lässt die führende Person die Raupe stoppen und tasten und schnuppern. Ist die Raupe weit genug gegangen, dürfen sich die Spieler ihre Augenbinden abnehmen und versuchen den Weg zurück zu gehen, den sie meinen, gegangen zu sein. 43
46 Station 12 Präriesee Der sogenannte Präriesee ist nach dem Sundermannsee das zweitgrößte Stillgewässer in Westerkappeln und ist wie dieser durch Sandabbau entstanden. Vor dem Sandabbau war das Gelände bewaldet und es wurde dort Fußball gespielt. Der Sportfischerverein Die Petrijünger hat den See für Angelzwecke gepachtet. Daher gilt auch Baden verboten für den See. Von der Sandstraße aus ist ein unbewachsenes Ufer zu erreichen, das im Sommer häufig zu Freizeitzwecken genutzt wird. Eigentümer und Pächter des Grundstücks sorgen hier für Ordnung und regeln das Betreten der Freifläche. Von hier aus hat man einen schönen Überblick über das Gewässer. Wege führen beinahe um den gesamten See herum. Achten Sie bitte beim Wandern auf die Bedürfnisse der Angler. Der Präriesee ist ihr Hauptangelgewässer und wird ganzjährig genutzt. Die folgenden Fischarten wurden schon im See gefangen: Rotauge, Rotfeder, Schleie, Regenbogenforelle, Karpfen, Hecht, Wels, Zander, Barsch. Die Hechte und Welse sind die größten Raubfische im See und erreichen Längen von mehr als einem Meter. Auch Teichmuscheln und Krebse kommen im See vor. und lerne die Fischarten kennen! Am Präriesee ist eine Station aufgebaut, an der du die verschiedenen im Präriesee lebenden Fische kennen lernen und erfahren kannst, in welcher Wassertiefe sich die Fische bevorzugt aufhalten. 44
47 Bemerkenswert ist die Vielfalt am Präriesee mit großen Schilfbeständen und einem Erlenbruchwald im Flachuferbereich sowie einem Kiefernwald an dem sandigen Steilufer zur Osnabrücker Straße hin. Auf dem See sind regelmäßig Haubentaucher und Blässhühner zuhause. Haubentaucher sind cm lang und haben eine Flügelspannweite von 59 bis 73 cm. Im Sommer sind die Vögel in ihrem Prachtkleid sehr leicht zu erkennen: sie schwimmen häufig mitten auf dem See und verschwinden immer wieder zu längeren Tauchgängen (Bis zu einer Minute!). Sie haben einen langen, von vorne weißen Hals, ein weißes Gesicht, einen schwarzen Scheitel und eine braunrote und schwarze Haube. Das Blässhuhn ist eine Art aus der Familie der Rallenvögel und wird auch Blässralle genannt. Es hat ein schwarzes Gefieder, einen weißen, relativ spitzen Schnabel und einen weißen Fleck (Hornschild) auf der Stirn. Dieser Blesse verdankt der Vogel seinen Namen. Blässhühner erreichen eine Länge von ca. 38 cm und sind gute Schwimmer und Taucher. An ihren kräftigen grünen Beinen befinden sich Schwimmlappen an den Zehen. Das Tauchen wird jeweils durch einen charakteristischen Kopfsprung im Wasser selbst eingeleitet Im Frühjahr besuchen Amphibien in größerer Zahl den Präriesee, um hier abzulaichen. Beim Ausbau der Osnabrücker Straße wurden deswegen sogenannte Krötentunnel am Sloopsteinweg und der Osnabrücker Straße eingebaut. Den Weg zu den Tunneln weisen fest installierte Amphibienzäune. Während der Wanderzeit sollten besonders Autofahrer den Bereich an der Sandstraße wegen der Amphibien meiden. 45
48 Im Sommer kann man verschiedene Libellenarten am Präriesee bewundern. Entgegen mancher Schauergeschichten können Libellen nicht stechen und ernähren sich von anderen Insekten, die sie im Flug erbeuten. Der Präriesee wird im Sommer häufig von Badegästen besucht. Wenn gebadet wird, sind die Möglichkeiten der Sportfischer stark eingeschränkt. Auch hinterlassen die Badegäste leider immer wieder Müllreste, die dann mühsam gesammelt werden müssen. Das größte Problem bilden aber die parkenden PKWs besonders entlang der Sandstraße. Die Gemeinde hat einseitig ein Halteverbot verhängt, damit die Straße auch für den landwirtschaftlichen Verkehr und Rettungsfahrzeuge befahrbar bleibt. und entdecke das bunte Reich der Gewässer! Material: Kescher oder Küchensieb, Becherlupe, weiße Schale Wer die Lebenswelt in Tümpel und See entdecken möchte, sollte sich langsam und vorsichtig dem Ufer nähern. Setze dich ruhig an den Uferrand und beobachte die Tiere und Insekten in ihren verschiedenen Lebensräumen. Mit dem Kescher oder Küchensieb kannst du die Tiere aus dem Wasser oder Schlamm fangen, sie vorsichtig von den Wasserpflanzen abstreifen und sie in ein mit Wasser gefüllte Schale geben. In einem weißen Gefäß sieht man die Insekten nicht nur besser, hieraus können wir sie mit dem Becher der Becherlupe auch vorsichtig herausfischen, um sie dann mit der Lupe genauer zu betrachten. Mit einem Bestimmungsbuch kannst du die gefangenen Tiere genau bestimmen. Anschließend müssen die Tiere wieder vorsichtig ins Wasser zurückgesetzt werden. 46
49 Spiel: Fisch schnappt Fliege - ein Spiel für schönes Wetter- Material: so viele Trinkbecher wie Mitspieler, Mineralwasser, Augenbinde, Wassersprühflasche Die mit Wasser gefüllten Trinkbecher stellen wir in einem Kreis mit jeweils 2m Abstand zwischen den Bechern auf. Ein Mitspieler stellt den gefräßigen Fisch dar, der im See schwimmt und auf die Fliege lauert. Er stellt sich in die Kreismitte und ihm werden die Augen verbunden. Fische können hervorragend hören und können Erschütterungen sofort wahrnehmen. Will man sich deshalb an einen Fisch anschleichen, muss man schon sehr vorsichtig sein. Alle anderen Mitspieler sind Beutetiere. Sie stellen sich in einem äußeren Kreis auf, etwa fünf Meter entfernt zum Fisch in der Kreismitte. Nun versucht auf das Zeichen des Spielleiters hin ein Beutetier, sich vorsichtig an seinen Wasserbecher heranzuschleichen, etwas davon zu trinken, den Becher wieder abzustellen und langsam zurückzugehen. Nimmt der Fisch ein Geräusch wahr, so darf er mit der Wasserspritze in diese Richtung spritzen. Wird die Beute getroffen, so muss sie Getroffen rufen und sich an dieser Stelle hinsetzen. Dann darf das nächste Tier sein Glück versuchen. Gelingt es ihm, unversehrt zurückzukommen, so setzt es sich an seinem Platz hin. 47
50 WICHTIGE BÜCHER Die folgende Literaturliste ist eine Auswahl von Büchern, die uns nützlich und interessant erscheinen und die wir gerne weiterempfehlen möchten. Aichele, D. u. Golte-Bechtle, M.: Was blüht denn da? ISBN Bouchner, M.: Der Spurenführer ISBN Cornell, Joseph: Mit Kindern die Natur erleben ISBN Engelhardt, Wolfgang: Was lebt in Tümpel, Bach und Weiher? ISBN Geißler, Uli: Umwelt Spiel und Spaßbuch ISBN Godet, Jean-Denis: Einheimische Bäume und Sträucher ISBN Langer, S. und Fladt, T.: Natur erlernen mit Kindern ISBN Mönter, Burckhard: Mittendrin. Ohne Wasser läuft nichts ISBN Oberholzer, A. u. Lässer, L.: Ein Garten für Tiere ISBN Papenberg, Michael: Nachbarn unterm Blätterdach ISBN Peterson, R.: Die Vögel Europas ISBN Straaß, Veronika: Natur erleben das ganze Jahr ISBN
51 PATEN Die folgenden Personen, Firmen, Institutionen und Vereine unterstützen den Naturerlebnisweg mit ihrer Patenschaft: Ullrich Hockenbrink, Wk PFIFFIKUS, Wk Heike Sievert, Wk Frau Korzen, Wk Fam. Kropf, Wk Fam. Leyschulte, Wk Freude am Garten, Wk Fam. Südbeck, Wk Fam. Wahlbrink, Wk Gärtnerei Kammler, Wk Roswitha u. Franz-Josef Lührmann, Recke H0-Freunde Tecklenburger Nordbahn, Wk Fam. Michel, Wk Fam. Gründel, Wk Fam. Schulte, Wk Fam. Strecke, Wk Schulpflegschaft Grundschule Stadt Herzlichen Dank 49
52 SPONSOREN Die Idee des Naturerlebnisweges konnte dank der großzügigen Spenden folgender Institutionen, Firmen und Vereine verwirklicht werden: 50
1. Wer ist Gregor und was macht er?
 Die hessischen Streuobstwiesen Hast du dir schon meine Seite (http://www.hessische- streuobstwiese.de/) durchgelesen? Ja? Dann kannst du als nächstes gerne die folgenden Aufgaben bearbeiten, um noch mehr
Die hessischen Streuobstwiesen Hast du dir schon meine Seite (http://www.hessische- streuobstwiese.de/) durchgelesen? Ja? Dann kannst du als nächstes gerne die folgenden Aufgaben bearbeiten, um noch mehr
Wiese in Leichter Sprache
 Wiese in Leichter Sprache 1 Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern die Natur. Zum Beispiel: Wir bauen Wege und Plätze aus Stein. Wo Stein ist, können Pflanzen nicht wachsen. Tiere
Wiese in Leichter Sprache 1 Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern die Natur. Zum Beispiel: Wir bauen Wege und Plätze aus Stein. Wo Stein ist, können Pflanzen nicht wachsen. Tiere
Die TOP 10 der kleinen Gartenhelfer
 Die TOP 10 der kleinen Gartenhelfer Dass Gartenarbeit anstrengend sein kann, weiß jeder. Viel anstrengender wäre sie aber, wenn nicht jeden Tag viele kleine Helfer mit uns ackern würden. Grund genug für
Die TOP 10 der kleinen Gartenhelfer Dass Gartenarbeit anstrengend sein kann, weiß jeder. Viel anstrengender wäre sie aber, wenn nicht jeden Tag viele kleine Helfer mit uns ackern würden. Grund genug für
Bienenweide. Hast du schon gewusst...?
 Hallo! Ich bin Fritz Frilaz und wohne hier im grünen Pausenhof! Ich freue mich, dass du mich besuchen möchtest! Verhalte dich bitte so, dass sich Tiere, Pflanzen und Kinder hier wohlfühlen können! Bienenweide
Hallo! Ich bin Fritz Frilaz und wohne hier im grünen Pausenhof! Ich freue mich, dass du mich besuchen möchtest! Verhalte dich bitte so, dass sich Tiere, Pflanzen und Kinder hier wohlfühlen können! Bienenweide
Bewerbung um den Naturschutzpreis für Projekte zum Schutz von Insekten Osnabrück WabOS e. V.
 Bewerbung um den Naturschutzpreis für Projekte zum Schutz von Insekten Wir, das heißt die Wagenburg Osnabrück (), möchten uns um den Naturschutzpreis für Projekte zum Schutz von Insekten bewerben. Obwohl
Bewerbung um den Naturschutzpreis für Projekte zum Schutz von Insekten Wir, das heißt die Wagenburg Osnabrück (), möchten uns um den Naturschutzpreis für Projekte zum Schutz von Insekten bewerben. Obwohl
Let it grow. Nistkästen für vögel
 Nistkästen für vögel In Städten fehlen Vögeln häufig natürliche Brutmöglichkeiten wie große Bäume mit Baumhöhlen. Nistkästen ersetzen diese auf einfache Weise und können an vielen Stellen angebracht werden.
Nistkästen für vögel In Städten fehlen Vögeln häufig natürliche Brutmöglichkeiten wie große Bäume mit Baumhöhlen. Nistkästen ersetzen diese auf einfache Weise und können an vielen Stellen angebracht werden.
Foto: Braun-Lüllemann Obstsortengarten Kloster Knechtsteden: Mit allen Sinnen erleben. In einfacher Sprache
 Foto: Braun-Lüllemann Obstsortengarten Kloster Knechtsteden: Mit allen Sinnen erleben In einfacher Sprache FÜR DIE SINNE Wir bieten Führungen und Mitmach-Aktionen an. Wir besuchen die Schafe, ernten Obst
Foto: Braun-Lüllemann Obstsortengarten Kloster Knechtsteden: Mit allen Sinnen erleben In einfacher Sprache FÜR DIE SINNE Wir bieten Führungen und Mitmach-Aktionen an. Wir besuchen die Schafe, ernten Obst
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt Leben im Wald. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt Leben im Wald Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Reihe: Veränderbare Arbeitsblätter für
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt Leben im Wald Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Reihe: Veränderbare Arbeitsblätter für
A: Eine Frage zum aktuellen Posten Lies dazu den Text an den Posten genau durch, dann kannst du die Frage beantworten.
 Naturlehrpfad am Bellacher Weiher Anleitung Auf deinen Postenkarten findest du immer drei Aufgaben: A: Eine Frage zum aktuellen Posten Lies dazu den Text an den Posten genau durch, dann kannst du die Frage
Naturlehrpfad am Bellacher Weiher Anleitung Auf deinen Postenkarten findest du immer drei Aufgaben: A: Eine Frage zum aktuellen Posten Lies dazu den Text an den Posten genau durch, dann kannst du die Frage
Infotexte und Steckbriefe zum Thema Tiere des Waldes Jede Gruppe bekommt einen Infotext und jedes Kind erhält einen auszufüllenden Steckbrief.
 Infotexte und Steckbriefe zum Thema Tiere des Waldes Jede Gruppe bekommt einen Infotext und jedes Kind erhält einen auszufüllenden Steckbrief. Bilder Daniela A. Maurer Das Eichhörnchen Das Eichhörnchen
Infotexte und Steckbriefe zum Thema Tiere des Waldes Jede Gruppe bekommt einen Infotext und jedes Kind erhält einen auszufüllenden Steckbrief. Bilder Daniela A. Maurer Das Eichhörnchen Das Eichhörnchen
Festival der Natur Am Tag der Biodiversität Natur Konkret
 Festival der Natur Landesweit sind dieses Wochenende rund 500 Veranstaltungen zu Pflanzen und Tieren in der Schweiz organisiert worden. «Am Tag der Biodiversität soll die Bedeutung der biologischen Vielfalt
Festival der Natur Landesweit sind dieses Wochenende rund 500 Veranstaltungen zu Pflanzen und Tieren in der Schweiz organisiert worden. «Am Tag der Biodiversität soll die Bedeutung der biologischen Vielfalt
Eulen des Burgwalds. Warum sind Eulen so interessant?
 Eulen des Burgwalds Vom König und vom Kobold der Nacht Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.v., Lindenstr. 5, 61209 Echzell Arbeitskreis Marburg-Biedenkopf, In den Erlengärten 10,
Eulen des Burgwalds Vom König und vom Kobold der Nacht Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.v., Lindenstr. 5, 61209 Echzell Arbeitskreis Marburg-Biedenkopf, In den Erlengärten 10,
Nisthilfe für nischenbrütende Vögel
 Nisthilfe für nischenbrütende Vögel Vorteile des Nistkastens erschwerter Zugang von Nesträubern durch vorgezogene Seitenwände und langem Dachüberstand Wahl des Aufhänge-Ortes geschützte, leicht besonnte,
Nisthilfe für nischenbrütende Vögel Vorteile des Nistkastens erschwerter Zugang von Nesträubern durch vorgezogene Seitenwände und langem Dachüberstand Wahl des Aufhänge-Ortes geschützte, leicht besonnte,
Einige heimische Arten
 Einige heimische Arten Auf den nachfolgenden Seiten finden sich Informationen zur Gefährdung und zu den Lebensraumansprüchen einzelner Arten sowie zu besonderen Schutzmaßnahmen. Für genauere Informationen
Einige heimische Arten Auf den nachfolgenden Seiten finden sich Informationen zur Gefährdung und zu den Lebensraumansprüchen einzelner Arten sowie zu besonderen Schutzmaßnahmen. Für genauere Informationen
Selber Kompost machen
 Selber Kompost machen Die Natur kennt keine Abfälle. Material, das sich zersetzen kann, können Sie weiter verwenden. Das wird Kompost genannt. Kompost ist ein guter Dünger für Blumen und Pflanzen. Selber
Selber Kompost machen Die Natur kennt keine Abfälle. Material, das sich zersetzen kann, können Sie weiter verwenden. Das wird Kompost genannt. Kompost ist ein guter Dünger für Blumen und Pflanzen. Selber
Die Stockwerke der Wiese
 Die Stockwerke der Wiese I. Die Stockwerke der Wiese..................................... 6 II. Der Aufbau der Blume........................................ 8 III. Die Biene..................................................
Die Stockwerke der Wiese I. Die Stockwerke der Wiese..................................... 6 II. Der Aufbau der Blume........................................ 8 III. Die Biene..................................................
Wiewowas? "Biologische Gewässeruntersuchung" Sielmanns Natur-Ranger "Frechdachse Wuppertal" Scheidtstr. 108, Wuppertal
 Wiewowas? "Biologische Gewässeruntersuchung" Dort, wo nur ganz wenige Menschen leben, kann man in der Regel aus jedem fließenden Gewässer trinken; so wie aus dem kleinen lappländischen See auf dem Bild.
Wiewowas? "Biologische Gewässeruntersuchung" Dort, wo nur ganz wenige Menschen leben, kann man in der Regel aus jedem fließenden Gewässer trinken; so wie aus dem kleinen lappländischen See auf dem Bild.
Eine Initiative der Berliner Stadtgüter zum Schutz der Bienen und anderer Bestäuber
 Eine Initiative der Berliner Stadtgüter zum Schutz der Bienen und anderer Bestäuber Wirtschaftsfaktor Biene Obwohl sie selbst nur wenige Milligramm auf die Waage bringen, sind sie wirtschaftlich gesehen
Eine Initiative der Berliner Stadtgüter zum Schutz der Bienen und anderer Bestäuber Wirtschaftsfaktor Biene Obwohl sie selbst nur wenige Milligramm auf die Waage bringen, sind sie wirtschaftlich gesehen
Lebensraum Bach 1. Abwasser: Dünger: Reinigung: Schreibe folgende Sätze zum passenden Bild:
 Lebensraum Bach 1 Der Bach ist ein vielfältiger Lebensraum. Jedes Tier und jede Pflanze hat ihre Aufgabe. Der Mensch verändert den Bach als Lebensraum stark. Für Tiere und Pflanzen wird es schwierig sich
Lebensraum Bach 1 Der Bach ist ein vielfältiger Lebensraum. Jedes Tier und jede Pflanze hat ihre Aufgabe. Der Mensch verändert den Bach als Lebensraum stark. Für Tiere und Pflanzen wird es schwierig sich
Teichfrosch: Lebensraum und Aussehen
 / 0 1 * 2 3 ' (. *. ' ' / ( 0. Teichfrosch: Lebensraum und Aussehen Der Teichfrosch kommt im Spreewald häufig vor. Er sitzt gern am Rand bewachsener Gewässer und sonnt sich. Dabei ist er stets auf der
/ 0 1 * 2 3 ' (. *. ' ' / ( 0. Teichfrosch: Lebensraum und Aussehen Der Teichfrosch kommt im Spreewald häufig vor. Er sitzt gern am Rand bewachsener Gewässer und sonnt sich. Dabei ist er stets auf der
nürnberger land Abenteuer Streuobstwiese Eine spannende Entdeckungsreise direkt vor der Haustüre
 nürnberger land Abenteuer Streuobstwiese Eine spannende Entdeckungsreise direkt vor der Haustüre www.nuernberger-land.de Vorwort Die Menschen leben gerne im Landkreis Nürnberger Land, weil man hier viel
nürnberger land Abenteuer Streuobstwiese Eine spannende Entdeckungsreise direkt vor der Haustüre www.nuernberger-land.de Vorwort Die Menschen leben gerne im Landkreis Nürnberger Land, weil man hier viel
CC BY-SA 3.0 Wikipedia- 4028mdk09
 CC BY-SA 3.0 Wikipedia- 4028mdk09 Das Wildschwein ist der Vorfahre unseres Hausschweins lebt in Familienverbänden, die nennt man Rotte frisst gerne Kräuter, Eicheln, Schwammerl, Mäuse und Frösche liebt
CC BY-SA 3.0 Wikipedia- 4028mdk09 Das Wildschwein ist der Vorfahre unseres Hausschweins lebt in Familienverbänden, die nennt man Rotte frisst gerne Kräuter, Eicheln, Schwammerl, Mäuse und Frösche liebt
Liebe macht blind. Krötenwanderung
 Krötenwanderung Arbeitsblatt 1 zum Mach-mit-Thema in TIERFREUND 2/2017 Liebe macht blind Bald ist es wieder so weit: Frösche, Kröten und andere Amphibien suchen ihre Laichplätze auf. Das ist für die Tiere
Krötenwanderung Arbeitsblatt 1 zum Mach-mit-Thema in TIERFREUND 2/2017 Liebe macht blind Bald ist es wieder so weit: Frösche, Kröten und andere Amphibien suchen ihre Laichplätze auf. Das ist für die Tiere
Hast du nun einiges auf dem Wege gelernt? Willkommen am Naturerlebnispfad-Fließgewässer-Oker! Pfeil _. Biologische _ e s _ r n_ g kraft. L _ a l _ a.
 Hast du nun einiges auf dem Wege gelernt? Willkommen am Naturerlebnispfad-Fließgewässer-Oker! Welche Pflanze erkennst du hier z. B. wieder? 32 Pfeil _ Und kennst du nun den Ausdruck für die Kraft, mit
Hast du nun einiges auf dem Wege gelernt? Willkommen am Naturerlebnispfad-Fließgewässer-Oker! Welche Pflanze erkennst du hier z. B. wieder? 32 Pfeil _ Und kennst du nun den Ausdruck für die Kraft, mit
Das Apfeljahr. am Donnerstag, 23. Oktober 2014, um 8:30 Uhr in der SJH-Kirche
 Das Apfeljahr am Donnerstag, 23. Oktober 2014, um 8:30 Uhr in der SJH-Kirche Musik zum Ankommen Einzugslied Begrüßung durch die Schüler (S.P. + J.K.) Gebet ( F.S.) Wir wollen beten: Guter Gott, du schenkst
Das Apfeljahr am Donnerstag, 23. Oktober 2014, um 8:30 Uhr in der SJH-Kirche Musik zum Ankommen Einzugslied Begrüßung durch die Schüler (S.P. + J.K.) Gebet ( F.S.) Wir wollen beten: Guter Gott, du schenkst
Meerfelder Maar. Litoralfauna
 Meerfelder Maar Litoralfauna Von Tabea Hammer, Mia Krümke und Mona Thyson Unsere Aufgabe war es herauszufinden, welches Kleinlebewesen im Uferbereich leben und anschließend ökologischen Bedeutung für den
Meerfelder Maar Litoralfauna Von Tabea Hammer, Mia Krümke und Mona Thyson Unsere Aufgabe war es herauszufinden, welches Kleinlebewesen im Uferbereich leben und anschließend ökologischen Bedeutung für den
Klärens Klarwasser. Was passiert bloß mit dem Braunschweiger Abwasser?
 Klärens Klarwasser Was passiert bloß mit dem Braunschweiger Abwasser? Hallo Kinder! Ich bin Klärens Klarwasser, ein Löwe aus Braunschweig. Den ganzen Tag habe ich geputzt, geschrubbt und gewaschen soooo
Klärens Klarwasser Was passiert bloß mit dem Braunschweiger Abwasser? Hallo Kinder! Ich bin Klärens Klarwasser, ein Löwe aus Braunschweig. Den ganzen Tag habe ich geputzt, geschrubbt und gewaschen soooo
"Freude am Schauen und Begreifen ist die schönste Gabe der Natur. Albert Einstein
 Natur erleben! "Freude am Schauen und Begreifen ist die schönste Gabe der Natur. Albert Einstein Öffne mit uns die Schatzkiste der Natur! Leopold Füreder Landesvorsitzender Tirol bietet abwechslungsreiche
Natur erleben! "Freude am Schauen und Begreifen ist die schönste Gabe der Natur. Albert Einstein Öffne mit uns die Schatzkiste der Natur! Leopold Füreder Landesvorsitzender Tirol bietet abwechslungsreiche
Windschutzstreifen. Lernziele. Aufgaben. IdeenSet Das Seeland-Grosses Moos Lernort 6: Windschutzstreifen Aufgabenblatt 1
 1/5 Aufgabenblatt 1 Windschutzstreifen Im Zusammenhang mit der 2.Juragewässerkorrektion und zahlreichen Gesamtmeliorationen sind im Moos viele Windschutzstreifen angelegt worden. Erfahrungen und Einsichten
1/5 Aufgabenblatt 1 Windschutzstreifen Im Zusammenhang mit der 2.Juragewässerkorrektion und zahlreichen Gesamtmeliorationen sind im Moos viele Windschutzstreifen angelegt worden. Erfahrungen und Einsichten
Hüpfdiktat 1 - Waldtiere
 Hüpfdiktat 1 - Waldtiere A B C D E 1 Weibchen zwei bis Diese Vögel werden jedoch jagen und haben ihre Augen der Nacht genannt. 2 Da Uhus vor allem in der 3 ihre Flügelspannweite 4 Leben lang zusammen,
Hüpfdiktat 1 - Waldtiere A B C D E 1 Weibchen zwei bis Diese Vögel werden jedoch jagen und haben ihre Augen der Nacht genannt. 2 Da Uhus vor allem in der 3 ihre Flügelspannweite 4 Leben lang zusammen,
Flussnapfschnecke Hakenkäfer. Eintagsfliege (Larve) Flohkrebs. große Köcherfliegenlarve. larve. Schlammschnecke. Kriebelmücke (Larve) Kugelmuschel
 Zeigertiere in Fließgewässern Mit diesen Zeigertieren kannst du die Wasserqualität von Fließgewässern bestimmen. (Dargestellt sind häufig Larven der genannten Tiere.) Eintagsfliege (Larve) Flohkrebs Flussnapfschnecke
Zeigertiere in Fließgewässern Mit diesen Zeigertieren kannst du die Wasserqualität von Fließgewässern bestimmen. (Dargestellt sind häufig Larven der genannten Tiere.) Eintagsfliege (Larve) Flohkrebs Flussnapfschnecke
Legekreis Heimische Vögel
 Legekreis Heimische Vögel Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Das Rotkehlchen ist ein Singvogel und gehört zur Familie der Drosseln. Es hat eine orangerote Brust, Kehle und
Legekreis Heimische Vögel Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Das Rotkehlchen ist ein Singvogel und gehört zur Familie der Drosseln. Es hat eine orangerote Brust, Kehle und
Bach, Graben, Fluss in Leichter Sprache
 Bach, Graben, Fluss in Leichter Sprache Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern sehr viel an der Natur. Zum Beispiel: Wir fällen Bäume. Aber Bäume sind wichtig für saubere Luft. Wir
Bach, Graben, Fluss in Leichter Sprache Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern sehr viel an der Natur. Zum Beispiel: Wir fällen Bäume. Aber Bäume sind wichtig für saubere Luft. Wir
Meer und Küste in Leichter Sprache
 Meer und Küste in Leichter Sprache Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern sehr viel an der Natur. Zum Beispiel: Wir fällen Bäume. Aber Bäume sind wichtig für saubere Luft. Wir Menschen
Meer und Küste in Leichter Sprache Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern sehr viel an der Natur. Zum Beispiel: Wir fällen Bäume. Aber Bäume sind wichtig für saubere Luft. Wir Menschen
10 Tipps für mehr nützliche Insekten im Garten
 10 Tipps für mehr nützliche Insekten im Garten Als Schädlingsvertilger, Schneckenjäger und Blütenbestäuber sind Käfer, Bienen und Co. unverzichtbar. Mit diesen 10 Tipps fördern Sie das Vorkommen nützlicher
10 Tipps für mehr nützliche Insekten im Garten Als Schädlingsvertilger, Schneckenjäger und Blütenbestäuber sind Käfer, Bienen und Co. unverzichtbar. Mit diesen 10 Tipps fördern Sie das Vorkommen nützlicher
Die Corvi-Krabbler - wir bauen ein Insektenhotel für unseren Schulhof
 Die Corvi-Krabbler - wir bauen ein Insektenhotel für unseren Schulhof Inhaltsverzeichnis 1. Das sind wir 2. Warum brauchen Insekten Hotels? 3. Wie gefährlich sind Wildbienen & Co.? 4. Der Bau des Hotels
Die Corvi-Krabbler - wir bauen ein Insektenhotel für unseren Schulhof Inhaltsverzeichnis 1. Das sind wir 2. Warum brauchen Insekten Hotels? 3. Wie gefährlich sind Wildbienen & Co.? 4. Der Bau des Hotels
Und was ist mit den Fischen?
 Und was ist mit den Fischen? Das Wasser ist auch Lebensraum für viele Tiere. Welche Tiere leben im Wasser? Sicher fallen dir gleich die Fische ein. Es gibt aber noch viel mehr Wasserbewohner! Hast du schon
Und was ist mit den Fischen? Das Wasser ist auch Lebensraum für viele Tiere. Welche Tiere leben im Wasser? Sicher fallen dir gleich die Fische ein. Es gibt aber noch viel mehr Wasserbewohner! Hast du schon
Legekreis. "Heimische Insekten"
 Legekreis "Heimische Insekten" Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Ameisen Ameisen leben in großen Staaten und jede Ameise hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Ameisen haben sechs
Legekreis "Heimische Insekten" Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Ameisen Ameisen leben in großen Staaten und jede Ameise hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Ameisen haben sechs
Folge 7: Naturerlebnispfad im Freizeitpark Marienfelde
 Folge 7: Naturerlebnispfad im Freizeitpark Marienfelde Der Ausflug führt nach Marienfelde in den Diedersdorfer Weg im Bezirk Tempelhof- Schöneberg. Hier befindet sich der Freizeitpark Marienfelde. Von
Folge 7: Naturerlebnispfad im Freizeitpark Marienfelde Der Ausflug führt nach Marienfelde in den Diedersdorfer Weg im Bezirk Tempelhof- Schöneberg. Hier befindet sich der Freizeitpark Marienfelde. Von
Tier-Steckbriefe. Tier-Steckbriefe. Lernziele: Material: Köcher iege. Arbeitsblatt 1 - Welches Tier lebt wo? Methode: Info:
 Tier-Steckbriefe Lernziele: Die SchülerInnen können Tiere nennen, die in verschiedenen Lebensräumen im Wald leben. Die SchülerInnen kennen die Lebenszyklen von Feuersalamander und Köcher iege. Sie wissen,
Tier-Steckbriefe Lernziele: Die SchülerInnen können Tiere nennen, die in verschiedenen Lebensräumen im Wald leben. Die SchülerInnen kennen die Lebenszyklen von Feuersalamander und Köcher iege. Sie wissen,
PFLEGEHINWEISE FÜR STREUWIESEN
 PFLEGEHINWEISE FÜR STREUWIESEN STREUWIESEN SELTENE LEBENSRÄUME UND BOTA- NISCHE SCHATZKAMMERN Klappertopf und Knabenkraut sind zwei der vielen gefährdeten Arten in Streuwiesen. Blütenreiche Streuwiesen
PFLEGEHINWEISE FÜR STREUWIESEN STREUWIESEN SELTENE LEBENSRÄUME UND BOTA- NISCHE SCHATZKAMMERN Klappertopf und Knabenkraut sind zwei der vielen gefährdeten Arten in Streuwiesen. Blütenreiche Streuwiesen
Insekten eine Nistgelegeneit bieten
 Insekten eine Nistgelegeneit bieten Warum? Insekten brauchen in unserer einseitigen und aufgeräumten Landschaft Nist- und Ruheplätze. Naturbelassene Gärten, von denen es nur noch wenige gibt, können mit
Insekten eine Nistgelegeneit bieten Warum? Insekten brauchen in unserer einseitigen und aufgeräumten Landschaft Nist- und Ruheplätze. Naturbelassene Gärten, von denen es nur noch wenige gibt, können mit
5 Alter und Wachstum
 Bäume Auftrag 14 5 Alter und Wachstum Ziel Ich bestimme das Alter eines Baumes. Auftrag Lies das Blatt Alter und Wachstum. Bestimme das Alter eines Baumes, indem du die Jahrringe zählst. Bestimme anhand
Bäume Auftrag 14 5 Alter und Wachstum Ziel Ich bestimme das Alter eines Baumes. Auftrag Lies das Blatt Alter und Wachstum. Bestimme das Alter eines Baumes, indem du die Jahrringe zählst. Bestimme anhand
Familie Thaller vlg. Wratschnig
 Natur auf unserem Betrieb Impressum: Herausgeber: Arge NATURSCHUTZ und LFI Kärnten; Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Margret Dabernig; Text und Layout: Mag. Margret Dabernig und Fam. Thaller; Fotos:
Natur auf unserem Betrieb Impressum: Herausgeber: Arge NATURSCHUTZ und LFI Kärnten; Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Margret Dabernig; Text und Layout: Mag. Margret Dabernig und Fam. Thaller; Fotos:
Infos zur Bio tonne. Wie sieht die Bio tonne aus? Wo stelle ich die Bio tonne hin?
 Infos zur Bio tonne Die Info gilt für den Landkreis Reutlingen, ohne die Städte Metzingen, Pfullingen und Reutlingen Wie sieht die Bio tonne aus? Die Bio tonne hat einen braunen Deckel. Oder die Bio tonne
Infos zur Bio tonne Die Info gilt für den Landkreis Reutlingen, ohne die Städte Metzingen, Pfullingen und Reutlingen Wie sieht die Bio tonne aus? Die Bio tonne hat einen braunen Deckel. Oder die Bio tonne
Stekendammsau und Heischer Tal. Fotos: Maren Janz / Umweltschutzamt LH Kiel
 Fotos: Maren Janz / Umweltschutzamt LH Kiel Station 1 Tal der Stekendammsau Von der das Tal querenden "Drei-Kronen-Brücke", über die die Fördestraße nach Schilksee führt, hat man einen weiten Blick. Die
Fotos: Maren Janz / Umweltschutzamt LH Kiel Station 1 Tal der Stekendammsau Von der das Tal querenden "Drei-Kronen-Brücke", über die die Fördestraße nach Schilksee führt, hat man einen weiten Blick. Die
Seekamper Seewiesen. Fotos: Maren Janz / Umweltschutzamt
 Fotos: Maren Janz / Umweltschutzamt Station 1 Seekamper Seewiesen Die liegen im Tal der Schilkseer Au. Die früher landwirtschaftlich genutzten Flächen wurden zwischen 2006 und 2011 wiedervernässt und haben
Fotos: Maren Janz / Umweltschutzamt Station 1 Seekamper Seewiesen Die liegen im Tal der Schilkseer Au. Die früher landwirtschaftlich genutzten Flächen wurden zwischen 2006 und 2011 wiedervernässt und haben
Wir wandern zur Letheheide
 Wir wandern zur Letheheide Ein Begleitbüchlein für kleine und große Menschen nach einem Entwurf von H.-F. Bornsiep Liebe Kinder, in diesem Büchlein findet ihr Tiere und Pflanzen, von denen ihr einige unterwegs
Wir wandern zur Letheheide Ein Begleitbüchlein für kleine und große Menschen nach einem Entwurf von H.-F. Bornsiep Liebe Kinder, in diesem Büchlein findet ihr Tiere und Pflanzen, von denen ihr einige unterwegs
STATION 3 AUWALD 1/5
 STATION 3 AUWALD 1/5 ERFAHREN TIERE BIBER Der Biber Baumeister im Schotterteich LEBENSRAUM: SEE Nagespuren vom Biber An einigen Bäumen am Pleschinger See erkennt man die Nagespuren des größten Säugetieres
STATION 3 AUWALD 1/5 ERFAHREN TIERE BIBER Der Biber Baumeister im Schotterteich LEBENSRAUM: SEE Nagespuren vom Biber An einigen Bäumen am Pleschinger See erkennt man die Nagespuren des größten Säugetieres
Kultur- und Lebensräume
 Kultur- und Lebensräume 14 Kultur- und Lebensräume 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Einstieg: Lebensräume
Kultur- und Lebensräume 14 Kultur- und Lebensräume 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Einstieg: Lebensräume
Verständnis für eine vernetzte Welt
 14 Verständnis für eine vernetzte Welt Der Ursprung der Permakultur liegt bei den Aborigines, den Ureinwohnern Australiens. Der Begriff wurde 1975 von Bill Mollison geprägt. Bill Mollison stammt aus Tasmanien,
14 Verständnis für eine vernetzte Welt Der Ursprung der Permakultur liegt bei den Aborigines, den Ureinwohnern Australiens. Der Begriff wurde 1975 von Bill Mollison geprägt. Bill Mollison stammt aus Tasmanien,
Mauersegler. Heidelerche. Bachstelze. Ziegenmelker
 Heidelerche Lebt auf trockenen, mageren Heideflächen mit einzeln stehenden Bäumen und kleinen Baumgruppen. Brütet auch in jungen Nadelwäldern (Tanne oder Kiefer). Mauersegler Brütet unter den Dächern älterer
Heidelerche Lebt auf trockenen, mageren Heideflächen mit einzeln stehenden Bäumen und kleinen Baumgruppen. Brütet auch in jungen Nadelwäldern (Tanne oder Kiefer). Mauersegler Brütet unter den Dächern älterer
Projekt Permakultur 2014 Barbara
 Projekt Permakultur 2014 Barbara ZIEL: einen essbaren Garten gestalten und Lebensraum für eine grosse Vielfalt von Pflanzen und Tieren schaffen. SITUATION: Garten in einer Ferienhauszone auf 560m, Haute
Projekt Permakultur 2014 Barbara ZIEL: einen essbaren Garten gestalten und Lebensraum für eine grosse Vielfalt von Pflanzen und Tieren schaffen. SITUATION: Garten in einer Ferienhauszone auf 560m, Haute
Station 1 Bodenleben
 Station 1 Bodenleben Handspaten, weißes Tuch, 2x Sieb, 3 Becherlupen, 3 Pinsel, Thermometer, Zeitschaltuhr, Bestimmungskarten Arbeitsaufträge: 1. Miss die Temperatur im Waldboden! Stecke das Thermometer
Station 1 Bodenleben Handspaten, weißes Tuch, 2x Sieb, 3 Becherlupen, 3 Pinsel, Thermometer, Zeitschaltuhr, Bestimmungskarten Arbeitsaufträge: 1. Miss die Temperatur im Waldboden! Stecke das Thermometer
Was sind Streuobstwiesen?
 Was sind Streuobstwiesen? Streuobstwiesen sind: Wiesen mit hochstämmigen Obstbäumen, die unterschiedlich alt sind und vielfältige Sorten haben. Flächen, die nicht gedüngt werden, Flächen ohne Einsatz von
Was sind Streuobstwiesen? Streuobstwiesen sind: Wiesen mit hochstämmigen Obstbäumen, die unterschiedlich alt sind und vielfältige Sorten haben. Flächen, die nicht gedüngt werden, Flächen ohne Einsatz von
Fleißige Arbeiterinnen, die imponieren. Warum wir die Bienen brauchen und sie uns.
 Fleißige Arbeiterinnen, die imponieren. Warum wir die Bienen brauchen und sie uns. Honigbienen sind aufgrund ihrer Bestäubungsleistung unsere drittwichtigsten Nutztiere nach Rindern und Schweinen. Allein
Fleißige Arbeiterinnen, die imponieren. Warum wir die Bienen brauchen und sie uns. Honigbienen sind aufgrund ihrer Bestäubungsleistung unsere drittwichtigsten Nutztiere nach Rindern und Schweinen. Allein
Exkursionen. Lebensräume. natur exkurs
 Exkursionen Lebensräume natur exkurs Exkursionen: Lebensräume 1 Auf diesen Exkursionen wird ein bestimmter Lebensraum als Ganzes vorgestellt. Wir beobachten die dort lebenden Pflanzen und Tiere, gehen
Exkursionen Lebensräume natur exkurs Exkursionen: Lebensräume 1 Auf diesen Exkursionen wird ein bestimmter Lebensraum als Ganzes vorgestellt. Wir beobachten die dort lebenden Pflanzen und Tiere, gehen
Dieses Smoothie-Rezeptbuch wurde von Kindern im Projekt Bio macht mobil gestaltet.
 Dieses Smoothie-Rezeptbuch wurde von Kindern im Projekt Bio macht mobil gestaltet. Mai Dezember 2016 WeSpE e.v. Schulstraße 4 49492 Westerkappeln Telefon: 05404-919627 E-Mail: wespenetzwerk@t-online.de
Dieses Smoothie-Rezeptbuch wurde von Kindern im Projekt Bio macht mobil gestaltet. Mai Dezember 2016 WeSpE e.v. Schulstraße 4 49492 Westerkappeln Telefon: 05404-919627 E-Mail: wespenetzwerk@t-online.de
Frank und Katrin Hecker. Der große NATURFÜ H RER
 Frank und Katrin Hecker Der große NATURFÜ H RER für Kindeflranzen Tiere & P 13 heimliches Doppelleben. Halb im Wasser und halb an Land. Ihre Eier legen sie in Teiche oder Bäche. Dar aus schlüpfen kleine
Frank und Katrin Hecker Der große NATURFÜ H RER für Kindeflranzen Tiere & P 13 heimliches Doppelleben. Halb im Wasser und halb an Land. Ihre Eier legen sie in Teiche oder Bäche. Dar aus schlüpfen kleine
Der Hund ernährt sich zum Beispiel von Fleisch, Wasser und Hundefutter.
 Tierlexikon Der Hund Der Hund stammt vom Wolf ab. Er lebt als Haustier beim Menschen. Der Hund kann klein sein,wie ein Chihuahua, oder groß wie ein Irischer Wolfshund. Sein Gewicht liegt zwischen 600 g
Tierlexikon Der Hund Der Hund stammt vom Wolf ab. Er lebt als Haustier beim Menschen. Der Hund kann klein sein,wie ein Chihuahua, oder groß wie ein Irischer Wolfshund. Sein Gewicht liegt zwischen 600 g
Antwort 31 Die Fließgeschwindigkeit des Abwassers wird vermindert. Frage 31 Wodurch erreicht man im Sandfang, dass sich der Sand absetzt?
 Frage 31 Wodurch erreicht man im Sandfang, dass sich der Sand absetzt? Antwort 31 Die Fließgeschwindigkeit des Abwassers wird vermindert. Frage 32 Welche Stoffe sind im Abwasser, die dort nicht hinein
Frage 31 Wodurch erreicht man im Sandfang, dass sich der Sand absetzt? Antwort 31 Die Fließgeschwindigkeit des Abwassers wird vermindert. Frage 32 Welche Stoffe sind im Abwasser, die dort nicht hinein
 Elefanten Elefanten erkennt man sofort an ihren langen Rüsseln, mit denen sie Gegenstände greifen und festhalten können, den gebogenen Stoßzähnen und den riesigen Ohren. Da Elefanten nicht schwitzen können,
Elefanten Elefanten erkennt man sofort an ihren langen Rüsseln, mit denen sie Gegenstände greifen und festhalten können, den gebogenen Stoßzähnen und den riesigen Ohren. Da Elefanten nicht schwitzen können,
Steinkäuzchen Gregor. und die Streuobstwiese
 Steinkäuzchen Gregor und die Streuobstwiese Liebe Kinder, mein Name ist Gregor, ich bin ein verschmustes, schlaues Steinkäuzchen und wohne in den hessischen Streuobstwiesen. Hier erlebe ich viele Abenteuer:
Steinkäuzchen Gregor und die Streuobstwiese Liebe Kinder, mein Name ist Gregor, ich bin ein verschmustes, schlaues Steinkäuzchen und wohne in den hessischen Streuobstwiesen. Hier erlebe ich viele Abenteuer:
Kennst Du alle Teile des Apfels?
 Arbeitsblatt 1 - Apfelkern wo steckst du? Kennst Du alle Teile des Apfels? Das musst du tun: 1. Schreibe die einzelnen Teile des Apfels in die Kästchen. 2. Verbinde die Kästchen mit den richtigen Teilen
Arbeitsblatt 1 - Apfelkern wo steckst du? Kennst Du alle Teile des Apfels? Das musst du tun: 1. Schreibe die einzelnen Teile des Apfels in die Kästchen. 2. Verbinde die Kästchen mit den richtigen Teilen
Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg (Hg.) Stadtwald Augsburg. 100 Tiere, Pflanzen und Pilze
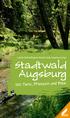 Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg (Hg.) Stadtwald Augsburg 100 Tiere, Pflanzen und Pilze 5 Verbände 6 Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg 6 Landesbund für Vogelschutz 8 Naturwissenschaftlicher
Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg (Hg.) Stadtwald Augsburg 100 Tiere, Pflanzen und Pilze 5 Verbände 6 Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg 6 Landesbund für Vogelschutz 8 Naturwissenschaftlicher
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Tiere im Frühling. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Tiere im Frühling Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Lernwerkstatt: Tiere im Frühling Bestellnummer:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Tiere im Frühling Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Lernwerkstatt: Tiere im Frühling Bestellnummer:
Biber. Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz. WWF Schweiz. Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0) Zürich
 WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Biber Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Fred F. Hazelhoff / WWF-Canon Steckbrief Grösse: 80-95
WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Biber Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Fred F. Hazelhoff / WWF-Canon Steckbrief Grösse: 80-95
FRAGEN ÜBER DEN HIRSCHEN: Was trägt der Hirsch auf dem Kopf?
 Vorbereitung beispielsweise im werkunterricht Im Werkunterricht können die Lochkarten hergestellt werden. Klebe die Vorlagen dazu auf einen Karton und schneide anschließend die Karten aus. Mit einem Nagel
Vorbereitung beispielsweise im werkunterricht Im Werkunterricht können die Lochkarten hergestellt werden. Klebe die Vorlagen dazu auf einen Karton und schneide anschließend die Karten aus. Mit einem Nagel
Insektenhotel. Insektenhotels schaffen Lebensräume für eine Vielzahl kleiner Helfer, die sich als äußerst nützlich erweisen.
 Insektenhotel Insektenhotels schaffen Lebensräume für eine Vielzahl kleiner Helfer, die sich als äußerst nützlich erweisen. Das Insektenhotel - Künstlich geschaffene Nist- und Überwinterungshilfe für Insekten
Insektenhotel Insektenhotels schaffen Lebensräume für eine Vielzahl kleiner Helfer, die sich als äußerst nützlich erweisen. Das Insektenhotel - Künstlich geschaffene Nist- und Überwinterungshilfe für Insekten
Mobile Museumskiste Artenvielfalt Lebensraum Gewässer. Arbeitsblätter. mit Lösungen
 Mobile Museumskiste Artenvielfalt Lebensraum Gewässer Arbeitsblätter mit Lösungen WAHR und UNWAHR 1. Gelbrandkäfer holen mit dem Hintern Luft! 2. Muscheln suchen sich eine neue, größere Schale, wenn sie
Mobile Museumskiste Artenvielfalt Lebensraum Gewässer Arbeitsblätter mit Lösungen WAHR und UNWAHR 1. Gelbrandkäfer holen mit dem Hintern Luft! 2. Muscheln suchen sich eine neue, größere Schale, wenn sie
Pfeilgiftfrösche. Wie sehen Pfeilgiftfrösche aus und sind sie wirklich giftig?
 Wie sehen aus und sind sie wirklich giftig? sind kleine Frösche und haben sehr auffällige, knallbunte Farben. Einige Frösche sind schwarz und haben gelbe, rote oder blaue Flecken, manche sind orange oder
Wie sehen aus und sind sie wirklich giftig? sind kleine Frösche und haben sehr auffällige, knallbunte Farben. Einige Frösche sind schwarz und haben gelbe, rote oder blaue Flecken, manche sind orange oder
Bauanleitung für ein Insektenhotel
 Bauanleitung für ein Insektenhotel Der Grundbaustein dieses Insektenhotels ist ein einfacher, relativ kleiner Kasten, der leicht selbst gebaut werden kann. Es ist möglich mehrere Kästen dieser Bauart zu
Bauanleitung für ein Insektenhotel Der Grundbaustein dieses Insektenhotels ist ein einfacher, relativ kleiner Kasten, der leicht selbst gebaut werden kann. Es ist möglich mehrere Kästen dieser Bauart zu
Graureiher und Stockente Anpassungen von Wassertieren an ihren Lebensraum S 2. Die Lebensweise der Stockente unter der Lupe
 Graureiher und Stockente Anpassungen von Wassertieren an ihren Lebensraum Reihe 6 M1 Verlauf Material S 2 LEK Glossar Die Lebensweise der Stockente unter der Lupe Die Stockente ist ein Vogel, den du sicher
Graureiher und Stockente Anpassungen von Wassertieren an ihren Lebensraum Reihe 6 M1 Verlauf Material S 2 LEK Glossar Die Lebensweise der Stockente unter der Lupe Die Stockente ist ein Vogel, den du sicher
Fruchtfolge. Baustein Nr. Die Fruchtfolge. Soja Vom Acker auf den Teller Ein Unterrichtskonzept des Soja Netzwerks
 Baustein Nr. Die Der Boden ist die Grundlage für das Wachstum der Pflanzen. Er bietet ein vielfältiges Ökosystem für unsere Tier- und Pflanzenwelt. Er ist unverzichtbar für die Erzeugung von Lebens- und
Baustein Nr. Die Der Boden ist die Grundlage für das Wachstum der Pflanzen. Er bietet ein vielfältiges Ökosystem für unsere Tier- und Pflanzenwelt. Er ist unverzichtbar für die Erzeugung von Lebens- und
Satzanfang/Satzende 1. Lies den Text. Setze nach jedem Satzende einen Strich. (/)
 Satzanfang/Satzende 1 Lies den Text. Setze nach jedem Satzende einen Strich. (/) die Wildschweine sind in unseren Wäldern die größten Tiere am Tag verstecken sie sich im Unterholz erst abends und in der
Satzanfang/Satzende 1 Lies den Text. Setze nach jedem Satzende einen Strich. (/) die Wildschweine sind in unseren Wäldern die größten Tiere am Tag verstecken sie sich im Unterholz erst abends und in der
Körperbau und Sinnesorgane
 Biberinfo: Körperbau und Sinnesorgane Der Biber ist das größte Nagetier Europas und kann bis zu 36 kg schwer und 1.30m lang werden. Der Schwanz des Bibers, die Biberkelle ist netzartig mit Schuppen bedeckt
Biberinfo: Körperbau und Sinnesorgane Der Biber ist das größte Nagetier Europas und kann bis zu 36 kg schwer und 1.30m lang werden. Der Schwanz des Bibers, die Biberkelle ist netzartig mit Schuppen bedeckt
Versuche mit Wasser. Das Rennen der Wassertiere Blühende Papierblumen Warm und kalt Eine Wasserlupe Bärlappsporen Löcher im Tiefkühlbeutel
 Auflistung der einzelnen Versuche Das Rennen der Wassertiere Blühende Papierblumen Warm und kalt Eine Wasserlupe Bärlappsporen Löcher im Tiefkühlbeutel Leitungswasser - Regenwasser Kletterwasser Wasser
Auflistung der einzelnen Versuche Das Rennen der Wassertiere Blühende Papierblumen Warm und kalt Eine Wasserlupe Bärlappsporen Löcher im Tiefkühlbeutel Leitungswasser - Regenwasser Kletterwasser Wasser
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Die große Frühlingswerkstatt. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Die große Frühlingswerkstatt Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de SCHOOL-SCOUT Die große Frühlingswerkstatt
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Die große Frühlingswerkstatt Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de SCHOOL-SCOUT Die große Frühlingswerkstatt
Vertikutieren richtig gemacht
 Vertikutieren richtig gemacht Hat sich über den Winter Moos und Rasenfilz im Garten breit gemacht? Wenn ja, sollte beides unbedingt entfernt werden, um den Rasen im Frühling wieder ordentlich zum Wachsen
Vertikutieren richtig gemacht Hat sich über den Winter Moos und Rasenfilz im Garten breit gemacht? Wenn ja, sollte beides unbedingt entfernt werden, um den Rasen im Frühling wieder ordentlich zum Wachsen
Unterrichtsmodul. UE 4: Wald-Exkursion
 UE 4: Wald-Exkursion Inhalt: SuS legen die Bestandteile eines Baumes aus Waldmaterialien, sprechen darüber, was Bäume zum Wachsen brauchen und lernen die Hauptbaumarten am Exkursionsort kennen. Auf einer
UE 4: Wald-Exkursion Inhalt: SuS legen die Bestandteile eines Baumes aus Waldmaterialien, sprechen darüber, was Bäume zum Wachsen brauchen und lernen die Hauptbaumarten am Exkursionsort kennen. Auf einer
Anleitung zum Erkennen funktioneller Gruppen
 Anleitung zum Erkennen funktioneller Gruppen Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie viele Pflanzen und Tiere an und um einen Baum herum leben? Tritt näher und wirf einen Blick auf die Vielfalt der
Anleitung zum Erkennen funktioneller Gruppen Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie viele Pflanzen und Tiere an und um einen Baum herum leben? Tritt näher und wirf einen Blick auf die Vielfalt der
Flurbereinigung. Arbeitsblatt 1. Erlebnis Natur 3 / Acker und Hecke
 Arbeitsblatt 1 Flurbereinigung Artenvielfalt und Veränderung der Landschaft Beschreibe die Veränderung der Landschaft von 1920 bis 2000! A. Landschaft um 1920 B. Landschaft um 2000 Zusatzinformationen
Arbeitsblatt 1 Flurbereinigung Artenvielfalt und Veränderung der Landschaft Beschreibe die Veränderung der Landschaft von 1920 bis 2000! A. Landschaft um 1920 B. Landschaft um 2000 Zusatzinformationen
Aufgabe 6: Nahrungsbeziehungen und Kreisläufe in einem Ökosystem
 Schüler/in Aufgabe 6: Nahrungsbeziehungen und Kreisläufe in einem Ökosystem LERNZIELE: Nahrungsbeziehungen und biologisches Gleichgewicht in Ökosystemen erklären Stoffkreislauf in einem Lebensraum ergänzen
Schüler/in Aufgabe 6: Nahrungsbeziehungen und Kreisläufe in einem Ökosystem LERNZIELE: Nahrungsbeziehungen und biologisches Gleichgewicht in Ökosystemen erklären Stoffkreislauf in einem Lebensraum ergänzen
Fleckis Milchlabor Mein Forscherheft
 Fleckis Milchlabor Mein Forscherheft Name Experiment 1 Fülle ein echerglas ungefähr halbvoll mit Milch, ein zweites halbvoll mit Wasser. Decke beide echergläser jeweils mit einem Uhrglas ab und stelle
Fleckis Milchlabor Mein Forscherheft Name Experiment 1 Fülle ein echerglas ungefähr halbvoll mit Milch, ein zweites halbvoll mit Wasser. Decke beide echergläser jeweils mit einem Uhrglas ab und stelle
Wasser. Versuche. Seite 26
 Wasser Versuche Seite 26 Wolken selber erzeugen Materialien 1. Erhitze Wasser im Wasserkocher. 2. Gieße das heiße Wasser in das Glasgefäß. Du wirst sehen, dass Dampf aufsteigt. 3. Halte nun die Schale
Wasser Versuche Seite 26 Wolken selber erzeugen Materialien 1. Erhitze Wasser im Wasserkocher. 2. Gieße das heiße Wasser in das Glasgefäß. Du wirst sehen, dass Dampf aufsteigt. 3. Halte nun die Schale
Übersicht über die Stationen
 Übersicht über die Stationen Station 1: Station 2: Station 3: Station 4: Station 5: Station 6: Station 7: Station 8: Die Erdkröte Der Grasfrosch Die Geburtshelferkröte Der Feuersalamander Tropische Frösche
Übersicht über die Stationen Station 1: Station 2: Station 3: Station 4: Station 5: Station 6: Station 7: Station 8: Die Erdkröte Der Grasfrosch Die Geburtshelferkröte Der Feuersalamander Tropische Frösche
Wo es quakt und klappert
 Regierungspräsidium Gießen Wo es quakt und klappert Ein Spaziergang durch die Aue Zum Malen, Lesen und Mitnehmen! Regierungspräsidium Gießen Obere Naturschutzbehörde Dez. 53.3 Gewässer entdecken Heft 2
Regierungspräsidium Gießen Wo es quakt und klappert Ein Spaziergang durch die Aue Zum Malen, Lesen und Mitnehmen! Regierungspräsidium Gießen Obere Naturschutzbehörde Dez. 53.3 Gewässer entdecken Heft 2
PUZZLESPIEL: AUF JEDEN TOPF PASST EIN DECKEL
 PUZZLESPIEL: AUF JEDEN TOPF PASST EIN DECKEL Zeit 10 Minuten Material Puzzleteile und Texte zu folgenden Paaren: Aguti Paranuss Fledermaus Bananenblüte Kolibri Helekonie/Ingwerblüte Pfeilgiftfrosch Bromelie
PUZZLESPIEL: AUF JEDEN TOPF PASST EIN DECKEL Zeit 10 Minuten Material Puzzleteile und Texte zu folgenden Paaren: Aguti Paranuss Fledermaus Bananenblüte Kolibri Helekonie/Ingwerblüte Pfeilgiftfrosch Bromelie
Alte Bäume im Garten? (aus aktuellem Anlass)
 Alte Bäume im Garten? (aus aktuellem Anlass) In den letzten Jahren wurden hier in Schleswig-Holstein in meiner direkten Umgebung einige bebaute und unbebaute Grundstücke verkauft. In fast jedem Fall konnte
Alte Bäume im Garten? (aus aktuellem Anlass) In den letzten Jahren wurden hier in Schleswig-Holstein in meiner direkten Umgebung einige bebaute und unbebaute Grundstücke verkauft. In fast jedem Fall konnte
Bericht zur Amphibienwanderung 2013 Trieben
 Bericht zur Amphibienwanderung 2013 Trieben Christine, Ernst & Irene Blatt Thomas, Michaela & Sebastian Blatt Susi Kalintsch Vroni & Gerald Oswald Fabian und Marie Schöfl & Katharina Gunegger Gertrude
Bericht zur Amphibienwanderung 2013 Trieben Christine, Ernst & Irene Blatt Thomas, Michaela & Sebastian Blatt Susi Kalintsch Vroni & Gerald Oswald Fabian und Marie Schöfl & Katharina Gunegger Gertrude
Guten Tag! Schön, dass du heute unser Museum erforscht.
 Guten Tag! Schön, dass du heute unser Museum erforscht. Gruppe 1 Lies die Aufgaben gut durch. Wenn du genau beobachtest, kannst du sie bestimmt lösen! Wir wünschen dir viel Vergnügen! Du startest bei der
Guten Tag! Schön, dass du heute unser Museum erforscht. Gruppe 1 Lies die Aufgaben gut durch. Wenn du genau beobachtest, kannst du sie bestimmt lösen! Wir wünschen dir viel Vergnügen! Du startest bei der
Grasland Schweiz. Oberstufe/Hauswirtschaft. Name:
 Die Schweiz ist ein typisches Grasland. Ihre Gesamtfläche beträgt 41 285 km 2. Neben dem Wald ist das Wiesland flächenmässig das wichtigste Landschaftselement der Schweiz. Die natürlichen Bedingungen wie
Die Schweiz ist ein typisches Grasland. Ihre Gesamtfläche beträgt 41 285 km 2. Neben dem Wald ist das Wiesland flächenmässig das wichtigste Landschaftselement der Schweiz. Die natürlichen Bedingungen wie
Weinbergschnecke. Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein. Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015
 0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Stationenlernen: Der Apfel - Fächerübergreifender Unterricht leicht gemacht
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Stationenlernen: Der Apfel - Fächerübergreifender Unterricht leicht gemacht Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Stationenlernen: Der Apfel - Fächerübergreifender Unterricht leicht gemacht Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
In diesem Jahr haben wir folgende Rezepte ausprobiert:
 In diesem Jahr haben wir folgende Rezepte ausprobiert: Nussschnitten als Tischkarten Pumuckl - Lebkuchen Fliegenpilze Schoko - Popcorn Schokoladenwürfel Nussschnitten als Tischkarten Du brauchst dazu:
In diesem Jahr haben wir folgende Rezepte ausprobiert: Nussschnitten als Tischkarten Pumuckl - Lebkuchen Fliegenpilze Schoko - Popcorn Schokoladenwürfel Nussschnitten als Tischkarten Du brauchst dazu:
Tiere im Winter. OPEL-ZOO Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung Seite 1
 OPEL-ZOO Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung Seite 1 Tiere im Winter Im Winter ist es sehr kalt und die Nahrung wird knapp, so dass sich viele Tiere zurückziehen. Bereits im Herbst verabschieden
OPEL-ZOO Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung Seite 1 Tiere im Winter Im Winter ist es sehr kalt und die Nahrung wird knapp, so dass sich viele Tiere zurückziehen. Bereits im Herbst verabschieden
Japanischer Staudenknöterich
 Blätter und Blüte Japanischer Staudenknöterich Blatt Japanischer Staudenknöterich Wissenschaftlicher Name: Fallopia japonica Beschreibung: Der japanische Staudenknöterich ist eine schnell wachsende, krautige
Blätter und Blüte Japanischer Staudenknöterich Blatt Japanischer Staudenknöterich Wissenschaftlicher Name: Fallopia japonica Beschreibung: Der japanische Staudenknöterich ist eine schnell wachsende, krautige
Pflanz- und Pflegeanleitung von Obstbäumchen. wiedersehen & wiederschmecken
 Pflanz- und Pflegeanleitung von Obstbäumchen alte bstsorten wiedersehen & wiederschmecken Vor der Pflanzung Obstbaumpflanzung Schritt für Schritt Gleich nach Abholung des Bäumchens sollten Sie es kurz
Pflanz- und Pflegeanleitung von Obstbäumchen alte bstsorten wiedersehen & wiederschmecken Vor der Pflanzung Obstbaumpflanzung Schritt für Schritt Gleich nach Abholung des Bäumchens sollten Sie es kurz
