Ada 95. Tasking. Gottlieb Bossert
|
|
|
- Josef Sachs
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Ada 95 Tasking Gottlieb Bossert
2 Gliederung meines Vortrags 1. Nebenläufige Prozesse 2. Tasking im Ada 95 Sprachkern 3. Das Tasking Konzept 4. Protected Objects
3 Nebenläufige Prozesse Wofür benötigt man nebenläufige Prozesse? Viele Aufgaben lassen sich effizient parallel ausführen Systeme mit mehreren Prozessoren eignen sich gut für verteilte Aufgaben Echtzeit Interaktionen mit der Realwelt müssen oft parallel bearbeitet werden
4 Tasking im Ada 95 Sprachkern Warum Tasking als Teil der Sprachspezifikation? Besser Portierbarkeit, da Betriebssystemschnittstellen zwar oft vorhanden, aber nicht genormt Komfortablere Verwendung, dadurch effizientere Anwendung
5 Tasking im Ada 95 Sprachkern Warum Tasking als Teil der Sprachspezifikation? Mehr Möglichkeiten zur Kontrolle Bessere Zeitsteuerung Größeres Optimierungspotential
6 Das Tasking Konzept Ada 95 bietet zwei unterschiedliche Konstrukte für nebenläufige Prozesse: Tasks Aktive Struktur zur parallelen Bearbeitung von Aufgaben Protected Objects Passive Konstruktion zur Datensyncronisation zwischen parallelen Prozessen
7 Task Definition Form ähnlich dem Paket: Unterteilung in Spezifikation und Body task T is... end T; task body T is... end T; -- specification -- body
8 Task Definition Ein Task ohne Interfaces sieht z.b. so aus: task T; task body T is begin Do_Something; end T;
9 Task Definition Ein Task kann auch in andere Strukturen eingebunden werden Dies kann auch ein anderer Task sein Der Zugriff auf private Bereiche ist hierdurch möglich procedure Foo is task T; task body T is begin Do_Something; end T; begin Do_Something_Else; end Foo;
10 Task Definition Ein Task kann auch als Typ definiert werden Typ ist limited und Zuweisung ist Konstante Ein Task Typ kann Diskriminanten besitzen task type T(I, J: Item); task body T is begin Do_Something(I, J); end T; declare Test: T(A, B); begin...
11 Task Definition Auf einen Task Typ kann auch ein Zeiger deuten Wie bei anderen Zeigern sind Zuweisungs- und Vergleichsoperatoren gestattet task type T(I, J: Item) is entry E(...); end T;... declare type Ref_T is access T; TX: Ref_T := new T(A, B); begin TX.E(...);...
12 Interaktion zwischen Tasks Interaktion zwischen Tasks durch direkten Nachrichtenaustausch Dieser Mechanismus wird in Ada Rendezvous genannt Beim Rendezvous wird der Einstiegspunkt (entry / accept) eines Tasks direkt aufgerufen
13 Einstiegspunkt (Entry / Accept) task One is entry E(...); end One; task body One is begin accept E(...) do Do_Something; end E; end One; task Two; task body Two is begin One.E(...); end Two; procedure Foo is begin One.E(...); end Foo;
14 Einstiegspunkt (Entry / Accept) Ein entry erlaubt Parameter wie eine Prozedur (in / out / in out) Der Aufrufende Task wird unterbrochen, bis die entry Anweisung abgearbeitet ist Einsprungspunkte werden abgewartet und squentiell abgearbeitet; ohne loop Schleife wird der Task danach beendet
15 Einstiegspunkt (Entry / Accept) task T is entry Put(X: in Item); entry Get(X: out Item); end T; task body T is V: Item; begin loop accept Put(X: in Item) do V := X; end Put; Modify(Thing); accept Get(X: out Item) do X := V; end Get; end loop; end T;
16 Die Select Anweisung Mittels der select Anweisung können alternative Einsprungpunkte / Dienste angeboten werden loop select accept Put(X: in...) do V := X; end Put; or accept Get(X: out...) do X := V; end Get; end select; end loop;
17 Die Select Anweisung Erfolgen mehrere Aufrufe eines Einsprungpunkts, so werden die Aufrufe in die Warteschlange des Einsprungpunkts gestellt und sukzessive abgearbeitet Haben mehrere Einsprungpunkte eines Tasks Elemente in der Warteschlange wird eine willkürliche Auswahl getroffen
18 Die Select Anweisung Im vorherigen Beispiel kann etwas ausgelesen werden, bevor es dem Task übergeben wurde oder während es übergeben wird... dies ist natürlich nicht sinnvoll! Mit when lassen sich Restriktionen für die select Anweisung festlegen
19 Die Select Anweisung Init: Boolean := False;... loop select accept Put(X: in...) do V := X; end Put; Init := True; or when Init and Put'Count = 0 => accept Get(X: out...) do X := V; end Get; end select; end loop;
20 Die Delay Anweisung Mit der delay Anweisung lässt sich ein Task für eine angegebene Zeit schlafen legen declare Minutes: constant Duration := 60.0 begin loop delay 5 * Minutes; Do_Something; end loop; end;
21 Die Delay Anweisung Das vorherige Beispiel ist nicht Optimal, da die loop Anweisung einen Overhead produziert... die Do_Something Anweisung eine bestimmte Zeit zur Ausführung benötigt... ein höher priorisierter Task uns warten lässt
22 Die Delay Until Anweisung Aus diesen Gründen kommt es bei dem vorherigen Beispiel zu einer wachsenden Verzögerung Besser wäre daher eine geplante Ausführung zu einem festgelegten Zeitpunkt Dies lässt sich mit der delay until Anweisung erreichen
23 Die Delay Until Anweisung declare use Calendar; Interval: constant Duration := 5 * Minutes; Next_Time: Time := Start_Time; begin loop delay until Next_Time; Do_Something; Next_Time := Next_Time + Interval; end loop; end;
24 Erweiterungen für Select Wartezeit: Wenn eine bestimmte Zeit lang kein Einstiegspunkt aufgerufen wurde, wird ein alternativer Anweisungsblock ausgeführt select accept Signal; or delay 10 * Minutes; Do_Something; end select;
25 Erweiterungen für Select Statt einer or delay Anweisung ist auch ein else Block möglich. Dieser wird bei nichtaufruf der Einstiegspunkts sofort ausgeführt und ist mit or delay 0.0 vergleichbar. select accept Signal; else Do_Something; end select;
26 Erweiterungen für Select Das select... else Konstrukt ist durchaus sinnvoll, da mit select auch eine Ausnahme für einen Einsprungspunktaufruf (also auf Seite des Aufrufers) definiert werden kann: select Resource.Lock; -- entry call else Put( Fehler: Die Resource ist bereits in Verwendung ); end select;
27 Erweiterungen für Select Auch select... or delay lässt sich für eine Ausnahme zu einem Einsprungspunkaufruf (auf Seite des Aufrufers) verwenden: select Resource.Lock; -- entry call or delay 1 * Minutes; Put( Fehler: Die Resource war die letzte Minute bereits in Verwendung ); end select;
28 Erweiterungen für Select Mittels asynchronous transfer of control (ATC) können laufende Berechnungen auch untebrochen werden Der Zeitpunkt des Abbruchs kann mittels Zeitgeber (delay / delay until) oder einer erfolgreichen entry Rückgabe erfolgen
29 Erweiterungen für Select Beispiele für Zeit- und Ereignisgesteuerte ATC: select delay 5 * Minutes; Put( Zeitüberschreitung ); then abort Calculation.Exec(X); end select; select Trigger.Wait; Put( Genauigkeit erreicht ); then abort Calculation.Iterate(X); end select;
30 Aktivierung von Tasks Tasks werden erst deklariert. Die Aktivierung und Ausführung der Tasks erfolgt nach der begin Anweisung. Der Block wird erst nach der Aktivierung aller Tasks ausgeführt. declare task A;... B: T; begin... end; aus Barnes, James: Programming in Ada 95, 2nd Edition, 1998, S. 436
31 Aktivierung von Tasks Anmerkung: Zeiger auf Tasks verhalten sich bei der Aktivierung anders: Deutet ein Zeiger (access type) auf einen Task, so wird der Task schon bei der Evaluierung des Zeigers aktiviert. Der Zeiger deutet dann auf den aktivierten Task
32 Terminierung von Tasks Tasks ohne Schleife werden nach ihrer Abarbeitung beendet Tasks mit Endlosschleife können eine select... or terminate Anweisung enthalten, damit sie automatisch beendet werden können. Ohne die terminate Anweisung kann der aufrufende Block nicht beendet werden
33 Terminierung von Tasks Auf die terminate Alternative im select Block können keine weiteren Anweisungen folgen Sinnvoll ist es daher zusätzlich eine Stop Routine zu implementieren, damit der Task sauer beendet werden kann Ausführen select... or accept Stop do... end Stop; or terminate; end select;
34 Terminierung von Tasks Tasks könne mit abort auch gewaltsam beendet werden Bei abort werden alle aufgerufenen Unterprogramme des Tasks ebenfalls abgebrochen Befindet sich der Task oder eines der Unterprogramme in einem Rendezvous treten Komplikationen auf
35 Terminierung von Tasks Wird der aufrufende Task in einem Rendezvous mit abort beendet, so wird der aufgerufenen Task nicht beeinflusst Wird der aufgerufene Task beendet, so wird eine Tasking_Error Eception propagiert. Dieses Vorgehen soll verhindern, dass kritische Serverprozesse Daten verlieren
36 Terminierung von Tasks Neben dem Rendezvous kommt es auch dann zu Komplikationen, wenn der zu beendende Task mit einem Protected Object kommunizert Prinzipiell sollte die Verwendung der abort Anweisung auf Ausnahmesituationen begrenzt werden (Der Zustand eine Tasks lässt sich abfragen)
37 Terminierung von Tasks Eine Ausnahmesituation für die abort Anweisung kann die Exception-Behandlung sein, da ein Block nur verlassen werden kann wenn alle seine Tasks beendet sind
38 Ausnahmebehandlung Die Ausnahme Tasking_Error wird erhoben bei Fehlern während der Akivierung eines Tasks... beim Terminieren unter bestimmten Bedingungen... wenn sich beim Beenden noch Tasks in einer Wartschlange befinden
39 Ausnahembehandlung Tritt eine Ausnahme bei einem Rendezvous in einer accept Anweisung auf und wird nicht intern behandelt, so wird diese Ausnahme an beide Tasks propagiert Dies kann z.b. dazu eingesetzt werden den Aufrufer über einen Fehler zu Informieren
40 Unzulänglichkeiten Tasks eigenen sich nicht besonders gut zur Syncronisation von Daten, da sie in diesem Falle als aktive Komponenten einen unnötigen Overhead produzieren, was zu einer schlechten Performance führt... keine sicheren Zugriffsbedingungen bieten (z.b. Entry'Count) {Anm: Mit vorgelagerten Proxy -Tasks unter Performance- und Komfortverlust trotzdem realisierbar}
41 Protected Objects Protected Objects wurden in Ada 95 neu eingeführt um diese Unzulänglichkeiten zu beheben Es handelt sich bei diesen um passive Strukturen Einem Protected Object ist kein Task zugeordent. Es wir vom Laufzeitsystem verwaltet.
42 Protected Object Definition Wie auch beim Task ähnelt die Form dem Paket, aber... protected P is... end P; protected body P is... end P; -- specification -- body
43 Protected Object Definition... Daten müssen im privaten Teil der Spezifikation definiert werden protected P is -- specification... private V: Item := Initial_Value; end P;
44 Protected Object Definition Ein Protected Object kann ebenso in andere Strukturen eingebunden werden Es kann auch als Typ deklariert werden Auf einen Protected Object Typ kann auch ein Zeiger deuten (access type)
45 Prozeduren, Funktionen, Entry Anweisungen Ein Protected Object kann wie ein Paket Prozeduren und Funkionen enthalten Des weiteren können entry Anweisungen mit Barrierekonditionen definiert werden Alle drei Konstrukte verhalten sich jedoch anders als gewohnt
46 Prozeduren Prozeduren in Protected Objects besitzen im gegensatz zu Prozeduren in anderen Strukturen eine Exklusivität: Während des Zugriffs auf eine Prozedur ist das gesamte Protected Object gesperrt; weitere Zugriffsversuche werde in eine Wartschlange gestellt Eine Prozedur hat Schreibrechte
47 Funktionen Neben Prozeduren gibt es auch Funktionen im Protected Object Funktionen besitzen nur Leserechte Solange ein Protected Object nicht durch eine Prozedur oder ein Entry gesperrt ist können mehrere Funktionen parallel ausgeführt werden
48 Die Entry Anweisung Oft ist es notwendig, dass Aufrufte nur unter bestimmten Bedingungen bearbeitet werden können entry Anweisungen in Protected Objects verlangen die Festlegung von Barrierekonditionen entry Anweisungen bieten wie auch Prozeduren Exklusivität und Warteschlangen
49 Die Entry Anweisung protected P is entry Put(X: in Item); entry Get(X: out Item); private V: Item; Empty: Boolean := True; end P; protected body P is entry Put(X: in Item) when Empty is begin V := X; Empty := False; end Put; entry Get(X: out Item) when not Empty is begin X := V; Empty := True; end Get; end P;
50 Barrierekonditionen Im Beispiel kann immer ein Element in P gelegt und dann wieder herausgenommen werden Bei jeder Aktion im Beispiel wird dazu die Variable für die Barrierekondition invertiert Alle Aktionen finden exklusiv statt, nach jeder Aktion werden alle Barrieren neu überprüft und wartende Anfragen bearbeitet
51 Die Requeue Anweisung Manchmal ist es sinnvoll eine erfolgreiche Anfrage wieder in eine Wartschlange einzufügen. Dies lässt sich mit der requeue Anweisung realisieren Die requeue Anweisung kann nur aus meinem entry heraus aufgerufen werden
52 Die Requeue Anweisung Ein Task dessen Anfrage mit requeue wieder in eine Warteschlange gelegt wurde kann nicht mit abort abgebrochen werden Soll dies möglich sein, so muss die Anfrage mit requeue Entry with abort behandelt werden Dies kann jedoch zu Komplikationen führen...
53 Requeue Beispiel protected Trigger is entry Wait; entry Signal; private entry Reset; Go: Boolean := False; end Trigger; protected body Trigger is entry Wait when Go is begin null; end Wait; entry Signal when True is begin Go := True; requeue Reset; end Signal; entry Reset when Wait'Count = 0 is begin Go := False; end Reset; end Trigger;
54 Requeue Beispiel Würde man im vorherigen Beispiel den Abbruch eines Tasks in der Reset Warteschlange mittels requeue Reset with abort gestatten, so könnte dies dazu führen, dass der Trigger kleben bleibt.
55 Anmerkungen Wenn möglich werden die Tasks in Ada auf die Taskingschnittstellen des Betriebssystems abgebildet Für den Echtzeitbereich existiert ein Annex, welcher Erweiterungen zum Scheduling definiert Mit pragma Anweisungen lässt sich das Multitasking Verhalten von Ada anpassen (z.b. pragma Atomic)
56 Schlußfolgerungen Mit den gebotenen Tasking Fähigkeiten lassen sich relativ komfortabel nebenläufige Prozesse einsetzen Mit den Protected Objects lassen sich Daten zwischen parallelen Prozessen gut syncroniseren
57 Fragen?
58 Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!
Echtzeitprogrammierung mit Ada. Frank Feinbube Seminar: Prozesssteuerung und Robotik
 Echtzeitprogrammierung mit Ada Frank Feinbube Seminar: Prozesssteuerung und Robotik Agenda 2 Einführung Geschichte Sprachfeatures Echtzeitprogrammierung Zeiten und Uhren Multitasking & Rendezvous Prioritäten
Echtzeitprogrammierung mit Ada Frank Feinbube Seminar: Prozesssteuerung und Robotik Agenda 2 Einführung Geschichte Sprachfeatures Echtzeitprogrammierung Zeiten und Uhren Multitasking & Rendezvous Prioritäten
Unterprogramme. Komplexes Verhalten kann modular mit Hilfe von Unterprogrammen beschrieben werden Es gibt zwei Arten von Unterprogrammen:
 Unterprogramme Dr. Wolfgang Günther Unterprogramme 2 Unterprogramme Komplexes Verhalten kann modular mit Hilfe von Unterprogrammen beschrieben werden Es gibt zwei Arten von Unterprogrammen: Prozeduren
Unterprogramme Dr. Wolfgang Günther Unterprogramme 2 Unterprogramme Komplexes Verhalten kann modular mit Hilfe von Unterprogrammen beschrieben werden Es gibt zwei Arten von Unterprogrammen: Prozeduren
1.7 Fehler- und Ausnahmebehandlung
 1.7 Fehler- und Ausnahmebehandlung Ein Beispiel: class PhoneBook { int capacity; String names[]; int numbers[]; int count; PhoneBook(int cap) { capacity = cap; names = new String[cap+1]; numbers = new
1.7 Fehler- und Ausnahmebehandlung Ein Beispiel: class PhoneBook { int capacity; String names[]; int numbers[]; int count; PhoneBook(int cap) { capacity = cap; names = new String[cap+1]; numbers = new
Bedingte Ausdrücke: (a > b)? a : b (C) if a > b then a else b case x of 1 => f1(y) 2 => f2(y) => g(y) (ML)
 Ausdrücke Infix-Notation Prefix-Notation Postfix-Notation a (b +c) a+bc a bc+ Operator-Assoziativität und -Preceedence: a +b c entwpricht a +(b c) (Pascal, C,... ) a =b
Ausdrücke Infix-Notation Prefix-Notation Postfix-Notation a (b +c) a+bc a bc+ Operator-Assoziativität und -Preceedence: a +b c entwpricht a +(b c) (Pascal, C,... ) a =b
8 Zugriffstypen ( Zeiger )
 8 Zugriffstypen ( Zeiger ) 1. Zugriffstypen, die auf Daten in einem Storage Pool zeigen Heap. 2. Allgemeine Zugriffstypen, die auf (mehr oder weniger) beliebige Daten zeigen. 3. Zugriffsparameter für Unterprogramme
8 Zugriffstypen ( Zeiger ) 1. Zugriffstypen, die auf Daten in einem Storage Pool zeigen Heap. 2. Allgemeine Zugriffstypen, die auf (mehr oder weniger) beliebige Daten zeigen. 3. Zugriffsparameter für Unterprogramme
Java Anweisungen und Ablaufsteuerung
 Informatik 1 für Nebenfachstudierende Grundmodul Java Anweisungen und Ablaufsteuerung Kai-Steffen Hielscher Folienversion: 24. Januar 2017 Informatik 7 Rechnernetze und Kommunikationssysteme Inhaltsübersicht
Informatik 1 für Nebenfachstudierende Grundmodul Java Anweisungen und Ablaufsteuerung Kai-Steffen Hielscher Folienversion: 24. Januar 2017 Informatik 7 Rechnernetze und Kommunikationssysteme Inhaltsübersicht
Einstieg in die Informatik mit Java
 1 / 34 Einstieg in die Informatik mit Java weitere Anweisungen Gerd Bohlender Institut für Angewandte und Numerische Mathematik Gliederung 2 / 34 1 Verbundanweisung 2 Bedingte Anweisung 3 Auswahlanweisung
1 / 34 Einstieg in die Informatik mit Java weitere Anweisungen Gerd Bohlender Institut für Angewandte und Numerische Mathematik Gliederung 2 / 34 1 Verbundanweisung 2 Bedingte Anweisung 3 Auswahlanweisung
Funktionen. Überblick über Stored Functions. Syntax zum Schreiben einer Funktion. Schreiben einer Funktion
 Überblick über Stored Functions Funktionen Eine Funktion ist ein benannter PL/SQL- Block, der einen Wert zurückgibt. Eine Funktion kann in der Datenbank als Objekt zur wiederholbaren Ausführung gespeichert
Überblick über Stored Functions Funktionen Eine Funktion ist ein benannter PL/SQL- Block, der einen Wert zurückgibt. Eine Funktion kann in der Datenbank als Objekt zur wiederholbaren Ausführung gespeichert
Musterlösung Prüfung SS 2002
 Musterlösung Prüfung SS 2002 Fach: I4neu (SEE, KOS, GRS, BTS) Teilprüfung: Betriebssystem Tag: 2.7.2002 8:15 12:15 Raum 1006 Bearbeitungszeit: 72 Minuten Name:... Matr.Nr.:... Punkte:... Note:... Hilfsmittel:
Musterlösung Prüfung SS 2002 Fach: I4neu (SEE, KOS, GRS, BTS) Teilprüfung: Betriebssystem Tag: 2.7.2002 8:15 12:15 Raum 1006 Bearbeitungszeit: 72 Minuten Name:... Matr.Nr.:... Punkte:... Note:... Hilfsmittel:
Prozedurale Datenbank- Anwendungsprogrammierung
 Idee: Erweiterung von SQL um Komponenten von prozeduralen Sprachen (Sequenz, bedingte Ausführung, Schleife) Bezeichnung: Prozedurale SQL-Erweiterung. In Oracle: PL/SQL, in Microsoft SQL Server: T-SQL.
Idee: Erweiterung von SQL um Komponenten von prozeduralen Sprachen (Sequenz, bedingte Ausführung, Schleife) Bezeichnung: Prozedurale SQL-Erweiterung. In Oracle: PL/SQL, in Microsoft SQL Server: T-SQL.
Arrays. Arrays werden verwendet, wenn viele Variablen benötigt werden. Der Vorteil in Arrays liegt darin, dass man nur eine Variable deklarieren muss
 Arrays FTI 41 2005-09-09 Arrays werden verwendet, wenn viele Variablen benötigt werden. Der Vorteil in Arrays liegt darin, dass man nur eine Variable deklarieren muss z.b. Dim Werte(x) As Single. Wobei
Arrays FTI 41 2005-09-09 Arrays werden verwendet, wenn viele Variablen benötigt werden. Der Vorteil in Arrays liegt darin, dass man nur eine Variable deklarieren muss z.b. Dim Werte(x) As Single. Wobei
CADSTAR MRP-Link. MRP-Link ist erstellt von:
 CADSTAR MRP-Link MRP-Link ist erstellt von: CSK CAD Systeme Kluwetasch Zip: 2161 Town: Altenholz Street: Struckbrook 9 Tel: +9-31-32917-0 Fax: +9-31-32917-26 Web: http://www.cskl.de E-Mail: Kluwetasch@cskl.de
CADSTAR MRP-Link MRP-Link ist erstellt von: CSK CAD Systeme Kluwetasch Zip: 2161 Town: Altenholz Street: Struckbrook 9 Tel: +9-31-32917-0 Fax: +9-31-32917-26 Web: http://www.cskl.de E-Mail: Kluwetasch@cskl.de
Einstieg in die Informatik mit Java
 1 / 41 Einstieg in die Informatik mit Java Weitere Anweisungen Gerd Bohlender Institut für Angewandte und Numerische Mathematik Gliederung 2 / 41 1 Überblick 2 Verbundanweisung 3 Bedingte Anweisung 4 Auswahlanweisung
1 / 41 Einstieg in die Informatik mit Java Weitere Anweisungen Gerd Bohlender Institut für Angewandte und Numerische Mathematik Gliederung 2 / 41 1 Überblick 2 Verbundanweisung 3 Bedingte Anweisung 4 Auswahlanweisung
Boolean Wertemenge: Wahrheitswerte {FALSE,TRUE}, auch {0,1} Deklaration:
 Boolean Wertemenge: Wahrheitswerte {,}, auch {,} Deklaration: VAR present,billig,laut,gefunden : BOOLEAN; Ein-/Ausgabe: keine! Operatoren: Negation, Verneinung NOT ~ Konjunktion, logisches UND AND & Disjunktion,
Boolean Wertemenge: Wahrheitswerte {,}, auch {,} Deklaration: VAR present,billig,laut,gefunden : BOOLEAN; Ein-/Ausgabe: keine! Operatoren: Negation, Verneinung NOT ~ Konjunktion, logisches UND AND & Disjunktion,
Musterlösung Prüfung WS 01/02
 Musterlösung Prüfung WS 01/02 Fach: I3 Software-Technik (SEE, GRS, BTS) Teilprüfung: Betriebssysteme Tag: 29.01.2002 10:45 14.45 Raum: 1006 Bearbeitungszeit: 4 Stunden Name:... Matr.Nr.:... Punkte:...
Musterlösung Prüfung WS 01/02 Fach: I3 Software-Technik (SEE, GRS, BTS) Teilprüfung: Betriebssysteme Tag: 29.01.2002 10:45 14.45 Raum: 1006 Bearbeitungszeit: 4 Stunden Name:... Matr.Nr.:... Punkte:...
Elementare Konzepte von
 Elementare Konzepte von Programmiersprachen Teil 2: Anweisungen (Statements) Kapitel 6.3 bis 6.7 in Küchlin/Weber: Einführung in die Informatik Anweisungen (statements) in Java Berechnung (expression statement)
Elementare Konzepte von Programmiersprachen Teil 2: Anweisungen (Statements) Kapitel 6.3 bis 6.7 in Küchlin/Weber: Einführung in die Informatik Anweisungen (statements) in Java Berechnung (expression statement)
Thread-Synchronisation in in Java. Threads Wechselseitiger Ausschluss Bedingte Synchronisation Beispiel: Warteschlangen
 Thread-Synchronisation in in Java Threads Wechselseitiger Ausschluss Bedingte Synchronisation Beispiel: Warteschlangen Die Klasse Thread Die Die Klasse Thread gehört zur zur Standardbibliothek von von
Thread-Synchronisation in in Java Threads Wechselseitiger Ausschluss Bedingte Synchronisation Beispiel: Warteschlangen Die Klasse Thread Die Die Klasse Thread gehört zur zur Standardbibliothek von von
6: Nebenläufigkeit in Ada
 6: Nebenläufigkeit in Ada In diesem Kapitel: Wie implementiert man Tasks in Ada? Wie kommunizieren Tasks miteinander, welche Syntax benutzen sie? Grundlegende Ideen. Viele Details und Feinheiten werden
6: Nebenläufigkeit in Ada In diesem Kapitel: Wie implementiert man Tasks in Ada? Wie kommunizieren Tasks miteinander, welche Syntax benutzen sie? Grundlegende Ideen. Viele Details und Feinheiten werden
(Aufgaben zu Wertzuweisungen siehe Vorlesungsbeilage S. 49)
 Anweisungen Eine Anweisung ist eine in einer beliebigen Programmiersprache abgefaßte Arbeitsvorschrift für einen Computer. Jedes Programm besteht aus einer bestimmten Anzahl von Anweisungen. Wir unterscheiden
Anweisungen Eine Anweisung ist eine in einer beliebigen Programmiersprache abgefaßte Arbeitsvorschrift für einen Computer. Jedes Programm besteht aus einer bestimmten Anzahl von Anweisungen. Wir unterscheiden
Einstieg in die Informatik mit Java
 Vorlesung vom 6.11.07, Weitere Anweisungen Übersicht 1 Verbundanweisung 2 Bedingte Anweisung 3 Auswahlanweisung 4 for Schleife 5 while Schleife 6 do Schleife 7 break Anweisung 8 continue Anweisung 9 Leere
Vorlesung vom 6.11.07, Weitere Anweisungen Übersicht 1 Verbundanweisung 2 Bedingte Anweisung 3 Auswahlanweisung 4 for Schleife 5 while Schleife 6 do Schleife 7 break Anweisung 8 continue Anweisung 9 Leere
Prozesszustände (1a)
 Prozesszustände (1a) NOT EXISTING DELETED CREATED Meta-Zustand (Theoretische Bedeutung) Prozesszustände Multiuser Umfeld (1c) Hintergrund-Prozess - der Prozess startet im Hintergrund - my-commandbin &
Prozesszustände (1a) NOT EXISTING DELETED CREATED Meta-Zustand (Theoretische Bedeutung) Prozesszustände Multiuser Umfeld (1c) Hintergrund-Prozess - der Prozess startet im Hintergrund - my-commandbin &
Ausnahmebehandlung in Java
 Ausnahmebehandlung in Java class A { void foo() throws Help, SyntaxError {... class B extends A { void foo() throws Help { if (helpneeded()) throw new Help();... try {... catch (Help e) {... catch (Exception
Ausnahmebehandlung in Java class A { void foo() throws Help, SyntaxError {... class B extends A { void foo() throws Help { if (helpneeded()) throw new Help();... try {... catch (Help e) {... catch (Exception
Einstieg in die Informatik mit Java
 1 / 47 Einstieg in die Informatik mit Java Anweisungen Gerd Bohlender Institut für Angewandte und Numerische Mathematik Gliederung 2 / 47 1 Ausdrucksanweisung 2 Einfache Ausgabeanweisung 3 Einfache Eingabeanweisung,
1 / 47 Einstieg in die Informatik mit Java Anweisungen Gerd Bohlender Institut für Angewandte und Numerische Mathematik Gliederung 2 / 47 1 Ausdrucksanweisung 2 Einfache Ausgabeanweisung 3 Einfache Eingabeanweisung,
Herzlich willkommen!
 Programmiertechnik 1 Herzlich willkommen! Dozent: Dipl.-Ing. Jürgen Wemheuer Teil 4: Schleifenkonstruktionen Mail: wemheuer@ewla.de Online: http://cpp.ewla.de/ Schleifenkonstruktion goto (veraltet!) 2
Programmiertechnik 1 Herzlich willkommen! Dozent: Dipl.-Ing. Jürgen Wemheuer Teil 4: Schleifenkonstruktionen Mail: wemheuer@ewla.de Online: http://cpp.ewla.de/ Schleifenkonstruktion goto (veraltet!) 2
Angewandte Mathematik und Programmierung
 Angewandte Mathematik und Programmierung Einführung in das Konzept der objektorientierten Anwendungen zu mathematischen Rechnens WS 2013/14 Operatoren Operatoren führen Aktionen mit Operanden aus. Der
Angewandte Mathematik und Programmierung Einführung in das Konzept der objektorientierten Anwendungen zu mathematischen Rechnens WS 2013/14 Operatoren Operatoren führen Aktionen mit Operanden aus. Der
PROGRAMMIERUNG IN JAVA
 PROGRAMMIERUNG IN JAVA ZUWEISUNGEN (1) Deklaration nennt man die Ankündigung eines Platzhalters (Variablen) und Initialisierung die erste Wertvergabe bzw. die konkrete Erstellung des Platzhalters. In einem
PROGRAMMIERUNG IN JAVA ZUWEISUNGEN (1) Deklaration nennt man die Ankündigung eines Platzhalters (Variablen) und Initialisierung die erste Wertvergabe bzw. die konkrete Erstellung des Platzhalters. In einem
12 == 12 true 12 == 21 false 4 === 7 true 4 === "vier" false 4 === 4.0 false 12!= 13 true 12!== 12 false 12!== 12.0 true. 1 < 3 true 3 < 1 false
 Die if-anweisung if (Bedingung 1) { Code 1 else { Code 2 ; Anm.1: Das ; kann entfallen, da innerhalb { ein sog. Codeblock geschrieben wird. Anm.2: Es gibt noch andere Schreibweisen, aber wir wollen uns
Die if-anweisung if (Bedingung 1) { Code 1 else { Code 2 ; Anm.1: Das ; kann entfallen, da innerhalb { ein sog. Codeblock geschrieben wird. Anm.2: Es gibt noch andere Schreibweisen, aber wir wollen uns
Wintersemester Maschinenbau und Kunststofftechnik. Informatik. Tobias Wolf Seite 1 von 25
 Kapitel 9 Schleifen Seite 1 von 25 Schleifen - Schleifen werden zur wiederholten Ausführung von Anweisungen verwendet. - Es werden drei Arten von Schleifen unterschieden: o for -Schleife o while -Schleife
Kapitel 9 Schleifen Seite 1 von 25 Schleifen - Schleifen werden zur wiederholten Ausführung von Anweisungen verwendet. - Es werden drei Arten von Schleifen unterschieden: o for -Schleife o while -Schleife
Einführung in die prozedurale und objektorientierte Programmierung (3)
 Abteilung für Wirtschaftsinformatik Einführung in die prozedurale und objektorientierte Programmierung (3) Ausnahmen (Exceptions), Referenzen, Direktiven (::routine, ::requires) Prof. Dr. Rony G. Flatscher
Abteilung für Wirtschaftsinformatik Einführung in die prozedurale und objektorientierte Programmierung (3) Ausnahmen (Exceptions), Referenzen, Direktiven (::routine, ::requires) Prof. Dr. Rony G. Flatscher
C++ Teil 2. Sven Groß. 16. Apr IGPM, RWTH Aachen. Sven Groß (IGPM, RWTH Aachen) C++ Teil Apr / 22
 C++ Teil 2 Sven Groß IGPM, RWTH Aachen 16. Apr 2015 Sven Groß (IGPM, RWTH Aachen) C++ Teil 2 16. Apr 2015 1 / 22 Themen der letzten Vorlesung Hallo Welt Elementare Datentypen Ein-/Ausgabe Operatoren Sven
C++ Teil 2 Sven Groß IGPM, RWTH Aachen 16. Apr 2015 Sven Groß (IGPM, RWTH Aachen) C++ Teil 2 16. Apr 2015 1 / 22 Themen der letzten Vorlesung Hallo Welt Elementare Datentypen Ein-/Ausgabe Operatoren Sven
Übung zur Vorlesung Wissenschaftliches Rechnen Sommersemester 2012 Auffrischung zur Programmierung in C++, 1. Teil
 MÜNSTER Übung zur Vorlesung Wissenschaftliches Rechnen Sommersemester 2012 Auffrischung zur Programmierung in C++ 1. Teil 11. April 2012 Organisatorisches MÜNSTER Übung zur Vorlesung Wissenschaftliches
MÜNSTER Übung zur Vorlesung Wissenschaftliches Rechnen Sommersemester 2012 Auffrischung zur Programmierung in C++ 1. Teil 11. April 2012 Organisatorisches MÜNSTER Übung zur Vorlesung Wissenschaftliches
Übung zur Vorlesung Wissenschaftliches Rechnen Sommersemester 2012 Auffrischung zur Programmierung in C++, 1. Teil
 MÜNSTER Übung zur Vorlesung Wissenschaftliches Rechnen Sommersemester 2012 Auffrischung zur Programmierung in C++ 1. Teil 11. April 2012 Organisatorisches MÜNSTER Übung zur Vorlesung Wissenschaftliches
MÜNSTER Übung zur Vorlesung Wissenschaftliches Rechnen Sommersemester 2012 Auffrischung zur Programmierung in C++ 1. Teil 11. April 2012 Organisatorisches MÜNSTER Übung zur Vorlesung Wissenschaftliches
Informatik I Übung, Woche 40
 Giuseppe Accaputo 1. Oktober, 2015 Plan für heute 1. Nachbesprechung Übung 2 2. Vorbesprechung Übung 3 3. Zusammenfassung der für Übung 3 wichtigen Vorlesungsslides Informatik 1 (D-BAUG) Giuseppe Accaputo
Giuseppe Accaputo 1. Oktober, 2015 Plan für heute 1. Nachbesprechung Übung 2 2. Vorbesprechung Übung 3 3. Zusammenfassung der für Übung 3 wichtigen Vorlesungsslides Informatik 1 (D-BAUG) Giuseppe Accaputo
Grundlagen der Fehlerbehandlung. Informatik B - Objektorientierte Programmierung in Java. Vorlesung 06: Ausnahme- und Fehlerbehandlung in Java.
 Universität Osnabrück 1 Grundlagen der Fehlerbehandlung 3 - Objektorientierte Programmierung in Java Vorlesung 06: Ausnahme- und Fehlerbehandlung in Java SS 2006 Prof. Dr. F.M. Thiesing, FH Osnabrück Wenn
Universität Osnabrück 1 Grundlagen der Fehlerbehandlung 3 - Objektorientierte Programmierung in Java Vorlesung 06: Ausnahme- und Fehlerbehandlung in Java SS 2006 Prof. Dr. F.M. Thiesing, FH Osnabrück Wenn
Javakurs für Anfänger
 Javakurs für Anfänger Einheit 06: Einführung in Kontrollstrukturen Lorenz Schauer Lehrstuhl für Mobile und Verteilte Systeme Heutige Agenda 1. Teil: Einführung in Kontrollstrukturen 3 Grundstrukturen von
Javakurs für Anfänger Einheit 06: Einführung in Kontrollstrukturen Lorenz Schauer Lehrstuhl für Mobile und Verteilte Systeme Heutige Agenda 1. Teil: Einführung in Kontrollstrukturen 3 Grundstrukturen von
Parallele Programmabläufe: R S
 REFERAT Parallele Programmabläufe: R S.242-246 1.Einführung 2.Synchronisation 2.1.Monitor-Konzept 2.2.Rendez-vous-Konzept 2.3.Bolt-Synchronisation 3.Behandlung Ausnahmesituationen 1.Einführung: Im Bereich
REFERAT Parallele Programmabläufe: R S.242-246 1.Einführung 2.Synchronisation 2.1.Monitor-Konzept 2.2.Rendez-vous-Konzept 2.3.Bolt-Synchronisation 3.Behandlung Ausnahmesituationen 1.Einführung: Im Bereich
Listing 1: Cowboy. Listing 2: Woody
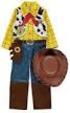 Musterlösung Test 3 Aufgabe 1: Cowboy Listing 1: Cowboy class Cowboy { public String rope ( Cowboy that ) { if ( this == that ) { return exclaim (); 5 else { return " Caught "; public String exclaim ()
Musterlösung Test 3 Aufgabe 1: Cowboy Listing 1: Cowboy class Cowboy { public String rope ( Cowboy that ) { if ( this == that ) { return exclaim (); 5 else { return " Caught "; public String exclaim ()
C.3 Funktionen und Prozeduren
 C3 - Funktionen und Prozeduren Funktionsdeklarationen in Pascal auch in Pascal kann man selbstdefinierte Funktionen einführen: Funktionen und Prozeduren THEN sign:= 0 Funktion zur Bestimmung des Vorzeichens
C3 - Funktionen und Prozeduren Funktionsdeklarationen in Pascal auch in Pascal kann man selbstdefinierte Funktionen einführen: Funktionen und Prozeduren THEN sign:= 0 Funktion zur Bestimmung des Vorzeichens
Synchronisation und Kommunikation über Nachrichten
 Synchronisation und Kommunikation über Nachrichten meist bei verteiltem Speicher, kein gemeinsamer Speicher -> keine globalen Variablen keine zu schützenden Datenbereiche Kommunikation über Kanäle und
Synchronisation und Kommunikation über Nachrichten meist bei verteiltem Speicher, kein gemeinsamer Speicher -> keine globalen Variablen keine zu schützenden Datenbereiche Kommunikation über Kanäle und
Beuth Hochschule Parameter-Übergabe-Mechanismen WS17/18, S. 1
 Beuth Hochschule Parameter-Übergabe-Mechanismen WS17/18, S. 1 Parameter-Übergabe-Mechanismen in Java und in anderen Sprachen. 1. Methoden vereinbaren mit Parametern Wenn man (z.b. in Java) eine Methode
Beuth Hochschule Parameter-Übergabe-Mechanismen WS17/18, S. 1 Parameter-Übergabe-Mechanismen in Java und in anderen Sprachen. 1. Methoden vereinbaren mit Parametern Wenn man (z.b. in Java) eine Methode
Einstieg in die Informatik mit Java
 1 / 34 Einstieg in die Informatik mit Java Klassen mit Instanzmethoden Gerd Bohlender Institut für Angewandte und Numerische Mathematik Gliederung 2 / 34 1 Definition von Klassen 2 Methoden 3 Methoden
1 / 34 Einstieg in die Informatik mit Java Klassen mit Instanzmethoden Gerd Bohlender Institut für Angewandte und Numerische Mathematik Gliederung 2 / 34 1 Definition von Klassen 2 Methoden 3 Methoden
Modellierung und Programmierung 1
 Modellierung und Programmierung 1 Prof. Dr. Sonja Prohaska Computational EvoDevo Group Institut für Informatik Universität Leipzig 4. November 2015 Administratives Zur Abgabe von Übungsaufgaben Nein, wir
Modellierung und Programmierung 1 Prof. Dr. Sonja Prohaska Computational EvoDevo Group Institut für Informatik Universität Leipzig 4. November 2015 Administratives Zur Abgabe von Übungsaufgaben Nein, wir
Schleifen in C/C++/Java
 Schleifen in C/C++/Java Alle 3 Sprachen stellen mindestens die folgenden 3 Schleifenkonstruktionen zur Verfügung. In C gibt es auch keine weiteren, C++, Java und C# haben noch weitere nützliche Varianten.
Schleifen in C/C++/Java Alle 3 Sprachen stellen mindestens die folgenden 3 Schleifenkonstruktionen zur Verfügung. In C gibt es auch keine weiteren, C++, Java und C# haben noch weitere nützliche Varianten.
Operatoren für elementare Datentypen Bedingte Anweisungen Schleifen. Operatoren für elementare Datentypen Bedingte Anweisungen Schleifen
 Programmieren I Martin Schultheiß Hochschule Darmstadt Wintersemester 2011/2012 1 / 25 Operatoren für elementare Datentypen Bedingte Schleifen 2 / 25 Zuweisungsoperator Die Zuweisung von Werten an Variablen
Programmieren I Martin Schultheiß Hochschule Darmstadt Wintersemester 2011/2012 1 / 25 Operatoren für elementare Datentypen Bedingte Schleifen 2 / 25 Zuweisungsoperator Die Zuweisung von Werten an Variablen
Master-Thread führt Programm aus, bis durch die Direktive
 OpenMP seit 1998 Standard (www.openmp.org) für die Shared-Memory Programmierung; (Prä-)Compiler für viele Systeme kommerziell oder frei (z.b. Omni von phase.hpcc.jp/omni) verfügbar Idee: automatische Generierung
OpenMP seit 1998 Standard (www.openmp.org) für die Shared-Memory Programmierung; (Prä-)Compiler für viele Systeme kommerziell oder frei (z.b. Omni von phase.hpcc.jp/omni) verfügbar Idee: automatische Generierung
2.5 Programmstrukturen Entscheidung / Alternative
 Entscheidung, ob der folgende Anweisungsblock ausgeführt wird oder ein alternativer Block Entscheidung ob die Bedingung wahr oder falsch (True / False) ist Syntax: 2.5 Programmstrukturen 2.5.1 Entscheidung
Entscheidung, ob der folgende Anweisungsblock ausgeführt wird oder ein alternativer Block Entscheidung ob die Bedingung wahr oder falsch (True / False) ist Syntax: 2.5 Programmstrukturen 2.5.1 Entscheidung
VBA-Programmierung: Zusammenfassung
 VBA-Programmierung: Zusammenfassung Programmiersprachen (Definition, Einordnung VBA) Softwareentwicklung-Phasen: 1. Spezifikation 2. Entwurf 3. Implementierung Datentypen (einfach, zusammengesetzt) Programmablaufsteuerung
VBA-Programmierung: Zusammenfassung Programmiersprachen (Definition, Einordnung VBA) Softwareentwicklung-Phasen: 1. Spezifikation 2. Entwurf 3. Implementierung Datentypen (einfach, zusammengesetzt) Programmablaufsteuerung
Modellierung von Echtzeitsystemen
 Modellierung von n Reaktive Systeme Werkzeuge: SCADE, Esterel Studio 71 Klausurtermin Für Studenten, die einen Schein benötigen, wird am Ende der Vorlesung eine schriftliche Klausur angeboten. Stoff der
Modellierung von n Reaktive Systeme Werkzeuge: SCADE, Esterel Studio 71 Klausurtermin Für Studenten, die einen Schein benötigen, wird am Ende der Vorlesung eine schriftliche Klausur angeboten. Stoff der
Nebenläufige Programmierung in Java: Threads
 Nebenläufige Programmierung in Java: Threads Wahlpflicht: Fortgeschrittene Programmierung in Java Jan Henke HAW Hamburg 10. Juni 2011 J. Henke (HAW) Threads 10. Juni 2011 1 / 18 Gliederung 1 Grundlagen
Nebenläufige Programmierung in Java: Threads Wahlpflicht: Fortgeschrittene Programmierung in Java Jan Henke HAW Hamburg 10. Juni 2011 J. Henke (HAW) Threads 10. Juni 2011 1 / 18 Gliederung 1 Grundlagen
Ada. Projektseminar: Verteilte Echtzeitsysteme. Tobias Flach,
 Ada Projektseminar: Verteilte Echtzeitsysteme Tobias Flach, 26.05.2010 Agenda Historische Entwicklung Eigenschaften von Ada Tasks und Protected Objects Prioritäten Scheduling Weitere Echtzeitkonzepte Historische
Ada Projektseminar: Verteilte Echtzeitsysteme Tobias Flach, 26.05.2010 Agenda Historische Entwicklung Eigenschaften von Ada Tasks und Protected Objects Prioritäten Scheduling Weitere Echtzeitkonzepte Historische
Algorithmen und Datenstrukturen II
 Algorithmen und Datenstrukturen II in JAVA D. Rösner Institut für Wissens- und Sprachverarbeitung Fakultät für Informatik Otto-von-Guericke Universität Magdeburg Sommer 2009, 31. März 2009, c 2009 D.Rösner
Algorithmen und Datenstrukturen II in JAVA D. Rösner Institut für Wissens- und Sprachverarbeitung Fakultät für Informatik Otto-von-Guericke Universität Magdeburg Sommer 2009, 31. März 2009, c 2009 D.Rösner
Ablaufsteuerung. Markus Roggenbach. 2. Dezember 2002
 Ablaufsteuerung Markus Roggenbach 2. Dezember 2002 Aktuelle Vorbemerkung Aktuelle Vorbemerkung 2 M.Broy, J.Siedersleben: Objektorientierte Programmierung und Softwareentwicklung, Informatik Spektrum, Februar
Ablaufsteuerung Markus Roggenbach 2. Dezember 2002 Aktuelle Vorbemerkung Aktuelle Vorbemerkung 2 M.Broy, J.Siedersleben: Objektorientierte Programmierung und Softwareentwicklung, Informatik Spektrum, Februar
Teil 5 - Java. Programmstruktur Operatoren Schlüsselwörter Datentypen
 Teil 5 - Java Programmstruktur Operatoren Schlüsselwörter Datentypen 1 Kommentare in Java In Java gibt es drei Möglichkeiten zur Kommentierung: // Kommentar Alle Zeichen nach dem // werden ignoriert. für
Teil 5 - Java Programmstruktur Operatoren Schlüsselwörter Datentypen 1 Kommentare in Java In Java gibt es drei Möglichkeiten zur Kommentierung: // Kommentar Alle Zeichen nach dem // werden ignoriert. für
Arithmetik in der tcsh
 Arithmetik in der tcsh Variablen speichern Zeichenketten (also Strings/Wörter) @ statt set Interpretation als arithmetische Ausdrücke (aus Ziffern, (, ), +, -, *, /, % bestehend) Beispiele: @ var = (3
Arithmetik in der tcsh Variablen speichern Zeichenketten (also Strings/Wörter) @ statt set Interpretation als arithmetische Ausdrücke (aus Ziffern, (, ), +, -, *, /, % bestehend) Beispiele: @ var = (3
DIPLOMHAUPTPRÜFUNG FÜR ELEKTROINGENIEURE PROZESSAUTOMATISIERUNG I Sommersemester 2006 - Musterlösung
 Universität Stuttgart Institut für Automatisierungs- und Softwaretechnik Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. P. Göhner Mr, Mb 30.08.06 DIPLOMHAUPTPRÜFUNG FÜR ELEKTROINGENIEURE PROZESSAUTOMATISIERUNG I Sommersemester
Universität Stuttgart Institut für Automatisierungs- und Softwaretechnik Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. P. Göhner Mr, Mb 30.08.06 DIPLOMHAUPTPRÜFUNG FÜR ELEKTROINGENIEURE PROZESSAUTOMATISIERUNG I Sommersemester
Abschnitt 7: Weitere Konzepte der oo Programmierung in Java
 Abschnitt 7: Weitere Konzepte der oo Programmierung in Java 7. Weitere Konzepte der oo Programmierung in Java 7.1 Peer Kröger (LMU München) Einführung in die Programmierung WS 14/15 596 / 627 Überblick
Abschnitt 7: Weitere Konzepte der oo Programmierung in Java 7. Weitere Konzepte der oo Programmierung in Java 7.1 Peer Kröger (LMU München) Einführung in die Programmierung WS 14/15 596 / 627 Überblick
JavaScript. Dies ist normales HTML. Hallo Welt! Dies ist JavaScript. Wieder normales HTML.
 JavaScript JavaScript wird direkt in HTML-Dokumente eingebunden. Gib folgende Zeilen mit einem Texteditor (Notepad) ein: (Falls der Editor nicht gefunden wird, öffne im Browser eine Datei mit der Endung
JavaScript JavaScript wird direkt in HTML-Dokumente eingebunden. Gib folgende Zeilen mit einem Texteditor (Notepad) ein: (Falls der Editor nicht gefunden wird, öffne im Browser eine Datei mit der Endung
Client-Server-Beziehungen
 Client-Server-Beziehungen Server bietet Dienste an, Client nutzt Dienste Objekt ist gleichzeitig Client und Server Vertrag zwischen Client und Server: Client erfüllt Vorbedingungen eines Dienstes Server
Client-Server-Beziehungen Server bietet Dienste an, Client nutzt Dienste Objekt ist gleichzeitig Client und Server Vertrag zwischen Client und Server: Client erfüllt Vorbedingungen eines Dienstes Server
Modula. A Language for Modular Multiprogramming
 Modula A Language for Modular Multiprogramming Daniel Ivancic 0425234 email: e0425234@student.tuwien.ac.at Modula : A Language for Modular Multiprogramming Abstract: Modula wurde 1976 von Niklaus Wirth
Modula A Language for Modular Multiprogramming Daniel Ivancic 0425234 email: e0425234@student.tuwien.ac.at Modula : A Language for Modular Multiprogramming Abstract: Modula wurde 1976 von Niklaus Wirth
Vorlesung Informatik II
 Vorlesung Informatik II Universität Augsburg Wintersemester 2011/2012 Prof. Dr. Bernhard Bauer Folien von: Prof. Dr. Robert Lorenz Lehrprofessur für Informatik 17. JAVA Kommunikation von Threads 1 Motivation
Vorlesung Informatik II Universität Augsburg Wintersemester 2011/2012 Prof. Dr. Bernhard Bauer Folien von: Prof. Dr. Robert Lorenz Lehrprofessur für Informatik 17. JAVA Kommunikation von Threads 1 Motivation
Objektorientierte Programmierung OO mit Ada 2005
 Objektorientierte Programmierung mit Ada 2005 Markus Knauß 8. Januar 2010 1/33 Motivation Erstellen Sie ein Programm, mit dem Sie Literaturverweise verwalten können. Die Literaturverweise sollen in einer
Objektorientierte Programmierung mit Ada 2005 Markus Knauß 8. Januar 2010 1/33 Motivation Erstellen Sie ein Programm, mit dem Sie Literaturverweise verwalten können. Die Literaturverweise sollen in einer
Kapitel 4. Kontrollstrukturen
 Kapitel 4 Kontrollstrukturen Kontrollstrukturen 1 Ziele Kontrollstrukturen in imperativen Programmen kennenlernen und verstehen. Realisierung der Kontrollstrukturen in Java. Kontrollstrukturen 2 Anweisungen
Kapitel 4 Kontrollstrukturen Kontrollstrukturen 1 Ziele Kontrollstrukturen in imperativen Programmen kennenlernen und verstehen. Realisierung der Kontrollstrukturen in Java. Kontrollstrukturen 2 Anweisungen
Einstieg in die Informatik mit Java
 Vorlesung vom 25.4.07, Anweisungen Übersicht 1 Ausdrucksanweisung 2 Einfache Ausgabeanweisung 3 Einfache Eingabeanweisung, Vorbereitungen 4 Verbundanweisung 5 Bedingte Anweisung 6 Auswahlanweisung 7 for
Vorlesung vom 25.4.07, Anweisungen Übersicht 1 Ausdrucksanweisung 2 Einfache Ausgabeanweisung 3 Einfache Eingabeanweisung, Vorbereitungen 4 Verbundanweisung 5 Bedingte Anweisung 6 Auswahlanweisung 7 for
zu große Programme (Bildschirmseite!) zerlegen in (weitgehend) unabhängige Einheiten: Unterprogramme
 Bisher Datentypen: einfach Zahlen, Wahrheitswerte, Zeichenketten zusammengesetzt Arrays (Felder) zur Verwaltung mehrerer zusammengehörender Daten desselben Datentypes eindimensional, mehrdimensional, Array-Grenzen
Bisher Datentypen: einfach Zahlen, Wahrheitswerte, Zeichenketten zusammengesetzt Arrays (Felder) zur Verwaltung mehrerer zusammengehörender Daten desselben Datentypes eindimensional, mehrdimensional, Array-Grenzen
FACHHOCHSCHULE AUGSBURG Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung
 C Sprachelemente für Übung 2 Typumwandlungen (type casts) Bei Ausdrücken, in denen Operanden mit unterschiedlichem Typ vorkommen, werden diese vom Compiler vor der Ausführung automatisch in einen gemeinsamen
C Sprachelemente für Übung 2 Typumwandlungen (type casts) Bei Ausdrücken, in denen Operanden mit unterschiedlichem Typ vorkommen, werden diese vom Compiler vor der Ausführung automatisch in einen gemeinsamen
Die for -Schleife HEUTE. Schleifen. Arrays. Schleifen in JAVA. while, do reichen aus, um alle iterativen Algorithmen zu beschreiben
 18.11.5 1 HEUTE 18.11.5 3 Schleifen Arrays while, do reichen aus, um alle iterativen Algorithmen zu beschreiben Nachteil: Steuermechanismus ist verteilt Übersicht nicht immer leicht dazu gibt es for (
18.11.5 1 HEUTE 18.11.5 3 Schleifen Arrays while, do reichen aus, um alle iterativen Algorithmen zu beschreiben Nachteil: Steuermechanismus ist verteilt Übersicht nicht immer leicht dazu gibt es for (
Ersetzbarkeit und Verhalten
 Ersetzbarkeit und Verhalten U ist Untertyp von T, wenn eine Instanz von U überall verwendbar ist, wo eine Instanz von T erwartet wird Struktur der Typen für Ersetzbarkeit nicht ausreichend Beispiel: void
Ersetzbarkeit und Verhalten U ist Untertyp von T, wenn eine Instanz von U überall verwendbar ist, wo eine Instanz von T erwartet wird Struktur der Typen für Ersetzbarkeit nicht ausreichend Beispiel: void
Kontrollstrukturen und Logik
 Programmieren mit Java Modul 2 Kontrollstrukturen und Logik Theorieteil Inhaltsverzeichnis 1 Modulübersicht 3 1.1 Anweisungen und Blöcke........................... 3 2 Operatoren (Teil II) 4 2.1 Relationale
Programmieren mit Java Modul 2 Kontrollstrukturen und Logik Theorieteil Inhaltsverzeichnis 1 Modulübersicht 3 1.1 Anweisungen und Blöcke........................... 3 2 Operatoren (Teil II) 4 2.1 Relationale
Proseminar: Konzepte von Betriebsystem-Komponenten (KVBK)
 Proseminar: Konzepte von Betriebsystem-Komponenten (KVBK) Schwerpunkt Linux Interrupts, Softirqs, Tasklets, Bottom Halves Interrupts: Softirqs, Tasklets, Bottom Halves 1 Thomas Engelhardt Übersicht: Klassifizierung
Proseminar: Konzepte von Betriebsystem-Komponenten (KVBK) Schwerpunkt Linux Interrupts, Softirqs, Tasklets, Bottom Halves Interrupts: Softirqs, Tasklets, Bottom Halves 1 Thomas Engelhardt Übersicht: Klassifizierung
11.3 Transaktionen und LUWs in SAP R/3
 11.3 Transaktionen und LUWs in SAP R/3 G Transaktionen heissen in SAP/R3 Logical Unit of Work (LUW). Eine LUW besteht in der Regel aus zwei Teilen: SAP-Transaktion: Folge von vorbereiteten Dialogschritten
11.3 Transaktionen und LUWs in SAP R/3 G Transaktionen heissen in SAP/R3 Logical Unit of Work (LUW). Eine LUW besteht in der Regel aus zwei Teilen: SAP-Transaktion: Folge von vorbereiteten Dialogschritten
Institut für Programmierung und Reaktive Systeme. Java 7. Markus Reschke
 Institut für Programmierung und Reaktive Systeme Java 7 Markus Reschke 14.10.2014 Vererbung in Java Vererbung ermöglicht es, Klassen zu spezialisieren Wiederverwendung vorhandener Klassen Kindsklasse erhält
Institut für Programmierung und Reaktive Systeme Java 7 Markus Reschke 14.10.2014 Vererbung in Java Vererbung ermöglicht es, Klassen zu spezialisieren Wiederverwendung vorhandener Klassen Kindsklasse erhält
S. d. I.: Programieren in C Folie 4-1. im Gegensatz zu Pascal gibt es in C kein Schlüsselwort "then"
 S. d. I.: Programieren in C Folie 4-1 4 Anweisungen 4.1 if-anweisung 1) if (Ausdruck) 2) if (Ausdruck) } else im Gegensatz zu Pascal gibt es in C kein Schlüsselwort "then" es wird nur der numerische Wert
S. d. I.: Programieren in C Folie 4-1 4 Anweisungen 4.1 if-anweisung 1) if (Ausdruck) 2) if (Ausdruck) } else im Gegensatz zu Pascal gibt es in C kein Schlüsselwort "then" es wird nur der numerische Wert
Dynamisches SQL. Folien zum Datenbankpraktikum Wintersemester 2009/10 LMU München
 Kapitel 4 Dynamisches SQL Folien zum Datenbankpraktikum Wintersemester 2009/10 LMU München 2008 Thomas Bernecker, Tobias Emrich unter Verwendung der Folien des Datenbankpraktikums aus dem Wintersemester
Kapitel 4 Dynamisches SQL Folien zum Datenbankpraktikum Wintersemester 2009/10 LMU München 2008 Thomas Bernecker, Tobias Emrich unter Verwendung der Folien des Datenbankpraktikums aus dem Wintersemester
3. Anweisungen und Kontrollstrukturen
 3. Kontrollstrukturen Anweisungen und Blöcke 3. Anweisungen und Kontrollstrukturen Mit Kontrollstrukturen können wir den Ablauf eines Programmes beeinflussen, z.b. ob oder in welcher Reihenfolge Anweisungen
3. Kontrollstrukturen Anweisungen und Blöcke 3. Anweisungen und Kontrollstrukturen Mit Kontrollstrukturen können wir den Ablauf eines Programmes beeinflussen, z.b. ob oder in welcher Reihenfolge Anweisungen
Einführung: Zustandsdiagramme Stand:
 Einführung: Zustandsdiagramme Stand: 01.06.2006 Josef Hübl (Triple-S GmbH) 1. Grundlagen Zustandsdiagramme Zustände, Ereignisse, Bedingungen, Aktionen 2. Verkürzte Darstellungen Pseudozustände 3. Hierarchische
Einführung: Zustandsdiagramme Stand: 01.06.2006 Josef Hübl (Triple-S GmbH) 1. Grundlagen Zustandsdiagramme Zustände, Ereignisse, Bedingungen, Aktionen 2. Verkürzte Darstellungen Pseudozustände 3. Hierarchische
Institut für Programmierung und Reaktive Systeme 25. Januar Programmieren I. Übungsklausur
 Technische Universität Braunschweig Dr. Werner Struckmann Institut für Programmierung und Reaktive Systeme 25. Januar 2018 Hinweise: Klausurtermine: Programmieren I Übungsklausur Programmieren I: 17. Februar
Technische Universität Braunschweig Dr. Werner Struckmann Institut für Programmierung und Reaktive Systeme 25. Januar 2018 Hinweise: Klausurtermine: Programmieren I Übungsklausur Programmieren I: 17. Februar
II.4.4 Exceptions - 1 -
 n 1. Unterklassen und Vererbung n 2. Abstrakte Klassen und Interfaces n 3. Modularität und Pakete n 4. Ausnahmen (Exceptions) n 5. Generische Datentypen n 6. Collections II.4.4 Exceptions - 1 - Ausnahmen
n 1. Unterklassen und Vererbung n 2. Abstrakte Klassen und Interfaces n 3. Modularität und Pakete n 4. Ausnahmen (Exceptions) n 5. Generische Datentypen n 6. Collections II.4.4 Exceptions - 1 - Ausnahmen
Interface. So werden Interfaces gemacht
 Design Ein Interface (=Schnittstelle / Definition) beschreibt, welche Funktionalität eine Implementation nach Aussen anzubieten hat. Die dahinter liegende Algorithmik wird aber der Implementation überlassen.
Design Ein Interface (=Schnittstelle / Definition) beschreibt, welche Funktionalität eine Implementation nach Aussen anzubieten hat. Die dahinter liegende Algorithmik wird aber der Implementation überlassen.
Kontrollfluss. man Verzweigungen und Sprünge. o bisher linear (von oben nach unten) o Für interessante Programme braucht
 Kontrollanweisungen Kontrollfluss o bisher linear (von oben nach unten) o Für interessante Programme braucht man Verzweigungen und Sprünge Kontrollfluss o bisher linear (von oben nach unten) o Für interessante
Kontrollanweisungen Kontrollfluss o bisher linear (von oben nach unten) o Für interessante Programme braucht man Verzweigungen und Sprünge Kontrollfluss o bisher linear (von oben nach unten) o Für interessante
Vorlesung Informatik II
 Vorlesung Informatik II Universität Augsburg Wintersemester 2011/2012 Prof. Dr. Bernhard Bauer Folien von: Prof. Dr. Robert Lorenz Lehrprofessur für Informatik 16. Java: Threads für Animationen 1 Motivation
Vorlesung Informatik II Universität Augsburg Wintersemester 2011/2012 Prof. Dr. Bernhard Bauer Folien von: Prof. Dr. Robert Lorenz Lehrprofessur für Informatik 16. Java: Threads für Animationen 1 Motivation
Schachtelung der 2. Variante (Bedingungs-Kaskade): if (B1) A1 else if (B2) A2 else if (B3) A3 else if (B4) A4 else A
 2.4.6. Kontrollstrukturen if-anweisung: Bedingte Ausführung (Verzweigung) 2 Varianten: if (Bedingung) Anweisung (Anweisung = einzelne Anweisung oder Block) Bedeutung: die Anweisung wird nur ausgeführt,
2.4.6. Kontrollstrukturen if-anweisung: Bedingte Ausführung (Verzweigung) 2 Varianten: if (Bedingung) Anweisung (Anweisung = einzelne Anweisung oder Block) Bedeutung: die Anweisung wird nur ausgeführt,
SPARK95. Ingmar Wirths. 12. Juli 2007
 SPARK95 Ingmar Wirths 12. Juli 2007 Motivation Ada wurde zur Programmierung von Mikroprozessoren entwickelt. Motivation Ada wurde zur Programmierung von Mikroprozessoren entwickelt. Ein Systemversagen
SPARK95 Ingmar Wirths 12. Juli 2007 Motivation Ada wurde zur Programmierung von Mikroprozessoren entwickelt. Motivation Ada wurde zur Programmierung von Mikroprozessoren entwickelt. Ein Systemversagen
Grundlagen der Programmierung in C Funktionen
 Der erste Mechanismus für Code-Reuse! Grundlagen der Programmierung in C Funktionen Wintersemester 2005/2006 G. Zachmann Clausthal University, Germany zach@in.tu-clausthal.de Ältester Mechanismus für Code-Reuse:
Der erste Mechanismus für Code-Reuse! Grundlagen der Programmierung in C Funktionen Wintersemester 2005/2006 G. Zachmann Clausthal University, Germany zach@in.tu-clausthal.de Ältester Mechanismus für Code-Reuse:
Parallele Prozesse Prozeß Parallele Prozesse verzahnte Prozesse Nebenläufige Prozesse: Threads Vorlesung Software-Entwicklung / Folie 131 Ziele:
 Parallele Prozesse SWE-131 Prozeß: Ausführung eines sequentiellen Programmstückes in dem zugeordneten Speicher (Adressraum). Veränderlicher Zustand: Speicherinhalt und Programmposition. Parallele Prozesse:
Parallele Prozesse SWE-131 Prozeß: Ausführung eines sequentiellen Programmstückes in dem zugeordneten Speicher (Adressraum). Veränderlicher Zustand: Speicherinhalt und Programmposition. Parallele Prozesse:
Theorie zu Übung 8 Implementierung in Java
 Universität Stuttgart Institut für Automatisierungstechnik und Softwaresysteme Prof. Dr.-Ing. M. Weyrich Theorie zu Übung 8 Implementierung in Java Klasse in Java Die Klasse wird durch das class-konzept
Universität Stuttgart Institut für Automatisierungstechnik und Softwaresysteme Prof. Dr.-Ing. M. Weyrich Theorie zu Übung 8 Implementierung in Java Klasse in Java Die Klasse wird durch das class-konzept
Algorithmen & Programmierung. Steuerstrukturen im Detail Selektion und Iteration
 Algorithmen & Programmierung Steuerstrukturen im Detail Selektion und Iteration Selektion Selektion Vollständige einfache Selektion Wir kennen schon eine Möglichkeit, Selektionen in C zu formulieren: if
Algorithmen & Programmierung Steuerstrukturen im Detail Selektion und Iteration Selektion Selektion Vollständige einfache Selektion Wir kennen schon eine Möglichkeit, Selektionen in C zu formulieren: if
Schleifen: Immer wieder dasselbe tun
 Schleifen: Immer wieder dasselbe tun Bei einer Schleife werden Anweisungen immer wieder ausgeführt, solange die Bedingung wahr ist. Dafür muss man eine Variable immer wieder ändern, solange bis eine Überprüfung
Schleifen: Immer wieder dasselbe tun Bei einer Schleife werden Anweisungen immer wieder ausgeführt, solange die Bedingung wahr ist. Dafür muss man eine Variable immer wieder ändern, solange bis eine Überprüfung
Programmiersprache 1 (C++) Prof. Dr. Stefan Enderle NTA Isny
 Programmiersprache 1 (C++) Prof. Dr. Stefan Enderle NTA Isny 5. Kontrollstrukturen Allgemein Kontrollstrukturen dienen zur Steuerung des Programmablaufs. (Bemerkung: C und C++ besitzen die selben Kontrollstrukturen.)
Programmiersprache 1 (C++) Prof. Dr. Stefan Enderle NTA Isny 5. Kontrollstrukturen Allgemein Kontrollstrukturen dienen zur Steuerung des Programmablaufs. (Bemerkung: C und C++ besitzen die selben Kontrollstrukturen.)
Konzepte der Programmiersprachen
 Konzepte der Programmiersprachen Sommersemester 2010 4. Übungsblatt Besprechung am 9. Juli 2010 http://www.iste.uni-stuttgart.de/ps/lehre/ss2010/v_konzepte/ Aufgabe 4.1: Klassen in C ++ Das folgende C
Konzepte der Programmiersprachen Sommersemester 2010 4. Übungsblatt Besprechung am 9. Juli 2010 http://www.iste.uni-stuttgart.de/ps/lehre/ss2010/v_konzepte/ Aufgabe 4.1: Klassen in C ++ Das folgende C
Programmieren I. Kapitel 5. Kontrollfluss
 Programmieren I Kapitel 5. Kontrollfluss Kapitel 5: Kontrollfluss Ziel: Komplexere Berechnungen im Methodenrumpf Ausdrücke und Anweisungen Fallunterscheidungen (if, switch) Wiederholte Ausführung (for,
Programmieren I Kapitel 5. Kontrollfluss Kapitel 5: Kontrollfluss Ziel: Komplexere Berechnungen im Methodenrumpf Ausdrücke und Anweisungen Fallunterscheidungen (if, switch) Wiederholte Ausführung (for,
Informatik I: Einführung in die Programmierung
 Informatik I: Einführung in die Programmierung 5., bedingte Ausführung und Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Bernhard Nebel 27. Oktober 2017 1 und der Typ bool Typ bool Typ bool Vergleichsoperationen
Informatik I: Einführung in die Programmierung 5., bedingte Ausführung und Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Bernhard Nebel 27. Oktober 2017 1 und der Typ bool Typ bool Typ bool Vergleichsoperationen
THE GO PROGRAMMING LANGUAGE. Michael Karnutsch & Marko Sulejic
 THE GO PROGRAMMING LANGUAGE Part 1: Michael Karnutsch & Marko Sulejic Gliederung Geschichte / Motivation Compiler Formatierung, Semikolons Variablen, eigene Typen Kontrollstrukturen Funktionen, Methoden
THE GO PROGRAMMING LANGUAGE Part 1: Michael Karnutsch & Marko Sulejic Gliederung Geschichte / Motivation Compiler Formatierung, Semikolons Variablen, eigene Typen Kontrollstrukturen Funktionen, Methoden
Kapitel 4. Kontrollstrukturen
 Kapitel 4 Kontrollstrukturen Kontrollstrukturen 1 Ziele Kontrollstrukturen in imperativen Programmen kennenlernen und verstehen. Realisierung der Kontrollstrukturen in Java. Kontrollstrukturen 2 Anweisungen
Kapitel 4 Kontrollstrukturen Kontrollstrukturen 1 Ziele Kontrollstrukturen in imperativen Programmen kennenlernen und verstehen. Realisierung der Kontrollstrukturen in Java. Kontrollstrukturen 2 Anweisungen
Wo sind wir? Kontrollstrukturen
 Wo sind wir? Java-Umgebung Lexikale Konventionen Datentypen Kontrollstrukturen Ausdrücke Klassen, Pakete, Schnittstellen JVM Exceptions Java Klassenbibliotheken Ein-/Ausgabe Collections Threads Applets,
Wo sind wir? Java-Umgebung Lexikale Konventionen Datentypen Kontrollstrukturen Ausdrücke Klassen, Pakete, Schnittstellen JVM Exceptions Java Klassenbibliotheken Ein-/Ausgabe Collections Threads Applets,
Kontrollstrukturen. Wo sind wir? Anweisung mit Label. Block. Beispiel. Deklarationsanweisung
 Java-Umgebung Lexikale Konventionen Datentypen Kontrollstrukturen Ausdrücke Klassen, Pakete, Schnittstellen JVM Exceptions Java Klassenbibliotheken Ein-/Ausgabe Collections Threads Applets, Sicherheit
Java-Umgebung Lexikale Konventionen Datentypen Kontrollstrukturen Ausdrücke Klassen, Pakete, Schnittstellen JVM Exceptions Java Klassenbibliotheken Ein-/Ausgabe Collections Threads Applets, Sicherheit
Javakurs für Anfänger
 Javakurs für Anfänger Einheit 04: Einführung in Kontrollstrukturen Lorenz Schauer Lehrstuhl für Mobile und Verteilte Systeme Heutige Agenda 1. Teil: Einführung in Kontrollstrukturen 3 Grundstrukturen von
Javakurs für Anfänger Einheit 04: Einführung in Kontrollstrukturen Lorenz Schauer Lehrstuhl für Mobile und Verteilte Systeme Heutige Agenda 1. Teil: Einführung in Kontrollstrukturen 3 Grundstrukturen von
