Schriftkultur und Schriftlichkeit
|
|
|
- Maria Goldschmidt
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Projekt Alphabetisierung und Bildung (AlBi) Schriftkultur und Schriftlichkeit wertschätzen und fördern Zum Sprachvergleich in der Alphabetisierung mit Migrantinnen und Migranten Hilfen und Tipps für Alphabetisierungskursleitende GEFÖRDERT VOM
2 Das dieser Veröffentlichung zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01AB gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren (s. BNBest-BMBF 98, 6.4). Die Deutsche Bibliothek CIP Einheitsaufnahme ISBN Schriftkultur und Schriftlichkeit wertschätzen und fördern Zum Sprachvergleich in der Alphabetisierung mit Migrantinnen und Migranten Hilfen und Tipps für Alphabetisierungskursleitende Herausgegeben von Kajo Wintzen und Elisabeth Vanderheiden für die Katholische Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz Landesarbeitsgemeinschaft e.v. Mainz 2011 Pädagogische Leitung und Redaktion: Kajo Wintzen Autoren/-innen Lucia Coluccia, Irene Haritonov, Janet Niksarlioglu, Ahmad-Maher Sandouk, Ulrike Weyrether, Kajo Wintzen sowie Anna Arera, Irina Dmitrienko und Mojgan Styner Verbundpartner im Projekt Alphabetisierung und Bildung (AlBi) Katholische Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz Landesarbeitsgemeinschaft e.v. Welschnonnengasse Mainz Telefon Telefax bei den Autoren/-innen 2
3 Zusammenfassung Schriftkultur wertzuschätzen und Schriftlichkeit zu fördern sind Anliegen der vorliegenden Arbeiten. Sie geben Alphabetisierungskursleitenden, die sich für die Herkunftssprachen ihrer Teilnehmenden interessieren, Hilfestellungen bei der Annäherung an die Sprachen Arabisch, Italienisch, Russisch und Türkisch. Kursleiterinnen und Kursleiter, die selbst aus den genannten Ländern stammen, vermitteln Einblicke in ihre Sprache, lassen die Perspektive der Lernenden aus ihren Sprachen anschaulich werden, stellen Vergleiche mit dem Deutschen an und vermitteln kollegiale Tipps. Ein einführender Beitrag spannt den Bogen über einige Jahrzehnte Sprachkursgeschichte zum Anliegen von Sprachvergleichen, ihren Möglichkeiten und Grenzen bis zum gegenwärtigen Kursalltag. Dem Einbeziehen der Herkunftssprachen der Teilnehmenden wird im Rahmen des gegenseitigen Lernens und der gegenseitigen Wertschätzung ein fester Platz eingeräumt. 3
4 Inhalt Einführung 5 Kajo Wintzen Schriftkultur wertschätzen und Schriftlichkeit fördern Zum Interesse an Menschen und ihrer Sprache 7 Praxistipps 17 Lucia Coluccia Wenn Italiener Deutsch lernen 20 Irene Haritonov Erste-Hilfe-Tipps für Alphabetisierungskursleitende Russisch 27 Janet Niksarlioglu Erste-Hilfe-Tipps für Alphabetisierungskursleitende Türkisch 34 Ahmad-Maher Sandouk, Ulrike Weyrether Zur Problematik der kontrastiven Alphabetisierung bei arabischen Muttersprachlern 41 Literatur- und Quellenverzeichnis 50 Autorinnen und Autoren 53 4
5 Einführung Bei der Recherche für die vorliegenden Beiträge zeigte es sich, dass keine zuverlässigen Daten zur Literalität in den Ländern Italien, Russland und der Türkei zu erhalten sind. Für die arabischen Staaten weist der Global Monitoring Report der UNESCO von 2008 dagegen 30 % Analphabeten aus. Das europäische und auch deutsche Problem des funktionalen Analphabetismus erreicht wenig Öffentlichkeit. Selbst als die ersten repräsentativen Zahlen für die Bundesrepublik Deutschland am 28. Februar 2011 von Anke Grotlüschen und Wibke Riekmann auf Grundlage der leo. Level-One Studie vorgestellt wurden, bemerkte Martin Spiewak (2011) von der ZEIT keine Debatte, die man angesichts der hohen Zahl von Analphabeten hätte erwarten können, sondern lediglich ein großes Phlegma. Die leo-studie macht Aussagen über die Literalität der deutsch sprechenden erwachsenen Bevölkerung (18 64 Jahre) in der Bundesrepublik Deutschland (Grotlüschen/Riekmann 2011a: 4). Das lässt sie auch für die Alphabetisierung mit Migrantinnen und Migranten interessant erscheinen; allerdings mit der Einschränkung, dass Menschen, denen die Sprachkenntnisse fehlten, um an der im Vordergrund stehenden Befragung zum Adult Education Survey (AES) teilnehmen zu können, nicht in die Studie aufgenommen wurden (vgl. Grotlüschen/Riekmann 2011b: 46). Zum Alpha-Level 1 3, dem funktionalen Analphabetismus, müssen der Studie nach 14,5 % bzw. 7,5 Millionen Menschen in Deutschland gerechnet werden. Von diesen Menschen sprechen 4,4 Millionen Deutsch als Erstsprache und 3,1 Millionen Deutsch als Zweitsprache. Die Arbeit auf Alpha-Level 1 3 bezieht sich auf die Buchstaben-, Wort- und Satzebene. Aussagekräftiger sind die Zuordnungen der lea-studie (Literalitätsentwicklung von Arbeitskräften. Schreiben. Alpha-Levels) zum Beispiel nach Kann-Kompetenzen, Phonemstufen, GER sowie logographischer und alphabetischer Strategie etc. (vgl. Grotlüschen u.a. 2010: 35 37). In den Alphabetisierungskursen für Migrantinnen und Migranten treffen Kursleitende hochgebildete Zweitschriftlerner, funktionale Analphabeten mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen und auch Sprach- und Schriftanfänger an. Die Spannbreite der Herkunftssprachen, Schriftsysteme und der Sprachund Lernbiographien zu erfassen, wäre eine eigene Studie wert. Für die Kursleitenden bedeutet ihre Arbeit immer wieder eine besondere Herausforderung. Dafür wünschen sie sich Unterstützung. Die Probleme der Lernenden, so wird vermutet, lassen sich besser verstehen, wenn man ihre Sprache ein wenig besser kennenlernt. Erste Hilfen und Tipps werden Kursleitenden mit den vorliegenden Beiträgen gegeben, die die Sprachen näherbringen, neugierig machen, auch vergleichen, aber insbesondere zu deren Wertschätzung beitragen sollen. Das Interesse von Kursleitenden an der Sprache der Beteiligten ist vorhanden. Es begleitet die Sprachund Alphabetisierungsarbeit seit ihren Anfängen. Von dort wird der erste Beitrag dieses Vorhabens einen Bogen über einige Jahrzehnte sprachvergleichender Arbeit bis in den heutigen Kursalltag spannen. Aus diesem Kursalltag heraus haben Kursleiterinnen und Kursleiter für diese Veröffentlichung versucht, Sprachen, die mit einer Ausnahme ihre eigenen Muttersprachen sind, für Kolleginnen und Kollegen zu erläutern und verständlicher zu machen. 5
6 Die Wahl fiel auf die in Alphabetisierungskursen häufig vertretenen Sprachen Türkisch, Russisch und Arabisch, aber auch auf Italienisch, die Sprache der ersten Einwanderer nach Deutschland. Interessanterweise zeigt eine Repräsentativ-Untersuchung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge von 2006/2007 über den Anteil von Analphabeten nach Nationalität und Geschlecht, dass auch 0,7 % der befragten italienischen Frauen und Männer als Analphabeten gelten (BAMF 2011a). Und eine weitere Repräsentativ-Untersuchung von 2006/2007 zu Deutschkenntnissen (Verstehen, Sprechen, Lesen und Schreiben) nach Nationalität, führt an, dass Befragte, die aus Italien stammen, zwar kaum Probleme mit dem Verstehen, Sprechen oder Lesen haben, wohl aber zu fast 52 % nur mittelmäßig bis sehr schlecht und einige eben gar nicht schreiben können (BAMF 2011b). Ziel der vorliegenden Beiträge ist es, Alphabetisierungskursleitende mit der Perspektive der Lernenden und deren Herkunftssprache zu verbinden. Das beinhaltet Wissen über Formen und Strukturen, aber auch eine Sensibilisierung für die Lern- und Sprachbiographien der Teilnehmenden und für andere Lernhindernisse, die sich nicht aus dem Vergleich der Sprachen heraus bearbeiten lassen. Die zur Verfügung gestellten Informationen stammen aus kollegialen Tipps, auch aus der Literatur, und insbesondere aus Beiträgen von erfahrenen Kursleitenden und deren Herkunftssprachen Arabisch, Italienisch, Russisch und Türkisch. 6
7 Kajo Wintzen Schriftkultur wertschätzen und Schriftlichkeit fördern Zum Interesse an Menschen und ihrer Sprache Wenn für Lernende die Notwendigkeit besteht, die individuelle Schriftlichkeit in einer fremden Sprache erst erschließen zu müssen, sagt das zunächst nichts über ihre Teilhabe an der Schriftkultur ihres Herkunftslandes aus. Teilnehmende der schriftsprachlichen Grundbildung kommen mit sehr unterschiedlichen Sprachbiographien in die Kurse. Die Heterogenität in den Lerngruppen ist bekanntermaßen nicht nur hinsichtlich der Lernerfahrungen, die fast völlig fehlen können oder bis zu akademischen Ausbildungen reichen, hoch. Je nach Region treffen Kursleitende auf sehr verschiedene Gruppenzusammensetzungen in Alphabetisierungskursen für Migrantinnen und Migranten. In einem städtischen Großraum können Buchstabenund Sprachanfänger/innen neben Zweitschriftlernern aus sieben und mehr Nationen einen gemeinsamen Kurs besuchen. In der einen oder anderen Großstadt werden möglicherweise vorwiegend Teilnehmende türkischer Herkunft vertreten sein. An anderen Orten trifft man sehr homogene Gruppen mit Teilnehmenden aus Russland oder aus Afghanistan an. In zeitlichen Wellen reisen bestimmte Sprachgruppen verstärkt ein, oder die Möglichkeit der Kursteilnahme spricht sich unter den Angehörigen verschiedener Herkunft herum, und es kommen zum Beispiel das eine Mal viele Frauen aus Südamerika und ein anderes Mal vermehrt Frauen aus Thailand in die Kurse. Daher lässt sich Kursleitenden, die sich für die Herkunftssprachen ihrer Teilnehmenden interessieren, kaum empfehlen, um welche Sprache sie sich besonders bemühen sollten. Das Interesse an Sprache bringen Kursleitende ebenso in ihre Kurse ein wie ihr soziales Engagement. Diesem Interesse sollen die folgenden Beiträge dienen. Fremde Sprachen und fremde Menschen wertzuschätzen, gelingt noch besser, wenn man den Menschen und den Sprachen noch etwas näher kommt. Das Anliegen, Sprache vergleichen zu wollen, um daraus für die Arbeit im Alphabetisierungskurs Nutzen zu ziehen, soll dabei gar nicht sprachwissenschaftlich verfolgt werden. Es dürfen aber Einblicke in Fachgebiete enthalten sein, die Neugier wecken. Eine Reihe von Arbeiten zu Sprachvergleichen entstand in den 70er Jahren im Zusammenhang eines Modellversuches an der Forschungsstelle ALFA der Pädagogischen Hochschule Rheinland. Ziel war die Entwicklung von Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung deutscher Lehrer von Kindern ausländischer Arbeitnehmer (Figge u.a. 1979:1). Veröffentlichungen der Reihe Publikation ALFA beschäftigten sich u.a. mit den Sprachen Türkisch/Deutsch, Griechisch/Deutsch, Portugiesisch/Deutsch und Italienisch/ Deutsch. Untersucht wurden phonetisch-phonologische, orthographische, syntaktische und semantische sowie lexikalische Aspekte. Und bereits in den 70er Jahren wurde die Bedeutung solcher Vergleiche verschieden gewertet. Die kontrastive Linguistik im Sprachunterricht ist nach Lee (1972: 157) nichts anderes als der Versuch, Spra- 7
8 chen insoweit zu vergleichen, als sie vergleichbar sind, was für den Sprachunterricht relevant sein kann. Lee stellt fest, dass der Begriff der kontrastiven Linguistik im Laufe der Jahre viele Bedeutungen angenommen habe und für manche eine Art Sesam-öffne-dich oder Losungswort, der Hauptschlüssel für einen effektiven Sprachunterricht geworden sei, was kontrastiven Untersuchungen eine unverdiente pädagogische Bedeutung beimißt (Lee 1972: 157). Das Hauptinteresse des Sprachlehrers liegt aber beim Sprachgebrauch als einem Werkzeug zur Lebensgestaltung, als einem Mittel, sich auf die Dinge, die nicht Sprache sind, zu beziehen, sie zu handhaben oder sich mit ihnen herumzuschlagen (Lee 1972: 163). Lehrende, die über viele Jahre in Kursen mit Kurden und Türken unterrichten, veranlasst ihr Interesse an den Teilnehmenden und deren Kultur und Sprache zur Einbeziehung der Teilnehmendensprache in den Unterricht. Dazu veröffentlichten Hans Barkowski, Ulrike Harnisch und Sigrid Kumm 1980 Beiträge in ihrem Handbuch für den Deutschunterricht mit ausländischen Arbeitern, das sich auf die Erfahrungen eines Kursangebotes für türkische Arbeiter bezieht, alltagsnahe Beispiele. Sie widmeten ihre Aufmerksamkeit u.a. auch kontrastiv begründeten Lernproblemen : Statt präpositionaler Angaben zur Kennzeichnung räumlicher Verhältnisse (wie: vor, neben, hinter, unter, über) wird das Verhältnis des Gegenstandes zu Vorderseite, Seite, Hinterseite etc. angegeben. Eine Äußerung wie Er stand vor der Tür (wobei das vor betont ist) wird z.b. durch kapinin önünde durdu (wörtlich übersetzt an der Vorderseite der Tür ) wiedergegeben. Die Vielzahl der Präpositionen im Deutschen ist für Türken ganz sicher ein Lernproblem, so umgekehrt für Deutsche beim Türkisch-Lernen die Ortsangaben mithilfe von Nomen ungewohnt sind und ein Umdenken erfordern (Barkowski u.a. 1980: 307). Die Anliegen der Autoren waren allerdings vielfältig und umschlossen das gesamte soziale Beziehungsgefüge der Lernenden, Lehrenden, Institutionen etc. Ihr besonderes Interesse galt der Begegnung der Kulturen, dem Zulassen von Entwicklungsräumen sowie dem Austausch und der gegenseitigen Bereicherung. Das Handbuch ist heute auch als Geschichtsbuch zu lesen. Mitte der achtziger Jahre untersuchte Herrad Meese in ihrer Systematischen Grammatikvermittlung und Spracharbeit u.a. die Fragestellung, auf welche Weise das System der Ausgangssprache und die durch sie bedingten Fehler berücksichtigt werden können. Ihre Arbeit beschäftigt sich im Besonderen mit dem Vergleich der deutschen und der türkische Sprache, zieht aber auch weitere Sprachen (Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Serbokroatisch und Griechisch) zum Vergleich heran. Informationen über Beispiele aus der Grammatik für die deutsche Sprache und für die Vergleichssprachen folgen Beschreibungen der Lernschwierigkeiten bezüglich des ausgewählten grammatischen Feldes und münden in konkrete Vorschläge für den Unterricht. Die Autorin bezieht dazu die zu ihrer Zeit aktuellen Lehrwerke für den Deutschunterricht für ausländische Arbeiter und Jugendliche ein. Der Umfang dieser immer wieder aktuellen Arbeit ist beträchtlich und reicht von der Besprechung von Sprachtheorien in Zusammenhang mit dem Fremdsprachenunterricht bis zur Darstellung wichtiger Grammatikgebiete, die immer auch in Unterrichtsvorschläge münden. 8
9 Meese (1988: 87, 88) stellt z.b. das Verb sein mit seiner Verwendungen im Deutschen dem Türkischen gegenüber. Im Deutschen gilt: Als Vollverb (im Gegensatz zu seiner Funktion als Hilfsverb in zusammengesetzten Zeiten, etwa ich bin gelaufen ) regiert sein den Nominativ als Prädikativ, also eine Ergänzung zum Verb im 1. Fall. Diese Ergänzung kann sein: ein Adjektiv: Er ist müde. ein Nomen/Substantiv: Sie ist Türkin. ein Adverb: Sie ist dort. ( ) Die türkischen Entsprechungen von sein sind sehr vielfältig und kompliziert, da es ein Verb sein nicht gibt das Verb olmak kommt nur in bestimmten Funktionen und Redewendungen vor. Statt des Verbs wird eine Endung verwendet, die den Personalendungen beim Vollverb entspricht, z.b.: müde yorgun Ich bin müde Yorgunum Du bist müde Yorgunsun Er ist müde Yorgun(dur) (1988: 88) Diese Endungen werden auch bei Substantiven und Adverbien angefügt. Ich bin Türkin Türküm Sie ist Türkin Türk(tür) Ich bin dort Oradayim Sie ist dort Orada(dir) (88) Zum Verständnis der Beispiele wären Grundkenntnisse des Türkischen sicher nützlich, sie sind aber wohl nicht erforderlich. Eine Fehlerprognose, die sich ausschließlich auf eine kontrastive Analyse bezieht, lehnt die Autorin allerdings unter Bezugnahme auf einen Beitrag von Bausch&Kaspar ab, den sie folgendermaßen zusammenfasst: Die von Lado und Fries aufgestellte These, daß die Grundsprache (z.b. das Türkische) die Zweitsprache (das Deutsche) so beeinflusse, daß identische Elemente und Regeln leicht und fehlerfrei erlernt würden, unterschiedliche hingegen zu Schwierigkeiten und Fehlern führten, ist nicht richtig. Neben den durch die Muttersprache ausgelösten Fehlerquellen gibt es noch andere Fehlerquellen (13). Zur Beschreibung der Lernschwierigkeiten bezieht sich Meese daher u.a. auf das Heidelberger Forschungsprojekt Pidgin Deutsch und das Wuppertaler Forschungsprojekt ZISA (vgl ). Dies sind Untersuchungen zum ungesteuerten Zweitspracherwerb ausländischer Arbeiter, die eine stufenweise Annäherung der Lernenden an die deutsche Sprache beschreiben, die die Lernenden u.a. durch eigene Regelbildungen weiterentwickeln oder aber fossilieren. Daneben zieht die Autorin Ergebnisse einer Untersuchung von Pienemann Der Zweitspracherwerb ausländischer Arbeiterkinder hinzu (vgl. 15). Dass in den damaligen Studien festgestellt wurde, dass der Kontakt mit Deutschen die entscheidende Rolle für das Deutschlernen habe, wundert Kursleitende nicht. 9
10 Manchmal erscheint es unwichtig, ob die Fehler der Lernenden als Interferenzfehler erklärbar, also durch die Verschiedenheit von Muttersprache und Zweitsprache bedingt sind. So konstatiert Meese zum Umgang mit dem Verb sein : Auffällig ist, dass die Deutschlernenden die konjugierten Formen von sein sehr regelmäßig und sehr lange nicht benutzen. ( ) Unwesentlich erscheint mir, ob das Weglassen durch die Muttersprache bedingt ist oder eine Phase auf dem Weg zum Deutschlernen (Interlingua); wesentlich ist, dass die Weglassung bei allen Ausländern vorkommt: das Türe (für: Das ist eine Türe. ) hier Junge (für: Hier ist ein Junge. ) Ich Ingenieur (für: Ich bin Ingenieur. ) Der Gebrauch von sein stellt eine Lernschwierigkeit dar, die gesondert berücksichtigt werden sollte. Das wird in den vorhandenen Lehrwerken jedoch nicht getan (Meese 1988: 89). Meese (1988: 90 ff.) bietet auch zum Umgang mit dem Verb sein einen Umsetzungsvorschlag für den Unterricht an. Gerade weil die Aufmerksamkeit gelegentlich mehr auf sprachvergleichende Elemente gelenkt wird, sollen Hinweise auf die anderen Faktoren für das Gelingen von Spracherwerb nicht aus den Augen verloren werden. Kuhs (1989: 9) weist darauf hin, dass der Kontrastiv-Hypothese, nach der das Zweitsprachenlernen in engem Zusammenhang mit Ähnlichkeit / Verschiedenheit der beteiligten Sprachen steht, noch eine weitere Ebene hinzugefügt werden muss, die die vorausgegangenen Entwicklungssequenzen berücksichtigt (vgl. Kuhs 1989: 8, 9). Lernende der Zweitsprache Deutsch haben durchaus zuvor noch weitere Zweitsprachen mehr oder weniger bruchstückhaft gelernt, und die bereits vor dem Kurs erworbenen Möglichkeiten in der Zweitsprache Deutsch sind sehr unterschiedlich. Kuhs Beitrag bietet einen wichtigen und interessanten Einblick in die sozialpsychologischen Einflussfaktoren beim Zweitspracherwerb. Sie geht u.a. auf die Ausmaße und die Qualität der Sprachkontakte, auf die Werthaltung gegenüber fremden Sprachen, auf Integrationsstrategien und auf affektive Faktoren wie Angst und Hemmungen im Zusammenhang mit dem Spracherwerb ein. Für den Rahmen der Alphabetisierungsarbeit wäre es sicher lohnend, die Einflüsse eines language shock und eines culture shock (Begriffe, die auf Schuhmann zurückgehen, vgl. Kuhs 1989: 53, 54) zu betrachten. Die Angst der Teilnehmenden davor, ihren unzureichenden Spracherwerb zu offenbaren, können Kursleitende in ihrem Unterricht differenziert erfahren. Weniger offensichtlich erscheint die Problematik, dass Teilnehmende Angst vor der Anpassung an die fremde Kultur haben können. Keim (1984) erläutert u.a. SCHUHMANNs Modell des Zweitspracherwerbs (85) näher, das Sprachlernbedingungen mit den Problematiken von sozialer Distanz (Problemlösungsstrategien passen nicht mehr, Verschiedenheit der Kulturen, Aufenthaltsdauer, ethnische Vorurteile etc.) oder Nähe und psychologischer Distanz (Scham, Angst, Unsicherheit) in Verbindung bringt (86, 87). Ein Ansatz, der gerade für die Arbeit in Alphabetisierungskursen Beachtung verdient. 10
11 Für die sprachwissenschaftlich interessierten Kursleitenden liegen kontrastive Grammatiken, wie zum Beispiel für Deutsch-Italienisch von Gislimberti (1989), oder Sprachvergleiche, wie der von Gladrow (1998) Russisch im Spiegel des Deutschen, vor. Solche Arbeiten wenden sich an Studierende und Lehrende der jeweiligen Sprachen. Der Sprachvergleich von Gladrow kann für russische Muttersprachler/- innen unter den Lehrenden, die unter Umständen in Gruppen von Teilnehmenden russischer Herkunft und gehobener Bildung unterrichten, auch als Nachschlagewerk bereichernd sein. Die Richtung dieses russisch-deutschen Sprachvergleichs wechselt je nach inhaltlichem Schwerpunkt. Auch diese wissenschaftliche Arbeit bietet Anknüpfungspunkte an mögliche Alltagserfahrungen von Teilnehmenden. Denkt man an die Zugausfälle des vergangenen heißen Sommers, so ließen sich russische Reisende vorstellen, die bei einer technischen Panne ihres Zuges auf einen Bus verwiesen würden, der als Schienenersatzverkehr bezeichnet wird. Eine Bezeichnung, für die es im Russischen keine Entsprechung gibt (vgl. Gladrow 1998: 268). Ebenso lassen sich in der Lerngruppe russische Begriffe finden, zu denen die deutschen Worte fehlen. Falsche Freunde, wie zum Beispiel Wörter, die in den beiden Vergleichssprachen ganz unterschiedliche Bedeutung haben, bieten ebenfalls Anlass zum Gespräch über Sprache. So steht das russische Wort, das mit Blick übersetzt wird, für Lichtreflex; Glanzlicht; Lichtfleck im Russischen und in der deutschen Sprache für kurzes Hinschauen; Ausdruck der Augen; Aussicht (Gottlieb 1995: 6). In den angesprochenen Kursen mit Teilnehmenden russischer Herkunft wären Kursinhalte zum Sprachvergleich und zur Reflexion über Sprache gut denkbar und hilfreich. Eine vertiefende Vermittlung bezieht sich in der Regel eher auf akademische Bereiche des Sprachenlernens. Der Reflexion über Sprache, Herkunfts- wie Zweitsprache, kann im Kursgeschehen ein fester Platz zugewiesen werden. Die Intensität dieser Auseinandersetzung und ihre Form wird deutlich von den Möglichkeiten der Teilnehmenden bestimmt. Lee (1972: 163) bemerkt kritisch: Viele der schon angestellten Vergleiche haben sich eher mit Formen denn mit der Verwendung jener Formen beschäftigt, die darauf abzielt, sich auf das Leben zu beziehen und es zu bewältigen. ( ) Das zentrale Problem beim Unterrichten einer Fremdsprache besteht jedoch darin, den bedeutungsvollen Gebrauch ihrer Systeme und Strukturen als eines Mittels zu Kommunikation mit anderen Leuten anschaulich zu machen und zu üben, und alle anderen Probleme des Sprachunterrichts erscheinen demgegenüber zweitrangig (Lee 1972: 165). Das Problem mit der zweitsprachlichen Kompetenz wird leicht auf ein persönliches Unvermögen reduziert. Die Lernerbiographien von Alphabetisierungskursteilnehmenden sind allerdings häufig Beweise ausgeprägter Kompetenzen und einer besonderen Überlebensfähigkeit. Menschen, die über sehr viele Jahre in einem Land leben, ohne sich dessen Sprache in Wort bzw. in Schrift angeeignet zu haben, wird mit Unverständnis begegnet. Wie kann denn aber ein Mensch, der in die Fremde zieht, auch noch seine Muttersprache, die ihm die einzig verbliebene Heimat ist, hinter sich lassen? Und wenn sich in der Fremde eine große Sprachgemeinschaft der eigenen Herkunft zusammenfindet, soll man dort nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen und können? Für manche Regionen und Menschen bestimmter Herkunftssprachen ist die deutsche Sprache für diese Teilhabe tatsächlich nicht erforderlich. Ihr Interesse an der deutschen Sprache zu fördern und zu entwickeln ist aber eine wichtige und lohnende Herausforderung. Es gilt, Türen zu öffnen. Zurzeit werden die Wege zur deutschen Sprache leider in Stunden abgemessen. Jenseits dieser Zeit sind aber manche Teilnehmende, wie Kursleitende sie in 11
12 Alphabetisierungskursen antreffen, nicht mit dem Lesen- und Schreibenlernen und ihrer Integration fertig. Aus dem Kursalltag stammt der von Karin Brandt 1998 verfasste Beitrag (AOB 2008). Mit ihrem A wie Arabisch deutsch-arabischer Sprachvergleich und seine praktische Umsetzung für die Alphabetisierung in der deutschen Sprache legte sie Unterrichtsmaterial für den Alphabetisierungsunterricht mit Teilnehmenden aus arabischen Ländern vor. Der Beitrag wurde 2008 von Christiana Gürgen und Ute Jaehn-Niesert überarbeitet. Er bietet allgemeine Informationen über die arabische Sprache, Schriftzeichen (allerdings ohne Beispiele der Schrift), die Lautebene, die Wortbildung und die Artikel. Die Sammlung enthält außerdem Arbeitsblätter zur Begriffsebene, Lautebene, Buchstabenebene, Wort-, Satz- und Textebene, die sich an möglichen Schwierigkeiten von arabisch sprechenden Teilnehmenden orientieren. Zu den verschiedenen Ebenen werden Zielvorgaben formuliert, die den Übungen der Arbeitsblätter zugeordnet sind. So zum Beispiel das siebte Ziel: Die mündliche und schriftliche Anwendung des e im Wort. E Der wichtigste Buchstabe in Deutschland dieses Zitat einer Teilnehmerin fasst treffend zusammen, wie Menschen des arabischen Sprachraumes den Laut wahrnehmen. Tatsächlich ist das e im Deutschen von großer Bedeutung, da es lautlich die Bindung zwischen Wort und grammatischer Funktion ist. Es kommt nämlich sehr oft vor grammatische Endungen (z.b. frisches Obst, Frauen). Das e stellt allerdings besondere Schwierigkeiten für arabische Teilnehmer dar, und zwar aus mehreren Gründen. Der wichtigste ist der der Abwesenheit in ihrer Muttersprache. Weitere Gründe sind in der deutschen Sprache zu finden: das e wird zwar durch ein Graphem (Schriftzeichen) abgebildet, hat aber viele lautliche Varianten. ( ) Je nach Buchstabenumgebung fällt es lautlich anders aus. ( ) Den Teilnehmenden muss klar werden, dass das e in verschiedenen Ausführungen fast immer in den Wortendungen des Deutschen steckt, ob das bei der Beugung von Verben ist oder bei Worten, deren letzter Laut r, l oder n ist. (AOB 2008: 16, 17). Auf ähnliche Bemühungen wird weiter unten noch hingewiesen. Der 2005 von Alexis Feldmeier veröffentlichte Beitrag Die kontrastive Alphabetisierung als Alternativkonzept zur zweisprachigen Alphabetisierung und zur Alphabetisierung in der Zweitsprache Deutsch am Beispiel der Sprachen Kurdisch und Türkisch beschreibt mögliche Ansätze zur Einbeziehung der Muttersprache von Teilnehmenden in den Alphabetisierungskurs. Für eine zweisprachige Alphabetisierung empfiehlt der Autor, mit Kurdisch und Türkisch beginnend zu alphabetisieren und daran mit Deutsch anzuknüpfen, da Kurdisch und Türkisch Sprachen mit einem sehr einfachen Laut- und Buchstabensystem sind (Feldmeier 2005: 44). Für Arabisch merkt er den Nachteil einer zweisprachigen Alphabetisierung im Falle anderer Schriftsysteme an, der darin besteht, dass eine spätere Übertragung der Buchstabenkenntnisse von einer auf die andere Sprache nicht möglich ist (48). Als Alternative zum zweisprachigen Ansatz schlägt Feldmeier die kontrastive Alphabetisierung vor, die auch in Kursen mit Teilnehmenden mehrerer verschiedener Muttersprachen praktiziert werden könne. In seinem Praxisbeispiel bezieht er sich auf Kurdisch und Türkisch. Der wichtigste Aspekt bei der kontrastiven Alphabetisierung ist der Einsatz von kurdischen / türkischen Wörtern / Sätzen und ihren Übersetzungen ins Deutsche als Beispielwörter (44). 12
13 Muttersprachliche Worte können den Wortschatz des Anfangsunterrichts ergänzen. Für fortgeschrittene Teilnehmende sieht Feldmeier Möglichkeiten zum Unterrichtsgespräch über Sprache zum Beispiel über die Vokalharmonie des Türkischen und des Deutschen (vgl. 2005: 45). Für die Kursleitenden setzt der Autor das Laut- und Buchstabeninventar und ein Gespür für die Aussprache der Muttersprache der Teilnehmenden voraus (45). In seinem im Frühjahr 2010 erschienenen Praxishandbuch Alphabetisierung widmet Feldmeier, der auch Autor des Konzeptes für einen bundesweiten Alphabetisierungskurs des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist, einige Seiten der Kontrastiven Alphabetisierung und Grammatikeinführung. Er knüpft hier, wie auch schon im BAMF-Konzept, an seinen 2005 in der Zeitschrift Deutsch als Zweitsprache veröffentlichten Beitrag zur kontrastiven Alphabetisierung an. Für das Konzept für einen bundesweiten Alphabetisierungskurs stellt die kontrastive Alphabetisierung ein ergänzendes Konzept zur L2-Alphabetisierung dar, das auch in multinationalen Teilnehmergruppen realisierbar ist und das zur Förderung sprachmittelnder Kompetenzen, so wie sie im GER gefordert werden, eingesetzt werden kann (BAMF 2009: 103). Einschränkungen bei der Umsetzung der kontrastiven Alphabetisierung sieht Feldmeier bei sehr fremden Herkunftssprachen oder bei Ablehnung einer Muttersprache durch die Teilnehmenden. Bei multinationalen Gruppen verweist er auf die Vorzüge einer teilnehmerorientierten Alphabetisierungsarbeit im Sinne eines Individualprogramms (BAMF 2009: 103). Im Praxishandbuch Alphabetisierung bekräftigt Feldmeier noch einmal die im BAMF-Konzept beschriebene notwendigerweise zu verändernde Sichtweise der Rolle der Lehrenden. Rolle der Lehrkraft ist es nicht, z.b. Experte für die Teilnehmermuttersprachen zu sein, den Teilnehmenden ihre jeweiligen Muttersprachen vermitteln zu wollen, die Orthographie der Teilnehmermuttersprachen zu vermitteln, die Grammatik der Teilnehmermuttersprachen zu vermitteln, die Teilnehmenden zu kontrollieren oder zu korrigieren. ( ) Aufgabe der Lehrkraft ist vielmehr das Expertenwissen der Teilnehmer hervorzuheben, zum Transfer schriftsprachlicher Kompetenzen in die Muttersprache zu ermuntern, den Transfer- und Lernprozess beratend zu unterstützen, zu Aha-Erlebnissen in der jeweiligen Muttersprache zu verhelfen (Feldmeier 2010: 121, Unterstreichung i.o.). Von den Lehrenden wird ein starkes Interesse an den Muttersprachen ihrer Teilnehmenden erwartet. Sie sollen die Förderung der Sprachmittlung als Möglichkeit wahrnehmen, selbst zu lernen und sich von den eigenen Lernern viel zeigen zu lassen (Feldmeier 2010: 121). 13
14 Das Praxisbeispiel Feldmeiers zur kontrastiven Alphabetisierung im Praxishandbuch Alphabetisierung bezieht sich auf die Sprachen Türkisch und Deutsch und zielt auf die Ausbildung eines Verständnisses für den morphematischen Aufbau der Sprache (121). Von den Teilnehmenden werden im Rahmen einer systematischen Arbeit mit Beispielsätzen u.a. Konjugationsendungen als sich wiederholende Elemente erarbeitet. Farben unterstützen das selbstentdeckende Lernen. Zur Verwendung werden laminierte Karten vorgeschlagen, die sich im weiteren Verlauf der Arbeit auf der Rückseite mit der Entsprechung in der Teilnehmersprache beschriften lassen. Bei mehreren Sprachen lassen sich Quader verwenden. Ein Teilnehmer, der z.b. Arabisch, Türkisch, Kurdisch und Deutsch beherrscht, kann durch die Arbeit mit Bauklötzen auf eine spielerische Weise die Konjugationen mehrerer Sprachen miteinander vergleichen (Feldmeier 2010: 123, 124). Im Rahmen des Köln-Siegener Verbundprojektes PAGES, Projekt Alphabetisierung und Grundbildung im Sozialraum ( ) entstanden Bemühungen um die Umsetzung einer kontrastiven Alphabetisierungsarbeit. Auf die Arbeiten von Fuhrmann/Schöneberger und Franke/Will sei hier kurz zur Beachtung verwiesen: Fuhrmann und Schöneberger (2009) knüpfen in ihrem Beitrag Kontrastive Alphabetisierung in der Zweitsprache Deutsch an das von Feldmeier 2005 angesprochene Alternativkonzept einer kontrastiven Alphabetisierung an. Im Rahmen ihres Praxisbeispiels für die Sprachen Deutsch und Arabisch stellen sie die phonologischen Interferenzen der Sprachen mit 18 Vokalphonemen der deutschen und 6 Vokalphonemen der arabischen Sprache als besondere Herausforderung für arabischsprachige Lerner heraus (2009: 11). Die Lautunterschiede beider Sprachen gelte es für Lernende wahrzunehmen, um sie in der Schriftsprache anwenden zu können (vgl. 16). Für die Qualifizierung von Kursleitenden fordern die Autorinnen Kenntnisse über die grundlegenden, relevanten Unterschiede zwischen Deutsch und den häufigsten Herkunftssprachen der Teilnehmer (z.b. Arabisch, Chinesisch, Farsi etc.) (19). Für den Unterricht schlagen sie u.a. tabellarische Zusammenstellungen phonetischer und struktureller Unterschiede der Sprachen vor (vgl. 20). Franke und Will (2009) bieten in einem Vortrag zur kontrastiven Alphabetisierung Thailändisch-Deutsch interessante Informationen zu den Merkmalen von Tonsprachen. In Tonsprachen hat die Tonhöhe der Aussprache eine bedeutungstragende Funktion. Entscheidend sind dabei sowohl verschiedene Tonhöhen als auch steigende bzw. abfallende Tonhöhenverläufe. ( ) Die thailändische Sprache umfasst fünf verschiedene Tonhöhen bzw. Tonhöhenverläufe: nā Reissetzling, ná Kosewort, nà Gesicht, nâ Tante/Onkel, nă dick (2009: 3). Wichtige Unterscheidungsmerkmale beider Sprachen, typische Ausspracheschwierigkeiten von thailändischen Lerner/-innen und konkrete didaktische Vorschläge für Übungen zur Lautbildung fügen die Autorinnen in ausführlichen tabellarischen Gegenüberstellungen bei (vgl. 4-12). 14
15 Die bisher genannten Beispiele sprachvergleichender Alphabetisierungsarbeit hinterlassen den Eindruck einer Forderung an Kursleitende, sich mit den Sprachen Arabisch, Chinesisch, Farsi, Kurdisch, Russisch, Thailändisch und Türkisch zu befassen. Aus dem Folgenden ließe sich Italienisch ergänzen. Darum kann es aber sicher nicht gehen. Die vorliegenden Beiträge und Beispiele sollen vielmehr dem Interesse an den Sprachen von Teilnehmenden genügen und auf die eine oder andere Arbeit aufmerksam machen. Grundsätzlich stellt sich, wenn Sprachvergleiche angestellt werden, auch immer die Frage nach dem, was eigentlich miteinander verglichen werden soll. Auf beiden Seiten der kontrastiv betrachteten Sprachen stellt schließlich die Standardsprache, die als Grundlage herangezogen wird, nur eine Vereinbarung zugunsten einer der Regionalsprachen dar. Für das Italienische ist das zum Beispiel die Florentinisch-Toskanische Variante, die sich als Normitalienisch durchgesetzt hat (vgl. Figge u.a. 1979: 6). Von den in Deutschland eingewanderten Italienern sprechen 68% eine süditalienische Variante. Die wiederum regionalen Dialekte des Süditalienischen vertreten Sprecher/-innen aus Kampanien (12%), Apulien (14%), Lukanien (5%), Kalabrien (14%), Abruzzen-Molese (8%) und Sizilien (12%) (vgl. Figge u.a. 1979: 7,8). Im Sprachvergleich wäre zum Beispiel zu bedenken, dass süditalienische Dialekte durchaus ein Neutrum des Artikels kennen, während in der Normsprache nur nach zwei Genera unterschieden wird (vgl. Figge u.a. 1979: 37). Aber es gibt unter Umständen noch mehr zu bedenken, denn es kann zum Sprachvergleich durchaus erforderlich sein, die Analyse auf je verschiedener Ebene der beiden Sprachen durchzuführen. So kann z.b. das, was lexikalisch gesagt wird, durch Phonologie oder Syntax ausgedrückt werden und umgekehrt. Das englische I don t lend my books to anyone kann, je nach Intonation, I lend my books to no one oder I lend my books to special people only bedeuten, während im Französischen personne oder n importe qui den Unterschied ausdrückt (Lee 1972: 163). Möchte man als Gründe für die Probleme beim Zweitspracherwerb die Unterschiede zwischen der Herkunfts- und der Zweitsprache näher betrachten, so darf man auch nicht vergessen, dass neben der angesprochenen Problematik der Normsprachen, die man für diesen Vergleich zu Grunde legt, die Migrantinnen und Migranten eine Sprachbiographie mitbringen, in deren Folge verschiedene Sprachen in unterschiedlicher Ausprägung angeeignet wurden, und es häufig zu einer verfestigt falschen Sprachaneignung der Zielsprache Deutsch gekommen ist. Zudem leben die Kursteilnehmenden in teilweise sehr heterogenen oder auch in stark abgeschlossenen homogenen Sprachgemeinschaften. Was als Sprache und Schriftkundigkeit in den Kurs mitgebracht wird, ist also unter Umständen sehr komplex. Im Falle von Migration bilden sich schon in den Familien sehr heterogene Sprachstrukturen. So spricht zum Beispiel eine aus der Türkei stammende Mutter mit ihrer Tochter ausschließlich Kurdisch, aber mit dem wesentlich später in Deutschland geborenem Sohn nur Türkisch. Kurdisch versteht der Sohn nicht. Er spricht mit seiner Schwester Türkisch und Deutsch. Die Mutter versteht Deutsch allerdings kaum. Das über die Jahre falsch gelernte Deutsch und seine Verfestigung stellt darüber hinaus eine besondere Herausforderung dar. Die Sprachbiographie des beschriebenen jungen Mannes lässt ihn in keiner Sprache wirklich zu Hause sein. 15
16 Wenn auch die Herkunftssprache bzw. ihr Dialekt nicht in schriftlicher Form zum Vergleich vorliegt oder die Schriftsprache nicht oder kaum erlernt wurde, so lässt sich dennoch an die Biographie der Lernenden und ihre Welt- und Kulturerfahrungen anknüpfen. Die Kulturen der Feste sind beispielsweise sehr facettenreich und im Vergleich überaus interessant. Deren Ausübung und Beschreibung hat unmittelbaren Alltagsbezug. Rede- und Schreibanlässe reichen von den Festtagsspeisen und ihrer Zubereitung über den Tagesablauf bis hin zur schriftlichen Bitte um Beurlaubung im Kurs. Sprachvergleich und Kulturvergleich bedeuten hier echtes Interesse aneinander. Eine schöne Grundlage für das gemeinsame Lernen. Wertschätzung durch Einbeziehen der Herkunftssprache und Kultur hilft auch die Sprachlichkeit und Schriftlichkeit zu fördern. Sprech- und Schreibanregungen stammen aus allen Sprachen und Kulturen und vermitteln zwischen ihnen. Die gegenseitige Bereicherung und nicht der Mangel tritt in den Vordergrund. Der Wortschatz des Kurses ist auf diese Weise weniger fremd. So können zum Beispiel ausgewanderte Wörter wie das Wort Kumpir Türkisch für: Ofenkartoffel, Folienkartoffel (Limbach 2007: 96) zum Kursthema werden. Es stammt vom pfälzischen Krummbeere und wurde über deutsche Siedler und Balkantürken nach Anatolien eingeführt. In der Gegenwart wird das Wort als türkisches Kumpir-ci wieder zurück nach Deutschland gebracht. Es bezeichnet einen türkischen Imbiss für Kartoffelspezialitäten und bedeutet Krummbeerkoch (vgl. 2007: 96). Rund um die Kartoffel, den Erdapfel, Ärpel etc. und seine Erscheinungsformen in der Küche ließe sich in diesem Zusammenhang ein kleines kulinarisches Unterrichtsprojekt gestalten, das alle Sinne einbezieht. Unter dem Stichwort Food Literacy hat sich eine von vielen neuen Zugangsweisen zur sprachlichen Grundbildung entwickelt. Zur Anregung seien noch einige Beispiele genannt: Im libanesischen Dialekt des Arabischen bürgerte sich durch Rückkehrende die Wendung Ach so! ein. Vorher musste man zum Ausdruck dafür, dass man etwas erst im Nachhinein verstanden hat, ganze Sätze bilden (2007: 126). Eine dicht besiedelte Region um Mailand wird im Italienischen als Hinterland bezeichnet. Im Deutschen wäre das eher ein schwach besiedelter Landstrich. Das Wort Realpolitik wurde zum Ausdruck für wahrhaft sinnvolle Politik. Ein Wort, das man mit Willy Brandt assoziiert hat (vgl. 2007: 82). Von den eingewanderten Wörtern (vgl. Limbach 2008) ist aus dem Türkischen längst der Dönerkebab und aus dem Italienischem die Latte macchiato in die deutsche Alltagssprache übernommen worden. Pizza und Pasta sind schon lange selbstverständlich. Als das gebräuchlichste deutsche Wort in der russischen Sprache (Limbach 2007: 94) gilt Butterbrot. Dabei handelt es sich um geschlossene Brotscheiben mit reichlich gutem Belag (in Russland aber ohne Butter!), die zum Beispiel in Theaterpausen angeboten werden. Solche Beispiele wie auch die Bezüge auf ein- oder ausgewanderte Worte beschreiben die Möglichkeit authentischer Gesprächs- oder Schreibanlässe. Solcher Wortschatz verdeutlicht Verbindungen von Sprachen und Kulturen. Der Anspruch, verbindende Anknüpfungspunkte zu schaffen, hat einen hohen Stellenwert. Für die erste Begegnung mit der Schrift/Sprache können diese Gemeinsamkeiten ein Zeichen für gegenseitige Wertschätzung und Annahme setzen. 16
17 Praxistipps Nach eigenen Erfahrungen gefragt, geben Kursleitende, die mit Lernhindernissen von Migrantinnen und Migranten verschiedener Herkunftssprachen in Alphabetisierungskursen zu tun haben, ganz allgemeine Tipps und auch umfassende Erkenntnisse wieder. In den folgenden Beispielen von Hilfen und Tipps für Alphabetisierungskursleitende bringen insbesondere Kursleitende mit eigenem Migrationshintergrund ihr Expertenwissen ein. Arabisch Zwischen der deutschen und der arabischen Sprache gibt es viele Unterschiede. Zum einen die andere Schreibrichtung, die bei einigen Schülern motorische Probleme verursacht bisweilen auch Schmerzen in der Hand durch Verkrampfung. Zum anderen sind die Buchstaben nicht so ausgefeilt. Das heißt, die arabische Schrift besteht zum Teil aus einfachen Strichen, die verbunden oder nicht verbunden werden, mit Punkten oben oder unten versehen werden. Ein Strich ist einfacher zu machen als ein k beispielsweise. Auch gibt es keine Groß- und Kleinschreibung. Jedoch muss für jeden Buchstaben Anfangs-, Mittel-, End- und Einzelstellung gelernt werden. Die Grammatik ist ebenfalls verschieden. Einen einfachen Satz kann man ohne Verb bilden: Hasan ist im Auto Hasan im Auto bzw. Das Buch liegt auf dem Tisch Das Buch auf dem Tisch. Zwischen männlich und weiblich wird bei diese unterschieden (haca, hacii). Ulrike Weyrether Russisch Aus meinen Beobachtungen in Alphabetisierungskursen habe ich zum Russischen und Deutschen folgende Tendenzen festgestellt: a) Typisch phonetische Fehler: [l] wird palatalisiert ausgesprochen (z.b. bald ), velarisierte Aussprache des Lateralen [l] (z.b. Geld, Probleme ), stimmloser frikativer Laut [s] anstatt Affrikate [ts] (z.b. Zug ), Ausfall von nasalem Laut [n] (z.b. fünfzig ), statt des stimmhaften Konsonanten [v] stimmloser Laut [f] (z.b. aufwuchsen, Karneval ), Aussprache des stimmlosen Explosiven [k] statt des Ach-Lautes [x] (z.b. auk ) (auch ländlich/dialektal bedingt), stimmhafter frikativer Laut [z] anstatt Affrikate [ts] (z.b. zurück ), Delabialisierung der Vokale [ö] und [ü] (z.b. schen, zurick ), Verzicht auf die Variationen von E-Lauten (z.b. schwär / schwer, speter / später, Mährwärtsteuer / Mehrwertsteuer, lähr / leer ), Delabialisierung des Vokals [y] (z.b. zurick / zurück, Psichologin / Psychologin ). 17
18 b) Typisch orthographische Fehler: [u] Laut und u -Buchstabe im Deutschen wird von den Russischsprechenden mit [i] verwechselt, weil es im Russischen äquivalent dem i - Vokal ist; (Butter / bitter) Diphthong [eu] mit [ei] bewirkt die Schreibweise (neu/nei, Leute/Leit; Anmerkung: klingt also dialektal gefärbt); [p] u. p wird mit [r][r], r verwechselt, da diese Bezeichnung im Russischen für r gilt (Puppe/Rirre; Tulpe/Tilre; Kopf/Kort); Deutsches ch wird durch Russisches x ersetzt (Koch/Kox; Küche/Kixe); Vokalisiertes [æ] bei der Schreibweise von -er im Wortauslaut wird durch a ersetzt (ist nicht nur bei den russischsprechenden Migrantinnen und Migrannten, sondern auch im arabischen Sprachraum anzutreffen) (Mutter/Mita/Muta; Vetter/Veta); Die Schreibweise von t und f (Kopf/Kort/Kopt; treffen/treten) (falsche opt. Wahrnehmung); Die Schreibweise von Q und O (Qual/Oual) (falsche optische Wahrnehmung) Ausgangssprache Fehler mögliche Therapien Russisch, Ukrainisch 1. Die getrennte Aussprache von Nasalen [Ñ] bei der Schreibweise von ng, in der Konsonantenverbindung nk im In- und Auslaut Deutliche Aussprache von [Ñ]: in isolierten gereimten Wörtern: Bank, Dank, Frank, trank, Schrank; im Wortin- und auslaut (in Singular- u. Pluralform): Zeitung Zeitungen; Endung Endungen; Meinung Meinungen; Sendung Sendungen. im Zungenbrecher: Eine lange Schlange ringelte sich um eine lange Schlange. Um eine lange Schlange ringelte sich eine lange Schlange. (Das ermöglicht die Einprägung der geraden und der invertierten Wortfolge.) Ausgangssprache Fehler mögliche Therapien Russisch, Ukrainisch, Kroatisch 2. Die entstellte Aussprache des Ich -Lautes ( isch, [x]) im In- und Auslaut Deutliche Aussprache des Ich -Lautes: in der Opposition des Ach - und Ich -Lautes (Singular- u. Pluralform): Buch Bücher; Bach Bäche; Dach Dächer; Nacht Nächte; in Zungenbrechern: Ich spreche den Ich -Laut nicht richtig aus. Es ist sehr wichtig, den Ich -Laut, richtig auszusprechen. Hinsichtlich der typisch orthographischen Fehler, die die russischsprechenden Migrantinnen und Migranten häufig zulassen, habe ich mich noch an zwei Beispiele erinnert und zwar: [g] u. g wird mit [d] u. d verwechselt, da diese Bezeichnung im Russischen für d gilt (gern/dern; Gabel/Dabel); [y] Laut und y -Buchstabe im Deutschen wird von den Russischsprechenden mit [u] verwechselt, weil es im Russischen äquivalent dem u - Vokal ist (Handy/Händu; Party/Partu). Irina Dmitrienko 18
19 Arabisch Einige oft vorkommende Probleme bei arabischsprachigen Teilnehmenden der Alphabetisierungskurse: a) Auslautidentifizierung r b) Die Schwierigkeit, zwei Konsonanten nebeneinander zu identifizieren. Zum Beispiel: Börut Brot, Farge Frage c) Ca. 90% haben Probleme beim Auslaut e - für sie kommt öfters a als e in Frage. d) Verwechselung von Anlaut I und E: Isel statt Esel! Mojgan Styner Russisch Die Russen sind ein etwas anderes Volk mit etwas anderen Bräuchen. Sie fahren z.b. nicht mit dem, sondern auf dem Bus. Ebenso auf der Straßenbahn, auf dem Zug etc. Wenn sie es aber einmal gelernt haben, mit dem Bus zu fahren, so gehen sie auch gleich mit dem Fuß. Die Möbel stellen sie nicht an, sondern neben die Wand und Bilder hängen sie dementsprechend auf die Wand, sowie Leuchten auf die Decken. Wir kennen keinen Unterschied zwischen an und auf. Ich erkläre es folgendermaßen: Was sich auf einer horizontalen Ebene befindet und nicht runterfallen kann ist auf, z.b.: Tisch nichts kann runterfallen, alles steht, liegt auf dem Tisch! (Gegenbeispiel: Decke es kann was runterfallen, also an ). Etwas anders verhält es sich hingegen mit der Kleidung. So tragen die Russen immer zwei Hosen. Ähnlich verhält es sich mit der Brille, Schere. Diese Gegenstände gibt es eben nur in einer Pluralform. Hier kommt man nicht ums Auswendiglernen drumrum. Im Russischen gibt es keine Hilfsverben, daher kommen auch diese genialen Vergangenheitsformen wie heute ich gegangen, gestern ich gemacht usw. Wobei die Wortfolge hierbei eine eher untergeordnete Rolle spielt. Genial ist ebenfalls der Spruch: Wir mit meinem Mann gestern ins Kino gegangen Als Deutscher möchte man doch gleich eine Frage stellen: Wer bitte war denn der Dritte??? Dabei handelt es sich aber im Russischen lediglich um zwei Personen. Wenn die Russen etwas spielen, dann spielen sie eher in etwas. Zum Beispiel: Wir heute in Schach gespielt ; genauso ins Fußball und in Karten. Ach ja, wenn wir schon vom Spielen reden: Die Russen beißen nicht ins Gras, sie spielen in den Kasten! Über anatomische Abweichungen sollte man sich auch nicht wundern. Wir haben nämlich keine Zehen, sondern Fußfinger. Zum Telefonieren: Wir rufen nicht jemanden, sondern jemandem an. Wir gehen davon aus, wir sagen jemandem etwas am Telefon. Anna Arera 19
20 Lucia Coluccia Wenn Italiener Deutsch lernen Die Italiener sind ein sehr offenes Volk. Das bedeutet, dass wir sehr gern neue Menschen kennen lernen und uns mit ihnen genau so gern und schnell anfreunden. Deshalb lieben wir es einfach, uns mit anderen zu unterhalten, und wenn wir sprechen, meistens machen wir es dann schnell und laut. Es ist mir schon oft passiert, Araber oder Türken oder Asiaten laut und schnell sprechen zu hören. Der erste Gedanke war oft: Streiten sie etwa?. Ich wusste es jedoch besser, denn ich kann mir gut vorstellen, dass andere Menschen genau das Gleiche von uns Italienern denken müssen, wenn sie uns in der Straßenbahn sprechen hören. Und jetzt kommt die Auflösung für alle: Wir streiten nicht, wir quatschen nur. Und noch etwas: Wenn jemand leise spricht, heißt es für uns, dass er etwas verheimlichen möchte oder dass er schlecht über jemanden spricht. Wie schon erwähnt: Wir sind meist offene Menschen und gerade diese Kontaktfreudigkeit bringt uns Italiener dazu, die gesprochene Sprache ziemlich schnell, wenn auch fehlerhaft, zu lernen. Wo liegen jedoch für die Italiener die Schwierigkeiten beim Deutschlernen, vor allem in der Alphabetisierung? Als Erstes möchte ich sagen, dass ich persönlich bis jetzt nur drei Italienerinnen in meinen Kursen unterrichtet habe. Zwei davon hatten in Italien die Schule mindestens drei Jahre lang besucht, das heißt, dass sie eigentlich schon lesen und schreiben konnten (wenn auch sehr mühsam). Nur eine hatte keine Schule besucht und musste also alles neu lernen. Ich habe meinen Beitrag in drei Abschnitte geteilt: 1. Schwierigkeiten in der Phonetik 2. Schwierigkeiten in der Semantik 3. Schwierigkeiten in der Syntax Dabei habe ich immer versucht, den kulturellen Faktor nicht aus den Augen zu verlieren. Die Aufteilung hört sich sehr wissenschaftlich an, deshalb möchte ich es doch noch deutlich sagen: Das ist keine wissenschaftliche Arbeit wie jene, die wir mal an der Uni schreiben mussten, oder wie solche, die man in Fachbüchern finden kann. Dies ist lediglich eine Zusammenstellung von Anmerkungen, Kommentaren und eventuell Tipps von mir in Bezug auf die Arbeit mit Italienern, die Deutsch lernen sollen. Solche Anmerkungen, Kommentare und Tipps basieren nur auf meiner eigenen Berufserfahrung und auf der Tatsache, dass ich selbst Italienerin bin und auch mal Deutsch lernen musste. Deshalb werdet ihr am Ende dieses Beitrages kein Literaturverzeichnis finden. 20
21 1. Schwierigkeiten in der Phonetik Ich brauche natürlich nicht zu sagen, wie unterschiedlich die zwei Sprachen (Italienisch und Deutsch) sind. Englisch und Deutsch sind die zwei europäischen Sprachen, die den Italiener am meisten Schwierigkeiten bereiten. Spanisch und Französisch lernen wir hingegen ziemlich schnell und gut. Ihr wisst schon romanische Sprachen usw. Als Erstes fällt einem Italiener auf, dass die Deutschen einfach Wörter mit vielen nebeneinander stehenden Konsonanten lieben. Und da die Italiener Vokal-Liebhaber sind, haben wir da schon einen ersten Konflikt. Nehmen wir mal das Wort Deutsch. Da haben wir t-s-c-h- nebeneinander stehen. Vier Konsonanten, die einen Laut bilden. Für den gleichen Laut haben wir das c gefolgt von einem e (t e), oder einem i (t i). Natürlich muss ein Italiener stocken, wenn er das Wort Deutsch oder ein ähnliches Wort zum ersten Mal liest. Bis man alle Buchstaben erkannt hat und noch verstanden hat, dass sie eigentlich nur einen Laut bilden, vergeht einige Zeit. Ganz viele Schwierigkeiten haben wir bei den Umlauten ä, ö, ü. Am schlimmsten ist das ü, da hört man oft iu. Die anderen zwei kriegen wir irgendwann auch mal hin, aber das ü Mein Tipp? Wiederholen, wiederholen, wiederholen, Lauterkennungsübungen, Reime (auch mit Quatschwörtern. Wichtig ist, dass das ü dabei ist: Bücher-Tücher-lücher-sücher-mücher-kücher- usw.). Das ü wird dann von jedem Teilnehmer mehrmals gehört und ausgesprochen. Den Laut von dem Buchstaben h haben wir im Italienischen nicht. Wir haben das Graphem, das jedoch nicht ausgesprochen wird. Wir brauchen es zum Beispiel bei chi (= ki), um es vom ci (=t i) lautlich zu unterscheiden oder a (= dt. Präpositionen an, zu, nach) von ha (= dt. Verb: er, sie, es hat) semantisch zu unterscheiden. Das h dient wie gezeigt eigentlich nur der Schriftsprache. Es kostet die Italiener große Anstrengungen, den Buchstaben und seinen Laut auszusprechen, weil sie zuerst das Graphem erkennen sollen (das gilt vor allem für diejenigen, die nie in der Schule waren und nicht schreiben können) und sich dann daran erinnern müssen, dass es doch wie beim Ausatmen ausgesprochen werden muss. 2. Schwierigkeiten in der Semantik Es ist schon schwer genug, die deutsche Sprache zu lernen, aber noch verwirrender wird es, wenn die Deutschen italienische Wörter beim Sprechen verwenden, die für uns an der Stelle ziemlich unsinnig sind. Was ich damit meine? Das kann ich euch durch etwas, das mir persönlich vor vielen, vielen Jahren passiert ist, erzählen. Einmal habe ich meinen Mann bei der Arbeit besucht. Sein Chef, den ich schon kannte und der immer sehr nett und höflich uns gegenüber war, kam mir entgegen und begrüßte mich mit dem Satz: Alles paletti? 21
22 Ich guckte ihn mit fragendem Gesicht an und wartete darauf, dass er etwas sagte, mir deutlich machte, was er eigentlich meinte. Alles in Ordnung?, fragte er endlich. Sie sind doch Italienerin!, fügte er hinzu, mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Ich wusste nicht sofort, wie ich reagieren sollte. Was bitte schön soll das heißen, ich bin Italienerin? Hätte ich gerne gefragt, habe mich dann doch zurückgehalten und habe grinsend genickt. Ja, alles in Ordnung. Und wie geht es Ihnen? So, jetzt kommt der richtige Kommentar: Nicht alles, was die Deutschen denken, es sei Italienisch, nur weil es so klingt, ist auch wirklich Italienisch. Paletti heißt (Holz-) Pflöcke. Überrascht? Da habt ihr jetzt die Übersetzung und trotzdem macht es für mich keinen Sinn, für euch vielleicht? Ich würde mich freuen, wenn jemand dazu eine Erklärung hat, eine gute! Aber kommen wir zu unserem Thema zurück. Was bereitet den Italienern besondere Schwierigkeiten beim Erlernen der deutschen Sprache, diesmal im semantischen Bereich? Präpositionen, was sonst? Ihr meint, dass Präpositionen eigentlich in den syntaktischen Bereich gehören? Es mag sein, aber ich finde, dass es in diesem Fall auch um die Semantik geht. Wir Italiener, wie viele andere Menschen mit anderen Nationalitäten, steigen immer auf den Bus, auf die Straßenbahn, auf den Zug, usw. Die Deutschen steigen immer in ein Verkehrsmittel ein, in den Bus, in die Straßenbahn, in den Zug. Da liegen, meiner Meinung nach, zwei vernünftige Erklärungen vor. Die Deutschen finden es vernünftig zu sagen, dass sie in etwas einsteigen, denn zuerst ist man draußen, danach ist man drinnen. Logisch, oder? Und was ist mit den Italienern? Überlegt mal: Um einzusteigen, müssen wir meistens ein paar Stufen aufsteigen. Das heißt, dass wir die Bewegung ganz anders sehen und zwar nicht von außen nach innen, sondern von unten nach oben. Unser Verb dafür ist aufsteigen/ hochsteigen, und das erklärt, denke ich zumindest, auch, warum wir die Präposition auf verwenden und nicht in. Wenn jemand da eine bessere Erklärung hat, bin ich ganz Ohr! Apropos: Warum versucht ihr es nicht mal anders? Steigt mal auf und nicht in! Im Sommer könnte es ganz angenehm werden, bei den Temperaturen, die wir hier in Deutschland inzwischen auch erreicht haben! Achtung: Wir steigen aber doch ins Auto, denn da müssen wir ja selbst fahren und außerdem gibt es da auch keine Stufen 3. Schwierigkeiten in der Grammatik und in der Syntax Noch ein Paar Hinweise zu Grammatik und Satzbau. Man kann eventuell Sätze hören wie: Die Hose sind zu groß. Die Brille gefallen mir. Die Schere schneiden nicht. 22
23 Ihr versteht schon, was ich meine. Sätze mit einem Subjekt im Singular und einem Verb im Plural. Es liegt einfach daran, dass es im Italienischen die entsprechenden Wörter nur im Plural gibt. Ich schreibe einfach mal eine kleine Liste, die bestimmt auch länger werden könnte. Italienisch Deutsch i pantaloni die Hose gli occhiali die Brille le forbici die Schere le mutande die Unterhose Wundert euch nicht, wenn ihr auch mal Sachen hört, wie: ein Paar Brille ein Paar Hose ein Paar Schere usw. Das sagen wir, wenn das Verb im Singular sein soll. È un bel paio di pantaloni Das ist eine schöne Hose. Sono dei bei pantaloni Das ist eine schöne Hose. Ich habe dafür keine tolle Lösung parat. Ich wiederhole einfach und immer wieder, dass die Wörter im Deutschen immer im Singular zu verwenden sind. Kommen wir jetzt zu den Verben und den Personalpronomen. Im Italienischen müssen die Personalpronomen nicht immer gleich vor oder evtl. nach dem Verb erwähnt oder geschrieben werden. Sie sind für uns in der Verbindung schon drin, also brauchen wir sie nicht noch einmal, außer wenn sie betont werden sollen. Hier sind einige Beispiele: (io) compro ich kaufe (tu) compri du kaufst aber: Io compro le mele. Ich kaufe die Äpfel. Compri tu le mele? Kaufst du die Äpfel? Sì, io compro le mele e Ja, ich kaufe die Äpfel und tu compri il pane. du kaufst das Brot. 23
24 Hier in diesem Beispiel werden alle Personalpronomen betont. Wenn man nicht die Absicht hat, sie zu betonen, darf man sie einfach weglassen. Das bedeutet, dass man bei Italienern aufpassen sollte, dass sie im Deutschen immer die Personalpronomen verwenden. Man muss ihnen erklären, dass sie kein Optional sind, sondern zu der Grundausstattung gehören. Sie sind einfach immer dabei. Wenn wir schon bei den Verben sind, kann ich noch etwas hinzufügen. Im Deutschen findet man das Partizip in normalen Aussagesätzen immer am Ende. Einige Beispiele: Ich habe einen Apfel gekauft. Ich bin nach Rom gefahren. Ich habe Dennis getroffen. Im Italienischen ist es anders, und zwar bleibt das Partizip im Satzinneren neben dem Hilfsverb. Also noch mal die gleichen Sätze wie oben, diesmal jedoch auf Italienisch: Ho comprato le mele. Sono andato a Roma. Ho incontrato Dennis. Das Problem könnte man mit einem Satzpuzzle lösen. Das mache ich oft, wenn die Teilnehmenden so weit sind und den richtigen Satzbau üben sollen. Man schreibt verschiedene Sätze groß auf ein Blatt Papier, dann schneidet man die Satzteile aus und gibt sie den Teilnehmenden. Wenn man das Perfekt üben will, kann man auch das Hilfsverb vom Partizip trennen. Die Teilnehmenden arbeiten in Gruppen und haben bestimmt Spaß. Die Leistungsstärkeren können den Leistungsschwächeren helfen und zum Schluss wird alles im Plenum korrigiert. Kennt ihr den bekannten Satz von Trapattoni? Ich habe fertig. Darüber kann ich euch auch etwas erzählen. Ich bin fertig heißt auf Italienisch Sono pronto oder Ho finito. Trapattoni wollte das Zweite sagen, und zwar, dass er mit der Rede fertig war, dass er nichts mehr dazu sagen wollte/konnte. Dafür brauchen wir auf Italienisch das Hilfsverb haben + Partizip von finire (finito). Der Satz Sono pronto heißt eigentlich Ich bin fertig (Ich habe die Jacke angezogen, jetzt können wir gehen) oder Ich bin bereit (etwas zu tun). 24
25 Damit es deutlicher wird, habe ich die möglichen Übersetzungen von ich bin fertig und sono pronto in eine Tabelle übertragen. Deutsch Italienisch Ich bin fertig. Sono pronto. Ho finito. Italienisch Deutsch Sono pronto. Ich bin fertig Ich bin bereit. Ich hätte da noch einen letzten Punkt, den ich gern ansprechen möchte: Artikel. Im Italienischen haben wir genaue und feste Regeln für die Wahl des Artikels. Wir haben natürlich auch Ausnahmen, welche Sprache hat sie nicht? Endet das Wort auf -a, so ist es feminin, also brauchen wir den bestimmten Artikel la. Fängt das Wort aber mit einem Vokal an, so müssen wir la apostrophieren und dann bleibt uns nur l. Endet das Wort auf -o, so ist es maskulin, also brauchen wir den bestimmten Artikel lo oder il. Wenn das Wort, das mit -o endet, mit x, y, z, s+konsonant, pn, gn, ps anfängt, dann wählen wir lo, wenn das Wort mit einem Vokal anfängt, dann wird lo apostrophiert und wird zu l. In allen anderen Fällen ist il der richtige Artikel für ein männliches Wort. Dann gibt es für jede Form im Singular auch die entsprechende im Plural: Singular Plural la/l le il i lo/l gli Einige Beispiele: Singular: la cas a (das Haus), il gatto (die Katze), lo zaino (der Rucksack) Plural: le case (die Häuser), i gatt i (die Katzen), gli zain i (die Rucksäcke) Die gleichen Regeln gelten auch für die unbestimmten Artikel. una/un = la un = il + l uno = lo 25
26 Wie ihr seht, ist die italienische Sprache in dieser Hinsicht sehr strukturiert. Kann man das Gleiche von der deutschen Sprache sagen? Natürlich gibt es im Deutschen einige hilfreiche Regeln (Endungen auf -heit/keit, -chen, -er und so weiter), den Rest muss man jedoch von Anfang an in Verbindung mit dem Nomen lernen. Das heißt, dass ich fast sofort damit anfange, meinen Teilnehmern Wörter gleich in Verbindung mit ihren Artikeln beizubringen. Und das bedeutet, dass die Wortschatzarbeit auch dafür da ist, den passenden Artikel dabei zu lernen und nicht nur, was ein Wort heißt und wie es verwendet wird. Eines hätte ich fast vergessen: Wir haben kein Neutrum, nur Femininum oder Maskulinum. Wenn Migrantinnen und Migranten (nicht nur Italiener) nicht wissen, was der richtige Artikel ist, dann wählen sie meistens die. Das muss man ihnen lassen: So haben sie mehr Chancen, das Richtige zu sagen, wenn man bedenkt, dass die auch alle Wörter im Plural mit einschließt! und zum Schluss: Ich hoffe, euch einen übersichtlichen Einblick in die italienische Sprache und vielleicht auch ein wenig in die italienische Kultur gegeben zu haben. Wenn ich besondere Tipps für euch gehabt habe, habe ich sie gleich aufgeschrieben, ansonsten, kann ich nichts anderes sagen, als dass man immer und immer wieder alles wiederholen soll. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer brauchen es, und sie sollten es auch bekommen. Die Grammatik sollte nicht trocken dargestellt werden, es sollte lebendig werden und Spaß machen, damit die Teilnehmenden die Regeln nicht einfach als Stress empfinden, sondern auch als etwas, das sie wirklich brauchen. Ich habe ein paar Brettspiele, die ich immer wieder einsetze, Verb- Ellipsen, Würfel mit Personalpronomen und so weiter. Aber wem sage ich das? Einige von euch habe ich schon getroffen und kennen gelernt, und ich weiß ganz genau, dass ihr eure Arbeit prima macht! Vielleicht können euch meine Anmerkungen und Kommentare einfach etwas weiterhelfen, und wenn es so ist, dann habe ich mein Ziel erreicht. 26
27 Irene Haritonov Erste-Hilfe-Tipps für Alphabetisierungskursleitende Russisch In meiner langjährigen Tätigkeit als Deutschlehrerin für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache habe ich mich oft gefragt, warum russische Muttersprachler Schwierigkeiten in eigentlich eindeutig klaren Fällen haben. Wird es falsch gehört oder gibt es dafür andere Gründe? Funktioniert der Sprechapparat bei Russen anders? Warum haben sie so große Probleme im Satzbau? Was hindert sie, die Logik der deutschen Grammatik zu verstehen? Diese und viele andere Fragen beschäftigen mich in meiner Tätigkeit als Vermittlerin der deutschen Sprache schon die ganze Zeit. Teilnehmende mit Russisch als Muttersprache gibt es in den Alphabetisierungskursen selten. Das sind immer nur funktionale Analphabeten, da das Schulsystem in der ehemaligen Sowjetunion so organisiert war, das es keine Schülerinnen und Schüler gab, die keine Grundschule besucht haben. Das wurde sehr streng kontrolliert. Die Einschulung mit sieben Jahren war Pflicht und verantwortlich dafür waren Lehrerinnen und Lehrer, die in den Orten gearbeitet haben. Sie waren verpflichtet, vor dem neuen Schuljahr die Kinder der ersten Klassen an der entsprechenden Schule anzumelden. Das hat dazu geführt, dass es keine primären Analphabeten aus Russland gibt. Bei den funktionalen Analphabeten gibt es meistens individuelle Gründe für den Verlust der Lese- und Schreibkenntnisse. Das Alphabet Die russische Sprache und die deutsche Sprache haben vieles gemeinsam. Obwohl die russische Sprache das kyrillische Alphabet hat, weisen doch einige Buchstaben Ähnlichkeiten mit dem deutschen Alphabet auf, z.b. die gleiche Schriftweise und die gleiche Artikulation haben die Selbstlaute a und o sowie die Konsonanten k und m. Das hilft den funktionalen Analphabeten oder Zweitschriftlernern im Deutschunterricht von Anfang an, sich nicht so ganz fremd zu fühlen. Der Aha-Effekt hilft hier, gleich motivierter an das Lernen heranzugehen. Auffällig ist die Schrift der Teilnehmenden aus der ehemaligen Sowjetunion. Sie schreiben fast alle wie gemalt, ordentlich und mit typischen Merkmalen der russischen Schrift. Das wird in der Grundschule sorgfältig eingeübt, da sie sehr intensiv die Schönschrift trainieren. Leseregeln und Aussprache Aber es gibt auch einige spezifische Schwierigkeiten, die nur bei russischsprechenden Kursteilnehmenden auftreten. 27
28 Schwierigkeiten beim Lesen: Das deutsche u wird als i gelesen, das deutsche c als s, das b als w, das kleine n als p, das p als r, und das m als t. Diese Buchstaben haben ähnliche Schreibweise mit den deutschen Buchstaben, aber eine andere Artikulation. Beide Sprachen sind Silbensprachen und die Laute werden auf gleiche Weise artikuliert. Das erleichtert die Aussprache. Die meisten Teilnehmenden können sehr schnell das B1-Niveau in der Aussprache erreichen. Das st und sp am Anfang des Wortes werden oft falsch gelesen, aber mit ein paar Übungen kann man diesen Stolperstein schnell aus dem Wege räumen. Die Teilnehmenden aus der ehemaligen Sowjetunion, die russischen Muttersprachler, haben eher wenige Schwierigkeiten in der Aussprache und können fast alle Laute gut artikulieren. Viele Ähnlichkeiten im Lautsystem haben Einfluss darauf, dass bestimmte Laute schneller und ohne großen Aufwand angeeignet werden können. Sie sprechen aber die deutschen Laute viel intensiver und härter aus. Den russischen Akzent hört man bei den Teilnehmenden sofort. Sie haben meistens gar keine Probleme, die Konsonanten g, b usw. auszusprechen. Die Schwierigkeiten beginnen, wenn sie ihnen unbekannte Konsonantenlaute wie h aussprechen sollen. Ich glaube, dass sie diesen Laut akustisch auch nicht wirklich richtig wahrnehmen. Diesen Hauchlaut artikulieren Russischsprachige als [ch] und dadurch klingt z.b. das Wort Hose wie [chos ]. So ist es bei allen Wörtern mit diesem Anlaut. Die Laute d, t und n gibt es sowohl im Deutschen als auch im Russischen. Sie werden aber anders artikuliert. Im Deutschen wird die Zunge bis zu den Alveolen gehoben und in diesem Bereich entstehen dann diese Laute. Im Russischen wird die Zungenspitze an die oberen Zähne gedrückt und die Laute entstehen durch das Trennen der Zunge von den Zähnen. Das muss man den Teilnehmenden deutlich erklären und den Unterschied der Aussprache bewusst machen. Mit Übungen, die Wörter mit diesen Lauten enthalten, und richtigen Erklärung der Artikulation dieser Laute, kann dieses Problem ziemlich schnell gelöst werden. Der nasale Laut ng ist im Russischen unbekannt und muss explizit trainiert werden. Die Zunge muss nach hinten gezogen und im mittleren Bereich nach oben gehoben werden, damit ein enger Spalt entsteht. Und da wird dieser Laut artikuliert. 28
29 Noch ein interessantes Phänomen konnte ich in meiner Praxis beobachten. Das sind die Länge und die Kürze der Vokale. Im Unterschied zum Deutschen ist die Länge der Vokale im Russischen weder bedeutungsunterscheidend (wie z.b. in Wall Wahl) noch für die richtige Aussprache eines Wortes ausschlaggebend. Die Länge und die Kürze der Vokale können sie akustisch nicht wahrnehmen und dadurch auch nicht richtig aussprechen. Daran muss man mit bestimmten Übungen, die fast in allen Lehrwerken im phonetischen Teil zu finden sind, arbeiten. Die deutschen langen Vokale werden ca. dreimal so lang gesprochen wie die Russischen. Ich nenne sie Singlaute, die man singt. Das lange i, geschrieben ie, muss extra erklärt und geübt werden. Man muss darauf hinweisen, dass das e kein Selbstlaut in diesem Fall ist und nur betont, dass das i lang ausgesprochen werden muss. Sowie auch das Dehnungs-h z.b. in wohnen, sehnen, lohnen, frühstücken usw. Große Schwierigkeiten haben die russischen Muttersprachler beim Deutschlernen mit den Umlauten ü und ö. Sie haben in ihrer Sprache auch so ähnliche Laute, aber sie werden mit einem j im Anlaut ausgesprochen. Beispiel: Übung hört sich wie Jübung an. Das deutsche e sprechen die meisten im Anlaut wie ein je aus und dann hört sich Eva wie Jeva an. Bei der Aussprache der Wörter, in denen ein stimmhafter Konsonant auf den stimmlosen folgt, wird der stimmlose auch stimmhaft: z.b. Mitbewohner ist [midbewo:n r]. Das gilt auch, wenn ein Wort mit einem stimmlosen Konsonanten endet und das folgende Wort mit einem stimmlosen beginnt: z.b. das Buch [daz bu:x]. Die Teilnehmer verstehen manchmal nicht, warum man sie verbessert, wenn sie das unbetonte o als a aussprechen. In der russischen Sprache ist das eine ganz normale Artikulation des Wortes und jeder versteht sofort, was gesagt wird, wenn man das unbetonte o als a ausspricht. Der Sinn des Wortes verändert sich dabei nicht, im Deutschen ist das Gegenteil der Fall: z.b. kopieren kapieren. Das e wird als i ausgesprochen, wenn es unbetont ist: z.b. egal [iga:l]. Die russisch-deutsche Beziehung, die sich quer durch alle Schichten der Gesellschaft und durch viele Bereiche auch durch viele Jahrhunderte zog, hat tiefe Spuren im russischen Wortschatz hinterlassen. Vom Schlagbaum über den Buchgalter (im Russischen existiert der Buchstabe h nicht) und die Schtraf bis zum Butterbrot, das natürlich mit zweimal rollendem r zu sprechen ist es wimmelt von deutschen Lehnwörtern im Russischen. 29
30 Satzglieder Nomen In beiden Sprachen haben wir ein Satzglied, das ich bei den Teilnehmenden als Name bezeichne. Jeder Gegenstand, jeder Mensch hat einen Namen, den wir in verschiedenen Situationen verwenden. Und dafür muss er, der Name, in der richtigen Form stehen. So erkläre ich das Substantiv und den Gebrauch. Das Substantiv hat einen Genus maskulinum, femininum oder neutrum wie im Deutschen so auch im Russischen und kann in Einzahl oder Mehrzahl gebraucht werden. Ich versuche es durch die Wörter Mann, Frau und Kind (nicht Mann, nicht Frau) zu erklären. Es gibt im Russischen sowie im Deutschen verschiedene Arten von Objekten z.b. Dativobjekt, Akkusativobjekt und Präpositionalobjekte. Beispiel: pomogat (komu?) Deutsch helfen (wem?) widet (kogo?) sehen (wen?) Die Präpositionen stehen vor dem Substantiv und haben auch die gleiche Aufgabe wie im deutschen Satz so auch im Russischen. Beispiel: in die Schule gehen (idti w schkolu) In beiden Sprachen wird das Substantiv dekliniert, bekommt in der russischen Sprache den Fällen entsprechende Endungen oder wie im Deutschen einen anderen Artikel. Im Deutschen haben wir vier Fälle und im Russischen sechs, deshalb kann man den Gebrauch der Fälle nicht immer vergleichen. Oft stimmen sie nicht überein. Verben, die im Deutschen mit dem Dativ gebraucht werden, können im Russischen den Akkusativ verlangen und umgekehrt. Beispiel: swonit komu? heißt im Russischen anrufen wem? Und im Deutschen anrufen wen? Das kann man so erklären: jemanden ans Telefon rufen. So kann man das Genus auch vergleichen: Im Russischen sind es auch drei Geschlechter, die aber bei vielen Wörtern nicht mit dem Deutschen übereinstimmen. Beispiel: der Hund (m) Sobaka (f); die Klasse (f) klass (m) das Buch (n) kniga (f); das Heft (n) tetrad (f) 30
31 Verb In beiden Sprachen ist das Verb das wichtigste Wort im Satz. Das Verb regiert den Satz und ist der Kanzler und das Subjekt kann man als den Präsidenten bezeichnen. Dieser Vergleich hilft meinen Teilnehmenden den Zusammenhang der Satzglieder und die Logik des Satzes besser zu verstehen. Das Verb wird konjugiert, bekommt abhängig von der Person und Zahl unterschiedliche Endungen. So ist es auch im Russischen. Es ist hilfreich, wenn man die Kursteilnehmenden darauf hinweist, dass die Personalendung t in der dritten Person Singular die gleiche im Russischen als auch im Deutschen ist. Die Verben haben in der russischen Sprache drei Zeitformen, die Verben verändern bei der Bildung der Zeitformen ihre Endungen, oft auch den Stamm, haben aber keine Hilfsverben für die Bildung von Perfekt und Plusquamperfekt. Die russische Sprache hat nur drei Zeitformen und nicht sechs wie im Deutschen. Pronomen Es gibt in beiden Sprachen die gleichen Personal- und Possessivpronomen. Die kann man leicht und vergleichbar übersetzen. Außerdem haben sie auch die gleichen Funktionen in der Grammatik. Die Personalpronomen erleichtern den Teilnehmenden, die Verbkonjugation zu verstehen. Ich habe es im Kurs nicht zweimal erklären müssen. Meine Teilnehmenden aus Kasachstan haben es sehr schnell begriffen, obwohl ich vermute, dass sie die Grammatik auch in ihrer Muttersprache nicht wirklich beherrschen. Adjektiv Ähnlichkeiten gibt es auch im Gebrauch von Adjektiven. Das deutsche Adjektiv wird genauso wie das russische Adjektiv sowohl in der Kurz- als auch in der Vollform gebraucht. Bei der Vollform steht das Adjektiv in beiden Sprachen vor dem Substantiv und hat entsprechende Kasus- und Geschlechtsformen. Wenn in der deutschen Sprache das Adjektiv am Ende des Satzes steht und in allen Geschlechtern die gleiche Endung hat, hat es in der russischen Sprache abhängig vom Geschlecht verschiedene Endungen, steht aber auch am Ende des Satzes. Beispiel: Das Fenster ist klein. Окно маленькое. Die Katze ist klein. Кошка маленькая. Der Tisch ist klein. Стол маленький. 31
32 Der Satzbau Der Satzbau weist auch viele Ähnlichkeiten auf, zum Beispiel die Satzreihe mit den Hauptsatzkonjunktionen und das Satzgefüge mit Konjunktionen, die Gliedsätze einleiten. Beispiel: Frau Müller kommt als Letzte, denn sie muss das Haus abschließen. Фрау Мюллер приходит последней, так как она должна закрыть дом. Frau Müller kommt als Letzte, weil sie das Haus abschließen muss. Фрау Мюллер приходит последней, потому что ей нужно закрыть дверь. Es gibt auch fast die gleichen Arten der Nebensätze im Russischen wie im Deutschen. Arten der Nebensätze werden in den ersten Modulen in den Deutschkursen nicht bearbeitet. In den Alphabetisierungskursen kommt es zu den verschiedenen Arten von Nebensätzen gar nicht. Man sagt von dem Deutschen, dass er aufmerksam auf das Ende des Satzes wartet. Und warum wartet er? Das Hauptverb steht meistens am Ende im Perfekt, in allen Passivformen, in den Nebensätzen. Das ist in der russischen Sprache nicht der Fall und da tun sich Teilnehmende, die Russisch als Muttersprache haben, schwer, denn im Russischen hat das Verb keine bestimmte Position. Bei der Erklärung des deutschen Satzbaus arbeite ich mit Symbolen. Jedes Satzglied hat ein bestimmtes Symbol, z.b. das Verb ist bei mir ein Dreieck und ist rot, das Nomen ist ein Viereck und ist blau, das Hilfsverb ist auch ein Dreieck, aber gestreift, und die Satzergänzungen haben auch ihnen zugeordnete Symbole. Da könnte der Satz Das Kind ist im Zimmer so aussehen (wo?). Das Kind geht in die Schule. (wohin?) Glokaja kudrja schmeko bryknula bokra i kudrjatschit bokrönka Dieser Satz hat im Russischen gar keinen Sinn, aber man kann die Satzglieder nach den formalen Merkmalen gut erkennen und den entsprechenden Regeln zuordnen. Die Grammatik hilft uns, den Inhalt besser zu verstehen und die Sätze richtig zu bauen. Man muss nur die Merkmale des entsprechenden grammatischen Phänomens erkennen können. Nach formalen Merkmalen kann man es sehen, welche Rolle das Wort im Satz spielt, und dadurch kann man auch den Sinn des Satzes besser interpretieren. Im Russischen gibt es keine Verben mit trennbaren Präfixen, deshalb bedarf dieses Thema besonderer Aufmerksamkeit. 32
33 Verben mit Präpositionen gibt es sowohl im Russischen als auch im Deutschen, aber nicht jedes Verb, das im Deutschen in fester Verbindung mit einer Präposition steht, verlangt auch eine Präposition im Russischen. Beispiel: sorgen für sabotitsja o zwei verschiedene Präpositionen (erklären) sich erinnern an wspominat warten auf shdat Zum Kulturschock : Ich glaube, dass es ein Thema für sich ist, und dazu gibt es sehr viele interessante Beobachtungen und kurze Geschichten aus dem Alltag. Diese Geschichten erzählen die Menschen meistens später, wenn sie sich in Deutschland ein bisschen besser auskennen. Hier eine ganz kleine Geschichte: Eine Frau hat der anderen im Gespräch gesagt: Spinnst du! Worauf sie geantwortet hat: Nein, ich habe in Russland gesponnen, hier stricke ich. Sie hat das Wort spinnen nur als Tätigkeit gekannt und wusste nicht, dass es mittlerweile eine ganz andere Bedeutung hat. Eine andere Frau hat mir erzählt, was ihr bei der Arbeit mal passiert ist. Sie hat in einem Büro nach den Öffnungszeiten die Räume sauber gemacht. Sie konnte noch fast kein Deutsch und ist nie ans Telefon gegangen, wenn es auch geklingelt hat. Das eine Mal hat es sie so genervt, dass sie den Hörer abgenommen und gesagt hat: Niemand ist da. Dann hat sie sich selber gefragt, und wer hat jetzt am Telefon gesprochen? Solche kurze Geschichten gibt es sehr viele aus dem Alltag, sie werden weitererzählt, darüber wird gelacht. Aber gelacht wird viel später, wenn die Sprache schon kein Abrakadabra mehr ist und bestimmte Strukturen bekommt, die man auch versteht. Mich hat einmal ein Mann gefragt: Wie kannst du die Deutschen verstehen? Wenn sie sprechen, hört sich das an, als ob ein Traktor arbeitet. Jetzt spricht dieser Mann ein gutes Deutsch und lacht über diese Frage, die er wirklich ernst gestellt hatte. Sein akustisches Empfinden der gehörten Wörter war in diesem Zeitabschnitt des Erlernens der deutschen Sprache einfach so. 33
34 Janet Niksarlioglu Erste-Hilfe-Tipps für Alphabetisierungskursleitende Türkisch Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer An den Alphabetisierungskursen nehmen mehrheitlich bildungsfremde türkische Muttersprachler teil (meist nachziehende Ehegatten). Die Teilnehmenden bringen unterschiedlichen Bildungsstand und unterschiedliches Sprachwissen mit. Auch die Altersklassen sind sehr verschieden, was zu starken Schwankungen des Lerntempos führt. In meinen Alphabetisierungskursen hatte ich meist mehr Frauen als Männer aus der Türkei, darunter viele Kurden. In den Kurdengebieten ist das Schulsystem nicht so gut ausgebaut. Oft liegt es aber auch an der Einstellung der Eltern: Die Tochter soll ja nur heiraten. Wozu soll sie da die Schule besuchen? Obwohl die Analphabetenzahl in der Türkei recht groß ist, finden auch Analphabeten ihren Platz auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt viele Jobs, in denen Schriftverkehr nicht notwendig ist, oder Stellen, die diesen übernehmen. Das System ist anders als in Deutschland darauf eingestellt. In der Türkei herrscht acht Jahre Schulpflicht. Vor einigen Jahren waren es nur fünf Jahre. Allerdings wird die Schulpflicht nicht so streng kontrolliert wie hierzulande. Wenn eine türkische Frau vor 30 Jahren nur die Grundschule besuchte und seitdem nicht mehr viel mit der Schriftsprache zu tun hatte, dann kann sie sich zur sekundären Analphabetin entwickeln. Mit fünf Jahren Schulbildung ist man lernungewohnt und es fällt einem schwer, autonom zu lernen. Hinzu kommt, dass die meisten türkischen Frauen kulturbedingt eher zurückhaltend sind. Ihre Schüchternheit und Introvertiertheit hemmt sie beim Sprach- und Schrifterwerb. Auch Gruppenarbeit fällt ihnen dadurch anfangs oft schwer. Ich hatte eine türkische Teilnehmerin, die nur noch mit gesenktem Blick stumm dasaß, sobald ein Mann den Raum betrat. Nur mit unserem türkischen Azubi konnte sie kommunizieren, da sie ihn wie einen Sohn sah. Sie freute sich immer, wenn der einzige männliche Teilnehmer fehlte. Die Klasse bestand größtenteils aus Türken, sodass ich die Möglichkeit hatte, den Unterricht teilweise auf Türkisch abzuhalten. Das war für die Teilnehmenden eine enorme Hilfe und förderte den Lernprozess. Die Teilnehmenden sind lernungewohnt und sind gleich zwei großen Herausforderungen ausgesetzt: Sie sollen im Erwachsenenalter lesen und schreiben lernen und das auch noch in einer fremden Sprache. Eine türkische bildungsfremde Frau gehört ja eigentlich an den Herd und hat im Alphabetisierungskurs nichts zu suchen, so denken zumindest einige Männer in ihrer Familie. So sitzt sie zwischen den Stüh- 34
35 len. Einerseits will sie vielleicht sogar lernen, muss aber gegen ihre eigene Hemmschwelle ankämpfen, aber auch gegen die Stolpersteine der Familie. Die Kinder sind krank, man braucht Vorbereitungen für ein Fest oder die Tante aus Ankara ist zu Besuch. Natürlich muss sich um alles die Frau kümmern. Der Alphabetisierungskurs steht an letzter Stelle. Die Bedürfnisse dieser Frau kommen erst nach den Bedürfnissen der (manchmal auch Groß-) Familie. Diese Rangfolge müssen Kursleitende manchmal erst lernen. Die Aussprache In der Aussprache tun sich Türken relativ leicht, da es viele gleiche Laute gibt. Besonders kurdische Türken haben eine schöne klare Aussprache im Deutschen. Das türkische Alphabet besteht seit Kemal Atatürk aus 29 lateinischen Buchstaben. Zuvor wurden arabische Buchstaben verwendet. Die meisten Buchstaben stimmen mit dem Deutschen überein. Im deutschen Alphabet unterscheiden sich die Buchstaben c, j, r, s, y und z in der Aussprache. Die Buchstaben qu, w, x, ä und Diphthonge gibt es nicht. Das türkische Alphabet (auf Türkisch alfabe ) unterscheidet sich durch folgende Buchstaben: c [dsch] wie in Dschungel ç [tsch] wie in Kutsche ğ weiches g (keine Entsprechung im Deutschen, verlängert und färbt den vorangehenden Vokal wie in oğlu = sein Sohn) ı ein i ohne Punkt wie im Auslaut bei Spiele j wie in Journalist r gerollt v nur stimmhaft wie das deutsche w y wie das deutsche j in jetzt z stimmhaft wie das deutsche s in Reise Die Umlaute ü und ö gehören ebenfalls zum türkischen Alphabet und gleichen der deutschen Aussprache. A-Umlaut muss gelernt werden, entspricht in der Aussprache aber dem türkischen e. Der Sch-Laut ist im Türkischen bekannt. Er entspricht dem s mit Häkchen ş. Auch der Ach-Laut ist aus Ahmet bekannt. Nur der Ich-Laut bereitet Probleme, da er der türkischen Sprache fremd ist. 35
36 Das typischste Ausspracheproblem von Türken ist die Unterscheidung von s und z. Türkische Muttersprachler sehen zu Hause und lesen [su hauße]. Damit tun sie sich richtig schwer auch noch im Integrationskurs. Dass das deutsche s im Anlaut und in der Mitte anders ausgesprochen wird als im Auslaut, macht es ihnen nicht leichter. Das deutsche Auslaut -s (Maus) entspricht dem türkischen s. Das deutsche Anlaut -s (Sonne) entspricht dem türkischen z. Das deutsche z kann mit [ts] erklärt werden. So müssten türkische Muttersprachler [tsu hauze] lesen. Die falsche Aussprache bedingt auch die falsche Orthographie. Die deutschen Diphthonge sind Türken lautlich zum Teil bekannt. Man kann ei mit dem türkischen Mond ay und eu/au mit der Wahlstimme oy veranschaulichen. Bei ie möchten Türken auch das e lesen, das das i nur verlängern soll. Doch das e bleibt stumm. Auch auf das stumme Dehnungs-h möchten sie oft beharren. Das i mit bzw. ohne Punkt sind im Türkischen tatsächlich zwei verschiedene Buchstaben mit unterschiedlicher Aussprache. Das erklärt, warum Türken bei groß geschriebenen Nomen wie Igel einen Punkt auf das i setzen möchten. In der deutschen Sprache hingegen signalisiert der Punkt einen Kleinbuchstaben. Das w ist eher aus der Internet-Adresse www. bekannt und wird englisch double u, double u, double u ausgesprochen. Das deutsche x könnte man mit ks umschreiben. So steht denn auch auf dem türkischen Taxischild Taksi. Das Türkische ist eine vokalreiche Sprache. Manche hören nur ü-laute, wenn sie Türken reden hören. Das bedingt die Vokalharmonie, die vorschreibt, welche Vokale auf vorangehende Vokale folgen müssen. An einen Wortstamm hängt man diverse Suffixe an (Verneinung, Verbendung, Possessivpronomen, Tempus, Präposition usw.) Dies nennt man Agglutination. Auch die Suffixe unterliegen der Vokalharmonie. Dadurch wiederholen sich die Vokale eines Wortes. Türken können mehrere Konsonanten hintereinander nicht aussprechen. Innerhalb einer Silbe folgt auf einen Konsonanten immer ein Vokal. Sie brauchen Vokale. 36
37 melek me lek (Engel) sokak so kak (Straße) yatmak yat mak (liegen) Bei Lehnwörtern wie spor (Sport) sprechen Türken [sıpor]. Ungebildete schreiben sogar das zusätzliche ı. Daher tun sich Türken mit vielen deutschen Worten schwer. Aus Blume haben sie das Bedürfnis, Bulume zu machen. Aus Schlüssel wird Schülüssel. Es geht ihnen einfach nicht über die Zunge. Aber sie beachtet dabei natürlich die Vokalharmonie. Man spricht im Türkischen, wie man schreibt, und man schreibt auch, wie man spricht. Bei der Groß-/Kleinschreibung hat das Türkische eine simple Regel: Außer Satzanfang und Eigennamen schreibt man alles klein. So muss die Großschreibung und zuvor die Erkennung der Nomen erst erlernt werden. Artikel Das deutsche Artikelsystem führt zu den hartnäckigsten Problemen. Das Türkische besitzt keine Artikel. Dass die Notwendigkeit eines Artikels überhaupt besteht, muss erst begriffen werden. Dann kommt die Unterscheidung von bestimmten und unbestimmten Artikeln. Und erst danach verstehen die Teilnehmenden die Unterteilung von Genus, Numerus und Kasus. Manche Teilnehmende versuchen, sich die Anwendung der Artikel mit der Unterscheidung von leblos und lebendig herzuleiten leider ohne Erfolg. Das Gegenstück des unbestimmten Artikels bir bedeutet eins und führt nur zu Verwirrungen. Existiert der Artikel in der Muttersprache nicht, ist es schwierig, ein Gefühl für das deutsche Artikelsystem zu bekommen. Aus diesem Grund wird der Artikel oft ganz weggelassen und auch nicht vermisst. Verben Auch das Türkische besitzt personenbezogene Verbendungen. Die Verbendungen -mek und -mak weisen auf die Infinitivform hin wie im Deutschen -en, -ern und -eln. Die Personalpronomen er, sie, es werden mit einem geschlechtsfreien türkischen Personalpronomen o wiedergegeben. 37
38 Die sechs Personalpronomen erwähnt man im Türkischen nur, wenn man sie betonen möchte. Die Person erkennt man also an der Verbendung. Daher wird dann auch im Deutschen oft das Personalpronomen weggelassen. So wird aus dem deutschen Satz Ich gehe zum Kurs, wenn man ihn ins Deutsche zurückübersetzt, der spartanische Satz Kurs gehe. Dass Türken viele Infinitive benutzen, statt zu konjugieren, liegt meines Erachtens eher daran, dass ihnen beispielsweise bei der Arbeit das falsche Deutsch beigebracht wurde, um es ihnen zu vereinfachen. Ich musste einmal mit einem türkischen Teilnehmer diskutieren, ob es Artikel im Deutschen tatsächlich gibt, denn in seinem Job als Hilfsarbeiter hätte er noch keinen gehört, auch nicht von seinem deutschen Vorgesetzten. Und natürlich lernen Migranten voneinander falsches Deutsch. Satzstellung: Verb Generell kann man sagen, dass die Satzstellung im Türkischen recht flexibel ist. Das Verb steht am Satzende. Hat man Teilnehmende nun endlich so weit, das Verb im Deutschen an die zweite Position zu setzen, beginnt man mit der Zeitform Perfekt und verwirrt die Lernenden total. Modalverben und verschiedene Zeiten sind im Türkischen in Form von Suffixen in einem Verb enthalten. Warum soll der Lerner nun also im deutschen Perfektsatz zwei Verben daraus machen und das zweite Verb auch noch an das Satzende setzen, von wo er das Verb doch so mühsam verbannt hatte? Und in der Entscheidungsfrage im Perfekt soll er das Hilfsverb, das er im Türkischen für die Vergangenheitsform nicht benötigt und das er mühsam versucht zu übersetzen, auch noch an den Satzanfang positionieren! Seine Verwirrung ist nachvollziehbar. Präpositionen Präpositionen sind im Deutschen ganz wichtig und entscheiden sogar über den Kasus. Im Türkischen handelt es sich wiederum nur um einen Suffix. Es sind keine eigenständigen Wörter. Hier einige Beispiele: Nerede? (wo?) evde (im Haus oder zu Hause) Nereden? (woher?) evden (aus dem Haus) Nereye? (wohin?) eve (ins Haus oder nach Hause) de kann in, auf, bei, an bedeuten den kann von, aus bedeuten e kann nach, zu, in bedeuten So ist es für einen Türkischdenkenden nicht klar, dass er für einen Buchstaben (e) ein ganzes Wort (nach) im Deutschen benötigt. 38
39 Satzstellung: Frage Bei Entscheidungsfragen tauschen im Deutschen Subjekt und Verb die Positionen. Im Türkischen bleiben die Positionen gleich. Das Fragepartikel mi zwischen Verbstamm und Personalendung macht aus einem Satz eine Entscheidungsfrage. Es sind zwei kleine Buchstaben mitten im Wort, die Türken in ihrer Muttersprache kaum beachten. Und weniger Gebildete lassen selbst dieses Fragepartikel weg und gehen am Satzende einfach mit der Stimme hoch, um eine Frage zu signalisieren. Daher fällt es schwer, im Deutschen an Satzumstellung zu denken, wenn man in der Muttersprache praktisch nichts am Satz verändert. Deutsch Türkisch Satz: Er geht nach Hause. (Er) Hause nach geht. Frage: Geht er nach Hause? (Er) Hause nach geht? Auch W-Fragen bildet man im Türkischen ganz einfach, indem man das Fragewort (dies ist ein eigenständiges Wort) vor den kompletten Satz setzt und die Syntax beibehält. Das Verb steht am Ende. Präpositionen werden angehängt. Deutsch Türkisch Satz: Er geht nach Hause. (Er) Hause nach geht. Frage: Warum geht er nach Hause? Warum (er) Hause nach geht? Wer geht nach Hause? Wer Hause nach geht? Wie geht er nach Hause? Wie (er) Hause nach geht? Die türkischen Fragewörter heißen: Kim? Wer? Ne? Was? Nerede? Wo? Nereden? Woher? Nereye? Wohin? Neden? Warum? Nasıl? Wie? Hangi? Welche? Kaç? Wie viel? 39
40 Das Subjekt wird nur dann genannt, wenn es betont werden soll (ähnlich wie im Spanischen). Deutsch Was machst du? Ich arbeite. Wo arbeitest du? Bei Mercedes. Türkisch Was (du) machst? (Ich) arbeite. Wo (du) arbeitest? Mercedes bei. In schlechtem Deutsch: Was machen? Arbeiten. Wo arbeiten? Mercedes. Modalverben Die Modalverben sind ins Türkische nicht so leicht zu übersetzen. Lediglich istemek (bedeutet je nach Kontext mögen oder wollen ) benötigt ein zweites Verb. Die anderen Modalverben tauchen als Suffixe auf oder müssen umschrieben werden. Das Modalverb müssen wird mit lazim (= notwendig) umschrieben. Das Modalverb können entspricht dem Suffix -ebil-, das zwischen Verbstamm und Verbende positioniert wird (Infix). Das erkennen Lernungewohnte aber nicht als eigenes Bedeutungspartikel. So fällt es ihnen schwer, ein Modalverb anzuwenden. Diese Ausdrucksweise ist ihnen höchst ungewohnt und bedarf eines intensiven Trainings. 40
41 Ahmad-Maher Sandouk, Ulrike Weyrether Zur Problematik der kontrastiven Alphabetisierung bei arabischen Muttersprachlern Salomon fragte einen Ifrit (Feuergeist), was das Sprechen sei? Er antwortete: Ein Wind, der vergeht. Er fragte, was seine Fesselung sei? Und er antwortete: das Schreiben. Aus: Das Kunststück der Vernünftigen, um das Handwerk des Schreibens und des Buches zu erlernen : Abdul Rahman Yusuf bin Al-Saigh ( ) (Georg-Eckert-Institut 2011) Gliederung des Beitrages: Darstellung der Forschungsrelevanz Geschichte der arabischen Sprache Aufbau des Arabischen, seine Unterschiede zum Deutschen und besondere Herausforderungen für arabischsprachige Lerner Resümee und Ausblick Bildung hat in islamisch geprägten Kulturkreisen einen besonderen Stellenwert Wie auch das Christentum und das Judentum ist der Islam eine Buchreligion. Am Anfang war das Wort heißt es im Johannesevangelium 1, Vers 1 (Bibel, Luther 1984). Lies, im Namen deines Herrn (Koran, Sure Alaq, Ayat 1 5) war das erste Wort, das dem Propheten Muhammad durch den Erzengel Gabriel offenbart wurde. Mit dem Ende des goldenen Zeitalters der Wissenschaften von Al-Andalus, den muslimisch beherrschten Teilen der iberischen Halbinsel, im Jahre 1492 ging es jedoch mit der Bildung in arabischen Ländern rapide bergab. 41
Kommunikativer Unterricht durch den. Einsatz analytischer Methoden
 Kommunikativer Unterricht durch den Einsatz analytischer Methoden INTERNATIONALER WORKSHOP DER GRUNDTVIG-LERNPARTNERSCHAFT EU-SPEAK AM 03. SEPTEMBER 2011 AM HERDER-INSTITUT DER UNIVERSITÄT LEIPZIG MUMM
Kommunikativer Unterricht durch den Einsatz analytischer Methoden INTERNATIONALER WORKSHOP DER GRUNDTVIG-LERNPARTNERSCHAFT EU-SPEAK AM 03. SEPTEMBER 2011 AM HERDER-INSTITUT DER UNIVERSITÄT LEIPZIG MUMM
Workshops im März 2018:
 Workshops im März 2018: Workshop Nr. 1: Wortschatzarbeit im DaF/DaZ-Unterricht Zeit und Ort: 20. März 2018, 16-20 Uhr an der EUF (Raum: OSL 231) In dem Workshop wird zunächst der Begriff Wortschatz definiert.
Workshops im März 2018: Workshop Nr. 1: Wortschatzarbeit im DaF/DaZ-Unterricht Zeit und Ort: 20. März 2018, 16-20 Uhr an der EUF (Raum: OSL 231) In dem Workshop wird zunächst der Begriff Wortschatz definiert.
Spaß am Lesen Verlag Ralf Beekveldt. Einfache Sprache
 Spaß am Lesen Verlag Ralf Beekveldt Einfache Sprache Wie liest Deutschland? Vor 2011: keine exakten Zahlen für Analphabetismus und Menschen mit Leseschwäche in Deutschland. Schätzung des Bundesverbandes
Spaß am Lesen Verlag Ralf Beekveldt Einfache Sprache Wie liest Deutschland? Vor 2011: keine exakten Zahlen für Analphabetismus und Menschen mit Leseschwäche in Deutschland. Schätzung des Bundesverbandes
FRAGEBOGEN INTEGRATIONSPANEL
 FRAGEBOGEN INTEGRATIONSPANEL ALPHA-KURSE KURSTEILNEHMENDE 1 A. Ihr persönlicher Hintergrund 1. Wie alt sind Sie? Ich bin 0 0 Jahre alt. 2. Geschlecht Mann Frau 3. Familienstand Ledig weiter mit Frage 4
FRAGEBOGEN INTEGRATIONSPANEL ALPHA-KURSE KURSTEILNEHMENDE 1 A. Ihr persönlicher Hintergrund 1. Wie alt sind Sie? Ich bin 0 0 Jahre alt. 2. Geschlecht Mann Frau 3. Familienstand Ledig weiter mit Frage 4
Sprachkontrastive Darstellung Deutsch-Türkisch
 Germanistik Nuran Aksoy Sprachkontrastive Darstellung Deutsch-Türkisch Studienarbeit Freie Universität Berlin Wintersemester 2003/2004 Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften: Fächergruppe deutsche
Germanistik Nuran Aksoy Sprachkontrastive Darstellung Deutsch-Türkisch Studienarbeit Freie Universität Berlin Wintersemester 2003/2004 Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften: Fächergruppe deutsche
1 / 12 ICH UND DIE FREMDSPRACHEN. Fragebogen für die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse (Luxemburg) Februar - März 2007
 1 / 12 Projet soutenu par la Direction générale de l Education et de la Culture, dans le cadre du Programme Socrates ICH UND DIE FREMDSPRACHEN Fragebogen für die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse
1 / 12 Projet soutenu par la Direction générale de l Education et de la Culture, dans le cadre du Programme Socrates ICH UND DIE FREMDSPRACHEN Fragebogen für die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse
Kernkompetenzen. im Fach Englisch, die in jeder Unterrichtsstunde erreicht werden können
 Kernkompetenzen im Fach Englisch, die in jeder Unterrichtsstunde erreicht werden können Bereich: Kommunikation sprachliches Handeln Schwerpunkt: Hörverstehen/Hör- Sehverstehen verstehen Äußerungen und
Kernkompetenzen im Fach Englisch, die in jeder Unterrichtsstunde erreicht werden können Bereich: Kommunikation sprachliches Handeln Schwerpunkt: Hörverstehen/Hör- Sehverstehen verstehen Äußerungen und
Hast du Fragen? Begleitmaterial Station 5. Ziel: Idee und Hintergrund. Kompetenzen. Fragen rund um das Thema Sprachen
 Begleitmaterial Station 5 Hast du Fragen? Ziel: Fragen rund um das Thema Sprachen Idee und Hintergrund Sprache und Sprachen sind für viele Lebensbereiche der Menschen von enormer Wichtigkeit. Es stellen
Begleitmaterial Station 5 Hast du Fragen? Ziel: Fragen rund um das Thema Sprachen Idee und Hintergrund Sprache und Sprachen sind für viele Lebensbereiche der Menschen von enormer Wichtigkeit. Es stellen
Ausspracheschwierigkeiten arabischer Deutschlernender aus dem Irak und didaktische Überlegungen zum Ausspracheunterricht
 Hallesche Schriften zur Sprechwissenschaft und Phonetik 49 Ausspracheschwierigkeiten arabischer Deutschlernender aus dem Irak und didaktische Überlegungen zum Ausspracheunterricht 1. Auflage 2014. Buch.
Hallesche Schriften zur Sprechwissenschaft und Phonetik 49 Ausspracheschwierigkeiten arabischer Deutschlernender aus dem Irak und didaktische Überlegungen zum Ausspracheunterricht 1. Auflage 2014. Buch.
Funktionaler Analphabetismus in der Bundesrepublik Deutschland
 Medien Andrea Harings Funktionaler Analphabetismus in der Bundesrepublik Deutschland Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 1 2. Analphabetismus... 2 2.1 Begriffsbestimmung... 2 2.2 Ausmaß...
Medien Andrea Harings Funktionaler Analphabetismus in der Bundesrepublik Deutschland Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 1 2. Analphabetismus... 2 2.1 Begriffsbestimmung... 2 2.2 Ausmaß...
Fragebogen Deutsch als Fremdsprache
 Fragebogen Deutsch als Fremdsprache Liebe Studentin, lieber Student! Am Institut für Germanistik der Universität Wien machen wir im Seminar Fremdsprachenerwerb, Identität und Bildungspolitik eine große
Fragebogen Deutsch als Fremdsprache Liebe Studentin, lieber Student! Am Institut für Germanistik der Universität Wien machen wir im Seminar Fremdsprachenerwerb, Identität und Bildungspolitik eine große
Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 5. Descripción
 Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 5 Descripción In dieser Stufe lernen Sie, über die Vergangenheit und die Zukunft zu sprechen. Sie benutzen dabei die verschiedenen Vergangenheitsformen im Deutschen.
Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 5 Descripción In dieser Stufe lernen Sie, über die Vergangenheit und die Zukunft zu sprechen. Sie benutzen dabei die verschiedenen Vergangenheitsformen im Deutschen.
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Kein leichter Fall - das deutsche Kasussystem
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Kein leichter Fall - das deutsche Kasussystem Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2 von 28 Kasus Grammatik und
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Kein leichter Fall - das deutsche Kasussystem Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2 von 28 Kasus Grammatik und
DIGITALES LERNEN IN DER ALPHABETISIERUNG UND GRUNDBILDUNG
 FACHTAGUNG DIGITALES LERNEN IN GRUNDBILDUNG UND INTEGRATION DIGITALES LERNEN IN DER ALPHABETISIERUNG UND GRUNDBILDUNG KOMED, Media Park 7, Köln Dienstag, 20. November 2018 9:15-10:00 Uhr Dr. Alexis Feldmeier
FACHTAGUNG DIGITALES LERNEN IN GRUNDBILDUNG UND INTEGRATION DIGITALES LERNEN IN DER ALPHABETISIERUNG UND GRUNDBILDUNG KOMED, Media Park 7, Köln Dienstag, 20. November 2018 9:15-10:00 Uhr Dr. Alexis Feldmeier
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS. Wir vergleichen Sprachen
 Wir vergleichen Sprachen Jahrgangsstufen 3/4 Fach Benötigtes Material Deutsch Sprache untersuchen und reflektieren Film (youtube) und Arbeitsblätter in unterschiedlichen Sprachen Kompetenzerwartungen D
Wir vergleichen Sprachen Jahrgangsstufen 3/4 Fach Benötigtes Material Deutsch Sprache untersuchen und reflektieren Film (youtube) und Arbeitsblätter in unterschiedlichen Sprachen Kompetenzerwartungen D
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS
 Sich begrüßen und verabschieden Guten Tag/Auf Wiedersehen Stand: 7.08.2017 Stand der Sprachkenntnisse Fächer Zeitrahmen Benötigtes Material Schülerinnen und Schüler mit geringen Sprachkenntnissen mit Grundkenntnissen
Sich begrüßen und verabschieden Guten Tag/Auf Wiedersehen Stand: 7.08.2017 Stand der Sprachkenntnisse Fächer Zeitrahmen Benötigtes Material Schülerinnen und Schüler mit geringen Sprachkenntnissen mit Grundkenntnissen
Laura Thiele Claudia Scochi
 Laura Thiele Claudia Scochi Bei Unterrichtshospitationen, die an italienischen Grund, Mittel- und Oberschulen von externen Personen oder Kollegen* durchgeführt wurden, erfolgte eine Unterrichtsbeobachtung
Laura Thiele Claudia Scochi Bei Unterrichtshospitationen, die an italienischen Grund, Mittel- und Oberschulen von externen Personen oder Kollegen* durchgeführt wurden, erfolgte eine Unterrichtsbeobachtung
Deutsch Dexway - Niveau 2
 Deutsch Dexway - Niveau 2 Contenido Lernziele: In diesem Block lernt der/die Schüler/-in, seine unmittelbare Umgebung auf einfache Weise zu beschreiben, er/sie wird auf einfache Fragen antworten können
Deutsch Dexway - Niveau 2 Contenido Lernziele: In diesem Block lernt der/die Schüler/-in, seine unmittelbare Umgebung auf einfache Weise zu beschreiben, er/sie wird auf einfache Fragen antworten können
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 5. Sitzung Deutsch als Zweitsprache/Mehrsprachigkeit
 Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 5. Sitzung Deutsch als Zweitsprache/Mehrsprachigkeit 1 Deutsch als Zweitsprache 2 Übersicht/Verlauf der Vorlesung Deutsche Sprache was ist
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 5. Sitzung Deutsch als Zweitsprache/Mehrsprachigkeit 1 Deutsch als Zweitsprache 2 Übersicht/Verlauf der Vorlesung Deutsche Sprache was ist
Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht
 Germanistik Mohamed Chaabani Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht Forschungsarbeit 1 Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht Chaabani Mohamed Abstract Gegenstand dieser Arbeit
Germanistik Mohamed Chaabani Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht Forschungsarbeit 1 Die Personenbeschreibung im Fremdsprachenunterricht Chaabani Mohamed Abstract Gegenstand dieser Arbeit
Curriculum Deutsch - Förderschule - Grundstufe
 Curriculum Deutsch - Förderschule - Grundstufe Klasse Kompetenz felder 3 Sprechen Seite 1 von 6 Kompetenzen nutzen Gestik und Mimik, um sich verständlich zu machen sprechen verständlich hören zu und verstehen
Curriculum Deutsch - Förderschule - Grundstufe Klasse Kompetenz felder 3 Sprechen Seite 1 von 6 Kompetenzen nutzen Gestik und Mimik, um sich verständlich zu machen sprechen verständlich hören zu und verstehen
Tabelle 2 - Gemeinsame Referenzniveaus: Raster zur Selbstbeurteilung. Verstehen Sprechen Schreiben C2 bis A1 Hören Lesen. An Gesprächen teilnehmen
 Tabelle 2 - Gemeinsame Referenzniveaus: Raster zur Selbstbeurteilung Verstehen Sprechen Schreiben C2 bis Hören Lesen An Gesprächen teilnehmen Zusammenhängendes sprechen Schreiben C2 Hören Ich habe keinerlei
Tabelle 2 - Gemeinsame Referenzniveaus: Raster zur Selbstbeurteilung Verstehen Sprechen Schreiben C2 bis Hören Lesen An Gesprächen teilnehmen Zusammenhängendes sprechen Schreiben C2 Hören Ich habe keinerlei
Methodische und didaktische Strategien der Binnendifferenzierung in Lerngruppen zur Förderung der Lernerautonomie
 Methodische und didaktische Strategien der Binnendifferenzierung in Lerngruppen zur Förderung der Lernerautonomie AkDaF Fachtagung 29.März 2014 Luzern Vecih Yaşaner Bundesamt für Migration und Flüchtlinge:
Methodische und didaktische Strategien der Binnendifferenzierung in Lerngruppen zur Förderung der Lernerautonomie AkDaF Fachtagung 29.März 2014 Luzern Vecih Yaşaner Bundesamt für Migration und Flüchtlinge:
76 Szene 1: Auf dem Schulhof 77 Szene 2: Wie ist das mit der Sprache? 78 Szene 3: Zwei Heimatländer geht das? Texte der Hörszenen: S.
 Berlin ist eine multikulturelle Stadt. Das haben Sie in der letzten Folge sicher schon an den vielen Restaurants bemerkt: Die Mitarbeiter von Radio D konnten sich kaum einigen, ob sie lieber türkisch,
Berlin ist eine multikulturelle Stadt. Das haben Sie in der letzten Folge sicher schon an den vielen Restaurants bemerkt: Die Mitarbeiter von Radio D konnten sich kaum einigen, ob sie lieber türkisch,
Mehrsprachigkeit Normalität, Ressource, Herausforderung Blicke aus der Perspektive (auch) der Basisbildung. thomas fritz lernraum.
 Mehrsprachigkeit Normalität, Ressource, Herausforderung Blicke aus der Perspektive (auch) der Basisbildung thomas fritz lernraum.wien oktober 2012 was bedeutet Mehrsprachigkeit? Individuum Gesellschaft
Mehrsprachigkeit Normalität, Ressource, Herausforderung Blicke aus der Perspektive (auch) der Basisbildung thomas fritz lernraum.wien oktober 2012 was bedeutet Mehrsprachigkeit? Individuum Gesellschaft
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017)
 Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS
 Wörter mit Doppelkonsonanz richtig schreiben Jahrgangsstufen 3/4 Fach Benötigtes Material Deutsch Passendes Wortmaterial (Minimalpaare, wie z. B. Riese Risse, siehe Arbeitsauftrag) Kompetenzerwartungen
Wörter mit Doppelkonsonanz richtig schreiben Jahrgangsstufen 3/4 Fach Benötigtes Material Deutsch Passendes Wortmaterial (Minimalpaare, wie z. B. Riese Risse, siehe Arbeitsauftrag) Kompetenzerwartungen
DESCRIPCIÓN. Federico Lahoz. "Deutsch Dexway Beruflich - Niveau B1 - Kurs I
 224 Deutsch Dexway Beruflich - Niveau B1 - Kurs I DESCRIPCIÓN "Deutsch Dexway Beruflich - Niveau B1 - Kurs I In dieser Stufe lernen Sie, über die Vergangenheit und die Zukunft zu sprechen. Sie benutzen
224 Deutsch Dexway Beruflich - Niveau B1 - Kurs I DESCRIPCIÓN "Deutsch Dexway Beruflich - Niveau B1 - Kurs I In dieser Stufe lernen Sie, über die Vergangenheit und die Zukunft zu sprechen. Sie benutzen
Inhaltsverzeichnis. 1 Einleitung Zur Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit Aufbau der Arbeit...13
 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 11 1.1 Zur Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit... 11 1.2 Aufbau der Arbeit...13 2 Aktuelle Situation des Fremdsprachenunterrichts Deutsch im Irak...15 2.1 Ausspracheunterricht
Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 11 1.1 Zur Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit... 11 1.2 Aufbau der Arbeit...13 2 Aktuelle Situation des Fremdsprachenunterrichts Deutsch im Irak...15 2.1 Ausspracheunterricht
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Didaktikfach
 Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Didaktikfach Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Themenübersicht: 1. Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle Kompetenz 2. Literarische Texte
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Didaktikfach Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Themenübersicht: 1. Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle Kompetenz 2. Literarische Texte
GRUNDLAGEN DEUTSCH ALS FREMD- UND ZWEITSPRACHE. Herausgegeben von Christian Fandrych, Marina Foschi Albert, Karen Schramm und Maria Thurmair
 GRUNDLAGEN DEUTSCH ALS FREMD- UND ZWEITSPRACHE Herausgegeben von Christian Fandrych, Marina Foschi Albert, Karen Schramm und Maria Thurmair 1 Phonetik im Fach Deutsch als Fremdund Zweitsprache Unter Berücksichtigung
GRUNDLAGEN DEUTSCH ALS FREMD- UND ZWEITSPRACHE Herausgegeben von Christian Fandrych, Marina Foschi Albert, Karen Schramm und Maria Thurmair 1 Phonetik im Fach Deutsch als Fremdund Zweitsprache Unter Berücksichtigung
Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 2. Descripción
 Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 2 Descripción Lernziele: In diesem Block lernt der/die Schüler/-in, seine unmittelbare Umgebung auf einfache Weise zu beschreiben, er/sie wird auf einfache Fragen
Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 2 Descripción Lernziele: In diesem Block lernt der/die Schüler/-in, seine unmittelbare Umgebung auf einfache Weise zu beschreiben, er/sie wird auf einfache Fragen
Lesen und Schreiben bei mehrsprachigen Kindern
 Raffaele De Rosa Lesen und Schreiben bei mehrsprachigen Kindern Raffaele De Rosa Lesen und Schreiben bei mehrsprachigen Kindern Theoretische und praktische Ansätze mit konkreten Beispielen Haupt Verlag
Raffaele De Rosa Lesen und Schreiben bei mehrsprachigen Kindern Raffaele De Rosa Lesen und Schreiben bei mehrsprachigen Kindern Theoretische und praktische Ansätze mit konkreten Beispielen Haupt Verlag
Duits in de beroepscontext Deutsch für den Beruf Niederlande Modellsatz A2-B1
 Duits in de beroepscontext Deutsch für den Beruf Niederlande Modellsatz A2-B1 KANDIDATENBLÄTTER SPRECHEN Zeit: 20 Minuten Das Modul Sprechen hat vier Teile. Sie kommunizieren mit einem/r Teilnehmenden
Duits in de beroepscontext Deutsch für den Beruf Niederlande Modellsatz A2-B1 KANDIDATENBLÄTTER SPRECHEN Zeit: 20 Minuten Das Modul Sprechen hat vier Teile. Sie kommunizieren mit einem/r Teilnehmenden
Glossar zum BESK/BESK-DaZ 2.0
 Glossar zum BESK/BESK-DaZ 2.0 Glossar zum BESK 2.0 bzw. BESK-DaZ 2.0 erstellt in Zusammenarbeit von der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg und dem Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Schule
Glossar zum BESK/BESK-DaZ 2.0 Glossar zum BESK 2.0 bzw. BESK-DaZ 2.0 erstellt in Zusammenarbeit von der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg und dem Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Schule
Markus und Caroline Eine Kurzgeschichte in 5 Teilen. von Anne Haase. 4. Teil: Caroline
 Markus und Caroline ine Kurzgeschichte in 5 Teilen von Anne Haase 4. Teil: Caroline Der Schrank ist repariert. Der Orangensaft ist leer. Die Gläser sind gespült. Caroline hört, dass Markus wieder bei ihrem
Markus und Caroline ine Kurzgeschichte in 5 Teilen von Anne Haase 4. Teil: Caroline Der Schrank ist repariert. Der Orangensaft ist leer. Die Gläser sind gespült. Caroline hört, dass Markus wieder bei ihrem
4 Farben Kernwortschatz des Situationsbildes kennenlernen, Adjektive zusammensetzen...30 Kernwortschatz silbieren und im Satz verwenden...
 Inhaltsverzeichnis Das Abc Nachschlagen üben Seite Inhalte des Wörterbuchs kennenlernen 6 Räumliche Begriffe verwenden: davor, dahinter, Vorgänger, Nachfolger 7 Das Abc lernen 8 Wörter nach dem Abc ordnen
Inhaltsverzeichnis Das Abc Nachschlagen üben Seite Inhalte des Wörterbuchs kennenlernen 6 Räumliche Begriffe verwenden: davor, dahinter, Vorgänger, Nachfolger 7 Das Abc lernen 8 Wörter nach dem Abc ordnen
Flüchtlinge lernen Deutsch Geschichten bauen Phase 2 - Ideen für fortgeschrittene Anfänger
 Flüchtlinge lernen Deutsch Geschichten bauen Phase 2 - Ideen für fortgeschrittene Anfänger In den ersten ca. 100 Stunden haben die Lernenden mit Hilfe von Gegenständen und Handlungen aus ihrem direkten
Flüchtlinge lernen Deutsch Geschichten bauen Phase 2 - Ideen für fortgeschrittene Anfänger In den ersten ca. 100 Stunden haben die Lernenden mit Hilfe von Gegenständen und Handlungen aus ihrem direkten
DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten
 Germanistik Mohamed Chaabani DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Wissenschaftlicher Aufsatz 1 DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Chaabani Mohamed Abstract Die
Germanistik Mohamed Chaabani DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Wissenschaftlicher Aufsatz 1 DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Chaabani Mohamed Abstract Die
Der zweite entscheidende und kritische Entwicklungsschritt ist die Entwicklung orthografischer Strategien (May 1995). Unsere Schrift ist keine
 Ich vertrete an der Universität Hamburg die Deutschdidaktik mit dem Schwerpunkt Sprachlicher Anfangsunterricht und möchte deshalb mit dem Schulanfang in das Thema einsteigen. Wie lernen Schulanfänger Schreiben?
Ich vertrete an der Universität Hamburg die Deutschdidaktik mit dem Schwerpunkt Sprachlicher Anfangsunterricht und möchte deshalb mit dem Schulanfang in das Thema einsteigen. Wie lernen Schulanfänger Schreiben?
Übersicht über die Dokumente
 Übersicht über die Dokumente 1. Checklisten zur Selbsteinschätzung Im Anhang C finden Sie sechs Checklisten. Sie können diese Checklisten brauchen, um sich selbst einzuschätzen und um Ihr Können von anderen,
Übersicht über die Dokumente 1. Checklisten zur Selbsteinschätzung Im Anhang C finden Sie sechs Checklisten. Sie können diese Checklisten brauchen, um sich selbst einzuschätzen und um Ihr Können von anderen,
Die pädagogische Wirksamkeit vorschulischer Förderung des Schriftspracherwerbs
 Pädagogik Dirk Kranz Die pädagogische Wirksamkeit vorschulischer Förderung des Schriftspracherwerbs Bachelorarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 3 2. Spracherwerb und Schriftspracherwerb... 3 2.1.
Pädagogik Dirk Kranz Die pädagogische Wirksamkeit vorschulischer Förderung des Schriftspracherwerbs Bachelorarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 3 2. Spracherwerb und Schriftspracherwerb... 3 2.1.
GOETHE-INSTITUT Diagnose & Einstufung: Der Alpha-Baustein im Einstufungssystem in die
 GOETHE-INSTITUT Diagnose & Einstufung: Der Alpha-Baustein im Einstufungssystem in die Integrationskurse in Deutschland München, 30. April 2010 Dr. Michaela Perlmann-Balme Bereich 41 Sprachkurse und Prüfungen
GOETHE-INSTITUT Diagnose & Einstufung: Der Alpha-Baustein im Einstufungssystem in die Integrationskurse in Deutschland München, 30. April 2010 Dr. Michaela Perlmann-Balme Bereich 41 Sprachkurse und Prüfungen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Grammatik. Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Grammatik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de kurz & bündig Band 6 Hartwig Lödige Grammatik INHALT Inhalt Zur
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Grammatik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de kurz & bündig Band 6 Hartwig Lödige Grammatik INHALT Inhalt Zur
1. Angaben zum DACHL-Fundstück. Fotograf/Fotografin Ki (Andrea) Bhebe Aufnahmedatum Aufnahmeort Berlin/Prenzlauer Berg
 Unterrichtsvorschlag von Ki (Andrea) Bhebe: Bücherbaum 1. Angaben zum DACHL-Fundstück Titel Bücherbaum Fotograf/Fotografin Ki (Andrea) Bhebe Aufnahmedatum 30.01.2016 Aufnahmeort Berlin/Prenzlauer Berg
Unterrichtsvorschlag von Ki (Andrea) Bhebe: Bücherbaum 1. Angaben zum DACHL-Fundstück Titel Bücherbaum Fotograf/Fotografin Ki (Andrea) Bhebe Aufnahmedatum 30.01.2016 Aufnahmeort Berlin/Prenzlauer Berg
ENTDECKEN SIE IHRE LERNSTRATEGIEN!
 ENTDECKEN SIE IHRE LERNSTRATEGIEN! Beantworten Sie folgenden Fragen ausgehend vom dem, was Sie zur Zeit wirklich machen, und nicht vom dem, was Sie machen würden, wenn Sie mehr Zeit hätten oder wenn Sie
ENTDECKEN SIE IHRE LERNSTRATEGIEN! Beantworten Sie folgenden Fragen ausgehend vom dem, was Sie zur Zeit wirklich machen, und nicht vom dem, was Sie machen würden, wenn Sie mehr Zeit hätten oder wenn Sie
Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 11. Descripción
 Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 11 Descripción Lernziele: In diesem Block wird der/die Schüler/-in lernen, das Aussehen einer Person gemäß ihres Alters und Körperbaus genau beschreiben zu können.
Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 11 Descripción Lernziele: In diesem Block wird der/die Schüler/-in lernen, das Aussehen einer Person gemäß ihres Alters und Körperbaus genau beschreiben zu können.
Rede von Staatsministerin Aydan Özoğuz. Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer!
 1 Rede von Staatsministerin Aydan Özoğuz Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer! Ich danke Ihnen sehr für die Einladung zu dieser Konferenz.
1 Rede von Staatsministerin Aydan Özoğuz Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer! Ich danke Ihnen sehr für die Einladung zu dieser Konferenz.
Die großen 5 des Deutschunterrichts: Wann? Was? Warum? Wer? Wie?
 Bildungscampus Nürnberg Die großen 5 des Deutschunterrichts: Wann? Was? Warum? Wer? Wie? Fachtag Flüchtlingshilfe Deutsch 30. Januar 2016 Wann? Grundsätzlich gilt: So bald wie möglich, aber Alles zu seiner
Bildungscampus Nürnberg Die großen 5 des Deutschunterrichts: Wann? Was? Warum? Wer? Wie? Fachtag Flüchtlingshilfe Deutsch 30. Januar 2016 Wann? Grundsätzlich gilt: So bald wie möglich, aber Alles zu seiner
3. Hilfen zur Diagnose
 3.3 Lernstandskontrollen im Diagnoseheft Lösungen kann keine zusammengesetzten Nomen zu Bildern bilden (Aufgabe 1) Da das zusammengesetzte Nomen aus zwei Bildern besteht, sind beim Bilden des Nomens keine
3.3 Lernstandskontrollen im Diagnoseheft Lösungen kann keine zusammengesetzten Nomen zu Bildern bilden (Aufgabe 1) Da das zusammengesetzte Nomen aus zwei Bildern besteht, sind beim Bilden des Nomens keine
Relativsatz. NIVEAU NUMMER SPRACHE Mittelstufe B1_2062G_DE Deutsch
 Relativsatz GRAMMATIK NIVEAU NUMMER SPRACHE Mittelstufe B1_2062G_DE Deutsch Lernziele Relativsatz lernen, bilden und verwenden Relativpronomen lernen Relativadverbien lernen 2 -Kennst du diesen Mann? -Welchen?
Relativsatz GRAMMATIK NIVEAU NUMMER SPRACHE Mittelstufe B1_2062G_DE Deutsch Lernziele Relativsatz lernen, bilden und verwenden Relativpronomen lernen Relativadverbien lernen 2 -Kennst du diesen Mann? -Welchen?
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Genial! Deutsch DAZ/DAF - Schritt für Schritt zukunftsfit - Schulbuch Deutsch - Serviceteil Das komplette Material finden Sie hier:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Genial! Deutsch DAZ/DAF - Schritt für Schritt zukunftsfit - Schulbuch Deutsch - Serviceteil Das komplette Material finden Sie hier:
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS
 Nicht alle Menschen sagen Hallo! Wörter aus verschiedenen Sprachen Jahrgangsstufen 1/2 Fach übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele Zeitrahmen Benötigtes Material Deutsch Interkulturelles Lernen 45
Nicht alle Menschen sagen Hallo! Wörter aus verschiedenen Sprachen Jahrgangsstufen 1/2 Fach übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele Zeitrahmen Benötigtes Material Deutsch Interkulturelles Lernen 45
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS
 Döi Erdäpflsuppn is dick Dialektwörter erforschen Jahrgangsstufen 3/4 Fach Benötigtes Material Deutsch Mundartlied Döi Erdäpflsuppn is dick, z. B. als geschriebener Text mit Melodie oder als Hörbeispiel
Döi Erdäpflsuppn is dick Dialektwörter erforschen Jahrgangsstufen 3/4 Fach Benötigtes Material Deutsch Mundartlied Döi Erdäpflsuppn is dick, z. B. als geschriebener Text mit Melodie oder als Hörbeispiel
Methoden der empirischen Kommunikationsforschung
 Studienbücher zur Kommunikations- und Medienwissenschaft Methoden der empirischen Kommunikationsforschung Eine Einführung Bearbeitet von Hans-Bernd Brosius, Alexander Haas, Friederike Koschel 7., überareitete
Studienbücher zur Kommunikations- und Medienwissenschaft Methoden der empirischen Kommunikationsforschung Eine Einführung Bearbeitet von Hans-Bernd Brosius, Alexander Haas, Friederike Koschel 7., überareitete
Sprachverständnis, Folie 1. Sprachverständnis
 Sprachverständnis, Folie 1 Sprachverständnis Indem wir Wörter und Sätze äussern, teilen wir etwas von unserer Welt mit. Indem wir Wörter und Sätze verstehen, nehmen wir ein Stück Aussenwelt zu uns. Susanne
Sprachverständnis, Folie 1 Sprachverständnis Indem wir Wörter und Sätze äussern, teilen wir etwas von unserer Welt mit. Indem wir Wörter und Sätze verstehen, nehmen wir ein Stück Aussenwelt zu uns. Susanne
Die DVV-Rahmencurricula Schreiben und Lesen im Grundbildungskurs
 Angela Rustemeyer Die DVV-Rahmencurricula Schreiben und Lesen im Grundbildungskurs Fachtagung Alpha Regional, 19. November 2014 Einführung Ergebnisse der leo.-studie und der AlphaPanel-Studie Schwierigkeiten
Angela Rustemeyer Die DVV-Rahmencurricula Schreiben und Lesen im Grundbildungskurs Fachtagung Alpha Regional, 19. November 2014 Einführung Ergebnisse der leo.-studie und der AlphaPanel-Studie Schwierigkeiten
Übungen - Für das Deutsche Sprachdiplom der KMK
 Die Grundlage der Übung ist der Beitrag Migration Neue Heimat Deutschland sowie der Text Willkommen in Deutschland Zwei Migranten berichten in vitamin de, Nr. 59, S. 16-17. Alle Aufgaben können auch einzeln
Die Grundlage der Übung ist der Beitrag Migration Neue Heimat Deutschland sowie der Text Willkommen in Deutschland Zwei Migranten berichten in vitamin de, Nr. 59, S. 16-17. Alle Aufgaben können auch einzeln
Fach: Deutsch Jahrgang: 5
 In jeder Unterrichtseinheit muss bei den überfachlichen Kompetenzen an je mindestens einer Selbst-, sozialen und lernmethodischen Kompetenz gearbeitet werden, ebenso muss in jeder Einheit mindestens eine
In jeder Unterrichtseinheit muss bei den überfachlichen Kompetenzen an je mindestens einer Selbst-, sozialen und lernmethodischen Kompetenz gearbeitet werden, ebenso muss in jeder Einheit mindestens eine
Lautspracherwerb - wichtigste Voraussetzung für den Schriftspracherwerb
 Lautspracherwerb - wichtigste Voraussetzung für den Schriftspracherwerb Lesen durch Sprechen - Alphabetisierung 1.0 Lautsprache ist - Gesamtheit der gesprochenen und hörbaren Laute menschlicher Sprache
Lautspracherwerb - wichtigste Voraussetzung für den Schriftspracherwerb Lesen durch Sprechen - Alphabetisierung 1.0 Lautsprache ist - Gesamtheit der gesprochenen und hörbaren Laute menschlicher Sprache
Bevor alle Deutschlehrer jetzt losschreien: Ahh, das geht nicht! Der Genitiv gehört zur deutschen Sprache! - Ja! Ihr habt Recht!
 1 Inhalt Vorwort... 2 Erklärung der Symbole:... 3 Genitiv in Nomen-Nomen-Konstruktionen... 4 Genitiv nach bestimmten Verben... 4 Verwendung nach Präpositionen... 6 Adjektive mit Genitiv... 10 Vorwort Bevor
1 Inhalt Vorwort... 2 Erklärung der Symbole:... 3 Genitiv in Nomen-Nomen-Konstruktionen... 4 Genitiv nach bestimmten Verben... 4 Verwendung nach Präpositionen... 6 Adjektive mit Genitiv... 10 Vorwort Bevor
Deutsch Dexway Reden wir Unlimited - Niveau B1 - Kurs I Descripción
 Deutsch Dexway Reden wir Unlimited - Niveau B1 - Kurs I Descripción In dieser Stufe lernen Sie, über die Vergangenheit und die Zukunft zu sprechen. Sie benutzen dabei die verschiedenen Vergangenheitsformen
Deutsch Dexway Reden wir Unlimited - Niveau B1 - Kurs I Descripción In dieser Stufe lernen Sie, über die Vergangenheit und die Zukunft zu sprechen. Sie benutzen dabei die verschiedenen Vergangenheitsformen
Schrifterwerb und Mehrsprachigkeit
 Schrifterwerb und Mehrsprachigkeit Referentin: Lisa Aul 28. Juni 2011 Vgl. Schrifterwerb und Mehrsprachigkeit von Gerlind Belke Fakten Mehrsprachigkeit ist in Deutschland der Regelfall Im Grundschulalter
Schrifterwerb und Mehrsprachigkeit Referentin: Lisa Aul 28. Juni 2011 Vgl. Schrifterwerb und Mehrsprachigkeit von Gerlind Belke Fakten Mehrsprachigkeit ist in Deutschland der Regelfall Im Grundschulalter
Sprache als Heimat wie Sprache uns formt und was sie uns bedeutet VORANSICHT. Wie fühlt es sich an, fremd in einer Sprachwelt zu sein?
 Sprache als Heimat 1 von 26 Sprache als Heimat wie Sprache uns formt und was sie uns bedeutet Natascha Raissa Floer, Röcklingen Wie fühlt es sich an, fremd in einer Sprachwelt zu sein? Vaterland und Muttersprache
Sprache als Heimat 1 von 26 Sprache als Heimat wie Sprache uns formt und was sie uns bedeutet Natascha Raissa Floer, Röcklingen Wie fühlt es sich an, fremd in einer Sprachwelt zu sein? Vaterland und Muttersprache
Vermittlung von Deutschsprachkenntnissen speziell an Flüchtlinge
 Vermittlung von Deutschsprachkenntnissen speziell an Flüchtlinge Thomas Lindner VHS Vogelsberg, Hochschule Fulda Deutschkurse von Alpha bis C2 Reckeröder Str. 26, 36275 Kirchheim, 0174-2167074 Rahmenbedingungen
Vermittlung von Deutschsprachkenntnissen speziell an Flüchtlinge Thomas Lindner VHS Vogelsberg, Hochschule Fulda Deutschkurse von Alpha bis C2 Reckeröder Str. 26, 36275 Kirchheim, 0174-2167074 Rahmenbedingungen
2 Sprechen Die SchülerInnen können
 Klasse Kompetenzfelder Kompetenzen 2 Sprechen über ein Thema sprechen, eine eigene Meinung äußern und so demokratische Verhaltensweisen einüben erste Gesprächsregeln beachten kurze Sprüche, Verse und Gedichte
Klasse Kompetenzfelder Kompetenzen 2 Sprechen über ein Thema sprechen, eine eigene Meinung äußern und so demokratische Verhaltensweisen einüben erste Gesprächsregeln beachten kurze Sprüche, Verse und Gedichte
Atividades de Estágio: Alemão Ausspracheschulung
 Atividades de Estágio: Alemão Ausspracheschulung Dörthe Uphoff 2. Semester 2013 Basislektüre Schweckendiek, Jürgen; Schumann, Franziska- Sophie. Phonetik im DaZ-Unterricht. In: Kaufmann, Susan et al. (orgs.).
Atividades de Estágio: Alemão Ausspracheschulung Dörthe Uphoff 2. Semester 2013 Basislektüre Schweckendiek, Jürgen; Schumann, Franziska- Sophie. Phonetik im DaZ-Unterricht. In: Kaufmann, Susan et al. (orgs.).
Förderliches Verhalten
 Ich lerne sprechen! Liebe Eltern, der Erwerb der Sprache ist wohl die komplexeste Aufgabe, die ein Kind im Laufe seiner frühen Entwicklung zu bewältigen hat. Es scheint, als würden unsere Kleinen das Sprechen
Ich lerne sprechen! Liebe Eltern, der Erwerb der Sprache ist wohl die komplexeste Aufgabe, die ein Kind im Laufe seiner frühen Entwicklung zu bewältigen hat. Es scheint, als würden unsere Kleinen das Sprechen
Einsteigen bitte! Einsteigen bitte! Lernbuch Einsteigen bitte!
 Einsteigen bitte! Ein Lernbuch für jugendliche erwachsene Neuleser schreiber 122 Seiten Herausgeber: Lesen Schreiben e.v. 2004 ISBN: 3-936735-85-9 Einsteigen bitte! Lernbuch Das Ziel dieses Basislehrganges
Einsteigen bitte! Ein Lernbuch für jugendliche erwachsene Neuleser schreiber 122 Seiten Herausgeber: Lesen Schreiben e.v. 2004 ISBN: 3-936735-85-9 Einsteigen bitte! Lernbuch Das Ziel dieses Basislehrganges
Schreiben. lea. Diagnostik. Morgens auf der Baustelle. Kann-Beschreibungen. Deckblatt. Alpha-Level 2 (ı 41)
 Morgens auf der Baustelle Alpha-Level 2 (ı 41) Deckblatt Kann-Beschreibungen 2.1.07 Kann kurze und geläufige Funktionswörter schreiben I (ist, ein, in, und) 2.1.08 Kann Wörter mit dem kurzen Vokal e" in
Morgens auf der Baustelle Alpha-Level 2 (ı 41) Deckblatt Kann-Beschreibungen 2.1.07 Kann kurze und geläufige Funktionswörter schreiben I (ist, ein, in, und) 2.1.08 Kann Wörter mit dem kurzen Vokal e" in
Fanzines: k r e a t i v e s W i e d e r h o l e n
 Fanzines: k r e a t i v e s W i e d e r h o l e n Mestre em Letras, UFRGS, Milena Hoffmann Kunrath Zusammenfassung: Jeder Schüler lernt anders, das heißt, dass die Regeln im Buch, wie sie sich darstellen,
Fanzines: k r e a t i v e s W i e d e r h o l e n Mestre em Letras, UFRGS, Milena Hoffmann Kunrath Zusammenfassung: Jeder Schüler lernt anders, das heißt, dass die Regeln im Buch, wie sie sich darstellen,
Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 12. Descripción
 Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 12 Descripción Lernziele: In diesem Block lernt der/die Schüler/-in, Tipps und Ratschläge zu geben, Hilfe anzubieten, Versprechen, Vorschläge und Bitten zu formulieren,
Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 12 Descripción Lernziele: In diesem Block lernt der/die Schüler/-in, Tipps und Ratschläge zu geben, Hilfe anzubieten, Versprechen, Vorschläge und Bitten zu formulieren,
Schriftliche Prüfung B1
 Aufbau und Ablauf der Prüfung Schriftliche Prüfung B1 Du musst bei der schriftlichen Prüfung einen persönlichen oder formellen Brief mit ca. 100-150 Wörtern schreiben, und dabei auf einen Brief, eine E-Mail,
Aufbau und Ablauf der Prüfung Schriftliche Prüfung B1 Du musst bei der schriftlichen Prüfung einen persönlichen oder formellen Brief mit ca. 100-150 Wörtern schreiben, und dabei auf einen Brief, eine E-Mail,
Kinder eine komplexe Lernaufgabe meistern und wo manche von ihnen Hilfe brauchen
 Fachtagung Sprache hat System Sprachförderung braucht System. Lernersprache Deutsch. Wie Formatvorlage des Untertitelmasters durch Klicken bearbeiten Kinder eine komplexe Lernaufgabe meistern und wo manche
Fachtagung Sprache hat System Sprachförderung braucht System. Lernersprache Deutsch. Wie Formatvorlage des Untertitelmasters durch Klicken bearbeiten Kinder eine komplexe Lernaufgabe meistern und wo manche
Deutsch Dexway - Niveau 12
 Deutsch Dexway - Niveau 12 Contenido Lernziele: In diesem Block lernt der/die Schüler/-in, Tipps und Ratschläge zu geben, Hilfe anzubieten, Versprechen, Vorschläge und Bitten zu formulieren, die entsprechende
Deutsch Dexway - Niveau 12 Contenido Lernziele: In diesem Block lernt der/die Schüler/-in, Tipps und Ratschläge zu geben, Hilfe anzubieten, Versprechen, Vorschläge und Bitten zu formulieren, die entsprechende
Die erneuerte europäische Agenda für Erwachsenenbildung. NA beim BIBB
 Die erneuerte europäische Agenda für Erwachsenenbildung Was erwartet Sie? Herausforderungen für die Erwachsenenbildung in Europa Wie Europa auf diese Herausforderungen reagiert - Übergeordnete bildungspolitische
Die erneuerte europäische Agenda für Erwachsenenbildung Was erwartet Sie? Herausforderungen für die Erwachsenenbildung in Europa Wie Europa auf diese Herausforderungen reagiert - Übergeordnete bildungspolitische
Zielsetzung der Materialien
 Zielsetzung der Materialien Die sprachliche Entwicklung von Kindern am Schulanfang führt zu vielen Besorgnissen bei Eltern und Pädagogen. Jedes vierte Kind hat im letzten Kindergartenjahr und in der ersten
Zielsetzung der Materialien Die sprachliche Entwicklung von Kindern am Schulanfang führt zu vielen Besorgnissen bei Eltern und Pädagogen. Jedes vierte Kind hat im letzten Kindergartenjahr und in der ersten
Graduierung der Adjektive. NIVEAU NUMMER SPRACHE Mittelstufe B2_1052G_DE Deutsch
 Graduierung der Adjektive GRAMMATIK NIVEAU NUMMER SPRACHE Mittelstufe B2_1052G_DE Deutsch Lernziele Lerne, was modale Adverbien ausdrücken und wann sie benutzt werden Lerne, wie Adjektive graduiert werden
Graduierung der Adjektive GRAMMATIK NIVEAU NUMMER SPRACHE Mittelstufe B2_1052G_DE Deutsch Lernziele Lerne, was modale Adverbien ausdrücken und wann sie benutzt werden Lerne, wie Adjektive graduiert werden
Coaching-Portfolio 1. Warum bin ich hier? (Kärtchen mit verschiedenen sprachlichen Bereichen) 2. Wie lerne ich?/meine Ressourcen
 Coaching Portfolio Coaching-Portfolio Hier finden Sie eine kleine Sammlung von Arbeitsblättern, die Teilnehmenden bei er Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernen, insbesondere seinem Sprachenlernen unterstützen
Coaching Portfolio Coaching-Portfolio Hier finden Sie eine kleine Sammlung von Arbeitsblättern, die Teilnehmenden bei er Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernen, insbesondere seinem Sprachenlernen unterstützen
Wissenschaftliches Schreiben. Recherche- und Schreibseminar Melanie Seiß
 Wissenschaftliches Schreiben Recherche- und Schreibseminar Melanie Seiß Inhalt Wissenschaftliche Arbeit Nach Beendigung der Vorarbeit: Gliederung und Literatur mit DozentIn besprechen vor Beginn des Schreibens:
Wissenschaftliches Schreiben Recherche- und Schreibseminar Melanie Seiß Inhalt Wissenschaftliche Arbeit Nach Beendigung der Vorarbeit: Gliederung und Literatur mit DozentIn besprechen vor Beginn des Schreibens:
Wiederholung des Konjunktiv I. NIVEAU NUMMER SPRACHE Mittelstufe B2_2055G_DE Deutsch
 Wiederholung des Konjunktiv I GRAMMATIK NIVEAU NUMMER SPRACHE Mittelstufe B2_2055G_DE Deutsch Lernziele Wiederhole die Präsensform des Konjunktiv I Lerne, die Konjunktiv I Vergangenheit zu gebrauchen Lerne,
Wiederholung des Konjunktiv I GRAMMATIK NIVEAU NUMMER SPRACHE Mittelstufe B2_2055G_DE Deutsch Lernziele Wiederhole die Präsensform des Konjunktiv I Lerne, die Konjunktiv I Vergangenheit zu gebrauchen Lerne,
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Erweiterungsstudium
 Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Erweiterungsstudium Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Schwerpunktübersicht: 1. Zweitspracherwerbsforschung / Hypothesen / Neurolinguistik 2. Fehler
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Erweiterungsstudium Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Schwerpunktübersicht: 1. Zweitspracherwerbsforschung / Hypothesen / Neurolinguistik 2. Fehler
Fach: Deutsch als Zweitsprache Klasse: 1. Klasse
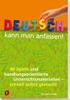 Klasse: 1. Klasse kann in verschiedenen Sprechsituationen aufmerksam zuhören kann im Alltag häufig gebrauchte Formeln (Standardausdrücke, Begrüßungen, Verabschiedungen, Entschuldigungen) und einfache Fragen
Klasse: 1. Klasse kann in verschiedenen Sprechsituationen aufmerksam zuhören kann im Alltag häufig gebrauchte Formeln (Standardausdrücke, Begrüßungen, Verabschiedungen, Entschuldigungen) und einfache Fragen
Grammatik. einfach logisch. Ein Handbuch. Maria Götzinger-Hiebner. Schwerpunkt Primarstufe und Sekundarstufe 1. Lernen mit Pfiff
 Grammatik_Kern:Layout 1 31.10.2018 10:28 Seite 1 Maria Götzinger-Hiebner Grammatik einfach logisch Ein Handbuch Schwerpunkt Primarstufe und Sekundarstufe 1 Lernen mit Pfiff Grammatik_Kern:Layout 1 31.10.2018
Grammatik_Kern:Layout 1 31.10.2018 10:28 Seite 1 Maria Götzinger-Hiebner Grammatik einfach logisch Ein Handbuch Schwerpunkt Primarstufe und Sekundarstufe 1 Lernen mit Pfiff Grammatik_Kern:Layout 1 31.10.2018
Didaktisch-methodische Hinweise
 idaktisch-methodische Hinweise Wie ist das Arbeitsheft aufgebaut? ieses Arbeitsheft zum Wörterbuch INIGO eignet sich besonders für den Unterricht und die Arbeit mit heterogenen Lerngruppen, um mit eutsch
idaktisch-methodische Hinweise Wie ist das Arbeitsheft aufgebaut? ieses Arbeitsheft zum Wörterbuch INIGO eignet sich besonders für den Unterricht und die Arbeit mit heterogenen Lerngruppen, um mit eutsch
Bedarf und Wirkung von Leicht Lesen (LL) Informationen
 Bedarf und Wirkung von Leicht Lesen (LL) Informationen Unser Motto: Wir fangen einfach an! Menschen sind verschieden. Gleichstellung: Alle an einem, gemeinsamen Tisch. Unser Job: Zugänge schaffen. capito:
Bedarf und Wirkung von Leicht Lesen (LL) Informationen Unser Motto: Wir fangen einfach an! Menschen sind verschieden. Gleichstellung: Alle an einem, gemeinsamen Tisch. Unser Job: Zugänge schaffen. capito:
Sprachbildung im Offenen Ganztag. Spielend Sprechen lernen, und die Lust der Kinder am Kommunizieren nutzen und stärken
 Sprachbildung im Offenen Ganztag Spielend Sprechen lernen, und die Lust der Kinder am Kommunizieren nutzen und stärken D I P L. - H E I L P Ä D. M A R E N B E R H E I D E Ablauf 1. Meilensteine der Sprachentwicklung
Sprachbildung im Offenen Ganztag Spielend Sprechen lernen, und die Lust der Kinder am Kommunizieren nutzen und stärken D I P L. - H E I L P Ä D. M A R E N B E R H E I D E Ablauf 1. Meilensteine der Sprachentwicklung
Oktober BSL- Nachrichten. Ergebnisse zur Studie Sprachmelodie und Betonung bei der Segmentierung gesprochener Sprache
 Oktober 2015 BSL- Nachrichten Ergebnisse zur Studie Sprachmelodie und Betonung bei der Segmentierung gesprochener Sprache BSL-Nachrichten Oktober 2015 2 Ein herzliches Dankeschön! Wir möchten uns ganz
Oktober 2015 BSL- Nachrichten Ergebnisse zur Studie Sprachmelodie und Betonung bei der Segmentierung gesprochener Sprache BSL-Nachrichten Oktober 2015 2 Ein herzliches Dankeschön! Wir möchten uns ganz
Lehrplan Deutsch 2. Jahrgangsstufe
 Lehrplan Deutsch 2. Jahrgangsstufe Die Spracherziehung entwickelt die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes und hat damit grundlegende Bedeutung für dessen geistige und soziale Entwicklung sowie den schulischen
Lehrplan Deutsch 2. Jahrgangsstufe Die Spracherziehung entwickelt die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes und hat damit grundlegende Bedeutung für dessen geistige und soziale Entwicklung sowie den schulischen
Lehrtext. Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Zentrale Einrichtung Fernstudienzentrum
 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Zentrale Einrichtung Fernstudienzentrum Psychologische Gesundheitsförderung für Krankenpflegepersonal Lehrtext Hilfreiche Gespräche Ilka Albers 1997 Zentrale Einrichtung
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Zentrale Einrichtung Fernstudienzentrum Psychologische Gesundheitsförderung für Krankenpflegepersonal Lehrtext Hilfreiche Gespräche Ilka Albers 1997 Zentrale Einrichtung
IDIOMAS DESCRIPCIÓN. Federico Lahoz. Deutsch Dexway Beruflich - Niveau A2 - Kurs II
 222 IDIOMAS Deutsch Dexway Beruflich - Niveau A2 - Kurs II DESCRIPCIÓN Deutsch Dexway Beruflich - Niveau A2 - Kurs II Lernziele: Im Rahmen dieses Blocks lernt der/die Schüler/-in, sich selbst in seiner
222 IDIOMAS Deutsch Dexway Beruflich - Niveau A2 - Kurs II DESCRIPCIÓN Deutsch Dexway Beruflich - Niveau A2 - Kurs II Lernziele: Im Rahmen dieses Blocks lernt der/die Schüler/-in, sich selbst in seiner
Teil Methodische Überlegungen Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17
 Inhaltsverzeichnis Dysgrammatismus EINLEITUNG Teil 1... 9 A Phänomen des Dysgrammatismus... 13 Methodische Überlegungen... 15 Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17 B Die Sprachstörung Dysgrammatismus...
Inhaltsverzeichnis Dysgrammatismus EINLEITUNG Teil 1... 9 A Phänomen des Dysgrammatismus... 13 Methodische Überlegungen... 15 Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17 B Die Sprachstörung Dysgrammatismus...
Wo steht mein Schüler? Richtige Einstufung ist wichtig!
 Wo steht mein Schüler? Richtige Einstufung ist wichtig! Bevor Sie mit dem Unterricht beginnen, möchten Sie sicherlich wissen, wo Ihr Schüler steht. Davon hängt ab, was Sie ihm als Lehrmaterial zur Verfügung
Wo steht mein Schüler? Richtige Einstufung ist wichtig! Bevor Sie mit dem Unterricht beginnen, möchten Sie sicherlich wissen, wo Ihr Schüler steht. Davon hängt ab, was Sie ihm als Lehrmaterial zur Verfügung
Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 3. Descripción
 Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 3 Descripción In dieser Stufe lernen die Studenten einige Verben wie können und dürfen, Adjektive, Adverbien der Wiederkehr, lokale Präpositionen, den Imperativ, wie
Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 3 Descripción In dieser Stufe lernen die Studenten einige Verben wie können und dürfen, Adjektive, Adverbien der Wiederkehr, lokale Präpositionen, den Imperativ, wie
FERTIGKEITEN UND PROZEDURALES WISSEN
 FERTIGKEITEN UND PROZEDURALES WISSEN S-1.+ Sprachliche Elemente / kulturelle Phänomene in mehr oder weniger vertrauten Sprachen / Kulturen beobachten / analysieren können S-2 + Sprachliche Elemente / kulturelle
FERTIGKEITEN UND PROZEDURALES WISSEN S-1.+ Sprachliche Elemente / kulturelle Phänomene in mehr oder weniger vertrauten Sprachen / Kulturen beobachten / analysieren können S-2 + Sprachliche Elemente / kulturelle
Die Sozialisation türkischer Kinder und Jugendlicher innerhalb ihrer Familien und ein Beispiel interkulturellen Lernens im Deutschunterricht
 Geisteswissenschaft Havva Yuvali Die Sozialisation türkischer Kinder und Jugendlicher innerhalb ihrer Familien und ein Beispiel interkulturellen Lernens im Deutschunterricht Studienarbeit Universität
Geisteswissenschaft Havva Yuvali Die Sozialisation türkischer Kinder und Jugendlicher innerhalb ihrer Familien und ein Beispiel interkulturellen Lernens im Deutschunterricht Studienarbeit Universität
RAUMKONZEPT IM TÜRKISCHEN UND IM DEUTSCHEN
 RAUMKONZEPT IM TÜRKISCHEN UND IM DEUTSCHEN EINE UNTERRICHTSEINHEIT ZUR BILDBESCHREIBUNG FOKUSSIERT AUF DIE VERWENDUNG DER PRÄPOSITIONEN IN EINER SIEBTEN KLASSE MIT SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN, DIE DEUTSCH
RAUMKONZEPT IM TÜRKISCHEN UND IM DEUTSCHEN EINE UNTERRICHTSEINHEIT ZUR BILDBESCHREIBUNG FOKUSSIERT AUF DIE VERWENDUNG DER PRÄPOSITIONEN IN EINER SIEBTEN KLASSE MIT SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN, DIE DEUTSCH
Orientierungshilfen. Name Sprachen Inhalt Niveau
 Orientierungshilfen Refugee Guide Französisch Kurdisch Türkisch Pashto Dari Russisch Serbisch Albanisch Urdu Tigrinya Mazedonisch Enthält nützliche Tipps und Informationen für das Leben in land zu Themen
Orientierungshilfen Refugee Guide Französisch Kurdisch Türkisch Pashto Dari Russisch Serbisch Albanisch Urdu Tigrinya Mazedonisch Enthält nützliche Tipps und Informationen für das Leben in land zu Themen
Wahlprüfsteine Was tun für die Alphabetisierung?
 Wahlprüfsteine 2013 Was tun für die Alphabetisierung? Der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung bringt sich auch im Wahljahr 2013 ein und fragte bei den Parteien ihre politische Positionen ab.
Wahlprüfsteine 2013 Was tun für die Alphabetisierung? Der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung bringt sich auch im Wahljahr 2013 ein und fragte bei den Parteien ihre politische Positionen ab.
