Prüfungsfragen Ingenieurhydrologie (Stand: März 2011)
|
|
|
- Thilo Braun
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Prüfungsfragen Ingenieurhydrologie (Stand: März 2011) 1.Einführung 1) Wasserbilanz (a) Geben Sie die Wasserbilanzgleichung für ein Einzugsgebiet an und beschreiben Sie die einzelnen Terme. Unter welchen Voraussetzungen kann man den Speicherterm vernachlässigen? (b) Was ist der Unterschied zwischen dem topographischen, wirksamen und hydrographischen Einzugsgebiet? (c) In welcher Weise hängt die Energiebilanz der Erdoberfläche mit der Wasserbilanz zusammen? (5P) 2) Aufgaben der Ingenieurhydrologie (a) Geben Sie 2 typische Aufgaben der Ingenieurhydrologie in Zusammenhang mit Hochwasser an. Beschreiben Sie kurz die Fragestellung mit Skizze. (b) Geben Sie 2 typische Aufgaben der Ingenieurhydrologie in Zusammenhang mit Grundwasser an. Beschreiben Sie kurz die Fragestellung mit Skizze. (c) Was sind Eingriffe in den Abflussvorgang? (5P) 3) Aufgaben der Ingenieurhydrologie Beschreiben sie die Vorgangsweise bei den drei untenstehenden Ingenieuraufgaben. Machen Sie für jeden Schritt eine schematische Skizze. Geben Sie jeweils den Namen einer Methode zur Lösung des Teilschrittes an (z.b.: "Muskingum Verfahren" zur Beschreibung des Wellenablaufs im Gerinne). (a) Hydrologische Dimensionierung eines Dammes oder einer Brücke. 10P (b) Bestimmung des Potentials der Wasserversorgung aus Grundwasser. 10P (c) Analyse der Zulässigkeit von Einleitungen bzw. Entnahmen (Bäche und Flüsse). 5P 4) Auswirkung von Eingriffen in den Abflussvorgang (a) Welche Eingriffe kann man mit Mitteln der Ingenieurhydrologie untersuchen (2 Eingriffe)? (5P) (b) Beschreiben Sie die Vorgangsweise mit Skizzen. (c) Welche Eingangsdaten sind jeweils notwendig. Woher erhalten Sie in Österreich die jeweiligen Eingangdaten? 5) Wasserbilanz (a) In einem Einzugsgebiet (A E = 50 km²) beträgt der Mittelwert des Jahresniederschlages für die Periode N=1200mm. Der mittlere Abfluss in der gleichen Periode beträgt 0,64 m³/s. Wie groß ist die mittlere Verdunstung? (b) Welche Annahme muss bei dieser Berechnung getroffen werden? (5P) (c) Bei einem Ereignis in diesem Gebiet wird eine Niederschlagshöhe (h N ) von 23 mm registriert. Welcher Niederschlagsvolumen entspricht dies für das gesamte Einzugsgebiet? 6) Niederwasser Eine Stadt an einem Fluss soll eine neue Kläranlage bekommen. Zur Berechnung der Konzentration des BSB5 nach der Einleitung wird das Q 95 benötigt. (a) Was ist mit Q 95 gemeint? (5P) (b) Wie wird es bestimmt, wenn lange Zeitreihen des Abflusses zur Verfügung stehen? (mit Skizze) (c) Wie wird es bestimmt, wenn keine Zeitreihen des Abflusses zur Verfügung stehen? (mit Skizze) 1
2 2.Niederschlag 1) Niederschlag (a) Was gibt eine Regenspendenlinie an? Wie wird sie ermittelt? Wofür wird sie verwendet? (b) Zeichen Sie schematisch die Regenspendenlinien für ein Gebiet im Osten Österreichs und ein Gebiet im Bundesland Salzburg. Wodurch unterscheiden sich die beiden Regenspendenlinien? (5P) (c) Wie kann man aus den Regenspendenlinien den Bemessungsniederschlag für ein Einzugsgebiet erhalten? 2) Niederschlag (a) Was sind Regenspendenlinien? Skizzieren Sie eine Regenspendenlinie für eine bestimmte Station mit Beschriftung der Achsen und Dauerstufen. 10P (b) Beschreiben und skizzieren Sie die Berechnung von Regenspendenlinien jeweils getrennt für Orte mit und ohne Niederschlagsmessungen. Was ist die Datenbasis? 10P (c) Wofür werden Regenspendenlinien verwendet? Geben Sie zwei Anwendungsbeispiele an einschließlich des Gesamtablaufes der Berechnungsschritte. 5P 3) Niederschlagsmessung (a) Was ist ein Ombrometer, ein Ombrograph, ein Totalisator? Skizzieren Sie das Ombrometer und den Totalisator und beschreiben Sie die Funktionsprinzipien. (b) Welche Messprinzipien existieren bei Ombrographen (Skizze + Beschreibung)? (c) Welche Faktoren können die Genauigkeit von Niederschlagsmessungen beeinträchtigen? (5P) 4) Niederschlag Zur Berechnung eines Bemessungshochwassers mit Hilfe eines Niederschlag-Abfluss- Modells für einen Zubringer der Steyr Einzugsgebiet mit 5700 ha Fläche werden Angaben über die 100-jährlichen Regenhöhen für Bezugsdauern von D=3h bis 24h benötigt. (a) Welche Möglichkeiten bestehen zur Beschaffung dieser Information? (b) Für welche wasserbaulichen Planungen dienen Regenreihen als Bemessungsgrundlage? (5P) (c) Bei einem Ereignis in diesem Gebiet wird eine Niederschlagshöhe (h N ) von 23 mm registriert. Welchem Niederschlagsvolumen entspricht dies für das gesamte Einzugsgebiet? (5P) 5) Niederschlag, Verdunstung (a) Wodurch unterscheidet sich ein Flächenabminderungsfaktor bei advektiven und konvektiven Ereignissen? Warum? (b) Ist die Verdunstung bei feuchtem oder trockenem Boden größer? Warum? (5P) (c) Was wird zum Aufstellen einer Bilanzgleichung benötigt? 3.Wasser im Boden 1) Wasser im Boden (a) Zeichnen Sie ein typisches Vertikalprofil für Wassergehalt, Druck und Potential des Bodenwassers bis zum Grundwasser. Begründen Sie in Stichworten die von Ihnen gewählte Form. (b) Aus welchen Teilen setzt sich das Gesamtpotential zusammen? (5P) (c) In Punkt A beträgt die Saugspannung 360 cm, im Punkt B 230 cm. Berechnen Sie das Potential in den Punkten A und B A über Bezugsniveau z=0. Bewegt sich das Bodenwasser von A 50 nach B oder von B nach A? Warum? Längenangabe in der B z Skizze in cm. 30 2
3 2) Gesättigte - Ungesättigte Bodenzone (a) Erläutern Sie die Begriffe "Grundwasserzone" und "Bodenfeuchtezone". (5P) (b) Stellen Sie den Verlauf von Sättigungsgrad und Druckverhältnissen in einem schematischen Bodenprofil zwischen der Geländeoberkante und dem Grundwasserspiegel für zwei Situationen dar: (i) nach längerer Trockenheit, (ii) während einer Niederschlagsperiode (c) Durch welche Mechanismen wird der Wassertransport in der gesättigten bzw. ungesättigten Bodenzone bewirkt? 3) Gesättigte - Ungesättigte Bodenzone Welche Arten von Porosität können bei Lockersedimenten und Festgesteinen unterschieden werden? (5P) Was versteht man unter Makroporen? Welche Bedeutung haben sie für die Wasserbewegung im Boden? Was ist die Saugspannungskurve (mit Skizze)? 4) Saugspannungskurve Was wird durch die Saugspannungskurve beschrieben? Fertigen Sie eine Skizze mit Achsenbeschriftung an. Ist die Saugspannung im trockenen oder im feuchten Boden größer? Warum? Was bedeuten die Begriffe Feldkapazität und Permanenter Welkepunkt? (5P) 5) Saugkerze, Ungesättigte Zone Was ist eine Saugkerze? Wofür dient Sie? Erklären Sie das Funktionsprinzip einer Saugkerze mit Skizze Weshalb sind Messungen mit einer Saugkerze für die Ingenieurhydrologie relevant? (5P) Welche Form hat das Gleichgewichtsprofil über einer Grundwasseroberfläche? Warum? 6) Bodenwasserpotential (a) Wann existiert ein Bodenwasserpotential? Erklären Sie Ihre Antwort mit Skizze. (b) Zeichnen und beschriften Sie die Komponenten des Bodenwasserpotentials für einen Punkt in der gesättigten Zone. (c) Zeichnen und beschriften Sie die Komponenten des Bodenwasserpotentials für einen Punkt in der ungesättigten Zone. 7) Darcy sches Gesetz (a) Was ist das Darcy sches Gesetz? Geben Sie die Formel an. Warum besitzt die Gleichung ein negatives Vorzeichen? (b) Fertigen Sie eine Skizze des Darcy Versuches an (mit Beschriftung). (c) Welche Praktischen Nutzen hat die Verwendung des Darcy schen Gesetzes in Vektorform für die Analyse von Grundwassersystemen? (5P) 8) Bodenwasserpotential (a) Die Wasserbewegung im Boden folgt dem Potentialgradienten und kann je nach Größe der Komponenten des Potentials nach oben oder nach unten erfolgen. Geben Sie die Gleichung an, die diesen Sachverhalt beschreibt. (b) Aus welchen Komponenten besteht das Potential? Wie kann man diese Komponenten berechnen? (5P) (c) Skizieren sie die Komponenten des Potentials und zeigen Sie zwei Situationen in denen die Wasserbewegung im Boden nach oben bzw. nach unten erfolgt. 3
4 4.Grundwassersysteme 1) Grundwasser (a) Beschreiben Sie die einzelnen Terme und Variablen der Grundwasserströmungsgleichung. Von welchen Grundgleichungen ist sie abgeleitet? (b) Für welche Situationen ist die Grundwasserströmungsgleichung gültig? (5P) Ss W = + x y z k t k Zeichen Sie den Schichtenplan jeweils für - Exfiltration von Grundwasser in ein Oberflächengewässer - Infiltration von Oberflächenwasser in das Grundwasser - Entnahme (c) Geben sie in den Schichtenlinien mittels Pfeilen die Fließrichtung an. 10P 2) Grundwasser Was versteht man unter freiem Grundwasser, gespanntem Grundwasser und Grundwasserstockwerke? (5P) Welche Randbedingungen existieren für das Grundwasser (mit Skizze) Mit welchen Methoden kann der Grundwasserspiegel gemessen werden (mit Skizze)? 3) Grundwasser (a) Was ist ein Pumpversuch? Wofür dient er? Erklären Sie die Vorgangsweise mit Skizze. (b) Die hydraulische Durchlässigkeit bei Sättigung in einem Kies beträgt ca m/s, in einem Feinsand ca m/s. Wie wirkt sich dieser Unterschied auf die Messgrößen bei einem Pumpversuch aus? Wie wirkt sich dieser Unterschiede aus auf die Leistungsfähigkeit eines Wasserversorgungsbrunnens in einem kiesigen bzw. sandigen Aquifer? Die (einfachste) Gleichung für die Auswertung von Pumpversuchen lautet Q r2 k ln 2H πs1 s2 r1 (c) Welche Annahmen und Grundgleichungen liegen dieser Gleichung zugrunde? (5P) 4) Potential der Wasserversorgung aus Grundwasser Für einen Porengrundwasserleiter soll untersucht werden, ob er sich in Hinblick auf die Wassermenge zur Nutzung für die Wasserversorgung der Gemeinde A eignet. Insbesondere soll die maximale Entnahmemenge aus dem Grundwasserleiter unter Einhaltung der zulässigen Grundwasserabsenkung und Berücksichtigung anderer Nutzungen bestimmt werden. (a) Beschreiben Sie die einzelnen Schritte der Vorgangsweise im Detail mit Skizzen. (b) Geben Sie für jede der Schritte konkrete Verfahren an (mit Skizzen und Erklärung). Welche Daten werden jeweils benötigt? (c) Welche Gleichungen liegen den Verfahren zugrunde? (5P) 5) Grundwasser Zur Dimensionierung eines Schutzgebietes eines Brunnens zur Trinkwasserversorgung ist die 60-Tages-Grenze zu bestimmen. (a) Was versteht man unter diesem Begriff? (5P) (b) Wie wird die entsprechende Entfernung ermittelt? Welche Information wird dafür benötigt? (c) Wie kann die Geschwindigkeit des Grundwassers bestimmt werden? (Messung und Berechnung) 4
5 6) Grundwasser (a) Die Wasserbewegung in einem Grundwasserleiter wird durch das Darcy sche Gesetz beschrieben.wie lautet dieses Gesetz? Welche Größen kommen darin vor und welche Bedeutung haben diese? (b) Für ein Grundwassergebiet liegt ein Grundwasserschichtenplan vor. Mit Hilfe dieses Planes ist abzuschätzen, woher das Grundwasser kommt und wohin es fließt. Wie gehen Sie dabei vor? (c) Was ist die theoretische Basis für Ihre Vorgangsweise? (5P) 7) Grundwasser Von einem Grundwasserleiter sind die folgenden mittleren Größen bekannt: Gefälle=0,22, Porosität = 30%, Durchlässigkeitsbeiwert: k f = m/s, Mächtigkeit = 15m, Breite des Grundwasserstroms = 2,5km, Länge = 12 km, Flurabstand = 2m. Innerhalb des Gebietes soll ein Brunnen errichtet werden. (a) Berechnen Sie den gesamten mittleren Grundwasserdurchfluß für diesen Grundwasserleiter. (b) Innerhalb der Fläche, in der die Fließzeit zum Brunnen weniger als 60 Tage beträgt (60 Tage Grenze) besteht das Verbot, organische Dünger aufzubringen. Wie weit erstreckt sich diese Grenze grundwasserstromaufwärts vom Brunnen gerechnet? (c) Was ist die theoretische Basis für Ihre Vorgangsweise? (5P) 5. Infiltration 1) Infiltration (a) Geben Sie die wichtigsten Einflussfaktoren für die Infiltration an. In welcher Weise wirken sie (d.h. erhöhen oder vermindern sie die Infiltration; erhöhen oder vermindern sie den Oberflächenabfluss)? (b) Wie kann man die Infiltration an einem Standort messen? (Skizze mit Beschriftung und Erklärung der Funktionsweise) (5P) (c) Berechnen Sie nach dem Green-Ampt Verfahren, unter der Annahme, dass die Niederschlagsintensität zeitlich konstant und größer als die Infiltrationsrate ist, nach welcher Zeit 40 mm Wasser infiltriert sind und wie groß die Infiltrationsrate nach dieser Zeit ist. Bodenparameter : k=3mm/h i = 0,1 s = 0,4 = -100mm Anm.: Green Ampt Gleichung: F t F t ψδθ ln 1 k t ψδθ 2) Richards Gleichung (a) Beschreiben Sie die einzelnen Terme der Richards Gleichung. Was stellen die Terme physikalisch dar? Für welche Situationen ist die Gleichung gültig? Θ k t z ψ z Θ 1 (b) Wie hängt k() ab und geben Sie eine plausible Erklärung dafür (mit Skizze). (5P) (c) Was ist das Gleichgewichtsprofil über einer Grundwasseroberfläche? Leiten Sie die Gleichung dafür aus der Richards Gleichung ab. 3) Infiltration (a) Erklären Sie den Infiltrationsversuch (mit Skizze). Was ist der Zweck der Doppelringanordnung? (b) Was sind die Annahmen des Green Ampt Verfahrens? (5P) (c) Berechnen Sie nach dem Green-Ampt Verfahren, unter der Annahme, dass die Niederschlagsintensität zeitlich konstant und größer als die Infiltrationsrate ist, nach welcher Zeit 40 mm Wasser infiltriert sind und wie groß die Infiltrationsrate nach dieser Zeit ist. Bodenparameter : k=3mm/h i = 0,1 s = 0,4 = -100mm Anm.: Green Ampt Gleichung: F t F t ψδθ ln 1 k t ψδθ 5
6 4) Infiltration (a) Geben Sie die Voraussetzungen für das Green-Ampt Modell an. 10P F t F t ψδθ ln 1 k t df ψδθ F ψδθ f k dt F (b) Ein Boden hat die Eigenschaften: k=5mm/h, i=0,1, s=0,4, = 100mm. Nach welcher Zeit sind 35 mm Wasser infiltriert wenn die Niederschlagintensität immer größer als die Infiltrationsrate ist? 10P (c) Wie groß ist die Infiltrationsrate nach dieser Zeit? 5P 6.Abflussbildung 1) Dauerlinie (a) Was gibt eine Dauerlinie an? Was ist sie statistisch gesehen? Wie wird sie ermittelt? Zeichnen Sie schematisch die Dauerlinien für einen alpinen Fluss und einen Tieflandfluss. (b) Wie ist das Q95 definiert? Wofür wird es verwendet? (5P) (c) Wie wird das Q95 an Stellen mit Abflussmessungen ermittelt? Wie wird das Q95 an Stellen ohne Abflussmessungen ermittelt? 2) Abflussmessung (a) Was ist ein Pegelschlüssel? Wofür dient er und wie erhält man ihn? Beschreiben Sie die Teilschritte mit Skizze. Welche Unsicherheiten des Pegelschlüssels treten auf und wodurch werden sie bewirkt? (b) Erklären Sie die Funktionsweise eines ADCP mit Skizze. Wofür verwendet man ihn und welche Messgrößen erhält man? Was sind die Vor- und Nachteile gegenüber alternativen Methoden? (5P) (c) Wer erhebt in Österreich hydrologische Daten? Wie erhält man sie? Welche Datenarten werden publiziert und wo? 3) Abflussbildung (a) Bei der Abflussbildung am Hang unterscheidet man Horton-Oberflächenfließen, Zwischenabfluss, Sättigungsflächenabfluss, Makroporenabfluss und Grundwasserabfluss. Wodurch unterscheiden sich diese Mechanismen? Welche Mechanismen erzeugen kleinere/größere Abflüsse? Bei welchen Bodeneigenschaften und Niederschlagseigenschaften sind welche Mechanismen bevorzugt zu erwarten? (b) Wie ist der Ereignisabflussbeiwert definiert? Wofür wird es verwendet? (c) Was ist ein Pegelschlüssel? (5P) 4) Abfluss (a) Was versteht man unter Abflussregimetypen? Welche Typen existieren in Österreich? (b) Beschreiben Sie die Funktionsweise eines Venturikanals. (5P) (c) Wie kann man den Ereignisabflussbeiwert an Stellen mit Abflussmessungen ermitteln? Wie wird kann man den Ereignisabflussbeiwert an Stellen ohne Abflussmessungen ermitteln? 5) Abflussmessung (a) An einem großen Fluss sind Durchflussmessungen zu organisieren. Welches Messverfahren schlagen Sie vor? Was ist zu messen? Wie erfolgt die Auswertung? (b) Was ist ein Pegelschlüssel und wieso ist er notwendig? (5P) (c) Erläutern Sie das Prinzip der Durchflussmessung nach der Verdünnungsmethode. Was wird gemessen? Wie erfolgt die Auswertung? Für welche Vorfluter würden Sie die Verdünnungsmethode verwenden? 6
7 6) Rechenbeispiel Dreieckswelle (a) Für ein Einzugsgebiet (Fläche A E = 12 km²) soll in vereinfachter Form der Hochwasserscheitel aus dem Niederschlag bestimmt werden. Der maßgebende Ereignisniederschlag beträgt 45mm. Der Flächenabminderungsfaktor für den Niederschlag beträgt 0,8. Die Dauer der Abflusswelle soll mit 8 Stunden angenommen werden. Die Form der Hochwasserwelle soll als Dreieck angenähert werden. Wie groß ist der Scheiteldurchfluss der Welle? (b) Welche Komponenten der Berechnung beziehen sich auf die Abflussbildung, welche auf die Abflusskonzentration? (5P) (b) Was versteht man unter Direktabfluss, Basisabfluss und Abflussbeiwert? 7) Abfluss (a) Welche Annahmen liegen dem SCS Kurvennummernverfahren (CN) zugrunde? Was sind die Eingangsdaten für die Anwendung des Verfahrens, was ist das Ergebnis? (10 P) (b) Wie wird die Vorbefeuchtung bei SCS Kurvennummernverfahren berücksichtigt? (5P) (c) Was versteht man unter Abflussbildung, was versteht man unter Abflusskonzentration? 7.Abflusskonzentration 1) Flutplanverfahren (a) Was ist das Flutplanverfahren? Wofür dient es? (5P) Beschreiben Sie die Arbeitsschritte bei dem Verfahren. Für ein Einzugsgebiet von 3 km² im Raum Wien ist der 100 jährliche Scheitelabfluss mittels Flutplanverfahrens zu berechnen. Das Einzugsgebiet besteht vorwiegend aus Wiese. Die Konzentrationszeit beträgt 30 Minuten. Anm.: Scheitelabflussbeiwert Wiese städtisch: as = 0,49 Bemessungsniederschlag (tb = 30min,T = 100) hn = 44,8mm Flächenabminderungsfaktor ARF = 0,8 2) Einheitsganglinie (UH) (a) Geg: Effektivniederschlag i 1 =0.3, i 2 =0.8; UH u 1 =4.5, u 2 =12.0, u 3 =8.3, u 4 =2.2 Berechnen Sie die Direktabflussganglinie. (15P) (b) Geben Sie die Annahmen für das Einheitsganglinienverfahren an. (5P) (c) Für ein Ereignis sind Niederschlagsmessungen und der UH vorhanden. Welche zusätzliche Information ist notwendig, um die Direktabflussganglinie zu berechnen? Welche zusätzliche Information ist notwendig, um die Abflussganglinie zu berechnen? (5P) 3) Zeitflächendiagramm (a) Für ein Einzugsgebiet soll ein Zeitflächendiagramm aufgestellt werden. Welche Schritte hat die Bearbeitung zu umfassen? (b) Wie können die bei der Aufstellung des Zeitflächendiagramms benötigten Laufzeiten ermittelt werden? (c) Aus welchen Teilschritten setzt sich die Abflussganglinienermittlung mittels eines Isochronenmodells zusammen? Wie können quantitative Angaben über den Speicherkoeffizienten erhalten werden? (5P) 4) Unit Hydrograph Was sind die Eingangsdaten für die Anwendung des Einheitsganglinienverfahrens. Was sind die Ergebnisse? Für welche Anwendungen der Ingenieurhydrologie wird das Einheitsganglinienverfahren verwendet. (5P) Was sind die dem Einheitsganglinienverfahren zugrunde liegendem Annahmen? 7
8 8.Abfluss im Gerinne und Wellenablauf 1) Ablauf von Hochwasserwellen im Gerinne (a) Geben Sie drei Einflussfaktoren auf den Ablauf von Hochwasserwellen im Gerinne an und beschreiben Sie ihre Wirkungsweise Wodurch wird die Retention einer Hochwasserwelle im Gerinne bzw. Vorland bestimmt? Machen Sie eine Skizze und beschriften Sie die zugehörigen Volumina. Was versteht man unter der Hysterese in der Durchfluss-Wasserstands-Beziehung (mit Skizze)? (5P) 2) Wellenablauf im Gerinne (a) Für den Wellenablauf im Gerinne gibt es zwei Gruppen von Verfahren. Welche sind das? Beschreiben Sie für jede der beiden Gruppen die Vor- und Nachteile. Für welche Aufgaben werden die beiden Gruppen jeweils eingesetzt? (b) Geben Sie für jede der beiden Gruppen ein Beispiel für ein Verfahren an und beschreiben Sie die Funktionsweise beider Beispiele (mit Skizze). dv v v v (c) Erklären Sie die Gleichheit dt t x mit einem Beispiel. (5P) 3) Kinematische Welle (a) Berechnen Sie die Wassergeschwindigkeit v und die kinematische Wellengeschwindigkeit c für ein Rechtecksprofil mit Breite B = 60m, einer Neigung I s = 1% und einer Stricklerrauhigkeit k ST =28, wenn der Durchfluß Q= 120m 3 /s beträgt. Was ist größer, die Wellengeschwindigkeit oder die Wassergeschwindigkeit? (20P) 2 / 3 1/ 2 Anm.: Rauhigkeitsansatz: v kst h I s dq 1 dq c Kinematische Wellengeschwindigkeit an einem Punkt: da B dh (b) Für welche Fragestellungen des Bauingenieurwesens dient diese Berechnung? (5P) 4) Abfluss im Gerinne (a) Zeichnen und beschreiben Sie die Wasserstands-Durchflussbeziehung bei Durchgang einer Hochwasserwelle. (b) Welche Parameter bzw. Daten sind für die Lösung der St.Venant'schen Gleichungen erforderlich? (5P) (c) Was ist eine Linearspeicherkaskade? Was sind die Eingangsgrößen, was das Ergebnis, was sind die Modellparameter und wie werden letztere bestimmt? 5) Abfluss im Gerinne (a) Geben Sie die zwei Verfahrenstypen zur Beschreibung des Abflusses im Gerinne an. Wofür werden sie verwendet? Wann wendet man das eine, wann das andere an? (b) Welche Lösungsverfahren für die St.Venant'schen Gleichungen existieren? (5P) (c) Was ist das Muskingum Verfahren? Was sind die Eingangsgrößen, was das Ergebnis, was sind die Modellparameter und wie werden letztere bestimmt? Abfluss im Gerinne (a) Beschreiben Sie die einzelnen Terme und Variablen der St. Venant'schen Gleichungen. A Q t x 0 v v v g h g( Ie Is ) t x x 0 Auf welchen Erhaltungssätzen basieren sie? (b) Unter welchen Annahmen sind die eindimensionalen St. Venant'schen Gleichungen gültig? (5P) 8
9 dv v v v (c) Warum ist dt t x? Geben Sie ein Beispiel an, um diese mathematische Identität zu verdeutlichen. Wellenablauf (a) Wofür dient das Muskingum-Verfahren? Geben Sie eine Ingenieuranwendung des Verfahrens an. (b) Beschreiben Sie die Parameter in der folgenden Speicherbeziehung. Was bedeuten sie? S( t) KXQZ ( t) 1 X QA ( t) (5P) (c) Wie erhält man K und X? Beschreiben Sie ein Verfahren zur Bestimmung von K und X (Skizze). 9.Hochwasser- und Niederwasserstatistik 1) Bemessungshochwasser (a) Auf welcher Basis wird die Jährlichkeit des Bemessungshochwassers gewählt? Geben Sie Beispiele an und zeichnen Sie ein Skizze der grundsätzlichen Überlegungen dazu. (5P) Was ist eine Verteilungsfunktion? Wofür dient Sie? Wie wird sie an die Stichprobe angepasst? Geben Sie ein Beispiel an. (5P) Was versteht man unter dem hydrologischen Risiko? Wofür dient es? Geben Sie ein Anwendungsbeispiel aus dem Bauingenieurwesen an. (5P) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein 100-jährliches Ereignis in 2 Jahren mindestens 1 mal auftritt oder überschritten wird? Erklären Sie die Vorgangsweise graphisch. 2) Hochwasserstatistik (a) Berechnen Sie das HQ 30 für die untenstehende jährliche Reihe von Hochwasserscheiteln mittels graphischer Auftragung der empirischen Jährlichkeiten und visueller Anpassung der Verteilungsfunktion. Jahreshöchstwerte des Durchflusses am Pegel Mitterbach (Einzugsgebietsfläche 30 km²) in den Jahren : 2,7; 4,5; 4,5; 8,2; 4,1; 4,1; 4,5; 4,7; 5,1; 6,1; 4,5; 6,7; 5,7; 17,0; 8,7; 7,0; 4,0; 6,6; 10,6; 20,0; 0,5 (Angaben in m³/s). (b) Die Bauumleitung einer Wasserbaustelle in der Nähe des Pegels Mitterbach soll auf ein 5 jährliches Hochwasser ausgelegt werden. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Baustelle mindestens einmal geflutet wird, wenn die Bauzeit drei Jahre beträgt. (c) Wofür wird die Index-Flood Methode verwendet? (5P) 3) Hochwasserstatistik (a) Berechnen Sie das HQ 30 für die untenstehende jährliche Reihe von Hochwasserscheiteln mittels graphischer Auftragung der empirischen Jährlichkeiten und visueller Anpassung der Verteilungsfunktion. Jahreshöchstwerte des Durchflusses am Pegel Wienerbruck (Einzugsgebietsfläche 36 km²) in den Jahren : 8,8; 18,3; 12,1; 14,9; 19,1; 17,9; 10,4; 17,2; 10,3; 16,2; 13,6; 46,4; 15,0; 74,2; 42,2; 17,2; 15,0; 21,5; 39,4; 79,9 (Angaben in m³/s). (b) Die Bauumleitung einer Wasserbaustelle in der Nähe des Pegels Wienerbruck soll auf ein 10 jährliches Hochwasser ausgelegt werden. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Baustelle mindestens einmal geflutet wird, wenn die Bauzeit drei Jahre beträgt. (c) Wofür wird die Index-Flood Methode verwendet? (5P) 9
10 4) Hochwasserstatistik (a) Was versteht man unter den folgenden Begriffen (definieren Sie jeweils): Stichprobe, Grundgesamtheit, Häufigkeitsverteilung Summenhäufigkeit, Dichtefunktion, Verteilungsfunktion. (b) Die Bauumleitung einer Wasserbaustelle soll auf ein 3 jährliches Hochwasser ausgelegt werden. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Baustelle mindestens einmal geflutet wird, wenn die Bauzeit drei Jahre beträgt. (c) Wofür wird die Index-Flood Methode verwendet? 5P 5) Hochwasserstatistik (a) Was versteht man unter den folgenden Begriffen (definieren Sie jeweils): Stichprobe, Grundgesamtheit, Häufigkeitsverteilung Summenhäufigkeit, Dichtefunktion, Verteilungsfunktion. (b) Wofür werden Historische Hochwässer verwendet. Worauf ist zu achten? Ich welcher Weise können Sie einbezogen werden. Geben Sie ein Bespiel mit Zahlenwerten an. (5P) (c) Hydrologisches Risiko. Was ist das, wofür wird es verwendet, wie wird es berechnet? 7) Hochwasserstatistik (a) Welche Arten der Parameterschätzung gibt es? Auf welchen Annahmen und Grundsätzen bauen sie auf? (b) Erklären Sie den Unterschied zwischen Stichprobe und Grundgesamtheit und den Vorgang der statistischen Schätzung. (c) Wie geht man mit Ausreißern um? (5P) 8) Hochwasserstatistik (a) Welche Annahmen liegen der Momentenmethode zur statistischen Parameterschätzung zugrunde? Wann sind sie gerechtfertigt, wann nicht? (b) Geben Sie in Worten die Definition des Niederwasserdurchflusses Q95 wieder. (c) Was ist der Unterschied zwischen einer jährlichen und einer partiellen Reihe? Bei welcher Reihe sind die Jährlichkeiten bei gleichem Durchfluss größer? (5P) 9) Hochwasserstatistik (a) Beschreiben Sie die fünf Schritte der Hochwasserstatistik. Bei welchen dieser Schritte ist eine "Experteneinschätzung" notwendig und in welcher Hinsicht? 10P (b) Beschreiben Sie das Konzept der Maximum Likelihood Methode. Wofür wird sie verwendet? 5P (c) Stichprobe Grundgesamtheit. Geben Sie jeweils die Definition an. Wie kann man sie in Beziehung setzen? Warum muss man sie in Beziehung setzen? 10P 10.Regionale Methoden 1) Regionale Methoden (a) Was versteht man unter Hochwasserlängenschnitt, Hüllkurve, Hochwasserspendendiagramm,? (b) Beschreiben Sie die vier Verfahren mit Skizze. Wofür dienen sie jeweils? Was ist eine Dauerlinie und wie kann man sie an Gewässerstellen ohne Abflussmessungen bestimmen? (5P) 2) Regionale Methoden (a) Was sind die Annahmen der Index-Flood Methode?(5P) (a) Was sind Hochwassspendendiagramme und was sind Hüllkurven? (5 P) (b) Wofür dienen sie? Welche Vorraussetzung für ihre Anwendung sollen vorliegen? (10 P) 10
Prüfungsfragen Ingenieurhydrologie (Stand: März 2012)
 Prüfungsfragen Ingenieurhydrologie (Stand: März 2012) 1.Einführung 1) Wasserbilanz (a) Geben Sie die Wasserbilanzgleichung für ein Einzugsgebiet an und beschreiben Sie die einzelnen Terme. Unter welchen
Prüfungsfragen Ingenieurhydrologie (Stand: März 2012) 1.Einführung 1) Wasserbilanz (a) Geben Sie die Wasserbilanzgleichung für ein Einzugsgebiet an und beschreiben Sie die einzelnen Terme. Unter welchen
VO Ingenieurhydrologie SS2014 Fragenkatalog
 VO Ingenieurhydrologie SS2014 Fragenkatalog Kap. 1 Einführung 1) Was versteht man unter Wasserkreislauf? Unter Wasserkreislauf versteht man den Prozess von Niederschlag, Abfluss und Verdunstung. 2) Was
VO Ingenieurhydrologie SS2014 Fragenkatalog Kap. 1 Einführung 1) Was versteht man unter Wasserkreislauf? Unter Wasserkreislauf versteht man den Prozess von Niederschlag, Abfluss und Verdunstung. 2) Was
Themen der Übung im Sommersemester 2007
 1 Themen der Übung im Sommersemester 2007 1. Auswertung von Niederschlagsmessungen, Abflusskurve 2. Verfahren zur Ermittlung der Verdunstung 3. Aufstellen und Berechnen von Wasserbilanzen 4. Einführung
1 Themen der Übung im Sommersemester 2007 1. Auswertung von Niederschlagsmessungen, Abflusskurve 2. Verfahren zur Ermittlung der Verdunstung 3. Aufstellen und Berechnen von Wasserbilanzen 4. Einführung
BODEN- UND GRUNDWASSER
 BODEN- UND GRUNDWASSER 1. AUFGABE Gegeben ist ein Boden- und Grundwasserkörper mit folgenden Eigenschaften: k f -Wert : 10-3 m/s Porosität: 19 % Gefälle: 3,5 %o Flurabstand: 4 m In der ungesättigten Zone
BODEN- UND GRUNDWASSER 1. AUFGABE Gegeben ist ein Boden- und Grundwasserkörper mit folgenden Eigenschaften: k f -Wert : 10-3 m/s Porosität: 19 % Gefälle: 3,5 %o Flurabstand: 4 m In der ungesättigten Zone
NIEDERSCHLAG. Hausübung 1
 Hausübung 1 NIEDERSCHLAG Abgabe: 25.10.2017 Niederschlag wird nahezu weltweit mit einem Netz von Messstationen erfasst. Dabei handelt es sich um punktuelle Messungen. Für grundlegende Fragen der Ingenieurhydrologie
Hausübung 1 NIEDERSCHLAG Abgabe: 25.10.2017 Niederschlag wird nahezu weltweit mit einem Netz von Messstationen erfasst. Dabei handelt es sich um punktuelle Messungen. Für grundlegende Fragen der Ingenieurhydrologie
Hydrologie und Flussgebietsmanagement
 Hydrologie und Flussgebietsmanagement o.univ.prof. DI Dr. H.P. Nachtnebel Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiver Wasserbau Gliederung der Vorlesung Statistische Grundlagen Extremwertstatistik
Hydrologie und Flussgebietsmanagement o.univ.prof. DI Dr. H.P. Nachtnebel Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiver Wasserbau Gliederung der Vorlesung Statistische Grundlagen Extremwertstatistik
Matrikelnummer: Studiengang:
 Seite 1 Name: Vorname: Fachbereich: Seite 1 BI WI/BI Matrikelnummer: Studiengang: Diplom Bachelor ERGEBNIS Aufgabe Punktzahl Erreicht 1 5 2 12 3 12 4 8 5 8 6 (15) Summe: 45 (60) NOTE: Seite 2 AUFGABE 1
Seite 1 Name: Vorname: Fachbereich: Seite 1 BI WI/BI Matrikelnummer: Studiengang: Diplom Bachelor ERGEBNIS Aufgabe Punktzahl Erreicht 1 5 2 12 3 12 4 8 5 8 6 (15) Summe: 45 (60) NOTE: Seite 2 AUFGABE 1
IfU Institut für Umweltingenieurwissenschaften. Hydrologie I. - Hausübung 1 -
 Hydrologie I - Hausübung 1 - Gliederung Einführung zu den Hausübungen Motivation Konzept Untersuchungsgebiet Hausübung 1 Charakterisierung des Untersuchungsgebietes (Aufgabe 1) Gebietsniederschlag (Aufgabe
Hydrologie I - Hausübung 1 - Gliederung Einführung zu den Hausübungen Motivation Konzept Untersuchungsgebiet Hausübung 1 Charakterisierung des Untersuchungsgebietes (Aufgabe 1) Gebietsniederschlag (Aufgabe
Statistische Analyse hydrologischer Daten (HW Berechnung)
 Lehrstuhl für Hydrologie und Wasserwirtschaft BTU Cottbus Statistische Analyse hydrologischer Daten (HW Berechnung) Übung zur Hochwasserstatistik Datensatz: jährliche Maximalabflüsse der Spree in Cottbus
Lehrstuhl für Hydrologie und Wasserwirtschaft BTU Cottbus Statistische Analyse hydrologischer Daten (HW Berechnung) Übung zur Hochwasserstatistik Datensatz: jährliche Maximalabflüsse der Spree in Cottbus
Matrikelnummer: Hochwasserentlastungsanlage (HWEA) GRUNDFACHPRÜFUNG WASSER UND UMWELT Wintersemester 2003/2004
 b) Wie ist der unterschiedliche Verlauf der beiden Kurven zu begründen? Nennen Sie den aus hydraulischer Sicht wesentlichen Unterschied der beiden Anlagentypen. c) Erläutern Sie die verschiedenen Phasen
b) Wie ist der unterschiedliche Verlauf der beiden Kurven zu begründen? Nennen Sie den aus hydraulischer Sicht wesentlichen Unterschied der beiden Anlagentypen. c) Erläutern Sie die verschiedenen Phasen
Hydrologie und Flussgebietsmanagement
 Hydrologie und Flussgebietsmanagement o.univ.prof. DI Dr. H.P. Nachtnebel Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiver Wasserbau Wiederholung Statistische Grundlagen Definitionen der statistischen
Hydrologie und Flussgebietsmanagement o.univ.prof. DI Dr. H.P. Nachtnebel Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiver Wasserbau Wiederholung Statistische Grundlagen Definitionen der statistischen
Hydrologie und Flussgebietsmanagement
 Hydrologie und Flussgebietsmanagement o.univ.prof. DI Dr. H.P. Nachtnebel Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiver Wasserbau Gliederung der Vorlesung Statistische Grundlagen Etremwertstatistik
Hydrologie und Flussgebietsmanagement o.univ.prof. DI Dr. H.P. Nachtnebel Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiver Wasserbau Gliederung der Vorlesung Statistische Grundlagen Etremwertstatistik
Anlage 01. Neubewilligung Nordharzverbundsystem
 Harzwasserwerke GmbH - Wasserwirtschaft Antrag auf Neufassung der wasserrechtlichen Bewilligung für das Nordharzverbundsystems Anlage 01 Neubewilligung Nordharzverbundsystem Bericht: Berechnung von Talsperrenzuflussganglinien
Harzwasserwerke GmbH - Wasserwirtschaft Antrag auf Neufassung der wasserrechtlichen Bewilligung für das Nordharzverbundsystems Anlage 01 Neubewilligung Nordharzverbundsystem Bericht: Berechnung von Talsperrenzuflussganglinien
Einführung: Extremwertstatistik in der Hydrologie
 1 Einführung: Extremwertstatistik in der Hydrologie Aufgaben der Extremwertstatistik in der Hydrologie Grundbegriffe Ermittlung der Verteilungsfunktion für hydrologische Extremwerte Anwendung der bekannten
1 Einführung: Extremwertstatistik in der Hydrologie Aufgaben der Extremwertstatistik in der Hydrologie Grundbegriffe Ermittlung der Verteilungsfunktion für hydrologische Extremwerte Anwendung der bekannten
Protokoll zum Unterseminar Geomorphologie vom 10.12.2001
 Unterseminar Geomorphologie Wintersemester 2001/2002 Dr. A. Daschkeit Protokollant: Helge Haacke Protokoll zum Unterseminar Geomorphologie vom 10.12.2001 Fluvialgeomophologie Fluvial ( lat. fluvius = Fluß
Unterseminar Geomorphologie Wintersemester 2001/2002 Dr. A. Daschkeit Protokollant: Helge Haacke Protokoll zum Unterseminar Geomorphologie vom 10.12.2001 Fluvialgeomophologie Fluvial ( lat. fluvius = Fluß
WS 2013/2014. Vorlesung Strömungsmodellierung. Prof. Dr. Sabine Attinger
 WS 2013/2014 Vorlesung Strömungsmodellierung Prof. Dr. Sabine Attinger 29.10.2013 Grundwasser 2 Was müssen wir wissen? um Grundwasser zu beschreiben: Grundwasserneubildung oder Wo kommt das Grundwasser
WS 2013/2014 Vorlesung Strömungsmodellierung Prof. Dr. Sabine Attinger 29.10.2013 Grundwasser 2 Was müssen wir wissen? um Grundwasser zu beschreiben: Grundwasserneubildung oder Wo kommt das Grundwasser
Methoden und Verfahren:
 Ermittlung von Überschwemmungsgebieten : 1. Pegelstatistisches Verfahren (W) oder 2. Hydrologische (Q) und hydraulische (W) Modellierung Ergänzend: Auswertung historischer Hochwasser auf der Grundlage
Ermittlung von Überschwemmungsgebieten : 1. Pegelstatistisches Verfahren (W) oder 2. Hydrologische (Q) und hydraulische (W) Modellierung Ergänzend: Auswertung historischer Hochwasser auf der Grundlage
INSTITUT FÜR GEOÖKOLOGIE
 INSTITUT FÜR GEOÖKOLOGIE Abteilung für Hydrologie und Landschaftsökologie Prof. Dr. M. Schöniger in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Ing. H. Wittenberg UE Hydrologie I Übungszettel 5 Braunschweig, 11.01.05
INSTITUT FÜR GEOÖKOLOGIE Abteilung für Hydrologie und Landschaftsökologie Prof. Dr. M. Schöniger in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Ing. H. Wittenberg UE Hydrologie I Übungszettel 5 Braunschweig, 11.01.05
Versuch der Synthese der Niederschlag- Abflussmodellierung und Hochwasserstatistik
 Versuch der Synthese der Niederschlag- Abflussmodellierung und Hochwasserstatistik (HOWATI Hochwasser Tirol) Magdalena Rogger Institut für Wasserbau und Ingenieurhydrologie Technische Universität Wien
Versuch der Synthese der Niederschlag- Abflussmodellierung und Hochwasserstatistik (HOWATI Hochwasser Tirol) Magdalena Rogger Institut für Wasserbau und Ingenieurhydrologie Technische Universität Wien
LARSIM-Anwenderworkshop
 LARSIM-Anwenderworkshop Neue Optionen für die Simulationen mit LARSIM Kai Gerlinger Ingenieurbüro Dr.-Ing. Karl Ludwig 15. Februar 2007 Optionsübersicht Ingenieurbüro Dr.-Ing. Karl Ludwig 2 Optionsübersicht
LARSIM-Anwenderworkshop Neue Optionen für die Simulationen mit LARSIM Kai Gerlinger Ingenieurbüro Dr.-Ing. Karl Ludwig 15. Februar 2007 Optionsübersicht Ingenieurbüro Dr.-Ing. Karl Ludwig 2 Optionsübersicht
 Dipl.-Ing. P. Guckelsberger Vorrechenübung Brunnenbemessung - SiWaWi-2 Schlagworte: Brunnenfassungsvermögen Q F / Brunnenergiebigkeit Q E / optimale Absenkung s http://www.paulguckelsberger.de/wasserprojekte.htm
Dipl.-Ing. P. Guckelsberger Vorrechenübung Brunnenbemessung - SiWaWi-2 Schlagworte: Brunnenfassungsvermögen Q F / Brunnenergiebigkeit Q E / optimale Absenkung s http://www.paulguckelsberger.de/wasserprojekte.htm
= 100 l/ (s ha). Prüfungsvorbereitung. (min) 5.4. Niederschlagshöhe [mm] min min min Regendauer [min]
![= 100 l/ (s ha). Prüfungsvorbereitung. (min) 5.4. Niederschlagshöhe [mm] min min min Regendauer [min] = 100 l/ (s ha). Prüfungsvorbereitung. (min) 5.4. Niederschlagshöhe [mm] min min min Regendauer [min]](/thumbs/50/26733525.jpg) Prüfungsvorbereitung In Bild 1a ist der zeitliche Verlauf eines Regenereignisses N dargestellt. Charakterisieren Sie das Ereignis nach Niederschlagshöhe [mm], mittlerer Intensität [L/s*ha] und Jährlichkeit
Prüfungsvorbereitung In Bild 1a ist der zeitliche Verlauf eines Regenereignisses N dargestellt. Charakterisieren Sie das Ereignis nach Niederschlagshöhe [mm], mittlerer Intensität [L/s*ha] und Jährlichkeit
Unsicherheiten bei der. Übertragung
 1 Unsicherheiten bei der Hochwasserabschätzung: Messung Extremwertstatistik Übertragung 1. Einführung 2. Abflussmessung 3. Extremwertstatistik 4. Übertragung 5. Situation im Hexental 3 Hochwasser ein
1 Unsicherheiten bei der Hochwasserabschätzung: Messung Extremwertstatistik Übertragung 1. Einführung 2. Abflussmessung 3. Extremwertstatistik 4. Übertragung 5. Situation im Hexental 3 Hochwasser ein
I N G E N I E U R H Y D R O L O G I E
 Fachgebiet Geohydraulik und Fachbereich Bauingenieurwesen Vorlesungsskript I N G E N I E U R H Y D R O L O G I E I Prof. Dr. rer. nat. Manfred Koch Sommersemester 2003 0. Einleitung: Aufgaben und Ziele
Fachgebiet Geohydraulik und Fachbereich Bauingenieurwesen Vorlesungsskript I N G E N I E U R H Y D R O L O G I E I Prof. Dr. rer. nat. Manfred Koch Sommersemester 2003 0. Einleitung: Aufgaben und Ziele
Hohlspiegel. Aufgabennummer: 2_023 Prüfungsteil: Typ 1 Typ 2. Grundkompetenzen: a) AG 2.1, FA 1.8 b) FA 1.7, FA 1.8 c) AG 2.1, FA 1.
 Hohlspiegel Aufgabennummer: 2_023 Prüfungsteil: Typ Typ 2 Grundkompetenzen: a) AG 2., FA.8 b) FA.7, FA.8 c) AG 2., FA.2 keine Hilfsmittel erforderlich gewohnte Hilfsmittel möglich besondere Technologie
Hohlspiegel Aufgabennummer: 2_023 Prüfungsteil: Typ Typ 2 Grundkompetenzen: a) AG 2., FA.8 b) FA.7, FA.8 c) AG 2., FA.2 keine Hilfsmittel erforderlich gewohnte Hilfsmittel möglich besondere Technologie
Grundwasserneubildung
 Grundwasserneubildung Diplom-Geologe Thomas Brons 05.12.2017 Folie 1 Die Grundwasserhydrologie unterscheidet 3 Arten der Neubildung: 2. Die Grundwasserneubildung, bei der das Grundwasser von Flüssen oder
Grundwasserneubildung Diplom-Geologe Thomas Brons 05.12.2017 Folie 1 Die Grundwasserhydrologie unterscheidet 3 Arten der Neubildung: 2. Die Grundwasserneubildung, bei der das Grundwasser von Flüssen oder
Grundwasserhydraulik Und -erschließung
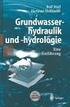 Vorlesung und Übung Grundwasserhydraulik Und -erschließung DR. THOMAS MATHEWS TEIL 5 Seite 1 von 19 INHALT INHALT... 2 1 ANWENDUNG VON ASMWIN AUF FALLBEISPIELE... 4 1.1 BERECHNUNGSGRUNDLAGEN... 4 1.2 AUFGABEN...
Vorlesung und Übung Grundwasserhydraulik Und -erschließung DR. THOMAS MATHEWS TEIL 5 Seite 1 von 19 INHALT INHALT... 2 1 ANWENDUNG VON ASMWIN AUF FALLBEISPIELE... 4 1.1 BERECHNUNGSGRUNDLAGEN... 4 1.2 AUFGABEN...
Alpine Retention von Hochwässern
 Alpine Retention von Hochwässern Günter Blöschl, Jose Luis Salinas, Jürgen Komma, Thomas Nester Rolle der agrartechnischen Fachbereiche im Naturgefahrenmanagement Innsbruck, 20. Oktober 2017 Fragestellung
Alpine Retention von Hochwässern Günter Blöschl, Jose Luis Salinas, Jürgen Komma, Thomas Nester Rolle der agrartechnischen Fachbereiche im Naturgefahrenmanagement Innsbruck, 20. Oktober 2017 Fragestellung
Abitur 2017 Mathematik Infinitesimalrechnung I
 Seite 1 http://www.abiturloesung.de/ Seite 2 Abitur 217 Mathematik Infinitesimalrechnung I Gegeben ist die Funktion g : x 2 4 + x 1 mit maximaler Definitionsmenge D g. Der Graph von g wird mit G g bezeichnet.
Seite 1 http://www.abiturloesung.de/ Seite 2 Abitur 217 Mathematik Infinitesimalrechnung I Gegeben ist die Funktion g : x 2 4 + x 1 mit maximaler Definitionsmenge D g. Der Graph von g wird mit G g bezeichnet.
Ein Auto fährt eine 50 km lange Teststrecke mit konstanter Geschwindigkeit v 0
 c) Der Treibstoffverbrauch eines Autos kann für Geschwindigkeiten zwischen 5 km/h und 13 km/h näherungsweise mithilfe der Funktion f beschrieben werden: f(v) =,42 v 2,38 v + 4,1 mit 5 < v < 13 v... Geschwindigkeit
c) Der Treibstoffverbrauch eines Autos kann für Geschwindigkeiten zwischen 5 km/h und 13 km/h näherungsweise mithilfe der Funktion f beschrieben werden: f(v) =,42 v 2,38 v + 4,1 mit 5 < v < 13 v... Geschwindigkeit
Kombination von statistischen Niederschlagsdaten mit einem realen Ereignis zur Ableitung eines Extremereignisses für Simulationen von Stauanlagen
 Kombination von statistischen Niederschlagsdaten mit einem realen Ereignis zur Ableitung eines Extremereignisses für Simulationen von Stauanlagen Dipl. AUW Natalie Stahl, Sachgebietsleiterin Hochwasservorhersagezentrale
Kombination von statistischen Niederschlagsdaten mit einem realen Ereignis zur Ableitung eines Extremereignisses für Simulationen von Stauanlagen Dipl. AUW Natalie Stahl, Sachgebietsleiterin Hochwasservorhersagezentrale
HYDROLOGISCHE PROGNOSEN
 HYDROLOGISCHE PROGNOSEN REINHOLD GODINA BMLFUW ABTEILUNG IV/4 - WASSERHAUSHALT 3.5.2016 --- 1 --- HYDROLOGISCHE PROGNOSEN - ÜBERBLICK Themen meines Vortrages: 1. DIE HYDROGRAFIE BEOBACHTET PERMANENT 2.
HYDROLOGISCHE PROGNOSEN REINHOLD GODINA BMLFUW ABTEILUNG IV/4 - WASSERHAUSHALT 3.5.2016 --- 1 --- HYDROLOGISCHE PROGNOSEN - ÜBERBLICK Themen meines Vortrages: 1. DIE HYDROGRAFIE BEOBACHTET PERMANENT 2.
FE-Berechnungen in der Geotechnik (SS 2012)
 FE-Berechnungen in der Geotechnik (SS 2012) Sickerströmung: ABAQUS 6.8-1 Beispiel (nach Abaqus 6.8-1; ABAQUS/Documentation) C. Grandas und A. Niemunis KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales
FE-Berechnungen in der Geotechnik (SS 2012) Sickerströmung: ABAQUS 6.8-1 Beispiel (nach Abaqus 6.8-1; ABAQUS/Documentation) C. Grandas und A. Niemunis KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales
Arbeitsweisen der Physik
 Übersicht Karteikarten Klasse 7 - Arbeitsweisen - Beobachten - Beschreiben - Beschreiben von Gegenständen, Erscheinungen und Prozessen - Beschreiben des Aufbaus und Erklären der Wirkungsweise eines technischen
Übersicht Karteikarten Klasse 7 - Arbeitsweisen - Beobachten - Beschreiben - Beschreiben von Gegenständen, Erscheinungen und Prozessen - Beschreiben des Aufbaus und Erklären der Wirkungsweise eines technischen
Diplomarbeit: Modellierung des Austausches zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser mit Hilfe des Umwelttracers Temperatur
 Diplomarbeit: Modellierung des Austausches zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser mit Hilfe des Umwelttracers Temperatur Von Johannes Ahrns Betreuer Prof. Dr.-Ing. Thomas Grischek Dipl.-Ing. Kerstin
Diplomarbeit: Modellierung des Austausches zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser mit Hilfe des Umwelttracers Temperatur Von Johannes Ahrns Betreuer Prof. Dr.-Ing. Thomas Grischek Dipl.-Ing. Kerstin
Veranlassung Aufgabenstellung Wassergewinnung mit Brunnen
 Dipl.-Ing. P. Guckelsberger Vorrechenübung Brunnenbemessung - SiWaWi-2 Schlagworte: Brunnenfassungsvermögen Q F / Brunnenergiebigkeit Q E / optimale Absenkung s zum Skript SiWaWi-2 Eckhardt/Guckelsberger
Dipl.-Ing. P. Guckelsberger Vorrechenübung Brunnenbemessung - SiWaWi-2 Schlagworte: Brunnenfassungsvermögen Q F / Brunnenergiebigkeit Q E / optimale Absenkung s zum Skript SiWaWi-2 Eckhardt/Guckelsberger
Schwall in Österreich Hydrologie Charakterisierung von Schwallwellen
 Schwall in Österreich Hydrologie Charakterisierung von Schwallwellen F. Greimel, B. Zeiringer, S. Schmutz Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement (IHG) Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt (WAU)
Schwall in Österreich Hydrologie Charakterisierung von Schwallwellen F. Greimel, B. Zeiringer, S. Schmutz Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement (IHG) Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt (WAU)
DAS STARKREGENEREIGNIS IM RAUM BAD WALTERSDORF VOM 10. JULI 2001
 1 DAS STARKREGENEREIGNIS IM RAUM BAD WALTERSDORF VOM 10. JULI 2001 Einleitung Am 10. Juli 2001 ereignete sich im Bereich Bad Waltersdorf Waltersdorfbergen ein lokales Unwetterereignis, das in diesem Bericht
1 DAS STARKREGENEREIGNIS IM RAUM BAD WALTERSDORF VOM 10. JULI 2001 Einleitung Am 10. Juli 2001 ereignete sich im Bereich Bad Waltersdorf Waltersdorfbergen ein lokales Unwetterereignis, das in diesem Bericht
1. Workshop Gewässerkunde
 1. Workshop Gewässerkunde ÜSG Berechnungen N-A-Modelle Oldenburg 20.03.2014 Inhalt Einführung Ziele und Modellerstellung Modellaufbau Kalibrierung Hochwasserabflüsse Langzeitsimulation Modellregen Anwendungsbeispiele
1. Workshop Gewässerkunde ÜSG Berechnungen N-A-Modelle Oldenburg 20.03.2014 Inhalt Einführung Ziele und Modellerstellung Modellaufbau Kalibrierung Hochwasserabflüsse Langzeitsimulation Modellregen Anwendungsbeispiele
Übungsblatt 1. a) Wie können diese drei Bereiche weiter unterteilt werden?
 INSTITUT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTIONS- UND INVESTITIONSFORSCHUNG Georg-August-Universität Göttingen Abteilung für Unternehmensplanung Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Bloech Aufgabe. (Produktionsfaktorsystem)
INSTITUT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTIONS- UND INVESTITIONSFORSCHUNG Georg-August-Universität Göttingen Abteilung für Unternehmensplanung Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Bloech Aufgabe. (Produktionsfaktorsystem)
Daraus ergibt sich: Eine Steigerung der Lokal-Magnitude um 1 entspricht einer Verzehnfachung des Ausschlags (denn 10 + M
 Erdbeben Außermathematische Anwendungen im Mathematikunterricht WS 201/15 Franz Embacher, Universität Wien Entstehung von Erdbeben Wird in der Vorlesung besprochen Das Magnituden-System Das bekannteste
Erdbeben Außermathematische Anwendungen im Mathematikunterricht WS 201/15 Franz Embacher, Universität Wien Entstehung von Erdbeben Wird in der Vorlesung besprochen Das Magnituden-System Das bekannteste
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung
 Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Übung 7 1 Inhalt der heutigen Übung Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Vorrechnen der Hausübung D.9 Gemeinsames Lösen der Übungsaufgaben D.10: Poissonprozess
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Übung 7 1 Inhalt der heutigen Übung Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Vorrechnen der Hausübung D.9 Gemeinsames Lösen der Übungsaufgaben D.10: Poissonprozess
Monitoring Wasserwirtschaftliche und hydrologische Grundlagen
 Der Betrieb von Beschneiungsanlagen Monitoring Wasserwirtschaftliche und hydrologische Grundlagen G. Suette 2010 Anknüpfungspunkte Monitoring Klimatologie Wasserwirtschaft Wasserrecht Betriebswirtschaft
Der Betrieb von Beschneiungsanlagen Monitoring Wasserwirtschaftliche und hydrologische Grundlagen G. Suette 2010 Anknüpfungspunkte Monitoring Klimatologie Wasserwirtschaft Wasserrecht Betriebswirtschaft
Grundwassermodell. 4.2 Wasserkreislauf. Einführung: Wir alle kennen den Wasserkreislauf:
 4.2 Wasserkreislauf Einführung: Wir alle kennen den Wasserkreislauf: Regen fällt zu Boden... und landet irgendwann irgendwie wieder in einer Wolke, die einen schon nach ein paar Stunden, die anderen erst
4.2 Wasserkreislauf Einführung: Wir alle kennen den Wasserkreislauf: Regen fällt zu Boden... und landet irgendwann irgendwie wieder in einer Wolke, die einen schon nach ein paar Stunden, die anderen erst
Folie 1. 2D-ÜSG-Berechnung und Verbesserung des Hochwasserschutzes an der. Ahauser Aa
 Folie 1 2D-ÜSG-Berechnung und Verbesserung des Hochwasserschutzes an der Ahauser Aa MIKE Anwendertreffen in Hamburg, 25.-26.02.2013 Dipl.-Ing. Manuel Sportmann Veranlassung Folie 2 Was war passiert...?
Folie 1 2D-ÜSG-Berechnung und Verbesserung des Hochwasserschutzes an der Ahauser Aa MIKE Anwendertreffen in Hamburg, 25.-26.02.2013 Dipl.-Ing. Manuel Sportmann Veranlassung Folie 2 Was war passiert...?
Abitur 2014 Mathematik Infinitesimalrechnung II
 Seite 1 Abiturloesung.de - Abituraufgaben Abitur 2014 Mathematik Infinitesimalrechnung II Geben Sie jeweils den Term einer in R definierten periodischen Funktion an, die die angegebene Eigenschaft hat.
Seite 1 Abiturloesung.de - Abituraufgaben Abitur 2014 Mathematik Infinitesimalrechnung II Geben Sie jeweils den Term einer in R definierten periodischen Funktion an, die die angegebene Eigenschaft hat.
2. Trierer Workshop zur Niederschlag-Abfluss-Modellierung: 14./ Ableitung extremer Abflüsse mit einem Flussgebietsmodell
 2. Trierer Workshop zur Niederschlag-Abfluss-Modellierung: 14./15.09.2009 Ableitung extremer Abflüsse mit einem Flussgebietsmodell Dipl.-Ing. J. Höfer & Dr.-Ing. J. Ihringer Gliederung: Einzugsgebiet der
2. Trierer Workshop zur Niederschlag-Abfluss-Modellierung: 14./15.09.2009 Ableitung extremer Abflüsse mit einem Flussgebietsmodell Dipl.-Ing. J. Höfer & Dr.-Ing. J. Ihringer Gliederung: Einzugsgebiet der
Datenanalyse Klausur SS 2014 (nicht wortwörtlich) Lösung (aus einer Nachbesprechung mit Elsenbeer)
 1. Ist das folgende Argument gültig? Datenanalyse Klausur SS 2014 (nicht wortwörtlich) Lösung (aus einer Nachbesprechung mit Elsenbeer) Wenn minderjährige Mörder für ihr Vergehen genauso verantwortlich
1. Ist das folgende Argument gültig? Datenanalyse Klausur SS 2014 (nicht wortwörtlich) Lösung (aus einer Nachbesprechung mit Elsenbeer) Wenn minderjährige Mörder für ihr Vergehen genauso verantwortlich
Mathematik GK 11 m3, AB 07 Hochwasser Lösung
 Aufgabe 1: Hochwasserwelle Während einer Hochwasserwelle wurde in einer Stadt der Wasserstand h des Flusses in Abhängigkeit von der Zeit t gemessen. Der Funktionsterm der Funktion, die den dargestellten
Aufgabe 1: Hochwasserwelle Während einer Hochwasserwelle wurde in einer Stadt der Wasserstand h des Flusses in Abhängigkeit von der Zeit t gemessen. Der Funktionsterm der Funktion, die den dargestellten
DIE HOCHWASSEREREIGNISSE IN DER ZWEITEN JULIHÄLFTE 2005
 Einleitung DIE HOCHWASSEREREIGNISSE IN DER ZWEITEN JULIHÄLFTE 2005 Nachdem bereits in der ersten Julihälfte 2005 vor allem die Enns und die Mur von Hochwasserereignissen betroffen waren, führten zahlreiche
Einleitung DIE HOCHWASSEREREIGNISSE IN DER ZWEITEN JULIHÄLFTE 2005 Nachdem bereits in der ersten Julihälfte 2005 vor allem die Enns und die Mur von Hochwasserereignissen betroffen waren, führten zahlreiche
4. Welche der folgenden glazialen Sedimente bilden in der Regel gute Grundwasserleiter:
 Testat Einführung Hydrogeologie 1. Was ist richtig: FEM und FDM unterscheiden sich nur in der Diskretisierung FEM und FDM basieren auf unterschiedlichen Algorithmen FEM sind in jedem Fall besser für Grundwasserfragestellungen
Testat Einführung Hydrogeologie 1. Was ist richtig: FEM und FDM unterscheiden sich nur in der Diskretisierung FEM und FDM basieren auf unterschiedlichen Algorithmen FEM sind in jedem Fall besser für Grundwasserfragestellungen
Statistik für Ingenieure Vorlesung 3
 Statistik für Ingenieure Vorlesung 3 Prof. Dr. Hans-Jörg Starkloff TU Bergakademie Freiberg Institut für Stochastik 14. November 2017 3. Zufallsgrößen 3.1 Zufallsgrößen und ihre Verteilung Häufig sind
Statistik für Ingenieure Vorlesung 3 Prof. Dr. Hans-Jörg Starkloff TU Bergakademie Freiberg Institut für Stochastik 14. November 2017 3. Zufallsgrößen 3.1 Zufallsgrößen und ihre Verteilung Häufig sind
VERFÜLLUNG UND RENATURIERUNG STEINBRUCH LAUBENHEIM GENEHMIGUNGSPLANUNG - WAT INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
 T 1 2 5 D hn rn hn rn hn rn hn rn hn rn hn rn hn rn 5,0 min 4,8 158,3 6,5 215,0 8,7 289,9 10,4 346,6 12,1 403,3 14,3 478,2 16,0 534,9 10,0 min 7,6 126,7 9,9 165,5 13,0 216,8 15,3 255,6 17,7 294,4 20,7
T 1 2 5 D hn rn hn rn hn rn hn rn hn rn hn rn hn rn 5,0 min 4,8 158,3 6,5 215,0 8,7 289,9 10,4 346,6 12,1 403,3 14,3 478,2 16,0 534,9 10,0 min 7,6 126,7 9,9 165,5 13,0 216,8 15,3 255,6 17,7 294,4 20,7
1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte
 1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte 1.1 Werkstoffe werden in verschiedene Klassen und die dazugehörigen Untergruppen eingeteilt. Ordnen Sie folgende Werkstoffe in ihre spezifischen Gruppen: Stahl Holz
1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte 1.1 Werkstoffe werden in verschiedene Klassen und die dazugehörigen Untergruppen eingeteilt. Ordnen Sie folgende Werkstoffe in ihre spezifischen Gruppen: Stahl Holz
Vorlesung Gesamtbanksteuerung Mathematische Grundlagen II Dr. Klaus Lukas Carsten Neundorf. Vorlesung 04 Mathematische Grundlagen II,
 Vorlesung Gesamtbanksteuerung Mathematische Grundlagen II Dr. Klaus Lukas Carsten Neundorf 1 Was sollen Sie heute lernen? 2 Agenda Wiederholung stetige Renditen deskriptive Statistik Verteilungsparameter
Vorlesung Gesamtbanksteuerung Mathematische Grundlagen II Dr. Klaus Lukas Carsten Neundorf 1 Was sollen Sie heute lernen? 2 Agenda Wiederholung stetige Renditen deskriptive Statistik Verteilungsparameter
Örtliche Regendaten zur Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138. Regenspende r D(T) [l/(s ha)] für Wiederkehrzeiten
![Örtliche Regendaten zur Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138. Regenspende r D(T) [l/(s ha)] für Wiederkehrzeiten Örtliche Regendaten zur Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138. Regenspende r D(T) [l/(s ha)] für Wiederkehrzeiten](/thumbs/97/130931511.jpg) Regen Örtliche Regendaten zur Bemessung Datenherkunft / Niederschlagsstation Müllheim (BW), KOSTRA-DWD-2010R Spalten-Nr. KOSTRA-Atlas 14 Zeilen-Nr. KOSTRA-Atlas 97 KOSTRA-Datenbasis KOSTRA-Zeitspanne 1951-2010
Regen Örtliche Regendaten zur Bemessung Datenherkunft / Niederschlagsstation Müllheim (BW), KOSTRA-DWD-2010R Spalten-Nr. KOSTRA-Atlas 14 Zeilen-Nr. KOSTRA-Atlas 97 KOSTRA-Datenbasis KOSTRA-Zeitspanne 1951-2010
Allgemeine Hydrogeologie Grundwasserhaushalt
 Allgemeine Hydrogeologie Grundwasserhaushalt von Prof. Dr. Dr. h.c. GEORG MATTHESS und Dr. techn. KAROLY UBELL Institut für Geowissenschaften der Universität Kiel und Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz
Allgemeine Hydrogeologie Grundwasserhaushalt von Prof. Dr. Dr. h.c. GEORG MATTHESS und Dr. techn. KAROLY UBELL Institut für Geowissenschaften der Universität Kiel und Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz
Thiele+Büttner GbR: Die Verwendung der Euler-2-Verteilung Seite 1 als Niederschlagsinput in NA-Modelle
 Thiele+Büttner GbR: Die Verwendung der Euler-2-Verteilung Seite 1 1 Einführung in die Problematik Als Input in NA-Modelle wird bei Bemessungsaufgaben üblicherweise ein KOSTRA- Niederschlag mit der Jährlichkeit
Thiele+Büttner GbR: Die Verwendung der Euler-2-Verteilung Seite 1 1 Einführung in die Problematik Als Input in NA-Modelle wird bei Bemessungsaufgaben üblicherweise ein KOSTRA- Niederschlag mit der Jährlichkeit
Abflussberechnung mit dem Einheitsganglinienverfahren (Unit Hydrograph)
 Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und Konstruktiven Wasserbau Universität für Bodenkultur Wien Abflussberechnung mit dem Einheitsganglinienverfahren (Unit Hydrograph) Hubert Holzmann (Email: hubert.holzmann@boku.ac.at)
Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und Konstruktiven Wasserbau Universität für Bodenkultur Wien Abflussberechnung mit dem Einheitsganglinienverfahren (Unit Hydrograph) Hubert Holzmann (Email: hubert.holzmann@boku.ac.at)
How To Understand The History Of The River Valley
 ANHANG ANHANG A: VERFAHREN ZUR RÄUMLICHEN ABMINDERUNG NACH LORENZ & SKODA 2000 UND SKODA ET AL. 2003...2 ANHANG B: LAGEPLAN SCHWEMMKEGEL LATTENBACH MIT GELÄNDEMODELL...5 ANHANG C: VERBAUUNGSMAßNAHMEN UND
ANHANG ANHANG A: VERFAHREN ZUR RÄUMLICHEN ABMINDERUNG NACH LORENZ & SKODA 2000 UND SKODA ET AL. 2003...2 ANHANG B: LAGEPLAN SCHWEMMKEGEL LATTENBACH MIT GELÄNDEMODELL...5 ANHANG C: VERBAUUNGSMAßNAHMEN UND
Rolf Mull Hartmut Holländer. Grundwasserhydraulik. und -hydrologie. Eine Einführung. Mit 157 Abbildungen und 20 Tabellen. Springer
 Rolf Mull Hartmut Holländer Grundwasserhydraulik und -hydrologie Eine Einführung Mit 157 Abbildungen und 20 Tabellen Springer VI 1 Bedeutung des Grundwassers 1 2 Strukturen der Grundwassersysteme 4 2.1
Rolf Mull Hartmut Holländer Grundwasserhydraulik und -hydrologie Eine Einführung Mit 157 Abbildungen und 20 Tabellen Springer VI 1 Bedeutung des Grundwassers 1 2 Strukturen der Grundwassersysteme 4 2.1
Wasserwirtschaftsamt Weilheim. Vergleich LME ALMO Sep. 2007
 Vergleich LME ALMO Sep. 2007 Map-D-Phase Im Rahmen des Projektes Map-D-Phase standen uns ab dem 29.08.07 zum Test Daten des Schweizer Modells ALMO parallel zu den LME Vorhersagen zur Verfügung. Nach dem
Vergleich LME ALMO Sep. 2007 Map-D-Phase Im Rahmen des Projektes Map-D-Phase standen uns ab dem 29.08.07 zum Test Daten des Schweizer Modells ALMO parallel zu den LME Vorhersagen zur Verfügung. Nach dem
Operatoren für das Fach Mathematik
 Operatoren für das Fach Mathematik Anforderungsbereich I Angeben, Nennen Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne nähere Erläuterungen und Begründungen, ohne Lösungsweg aufzählen Geben Sie die Koordinaten des
Operatoren für das Fach Mathematik Anforderungsbereich I Angeben, Nennen Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne nähere Erläuterungen und Begründungen, ohne Lösungsweg aufzählen Geben Sie die Koordinaten des
Klausur zu Methoden der Statistik I (mit Kurzlösung) Sommersemester Aufgabe 1
 Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Otto-Friedrich-Universität Bamberg Prof. Dr. Susanne Rässler Klausur zu Methoden der Statistik I (mit Kurzlösung) Sommersemester 2015 Aufgabe 1 In der aktuellen
Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Otto-Friedrich-Universität Bamberg Prof. Dr. Susanne Rässler Klausur zu Methoden der Statistik I (mit Kurzlösung) Sommersemester 2015 Aufgabe 1 In der aktuellen
Tagung der FH-DGG in Cottbus 24. Bis 28. Mai 2006 MOTIVATION GLOBAL CHANGE GLOBALE KLIMATISCHE RANDBEDINGUNGEN ATMOSPHÄRE
 Grundwassermodellierung im Kontext hydrologischer Modellierung auf unterschiedlichen Skalen Eine Fallstudie im Einzugsgebiet der Ammer. J. Wolf 1, V. Rojanschi 1, R. Barthel 1, J. Braun 1 1, jens.wolf@iws.uni-stuttgart.de
Grundwassermodellierung im Kontext hydrologischer Modellierung auf unterschiedlichen Skalen Eine Fallstudie im Einzugsgebiet der Ammer. J. Wolf 1, V. Rojanschi 1, R. Barthel 1, J. Braun 1 1, jens.wolf@iws.uni-stuttgart.de
Hydrologie und Flussgebietsmanagement
 Hydrologie und Flussgebietsmanagement o.univ.prof. DI Dr. H.P. Nachtnebel Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiver Wasserbau Gliederung der Vorlesung Statistische Grundlagen Extremwertstatistik
Hydrologie und Flussgebietsmanagement o.univ.prof. DI Dr. H.P. Nachtnebel Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiver Wasserbau Gliederung der Vorlesung Statistische Grundlagen Extremwertstatistik
ca. 1,98 ca. 1,8 ca. 2,42 ca. 2,68
 ca. 2,68 ca. 2,42 ca. 1,8 ca. 1,98 Regen Örtliche Regendaten zur Bemessung Datenherkunft / Niederschlagsstation Erding Spalten-Nr. KOSTRA-Atlas 52 Zeilen-Nr. KOSTRA-Atlas 90 KOSTRA-Datenbasis 1951-2000
ca. 2,68 ca. 2,42 ca. 1,8 ca. 1,98 Regen Örtliche Regendaten zur Bemessung Datenherkunft / Niederschlagsstation Erding Spalten-Nr. KOSTRA-Atlas 52 Zeilen-Nr. KOSTRA-Atlas 90 KOSTRA-Datenbasis 1951-2000
Statistik III. Walter Zucchini Fred Böker Andreas Stadie
 Statistik III Walter Zucchini Fred Böker Andreas Stadie Inhaltsverzeichnis 1 Zufallsvariablen und ihre Verteilung 1 1.1 Diskrete Zufallsvariablen........................... 1 1.2 Stetige Zufallsvariablen............................
Statistik III Walter Zucchini Fred Böker Andreas Stadie Inhaltsverzeichnis 1 Zufallsvariablen und ihre Verteilung 1 1.1 Diskrete Zufallsvariablen........................... 1 1.2 Stetige Zufallsvariablen............................
Abitur 2017 Mathematik Infinitesimalrechnung II
 Seite 1 http://www.abiturloesung.de/ Seite 2 Abitur 217 Mathematik Infinitesimalrechnung II Die Abbildung zeigt den Graphen der in R definierten Funktion g : x p + q sin p, q, r N. ( π r x ) mit Gegeben
Seite 1 http://www.abiturloesung.de/ Seite 2 Abitur 217 Mathematik Infinitesimalrechnung II Die Abbildung zeigt den Graphen der in R definierten Funktion g : x p + q sin p, q, r N. ( π r x ) mit Gegeben
Univ.-Prof. DDr. Franz Adunka, A
 Univ.-Prof. DDr. Franz Adunka, A Warum die Diskussion über den JMF? EN 1434 legt für die zulässigen Messabweichungen fest: Seite 2 Grundsätzliche Überlegungen Messfehler / Messabweichung ist wichtig für
Univ.-Prof. DDr. Franz Adunka, A Warum die Diskussion über den JMF? EN 1434 legt für die zulässigen Messabweichungen fest: Seite 2 Grundsätzliche Überlegungen Messfehler / Messabweichung ist wichtig für
Hydrologische Interaktion zwischen Grundwasser und Oberflächengewässer
 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Hydrologische Interaktion zwischen Grundwasser und Oberflächengewässer Prof. Dr.-Ing. Joseph Hölscher Dipl.-Ing. (FH) Thomas
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Hydrologische Interaktion zwischen Grundwasser und Oberflächengewässer Prof. Dr.-Ing. Joseph Hölscher Dipl.-Ing. (FH) Thomas
e-funktionen Aufgaben
 e-funktionen Aufgaben Die Fichte ist in Nordeuropa und den Gebirgen Mitteleuropas beheimatet. Durch Aufforsten wurde sie jedoch auch im übrigen Europa weit verbreitet. Fichten können je nach Standort Höhen
e-funktionen Aufgaben Die Fichte ist in Nordeuropa und den Gebirgen Mitteleuropas beheimatet. Durch Aufforsten wurde sie jedoch auch im übrigen Europa weit verbreitet. Fichten können je nach Standort Höhen
HOCHWASSERSCHUTZ UND GEWÄSSERENTWICKLUNG AN DER WERTACH. Anlage 7.1 Radegundisbach
 HOCHWASSERSCHUTZ UND GEWÄSSERENTWICKLUNG AN DER WERTACH 4. Realisierungsabschnitt Genehmigungsplanung Anlage 7.1 Radegundisbach Hydrologisch Planungsgrundlagen und Wasserspiegellagenmodell Vorhaben: Wertach
HOCHWASSERSCHUTZ UND GEWÄSSERENTWICKLUNG AN DER WERTACH 4. Realisierungsabschnitt Genehmigungsplanung Anlage 7.1 Radegundisbach Hydrologisch Planungsgrundlagen und Wasserspiegellagenmodell Vorhaben: Wertach
F r a g e n k a t a l o g
 F r a g e n k a t a l o g 1. Was ist eine Konstante? 2. Was ist eine Variable? 3. Was ist ein Datum? 4. Welche Werte haben Variablen? 5. Was sind qualitative Variablen? 6. Was sind quantitative Variablen?
F r a g e n k a t a l o g 1. Was ist eine Konstante? 2. Was ist eine Variable? 3. Was ist ein Datum? 4. Welche Werte haben Variablen? 5. Was sind qualitative Variablen? 6. Was sind quantitative Variablen?
Zentralabitur 2008 Physik Schülermaterial Aufgabe II ea Bearbeitungszeit: 300 min
 Thema: Experimente mit Interferometern Im Mittelpunkt der in den Aufgaben 1 und 2 angesprochenen Fragestellungen steht das Michelson-Interferometer. Es werden verschiedene Interferenzversuche mit Mikrowellen
Thema: Experimente mit Interferometern Im Mittelpunkt der in den Aufgaben 1 und 2 angesprochenen Fragestellungen steht das Michelson-Interferometer. Es werden verschiedene Interferenzversuche mit Mikrowellen
Vorgehensweise zur Bestimmung von extremen HW-Spitzen bzw. Volumina
 Folie Vorgehensweise zur Bestimmung von extremen HW-Spitzen bzw. Volumina Dr.-Ing. Harald Wegner (ASCE, BWK, DWA, EWRI) Franz Fischer Ingenieurbüro www.fischer-teamplan.de, harald.wegner@fischer-teamplan.de
Folie Vorgehensweise zur Bestimmung von extremen HW-Spitzen bzw. Volumina Dr.-Ing. Harald Wegner (ASCE, BWK, DWA, EWRI) Franz Fischer Ingenieurbüro www.fischer-teamplan.de, harald.wegner@fischer-teamplan.de
Übungsblatt 2 ( )
 Experimentalphysik für Naturwissenschaftler Universität Erlangen Nürnberg SS 01 Übungsblatt (11.05.01) 1) Geschwindigkeitsverteilung eines idealen Gases (a) Durch welche Verteilung lässt sich die Geschwindigkeitsverteilung
Experimentalphysik für Naturwissenschaftler Universität Erlangen Nürnberg SS 01 Übungsblatt (11.05.01) 1) Geschwindigkeitsverteilung eines idealen Gases (a) Durch welche Verteilung lässt sich die Geschwindigkeitsverteilung
Hydrographischer Dienst Kärnten
 Hydrographischer Dienst Kärnten Hydrologisches Datenservice, Analysen und Interpretation Hydrographie Aufgaben, Messnetz und Modell Messdaten und Modelldaten (Datensammlung) Hydrographie Online Service
Hydrographischer Dienst Kärnten Hydrologisches Datenservice, Analysen und Interpretation Hydrographie Aufgaben, Messnetz und Modell Messdaten und Modelldaten (Datensammlung) Hydrographie Online Service
Aufgabe 1 (10 Punkte)
 Univ.-Prof. Dr.-Ing. J. Jensen 16.03.2009, Seite 1 Zugelassene Hilfsmittel: SCHNEIDER - Bautabellen für Ingenieure bzw. WENDEHORST - Bautechnische Zahlentafeln NAME: MATR.-NR.: Aufgabe 1 2 3 4 5 Summe
Univ.-Prof. Dr.-Ing. J. Jensen 16.03.2009, Seite 1 Zugelassene Hilfsmittel: SCHNEIDER - Bautabellen für Ingenieure bzw. WENDEHORST - Bautechnische Zahlentafeln NAME: MATR.-NR.: Aufgabe 1 2 3 4 5 Summe
Schlechtwetter am Bau - Jährlichkeiten
 Schlechtwetter am Bau - Jährlichkeiten 6. Wiener Gespräche Wissenschaft und Bauwirtschaft, 23. Oktober 2014 Mag. Johanna Oberzaucher, Bereich Kundenservice, Fachabteilung Klima johanna.oberzaucher@zamg.ac.at,
Schlechtwetter am Bau - Jährlichkeiten 6. Wiener Gespräche Wissenschaft und Bauwirtschaft, 23. Oktober 2014 Mag. Johanna Oberzaucher, Bereich Kundenservice, Fachabteilung Klima johanna.oberzaucher@zamg.ac.at,
Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung. Mathematik. Probeklausur März Teil-2-Aufgaben
 Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung Mathematik Probeklausur März 2014 Teil-2-Aufgaben Aufgabe 1 Radfahrerin Eine Funktion v beschreibt die Geschwindigkeit einer Radfahrerin während
Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung Mathematik Probeklausur März 2014 Teil-2-Aufgaben Aufgabe 1 Radfahrerin Eine Funktion v beschreibt die Geschwindigkeit einer Radfahrerin während
KOSTRA-DWD 2000 Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie - Niederschlagshöhen und -spenden nach KOSTRA-DWD 2000 Niederschlagshöhen und -spenden für
 KOSTRA-DWD 2000 Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie - Niederschlagshöhen und -spenden nach KOSTRA-DWD 2000 Niederschlagshöhen und -spenden für Freiburg Zeitspanne : Januar - Dezember Rasterfeld
KOSTRA-DWD 2000 Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie - Niederschlagshöhen und -spenden nach KOSTRA-DWD 2000 Niederschlagshöhen und -spenden für Freiburg Zeitspanne : Januar - Dezember Rasterfeld
Wasser findet (s)einen Weg. Dipl.-Ing. Frank Ohlendorf BAUGRUND DRESDEN Ingenieurgesellschaft mbh. Dresdner Umweltgespräche : Vier Elemente - Wasser 1
 Wasser findet (s)einen Weg Dipl.-Ing. Frank Ohlendorf BAUGRUND DRESDEN Ingenieurgesellschaft mbh 1 Inhaltsübersicht Der schöne Wachwitzer Elbhang Niederschlagssituation Hydrologisches Szenario Maßnahmen
Wasser findet (s)einen Weg Dipl.-Ing. Frank Ohlendorf BAUGRUND DRESDEN Ingenieurgesellschaft mbh 1 Inhaltsübersicht Der schöne Wachwitzer Elbhang Niederschlagssituation Hydrologisches Szenario Maßnahmen
Daraus ergibt sich: Eine Steigerung der Lokal-Magnitude um 1 entspricht einer Verzehnfachung des Ausschlags (denn 10 + M
 Erdbeben Außermathematische Anwendungen im Mathematikunterricht WS 2012/13 Franz Embacher, Universität Wien Entstehung von Erdbeben Siehe http://geol3uni-grazat/08w/geo521/seismologiepdf Das Magnituden-System
Erdbeben Außermathematische Anwendungen im Mathematikunterricht WS 2012/13 Franz Embacher, Universität Wien Entstehung von Erdbeben Siehe http://geol3uni-grazat/08w/geo521/seismologiepdf Das Magnituden-System
Parametrisierte Funktionen nach van Genuchten/Mualem, Anwendungen und Grenzen. Wolfgang Durner Sascha Iden Andre Peters
 Parametrisierte Funktionen nach van Genuchten/Mualem, Anwendungen und Grenzen Wolfgang Durner Sascha Iden Andre Peters Gliederung Der Begriff Gliederung 1 Hintergrund van Genuchten Retentionsfunktion -
Parametrisierte Funktionen nach van Genuchten/Mualem, Anwendungen und Grenzen Wolfgang Durner Sascha Iden Andre Peters Gliederung Der Begriff Gliederung 1 Hintergrund van Genuchten Retentionsfunktion -
 Abiturprüfung Mathematik Baden-Württemberg (ohne CAS) Wahlteil - Aufgaben Analysis I Aufgabe I : Gegeben sind die Funktionen f und g durch f(x) cos( π x) und g(x) ( x) f(x) ; x Ihre Schaubilder sind K
Abiturprüfung Mathematik Baden-Württemberg (ohne CAS) Wahlteil - Aufgaben Analysis I Aufgabe I : Gegeben sind die Funktionen f und g durch f(x) cos( π x) und g(x) ( x) f(x) ; x Ihre Schaubilder sind K
Arbeitsblatt Dierentialrechnung
 1 Darmerkrankung Das Robert-Koch-Institut in Berlin hat den Verlauf der Darmerkrankung EHEC untersucht. Die Zahl der Erkrankten kann näherungsweise durch folgende Funktionsgleichung dargestellt werden:
1 Darmerkrankung Das Robert-Koch-Institut in Berlin hat den Verlauf der Darmerkrankung EHEC untersucht. Die Zahl der Erkrankten kann näherungsweise durch folgende Funktionsgleichung dargestellt werden:
Operationelle Abflussvorhersage für Quellgebiete
 Wasserwirtschaftsamt Kempten Operationelle Abflussvorhersage für Quellgebiete Praxisbericht, OPAQUE workshop 2008 Dr. Manfred Bremicker, Referat 43 Hydrologie, Hochwasservorhersage Dr. Uwe Ehret WWA Kempten,
Wasserwirtschaftsamt Kempten Operationelle Abflussvorhersage für Quellgebiete Praxisbericht, OPAQUE workshop 2008 Dr. Manfred Bremicker, Referat 43 Hydrologie, Hochwasservorhersage Dr. Uwe Ehret WWA Kempten,
Erweiterung von Larsim um ein Grundwassermodul zur Beschreibung der Speicherung von Wasser in den alpinen und voralpinen Schotterkörpern
 Erweiterung von Larsim um ein Grundwassermodul zur Beschreibung der Speicherung von Wasser in den alpinen und voralpinen Schotterkörpern Natalie Stahl WWA Technische Umsetzung Hydron GmbH Inhalt A) Voralpine
Erweiterung von Larsim um ein Grundwassermodul zur Beschreibung der Speicherung von Wasser in den alpinen und voralpinen Schotterkörpern Natalie Stahl WWA Technische Umsetzung Hydron GmbH Inhalt A) Voralpine
Modellierung der Interaktion zwischen Fluss und Grundwasser Zwei Beispiele aus der Region Zürich
 Tagung Numerische Grundwassermodellierung Graz, 24.-25. Juni 2008 Modellierung der Interaktion zwischen Fluss und Grundwasser Zwei Beispiele aus der Region Zürich Fritz STAUFFER, Tobias DOPPLER und Harrie-Jan
Tagung Numerische Grundwassermodellierung Graz, 24.-25. Juni 2008 Modellierung der Interaktion zwischen Fluss und Grundwasser Zwei Beispiele aus der Region Zürich Fritz STAUFFER, Tobias DOPPLER und Harrie-Jan
Operatoren. Operatoren. angeben, nennen
 angeben, nennen I Objekte, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne nähere en, Begründungen und ohne Darstellung von Lösungsansätzen oder Lösungswegen aufzählen anwenden I - II Einen bekannten Sachverhalt, eine
angeben, nennen I Objekte, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne nähere en, Begründungen und ohne Darstellung von Lösungsansätzen oder Lösungswegen aufzählen anwenden I - II Einen bekannten Sachverhalt, eine
HOCHWASSERANALYSE. Hausübung 4. α = s x. σ = +
 Hrologie un Wasserwirtschaft Hausübung 4 HOCHWASSERANALYSE Abgabe: 20.12.2017 Hinweis: Bei em vorliegenen Dokument hanelt es sich leiglich um einen Lösungsvorschlag un nicht um eine Musterlösung. Es besteht
Hrologie un Wasserwirtschaft Hausübung 4 HOCHWASSERANALYSE Abgabe: 20.12.2017 Hinweis: Bei em vorliegenen Dokument hanelt es sich leiglich um einen Lösungsvorschlag un nicht um eine Musterlösung. Es besteht
Statistische Einordnung des Hochwassers Dezember 2014
 Statistische Einordnung des Hochwassers Dezember 2014 7. Hydrologisches Gespräch 8.5.2015 Dr. Thomas Hirschhäuser 1 Statistische Einordnung Dr. Thomas Hirschhäuser 2 Statistische Einordnung alt DVWK-Merkblatt
Statistische Einordnung des Hochwassers Dezember 2014 7. Hydrologisches Gespräch 8.5.2015 Dr. Thomas Hirschhäuser 1 Statistische Einordnung Dr. Thomas Hirschhäuser 2 Statistische Einordnung alt DVWK-Merkblatt
Wiederholung. Diese Fragen sollten Sie ohne Skript beantworten können:
 Wiederholung Diese Fragen sollten Sie ohne Skript beantworten können: Was bedeutet ein negativer Eponent? Wie kann man den Grad einer Wurzel noch darstellen? Wie werden Potenzen potenziert? Was bewirkt
Wiederholung Diese Fragen sollten Sie ohne Skript beantworten können: Was bedeutet ein negativer Eponent? Wie kann man den Grad einer Wurzel noch darstellen? Wie werden Potenzen potenziert? Was bewirkt
Datenanalyse Klausur SS 2014 (nicht wortwörtlich) Minderjährige Mörder sind für ihr Vergehen nicht genauso verantwortlich wie Erwachsene.
 Datenanalyse Klausur SS 2014 (nicht wortwörtlich) 1. Ist das folgende Argument gültig? Wenn minderjährige Mörder für ihr Vergehen genauso verantwortlich sind wie Erwachsene, ist eine lebenslängliche Strafe
Datenanalyse Klausur SS 2014 (nicht wortwörtlich) 1. Ist das folgende Argument gültig? Wenn minderjährige Mörder für ihr Vergehen genauso verantwortlich sind wie Erwachsene, ist eine lebenslängliche Strafe
1 Die elastischen Konstanten 10 Punkte
 1 Die elastischen Konstanten 10 Punkte 1.1 Ein Würfel wird einachsig unter Zug belastet. a) Definieren Sie durch Verwendung einer Skizze den Begriff der Spannung und der Dehnung. b) Der Würfel werde im
1 Die elastischen Konstanten 10 Punkte 1.1 Ein Würfel wird einachsig unter Zug belastet. a) Definieren Sie durch Verwendung einer Skizze den Begriff der Spannung und der Dehnung. b) Der Würfel werde im
Übung zur Vorlesung Grundlagen der Fahrzeugtechnik I. Übung
 Institut für Fahrzeugsystemtechnik Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik Leiter: Prof. Dr. rer. nat. Frank Gauterin Rintheimer Querallee 2 76131 Karlsruhe Übung zur Vorlesung Grundlagen der Fahrzeugtechnik I Übung
Institut für Fahrzeugsystemtechnik Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik Leiter: Prof. Dr. rer. nat. Frank Gauterin Rintheimer Querallee 2 76131 Karlsruhe Übung zur Vorlesung Grundlagen der Fahrzeugtechnik I Übung
Massnahmen zur Erhöhung der Abflusskapazität am Alpenrhein
 Massnahmen zur Erhöhung der Abflusskapazität am Alpenrhein Prof. Dr. Robert Boes Versuchsanstalt für Wasserbau, ETH Zürich Ausgangslage Ziel des Hochwasserschutzprojekts Rhesi Erhöhung der Abflusskapazität
Massnahmen zur Erhöhung der Abflusskapazität am Alpenrhein Prof. Dr. Robert Boes Versuchsanstalt für Wasserbau, ETH Zürich Ausgangslage Ziel des Hochwasserschutzprojekts Rhesi Erhöhung der Abflusskapazität
TS Eibenstock Zwickauer Mulde Hochwasser in Sachsen und die Rolle der Stauanlagenbewirtschaftung
 TS Eibenstock Zwickauer Mulde Hochwasser in Sachsen und die Rolle der Stauanlagenbewirtschaftung Die Vielfalt der Hochwasserereignisse Hochwasserentstehung Kleinräumiger (konvektiver) Niederschlag (1999
TS Eibenstock Zwickauer Mulde Hochwasser in Sachsen und die Rolle der Stauanlagenbewirtschaftung Die Vielfalt der Hochwasserereignisse Hochwasserentstehung Kleinräumiger (konvektiver) Niederschlag (1999
HYDROLOGISCHE EFFEKTE IN DER TERRESTRISCHEN GRAVIMETRIE. Matthias Weigelt
 HYDROLOGISCHE EFFEKTE IN DER TERRESTRISCHEN GRAVIMETRIE Matthias Weigelt weigelt@gis.uni-stuttgart.de 18.11.2011 oder 2 oder Gravimeter 3 oder Gravimeter Seismologische Station Membach Belgien 4 oder Gravimeter
HYDROLOGISCHE EFFEKTE IN DER TERRESTRISCHEN GRAVIMETRIE Matthias Weigelt weigelt@gis.uni-stuttgart.de 18.11.2011 oder 2 oder Gravimeter 3 oder Gravimeter Seismologische Station Membach Belgien 4 oder Gravimeter
