Management. Vorhersagen
|
|
|
- Karoline Gerber
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 10 bis 20 kv Management Leitzentrale Vorhersagen 400 V Fotovoltaik und Last Last Brennstoffzelle Betrieb Virtuelle Kraftwerke: Theorie oder Realität? BHKW Batterie Unter einem virtuellen Kraftwerk wird ein System zur Stromerzeugung verstanden, das nicht in Form eines herkömmlichen Kraftwerks existiert, aber dennoch vergleichbare oder ähnliche Möglichkeiten bietet. Das Konzept des virtuellen Kraftwerks ist untrennbar mit dezentraler Stromerzeugung verknüpft, die eine verbrauchernahe Erzeugung und Einspeisung in ein Verteilnetz verspricht. Der Beitrag fasst wesentliche Erkenntnisse aktueller Forschungs- und Entwicklungsprojekte zusammen. Für dezentrale Erzeugungsanlagen ist die Prognostizierbarkeit und Planbarkeit der zu erwartenden Energieerträge ein wesentliches Kriterium. Insbesondere Erzeugungsanlagen auf der Grundlage erneuerbarer Energien, wie zum Beispiel Windenergieoder Fotovoltaik-Anlagen, weisen mit Blick auf die zu erwartenden Energieerträge eine geringe Planbarkeit auf. Mit Autoren wachsender Prognosegüte von Wetter-, Wind- oder Einstrahlungsvorhersagen steigt auch die Verlässlichkeit der Integration dieser dezentralen Anlagen in die allgemeine Stromversorgung. Kraft- Wärme-Kopplungsanlagen auf Basis konventioneller oder biogener Energieträger verfügen größenabhängig über eine hohe Planbarkeit und Beeinflussbarkeit der disponiblen elektrischen Leis- tung und Energieerträge. Deshalb sind sie für den Einsatz in virtuellen Kraftwerken grundsätzlich geeignet. Konzepte, Zielvorgaben, Projekte Das Konzept des virtuellen Kraftwerks sieht vor, dezentrale Erzeugungsanlagen informationstechnisch untereinander zu vernetzen und extern zu regeln, um Dipl.-Ing. Ulli Arndt, Jahrgang 1970, Studium des Maschinenbaus an der Technischen Universität Braunschweig und an der Universidad Politécnica de Valencia, seit 2000 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) e.v. in München. i uarndt@ffe.de Dipl.-Ing. Serafin von Roon, Jahrgang 1977, Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Technischen Universität Berlin, seit 2003 wissenschaftlicher Mitarbeiter der FfE. Prof. Dr.-Ing. Ulrich Wagner, Jahrgang 1955, seit 1987 Geschäftsführer der FfE, seit 1995 Wissenschaftlicher Leiter der FfE und Ordinarius für Energiewirtschaft und Anwendungstechnik an der TU München, dort seit 2005 Dekan der Elektrotechnik und Informationstechnik. 52 BWK Bd. 58 (2006) Nr. 6
2 Projektname Beteiligte VK Stadtwerke Unna, EUS, ABB New Ventures VFCPP Vaillant, Plug Power Holland (NL), Cogen Europe (BL), Instituti Superior Technico (P), TEE, DLR, Sistemas de Calor (SP), Gasunie (NL), E.on Ruhrgas, E.on Energie, EWE Dispower mehr als 30 europäische Partner PoMS ISE KonWerl Energiepark 2010 Steag-Saar-Energie, Siemens, Kreis Soest, Stadt Werl, TWS, GWS Edison EnBW, Stadtwerke Karlsruhe, EUS, ZSW, ISE, Alstom, Görlitz Computerbau, Amtec, EVB, Uni Paderborn, Uni Karlsruhe, Exide, Siemens, Uni Magdeburg PEM-Oberhausen EUS, Fraunhofer Umsicht, Alstom, MVV Energie, E.on Engineering, AEG SVS Power Supply Systems, Uni Dortmund VK Harz/Eichsfeld Harz Energie, IEE (TU Clausthal), Stadt Goslar, Orlowski I 2 ERN dena, EnergieRegion Nürnberg, Fraunhofer IIS, enwiko, Siemen, E.on Energie, RMD Consult, etz, VDI/VDE/IT Virtuelles Regelkraftwerk Steag Saar Energie, 22 Anlagenbetreiber Laufzeit Anlagen und Leistung Vernetzung, EMS Ziele seit 2001, Ende 2004 Start des VK-Betriebs 5 BHKW, 1 Wasserkraftwerk, 1 Fotovoltaikanlage, 2 Windparks, Jahresproduktion: 26 GWh/a 2001 bis Brennstoffzellen mit je 4,6 kw(el.) vom Typ Vaillant-Euro bis 2006 Ersteinsatz 2005 seit Fotovoltaikanlage mit 30 kw(peak), 1 BHKW mit 40 kw(el.), 1 Batteriebank mit 100 kw für 1h 1 Windenergieanlage mit 1,8 MW, 1 Fotovoltaikanlage mit 22 kw(peak), 1 Biomasse-BHKW mit 500 kw(el.), 1 Brennstoffzelle (geplant), 1 Batteriespeicher 1999 bis PEM-Brennstoffzelle mit 250 kw(el.), 2 BHWK, 2 Batteriecontainer, je 100 kw für 1h, 1 PEM-Brennstoffzelle mit 2 kw(el.), 1 Gleichstromkopplung mit 2 MVA 1999 bis PEM-Brenstoffzelle mit 210 kw(el.), 1 Mikrogasturbine mit 100 kw(el.), 1 Gasmotor mit 470 kw(el.), 1 Kältemaschine mit 60 kw(th.) seit Mini-BHKW, Notstromaggregate, kleine Wasserkraftwerke mit insgesamt 5 bis 7 MW sowie abschaltbare Lasten Prognose-, Leit- und Automatisierungssysteme Funkrundsteuerung, Vorgabe von Fahrplänen Steuereinheit und komponentenspezifi sche Interface-Einheiten DEMS (Siemens) DEMS (Siemens) Kommunikation mittels PLC-Technologie Autarke Controller, Netzwerk mit globalem Energiemanagement Funk, Telefon, Internet Optimierung der Energieerzeugung in Abhängigkeit der technischen Möglichkeiten, der prognostizierten Verbraucherlast und der Einkaufskonditionen; Verbesserung der Prognosegüte Erprobung der Vernetzung von Brennstoffzellen als virtuelles Kraftwerk; Notwendigkeit zur bidirektionalen Kommunikation Reduktion der Spitzenlasten und der Leistungskosten, Simulationsprognose 35 % Ermittlung der kostenoptimierten Kurzfristeinsatzplanung für alle Erzeugerund Verbrauchereinheiten in Verbindung mit der Möglichkeit von Regeleingriffen auf schaltbare Lasten Clusterung von dezentralen Erzeugern, Speichern und Lasten kleiner Leistung zu regelbaren bzw. prognostizierten marktund vertragsfähigen größeren Einheiten Entwicklung von Erzeugungsfahrplänen und Belastungsoptimierung der Netzbetriebsmittel, Bereitstellung/Kompensation von Blindleistung, Bereitstellung von Sofortreserve und lokale Bereitstellung von Premium Power Wirtschaftliche und technische Optimierung der Energieversorgung durch Vermeidung von Leistungsspitzen der Stromversorgung 2005 bis ) noch nicht defi niert noch nicht defi niert Optimierte Integration dezentraler und regenerativer Erzeuger in bestehende Versorgungsnetze seit 2003 Industrielle und kommunale KWK- oder Spitzenlastkraftwerke ab 1 MW(el.), insgesamt 400 MW(el.) Internet Teilnahme am Regelleistungsmarkt auch für Anbieter mit elektrischen Leistungen unterhalb von 30 MW ermöglichen BHKW: Blockheizkraftwerk; EMS: Energiemanagementsysteme; PEM: Polymer-Elektrolyt-Membran; VK: Virtuelles Kraftwerk; 1 ) Machbarkeitsstudie mit anschließender Konzeptumsetzung weitere, über die verbrauchsnahe Versorgung hinausgehende energiewirtschaftliche Aufgaben übernehmen zu können. Diese Aufgaben definieren das jeweilige Betriebskonzept des virtuellen Kraftwerks. Unter dem Schlagwort des virtuellen Kraftwerks sind in Deutschland in letzter Zeit zahlreiche Projekte realisiert bzw. begonnen worden. Beispiele für derartige Projekte sind in der Tabelle 1 aufgeführt. Die meisten Projekte werden von mehreren Partnern gemeinsam realisiert. In diesem Bereich engagieren sich große Energieversorgungsunternehmen, Stadtwerke, Anlagenhersteller, Systementwickler und Forschungsinstitute. Es werden in der Regel nur wenige Anlagen, vorrangig Mikro-KWK-, Fotovoltaik- und Windenergieanlagen, und teilweise elektrische Speicher (zum Beispiel Batterien) zusammengeschlossen. Zielvorgaben neben der Untersuchung des Anlagenverhaltens sind: > die Erprobung der Anforderungen an die Kommunikation, > die Optimierung der Integration von regenerativer Erzeugung in das Versorgungsnetz, > die Belastungsoptimierung der Netzbetriebsmittel, > die lokale Bereitstellung sogenannter Premium Power, > die Vermeidung von Lastspitzen und > die Verbesserung der Prognostizierbarkeit. Die Auswertung bereits abgeschlossener und noch laufender Projekte zu virtuellen Kraftwerken in Deutschland zeigt, dass das Konzept noch nicht die Marktreife erlangt hat und weitere Forschung und Entwicklung notwendig ist. Einerseits liegt dies neben den eingesetzten Technologien, zum Beispiel der Brennstoffzelle (Prototypstatus), an den teilweise teuren Kommunikationslösungen. Andererseits sorgen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dafür, dass eine Realisierung der Projekte nur mit Fördergeldern und in den meisten Fällen nur zeitlich begrenzt möglich ist. Die durch den Zusammenschluss gebündelten Tabelle 1 Übersicht aktueller und bereits abgeschlossener Projekte zu virtuellen Kraftwerken. elektrischen Leistungen erreichen außerdem meistens keine energiewirtschaftlich relevante Größe. Die Projekte sind auch nicht darauf ausgelegt, als Konkurrenz zu bestehenden Strukturen zu fungieren. Vielmehr sollen Erfahrungen im laufenden Betrieb über Anlagen und Energiemanagementsysteme gewonnen werden. Eine Ausnahme bildet das virtuelle Regelleistungskraftwerk der Steag Saar Energie AG, Saarbrücken, das als funktionierendes Geschäftsmodell betrachtet werden muss. Die in diesem Verbund organisierten Erzeugungsanlagen mit elektrischen Leistungen von deutlich mehr als 1 MW entsprechen weniger der eingangs getroffenen Definition dezentraler Energieerzeugungsanlagen eines BWK Bd. 58 (2006) Nr. 6 53
3 Betriebskonzepte virtueller Kraftwerke > Primärenergieeinsparung Mit Hilfe einer externen Regelung von KWK-Anlagen kann versucht werden, Primärenergie im Vergleich zum allein wärmegeführten Betrieb von KWK-Anlagen einzusparen. In einer diesbezüglichen FfE-Studie konnte gezeigt werden, dass sowohl das gebäudeoptimierte als auch das zentral gesteuerte virtuelle Brennstoffzellen-Kraftwerk trotz konservativ angesetzter Wirkungsgrade der Brennstoffzellenanlagen nahezu denselben Primärenergieverbrauch aufweist wie die Referenzvariante mit Brennwerttechnik (Wärme) und GuD-Kraftwerk (Strom). In der Simulation ergeben sich jedoch nur marginale Unterschiede zwischen wärmegeführten Brennstoffzellenanlagen und den als virtuelles Kraftwerk betriebenen, identischen Brennstoffzellenanlagen [1]. > Peak-Shaving Das Peak-Shaving-Konzept sieht vor, die Erzeugung dezentraler Anlagen in Zeiten einer hohen elektrischen Gesamtlast zu erhöhen, um die durch konventionelle Kraftwerke zu deckende Last zu reduzieren. Das wirtschaftliche Potenzial dieses Konzepts wird durch die Strompreise und die disponible elektrische Leistung der dezentralen Erzeugungsanlagen zu diesen Zeitpunkten bestimmt. Durch einen Einsatz von Wärmespeichern kann die Erzeugungscharakteristik in gewissen Grenzen vom dezentralen Energiemanagementsystem verändert werden, indem die Wärmeerzeugung über den betrachteten Zeitraum verschoben wird. Nach dem Peak-Shaving-Konzept ist es daher interessant, die elektrische Leistung der KWK-Anlagen in Zeiten einer hohen elektrischen Gesamtlast und somit hoher Preise an der Strombörse zu erhöhen, um im Gegenzug die Leistung in Zeiten einer geringen elektrischen Last zu vermindern. Für die Abschätzung des wirtschaftlichen Potenzials ist die Verteilung der Spotmarktpreise über den Tag interessant. Im Jahr 2004 wurden im Mittel die höchsten Preise während der Mittags- und der frühen Abendstunden erzielt mit lokalen Maxima in der Zeit von 11:00 bis 12:00 Uhr und von 18:00 bis 19:00 Uhr. Die mittleren Preise für die Stunde von 11:00 bis 12:00 Uhr waren im Mittel um das 2,5fache so hoch wie die Preise von 3:00 bis 4:00 Uhr. > Lastflussoptimierung Ähnlich wie beim Peak-Shaving-Konzept zielt die externe Regelung beim Konzept der Lastflussoptimierung auf die Reduktion der Spitzenlast ab. Während sich das Peak-Shaving-Konzept nur indirekt an der elektrischen Gesamtlast in Form tageszeitabhängiger Strompreisschwankungen orientiert, ist beim Konzept der Lastflussoptimierung der Lastfluss in einem bestimmten Netzbereich die bestimmende Größe. Im Rahmen einer weiteren FfE- Studie wurde eine Siedlung mit 120 Gebäuden simuliert, in denen je eine KWK-Anlage (Brennstoffzelle) zum Einsatz kommt. Die Studie kam zum Ergebnis, dass der Einsatz der dezentralen Erzeugungssysteme zu einer Reduktion der Netzbelastung um etwa die Hälfte und zu einem Rückgang der extern gelieferten elektrischen Arbeit um etwa zwei Drittel führen kann. Dabei wurden eine 100 %-Verfügbarkeit und eine ausreichende Leistungsdynamik der Brennstoffzellen vorausgesetzt. Die Spannungshaltung im Netz wird durch die dezentrale Erzeugung verbessert, da der Spannungsabfall auf den Leitungen verringert wird. Theoretisch wären somit größere Stromkreislängen oder geringere Kabelquerschnitte möglich, was in der Praxis aus Standardisierungsgründen nur zu geringen Kosteneinsparungen führen dürfte. Darüber hinaus müssten hierzu noch Betreibermodelle ausgearbeitet werden, um die Verteilung der möglichen Wertschöpfungspotenziale zwischen den Akteuren zu klären [2]. > Alternative zum Kraftwerksneubau Durch die technischen, ökonomischen und insbesondere die politischen Rahmenbedingungen ändern sich die Kriterien bei der Investitionsentscheidung im Kraftwerksmarkt grundsätzlich. Die Politik befürwortet explizit den Ausbau von KWK-Anlagen, wie die Ziele und die Bestimmungen des KWKModG zeigen. Der Ausbau dezentraler KWK-Anlagen könnte somit einen Beitrag zur Deckung der Kapazitätslücke leisten, die sich aus dem Ersatz von veralteten Kraftwerken und den Kernenergieausstieg abzeichnet. Da mit dezentralen Energieerzeugungsanlagen eine zeitnahe, kostenproportionale und am Bedarf orientierte Erweiterung des Kraftwerksparks möglich ist, könnten diese Anlagen auch für Energieversorgungsunternehmen interessant werden. Wenn im Mikro-KWK-Bereich installierte Leistungen von mehr als 500 MW erreicht werden sollten, die mit der Größe eines konventionellen Großkraftwerks vergleichbar sind, werden die Unternehmen daran interessiert sein, Mikro-KWK-Anlagen in die Kraftwerkseinsatzplanung zu integrieren und weitere Wertschöpfungspotenziale zu erschließen. Hierbei könnte das virtuelle Kraftwerk ein mögliches Konzept sein. > Virtuelles Regelleistungskraftwerk Ein vielversprechendes Betriebskonzept könnte auch die Bereitstellung von Regelleistung durch dezentrale Erzeugungsanlagen sein. Die Erwartungen, die auf dieses Konzept gesetzt werden, beruhen einerseits auf der hohen Dynamik, mit denen eine Vielzahl von KWK-Anlagen auf eine mögliche Anforderung durch den Übertragungsnetzbetreiber, wegen des modularen Aufbaus und des möglichen guten Teillastverhaltens innovativer Technologien, wie der Brennstoffzelle, reagieren können. Andererseits scheinen die wirtschaftlichen Potenziale bei diesem Konzept besonders hoch zu sein, da sowohl Erlöse für die Leistungsvorhaltung, als auch für den Leistungsabruf erwirtschaftet werden. Im Rahmen der Forschungsinitiative Kraftwerke des 21. Jahrhunderts werden an der Forschungsstelle für Energiewirtschaft Einsatztauglichkeit und -potenziale kleiner KWK-Anlagen für den Betrieb als virtuelles Regelleistungskraftwerk untersucht [3]. Im Rahmen des zugehörigen Projektes KW21-E2 werden an einem Prüfstand des Lehrstuhls für Energiewirtschaft und Anwendungstechnik der Technischen Universität München messtechnische Untersuchungen durchgeführt. Der Prüfstand bietet die Möglichkeit, die Anforderungen der Gebäude ebenso wie die Einsatzkriterien nach Vorgaben realitätsnah abzubilden. Die messtechnischen Analysen liefern die Basis für die Simulation eines virtuellen Regelleistungskraftwerks. 54 BWK Bd. 58 (2006) Nr. 6
4 virtuellen Kraftwerks. Die KWK-Anlagen und Spitzenlastkraftwerke in der Industrie erfüllen zwar die Bedingung der verbrauchsnahen Erzeugung. Die im virtuellen Kraftwerk zusammengeschlossenen kommunalen Kraftwerke speisen in der Regel jedoch in Versorgungsnetze ein, die nicht mehr dem Anspruch einer verbrauchsnahen Verteilung genügen. In einigen der Projekte wird auch der sogenannte netzgekoppelte Inselbetrieb untersucht. Hierbei wird das Zusammenspiel von mehreren dezentralen Energieerzeugungsanlagen mit Speicher im abgeschlossenen Netz optimiert. Die Unabhängigkeit vom allgemeinen Stromnetz ist allerdings nur dann gegeben, wenn die Spannungs- und Frequenzhaltung trotz eines Netzausfalls auf einer höheren Netzebene gewährleistet werden kann. Darüber hinaus gibt es Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Energieversorgung gefragt ist. Dazu gehören zum Beispiel Rechenzentren, Sendeanstalten, Banken, Versicherungen und ähnliche Objekte. Im Gegensatz zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV), bei der wartungsintensive Akkumulatoren die Anfahrlücke bis zum Hochlaufen eines Notstromdiesels schließen, liefern KWK-Anlagen permanent sogenannte Premium Power. Deren Bereitstellung wird teilweise als ein Ziel von virtuellen Kraftwerken angegeben. Weder der netzgekoppelte Inselbetrieb noch die Bereitstellung von Premium Power entsprechen den eingangs definierten Merkmalen eines virtuellen Kraftwerks. Aus ökologischer und energiewirtschaftlicher Sicht bieten virtuelle Kraftwerke Vorteile, wenn mit ihnen Primärenergie und CO 2 -Emissionen im Vergleich zu einem Referenzsystem eingespart werden können. Zu den wichtigsten Zielen und Betriebskonzepten virtueller Kraftwerke gehören [1 bis 3]: > Primärenergieeinsparung, > Peak-Shaving, > Lastflussoptimierung, > Alternative zum Kraftwerksneubau, > Beeitstellung von Regelleistung. Energiegestehungskosten [Ct/kWh] Bild 1 Beispielrechnung für eine Mikro-KWK-Anlage mit 5,5 kw(el.) und 12,5 kw (th.) inklusive Spitzenlastkessel mit 40 kw(th.) in einem Zehnfamilienhaus mit mittlerem Wärmedämmstandard, Berücksichtigung aller Kosten, Preise als Mittelwert von 2005, Zinssatz: 5 % Strombezugskosten Wärmegestehungskosten Stromgestehungskosten KWK Wärmegestehungskosten KWK Referenz Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Strombezugs- und Wärmegestehungskosten (konventionell) Energiegestehungskosten für KWK-Anlagen. Wirtschaftliche Aspekte Aus wirtschaftlicher Sicht müssen die Aufwendungen für das zentrale Energiemanagementsystem und die Kommunikation durch das Erschließen weiterer Wertschöpfungspotenziale, die über den Einzelanlagenbetrieb hinausgehen, mindestens ausgeglichen werden. Bei KWK-Anwendungen gibt es keine eindeutige Methode, um die eingesetzte Energie und die Kosten auf die beiden Produkte Strom und Wärme aufzuteilen. Die unterschiedlichen Ansätze gemäß Bild 1 ziehen entweder je eine Größe (Wärmegestehungs- bzw. Strombezugskosten) eines vergleichbaren konventionell versorgten Objektes heran und teilen die restlichen Kosten der anderen Fester Wärmepreis Fester Strompreis Aufteilung im Verhältnis der Strombezugs- und Wärmegestehungskosten (konventionell) Aufteilung im Verhältnis der KWK-Strom- und -Wärmeerzeugung Größe zu (Varianten 1 und 2). Alternativ werden die Gestehungskosten nach dem Verhältnis der konventionellen Wärmegestehungs- bzw. Strombezugskosten (Variante 3) beziehungsweise nach den erzeugten Energiemengen Strom und Wärme aufgeteilt (Variante 4). Bei der wirtschaftlichen Betrachtung der KWK ist die Definition der Nutzungsvariante des KWK-Stroms im Versorgungsobjekt von Bedeutung. Wie im Beispiel für die Hausenergieversorgung im Bild 1 dargestellt, liegen die Stromgestehungskosten von Mikro-KWK-Anlagen in der Regel zwischen der Einspeisevergütung von etwa 10 Ct/kWh(el.) und den Haushalts-Strombezugskosten von etwa 19 Ct/kWh(el.). Aus der Sicht eines KWK-Anlagenbetreibers im eigenen Versorgungsobjekt liegt das höhere wirtschaftliche Potenzial daher in der Vermeidung des externen Strombezugs. Aus der Sicht eines Energieversorgers, der einen Einfluss auf den Betrieb einer KWK-Anlage im gegebenenfalls fremden Versorgungsobjekt hat, stellt sich die Theoretischer Markt für virtuelle Regelleistungskraftwerke Bild 2 Leistung P Störung in der Leistungsbilanz Momentanreserve Aktivierungszeit 30 s Aktivierungszeit 5 min Markt 1 ) Aktivierungszeit 15 min Stundenreserve Einsatzreihenfolge für unterschiedliche Arten von Regelleistung. Primärregelung Sekundärregelung Tertiärregelung Minutenreserve Zeit t 1 ) unter Berücksichtigung der Ausschreibungsbedingungen BWK Bd. 58 (2006) Nr. 6 55
5 Pro Das Konzept des virtuellen Kraftwerks erschließt weitere Wertschöpfungspotenziale für KWK-Anwendungen Virtuelle Kraftwerke aus KWK-Anlagen ermöglichen einen kostenproportionalen und zeitnahen Ausbau der Erzeugungskapazität Bei deutlicher Erhöhung des KWK-Anteils an der Stromerzeugung kann Einfl uss auf die Erzeugungscharakteristik genommen werden Tabelle 2 Treiber und Hemmnisse eines virtuellen Kraftwerks. Frage, ob die Stromgestehungskosten der KWK-Anlage zu seinen üblichen Strombezugskosten konkurrenzfähig sind. Dabei muss allerdings die vermiedene Netznutzung des KWK-Stroms berücksichtigt werden. Damit sind bei der KWK-Stromerzeugung zur Hausenergieversorgung die Erlöspotenziale durch die Strombezugskosten begrenzt. Im Konzept des virtuellen Kraftwerks können weitere Vermarktungspotenziale erschlossen werden. Virtuelle Regelleistungskraftwerke Im Rahmen eines FfE-Projekts wurden organisatorische Hemmnisse und wirtschaftliche Potenziale der Bereitstellung von Regelleistung unter heutigen Marktbedingungen untersucht. Der Anbieter von Regelleistung muss entscheiden, ob Primär-, Sekundär- oder Tertiär-Regelleistung (Minutenreserve) angeboten werden soll. Diese unterscheiden sich durch die im Transmission Code 2003 [4] definierten technischen Anforderungen. Wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist die Aktivierungszeit, die die Einsatzreihenfolge bestimmt (Bild 2). Darüber hinaus werden bei der Sekundär- und Tertiärregelung positive und negative Regelleistung getrennt ausgeschrieben. Aus der Sicht eines Kraftwerksbetreibers bedeutet der Abruf positiver Regelleistung eine Leistungserhöhung und der Abruf negativer Regelleistung entsprechend eine Leistungsverringerung. Der Regelleistungsanbieter ist verpflichtet, für einen Einsatz vorgesehene Anlagen zunächst zu präqualifizieren und mit dem Übertragungsnetzbetreiber einen Rahmenvertrag zu schließen. Die Mindestgebotmenge für Sekundär- und Tertiärregelleistung beträgt 30 MW. Dies ist eine Hürde, denn sollte diese Leistung beispielsweise vollständig durch Mikro- KWK-Anlagen zur Hausenergieversorgung gedeckt werden, müssten bei einer Contra angenommenen mittleren elektrischen Leistung von 5 kw mindestens Anlagen zusammengeschlossen werden und alle Anlagen zur gleichen Zeit ihre Nennleistung erbringen können. Eine weitere Hürde ist die hohe Zeitverfügbarkeit der angebotenen Leistung, die bei der Sekundärregelung 95 % beträgt und bei der Primär- bzw. Tertiärreglung 100 %, das heißt, die Leistung muss konstant über den gesamten Angebotszeitraum verfügbar sein. Hieraus ergeben sich aufgrund der saisonalen Schwankungen im KWK-Betrieb vor allem Schwierigkeiten bei der Bereitstellung von Primär- und Sekundärregelleistung, die immer für sechs Monate vorzuhalten ist. Bei der Tertiärregelung können saisonale und tageszeitliche Schwankungen besser berücksichtigt werden, da die vorzuhaltende Leistung immer für den folgenden Tag ausgeschrieben wird. Bei Vattenfall Europe kann getrennt auf jeweils Vier-Stunden-Blöcke geboten werden, während bei E.on nur zwischen einer Hoch- und Niedertarifphase unterschieden wird. Da die disponible Leistung bereits am Vortag zu quantifizieren ist, ergibt sich die Notwendigkeit einer besonders guten Prognose für die KWK- Fahrweise. Die Auswertung der technischen und organisatorischen Anforderungen führt zu dem Ergebnis, dass für ein virtuelles Regelleistungskraftwerk vor allem der Minutenreservemarkt interessant ist. Für den Fall eines erfolgreichen Regelleistungsgebots wird einerseits die Vorhaltung der Leistung (Leistungspreis) und andererseits, im Falle eines Regelleistungsabrufs, die geleistete Arbeit (Arbeitspreis) vergütet. Hierbei erhält jeder Regelleistungsanbieter die von ihm im Angebot festgelegten Preise. Für eine wirtschaftliche Bewertung wurden mittlere Leistungspreise aller erfolgreichen Gebote im Zeitraum von Dezember 2004 bis November 2005 ausgewertet. Es ergibt sich ein mittlerer Leistungspreis für die positive Minutenreserve von 240 /MW an Werktagen und von 37 /MW an Wochenendtagen. Der mittlere Leistungspreis bezieht sich hierbei immer auf den gesamten Tag, Virtuelle Kraftwerke befi nden sich noch in der Erprobungsphase Es besteht noch Forschungsbedarf mit Blick auf Anlageneinbindung, Kommunikation und Sicherheitsaspekte Es entstehen zusätzliche Kosten beim Betreiber für Information und Kommunikation sowie gegebenenfalls Wärmespeicher Die disponible Leistung unterliegt je nach Einsatzfall tageszeitlichen bzw. saisonalen Schwankungen das heißt, im Mittel resultiert somit ein Wert von 1 Ct/kW für jede vorgehaltene Stunde an Werktagen. Dies ist im Vergleich zu den in Bild 1 dargestellten Stromgestehungskosten ein geringes zusätzliches Wertschöpfungspotenzial. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um die Vorhaltung von Leistung, durch die zunächst keine Kosten entstehen. Weiterhin muss beachtet werden, dass teilweise deutlich höhere Preise von einzelnen Anbietern im Betrachtungszeitraum erzielt wurden, wie zum Beispiel mit Preisen von bis zu 23 ct/kw bei E.on oder sogar bis zu 150 Ct/kW pro vorgehaltener Stunde bei RWE. Kommt es zu einem Abruf elektrischer Arbeit, durch den dem Anlagenbetreiber Kosten entstehen, wird diese elektrische Arbeit mit dem Arbeitspreis vergütet. Dieser lag beispielsweise bei E.on in der Regel zwischen 12 und 280 Ct/kWh. In Deutschland wird Minutenreserve jedoch nur sehr selten benötigt: Im Zeitraum von September bis Dezember 2005 wurde zum Beispiel im E.on-Netzgebiet in lediglich 109 von Viertelstunden Minutenreserve abgerufen. Der Arbeitspreis für negative Tertiärregelleistung beträgt normalerweise 0 Ct/kWh. Dies bedeutet, dass der im Falle eines Abrufs notwendige zusätzliche Strombezug aus dem Netz der allgemeinen Versorgung kostenlos erfolgt. Die mittleren Leistungspreise für die negative Minutenreserve lagen im obigen Auswertungszeitraum an Werktagen bei 47 /MW und am Wochenendtagen bei 96 /MW. Im Falle eines virtuellen Regelleistungskraftwerks sind die vermarktbaren Leistungen entscheidend. Wird zum Beispiel positive Regelleistung angeboten, was aus preislicher Sicht besonders attraktiv ist, dürfen die Anlagen in der Zeit, in der keine Regelleistung abgerufen wird, nur mit verminderter Leistung betrieben werden. Hierdurch verringern sich die Ausnutzungsdauer und Primärenergieeinsparungen gegenüber einer ungekoppelten Erzeugung, da der Wärmebedarf zu diesen Zeiten über den Spitzenlastkessel gedeckt werden muss. Die Quantifizierung der ökonomisch 56 BWK Bd. 58 (2006) Nr. 6
6 und technisch sinnvollen disponiblen Regelleistung aus Mikro-KWK-Anlagen ist eine der wesentlichen Ziele des KW21-E2-Projekts [5]. KWK-Potenziale Einschlägige Studien zur Energieversorgung der Zukunft gehen davon aus, dass der Anteil der dezentralen KWK- Stromerzeugung von den heute etwa 57 bis 62 TWh(el.)/a weiter ansteigen wird [6 bis 8]. Das für das Jahr 2050 ausgewiesene KWK-Potenzial reicht von etwa 116 bis 276 TWh(el.)/a [9]. Schon heute kann der KWK-Einsatz primärenergetisch betrachtet mit dem heutigen Stand der konventionellen Energieerzeugungstechnik konkurrieren, obwohl zumeist kleinere Leistungseinheiten zum Einsatz kommen [1]. Welches prognostizierte KWK-Potenzial tatsächlich erschlossen wird, hängt von den politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. In virtuellen Kraftwerken wird jedoch nur eine Teilmenge der dezentralen Erzeugungsstrukturen zusammengeschlossen sein. Aus wirtschaftlicher Sicht bieten Betriebskonzepte wie das Peak-Shaving, die Lastflussoptimierung oder die Bereitstellung von Regelleistung und -energie interessante Optionen. Die Möglichkeit einer zentralen Optimierung und Steuerbarkeit kann aus sicherheitsrelevanten Aspekten und der Aufrechterhaltung einer hohen Versorgungsqualität eine technische Lösung sein. Insbesondere bei einer deutlichen Zunahme dezentraler Stromerzeugung könnte dies sogar technisch notwendig werden. Es stellt sich die Frage, ob eine Vielzahl dezentraler Erzeugungsanlagen, betrieben nur nach internen Regelstrategien, ohne Einfluss der Bilanzkreisverantwortlichen in das Stromnetz einspeisen sollte. Zu einem vergleichbaren Ergebnis kommt auch die aktuelle VDE-Studie Versorgungsqualität im deutschen Stromversorgungssystem [10], in der durch die zunehmende dezentrale Erzeugung bis 2020 die Notwendigkeit von virtuellen Kraftwerken vorhergesagt wird. Fazit Der Begriff des virtuellen Kraftwerks wird derzeit als Oberbegriff für Forschungsprojekte genutzt, die sich dem Betrieb von dezentralen Energieerzeugungsanlagen widmen. In Hinblick auf die Anlageneinbindung, die Anlagenkommunikation sowie Aspekte der Versorgungssicherheit und -qualität besteht noch weiterer Forschungsbedarf. Wenn einfache, kostengünstige und effiziente Kommunikations- und Energiemanagementsysteme zur Verfügung stehen, können dezentrale Erzeugungsanlagen genutzt werden, um weitere, über die verbrauchsnahe Versorgung hinausgehende, energiewirtschaftliche Aufgaben zu übernehmen. Literatur [1] Arndt, U.; Köhler, D.; Krammer, Th.; Mühlbacher, H.: Das virtuelle Brennstoffzellen-Kraftwerk, Perspektiven einer Wasserstoff-Energiewirtschaft Teil 3. Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.v., München, März [2] Arndt, U.; Duschl, A.; Köhler, D.; Schwaegerl, P.: Energiewirtschaftliche Bewertung dezentraler KWK-Systeme für die Hausenergieversorgung, Perspektiven einer Wasserstoff-Energiewirtschaft Teil 5, Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.v., München, Juli [3] Wagner, U.; Roth, H.; Richter, S.; von Roon, S.: Perspektiven in der Kraftwerkstechnik. Projekt KW 21. BWK Bd. 57 (2005) Nr. 10, S [4] Verband der Netzbetreiber (VDN): TransmissionCode Netz- und Systemregeln der deutschen Übertragungsnetzbetreiber. Berlin, [5] Arndt, U.; von Roon, S.: Innovative KWK-Systeme. Ersatz für Heizungen und Kraftwerke? Vortrag anlässlich des 37. Kraftwerkstechnischen Kolloquiums, 18. bis 19. Oktober 2005, Dresden. [6] [7] Wärme- und Heizkraftwirtschaft in Deutschland: Arbeitsbericht 2004 der AGFW. [8] Blesl, M.; Fahl, U.; Voß, A.: Wirksamkeit des Kraft- Wärme-Kopplungs-Gesetzes. Energiewirtschaftliche Tagesfragen, Bd. 56 (2006), Nr. 4, S [9] Enquête-Kommission des Bundestags: Nachhaltige Energieversorgung, Bundestags-Drucksache 14/9400, Ziffer 870, btd/14/094/ pdf [10] ETG-Task-Force Versorgungsqualität: Versorgungsqualität im deutschen Stromversorgungssystem. Energietechnische Gesellschaft im VDE (Hrsg.), 2006.
BHKW und Wärmepumpe von Endkunden fernsteuern
 1 BHKW und Wärmepumpe von Endkunden fernsteuern Wind und Sonne geben zunehmende den Takt der Energieerzeugung vor. Um die erneuerbaren Energien besser in das Stromnetz integrieren zu können, koordiniert
1 BHKW und Wärmepumpe von Endkunden fernsteuern Wind und Sonne geben zunehmende den Takt der Energieerzeugung vor. Um die erneuerbaren Energien besser in das Stromnetz integrieren zu können, koordiniert
Das eigene Kraftwerk im Haus.
 Das eigene Kraftwerk im Haus. Stromerzeugende Heizungen etablieren sich immer mehr und fügen sich perfekt in praktisch jedes Wohnkonzept ein. 2 Das eigene Kraftwerk im Haus. Gewinnen Sie gleichzeitig Strom
Das eigene Kraftwerk im Haus. Stromerzeugende Heizungen etablieren sich immer mehr und fügen sich perfekt in praktisch jedes Wohnkonzept ein. 2 Das eigene Kraftwerk im Haus. Gewinnen Sie gleichzeitig Strom
Contracting. dezentrale Energieerzeugung mit kleinen BHKWs
 Contracting dezentrale Energieerzeugung mit kleinen BHKWs Stadt Bad Oldesloe 100% Stadt Mölln 100% Stadt Ratzeburg 100% 1/3 1/3 1/3 Energievertrieb in eigenen und fremden Netzgebieten 100% 51% 36% Gasnetze
Contracting dezentrale Energieerzeugung mit kleinen BHKWs Stadt Bad Oldesloe 100% Stadt Mölln 100% Stadt Ratzeburg 100% 1/3 1/3 1/3 Energievertrieb in eigenen und fremden Netzgebieten 100% 51% 36% Gasnetze
Mit Pumpspeicherkraftwerken
 Die Energiewende erfolgreich gestalten: Mit Pumpspeicherkraftwerken Pressekonferenz Berlin, 2014-04-15 PSW Goldisthal, 1060 MW, 300m Fallhöhe, 8,5 GWh el Voith in Zahlen In über 50 Ländern 43.000 Mitarbeiter
Die Energiewende erfolgreich gestalten: Mit Pumpspeicherkraftwerken Pressekonferenz Berlin, 2014-04-15 PSW Goldisthal, 1060 MW, 300m Fallhöhe, 8,5 GWh el Voith in Zahlen In über 50 Ländern 43.000 Mitarbeiter
Blockheizkraftwerke bis 100 kw elektrischer Leistung Teil 2: BHKW-Heizölmotoren
 Marktübersicht 2000: Blockheizkraftwerke bis 100 kw elektrischer Leistung Teil 2: BHKW-Heizölmotoren Markus Gailfuß*, Rastatt Der für die Einzelobjektversorgung (Wohn-, Bürogebäude, Schulen) und kleinere
Marktübersicht 2000: Blockheizkraftwerke bis 100 kw elektrischer Leistung Teil 2: BHKW-Heizölmotoren Markus Gailfuß*, Rastatt Der für die Einzelobjektversorgung (Wohn-, Bürogebäude, Schulen) und kleinere
Erfahrungen der Wohnungswirtschaft mit Mieterstrom
 Berliner Energietage 2016 Möglichkeiten und Hindernisse für Mieterstromprojekte in Berlin und anderswo 11.04.2016 Erfahrungen der Wohnungswirtschaft mit Mieterstrom Dr.-Ing. Ingrid Vogler GdW Bundesverband
Berliner Energietage 2016 Möglichkeiten und Hindernisse für Mieterstromprojekte in Berlin und anderswo 11.04.2016 Erfahrungen der Wohnungswirtschaft mit Mieterstrom Dr.-Ing. Ingrid Vogler GdW Bundesverband
ENERGIE AUS BERGHEIM FÜR BERGHEIM
 ENERGIE AUS BERGHEIM FÜR BERGHEIM Ohne Energie geht in unserem Alltag nichts. Sie wird erzeugt, umgewandelt, transportiert, gespeichert und verbraucht. Dabei kann man "Energie" selbst nicht sehen, hören,
ENERGIE AUS BERGHEIM FÜR BERGHEIM Ohne Energie geht in unserem Alltag nichts. Sie wird erzeugt, umgewandelt, transportiert, gespeichert und verbraucht. Dabei kann man "Energie" selbst nicht sehen, hören,
ecotrialog#5: Trampelpfade Neue Wege, um die Stromkosten von Datacenter-Betreibern zu senken!
 ecotrialog#5: Trampelpfade Neue Wege, um die Stromkosten von Datacenter-Betreibern zu senken! Hamburg, 5. Juni 2013 Vortrag: Mit der NEA am Regelenergiemarkt partizipieren 1 Next Kraftwerke Langjährige
ecotrialog#5: Trampelpfade Neue Wege, um die Stromkosten von Datacenter-Betreibern zu senken! Hamburg, 5. Juni 2013 Vortrag: Mit der NEA am Regelenergiemarkt partizipieren 1 Next Kraftwerke Langjährige
Überlagerung des Stromverbrauchs in Baden-Württemberg mit der Stromerzeugung aller Windenergie- und Fotovoltaik-Anlagen in Deutschland: März 2015
 Überlagerung des Stromverbrauchs in Baden-Württemberg mit der Stromerzeugung aller Windenergie- und Fotovoltaik-Anlagen in Deutschland: März 2015 Der Stromverbrauch in Baden-Württemberg (10,5 Millionen
Überlagerung des Stromverbrauchs in Baden-Württemberg mit der Stromerzeugung aller Windenergie- und Fotovoltaik-Anlagen in Deutschland: März 2015 Der Stromverbrauch in Baden-Württemberg (10,5 Millionen
Nachhaltigkeit in der Energieversorgung Energieeinsparungen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Das e³-programm von EWE
 Nachhaltigkeit in der Energieversorgung Energieeinsparungen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Das e³-programm von EWE Strausberg, 06. September 2012 Eine saubere Zukunft braucht Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit in der Energieversorgung Energieeinsparungen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Das e³-programm von EWE Strausberg, 06. September 2012 Eine saubere Zukunft braucht Nachhaltigkeit
Greenpeace Energy und die Energiewende
 Greenpeace Energy und die Energiewende Marcel Keiffenheim Leiter Energiepolitik, Greenpeace Energy Das sagen die großen Energiekonzerne heute: 2 Das sagten die großen Energiekonzerne vor einem Jahrzehnt:
Greenpeace Energy und die Energiewende Marcel Keiffenheim Leiter Energiepolitik, Greenpeace Energy Das sagen die großen Energiekonzerne heute: 2 Das sagten die großen Energiekonzerne vor einem Jahrzehnt:
Marktprämienmodell versus EEG-Umlagen Verringerung. Berliner Energietage, 25.05.2012 Oliver Hummel, Vorstand NATURSTROM AG
 Marktprämienmodell versus EEG-Umlagen Verringerung Berliner Energietage, 25.05.2012 Seite 1 Oliver Hummel, Vorstand NATURSTROM AG Inhalt Agenda 1. Grundlagen 2. Vergleich Marktprämie - 39 EEG 3. Beispiel
Marktprämienmodell versus EEG-Umlagen Verringerung Berliner Energietage, 25.05.2012 Seite 1 Oliver Hummel, Vorstand NATURSTROM AG Inhalt Agenda 1. Grundlagen 2. Vergleich Marktprämie - 39 EEG 3. Beispiel
Informationsblatt zum Einspeisemanagement bei EEG/KWK-Anlage im Netzgebiet der Stadtwerke Eutin GmbH
 Informationsblatt zum Einspeisemanagement bei EEG/KWK-Anlage im Netzgebiet der Stadtwerke Eutin GmbH Stand 01/2013 Inhalt 1. Allgemeines... 2 2. Anwendungsbereich... 2 3. Technische Realisierung... 3 4.
Informationsblatt zum Einspeisemanagement bei EEG/KWK-Anlage im Netzgebiet der Stadtwerke Eutin GmbH Stand 01/2013 Inhalt 1. Allgemeines... 2 2. Anwendungsbereich... 2 3. Technische Realisierung... 3 4.
Zusammensetzung des Strompreises
 Zusammensetzung des Strompreises Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen Ihres Strompreises! Welche Kosten werden durch den Preis abgedeckt und wer erhält am Ende eigentlich das Geld? Jessica Brockmann,
Zusammensetzung des Strompreises Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen Ihres Strompreises! Welche Kosten werden durch den Preis abgedeckt und wer erhält am Ende eigentlich das Geld? Jessica Brockmann,
Erste Erfahrungen mit dem SDL- Bonus für Windenergieanlagen und Herausforderungen für andere Erzeugungsanlagen
 Erste Erfahrungen mit dem SDL- Bonus für Windenergieanlagen und Herausforderungen für andere Erzeugungsanlagen EnergieVerein Fachgespräch Zukunftsfähigkeit deutscher Energienetze Berliner Energietage 2010,
Erste Erfahrungen mit dem SDL- Bonus für Windenergieanlagen und Herausforderungen für andere Erzeugungsanlagen EnergieVerein Fachgespräch Zukunftsfähigkeit deutscher Energienetze Berliner Energietage 2010,
RundumWärme NATÜRLICH WÄRME. Ihre passende Wärmelösung
 RundumWärme NATÜRLICH WÄRME Ihre passende Wärmelösung PASSEND FÜR SIE Das Wärmekonzept für Ihren Neubau oder Ihre Sanierung Einfach, zuverlässig, günstig so wünschen sich unsere Kunden Ihre neue Wärmeversorgung.
RundumWärme NATÜRLICH WÄRME Ihre passende Wärmelösung PASSEND FÜR SIE Das Wärmekonzept für Ihren Neubau oder Ihre Sanierung Einfach, zuverlässig, günstig so wünschen sich unsere Kunden Ihre neue Wärmeversorgung.
Mieterstrom. Finanzielle Vorteile durch umweltschonende Stromerzeugung direkt an Ihren Objekten.
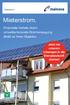 Mieterstrom Mieterstrom. Finanzielle Vorteile durch umweltschonende Stromerzeugung direkt an Ihren Objekten. Jetzt mit unseren Lösungen in die Energiezukunft starten! Klimaaktiv! www.mainova.de Die Energiezukunft
Mieterstrom Mieterstrom. Finanzielle Vorteile durch umweltschonende Stromerzeugung direkt an Ihren Objekten. Jetzt mit unseren Lösungen in die Energiezukunft starten! Klimaaktiv! www.mainova.de Die Energiezukunft
Familie Wiegel. Solarstrom vom eigenen Dach. In Kooperation mit: www.stadtwerke-erfurt.de/solar
 Familie Wiegel Solarstrom vom eigenen Dach. In Kooperation mit: www.stadtwerke-erfurt.de/solar Werden Sie Ihr eigener Stromerzeuger. Die SWE Energie GmbH versorgt Kunden zuverlässig und zu fairen Preisen
Familie Wiegel Solarstrom vom eigenen Dach. In Kooperation mit: www.stadtwerke-erfurt.de/solar Werden Sie Ihr eigener Stromerzeuger. Die SWE Energie GmbH versorgt Kunden zuverlässig und zu fairen Preisen
Ausbau der Niederspannungsnetze minimieren Durch Integration dezentraler Speicher
 Ausbau der Niederspannungsnetze minimieren Durch Integration dezentraler Speicher Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV) Dipl.-Ing. Wolf von Fabeck Vordringliches Problem: Anschluss von Solarstromanlagen
Ausbau der Niederspannungsnetze minimieren Durch Integration dezentraler Speicher Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV) Dipl.-Ing. Wolf von Fabeck Vordringliches Problem: Anschluss von Solarstromanlagen
Flensburg extra öko. Ihr Ökostrom aus 100 % erneuerbaren Energien. Ein Wechsel, der sich auszahlt.
 Flensburg extra öko Ihr Ökostrom aus 100 % erneuerbaren Energien Ein Wechsel, der sich auszahlt. Was ist Flensburg extra öko? Grüner Strom aus regenerativer Energie Flensburg extra öko ist der umweltfreundliche
Flensburg extra öko Ihr Ökostrom aus 100 % erneuerbaren Energien Ein Wechsel, der sich auszahlt. Was ist Flensburg extra öko? Grüner Strom aus regenerativer Energie Flensburg extra öko ist der umweltfreundliche
Warum Deutschland neue Netze braucht! Energieeffizienzmesse Frankfurt
 Warum Deutschland neue Netze braucht! Energieeffizienzmesse Frankfurt 01.09.2015 Dr. Heinrich Gartmair TenneT auf einen Blick Europas erster grenzüberschreitender ÜNB Fakten & Zahlen 2014 (in Klammern:
Warum Deutschland neue Netze braucht! Energieeffizienzmesse Frankfurt 01.09.2015 Dr. Heinrich Gartmair TenneT auf einen Blick Europas erster grenzüberschreitender ÜNB Fakten & Zahlen 2014 (in Klammern:
1 GRUNDLAGEN SMART ENERGY. 1.1 Die Vision Smart Energy. 1.1.1 Zielsetzung Einführung intelligenter Messsysteme
 Grundlagen Smart Energy 1 GRUNDLAGEN SMART ENERGY 1.1 Die Vision Smart Energy 1.1.1 Zielsetzung Einführung intelligenter Messsysteme Smart Energy - intelligentes Stromnetz heißt die Vision, bei der die
Grundlagen Smart Energy 1 GRUNDLAGEN SMART ENERGY 1.1 Die Vision Smart Energy 1.1.1 Zielsetzung Einführung intelligenter Messsysteme Smart Energy - intelligentes Stromnetz heißt die Vision, bei der die
Energetische Klassen von Gebäuden
 Energetische Klassen von Gebäuden Grundsätzlich gibt es Neubauten und Bestandsgebäude. Diese Definition ist immer aktuell. Aber auch ein heutiger Neubau ist in drei (oder vielleicht erst zehn?) Jahren
Energetische Klassen von Gebäuden Grundsätzlich gibt es Neubauten und Bestandsgebäude. Diese Definition ist immer aktuell. Aber auch ein heutiger Neubau ist in drei (oder vielleicht erst zehn?) Jahren
Wirtschaftlichkeit der Eigenstromerzeugung
 Wirtschaftlichkeit der Eigenstromerzeugung Prof. Dr.-Ing. Christoph Kail FH Südwestfalen, Soest 11.03.2014 Photovoltaik und Kraft-Wärme-Kopplung in Lippstädter Unternehmen Veranstalter: Stadt Lippstadt,
Wirtschaftlichkeit der Eigenstromerzeugung Prof. Dr.-Ing. Christoph Kail FH Südwestfalen, Soest 11.03.2014 Photovoltaik und Kraft-Wärme-Kopplung in Lippstädter Unternehmen Veranstalter: Stadt Lippstadt,
15 Arten von QR-Code-Inhalten!
 15 Arten von QR-Code-Inhalten! Quelle: www.rohinie.eu QR-Codes(= Quick Response Codes) sind Pop-Art-Matrix Barcodes, die Informationen in einer kleinen rechteckigen Grafik enthalten. Sie sind auch eine
15 Arten von QR-Code-Inhalten! Quelle: www.rohinie.eu QR-Codes(= Quick Response Codes) sind Pop-Art-Matrix Barcodes, die Informationen in einer kleinen rechteckigen Grafik enthalten. Sie sind auch eine
Kraft-Wärme-Kopplung in Deutschland Entwicklung im Zeitraum 2003-2010 und mögliche Ausbaupfade 2020/2030
 Kraft-Wärme-Kopplung in Deutschland Entwicklung im Zeitraum 2003-2010 und mögliche Ausbaupfade 2020/2030 Sabine Gores, Öko-Institut e.v., Berlin BMU, KWK-Workshop 16. November 2011 Überblick Stand der
Kraft-Wärme-Kopplung in Deutschland Entwicklung im Zeitraum 2003-2010 und mögliche Ausbaupfade 2020/2030 Sabine Gores, Öko-Institut e.v., Berlin BMU, KWK-Workshop 16. November 2011 Überblick Stand der
Der Stadtrat an den Gemeinderat
 Der Stadtrat an den Gemeinderat Beschluss-Nr. 194 Interpellation betreffend Solarstrom für die Erzeugung von Wasserstoff und Methangas der Gemeinderäte Michael Hefti und Stefan Geiges Beantwortung Frau
Der Stadtrat an den Gemeinderat Beschluss-Nr. 194 Interpellation betreffend Solarstrom für die Erzeugung von Wasserstoff und Methangas der Gemeinderäte Michael Hefti und Stefan Geiges Beantwortung Frau
Stromspeicher in der Energiewende
 e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3, 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 E-Mail: info@eundu-online.de Internet: www.eundu-online.de Elbrinxen, 26.11.2014 Michael Brieden-Segler
e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3, 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 E-Mail: info@eundu-online.de Internet: www.eundu-online.de Elbrinxen, 26.11.2014 Michael Brieden-Segler
Die Zukunft der Zukunftsforschung im Deutschen Management: eine Delphi Studie
 Die Zukunft der Zukunftsforschung im Deutschen Management: eine Delphi Studie Executive Summary Zukunftsforschung und ihre Methoden erfahren in der jüngsten Vergangenheit ein zunehmendes Interesse. So
Die Zukunft der Zukunftsforschung im Deutschen Management: eine Delphi Studie Executive Summary Zukunftsforschung und ihre Methoden erfahren in der jüngsten Vergangenheit ein zunehmendes Interesse. So
Alternative Direktvermarktung Der Weg zum lokalen Stromversorger?! SPREEWIND, 13.11.2014
 Alternative Direktvermarktung Der Weg zum lokalen Stromversorger?! SPREEWIND, 13.11.2014 ENERVIE Konzernstruktur 19,02 % 14,20 % 42,66 % 24,12 % Aktionäre Weitere Kommunen (1) Stadt Hagen Stadt Lüdenscheid
Alternative Direktvermarktung Der Weg zum lokalen Stromversorger?! SPREEWIND, 13.11.2014 ENERVIE Konzernstruktur 19,02 % 14,20 % 42,66 % 24,12 % Aktionäre Weitere Kommunen (1) Stadt Hagen Stadt Lüdenscheid
- 3 - Thesen zum Thema Grundlast, Residuallast und Regelenergie
 - 2 - In der Vergangenheit wurde die Stromnachfrage fast ausschließlich durch steuerbare Kraftwerke vor allem Kohle-, Gas- und Kernkraftwerke gedeckt. Um den Bedarf an steuerbaren Kraftwerken zur Sicherstellung
- 2 - In der Vergangenheit wurde die Stromnachfrage fast ausschließlich durch steuerbare Kraftwerke vor allem Kohle-, Gas- und Kernkraftwerke gedeckt. Um den Bedarf an steuerbaren Kraftwerken zur Sicherstellung
Solarpark. Kurz-Info. Bürgerbeteiligungs-Projekt
 Kurz-Info Windund Solarpark Bürgerbeteiligungs-Projekt Treiben Sie die Energiewende voran und machen Sie mit! Entscheiden Sie sich jetzt und sichern sich den Frühzeichner-Bonus. Ein Erfolgsprojekt wird
Kurz-Info Windund Solarpark Bürgerbeteiligungs-Projekt Treiben Sie die Energiewende voran und machen Sie mit! Entscheiden Sie sich jetzt und sichern sich den Frühzeichner-Bonus. Ein Erfolgsprojekt wird
Kandidatinnen und Kandidaten für ein Direktmandat für den 18. Deutschen Bundestag. Bundestagswahl 2013
 Kandidatinnen und Kandidaten für ein Direktmandat für den 18. Deutschen Bundestag Bundesverband WindEnergie e. V. Neustädtische Kirchstraße 6 10117 Berlin politik@wind-energie.de Bundestagswahl 2013 Sehr
Kandidatinnen und Kandidaten für ein Direktmandat für den 18. Deutschen Bundestag Bundesverband WindEnergie e. V. Neustädtische Kirchstraße 6 10117 Berlin politik@wind-energie.de Bundestagswahl 2013 Sehr
Fernwärme-Erschließung für das Baugebiet Auf dem Kalverradd
 Fernwärme-Erschließung für das Baugebiet Auf dem Kalverradd 1 Baugebiet Auf dem Kalverradd Daten und Fakten 213 Grundstücke für Einfamilienhaus- bzw. Doppelhaus-Bebauung 12 Grundstücke für RH Bebauung
Fernwärme-Erschließung für das Baugebiet Auf dem Kalverradd 1 Baugebiet Auf dem Kalverradd Daten und Fakten 213 Grundstücke für Einfamilienhaus- bzw. Doppelhaus-Bebauung 12 Grundstücke für RH Bebauung
Auslegung von KWK-Anlagen als virtuelle Kraftwerke
 Auslegung von KWK-Anlagen als virtuelle Kraftwerke Jörg Entress Michael Bachseitz Meinhard Ryba Hochschule Biberach Studiengang Energie-Ingenieurwesen (B.Eng.) Institut für Gebäude- und Energiesysteme
Auslegung von KWK-Anlagen als virtuelle Kraftwerke Jörg Entress Michael Bachseitz Meinhard Ryba Hochschule Biberach Studiengang Energie-Ingenieurwesen (B.Eng.) Institut für Gebäude- und Energiesysteme
Energiewirtschaftliche Auswirkungen der Eigenverbrauchsregelung. Eva Hauser, hauser@izes.de
 Energiewirtschaftliche Auswirkungen der Eigenverbrauchsregelung Eva Hauser, hauser@izes.de Energiewirtschaftliche Auswirkungen der Eigenverbrauchsregelung 1 2 3 Eigenverbrauch und Energieeffizienz im Haushaltsbereich
Energiewirtschaftliche Auswirkungen der Eigenverbrauchsregelung Eva Hauser, hauser@izes.de Energiewirtschaftliche Auswirkungen der Eigenverbrauchsregelung 1 2 3 Eigenverbrauch und Energieeffizienz im Haushaltsbereich
Urteil des OLG Oldenburg:
 Urteil des OLG Oldenburg: Grundsätzliches zu den Begriffen der Anlage und Inbetriebnahme bei Biogasanlagen Paluka Sobola & Partner Neupfarrplatz 10 93047 Regensburg Tel. 0941 58 57 1-0 Fax 0941 58 57 1-14
Urteil des OLG Oldenburg: Grundsätzliches zu den Begriffen der Anlage und Inbetriebnahme bei Biogasanlagen Paluka Sobola & Partner Neupfarrplatz 10 93047 Regensburg Tel. 0941 58 57 1-0 Fax 0941 58 57 1-14
Die Bedeutung der erneuerbaren Energien in Zukunft
 Die Bedeutung der erneuerbaren Energien in Zukunft Tage der erneuerbaren Energien 2009 in Ibbenbüren Ibbenbüren, 20. April 2009 Holger Gassner, RWE Innogy GmbH RWE Innogy GmbH, 20. April 2009 SEITE 1 RWE
Die Bedeutung der erneuerbaren Energien in Zukunft Tage der erneuerbaren Energien 2009 in Ibbenbüren Ibbenbüren, 20. April 2009 Holger Gassner, RWE Innogy GmbH RWE Innogy GmbH, 20. April 2009 SEITE 1 RWE
Die Einbindung erneuerbarer Energien ins Smart Grid - Wie wird die zukünftige Energieversorgung nachhaltig sichergestellt
 Die Einbindung erneuerbarer Energien ins Smart Grid - Wie wird die zukünftige Energieversorgung nachhaltig sichergestellt Dr. Jürgen Jarosch, Elektro Technologie Zentrum, Stuttgart 1 Agenda Ausgangspunkt
Die Einbindung erneuerbarer Energien ins Smart Grid - Wie wird die zukünftige Energieversorgung nachhaltig sichergestellt Dr. Jürgen Jarosch, Elektro Technologie Zentrum, Stuttgart 1 Agenda Ausgangspunkt
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren
 Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Guck mal, Energiewende! Eine Ausstellung über smarte Energielösungen in der HafenCity
 Guck mal, Energiewende! Eine Ausstellung über smarte Energielösungen in der HafenCity Willkommen in meinem smarten Zuhause. Ich bin Paul. Gemeinsam mit meinem Hund Ben lebe ich in einem Smart Home. Was
Guck mal, Energiewende! Eine Ausstellung über smarte Energielösungen in der HafenCity Willkommen in meinem smarten Zuhause. Ich bin Paul. Gemeinsam mit meinem Hund Ben lebe ich in einem Smart Home. Was
Gewinn für die Region. Mit erneuerbaren energien in die zukunft investieren. eine Initiative der. und der. Volks- und Raiffeisenbank eg, Güstrow
 eine Initiative der und der Volks- und Raiffeisenbank eg, Güstrow Raiffeisenbank eg, Hagenow VR-Bank eg, Schwerin Raiffeisenbank eg, Südstormarn Mölln Gewinn für die Region Mit erneuerbaren energien in
eine Initiative der und der Volks- und Raiffeisenbank eg, Güstrow Raiffeisenbank eg, Hagenow VR-Bank eg, Schwerin Raiffeisenbank eg, Südstormarn Mölln Gewinn für die Region Mit erneuerbaren energien in
Erfahrungen aus Pilotprojekten zur Optimierung durch virtuelle Kraftwerke
 Erfahrungen aus Pilotprojekten zur Optimierung durch virtuelle Kraftwerke Martin Kramer, RWE Deutschland AG Dena Dialogforum, Berlin, 24. April 2013 RWE Deutschland AG 24.04.2013 SEITE 1 RWE Deutschland
Erfahrungen aus Pilotprojekten zur Optimierung durch virtuelle Kraftwerke Martin Kramer, RWE Deutschland AG Dena Dialogforum, Berlin, 24. April 2013 RWE Deutschland AG 24.04.2013 SEITE 1 RWE Deutschland
Wasserkraft früher und heute!
 Wasserkraft früher und heute! Wasserkraft leistet heute einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung in Österreich und auf der ganzen Welt. Aber war das schon immer so? Quelle: Elvina Schäfer, FOTOLIA In
Wasserkraft früher und heute! Wasserkraft leistet heute einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung in Österreich und auf der ganzen Welt. Aber war das schon immer so? Quelle: Elvina Schäfer, FOTOLIA In
Zusammenspiel ÜNB VNB in Hinblick auf SDL Berlin, 15. Mai 2014
 Zusammenspiel ÜNB VNB in Hinblick auf SDL Berlin, 15. Mai 2014 Quelle: dena-studie SDL2030 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse der Studie, Deutsche Energie-Agentur, 11.02.2014 2 Alle in der Tabelle
Zusammenspiel ÜNB VNB in Hinblick auf SDL Berlin, 15. Mai 2014 Quelle: dena-studie SDL2030 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse der Studie, Deutsche Energie-Agentur, 11.02.2014 2 Alle in der Tabelle
EEWärmeG. Welche Auswirkungen hat das EEWärmeG auf Planung und Betrieb von Logistikzentren
 EEWärmeG Das Erneuerbare Energien Wärmegesetz Welche Auswirkungen hat das EEWärmeG auf Planung und Betrieb von Logistikzentren Alexander Wölflick Geschäftsführer Haydn Energie Consult GmbH - HEC Übersicht
EEWärmeG Das Erneuerbare Energien Wärmegesetz Welche Auswirkungen hat das EEWärmeG auf Planung und Betrieb von Logistikzentren Alexander Wölflick Geschäftsführer Haydn Energie Consult GmbH - HEC Übersicht
Betriebsplanung eines Virtuellen Kraftwerks
 Betriebsplanung eines Virtuellen Kraftwerks 5. BHKW-Info Tage 2009 Goslar, 24. Oktober 2009 Dipl.-Ing. Michael Steck Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.v. 11 Gliederung 1. Forschungsverbund EnEff:
Betriebsplanung eines Virtuellen Kraftwerks 5. BHKW-Info Tage 2009 Goslar, 24. Oktober 2009 Dipl.-Ing. Michael Steck Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.v. 11 Gliederung 1. Forschungsverbund EnEff:
Mobile Intranet in Unternehmen
 Mobile Intranet in Unternehmen Ergebnisse einer Umfrage unter Intranet Verantwortlichen aexea GmbH - communication. content. consulting Augustenstraße 15 70178 Stuttgart Tel: 0711 87035490 Mobile Intranet
Mobile Intranet in Unternehmen Ergebnisse einer Umfrage unter Intranet Verantwortlichen aexea GmbH - communication. content. consulting Augustenstraße 15 70178 Stuttgart Tel: 0711 87035490 Mobile Intranet
Windparks an Land. Unser Engagement für eine sichere und saubere Stromerzeugung. Energien optimal einsetzen. engie-deutschland.de
 Windparks an Land Unser Engagement für eine sichere und saubere Stromerzeugung Energien optimal einsetzen. engie-deutschland.de -Gruppe innovativ, erneuerbar, effizient Deutschland Energiezukunft gestalten
Windparks an Land Unser Engagement für eine sichere und saubere Stromerzeugung Energien optimal einsetzen. engie-deutschland.de -Gruppe innovativ, erneuerbar, effizient Deutschland Energiezukunft gestalten
Produktionsprofile in der Energiewirtschaft 24.10.2009
 Produktionsprofile in der Energiewirtschaft 24.10.2009 Harz Energie Netz GmbH Bereich Netzwirtschaft Stefan Lummer Tel.: 05522/503-120 s.lummer@harzenergie-netz.de 1 Agenda Produktionsprofile in der Energiewirtschaft
Produktionsprofile in der Energiewirtschaft 24.10.2009 Harz Energie Netz GmbH Bereich Netzwirtschaft Stefan Lummer Tel.: 05522/503-120 s.lummer@harzenergie-netz.de 1 Agenda Produktionsprofile in der Energiewirtschaft
Insiderwissen 2013. Hintergrund
 Insiderwissen 213 XING EVENTS mit der Eventmanagement-Software für Online Eventregistrierung &Ticketing amiando, hat es sich erneut zur Aufgabe gemacht zu analysieren, wie Eventveranstalter ihre Veranstaltungen
Insiderwissen 213 XING EVENTS mit der Eventmanagement-Software für Online Eventregistrierung &Ticketing amiando, hat es sich erneut zur Aufgabe gemacht zu analysieren, wie Eventveranstalter ihre Veranstaltungen
Das EEG aus Sicht der Wasserkraftbetreiber. - ein Diskussionsbeitrag -
 Das EEG aus Sicht der Wasserkraftbetreiber - ein Diskussionsbeitrag - Dr.-Ing. Stephan Heimerl Abteilungsleiter Wasserkraft-Studien DUH-Workshop Wasserkraft, Gewässerökologie & EEG, 03.12.2008, Dr. S.
Das EEG aus Sicht der Wasserkraftbetreiber - ein Diskussionsbeitrag - Dr.-Ing. Stephan Heimerl Abteilungsleiter Wasserkraft-Studien DUH-Workshop Wasserkraft, Gewässerökologie & EEG, 03.12.2008, Dr. S.
23. Fachgespräch der Clearingstelle EEG. 08.03.2016 00416-16 / 2979434 BECKER BÜTTNER HELD Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater PartGmbB
 Technische Einrichtungen nach 9, 36 EEG Pflichten, Rechte & Sanktionen: Was ist erforderlich? Welche Pflichten haben die Beteiligten und welche Rechtsfolgen gibt es? 23. Fachgespräch der Clearingstelle
Technische Einrichtungen nach 9, 36 EEG Pflichten, Rechte & Sanktionen: Was ist erforderlich? Welche Pflichten haben die Beteiligten und welche Rechtsfolgen gibt es? 23. Fachgespräch der Clearingstelle
Mitteilung zur Kenntnisnahme
 17. Wahlperiode Drucksache 17/1970 14.11.2014 Mitteilung zur Kenntnisnahme Lizenzmanagement Drucksache 17/0400 ( II.A.14.6) Schlussbericht Abgeordnetenhaus von Berlin 17. Wahlperiode Seite 2 Drucksache
17. Wahlperiode Drucksache 17/1970 14.11.2014 Mitteilung zur Kenntnisnahme Lizenzmanagement Drucksache 17/0400 ( II.A.14.6) Schlussbericht Abgeordnetenhaus von Berlin 17. Wahlperiode Seite 2 Drucksache
Ökostrom Erzeugung, Transport und Marktintegration Vortrag zur Jahrestagung des FVS Forschungsverbund Sonnenenergie
 Ökostrom Erzeugung, Transport und Marktintegration Vortrag zur Jahrestagung des FVS Forschungsverbund Sonnenenergie Berlin, 22.09.2006 Dr. Thomas E. Banning Vorstand NATURSTROM AG Strom kommt aus der Steckdose
Ökostrom Erzeugung, Transport und Marktintegration Vortrag zur Jahrestagung des FVS Forschungsverbund Sonnenenergie Berlin, 22.09.2006 Dr. Thomas E. Banning Vorstand NATURSTROM AG Strom kommt aus der Steckdose
über die kfe Zusammenschluss von 35 Stadt- Gemeindewerken Gründung Dez. 1998 Gesellschaftszweck Energiedatenmanagement
 über die kfe Zusammenschluss von 35 Stadt- Gemeindewerken Gründung Dez. 1998 Gesellschaftszweck Stromeinkauf Energiedatenmanagement Diverse Dienstleistungen 6 Mitarbeiter www.kfelt.de Organisation der
über die kfe Zusammenschluss von 35 Stadt- Gemeindewerken Gründung Dez. 1998 Gesellschaftszweck Stromeinkauf Energiedatenmanagement Diverse Dienstleistungen 6 Mitarbeiter www.kfelt.de Organisation der
Energiewende. im Konflikt zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Sigismund KOBE. Institut für Theoretische Physik Technische Universität Dresden
 Energiewende im Konflikt zwischen Anspruch und Wirklichkeit Sigismund KOBE Institut für Theoretische Physik Technische Universität Dresden http://www.physik.tu-dresden.de/itp/members/kobe/eingang.html
Energiewende im Konflikt zwischen Anspruch und Wirklichkeit Sigismund KOBE Institut für Theoretische Physik Technische Universität Dresden http://www.physik.tu-dresden.de/itp/members/kobe/eingang.html
Wichtige Parteien in Deutschland
 MAXI MODU L 4 M1 Arbeitsauftrag Bevor du wählen gehst, musst du zuerst wissen, welche Partei dir am besten gefällt. Momentan gibt es im Landtag Brandenburg fünf Parteien:,,, Die Linke und Bündnis 90/.
MAXI MODU L 4 M1 Arbeitsauftrag Bevor du wählen gehst, musst du zuerst wissen, welche Partei dir am besten gefällt. Momentan gibt es im Landtag Brandenburg fünf Parteien:,,, Die Linke und Bündnis 90/.
Der Power System Simulator an der BTU Cottbus-Senftenberg
 Der Power System Simulator an der BTU Cottbus-Senftenberg - ein Ausbildungs- und Trainingssystem für eine zuverlässige Netzintegration erneuerbarer Energien und Elektromobilität Als Teil des Schaufensterprojekte
Der Power System Simulator an der BTU Cottbus-Senftenberg - ein Ausbildungs- und Trainingssystem für eine zuverlässige Netzintegration erneuerbarer Energien und Elektromobilität Als Teil des Schaufensterprojekte
Feldversuch virtuelles Kraftwerk für Haushalte in Baden-Württemberg
 Feldversuch virtuelles Kraftwerk für Haushalte in Baden-Württemberg Dr. Holger Wiechmann EnBW Vertrieb GmbH 28. Oktober 2013 Energie braucht Impulse Hintergrund - Die Beteiligten der Smarten Energiewelt
Feldversuch virtuelles Kraftwerk für Haushalte in Baden-Württemberg Dr. Holger Wiechmann EnBW Vertrieb GmbH 28. Oktober 2013 Energie braucht Impulse Hintergrund - Die Beteiligten der Smarten Energiewelt
RWE Power KOHLE FÜRS STUDIUM! Spannender Studieren mit Power Engineers. Power Engineers Die Studienförderung von RWE Power.
 RWE ower KOHLE FÜRS STUDIUM! Spannender Studieren mit ower Engineers. ower Engineers Die Studienförderung von RWE ower. KOHLE FÜRS STUDIUM! Spannender Studieren mit ower Engineers. ower Engineers ist die
RWE ower KOHLE FÜRS STUDIUM! Spannender Studieren mit ower Engineers. ower Engineers Die Studienförderung von RWE ower. KOHLE FÜRS STUDIUM! Spannender Studieren mit ower Engineers. ower Engineers ist die
Erzeugung von BioErdgas und ökonomische
 Erzeugung von BioErdgas und ökonomische Rahmenbedingungen für den Einsatz im BHKW BioErdgas in kommunalen Liegenschaften Eine Veranstaltung des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft
Erzeugung von BioErdgas und ökonomische Rahmenbedingungen für den Einsatz im BHKW BioErdgas in kommunalen Liegenschaften Eine Veranstaltung des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft
Vermarktungvon Flexibilitäten
 Vermarktungvon Flexibilitäten am Beispiel der ORC-Anlage Wächtersbach - Workshop Berlin 1.09.2015-1 Anlagendaten Wächtersbach installierte Leistung Bemessungsleistung 2015 1.200 kw 889 kw Präqualifikation
Vermarktungvon Flexibilitäten am Beispiel der ORC-Anlage Wächtersbach - Workshop Berlin 1.09.2015-1 Anlagendaten Wächtersbach installierte Leistung Bemessungsleistung 2015 1.200 kw 889 kw Präqualifikation
Wichtiges Thema: Ihre private Rente und der viel zu wenig beachtete - Rentenfaktor
 Wichtiges Thema: Ihre private Rente und der viel zu wenig beachtete - Rentenfaktor Ihre private Gesamtrente setzt sich zusammen aus der garantierten Rente und der Rente, die sich aus den über die Garantieverzinsung
Wichtiges Thema: Ihre private Rente und der viel zu wenig beachtete - Rentenfaktor Ihre private Gesamtrente setzt sich zusammen aus der garantierten Rente und der Rente, die sich aus den über die Garantieverzinsung
Die Wertschöpfung bleibt in der Region
 PRESSEINFORMATION Energiewende aus regionalem Anbau: In Thüringen treibt der erste Tarif mit genossenschaftlich erzeugtem Ökostrom den Ausbau der erneuerbaren Energien voran. Regional, dezentral und auch
PRESSEINFORMATION Energiewende aus regionalem Anbau: In Thüringen treibt der erste Tarif mit genossenschaftlich erzeugtem Ökostrom den Ausbau der erneuerbaren Energien voran. Regional, dezentral und auch
Arbeitsmarkteffekte von Umschulungen im Bereich der Altenpflege
 Aktuelle Berichte Arbeitsmarkteffekte von Umschulungen im Bereich der Altenpflege 19/2015 In aller Kürze Im Bereich der Weiterbildungen mit Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf für Arbeitslose
Aktuelle Berichte Arbeitsmarkteffekte von Umschulungen im Bereich der Altenpflege 19/2015 In aller Kürze Im Bereich der Weiterbildungen mit Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf für Arbeitslose
Übungsaufgaben Tilgungsrechnung
 1 Zusatzmaterialien zu Finanz- und Wirtschaftsmathematik im Unterricht, Band 1 Übungsaufgaben Tilgungsrechnung Überarbeitungsstand: 1.März 2016 Die grundlegenden Ideen der folgenden Aufgaben beruhen auf
1 Zusatzmaterialien zu Finanz- und Wirtschaftsmathematik im Unterricht, Band 1 Übungsaufgaben Tilgungsrechnung Überarbeitungsstand: 1.März 2016 Die grundlegenden Ideen der folgenden Aufgaben beruhen auf
Übersicht. Warum Sie zu viel zahlen? Wie können Sie sparen? Was ist ein BHKW? Wie funktioniert ein BHKW? Förderungen Vorteile
 Übersicht Warum Sie zu viel zahlen? Wie können Sie sparen? Was ist ein BHKW? Wie funktioniert ein BHKW? Förderungen Vorteile Warum Sie zu viel zahlen? Mit jeder kwh Strom aus dem deutschen Stromnetz zahlt
Übersicht Warum Sie zu viel zahlen? Wie können Sie sparen? Was ist ein BHKW? Wie funktioniert ein BHKW? Förderungen Vorteile Warum Sie zu viel zahlen? Mit jeder kwh Strom aus dem deutschen Stromnetz zahlt
Organisation des Qualitätsmanagements
 Organisation des Qualitätsmanagements Eine zentrale Frage für die einzelnen Funktionen ist die Organisation dieses Bereiches. Gerade bei größeren Organisationen Für seine Studie mit dem Titel Strukturen
Organisation des Qualitätsmanagements Eine zentrale Frage für die einzelnen Funktionen ist die Organisation dieses Bereiches. Gerade bei größeren Organisationen Für seine Studie mit dem Titel Strukturen
OECD Programme for International Student Assessment PISA 2000. Lösungen der Beispielaufgaben aus dem Mathematiktest. Deutschland
 OECD Programme for International Student Assessment Deutschland PISA 2000 Lösungen der Beispielaufgaben aus dem Mathematiktest Beispielaufgaben PISA-Hauptstudie 2000 Seite 3 UNIT ÄPFEL Beispielaufgaben
OECD Programme for International Student Assessment Deutschland PISA 2000 Lösungen der Beispielaufgaben aus dem Mathematiktest Beispielaufgaben PISA-Hauptstudie 2000 Seite 3 UNIT ÄPFEL Beispielaufgaben
Kraftwerk der Zukunft: Das Zusammenspiel zwischen EE Erzeugung und Speicherung. Impulsvortrag Bernhard Beck
 Kraftwerk der Zukunft: Das Zusammenspiel zwischen EE Erzeugung und Speicherung Impulsvortrag Bernhard Beck Energiewende Deutschland Anteil Erneuerbarer Energien aktuell bei 23 Prozent an der Bruttostromerzeugung
Kraftwerk der Zukunft: Das Zusammenspiel zwischen EE Erzeugung und Speicherung Impulsvortrag Bernhard Beck Energiewende Deutschland Anteil Erneuerbarer Energien aktuell bei 23 Prozent an der Bruttostromerzeugung
Blockheizkraftwerke 50 400 kw Biogas Klärgas Erdgas
 Schalten Sie um auf Qualität F I M A G Blockheizkraftwerke 50 400 kw Biogas Klärgas Erdgas Ein nachhaltiger und ressourcenschonender Umgang mit Primärenergie leistet einen entscheidenden Beitrag zum Umweltschutz.
Schalten Sie um auf Qualität F I M A G Blockheizkraftwerke 50 400 kw Biogas Klärgas Erdgas Ein nachhaltiger und ressourcenschonender Umgang mit Primärenergie leistet einen entscheidenden Beitrag zum Umweltschutz.
Kraft Wärme Kopplung, Potentiale und Einsatzmölichkeiten. Peter Lückerath, EnergieAgentur.NRW
 Kraft Wärme Kopplung, Potentiale und Einsatzmölichkeiten Peter Lückerath, EnergieAgentur.NRW Gegründet 1990 durch das damalige Wirtschaftsministerium NRW Neutral, unabhängig, nicht kommerziell Vom Land
Kraft Wärme Kopplung, Potentiale und Einsatzmölichkeiten Peter Lückerath, EnergieAgentur.NRW Gegründet 1990 durch das damalige Wirtschaftsministerium NRW Neutral, unabhängig, nicht kommerziell Vom Land
1. Die Maße für ihren Vorbaurollladen müssen von außen genommen werden.
 Vorbaurollladen Massanleitung Sehr geehrte Kunden, diese Maßanleitung dient zur korrekten Ermittlung der für den RDEMCHER Vorbaurollladen Konfigurator notwendigen Maße. Um diese nleitung optimal nutzen
Vorbaurollladen Massanleitung Sehr geehrte Kunden, diese Maßanleitung dient zur korrekten Ermittlung der für den RDEMCHER Vorbaurollladen Konfigurator notwendigen Maße. Um diese nleitung optimal nutzen
Organische Photovoltaik: Auf dem Weg zum energieautarken Haus. Referat von Dr. Gerhard Felten. Geschäftsleiter Zentralbereich Forschung und
 27. Juni 2007 RF 70602 Organische Photovoltaik: Auf dem Weg zum energieautarken Haus Referat von Dr. Gerhard Felten Geschäftsleiter Zentralbereich Forschung und Vorausentwicklung anlässlich des Starts
27. Juni 2007 RF 70602 Organische Photovoltaik: Auf dem Weg zum energieautarken Haus Referat von Dr. Gerhard Felten Geschäftsleiter Zentralbereich Forschung und Vorausentwicklung anlässlich des Starts
Das Energiekonzept der Bundesregierung Bremse oder Antrieb für eine gestärkte Rolle der Stadtwerke im Energiemarkt?
 Das Energiekonzept der Bundesregierung Bremse oder Antrieb für eine gestärkte Rolle der Stadtwerke im Energiemarkt? Stadtwerke-Workshop: Perspektiven für Kraftwerksinvestitionen im zukünftigen Energiemix
Das Energiekonzept der Bundesregierung Bremse oder Antrieb für eine gestärkte Rolle der Stadtwerke im Energiemarkt? Stadtwerke-Workshop: Perspektiven für Kraftwerksinvestitionen im zukünftigen Energiemix
Durch die virtuelle Optimierung von Werkzeugen am Computer lässt sich die reale Produktivität von Servopressen erhöhen
 PRESSEINFORMATION Simulation erhöht Ausbringung Durch die virtuelle Optimierung von Werkzeugen am Computer lässt sich die reale Produktivität von Servopressen erhöhen Göppingen, 04.09.2012 Pressen von
PRESSEINFORMATION Simulation erhöht Ausbringung Durch die virtuelle Optimierung von Werkzeugen am Computer lässt sich die reale Produktivität von Servopressen erhöhen Göppingen, 04.09.2012 Pressen von
Dezentrale Stromversorgung von Haushalten mit Photovoltaik, Batterie und Netzanschluss
 Dezentrale Stromversorgung von Haushalten mit Photovoltaik, Batterie und Netzanschluss 22.10.2012 Bund Naturschutz in Bayern e.v., Kreisgruppe Dillingen Dipl.-Ing. Sebastian Eller 1 Gliederung 1. Einleitung
Dezentrale Stromversorgung von Haushalten mit Photovoltaik, Batterie und Netzanschluss 22.10.2012 Bund Naturschutz in Bayern e.v., Kreisgruppe Dillingen Dipl.-Ing. Sebastian Eller 1 Gliederung 1. Einleitung
Power-to-Gas Neue Energiespeichertechnologie der Zukunft
 6. Isnyer Energiegipfel 17.03.2013 Power-to-Gas Neue Energiespeichertechnologie der Zukunft Benjamin Schott Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) Baden-Württemberg -1- Was erwartet
6. Isnyer Energiegipfel 17.03.2013 Power-to-Gas Neue Energiespeichertechnologie der Zukunft Benjamin Schott Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) Baden-Württemberg -1- Was erwartet
ecopower Mini-Blockheizkraftwerk
 ecopower Mini-Blockheizkraftwerk Das kleine Kraftwerk im Keller Vaillant Vertriebsingenieur Dipl.-Ing. (FH) Benjamin Michler Tel. 0171/9763484 ecopower Mini-Blockheizkraftwerk Das kleine Kraftwerk im Keller
ecopower Mini-Blockheizkraftwerk Das kleine Kraftwerk im Keller Vaillant Vertriebsingenieur Dipl.-Ing. (FH) Benjamin Michler Tel. 0171/9763484 ecopower Mini-Blockheizkraftwerk Das kleine Kraftwerk im Keller
Rundum-G. Die Anforderungen durch ständig steigende
 Rundum-G LevelOne bietet für jede Netzwerkanwendung alles aus einer Hand. Produkte, Schulungen und die individuelle Projektunterstützung für den Fachhandel. Die Anforderungen durch ständig steigende Produktangebote
Rundum-G LevelOne bietet für jede Netzwerkanwendung alles aus einer Hand. Produkte, Schulungen und die individuelle Projektunterstützung für den Fachhandel. Die Anforderungen durch ständig steigende Produktangebote
Erfassung von Anlagendaten im Marktstammdatenregister
 Erfassung von Anlagendaten im Marktstammdatenregister Das Marktstammdatenregister (MaStR) wird die Stammdaten der Energieerzeugungs- und Verbrauchsanlagen im Strom- und Gasbereich erfassen und für den
Erfassung von Anlagendaten im Marktstammdatenregister Das Marktstammdatenregister (MaStR) wird die Stammdaten der Energieerzeugungs- und Verbrauchsanlagen im Strom- und Gasbereich erfassen und für den
Energiebarometer Herbst 2014
 Energiebarometer Herbst 2014 Das VDI-Energiebarometer ist eine regelmäßige Befragung der mit den Themen der Energietechnik assoziierten Mitglieder des VDI Verein Deutscher Ingenieure. Ziel ist es, die
Energiebarometer Herbst 2014 Das VDI-Energiebarometer ist eine regelmäßige Befragung der mit den Themen der Energietechnik assoziierten Mitglieder des VDI Verein Deutscher Ingenieure. Ziel ist es, die
Projekt im Schaufenster Elektromobilität TANKEN IM SMART GRID / 16SNI005E
 Projekt im Schaufenster Elektromobilität TANKEN IM SMART GRID / 16SNI005E Vorstellung des Projekts MobiliTec Forum Hannover / 10. April 2014 Projektpartner für Öffentlichkeitsarbeit & Koordination Matthias
Projekt im Schaufenster Elektromobilität TANKEN IM SMART GRID / 16SNI005E Vorstellung des Projekts MobiliTec Forum Hannover / 10. April 2014 Projektpartner für Öffentlichkeitsarbeit & Koordination Matthias
AGROPLUS Buchhaltung. Daten-Server und Sicherheitskopie. Version vom 21.10.2013b
 AGROPLUS Buchhaltung Daten-Server und Sicherheitskopie Version vom 21.10.2013b 3a) Der Daten-Server Modus und der Tresor Der Daten-Server ist eine Betriebsart welche dem Nutzer eine grosse Flexibilität
AGROPLUS Buchhaltung Daten-Server und Sicherheitskopie Version vom 21.10.2013b 3a) Der Daten-Server Modus und der Tresor Der Daten-Server ist eine Betriebsart welche dem Nutzer eine grosse Flexibilität
Primzahlen und RSA-Verschlüsselung
 Primzahlen und RSA-Verschlüsselung Michael Fütterer und Jonathan Zachhuber 1 Einiges zu Primzahlen Ein paar Definitionen: Wir bezeichnen mit Z die Menge der positiven und negativen ganzen Zahlen, also
Primzahlen und RSA-Verschlüsselung Michael Fütterer und Jonathan Zachhuber 1 Einiges zu Primzahlen Ein paar Definitionen: Wir bezeichnen mit Z die Menge der positiven und negativen ganzen Zahlen, also
Zahlenwinkel: Forscherkarte 1. alleine. Zahlenwinkel: Forschertipp 1
 Zahlenwinkel: Forscherkarte 1 alleine Tipp 1 Lege die Ziffern von 1 bis 9 so in den Zahlenwinkel, dass jeder Arm des Zahlenwinkels zusammengezählt das gleiche Ergebnis ergibt! Finde möglichst viele verschiedene
Zahlenwinkel: Forscherkarte 1 alleine Tipp 1 Lege die Ziffern von 1 bis 9 so in den Zahlenwinkel, dass jeder Arm des Zahlenwinkels zusammengezählt das gleiche Ergebnis ergibt! Finde möglichst viele verschiedene
Smart Grids und das Maßnahmen- Puzzle der Energiewende Rudolf Martin Siegers, Leiter Siemens Deutschland
 Smart Grids und das Maßnahmen- Puzzle der Energiewende Rudolf Martin Siegers, Leiter Siemens Deutschland Seite 1 Die Energiewende eine Jahrhundertaufgabe Weltweite Aufgabe Die Energiesysteme der Welt müssen
Smart Grids und das Maßnahmen- Puzzle der Energiewende Rudolf Martin Siegers, Leiter Siemens Deutschland Seite 1 Die Energiewende eine Jahrhundertaufgabe Weltweite Aufgabe Die Energiesysteme der Welt müssen
EIN VIRTUELLES KRAFTWERK FÜR DIE ENERGIEWENDE FLEXIBILITÄT AM STROMMARKT MIT NEXT KRAFTWERKE! Gemeinsam sind wir Megawatt!
 EIN VIRTUELLES KRAFTWERK FÜR DIE ENERGIEWENDE FLEXIBILITÄT AM STROMMARKT MIT NEXT KRAFTWERKE! Gemeinsam sind wir Megawatt! DIE IDEE Die Erneuerbaren regeln das schon selbst! In vielerlei Hinsicht haben
EIN VIRTUELLES KRAFTWERK FÜR DIE ENERGIEWENDE FLEXIBILITÄT AM STROMMARKT MIT NEXT KRAFTWERKE! Gemeinsam sind wir Megawatt! DIE IDEE Die Erneuerbaren regeln das schon selbst! In vielerlei Hinsicht haben
BHKW-Förderung im Land Bremen
 BHKW-Förderung im Land Bremen Michael Richts Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa Referat Energie und Umwelttechnik Dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz
BHKW-Förderung im Land Bremen Michael Richts Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa Referat Energie und Umwelttechnik Dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz
2.1 Präsentieren wozu eigentlich?
 2.1 Präsentieren wozu eigentlich? Gute Ideen verkaufen sich in den seltensten Fällen von allein. Es ist heute mehr denn je notwendig, sich und seine Leistungen, Produkte etc. gut zu präsentieren, d. h.
2.1 Präsentieren wozu eigentlich? Gute Ideen verkaufen sich in den seltensten Fällen von allein. Es ist heute mehr denn je notwendig, sich und seine Leistungen, Produkte etc. gut zu präsentieren, d. h.
Stellungnahme der Bundesärztekammer
 Stellungnahme der Bundesärztekammer zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Änderung des 87 der Strafprozessordnung Berlin, 21. Februar 2012 Korrespondenzadresse: Bundesärztekammer Herbert-Lewin-Platz
Stellungnahme der Bundesärztekammer zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Änderung des 87 der Strafprozessordnung Berlin, 21. Februar 2012 Korrespondenzadresse: Bundesärztekammer Herbert-Lewin-Platz
9. Fachgespräch der Clearingstelle EEG DAS EEG 2012
 9. Fachgespräch der Clearingstelle EEG DAS EEG 2012 Berlin-Dahlem Änderungen bei der Biomasse Strom in Kraft-Wärme-Kopplung Einsatzstoffbezogene Vergütung Christian Leuchtweis C.A.R.M.E.N. e.v. STROM IN
9. Fachgespräch der Clearingstelle EEG DAS EEG 2012 Berlin-Dahlem Änderungen bei der Biomasse Strom in Kraft-Wärme-Kopplung Einsatzstoffbezogene Vergütung Christian Leuchtweis C.A.R.M.E.N. e.v. STROM IN
Ein neues System für die Allokation von Spenderlungen. LAS Information für Patienten in Deutschland
 Ein neues System für die Allokation von Spenderlungen LAS Information für Patienten in Deutschland Ein neues System für die Allokation von Spenderlungen Aufgrund des immensen Mangels an Spenderorganen
Ein neues System für die Allokation von Spenderlungen LAS Information für Patienten in Deutschland Ein neues System für die Allokation von Spenderlungen Aufgrund des immensen Mangels an Spenderorganen
Kontext Grundlast/residuale Last und Regelleistung
 Kontext Grundlast/residuale Last und Regelleistung Kontext Vortragsziele Transparenz über heutigen Kraftwerkspark Systemrelevante Optionen für Zukunft Regelleistung: Trends & Zusammenhänge Grafik: N. Kreifels,
Kontext Grundlast/residuale Last und Regelleistung Kontext Vortragsziele Transparenz über heutigen Kraftwerkspark Systemrelevante Optionen für Zukunft Regelleistung: Trends & Zusammenhänge Grafik: N. Kreifels,
Energiesysteme Teil: Elektrische Energieversorgungssysteme (S8804) Seite 5.1 Wirtschaftliche Aspekte
 Energiesysteme Teil: Elektrische Energieversorgungssysteme (S8804) Seite 5.1 5. 5.1 Gestehungskosten für die elektrische Energie Der jährliche Leistungskostenanteil eines Betriebsmittels errechnet sich
Energiesysteme Teil: Elektrische Energieversorgungssysteme (S8804) Seite 5.1 5. 5.1 Gestehungskosten für die elektrische Energie Der jährliche Leistungskostenanteil eines Betriebsmittels errechnet sich
ENERGIE EFFIZIENZ EXPERTEN NEHMEN SIE IHRE STROMVERSORGUNG IN DIE EIGENE HAND!
 ENERGIE EFFIZIENZ EXPERTEN NEHMEN SIE IHRE STROMVERSORGUNG IN DIE EIGENE HAND! SIE WOLLEN UNABHÄNGIGER SEIN? RESSOURCEN SPAREN UND DIE PERSÖNLICHE ENERGIEZUKUNFT SICHERN, ABER WIE? Mit Solarspeicherlösungen
ENERGIE EFFIZIENZ EXPERTEN NEHMEN SIE IHRE STROMVERSORGUNG IN DIE EIGENE HAND! SIE WOLLEN UNABHÄNGIGER SEIN? RESSOURCEN SPAREN UND DIE PERSÖNLICHE ENERGIEZUKUNFT SICHERN, ABER WIE? Mit Solarspeicherlösungen
Nachrüstung von PV-Anlagen mit Einrichtungen zur Wirkleistungsbegrenzung
 Nachrüstung von PV-Anlagen mit Einrichtungen zur Wirkleistungsbegrenzung für SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL, SUNNY TRIPOWER Inhalt Nach 66 des Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) müssen Bestandsanlagen mit
Nachrüstung von PV-Anlagen mit Einrichtungen zur Wirkleistungsbegrenzung für SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL, SUNNY TRIPOWER Inhalt Nach 66 des Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) müssen Bestandsanlagen mit
BÜRGERBETEILIGUNG ALS ZENTRALER ERFOLGSFAKTOR
 BÜRGERBETEILIGUNG ALS ZENTRALER ERFOLGSFAKTOR ZIELE, MÖGLICHKEITEN UND POTENZIALE DER BÜRGERBETEILIGUNG AKADEMIE FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN LÜCHOW, 23.06.2011 Martina Wojahn, Regionales gestalten Definitionen
BÜRGERBETEILIGUNG ALS ZENTRALER ERFOLGSFAKTOR ZIELE, MÖGLICHKEITEN UND POTENZIALE DER BÜRGERBETEILIGUNG AKADEMIE FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN LÜCHOW, 23.06.2011 Martina Wojahn, Regionales gestalten Definitionen
Online-Befragung der Promovierenden zur Betreuungssituation an der Universität Potsdam
 Fakultätsübergreifender Kurzbericht Online-Befragung der Promovierenden zur Betreuungssituation an der Universität Potsdam 30.03.2012 Befragung der Potsdam Graduate School in Zusammenarbeit mit dem PEP-Team
Fakultätsübergreifender Kurzbericht Online-Befragung der Promovierenden zur Betreuungssituation an der Universität Potsdam 30.03.2012 Befragung der Potsdam Graduate School in Zusammenarbeit mit dem PEP-Team
