Grundlage für die Definition des Leitbildes. Gemeinde Steinfort
|
|
|
- Hella Dresdner
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Grundlage für die Definition des Leitbildes Gemeinde Steinfort September 2014
2 erstellt von 6, Jos Seylerstroos L-8522 Beckerich Tel: Fax:
3 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis... II Tabellenverzeichnis... II 1 Einleitung Problemstellung und Zielsetzung Methodik Analyse der Ausgangssituation Beschreibung des Untersuchungsgebietes Derzeitige Energieversorgung Stromversorgung Wärmeversorgung Treibhausgasemissionen Analyse der Energiepotentiale Stromeinsparungen Wärmeeinsparungen Potentialanalyse der Erneuerbaren Energien Potential Bioenergie Vergärbare Biomassen Verbrennbare feste Biomassen Biomassepotential Potential Sonnenenergie Potential Windenergie Potential Geothermie Potential Wasserkraft Gesamtes Potential Zusammenfassung der Ausbaupotentiale Stromversorgung Wärmeversorgung Treibhausgasemissionen Definition des Leitbildes Stromversorgung Wärmeversorgung Treibhausgasemissionen I
4 Literaturverzeichnis Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Luftbildaufnahme der Gemeinde (Administration du Cadastre et de la Topographie, 2013)... 2 Abbildung 2: Stromverbrauch in der Gemeinde nach Verbraucher in Abbildung 3: Aufteilung des Wärmeverbrauchs nach Verbrauchergruppe... 5 Abbildung 4: Aufteilung des Wärmeverbrauchs nach Energieträger in Abbildung 5: Karte der mittleren Jahresgeschwindigkeiten des Windes in 30m Höhe für das Gemeindegebiet (Energieagence, o.j.) Abbildung 6: Mögliche Standorte für Windkraftanlagen laut Engel, Eischen & Mirgan und Natura 2000 Zonen in der Gemeinde (Administration du Cadastre et de la Topographie, 2013 überarbeitet) Abbildung 7: Abstandsempfehlungen für Windkraftanlagenstandorte aus Sicht des Vogelschutzes für das Gemeindegebiet (Lëtzebuerger Natur- an Vulleschutzliga, o.j. überarbeitet) Abbildung 8: Abstandsempfehlungen für die Errichtung von Windkraftanlagen aus Sicht des Fledermausschutzes für das Gemeindegebiet (Lëtzebuerger Natur- an Vulleschutzliga, o.j. überarbeitet) Abbildung 9: Karte mit den eingeschränkten Zonen für Tiefenbohrungen in der Gemeinde (Administration du Cadastre et de la Topographie, 2013) Abbildung 10: Graphische Darstellung des Strom- und Wärmepotentials nach erneuerbarer Energiequelle Abbildung 11: Treibhausgaseinsparungen durch die 100% Aktivierung der erneuerbaren Energie- und Einsparpotentiale Abbildung 12: Treibhausgaseinsparungen durch die partielle Aktivierung der erneuerbaren Energieund Einsparpotentiale Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Stromverbrauch in der Gemeinde in 2012 (Creos, 2013)... 3 Tabelle 2: Bilanz der Stromversorgung in der Gemeinde für Tabelle 3: Geschätzter Wärmeverbrauch in der Gemeinde für II
5 Tabelle 4: Geschätzte Wärmeproduktion aus erneuerbaren Energiequellen in der Gemeinde für Tabelle 5: Bilanz der Wärmeversorgung in der Gemeinde für Tabelle 6: Treibhausgasemissionen im Strom- und Wärmebereich in der Gemeinde für Tabelle 7: Angenommene Stromeinsparpotentiale nach Sektor... 9 Tabelle 8: Angenommene Wärmeeinsparpotentiale nach Sektor... 9 Tabelle 9: Realisierbares Energiepotential in der Gemeinde im Bereich der vergärbaren Biomassen 11 Tabelle 10: Realisierbares Energiepotential in der Gemeinde im Bereich der verbrennbaren Biomassen Tabelle 11: Realisierbares Strom- und Wärmepotential im Bereich Biomasse in der Gemeinde Tabelle 12: Bilanz der Stromversorgung bei vollständiger Aktivierung der Potentiale Tabelle 13: Bilanz der Wärmeversorgung bei vollständiger Aktivierung der Potentiale Tabelle 14: Treibhausgaseinsparungen und Emissionen bei 100% Aktivierung der Potentiale Tabelle 15: Bilanz der Stromversorgung in Berücksichtigung der festgehaltenen Pisten Tabelle 16: Bilanz der Wärmeversorgung in Berücksichtigung der festgehaltenen Pisten Tabelle 17: Treibhaugaseinsparpotentiale und Emissionen in Berücksichtigung der festgehaltenen Pisten III
6 1 Einleitung 1.1 Problemstellung und Zielsetzung Die Gemeinde Steinfort ist am 1. Januar 2013 dem Klimapakt beigetreten. In diesem Zusammenhang wird eine Klimaschutz- und Energiestrategie auf Gemeindeebene ausgearbeitet. Die Analyse der Energieversorgung und der ungenutzten Energiepotentiale erlaubt es der Gemeinde prioritäre Bereiche zu identifizieren und qualitative und quantitative Zielsetzungen in einem energie- und klimapolitischen Leitbild festzulegen. 1.2 Methodik Im ersten Schritt wurde die Energieversorgung der Ausgangssituation untersucht. Der Energieverbrauch wurde nach Sektor und Energieträger aufgeteilt und analysiert. Neben dem Energieverbrauch wurden auch die vorhandenen erneuerbaren Energie Anlagen erfasst. Auf Basis der Energieversorgung der Ausgangslage wurden die Treibhausgasemissionen auf dem Gemeindeterritorium berechnet. Anschließend wurden die realisierbaren Einspar- und Erneuerbaren Energiepotentiale auf dem Gemeindegebiet analysiert und abgeschätzt. Auf Basis der ermittelten Potentiale wurden Szenarien für die zukünftige Energieversorgung erstellt, die es der Gemeinde erlauben ihre Handlungsprioritäten festzulegen und quantitative energie- und klimapolitische Zielsetzungen im Leitbild festzulegen. 1
7 2 Analyse der Ausgangssituation 2.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes Die Gemeinde Steinfort besteht aus 4 Ortschaften und erstreckt sich auf einer Fläche von 12,2 km 2 (Abbildung 1). Die Gemeinde zählt insgesamt Einwohner, die sich auf Haushalte aufteilen. Die Einwohnerdichte liegt bei 403 Einwohner/km 2. Das Landschaftsbild in der Gemeinde ist geprägt durch die Landwirtschaft. Es werden insgesamt 708 ha landwirtschaftliche Fläche (Statec, 2012). Die landwirtschaftlichen Flächen sind von 234 ha Wald umgeben (Statec, 1995). Neben dem ländlichen Charakter kennzeichnet sich die Gemeinde Steinfort auch durch größere Industrie- und Gewerbebetriebe aus. Zu den größeren Betrieben zählen unteranderem die Mühle und Presta-gaz in Kleinbettingen sowie Textilcord in Steinfort. Abbildung 1: Luftbildaufnahme der Gemeinde (Administration du Cadastre et de la Topographie, 2013) 2
8 2.2 Derzeitige Energieversorgung Stromversorgung Stromverbrauch Für die Ermittlung des Stromverbrauchs wurden Daten bei dem zuständigen Stromnetzbetreiber für das Jahr 2012 beantragt und ausgewertet. Diese Daten wurden zusätzlich durch Verbrauchsdaten von den kommunalen Gebäuden ergänzt, die aus einer Studie von Engel, Eischen & Mirgain von 2008 abgeleitet wurden. Der Stromverbrauch der Wärmepumpen wurde beim Wärmeverbrauch berücksichtigt. In der Gemeinde Steinfort lag der Stromverbrauch im Jahr 2012 bei 48,3 GWh/a (Tabelle 1). Tabelle 1: Stromverbrauch in der Gemeinde in 2012 (Creos, 2013) kwh/a Privathaushalte Industrie und Gewerbe Öffentliche Beleuchtung Gemeindegebäude Gesamt In der Abbildung 2 kann man erkennen, dass in 2012 die Industrie- und Gewerbebetriebe den größten Anteil am Gesamtstromverbrauch in der Gemeinde hatten. Die Privathaushalte machten einen Anteil von etwa 20% aus, während sich der Verbrauch der kommunalen Infrastrukturen und der öffentlichen Beleuchtung nur auf etwa 3% des Stromverbrauchs beläuft. 1,2% 2,2% 76,4% 20,3% Privathaushalte Industrie und Gewerbe Öffentliche Beleuchtung Gemeindegebäude Abbildung 2: Stromverbrauch in der Gemeinde nach Verbraucher in 2012 Über die Herkunft des Stroms lagen keine Informationen vor. Es wurde davon ausgegangen, dass in den Privathaushalten und Betrieben die Niederspannungsanschlüsse mit grünem Strom und die Mittel- und Hochspannungsanschlüsse mit konventionnelem Strom beliefert wurden. Die 3
9 kommunalen Gebäude und die öffentliche Beleuchtung wurden mit grünem Strom versorgt. In Berücksichtigung dieser Annahmen wurden in der Gemeinde Steinfort schätzungsweise MWh/a grüner Strom und MWh/a konventionelller Strom von den Stromlieferanten bezogen Stromproduktion Auf dem Gemeindegebiet lag die Stromproduktion in 2012 laut den Angaben des Netzbetreibers bei kwh/a. Laut dem Ministère du Développement durable et des Infrastructures lag die installierte Leistung der subventionierten Photovoltaikanlagen bei 399 kw p in Die Stromproduktion aus Photovoltaik wurde auf kwh/a geschätzt. Es wurde davon ausgegangen, dass der restliche Strom durch Kraftwärmekopplung (KWK) aus fossilen Brennstoffen (Erdgas) produziert wurde. Produktionsdaten von bestehenden Anlagen lagen nicht vor Bilanz In der Gemeinde Steinfort wurden in 2012 durch die lokalen erneuerbaren Energieanlagen 0,7 % des gesamten Stromverbrauchs gedeckt (Tabelle 2). Der gesamte Deckungsgrad, in Berücksichtigung der KWK-Anlagen, lag bei 4,6%. Tabelle 2: Bilanz der Stromversorgung in der Gemeinde für 2012 Erneuerbar Erneuerbar+KWK kwh/a Anteil kwh/a Anteil Stromproduktion Photovoltaik ,0% ,2% KWK mit fossilem Brennstoff - 0,0% ,8% Gesamt ,0% ,0% Stromverbrauch Privathaushalte ,3% ,3% Industrie und Gewerbe ,4% ,4% Öffentliche Beleuchtung ,2% ,2% Gemeindegebäude ,2% ,2% Gesamt ,0% ,0% Bilanz Deckungsgrad durch lokal erzeugte Energien 0,7% 4,6% 4
10 2.2.2 Wärmeversorgung Wärmeverbrauch Es lagen keine Daten hinsichtlich des Wärmeverbrauchs in den privaten Haushalten vor. Der Verbrauch wurde auf Basis eines Energiekatasters einer vergleichbaren ländlichen Gemeinde über die Anzahl der Haushalte geschätzt. Die Verbrauchsdaten der kommunalen Gebäude und der Industrie- und Gewerbebetriebe lagen ebenfalls nicht vor, es wurde auf Erfahrungswerte zurückgegriffen. Der Erdgasverbrauch wurde beim Netzbetreiber beantragt und in der Bilanzierung integriert. In der Gemeinde Steinfort wurden schätzungsweise 81,3 GWh/a verbraucht (Tabelle 3). Tabelle 3: Geschätzter Wärmeverbrauch in der Gemeinde für 2012 kwh/a Privathaushalte Industrie und Gewerbe Gemeindegebäude Gesamt Der Großteil der Wärme wurde in den Privathaushalten verbraucht. Die Industrie- und Gewerbebetriebe machten 31% des Wärmeverbrauchs in der Gemeinde aus. Die kommunalen Infrastrukturen trugen nur zu einem kleinen Teil des Wärmeverbrauchs bei (Abbildung 3). 2,5% 31,0% 66,6% Privathaushalte Industrie und Gewerbe Gemeindegebäude Abbildung 3: Aufteilung des Wärmeverbrauchs nach Verbrauchergruppe Wärmeproduktion In der Gemeinde Steinfort wurden laut den Angaben des Revierförsters 100 Rm/a Brennholz aus dem Gemeindewald an die Bürger verkauft. Für den Privatwald lagen keine Informationen vor. Der in der Gemeinde anfallende Biomüll und das halmgutartige Landschaftspflegematerial wurden in der Biogasanlage in Kehlen energetisch genutzt. Das entstehende Biogas wird auf Erdgasniveau aufgearbeitet und in das lokale Erdgasnetz eingespeist. Diese Energie kann der Gemeinde Steinfort 5
11 gutgeschrieben werden. Die jährlich anfallenden Mengen wurden über die Einwohnerzahl und einen spezifischen Einwohnerkennwert berechnet. Es handelte sich um schätzungsweise 426 t FM/a Bioabfall und 219 t FM/a halmgutartiges Landschaftspflegematerial. Aus diesen Biomassen wurden nach Abzug der Prozessenergie schätzungsweise m 3 /a Biomethan produziert. Laut dem Ministère du Développement durable et des Infrastructures gibt es noch Biomassekleinanlagen, die mit Scheitholz und Holzpellets befeuert wurden. Neben der Nutzung von Holz wurden noch thermische Solarkollektoren und Luftwärmepumpen zur Wärmeproduktion genutzt. Die Wärmeerzeugung aus den erneuerbaren Energiequellen wurde geschätzt. Die gesamte Wärmeproduktion aus erneuerbaren Energiequellen in der Gemeinde belief sich auf schätzungsweise MWh/a (Tabelle 4). Die Nutzung von Solarthermie für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung nahm in 2012 den größten Stellenwert bei der Wärmegewinnung aus regenerativen Quellen ein. Tabelle 4: Geschätzte Wärmeproduktion aus erneuerbaren Energiequellen in der Gemeinde für 2012 kwh/a Anteil Brennholz ,5% Holzpellets ,8% Naturgas Kielen Gutschrift ,1% Solarthermie ,7% Umweltwärme ,1% Gesamt ,0% Bilanz Vergleicht man den Wärmeverbrauch mit der Wärmeproduktion aus erneuerbaren Energien, erreichte man in der Gemeinde einen Deckungsgrad von 1,5% in 2012 (Tabelle 5). Tabelle 5: Bilanz der Wärmeversorgung in der Gemeinde für 2012 kwh/a Anteil Wärmeproduktion Brennholz ,5% Holzpellets ,8% Naturgas Kielen Gutschrift ,1% Solarthermie ,7% Umweltwärme ,1% Gesamt ,0% Wärmeverbrauch Privathaushalte ,6% Industrie und Gewerbe ,0% Gemeindegebäude ,5% Gesamt ,0% Bilanz Deckungsgrad durch lokal erzeugte erneuerbare Energien 1,5% 6
12 Im Jahr 2012 machte der Energieträger Heizöl den größten Teil des Endenergieträgerverbrauchs für die Wärmebereitstellung aus. Erdgas war mit rund 40% vertreten. 0,2% 0,1% 0,3% 0,4% 0,3% 0,1% 2,7% 55,4% 40,4% Erdgas Heizöl Pellets Umweltwärme Naturgas Kielen Gutschrift Brennholz Solarthermie Strom Abwärme aus KWK mit fossilem Brennstoff Abbildung 4: Aufteilung des Wärmeverbrauchs nach Energieträger in Treibhausgasemissionen Die Treibhausgasemissionen auf dem Gemeindegebiet wurden auf Basis der Daten für die Energieversorgung ermittelt. Für die Berechnung der Emissionen wurde für die Strom- und Wärmeversorgung ein lokaler Emissionsfaktor ermittelt. Diese lokalen Emissionsfaktoren berücksichtigen die lokale Energieproduktion aus erneuerbaren Energien. Die Emissionsfaktoren für die Berechnung der Treibhausgasemissionen beziehen sich auf Angaben des Institut Luxembourgeois de Régulation und auf das Règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels. In 2012 wurden in der Gemeinde im Strombereich rund t CO 2 Äq./a und im Wärmebereich t CO 2 Äq./a emittiert (Tabelle 6). Der lokale Emissionsfaktor für Strom lag bei 0,159 kg CO 2 Äq./kWh. Für eine Kilowattstunde Wärme wurden 0,267 kg CO 2 Äq. emittiert. Insgesamt beliefen sich die Emissionen auf t CO 2 Äq./a. 7
13 Tabelle 6: Treibhausgasemissionen im Strom- und Wärmebereich in der Gemeinde für 2012 Endenergie Emissionsfaktor Emissionen kwh/a kg CO 2 Äq./kWh t CO 2 Äq./a Stromversorgung Grüner Strom Strommix , Photovoltaik , KWK mit fossilem Brennstoff , Gesamt , Wärmeversorgung Heizöl , Erdgas , Nahwärme aus KWK mit fossilem Brennstoff , Strom Naturgas Kielen Gutschrift ,011 2 Brennholz ,014 3 Holzpellets ,021 6 Solarthermie Umweltwärme Gesamt , Gesamt Analyse der Energiepotentiale Der Energieeinsparung wird in Zukunft eine bedeutende Rolle zukommen. Die Senkung des Energieverbrauchs und die damit verbundenen Treibhausgaseinsparungen können einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz leisten. Es liegen enorme Potentiale in diesem Bereich. In der Vergangenheit wurden bereits einzelne Ansätze im Bereich der Sanierung von Gebäuden und Stromeinsparungen in der Gemeinde gemacht. 3.1 Stromeinsparungen Im Strombereich können bereits durch einfache Maßnahmen wie beispielsweise die Anschaffung von besonders energieeffizienten Geräten und die Nutzung von energiesparenden Lampen Einsparungen erreicht werden. Die Auswahl der energiesparenden Geräte wird durch die Einordnung in Energieeffizienzklassen erleichtert. Allgemein kann man von einem durchschnittlichen Einsparpotential von 10% ausgehen, welches sich ohne größere Investitionen erschließen lässt. Mit folgenden Maßnahmen könnte Strom eingespart werden: Austausch eines Kühlgerätes (älter als 10 Jahre) durch ein energiesparendes Gerät Austausch einer Heizungspumpe durch eine Energieeffizienzpumpe Vermeidung von Standby-Verbräuchen welche mittlerweile bis zu 5% vom Stromverbrauch von Privathaushalten ausmachen Übergang zur LED-Beleuchtung 8
14 Neben den Gebäuden könnte beispielsweise durch einen kontinuierlichen Austausch der Straßenbeleuchtung durch energiesparende Lampen oder LED Beleuchtung der Stromverbrauch gesenkt werden. Es wurde davon ausgegangen, dass 20% des Stromverbrauchs für die Straßenbeleuchtung eingespart werden könnte. In der Gemeinde könnten insgesamt MWh Strom eingespart werden (Tabelle 7). Es war schwierig pauschale Aussagen über Einsparmöglichkeiten in Betrieben zu treffen, sie benötigen einer individuellen Betrachtung. Tabelle 7: Angenommene Stromeinsparpotentiale nach Sektor Verbrauchergruppe Einsparmenge Einsparziel kwh Privathaushalte ,0% Industrie und Gewerbe Öffentliche Beleuchtung ,0% Gemeindegebäude ,0% Gesamt ,5% 3.2 Wärmeeinsparungen Die Sanierung von Gebäuden bietet eine entscheidende Möglichkeit auch langfristig Energie einzusparen. Bei Instandhaltungsarbeiten an älteren Häusern bietet es sich oftmals an gleichzeitig energetische Verbesserungen durchzuführen. Im Bereich der Wärme lassen sich beispielsweise mit folgenden Maßnahmen Einsparpotentiale erschließen: Verbesserung der Wärmedämmung im Bestand Modernisierung bestehender Heizungsanlagen Hydraulischer Abgleich und bessere Parametrierung der Heizungsanlagen Als sofort erschließbar gelten Einsparpotentiale im Bereich der Dachdämmung sowie der Dämmung der Heizungsrohre im Heizungsraum. Die Erfahrung zeigt, dass zirka 80% des Gebäudebestandes Schwachpunkte in diesen Bereichen vorweist. Im Wärmebereich wären Einsparungen von MWh entsprechend Litern Heizöl möglich (Tabelle 8). Ähnlich wie bei der Stromversorgung konnten keine Aussagen über die Einsparpotentiale in den örtlich ansässigen Betrieben gemacht werden, diese müssten einzeln untersucht werden. Tabelle 8: Angenommene Wärmeeinsparpotentiale nach Sektor Verbrauchergruppe Einsparmenge Einsparziel kwh Privathaushalte ,0% Industrie und Gewerbe - 0,0% Gemeindegebäude ,0% Gesamt ,4% 9
15 4 Potentialanalyse der Erneuerbaren Energien 4.1 Potential Bioenergie Die nachhaltige Energieerzeugung aus Biomasse ist ein wichtiger Bestandteil der nationalen Strategie für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Luxemburg. Biomasse hat den Vorteil gegenüber von anderen regenerativen Energien, dass sie unabhängig von dem Wetter und der Jahreszeit sowohl für die Wärmeproduktion als auch für die Stromproduktion genutzt werden kann. Für die Potentialermittlung im Bereich Biomasse wurden alle in der Gemeinde verfügbaren Biomassefraktionen berücksichtigt. Es wurden land- und forstwirtschaftliche Biomassen sowie gewerbliche, industrielle und kommunale biogene Abfall- und Reststoffe betrachtet. Bei der Potentialermittlung wurde besonderen Wert auf die nachhaltige Nutzung der Biomasse für die Bioenergieerzeugung gelegt Vergärbare Biomassen Auf den landwirtschaftlichen Flächen könnten Energiepflanzen für die Energieproduktion angebaut werden. In der Gemeinde Steinfort werden 323 ha Ackerland und 385 ha Grünland von den ortsansässigen Landwirten bewirtschaftet (Statec, 2012). Die zentrale Frage beim Anbau von Energiepflanzen ist die zum Anbau zur Verfügung stehende landwirtschaftliche Fläche. Es wurde davon ausgegangen, dass 10% der landwirtschaftlichen Fläche zur Energieproduktion bereitgestellt werden könnte. Auf 32,3 ha Ackerfläche würden Energiepflanzen für die Biogasproduktion angebaut werden. Biogassubstrate müssen jedoch nicht zwangsweise ackerbaulich erzeugt werden. So könnten die Grasaufwüchse von den 38,5 ha Grünlandflächen als Substartergänzung verwertet werden. Zur Ermittlung des energetischen Potentials aus der Viehhaltung wurde der Festmist- und Gülleanfall über den Viehbestand und die spezifische Festmist- und Gülleproduktion in Berücksichtigung der Aufstallungsart ermittelt. Im Jahr 2007 lag die Viehzahl bei rund Stück, was 807 GVE entsprach (Statec, 2007). Es fielen jährlich rund m 3 Gülle und t Mist an. Es lagen keine aktuellen Zahlen über den Viehbestand vor, es wurde davon ausgegangen, dass der Viehbestand konstant blieb. Neben den landwirtschaftlichen Biomassen, fallen auch organische Reststoffe in den Gewerbe- und Industriebetrieben an. In der Mühle in Kleinbettingen werden bei der Mehlherstellung Mühlennachprodukte produziert. Die Mehlproduktion liegt bei schätzungsweise t/a. Bei einer Mehlausbeute von 80%, entstehen theoretisch t/a Mühlennachprodukte. Aufgrund des hohen Trockenmassegehaltes und der Energiedichte würden sie sich gut für die Biogasproduktion 10
16 eignen. Über die aktuelle Verwertung dieser Nebenprodukte lagen keine Informationen vor. Es wurde angenommen, dass sie in der Futtermittelherstellung verwendet werden und für eine energetische Verwertung nicht zur Verfügung stehen würden. Biomüll und halmgutartiges Landschaftspflegematerial werden bereits energetisch in der Biogasanlage in Kehlen verwertet. Unter Berücksichtigung der zugrunde gelegten Annahmen würde das Biogaspotential im Bereich der vergärbaren Biomassen bei MWh/a liegen (Tabelle 9). Das produzierte Biogas könnte entweder in einem Blockheizkraftwerk verstromt oder auf Erdgasniveau aufgearbeitet werden. Da eine Aufbereitung des Biogases aus wirtschaftlichen Gründen nicht für kleinere Anlagen interessant wäre, wurde davon ausgegangen, dass das Biogas verstromt werden würde. Der produzierte Strom würde in das öffentliche Stromnetz eingespeist und die bei der Stromerzeugung entstehende Abwärme an Wärmeabnehmer abgegeben werden. Für die Berechnungen wurde von einem Blockheizkraftwerk mit einem elektrischen Wirkungsgrad von 39% und einem thermischer Wirkungsgrad von 45% ausgegangen. Der Eigenwärmebedarf der Fermenter der Biogasanlage wurde mit 25% der produzierten Wärme angesetzt. Aus den vergärbaren Biomassen könnten insgesamt kwh/a Strom produziert und kwh/a Abwärme an Wärmeabnehmer abgegeben werden. Tabelle 9: Realisierbares Energiepotential in der Gemeinde im Bereich der vergärbaren Biomassen Energiepotential Strompotential Wärmepotential Elektrische Leistung kwh/a (brutto) kwh/a kwh/a kw Biomüll Landschaftspflegematerial Landwirtschaftliche Fläche Tierhaltung Gesamt Verbrennbare feste Biomassen Für die Abschätzung des Energiepotentials aus Waldholz wurde die gesamte Waldfläche in der Gemeinde Steinfort berücksichtigt. Die Waldfläche setzt sich aus 142,7 ha Gemeinde- und Staatswald sowie schätzungsweise 91,2 ha Privatwald zusammen. Die Flächenangaben stammen vom Revierförster. Der Wald wurde nach Artenzusammensetzung in verschiedene Waldgruppen aufgeteilt. Um eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes zu gewährleisten wurde der bestehende Holzbestand nicht zum Energieholzpotential gezählt, sondern nur der jährliche Hiebsatz für jede Baumgruppe 11
17 berücksichtigt. Spezifische Hiebsätze lagen für die Forstflächen in der Gemeinde nicht vor. Es wurde auf Werte aus der Bundeswaldinventur für Rheinland-Pfalz, die mit Vertretern der luxemburgischen Forstverwaltung diskutiert wurden, zurückgegriffen. Für die verschiedenen Waldgruppen wurde anschließend das Verhältnis zwischen Stark- und Schwachholz festgelegt. Um die bereits bestehenden Verwertungswege des Waldholzes zu berücksichtigen wurde angenommen, dass ausschließlich 50% des Schwachholzes für die Energieproduktion zur Verfügung stehen würde. Das Energieholzpotential im Privatwald könnte aufgrund der Zersplitterung und der mangelhaften Erschließung der Parzellen nur teilweise aktiviert werden. Für den Privatwald wurde daher von einer 50% Mobilisierung des Energieholzpotentials ausgegangen. In den Berechnungen wurde auch das bereits aus dem Wald genutzte Energieholz berücksichtigt und vom Potential abgezogen. Neben dem Waldholz fällt noch holzartiges Landschaftspflegematerial in der Gemeinde Steinfort an. Das Aufkommen wurde auf Basis der Einwohnerzahl und eines spezifischen Einwohnerkennwertes ermittelt. Es fallen rund 196 t/a holzartiges Landschaftspflegematerial an, die energetisch genutzt werden könnten. Im Bereich der verbrennbaren Biomassen würde das Energiepotential bei 992 MWh/a liegen (Tabelle 10). Tabelle 10: Realisierbares Energiepotential in der Gemeinde im Bereich der verbrennbaren Biomassen Energiepotential kwh/a Landschaftspflegematerial Waldholz Gesamt Biomassepotential Aus den lokalen vergärbaren und festen Biomassen könnten in der Gemeinde MWh/a Strom und MWh/a Wärme produziert werden (Tabelle 11). Tabelle 11: Realisierbares Strom- und Wärmepotential im Bereich Biomasse in der Gemeinde Strompotential Wärmepotential kwh/a kwh/a Vergärbare Biomassen Feste Biomassen Gesamt
18 4.2 Potential Sonnenenergie Die Sonnenergie kann zur solarthermischen Wärmegewinnung und zur photovoltaischen Stromproduktion genutzt werden. Bei der Photovoltaik wird die solare Energie mittels Solarzellen in Strom umgewandelt. Neben der Photovoltaik kann die solare Strahlung auch in Solarkollektoren in Wärme umgewandelt werden. Die Wärme wird in der Regel zur Warmwasserbereitstellung und/oder zur Heizungsunterstützung genutzt. Durch den Einsatz von speziellen Kollektoren kann Solarthermie auch für andere Prozesszwecke mit einem höheren Temperaturniveau genutzt werden. In dieser Studie wurde das Energiepotential ausschließlich für die Dachflächen der privaten Haushalte ausgewiesen, sonstige Dachflächen wurden nicht berücksichtigt. Als Berechnungsgrundlage für die Abschätzung des Potentials diente der Solarkataster einer vergleichbaren ländlichen luxemburgischen Kommune. In der Gemeinde Steinfort würden sich zusätzlich m 2 Dachfläche für die Nutzung von Solarenergie eignen. Im Bereich der Stromproduktion könnten Photovoltaikanlagen mit einer elektrischen Leistung von kw p installiert werden. Das realisierbare Strompotential würde bei MWh/a liegen. Durch die Nutzung von thermischen Solarkollektoren könnten Liter Heizöl substituiert werden. 4.3 Potential Windenergie Für die Nutzung von Windenergie eignen sich insbesondere Standorte mit guten Windverhältnissen. Die Standortwahl von Windkraftanlagen wird jedoch unteranderem von Vorschriften in Bezug auf den Schalldruckpegel, die Schattenwurfdauer sowie die Auswirkungen auf die Natur und Flugverkehr eingeschränkt. Die Agence de l énergie hat einen Windatlas für Luxemburg erstellen lassen, welche die Standortwahl erleichtern soll. Die mittleren Jahresgeschwindigkeiten in 30 m Höhe sind für jedes Gebiet in Luxemburg ersichtlich. Die Abbildung 5 zeigt einen Auszug aus dem Windatlas von Luxemburg für das Gemeindegebiet von Steinfort. Das Gemeindeterritorium kennzeichnet sich durch eine große Variabilität der mittleren Jahreswindgeschwindigkeiten aus. Im Süden werden über das Jahr gesehen die höchsten Windgeschwindigkeiten verzeichnet. 13
19 Abbildung 5: Karte der mittleren Jahresgeschwindigkeiten des Windes in 30m Höhe für das Gemeindegebiet (Energieagence, o.j.) Laut der Engel, Eischen & Mirgan gibt es potentielle Standorte für Windkraftanlagen in der Gemeinde Steinfort. Als Standorte würden Loer und Kéibréck in Frage kommen (Abbildung 6). Bei der Standortwahl wurden jedoch ausschließlich die Windverhältnisse und die Abstände zu Siedlungen berücksichtigt. Laut der Studie von 2008 würde das Potential bei MWh/a liegen (ENERCON E70-E4 2 MW, 98 m Nabenhöhe, 80 m Rotordurchmesser). Bei der Planung von Windkraftanlagen müssen jedoch auch in einer Umweltverträglichkeitsprüfung die Auswirkungen des Projektes auf die Natur und Natürlichen Ressourcen berücksichtigt werden. Die Abbildung 6 zeigt, dass an die in der Studie zurückbehaltenen Standorte an eine Natura 2000 Schutzzone angrenzen. Abbildung 6: Mögliche Standorte für Windkraftanlagen laut Engel, Eischen & Mirgan und Natura 2000 Zonen in der Gemeinde (Administration du Cadastre et de la Topographie, 2013 überarbeitet) 14
20 Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass Windkraftanlagen zu Lebensraumverlusten und zur Aufgabe von Brutrevieren von verschiedenen Vogelarten sowie zum Totschlag und Verletzungen bei Fledermäusen führen können. Um Windkraftanlagenbetreiber kostenintensive Planungen und Umweltverträglichkeitsprüfungen an aus Sicht des Naturschutzes ungünstigen Standorten zu ersparen, wurde von der luxemburgischen Natur- und Vogelschutzliga Karten mit Abstandempfehlungen erstellt. Auf Basis von Kriterien wurden Ausschlussbereiche und Prüfbereiche ausgewiesen. Die Abbildung 7 zeigt aus Sicht des Vogelschutzes die Ausschlussbereiche und Prüfbereiche für Windkraftanlagen betreffend den Schutz der Vögel für die Gemeinde Steinfort. Man sieht, dass fasst das gesamte Gemeindegebiet in dem Prüfbereich liegt, bei dem zu untersuchen ist, ob die entsprechenden Lebensräume von den betroffenen Vogelarten genutzt werden. Betreffend den Vogelschutz wurden in der Gemeinde Steinfort keine Ausschlussbereiche für Windkraftanlagen ausgewiesen. Abbildung 7: Abstandsempfehlungen für Windkraftanlagenstandorte aus Sicht des Vogelschutzes für das Gemeindegebiet (Lëtzebuerger Natur- an Vulleschutzliga, o.j. überarbeitet) In der Abbildung 8 werden die Ausschlussbereiche und Prüfbereiche für Windkraftanlagen aus sicht des Schutzes der Fledermäuse dargestellt. Im nördlichen und mittleren Teil des Gemeindegebietes wurden besondere Fledermauskolonien verzeichnet. 15
21 Abbildung 8: Abstandsempfehlungen für die Errichtung von Windkraftanlagen aus Sicht des Fledermausschutzes für das Gemeindegebiet (Lëtzebuerger Natur- an Vulleschutzliga, o.j. überarbeitet) Um weitere Aussagen bezüglich der Machbarkeit von Windkraftanlagen zu treffen und mögliche Standorte zu identifizieren sind weiterführende Studien nötig. Man kann jedoch schlussfolgern, dass es bei der Errichtung von Windkraftanlagen zu Konflikten mit dem Naturschutz kommen kann. Das in der Studie ausgewiesene Energiepotential wurde nicht in das Leitbild mit aufgenommen. 16
22 4.4 Potential Geothermie In Luxemburg kommt auf Grund des allgemein niedrigen geothermischen Gradienten nur die Nutzung der oberflächennahen Geothermie in Frage. Die Nutzung der Erdwärme mit Wärmepumpen hat in den letzten Jahren relativ stark an Interesse gewonnen. Die Erdwärme wird über Erdsonden oder Erdkollektoren angezapft. Der Bau von Erdsonden ist genehmigungspflichtig, da sie einen Eingriff in die geohydraulischen Eigenschaften des Untergrundes darstellen und zu Beeinträchtigungen des Grundwassers führen können. Das gesamte Gemeindegebiet liegt in einer Zone wo Tiefenbohrungen nicht genehmigungsfähig sind oder mit Einschränkungen genehmigt werden können (Abbildung 9). Folglich ist das Potential für die der Erdwärme mittels Erdsonden als marginal einzuschätzen. Eine Nutzung von Erdkollektoren ist jedoch nicht ausgeschlossen. Abbildung 9: Karte mit den eingeschränkten Zonen für Tiefenbohrungen in der Gemeinde (Administration du Cadastre et de la Topographie, 2013) 17
23 Energiepotential in kwh/a 4.5 Potential Wasserkraft Das Wasserkraftpotential wird in Luxemburg bereits zum Großteil ausgeschöpft. Im kleinen Leistungsbereich bestehen jedoch noch Ausbaumöglichkeiten in der Reaktivierung und Modernisierung von bestehenden Standorten, beispielsweise alter Mühlen. Die Errichtung und der Betrieb von Kleinwasserkraftwerken werden jedoch durch verschärfte wasserschutzrechtliche Rahmenbedingungen erschwert. Die in der europäischen Wasserrahmenrichtlinie vorgeschriebenen Restwassermengen und zusätzliche baulichen Einrichtungen wirken sich besonders auf die Wirtschaftlichkeit kleiner Anlagen aus. Mögliche Standorte für die Wasserkraftnutzung in der Gemeinde könnten die alte Mühle in Kleinbettingen und in Schwarzenhof sein. Neben den alten bestehenden Infrastrukturen könnte man die Installierung einer Turbine in der Wasserleitung, die im Rahmen des Baus einer neuen Kläranlage angelegt wird, in Betracht ziehen. Für eine Abschätzung des Potentials wären jedoch weitere Studien nötig 4.6 Gesamtes Potential In Berücksichtigung der verschiedenen erneuerbaren Energien würde das zusätzliche realisierbare Potential für die Stromproduktion bei insgesamt MWh/a und für die Wärmeproduktion bei MWh/a liegen (Abbildung 10). Es ist anzumerken, dass die Potentiale im Bereich der Windenergie, Geothermie und Wasserkraft nicht miteinbezogen wurden Strompotential Wärmepotential - Abbildung 10: Graphische Darstellung des Strom- und Wärmepotentials nach erneuerbarer Energiequelle 18
24 5 Zusammenfassung der Ausbaupotentiale Um eine geeignete Strategie aus den Potentialen ableiten zu können und ein Leitbild für die Gemeinde auszuarbeiten, ist ein Blick auf eine zusammenfassende Bilanz sinnvoll. 5.1 Stromversorgung Durch die gesamte Aktivierung der Potentiale würde die lokale, regenerative Stromproduktion von 339 auf MWh/a ansteigen (Tabelle 12). Die Nutzung des lokalen Biogaspotentials würde zu 39,3% zur erneuerbaren Stromproduktion beitragen. Durch die Aktivierung der verfügbaren Dachflächen könnten zusätzlich MWh/a durch Photovoltaikanlagen produziert werden. Der Stromverbrauch in der Gemeinde könnte durch Umsetzung von Einsparmaßnahmen in den Privathaushalten, in den kommunalen Gebäuden und der öffentlichen Beleuchtung um 2,5 % gegenüber der Ausgangslage gesenkt werden. Es ist wichtig anzumerken, dass die Einsparpotentiale in den Betrieben nicht betrachtet wurden. Aus den ermittelten Strompotentialen, sowie unter der Voraussetzung wesentlicher Anstrengungen bei den Stromeinsparungen wäre eine Deckung des Stromverbrauchs von 2012 durch lokal erzeugte regenerative Energien von 7,8% möglich. Tabelle 12: Bilanz der Stromversorgung bei vollständiger Aktivierung der Potentiale Szeanrio: 100% Aktivierung der Potentiale kwh/a Anteil Stromproduktion Bestand Photovoltaik ,2% Potential Photovoltaik ,5% Biogas ,3% Gesamt ,0% Stromverbrauch Gesamt Potential Stromeinsparungen ,5% Voraussichtlicher Stromverbrauch Bilanz Deckungsgrad durch lokal erzeugte erneuerbare Energien 7,8% 19
25 5.2 Wärmeversorgung Die Wärmeproduktion aus erneuerbaren Energiequellen könnte durch eine gesamte Mobilisierung der bislang ungenutzten Potentiale in den Bereichen Biogas, Solarthermie und Hackschnitzel auf MWh/a ansteigen (Tabelle 13). Durch die Sanierungsmaßnahmen in den Privathaushalten und kommunalen Infrastrukturen könnte der Wärmeverbrauch in der Gemeinde auf MWh/a sinken. Dies würde einer Senkung des Verbrauchs von 10,4 % gegenüber der Ausgangslage entsprechen. Durch die Steigerung der Wärmeproduktion aus regenerativen Quellen sowie Einsparungen in den Gebäuden könnten 11,4 % des Wärmeverbrauchs von 2012 in der Gemeinde gedeckt werden. Tabelle 13: Bilanz der Wärmeversorgung bei vollständiger Aktivierung der Potentiale Szeanrio: 100% Aktivierung der Potentiale kwh/a Anteil Wärmeproduktion Bestand Brennholz ,9% Holzpellets ,4% Solarthermie ,2% Biogasanlage Kehlen Gutschrift ,4% Umweltwärme ,3% Potential Holzhackschnitzel ,0% Biogas ,3% Solarthermie ,4% Gesamt ,0% Wärmeverbrauch Gesamt Potential Einsparung durch Sanierung ,4% Voraussichtlicher Wärmeverbrauch Bilanz Deckungsgrad durch lokal erzeugte erneuerbare Energien 11,4% 5.3 Treibhausgasemissionen In Folgendem wurden die Treibhausgasemissionen nach der gesamten Aktivierung der Potentiale berechnet und anschließend mit den Treibhausgasemissionen in der Ausgangslage verglichen. Für die Berechnung der Treibhausgasemissionen in 2020 wurden die mit der Aktivierung der Potentiale verbundenen Treibhausgaseinsparungen von den aktuellen Treibhausgasemissionen abgezogen. Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Durchführungen von Energieeinsparmaßnahmen würden in der Gemeinde Steinfort insgesamt t CO 2 Äq. eingespart werden. Die Treibhausgasemissionen würden gegenüber der Ausgangslage um 17,2% gesenkt werden (Tabelle 14). In 2020 würden die Emissionen bei t CO 2 Äq./a liegen. Der lokale 20
26 Emissionsfaktor für Strom würde auf 0,143 kg CO 2 Äq./kWh sinken. Für die Wärmeversorgung würden auf dem Gemeindegebiet 0,241 kg CO 2 Äq./kWh emittiert werden. Tabelle 14: Treibhausgaseinsparungen und Emissionen bei 100% Aktivierung der Potentiale Stromversorgung Szeanrio: 100% Aktivierung der Potentiale Endenergie Emissionsfaktor Emissionen kwh/a kg CO2 Äq./kWh t CO 2 Äq./a Potential Biogas , Photovoltaik , Stromeinsparungen , Gesamt In , Wärmeversorgung Potential Biogas , Hackschnitzel , Solarthermie , Wärmeinsparungen , Gesamt In , Gesamt In Treibhausgaseinsparungen 17,2% Durch die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen in den kommunalen Infrastrukturen und Privathaushalten und die Nutzung von Solarthermie könnten die größten Emissionssenkungen erreicht werden (Abbildung 11). 7,6% 2,3% 1,5% 0,6% Biogas Photovoltaik Stromeinsparungen 4,4% 0,8% Hackschnitzel Solarthermie Wärmeeinsparungen Abbildung 11: Treibhausgaseinsparungen durch die 100% Aktivierung der erneuerbaren Energie- und Einsparpotentiale 21
27 6 Definition des Leitbildes Folgende Pisten wurden für die Definition des Leitbildes festgehalten: 50% des Holzpotentials 50% des Biogaspotentials 50% des Sonnenenergiepotentials 100% des Energieeinsparpotentials Auf Basis dieser Annahmen wurden die Zielsetzungen für die Strom- und Wärmeversorgung sowie die Treibhausgaseinsparungen in der Gemeinde, die in dem klima- und energiepolitischen Leitbild festgehalten wurden, definiert. 6.1 Stromversorgung In Berücksichtigung dieser Annahmen könnte der Stromverbrauch von 2012 in Berücksichtigung der angenommenen Einsparungen zu 3,9 % durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Durch die Einsparmaßnahmen könnte der Stromverbrauch um 2,5 % gesenkt werden (Tabelle 15). Tabelle 15: Bilanz der Stromversorgung in Berücksichtigung der festgehaltenen Pisten Szeanrio: Partielle Aktivierung der Potentiale kwh/a Anteil Stromproduktion Bestand Photovoltaik ,5% Potential Photovoltaik ,2% Biogas ,3% Gesamt ,0% Stromverbrauch Gesamt Potential Stromeinsparungen ,5% Voraussichtlicher Stromverbrauch Bilanz Deckungsgrad durch lokal erzeugte erneuerbare Energien 3,9% 22
28 6.2 Wärmeversorgung Durch die partielle Aktivierung der Potentiale könnte der Wärmeverbrauch auf dem Gemeindegebiet von 2012 in Berücksichtigung der angenommenen Einsparungen zu 6,2 % durch lokal erzeugte erneuerbare Energien gedeckt werden. Durch Sanierungsmaßnahmen in den Privathaushalten und kommunalen Infrastrukturen könnte der Wärmeverbrauch um 10,4 % gesenkt werden (Tabelle 16). Tabelle 16: Bilanz der Wärmeversorgung in Berücksichtigung der festgehaltenen Pisten Szeanrio: Partielle Aktivierung der Potentiale kwh/a Anteil Wärmeproduktion Bestand Brennholz ,3% Holzpellets ,2% Solarthermie ,7% Biogasanlage Kehlen Gutschrift ,4% Umweltwärme ,4% Potential Holzhackschnitzel ,9% Biogas ,9% Solarthermie ,3% Gesamt ,0% Wärmeverbrauch Gesamt Potential Einsparung durch Sanierung ,4% Voraussichtlicher Wärmeverbrauch Bilanz Deckungsgrad durch lokal erzeugte erneuerbare Energien 6,2% 23
29 6.3 Treibhausgasemissionen Auf Grundlage der festgehaltenen Pisten wurden die Treibhausgasemissionen für das Jahr 2020 berechnet. In Berücksichtigung der festgehaltenen Pisten könnten die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 12,5 % gegenüber der Ausgangslage gesenkt werden (Tabelle 17). Durch die Einsparung von t CO 2 Äq würden die Treibhausgasemissionen auf t CO 2 Äq./a sinken. Tabelle 17: Treibhaugaseinsparpotentiale und Emissionen in Berücksichtigung der festgehaltenen Pisten Stromversorgung Szeanrio: Partielle Aktivierung der Potentiale Endenergie Emissionsfaktor Emissionen kwh/a kg CO2 Äq./kWh t CO 2 Äq./a Potential Biogas , Photovoltaik , Stromeinsparungen , Gesamt In , Wärmeversorgung Potential Biogas , Hackschnitzel , Solarthermie , Wärmeeinsparungen , Gesamt In , Gesamt In Treibhausgaseinsparungen 12,5% Der Emissionsfaktor für Strom würde auf dem Gemeindegebiet bei 0,152 kg CO 2 Äq./kWh liegen. Im Wärmebereich würde der Emissionsfaktor auf 0,255 kg CO 2 Äq./kWh sinken. 1,1% 0,6% 0,6% 0,4% Biogas Photovoltaik 7,6% 2,0% Stromeinsparungen Hackschnitzel Solarthermie Wärmeeinsparungen Abbildung 12: Treibhausgaseinsparungen durch die partielle Aktivierung der erneuerbaren Energie- und Einsparpotentiale 24
30 Die Abbildung 12 zeigt die Treibhausgaseinsparungen, die durch die partielle Aktivierung der Potentiale erreicht werden könnten. Die Sanierungsmaßnahmen in den kommunalen Gebäuden und Privathaushalten würden zu den größten Treibhausgaseinsparungen führen. Literaturverzeichnis Administration du Cadastre et de la Topographie (2013): Geoportal, Geographisches Informationssystem, Luxemburg Creos (2013): Données Steinfort Energieagence (o.j.): Windatlas Luxemburg, Luxemburg Engel A., Eischen R. & Mirgan T. (2008): Gemeinde Steinfort, Energiekonzept, Goblet Lavandier & Associés, Luxemburg Lëtzebuerger Natur- an Vulleschutzliga (o.j.): Karte mit Abstandsempfehlungen zu besonderen Tiervorkommen bei der Planung von Windkraftanlagen Statec (1995): Superficie forestière par canton et commune 1995, Luxemburg Statec (2007): Landwirtschaftliche Zählung vom Mai 2007, Luxemburg Statec (2012): Annuaire statistique 2012, Luxembourg 25
Grundlage für die Definition des Leitbildes. Gemeinde Koerich
 Grundlage für die Definition des Leitbildes Gemeinde Koerich November 2014 erstellt von 6, Jos Seylerstroos L-8522 Beckerich Tel: 268818 Fax: 268819 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis... II Tabellenverzeichnis...
Grundlage für die Definition des Leitbildes Gemeinde Koerich November 2014 erstellt von 6, Jos Seylerstroos L-8522 Beckerich Tel: 268818 Fax: 268819 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis... II Tabellenverzeichnis...
LEITBILD Gemeinde Bourscheid
 LEITBILD Gemeinde Bourscheid Analyse der Ausgangssituation Die Gemeinde Die Gemeinde besteht aus 4 Ortschaften Fläche: 36,86 km 2 Bevölkerung: 1.681 Einwohner Haushalte: 652 Bildquelle: chateau.bourscheid.lu/
LEITBILD Gemeinde Bourscheid Analyse der Ausgangssituation Die Gemeinde Die Gemeinde besteht aus 4 Ortschaften Fläche: 36,86 km 2 Bevölkerung: 1.681 Einwohner Haushalte: 652 Bildquelle: chateau.bourscheid.lu/
Grundlage für die Definition des Leitbildes. Gemeinde Bous
 Grundlage für die Definition des Leitbildes Gemeinde Bous Februar 2014 erstellt von 6, Jos Seylerstroos L-8522 Beckerich Tel: 268818 Fax: 268819 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis... II Tabellenverzeichnis...
Grundlage für die Definition des Leitbildes Gemeinde Bous Februar 2014 erstellt von 6, Jos Seylerstroos L-8522 Beckerich Tel: 268818 Fax: 268819 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis... II Tabellenverzeichnis...
November 2014 LEITBILD. Gemeinde Koerich HEADLINE PRÄSENTATIONSTITEL AUCH ZWEIZEILIG
 November 2014 LEITBILD Gemeinde Koerich Analyse der Ausgangssituation Die Gemeinde Die Gemeinde besteht aus 4 Ortschaften Fläche: 18,9 km 2 Bevölkerung: 2.400 Einwohner Haushalte: 857 Administration du
November 2014 LEITBILD Gemeinde Koerich Analyse der Ausgangssituation Die Gemeinde Die Gemeinde besteht aus 4 Ortschaften Fläche: 18,9 km 2 Bevölkerung: 2.400 Einwohner Haushalte: 857 Administration du
Energiebedarf 2013 / 2040
 Allgemeine Angaben Gemeindeschlüssel 9189135 Einwohner 213 EW/km² 2.287 76 Fläche (ha) Flächenanteil am Lkr. 2.993 2,% % Elektrischer 5.971 16% Thermischer 32.292 84% Gesamt 38.263 1% Anteil der EE am
Allgemeine Angaben Gemeindeschlüssel 9189135 Einwohner 213 EW/km² 2.287 76 Fläche (ha) Flächenanteil am Lkr. 2.993 2,% % Elektrischer 5.971 16% Thermischer 32.292 84% Gesamt 38.263 1% Anteil der EE am
FAKTENBLATT ERNEUERBARE ENERGIEN IM KANTON ZUG Beilage zur Medienmitteilung vom 26. Januar 2011
 Baudirektion FAKTENBLATT ERNEUERBARE ENERGIEN IM KANTON ZUG Beilage zur Medienmitteilung vom 26. Januar 211 Das vorliegende Faktenblatt fasst die Ergebnisse der Studie "Erneuerbare Energien im Kanton Zug:
Baudirektion FAKTENBLATT ERNEUERBARE ENERGIEN IM KANTON ZUG Beilage zur Medienmitteilung vom 26. Januar 211 Das vorliegende Faktenblatt fasst die Ergebnisse der Studie "Erneuerbare Energien im Kanton Zug:
Frankfurt am Main, krsfr. Stadt
 Rahmendaten Status Quelle Kommentar Datenqualität* Einwohner 701.350 Statistik Hessen Datenstand: 31.12.2013 IST_Gebietsfläche 248.300.000 m² Statistik Hessen Datenstand: 05/2014 Basisjahr 2013 Einzelne
Rahmendaten Status Quelle Kommentar Datenqualität* Einwohner 701.350 Statistik Hessen Datenstand: 31.12.2013 IST_Gebietsfläche 248.300.000 m² Statistik Hessen Datenstand: 05/2014 Basisjahr 2013 Einzelne
Grundlagen der Kraft-Wärme-Kopplung
 Grundlagen der Kraft-Wärme-Kopplung Funktionsweise der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) Bei der Erzeugung von elektrischem Strom entsteht als Nebenprodukt Wärme. In Kraftwerken entweicht sie häufig ungenutzt
Grundlagen der Kraft-Wärme-Kopplung Funktionsweise der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) Bei der Erzeugung von elektrischem Strom entsteht als Nebenprodukt Wärme. In Kraftwerken entweicht sie häufig ungenutzt
n Ein gemeinsames Umsetzungsprogramm für Maßnahmen in Gemeinden, Haushalten und Betrieben
 REGIONALES ENERGIEKONZEPT Bucklige Welt Wechselland Von der Konzeptphase in die gemeinsame Umsetzung! Ein Projekt im Auftrag der LEADER Region Bucklige Welt-WechsellandWechselland DI Andreas Karner KWI
REGIONALES ENERGIEKONZEPT Bucklige Welt Wechselland Von der Konzeptphase in die gemeinsame Umsetzung! Ein Projekt im Auftrag der LEADER Region Bucklige Welt-WechsellandWechselland DI Andreas Karner KWI
Gemeindesteckbrief - Gemeinde Kammerstein Allgemeine Angaben
 Verteilung des Gebäudebestandes [%] 70 84 122 126 126 116 207 232 Gemeindesteckbrief - Gemeinde Kammerstein Allgemeine Angaben Gemeindeschlüssel 09 576 128 Postleitzahl 91126 Einwohner 2010 EW/km² 2.815
Verteilung des Gebäudebestandes [%] 70 84 122 126 126 116 207 232 Gemeindesteckbrief - Gemeinde Kammerstein Allgemeine Angaben Gemeindeschlüssel 09 576 128 Postleitzahl 91126 Einwohner 2010 EW/km² 2.815
Energieentwicklungskonzept für den Landkreis Roth
 Energieentwicklungskonzept für den Landkreis Roth Institut für IfE GmbH Hochschule Amberg-Weiden Kaiser-Wilhelm-Ring 23 92224 Amberg www.ifeam.de Folie 1 Inhaltsverzeichnis 1. Energie- und CO 2 -Bilanz
Energieentwicklungskonzept für den Landkreis Roth Institut für IfE GmbH Hochschule Amberg-Weiden Kaiser-Wilhelm-Ring 23 92224 Amberg www.ifeam.de Folie 1 Inhaltsverzeichnis 1. Energie- und CO 2 -Bilanz
Kommunales Energiekonzept in der Gemeinde Schipkau
 Kommunales Energiekonzept in der Gemeinde Schipkau Analyse der Energieverbräuche und der Energieerzeugung in der Gemeinde Schipkau ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE Klettwitz, 07. April
Kommunales Energiekonzept in der Gemeinde Schipkau Analyse der Energieverbräuche und der Energieerzeugung in der Gemeinde Schipkau ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE Klettwitz, 07. April
KLIMASCHUTZ IN PFAFFENHOFEN Wo steht die Stadt und was ist möglich?
 KLIMASCHUTZ IN PFAFFENHOFEN Wo steht die Stadt und was ist möglich? AUFTAKTVERANSTALTUNG 14.MAI 2012 Mirjam Schumm, Green City Energy Gliederung Wer sind wir? Wo steht die Stadt Pfaffenhofen heute? Welche
KLIMASCHUTZ IN PFAFFENHOFEN Wo steht die Stadt und was ist möglich? AUFTAKTVERANSTALTUNG 14.MAI 2012 Mirjam Schumm, Green City Energy Gliederung Wer sind wir? Wo steht die Stadt Pfaffenhofen heute? Welche
ECORegion. Das internetbasierte Instrument zur CO 2 -Bilanzierung für Kommunen
 ECORegion Das internetbasierte Instrument zur CO 2 -Bilanzierung für Kommunen Warum eine Bilanzierung der CO 2 -Emissionen? Welche Bereiche sollten betrachtet werden? Klima-Bündnis Gemeinden : - Reduktion
ECORegion Das internetbasierte Instrument zur CO 2 -Bilanzierung für Kommunen Warum eine Bilanzierung der CO 2 -Emissionen? Welche Bereiche sollten betrachtet werden? Klima-Bündnis Gemeinden : - Reduktion
Leitung: Betreuung: Sven Erik. Zürich, 1. Juli
 Standortpotentiale der Schweiz für erneuerbare Energie in Masterarbeit in Raumentwicklung und Infrastruktursysteme von Philipp Renggli Leitung: Betreuung: Prof. Dr. Adrienne Grêt Regamey Bettina Weibel,
Standortpotentiale der Schweiz für erneuerbare Energie in Masterarbeit in Raumentwicklung und Infrastruktursysteme von Philipp Renggli Leitung: Betreuung: Prof. Dr. Adrienne Grêt Regamey Bettina Weibel,
Integriertes Klimaschutzkonzept Landkreis München
 Eckdaten im Jahr 21 Im Jahr 21 zählte der 323.15 Einwohner und 272.92 Fahrzeuge. Bis zum Jahr 23 wird die Einwohnerzahl um ca. 12 Prozent auf 366.5 steigen. weit wurden 21 ca. 13.43 GWh Endenergie benötigt.
Eckdaten im Jahr 21 Im Jahr 21 zählte der 323.15 Einwohner und 272.92 Fahrzeuge. Bis zum Jahr 23 wird die Einwohnerzahl um ca. 12 Prozent auf 366.5 steigen. weit wurden 21 ca. 13.43 GWh Endenergie benötigt.
Energie- und Klimakonzept für Ilmenau Zwischenstand
 Energie- und Klimakonzept für Ilmenau Zwischenstand 3.2.212 Ist-Analyse und Trendszenario bis 225 Einleitung Im Auftrag der Stadt Ilmenau erstellt die Leipziger Institut für Energie GmbH derzeit ein kommunales
Energie- und Klimakonzept für Ilmenau Zwischenstand 3.2.212 Ist-Analyse und Trendszenario bis 225 Einleitung Im Auftrag der Stadt Ilmenau erstellt die Leipziger Institut für Energie GmbH derzeit ein kommunales
KLIMASCHUTZ IN EBERSBERG
 KLIMASCHUTZ IN EBERSBERG Auftaktveranstaltung am 24.November 2011 Willi Steincke & Matthias Heinz Unsere Themen. Kurzvorstellung der beiden Fachbüros Warum ein Integriertes Klimaschutzkonzept? Wie läuft
KLIMASCHUTZ IN EBERSBERG Auftaktveranstaltung am 24.November 2011 Willi Steincke & Matthias Heinz Unsere Themen. Kurzvorstellung der beiden Fachbüros Warum ein Integriertes Klimaschutzkonzept? Wie läuft
Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Pulheim
 Zwischenbericht Kurzfassung 2017 Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Pulheim Tippkötter, Reiner; Methler, Annabell infas enermetric Consulting GmbH 14.02.2017 1. Einleitung Der vorliegende Bericht
Zwischenbericht Kurzfassung 2017 Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Pulheim Tippkötter, Reiner; Methler, Annabell infas enermetric Consulting GmbH 14.02.2017 1. Einleitung Der vorliegende Bericht
Projektarbeit Nr. 2. Nachhaltige Wärmeversorgung von öffentlichen Einrichtungen
 Projektarbeit Nr. 2 Nachhaltige Wärmeversorgung von öffentlichen Einrichtungen -Hallenbad- Sporthalle- Kindertagesstätte- Feuerwehr- In Kooperation mit Einleitung: Im Jahr 2012 wurden in Deutschland 16,2%
Projektarbeit Nr. 2 Nachhaltige Wärmeversorgung von öffentlichen Einrichtungen -Hallenbad- Sporthalle- Kindertagesstätte- Feuerwehr- In Kooperation mit Einleitung: Im Jahr 2012 wurden in Deutschland 16,2%
Das Klimaschutzkonzept des Landkreises Landsberg am Lech: Inhalte, Hintergründe und Vorhaben
 Das Klimaschutzkonzept des Landkreises Landsberg am Lech: Inhalte, Hintergründe und Vorhaben Jasmin Dameris Klimaschutzmanagerin Lkr. Landsberg am Lech Landkreis Landsberg am Lech Integriertes Klimaschutzkonzept
Das Klimaschutzkonzept des Landkreises Landsberg am Lech: Inhalte, Hintergründe und Vorhaben Jasmin Dameris Klimaschutzmanagerin Lkr. Landsberg am Lech Landkreis Landsberg am Lech Integriertes Klimaschutzkonzept
Potenziale Energieeinsparung, Effizienz und erneuerbare Energien. Einwohnerzahl: Anzahl Erwerbstätige: 1.221
 Gemeinde Emmering Potenziale Energieeinsparung, Effizienz und erneuerbare Energien 1 Ist-Zustand 2010 1.1 Allgemeine Daten Fläche: 1.094 ha Einwohnerzahl: 6.318 Anzahl Erwerbstätige: 1.221 Besiedelungsdichte:
Gemeinde Emmering Potenziale Energieeinsparung, Effizienz und erneuerbare Energien 1 Ist-Zustand 2010 1.1 Allgemeine Daten Fläche: 1.094 ha Einwohnerzahl: 6.318 Anzahl Erwerbstätige: 1.221 Besiedelungsdichte:
Energiepotenzialstudie Ergebnisse der Gemeinde Gottenheim Rathaus Gottenheim,
 Energiepotenzialstudie Ergebnisse der Gemeinde Gottenheim Rathaus Gottenheim, 17.06.2014 Nina Weiß Innovations- & Ökologiemanagement Dokumentation der Energienutzungsstruktur in Energie- und CO 2 -Bilanzen
Energiepotenzialstudie Ergebnisse der Gemeinde Gottenheim Rathaus Gottenheim, 17.06.2014 Nina Weiß Innovations- & Ökologiemanagement Dokumentation der Energienutzungsstruktur in Energie- und CO 2 -Bilanzen
Integriertes Klimaschutzkonzept für die Marktgemeinde Wiggensbach. Basisdaten Energie und Potenziale. Energieteamsitzung am
 Integriertes Klimaschutzkonzept für die Marktgemeinde Wiggensbach Energieteamsitzung am 10.10.2012 Basisdaten Energie und Potenziale 1 Dr. Kerstin Koenig-Hoffmann Agenda TOP 1 Überblick Energie- und CO
Integriertes Klimaschutzkonzept für die Marktgemeinde Wiggensbach Energieteamsitzung am 10.10.2012 Basisdaten Energie und Potenziale 1 Dr. Kerstin Koenig-Hoffmann Agenda TOP 1 Überblick Energie- und CO
Gemeinde Kottgeisering
 Gemeinde Kottgeisering Potenziale Energieeinsparung, Effizienz und erneuerbare Energien 1 Ist-Zustand 2010 1.1 Allgemeine Daten Fläche: 821 ha Einwohnerzahl: 1.593 Anzahl Erwerbstätige: 49 Besiedelungsdichte:
Gemeinde Kottgeisering Potenziale Energieeinsparung, Effizienz und erneuerbare Energien 1 Ist-Zustand 2010 1.1 Allgemeine Daten Fläche: 821 ha Einwohnerzahl: 1.593 Anzahl Erwerbstätige: 49 Besiedelungsdichte:
Kirchheimer. Auftaktveranstaltung 18. April 2013
 Kirchheimer Klimaschutzkonzept Auftaktveranstaltung 18. April 2013 Klimawandel: Doch nicht in Kirchheim - oder? LUBW: Die Temperatur steigt Starkregenereignisse und Stürme nehmen zu Jährliche Anzahl der
Kirchheimer Klimaschutzkonzept Auftaktveranstaltung 18. April 2013 Klimawandel: Doch nicht in Kirchheim - oder? LUBW: Die Temperatur steigt Starkregenereignisse und Stürme nehmen zu Jährliche Anzahl der
Klimaschutzkonzept 2014 Nutzung von und Anlagen für erneuerbare Energien in der Samtgemeinde Flotwedel
 Gemeinnütziges Unternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes Klimaschutzkonzept 2014 Nutzung von und Anlagen für erneuerbare Energien in der Samtgemeinde Flotwedel Arbeitskreissitzung am 19.03.2014
Gemeinnütziges Unternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes Klimaschutzkonzept 2014 Nutzung von und Anlagen für erneuerbare Energien in der Samtgemeinde Flotwedel Arbeitskreissitzung am 19.03.2014
Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren Energien
 Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren Energien Holz dominiert kwhth/ Jahr und Einwohner 2000 1800 1600 155 82 1400 74 1200 1000 86 100 Holz Solarthermie Wärmepumpen Biogas Holz hat einen sehr hohen Anteil Solarthermieund
Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren Energien Holz dominiert kwhth/ Jahr und Einwohner 2000 1800 1600 155 82 1400 74 1200 1000 86 100 Holz Solarthermie Wärmepumpen Biogas Holz hat einen sehr hohen Anteil Solarthermieund
Energiepotentiale. Geschichte und Effekte des Umstiegs auf erneuerbare Energieträger.
 Energiepotentiale Güssing: Geschichte und Effekte des Umstiegs auf erneuerbare Energieträger. Dr. Richard Zweiler 1 Die Welt verbraucht 10 Mio. to Erdöl 12,5 Mio. to Steinkohle 7,5Mrd. m³ Erdgas PRO TAG!
Energiepotentiale Güssing: Geschichte und Effekte des Umstiegs auf erneuerbare Energieträger. Dr. Richard Zweiler 1 Die Welt verbraucht 10 Mio. to Erdöl 12,5 Mio. to Steinkohle 7,5Mrd. m³ Erdgas PRO TAG!
. Workshop ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE
 . Workshop ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE Plessa, 13. Februar 2014 Agenda 2 Analyse der Energieverbräuche und der Energieerzeugung im Amt Plessa ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT
. Workshop ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE Plessa, 13. Februar 2014 Agenda 2 Analyse der Energieverbräuche und der Energieerzeugung im Amt Plessa ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT
Das Modell Güssing - ein Beispiel für eine nachhaltige, regionale Energieversorgung. Joachim Hacker, EEE
 Das Modell Güssing - ein Beispiel für eine nachhaltige, regionale Energieversorgung Joachim Hacker, EEE Geographische Lage Burgenland Fläche (km²) 3.966 EinwohnerInnen 281.190 Bezirk Güssing Fläche (km²)
Das Modell Güssing - ein Beispiel für eine nachhaltige, regionale Energieversorgung Joachim Hacker, EEE Geographische Lage Burgenland Fläche (km²) 3.966 EinwohnerInnen 281.190 Bezirk Güssing Fläche (km²)
Stadtverordnetenversammlung, 08.10.2015
 Stadtverordnetenversammlung, Gegenstand und Ausgangszustand Gegenstand: Verbrauch von Strom und Wärme in Müncheberg und die dadurch bedingten CO 2 -Emissionen Zeitrahmen: 2015 bis 2030 Eckdaten (Ist):
Stadtverordnetenversammlung, Gegenstand und Ausgangszustand Gegenstand: Verbrauch von Strom und Wärme in Müncheberg und die dadurch bedingten CO 2 -Emissionen Zeitrahmen: 2015 bis 2030 Eckdaten (Ist):
Erneuerbare Energien in Kasachstan Energiestrategie 2050
 Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ministerialdirigent Edgar Freund Erneuerbare Energien in Kasachstan Energiestrategie 2050 15.09.2014 Inhaltsübersicht 1. Politischer Hintergrund
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ministerialdirigent Edgar Freund Erneuerbare Energien in Kasachstan Energiestrategie 2050 15.09.2014 Inhaltsübersicht 1. Politischer Hintergrund
Einleitung. Erfassung des energetischen Ist- Zustandes
 Einleitung Am 18. November 2014 fiel in Mengkofen der Startschuss für das erste interkommunale Energiekonzept auf Ebene einer Planungsregion in Bayern. Die Erstellung des Energiekonzepts erfolgt im Auftrag
Einleitung Am 18. November 2014 fiel in Mengkofen der Startschuss für das erste interkommunale Energiekonzept auf Ebene einer Planungsregion in Bayern. Die Erstellung des Energiekonzepts erfolgt im Auftrag
1. Energiewerkstatt in Vörstetten
 1. Energiewerkstatt in Vörstetten Klimaschutz aktiv mitgestalten! 13.09.2017 Susanne Heckelmann, Elisabeth Scholz Stabsstelle Energiedienstleistungen, badenova Marissa Walzer Moderation Ziele der 1. Energiewerkstatt
1. Energiewerkstatt in Vörstetten Klimaschutz aktiv mitgestalten! 13.09.2017 Susanne Heckelmann, Elisabeth Scholz Stabsstelle Energiedienstleistungen, badenova Marissa Walzer Moderation Ziele der 1. Energiewerkstatt
Erhebung der zur anaeroben Vergärung verfügbaren Biomasse in Südtirol
 Erhebung der zur anaeroben Vergärung verfügbaren Biomasse in Südtirol Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali Programma nazionale Biocombustibili Inhalt 1. Einleitung 2. Derzeitige Biogasproduktion
Erhebung der zur anaeroben Vergärung verfügbaren Biomasse in Südtirol Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali Programma nazionale Biocombustibili Inhalt 1. Einleitung 2. Derzeitige Biogasproduktion
Energienutzungsplan für den Landkreis Kelheim
 Energienutzungsplan für den Landkreis Kelheim Prof. Dr.-Ing. Markus Brautsch Institut für Energietechnik IfE GmbH an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden Kaiser-Wilhelm-Ring 23 92224
Energienutzungsplan für den Landkreis Kelheim Prof. Dr.-Ing. Markus Brautsch Institut für Energietechnik IfE GmbH an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden Kaiser-Wilhelm-Ring 23 92224
ADMINISTRATION COMMUNALE HESPERANGE
 ADMINISTRATION COMMUNALE HESPERANGE Ausarbeitung der lokalen Energiebilanzierung im Rahmen des Klimapakts Hesperange, den 20. Februar 2017 Kontext & Klimaziele: Herausforderungen: Klimapaktziele 2020 CO
ADMINISTRATION COMMUNALE HESPERANGE Ausarbeitung der lokalen Energiebilanzierung im Rahmen des Klimapakts Hesperange, den 20. Februar 2017 Kontext & Klimaziele: Herausforderungen: Klimapaktziele 2020 CO
Oberharmersbach ein Bioenergiedorf startet!
 Oberharmersbach ein Bioenergiedorf startet! Vorgetragen von: Lokale Agendagruppe Arbeitskreis Energiewende Dipl.-Ing. Oliver Heizmann Gemeinde Oberharmersbach Bürgermeister Siegfried Huber www.oberharmersbach.de
Oberharmersbach ein Bioenergiedorf startet! Vorgetragen von: Lokale Agendagruppe Arbeitskreis Energiewende Dipl.-Ing. Oliver Heizmann Gemeinde Oberharmersbach Bürgermeister Siegfried Huber www.oberharmersbach.de
Erneuerbare Energien 2017
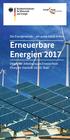 Die Energiewende ein gutes Stück Arbeit Erneuerbare Energien 2017 Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) Bedeutung der erneuerbaren Energien im Strommix steigt Im Jahr 2017
Die Energiewende ein gutes Stück Arbeit Erneuerbare Energien 2017 Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) Bedeutung der erneuerbaren Energien im Strommix steigt Im Jahr 2017
100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen bis zum Jahr oder reale Vision. Energieland Rheinland-Pfalz
 Energieland Rheinland-Pfalz 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen bis zum Jahr 2030 Utopie oder reale Vision www.100-prozent-erneuerbar.de 27. März 2012 1 Rheinland-Pfalz heute: abhängig von
Energieland Rheinland-Pfalz 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen bis zum Jahr 2030 Utopie oder reale Vision www.100-prozent-erneuerbar.de 27. März 2012 1 Rheinland-Pfalz heute: abhängig von
Regionales Energie- und Klimakonzept 2016
 Regionales Energie- und Klimakonzept 2016 REKLIS Weiterentwicklung regionale Energie- und Klimaschutzstrategie VRS Energiebilanz und Ist-Stand erneuerbare Energien Anlage 3 zur Sitzungsvorlage 127/2017
Regionales Energie- und Klimakonzept 2016 REKLIS Weiterentwicklung regionale Energie- und Klimaschutzstrategie VRS Energiebilanz und Ist-Stand erneuerbare Energien Anlage 3 zur Sitzungsvorlage 127/2017
Bayerische Klimawoche. Vorstellung von Klimaschutz- und Energiefakten für den Landkreis Günzburg und seine Gemeinden
 Bayerische Klimawoche Umwelt-Projekttag am Dossenberger Gymnasium in Günzburg, 24.7.2015 Vorstellung von Klimaschutz- und Energiefakten für den Landkreis Günzburg und seine Gemeinden Vortrag verändertvon
Bayerische Klimawoche Umwelt-Projekttag am Dossenberger Gymnasium in Günzburg, 24.7.2015 Vorstellung von Klimaschutz- und Energiefakten für den Landkreis Günzburg und seine Gemeinden Vortrag verändertvon
Energie- und CO2-Bilanz für Wiernsheim 2007
 Energie- und CO2-Bilanz für Wiernsheim 2007 Ausgangsbasis - Endenergie- und CO 2 -Bilanz des Jahres 1994 Die letzte komplette Energie- und CO 2 -Bilanz der Gemeinde Wiernsheim wurde im Rahmen des Forschungsfeldes
Energie- und CO2-Bilanz für Wiernsheim 2007 Ausgangsbasis - Endenergie- und CO 2 -Bilanz des Jahres 1994 Die letzte komplette Energie- und CO 2 -Bilanz der Gemeinde Wiernsheim wurde im Rahmen des Forschungsfeldes
Energielandschaft Morbach: Energieregion
 : Energieregion 1957-1995 1957-1995 1995 Vorteile der 145 ha großen Fläche: - relativ hoher Abstand zu Orten (1.000 m) - Gelände seit 50 Jahren nicht zugänglich (kein Nutzungskonflikt) - sehr gute Erschließung
: Energieregion 1957-1995 1957-1995 1995 Vorteile der 145 ha großen Fläche: - relativ hoher Abstand zu Orten (1.000 m) - Gelände seit 50 Jahren nicht zugänglich (kein Nutzungskonflikt) - sehr gute Erschließung
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Gerhard Hausladen Technische Universität München
 Technische Universität München Aschheim Kirchheim Feldkirchen Strom-Versorgung Gas-Versorgung -Geothermie -Zentrale Biogasanlage -Dezentrale Biogasanlage -Holzheizkraftwerk -Holz-/Getreideheizwerk -Wärmepumpen
Technische Universität München Aschheim Kirchheim Feldkirchen Strom-Versorgung Gas-Versorgung -Geothermie -Zentrale Biogasanlage -Dezentrale Biogasanlage -Holzheizkraftwerk -Holz-/Getreideheizwerk -Wärmepumpen
Klimaschutzkonzept Memmingen Klimaschutzkonzept Memmingen CO2-Bilanz, Potentiale
 Klimaschutzkonzept Memmingen CO2-Bilanz, Potentiale 12.06.2012 Dr. Hans-Jörg Barth Dr. Kerstin Koenig-Hoffmann 1 Agenda TOP 1 TOP 2 TOP 3 Zusammenfassung CO2-Bilanz Ergebnisse Potenziale Bürgerbefragung
Klimaschutzkonzept Memmingen CO2-Bilanz, Potentiale 12.06.2012 Dr. Hans-Jörg Barth Dr. Kerstin Koenig-Hoffmann 1 Agenda TOP 1 TOP 2 TOP 3 Zusammenfassung CO2-Bilanz Ergebnisse Potenziale Bürgerbefragung
ENERGIEBILANZ der Stadt Vreden
 ENERGIEBILANZ der Stadt Vreden erstellt im Rahmen des integrierten Wärmenutzungskonzepts 21.08.2012 DFIC Dr. Fromme International Consulting Zweigertstr. 43, 45130 Essen, www.dfic.de, Tel.: (0) 201 / 878
ENERGIEBILANZ der Stadt Vreden erstellt im Rahmen des integrierten Wärmenutzungskonzepts 21.08.2012 DFIC Dr. Fromme International Consulting Zweigertstr. 43, 45130 Essen, www.dfic.de, Tel.: (0) 201 / 878
Technologien und aktuelle Entwicklungen im Bereich Wind, Solar und Biomasse
 Technologien und aktuelle Entwicklungen im Bereich Wind, Solar und Biomasse Dirk Volkmann, 13.06.2017, Minsk Exportinitiative Energie Inhalt Einführung Windenergie Solarenergie Energie aus Biomasse Dirk
Technologien und aktuelle Entwicklungen im Bereich Wind, Solar und Biomasse Dirk Volkmann, 13.06.2017, Minsk Exportinitiative Energie Inhalt Einführung Windenergie Solarenergie Energie aus Biomasse Dirk
Klimaschutzkonzept Berchtesgadener Land
 Klimaschutzkonzept Berchtesgadener Land greenalps, 29.04.2014 Manuel Münch Agenda 1) Ausgangssituation 2) Bestandsanalyse 3) Ziele des Klimaschutzkonzeptes 4) Handlungsfelder a. Strukturbildung b. Energie
Klimaschutzkonzept Berchtesgadener Land greenalps, 29.04.2014 Manuel Münch Agenda 1) Ausgangssituation 2) Bestandsanalyse 3) Ziele des Klimaschutzkonzeptes 4) Handlungsfelder a. Strukturbildung b. Energie
Energie- und CO 2 -Bilanz der Gemeinde Kißlegg
 Energie- und CO 2 -Bilanz der Gemeinde Kißlegg Aufgestellt im Dezember 2012 Datenbasis: 2009 Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg ggmbh Energie- und Klimaschutzziele des Bundes,
Energie- und CO 2 -Bilanz der Gemeinde Kißlegg Aufgestellt im Dezember 2012 Datenbasis: 2009 Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg ggmbh Energie- und Klimaschutzziele des Bundes,
Energiebericht Wiernsheim.ppt. Energie- und Klimaschutzkonzept 2013
 Energiebericht Wiernsheim.ppt Energie- und Klimaschutzkonzept 2013 Gliederung 1. Ziel der Arbeit 2. Ausgangssituation und Methodik 3. Energie und CO 2 -Bilanz 4. Aktuelle Nutzung erneuerbarer Energien
Energiebericht Wiernsheim.ppt Energie- und Klimaschutzkonzept 2013 Gliederung 1. Ziel der Arbeit 2. Ausgangssituation und Methodik 3. Energie und CO 2 -Bilanz 4. Aktuelle Nutzung erneuerbarer Energien
Energiebilanzierung im Landkreis Barnim
 Energiebilanzierung im Landkreis Barnim Auswertung Gemeinde Schorfheide für das Jahr 2014 Barnimer Energiegesellschaft mbh Brunnenstraße 26 16225 Eberswalde Tel. 03334-49 700 13 Fax 03334-49 85 07 www.beg-barnim.de
Energiebilanzierung im Landkreis Barnim Auswertung Gemeinde Schorfheide für das Jahr 2014 Barnimer Energiegesellschaft mbh Brunnenstraße 26 16225 Eberswalde Tel. 03334-49 700 13 Fax 03334-49 85 07 www.beg-barnim.de
e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr Bielefeld Telefon: 0521/ Fax: 0521/
 Klimaschutzkonzept Remscheid Arbeitsgruppe Kraft-Wärme-Kopplung und Innovative Technologien 18.03.2013 e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Inhalt
Klimaschutzkonzept Remscheid Arbeitsgruppe Kraft-Wärme-Kopplung und Innovative Technologien 18.03.2013 e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Inhalt
Potential Erneuerbarer Energien im Landkreis Amberg-Sulzbach. Prof. Dr.-Ing. Franz Bischof
 Potential Erneuerbarer Energien im Landkreis Amberg-Sulzbach Prof. Dr.-Ing. Franz Bischof Der Mensch beeinflusst das Klima 2 Wie decken wir die Energie 3 Was kommt an?! 4 14 200 PJ jedes Jahr nach D! Ein
Potential Erneuerbarer Energien im Landkreis Amberg-Sulzbach Prof. Dr.-Ing. Franz Bischof Der Mensch beeinflusst das Klima 2 Wie decken wir die Energie 3 Was kommt an?! 4 14 200 PJ jedes Jahr nach D! Ein
Heizen mit umwelt schonenden Energien!
 Heizen mit umwelt schonenden Energien! Klima schützen mit Erdgas, Bio-Erdgas und Solar. Bis zu 40 % CO pro Jahr sparen! 2 www.moderne-heizung.de Modernes und umweltschonendes Heizen. Die Initiative ERDGAS
Heizen mit umwelt schonenden Energien! Klima schützen mit Erdgas, Bio-Erdgas und Solar. Bis zu 40 % CO pro Jahr sparen! 2 www.moderne-heizung.de Modernes und umweltschonendes Heizen. Die Initiative ERDGAS
Landkreis Fürstenfeldbruck
 Landkreis Fürstenfeldbruck Potenziale Energieeinsparung, Effizienz und erneuerbare Energien 1 Ist-Zustand 2010 1.1 Allgemeine Daten Fläche: 43.478 ha Einwohnerzahl: 204.538 Anzahl Erwerbstätige: 49.185
Landkreis Fürstenfeldbruck Potenziale Energieeinsparung, Effizienz und erneuerbare Energien 1 Ist-Zustand 2010 1.1 Allgemeine Daten Fläche: 43.478 ha Einwohnerzahl: 204.538 Anzahl Erwerbstätige: 49.185
Bilanzierung von Umwelt- und Klimaindikatoren in der Gemeinde Schieren. Umwelt Energie Mobilität Klima
 Bilanzierung von Umwelt- und Klimaindikatoren in der Gemeinde Schieren Umwelt Energie Mobilität Klima Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung...3 2 Allgemeine Indikatoren...3 2.1 Einwohnerzahl (jeweils am 01.
Bilanzierung von Umwelt- und Klimaindikatoren in der Gemeinde Schieren Umwelt Energie Mobilität Klima Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung...3 2 Allgemeine Indikatoren...3 2.1 Einwohnerzahl (jeweils am 01.
PRESSEMELDUNG vom Biosphärenreservat Bliesgau auf dem Weg zur Null-Emissions- Region
 PRESSEMELDUNG vom 30.4.2014 Biosphärenreservat Bliesgau auf dem Weg zur Null-Emissions- Region Die Ziellatte hängt hoch beim "Masterplans 100% Klimaschutz" im Biosphärenreservat Bliesgau. Bis 2050 soll
PRESSEMELDUNG vom 30.4.2014 Biosphärenreservat Bliesgau auf dem Weg zur Null-Emissions- Region Die Ziellatte hängt hoch beim "Masterplans 100% Klimaschutz" im Biosphärenreservat Bliesgau. Bis 2050 soll
Klimastark Strategien und Entwicklungsperspektiven für 100 % erneuerbare Energie Regionen. RegioTwin Vernetzungsworkshop, Kassel
 Klimastark Strategien und Entwicklungsperspektiven für 100 % erneuerbare Energie Regionen RegioTwin Vernetzungsworkshop, Kassel 22.11.2016 Agenda Vorstellung Rückblick Neue Projekte Weiteres Vorgehen Agenda
Klimastark Strategien und Entwicklungsperspektiven für 100 % erneuerbare Energie Regionen RegioTwin Vernetzungsworkshop, Kassel 22.11.2016 Agenda Vorstellung Rückblick Neue Projekte Weiteres Vorgehen Agenda
Elektrische Energie aus dem Landkreis Schwäbisch Hall
 FORTSCHREIBUNG 2012 Elektrische Energie aus dem Landkreis Schwäbisch Hall Installierte Leistung aus erneuerbaren Energien im Landkreis Schwäbisch Hall Die installierte Leistung aus erneuerbaren Energien
FORTSCHREIBUNG 2012 Elektrische Energie aus dem Landkreis Schwäbisch Hall Installierte Leistung aus erneuerbaren Energien im Landkreis Schwäbisch Hall Die installierte Leistung aus erneuerbaren Energien
Regionale Wertschöpfung durch energetische Verwertung von regionaler Biomasse 22. August 2017
 Regionale Wertschöpfung durch energetische Verwertung von regionaler Biomasse 22. August 2017 Normwärmebedarf Gießen und Ortsteile (Nutzwärme) 2016 Wärmebedarf 988.557 MWh/a 407.713 MWh Gas ~ 42% 492.713
Regionale Wertschöpfung durch energetische Verwertung von regionaler Biomasse 22. August 2017 Normwärmebedarf Gießen und Ortsteile (Nutzwärme) 2016 Wärmebedarf 988.557 MWh/a 407.713 MWh Gas ~ 42% 492.713
Erneuerbare Energien Potenziale in Brandenburg 2030
 Erneuerbare Energien Potenziale in Brandenburg 2030 Erschließbare technische Potenziale sowie Wertschöpfungsund Beschäftigungseffekte eine szenariobasierte Analyse Pressekonferenz Potsdam, 24.1.2012 Dr.
Erneuerbare Energien Potenziale in Brandenburg 2030 Erschließbare technische Potenziale sowie Wertschöpfungsund Beschäftigungseffekte eine szenariobasierte Analyse Pressekonferenz Potsdam, 24.1.2012 Dr.
Das Modell Güssing ein Beispiel für eine nachhaltige regionale Energieversorgung. Franz Jandrisits
 Das Modell Güssing ein Beispiel für eine nachhaltige regionale Energieversorgung Franz Jandrisits Europäisches Zentrum f. Erneuerbare Energie Güssing GmbH Demoanlagen Forschung & Entwicklung Aus- und Weiterbildung
Das Modell Güssing ein Beispiel für eine nachhaltige regionale Energieversorgung Franz Jandrisits Europäisches Zentrum f. Erneuerbare Energie Güssing GmbH Demoanlagen Forschung & Entwicklung Aus- und Weiterbildung
CO 2 -Neutralität am Beispiel Großschönau Darstellung von Handlungsspielräumen und Lösungswegen
 CO 2 -Neutralität am Beispiel Großschönau Darstellung von Handlungsspielräumen und Lösungswegen Energievision Großschönau - Zero Carbon Town wird aus Mitteln des Klimaund Energiefonds gefördert und im
CO 2 -Neutralität am Beispiel Großschönau Darstellung von Handlungsspielräumen und Lösungswegen Energievision Großschönau - Zero Carbon Town wird aus Mitteln des Klimaund Energiefonds gefördert und im
Energiebericht Gesamtbetrachtung der Kreisgebäude. Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft
 Energiebericht 2017 Gesamtbetrachtung der Kreisgebäude Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft Oktober 2017 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Einführung 3 2 Gesamtentwicklung bei Verbrauch und Kosten 3
Energiebericht 2017 Gesamtbetrachtung der Kreisgebäude Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft Oktober 2017 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Einführung 3 2 Gesamtentwicklung bei Verbrauch und Kosten 3
BEE. Weltenergiebedarf. (vereinfachte Darstellung nach Shell, Szenario Nachhaltiges Wachstum ) 1500 Exajoules erneuerbare Energien
 15 Exajoules erneuerbare Energien 1 5 Energie aus Kernkraft Energie aus fossilen Brennstoffen davon Erdöl 19 192 194 196 198 2 22 24 26 exa=118 1 Exajoule=34,12 Mio t SKE Weltenergiebedarf 225 23 (vereinfachte
15 Exajoules erneuerbare Energien 1 5 Energie aus Kernkraft Energie aus fossilen Brennstoffen davon Erdöl 19 192 194 196 198 2 22 24 26 exa=118 1 Exajoule=34,12 Mio t SKE Weltenergiebedarf 225 23 (vereinfachte
Tag der Sonne in Offenhausen/Kucha
 Tag der Sonne 31.05.2018 in Offenhausen/Kucha Erneuerbare Energien Aktivitäten im Bereich der Gemeinde Offenhausen mit Daten aus dem Energieatlas Bayern Erneuerbare Energien in Offenhausen am Anfang stand
Tag der Sonne 31.05.2018 in Offenhausen/Kucha Erneuerbare Energien Aktivitäten im Bereich der Gemeinde Offenhausen mit Daten aus dem Energieatlas Bayern Erneuerbare Energien in Offenhausen am Anfang stand
Energie- und CO 2 -Bilanz der Stadt Sigmaringen
 Energie- und CO 2 -Bilanz der Stadt Sigmaringen Aufgestellt im Oktober 2012 Datenbasis: 2009 Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Sigmaringen ggmbh Energie- und Klimaschutzziele des Bundes,
Energie- und CO 2 -Bilanz der Stadt Sigmaringen Aufgestellt im Oktober 2012 Datenbasis: 2009 Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Sigmaringen ggmbh Energie- und Klimaschutzziele des Bundes,
ENERGIEBAUSTEINE DES INTEGRIERTEN KLIMASCHUTZKONZEPTES
 Tischvorlage Klimaschutzkonferenz I 30. & 31.10.2009 in Garching Die Stadt Garching hat sich mit der Übernahme der Energievision des Landkreises München vom März 2007 verpflichtet, den Energieverbrauch
Tischvorlage Klimaschutzkonferenz I 30. & 31.10.2009 in Garching Die Stadt Garching hat sich mit der Übernahme der Energievision des Landkreises München vom März 2007 verpflichtet, den Energieverbrauch
Energieversorgung in Bürgerhand. Bioenergiedorf St. Peter im Schwarzwald
 Fernwärmeversorgung Energieerzeugung Energieversorgung in Bürgerhand Bioenergiedorf St. Peter im Schwarzwald Gefördert durch: Europäische Union, Fond für regionale Entwicklung Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg,
Fernwärmeversorgung Energieerzeugung Energieversorgung in Bürgerhand Bioenergiedorf St. Peter im Schwarzwald Gefördert durch: Europäische Union, Fond für regionale Entwicklung Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg,
Energiezukunft Oberösterreich 2030 Potentiale & Szenarien
 - 1 - Energiezukunft Oberösterreich 2030 Potentiale & Szenarien Potentiale - Elektrische Energie Im Bereich Strom ist in absoluten Zahlen die Wasserkraft und im speziellen die Großwasserkraft die weitaus
- 1 - Energiezukunft Oberösterreich 2030 Potentiale & Szenarien Potentiale - Elektrische Energie Im Bereich Strom ist in absoluten Zahlen die Wasserkraft und im speziellen die Großwasserkraft die weitaus
Energie- und CO 2 -Bilanz der Stadt Ravensburg
 Energie- und CO 2 -Bilanz der Stadt Ravensburg Aufgestellt im Mai 2012, Stand 31.12.2010 Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg ggmbh Energie- und Klimaschutzziele des Bundes, Landes
Energie- und CO 2 -Bilanz der Stadt Ravensburg Aufgestellt im Mai 2012, Stand 31.12.2010 Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg ggmbh Energie- und Klimaschutzziele des Bundes, Landes
Wärmekonzept Meddingheide II
 Wärmekonzept Meddingheide II Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen, 06.02.2019 Quelle: Shutterstock, Vororthaeuser_shutterstock_425561287_RikoBest Neubaugebiet Meddingheide II Städtebaulicher Entwurf
Wärmekonzept Meddingheide II Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen, 06.02.2019 Quelle: Shutterstock, Vororthaeuser_shutterstock_425561287_RikoBest Neubaugebiet Meddingheide II Städtebaulicher Entwurf
Potentialstudie Erneuerbare Energien im Landkreis Biberach Kann der Landkreis Biberach die Energiewende bis 2022 erreichen?
 Potentialstudie Erneuerbare Energien im Landkreis Biberach Kann der Landkreis Biberach die Energiewende bis 2022 erreichen? Referent: Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Biberach Energiepolitische
Potentialstudie Erneuerbare Energien im Landkreis Biberach Kann der Landkreis Biberach die Energiewende bis 2022 erreichen? Referent: Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Biberach Energiepolitische
Energiewende und Klimaschutz
 Energiewende und Klimaschutz Integriertes Klimaschutzkonzept Gemeinde Owingen Owingen, Billafingen, Hohenbodman, Taisersdorf, Was passiert heute? Agenda. 1. Bilanzdaten Owingen Energiedaten Treibhausgase
Energiewende und Klimaschutz Integriertes Klimaschutzkonzept Gemeinde Owingen Owingen, Billafingen, Hohenbodman, Taisersdorf, Was passiert heute? Agenda. 1. Bilanzdaten Owingen Energiedaten Treibhausgase
Das Modell Güssing Ein Beispiel für eine nachhaltige, regionale Energieversorgung. Christian Keglovits
 Das Modell Güssing Ein Beispiel für eine nachhaltige, regionale Energieversorgung Christian Keglovits Geographische Lage Burgenland Fläche (km²) 3.966 EinwohnerInnen 281.190 Bezirk Güssing Fläche (km²)
Das Modell Güssing Ein Beispiel für eine nachhaltige, regionale Energieversorgung Christian Keglovits Geographische Lage Burgenland Fläche (km²) 3.966 EinwohnerInnen 281.190 Bezirk Güssing Fläche (km²)
Informationsveranstaltung Energienutzungsplan - Stadt Bischofsheim -
 Informationsveranstaltung Energienutzungsplan - Stadt Bischofsheim - B.Eng. Simon Achhammer Institut für Energietechnik IfE GmbH an der ostbayerischen technischen Hochschule Amberg-Weiden Kaiser-Wilhelm-Ring
Informationsveranstaltung Energienutzungsplan - Stadt Bischofsheim - B.Eng. Simon Achhammer Institut für Energietechnik IfE GmbH an der ostbayerischen technischen Hochschule Amberg-Weiden Kaiser-Wilhelm-Ring
. Workshop ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE
 . Workshop ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE Massen-Niederlausitz, 12. Februar 2014 Agenda 2 Analyse der Energieverbräuche und der Energieerzeugung im Amt Kleine Elster ENERGIE BRAUCHT
. Workshop ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE Massen-Niederlausitz, 12. Februar 2014 Agenda 2 Analyse der Energieverbräuche und der Energieerzeugung im Amt Kleine Elster ENERGIE BRAUCHT
Nachhaltige Energieversorgung in der Gemeinde Beckerich, Luxemburg
 Nachhaltige Energieversorgung in der Gemeinde Beckerich, Luxemburg 1 Luxemburg zählt 116 Gemeinden mit insgesamt 450.000 Einwohnern Der Kanton Redingen zählt 10 Gemeinden: Beckerich, Ell, Grosbous, Préizerdaul,
Nachhaltige Energieversorgung in der Gemeinde Beckerich, Luxemburg 1 Luxemburg zählt 116 Gemeinden mit insgesamt 450.000 Einwohnern Der Kanton Redingen zählt 10 Gemeinden: Beckerich, Ell, Grosbous, Préizerdaul,
Think Blue. Factory.
 Think Blue. Factory. nachhaltig und mitbestimmt für eine regenerative und effiziente Energiestrategie von Volkswagen am Standort Emden Energiebedarf pro Produkt Für die Fertigung eines Volkswagen Passat
Think Blue. Factory. nachhaltig und mitbestimmt für eine regenerative und effiziente Energiestrategie von Volkswagen am Standort Emden Energiebedarf pro Produkt Für die Fertigung eines Volkswagen Passat
Energieland Hessen. 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen bis zum Jahr Utopie oder reale Vision?
 Energieland Hessen 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen bis zum Jahr 2025 Utopie oder reale Vision? Hessen heute: Abhängig von Importen Strombedarf in Hessen 2005: ca. 35 TWh (Eigenstromerzeugung
Energieland Hessen 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen bis zum Jahr 2025 Utopie oder reale Vision? Hessen heute: Abhängig von Importen Strombedarf in Hessen 2005: ca. 35 TWh (Eigenstromerzeugung
Fragebogen zur Bewertung der Ziele und Kriterien des Kommunalen Energiekonzeptes der Stadt Schwedt/ Oder
 Fragebogen zur Bewertung der Ziele und Kriterien des Kommunalen Energiekonzeptes der Stadt Schwedt/ Oder Was wollen wir erreichen? Im 1. Workshop der Veranstaltungsreihe Kommunales Energiekonzept der Stadt
Fragebogen zur Bewertung der Ziele und Kriterien des Kommunalen Energiekonzeptes der Stadt Schwedt/ Oder Was wollen wir erreichen? Im 1. Workshop der Veranstaltungsreihe Kommunales Energiekonzept der Stadt
Elektrische Energie aus dem Landkreis Schwäbisch Hall
 FORTSCHREIBUNG Elektrische Energie aus dem Landkreis Schwäbisch Hall Installierte Leistung aus erneuerbaren Energien im Landkreis Schwäbisch Hall Im Jahr betrugen die installierten Leistungen aus erneuerbaren
FORTSCHREIBUNG Elektrische Energie aus dem Landkreis Schwäbisch Hall Installierte Leistung aus erneuerbaren Energien im Landkreis Schwäbisch Hall Im Jahr betrugen die installierten Leistungen aus erneuerbaren
LANDonline Transnationales Netzwerk Erneuerbare Energien und Speichertechnologien
 LANDonline Transnationales Netzwerk Erneuerbare Energien und Speichertechnologien BioEnergie Kyritz - Potenziale in der Land- und Forstwirtschaft zur Wärme-, Strom- und Treibstoffversorgung - Friedrich
LANDonline Transnationales Netzwerk Erneuerbare Energien und Speichertechnologien BioEnergie Kyritz - Potenziale in der Land- und Forstwirtschaft zur Wärme-, Strom- und Treibstoffversorgung - Friedrich
1. Wiesbadener KlimaschutzQuartier Alt-Biebrich. Projektvorstellung Ergebnisse der Ausgangsanalysen
 1. Wiesbadener KlimaschutzQuartier Alt-Biebrich Projektvorstellung Ergebnisse der Ausgangsanalysen 12.03.2014 Inhalt 1 2 3 4 5 6 7 Kurzvorstellung des Quartiers Projektziele Projektstatus Ergebnisse der
1. Wiesbadener KlimaschutzQuartier Alt-Biebrich Projektvorstellung Ergebnisse der Ausgangsanalysen 12.03.2014 Inhalt 1 2 3 4 5 6 7 Kurzvorstellung des Quartiers Projektziele Projektstatus Ergebnisse der
Energiewende in Lörrach
 Biomasse im Energiemix der Stadt Lörrach Marion Dammann Bürgermeisterin der Stadt Lörrach Energiewende in Lörrach European Energy Award: Kommunale Handlungsfelder Stadtplanung Kommunale Gebäude und Anlagen
Biomasse im Energiemix der Stadt Lörrach Marion Dammann Bürgermeisterin der Stadt Lörrach Energiewende in Lörrach European Energy Award: Kommunale Handlungsfelder Stadtplanung Kommunale Gebäude und Anlagen
Bitte übermitteln Sie uns den ausgefüllten Fragebogen bis zum 1. Dezember 2008
 Regionale Szenarien erneuerbarer Energiepotenziale in den Jahren / Dieser Fragebogen ist als qualitative Umfrage unter den LEADER-Regionen zu verstehen, in der es um die Abschätzung der Trends hinsichtlich
Regionale Szenarien erneuerbarer Energiepotenziale in den Jahren / Dieser Fragebogen ist als qualitative Umfrage unter den LEADER-Regionen zu verstehen, in der es um die Abschätzung der Trends hinsichtlich
Initialberatung Klimaschutz Gemeinde Schöneiche bei Berlin 2. Workshop
 Initialberatung Klimaschutz Gemeinde Schöneiche bei Berlin 2. Workshop Initialberatung Klimaschutz Gemeinde Schöneiche bei Berlin Inhalt Eröffnung der Sitzung Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung Abstimmung
Initialberatung Klimaschutz Gemeinde Schöneiche bei Berlin 2. Workshop Initialberatung Klimaschutz Gemeinde Schöneiche bei Berlin Inhalt Eröffnung der Sitzung Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung Abstimmung
Ein integriertes Klimaschutzkonzept für Bad Driburg. Arbeitskreis Erneuerbare Energie/KWK Themen
 e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3, 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Internet: www.eundu-online.de Ein integriertes Klimaschutzkonzept für Bad Driburg Arbeitskreis Erneuerbare
e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3, 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Internet: www.eundu-online.de Ein integriertes Klimaschutzkonzept für Bad Driburg Arbeitskreis Erneuerbare
KLARANLAGE EBERSBERG
 KLARANLAGE EBERSBERG MICROGASTURBINE UND FREIFLÄCHEN-PHOTOVOLTAIKANLAGEN ZUR STROMPRODUKTION Das Energiekonzept der Kläranlage Ebersberg Energieproduktion und Energieeffizienz steigern durch Kraft-Wärmekopplung
KLARANLAGE EBERSBERG MICROGASTURBINE UND FREIFLÄCHEN-PHOTOVOLTAIKANLAGEN ZUR STROMPRODUKTION Das Energiekonzept der Kläranlage Ebersberg Energieproduktion und Energieeffizienz steigern durch Kraft-Wärmekopplung
Die Insel Pellworm als Modell für den ländlichen Raum
 Die Insel Pellworm als Modell für den ländlichen Raum Klaus Jensen Bürgermeister, Amt Pellworm Dr. Uwe Kurzke AG Energie Pellworm Einwohner 1180 Insel umgeben vom Nationalpark Wattenmeer Alterstruktur
Die Insel Pellworm als Modell für den ländlichen Raum Klaus Jensen Bürgermeister, Amt Pellworm Dr. Uwe Kurzke AG Energie Pellworm Einwohner 1180 Insel umgeben vom Nationalpark Wattenmeer Alterstruktur
SIMLA Solarinitiative München-Land e.v. Dipl. Ing. Stefan Peter, München
 Bürgermeisterdienstbesprechung am 18. April 212 Simulation zur Abbildung und Untersuchung von Energieverbrauch und eigener Erzeugung In den Gemeinden des Landkreises München SIMLA Solarinitiative München-Land
Bürgermeisterdienstbesprechung am 18. April 212 Simulation zur Abbildung und Untersuchung von Energieverbrauch und eigener Erzeugung In den Gemeinden des Landkreises München SIMLA Solarinitiative München-Land
Potenziale Energieeinsparung, Effizienz und erneuerbare Energien. Einwohnerzahl: 19.512 Anzahl Erwerbstätige: 3.712
 Gemeinde Gröbenzell Potenziale Energieeinsparung, Effizienz und erneuerbare Energien 1 Ist-Zustand 2010 1.1 Allgemeine Daten Fläche: 635 ha Einwohnerzahl: 19.512 Anzahl Erwerbstätige: 3.712 Besiedelungsdichte:
Gemeinde Gröbenzell Potenziale Energieeinsparung, Effizienz und erneuerbare Energien 1 Ist-Zustand 2010 1.1 Allgemeine Daten Fläche: 635 ha Einwohnerzahl: 19.512 Anzahl Erwerbstätige: 3.712 Besiedelungsdichte:
Vorstellung des Energie- und. des Landkreises Kitzingen
 Vorstellung des Energie- und Klimaschutzkonzepts des Landkreises Kitzingen i Regierung von Unterfranken, 22.2.2013 22. Februar 2013 Energie- und Klimaschutzkonzept 1 Hintergrund Maßnahmen der letzten Jahre:
Vorstellung des Energie- und Klimaschutzkonzepts des Landkreises Kitzingen i Regierung von Unterfranken, 22.2.2013 22. Februar 2013 Energie- und Klimaschutzkonzept 1 Hintergrund Maßnahmen der letzten Jahre:
ENERGIEBILANZ der Stadt Vreden
 ENERGIEBILANZ der Stadt Vreden erstellt im Rahmen des integrierten Wärmenutzungskonzepts 21.08.2012 DFIC Dr. Fromme International Consulting Zweigertstr. 43, 45130 Essen, www.dfic.de, Tel.: (0) 201 / 878
ENERGIEBILANZ der Stadt Vreden erstellt im Rahmen des integrierten Wärmenutzungskonzepts 21.08.2012 DFIC Dr. Fromme International Consulting Zweigertstr. 43, 45130 Essen, www.dfic.de, Tel.: (0) 201 / 878
Arbeitspapier. Arbeitspapier: Wissenschaftliche Zuarbeit zur Ausweisung von Effizienz- und Energieeinsparzielen aus den Szenarien des Klimaschutzplans
 Arbeitspapier: Wissenschaftliche Zuarbeit zur Ausweisung von Effizienz- und Energieeinsparzielen aus den Szenarien des Klimaschutzplans Wuppertal, 23.01.2015 Prof. Dr. Manfred Fischedick Christoph Zeiss
Arbeitspapier: Wissenschaftliche Zuarbeit zur Ausweisung von Effizienz- und Energieeinsparzielen aus den Szenarien des Klimaschutzplans Wuppertal, 23.01.2015 Prof. Dr. Manfred Fischedick Christoph Zeiss
Energetische Stadtsanierung
 Energetische Stadtsanierung Integriertes Quartierskonzept "Würzburg Heidingsfeld" 1. Akteursforum - Nachgang - Heidingsfeld, 22. November 2012 Agenda 1 Begrüßung 2 3 4 Klimaschutz in der Stadt Würzburg
Energetische Stadtsanierung Integriertes Quartierskonzept "Würzburg Heidingsfeld" 1. Akteursforum - Nachgang - Heidingsfeld, 22. November 2012 Agenda 1 Begrüßung 2 3 4 Klimaschutz in der Stadt Würzburg
Kosten-Nutzen-Analyse von Förderprogrammen zur Steigerung der Energieeffizienz
 Kosten-Nutzen-Analyse von Förderprogrammen zur Steigerung der Energieeffizienz Marcel Bellmann 1 Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH Kurzpräsentation GRACE Laufzeit: Juni 2011 bis Mai 2013 Partner:
Kosten-Nutzen-Analyse von Förderprogrammen zur Steigerung der Energieeffizienz Marcel Bellmann 1 Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH Kurzpräsentation GRACE Laufzeit: Juni 2011 bis Mai 2013 Partner:
Energie- und CO 2 -Bilanz für die Kommunen im Landkreis Ostallgäu
 Energie- und CO 2 -Bilanz für die Kommunen im Landkreis Ostallgäu Gemeindeblatt für die Gemeinde Ruderatshofen Die vorliegende Energie- und CO 2-Bilanz umfasst sämtliche Energiemengen, die für elektrische
Energie- und CO 2 -Bilanz für die Kommunen im Landkreis Ostallgäu Gemeindeblatt für die Gemeinde Ruderatshofen Die vorliegende Energie- und CO 2-Bilanz umfasst sämtliche Energiemengen, die für elektrische
