Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen
|
|
|
- Frida Müller
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen Vortrag Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen FRENGER SYSTEMEN BV Heiz- und Kühldecken GmbH am 10. Juni 2003 Dipl.-Ing. (TU) / Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) Oliver D. Bind Troppauer Straße Oberursel (Taunus) Tel / FAX 06171/ O.Bind@ingenieurbuero-Bind.de Sachkundiger für Beleuchtung nach BGR 131 Sicherheits- und Gesundheits-Koordinator nach der Baustellenverordnung BLP Ingenieurbüro Bind 1 Dipl.-Ing. Oliver Bind
2 Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen Inhaltsverzeichnis EINE EINFÜHRUNG ZUM THEMA LICHT 3 WAS IST LICHT? 5 SEHORIENTIERTE GÜTEMERKMALE 6 Beleuchtungsniveau 6 Lichtstrom 7 Lichtstärke 7 Beleuchtungsstärke 8 Photometrische Entfernungsgesetz 9 Leuchtdichte 10 Beleuchtungsniveau am Beispiel Ballsporthallenbeleuchtung 11 Blendung und Blendungsbegrenzung 11 Physiologische Blendung 11 Psychologische Blendung 12 Direktblendung 12 Reflexblendung 13 Blendung am Beispiel Ballsporthallenbeleuchtung 14 Lichtfarbe und Farbwiedergabe 14 Lichtfarbe und Farbwidergabe am Beispiel Ballsporthallenbeleuchtung 17 WAHRNEHMUNGSORIENTIERTE GÜTEMERKMALE 17 Harmonische Helligkeitsverteilung 18 Orientierung im Raum 19 Charakterisierung der Architektur 19 ARCHITEKTONISCH, GESTALTERISCHE GÜTEMERKMALE 20 WIRTSCHAFTLICHKEIT 21 Einsatz von wirtschaftlichen Lampen 21 Einsatz von wirtschaftlichen Vorschaltgeräte 21 Vermehrte Tageslichtnutzung 22 Beleuchtungserneuerung 22 ZUSAMMENFASSUNG GEBOTE FÜR RICHTIGES UND GUTES LICHT 23 LITERATURVERZEICHNIS 25 BLP Ingenieurbüro Bind 2 Dipl.-Ing. Oliver Bind
3 Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen Eine Einführung zum Thema Licht Ein Ingenieur oder Physiker beschreibt Licht als eine elektromagnetische Strahlung bei einer Wellenlänge zwischen nm (visueller Bereich). Ein Architekt hingegen beschreibt Licht als Sinneserfahrung, die im Erleben der Architektur erfahrbar wird. Licht kann als warm oder kalt, scharf oder weich, hell oder dunkel, direkt oder diffus, ehrlich oder unehrlich, blendend oder glitzernd gesehen werden. Die kurze Gegenüberstellung der unterschiedlichen Sichtweisen von Licht von Ingenieur und Architekt soll exemplarisch zeigen, wie kontrovers Licht gesehen werden kann und auch gesehen wird. Die einen sehen Licht quantitativ die anderen qualitativ. Sie deutet aber auch die Vielschichtigkeit des Lichtbegriffes an. Beide Sichtweisen vernachlässigen jeweils einen Teil des Lichtes und sind somit nicht umfassend. Nur wenn die Wirkungsweise des Lichtes ganzheitlich verstanden wird, kann Licht gezielt eingesetzt und geplant werden. Licht kann dann zur Raumqualität erheblich beitragen. Hierzu zwei Beispiele: Tageslicht ist vielmehr als die spektrale Zusammensetzung des Sonnenlichtes. Es ist unser Bezug zur Umwelt. Es ist Lebensspender. Es gibt den Tagesrhythmus und Jahreszyklus vor. Es bestimmt in weiten Bereichen unser Leben. Die Frage nach einer guten darf daher das Tageslicht nicht außer Acht lassen. Mit Tageslicht ist hierbei nicht nur das Licht bei Tage gemeint, sondern die Möglichkeit den Bezug zur Außenwelt herstellen zu können. Dies gilt auch für den Nachtfall. Untersuchungen aus den USA haben gezeigt, dass die Akzeptanz einer Bürobeleuchtung bei Vorhandensein von geringem Tageslicht (kein nennenswerter Beleuchtungsstärkeanteil) höher war, als ohne Tageslichtanteil. Dieses Beispiel zeigt die unterschiedliche Akzeptanz einer Kunstbeleuchtungsanlage bei gleichem lichttechnischen Beleuchtungsdaten durch den Einfluss von Tageslicht. Eine Empfangshalle eines Bürogebäudes wird mit hochwertig wirkenden Leuchten ausgestattet, ein Lagerraum hingegen mit preiswerten funktionalen Leuchten. Wohlgemerkt mögen die lichttechnischen Eigenschaften beider Beleuchtungslösungen identisch sein, ihre Akzeptanz dagegen sehr unterschiedlich ausfallen. Die unterschiedliche Akzeptanz ist dabei durch die differierende Erwartungshaltung dem Raumambiente und der Raumfunktion gegenüber erklärbar. Die verschiedenen Beleuchtungskörper sind nur Teil und Ausdruck des Ambientes, bzw. der Raumfunktion. Die Beleuchtung ist im Kontext der Nutzung zu sehen. Die Integration der Leuchte in ein Gebäude setzt einen gegenseitigen Austausch von Lichtplaner und Kunde im Planungsprozess voraus. Als Ergebnis erhält man ein Gesamtgebilde, welches schließlich in seiner Gesamtheit mit allen Sinnen wahrgenommen wird. Auf diesem Wege wird eine Beleuchtung hoher Qualität erreicht, wodurch sich die bestmögliche Akzeptanz des Ambientes im Raum beim Betrachter einstellt. Die Güte und Qualität vom Beleuchtungsanlagen wird also neben technischen Faktoren auch von subjektiven Faktoren beeinflusst. Die Güte einer Beleuchtung wird in der Regel durch folgende Gütemerkmale bewertet: Beleuchtungsniveau Helligkeitsverteilung Blendungsbegrenzung Lichtrichtung und Schattigkeit BLP Ingenieurbüro Bind 3 Dipl.-Ing. Oliver Bind
4 Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen Lichtfarbe und Farbwiedergabe Flimmerfreiheit Wirtschaftlichkeit Diese Merkmale sind in Richtlinien für die Beleuchtungsplanung und in Normen und Empfehlungen festgelegt. Bei der Anwendung derartiger Empfehlungen sind zwei Grundsätze besonders zu beachten: Viele der in Normen festgelegten Verfahren zur Bewertung einzelner Gütemerkmale sind so angelegt, dass sie in der Praxis hinreichend leicht anwendbar sind. Sie berücksichtigen den Stand der Technik zum Zeitpunkt ihrer Entstehung und gelten daher im Grunde zunächst nur unter den dadurch gegebenen technischen Bedingungen. Der Fortschritt der Technik kann dazu führen, dass eine buchstabengetreue Anwendung von Empfehlungen nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt. Aus diesem Grunde erfordert eine sachgerechte Anwendung, auch einfacher praxisgerechter Verfahren zur Bewertung der Güte der Beleuchtung, eine gründliche Kenntnis der Hintergründe für die Entstehung der Empfehlung. Auch die Einhaltung von Normen und Empfehlungen garantiert noch nicht, dass die geplante Beleuchtungsanlage voll befriedigend ist. Gute Beleuchtungsanlagen müssen auch Kriterien erfüllen, die sich in diesen Regeln nicht festlegen lassen. ist die Planung der visuellen Umwelt des Menschen ihr Ziel ist die Schaffung von Seh- und Wahrnehmungsbedingungen die einerseits ein effektives Arbeiten andererseits aber Sicherheit und Wohlbefinden vermitteln. Sucht man nach Gütemerkmale für die Beleuchtung besonders von Innenräumen, so stößt man in der qualitativen Beleuchtungsplanung auf vier Hauptaspekte: 1 1. den sehorientierten funktionalen Aspekt des Beleuchtens, 2. den wahrnehmungsorientierten Aspekt des Beleuchtens, 3. den architektonischen, gestalterischen Aspekt der Planung selbst und schließlich 4. die Wirtschaftlichkeit als den Aspekt des monetären Bereichs der Planung. Der Schwerpunkt konventioneller, quantitativer Planung (auch : normtechnische Planung) liegt heute noch überwiegend auf der sehorientierten funktionalen Seite, diese Art der Planung orientiert sich an lichtphysikalischen Kriterien wie der räumlichen Verteilung von Beleuchtungsstärke und Leuchtdichte (Helligkeitseindruck, Beleuchtungsniveau) und bezieht ihre Bedeutung und Rechtfertigung aus Normen und Richtlinien. Sie wird meist von den reinen Elektroplanern als einzigen Ansatz angewandt. Andere Aspekte Beleuchtung können aber nur beachtet werden, wenn einerseits eine Erweiterung des Planungsansatzes auch, oder vor allem in Richtung wahrnehmungsorientierter und gestalterischer Planung erfolgt und eine quantitative Planung im Hinblick auf qualitative Kriterien oder Gütemerkmale erweitert wird, wie im folgenden näher erläutert wird. Der letztgenannte gestalterische Ansatz wird meist als einziger Ansatz von sogenannten Lichtdesignern verfolgt, welche somit den medizinischen und sicherheitstechnischen Bereich der Beleuchtung ausblenden oder keine genügende Aufmerksamkeit schenken. Damit können dort ebenso schlechte Planungen entstehen, wie bei Planungen von reinen Elektroplanern. 1 H.Hofmann, Von der Quantität zur Qualität Über neue Wege in der Architekturbeleuchtung, Tagungsband Licht 2000, Seite 752 BLP Ingenieurbüro Bind 4 Dipl.-Ing. Oliver Bind
5 Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen Was ist Licht? Als Licht wird die vom menschlichen Auge wahrnehmbare, sichtbare elektromagnetische Strahlung bezeichnet. Dabei handelt es sich um einen kleinen Ausschnitt aus dem gesamten elektromagnetischem Wellenlängenbereich, welcher neben dem sichtbaren Licht auch die Gamma-, Röntgen, UV-Strahlung sowie die Infrarotstrahlung, die Radioweilen usw. umfasst. Der Spektralbereich des sichtbaren Lichts reicht von 380 bis 750 nm (sprich: Nanometer) Wellenlange. Innerhalb dieses Bereiches unterteilt sich das Spektrum in verschiedenen Farben von violett über blau, grün, gelb nach rot. Außerhalb dieses Bereiches kann das menschliche Auge keine Strahlung sehen. Die Hellempfindung hingt nicht nur von der Strahlungsreistung, also der Menge des in das Auge eindringenden Lichtes ab, sondern auch ganz entscheidend von seiner spektralen Zusammensetzung, Das menschliche Auge sieht nicht alle Bereiche des Spektrums gleich hell. Die Lichtreize unterschiedlicher Wellenlängen erzeugen auch unterschiedlich starke Hellempfindungen im Auge. So liegt die maximale Empfindlichkeit für das Tagessehen bei 555 nm (grün), Zu den längeren (gelb, orange, rot) wie auch zu den kürzeren Wellenlängen (blau, violett) hin nimmt die Empfindlichkeit ab. Außerhalb des Bereichs von ca. 380 bis 780 nm ist sie gleich Null. Des weiteren unterscheiden sich die Empfindlichkeitsfunktion für den Tag und die Nachr. V(~) für Tagessehen = helladaptiertes Auge und V'(~) für Nachtsehen = dunkeladaptiertes Auge. Für die Nacht ist die Empfindlichkeit leicht zu den kürzeren Wellenlängen (blau, violett) hin verschoben, so dass die in der Nacht vorherrschenden blauen Lichtanteile verstärkt wahrgenommen werden können. Die Anpassung des Auges an die im Gesichtsfeld vorherrschende mittlere Leuchtdichte wird Adaptation genannt, Das menschliche Auge ist in der Lage, sich auf Leuchtdichtewerte im Bereich von 10-9 cd/m² bis etwa 10 5 cd/m² einzustellen. Sind im Gesichtsfeld größere Flachen stark unterschiedlicher Helligkeiten vorhanden, dann verlangt dies vom Auge häufige Neuadaptation, was zu rascher Ermüdung führen kann. Eine Beleuchtungsanlage, die optimale Bedingungen für Sehen, Erkennen und Wohlbefinden schaffen soll, muss daher in Verbindung mit den Reflexionsgraden der Raumbegrenzungsflächen und der Raumeinrichtung auch für eine harmonische Helligkeitsverteilung sorgen. Das menschliche Auge ist in der Lage, unterschiedlich weit entfernte Gegenstände scharf auf der Netzhaut abzubilden, Dieser Anpassungsvorgang des Auges heißt Akkumulation. Bei BLP Ingenieurbüro Bind 5 Dipl.-Ing. Oliver Bind
6 Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen unzureichenden Lichtverhältnissen (unter 100 lx oder starkem Nebel) ist die Akkumulationsfähigkeit des Auges herabgesetzt. Sie sinkt ebenfalls mit zunehmendem Alter ab etwa 40 fahren. Sehorientierte Gütemerkmale Bei sehorientierten Gütemerkmalen geht man davon aus, dass eine Beleuchtung Gütemerkmale aufweist, deren Erkennen von lichtphysikalischen Größen abhängt. Solche Merkmale einer Sehaufgabe können z.b. ihre relative Größe oder räumliche Lage sein, ebenso die Frage, die Sehaufgabe ortsfest oder beweglich ist, ob kleine Details oder geringe Kontraste zu erfassen sind und inwieweit das Erkennen von Farben, Oberflächenstrukturen bzw. Geometrien die wesentlichen Merkmale der Sehtätigkeit sind. Aus den typischen Merkmalen der Sehaufgabe, z.b. dem Erkennen von Symbolen und Zeichen, dem Unterscheiden von Farben und dem Auffinden von Details lassen sich wiederum Beleuchtungsbedingungen ableiten unter denen sich die Sehaufgabe lösen lässt. Die Zusammenhänge zwischen dem Schwierigkeitsgrad der Sehaufgabe und den dafür erforderlichen lichtphysikalischen Werten sind inzwischen ausreichend erforscht und dokumentiert; diese Zusammenhänge bilden die Basis für beleuchtungstechnische Regelwerke und somit der Norm und dem Stand der Technik. Normenvorgaben sind derzeit bei der Planung von Beleuchtungsanlagen von zentraler Bedeutung. Beleuchtungsniveau Der typische Vertreter der sehorientierten Gütemerkmale ist das Beleuchtungsniveau. Die Leistungsfähigkeit des Auges hängt im wesentlichen von Helligkeitseindruck im Gesichtsfeld und deren Verteilung ab. Wenn man annimmt, dass das Beleuchtungsniveau ein wesentlicher Faktor zum Erreichen einer für die Nutzung eines Raumes erforderlichen Sehleistung ist, so wäre es folgerichtig, das Beleuchtungsniveau durch die Leuchtdichte zu kennzeichnen. Nun kann man in der Lichttechnik nur Beleuchtungsstärken messen. Die Leuchtdichte kann aber nur mit Hilfe des Reflexionsgrades der beleuchteten Flächen bestimmt werden. Im allgemeinen gibt es in einem Raum sehr viele beleuchtete Flächen. Daher wird beim Beleuchtungsniveau in der Normung, die Beleuchtungsstärke als Kennzahl verwendet. BLP Ingenieurbüro Bind 6 Dipl.-Ing. Oliver Bind
7 Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen Lichtstrom Der Lichtstrom beschreibt die photometrisch bewertete Strahlungsleistung, also die von einer Lichtquelle (Lampe) abgegebene gesamten Lichtleistung. Der Lichtstrom wird dabei bezogen auf den gesamten Raum. Alle weiteren photometrischen Größen lassen sich vom Lichtstrom über geometrische Beziehungen ableiten. Die Einheit des Lichtstroms ist Lumen [lm]. Die Angabe des Lichtstromes findet Verwendung bei der Charakterisierung von Lampen. Der Lichtstrom ist die Größe, die angegeben werden muss, um zu beschreiben, wie viel Licht von einer Lampe erzeugt wird. Die übliche Angabe "so hell wie eine 100W Lampe" ist unzureichend, da eine Glühlampe mit 100W = 1360 lm deutlich weniger Lichtstrom erzeugt als z.b. eine 100 W = lm Natrium-Lampe. Lichtstärke Die Lichtstärke beschreibt den Lichtstromanteil, welcher in eine bestimmte Richtung ausgestrahlt wird. Sie bestimmt sich also aus dem Verhältnis des Lichtromanteils zum dazugehörigen Raumwinkelelement. Die Lichtstärke ist ein eine der Basiseinheiten der internationalen Einheitssystems SI Einheit Candela cd. Die Lichtstärke einer Lampe ist aber nicht in jeder Richtung gleich. Werden die Lichtstärken im Raum um die Lampe herum erfasst, erhält man die Lichtstärkeverteilung, welche die lichttechnischen Eigenschaften einer Lampe oder Leuchte genau beschreibt. Die Lichtstärkeverteilungskurve (LVK) ergibt sich in jeder Schnittebene durch den Lichtstärkeverteilungskörper. Zur Vergleichbarkeit wird bei Lichtstärkeverteilungskurven auf Candela pro 1000 lm (cd/klm) normiert. Sie ist die Basis für jede Lichtberechnung, da Sie die lichttechnischen Eigenschaften einer Leuchte charakterisiert. C0-180 C [cd/klm] Abbildung Beispiel-LVK BLP Ingenieurbüro Bind 7 Dipl.-Ing. Oliver Bind
8 Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen Beleuchtungsstärke Die Beleuchtungsstärke nun, beschreibt die Menge des Lichtstroms, der auf eine gegebene Fläche auftrifft, somit ist sie ein Energiedichte. Genauer: Die Beleuchtungsstärke ist der Quotient aus Lichtstrom und beleuchteter Fläche. Fällt z.b. ein Lichtstrom von 1000 Lumen gleichmäßig auf eine Fläche von 5 m², so ergibt das eine Beleuchtungsstärke vorn 200 Lux. Die Leistungsfähigkeit des Auges hängt entscheidend vom Beleuchtungsniveau im Sehfeld ab. Mit zunehmender Beleuchtungsstärke nimmt auch die allgemeine Leistungsfähigkeit zu, so dass die Produktivität steigt und die Fehlerhäufigkeit abnimmt. Die DIN definiert die Wartungswert der Beleuchtungsstärke E m als örtlichen und zeitlichen Mittelwert bei mittlerem Alterungszustand der Beleuchtungsanlage, der nicht unterschritten werden darf. Die Angabe der Wartungswert der Beleuchtungsstärke E m bezieht sich stets auf die Lage der zu beleuchtenden Ebene. So gibt die horizontale Beleuchtungsstärke E h das Beleuchtungsniveau auf einer waagerechten Nutzebene an, während sich die vertikale Beleuchtungsstärke E v auf eine senkrechte Ebene bezieht. Sie kann im Einzelfall auch für ein z. B. um 70 zur Horizontalen geneigtes Zeichenbrett gelten. Ohne Messgerät lässt sich bei Leuchtstofflampen anhand der Leistung pro Quadratmeter Grundfläche grob abschätzen, ob die geforderten Werte eingehalten werden: Bei 30 Watt Leistung in einer Höhe von 3 m sind näherungsweise 500 Lux eingehalten. Ältere Mitarbeiter benötigen eine höhere Beleuchtungsstärke. Das also erfordert individuelle Beleuchtungsverhältnisse. Die zylindrische Beleuchtungsstärke E z ist der über alle Richtungen um einen Punkt (an einer vertikalen Achse) gebildete Mittelwert der vertikalen Beleuchtungsstärken. In der Praxis wird E z annähernd als Mittelwert der Vertikalbeleuchtungsstärke E v in 4 aufeinander senkrechten Richtungen bestimmt. Durch den Vergleich von zylindrischer und horizontaler Beleuchtungsstärke kann das Verhältnis zwischen diffusem und gerichtetem Licht grob beurteilt werden. Für eine angenehme Schattigkeit, die für das räumliche Sehen und eine gute Orientierung wichtig ist, sollen beide Lichtanteile in einem ausgewogenen Verhältnis vorhanden sein (E z : E h zwischen 0,3 und 0,7). Reines Direktlicht erzeugt harte Schlagschatten, während ausschließlich diffuse Beleuchtung zu eintöniger, flach wirkender Schattenlosigkeit führt. Beispiele für Beleuchtungsstärken sind: BLP Ingenieurbüro Bind 8 Dipl.-Ing. Oliver Bind
9 Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen Photometrische Entfernungsgesetz Das photometrische Entfernungsgesetz verknüpft die Beleuchtungsstärke E in einem Punkt auf der Nutzebene (Punktbeleuchtungsstärke) mit der Lichtausstrahlung einer Lichtquelle (Lichtstärke I) im Abstand r: E I( ) * cos 2 r α steht dabei für den Einfallswinkel des Lichts, d. h. den Winkel zwischen der Richtung des einfallenden Lichtstrahls und der Senkrechten auf der beleuchteten Ebene. BLP Ingenieurbüro Bind 9 Dipl.-Ing. Oliver Bind
10 Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen Die Beziehung besagt, dass die Beleuchtungsstärke auf einer Fläche umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands zwischen Lichtquelle und beleuchteter Fläche abnimmt, d. h. wird der Abstand der Lichtquelle zur Fläche verdoppelt, so reduziert sich die Beleuchtungsstärke auf ein Viertel. Dieses Gesetz gilt jedoch streng genommen nur für punktförmige Lichtquellen und Empfänger und mit ausreichender Genauigkeit erst ab einer gewissen photometrischen Grenzentfernung. Diese Entfernung hängt ab von: der größten Ausdehnung der Lichtquelle der räumlichen Lichtstärkeverteilung der Lichtquelle der Leuchtdichteverteilung auf der Oberfläche der Lichtquelle in der betrachteten Richtung der Größe der Lichteintrittsfläche des Photometerkopfs des Beleuchtungsstärkemessgerätes der räumlichen und örtlichen Empfindlichkeitsverteilung des Photometerkopfes Die Beachtung der photometrischen Grenzentfernung ist besonders in der Lichtmesstechnik (Photometrie) von großer Bedeutung. Hier werden zur Bestimmung der Lichtstärkeverteilung einer Leuchte Beleuchtungsstärken gemessen und über das photometrische Entfernungsgesetz auf die Lichtstärken zurückgerechnet. Als Faustregel gilt: wenn der Messabstand r das zehnfache der größten Ausdehnung der Lichtquelle beträgt, bleibt der Fehler kleiner 1%. Leuchtdichte Die Leuchtdichte ist diejenige lichttechnische Grundgröße, die vom menschlichen Auge wahrgenommen wird. Sie ist für den Helligkeitseindruck einer leuchtenden oder beleuchteten Fläche ausschlaggebend. Die Leuchtdichte L ist definiert durch die Lichtstärke I(α) einer Fläche A in Richtung α. Unterstellt man bei einer beleuchteten Fläche diffuse Reflexion (Lambertstrahler), so ergibt sich eine einfache Beziehung zwischen der Leuchtdichte L, der Beleuchtungsstärke E und der Reflexionsgrad ρ dieser Fläche: 1 L * E * Der Helligkeitseindruck eines Gegenstandes wird zwar vorwiegend von der Leuchtdichte bestimmt, trotzdem ist die Leuchtdichte kein absolutes Maß für das Helligkeitsempfinden. Flächen gleicher Leuchtdichte können bei unterschiedlicher Umgebungshelligkeit subjektiv unterschiedliches Helligkeitsempfinden hervorrufen. Die Leuchtdichte ist die physikalisch messbare Große, während die Helligkeit die subjektive Empfindung einschließlich der Farbeindrücke beschreibt. lm Bereich des Tagessehens ist die Helligkeit ungefähr mit dem Logarithmus der Leuchtdichte proportional. Das Beleuchtungsniveau, also die Leuchtdichte die wir sehen, wird durch die Beleuchtungsstärke E und die Reflexionseigenschaften der beleuchteten Fläche bestimmt. Je geringer die Reflexionsgrade sind und je schwieriger die Sehaufgabe ist, desto höher muss die Beleuchtungsstärke sein. Typische Beispiele für Reflexionsgrade sind z.b., weiße Wände 85 % oder helle Holzverkleidungen 50 %. rote Ziegelsteine haben nur einen Reflexionsgrad von 25 %. Die Unkenntnis der Beziehungen zwischen Beleuchtungsstärke, Leuchtdichte und Reflexionsgrad kann dazu führen, dass ein Raum trotz des Erreichens der genormten mittleren Beleuchtungsstärke sehr dunkel oder unangenehm wirken kann. Das Wohlbefinden und die Sehleistung hängt also, rein quantitativ gesehen, ganz wesentlich neben den Leuchten, von der Farb- und Oberflächengestaltung des Raumes, also Reflexionsgraden ab. BLP Ingenieurbüro Bind 10 Dipl.-Ing. Oliver Bind
11 Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen Beleuchtungsniveau am Beispiel Ballsporthallenbeleuchtung Grundsätzlich ist sowohl die Horizontal- als auch die Vertikal-Beleuchtungsstärke wichtig. Normalerweise werden die Anforderungen an die Vertikal-Beleuchtungsstärke erfüllt, wenn für Sportler und Zuschauer eine ausreichende Horizontal-Beleuchtungsstärke vorhanden ist. Ballsportarten, wie Handball, Basketball, Volleyball, Faustball, Fußball und Tennis sind meist Mannschaftsport. Die erforderlichen Spielflächen sind auch in der Halle größer als bei vielen anderen Sportarten, denn sie sollen mehreren Spielern ausreichende Bewegungsfreiraum bieten. Wichtig für den guten Überblick über das gesamte Spielfeld ist die gleichmäßige Ausleuchtung der Halle. Mit der EN wurden diverse Sportarten zu einer Anwendungstabelle mit Klassen eingeteilt. Klasse I: Hochleistungswettbewerbe, Klasse II :regionale Wettbewerbe und Klasse III: kleine Wettbewerbe. Die Werte gelten als Mittelwerte für horizontale Bewertungsfläche 1,0 m über dem Sportfeld. Die Gleichmäßigkeit g1 beschreibt die minimalste zur mittleren Beleuchtungsstärke. Klasse horizontale Gleichmäßigkeit Beleuchtungsstärke I 750 Lux 0,7 II 500 Lux 0,7 II 200 Lux 0,5 Bei der Planung ist der Wartungswert der mittleren Beleuchtungsstärke im allgemeinen mit 1,25 zu multiplizieren. Blendung und Blendungsbegrenzung Eine weitere Vertreterin der sehorientierten, quantitative Gütemerkmale ist die Blendung bzw. deren Begrenzung. Als Blendung werden Sehstörungen bezeichnet, die durch eine ungünstige Leuchtdichteverteilung und/oder zu hohe Leuchtdichtekontraste (Leuchtdichteunterschiede) im Gesichtsfeld entstehen. Diese können unterschiedlich vom Betrachter sein. Blendung ist nicht nur ein Problem der künstlichen Beleuchtung, sondern vor allem auch ein Problem der Tageslichtbeleuchtung (Stichwort: Sonnenschutz). Man unterscheidet zwei Arten von Blendung nach ihrer Wirkung: Physiologische Blendung Blendung, die zur Herabsetzung des Sehvermögens führt (z. B. Unterschiedsempfindlichkeit und Formenerkennung bei Blendung durch ein entgegenkommendes Auto bei Nacht). Bei einer ausgewogenen Leuchtdichteverteilung im Gesichtsfeld adaptiert das Auge auf dessen Mittelwert. Eine zusätzliche Blendquelle (z.b. ungeschirmte Lampe hoher Leuchtdichte) im Blickfeld erzeugt im Augeninneren durch Streulicht einen "Schleier", wodurch das Adaptationsniveau angehoben wird und kleine Leuchtdichteunterschiede des Sehdetails unsichtbar werden können. Je höher die Leuchtdichte der Blendlichtquelle und je näher sie der Blickrichtung liegt, desto mehr blendet sie. BLP Ingenieurbüro Bind 11 Dipl.-Ing. Oliver Bind
12 Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen Psychologische Blendung Blendung, die allein unter dem Gesichtspunkt der Störempfindung bewertet wird. Das Sehvermögen wird nicht merklich herabgesetzt. Bei längerem Einwirken führt psychologische Blendung aber zu Ermüdung, Herabsetzung der Leistung und geringerem Wohlbefinden. Alle Verfahren zur Begrenzung der Direktblendung, z.b. das Grenzkurvensystem nach Söllner oder das neue UGR-Verfahren, berücksichtigen lediglich die psychologische Blendung, nicht aber die physiologische Blendung. Blendung kann dabei auf zweierlei Art hervorgerufen werden: Direktblendung Blendung, die unmittelbar durch Lichtquellen hervorgerufen wird. Ihr Ausmaß hängt ab von der Leuchtdichte und Größe der gesehenen leuchtenden Flächen aller im Blickfeld befindlichen Leuchten sowie von der Leuchtdichte des Hintergrunds. Direktblendung gilt als ausreichend begrenzt, trotz einer möglichen Adaptation und ohne Berücksichtigung des Umfelds, wenn die mittlere Leuchtdichte der Leuchten im, für die Blendung kritischen Winkelbereich von 45 bis 85, die Werte der Leuchtdichtegrenzkurven nicht überschreitet (Abbildung 4). Dies sind etwa 200 cd/m², zum Vergleich: eine 1,50 m lange Leuchtstoffröhre hat als freistrahlende Lichtleiste eine Leuchtdichte von etwa cd/m² in jeder Richtung. Zur Beurteilung der von einer Beleuchtungsanlage ausgehenden Gefahr von Direktblendung und speziell der psychologischen Blendung wurde das UGR-Verfahren entwickelt. Der UGR-Verfahren beschreibt den Grad der Direktenblendung durch Leuchten einer Beleuchtungsanlage im Innenraum nach einer Tabellenmethode. Als Bespiel: der UGR-Wert an Büroarbeitsplätzen darf höchsten 19 sein. BLP Ingenieurbüro Bind 12 Dipl.-Ing. Oliver Bind
13 Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen Reflexblendung Blendung und Kontrastminderung, die durch spiegelnde Reflexion von leuchtenden Objekten, z.b. auf glänzendem Papier oder Bildschirmoberflächen, verursacht wird. Die Lichtreflexe führen im allgemeinen zu einer Beeinträchtigung des Kontrastsehens, so dass z.b. die Zeichenerkennung auf bedrucktem Papier erschwert wird. Diese Art der Blendung wird meist zu sehr unterschätzt. Reflexblendung kann durch folgende Maßnahmen vermieden oder verringert werden: sorgfältige Anordnung von Leuchten oder Fenster und Arbeitsplätzen zueinander, Leuchtdichtebegrenzung der Leuchten oder Fenstern zur Vermeidung von Lichtreflexen auf dem Sehobjekt, Verwendung von matten, diffus reflektierenden oder entspiegelten Oberflächen am Arbeitsplatz, diffuse Lichteinstrahlung durch Beleuchtungslösungen mit hohem Indirektanteil oder höheren Vertikalbeleuchtungsstärken. Allgemein kann man für Arbeitsplätze sagen, dass direkt über dem Arbeitsplatz sich keine Leuchte befinden sollte Arbeitsplätze mit Computerbildschirmen stellen hinsichtlich der Beleuchtung besondere Anforderungen. Dies bezieht sich speziell auf die Leuchtdichteverteilung im Raum sowie auf die Begrenzung der Direkt- und der Reflexblendung. BLP Ingenieurbüro Bind 13 Dipl.-Ing. Oliver Bind
14 Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen Die Leuchtdichteverteilung ist u.a. abhängig von den Reflexionsgraden, Glanzeigenschaften und Farben der Flächen am Arbeitsplatz und im Raum. Sie sollen so gewählt werden, das keine allzu hohen Leuchtdichteunterschiede (Kontraste) oder störende Spiegelungen heller Flächen auftreten können. Bezüglich der Direktblendung durch Leuchten ist zu beachten, dass bei der Bildschirmarbeit die Hauptblickrichtung üblicherweise nahezu horizontal ist, während bei anderer Büroarbeit der Blick oft stärker nach unten geneigt wird. Reflexblendung rührt von der Spiegelung heller, glänzender Flächen an glänzenden Oberflächen her. Da die Spiegelung winkelabhängig ist, hat die Anordnung von Arbeitsplätzen und Leuchten einen entscheidenden Einfluss. Blendung am Beispiel Ballsporthallenbeleuchtung Da Lichtquellen in der Regel die größten Leuchtdichten aufweisen, sind sie zur Vermeindung von Direktblendung in den von Sportlern und Zuschauern bevorzugten Blickrichtungen abzuschirmen. Zum Schutz vor Blendung beim Blick auf hohe Bälle sollten die Leuchten für das Volleyballfeld nicht in dem Bereich der Decke montiert sein, der sich direkt über dem Spielfeld befindet. Auch über Basketballkörben sollten in einem Radius von vier Meter keine Leuchten montiert sein. Reflexblendung kann durch Spiegelung heller Flächen, z.b. von Leuchten oder Fenstern auf den Boden, entstehen. Bei glänzenden Böden können von Leuchten herrührende Reflexstreifen als solche stören oder das Erkennen von Markierungslinien erschweren. In Mehrzweckhallen kann es daher Zweckmäßig sein, zwei separate Beleuchtungsanlagen einzurichten: Eine für den Sportbetrieb und eine für gesellschaftliche Anlässe. Lichtfarbe und Farbwiedergabe Die für allgemeine Beleuchtungszwecke verwendeten Lichtquellen geben im allgemeinen weißes Licht ab. Was für den Laien doch sehr verblüffende ist, unterscheiden sich die Lichtfarben und Farbwiedergabe derartiger Lichtquellen für weißes Licht unter Umständen erheblich. BLP Ingenieurbüro Bind 14 Dipl.-Ing. Oliver Bind
15 Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen Als Lichtfarbe wird die Farbart eines Selbstleuchters, also einer Lichtquelle (Lampe), bezeichnet (im Gegensatz zur Körperfarbe eines Objektes, die nur durch Bestrahlung entsteht). Die Lichtfarbe ergibt sich aus der spektralen Zusammensetzung (Spektrum) des ausgesandten Lichts. Die Farbart einer Lichtquelle wird mit der Farbe des sog. "Schwarzen" oder Planckschen Strahlers verglichen und ist beschrieben durch die ähnlichste Temperatur. Niedrige Farbtemperaturen sind roten Farbarten zuzuordnen. Mit steigender Temperatur wird die Farbart weiß und dann blau. Die Farbtemperatur wird in Kelvin (K) angegeben. Nach DIN EN und CIE gibt es eine Einteilung der technischen Lichtquellen nach ihrer Lichtfarbe. Sie erscheinen alle dem menschlichen Auge als weiß, ein Unterschied wird erst im direkten Vergleich deutlich. Die Sehleistung wird durch diese verschiedenen Lichtfarben nicht direkt beeinflusst. Bezeichnung nach DIN Kürzel Farbtemperatur Farberscheinung Warmweiß WW < 3300K Warm Neutralweiß/Universalweiß NW 3300K-5300K Mittel Tageslichtweiß TW > 5300K Kalt Soll die Beleuchtung nicht unbehaglich kalt wirken, so sollte man tageslichtweiße Lampen, wenn das Beleuchtungsniveau hoch ist. Im Prinzip gibt es jedoch keine sachliche Begründung für die Bevorzugung bestimmter weißer Lichtfarben. Sicher ist nur, dass eine weiße Fläche mit warmweißer Farbe rötlicher als mit tageslichtweißer Lichtfarbe wirkt. Die Farbwiedergabe soll darüber Aufschluss geben, wie "richtig" eine Körperfarbe (Wände, Decken, Möbel, Objekte) bei künstlicher Beleuchtung dem Betrachter gegenüber dem Sonnenlicht erscheint. Sie ist ein wichtiges Gütekriterium. Sie hat erst einmal nichts mit der Lichtfarbe selbst zutun. Obwohl die Farbwiedergabe von weiß, natürlich von der Lichtfarbe abhängt. Lampen, speziell Leuchtstofflampen, können bei gleicher Lichtfarbe verschiedene Farbwiedergabeeigenschaften haben. Im allgemeinen Farbwiedergabeindex (Ra) werden die Abweichungen zusammengefasst, beim Vergleich von diversen Testfarben unter der zu kennzeichnenden Lichtart und einer Bezugsbeleuchtung. Eine Vereinfachung stellt die Kennzeichnung der Farbwiedergabeeigenschaften von Lichtquellen nach DIN mit Farbwiedergabestufen, dar. Es sind sechs Farbwiedergabestufen definiert, denen Bereiche des allgemeinen Farbwiedergabeindex nach folgender Tabelle zugeordnet sind: Bezeichnung Farbwiedergabestufe Farbwiedergabeindex Ra Sehr gut 1A Ra > 90 1B Ra Gut 2A Ra B Ra Weniger gut 3 Ra Ra < Je nach Art des Raumes und der Tätigkeit sind in Normen Stufen der Farbwiedergabe gefordert. Generell bedeutet die Farbwiedergabestufe 1A höchste Farbwiedergabequalität, wie sie bei der Farbprüfung/Farbkontrolle, aber z.b. auch in Sanitätsräumen erforderlich ist. In allgemeinen ist die Stufe 1B vollkommen ausreichend. In variablen, nutzbaren Räumen oder z.b. bei Grafikern sollte man die Stufe 1A wählen. BLP Ingenieurbüro Bind 15 Dipl.-Ing. Oliver Bind
16 Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen Entscheidend für die Qualität der Farbwiedergabe in einer Beleuchtungsanlage ist die Wahl der Lampen. Temperaturstrahler wie Glühlampen haben sehr gute Farbwiedergabeeigenschaften aber eine warmweiße (rötliche) Lichtfarbe, während Leuchtstofflampen in verschiedenen Qualitätsstufen erhältlich sind. Hier eine Übersicht über Farbwiedergabeeigenschaften einzelner Lampenarten Farbwiedergabestufe sehr gut gut Weniger gut Alte Bezeichnung 1A 1B 2A 2B 3 4 Farbwiedergabeindex Ra neu Ra >90 Ra Ra Ra Ra Ra <20-40 Glühlampen X X Kompakt- Leuchtstofflampen X X Leuchtstofflampen X X X X X Quecksilberdampf- Hochdrucklampen X X X Halogen- Metalldampflampen X X X X Neben diesen gängigen Lichtfarben und Farbwiedergaben gibt es natürlich noch Sonderformen. Lampen für Körperfarben, Pflanzen, Aquarien und Vollspektrumlampen. Bei einer herkömmlichen Lampe kommt nur ein eingeschränktes Lichtspektrum zum Einsatz. Sie erzeugt primär Helligkeit. Vollspekrumlicht dagegen gibt das mittägliche Tageslicht in etwa wieder. Es berücksichtigt sowohl UV-, wie auch Infrarotanteile, daher sollten Vollspekrumlampen meist als Indirektbeleuchtung angewendet werden. Ein blendfreier und gleichmäßig ausgeleuchteter Raum entspannt die Augen und verhindert Ermüdungserscheinungen. Bekanntlich beeinflussen Farben das Wohlbefinden. Vollspektrumlampen lassen Farben natürlich und klar erscheinen, so wie Tageslicht. Ihr Einsatz wird vor allem in Räumlichkeiten, die wenig oder kein Tageslicht haben empfohlen. Neben Lichtfarbe, Farbwiedergabe, Stärke und Verteilung des beleuchtenden Lichtes ist die Farbgebung im Raum für seine Gesamtwirkung d.h. für die stimmungsmäßige Beeinflussung des Menschen, maßgebend. Bei der Mannigfaltigkeit der möglichen Farben und Vielzahl der vorhandenen Einflussgrößen ist es nicht möglich, feste Richtlinien für die farbige Raumgestaltung anzugeben. Trotzdem sind im Folgenden eine Reihe von Aussagen möglich: Unter Lichtquellen mit warmer Lichtfarbe und guten Farbwiedergabe-Eigenschaften werden auch die warmen Körperfarbe günstig beurteilt. Der geringe Anteil an kurzwelliger blauer Strahlung in diesen Lichtquellen führt jedoch dazu, dass kalte Farben mehr oder weniger getötet werden, z.b. blaugrün, blau, purpur. Bei neutralweißen Lichtquellen werden alle Farben gleichwertig beurteilt. Lampen dieser Gruppe können deshalb als solche mit sicheren Lichtfarben bezeichnet werden. Als Farben der Raumbegrenzungsflächen werden weiß oder helle Farben von sehr geringer Sättigung bevorzugt, sogenannte Pastellfarben. Hier kann man deshalb von sicheren Wandfarben sprechen. Auch werden sehr dunkle Hintergrundfarben akzeptiert, dagegen werden Farben mittlerer Sättigung und Helligkeit am wenigsten vom Betrachter geschätzt. Während für den Hintergrund Farben von sehr geringer Sättigung bevorzugt werden, sind für Objekte stärker gesättigte Farben vorrangig. Farben von Lebensmitteln werden allgemein unter warmen Licht günstiger beurteilt als unter kälterem Licht. BLP Ingenieurbüro Bind 16 Dipl.-Ing. Oliver Bind
17 Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen Trotzdem wird eine farbige Umwelt im Raum nur dann wirklich befriedigt, wenn sie lebendig und abwechslungsreich gestaltet wird. Jedoch führt in benachbarten Räumen das Wiederholen der gleichen farbigen Gestaltung, auch wenn sie sich einmal als gut, gefällig und zweckmäßig erwiesen hat, leicht zur Eintönigkeit oder Überdruss. Lichtfarbe und Farbwidergabe am Beispiel Ballsporthallenbeleuchtung Die Lichtfarbe der Lampe spielt bei der Sportstättenbeleuchtung meistens eine untergeordnete Rolle, d.h. es können Lampen der Lichtfarben warmweiß, neutralweiß und tageslichtweiß frei verwendet werden. Die Farbwiedergabe-Eigenschaften der Lampe sollte bei Anlagen für Wettkämpfe mindestens 2A (Ra 70) entsprechen. In Anlagen für ausschließlichen Trainingsbetrieb genügen auch Lampen der Stufe 3 (Ra 60). Durch gutes Mischen des Lichts verschiedener Lichtquellen lassen sich beabsichtigte Änderungen oder Verbesserungen der Farbwidergabe ermöglichen. Wahrnehmungsorientierte Gütemerkmale Die oben genannten quantitative, lichttechnische Gütemerkmale reichen aber grundsätzlich nicht aus, um den Bedarf an visueller Information bzw. die Güte halbwegs vollständig zu beschreiben. Über den, aus der jeweiligen Tätigkeit hergeleiteten quantitativen Lichtbedarf hinaus, gibt es noch einen weiteren Lichtbedarf der aus dem natürlichen Wunsch resultiert, ständig visuelle Informationen aus dem individuellen Umfeld aufzunehmen. Während also durch die Schaffung optimaler Beleuchtungsbedingungen z.b. im Sehfeld um zuverlässiges Arbeiten zu ermöglichen, hängt von der Befriedigung des visuellen Informationsbedarfs, also dem individuelle Wohlbefinden ab. Im Bereich des funktionalen Sehfeldes können wir uns an fundierten Planungswerte der quantitativen, also der Beleuchtungsstärke, Blendung usw. orientieren, diese fehlen im Bereich der Wahrnehmung weitestgehend. Es ist nämlich sinnlos, die komplexe Wahrnehmungswelt auf einzelne Sehaufgaben zu reduzieren, um daraus Schlüsse für die lichttechnische Dimensionierung des Wahrnehmungsfeldes herzuleiten. Um die Rolle von Beleuchtung beim Wahrnehmungsprozess besser verstehen zu können gilt es Gesetzmäßigkeiten der Wahrnehmung aufzuspüren. 2 Ein für den Laien verblüffender Wahrnehmungsmechanismus besteht darin, dass der Mensch aus wechselnden Helligkeitsverteilungen auf der Netzhaut zwischen konstanten Objekteigenschaften von Reflexionsgrad bzw. Farbe und veränderbaren Eigenschaften wie der Leuchtdichteverteilung bzw. Beleuchtungssituation unterscheiden kann. Diese spezielle Wahrnehmungsleistung wird in der Psychologie als Phänomen der Helligkeits- und Farbkonstanz bezeichnet. Hierzu gehört auch der sogenannte Helmholtz-Kohlrausch-Effekt, bei dem bunte Beleuchtung, bei gleicher Leuchtdichte, heller empfunden wird als unbunte (weiß-grauschwarz). Für den Bereich der qualitativen ist das Konstanzphänomen besonders bedeutend. Zeigt es doch, das für die Wahrnehmung unserer Umwelt die lichtphysikalische Größen eine relativ geringe Rolle spielen, bzw. dass sie sich nicht unabhängig von den Wahrnehmungsinhalten betrachten lassen. 2 ebenda, Seite 763 BLP Ingenieurbüro Bind 17 Dipl.-Ing. Oliver Bind
18 Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen Die Fähigkeit auf Grund der Konstanzleistung die visuelle Umgebung bei unterschiedlichen Beleuchtungsverhältnissen und damit unabhängig von Leuchtdichten spontan zu erkennen, zeigt sich, wenn uns Räume sowohl bei Kerzenschein als auch bei Tageslicht als identisch erscheinen. Andere Beispiele zeigen, dass bei unterschiedlichen Lichtfarben das Erkennen einer Oberflächenfarbe auf Grund von Konstanzleistung möglich ist. Unter blauem Himmel, wie unter direktem Sonnenlicht sehen Körperfarben grundsätzlich gleich aus. Daraus erkennt man, dass auf Grund des Konstanzphänomens Beleuchtungsverhältnisse beim Wahrnehmen unserer gegenständlichen Welt ausgeblendet werden und Licht zum Medium der Wahrnehmung, aber nicht zum quantifizierbaren Inhalt des Sehens wird. Diese Tatsache zeigt wie Fragwürdigkeit es ist, allgemein gültige quantifizierbare Beleuchtungsregeln außerhalb des unmittelbaren Ortes der Sehaufgabe zu definieren. Bereits eine allgemeine, situationsunabhängige Leuchtdichtedefinition für das Auftreten psychologischer Blendung (siehe oben) scheitert an der mangelnden Einbeziehung des Informationsgehalts der Blendquelle, nicht das Fenster mit Ausblick auf die besonnte Landschaft mit relativ hoher Leuchtdichte blendet, sondern - trotz geringerer Leuchtdichte - die Opalglasscheibe, falls sie den Ausblick verwehrt. Es wäre falsch, aus diesen Sachverhalten auf eine geringe Bedeutung der Planung, einer wahrnehmungsorientierten Beleuchtung zu schließen. wahrnehmungsorientierte Beleuchtung wird zwar weniger durch Beleuchtungsstärken und Leuchtdichten beschrieben als vielmehr durch gestalterische Parameter der Beleuchtung, die dafür verantwortlich sind, dass räumliche Strukturen erkannt, Raumzonen gegliedert, Räume erweitert werden, dass Blicke gelenkt die visuelle Aufmerksamkeit gerichtet und damit die Wahrnehmung gesteuert wird. Welches sind nun die spezifischen Merkmale, die an die Güte einer wahrnehmungsorientierten Beleuchtung gestellt werden? Von den Beleuchtungsverhältnissen eines Raumes hängen Befindlichkeit der Nutzer und damit die Akzeptanz der Raumsituation ab. Besonders in weniger vertrauter Umgebung sucht man nach visueller Orientierung, dabei kann Beleuchtung helfen, die Informationsflut eines Raumes zuordnen. Eine exakte Beschreibung dessen, was Beleuchtung, ist nicht möglich, dafür ist das Zusammenspiel von Licht, Raum und Wahrnehmung zu komplex. Zumindest versagt der herkömmliche sehorientierte Ansatz völlig. Die Zahl der Beleuchtungslösungen ist so vielfältig, wie die der architektonischen Gestaltungsvarianten. Trotzdem gibt es Gütekriterien, nach denen sich eine qualitative Beleuchtungsplanung orientieren sollte. Harmonische Helligkeitsverteilung Große Leuchtdichteunterschiede (Helligkeitsunterschiede) im Gesichtsfeld beeinträchtigen die Sehleistung und das Wohlbefinden und müssen daher vermieden werden. Das gilt sowohl für Innenraumbeleuchtung als auch im Außenbereich. Die Leuchtdichte im nahen Arbeitsbereich, z.b. einer Schreibtisch-Arbeitsfläche sollte nicht kleiner als ein Drittel der Leuchtdichte eines auf der Fläche liegenden Dokumentes. Das Leuchtdichteverhältnis von Sehaufgabe und ausgedehnten Flächen im entfernteren Umfeld sollte nicht mehr als 5:1 betragen (ältere Studien sagen auch 1:10). Zu geringe Leuchtdichteunterschiede ergeben einen gleichförmig monotonen Raumeindruck, der ebenfalls als unangenehm empfunden wird. Im Sinne von Sicherheit durch rechtzeitiges Erkennen von Hindernissen, ist eine gute örtliche Gleichmäßigkeit der Leuchtdichte wichtig. BLP Ingenieurbüro Bind 18 Dipl.-Ing. Oliver Bind
19 Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen Orientierung im Raum Wahrnehmungsorientierte unterstützt in diesem Zusammenhang die Orientierung und verbessert die Informationsstruktur eines Raumes. Es werden mit Licht und Beleuchtung Wege markiert. Leuchtenanordnungen und Helligkeitsmuster weisen Wege, kennzeichnen Anlaufpunkte und definieren Raumzonen, vertikale Beleuchtungsstärken oder akzentuierende Beleuchtung auf den Raumbegrenzungen differenzieren Räume, heben Strukturen hervor und machen Materialeigenschaften wie Glanz, Transparenz und Textur sichtbar. Charakterisierung der Architektur Auch Raumfunktion und Nutzungsart lassen sich über eine qualitative kommunizieren. Die Beleuchtung einer Produktionshalle wird sich nicht nur quantitativdeutlich von der eines Kirchenraumes unterscheiden und das Licht eines Supermarktes von dem einer Hotellobby. Hier spielen kulturelle Konventionen und Erwartungshaltungen ebenso eine Rolle wie formal architektonische Regeln. Generell lassen sich Raumklima und Raumcharakter durch Leuchtentyp und architektonische Anordnung sowie durch Lichtqualität und Lichtführung verdeutlichen. Wie kann dies in die Planungspraxis umsetzen? Im Bereich der wahrnehmungsorientierten Planung spielt folglich die klassische sehorientierten Lichtgrößen nicht die dominierende Rolle. Es sind andere Kriterien, die hier in den Vordergrund der Planung treten. Die Entscheidung für einen bestimmten Lampentyp wird in der Regel von wirtschaftlichen Kriterien, aber auch durch die geplante Lichtwirkung bestimmt dies trifft auf Beleuchtungswirkungen, wie Brillanz und Modellierung, aber auch auf Lampeneigenschaften wie Farbwiedergabe und Lichtfarbe zu. Die Auswahl von Leuchten richtet sich einerseits nach der Auswahl des Lampentyps, die Vorentscheidung für einen Lampentyp engt also die Leuchtenauswahl ein. Generell sind in einer qualitativ orientierten Planung Beleuchtungswirkung und Sehkomfort die wichtigsten Auswahlkriterien, denen formale Kriterien und Effizienzkriterien unterzuordnen sind: wenn es gilt eine Wandfläche gleich mäßig zu beleuchten, kann allein die Leuchtenfunktion und nicht der Wirkungsgrad ein Auswahlkriterium der Leuchte sein. In diesem Zusammenhang sind Leuchten Werkzeuge und für jede Beleuchtungsaufgabe gilt es das passende Werkzeug zu finden. Auch die Entscheidung für eine architektonisch integrierte Beleuchtung nimmt Einfluss auf die Leuchtenauswahl, ebenso die Entscheidung für den Montageort, sei es die Wand oder die Raumdecke. BLP Ingenieurbüro Bind 19 Dipl.-Ing. Oliver Bind
20 Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen Unterschiedliche Beleuchtungsarten schaffen unterschiedliche Eindrücke, dabei verändert sich auch der Charakter des Lichtes. Wird ausschließlich direktem Licht beleuchtet, entstehen harte Schatten, wie auf dem linken Bild zusehen ist, welche Objekte und deren Details schlechter erkennbar machen. Die verhältnismäßig dunkle Decke erscheint optisch sehr niedrig. Die reine Indirektbeleuchtung, zusehen im Bild in der Mitte, dagegen erzeugt eine schattenarme Lichtatmosphäre, die häufig einen monotonen wirkt. Rein indirekte, diffuse Beleuchtung wie lässt die Konturen verschwimmen zu Lasten gut erkennbarer Formen. Die Kombination aus direkter und indirekter Beleuchtung, so wie im Bild ganz rechts zusehen, bringt eine ausgewogene Schattigkeit mit. Dadurch sind Form und Oberflächenstrukturen der Architektur, der Menschen und der Gegenstände klar und deutlich erkennbar. Die Mischung aus direktem und indirektem Licht lässt durch die ausgewogene Schattenbildung Formen gut erkennen und schafft ein lebendiges, sympathisches Gesicht wie auf dem rechten Bild. Angenehm beleuchtete Wände und Arbeitsflächen vermitteln einen offenen, freundlichen und interessanten Raumeindruck. Daraus resultieren folgende Konzepte. Architektonisch, gestalterische Gütemerkmale Zusätzlich zu einem wahrnehmungsorientierten Lichtkonzept stellt sich bei der Beleuchtungsplanung die Forderung, Strukturen und charakteristische Merkmale einer Architektur durch die gestalterische Wirkung von Beleuchtungswirkung und Leuchten zu verdeutlichen. Gesucht werden dabei Konzepte, welche die Formensprache eines Gebäudes, seine Gestaltungsmerkmale und Raumgliederungen formal aufnehmen verstärken. Beleuchtungsanlagen sind als Teil des architektonischen Gesamtentwurfs zu sehen, die auch über Form und Anordnung Einfluss auf die Akzeptanz einer Raumsituation nehmen. Beleuchtung definiert sich dabei formal als gestalterisches Element durch Leuchten- und Anordnungsgeometrie. Es liegt in der planerischen Verantwortung des Architekten, unter Berücksichtigung von wahrnehmungspsychologischen Gestaltgesetzen Leuchtenformen, Leuchtenanordnung und deren Lichtwirkung so aufeinander abzustimmen, dass Architektur nicht nur betont, sondern möglichst auch an Aussagekraft gewinnt. Hierzu kann der Planer nur eine Hilfestellung geben. Letztendlich bleibt es dem Architekten überlassen, wie sein Entwurf architektonisch in Szene gesetzt werden soll. BLP Ingenieurbüro Bind 20 Dipl.-Ing. Oliver Bind
21 Beleuchtungsplanung unter quantitativen und qualitativer Gütemerkmalen Wirtschaftlichkeit Die Wirtschaftlichkeit lässt sich nicht ohne weiteres in eines der oben beschriebenen Aspekte einordnen. Wirtschaftlichkeit trägt nur entfernt etwas zur Sehorientierung und Wahrnehmungsorientierung bei. Zur Architektonische, gestalterischen Aspekt sowieso nicht. Als Wirtschaftlichkeit wird heute hauptsächlich die Minimierung der Kosten der Beleuchtungsanlage betrachtet. Zur Ermittlung dieser Kosten existierte früher eine Norm (DIN 5035) Hierzu werden die Anschaffungskosten, Energiekosten, Lampenkosten und Instandhaltungskosten inklusive Reinigungskosten ermittelt. Es wird aber zunehmend schwieriger diese Kosten über die gesamte Lebensdauer zu ermitteln (z.b. ist es schwer die Energiekosten in den nächsten 5 Jahren zu schätzen). Somit lässt sich Wirtschaftlichkeit auch nicht eindeutig quantifizieren. Einige Merkmale sind auch qualitativ zu sehen. Daher wird hier nur auf einige Faktoren eingegangen, wie man die Wirtschaftlichkeit und daher die Kosten senken kann bzw. den Nutzen bei weniger Einsatz maximieren kann. Einsatz von wirtschaftlichen Lampen Neue Lampenentwicklungen schaffen immer höhere Lichtausbeuten, bei gleichzeitiger Verbesserung des visuellen Komforts. Hier sind besonders die farbverbesserten Natriumdampf- Hochdrucklampen und die immer kleiner werdenden Kompakt-Leuchtstofflampen mit Stift- und Schraubsockel zu nennen (Energiesparlampen). Daneben haben sich bereits die Halogen- Metalldampflampen durchgesetzt, die brillantes Licht bei ebenfalls sehr hoher Effizienz bieten, z.b. hohe Lichtausbeute. Schalthäufigkeiten und verfügbare Lichtfarben, erlauben dabei meist den problemlosen Ersatz der herkömmlichen Lampen. Die höheren Erstinstallationskosten rechnen sich durch eine längere Lebensdauer (z. B. 8-fach bei der Kompakt-Leuchtstofflampe) und dem deutlich geringeren Stromverbrauch bei gleichem oder sogar höherem Lichtstrom. Einsatz von wirtschaftlichen Vorschaltgeräte Elektronische Vorschaltgeräte bieten Energieersparnis und eine höhere Wirtschaftlichkeit. Die Vorteile sind vielfältig, besonders im Bereich der Leuchtstoff- und Kompakt-Leuchtstofflampen: geringerer Eigenverbrauch (nur noch ca. 10% der Lampenleistung, d. h. ca. 30% weniger Energieverluste gegenüber konventionellen Vorschaltgeräten), besserer Wirkungsgrad der Lampe (ca. 10% Energieeinsparung gegenüber konventionellen Vorschaltgeräten), längere Lampenlebensdauer durch flackerfreien Warmstart (ca % länger), geringerer Lichtstromrückgang über die Lebensdauer, erhöhte Schalthäufigkeit (Faktor 3), niedrigere Lampenersatz- und Wartungskosten, geringere Heizlast; dadurch Entlastung der Klimaanlage, Abschaltautomatik zur Vermeidung des energieaufwendigen Flackerns am Lebensdauerende dimmen und steuern gegenüber konventionellen Vorschaltgeräten möglich. Ein sparsamer und bewusster Umgang mit Energie wird beim Einsatz eines Lichtsteuersystems deutlich. Ein intelligentes Lichtsteuerungssystem ermöglicht die Einsparung von bis zu 80% der Stromkosten für Beleuchtung. Nicht allein ein automatisches Ein- und Ausschalten, sondern ein BLP Ingenieurbüro Bind 21 Dipl.-Ing. Oliver Bind
Arbeitswissenschaftliches Praktikum - Messung lichttechnischer Größen (Beleuchtung) -
 Arbeitswissenschaftliches Praktikum - Messung lichttechnischer Größen (Beleuchtung) - Universität Karlsruhe (TH) - Institut für Industriebetriebslehre und Industrielle Produktion Abteilung Arbeitswissenschaften
Arbeitswissenschaftliches Praktikum - Messung lichttechnischer Größen (Beleuchtung) - Universität Karlsruhe (TH) - Institut für Industriebetriebslehre und Industrielle Produktion Abteilung Arbeitswissenschaften
Lichtqualitäten für behagliche Wirkung im Raum
 Licht ist Lebensqualität Lichtqualitäten für behagliche Wirkung im Raum Subjektive Licht- und Raumempfindung Praktische Messungen: Farbtemperatur, Farbwiedergabe, Lichtspektrum Dipl. Biol. Pamela Jentner
Licht ist Lebensqualität Lichtqualitäten für behagliche Wirkung im Raum Subjektive Licht- und Raumempfindung Praktische Messungen: Farbtemperatur, Farbwiedergabe, Lichtspektrum Dipl. Biol. Pamela Jentner
Vorlesungsskripte zur Bauphysik Masterstudium. Tageslicht
 HAWK - HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFT UND KUNST Baukonstruktion und Bauphysik in der Fakultät Bauwesen in Hildesheim Vorlesungsskripte zur Bauphysik Masterstudium Tageslicht C:\FHHI\SS2006\Master\BP2\Skripte\tageslicht-m.doc
HAWK - HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFT UND KUNST Baukonstruktion und Bauphysik in der Fakultät Bauwesen in Hildesheim Vorlesungsskripte zur Bauphysik Masterstudium Tageslicht C:\FHHI\SS2006\Master\BP2\Skripte\tageslicht-m.doc
1 Grundlagen. 1.1 Definition des Lichts
 1 Grundlagen Der Sehvorgang»beginnt«mit dem Licht. Ohne Licht ist eine visuelle Wahrnehmung nicht möglich, denn das menschliche Auge kann Körper nur wahrnehmen, wenn von ihnen ausgehendes bzw. reflektiertes
1 Grundlagen Der Sehvorgang»beginnt«mit dem Licht. Ohne Licht ist eine visuelle Wahrnehmung nicht möglich, denn das menschliche Auge kann Körper nur wahrnehmen, wenn von ihnen ausgehendes bzw. reflektiertes
Quantitative und Qualitative Gütemerkmale von Beleuchtungen in der Architektur
 Vortrag Quantitative und Qualitative Gütemerkmale von Beleuchtungen in der Architektur Licht + Kunst Herbsttreffen VfA-Bezirksgruppe Region Darmstadt am 24.November 2000 Dipl.-Ing. (TU) / Dipl.-Wirtschaftsing.(FH)
Vortrag Quantitative und Qualitative Gütemerkmale von Beleuchtungen in der Architektur Licht + Kunst Herbsttreffen VfA-Bezirksgruppe Region Darmstadt am 24.November 2000 Dipl.-Ing. (TU) / Dipl.-Wirtschaftsing.(FH)
Kriterien für gute Beleuchtungsanlagen und deren messtechnische Bewertung
 Kriterien für gute Beleuchtungsanlagen und deren messtechnische Bewertung DI(FH) Horst PRIBITZER Leitender Referent Lichttechnik Labor Magistratsabteilung 39 - Prüf- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle
Kriterien für gute Beleuchtungsanlagen und deren messtechnische Bewertung DI(FH) Horst PRIBITZER Leitender Referent Lichttechnik Labor Magistratsabteilung 39 - Prüf- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle
Untersuchung zum Kontrast, Lesbarkeit und Hintergrundfarben am Monitor Ales Markytan FG Lichttechnik, TU Ilmenau
 Untersuchung zum Kontrast, Lesbarkeit und Hintergrundfarben am Monitor Ales Markytan FG Lichttechnik, TU Ilmenau. Zusammenfassung Heutzutage ist der Bildschirm im Büro die wichtigste Informationsquelle
Untersuchung zum Kontrast, Lesbarkeit und Hintergrundfarben am Monitor Ales Markytan FG Lichttechnik, TU Ilmenau. Zusammenfassung Heutzutage ist der Bildschirm im Büro die wichtigste Informationsquelle
Grundbegriffe. der. Lichttechnik
 Grundbegriffe der Lichttechnik Nicht jede Farbe empfindet das Auge als gleich hell Relative Hellempfindlichkeit für Tagessehen 1,0 0,5 380 780 0 400 500 600 700 (nm) UV Licht IR Fördergemeinschaft
Grundbegriffe der Lichttechnik Nicht jede Farbe empfindet das Auge als gleich hell Relative Hellempfindlichkeit für Tagessehen 1,0 0,5 380 780 0 400 500 600 700 (nm) UV Licht IR Fördergemeinschaft
LED Energetische und qualitative Eigenschaften
 LED Energetische und qualitative Eigenschaften Prof. M. Wambsganß / M. Schmidt - 1 Gliederung! Grundlagen " Technologie der (weißen) LED " (LED-) Licht und Gesundheit! Effizienz! Qualitätsmerkmale " Temperaturmanagement
LED Energetische und qualitative Eigenschaften Prof. M. Wambsganß / M. Schmidt - 1 Gliederung! Grundlagen " Technologie der (weißen) LED " (LED-) Licht und Gesundheit! Effizienz! Qualitätsmerkmale " Temperaturmanagement
Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik e.v.
 Lernprogramm Beleuchtungstechnik 2.0 Inhalt: 1 Physikalische Grundlagen des Lichts 1.1Einleitung 1.1.1 Physikalische Grundlagen des Lichts 1.2 Elektromagnetische Strahlung 1.2.1 Lernziele 1.2.2 Licht als
Lernprogramm Beleuchtungstechnik 2.0 Inhalt: 1 Physikalische Grundlagen des Lichts 1.1Einleitung 1.1.1 Physikalische Grundlagen des Lichts 1.2 Elektromagnetische Strahlung 1.2.1 Lernziele 1.2.2 Licht als
Uni für Alle. Patrik Janett Labor für Energieeffizienz und EMV. 14. März Seite 1
 Uni für Alle Patrik Janett Labor für Energieeffizienz und EMV 14. März 2017 Seite 1 Ablauf - Energiestrategie 2050 - Lichttechnische Begriffe - Energielabel - Begriffe welche auf der Verpackung stehen
Uni für Alle Patrik Janett Labor für Energieeffizienz und EMV 14. März 2017 Seite 1 Ablauf - Energiestrategie 2050 - Lichttechnische Begriffe - Energielabel - Begriffe welche auf der Verpackung stehen
und jetzt auch noch die LED!!
 LED Energetische und qualitative Eigenschaften Dipl.-Ing.(FH) M. Schmidt M.A. / Prof. M. Wambsganß - 1 Leuchtmittelübersicht und jetzt auch noch die LED!! Dipl.-Ing.(FH) M. Schmidt M.A. / Prof. M. Wambsganß
LED Energetische und qualitative Eigenschaften Dipl.-Ing.(FH) M. Schmidt M.A. / Prof. M. Wambsganß - 1 Leuchtmittelübersicht und jetzt auch noch die LED!! Dipl.-Ing.(FH) M. Schmidt M.A. / Prof. M. Wambsganß
Die Wahrnehmung schwarzer & weißer Flächen nach einem Bericht von Alan L. Gilchrist
 Die Wahrnehmung schwarzer & weißer Flächen nach einem Bericht von Alan L. Gilchrist Seminar: Visuelle Wahrnehmung Dozent: Prof. Gegenfurtner Referentin: Andrea Hackl Datum: 15.11.2001 Grundlagen Farbkonstanz:
Die Wahrnehmung schwarzer & weißer Flächen nach einem Bericht von Alan L. Gilchrist Seminar: Visuelle Wahrnehmung Dozent: Prof. Gegenfurtner Referentin: Andrea Hackl Datum: 15.11.2001 Grundlagen Farbkonstanz:
BG-Regel Natürliche und künstliche Beleuchtung von Arbeitsstätten (BGR 131)
 BG-Regel Natürliche und künstliche Beleuchtung von Arbeitsstätten (BGR 131) Gerold Soestmeyer Fachausschuss Einwirkungen und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren Arbeitskreis Beleuchtung, Licht und Farbe
BG-Regel Natürliche und künstliche Beleuchtung von Arbeitsstätten (BGR 131) Gerold Soestmeyer Fachausschuss Einwirkungen und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren Arbeitskreis Beleuchtung, Licht und Farbe
Bei Licht betrachtet: Bürobeleuchtung. Herzlich Willkommen. Potsdamer Dialog, April Seite 1
 Bei Licht betrachtet: Bürobeleuchtung Herzlich Willkommen Potsdamer Dialog, 16. 18. April 2013 04.07.2013 Seite 1 Quelle: C. Schierz. Spektrale Hellempfindlichkeit 2 Gesichtsfeld V (λ): scotopisch (Nachtsehen)
Bei Licht betrachtet: Bürobeleuchtung Herzlich Willkommen Potsdamer Dialog, 16. 18. April 2013 04.07.2013 Seite 1 Quelle: C. Schierz. Spektrale Hellempfindlichkeit 2 Gesichtsfeld V (λ): scotopisch (Nachtsehen)
DIN EN 12464-1 Wie ändert sich die Lichtplanung in der Praxis?
 in der Praxis? Vortrag in der Praxis? Luxjunior 2003 Arnstadt am 21. September 2003 Dipl.-Ing. (TU) / Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) Oliver D. Bind Troppauer Straße 11 61440 Oberursel (Taunus) Tel. 06171/587097
in der Praxis? Vortrag in der Praxis? Luxjunior 2003 Arnstadt am 21. September 2003 Dipl.-Ing. (TU) / Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) Oliver D. Bind Troppauer Straße 11 61440 Oberursel (Taunus) Tel. 06171/587097
LED-Einleitung 2011LED
 2011LED LED-Einleitung LED-Einleitung architektonisches licht Effiziente LED-Technologie bildet die Basis für Beleuchtungslösungen der Zukunft, und die Zahl ihrer Anwendungsmöglichkeiten wächst ständig.
2011LED LED-Einleitung LED-Einleitung architektonisches licht Effiziente LED-Technologie bildet die Basis für Beleuchtungslösungen der Zukunft, und die Zahl ihrer Anwendungsmöglichkeiten wächst ständig.
Beleuchtung von Büroräumen entsprechend DIN 5035-7 - Betätigungsfeld für das Elektrohandwerk
 Beleuchtung von Büroräumen entsprechend DIN 5035-7 - Betätigungsfeld für das Elektrohandwerk Die im August 2004 neu herausgegebene Norm die in Verbindung mit DIN EN 12464-1 als Ersatz für DIN 5035-7:1988-09
Beleuchtung von Büroräumen entsprechend DIN 5035-7 - Betätigungsfeld für das Elektrohandwerk Die im August 2004 neu herausgegebene Norm die in Verbindung mit DIN EN 12464-1 als Ersatz für DIN 5035-7:1988-09
Licht- und Displaytechnik Grundgrößen
 Lichttechnisches Institut Licht- und Displaytechnik Grundgrößen von Karsten Klinger Wintersemester 2008/2009 Inhalt Strahlung Raumwinkel Spektrale Wirkungsfunktionen Lichttechnische Grundgrößen Photometrisches
Lichttechnisches Institut Licht- und Displaytechnik Grundgrößen von Karsten Klinger Wintersemester 2008/2009 Inhalt Strahlung Raumwinkel Spektrale Wirkungsfunktionen Lichttechnische Grundgrößen Photometrisches
Grundlagen der Lichttechnik I
 Grundlagen der Lichttechnik I S. Aydınlı Raum: E 203 Tel.: 314 23489 Technische Universität Berlin Fachgebiet Lichttechnik, Sekr. E6 Einsteinufer 19 10587 Berlin email: sirri.aydinli@tu-berlin.de http://www.li.tu-berlin.de
Grundlagen der Lichttechnik I S. Aydınlı Raum: E 203 Tel.: 314 23489 Technische Universität Berlin Fachgebiet Lichttechnik, Sekr. E6 Einsteinufer 19 10587 Berlin email: sirri.aydinli@tu-berlin.de http://www.li.tu-berlin.de
LED Leuchtmittel kaufen
 LED Leuchtmittel kaufen Was man vorm Kauf eines LED Leuchtmittels wissen sollte! Kein anderes Leuchtmittel, ausgenommen der ersten Glühbirne, hat einen derartigen Boom hinter sich wie die LED. Die möglichen
LED Leuchtmittel kaufen Was man vorm Kauf eines LED Leuchtmittels wissen sollte! Kein anderes Leuchtmittel, ausgenommen der ersten Glühbirne, hat einen derartigen Boom hinter sich wie die LED. Die möglichen
Gestaltgesetze Figur-Grund-Beziehung
 Figur-Grund-Beziehung Die Wahrnehmung unserer Umwelt geschieht nach der Gestaltpsychologie durch die Wahrnehmung von Formen. Nur so kann die unbestimmte Komplexität der Sinneswahrnehmungen aufgelöst und
Figur-Grund-Beziehung Die Wahrnehmung unserer Umwelt geschieht nach der Gestaltpsychologie durch die Wahrnehmung von Formen. Nur so kann die unbestimmte Komplexität der Sinneswahrnehmungen aufgelöst und
Visuell barrierefreie Lösungen in Gebäuden
 20.04.2013 Visuell barrierefreie Lösungen in Gebäuden Winfried Rullof Leiter Immobilienmanagement Nikolauspflege 1 Übersicht 1. Allgemein 2. Kompensationsprinzipien mit Beispielen 3. Literatur 2 1. Allgemein
20.04.2013 Visuell barrierefreie Lösungen in Gebäuden Winfried Rullof Leiter Immobilienmanagement Nikolauspflege 1 Übersicht 1. Allgemein 2. Kompensationsprinzipien mit Beispielen 3. Literatur 2 1. Allgemein
Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis
 5 1 Innenbeleuchtung...11 1.1 Zweck einer Innenbeleuchtung...11 1.2 Sehaufgabe...12 1.3 Sehleistung...12 1.4 Sehkomfort...13 1.5 Sicherheit und Gesundheit...13 Zusammenfassung...14 2 Vorschriften...15
5 1 Innenbeleuchtung...11 1.1 Zweck einer Innenbeleuchtung...11 1.2 Sehaufgabe...12 1.3 Sehleistung...12 1.4 Sehkomfort...13 1.5 Sicherheit und Gesundheit...13 Zusammenfassung...14 2 Vorschriften...15
Elektrischer Strom : Elektrischer Strom ist der gerichtete Fluss freier Ladungsträger. Es wird zwischen Gleich- und Wechselstrom unterschieden.
 Grundbegriffe der Lichttechnik 1 / 5 Glühlampen - Grundbegriffe Lichttechnik ( 2004 - Quelle: Paulmann / Philips / Osram ) Die wichtigsten Grundbegriffe kurz erklärt : Elektrischer Strom : Elektrischer
Grundbegriffe der Lichttechnik 1 / 5 Glühlampen - Grundbegriffe Lichttechnik ( 2004 - Quelle: Paulmann / Philips / Osram ) Die wichtigsten Grundbegriffe kurz erklärt : Elektrischer Strom : Elektrischer
Was ist der Farbwiedergabeindex?
 Was ist der Farbwiedergabeindex? Das Licht bestimmt die Farbe Unter der Farbwiedergabe einer Lichtquelle versteht man deren Eigenschaft, welche Farberscheinung ihr Licht auf Gegenständen bewirkt. Farbwiedergabe
Was ist der Farbwiedergabeindex? Das Licht bestimmt die Farbe Unter der Farbwiedergabe einer Lichtquelle versteht man deren Eigenschaft, welche Farberscheinung ihr Licht auf Gegenständen bewirkt. Farbwiedergabe
Licht und Beleuchtung
 I Hans-Jürgen Hentschel (Hrsg.) Licht und Beleuchtung Grundlagen und Anwendungen der Lichttechnik 5., neu bearbeitete und erweiterte Auflage Unter Mitarbeit von Franz Bernitz, Udo Fischer, Manfred Gröbel,
I Hans-Jürgen Hentschel (Hrsg.) Licht und Beleuchtung Grundlagen und Anwendungen der Lichttechnik 5., neu bearbeitete und erweiterte Auflage Unter Mitarbeit von Franz Bernitz, Udo Fischer, Manfred Gröbel,
Grundlagen der Lichttechnik. DI(FH) Horst Pribitzer MA39 Lichttechniklabor
 Grundlagen der Lichttechnik DI(FH) Horst Pribitzer MA39 Lichttechniklabor Gliederung & Ziele Was ist überhaupt Licht Menschliche Strahlungsmessgerät = AUGE Kenngrößen der Lichttechnik Messtechnik Wertschätzung
Grundlagen der Lichttechnik DI(FH) Horst Pribitzer MA39 Lichttechniklabor Gliederung & Ziele Was ist überhaupt Licht Menschliche Strahlungsmessgerät = AUGE Kenngrößen der Lichttechnik Messtechnik Wertschätzung
Das geht ins Auge. Auf der Netzhaut selbst sind mehrere Rezeptor-Systeme mit unterschiedlichen Funktionen vorhanden.
 Das geht ins Auge Einen Großteil unserer Informationen nehmen wir über unsere Augen auf. Doch nicht nur das Erkennen von Gegenständen oder von Farben ist Aufgabe dieses Sinnesorgans. Auch Gefühle und Empfindungen
Das geht ins Auge Einen Großteil unserer Informationen nehmen wir über unsere Augen auf. Doch nicht nur das Erkennen von Gegenständen oder von Farben ist Aufgabe dieses Sinnesorgans. Auch Gefühle und Empfindungen
ÖNorm EN 12464-1 in der Praxis
 ÖNorm EN 12464-1 in der Praxis ÖNorm EN 12464-1 Überblick Normen Überarbeitung der EN 12464-1 Licht im Büro im Laufe der Zeit Lichteffizienz und Lichtqualität Die wichtigsten EU-Richtlinien - Normen Richtlinie
ÖNorm EN 12464-1 in der Praxis ÖNorm EN 12464-1 Überblick Normen Überarbeitung der EN 12464-1 Licht im Büro im Laufe der Zeit Lichteffizienz und Lichtqualität Die wichtigsten EU-Richtlinien - Normen Richtlinie
Praktische Hinweise zur Umsetzung der EU-Bildschirmrichtlinie
 Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen Praktische Hinweise zur Umsetzung der EU-Bildschirmrichtlinie Seit 1996 gilt die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten.
Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen Praktische Hinweise zur Umsetzung der EU-Bildschirmrichtlinie Seit 1996 gilt die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten.
Blendbewertung aus der Sicht des Lichtplaners Praktische Erfahrungen bei der Messung
 TU Ilmenau Fakultät für Maschinenbau Fachgebiet Lichttechnik Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e. V. Bezirksgruppe Thüringen-Nordhessen Stützpunkt Ilmenau Blendbewertung aus der Sicht des Lichtplaners
TU Ilmenau Fakultät für Maschinenbau Fachgebiet Lichttechnik Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e. V. Bezirksgruppe Thüringen-Nordhessen Stützpunkt Ilmenau Blendbewertung aus der Sicht des Lichtplaners
Lichtplanung: Wie wird eine Lichtplanung gelesen
 Lichtplanung: Wie wird eine Lichtplanung gelesen Die Lichtplanung ist die theoretische Platzierung von Leuchten im Raum. Der Umfang reicht hier von einer schnellen Simulation der Lichtverteilung, bis zur
Lichtplanung: Wie wird eine Lichtplanung gelesen Die Lichtplanung ist die theoretische Platzierung von Leuchten im Raum. Der Umfang reicht hier von einer schnellen Simulation der Lichtverteilung, bis zur
Lichtplanung. Licht & Design
 Wie wird eine gelesen Die ist die theoretische Platzierung von Leuchten im Raum. Der Umfang reicht hier von einer schnellen Simulation der Lichtverteilung im Raum, bis zur kompletten Simulation komplexer
Wie wird eine gelesen Die ist die theoretische Platzierung von Leuchten im Raum. Der Umfang reicht hier von einer schnellen Simulation der Lichtverteilung im Raum, bis zur kompletten Simulation komplexer
Wie du ganz einfach auf LED-Leuchtmittel umsteigst
 Wie du ganz einfach auf LED-Leuchtmittel umsteigst Ein Leitfaden zum Umstieg auf LED macht ihr Witze? Nein, eigentlich nicht. Wir möchten aber gern mit dir die tollen Informationen und Vorteile von LED-
Wie du ganz einfach auf LED-Leuchtmittel umsteigst Ein Leitfaden zum Umstieg auf LED macht ihr Witze? Nein, eigentlich nicht. Wir möchten aber gern mit dir die tollen Informationen und Vorteile von LED-
Beleuchtung für Puten. PRÄSENTIERT von der PAL-BULLERMANN GMBH ÜBER DEM VEHNTEICH 2-26169 MARKHAUSEN
 Beleuchtung für Puten PRÄSENTIERT von der PAL-BULLERMANN GMBH ÜBER DEM VEHNTEICH 2-26169 MARKHAUSEN Lichtfarbe: Die Lichtfarbe ist eine Kenngröße, um Leuchtmittel zu charakterisieren. So werden insbesondere
Beleuchtung für Puten PRÄSENTIERT von der PAL-BULLERMANN GMBH ÜBER DEM VEHNTEICH 2-26169 MARKHAUSEN Lichtfarbe: Die Lichtfarbe ist eine Kenngröße, um Leuchtmittel zu charakterisieren. So werden insbesondere
Effiziente Beleuchtung
 Effiziente Beleuchtung Vom Sinn und Unsinn beim Stromsparen mit Licht + LED - Erleuchtung oder Verblendung Energiekonferenz 15.11.2012, HWKLeipzig, BTZ 04451 Borsdorf, Steinweg 3 Dipl.-Ing. Gunter Winkler
Effiziente Beleuchtung Vom Sinn und Unsinn beim Stromsparen mit Licht + LED - Erleuchtung oder Verblendung Energiekonferenz 15.11.2012, HWKLeipzig, BTZ 04451 Borsdorf, Steinweg 3 Dipl.-Ing. Gunter Winkler
Workshop Werkzeuge der Bildgestaltung und der Komposition.
 Workshop Werkzeuge der Bildgestaltung und der Komposition www.uli-kunz.com Komposition Ein gutes Foto ist ein Foto, auf das man länger als eine Sekunde schaut. - Henri Cartier-Bresson Bildgestaltung Bildgestaltung
Workshop Werkzeuge der Bildgestaltung und der Komposition www.uli-kunz.com Komposition Ein gutes Foto ist ein Foto, auf das man länger als eine Sekunde schaut. - Henri Cartier-Bresson Bildgestaltung Bildgestaltung
Lichtplanungsaspekte beim Bau von Altenheimen / Seniorenwohnungen
 Lichtplanungsaspekte beim Bau von Altenheimen / Seniorenwohnungen Lichtraum2 Lichtplanungsbüro I Progetti d illuminazione Dr. Arch. Gerlinde Schatzer MAS Master of Advanced Studies für Lichtplanung und
Lichtplanungsaspekte beim Bau von Altenheimen / Seniorenwohnungen Lichtraum2 Lichtplanungsbüro I Progetti d illuminazione Dr. Arch. Gerlinde Schatzer MAS Master of Advanced Studies für Lichtplanung und
Bruno Weis. Industriebeleuchtung. Grundlagen, Berechnungen, Werkstoffe, Normen, Vorschriften. Mit 73 Abbildungen und 44 Tabellen.
 Bruno Weis Industriebeleuchtung Grundlagen, Berechnungen, Werkstoffe, Normen, Vorschriften Mit 73 Abbildungen und 44 Tabellen Pflaum Vorwort 9 1 Einleitung 11 2 Grundlagen der Lichttechnik 13 2.1 Größen,
Bruno Weis Industriebeleuchtung Grundlagen, Berechnungen, Werkstoffe, Normen, Vorschriften Mit 73 Abbildungen und 44 Tabellen Pflaum Vorwort 9 1 Einleitung 11 2 Grundlagen der Lichttechnik 13 2.1 Größen,
Photometrie. EPD.06 Photometrie.doc iha Ergonomie / Arbeit + Gesundheit
 1 EPD.06.doc iha Ergonomie / Arbeit + Gesundheit H. Krueger 6. 6.1 Umrechnung physikalischer in photometrische Grössen Physikalische Grössen werden mittels der spektralen Empfindlichkeitskurve des menschlichen
1 EPD.06.doc iha Ergonomie / Arbeit + Gesundheit H. Krueger 6. 6.1 Umrechnung physikalischer in photometrische Grössen Physikalische Grössen werden mittels der spektralen Empfindlichkeitskurve des menschlichen
5. Optische Täuschungen
 5. Hat der Betrachter den Eindruck, es besteht ein Unterschied zwischen dem was er sieht und dem was er vor sich hat, spricht er von einer optischen Täuschung. So stellen optische Täuschungen die Ansicht
5. Hat der Betrachter den Eindruck, es besteht ein Unterschied zwischen dem was er sieht und dem was er vor sich hat, spricht er von einer optischen Täuschung. So stellen optische Täuschungen die Ansicht
... ein kleiner Ausflug in die Physik des Lichts und des Farbempfindens
 Licht Wissen... ein kleiner Ausflug in die Physik des Lichts und des Farbempfindens Inhalt: # 1 Das Farbempfinden # 2 Die Farbtemperatur # 3 Lumen, Candela, Lux 1. Das Farbempfinden: Das Farbempfinden
Licht Wissen... ein kleiner Ausflug in die Physik des Lichts und des Farbempfindens Inhalt: # 1 Das Farbempfinden # 2 Die Farbtemperatur # 3 Lumen, Candela, Lux 1. Das Farbempfinden: Das Farbempfinden
Licht- und Displaytechnik Grundgrößen
 Lichttechnisches Institut Licht- und Displaytechnik Grundgrößen von Karsten Klinger Wintersemester 2007/2008 Administratives Eine Email-Adresse funktioniert nicht Neue Teilnehmer: Bitte Email angeben Erste
Lichttechnisches Institut Licht- und Displaytechnik Grundgrößen von Karsten Klinger Wintersemester 2007/2008 Administratives Eine Email-Adresse funktioniert nicht Neue Teilnehmer: Bitte Email angeben Erste
TAGES- UND KUNSTLICHTOPTIMIERUNG IN KLASSENRÄUMEN
 TAGES- UND KUNSTLICHTOPTIMIERUNG IN KLASSENRÄUMEN Eine Projektarbeit - Seminarreihe Lichtgestaltung Donau-Universität Krems Eva Jacoby Interior Design Forum Building Science 2009 KIND, DU VERDIRBST DIR
TAGES- UND KUNSTLICHTOPTIMIERUNG IN KLASSENRÄUMEN Eine Projektarbeit - Seminarreihe Lichtgestaltung Donau-Universität Krems Eva Jacoby Interior Design Forum Building Science 2009 KIND, DU VERDIRBST DIR
Sehleistung sehbehinderter Menschen in Abhängigkeit von der Beleuchtung
 Tagung Visuelle Kontraste 18.05.2017 Sehleistung sehbehinderter Menschen in Abhängigkeit von der Beleuchtung Ergebnisse aus den Projekten ViDeA und BaLiA Nico Hauck Nico Hauck Seite 1 Nico Hauck 2000 2004
Tagung Visuelle Kontraste 18.05.2017 Sehleistung sehbehinderter Menschen in Abhängigkeit von der Beleuchtung Ergebnisse aus den Projekten ViDeA und BaLiA Nico Hauck Nico Hauck Seite 1 Nico Hauck 2000 2004
Lichttechnische Grundlagen
 1. 1.1 Elektromagnetische Strahlung 1. Die Augenempfindlichkeitskurve. Lichttechnische Grundgrössen.1 Lichtstrom. Lichtstärke..1 C Ebenensystem / Darstellung der Lichtstärkeverteilung.3 Beleuchtungsstärke.4
1. 1.1 Elektromagnetische Strahlung 1. Die Augenempfindlichkeitskurve. Lichttechnische Grundgrössen.1 Lichtstrom. Lichtstärke..1 C Ebenensystem / Darstellung der Lichtstärkeverteilung.3 Beleuchtungsstärke.4
Überprüfung der Beleuchtungsanlage. 1. Ergebnis der durchgeführten Prüfung. 2. Allgemeine Angaben
 1. Ergebnis der durchgeführten Prüfung Die Beleuchtungsanlage o erfüllt die Anforderungen gemäß BGR 131-2 und EN 12464-1 o muss gewartet / gereinigt werden bald o sofort o o muss nachgerüstet / ausgetauscht
1. Ergebnis der durchgeführten Prüfung Die Beleuchtungsanlage o erfüllt die Anforderungen gemäß BGR 131-2 und EN 12464-1 o muss gewartet / gereinigt werden bald o sofort o o muss nachgerüstet / ausgetauscht
Die Spektralfarben des Lichtes
 Die Spektralfarben des Lichtes 1 Farben sind meistens bunt. Es gibt rot, grün, gelb, blau, helldunkles rosarot,... und noch viele mehr. Es gibt vier Grundfarben, die anderen werden zusammengemischt. Wenn
Die Spektralfarben des Lichtes 1 Farben sind meistens bunt. Es gibt rot, grün, gelb, blau, helldunkles rosarot,... und noch viele mehr. Es gibt vier Grundfarben, die anderen werden zusammengemischt. Wenn
Licht für Arbeitsplätze in der Industrie
 Licht für Arbeitsplätze in der Industrie Die DIN EN 12464-1 unterscheidet für Arbeitsplätze den Bereich der Sehaufgabe und den unmittelbaren Umgebungsbereich. Welche Beleuchtungssysteme eingesetzt werden,
Licht für Arbeitsplätze in der Industrie Die DIN EN 12464-1 unterscheidet für Arbeitsplätze den Bereich der Sehaufgabe und den unmittelbaren Umgebungsbereich. Welche Beleuchtungssysteme eingesetzt werden,
Gütemerkmale von Beleuchtungen in der Architektur. VfA-Treff Bezirksgruppe Rhein-Main am 14.Dezember 1999
 Vortrag Gütemerkmale von Beleuchtungen in der Architektur VfA-Treff Bezirksgruppe Rhein-Main am 14.Dezember 1999 Dipl.-Ing. (TU) / Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) Oliver D. Bind Troppauer Straße 11 61440 Oberursel
Vortrag Gütemerkmale von Beleuchtungen in der Architektur VfA-Treff Bezirksgruppe Rhein-Main am 14.Dezember 1999 Dipl.-Ing. (TU) / Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) Oliver D. Bind Troppauer Straße 11 61440 Oberursel
Dr.-Ing. Ahmet Çakir ERGONOMIC Institut, Berlin
 Ergonomische Anforderungen an und Empfehlungen für die Arbeitsumwelt bei Bildschirmarbeit: DIN EN ISO 9241-6 Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen - Neue Regelungen, Neue Konzepte, Neue Lösungen, 5.
Ergonomische Anforderungen an und Empfehlungen für die Arbeitsumwelt bei Bildschirmarbeit: DIN EN ISO 9241-6 Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen - Neue Regelungen, Neue Konzepte, Neue Lösungen, 5.
Thema Farbe 2. Farbwirkungen
 Thema Farbe 2 Farbwirkungen Allgemeine Bezeichnungen für Farbwirkungen Uni: Hier ungerichtet > Grau Bunt: Farben verschiedener Richtungen Reinheiten und Helligkeiten. Farbig: Farben verschiedener Richtungen
Thema Farbe 2 Farbwirkungen Allgemeine Bezeichnungen für Farbwirkungen Uni: Hier ungerichtet > Grau Bunt: Farben verschiedener Richtungen Reinheiten und Helligkeiten. Farbig: Farben verschiedener Richtungen
Die Beleuchtung mit künstlichem Licht
 Die Beleuchtung mit künstlichem Licht Grundlagen der Lichttechnik Die Beleuchtung mit künstlichem Licht Seite 1 Was ist Licht? Sichtbarer Teil der elektromagnetischen Strahlung, die aus schwingenden Energiequanten
Die Beleuchtung mit künstlichem Licht Grundlagen der Lichttechnik Die Beleuchtung mit künstlichem Licht Seite 1 Was ist Licht? Sichtbarer Teil der elektromagnetischen Strahlung, die aus schwingenden Energiequanten
Dirk Zischka. Farbgestaltung
 Farbgestaltung Farbgestaltung Anmerkung: generell Geschmacksfrage, für die es keine verbindliche Regel gibt Ziel: Aufmerksamkeit erzielen Hilfsmittel: Farbe und Form Farbharmonien Farbkontraste Farbklänge
Farbgestaltung Farbgestaltung Anmerkung: generell Geschmacksfrage, für die es keine verbindliche Regel gibt Ziel: Aufmerksamkeit erzielen Hilfsmittel: Farbe und Form Farbharmonien Farbkontraste Farbklänge
Inhaltsverzeichnis. Grundlagen. Warm-up. Lichttechnische LICHT UND LEBEN Darstellung der Verteilung von Beleuchtungsstärken 84
 Dr. phil. Walter Witting (Autor) Bartenbach Lichtgestaltung GmbH (Hg.) Licht. Sehen. Gestalten. Lichttechnische und wahrnehmungspsychologische Grundlagen für Architekten und Lichtdesigner Birkhäuser Basel
Dr. phil. Walter Witting (Autor) Bartenbach Lichtgestaltung GmbH (Hg.) Licht. Sehen. Gestalten. Lichttechnische und wahrnehmungspsychologische Grundlagen für Architekten und Lichtdesigner Birkhäuser Basel
Das Licht macht den Unterschied. LED-Beleuchtung für die Präsentation von Schmuck und Uhren in Vitrinen, Schaufenstern und am Verkaufsplatz
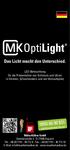 Das Licht macht den Unterschied. LED-Beleuchtung für die Präsentation von Schmuck und Uhren in Vitrinen, Schaufenstern und am Verkaufsplatz 0800 80 90 831 gebührenfreier Anruf MüllerKälber GmbH Daimlerstraße
Das Licht macht den Unterschied. LED-Beleuchtung für die Präsentation von Schmuck und Uhren in Vitrinen, Schaufenstern und am Verkaufsplatz 0800 80 90 831 gebührenfreier Anruf MüllerKälber GmbH Daimlerstraße
Gestaltgesetze der Wahrnehmung. DI (FH) Dr. Alexander Berzler
 DI (FH) Dr. Alexander Berzler Gestaltpsychologie Die Gestaltpsychologie wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts begründet. Die Wahrnehmung unserer Umwelt geschieht nach der Gestaltpsychologie durch die Wahrnehmung
DI (FH) Dr. Alexander Berzler Gestaltpsychologie Die Gestaltpsychologie wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts begründet. Die Wahrnehmung unserer Umwelt geschieht nach der Gestaltpsychologie durch die Wahrnehmung
Farben sind Taten des Lichts (Goethe) Ich heisse sie, zum Xing Treffen, herzlich willkommen April Alexander Demmler Lacunasolutions
 Farben sind Taten des Lichts (Goethe) Ich heisse sie, zum Xing Treffen, herzlich willkommen April 2018. Alexander Demmler Lacunasolutions Tätigkeitsbereiche Hardware Entwicklung Software Entwicklung -
Farben sind Taten des Lichts (Goethe) Ich heisse sie, zum Xing Treffen, herzlich willkommen April 2018. Alexander Demmler Lacunasolutions Tätigkeitsbereiche Hardware Entwicklung Software Entwicklung -
TEIL 13: DIE LINEARE REGRESSION
 TEIL 13: DIE LINEARE REGRESSION Dozent: Dawid Bekalarczyk GLIEDERUNG Dozent: Dawid Bekalarczyk Lineare Regression Grundlagen Prognosen / Schätzungen Verbindung zwischen Prognose und Zusammenhang zwischen
TEIL 13: DIE LINEARE REGRESSION Dozent: Dawid Bekalarczyk GLIEDERUNG Dozent: Dawid Bekalarczyk Lineare Regression Grundlagen Prognosen / Schätzungen Verbindung zwischen Prognose und Zusammenhang zwischen
Eine optimale Beleuchtung für eine Videoüberwachungsanlage setzt die Beachtung der nachfolgend dargestellten Basisinformationen voraus.
 5. Beleuchtung 5.1 Allgemeines Bei gewöhnlichen Kamera-Einsätzen sind die Lichtverhältnisse in aller Regel ausreichend, so dass keine zusätzliche Beleuchtung erforderlich ist. Nachts oder in anderen spezifischen
5. Beleuchtung 5.1 Allgemeines Bei gewöhnlichen Kamera-Einsätzen sind die Lichtverhältnisse in aller Regel ausreichend, so dass keine zusätzliche Beleuchtung erforderlich ist. Nachts oder in anderen spezifischen
Prof. Dr.-Ing. e.h. Klaus Daniels. 5 Lichttechnik
 5 Lichttechnik Maß für die Lichtleistung, die von einer Lichtquelle ausgestrahlt wird. Grundbegriffe Lichtstrom (Lumen) 5-01 Verhältnis von Lichtstrom und elektrischer Leistung einer Lampe. Die Lichtausbeute
5 Lichttechnik Maß für die Lichtleistung, die von einer Lichtquelle ausgestrahlt wird. Grundbegriffe Lichtstrom (Lumen) 5-01 Verhältnis von Lichtstrom und elektrischer Leistung einer Lampe. Die Lichtausbeute
der Straßenbeleuchtung
 Konferenz Effiziente Straßenbeleuchtung" 3. Energie-Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Straßenbeleuchtung Planung + Berechnung von SB-Anlagen mit LED-Technik Methoden zur lichttechnischen und energetischen
Konferenz Effiziente Straßenbeleuchtung" 3. Energie-Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Straßenbeleuchtung Planung + Berechnung von SB-Anlagen mit LED-Technik Methoden zur lichttechnischen und energetischen
Beleuchtungsplanung im Unternehmen Grundlagen
 16.02.2016 e2 Ingenieurgesellschaft mbh, Bremen Ibek GmbH, Bremen Licht ist eine elektromagnetische Strahlung, die für Menschen sichtbar ist Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:spectre.svg
16.02.2016 e2 Ingenieurgesellschaft mbh, Bremen Ibek GmbH, Bremen Licht ist eine elektromagnetische Strahlung, die für Menschen sichtbar ist Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:spectre.svg
TEIL 13: DIE EINFACHE LINEARE REGRESSION
 TEIL 13: DIE EINFACHE LINEARE REGRESSION Die einfache lineare Regression Grundlagen Die einfache lineare Regression ist ebenfalls den bivariaten Verfahren für metrische Daten zuzuordnen 1 Sie hat einen
TEIL 13: DIE EINFACHE LINEARE REGRESSION Die einfache lineare Regression Grundlagen Die einfache lineare Regression ist ebenfalls den bivariaten Verfahren für metrische Daten zuzuordnen 1 Sie hat einen
Alle Menschen sind nicht gleich
 Alle Menschen sind nicht gleich Zur Bedeutung von Mittelwert und Streuung bei psychologischen Untersuchungen in der Lichttechnik Prof. Dr. Bernd Jödicke Martin Merkler Fachhochschule Konstanz Ökolux GmbH
Alle Menschen sind nicht gleich Zur Bedeutung von Mittelwert und Streuung bei psychologischen Untersuchungen in der Lichttechnik Prof. Dr. Bernd Jödicke Martin Merkler Fachhochschule Konstanz Ökolux GmbH
Ajdovic/Mühl Farbmodelle FARBMODELLE
 FARBMODELLE Grundlagen: Gegenstände, die von einer Lichtquelle beleuchtet werden, reflektieren und absorbieren jeweils einen Teil des Lichts. Dabei wird das von den Gegenständen reflektierte Licht vom
FARBMODELLE Grundlagen: Gegenstände, die von einer Lichtquelle beleuchtet werden, reflektieren und absorbieren jeweils einen Teil des Lichts. Dabei wird das von den Gegenständen reflektierte Licht vom
Der neue Stellenwert von Arbeitsplatzleuchten bei der Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen
 Der neue Stellenwert von Arbeitsplatzleuchten bei der Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen Stefan Eiselt Vortrag bei der Konferenz Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen - Neue Regelungen, neue Konzepte,
Der neue Stellenwert von Arbeitsplatzleuchten bei der Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen Stefan Eiselt Vortrag bei der Konferenz Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen - Neue Regelungen, neue Konzepte,
Dynamisches Sport Flutlichtsystem (DSF) mit LED
 Dynamisches Sport Flutlichtsystem (DSF) mit LED 1 LED-Flutlichtsystem für Sportanlagen Serie WSxxx Dieses LED-Flutlichtsystem eignet sich hervorragend Sportplätze, nach der Norm zur Beleuchtung von Sportanlagen
Dynamisches Sport Flutlichtsystem (DSF) mit LED 1 LED-Flutlichtsystem für Sportanlagen Serie WSxxx Dieses LED-Flutlichtsystem eignet sich hervorragend Sportplätze, nach der Norm zur Beleuchtung von Sportanlagen
Indirekte Beleuchtung
 Indirekte Beleuchtung Im Innenraum erfreut sich die als weich empfundene indirekte Beleuchtung großer Beliebtheit. Für verschiedene Sehaufgaben genügt sie jedoch nicht, weshalb in Wohnräumen eine Mischung
Indirekte Beleuchtung Im Innenraum erfreut sich die als weich empfundene indirekte Beleuchtung großer Beliebtheit. Für verschiedene Sehaufgaben genügt sie jedoch nicht, weshalb in Wohnräumen eine Mischung
LUX I Beleuchtungsstärke
 Kompakt-FL-Lampe mit Sockel E27 LUX I Beleuchtungsstärke mit LUX wird die Beleuchtungsstärke des Lichts beschrieben. Das ist der Lichtstrom, der auf einer bestimmten Fläche bei einem Empfänger auftritt.
Kompakt-FL-Lampe mit Sockel E27 LUX I Beleuchtungsstärke mit LUX wird die Beleuchtungsstärke des Lichts beschrieben. Das ist der Lichtstrom, der auf einer bestimmten Fläche bei einem Empfänger auftritt.
Licht.Beleuchtung in seiner schönsten Form.
 Licht.Beleuchtung in seiner schönsten Form. gültig ab 1.2.2014 Licht ist mehr als einfach nur etwas sichtbar machen. Diente künstliches Licht ursprünglich vor allem der Arbeitsplatzbeleuchtung, so soll
Licht.Beleuchtung in seiner schönsten Form. gültig ab 1.2.2014 Licht ist mehr als einfach nur etwas sichtbar machen. Diente künstliches Licht ursprünglich vor allem der Arbeitsplatzbeleuchtung, so soll
Einführung in die Arbeitswissenschaft
 Einführung in die Arbeitswissenschaft Übung zur Lehreinheit 11 Computergestützte Büroarbeit Sommersemester 2016 Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Christopher M. Schlick Lehrstuhl und Institut für Arbeitswissenschaft
Einführung in die Arbeitswissenschaft Übung zur Lehreinheit 11 Computergestützte Büroarbeit Sommersemester 2016 Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Christopher M. Schlick Lehrstuhl und Institut für Arbeitswissenschaft
Das richtige Licht für jeden Moment
 PHILIPS LED Kerzenlampe (dimmbar) 6 W (40 W) E14 WarmGlow dimmbar Das richtige Licht für jeden Moment Philips Kerzen mit einem warm leuchtenden Dimmen bieten ein ganz neues Erlebnis für dimmbare LEDs.
PHILIPS LED Kerzenlampe (dimmbar) 6 W (40 W) E14 WarmGlow dimmbar Das richtige Licht für jeden Moment Philips Kerzen mit einem warm leuchtenden Dimmen bieten ein ganz neues Erlebnis für dimmbare LEDs.
Modul: Labor und Statistik SENSORTECHNIK M.SC.KRUBAJINI KRISHNAPILLAI; PROF.DR.ROBBY ANDERSSON. Lichttechnik
 Modul: Labor und Statistik SENSORTECHNIK M.SC.KRUBAJINI KRISHNAPILLAI; PROF.DR.ROBBY ANDERSSON Lichttechnik Sensortechnik Lichttechnik Inhaltsverzeichnis Einleitung Physikalische Grundlagen Wahrnehmung
Modul: Labor und Statistik SENSORTECHNIK M.SC.KRUBAJINI KRISHNAPILLAI; PROF.DR.ROBBY ANDERSSON Lichttechnik Sensortechnik Lichttechnik Inhaltsverzeichnis Einleitung Physikalische Grundlagen Wahrnehmung
Hocheffiziente Beleuchtungsanlagen
 Hocheffiziente Beleuchtungsanlagen Vergleich von Lichttechnologien LED als Non-Plus-Ultra? Potentiale und Begrenzung der Einsatzmöglichkeiten Fördermöglichkeiten für KMU Referent: Dipl. Ing. Steffen Roß
Hocheffiziente Beleuchtungsanlagen Vergleich von Lichttechnologien LED als Non-Plus-Ultra? Potentiale und Begrenzung der Einsatzmöglichkeiten Fördermöglichkeiten für KMU Referent: Dipl. Ing. Steffen Roß
Klausurtermin: Nächster Klausurtermin: September :15-11:15
 Klausurtermin: 10.02.2017 Gruppe 1: 9:15 11:15 Uhr Gruppe 2: 11:45-13:45 Uhr Nächster Klausurtermin: September 2017 9:15-11:15 Fragen bitte an: Antworten: t.giesen@uni-kassel.de direkt oder im Tutorium
Klausurtermin: 10.02.2017 Gruppe 1: 9:15 11:15 Uhr Gruppe 2: 11:45-13:45 Uhr Nächster Klausurtermin: September 2017 9:15-11:15 Fragen bitte an: Antworten: t.giesen@uni-kassel.de direkt oder im Tutorium
6.3 Beleuchtung in Büroräumen
 6.3 Beleuchtung in Büroräumen S. Neumann, Hamburg 6.3.1 Allgemeine Hinweise Anforderungen zur Gestaltung der Beleuchtung in Arbeitsstätten enthalten die Arbeitsstättenverordnung [1] und die Technische
6.3 Beleuchtung in Büroräumen S. Neumann, Hamburg 6.3.1 Allgemeine Hinweise Anforderungen zur Gestaltung der Beleuchtung in Arbeitsstätten enthalten die Arbeitsstättenverordnung [1] und die Technische
Möglichkeiten und Grenzen beim Einsatz von LED in der Beleuchtungstechnik
 VDI Tagung Innovative Beleuchtung mit LED 17. + 18.11.2003 Gall, D. Möglichkeiten und Grenzen beim Einsatz von LED in der Beleuchtungstechnik Gall, Dietrich Lichttechnik Technische Universität Ilmenau
VDI Tagung Innovative Beleuchtung mit LED 17. + 18.11.2003 Gall, D. Möglichkeiten und Grenzen beim Einsatz von LED in der Beleuchtungstechnik Gall, Dietrich Lichttechnik Technische Universität Ilmenau
Ich möchte Sie daher bitten, diesen Fragebogen vor der Untersuchung bei mir auszufüllen.
 Schwindelfragebogen Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, Schwindel tritt bei einer Vielzahl von Erkrankungen auf. Eine genaue Schilderung der Beschwerden ist wichtig, da die Ursache von Schwindel
Schwindelfragebogen Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, Schwindel tritt bei einer Vielzahl von Erkrankungen auf. Eine genaue Schilderung der Beschwerden ist wichtig, da die Ursache von Schwindel
Die neue Generation der. -Reflektoren. www.megaman.de
 LED Die neue Generation der -Reflektoren www.megaman.de LED Reflektor Serien LED Reflektoren Eine Welt-Premiere Typisch! Die neuen LED-Reflektoren schlagen eine neue Seite der LED-Technologie auf. Mit
LED Die neue Generation der -Reflektoren www.megaman.de LED Reflektor Serien LED Reflektoren Eine Welt-Premiere Typisch! Die neuen LED-Reflektoren schlagen eine neue Seite der LED-Technologie auf. Mit
2.3.2 Gesichtssinn (Sehen) - Beleuchtung/Farbe
 Seite 18 Teil II/Kapitel 2.3.2 II Der Mensch im Arbeitsprozess Arbeitswissenschaft 2.3.2 Gesichtssinn (Sehen) - Beleuchtung/Farbe 1 Die Biologie des Auges 1.1 Das Auge (Abbildung 2) - der lichtempfindliche
Seite 18 Teil II/Kapitel 2.3.2 II Der Mensch im Arbeitsprozess Arbeitswissenschaft 2.3.2 Gesichtssinn (Sehen) - Beleuchtung/Farbe 1 Die Biologie des Auges 1.1 Das Auge (Abbildung 2) - der lichtempfindliche
Licht- und Displaytechnik. Messtechnik
 Lichttechnisches Institut Licht- und Displaytechnik Messtechnik von Karsten Klinger Wintersemester 2008/2009 Inhalt Das Auge Raumwinkelprojektion Vier Grundgrößen Photometrisches Entfernungsgesetz und
Lichttechnisches Institut Licht- und Displaytechnik Messtechnik von Karsten Klinger Wintersemester 2008/2009 Inhalt Das Auge Raumwinkelprojektion Vier Grundgrößen Photometrisches Entfernungsgesetz und
Licht und Gesundheit & Energieeffiziente Leuchtmittel
 Licht und Gesundheit Teil 1 Naturorientierte Lichtplanung heißt, den Menschen als biologisches, lichtgesteuertes Wesen in die Planung mit einzubeziehen! Spektrale Zusammensetzungen verschiedener Lichtquellen
Licht und Gesundheit Teil 1 Naturorientierte Lichtplanung heißt, den Menschen als biologisches, lichtgesteuertes Wesen in die Planung mit einzubeziehen! Spektrale Zusammensetzungen verschiedener Lichtquellen
Die Farben des Lichts oder Das Geheimnis des Regenbogens
 Kurzinformation Lehrkräfte (Sachanalyse) Sachanalyse Das sichtbare Licht, das die Farben unserer Welt erzeugt, hat eine bestimmte Wellenlänge, sodass es unser menschliches Auge sehen kann. Es ist jedoch
Kurzinformation Lehrkräfte (Sachanalyse) Sachanalyse Das sichtbare Licht, das die Farben unserer Welt erzeugt, hat eine bestimmte Wellenlänge, sodass es unser menschliches Auge sehen kann. Es ist jedoch
Optische Technologien im Automobil
 Optische Technologien im Automobil Messtechnik Karsten Klinger Sommersemester 2008 Inhalt Messtechnik für Körperfarben und Reflektoren Einfache Messtechnik Leuchtdichte und Helligkeit Erkennung farbiger
Optische Technologien im Automobil Messtechnik Karsten Klinger Sommersemester 2008 Inhalt Messtechnik für Körperfarben und Reflektoren Einfache Messtechnik Leuchtdichte und Helligkeit Erkennung farbiger
Farbentheorie. Die Wirkung der Farben
 Theorie Teil 2: Die Wirkung von Farben Agenda Teil 2: Die Wirkung der Farben: Relatives Farbensehen Farbentheorie Optische Phänomene Simultankontrast und Sukzessivkontrast Farben und Stimmung Die Wirkung
Theorie Teil 2: Die Wirkung von Farben Agenda Teil 2: Die Wirkung der Farben: Relatives Farbensehen Farbentheorie Optische Phänomene Simultankontrast und Sukzessivkontrast Farben und Stimmung Die Wirkung
Die richtige Beleuchtung- Entscheidender Erfolgsfaktor. Hendrik Schumann
 Die richtige Beleuchtung- Entscheidender Erfolgsfaktor Hendrik Schumann Polytec GmbH 2013 Die richtige Beleuchtung Beleuchtung Objektiv Kamera 2 Die richtige Beleuchtung Qualität der Ausleuchtung x Qualität
Die richtige Beleuchtung- Entscheidender Erfolgsfaktor Hendrik Schumann Polytec GmbH 2013 Die richtige Beleuchtung Beleuchtung Objektiv Kamera 2 Die richtige Beleuchtung Qualität der Ausleuchtung x Qualität
Übungsfragen zur Vorlesung Grundlagen der technischen Optik
 Übungsfragen zur Vorlesung Grundlagen der technischen Optik 1) Welche Näherungen/Vereinfachungen werden beim Übergang zu folgenden optischen Modellen vorgenommen: von der Quantenoptik zur Maxwellschen
Übungsfragen zur Vorlesung Grundlagen der technischen Optik 1) Welche Näherungen/Vereinfachungen werden beim Übergang zu folgenden optischen Modellen vorgenommen: von der Quantenoptik zur Maxwellschen
Sehbehindertengerechte Beleuchtung im Außenbereich. 625.03.2015 Sehbehindertengerechte Beleuchtung 1
 Sehbehindertengerechte Beleuchtung im Außenbereich 625.03.2015 Sehbehindertengerechte Beleuchtung 1 Wodurch entstehen Sehprobleme? Krankheit (vor allem AMD, Diabetes, Glaukom) Vererbung Unfall Alter (ein
Sehbehindertengerechte Beleuchtung im Außenbereich 625.03.2015 Sehbehindertengerechte Beleuchtung 1 Wodurch entstehen Sehprobleme? Krankheit (vor allem AMD, Diabetes, Glaukom) Vererbung Unfall Alter (ein
Tageslichtbeleuchtung in Museen unter qualitativen und konservatorischen Gesichtspunkten
 Tageslichtbeleuchtung in Museen unter qualitativen und konservatorischen Gesichtspunkten Round Table 4 Beleuchtung von Werken der Bildenden Kunst Museum Folkwang, Essen, 21. April 2015 Helmut F.O. Müller,
Tageslichtbeleuchtung in Museen unter qualitativen und konservatorischen Gesichtspunkten Round Table 4 Beleuchtung von Werken der Bildenden Kunst Museum Folkwang, Essen, 21. April 2015 Helmut F.O. Müller,
Lichtberechnung Beispiel Lager
 Die Lichtberechnung erfolgte in Anlehnung an die DIN EN 12464-1, die 150 Lux in den Gängen zwischen den Regalen vorsieht. Die Berechnung basiert auf den Standardvorgaben von Dialux, da viele Parameter
Die Lichtberechnung erfolgte in Anlehnung an die DIN EN 12464-1, die 150 Lux in den Gängen zwischen den Regalen vorsieht. Die Berechnung basiert auf den Standardvorgaben von Dialux, da viele Parameter
Kreative Ideen für Ihr Zuhause
 Kreative Ideen für Ihr Zuhause Persönliches Wärmedämm-Verbundsysteme Wohnqualität von Anfang an Rundum angenehm und gemütlich 1958 von Wilhelm Kauer gegründet, gehört der Malerfachbetrieb Kauer zu einem
Kreative Ideen für Ihr Zuhause Persönliches Wärmedämm-Verbundsysteme Wohnqualität von Anfang an Rundum angenehm und gemütlich 1958 von Wilhelm Kauer gegründet, gehört der Malerfachbetrieb Kauer zu einem
Beleuchtung.
 Beleuchtung www.stadtwerke-emsdetten.de Beleuchtung Wählen Sie den Lampentyp nach dem Bedarf aus. LED Beleuchtung In den letzten Jahren haben LEDs (lichtemittierenden Dioden) große Fortschritte gemacht.
Beleuchtung www.stadtwerke-emsdetten.de Beleuchtung Wählen Sie den Lampentyp nach dem Bedarf aus. LED Beleuchtung In den letzten Jahren haben LEDs (lichtemittierenden Dioden) große Fortschritte gemacht.
MESSUNG UND BEURTEILUNG
 MESSUNG UND BEURTEILUNG SPORTSTÄTTE IM SCHEINWERFERLICHT 12. Oktober 2015 1 DI(FH) Horst PRIBITZER Leitender Referent Lichttechnik Labor Magistratsabteilung 39 - Prüf- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle
MESSUNG UND BEURTEILUNG SPORTSTÄTTE IM SCHEINWERFERLICHT 12. Oktober 2015 1 DI(FH) Horst PRIBITZER Leitender Referent Lichttechnik Labor Magistratsabteilung 39 - Prüf- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle
1.4 Gradient, Divergenz und Rotation
 .4 Gradient, Divergenz und Rotation 5.4 Gradient, Divergenz und Rotation Die Begriffe Gradient, Divergenz und Rotation erfordern die partiellen Ableitung aus Abschnitt.. sowie das Konzept des Differentialoperators.
.4 Gradient, Divergenz und Rotation 5.4 Gradient, Divergenz und Rotation Die Begriffe Gradient, Divergenz und Rotation erfordern die partiellen Ableitung aus Abschnitt.. sowie das Konzept des Differentialoperators.
Farbe und Farbkontraste Roland Bühs. LIS. Bremen
 Sukzessivkontrast Nachbilder entstehen bei der Farbwahrnehmung durch die Anpassung des Auges gegenüber Lichtreizen, was zur Folge hat, dass die Gegenfarbe des ursprünglichen Reizes erscheint. Betrachtet
Sukzessivkontrast Nachbilder entstehen bei der Farbwahrnehmung durch die Anpassung des Auges gegenüber Lichtreizen, was zur Folge hat, dass die Gegenfarbe des ursprünglichen Reizes erscheint. Betrachtet
Ihr ROSSMANN Leuchtmittel. Ihr Leuchtmittel einfach finden Sockelkunde Erklärung der Symbole Leuchtmittel ABC. Finder
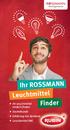 Ihr ROSSMANN Leuchtmittel Ihr Leuchtmittel einfach finden Sockelkunde Erklärung der Symbole Leuchtmittel ABC Finder Leuchtmittel-Kuddelmuddel? Jetzt kommt Licht in die Sache. Früher gab es nur die Glühbirne.
Ihr ROSSMANN Leuchtmittel Ihr Leuchtmittel einfach finden Sockelkunde Erklärung der Symbole Leuchtmittel ABC Finder Leuchtmittel-Kuddelmuddel? Jetzt kommt Licht in die Sache. Früher gab es nur die Glühbirne.
Ausbleichen von Farben in Textilien
 von Farben in Textilien Einflußfaktoren Folgende Faktoren beeinflussen das Ausbleichen von Farben bei Lichteinwirkung: Die Lichttechtheit der Ware Die Beleuchtungsstärke Die Lichtquelle Die Belichtungszeit/Auslagedauer
von Farben in Textilien Einflußfaktoren Folgende Faktoren beeinflussen das Ausbleichen von Farben bei Lichteinwirkung: Die Lichttechtheit der Ware Die Beleuchtungsstärke Die Lichtquelle Die Belichtungszeit/Auslagedauer
