Regionale Struktur- und Einkommenswirkungen der Biogasproduktion in NRW
|
|
|
- Ewald Schäfer
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Forschungsberichte des Fachbereichs Agrarwirtschaft Soest Nr. 24 Regionale Struktur- und Einkommenswirkungen der Biogasproduktion in NRW Prof. Dr. Jürgen Braun Prof. Dr. Wolf Lorleberg Dipl.-Ing. (FH) Heike Wacup
2 Gefördert durch das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 2010 Fachhochschule Südwestfalen Fachbereich Agrarwirtschaft Lübecker Ring Soest Tel: Fax: mail: agrar@fh-swf.de ISBN (Print) ISBN (Download)
3 Abschlussbericht Regionale Struktur- und Einkommenswirkungen der Biogasproduktion in NRW Fachbereich Agrarwirtschaft Soest der Fachhochschule Südwestfalen 2009 Prof. Dr. Jürgen Braun Prof. Dr. Wolf Lorleberg Dipl.-Ing. (FH) Heike Wacup
4
5 Inhaltsverzeichnis I Inhaltsverzeichnis Seite 1 Einleitung Vorbemerkung Zielsetzung Durchführung Untersuchungsregionen und Methodik zur Ableitung der Modellbetriebe Biogasproduktion und ihre politischen Rahmenbedingungen Rahmenbedingungen für den Klimaschutz Internationale Rahmenbedingungen Politische Rahmenbedingungen in Deutschland Politische Rahmenbedingungen in NRW Biomassestrategie des Landes NRW Zielvorgaben der Politik für erneuerbare Energien in Deutschland Entwicklung Erneuerbarer Energien in Deutschland Entwicklung erneuerbarer Energien in NRW Das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) Stand und Entwicklung der Biogasproduktion in Deutschland und NRW Flächennutzung in Deutschland und NRW Bericht zum Projekt 1 Regionale Struktur- und Einkommenswirkungen der Biogasproduktion in Veredlungsregionen Nordrhein-Westfalens Vorbemerkung Einführung zur Gesamtmethodik und zum Modell Gesamtmethodik und Modell Durchführung der einzelbetrieblichen LP-Modellrechnungen Modellergebnisse und Folgerungen Modellrechnung Szenario Modellrechnung Szenario Modellrechnung Szenario Modellrechnungen zu Varianten des Szenario Schlussfolgerungen als Grundlage für weitere Diskussionen... 44
6 II Inhaltsverzeichnis Seite 4 Bericht zum Projekt 2 Regionale Struktur- und Einkommenswirkungen der Biogasproduktion in Grünlandregionen Nordrhein-Westfalens Vorbemerkung Vorgehen und Methodik Vorgehen Methodik der Modellkalkulationen Modellergebnisse und Folgerungen Modellrechnung Szenario EEG Modellrechnung Szenario EEG 04 Wärme Modellrechnung Szenario EEG Modellrechnung Szenario EEG 09 Wärme Schlussfolgerungen Bericht zum Projekt 3 Regionale Struktur- und Einkommenswirkungen der Biogasproduktion in Ackerbauregionen Nordrhein-Westfalens Vorbemerkung Vorgehen und Methodik Vorgehen Methodik der Modellkalkulationen Modellergebnisse und Folgerungen Modellrechnung Szenario EEG 09 Variante Modellrechnung Szenario EEG 09 Variante Modellrechnung Szenario EEG 09 Variante Modellrechnung Szenario EEG 09 Variante 3a Modellrechnung Szenario EEG 09 Variante Modellrechnung Szenario EEG 09 Variante Modellkalkulationen für Anlagenkonzepte zur Aufbereitung und Einspeisung von Biomethan Exkurs: Mögliche indirekte Auswirkungen von Emissionszertifikaten Schlussfolgerungen
7 Inhaltsverzeichnis III Seite Anhang 1 Untersuchungsregionen und Agrarstrukturen Anhang 2 Positionen zur EEG-Novellierung und Ergebnistabellen (Projekt 1)149 Anhang 3 Projekt 1: Schattenpreise Anhang 4 Projekt 2: Ergebnisse Anhang 5 Projekt 3: Ergebnisse
8
9 Abbildungsverzeichnis V Abbildungsverzeichnis Seite Abbildung 1: Bausteine des Energie- und Klimaschutzkonzeptes NRW... 6 Abbildung 2: Entwicklung der Biogasproduktion von 1992 bis Ende 2009 in Deutschland Abbildung 3: Anzahl und regionale Verteilung der Biogasanlagen Deutschlands 12 Abbildung 4: Installierte elektrische Biogasanlagenleistung und das verbliebene Biogaspotenzial auf Basis von tierischen Exkrementen in Deutschland getrennt nach Landkreisen Abbildung 5: Entwicklung der Biogasproduktion von 1981 bis 2007 in NRW Abbildung 6: Entwicklung der Maisanbauflächen zur Biogasnutzung Abbildung 7: Blockschaubild des einzelbetrieblichen LP-Modellansatzes Abbildung 8: Vergleich der drei Szenarien mit den wichtigsten prozentualen Veränderungen für den Kreis Borken Abbildung 9: Vergleich der drei Szenarien mit den wichtigsten prozentualen Veränderungen für den Kreis Steinfurt Abbildung 10: Prozentuale Veränderungen im Kreis Borken Abbildung 11: Prozentuale Veränderungen im Kreis Steinfurt Abbildung 12: Prozentuale Veränderungen im Hochsauerlandkreis Abbildung 13: Prozentuale Veränderungen im Oberbergischen Kreis Abbildung 9: Relative Verteilung wichtiger Parameter auf Landkreisebene im Kreis Düren Abbildung 10: Relative Verteilung wichtiger Parameter auf Landkreisebene im Kreis Neuss
10
11 Tabellenverzeichnis VII Tabellenverzeichnis Seite Tabelle 1: Zielvorgaben Erneuerbare Energien in Deutschland... 7 Tabelle 2: Entwicklung erneuerbarer Energien in Deutschland von 2006 bis Tabelle 3: Entwicklung der erneuerbaren Energien bis Tabelle 4: Entwicklung erneuerbarer Energien in NRW... 9 Tabelle 5: Grundvergütungen für Strom aus Biomasse... 9 Tabelle 6: Boni für Strom aus Biomasse Tabelle 7: Anbauentwicklung nachwachsender Rohstoffe in Deutschland Tabelle 8: Anbauentwicklung nachwachsender Rohstoffe in NRW Tabelle 9: Einzelbetriebliche Auswirkungen durch Aufnahme der Biogasproduktion Tabelle 10: Veränderungen auf Landkreisebene durch Aufnahme der Biogasproduktion Tabelle 11: Einzelbetrieblicher Vergleich mit und ohne Wahrnehmung von Investitionsmöglichkeiten Tabelle 12: Veränderungen auf Landkreisebene durch Wahrnehmung von Investitionsmöglichkeiten im Vergleich zur bestehenden Organisation Tabelle 13: Einzelbetrieblicher Vergleich mit und ohne Wahrnehmung von Investitionsmöglichkeiten bei prognostizierten Preisverhältnissen Tabelle 14: Veränderungen auf Landkreisebene durch Wahrnehmung von Investitionsmöglichkeiten im Vergleich zur bestehenden Organisation bei prognostizierten Preisen von Tabelle 15: Einzelbetrieblicher Vergleich mit und ohne Wahrnehmung von Investitionsmöglichkeiten unter verschiedenen Annahmen bei prognostizierten Preis- und Kostenverhältnissen Tabelle 16: Veränderungen auf Landkreisebene mit und ohne Wahrnehmung von Investitionsmöglichkeiten unter verschiedenen Annahmen bei prognostizierten Preis- und Kostenverhältnissen Tabelle 17: Biogasproduktion in Grünland-Regionen NRWs Tabelle 18: Auswirkungen durch Realisierung von Investitionsmöglichkeiten Szenario EEG Tabelle 19: Veränderungen durch Realisierung von Investitionsmöglichkeiten Szenario EEG Tabelle 20: Auswirkungen durch Realisierung von Investitionsmöglichkeiten Szenario EEG 04 Wärme Tabelle 21: Veränderungen durch Realisierung von Investitionsmöglichkeiten Szenario EEG 04 Wärme
12 VIII Tabellenverzeichnis Tabelle 22: Auswirkungen durch Realisierung von Investitionsmöglichkeiten Szenario EEG Tabelle 23: Veränderungen durch Realisierung von Investitionsmöglichkeiten Szenario EEG Tabelle 24: Auswirkungen durch Realisierung von Investitionsmöglichkeiten Szenario EEG 09 Wärme Tabelle 25: Veränderungen durch Realisierung von Investitionsmöglichkeiten Szenario EEG 09 Wärme Tabelle 26: Biogasproduktion in Ackerbau-Regionen NRWs Tabelle 27: Auswirkungen durch Realisierung von Investitionsmöglichkeiten Tabelle 28: Veränderungen durch Realisierung von Investitionsmöglichkeiten.. 82 Tabelle 29: Auswirkungen durch Realisierung von Investitionsmöglichkeiten Tabelle 30: Veränderungen durch Realisierung von Investitionsmöglichkeiten.. 86 Tabelle 31: Auswirkungen durch Realisierung von Investitionsmöglichkeiten Tabelle 32: Veränderungen durch Realisierung von Investitionsmöglichkeiten.. 90 Tabelle 33: Auswirkungen durch Realisierung von Investitionsmöglichkeiten Tabelle 34: Veränderungen durch Realisierung von Investitionsmöglichkeiten.. 94 Tabelle 35: Auswirkungen durch Realisierung von Investitionsmöglichkeiten Tabelle 36: Veränderungen durch Realisierung von Investitionsmöglichkeiten.. 98 Tabelle 37: Auswirkungen durch Realisierung von Investitionsmöglichkeiten Tabelle 38: Veränderungen durch Realisierung von Investitionsmöglichkeiten 102 Tabelle 39: Abschätzung der Wirtschaftlichkeit der Bioerdgaserzeugung I: Kosten bis ins Erdgasnetz Tabelle 40: Abschätzung der Wirtschaftlichkeit der Bioerdgaserzeugung II: Kosten und Erlöse ab Erdgasnetz für die Verwertungsrichtungen Heizgas und Kraftstoff Tabelle 41: Abschätzung der Wirtschaftlichkeit der Bioerdgaserzeugung III: Kosten und Erlöse ab Erdgasnetz für die Verwertungsrichtung Strom- und Wärmeproduktion in BHKW Tabelle 42: Abschätzung von Grenzpreisen für Silomais nach Vollkosten in der Bioerdgas-Wertschöpfungskette Tabelle 43: CO 2 -Äquiv.-Einsparung durch Substitution von 1 kwh el aus fossilen Energien erzeugtem Strom durch Erneuerbare Energien in g CO 2 -Äquiv./1 kwh el Tabelle 44: Geldwerter Vorteil durch Zertifikateinsparung in Cent/kWh el, wenn anstelle aus fossilen Energien aus Erneuerbaren Energien Strom erzeugt wird Tabelle 45: Geldwerter Vorteil durch Zertifikateinsparung in Cent/kWh el, wenn anstelle aus fossilen Energien aus Erneuerbaren Energien Strom erzeugt wird; Abzinsung auf 4 Jahre ( ) Tabelle 46: CO 2 -Aquiv.-Einsparung durch Substitution von 1 kwh el + 2 kwh th von aus fossilen Energien erzeugtem Strom und Wärme durch Erneuerbare Energien in g CO 2 -Äquiv./(1 kwh el +2 kwh th )
13 Tabellenverzeichnis IX Seite Tabelle 47: Geldwerter Vorteil durch Zertifikateinsparung in Cent/ (1 kwh el + 2 kwh th ), wenn anstelle aus fossilen Energien aus Erneuerbaren Energien Strom und Wärme erzeugt werden Tabelle 48: Geldwerter Vorteil durch Zertifikateinsparung in Cent/kWh el, wenn anstelle aus fossilen Energien aus Erneuerbaren Energien Strom und Wärme erzeugt werden; Abzinsung auf 4 Jahre ( ) Tabelle 49: Tierproduktion auf Landkreisebene im Vergleich zu NRW Tabelle 50: Flächen im Kreis Borken nach Hauptnutzungsarten Tabelle 51: Betriebsformen des Kreises Borken mit den jeweiligen Flächenanteilen Tabelle 52: Biogasproduktion in viehstarken Regionen NRWs Tabelle 53: Viehbestände und Biogasproduktion im Kreis Borken Tabelle 54: Einsatz der Substrate in der Biogasproduktion des Landkreises Borken Tabelle 55: Betriebsformen der Modellbetriebe für den Landkreis Borken Tabelle 56: Flächen im Kreis Steinfurt nach Hauptnutzungsarten Tabelle 57: Betriebsformen des Kreises Steinfurt mit den jeweiligen Flächenanteilen Tabelle 58: Viehbestände und Biogasproduktion im Kreis Steinfurt Tabelle 59: Einsatz der Substrate in der Biogasproduktion des Landkreises Steinfurt Tabelle 60: Modellbetriebe für den Kreis Steinfurt Tabelle 61: Flächen im Hochsauerlandkreis nach Hauptnutzungsarten Tabelle 62: Betriebsformen im Hochsauerlandkreis Tabelle 63: Viehbestände und Biogasproduktion im Hochsauerlandkreis Tabelle 64: Modellbetriebe für den Hochsauerlandkreis Tabelle 65: Flächen im Oberbergischen Kreis nach Hauptnutzungsarten Tabelle 66: Betriebsformen des Oberbergischen Kreises Tabelle 67: Viehbestände und Biogasproduktion im Oberbergischen Kreis Tabelle 68: Modellbetriebe für den Oberbergischen Kreis Tabelle 69: Bodenflächen im Kreis Düren nach Hauptnutzungsarten Tabelle 70: Betriebsformen und Flächenanteile Tabelle 71: Biogasproduktion in Ackerbau-Regionen NRWs Tabelle 72: Viehbestände und Biogasproduktion im Kreis Düren Tabelle 73: Flächen im Rhein-Kreis Neuss nach Hauptnutzungsarten Tabelle 74: Betriebsformen und Flächenanteile im Rhein Kreis Neuss Tabelle 75: Viehbestände und Biogasproduktion im Rhein-Kreis Neuss Tabelle 76 Modellbetriebe der Ackerbauregionen NRW Tabelle 77: Veränderungen auf Landkreisebene durch Wahrnehmung von Investitionsmöglichkeiten im Vergleich zur bestehenden Organisation
14 X Tabellenverzeichnis Seite Tabelle 78: Szenario 08 Wärme+: Einzelbetrieblicher Vergleich mit und ohne Wahrnehmung von Investitionsmöglichkeiten Tabelle 79: Szenario 08 Wärme+: Veränderungen auf Landkreisebene durch Wahrnehmung von Investitionsmöglichkeiten im Vergleich zur bestehenden Organisation Tabelle 80: Szenario 08 KWK+: Einzelbetrieblicher Vergleich mit und ohne Wahrnehmung von Investitionsmöglichkeiten Tabelle 81: Szenario 08 KWK+: Veränderungen auf Landkreisebene durch Wahrnehmung von Investitionsmöglichkeiten im Vergleich zur bestehenden Organisation Tabelle 82: Szenario 08 NWR+: Einzelbetrieblicher Vergleich mit und ohne Wahrnehmung von Investitionsmöglichkeiten Tabelle 83: Szenario 08 Gülle+: Einzelbetrieblicher Vergleich mit und ohne Wahrnehmung von Investitionsmöglichkeiten Tabelle 84: Schattenpreise zu den Szenarien Landkreis Borken Tabelle 85: Schattenpreise zu den Szenarien Landkreis Steinfurt Tabelle 86: Neue und alte Mindestvergütungen für Strom aus Biomasse im Vergleich (Stand Juni 2008) Tabelle 87: Neue und alte Bonuszahlungen für Strom aus Biomasse im Vergleich Tabelle 88: Aktuelle Preisannahmen als Berechnungsgrundlage für die Modellrechnungen -Stand Mai Tabelle 89: Schattenpreise zu den einzelnen Szenarien Tabelle 90: Einzelbetrieblicher Vergleich mit und ohne Wahrnehmung von Investitionsmöglichkeiten unter verschiedenen Annahmen Tabelle 91: Veränderungen auf Landkreisebene mit und ohne Wahrnehmung von Investitionsmöglichkeiten unter verschiedenen Annahmen Tabelle 92: Neue und alte Mindestvergütungen für Strom aus Biomasse im Vergleich (Stand Juni 2008) Tabelle 93: Neue und alte Bonuszahlungen für Strom aus Biomasse im Vergleich Tabelle 94: Aktuelle Preisannahmen als Berechnungsgrundlage für die Modellrechnungen Tabelle 95: Schattenpreise zu den einzelnen Szenarien Tabelle 96: Einzelbetrieblicher Vergleich mit und ohne Wahrnehmung von Investitionsmöglichkeiten unter verschiedenen Annahmen Tabelle 97: Veränderungen auf Landkreisebene mit und ohne Wahrnehmung von Investitionsmöglichkeiten unter verschiedenen Annahmen
15 1.1 Vorbemerkung 1 1 Einleitung 1.1 Vorbemerkung Die weltweit steigende Energienachfrage, vor allem in den Schwellenländern China und Indien, steht einer Verknappung der vorhandenen Ressourcen gegenüber (Staiß 2007 S. I-2). Die erhöhte Nachfrage nach Nahrungsmitteln und Energie bedarf einer Steigerung der Nutzungseffizienz der fossilen Ressourcen bei einem gleichzeitigen Ausbau der Einsparpotenziale dieser Energieformen und der Effizienzsteigerung in der Nahrungsmittelproduktion. Die Industrieländer tragen hier eine große Verantwortung zur Senkung ihres Energieverbrauchs, um aktiven Klimaschutz zu betreiben und darüber hinaus eine höhere Unabhängigkeit im Bezug auf Öl-, Gas-, Kohle- und Uranimporten zu erreichen (BMU, Juni 2008). Vor diesem Hintergrund hat das Bundesumweltministerium neben der Einsparung von Energie und der effizienteren Nutzung der Energieträger die Förderung der erneuerbaren Energien als zentrales Steuerelement zur Reduzierung der Treibhausgase erklärt. Erneuerbare Energien gewinnen immer stärker an Bedeutung und stellen eine wirtschaftlich interessante Alternative zu den fossilen Energieträgern dar. Der Ausbau dieser Branche spiegelt sich in den gestiegenen Beschäftigungszahlen auf dem Arbeitsmarkt wider und hat im Verkehrs- und Wärmesektor erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Novellierung des EEG im Jahr 2004 schuf die Voraussetzung für die Nutzung nachwachsender Rohstoffe zur Verstromung und Wärmeund Gasproduktion. Seit dieser Novellierung und den damit verbundenen Verbesserungen der Vergütung für Strom aus Biomasse ist die Erzeugung von Strom und Wärme aus Biomasse in Deutschland sprunghaft angestiegen. Die Anteile der erneuerbaren Energien am gesamten Endenergieverbrauch betrugen im Jahr 2006 insgesamt 7,5 % und stiegen im Jahr 2007 bereits um 13,3 % auf insgesamt 8,5 % an (BMU 2008 S.3).
16 2 1 Einleitung 1.2 Zielsetzung Ziel des Forschungsvorhabens über alle drei Projekte war die Abschätzung der Strukturwirkungen der kurz- und mittelfristig zu erwartenden Expansion der Biogasproduktion in landwirtschaftlichen Betrieben. Im Einzelnen sollten folgende Aspekte herausgearbeitet werden: Änderungen der Flächennutzung Auswirkungen auf den Bodenmarkt Folgen für das Einkommen landwirtschaftlicher Betriebe Mittelfristige Folgen für die Agrarstruktur Änderungen in der Produktionsstruktur der Betriebe und sich daraus ergebende Konsequenzen für die Rohstoffbereitstellung für die Verarbeitungsindustrie Diskussion politischer Maßnahmen zur Förderung und Lenkung der weiteren Entwicklung. 1.3 Durchführung Die Durchführung gliederte sich in folgende aufeinander aufbauende Phasen: Abgrenzung der Untersuchungsregionen Abschätzung der Folgen durch die Veränderung der Bodennutzungsstruktur - Änderung der Flächennutzung bezogen auf die Nutzungsstruktur und intensität, - Umweltwirkungen aufgrund veränderter betrieblicher und regionaler Nährstoffbilanzen, - Bedarf bzw. Nachfrage nach landwirtschaftlichen Nutzflächen zur Biogasproduktion, - Veränderung der Einkommen der Biogas produzierenden Betriebe durch den Einstieg in diese Produktionsrichtung, - Umfang des Entzugs von Fläche für die Nahrungsmittelproduktion und daraus ableitbare Konkurrenzsituationen im Hinblick auf die Flächennutzung und - Auswirkungen geänderter Produktionsrichtungen auf die Bereitstellung von pflanzlichen und tierischen Produkten zur Weiterverarbeitung. Hochrechnung der einzelbetrieblichen Ergebnisse auf Landesebene und Ergebnisdiskussion.
17 1.4 Untersuchungsregionen und Methodik zur Ableitung der Modellbetriebe Untersuchungsregionen und Methodik zur Ableitung der Modellbetriebe Abhängig von den aktuellen Entwicklungen an den Märkten und in der Förderpolitik der letzten Jahre wurde das Gesamtvorhaben Regionale Struktur- und Einkommenswirkungen der Biogasproduktion in NRW in drei einzelnen Projekten für jeweils einen typischen Hauptproduktionsstandort des Bundeslandes abgearbeitet. Begonnen wurde im August 2006 zunächst mit den Veredelungsregionen in Nordrhein-Westfalen, da dort die Biogasproduktion den größten Umfang bei weiterem dynamischen Wachstum aufwies und sich lokale Flächenkonkurrenzen abzeichneten. Da im Lauf des Jahres 2007 der Ausstieg aus der Milchquotenregelung politisch diskutiert wurde, wurde im zweiten Projekt für die Grünlandregionen Nordrhein-Westfalens unter anderem hinterfragt, inwiefern die Erzeugung von Biogas eine Alternative oder eine Ergänzung zur Milchviehhaltung bietet. Die hohe Dynamik der Getreidepreise in den Jahren 2008 und Anfang 2009, die Novellierung des Erneuerbaren Energien-Gesetzes sowie das Aufkommen der Bioerdgasproduktion bildeten schließlich den Anlass dafür, sich im dritten Projekt speziell den Ackerbauregionen des Bundeslandes zu widmen. Jede Untersuchungsregion wurde mit zwei typischen Landkreisen des Bundeslandes abgebildet, wobei darauf geachtet wurde, dass sie sowohl bereits über Biogasanlagen vor Ort verfügen und mit ihren Agrarstrukturen die jeweiligen Hauptproduktionsschwerpunkte typisch repräsentierten (Daten dazu vgl. Anhang 1). Zur Durchführung der Modellkalkulationen der drei Projekte war es erforderlich, jeweils mehrere typische Betriebe in den untersuchten Landkreisen abzuleiten. Dazu wurden Agrarstatistiken ausgewertet, zahlreiche Gespräche mit Experten der Landwirtschaftskammer NRW zur Erhebung von Daten und zur Plausibilitätsprüfung geführt und Datenlücken mit Normdaten ergänzt. Die formulierten Modellbetriebe wiesen folgende Charakteristika auf: Zukunftsfähige und innovative Betriebe bezüglich ihrer Faktorausstattung und ihres Produktionsniveaus (in etwa oberes Drittel der Betriebe); Abbildung der regionalen Produktionskapazität durch einfache Hochrechnung der Kapazitäten der Einzelmodellbetriebe mit Gewichtungsfaktoren. Die Daten, aus denen die Modellbetriebe abgeleitet wurden und die Daten zu den Modellbetrieben selbst sind in Anhang 1 wiedergegeben.
18 4 2 Biogasproduktion und ihre politischen Rahmenbedingungen 2 Biogasproduktion und ihre politischen Rahmenbedingungen 2.1 Rahmenbedingungen für den Klimaschutz Internationale Rahmenbedingungen Die Nutzung fossiler Energieträger reichert die Atmosphäre mit CO 2 an, zudem ist die Förderung dieser Reserven mit zahlreichen Umweltbelastungen (Flächenverbrauch, Verschmutzung der Weltmeere etc.) verbunden (Marutzky und Seeger 1999 S.6). Die künftige Verfügbarkeit der fossilen Ressourcen hängt von der Entwicklung des Weltenergieverbrauchs und der Nutzungsart der jeweiligen Energieträger ab (Marutzky und Seeger, 1999 S.1). Vor diesem Hintergrund wurde der Klimaschutz über die Klimarahmenkonvention von 1992 auf internationaler Ebene als erste völkerrechtliche Grundlage beschlossen (Staiß 2007 S. I-231). Die Klimarahmenkonvention hat zum Ziel, die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau zu stabilisieren und zu verlangsamen, dass Ökosysteme sich auf diese Veränderungen anpassen können, die Nahrungsmittelproduktion nicht bedroht und die wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig fortgeführt werden kann (Staiß 2007 S. I-231). Das Kyoto-Protokoll von 1997 formuliert erstmalig konkrete Ziele zur Reduktion der Treibhausgase und legt Zeiträume zur Realisierung der Ziele fest (Staiß 2007 S. I- 233). Zur Erreichung der Ziele auf europäischer Ebene hat die EU-Kommission mit verschiedenen Maßnahmen in Form von ECCP I ( ) 1 und darauf aufbauend ECCP II (seit Oktober 2005) reagiert (Staiß 2007 S.I-246). Zu den wichtigsten Zielen gehören der Treibhausgasemissionshandel, die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auf 21 % bis zum Jahr 2010, die Förderung der Biokraftstoffe auf einen Anteil von 5,75 % bis zum Jahr 2010, der Biomasseaktionsplan und die Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung. Darüber hinaus beinhaltet das Paket Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs und der CO 2 -Emissionen und im Bereich der Landwirtschaft u. a. die Förderung umweltfreundlicher Anbaumaßnahmen und Investitionen, sowie die Reduktion der N 2 O-Emissionen Politische Rahmenbedingungen in Deutschland In Deutschland wird der verstärkte Ausbau der gekoppelten Strom- und Wärmebereitstellung auf Biomassebasis durch das im Jahr 2004 novellierte Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) und die Biomasseverordnung (BiomasseV) gefördert. Darüber hinaus verfügt Deutschland über ein umfangreiches Fördersystem für erneuerbare Energien (EE) wie beispielsweise das Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWK-Ge- 1 First European Climate Change Programm
19 2.1 Rahmenbedingungen für den Klimaschutz 5 setz) für Strom und Wärme, das Marktanreizprogramm (Investitionsförderung zur Wärmeerzeugung aus Biomasse, Solarenergie und Geothermie), das Energiesteuer- Gesetz, das Biokraftstoffquotengesetz und obendrein noch übergreifende Maßnahmen in Form der Förderung von F&E, Ökologische Steuerreform, Zertifikatehandel für CO2-Emissionen und Öffentlichkeitsarbeit (DAF 2007 S.26). Im August 2007 wurde mit den Meseberger Entschlüssen ein wichtiger Schritt für den Klimaschutz in Deutschland unternommen. Darüber hinaus wurde zur Positionierung der deutschen Klimaforschung erneut eine deutsche IPPC 2 -Koordinierungsstelle errichtet. Die erstellten Sachstandsberichte dienen als wichtige Grundlage für die UN-Klimarahmenkonvention. Die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHST) genehmigt nach den Regeln des Kyoto-Protokolls diverse Klimaschutzprojekte und stellt somit neben dem Emissionshandel ein wichtiges Klimaschutzinstrument in Deutschland dar. Aus den Erlösen des Emissionshandels finanziert sich die Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums mit einem nationalen und internationalen Teil Politische Rahmenbedingungen in NRW NRW, oft als Energieland Nummer Eins tituliert, zeichnet sich durch einen hohen Energie - und Nahrungsmittelbedarf aus. Mit 18 Mio. Einwohnern steht NRW an der Spitze im bundesweiten Vergleich, das aufgrund der geringeren Flächenkapazität im Vergleich zu anderen Bundesländern spezielle Anforderungen an die Biomasseproduktion stellt. Der Energieverbrauch in NRW wird derzeit noch zum größten Teil durch Nutzung fossiler Brennstoffe und Kernkraft gedeckt. Für die Energieversorgung des Landes NRW wird in der Zukunft ein Energiemix aus fossilen und erneuerbaren Energien angestrebt, der allerdings in der Kombination mit Energievermeidungsstrategien und einer höheren Energieeffizienz verbunden sein wird (BMU 2007 S.13). Zur Umsetzung der Klimaschutzziele entwickelte die Landesregierung das Energieund Klimaschutzkonzept NRW. Die vier Bausteine des Gesamtkonzeptes sehen eine Vielzahl an Maßnahmen zur Einsparung und effizienten Nutzung der Energie vor (siehe Abbildung 1). Als neues Bindeglied zwischen Wissenschaft und Wirtschaft dient die neu strukturierte EnergieAgentur.NRW. Die Biomassestrategie stellt ein wichtiges Instrument zur Umsetzung der Ziele, wie Förderung innovativer Energietechnologien, Bereitstellung von Beratungs- und Qualifizierungsleistungen, dar (MUNLV 2007a, S. 6). Die Landesregierung legt hier besonderen Wert auf die Erschließung weiterer Biomassepotenziale in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Bereich der Energieholzpflanzung. 2 Intergovernmental Panel on Climate Change
20 6 2 Biogasproduktion und ihre politischen Rahmenbedingungen Energie- und Klimaschutzkonzept NRW Energieeffizienz- Offensive NRW spart Energie NRW-Konzept Erneuerbare Energien Biomassestrategie Konzept Energieforschung Strategiefelder: Unternehmen Kommunen Privathaushalte Landesregierung Zielvorgaben definiert im Zwölf-Punkte- Programm Erneuerbare Energien 2020 Handlungsfelder: Biomasseanbau, - mobilisierung und bereitstellung Biomasse zur Wärmeund Stromversorgung Biokraftstoffe Bioenergieforschung Ziele: Steigern der Energieeffizienz Senkung des Energieverbrauchs Abbildung 1: Bausteine des Energie- und Klimaschutzkonzeptes NRW (Quelle: MUNLV 2007a) Biomassestrategie des Landes NRW Vor dem Hintergrund der dezentralen Einsatzmöglichkeiten der erneuerbaren Energien im ländlichen Raum, gekoppelt mit einem besseren Platzangebot für die Lagerung der Biomasse-Festbrennstoffe, soll die Energieversorgung im ländlichen Raum durch geeignete Maßnahmen der Landesregierung neu gestaltet und weiterentwickelt werden. Darüber hinaus werden die umweltgerechte Erzeugung von Energie mit dem Gebot der Nachhaltigkeit und die Vermarktung der Energie aus Biomasse in den Vordergrund gestellt. Die Potenziale der Bioenergie sollen durch geeignete Maßnahmen unterstützt werden, um die Biomasse in der Zukunft effizienter und umweltschonend einsetzen zu können. Ästhetische, ökologische und tierschutzrelevante Aspekte werden bei der Durchführung besonders beachtet. Die dauerhafte Schaffung von Arbeitsplätzen in der Land- und Forstwirtschaft im ländlichen Raum sowie an den Industriestandorten (Anlagenbau etc.) wird ebenfalls als wichtiges Ziel definiert. Die Landesregierung wird in Kooperation mit der EnergieAgentur.NRW die Empfehlungen zu den einzelnen Maßnahmen umsetzen und unter den derzeitigen Rahmenbedingungen für den Sektor Wärme und Strom für das Jahr 2010 eine Verdopplung der Leistungserzeugung erreichen können.
21 2.2 Zielvorgaben der Politik für erneuerbare Energien in Deutschland Zielvorgaben der Politik für erneuerbare Energien in Deutschland Deutschland führt im internationalen Vergleich im Bereich der Erneuerbaren Energien bezogen auf die Leistungsfähigkeit der Unternehmen und der bisher erreichten Umsetzung. Kein anderes Land betreibt so viele Windenergieanlagen wie Deutschland und verfügt über mehr Photovoltaikleistung. Der größte Markt für Biokraftstoffe besteht in Deutschland und die EE-Branche erwirtschaftet bereits zweistellige Milliardenumsätze (Staiß 2007 S.I-263). Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Strombereitstellung wurde im Jahr 2006 mit der Zielvorgabe des Koalitionsvertrages für Deutschland bis 2010 in Höhe von 12,5 % mit 11,8 % schon fast erreicht. Für 2007 wird mit einem Anstieg auf ca. 13 % gerechnet, womit die Zielvorgabe für Deutschland bis 2010 bereits überschritten wird (Erfahrungsbericht EEG 2007, S. 9). Bis zum Jahr 2020 soll dieser Anteil auf 20% ansteigen (vgl. Tabelle 1). Tabelle 1: Zielvorgaben Erneuerbare Energien in Deutschland Erneuerbare Energien Zielvorgabe des Koalitions-Vertrages für Deutschland bis 2010 Zielvorgabe des Koalitions- Vertrages für Deutschland bis 2020 Anteil EE am Primärenergieverbrauch (%) Anteil EE an der Strombereitstellung (%) 4,7 5,3 4, ,4 11,8 12,5 20 Quelle: BMU Pressemitteilung 2007, Tabelle geändert Entwicklung Erneuerbarer Energien in Deutschland Von 1998 bis 2007 stieg der Anteil der EE am Endenergieverbrauch von 3,1 auf 8,6 %, am Primärenergieverbrauch von 2,1 auf 6,7 % im Jahr Dieser geringe Anteil der EE an der Energiebereitstellung trägt allerdings erheblich zur Verringerung der CO 2 Emissionen und damit zum Klimaschutz in Deutschland bei. Im Jahr 2007 wurden rund 115 Mio. Tonnen CO 2 -Äquivalent durch die Nutzung von EE im Bereich Stromerzeugung, Wärmebereitstellung und Biokraftstoffe vermieden (BMU 2008 S.23). Die Zuwachsraten der einzelnen Sparten der EE allein vom Jahr 2006 bis 2007 zeigen die starke Wachstumsdynamik in diesem Sektor auf. Die Windenergie und Photovoltaik heben sich mit ihren Zuwachsraten deutlich ab. Die folgende Tabellen 2 und 3 geben einen Überblick über die aktuelle Situation und die angestrebte zukünftige Entwicklung.
22 8 2 Biogasproduktion und ihre politischen Rahmenbedingungen Tabelle 2: Entwicklung erneuerbarer Energien in Deutschland von 2006 bis 2007 Wasser- Wind- Biomasse Photo- Solar- Geo- kraft energie Voltaik Thermie Thermie (TWh) (TWh) (TWh) (TWh) (TWh) (TWh) Strom 20,0 20,7 30,7 39,5 19,2 23,8 2,2 3,5 - - <0,1 <0,1 Wärme ,8 84, ,3 3,7 1,9 2,3 Kraftstoff 40,4 44,4 Gesamt 20,0 20,7 30,7 39,5 138,4 152,4 2,2 3,5 3,3 3,7 1,9 2,3 Veränderung 2006/2007 (%) + 3,5 + 28,7 + 10,1 + 59,1 + 12,1 + 13,0 Quelle: BMU Pressemitteilung März 2008, Tabelle geändert Tabelle 3: Entwicklung der erneuerbaren Energien bis 2020 Stromerzeugung aus unterschiedlichen Quellen Windenergie (TWh/a) 26,5 39,7 54,4 149 Bioenegie gesamt (TWh/a) 13,6 24,8 30,8 54,3 Davon Biogas (TWh/a) 8,9 12,6 31,2 Davon biogener Abfall (TWh/a) 4,3 4,3 4,3 Davon fest (TWh/a) 7,4 9,5 14,5 Davon flüssig (TWh/a) 2,1 2,3 2,3 Davon Klär-und Deponiegas (TWh/a) 2,1 2,2 2,1 Photovoltaik (TWh/a) 1,3 3,0 6,9 39,5 Wasserkraft(TWh/a) 21,5 20,7 23,1 31,9 Geothermie (TWh/a) 0,0002 0,004 0,2 3,8 Erneuerbare Energien gesamt(twh/a) 63,6 88,0 116,0 278,0 Gesamter Anteil am Bruttostromverbrauch (in %) 10,4 14,2 21,0 47,0 Gesamte installierte Leistung (GW) 27,2 34,9 46,0 111,0 Quelle: Ernährungsdienst 2009 S.9, Tabelle geändert Entwicklung erneuerbarer Energien in NRW Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) steigerte die regenerative Stromerzeugung in NRW um 700 Mio. kwh allein im Jahr Die folgende Tabelle 4 zeigt v. a. die starke Ausprägung der Wärme- und Kraftstoffproduktion aus Biomasse.
23 2.2 Zielvorgaben der Politik für erneuerbare Energien in Deutschland 9 Tabelle 4: Entwicklung erneuerbarer Energien in NRW Wasserkraft Windenergie Biomasse Photo-Voltaik Geo-Thermie (TWh) (TWh) (TWh) (TWh) (TWh) Nutzung 2004 Nutzung 2004 Nutzung 2004 Nutzung 2004 Nutzung 2004 Strom 0,54 2,83 0,58 0,07 - Wärme - - 1,12-0,33 Kraftstoff - - 2, Gesamt 0,54 2,83 4,51 0,07 0,33 Quelle: MUNLV 2007b, Tabellen geändert Das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) Die neue Grundausrichtung der EEG-Novelle mit Gültigkeit ab dem verbessert durch die vorrangige Förderung nachwachsender Rohstoffe die Ausweitung der Rohstoffbasis. Die Grundvergütungen für Strom aus Biomasse wurden für Anlagen bis 150 kw el um einen Cent auch für bestehende Altanlagen angehoben bei einer gleichzeitigen Erweiterung der Stoffnutzungsliste. Die folgenden Tabellen zeigen die novellierten Grundvergütungen und die Veränderungen im Bereich der Boni- Zahlungen für nachwachsende Rohstoffe des EEG-Gesetzentwurfes vom im Vergleich zum EEG 2004 und Tabelle 5: Grundvergütungen für Strom aus Biomasse (Stand Juni 2008) Installierte elektrische Leistung Bis 150 KW Bis 500 KW Bis 5 MW Bis 20 MW (Cent/kWh) (Cent/kWh) (Cent/kWh) (Cent/kWh) EEG ,67 9,18 8,25 7,79 EEG Regierungsentwurf vom EEG 2009 Bundestags-Beschluss vom ,67¹ 9,18 8,25 7,79² 11,67¹ 9,18 8,25 7,79² ¹) auch für Altanlagen ²) wird nur bei Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung gewährt Quelle: BMU Die Veränderungen des NawaRo-Bonus des EEG-Regierungsentwurfes vom zum Vergütungssystem der Bereinigungssitzung von CDU/CSU und SPD vom zeigt die folgende Übersicht.
24 10 2 Biogasproduktion und ihre politischen Rahmenbedingungen Tabelle 6: Boni für Strom aus Biomasse NawaRo-Bonus EEG 2004 EEG Regierungsentwurf vom Aktuelles Vergütungssystem nach Bereinigungssitzung Stand: Leistungsanteil (bis 150 kw el ) Cent/kWh Cent/kWh Cent/kWh Feste Biomasse 6,00 6,00 6,00 Flüssige Biomasse 6,00 6,00 6,00 Gasförmige Biomasse (Biogas) bei überwiegendem Einsatz v. Landschaftspflegematerial Gülle-Bonus Gasförmige Biomasse bei mind. 30% Wirtschaftsdünger-/ Gülleeinsatz 6,00-8,00-7,00 2,00-2,00 4,00 Leistungsanteil (bis 500 kw el ) Feste Biomasse 6,00 6,00 6,00 Flüssige Biomasse 6,00 0,0¹ 0,0¹ Gasförmige Biomasse (Biogas) bei überwiegendem Einsatz v. Landschaftspflegematerial Gülle-Bonus Gasförmige Biomasse bei mind. 30% Wirtschaftsdünger-/ Gülleeinsatz 6,00-8,00-7,00 2, ,00 Leistungsanteil (bis 5 MW el ) Feste Biomasse 4,00 4,00 4,00 Flüssige Biomasse 4,00 0,0¹ 0,0¹ Gasförmige Biomasse 4,00 4,00 4,00 Bei Holzverbrennung (HV) HV aus Kurzumtriebsplantagen und Landschaftspflegematerial 2,50 2,50 2,50 4,00 2,50 4,00 Leistungsanteil (bis 20 MW el ) 0,0 0,0 0,0 KWK-Bonus Bis zu einer Leistung von 20 MW für alle Anlagen gleich hoch 2,00 3,00 3,00 Neuanlagen mit sinnvollem Wärmekonzept Altanlagen, die in ein sinnvolles Wärmekonzept investieren (nach Inkrafttreten des novellierten EEG) Altanlagen, die strengere Anforderungen bezgl. der Wärmenutzung neu erfüllen Altanlagen mit Wärmenutzung, die die neuen Maßgaben nicht erfüllen Technologie-Bonus Technologie-Bonus für innovative Anlagentechnik bis 5 MW el Technologie-Bonus für Gasaufbereitung bis max. 350 Nqm aufbereitetem Biogas/Stunde bis max. 700 Nqm/Std Emissionsminderungsbonus (nur bis einschließlich 500 KW) Degression (%) (auf Grundvergütung und KWK-, NawaRo- und T-Boni) 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00-2,00 2,00 1,00-0,0 1,00 1,5² 1,00 1,00 Quelle: BMU 2008: Tabellen geändert;¹)gilt nur für neue Anlagen ab ; ²)nur auf die Grundvergütung
25 2.3 Stand und Entwicklung der Biogasproduktion in Deutschland und NRW Stand und Entwicklung der Biogasproduktion in Deutschland und NRW Der rasante Anstieg der Anzahl von Biogasanlagen begann in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts mit der garantierten Stromabnahme durch das Stromeinspeisegesetz von Die Zahl der Biogasanlagen vervierfachte sich bis auf Anlagen im Jahr 2000 (Eder und Schulz 2006 S. 14). Die Novellierung des EEG im Jahr 2004 führte zu einem weiteren Anstieg der Biogasanlagen auf ca Anlagen mit einer installierten Leistung von ca MW zum Jahresende 2006 (LWK NRW 2006, siehe Abbildung 2). Die meisten Anlagen (80%) erhalten den NawaRo- Bonus, Kofermentationsanlagen spielen mittlerweile kaum noch eine Rolle. Prognose Ende 2009* Abbildung 2: k.a 617 k.a. 450 k.a. 370 k.a. 274 k.a. 186 k.a. 159 k.a. 139 MW install. elektr. Leistung Entwicklung der Biogasproduktion von 1992 bis Ende 2009 in Deutschland (Quelle: Fachverband Biogas e.v. 2008) Die folgende Abbildung 3 zeigt die Schwerpunkte der Biogasproduktion in Deutschland auf einen Blick. Die Novelle 2004 begünstigte den Bau größerer Anlagen im Leistungsbereich von kw el bzw. von kw el. Diese Größenklassen kommen zu je einem Drittel vor, die Leistungsklasse von kw el macht einen Anteil von ca. 20 % aus, kleinere Anlagen und erheblich größere Anlagen liegen bei nur je 5 % (BMU 2008 S. 7). Der Bau neuer Biogasanlagen stagnierte im Jahre 2007 und 2008 in Deutschland, da der wirtschaftliche Betrieb vieler Anlagen aufgrund der teilweise verdoppelten Substratpreise erschwert wurde. Die erneute Novelle des EEG ab dem verhilft im Bereich der Biogasproduktion viehhaltenden Betrieben über den eingeführten 2680 Anlagenanzahl
26 12 2 Biogasproduktion und ihre politischen Rahmenbedingungen Güllebonus kleine hofnahe Anlagen bis 500 kw el mit einem hohen Gülleanteil erfolgreich betreiben zu können (siehe Kapitel 5.). Ebenfalls positiv zu bewerten ist die um einen Cent gestiegene Grundvergütung, da sich diese auch auf Altanlagen bezieht. Abbildung 3: Anzahl und regionale Verteilung der Biogasanlagen Deutschlands (Quelle: Vogt et al 2008 S. 24) Die Gesamtzahl der Biogasanlagen in Deutschland hat sich auch im Jahr 2008 um 180 Anlagen auf eine Gesamtzahl von Anlagen (Stand August 2008) weiter erhöht (Fachverband Biogas e.v. 2008). Der Fachverband Biogas e. V. geht in seiner Prognose für 2009 unter Berücksichtigung des neuen EEG von insgesamt Biogasanlagen mit einer installierten Leistung von MW für ganz Deutschland aus.
27 2.3 Stand und Entwicklung der Biogasproduktion in Deutschland und NRW 13 Abbildung 4: Installierte elektrische Biogasanlagenleistung und das verbliebene Biogaspotenzial auf Basis von tierischen Exkrementen in Deutschland getrennt nach Landkreisen. (Quelle: Vogt et al S. 338) Ausgehend von dieser installierten Leistung im Jahr 2009 liegt der errechnete Flächenverbrauch der Biogasproduktion bei ha, das entspricht einem Anteil an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche Deutschlands von 3,3 %. Der Flächenbe-
28 14 2 Biogasproduktion und ihre politischen Rahmenbedingungen darf der Biogasproduktion kann mit einer Faustzahl von ha pro 100 kw el angesetzt werden. Mit der Einführung des NawaRo-Bonus über das novellierte EEG im Jahr 2004 änderten sich die verwendeten Substrate in der Biogasproduktion zugunsten der nachwachsenden Rohstoffe. Silomais stellt mit einem Anteil von 80 % die häufigste Substratart dar. Häufig werden ein bis drei Co-Substrate in Form von Getreide und Mais genutzt. Der Masseanteil der Wirtschaftsdünger in Form von Rinder- oder Schweinegülle liegt bei der Hälfte aller Anlagen bei % (BMU 2008, S. 7). Im bundesweiten Vergleich liegt NRW an vierter Stelle nach Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg bezüglich installierter Leistung und Anzahl der Biogasanlagen (Eder und Schulz 2006, S. 15). Die Novellierung des EEG 2004 förderte den Bau der Anlagen in NRW, der im Jahre 2005 den höchsten Zuwachs mit insgesamt 59 Biogasanlagen zur Folge hatte (Dahlhoff 2007). Zum Jahreswechsel 2007 wurden insgesamt 239 Biogasanlagen mit einer installierten elektrischen Gesamtleistung von 79 MW betrieben (LWK NRW 2007). Die folgende Abbildung 5 zeigt die rasante Entwicklung des Anlagenbestandes in NRW bis ,93 29,24 20,97 15,89 11, , , , ,00 69, , , ,71 4 0,57 2 0,49 1 Quelle: LWK NRW 2007 Abbildung 5: inst. el. Leistung (MW) Anzahl Biogasanlagen Entwicklung der Biogasproduktion von 1981 bis 2007 in NRW Die landesweite Verteilung der Anlagen zeigt eine deutliche Konzentration der Anlagendichte im westlichen Münsterland mit den Landkreisen Borken, Steinfurt und Coesfeld. Die durchschnittlich installierte elektrische Leistung je 100 ha beträgt hier
29 2.4 Flächennutzung in Deutschland und NRW 15 8,9 kw, Steinfurt liegt mit 10,75 kw el /100 ha noch darüber (LWK NRW 2007). Der landesweite Durchschnitt liegt bei 4,47 kw el /100 ha. Der Flächenbedarf der Biogasproduktion in NRW kann mit einer Faustzahl von ha pro 100 kw el angesetzt werden (Dahlhoff 2007). In den folgenden Tabellen zur Ermittlung des Flächenbedarfs der Biogasproduktion auf Landkreisebene wurden 35 ha angesetzt. Für die Biogasproduktion in NRW ergibt sich somit ein Flächenbedarf von ha. Die hauptsächliche Substratart stellt der Silomais dar, dicht gefolgt von Gülle, Grünroggen, Getreidekörnern und anderen Kulturpflanzen wie beispielsweise Sudangras. Beim Einsatz der tierischen Substrate führt die Gülle, neben einem mittlerweile vermehrten Einsatz von Hähnchenmist und Hühnertrockenkot (Dahlhoff 2007). 2.4 Flächennutzung in Deutschland und NRW Mit der Novellierung des EEG im Jahre 2004 stieg in Deutschland die Anbaufläche der nachwachsenden Rohstoffe (NawaRo) für die Biogasproduktion stark an. Mit Einführung der Energiepflanzenprämie im Jahr 2004 durch die EU erfolgte auch ein verstärkter Energiepflanzenanbau auf nicht stillgelegten Flächen. Tabelle 7: Anbauentwicklung nachwachsender Rohstoffe in Deutschland Erntejahr Anbau nachwachsender Rohstoffe auf Stilllegungsflächen (ha) Energiepflanzenanbau auf nicht stillgelegten Flächen (ha) k. A k. A k. A Quelle: BLE 2008, alle Flächenangaben gerundet Im Erntejahr 2001 erfolgte der NawaRo-Anbau auf Stilllegungsflächen in NRW insgesamt auf ha, im Jahr 2007 betrug die Anbaufläche bereits ha. Eine noch deutlichere Steigerung konnte der Energiepflanzenanbau auf nicht stillgelegten Flächen verzeichnen. Im Erntejahr 2007 wurden bereits ha für den Energiepflanzenanbau genutzt. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anbauflächen in NRW im Detail.
30 Silomais Stilllegung Silomais mit Energiepflanzenprämie 16 2 Biogasproduktion und ihre politischen Rahmenbedingungen Tabelle 8: Anbauentwicklung nachwachsender Rohstoffe in NRW Erntejahr Anbau nachwachsender Rohstoffe auf Stilllegungsflächen (ha) Energiepflanzenanbau auf nicht stillgelegten Flächen (ha) k.a k.a k.a Quelle: BLE 2008, alle Flächenangaben gerundet Der Anteil der Brach- und Stilllegungsflächen in Deutschland ging von 2007 auf 2008 rapide zurück. Im Jahr 2007 wurden nur noch ca. 2,6 % des gesamten Ackerlandes stillgelegt. Die folgende Abbildung 6 zeigt den Zuwachs und den Rückgang der verschiedenen Kulturen in Deutschland. Gestiegene Getreidepreise ließen den Getreideanbau von 2007 auf 2008 um 7,1 % steigen, der Zuwachs beim Futterbau konzentriert sich auf den Silomaisanbau, der der Erzeugung erneuerbarer Energien und dem Anbau von Futterpflanzen dient. NRW Deutschland NRW Deutschland Tausend ha Abbildung 6: Entwicklung der Maisanbauflächen zur Biogasnutzung (Quelle: DMK 2007, Online-Abruf )
31 3.1 Vorbemerkung 17 3 Bericht zum Projekt 1 Regionale Struktur- und Einkommenswirkungen der Biogasproduktion in Veredlungsregionen Nordrhein-Westfalens 3.1 Vorbemerkung Die hier dargestellten Ergebnisse und Folgerungen fußen auf Variantenrechnungen eines ökonomischen Modells mit praxisnahen Daten typischer und gemessen an ihrer Faktorausstattung als zukunftsfähig einzustufender landwirtschaftlicher Betriebe der Landkreise Borken und Steinfurt mit und ohne bestehende Biogasproduktion. In verschiedenen Szenarien, die jeweils unterschiedliche Preisverhältnisse widerspiegeln, werden Auswirkungen auf Einkommen und Strukturen sowohl auf einzelbetrieblicher Ebene als auch auf Ebene der Landkreise dargestellt. Das Modell ist getestet, auf Plausibilität überprüft und kann flexibel an neue Preis- und Förderbedingungen angepasst werden. Für die anstehende Diskussion zur Novelle des EEG sind Aussagen ableitbar. Das Modell erlaubt aber auch, mögliche Anpassungen des EEG zur Biogas-Förderung in Hinblick auf einzelbetriebliche und regionale Auswirkungen zu simulieren. Dies ist nach Rücksprache mit dem MUNLV im September 2007 geschehen (vgl. Abschnitt 3.3.4). Dabei wurden Anpassungsoptionen des EEG, die aus Sicht des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen von Interesse sein könnten, hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkungen überprüft (vgl. dazu Anhang 1 Positionierungen und Vorschläge zur EEG-Novellierung 2008 ). Um das vorliegende Papier möglichst knapp zu halten, beschränkt sich die Darstellung auf wenige Zahlen und konzentriert sich auf Folgerungen. Für den eiligen Leser wird empfohlen, sich nur auf die Folgerungen zu den einzelnen Szenarien und auf die Schlussfolgerungen zu konzentrieren. Diese stellen keine handfesten Empfehlungen dar, sondern sind als Diskussionsanstoß zu verstehen. Eine umfassende Darstellung und eine ausführliche Diskussion der Ergebnisse erfolgen im Zusammenhang mit dem Bericht des sich an dieses Projekt anschließenden Vorhabens zur Biogasproduktion in Grünlandregionen. Methodische und technische Informationen sind einführend kurz vorangestellt und per Fußnote präzisiert. Zur ausführlichen Dokumentation der Modellerstellung und Formulierung von spezifischen projektrelevanten Sachverhalten ist ein separates Modellbau-Protokoll angefertigt worden.
32 18 3 Regionale Struktur- und Einkommenswirkungen in Veredlungsregionen 3.2 Einführung zur Gesamtmethodik und zum Modell Gesamtmethodik und Modell Der gewählte komparativ-statische Untersuchungsansatz des Forschungsvorhabens Regionale Struktur- und Einkommenswirkungen der Biogasproduktion in NRW ist der angewandten standortorientierten Sektoranalyse zuzuordnen. Vertreterinnen und Vertreter dieser mikroökonomisch fundierten Teildisziplin gehen u.a. davon aus, dass sich unter veränderten (preis-)politischen Rahmenbedingungen agrarsektorale Anpassungsvorgänge bzw. Faktorallokationen als Folge einer Summe von einzelbetrieblichen Reaktionen vollziehen. Entsprechend lassen sich auch Wirkungsanalysen zu veränderten Rahmenbedingungen bzw. neuen (agrar-)politischen Maßnahmen auf der Grundlage des ökonomischen Verhaltens repräsentativer Agrarbetriebe durchführen. Zur Abschätzung regionaler und/oder sektoraler Gesamtauswirkungen wird in diesen Fällen nach einer Analyse der einzelbetrieblichen Reaktionen eine Aggregation auf regionaler/sektoraler Ebene vorgenommen. Die der einzelbetrieblichen Analyse zugrunde liegende Methode der Linearen Programmierung (LP) ist über viele Jahre in einer Vielzahl von agrarökonomischen Publikationen beschrieben und diskutiert worden und gilt als wissenschaftlich hinreichend bekannt. Auf eine tiefer gehende Betrachtung wird deshalb verzichtet bzw. dazu auf die im Modellbau-Protokoll verzeichneten technischen Hinweise verwiesen. Prinzipiell werden bei der Linearen Programmierung, vereinfacht ausgedrückt, einem Modellbetrieb verschiedene Produktionsaktivitäten ( variables ) zur Realisierung angeboten. Diese unterscheiden sich jeweils durch ihre Zielerreichungsbeiträge (z.b. durch ihren Deckungs- oder Gewinnbeitrag oder ihre Produktionskosten) und durch ihre Ansprüche an fixe oder knappe Produktionsfaktoren ( technical coefficients ). Ein mathematischer Algorithmus - der sog. Simplex-Algorithmus - ermittelt dann ausgehend von den Faktorkapazitäten eines Betriebes ( constraints ) Art und Umfang der Produktionsaktivitäten, mit denen der Betrieb einen maximalen Zielfunktionswert erreicht. Es wird somit das unter den angenommenen Konstellationen hinsichtlich der Preise für Produkte und Betriebsmittel, Produktionsfaktoren sowie technischer Verfahrensgestaltung optimale Produktionsprogramm ermittelt. Als Zielfunktionswerte werden im vorliegenden Modell der Deckungs- oder der Gewinnbeitrag angesetzt, je nach dem, ob in einer kurzfristigen Betrachtung nur die variablen Kosten oder in einer mittelfristigen Analyse auch die festen mit Veränderung der Produktionsrichtung verbundenen Kosten der Produktion berücksichtigt werden Durchführung der einzelbetrieblichen LP-Modellrechnungen Die Gestaltung des einzelbetrieblichen LP-Modellansatzes kurz des Biogasmodells - ist in Abbildung 7 im Überblick dargestellt.
33 3.2 Einführung zur Gesamtmethodik und zum Modell 19 AB= Arbeitsblatt; 1) Mehrere Arbeitsblätter je für eine Tierart; 2) Je nach Optimierung in Hinblick auf Deckungsbeitrag oder Gewinnbeitrag Abbildung 7: Blockschaubild des einzelbetrieblichen LP-Modellansatzes
34 20 3 Regionale Struktur- und Einkommenswirkungen in Veredlungsregionen Das Gesamtkonzept, das auf der Grundlage der Software Excel in mehreren Arbeitsblättern formuliert ist, ist solchermaßen gestaltet, dass sich auch ohne Eingriff in die Programmierung bzw. in die mathematische Matrix des Modells wichtige Eingabeparameter wie Strukturdaten und Preise leicht und schnell verändern lassen. Das gleiche gilt sinngemäß auch für die technischen Daten, deren Änderung eine Verwendung des Modells auch für zukünftige Fragestellungen ermöglichen soll. Der Datenfluss im Modell gestaltet sich wie folgt: Zunächst werden im Arbeitsblatt (Abkürzung AB in Abbildung 7) die Strukturdaten des zu analysierenden Modellbetriebs wie Ackerfläche und Grünland, Tierbestände, Arbeitskräfte, Milchkontingent usw. eingegeben. Die maßgeblichen Preise für Zuund Verkäufe von Betriebsmitteln, Produktionsfaktoren und Produkten einschließlich Energie können anschließend in den dafür vorgesehenen Arbeitsblättern eingestellt werden. Technische Daten wie Fütterungsansprüche einzelner Tierarten oder Faktoransprüche einzelner Produktionsverfahren wiederum sind in einer dritten Gruppe von Arbeitsblättern (vgl. Blockschaubild) anpassbar. Sind diese Eingaben alle vorgenommen und auf Richtigkeit überprüft, muss entschieden werden, welche der vielen formulierten Produktionsaktivitäten dem Modellbetrieb zur Realisierung angeboten werden und welche nicht. Dies wird dadurch umgesetzt, dass im so genannten Übergabebereich I der Arbeitsblätter eine Aktivierung oder eine Deaktivierung der fraglichen Produktionsaktivitäten vorgenommen wird (durch Eintrag einer 1 oder einer 0 in die Aktivierungszeile). Die Auswahl der aktivierten Produktionsaktivitäten hat nach Standort-, Struktur- und Plausibilitätsgesichtspunkten zu erfolgen. Nach der Aktivierung vollzieht sich der weitere Datenfluss zur Aufstellung des einzelbetrieblichen Gesamtmodells (bzw. der kompletten mathematischen Matrix) von selbst es kann unmittelbar der Rechenlauf mit dem Excel-Modul zur Linearen Programmierung ( Excel-Solver ) gestartet werden 3. Die Ergebnis-Arbeitsblätter, die der Excel-Solver anlegt, enthalten Deckungs- oder Gewinnbeitrag als Zielerreichungsgröße sowie die deckungs- oder gewinnbeitragsoptimale Betriebsorganisation d. h. es wird angegeben, welche Aktivitäten (Produktion, Investition, Bezug und Absatz sowie Transfer) wie oft (also in welchem Umfang) in diesem Fall realisiert werden und welche Faktoransprüche dazu bestehen. Darüber hinaus lassen sich so genannte Schattenpreise ermitteln. Ein Schattenpreis ist der Maximalpreis, zu dem der Einsatz einer zusätzlichen Einheit eines knappen Produktionsfaktors gerade noch wirtschaftlich, d.h. gewinnneutral wäre er entspricht damit im Prinzip der maximalen Zahlungsbereitschaft und gibt Aufschluss über den Knappheitsgrad eines Produktionsfaktors. Für die Berechnung möglicher Auswirkungen auf Landkreisebene werden die einzelbetrieblichen Modellergebnisse mit Hilfe von aus Statistikquellen abgeleiteten Gewichtungsfaktoren, die sicherstellen, dass sowohl die landwirtschaftlich genutzte Flä- 3 Weitere technische Details sind im Modellbauprotokoll aufgeführt.
Biomasse und Biogas in NRW
 Biomasse und Biogas in NRW Herbsttagung der Landwirtschaftskammer NRW Veredelung und Futterbau im Wettbewerb zu Biogas Martin Hannen Referat Pflanzenproduktion, Gartenbau Gliederung 1. Stand der Biomasse-
Biomasse und Biogas in NRW Herbsttagung der Landwirtschaftskammer NRW Veredelung und Futterbau im Wettbewerb zu Biogas Martin Hannen Referat Pflanzenproduktion, Gartenbau Gliederung 1. Stand der Biomasse-
Auf dem Weg zum 40 %-Klimaziel: Mehr Wind an Land und Photovoltaik - warum die Deckelung keine Kosten spart
 Auf dem Weg zum 40 %-Klimaziel: Mehr Wind an Land und Photovoltaik - warum die Deckelung keine Kosten spart Herausgeber/Institute: EnKliP Autoren: Uwe Nestle Themenbereiche: Schlagwörter: Strompreis, Windenergie,
Auf dem Weg zum 40 %-Klimaziel: Mehr Wind an Land und Photovoltaik - warum die Deckelung keine Kosten spart Herausgeber/Institute: EnKliP Autoren: Uwe Nestle Themenbereiche: Schlagwörter: Strompreis, Windenergie,
Biomasseanbau in Brandenburg - Wandel der Landnutzung
 Biomasseanbau in Brandenburg - Wandel der Landnutzung Dr. Günther Hälsig Zielstellungen zum Biomasseanbau Ziele der EU bis 2020 20 Prozent erneuerbare Energien am Gesamtenergieverbrauch 20 Prozent Reduzierung
Biomasseanbau in Brandenburg - Wandel der Landnutzung Dr. Günther Hälsig Zielstellungen zum Biomasseanbau Ziele der EU bis 2020 20 Prozent erneuerbare Energien am Gesamtenergieverbrauch 20 Prozent Reduzierung
Biomassenutzung in Brandenburg Wohin geht die Reise?
 Biomassenutzung in Brandenburg Wohin geht die Reise? Sabine Blossey 7. Infoveranstaltung Tag des Bodens 25.11.2009 Prenzlau Energiestrategie 2020 Land Brandenburg Ausbauziel EE PJ 140,00 120,00 Stand 2004
Biomassenutzung in Brandenburg Wohin geht die Reise? Sabine Blossey 7. Infoveranstaltung Tag des Bodens 25.11.2009 Prenzlau Energiestrategie 2020 Land Brandenburg Ausbauziel EE PJ 140,00 120,00 Stand 2004
Auswirkungen der EEG-Novelle auf die Biogasbranche
 Auswirkungen der EEG-Novelle auf die Biogasbranche Bastian Olzem, Hauptstadtbüro Fachgespräch: EEG und Klimaschutz Biomasse, Solar und Geothermie 7. Mai 008, Berlin Gliederung 1 Einleitung Eckpunkte EEG
Auswirkungen der EEG-Novelle auf die Biogasbranche Bastian Olzem, Hauptstadtbüro Fachgespräch: EEG und Klimaschutz Biomasse, Solar und Geothermie 7. Mai 008, Berlin Gliederung 1 Einleitung Eckpunkte EEG
Erneuerbare Energien 2012. Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat)
 Erneuerbare Energien 2012 Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) Die Energiewende nimmt an Fahrt auf Auch im Jahr 2012 ist der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch
Erneuerbare Energien 2012 Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) Die Energiewende nimmt an Fahrt auf Auch im Jahr 2012 ist der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch
Erneuerbare Energien in Deutschland auf einen Blick
 Energy Erneuerbare Energien in Deutschland auf einen Blick 16. Oktober 2012 in Budapest, Ungarn Antje Kramer, eclareon GmbH Management Consultants on behalf of the German Federal Ministry of Economics
Energy Erneuerbare Energien in Deutschland auf einen Blick 16. Oktober 2012 in Budapest, Ungarn Antje Kramer, eclareon GmbH Management Consultants on behalf of the German Federal Ministry of Economics
pressedienst AG Energiebilanzen mit Jahresprognose / Langer Winter steigert Energienachfrage / Erneuerbare wachsen weiter
 Energieverbrauch steigt moderat AG Energiebilanzen mit Jahresprognose / Langer Winter steigert Energienachfrage / Erneuerbare wachsen weiter Berlin/Köln (18.12.2013) - Der Energieverbrauch in Deutschland
Energieverbrauch steigt moderat AG Energiebilanzen mit Jahresprognose / Langer Winter steigert Energienachfrage / Erneuerbare wachsen weiter Berlin/Köln (18.12.2013) - Der Energieverbrauch in Deutschland
BEE. Weltenergiebedarf. (vereinfachte Darstellung nach Shell, Szenario Nachhaltiges Wachstum ) 1500 Exajoules erneuerbare Energien
 15 Exajoules erneuerbare Energien 1 5 Energie aus Kernkraft Energie aus fossilen Brennstoffen davon Erdöl 19 192 194 196 198 2 22 24 26 exa=118 1 Exajoule=34,12 Mio t SKE Weltenergiebedarf 225 23 (vereinfachte
15 Exajoules erneuerbare Energien 1 5 Energie aus Kernkraft Energie aus fossilen Brennstoffen davon Erdöl 19 192 194 196 198 2 22 24 26 exa=118 1 Exajoule=34,12 Mio t SKE Weltenergiebedarf 225 23 (vereinfachte
Biogasproduktion in NRW Struktur- und Einkommenswirkungen
 Biogasproduktion in NRW Struktur- und Einkommenswirkungen Prof. Dr. Jürgen Braun Prof. Dr. Wolf Lorleberg Konferenz Biomassestrategie NRW Soest 25.06.08 Forschungsprojekte Einkommens- und Strukturwirkungen
Biogasproduktion in NRW Struktur- und Einkommenswirkungen Prof. Dr. Jürgen Braun Prof. Dr. Wolf Lorleberg Konferenz Biomassestrategie NRW Soest 25.06.08 Forschungsprojekte Einkommens- und Strukturwirkungen
Biogasanlagen in Rheinland-Pfalz 2007
 Biogasanlagen in Rheinland-Pfalz 2007 Ergebnisse einer Umfrage Inhalt - Biogas in Deutschland - Biogaserhebung 2007 in Rheinland-Pfalz - Aussichten Stand der Biogaserzeugung in Deutschland Verteilung der
Biogasanlagen in Rheinland-Pfalz 2007 Ergebnisse einer Umfrage Inhalt - Biogas in Deutschland - Biogaserhebung 2007 in Rheinland-Pfalz - Aussichten Stand der Biogaserzeugung in Deutschland Verteilung der
Arbeitspapier. Arbeitspapier: Wissenschaftliche Zuarbeit zur Ausweisung von Effizienz- und Energieeinsparzielen aus den Szenarien des Klimaschutzplans
 Arbeitspapier: Wissenschaftliche Zuarbeit zur Ausweisung von Effizienz- und Energieeinsparzielen aus den Szenarien des Klimaschutzplans Wuppertal, 23.01.2015 Prof. Dr. Manfred Fischedick Christoph Zeiss
Arbeitspapier: Wissenschaftliche Zuarbeit zur Ausweisung von Effizienz- und Energieeinsparzielen aus den Szenarien des Klimaschutzplans Wuppertal, 23.01.2015 Prof. Dr. Manfred Fischedick Christoph Zeiss
Erneuerbare Energien 2015
 Die Energiewende ein gutes Stück Arbeit Erneuerbare Energien 2015 Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statisik (AGEE-Stat) Erneuerbare Energien decken fast ein Drittel des Stromverbrauchs Das
Die Energiewende ein gutes Stück Arbeit Erneuerbare Energien 2015 Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statisik (AGEE-Stat) Erneuerbare Energien decken fast ein Drittel des Stromverbrauchs Das
Das folgende Kapitel soll dabei als kurze Standortbestimmung für Deutschland dienen.
 B. Erneuerbare Energien Erster Teil - Wirtschaftliche und technische Rahmenbedingungen. Vorbemerkung zu den Erneuerbaren Energien Die Energiewende für Deutschland gilt als beschlossen. Allerdings wird
B. Erneuerbare Energien Erster Teil - Wirtschaftliche und technische Rahmenbedingungen. Vorbemerkung zu den Erneuerbaren Energien Die Energiewende für Deutschland gilt als beschlossen. Allerdings wird
Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Pulheim
 Zwischenbericht Kurzfassung 2017 Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Pulheim Tippkötter, Reiner; Methler, Annabell infas enermetric Consulting GmbH 14.02.2017 1. Einleitung Der vorliegende Bericht
Zwischenbericht Kurzfassung 2017 Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Pulheim Tippkötter, Reiner; Methler, Annabell infas enermetric Consulting GmbH 14.02.2017 1. Einleitung Der vorliegende Bericht
Biogaserzeugung in Veredlungsregionen in NRW Struktur- und Einkommenswirkungen
 Biogaserzeugung in Veredlungsregionen in NRW Struktur- und Einkommenswirkungen Prof. Dr. Jürgen Braun Prof. Dr. Wolf Lorleberg Biogas- und Veredlungsproduktion: Wechselwirkungen Forschungsprojekt: Einkommens-
Biogaserzeugung in Veredlungsregionen in NRW Struktur- und Einkommenswirkungen Prof. Dr. Jürgen Braun Prof. Dr. Wolf Lorleberg Biogas- und Veredlungsproduktion: Wechselwirkungen Forschungsprojekt: Einkommens-
Erneuerbare Energien Durchschnittliche Wachstumsrate der Primärenergie-Versorgung* pro Jahr in Prozent, nach Energieträgern, 25,1
 Erneuerbare Energien Durchschnittliche Wachstumsrate der Primärenergie-Versorgung* pro Jahr in Prozent, nach Energieträgern, Durchschnittliche Wachstumsrate der Primärenergie-Versorgung* pro Jahr in Prozent,
Erneuerbare Energien Durchschnittliche Wachstumsrate der Primärenergie-Versorgung* pro Jahr in Prozent, nach Energieträgern, Durchschnittliche Wachstumsrate der Primärenergie-Versorgung* pro Jahr in Prozent,
Vorläufiger Bericht zum Projekt. Regionale Struktur- und Einkommenswirkungen der Biogasproduktion in NRW
 Vorläufiger Bericht zum Projekt Regionale Struktur- und Einkommenswirkungen der Biogasproduktion in NRW Fachbereich Agrarwirtschaft Soest der Fachhochschule Südwestfalen Oktober 2007 Prof. Dr. Jürgen Braun
Vorläufiger Bericht zum Projekt Regionale Struktur- und Einkommenswirkungen der Biogasproduktion in NRW Fachbereich Agrarwirtschaft Soest der Fachhochschule Südwestfalen Oktober 2007 Prof. Dr. Jürgen Braun
Entwicklung der Stromerzeugung aus Bioenergie in Niedersachsen ab 2015
 Entwicklung der Stromerzeugung aus Bioenergie in Niedersachsen ab 2015 Dipl.-Ing. Michael Kralemann 3N-Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe Tel. 0551/ 30738-18, kralemann@3-n.info
Entwicklung der Stromerzeugung aus Bioenergie in Niedersachsen ab 2015 Dipl.-Ing. Michael Kralemann 3N-Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe Tel. 0551/ 30738-18, kralemann@3-n.info
Langfristige Strategien und Ziele in Deutschland und EU im Bereich Bioenergie - insbesondere Biogas. Ulrich Schmack, Vorstand Schmack Biogas AG
 Langfristige Strategien und Ziele in Deutschland und EU im Bereich Bioenergie - insbesondere Biogas Ulrich Schmack, Vorstand Schmack Biogas AG Energiemarkt Ausgangssituation globaler Energiemarkt Weltweit
Langfristige Strategien und Ziele in Deutschland und EU im Bereich Bioenergie - insbesondere Biogas Ulrich Schmack, Vorstand Schmack Biogas AG Energiemarkt Ausgangssituation globaler Energiemarkt Weltweit
Energiewende Quo Vadis?
 Energiewende Quo Vadis? Energiegenossenschaft Bad Laasphe 10.06.2015 08.06.2015 1 Dipl.-Ing. (FH) Hans Hermann Freischlad Seit 37 Jahren selbstständiger Ingenieur, davon 33 Jahre im Bereich der Technischen
Energiewende Quo Vadis? Energiegenossenschaft Bad Laasphe 10.06.2015 08.06.2015 1 Dipl.-Ing. (FH) Hans Hermann Freischlad Seit 37 Jahren selbstständiger Ingenieur, davon 33 Jahre im Bereich der Technischen
Bioenergie im deutschen Nationalen Aktionsplan für erneuerbare Energie
 Bioenergie im deutschen Nationalen Aktionsplan für erneuerbare Energie Nicolas Oetzel Referat KI III 1 Allgemeine und grundsätzliche Angelegenheiten der Erneuerbaren Energien 21. Januar 2011 Anteil erneuerbarer
Bioenergie im deutschen Nationalen Aktionsplan für erneuerbare Energie Nicolas Oetzel Referat KI III 1 Allgemeine und grundsätzliche Angelegenheiten der Erneuerbaren Energien 21. Januar 2011 Anteil erneuerbarer
Biogas und Biomethan. Wichtige Treiber der Energiewende in Niedersachsen. DENA Veranstaltung Biomethan: Der Dialog in Hannover. Dr. Gerd Carsten Höher
 Biogas und Biomethan Wichtige Treiber der Energiewende in Niedersachsen DENA Veranstaltung Biomethan: Der Dialog in Hannover Dr. Gerd Carsten Höher 1 Erneuerbare Energien und Energiewende in Deutschland
Biogas und Biomethan Wichtige Treiber der Energiewende in Niedersachsen DENA Veranstaltung Biomethan: Der Dialog in Hannover Dr. Gerd Carsten Höher 1 Erneuerbare Energien und Energiewende in Deutschland
AG Biomasse: Biogaseinspeisung
 AG Biomasse: Biogaseinspeisung Grundlagen der Biogaseinspeisung und Perspektiven für NRW aus Sicht der Landwirtschaft Detmold, 13.04.2010 Dr. Arne Dahlhoff Biogasanlagen in NRW Anzahl inst. el. Leistung
AG Biomasse: Biogaseinspeisung Grundlagen der Biogaseinspeisung und Perspektiven für NRW aus Sicht der Landwirtschaft Detmold, 13.04.2010 Dr. Arne Dahlhoff Biogasanlagen in NRW Anzahl inst. el. Leistung
Erneuerbare Energien 2017
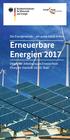 Die Energiewende ein gutes Stück Arbeit Erneuerbare Energien 2017 Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) Bedeutung der erneuerbaren Energien im Strommix steigt Im Jahr 2017
Die Energiewende ein gutes Stück Arbeit Erneuerbare Energien 2017 Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) Bedeutung der erneuerbaren Energien im Strommix steigt Im Jahr 2017
Erneuerbare Energien: Entwicklung, aktueller Stand & Herausforderungen. Vortrag Prof. Dr.-Ing. habil. Stefan Krauter 1
 Erneuerbare Energien: Entwicklung, aktueller Stand & Herausforderungen 1 Anteile erneuerbarer Energien am Energieverbrauch in den Bereichen Strom, Wärme und Kraftstoffe in den Jahren 2011 und 2012 25 Wasserkraft
Erneuerbare Energien: Entwicklung, aktueller Stand & Herausforderungen 1 Anteile erneuerbarer Energien am Energieverbrauch in den Bereichen Strom, Wärme und Kraftstoffe in den Jahren 2011 und 2012 25 Wasserkraft
Regionales Energie- und Klimakonzept 2016
 Regionales Energie- und Klimakonzept 2016 REKLIS Weiterentwicklung regionale Energie- und Klimaschutzstrategie VRS Energiebilanz und Ist-Stand erneuerbare Energien Anlage 3 zur Sitzungsvorlage 127/2017
Regionales Energie- und Klimakonzept 2016 REKLIS Weiterentwicklung regionale Energie- und Klimaschutzstrategie VRS Energiebilanz und Ist-Stand erneuerbare Energien Anlage 3 zur Sitzungsvorlage 127/2017
Übersicht über die EEG-Vergütungsregelungen für 2009 gemäß Bundestagsbeschluss zum EEG Vergütung ct/ kwh
 Übersicht über die EEG-Vergütungsregelungen für 2009 gemäß Bundestagsbeschluss zum EEG Die folgenden Tabellen geben einen beispielhaften Überblick für Vergütungen und Degressionen für Anlagen, die im Jahr
Übersicht über die EEG-Vergütungsregelungen für 2009 gemäß Bundestagsbeschluss zum EEG Die folgenden Tabellen geben einen beispielhaften Überblick für Vergütungen und Degressionen für Anlagen, die im Jahr
Optimierung der Ausrichtung eines strategischen Geschäftsfeldes auf Basis einer Potentialanalyse für den Markt von Biogasanlagen in Deutschland
 Wirtschaft Caroline Wermeling Optimierung der Ausrichtung eines strategischen Geschäftsfeldes auf Basis einer Potentialanalyse für den Markt von Biogasanlagen in Deutschland Diplomarbeit Fachbereich Wirtschaft
Wirtschaft Caroline Wermeling Optimierung der Ausrichtung eines strategischen Geschäftsfeldes auf Basis einer Potentialanalyse für den Markt von Biogasanlagen in Deutschland Diplomarbeit Fachbereich Wirtschaft
Zielsetzung bis 2020 für die Windenergieentwicklung in Nordrhein-Westfalen und Bedeutung dieser Ziele für den Windenergieausbau
 Kurzstellungnahme Zielsetzung bis 2020 für die Windenergieentwicklung in Nordrhein-Westfalen und Bedeutung dieser Ziele für den Windenergieausbau Februar 2011 Im Auftrag: Ministerium für Klimaschutz, Umwelt,
Kurzstellungnahme Zielsetzung bis 2020 für die Windenergieentwicklung in Nordrhein-Westfalen und Bedeutung dieser Ziele für den Windenergieausbau Februar 2011 Im Auftrag: Ministerium für Klimaschutz, Umwelt,
Voraussichtliche Auswirkungen der geplanten EEG-Novellierung auf die Entwicklung der Regenerativen Energien aus systemwissenschaftlicher Sicht.
 Voraussichtliche Auswirkungen der geplanten EEG-Novellierung auf die Entwicklung der Regenerativen Energien aus systemwissenschaftlicher Sicht. 4. Solartagung Umwelt-Campus Birkenfeld 11. 9. 2008 Dr.-Ing.
Voraussichtliche Auswirkungen der geplanten EEG-Novellierung auf die Entwicklung der Regenerativen Energien aus systemwissenschaftlicher Sicht. 4. Solartagung Umwelt-Campus Birkenfeld 11. 9. 2008 Dr.-Ing.
Energieland Hessen. 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen bis zum Jahr Utopie oder reale Vision?
 Energieland Hessen 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen bis zum Jahr 2025 Utopie oder reale Vision? Hessen heute: Abhängig von Importen Strombedarf in Hessen 2005: ca. 35 TWh (Eigenstromerzeugung
Energieland Hessen 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen bis zum Jahr 2025 Utopie oder reale Vision? Hessen heute: Abhängig von Importen Strombedarf in Hessen 2005: ca. 35 TWh (Eigenstromerzeugung
Drei Szenarien: RWE 18/017 gkl Seite 1
 Drei Szenarien: New Policies (NP) Zeigt auf, wie sich das Energiesystem bei Zugrundelegung der aktuellen Politik und der bis August 2018 angekündigten Pläne entwickeln könnte. Current Policies (CP) Geht
Drei Szenarien: New Policies (NP) Zeigt auf, wie sich das Energiesystem bei Zugrundelegung der aktuellen Politik und der bis August 2018 angekündigten Pläne entwickeln könnte. Current Policies (CP) Geht
Technologische Entwicklungen und Herausforderungen im Feld der regenerativen Energien
 Technologische Entwicklungen und Herausforderungen im Feld der regenerativen Energien Prof. Dr. Frank Behrendt Technische Universität Berlin Institut für Energietechnik Baltisch-Deutsches Hochschulkontor
Technologische Entwicklungen und Herausforderungen im Feld der regenerativen Energien Prof. Dr. Frank Behrendt Technische Universität Berlin Institut für Energietechnik Baltisch-Deutsches Hochschulkontor
Themenbereiche: UBA. Schlagwörter: Verkehr, Treibhausgase, Klimaschutz. Rosemarie Benndorf et al. Juni 2014
 Treibhausgasneutrales Deutschland im Jahr 2050 Herausgeber/Institute: UBA Autoren: Rosemarie Benndorf et al. Themenbereiche: Schlagwörter: Verkehr, Treibhausgase, Klimaschutz Datum: Juni 2014 Seitenzahl:
Treibhausgasneutrales Deutschland im Jahr 2050 Herausgeber/Institute: UBA Autoren: Rosemarie Benndorf et al. Themenbereiche: Schlagwörter: Verkehr, Treibhausgase, Klimaschutz Datum: Juni 2014 Seitenzahl:
Darstellung der deutschen Erfahrungen zu erneuerbaren Energien, KWK und Energieeffizienz
 Darstellung der deutschen Erfahrungen zu erneuerbaren Energien, KWK und Energieeffizienz 10.12.2013-Zielona Gora/11.12.2013-Gorzow Dipl.Ing. Klaus Schwarz Bioenergieberatung Gliederung Ausgangssituation
Darstellung der deutschen Erfahrungen zu erneuerbaren Energien, KWK und Energieeffizienz 10.12.2013-Zielona Gora/11.12.2013-Gorzow Dipl.Ing. Klaus Schwarz Bioenergieberatung Gliederung Ausgangssituation
EEG 2009 DIE NEUREGELUNG DES RECHTS DER ERNEUERBAREN ENERGIEN. von Hanna Schumacher
 EEG 2009 DIE NEUREGELUNG DES RECHTS DER ERNEUERBAREN ENERGIEN von Hanna Schumacher Gliederung 1. Ausgangslage 2. Der Regierungsentwurf (EEG 2009) a) Erneuerbare Energien integrieren b) Zielgenauer fördern
EEG 2009 DIE NEUREGELUNG DES RECHTS DER ERNEUERBAREN ENERGIEN von Hanna Schumacher Gliederung 1. Ausgangslage 2. Der Regierungsentwurf (EEG 2009) a) Erneuerbare Energien integrieren b) Zielgenauer fördern
Erneuerbare Energien die Rolle der Bioenergie
 Energie aus Biomasse Ethik und Praxis Sommerkolloquium, Straubing, 28.06.2012 Erneuerbare Energien die Rolle der Bioenergie Dr. Bernhard Leiter Technologie- und Förderzentrum Folie 1 Energie aus Biomasse
Energie aus Biomasse Ethik und Praxis Sommerkolloquium, Straubing, 28.06.2012 Erneuerbare Energien die Rolle der Bioenergie Dr. Bernhard Leiter Technologie- und Förderzentrum Folie 1 Energie aus Biomasse
Entwicklung der Flächenbelegung durch Energiepflanzenanbau für Biogas in Deutschland. Workshop Basisdaten zur Flächenausdehnung
 21. November 2007 Institut für Energetik und Umwelt Institute for Energy and Environment www.ie-leipzig.de Forschung, Entwicklung, Dienstleistung für - Energie - Wasser -Umwelt Entwicklung der Flächenbelegung
21. November 2007 Institut für Energetik und Umwelt Institute for Energy and Environment www.ie-leipzig.de Forschung, Entwicklung, Dienstleistung für - Energie - Wasser -Umwelt Entwicklung der Flächenbelegung
Erneuerbare Energien Potenziale in Brandenburg 2030
 Erneuerbare Energien Potenziale in Brandenburg 2030 Erschließbare technische Potenziale sowie Wertschöpfungsund Beschäftigungseffekte eine szenariobasierte Analyse Pressekonferenz Potsdam, 24.1.2012 Dr.
Erneuerbare Energien Potenziale in Brandenburg 2030 Erschließbare technische Potenziale sowie Wertschöpfungsund Beschäftigungseffekte eine szenariobasierte Analyse Pressekonferenz Potsdam, 24.1.2012 Dr.
Die ökonomischen Wirkungen der Förderung Erneuerbarer Energien: Erfahrungen aus Deutschland
 Die ökonomischen Wirkungen der Förderung Erneuerbarer Energien: Erfahrungen aus Deutschland Herausgeber/Institute: RWI Autoren: Themenbereiche: Schlagwörter: ökonomische Effekte Manuel Frondel, Nolan Ritter,
Die ökonomischen Wirkungen der Förderung Erneuerbarer Energien: Erfahrungen aus Deutschland Herausgeber/Institute: RWI Autoren: Themenbereiche: Schlagwörter: ökonomische Effekte Manuel Frondel, Nolan Ritter,
Energielehrschau-Sondertag am
 Energielehrschau-Sondertag am 24.4.28 Strom aus Sonne, Wasser und Wind Aktuelle Situation der erneuerbaren Energien in Deutschland, Zentrum für nachwachsende Rohstoffe NRW, Haus Düsse Wasserkraftnutzung
Energielehrschau-Sondertag am 24.4.28 Strom aus Sonne, Wasser und Wind Aktuelle Situation der erneuerbaren Energien in Deutschland, Zentrum für nachwachsende Rohstoffe NRW, Haus Düsse Wasserkraftnutzung
Einspeisevergütung für im Kalenderjahr 2013 neu in Betrieb genommene Eigenerzeugungsanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG vom 28.07.
 Einspeisevergütung für im Kalenderjahr 2013 neu in Betrieb genommene Eigenerzeugungsanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG vom 28.07.2011 Grundlage: Zum 1. Januar 2012 ist das novellierte Gesetz
Einspeisevergütung für im Kalenderjahr 2013 neu in Betrieb genommene Eigenerzeugungsanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG vom 28.07.2011 Grundlage: Zum 1. Januar 2012 ist das novellierte Gesetz
Erneuerbare Energien 2016
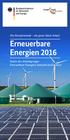 Die Energiewende ein gutes Stück Arbeit Erneuerbare Energien 2016 Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) Erneuerbare Energien bleiben wichtigste Stromquelle Im Jahr 2016 ist
Die Energiewende ein gutes Stück Arbeit Erneuerbare Energien 2016 Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) Erneuerbare Energien bleiben wichtigste Stromquelle Im Jahr 2016 ist
Erneuerbare Energien. Entwicklung in Deutschland 2010
 Erneuerbare Energien Entwicklung in Deutschland 2010 Zeichen auf Wachstum Erneuerbare Energien bauen ihre Position weiter aus Die erneuerbaren Energien haben ihren Anteil am gesamten Endenergieverbrauch
Erneuerbare Energien Entwicklung in Deutschland 2010 Zeichen auf Wachstum Erneuerbare Energien bauen ihre Position weiter aus Die erneuerbaren Energien haben ihren Anteil am gesamten Endenergieverbrauch
Optimierung von Erzeugung und Verbrauch
 THG Bilanz von Biomethan Upstream, Downstream: Optimierung von Erzeugung und Verbrauch Biogasplattform, 1. Workshop Berlin 13. 04. 2011 Karin Arnold Forschungsgruppe Zukünftige Energie- und Mobilitätsstrukturen
THG Bilanz von Biomethan Upstream, Downstream: Optimierung von Erzeugung und Verbrauch Biogasplattform, 1. Workshop Berlin 13. 04. 2011 Karin Arnold Forschungsgruppe Zukünftige Energie- und Mobilitätsstrukturen
Ein EEG für eine effiziente Energiewende: Kritische Betrachtung von fixen und Kapazitätsprämien für Erneuerbare Energien
 Ein EEG für eine effiziente Energiewende: Kritische Betrachtung von fixen und Kapazitätsprämien für Erneuerbare Energien Herausgeber/Institute: EnKliP Autoren: Uwe Nestle Themenbereiche: Schlagwörter:
Ein EEG für eine effiziente Energiewende: Kritische Betrachtung von fixen und Kapazitätsprämien für Erneuerbare Energien Herausgeber/Institute: EnKliP Autoren: Uwe Nestle Themenbereiche: Schlagwörter:
Biogasnutzung: Freud der Energie- oder der Landwirtschaft?
 Biogasnutzung: Freud der Energie- oder der Landwirtschaft? Dr. Claudius da Costa Gomez 6.12.2007, Fachtagung für Milchwirtschaft und Veredelungswirtschaft: Auswirkungen der Bioenergieproduktion auf die
Biogasnutzung: Freud der Energie- oder der Landwirtschaft? Dr. Claudius da Costa Gomez 6.12.2007, Fachtagung für Milchwirtschaft und Veredelungswirtschaft: Auswirkungen der Bioenergieproduktion auf die
Der Rechtsrahmen für die energetische Nutzung von Klärgas
 Der Rechtsrahmen für die energetische Nutzung von Klärgas Christian Buchmüller und Jörn Schnutenhaus 1. Einführung...71 2. Förderung nach dem KWKG...71 2.1. Förderung der Stromerzeugung...72 2.1.1. Anspruchsvoraussetzungen...72
Der Rechtsrahmen für die energetische Nutzung von Klärgas Christian Buchmüller und Jörn Schnutenhaus 1. Einführung...71 2. Förderung nach dem KWKG...71 2.1. Förderung der Stromerzeugung...72 2.1.1. Anspruchsvoraussetzungen...72
Biogasanlagen, EEG und Landwirtschaft - Konflikte und Potentiale
 LWK NRW Biogastagung 2007 22. März 2007 Biogasanlagen, EEG und Landwirtschaft - Konflikte und Potentiale Dr. Thomas Forstreuter Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.v. Einleitung / Zielvorgaben
LWK NRW Biogastagung 2007 22. März 2007 Biogasanlagen, EEG und Landwirtschaft - Konflikte und Potentiale Dr. Thomas Forstreuter Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.v. Einleitung / Zielvorgaben
Biogas - Stand und Perspektiven in Nordrhein-Westfalen
 Biogas - Stand und Perspektiven in Nordrhein-Westfalen Martin Hannen Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen Biogasanlagen in NRW - 1981
Biogas - Stand und Perspektiven in Nordrhein-Westfalen Martin Hannen Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen Biogasanlagen in NRW - 1981
Entwicklung der erneuerbaren Energien im Jahr 2005 in Deutschland Stand: Februar 2006
 Entwicklung der erneuerbaren Energien im Jahr 2005 in Deutschland Stand: Februar 2006 2005 hat sich die Nutzung erneuerbarer Energien erneut positiv weiterentwickelt. Nach Angaben der Arbeitsgruppe Erneuerbare
Entwicklung der erneuerbaren Energien im Jahr 2005 in Deutschland Stand: Februar 2006 2005 hat sich die Nutzung erneuerbarer Energien erneut positiv weiterentwickelt. Nach Angaben der Arbeitsgruppe Erneuerbare
Klimaschutz und ländliche Entwicklung durch Biogas in Brandenburg
 Klimaschutz und ländliche Entwicklung durch Biogas in Brandenburg Dr. Günter Hälsig 10 Jahre Fachtagung Biogas Was war und ist uns wichtig? 1. Fachtagung 2002 Biogas und Energielandwirtschaft Potenzial,
Klimaschutz und ländliche Entwicklung durch Biogas in Brandenburg Dr. Günter Hälsig 10 Jahre Fachtagung Biogas Was war und ist uns wichtig? 1. Fachtagung 2002 Biogas und Energielandwirtschaft Potenzial,
Bedeutung biogener Brennstoffe für die Kraft-Wärme-Kopplung heute und in Zukunft
 Deutsches BiomasseForschungsZentrum German Biomass Research Centre Bedeutung biogener Brennstoffe für die Kraft-Wärme-Kopplung heute und in Zukunft Dialogforum Flexibilisierung der Kraft-Wärme-Kopplung
Deutsches BiomasseForschungsZentrum German Biomass Research Centre Bedeutung biogener Brennstoffe für die Kraft-Wärme-Kopplung heute und in Zukunft Dialogforum Flexibilisierung der Kraft-Wärme-Kopplung
Herausforderungen und Chancen bei der Biogasproduktion und -nutzung
 Deutsches Biomasseforschungszentrum Herausforderungen und Chancen bei der Biogasproduktion und -nutzung Bialystok Michael Seiffert Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH, Torgauer Str.
Deutsches Biomasseforschungszentrum Herausforderungen und Chancen bei der Biogasproduktion und -nutzung Bialystok Michael Seiffert Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH, Torgauer Str.
Beschreiben Sie bitte in Stichworten die Funktionsweise eines GuD-Kraftwerks:
 1 Beschreiben Sie bitte in Stichworten die Funktionsweise eines GuD-Kraftwerks: Wie hoch ist der Wirkungsgrad der Stromerzeugung in einem modernen Steinkohle- Dampkraftwerk? 35 %, 45 %, 55 %, 65 %, 75
1 Beschreiben Sie bitte in Stichworten die Funktionsweise eines GuD-Kraftwerks: Wie hoch ist der Wirkungsgrad der Stromerzeugung in einem modernen Steinkohle- Dampkraftwerk? 35 %, 45 %, 55 %, 65 %, 75
EEG Auswirkungen für die Biogasbranche. Anke Rostankowski
 EEG 2009 - Auswirkungen für die Biogasbranche Anke Rostankowski Potsdam, 23.10.2008 Gliederung Ausgangslage Ziele Status quo Entwicklung bis 2020 Stromerzeugung aus Biomasse Neufassung des EEG Überblick
EEG 2009 - Auswirkungen für die Biogasbranche Anke Rostankowski Potsdam, 23.10.2008 Gliederung Ausgangslage Ziele Status quo Entwicklung bis 2020 Stromerzeugung aus Biomasse Neufassung des EEG Überblick
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 18/ Wahlperiode
 SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 18/4079 18. Wahlperiode 2016-04-27 Kleine Anfrage des Abgeordneten Oliver Kumbartzky (FDP) und Antwort der Landesregierung Minister für Energiewende, Landwirtschaft,
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 18/4079 18. Wahlperiode 2016-04-27 Kleine Anfrage des Abgeordneten Oliver Kumbartzky (FDP) und Antwort der Landesregierung Minister für Energiewende, Landwirtschaft,
Regenerative Energien. in Brandenburg
 Regenerative Energien in Brandenburg - Status Quo und Ziele - Tanja Kenkmann Leiterin Brandenburgische Energie Technologie Initiative (ETI) 12.07.2007, Waldsolarheim Eberswalde Brandenburgische Energie
Regenerative Energien in Brandenburg - Status Quo und Ziele - Tanja Kenkmann Leiterin Brandenburgische Energie Technologie Initiative (ETI) 12.07.2007, Waldsolarheim Eberswalde Brandenburgische Energie
Daten und Fakten Bioenergie 2011
 Daten und Fakten Bioenergie 2011 Jörg Mühlenhoff 14.07.2011 Daten und Fakten Bioenergie 2011 Anteil der Bioenergie am deutschen Energieverbrauch 2010 Strom Wärme Kraftstoffe Quelle: BMU, AG EE-Stat, März
Daten und Fakten Bioenergie 2011 Jörg Mühlenhoff 14.07.2011 Daten und Fakten Bioenergie 2011 Anteil der Bioenergie am deutschen Energieverbrauch 2010 Strom Wärme Kraftstoffe Quelle: BMU, AG EE-Stat, März
Studienvergleich. Titel
 Studienvergleich Titel Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland und verringerte fossile Brennstoffimporte durch erneuerbare Energien und Energieeffizienz Zielsetzung und Fragestellung
Studienvergleich Titel Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland und verringerte fossile Brennstoffimporte durch erneuerbare Energien und Energieeffizienz Zielsetzung und Fragestellung
EEG Novelle Entwicklung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien und finanzielle Auswirkungen
 EEG Novelle Entwicklung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien und finanzielle Auswirkungen Anzahl der Folien: 17 Stand: 31. Juli 23 1 [Mrd. kwh/a] 15 125 1 75 5 25 1991 Wasser EEG Wind offshore
EEG Novelle Entwicklung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien und finanzielle Auswirkungen Anzahl der Folien: 17 Stand: 31. Juli 23 1 [Mrd. kwh/a] 15 125 1 75 5 25 1991 Wasser EEG Wind offshore
am im Landwirtschaftszentrum Haus Düsse Stand der Novelle des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) Dipl.-Volkswirt Bernd Geisen
 NRW-Biogastagung am 13.03.2008 im Landwirtschaftszentrum Haus Düsse Stand der Novelle des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) Dipl.-Volkswirt Bernd Geisen Inhalte: Der Bundesverband BioEnergie e.v. (BBE)
NRW-Biogastagung am 13.03.2008 im Landwirtschaftszentrum Haus Düsse Stand der Novelle des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) Dipl.-Volkswirt Bernd Geisen Inhalte: Der Bundesverband BioEnergie e.v. (BBE)
Potenzialabschätzung der EEG-Einspeisung im Bundesland Niedersachsen
 Potenzialabschätzung der EEG-Einspeisung im Bundesland Niedersachsen Studie der DEWI GmbH Deutsches Windenergie-Institut im Auftrag der E.ON Netz GmbH - Kurzfassung - erstellt durch DEWI GmbH Deutsches
Potenzialabschätzung der EEG-Einspeisung im Bundesland Niedersachsen Studie der DEWI GmbH Deutsches Windenergie-Institut im Auftrag der E.ON Netz GmbH - Kurzfassung - erstellt durch DEWI GmbH Deutsches
Stromerzeugung aus Biomasse Nachhaltige Nutzung von Biomasse in Kraft-Wärme-Kopplung. FVS-Workshop Systemanalyse im FVS
 FVS-Workshop Systemanalyse im FVS 10.11.2008, Stuttgart Dr. Antje Vogel-Sperl Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) Baden-Württemberg -1- Mittels erneuerbarer Energiequellen kann Nutzenergie
FVS-Workshop Systemanalyse im FVS 10.11.2008, Stuttgart Dr. Antje Vogel-Sperl Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) Baden-Württemberg -1- Mittels erneuerbarer Energiequellen kann Nutzenergie
Monitoring der Stromerzeugung aus Festbrennstoffen unter besonderer Berücksichtigung der Holzindustrie
 Deutsches BiomasseForschungsZentrum German Biomass Research Centre Monitoring der Stromerzeugung aus Festbrennstoffen unter besonderer Berücksichtigung der Holzindustrie M.Eng., Dipl.-Ing. (FH) Andre Schwenker
Deutsches BiomasseForschungsZentrum German Biomass Research Centre Monitoring der Stromerzeugung aus Festbrennstoffen unter besonderer Berücksichtigung der Holzindustrie M.Eng., Dipl.-Ing. (FH) Andre Schwenker
Hessische Biomassepotenziale - Energie für die Zukunft. Möglichkeiten kommunalen Engagements für Erneuerbare Energien 3. November 2005, Weilburg
 Hessische Biomassepotenziale - Energie für die Zukunft Möglichkeiten kommunalen Engagements für Erneuerbare Energien 3. November 2005, Weilburg Dipl.-Ing. Reinhard Porwoll Geschäftsführer Organisation
Hessische Biomassepotenziale - Energie für die Zukunft Möglichkeiten kommunalen Engagements für Erneuerbare Energien 3. November 2005, Weilburg Dipl.-Ing. Reinhard Porwoll Geschäftsführer Organisation
Auswirkungen der. Bioenergie auf den Holzverbrauch
 Auswirkungen der Bioenergie auf den Holzverbrauch Tagung Rohholzmanagement in Deutschland 22. bis 23. März 2007 Dr. Gerd Höher 1 Triebfedern des Holz-Booms Marktkräfte und Umwelteinflüsse Weltweite Holznachfrage
Auswirkungen der Bioenergie auf den Holzverbrauch Tagung Rohholzmanagement in Deutschland 22. bis 23. März 2007 Dr. Gerd Höher 1 Triebfedern des Holz-Booms Marktkräfte und Umwelteinflüsse Weltweite Holznachfrage
Energieperspektive 2050 Deutschland Energiewende und dann?
 Forum Mittelstand LDS 2012 - Wildau Wildau 25.10.2012 Energieperspektive 2050 Deutschland Energiewende und dann? Dr. Lutz B. Giese Physikalische Technik (Regenerative Energien) TH Wildau, FB Ingenieurwesen
Forum Mittelstand LDS 2012 - Wildau Wildau 25.10.2012 Energieperspektive 2050 Deutschland Energiewende und dann? Dr. Lutz B. Giese Physikalische Technik (Regenerative Energien) TH Wildau, FB Ingenieurwesen
Erneuerbare Energien 2013
 Erneuerbare Energien 2013 Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) Mehr Energie aus Sonne, Wind & Co. Die Bereitstellung von Endenergie aus erneuerbaren Quellen in Form von Strom,
Erneuerbare Energien 2013 Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) Mehr Energie aus Sonne, Wind & Co. Die Bereitstellung von Endenergie aus erneuerbaren Quellen in Form von Strom,
Stand und Potential von erneuerbaren Energien im Land Brandenburg
 Stand und Potential von erneuerbaren Energien im Land Brandenburg Dr. Volker Scheps MLUV Brandenburg Referat Klimaschutz, Erneuerbare Energien, Umweltbezogene Energiepolitik, Emissionshandel -------------------------------------------------------------------------------------------------
Stand und Potential von erneuerbaren Energien im Land Brandenburg Dr. Volker Scheps MLUV Brandenburg Referat Klimaschutz, Erneuerbare Energien, Umweltbezogene Energiepolitik, Emissionshandel -------------------------------------------------------------------------------------------------
Biomassestrategie des Landes Brandenburg Sabine Blossey
 Biomassestrategie des Landes Brandenburg Sabine Blossey 1 Energiestrategie 2020 Land Brandenburg Ausbauziel EE PJ 140,00 120,00 Stand 2004 6 % am PEV Gesamt 38,7 PJ Steigerung des Anteils Ziel 2020 20
Biomassestrategie des Landes Brandenburg Sabine Blossey 1 Energiestrategie 2020 Land Brandenburg Ausbauziel EE PJ 140,00 120,00 Stand 2004 6 % am PEV Gesamt 38,7 PJ Steigerung des Anteils Ziel 2020 20
Pressegespräch 9. Juli Themen. 1. Rückblick: Geschäftsjahr Strategie: Ausbau des regenerativen Engagements
 5 Jahre ENNI Hauptausschuss Stadt Neukirchen-Vluyn - Erfolg im Spannungsfeld 22. September 2010 der Interessengruppen - Stefan Krämer 22. September 2010 Folie 1 Stefan Krämer 22. September 2010 Folie 2
5 Jahre ENNI Hauptausschuss Stadt Neukirchen-Vluyn - Erfolg im Spannungsfeld 22. September 2010 der Interessengruppen - Stefan Krämer 22. September 2010 Folie 1 Stefan Krämer 22. September 2010 Folie 2
Technologien und aktuelle Entwicklungen im Bereich Wind, Solar und Biomasse
 Technologien und aktuelle Entwicklungen im Bereich Wind, Solar und Biomasse Dirk Volkmann, 13.06.2017, Minsk Exportinitiative Energie Inhalt Einführung Windenergie Solarenergie Energie aus Biomasse Dirk
Technologien und aktuelle Entwicklungen im Bereich Wind, Solar und Biomasse Dirk Volkmann, 13.06.2017, Minsk Exportinitiative Energie Inhalt Einführung Windenergie Solarenergie Energie aus Biomasse Dirk
Bioenergie in Niedersachsen
 5. Regionalkonferenz der Regionalen Entwicklungskooperation Weserbergland Hameln, 14. Oktober 2009 Forum Energieregionen: Bioenergie in Niedersachsen Chancen für Klimaschutz, Landwirtschaft und ländliche
5. Regionalkonferenz der Regionalen Entwicklungskooperation Weserbergland Hameln, 14. Oktober 2009 Forum Energieregionen: Bioenergie in Niedersachsen Chancen für Klimaschutz, Landwirtschaft und ländliche
Zahlt sich Biogas-Produktion in Zukunft aus? Werner Fuchs. Fachtagung Energie Graz
 Zahlt sich Biogas-Produktion in Zukunft aus? Werner Fuchs Fachtagung Energie 25.01.2013 Graz Future strategy and 2020 and related projects C-II-2 Biogas im Umbruch Europa wächst österreichischer und deutscher
Zahlt sich Biogas-Produktion in Zukunft aus? Werner Fuchs Fachtagung Energie 25.01.2013 Graz Future strategy and 2020 and related projects C-II-2 Biogas im Umbruch Europa wächst österreichischer und deutscher
Szenarien zur Energieversorgung in Niedersachsen im Jahr 2050
 Runder Tisch Energiewende Land Niedersachsen 1. Sitzung, Hannover, 7. Mai 2015 Szenarien zur Energieversorgung in Niedersachsen im Jahr 2050 M. Faulstich, H.-P. Beck, C. v. Haaren, J. Kuck, M. Rode, H.-H.
Runder Tisch Energiewende Land Niedersachsen 1. Sitzung, Hannover, 7. Mai 2015 Szenarien zur Energieversorgung in Niedersachsen im Jahr 2050 M. Faulstich, H.-P. Beck, C. v. Haaren, J. Kuck, M. Rode, H.-H.
Bayerischer Landtag. Schriftliche Anfrage. Antwort. 17. Wahlperiode Drucksache 17/19117
 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode 28.05.2018 Drucksache 17/19117 Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Martin Stümpfig BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 24.08.2017 Stromerzeugung durch Biogas in Bayern Sofern
Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode 28.05.2018 Drucksache 17/19117 Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Martin Stümpfig BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 24.08.2017 Stromerzeugung durch Biogas in Bayern Sofern
Energielandschaft Morbach: Energieregion
 : Energieregion 1957-1995 1957-1995 1995 Vorteile der 145 ha großen Fläche: - relativ hoher Abstand zu Orten (1.000 m) - Gelände seit 50 Jahren nicht zugänglich (kein Nutzungskonflikt) - sehr gute Erschließung
: Energieregion 1957-1995 1957-1995 1995 Vorteile der 145 ha großen Fläche: - relativ hoher Abstand zu Orten (1.000 m) - Gelände seit 50 Jahren nicht zugänglich (kein Nutzungskonflikt) - sehr gute Erschließung
CO 2 -Bilanz der Stadt Wuppertal 1990-2009 (Stand: 05.09.2011) Anlage zur Drucksache VO/0728/11
 Geschäftsbereichsbüro 100.2 für den Geschäftsbereich 1.2 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt rolf.kinder@stadt.wuppertal.de 05.09.2011 563 69 42 563-80 50 CO 2 -Bilanz der Stadt Wuppertal 1990-2009
Geschäftsbereichsbüro 100.2 für den Geschäftsbereich 1.2 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt rolf.kinder@stadt.wuppertal.de 05.09.2011 563 69 42 563-80 50 CO 2 -Bilanz der Stadt Wuppertal 1990-2009
Das Erneuerbare - Energien Gesetz Alle Vergütungssätze beziehen sich auf Inbetriebnahme der Anlage im Jahre 2004
 Das Erneuerbare - Energien Gesetz 2004 Alle Vergütungssätze beziehen sich auf Inbetriebnahme der Anlage im Jahre 2004 1 Zweck des Gesetzes Nachhaltige Energieversorgung für Klima-, Natur- und Umweltschutz
Das Erneuerbare - Energien Gesetz 2004 Alle Vergütungssätze beziehen sich auf Inbetriebnahme der Anlage im Jahre 2004 1 Zweck des Gesetzes Nachhaltige Energieversorgung für Klima-, Natur- und Umweltschutz
Zusammenfassung. Abbildung 1: Entwicklung des Energiemix von Österreich bis 2020. Erdgas im Energiemix der Zukunft AP1: Potentialbetrachtungen
 Zusammenfassung Die Energiesysteme in Europa und weltweit werden langfristig adaptiert, um die Energieund Klimaziele erreichen zu können. Dies führt zu grundlegenden Veränderungen bei der Energieerzeugung,
Zusammenfassung Die Energiesysteme in Europa und weltweit werden langfristig adaptiert, um die Energieund Klimaziele erreichen zu können. Dies führt zu grundlegenden Veränderungen bei der Energieerzeugung,
Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland in den ersten drei Quartalen 2017
 Stand: 21. November 217 Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland in den ersten drei Quartalen 217 Quartalsbericht der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) * Erstellt durch
Stand: 21. November 217 Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland in den ersten drei Quartalen 217 Quartalsbericht der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) * Erstellt durch
Warum überhaupt Energiewende?
 Solar lohnt sich! Warum überhaupt Energiewende? Energieressourcen Akzeptanz Erneuerbarer Energien Zellen und Modultypen Quelle: https://www.manz.com/de/maerkte/solar/systemloesungen-fuer-gebaeudeintegrierte-photovoltaik-bipv/manz-cigs-solarmodule/
Solar lohnt sich! Warum überhaupt Energiewende? Energieressourcen Akzeptanz Erneuerbarer Energien Zellen und Modultypen Quelle: https://www.manz.com/de/maerkte/solar/systemloesungen-fuer-gebaeudeintegrierte-photovoltaik-bipv/manz-cigs-solarmodule/
Stand und Perspektiven der Bioenergienutzung in Baden-Württemberg
 Stand und Perspektiven der Bioenergienutzung in Baden-Württemberg Konrad Raab Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Referat Erneuerbare Energien Ziele des Koalitionsvertrages
Stand und Perspektiven der Bioenergienutzung in Baden-Württemberg Konrad Raab Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Referat Erneuerbare Energien Ziele des Koalitionsvertrages
Biogasproduktion Einzelbetriebliche Chancen und Risiken
 Biogasproduktion Einzelbetriebliche Chancen und Risiken Herbsttagung der Landwirtschaftskammer NRW Schlangen, 16.11.2010 Uedem-Keppeln, 17.11.2010 Nottuln, 18.11.2010 Dr. Arne Dahlhoff Hinweis zum Vortrag
Biogasproduktion Einzelbetriebliche Chancen und Risiken Herbsttagung der Landwirtschaftskammer NRW Schlangen, 16.11.2010 Uedem-Keppeln, 17.11.2010 Nottuln, 18.11.2010 Dr. Arne Dahlhoff Hinweis zum Vortrag
Ulrich Ahlke Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit
 Inhalte des Vortrages Der Zukunftskreis Netzwerke energieland 2050: der strategische Ansatz Masterplan 100 % Klimaschutz Maßnahmen, Projekte und Aktivitäten Fazit Der Zukunftskreis Gesamtfläche: 1.793
Inhalte des Vortrages Der Zukunftskreis Netzwerke energieland 2050: der strategische Ansatz Masterplan 100 % Klimaschutz Maßnahmen, Projekte und Aktivitäten Fazit Der Zukunftskreis Gesamtfläche: 1.793
Stand und Entwicklung des Klein-KWK-Marktes aus Sicht der BBT Referent: Dr. Stefan Honcamp, BBT Thermotechnik GmbH,
 Stand und Entwicklung des Klein-KWK-Marktes aus Sicht der BBT Referent: Dr. Stefan Honcamp, BBT Thermotechnik GmbH, stefan.honcamp@buderus.de Folie Nr. 1 Stand und Entwicklung des Klein-KWK-Marktes Inhalt
Stand und Entwicklung des Klein-KWK-Marktes aus Sicht der BBT Referent: Dr. Stefan Honcamp, BBT Thermotechnik GmbH, stefan.honcamp@buderus.de Folie Nr. 1 Stand und Entwicklung des Klein-KWK-Marktes Inhalt
Potenzialstudie Windenergie NRW
 Potenzialstudie Windenergie NRW PantherMedia/James Steindl Ellen Grothues, Dr. Barbara Köllner Koordinierungsstelle Klimaschutz, Klimawandel LANUV NRW Klimaschutz durch Windenergie in NRW Klimaschutzgesetz
Potenzialstudie Windenergie NRW PantherMedia/James Steindl Ellen Grothues, Dr. Barbara Köllner Koordinierungsstelle Klimaschutz, Klimawandel LANUV NRW Klimaschutz durch Windenergie in NRW Klimaschutzgesetz
Vergleich der EEG-Vergütungsregelungen für 2009
 Vergleich der -Vergütungsregelungen für 2009 Bundestagsbeschluss zum nachrichtlich (theoretische Werte): nach, - und nach. Die folgenden Tabellen geben einen beispielhaften Überblick für Vergütungen und
Vergleich der -Vergütungsregelungen für 2009 Bundestagsbeschluss zum nachrichtlich (theoretische Werte): nach, - und nach. Die folgenden Tabellen geben einen beispielhaften Überblick für Vergütungen und
Zum aktuellen Stand und zu den Herausforderungen der energetischen Biomassenutzung in Deutschland
 Zum aktuellen Stand und zu den Herausforderungen der energetischen Biomassenutzung in Deutschland Dr. Bernhard Dreher Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Referat E I 5, Solarenergie,
Zum aktuellen Stand und zu den Herausforderungen der energetischen Biomassenutzung in Deutschland Dr. Bernhard Dreher Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Referat E I 5, Solarenergie,
Erneuerbare Energien
 Erneuerbare Energien Forum Hasetal, Löningen Dr. Marie-Luise Rottmann-Meyer 3N Kompetenzzentrum 20.09.2012 Handlungsfeld Klimaschutz Täglich produzieren wir ca. 100 Millionen Tonnen Treibhausgase durch
Erneuerbare Energien Forum Hasetal, Löningen Dr. Marie-Luise Rottmann-Meyer 3N Kompetenzzentrum 20.09.2012 Handlungsfeld Klimaschutz Täglich produzieren wir ca. 100 Millionen Tonnen Treibhausgase durch
Untersuchung unterschiedlicher Szenarien zum Ausstieg aus der Kohleverbrennung am Standort HKW Nord
 Untersuchung unterschiedlicher Szenarien zum Ausstieg aus der Kohleverbrennung am Standort HKW Nord Dr. Markus Henle (SWM), Fr. Sabine Gores (Öko-Institut) 21.04.2015 Übersicht Auftrag der LH München an
Untersuchung unterschiedlicher Szenarien zum Ausstieg aus der Kohleverbrennung am Standort HKW Nord Dr. Markus Henle (SWM), Fr. Sabine Gores (Öko-Institut) 21.04.2015 Übersicht Auftrag der LH München an
Anteile der Energieträger an der Stromerzeugung in Deutschland 2003
 Anteile der Energieträger an der Stromerzeugung in Deutschland 2003 Gesamte Brutto-Stromerzeugung 597 TWh Stromerzeugung aus Erneuerbaren 46,3 TWh Kernenergie 27,6 % Braunkohle 26,6 % Steinkohle 24,5 %
Anteile der Energieträger an der Stromerzeugung in Deutschland 2003 Gesamte Brutto-Stromerzeugung 597 TWh Stromerzeugung aus Erneuerbaren 46,3 TWh Kernenergie 27,6 % Braunkohle 26,6 % Steinkohle 24,5 %
Energie & emobility 1. Stromquellen Die vier+2 Elemente
 Wildauer Wissenschaftswoche 2015 4. Energiesymposium Wildau 13.03.2015 Energie & emobility 1. Stromquellen Die vier+2 Elemente Dr. Lutz B. Giese Physikalische Technik (Regenerative Energien) TH Wildau,
Wildauer Wissenschaftswoche 2015 4. Energiesymposium Wildau 13.03.2015 Energie & emobility 1. Stromquellen Die vier+2 Elemente Dr. Lutz B. Giese Physikalische Technik (Regenerative Energien) TH Wildau,
Strommix in Deutschland: Die Erneuerbaren auf Rekordkurs
 Strommix in Deutschland: Die Erneuerbaren auf Rekordkurs Im Sektor Strom ist die Energiewende auf einem guten Weg. Während des ersten Halbjahrs 2017 stieg der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Quellen
Strommix in Deutschland: Die Erneuerbaren auf Rekordkurs Im Sektor Strom ist die Energiewende auf einem guten Weg. Während des ersten Halbjahrs 2017 stieg der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Quellen
Biogasanlagen im EEG 2009
 Biogasanlagen im EEG 2009 Herausgegeben von Dr. Helmut Loibl, Prof. Dr. Martin Maslaton und Hartwig Freiherr von Bredow Redaktionsteam: Hartwig Freiherr von Bredow, Dr. Helmut Loibl, Prof. Dr. Martin Maslaton,
Biogasanlagen im EEG 2009 Herausgegeben von Dr. Helmut Loibl, Prof. Dr. Martin Maslaton und Hartwig Freiherr von Bredow Redaktionsteam: Hartwig Freiherr von Bredow, Dr. Helmut Loibl, Prof. Dr. Martin Maslaton,
Erste vorläufige Daten zur Entwicklung der Energiewirtschaft im Jahr 2014
 Erste vorläufige Daten zur Entwicklung der Energiewirtschaft im Jahr 2014 Stand: Mai 2015 1. Allgemeiner Überblick Die folgenden Darstellungen zeigen die Entwicklung von der Energieaufbringung bis zum
Erste vorläufige Daten zur Entwicklung der Energiewirtschaft im Jahr 2014 Stand: Mai 2015 1. Allgemeiner Überblick Die folgenden Darstellungen zeigen die Entwicklung von der Energieaufbringung bis zum
Presseinformation. Was kostet die Energiewende? Wege zur Transformation des deutschen Energiesystems bis 2050
 Seite 1 Was kostet die Energiewende? Wege zur Transformation des deutschen Energiesystems bis 2050 Die Energiewende in Deutschland ist erklärtes politisches Ziel der Bundesregierung. Um mindestens 80 Prozent,
Seite 1 Was kostet die Energiewende? Wege zur Transformation des deutschen Energiesystems bis 2050 Die Energiewende in Deutschland ist erklärtes politisches Ziel der Bundesregierung. Um mindestens 80 Prozent,
Zum Stand der Energiewende aus Sicht der Politikberatung - Schwerpunkt ländlicher Raum -
 Zum Stand der Energiewende aus Sicht der Politikberatung - Schwerpunkt ländlicher Raum - 2050 Prof. Dr. Karin Holm-Müller Sachverständigenrat für Umweltfragen, Berlin Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik,
Zum Stand der Energiewende aus Sicht der Politikberatung - Schwerpunkt ländlicher Raum - 2050 Prof. Dr. Karin Holm-Müller Sachverständigenrat für Umweltfragen, Berlin Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik,
