Wirkungsgrad (direkt, indirekt)
|
|
|
- Judith Engel
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Wirkungsgrad (direkt, indirekt) Einer der wichtigsten Kenngrößen zur Beurteilung der Qualität einer Holzfeuerung ist der Wirku ngsgrad. Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der nutzbaren Leistung P ab (oder auch Q ab, P Nenn, Nennwärmeleistung) und der zugeführten Leistung P ZU (Feuerungsleistung, Input Q F ). Der Wirkungsgrad kann entweder direkt (auch Kesselwirkunsgrad genannt) über die abgegebene und zugeführte Leistung bestimmt werden oder indirekt (feuerungstechnsicher Wirkungsgrad), indem die Verluste bestimmt werden. Im folgenden wird die Bestimmung von beiden Wirkungsgraden erläutert. Einige Erläuterungen wurden dem Handbuch der Berechnungssoftware Feuerungs- und Wärmetechnik " firecalc " entnommen. Direkter Wirkungsgrad (direkte Methode, Kesselwirkungsgrad) Bei dieser Methode wird der Wirkungsgrad (eta) direkt über die abgegebene Nutzwärme bestimmt. Der Wirkungsgrad nach der direkten Methode ist das Verhältnis von eingesetzter Leistung 1 / 28
2 (Brennstoffenergiestrom QB) zur nutzbaren Leistung (Nutzenergiestrom QN oder Nennleistung) in Prozent. Die erzeugte Wärme wird auf einen Wärmeträger übertragen, z. B. Wasser. Die Bestimmung des direkten Wirkungsgrades wird nur bei "Kesselgeräten" oder auch selten bei Speicheröfen im Kaloriemeterraum durchgeführt. Die Berechnung des direkten Wirkungsgrad erfolgt nach folgender Beziehung: eta direkter Wirkungsgrad (Kesselwirkungsgrad) Pab Nutzleistung (Nennleistung, Output) Pzu zugeführte Leistung, Feuerungsleistung m Wasserdurchfluß [kg/h] cp spezifische Wärmekapazität des Wärmeträgers [kj/kgk] (Wasser ~4,2 kj/kg TV Vorlauftemperatur [K] (bzw. je nach verwendeter Wassermeßstrecke) TR Rücklauftemperatur [K] (bzw. je nach verwendeter Wassermeßstrecke) Hu unterer Heizwert des Brennstoffes [kj/kg] B Brennstoffdurchsatz [kg/h] Zusätzlich müssen gegebenenfalls noch Verluste und/oder Gewinne der Meßstrecke berücksichtigt werden (z.b. Aufheizung des Kesselwassers durch die Umwälzpumpe, Abkühlungsverluste in den Verbindungsschläuchen usw.). Auf eine direkte Messung der Vorlauf- und Rücklauftemperaturen sollte man aus Gründen der Messgenauigkeit verzichten. Aufgrund der geringen Temperaturspreizung und des hohen Wasserdurchsatzes können recht große Meßfehler entstehen. Eine Temperaturmessung mit einer Genauigkeit von 2 Kelvin ist bereits sehr schwierig zu gewährleisten. Akkreditierte Feuertstättenprüfstände müssen aufgrund der in den Produktnormen geforderten Meßgenauigkeit deshalb sogenannte Kurzschlußmeßstände (Kurzschlussmesstrecke) oder Wärmetauschermeßstände verwenden. Bei der Kurzschlussmeßstrecke wird die an das Heizwasser nutzbar abgegebene Wärmeleistung durch Messung eines in den Kesselkreislauf eingespeisten Kaltwasser-Massenstromes und Temperaturerhöhung auf Vorlauftemperatur oder durch Messung des im Kesselkreislauf umgewälzten Wasser-Massenstromes und seiner Temperaturerhöhung ermittelt. 2 / 28
3 Folgend eine schematische Darstellung aus DIN EN 13240, DIN EN 13229, DIN EN und auch DIN EN 303-5: Die spezifische Wärmekapazität des Wärmeträgers c P beträgt bei Wasser überschlägig 4,2 kj/kgk. Hier sollte die Wärmekapazität aufgründen der Genauigkeit aber getrennt nach Vorund Rücklauftemperatur ermittelt werden. 3 / 28
4 Indirekter Wirkungsgrad eta i (indirekte Methode, feuerungstechnischer Wirkungsgrad) In der Praxis ist das direkte Messen der zugeführten und nutzbar abgegebenen Wärme insbesondere bei Raumheizern schwierig oder teilweise unmöglich. Deshalb begnügt man sich bei Messungen meistens mit der Bestimmung des Wirkungsgrades nach der indirekten Methode. Der Wirkungsgrad nach der indirekten Methode in Prozent entspricht der eingesetzten Leistung (Brennstoffenergiestrom QB, Feuerungsleistung) minus der Verluste (plus der Kondensationswärme, wenn vorhanden). eta indirekter Wirkungsgrad (feuerungstechnischer Wirkungsgrad etai) Qab Nutzleistung (QN, Nennleistung, Output) Qzu zugeführte Leistung (QF, Feuerungsleistung) QVerl. Summe aller Verluste QK Kondensationsgewinne QA Abgasverluste (thermische verluste) 4 / 28
5 QU Chemische Verluste im Abgas (unverbrannte Bestandteile) QR Ascheverluste QS Strahlungsverluste Abgasverluste durch freie Wärme Q A (thermische Verluste) Wenn die Abgase die Feuerstätte verlassen, besitzen sie noch eine höhere Temperatur als die Luft und der Brennstoff bei Eintritt in die Feuerung. Diese Differenz des Wärmeinhaltes der Heizgase stellt den bedeutendsten Verlust dar. Wenn auch anzustreben ist ihn möglichst klein zu halten, so sind hierfür doch Grenzen gesetzt. Einmal muss der notwendige Förderdruck (Kaminzug) gesichert sein, zum anderen muss durch genügend hohe Abgastemperatur der Tauwasserbildung (in der Abgasableitung) im Schornstein und der Korrosion in der Feuerstätte vorgebeugt werden (außer bei Feuerstätten mit planmäßiger Kondensation, Brennwerttechnik). Nach der 1. BImSchV, Anlage 2, Abschnitt 3.4 werden die thermischen Verluste im Abgas für Gas- und Ölfeuerungen überschlägig ermittelt: 5 / 28
6 Die Abgasverluste werden bei Messung des Sauerstoffgehaltes nach folgender Beziehung berechnet: Es bedeuten: qa Abgasverlust in % ta Abgastemperatur in C tl Verbrennungslufttemperatur in C O2,A Volumengehalt an Sauerstoff im trockenen Abgas in % A1 Brennstoffbezogene Faktor A2 Brennstoffbezogene Faktor 6 / 28
7 B Brennstoffbezogene Faktor Bei der Produktprüfung von Feuerstätten wie Raumheizer nach DIN EN oder Kamineinsätze / Kachelöfen nach DIN EN müssen Feuerstättenpr üfstellen aufgru nd der geforderten Genauigkeit exaktere Berechnungen durchführen. Nachfolgend ein Beispiel zur Berechnung des Abgasverlustes aus DIN EN oder DIN EN zur Bestimmung des Abgasverlustes QA: QA Abgasverlust in % ta Abgastemperatur in C 7 / 28
8 tr Verbrennungslufttemperatur in C cpm Von Temperatur und Zusammensetzung der Gase abhängige C Kohlenstoffgehalt des Prüfbrennstoff Cr Kohlenstoffgehalt des Rost- und Schürdurchfalls CO Kohlenstoffmonoxidgehalt der trockenen Abgase CO2 Kohlenstoffdioxidgehalt der trockenen Abgase cpmh2o Von der Temperatur abhängige spezifische Wärme des Wass H Wasserstoffgehalt des Prüfbrennstoff W Wassergehalt des Prüfbrennstoff Wie anhand der Daten erkennbar ist, werden vor der Verwendung der Formel zusätzlich Berechnungen z.b. für die Berechnung der spezifische Wärmekapazität des Rauchgases notwendig. 8 / 28
9 Verluste durch unverbrannte Gase Q U (che mische Verluste) Von den im Abgas etwa noch vorhandenen unverbrannten Gasen spielt praktisch nur der Kohlenmonoxidgehalt eine Rolle. Der anteilsmäßige Verlust lässt sich berechnen. Die Erläuterung der Werte können der Tabelle oben entommen werden. Verluste durch brennbare Rückstände Q R (Ascheverluste) Im Rostdurchfall ist je nach Beschaffenheit des Brennstoffes und der Betriebsweise der Feuerung eine mehr oder weniger große Menge an Unverbranntem (Kohlenstoff) enthalten. 9 / 28
10 Für die Berechnung der Ascheverluste "Wärmeverluste durch Verbrennliches im Rost- und Schürdurchfall von Holz- oder Kohlefeuerungen ist bei der Prüfung der Wärmeleistung der Rost und Schürdurchfall zur Seite zu stellen und abkühlen zu lassen. Die Masse des Rückstandes wird in Kilogramm auf ± 2 g genau bestimmt und registriert. Der Rost- und Schürdurchfall wird analysiert und das Verbrennliche darin bezogen auf den Rost- und Schürdurchfall in Prozent ermittelt. Hierin sind b = brennbare Bestandteile im Rost- 10 / 28
11 und Schürdurchfall, bezogen auf die Masse des Rückstandes R = Rost- und Schürdurchfall, bezogen auf die Masse des verfeuerten Brennstoffs Pauschaler Ansatz: Bei der Produktprüfung, Erstprüfung von folgenden Raumheizern lassen die unten aufgeführten Normen einen pauschalen Verlustwert bei dem Prüfbrennstoff Holz mit 0,5 Prozentpunkten des Wirkungsgrades zu. - DIN EN 13240, DIN EN und 11 / 28
12 DIN EN und bei der Prüfung von Raumheizer für Holzpellets / Pelletöfen nach - DIN EN der Brennstoff-Wärmeverlust mit 0,2 Prozentpunkten des Wirkungsgrades angesetzt werden. Verluste infolge Strahlung Q S (Strahlungsverluste) Verluste über heiße Oberflächen 12 / 28
13 des Wärmeerzeugers ohne dem Wärmeträger von Nutzen zu sein z.b. bei Aufstellung in den nichtbeheizten Bereichen (wird bei Raumheizern nicht berücksichtigt). Der Strahlungsverlust hängt von der Größe der nicht oder unzureichend wärmegedämmten Kesselbeschlagteile, z.b. Kesseltüren, Kessel, Boiler, Rohren und Ventilen und von der Wärmedämmung des Heizkessels ab. Der Strahlungsverlust wird nur indirekt ermittelt und von den 13 / 28
14 Herstellern in der Regel nicht gesondert angegeben. Er hängt von der Größe der nicht wärmegedämmten Kesselbeschlagteile, z.b. Kesseltüren, und von der Wärmedämmung des Heizkessels ab. Der Strahlungsverlust entsteht bei Wärmeerzeugern durch Wärmeabstrahlung warmer Oberflächen in den unbeheizten Aufstellraum ohne dem Wärmeträger von Nutzen zu sein. Der Strahlungsverlust reduziert sich mit sinkender Kesselwassertemperatur und 14 / 28
15 verbesserter Wärmedämmung es Kessels, aber auch durch geringe Stillstandszeiten, eine sorgfältige Dimensionierung des Kessels sowie durch Leistungsmodulation. Die Wärmeabstrahlung (oder Wärmestrahlung) ist eine Form der Wärmeübertragung, die nicht an ein Transportmedium wie Luft oder Wasser gebunden ist. Die Energie der Wärmeabstrahlung ist abhängig von der Oberflächentemperatur, wobei immer der höher temperierte den kälteren Körper "anstrahlt". Die Wärmeverluste werden indirekt bestimmt. Bei der indirekten 15 / 28
16 Methode ist es notwendig, diesen Verlust zu kennen. Näherungsweise kann er auf folgendem Wege ermittelt werden: Von den Kesseloberflächen annähernd gleicher Temperatur (also zu trennen sind z.b. Flächen mit unterschiedlichen Temperaturen wie isolierte Flächen, Türen, Abgasstutzen, Verbindungsrohre, Kesselfundamente,...) werden durch Temperaturmessung (Oberflächenthermometerfühler) Temperaturfelder aufgenommen. Aus dem Mittel der jeweiligen 16 / 28
17 Temperaturen errechnet sich die Wärmeabgabe der Teilfläche wie folgt: Hierin sind Qx = Wärmeabgabe der Teilfläche, in W Fx = Teilfläche, in m2 α = Wärmeübergangszahl, in W/(m2 K) tm = mittlere Oberflächentemperatur der Teilfläche, in C 17 / 28
18 tl = Umgebungstemperatur (in halber Kesselhöhe und von der Kesselvorderseite in 1,5 m Abstand gemessen), in C In dieser Formel ist die Ermittlung des korrekten Wertes für die Wärmeübergangszahl der zu bewertenden Oberfläche sicherlich am schwierigsten. Kondensationsgewinne QS Wird bei einem Brennwertkessel das Abgas soweit abgekühlt, dass das bei der Verbrennung verdampfte Wasser kondensiert, kann die dabei freiwerdende Kondensationswärme der 18 / 28
19 Nutzenergie zugute kommen. Bei der Brennwerttechnik kondensiert ein Teil des bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Heizöl oder Erdgas entstehenden Wassers aus. Zusätzlich zur fühlbaren Wärme kann dadurch die latente Wärme (Kondensation) des Wasserdampfes genutzt werden. Über die Kondensatmenge kann kontrolliert werden, wie gut der Brennwertfeuerung die Energie des eingesetzten Brennstoffes nutzt. Das Messverfahren über die 19 / 28
20 Kondensatmenge ist integrierend und vermeidet Fehler bei Momentanwerten und Differenzbildungen aus viel größeren Zahlen. Die Berechnung der Gewinne durch die Kondensationswärme kann vereinfacht nach den Berechnungsverfahren der (zurückgezogenen) DIN : "Heizkessel-Regeln für die heiztechnische Prüfung" durchgeführt werden. Bei der vereinfachten Berechnung nach DIN wird für die Enthalpie des Wasserdampfes 2440,0 kj/kg 20 / 28
21 und für die Dichte des Wasserdampfs 1,302 kg/m³ angenommen. Als Zwischenergebnis wird die gemessene Kondensatmasse pro kg bzw. pro m³ (bei Gas) verbranntem Brennstoff berechnet. Da es sich um eine vereinfachte Berechnung handelt, wird nach DIN angenommen, dass die Temperatur des Kondensats 25 C beträgt. Das Abgaskondensat was als Tröpfchenform mit dem Abgas entweicht bleibt ebenfalls nach DIN unbestimmt. 21 / 28
22 Formel nach DIN für die Berechnung der Kondensationsgewinne: hd = Enthalpie des Wasserdampfes = 2440 kj/kg bei einer Kondensattemperatur von 25 C Hu = unterer Heizwert des Brennstoffs in kj/kg mk = Kondensationsmasse in kg 22 / 28
23 Der Brennstoff Heizöl EL besteht zu ca. 86,6 Gewichtsprozenten aus Kohlenstoff (C) und zu ca. 13,3 Gewichtsprozenten aus Wasserstoff (H). Heizöl EL enthält geringe Mengen an organisch gebundenem Schwefel (S) sowie Spuren von gebundenem Stickstoff (N). Bei der Verbrennung entstehen daraus als Hauptprodukte Kohlendioxid (CO 2 ) und Wasser (H 2 O). Man kann davon ausgehen, dass bei der Verbrennung von einem Liter Heizöl ca. 0,9 Liter Wasser gebildet wird, welches bei der konventionellen Heizkessel-Technik den Kessel 23 / 28
24 gasförmig verlässt und bei Brennwertkesseln ausgenützt werden kann. Der Brennstoff Erdgas besteht zu ca. 75 Gewichtsprozenten aus Kohlenstoff (C) bzw. aus 92 Vol. % Methan (CH 4 ). Bei der Verbrennung von einem Kubikmeter (m³) Erdgas werden ca. 1,56 kg Wasser (H 2 O) freigesetzt, das bei Brennwertkesseln ausgenützt werden kann. 24 / 28
25 In letzter Zeit wird die Brennwerttechnik auch für Holzfeuerungen verwendet. Von Grundsatz her enthält Holz; auch ausreichend getrocknetes Holz noch immer eine Restfeuchte von ca. 12%. Damit wäre grundsätzlich die Voraussetzung geschaffen, um Wasserdampf-Kondensation im Abgas zu betreiben. Bei der Brennwerttechnik bei Holzfeuerungen enstehen aber größere Probleme mit dem agressiven Kondensat (schwefelund chlorhaltig, geringer ph-wert) hinsichtlich chemischer Angriffe im 25 / 28
26 Wärmetauscher (Korrosion), Verschmutzung der Wärmetauscherflächen (Ruß, Asche) und Probleme bei der Abführung des Kondensats ins Abwasser (örtliche Abwasserbestimmungen sind zu beachten). Zusätzlich werden bei Holzfeuerung größere Luftzahlen (Luftüberschuss Lambda) gefahren als bei Öl- oder Gasfeuerungen, wodurch größere Abgasvolumenströme resultieren. Hierdurch müssen konstruktiv größere Wärmetauscherflächen realisiert werden als bei Gas- oder Öl- Brennwertgeräten. 26 / 28
27 Die berechneten Gewinne durch Kondensation erhöhen den feuerungstechnischen Wirkungsgrad und damit die Nutzleistung. Falls Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, würden wir uns über einen Beitrag in unser Gästebuch freuen. 27 / 28
28 Gerne nehmen wir auch konstruktive Kritik, Anregungen oder Hinweise über Fehler entgegen. Zugriffe auf diesen Beitrag: {oshits } 28 / 28
Verbrennungstechnik. 1. Brennstoffe. 1.Brennstoffe. 2.Heizwert. 2.1 Oberer Heizwert 2.2 Unterer Heizwert. 3.Verbrennungsvorgang
 Verbrennungstechnik 1.Brennstoffe.Heizwert.1 Oberer Heizwert. Unterer Heizwert.Verbrennungsvorgang.1 Verbrennungsgleichungen 4.Ermittlung von Sauerstoff-, Luftbedarf u. Rauchgasmenge 5.Verbrennungskontrolle
Verbrennungstechnik 1.Brennstoffe.Heizwert.1 Oberer Heizwert. Unterer Heizwert.Verbrennungsvorgang.1 Verbrennungsgleichungen 4.Ermittlung von Sauerstoff-, Luftbedarf u. Rauchgasmenge 5.Verbrennungskontrolle
Kondensate von Brennwertkesseln
 Kondensate von Brennwertkesseln Rechtliche Vorgaben -Praktische Erfahrungen Ing. Wilhelm Lammer Abwasserverband Welser Heide 2008 1 Inhalt Brennwertkessel Funktionsweise Zusammensetzung des Kondensat Auswirkung
Kondensate von Brennwertkesseln Rechtliche Vorgaben -Praktische Erfahrungen Ing. Wilhelm Lammer Abwasserverband Welser Heide 2008 1 Inhalt Brennwertkessel Funktionsweise Zusammensetzung des Kondensat Auswirkung
- ANHANG - DAMPF UND KONDENSAT NACHSCHLAGEWERK / ANHANG / QUELLEN
 DAMPF UND KONDENSAT NACHSCHLAGEWERK / ANHANG / QUELLEN Hier entsteht ein umfassendes Nachschlagewerk. Zur Zeit sind noch nicht sehr viele Informationen vorhanden. Zukünftig soll sich hier aber jeder Planer
DAMPF UND KONDENSAT NACHSCHLAGEWERK / ANHANG / QUELLEN Hier entsteht ein umfassendes Nachschlagewerk. Zur Zeit sind noch nicht sehr viele Informationen vorhanden. Zukünftig soll sich hier aber jeder Planer
Thermodynamik 2 Klausur 15. September 2010
 Thermodynamik 2 Klausur 15. September 2010 Bearbeitungszeit: 120 Minuten Umfang der Aufgabenstellung: 5 nummerierte Seiten Alle Unterlagen zu Vorlesung und Übung sowie Lehrbücher und Taschenrechner sind
Thermodynamik 2 Klausur 15. September 2010 Bearbeitungszeit: 120 Minuten Umfang der Aufgabenstellung: 5 nummerierte Seiten Alle Unterlagen zu Vorlesung und Übung sowie Lehrbücher und Taschenrechner sind
BRÖTJE-Fachinformation. (Juli 1999) Kennwerte zur Bemessung von Abgasanlagen
 BRÖTJE-Fachinformation (Juli 1999) Kennwerte zur Bemessung von Abgasanlagen Informationsblatt Nr. 12 Juli 1999 Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie Kennwerte zur Bemessung von Abgasanlagen Die
BRÖTJE-Fachinformation (Juli 1999) Kennwerte zur Bemessung von Abgasanlagen Informationsblatt Nr. 12 Juli 1999 Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie Kennwerte zur Bemessung von Abgasanlagen Die
Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff und wird nach Ausgangsprodukt in. - Teeröle
 Zusammenfassung zur Vorlesung Optimierte Gebäudetechnik / Teil Wärmeversorgungssysteme ab 3.KW/00 Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff und wird nach Ausgangsprodukt in zwei Hauptgruppen eingeteilt: - Mineralische
Zusammenfassung zur Vorlesung Optimierte Gebäudetechnik / Teil Wärmeversorgungssysteme ab 3.KW/00 Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff und wird nach Ausgangsprodukt in zwei Hauptgruppen eingeteilt: - Mineralische
- WÄRMETAUSCHER - WÄRMETAUSCHER
 WÄRMETAUSCHER Wärmetauscher (WT) dienen in einem - und system z. B. zum Erwärmen von oder Luft. Als Heizmedium wird oder verwendet. Das aufzuheizende oder die aufzuheizende Luft strömt durch die Rohre
WÄRMETAUSCHER Wärmetauscher (WT) dienen in einem - und system z. B. zum Erwärmen von oder Luft. Als Heizmedium wird oder verwendet. Das aufzuheizende oder die aufzuheizende Luft strömt durch die Rohre
a.) Wie beeinflussen in einer Verbrennungsreaktion Brennstoffe in fester bzw. flüssiger Phase das chemische Gleichgewicht? Begründung!
 Klausur F2004 (Grundlagen der motorischen Verbrennung) 2 Aufgabe 1.) ( 2 Punkte) Wie beeinflussen in einer Verbrennungsreaktion Brennstoffe in fester bzw. flüssiger Phase das chemische Gleichgewicht? Begründung!
Klausur F2004 (Grundlagen der motorischen Verbrennung) 2 Aufgabe 1.) ( 2 Punkte) Wie beeinflussen in einer Verbrennungsreaktion Brennstoffe in fester bzw. flüssiger Phase das chemische Gleichgewicht? Begründung!
Vorlesung Wärmeerzeuger
 Vorlesung Warmwasserpumpenheizung und Wärmebilanz Wärmeträger Heizkesselkonstruktionen und Einsatzbereich Anforderungen an Prof. Dr.-Ing. Dirk Bohne IEK/Abt. technische Gebäudeausrüstung Fakultät Architektur
Vorlesung Warmwasserpumpenheizung und Wärmebilanz Wärmeträger Heizkesselkonstruktionen und Einsatzbereich Anforderungen an Prof. Dr.-Ing. Dirk Bohne IEK/Abt. technische Gebäudeausrüstung Fakultät Architektur
Berechnung der adiabaten Rauchgastemperatur sowie des Nutzwäremstromes:
 Berechnung der adiabaten Rauchgastemperatur sowie des Nutzwäremstromes: Brennstoff-, Verbrennungsluft- und Rauchgasmengen und -Zusammensetzungen (Analysen) und Temperaturen, Heizwert des Brennstoffs. zu
Berechnung der adiabaten Rauchgastemperatur sowie des Nutzwäremstromes: Brennstoff-, Verbrennungsluft- und Rauchgasmengen und -Zusammensetzungen (Analysen) und Temperaturen, Heizwert des Brennstoffs. zu
Vergleich zwischen Heizwert Brennwert ErP-Richtlinie
 Vergleich zwischen Heizwert Brennwert ErP-Richtlinie Übersicht Heizwert Nachteile gegenüber Brennwert Brennwert Vorteile gegenüber Heizwert Preisvergleich Ökodesign-Richtlinie (ErP) Heizwert Der Heizwert
Vergleich zwischen Heizwert Brennwert ErP-Richtlinie Übersicht Heizwert Nachteile gegenüber Brennwert Brennwert Vorteile gegenüber Heizwert Preisvergleich Ökodesign-Richtlinie (ErP) Heizwert Der Heizwert
Aufgaben. 2 Physikalische Grundlagen
 Der Verdampfungs- oder Kondensationspunkt jedes Stoffes ist von der Temperatur und dem Druck abhängig. Für jede Verdampfungstemperatur gibt es nur einen zugehörigen Verdampfungsdruck und für jeden Verdampfungsdruck
Der Verdampfungs- oder Kondensationspunkt jedes Stoffes ist von der Temperatur und dem Druck abhängig. Für jede Verdampfungstemperatur gibt es nur einen zugehörigen Verdampfungsdruck und für jeden Verdampfungsdruck
Lehrabschlussprüfungs Vorbereitungskurs Rauchfangkehrer. Brennstoffe. Wir Unterscheiden grundsätzlich Brennstoffe in:
 Lehrabschlussprüfungs Vorbereitungskurs Rauchfangkehrer Wir Unterscheiden grundsätzlich in: Feste Flüssige Gasförmige Biomasse Feste Torf Holz Kohle Brikett Koks Anthrazit Holz: Anwendung: Kachelofen,
Lehrabschlussprüfungs Vorbereitungskurs Rauchfangkehrer Wir Unterscheiden grundsätzlich in: Feste Flüssige Gasförmige Biomasse Feste Torf Holz Kohle Brikett Koks Anthrazit Holz: Anwendung: Kachelofen,
Erdgas-Brennwert-Heizkessel
 Erdgas-Brennwert-Heizkessel Spart Energie und verringert Emissionen Aus der Broschürenreihe: Spar Energie wir zeigen wie Energie sparende Heizungstechnik Arbeitsprinzip des Erdgas-Brennwert-Heizkessels
Erdgas-Brennwert-Heizkessel Spart Energie und verringert Emissionen Aus der Broschürenreihe: Spar Energie wir zeigen wie Energie sparende Heizungstechnik Arbeitsprinzip des Erdgas-Brennwert-Heizkessels
80 C. QUERSCHNITTSBEMESSUNG Erdgas - Gasspezialkessel (mit Brenner ohne Gebläse) QUERSCHNITTSBEMESSUNG Diagramm 1.1 Erdgas TNF
 Schiedel TECNOFIX Erdgas - Gasspezialkessel (mit Brenner ohne Gebläse) Diagramm 1.1 Erdgas Gasfeuerung mit Brenner ohne Gebläse (atmosphärischer Brenner) Heizkessel mit Zugbedarf mit Brenner ohne Gebläse
Schiedel TECNOFIX Erdgas - Gasspezialkessel (mit Brenner ohne Gebläse) Diagramm 1.1 Erdgas Gasfeuerung mit Brenner ohne Gebläse (atmosphärischer Brenner) Heizkessel mit Zugbedarf mit Brenner ohne Gebläse
Energie- und Kältetechnik Klausur WS 2008/2009
 Aufgabenteil / 00 Minuten Name: Vorname: Matr.-Nr.: Das Aufgabenblatt muss unterschrieben und zusammen mit den (nummerierten und mit Namen versehenen) Lösungsblättern abgegeben werden. Nicht nachvollziehbare
Aufgabenteil / 00 Minuten Name: Vorname: Matr.-Nr.: Das Aufgabenblatt muss unterschrieben und zusammen mit den (nummerierten und mit Namen versehenen) Lösungsblättern abgegeben werden. Nicht nachvollziehbare
Abgasmessung. Beiblatt zum Abgasmessgerät. Bestimmung des feuerungstechnischen Wirkungsgrades
 Abgasmessung Beiblatt zum Abgasmessgerät Bestimmung des feuerungstechnischen Wirkungsgrades Der feuerungstechnische Wirkungsgrad errechnet sich: Aus der Differenz von 100 und dem Abgasverlust in Prozenten
Abgasmessung Beiblatt zum Abgasmessgerät Bestimmung des feuerungstechnischen Wirkungsgrades Der feuerungstechnische Wirkungsgrad errechnet sich: Aus der Differenz von 100 und dem Abgasverlust in Prozenten
DAMPF UND KONDENSAT IN ROHRLEITUNGEN
 DAMPF UND KONDENSAT IN ROHRLEITUNGEN Durch Rohrleitungen strömt Dampf oder Kondensat zum Verbraucher. Die Rohrleitungen sollten nicht zu klein und nicht zu groß sein. Ist die Rohrleitung zu klein, passt
DAMPF UND KONDENSAT IN ROHRLEITUNGEN Durch Rohrleitungen strömt Dampf oder Kondensat zum Verbraucher. Die Rohrleitungen sollten nicht zu klein und nicht zu groß sein. Ist die Rohrleitung zu klein, passt
Versuch 3 ( Kalorimeter C 4000 ) Messung des Brenn- und Heizwertes ( DIN )
 Versuch 3 ( Kalorimeter C 4000 ) Messung des Brenn- und Heizwertes ( DIN 51900 ) Versuch 3 Messung des Brenn- und Heizwertes ( DIN 51900-1 ) ( Kalorimeter C 4000 ) 3.1 Einführung Brennwert und Heizwert
Versuch 3 ( Kalorimeter C 4000 ) Messung des Brenn- und Heizwertes ( DIN 51900 ) Versuch 3 Messung des Brenn- und Heizwertes ( DIN 51900-1 ) ( Kalorimeter C 4000 ) 3.1 Einführung Brennwert und Heizwert
Wärmepumpe. Verflüssiger. Verdichter. Strom. Drosselventil. Umwelt
 Wärmepumpe Wärmepumpe Eine Wärmepumpe nutzt die in der Umwelt gespeicherte Wärme, etwa aus der Außenluft oder dem Erdboden. Das Temperaturniveau dieser in der Umwelt gespeicherten Energie wird mittels
Wärmepumpe Wärmepumpe Eine Wärmepumpe nutzt die in der Umwelt gespeicherte Wärme, etwa aus der Außenluft oder dem Erdboden. Das Temperaturniveau dieser in der Umwelt gespeicherten Energie wird mittels
www.ihk-hessen.de RATGEBER WÄRME IN HESSEN Industrie- und Handelskammer
 Arbeitsgemeinschaft hessischer n Telefon 069 2197-1384 Telefax 069 2197-1497 www.ihk-hessen.de Kassel-Marburg Kurfürstenstraße 9 34117 Kassel Telefon 0561 7891-0 Telefax 0561 7891-290 www.ihk-kassel.de
Arbeitsgemeinschaft hessischer n Telefon 069 2197-1384 Telefax 069 2197-1497 www.ihk-hessen.de Kassel-Marburg Kurfürstenstraße 9 34117 Kassel Telefon 0561 7891-0 Telefax 0561 7891-290 www.ihk-kassel.de
EXKURS ANFORDERUNGEN AN EMISSIONEN UND WIRKUNGSGRADE BEI DER PRÜFUNG VON HEIZKESSEL NACH EN 303-5:2012. Anforderungen der EN 303-5:2012
 EXKURS ANFORDERUNGEN AN EMISSIONEN UND WIRKUNGSGRADE BEI DER PRÜFUNG VON HEIZKESSEL NACH EN 303-5:2012 Anforderungen der EN 303-5:2012 Gesetzliche Anforderungen an Kleinfeuerungen für biogene Brennstoffe
EXKURS ANFORDERUNGEN AN EMISSIONEN UND WIRKUNGSGRADE BEI DER PRÜFUNG VON HEIZKESSEL NACH EN 303-5:2012 Anforderungen der EN 303-5:2012 Gesetzliche Anforderungen an Kleinfeuerungen für biogene Brennstoffe
Integration von Heizkesseln in Wärmeverbundsysteme mit großen Solaranlagen Vorstellung Kesselprüfstand Dipl.-Ing.
 Integration von Heizkesseln in Wärmeverbundsysteme mit großen Solaranlagen Vorstellung Kesselprüfstand Dipl.Ing. (FH) Jörn Deidert Zugrunde liegenden Normen DIN EN 3033 Heizkessel Teil 3: Zentralheizkessel
Integration von Heizkesseln in Wärmeverbundsysteme mit großen Solaranlagen Vorstellung Kesselprüfstand Dipl.Ing. (FH) Jörn Deidert Zugrunde liegenden Normen DIN EN 3033 Heizkessel Teil 3: Zentralheizkessel
Merkblatt betreffend Kennwerte zur Bemessung von Abgasanlagen
 LIEFERANTENVERBAND HEIZUNGSMATERIALIEN ASSOCIATION DES FOURNISSEURS DE MATERIEL DE CHAUFFAGE PROCAL Merkblatt betreffend Kennwerte zur Bemessung von Abgasanlagen Die Funktionssicherheit einer Heizungsanlage
LIEFERANTENVERBAND HEIZUNGSMATERIALIEN ASSOCIATION DES FOURNISSEURS DE MATERIEL DE CHAUFFAGE PROCAL Merkblatt betreffend Kennwerte zur Bemessung von Abgasanlagen Die Funktionssicherheit einer Heizungsanlage
Industriebrennstoffe
 Industriebrennstoffe apl.prof. Dr.-Ing.habil. Th. Hackensellner Begleitmaterial ausschließlich zur Vorlesung Energiemonitoring. Veröffentlichung und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Verfassers.
Industriebrennstoffe apl.prof. Dr.-Ing.habil. Th. Hackensellner Begleitmaterial ausschließlich zur Vorlesung Energiemonitoring. Veröffentlichung und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Verfassers.
Abrechnung Gas Die Grundlagen für das Ermitteln der energetischen Menge in kwh
 Abrechnung Gas Die Grundlagen für das Ermitteln der energetischen Menge in kwh Inhaltsverzeichnis 1. Grundlagen der Abrechnung Gas 2. Vertriebsabrechnung Gas 2.1 Begrifflichkeiten 2.2 die Anwendung in
Abrechnung Gas Die Grundlagen für das Ermitteln der energetischen Menge in kwh Inhaltsverzeichnis 1. Grundlagen der Abrechnung Gas 2. Vertriebsabrechnung Gas 2.1 Begrifflichkeiten 2.2 die Anwendung in
Klausur Thermische Kraftwerke (Energieanlagentechnik I)
 Klausur Thermische Kraftwerke (Energieanlagentechnik I) Datum: 06.0.2006 Dauer:,5 Std. Der Gebrauch von nicht-programmierbaren Taschenrechnern und schriftlichen Unterlagen ist erlaubt. Aufgabe 2 4 5 6
Klausur Thermische Kraftwerke (Energieanlagentechnik I) Datum: 06.0.2006 Dauer:,5 Std. Der Gebrauch von nicht-programmierbaren Taschenrechnern und schriftlichen Unterlagen ist erlaubt. Aufgabe 2 4 5 6
Messen und Überprüfen
 Lehrabschlussprüfungs Vorbereitungskurs Rauchfangkehrer Messen und Überprüfen Abgasmessung Steiermärkisches Feuerungsanlagengesetz FAnlG. 2001 1. Abschnitt Die wichtigsten allgemeinen Begriffsbestimmungen
Lehrabschlussprüfungs Vorbereitungskurs Rauchfangkehrer Messen und Überprüfen Abgasmessung Steiermärkisches Feuerungsanlagengesetz FAnlG. 2001 1. Abschnitt Die wichtigsten allgemeinen Begriffsbestimmungen
Energieeinsparverordnung - Glossar
 Energieeinsparverordnung - Glossar Abgasverlust Bei der Verbrennung des Energieträgers kann die eingesetzte Energie nicht vollständig genutzt werden. Ein Teil der Energie entweicht über die warmen Abgase
Energieeinsparverordnung - Glossar Abgasverlust Bei der Verbrennung des Energieträgers kann die eingesetzte Energie nicht vollständig genutzt werden. Ein Teil der Energie entweicht über die warmen Abgase
M5 Viskosität von Flüssigkeiten
 Christian Müller Jan Philipp Dietrich M5 Viskosität von Flüssigkeiten I. Dynamische Viskosität a) Erläuterung b) Berechnung der dynamischen Viskosität c) Fehlerrechnung II. Kinematische Viskosität a) Gerätekonstanten
Christian Müller Jan Philipp Dietrich M5 Viskosität von Flüssigkeiten I. Dynamische Viskosität a) Erläuterung b) Berechnung der dynamischen Viskosität c) Fehlerrechnung II. Kinematische Viskosität a) Gerätekonstanten
Prüfbericht Pufferspeicher Bestimmung der Wärmeverlustrate für vier verschiedene Wärmedämmungen
 FORSCHUNGS- UND TESTZENTRUM FÜR SOLARANLAGEN Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik Universität Stuttgart in Kooperation mit Prüfbericht Pufferspeicher Bestimmung der Wärmeverlustrate für vier verschiedene
FORSCHUNGS- UND TESTZENTRUM FÜR SOLARANLAGEN Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik Universität Stuttgart in Kooperation mit Prüfbericht Pufferspeicher Bestimmung der Wärmeverlustrate für vier verschiedene
Eva Schumann Gerhard Milicka. Das. Kleingewächshaus
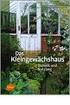 Eva Schumann Gerhard Milicka Das Kleingewächshaus 21 Das Gewächshaus, seine Ausstattung und spezielle Einrichtungen Für jeden Zweck und jeden Anspruch an die optische Wirkung gibt es das passende Gewächshaus.
Eva Schumann Gerhard Milicka Das Kleingewächshaus 21 Das Gewächshaus, seine Ausstattung und spezielle Einrichtungen Für jeden Zweck und jeden Anspruch an die optische Wirkung gibt es das passende Gewächshaus.
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg
 TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg GRUNDLAGEN Modul: Versuch: Elektrochemie 1 Abbildung 1: I. VERSUCHSZIEL
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg GRUNDLAGEN Modul: Versuch: Elektrochemie 1 Abbildung 1: I. VERSUCHSZIEL
Kopf SynGas Fact Sheet Mannheim
 Fact Sheet Kopf SynGas GmbH & Co. KG Stützenstrasse 6 72172 Sulz Tel. 07454 75-0 Fax: 07454 75-310 www.ssk-gruppe.de Stand: 2010 1 Auslegungsdaten Schlammenge (92% TS): Rechengut (60%TS): 10.000 To/a 800
Fact Sheet Kopf SynGas GmbH & Co. KG Stützenstrasse 6 72172 Sulz Tel. 07454 75-0 Fax: 07454 75-310 www.ssk-gruppe.de Stand: 2010 1 Auslegungsdaten Schlammenge (92% TS): Rechengut (60%TS): 10.000 To/a 800
NAME, Vorname Matr.-Nr. Studiengang. Prüfung am im Fach Thermodynamik II
 NAME, Vorname Matr.-Nr. Studiengang ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º º Ë Ñ ØÞ Prüfung am 12. 08. 2014 im Fach Thermodynamik II Fragenteil ohne Hilfsmittel erreichbare Punktzahl: 20 Dauer: 15 Minuten Regeln Nur eine eindeutige
NAME, Vorname Matr.-Nr. Studiengang ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º º Ë Ñ ØÞ Prüfung am 12. 08. 2014 im Fach Thermodynamik II Fragenteil ohne Hilfsmittel erreichbare Punktzahl: 20 Dauer: 15 Minuten Regeln Nur eine eindeutige
Energiesparen im Industriebetrieb. Dampfkessel. J. Fresner, G. Engelhardt Geidorfgürtel 21, 8010 Graz
 Energiesparen im Industriebetrieb Dampfkessel J. Fresner, G. Engelhardt Geidorfgürtel 21, 8010 Graz www.stenum.at Elemente einer Dampfkesselanlage Brennstoffzufuhr Luftzufuhr Feuerraum Speisewasseraufbereitung
Energiesparen im Industriebetrieb Dampfkessel J. Fresner, G. Engelhardt Geidorfgürtel 21, 8010 Graz www.stenum.at Elemente einer Dampfkesselanlage Brennstoffzufuhr Luftzufuhr Feuerraum Speisewasseraufbereitung
Institut für Thermodynamik Prof. Dr. rer. nat. M. Pfitzner Thermodynamik I - Lösung 5
 Aufgabe 20 In einem Kalorimeter soll die mittlere spezifische Wärmekapazität eines Öls zwischen 20 C und 00 C bestimmt werden. Das Kalorimeter wurde mit 3 kg Öl gefüllt. Mit einer elektrischen Heizung
Aufgabe 20 In einem Kalorimeter soll die mittlere spezifische Wärmekapazität eines Öls zwischen 20 C und 00 C bestimmt werden. Das Kalorimeter wurde mit 3 kg Öl gefüllt. Mit einer elektrischen Heizung
Seminar Thermische Abfallbehandlung - Veranstaltung 5 - Dampfkraftanlagen - Wirkungsgradberechnung
 Institut für Abfallwirtschaft und Altlasten, TU-Dresden Seminar Thermische Abfallbehandlung - Veranstaltung 5 - Dampfkraftanlagen - Wirkungsgradberechnung Dresden, 30. Juni 2008 Dipl.- Ing. Christoph Wünsch,
Institut für Abfallwirtschaft und Altlasten, TU-Dresden Seminar Thermische Abfallbehandlung - Veranstaltung 5 - Dampfkraftanlagen - Wirkungsgradberechnung Dresden, 30. Juni 2008 Dipl.- Ing. Christoph Wünsch,
Lösungen der Aufgaben
 Energie und Energiemanagement Energie in verschiedenen Varianten der Aufgaben - Energiespeicherung - - Energieverluste - - Luft und Feuchtigkeit - 1 Aufgabe 1 Ein Gebäude hat einem Wärmebedarf von 24.000
Energie und Energiemanagement Energie in verschiedenen Varianten der Aufgaben - Energiespeicherung - - Energieverluste - - Luft und Feuchtigkeit - 1 Aufgabe 1 Ein Gebäude hat einem Wärmebedarf von 24.000
Ausfüllanleitung für die Anlage 5 (Vordruck für Feuerungsanlagen)
 info@schornsteinfeger-cosmos.de www.schornsteinfeger.cosmos.de Ausfüllanleitung für die Anlage 5 (Vordruck für Feuerungsanlagen) Grundsätzliches wichtig bitte lesen!! Die Anlage 5 ist in 11 Abschnitte
info@schornsteinfeger-cosmos.de www.schornsteinfeger.cosmos.de Ausfüllanleitung für die Anlage 5 (Vordruck für Feuerungsanlagen) Grundsätzliches wichtig bitte lesen!! Die Anlage 5 ist in 11 Abschnitte
1 Allgemeine technische Angaben 2. 2 Heizwände horizontal 12. Werte nach EN 442 für Längen von 0.50 6.00 m. 3 Heizwände vertikal 102
 1 Allgemeine technische Angaben 2 Seite Allgemeine techn. Angaben 2 12 Wärmeleistungstabellen Werte nach für Längen von 0.50 6.00 m Werte für Übertemperaturen T von 10 50 K für 1m Baulänge 3 Heizwände
1 Allgemeine technische Angaben 2 Seite Allgemeine techn. Angaben 2 12 Wärmeleistungstabellen Werte nach für Längen von 0.50 6.00 m Werte für Übertemperaturen T von 10 50 K für 1m Baulänge 3 Heizwände
BKA/RIS Landesrecht Oberösterreich - Volltext
 BKA/RIS esrecht - olltext Seite 1 von 6 0 Langtitel erordnung der Oö. esregierung vom 7. April 1997 über die Wirkungsgrade von mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasserbereitungsanlagen
BKA/RIS esrecht - olltext Seite 1 von 6 0 Langtitel erordnung der Oö. esregierung vom 7. April 1997 über die Wirkungsgrade von mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasserbereitungsanlagen
Auslegung von Sondenfeldern
 Auslegung von Sondenfeldern Ermittlung des Volumenstromes: Als Grundlage dient die Formel: Q = m x c x t Damit wird die Sole-Umlaufmenge in kg berechnet. Q = Wärmemenge kwh m = Masse (Umlaufmenge) kg c
Auslegung von Sondenfeldern Ermittlung des Volumenstromes: Als Grundlage dient die Formel: Q = m x c x t Damit wird die Sole-Umlaufmenge in kg berechnet. Q = Wärmemenge kwh m = Masse (Umlaufmenge) kg c
Gasmotor-Wärmepumpe Absorptions-Wärmepumpe Diffusions-Absorptions-Wärmepumpe
 Seite 1.1 Gasbetriebene Wärmepumpen Gaswärmepumpen werden unabhängig von ihrer Bauart hauptsächlich mit Erdgas angetrieben. Zusätzlich wird durch die Nutzung von Umgebungswärme der Wirkungsgrad im Vergleich
Seite 1.1 Gasbetriebene Wärmepumpen Gaswärmepumpen werden unabhängig von ihrer Bauart hauptsächlich mit Erdgas angetrieben. Zusätzlich wird durch die Nutzung von Umgebungswärme der Wirkungsgrad im Vergleich
Neue Wege der Abgasreinigung und Wärmerückgewinnung von Kleinanlagen
 Neue Wege der Abgasreinigung und Wärmerückgewinnung von Kleinanlagen Fachtagung Weg vom Öl Die Zukunft dezentraler Wärmesysteme Januar 2007 Landwirtschaftszentrum Haus Düsse 1 Gliederung - Einleitung und
Neue Wege der Abgasreinigung und Wärmerückgewinnung von Kleinanlagen Fachtagung Weg vom Öl Die Zukunft dezentraler Wärmesysteme Januar 2007 Landwirtschaftszentrum Haus Düsse 1 Gliederung - Einleitung und
1) Gas-Zufuhr 2) Gas-Brenner 3) Gehäuse 4) Wärmetauscher 5) Kalt-Wasser 6) Warm-Wasser 7) Strömungssicherung 8) Kamin
 Technische Mathematik ohne Formeln Gas-Therme Seite 1 von 7 1) Gas-Zufuhr 2) Gas-Brenner 3) Gehäuse 4) Wärmetauscher 5) Kalt-Wasser 6) Warm-Wasser 7) Strömungssicherung 8) Kamin Abbildung 1 Gastherme Technische
Technische Mathematik ohne Formeln Gas-Therme Seite 1 von 7 1) Gas-Zufuhr 2) Gas-Brenner 3) Gehäuse 4) Wärmetauscher 5) Kalt-Wasser 6) Warm-Wasser 7) Strömungssicherung 8) Kamin Abbildung 1 Gastherme Technische
Berechnung der Schornsteinhöhe am Beispiel eines Braunkohlenkraftwerkes mit Festlegung des Beurteilungsgebietes
 Anhang III Seite 1 von 8 Schornsteinhöhenbestimmung nach der TA Luft Berechnung der Schornsteinhöhe am Beispiel eines Braunkohlenkraftwerkes mit Festlegung des Beurteilungsgebietes Beispiel: Wesentliche
Anhang III Seite 1 von 8 Schornsteinhöhenbestimmung nach der TA Luft Berechnung der Schornsteinhöhe am Beispiel eines Braunkohlenkraftwerkes mit Festlegung des Beurteilungsgebietes Beispiel: Wesentliche
Übungsaufgaben zu den LPE 11: Wärme erzeugen und 12: Brennstoffzelle. Inhaltsverzeichnis
 Übungsaufgaben zu den LPE 11: Wärme erzeugen und 12: Brennstoffzelle Themenbereiche LPE 11: Solarthermie Brennwerttechnik Wärmepumpe Blockheizkraftwerke LPE 12: Brennstoffzelle Prüfungsvorbereitung Energie-,
Übungsaufgaben zu den LPE 11: Wärme erzeugen und 12: Brennstoffzelle Themenbereiche LPE 11: Solarthermie Brennwerttechnik Wärmepumpe Blockheizkraftwerke LPE 12: Brennstoffzelle Prüfungsvorbereitung Energie-,
7.2 Energiebilanz bei chemischen Stoffumwandlungen
 7.2 Energiebilanz bei chemischen Stoffumwandlungen Betrachtung eines Reaktionsgefäßes mit eintretenden Edukten und austretenden Produkten am Beispiel der Verbrennung eines Brennstoffes mit Luft (kinetische
7.2 Energiebilanz bei chemischen Stoffumwandlungen Betrachtung eines Reaktionsgefäßes mit eintretenden Edukten und austretenden Produkten am Beispiel der Verbrennung eines Brennstoffes mit Luft (kinetische
Brennwerttechnik der neue Stand der Technik auch bei Pelletheizungen?
 Brennwerttechnik der neue Stand der Technik auch bei Pelletheizungen? Ein Erfahrungsbericht Lothar Tomaschko, Geschäftsführer ÖkoFEN Heiztechnik GmbH Renexpo Holz-Energiekongress 07.10.2016 Vorstellung
Brennwerttechnik der neue Stand der Technik auch bei Pelletheizungen? Ein Erfahrungsbericht Lothar Tomaschko, Geschäftsführer ÖkoFEN Heiztechnik GmbH Renexpo Holz-Energiekongress 07.10.2016 Vorstellung
Abgasmessung. Beiblatt zum Abgasmessgerät. Bestimmung des feuerungstechnischen Wirkungsgrades
 Abgasmessung Beiblatt zum Abgasmessgerät Bestimmung des feuerungstechnischen Wirkungsgrades Der feuerungstechnische Wirkungsgrad errechnet sich: Aus der Differenz von 100 und dem Abgasverlust in Prozenten
Abgasmessung Beiblatt zum Abgasmessgerät Bestimmung des feuerungstechnischen Wirkungsgrades Der feuerungstechnische Wirkungsgrad errechnet sich: Aus der Differenz von 100 und dem Abgasverlust in Prozenten
Schriftliche Prüfung aus VO Kraftwerke am Name/Vorname: / Matr.-Nr./Knz.: /
 Schriftliche Prüfung aus VO Kraftwerke am 22.06.2016 KW 06/2016 Name/Vorname: / Matr.-Nr./Knz.: / 1. Beispiel 1: Gasturbine mit geschlossenem Kreislauf (25 Punkte) Ein Joule-Prozess soll berechnet werden.
Schriftliche Prüfung aus VO Kraftwerke am 22.06.2016 KW 06/2016 Name/Vorname: / Matr.-Nr./Knz.: / 1. Beispiel 1: Gasturbine mit geschlossenem Kreislauf (25 Punkte) Ein Joule-Prozess soll berechnet werden.
Übung 1. Göksel Özuylasi Tel.: Torsten Methling Tel.
 Göksel Özuylasi Email: goeksel.oezuylasi@dlr.de Tel.: 0711 6862 8098 Torsten Methling Email: torsten.methling@dlr.de Tel.: 0711 6862 277 WS 2013/14 Übung - Einführung in die Verbrennung - Özuylasi, Methling
Göksel Özuylasi Email: goeksel.oezuylasi@dlr.de Tel.: 0711 6862 8098 Torsten Methling Email: torsten.methling@dlr.de Tel.: 0711 6862 277 WS 2013/14 Übung - Einführung in die Verbrennung - Özuylasi, Methling
Ihr Bezirksschornsteinfegermeister informiert:
 Lutz Kühl Tel.: 04332-9 87 87 Bezirksschornsteinfegermeister Fax: 04332-9 87 85 Kurze Straße 2 info@bsmkuehl.de 24800 Elsdorf-Westermühlen www.bsmkuehl.de Ihr Bezirksschornsteinfegermeister informiert:
Lutz Kühl Tel.: 04332-9 87 87 Bezirksschornsteinfegermeister Fax: 04332-9 87 85 Kurze Straße 2 info@bsmkuehl.de 24800 Elsdorf-Westermühlen www.bsmkuehl.de Ihr Bezirksschornsteinfegermeister informiert:
Energieeffizienz bei automatischen Holzfeuerungen Erfahrungen aus der angewandten Praxis
 Energieeffizienz bei automatischen Holzfeuerungen Erfahrungen aus der angewandten Praxis Referat von: Oskar Leiser - ErnEL GmbH, Betriebsoptimierungen, 4410 Liestal Was ist überhaupt Energieeffizienz?
Energieeffizienz bei automatischen Holzfeuerungen Erfahrungen aus der angewandten Praxis Referat von: Oskar Leiser - ErnEL GmbH, Betriebsoptimierungen, 4410 Liestal Was ist überhaupt Energieeffizienz?
BRENNWERTTECHNIK Energiesparend und umweltschonend...
 3. Ausgabe 2000 BRENNWERTTECHNIK Energiesparend und umweltschonend... Ein Leitfaden der FORMAT Handelsgruppe 21 Brennwerttechnik Umweltschutz und Energieersparnis Die Brennwerttechnik ist seit langem bekannt.
3. Ausgabe 2000 BRENNWERTTECHNIK Energiesparend und umweltschonend... Ein Leitfaden der FORMAT Handelsgruppe 21 Brennwerttechnik Umweltschutz und Energieersparnis Die Brennwerttechnik ist seit langem bekannt.
Konfidenzintervall für den Anteilswert θ. Konfidenzintervalle. Jost Reinecke. Universität Bielefeld. 13. Juni 2005
 Universität Bielefeld 13. Juni 2005 Einführung Einführung Wie kann die Kenntnis der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Parameter einer Stichprobe dazu verhelfen auf die wahren Werte der Grundgesamtheit
Universität Bielefeld 13. Juni 2005 Einführung Einführung Wie kann die Kenntnis der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Parameter einer Stichprobe dazu verhelfen auf die wahren Werte der Grundgesamtheit
Thermodynamik 2 Klausur 19. September 2012
 Thermodynamik 2 Klausur 19. September 2012 Bearbeitungszeit: 120 Minuten Umfang der Aufgabenstellung: 5 nummerierte Seiten Alle Unterlagen zu Vorlesung und Übung sowie Lehrbücher und Taschenrechner sind
Thermodynamik 2 Klausur 19. September 2012 Bearbeitungszeit: 120 Minuten Umfang der Aufgabenstellung: 5 nummerierte Seiten Alle Unterlagen zu Vorlesung und Übung sowie Lehrbücher und Taschenrechner sind
Erläuterung der Messbescheinigung gemäß 14 und 15-1.BImSchV
 Erläuterung der Messbescheinigung gemäß 14 und 15-1.BImSchV Form und Inhalt der Bescheinigung sind in der Anlage III der 1.BImSchV fest vorgegeben. Die Messbescheinigung wird Ihnen nach Durchführung der
Erläuterung der Messbescheinigung gemäß 14 und 15-1.BImSchV Form und Inhalt der Bescheinigung sind in der Anlage III der 1.BImSchV fest vorgegeben. Die Messbescheinigung wird Ihnen nach Durchführung der
Heizung OK? Ist Ihre Heizung noch OK?
 Heizung OK? Ist Ihre Heizung noch OK? Das Messprotokoll des Schornsteinfegers: "Verringern alle Haushalte ihren Abgasverlust um ein Prozent, so reicht die eingesparte Energiemenge zur Beheizung von 500.000
Heizung OK? Ist Ihre Heizung noch OK? Das Messprotokoll des Schornsteinfegers: "Verringern alle Haushalte ihren Abgasverlust um ein Prozent, so reicht die eingesparte Energiemenge zur Beheizung von 500.000
Novellierung der 1.BImSchV neue Regelungen. Holzheizkessel
 Novellierung der 1.BImSchV neue Regelungen für r Kaminöfen und Holzheizkessel Referent: Albert Jung Schornsteinfeger Energieberater Schimmelgutachter Die Verordnung regelt: - die Errichtung, - die Beschaffenheit
Novellierung der 1.BImSchV neue Regelungen für r Kaminöfen und Holzheizkessel Referent: Albert Jung Schornsteinfeger Energieberater Schimmelgutachter Die Verordnung regelt: - die Errichtung, - die Beschaffenheit
Feuerungen und Umwelt
 Feuerungen und Umwelt Der Kohlenstoffkreislauf Anstieg der CO 2 -Konzentration der Atmosphäre Der Treibhauseffekt Klimatische Auswirkungen von Feuerungen Gibt es einen Ausweg? Energiekosten und Energiepolitik
Feuerungen und Umwelt Der Kohlenstoffkreislauf Anstieg der CO 2 -Konzentration der Atmosphäre Der Treibhauseffekt Klimatische Auswirkungen von Feuerungen Gibt es einen Ausweg? Energiekosten und Energiepolitik
Mehr Informationen zum Titel
 Mehr Informationen zum Titel 17 Bemessung von Kabeln und Leitungen DIN VDE 00-30 17.1 Allgemeine Anforderungen Nach DIN VDE 00-0 Abschnitt 131. gilt für den Schutz bei Überstrom folgender Merksatz: Personen
Mehr Informationen zum Titel 17 Bemessung von Kabeln und Leitungen DIN VDE 00-30 17.1 Allgemeine Anforderungen Nach DIN VDE 00-0 Abschnitt 131. gilt für den Schutz bei Überstrom folgender Merksatz: Personen
Brenne und Löschen Grundlagen
 Brennen und Löschen Jugendfeuerwehr Mühlheim Brenne und Löschen Grundlagen JFM / JG 2007 1 Brennen: Brennen ist durch eine Flamme und/oder Glut selbstständig ablaufende Reaktion zwischen einem brennbaren
Brennen und Löschen Jugendfeuerwehr Mühlheim Brenne und Löschen Grundlagen JFM / JG 2007 1 Brennen: Brennen ist durch eine Flamme und/oder Glut selbstständig ablaufende Reaktion zwischen einem brennbaren
Betonieren bei kaltem Wetter.
 Betonieren bei kaltem Wetter. Holcim (Süddeutschland) GmbH D-72359 Dotternhausen Telefon +49 (0) 7427 79-300 Telefax +49 (0) 7427 79-248 info-sueddeutschland@holcim.com www.holcim.de/sued Einleitung Der
Betonieren bei kaltem Wetter. Holcim (Süddeutschland) GmbH D-72359 Dotternhausen Telefon +49 (0) 7427 79-300 Telefax +49 (0) 7427 79-248 info-sueddeutschland@holcim.com www.holcim.de/sued Einleitung Der
Schriftliche Prüfung aus VO Kraftwerke am 01.10.2015. Name/Vorname: / Matr.-Nr./Knz.: /
 Schriftliche Prüfung aus VO Kraftwerke am 01.10.2015 Name/Vorname: / Matr.-Nr./Knz.: / 1. Gasturbine mit geschlossenem Kreislauf (25 Punkte) Ein Joule-Prozess soll berechnet werden. Eine Gasturbine mit
Schriftliche Prüfung aus VO Kraftwerke am 01.10.2015 Name/Vorname: / Matr.-Nr./Knz.: / 1. Gasturbine mit geschlossenem Kreislauf (25 Punkte) Ein Joule-Prozess soll berechnet werden. Eine Gasturbine mit
NAME, Vorname Matr.-Nr. Studiengang. Prüfung am im Fach Thermodynamik II
 NAME, Vorname Matr.-Nr. Studiengang Prof. Dr.-Ing. G. Schmitz Prüfung am 16. 07. 2012 im Fach Thermodynamik II Fragenteil ohne Hilfsmittel erreichbare Punktzahl: 20 Dauer: 20 Minuten 1. (4 Punkte) Skizzieren
NAME, Vorname Matr.-Nr. Studiengang Prof. Dr.-Ing. G. Schmitz Prüfung am 16. 07. 2012 im Fach Thermodynamik II Fragenteil ohne Hilfsmittel erreichbare Punktzahl: 20 Dauer: 20 Minuten 1. (4 Punkte) Skizzieren
Produktkatalog 2015/2016
 Produktkatalog 2015/2016 Holzkohle Holzkohle ist ein Brennstoff, welcher entsteht, wenn lufttrockenes Holz ohne Zufuhr von Sauerstoff auf 350 400 C erhitzt wird. Holzkohle ist ein Gemisch organischer Verbindungen
Produktkatalog 2015/2016 Holzkohle Holzkohle ist ein Brennstoff, welcher entsteht, wenn lufttrockenes Holz ohne Zufuhr von Sauerstoff auf 350 400 C erhitzt wird. Holzkohle ist ein Gemisch organischer Verbindungen
Thermodynamik II Klausur SS 2006
 Thermodynamik II Klausur SS 0 Prof. Dr. G. Wilhelms Aufgabenteil / 00 Minuten / Blatt Das Aufgabenblatt muss unterschrieben und zusammen mit den (nummerierten und mit Namen versehenen) Lösungsblättern
Thermodynamik II Klausur SS 0 Prof. Dr. G. Wilhelms Aufgabenteil / 00 Minuten / Blatt Das Aufgabenblatt muss unterschrieben und zusammen mit den (nummerierten und mit Namen versehenen) Lösungsblättern
Das neue Kesselzeitalter beginnt jetzt mit dem Domotec A1 Heizkessel
 Tipps für die Praxis Domotec AG Aarburg Ausgabe 16.19 07/2011 Das neue Kesselzeitalter beginnt jetzt mit dem Domotec A1 Heizkessel Domotec A1 ist eine völlig neuartige Heizkessel-Generation in den Ausführungen:
Tipps für die Praxis Domotec AG Aarburg Ausgabe 16.19 07/2011 Das neue Kesselzeitalter beginnt jetzt mit dem Domotec A1 Heizkessel Domotec A1 ist eine völlig neuartige Heizkessel-Generation in den Ausführungen:
Sind Ihre Heizkosten zu hoch?
 - 1 - Sind Ihre Heizkosten zu hoch? Noch vor einigen Jahren spielten die Heizkosten keine große Rolle. Sie hatten nur einen geringen Anteil an den Haushaltskosten. Heute steht fest, dass die enorme Verteuerung
- 1 - Sind Ihre Heizkosten zu hoch? Noch vor einigen Jahren spielten die Heizkosten keine große Rolle. Sie hatten nur einen geringen Anteil an den Haushaltskosten. Heute steht fest, dass die enorme Verteuerung
T7 Phasenumwandlungsenthalpie
 Christian Müller Jan Philipp Dietrich T7 Phasenumwandlungsenthalpie 1. Bestimmung der Kondensationsenthalpie und -entropie a) Versuchserläuterung b) Werte und Grafiken c) Berechnung der Kondensationsenthalpie
Christian Müller Jan Philipp Dietrich T7 Phasenumwandlungsenthalpie 1. Bestimmung der Kondensationsenthalpie und -entropie a) Versuchserläuterung b) Werte und Grafiken c) Berechnung der Kondensationsenthalpie
Thermodynamik 2 Klausur 11. März 2011
 Thermodynamik 2 Klausur 11. März 2011 Bearbeitungszeit: 120 Minuten Umfang der Aufgabenstellung: 4 nummerierte Seiten Alle Unterlagen zu Vorlesung und Übung sowie Lehrbücher und Taschenrechner sind als
Thermodynamik 2 Klausur 11. März 2011 Bearbeitungszeit: 120 Minuten Umfang der Aufgabenstellung: 4 nummerierte Seiten Alle Unterlagen zu Vorlesung und Übung sowie Lehrbücher und Taschenrechner sind als
Lösungen Serie 16: Kalorimetrie
 en Serie 16: Kalorimetrie Aufgabe 16.1 A Sie wollen in einem Kochtopf ( =0.6, =0.4 ( =4.182 k K gegeben: =0.6 =0.4 k K ) einen halben Liter Wasser ) von 10 auf 40 erwärmen. Welche Wärmemenge ist dazu notwendig?
en Serie 16: Kalorimetrie Aufgabe 16.1 A Sie wollen in einem Kochtopf ( =0.6, =0.4 ( =4.182 k K gegeben: =0.6 =0.4 k K ) einen halben Liter Wasser ) von 10 auf 40 erwärmen. Welche Wärmemenge ist dazu notwendig?
Allein in Deutschland sind noch rund zwei Millionen Heizungsanlagen in Betrieb, die älter
 Öl-Brennwertkessel Mit einem Öl-Brennwertkessel leisten Sie dank seiner Effizienz und des unschlagbar hohen Wirkungsgrads von 97% bei der Umwandlung von Heizöl in Wärme einen aktiven Beitrag zum Klima-
Öl-Brennwertkessel Mit einem Öl-Brennwertkessel leisten Sie dank seiner Effizienz und des unschlagbar hohen Wirkungsgrads von 97% bei der Umwandlung von Heizöl in Wärme einen aktiven Beitrag zum Klima-
Einsatzmöglichkeiten von Kraft-Wärme-Kopplung in der Wohnungswirtschaft
 Einsatzmöglichkeiten von Kraft-Wärme-Kopplung in der Wohnungswirtschaft MBA/Dipl.-Ing.(FH) Matthias Kabus Folie 1 Themenübersicht 1. Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 2. Einsatzkriterien 3. Wirtschaftlichkeit
Einsatzmöglichkeiten von Kraft-Wärme-Kopplung in der Wohnungswirtschaft MBA/Dipl.-Ing.(FH) Matthias Kabus Folie 1 Themenübersicht 1. Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 2. Einsatzkriterien 3. Wirtschaftlichkeit
Verfahrenstechnisches Praktikum WS 2017/2018. Versuch D3: Energiebilanz einer Verbrennung
 Fakultät für Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik Verfahrenstechnisches Praktikum WS 2017/2018 Versuch D3: Energiebilanz einer Verbrennung Betreuer: Fernando Reichert Email: fernando.reichert@kit.edu
Fakultät für Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik Verfahrenstechnisches Praktikum WS 2017/2018 Versuch D3: Energiebilanz einer Verbrennung Betreuer: Fernando Reichert Email: fernando.reichert@kit.edu
Feuerwehr Riegelsberg
 Feuerwehr Riegelsberg Brennen und Löschen Anlage zur Versuchsreihe Erstellt: Jörg Klein Folie 1 Löschmittel der Feuerwehr Wasser Schaum Pulver Kohlendioxid CO 2 Sonstige Sand Graugußspäne Zement u.a. Erstellt:
Feuerwehr Riegelsberg Brennen und Löschen Anlage zur Versuchsreihe Erstellt: Jörg Klein Folie 1 Löschmittel der Feuerwehr Wasser Schaum Pulver Kohlendioxid CO 2 Sonstige Sand Graugußspäne Zement u.a. Erstellt:
Verfahrenstechnisches Praktikum WS 2016/2017. Versuch D3: Energiebilanz einer Verbrennung
 Fakultät für Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik Verfahrenstechnisches Praktikum WS 201/2017 Versuch D3: Energiebilanz einer Verbrennung Betreuer: Matthias Sentko Email: Matthias.Sentko@kit.edu
Fakultät für Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik Verfahrenstechnisches Praktikum WS 201/2017 Versuch D3: Energiebilanz einer Verbrennung Betreuer: Matthias Sentko Email: Matthias.Sentko@kit.edu
Mittelwertvergleiche, Teil II: Varianzanalyse
 FB 1 W. Ludwig-Mayerhofer Statistik II 1 Herzlich willkommen zur Vorlesung Mittelwertvergleiche, Teil II: FB 1 W. Ludwig-Mayerhofer Statistik II 2 : Wichtigste Eigenschaften Anwendbar auch bei mehr als
FB 1 W. Ludwig-Mayerhofer Statistik II 1 Herzlich willkommen zur Vorlesung Mittelwertvergleiche, Teil II: FB 1 W. Ludwig-Mayerhofer Statistik II 2 : Wichtigste Eigenschaften Anwendbar auch bei mehr als
Thermodynamik 1 Klausur 02. August 2010
 Thermodynamik 1 Klausur 02. August 2010 Bearbeitungszeit: 120 Minuten Umfang der Aufgabenstellung: 6 nummerierte Seiten Alle Unterlagen zu Vorlesung und Übung sowie Lehrbücher und Taschenrechner sind als
Thermodynamik 1 Klausur 02. August 2010 Bearbeitungszeit: 120 Minuten Umfang der Aufgabenstellung: 6 nummerierte Seiten Alle Unterlagen zu Vorlesung und Übung sowie Lehrbücher und Taschenrechner sind als
Vortrag: Technische Konzepte zur Nutzung von Energie aus Biogas. Akademie für erneuerbare Energien Lüchow 23.06.2011
 Vortrag: Technische Konzepte zur Nutzung von Energie aus Biogas Akademie für erneuerbare Energien Lüchow 23.06.2011 Beesem 8 29487 Luckau Tel. 05844.976213 Fax 05844.976214 mail@biogas-planung.de Vortragsgliederung
Vortrag: Technische Konzepte zur Nutzung von Energie aus Biogas Akademie für erneuerbare Energien Lüchow 23.06.2011 Beesem 8 29487 Luckau Tel. 05844.976213 Fax 05844.976214 mail@biogas-planung.de Vortragsgliederung
Prüfstelle. Technische Universität Wien Karlsplatz 13, 1040 Wien
 Prüfstelle Rechtsperson Karlsplatz 13, 1040 Wien Ident 0121 Standort Prüflabor für Feuerungsanlagen am Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und technische Biowissenschaften Getreidemarkt 9/166,
Prüfstelle Rechtsperson Karlsplatz 13, 1040 Wien Ident 0121 Standort Prüflabor für Feuerungsanlagen am Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und technische Biowissenschaften Getreidemarkt 9/166,
VIESMANN VITOSOL 200-T Vakuum-Röhrenkollektor nach dem Heatpipe-Prinzip zur Nutzung der Sonnenenergie
 VIESMNN VITOSOL 200-T Vakuum-Röhrenkollektor nach dem Heatpipe-Prinzip zur Nutzung der Sonnenenergie Datenblatt Best.-Nr. und Preise: siehe Preisliste VITOSOL 200-T Typ SPE Vakuum-Röhrenkollektor Zur Erwärmung
VIESMNN VITOSOL 200-T Vakuum-Röhrenkollektor nach dem Heatpipe-Prinzip zur Nutzung der Sonnenenergie Datenblatt Best.-Nr. und Preise: siehe Preisliste VITOSOL 200-T Typ SPE Vakuum-Röhrenkollektor Zur Erwärmung
 --- j ~77C ~ ::- ::.-:;~=~"'5~~~~~_;.~~~~~~~:_~~~-~~::~~;;:;~~~-i~~~=~-;:~-~~c~~:"~:~s-."';;:,?: ~~r;-;~,,., - '-< i!-~;_-~-.!;>-"' ~- faergieausweis für Wohngebäude > gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung
--- j ~77C ~ ::- ::.-:;~=~"'5~~~~~_;.~~~~~~~:_~~~-~~::~~;;:;~~~-i~~~=~-;:~-~~c~~:"~:~s-."';;:,?: ~~r;-;~,,., - '-< i!-~;_-~-.!;>-"' ~- faergieausweis für Wohngebäude > gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung
Klausurlösungen Thermodynamik II Sommersemester 2014 Fragenteil
 Klausurlösungen Thermodynamik II Sommersemester 2014 Fragenteil Lösung zum Fragenteil Regeln Nur eine eindeutige Markierung wird bewertet, z. B.: Für eine Korrektur kann die zweite Spalte mögl. Korrektur
Klausurlösungen Thermodynamik II Sommersemester 2014 Fragenteil Lösung zum Fragenteil Regeln Nur eine eindeutige Markierung wird bewertet, z. B.: Für eine Korrektur kann die zweite Spalte mögl. Korrektur
Versuchsprotokoll. Spezifische Wärmekapazität des Wassers. Dennis S. Weiß & Christian Niederhöfer. zu Versuch 7
 Montag, 10.11.1997 Dennis S. Weiß & Christian Niederhöfer Versuchsprotokoll (Physikalisches Anfängerpraktikum Teil II) zu Versuch 7 Spezifische Wärmekapazität des Wassers 1 Inhaltsverzeichnis 1 Problemstellung
Montag, 10.11.1997 Dennis S. Weiß & Christian Niederhöfer Versuchsprotokoll (Physikalisches Anfängerpraktikum Teil II) zu Versuch 7 Spezifische Wärmekapazität des Wassers 1 Inhaltsverzeichnis 1 Problemstellung
Stellen Sie für die folgenden Reaktionen die Gleichgewichtskonstante K p auf: 1/2O 2 + 1/2H 2 OH H 2 + 1/2O 2 H 2 O
 Klausur H2004 (Grundlagen der motorischen Verbrennung) 2 Aufgabe 1.) Stellen Sie für die folgenden Reaktionen die Gleichgewichtskonstante K p auf: 1/2O 2 + 1/2H 2 OH H 2 + 1/2O 2 H 2 O Wie wirkt sich eine
Klausur H2004 (Grundlagen der motorischen Verbrennung) 2 Aufgabe 1.) Stellen Sie für die folgenden Reaktionen die Gleichgewichtskonstante K p auf: 1/2O 2 + 1/2H 2 OH H 2 + 1/2O 2 H 2 O Wie wirkt sich eine
Thermodynamik I. Sommersemester 2012 Kapitel 5, Teil 1. Prof. Dr. Ing. Heinz Pitsch
 Thermodynamik I Sommersemester 2012 Kapitel 5, Teil 1 Prof. Dr. Ing. Heinz Pitsch Kapitel 5, Teil 1: Übersicht 5. Energieumwandlungen als reversible und nichtreversible Prozesse 5.1 Reversibel isotherme
Thermodynamik I Sommersemester 2012 Kapitel 5, Teil 1 Prof. Dr. Ing. Heinz Pitsch Kapitel 5, Teil 1: Übersicht 5. Energieumwandlungen als reversible und nichtreversible Prozesse 5.1 Reversibel isotherme
A 1.1 a Wie groß ist das Molvolumen von Helium, flüssigem Wasser, Kupfer, Stickstoff und Sauerstoff bei 1 bar und 25 C?
 A 1.1 a Wie groß ist das Molvolumen von Helium, flüssigem Wasser, Kupfer, Stickstoff und Sauerstoff bei 1 bar und 25 C? (-> Tabelle p) A 1.1 b Wie groß ist der Auftrieb eines Helium (Wasserstoff) gefüllten
A 1.1 a Wie groß ist das Molvolumen von Helium, flüssigem Wasser, Kupfer, Stickstoff und Sauerstoff bei 1 bar und 25 C? (-> Tabelle p) A 1.1 b Wie groß ist der Auftrieb eines Helium (Wasserstoff) gefüllten
Betriebsfeld und Energiebilanz eines Ottomotors
 Fachbereich Maschinenbau Fachgebiet Kraft- u. Arbeitsmaschinen Fachgebietsleiter Prof. Dr.-Ing. B. Spessert März 2016 Praktikum Kraft- und Arbeitsmaschinen Versuch 2 Betriebsfeld und Energiebilanz eines
Fachbereich Maschinenbau Fachgebiet Kraft- u. Arbeitsmaschinen Fachgebietsleiter Prof. Dr.-Ing. B. Spessert März 2016 Praktikum Kraft- und Arbeitsmaschinen Versuch 2 Betriebsfeld und Energiebilanz eines
Übungssunterlagen. Energiesysteme I. Prof. Dr.-Ing. Bernd Epple
 Übungssunterlagen Energiesysteme I Prof. Dr.-Ing. Bernd Epple 1 1. Allgemeine Informationen Zum Bearbeiten der Übungen können die Formelsammlungen aus den Fächern Technische Thermodynamik 1, Technische
Übungssunterlagen Energiesysteme I Prof. Dr.-Ing. Bernd Epple 1 1. Allgemeine Informationen Zum Bearbeiten der Übungen können die Formelsammlungen aus den Fächern Technische Thermodynamik 1, Technische
Bundesrealgymnasium Imst. Chemie 2010-11. Klasse 4. Einführung Stoffe
 Bundesrealgymnasium Imst Chemie 2010-11 Einführung Stoffe Dieses Skriptum dient der Unterstützung des Unterrichtes - es kann den Unterricht aber nicht ersetzen, da im Unterricht der Lehrstoff detaillierter
Bundesrealgymnasium Imst Chemie 2010-11 Einführung Stoffe Dieses Skriptum dient der Unterstützung des Unterrichtes - es kann den Unterricht aber nicht ersetzen, da im Unterricht der Lehrstoff detaillierter
Das Baustellenhandbuch für die Ausführung nach EnEV Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,
 FORUM VERLAG HERKERT GMBH Mandichostraße 18 86504 Merching Telefon: 08233/381-123 E-Mail: service@forumverlag.com www.forum-verlag.com Das Baustellenhandbuch für die Ausführung nach EnEV 2009 Liebe Besucherinnen
FORUM VERLAG HERKERT GMBH Mandichostraße 18 86504 Merching Telefon: 08233/381-123 E-Mail: service@forumverlag.com www.forum-verlag.com Das Baustellenhandbuch für die Ausführung nach EnEV 2009 Liebe Besucherinnen
Flüssiggase. Physikalische Daten Flüssiggas Propan Butan. Chemisches Zeichen C3H8 C4H10. Molmasse g/mol 44,1 58,12. Siedepunkt C -42,1-0,5
 Flüssiggase 02/2015 1 Physikalische und technische Daten... 1 1.1 Dampfdruckkurve von Propan und Butan... 3 1.2 Zusammensetzung von Propangas nach DIN 51622... 3 1.3 Zusammensetzung von Autogas nach DIN
Flüssiggase 02/2015 1 Physikalische und technische Daten... 1 1.1 Dampfdruckkurve von Propan und Butan... 3 1.2 Zusammensetzung von Propangas nach DIN 51622... 3 1.3 Zusammensetzung von Autogas nach DIN
Allgemeine Information
 Allgemeine Information ESSE-N / A.S. 1 Gasgeräte in Europa Harmonisierung auf der Geräteseite: CE-Kennzeichnung gemäß Gasgeräte-Richtlinie 90/396/EWG Typprüfung gemäß EN30 Aufschriften, Klassifizierung
Allgemeine Information ESSE-N / A.S. 1 Gasgeräte in Europa Harmonisierung auf der Geräteseite: CE-Kennzeichnung gemäß Gasgeräte-Richtlinie 90/396/EWG Typprüfung gemäß EN30 Aufschriften, Klassifizierung
Test zur Messung der thermischen Eigenschaften von Beton
 Test zur Messung der thermischen Eigenschaften von Beton Jean-David GRANDGEORGE, Sandrine BRAYMAND, Christophe FOND, Violaine TINARD IUT Robert Schuman, Université de Strasbourg «Nachhaltiges Bauen am
Test zur Messung der thermischen Eigenschaften von Beton Jean-David GRANDGEORGE, Sandrine BRAYMAND, Christophe FOND, Violaine TINARD IUT Robert Schuman, Université de Strasbourg «Nachhaltiges Bauen am
DIN EN 12831 vom August 2003, und Beiblatt 1, Nationaler Anhang vom April 2004
 DIN EN 12831 vom August 2003, und Beiblatt 1, Nationaler Anhang vom April 2004 04 Heizungsanlagen in Gebäuden Heizungssysteme in Gebäuden Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast von Fachdozent Dipl.-Ing.
DIN EN 12831 vom August 2003, und Beiblatt 1, Nationaler Anhang vom April 2004 04 Heizungsanlagen in Gebäuden Heizungssysteme in Gebäuden Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast von Fachdozent Dipl.-Ing.
VIESMANN VITOLIGNO 200-S Hochleistungs-Holzvergaserkessel 20 bis 40 kw zur Verbrennung von Scheitholz
 VIESMANN VITOLIGNO 200-S Hochleistungs-Holzvergaserkessel 20 bis 40 kw zur Verbrennung von Scheitholz Datenblatt Best.-Nr. und Preise: siehe Preisliste VITOLIGNO 200-S Hochleistungs-Holzvergaserkessel
VIESMANN VITOLIGNO 200-S Hochleistungs-Holzvergaserkessel 20 bis 40 kw zur Verbrennung von Scheitholz Datenblatt Best.-Nr. und Preise: siehe Preisliste VITOLIGNO 200-S Hochleistungs-Holzvergaserkessel
