Mittelhochdeutsche Kurzgrammatik. Fabian Bross
|
|
|
- Meike Graf
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Mittelhochdeutsche Kurzgrammatik Fabian Bross 1
2 Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen 3 2 Lautgeschichte 4 3 Lautwandel im Vokalismus 13 4 Weitere wichtige Erscheinungen 19 5 Verben 20 6 Syntax 24 7 Nützliche Links im Weltnetz 27 2
3 1 Vorbemerkungen Diese Kurzgrammatik erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es handelt sich lediglich um eine verkürzte Darstellung der wichtigsten Inhalte aus: Thordis Hennings (2003): Einführung in das Mittelhochdeutsche. Berlin & New York. Hilkert Weddige (2004): Einführung in das Mittelhochdeutsche. München. Die Notation wurde nicht immer einheitlich gebraucht. Fabian Bross 3
4 2 Lautgeschichte Klassifikation der Laute Laute können klassifiziert werden nach fünf Kriterien: Beteiligung der Stimme Art der Artikulation Stelle der Artikulation Stärke der Artikulation Dauer der Artikulation Merkwort: BASSD (Bairisch für passt) Beteiligung der Stimme: Stimmhafte Laute werden unter Vibration der Stimmbänder gebildet. w wie in W aren oder s wie in Sonne Stimmlose Laute werden ohne Vibration der Stimmbänder gebildet. f wie in f ahren, s wie in Hass Art der Artikulation: Die Stellung der beweglichen Sprechorgane kann unterschieden werden nach: Öffnung, Enge oder Verschluss. Verschlusslaute und Englaute nennt man Obstruenten (der Apfel gehört zum Obst; Obstipation = Verstopfung) oder Plosive (wegen der Explosion bei der Aussprache). Stellung Laute Bezeichnung Verschluss p t k stimmlose Verschlusslaute, sog. Tenues Verschluss b d g stimmhafte Verschlusslaute, sog. Mediae Enge z.b. s wie in krass oder stimmlose Reibelaute, sog. f wie in f ahren Frikative Enge z.b. s wie in Sonne oder w wie in W aren stimmhafte Reibelaute, sog. Frikative Verschluss, Enge pf z kch Affrikaten (Sg. Affrikate) 1 4
5 Stellung Laute Bezeichnung Öffnung mit Atemstrom h 2 Hauchlaut Öffnung mit Vibration a e i o u Vokale 3 der Stimmbänder Weiter unterscheidet man die sogenannten Sonanten, also die Nasale m und n und die Liquide l und r: Nasale m - n Liquide l - r Und die für das Mittelhochdeutsche wichtigen Halbvokale i und u (im Mittelhochdeutschen j und w). Stelle der Artikulation: Die Stelle, an der Verschluss oder die Enge gebildet werden. Stelle Fachbegriff Überbegriff Beispiele Ober- und Unterlippe Bilabiale Labiale 4 p b m pf Unterlippe und Labiodentale Labiale f w pf Zähne Zahndamm Alveolen Dentale t d s n Kehlkopf Laryngale 5 Vordergaumen Palatale 6 Gutturale k, g, ch, kch, ng Hintergaumen Velare 7 Stärke der Artikulation: Je nach Stärke kann man zwischen Fortes und Lenes unterscheiden, also starke und schwache Artikulation (z.b. Fortes: p t k; Lenes: b d g). Dauer der Artikulation: Die Dauer der Artikulation kann unterschieden werden, so spricht man die Bahn mit langem, den Bann mit kurzem a (in Bayern trinkt man keine Maß Bier, sondern eine Mass). 5
6 Lautwandel im Konsonantismus Erste und Zweite Lautverschiebung: Die Veränderung der Konsonanten im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende vollzogen sich relativ geregelt. Man unterscheidet zwischen zwei Lautverschiebungen. Die Erste Lautverschiebung wird auch germanische Lautverschiebung genannt (ca. 5. Jh. v.d.z.), weil die Veränderungen vom Indogermanischen zum Germanischen stattfanden. Die Zweite Lautverschiebung wir auch hochdeutsche Lautverschiebung genannt (ca. 6./7. Jh. n.d.z.), weil die Veränderungen vom Germanischen zum (Alt)Hochdeutschen stattfanden. Exkurs: Sprachen 1: Das Indogermanische (manchmal auch das Indoeuropäische) ist eine Sprachfamilie mit ungefähr 140 miteinander verwandten Sprachen. Sprachgruppen, die zum Indogermanischen gehören, sind zum Beispiel Germanisch, Keltisch, Italisch oder Slawisch. Das Indogermanische entwickelte sich vermutlich im 3. Jahrtausend vor Christus und ist natürlich nicht überliefert. Die Wissenschaft kann aber (versuchen) frühere Sprachstufen (zu) rekonstruieren. Solche rekonstruierten Formen werden mit einem Stern (*) markiert, dem sogenannten Asteriskus. 8 Bevor wir dazu kommen, was es mit den Lautverschiebungen genau auf sich hat, sei noch gesagt, dass sie sich am stärksten im Süden durchgesetzt haben und je weiter nördlich man geht, desto weniger. Exkurs: Sprachen 2:Als Vergleichssprachen für die verschiedenen Stufen der Lautverschiebungen dienen besonders das Lateinisch für die Stufe des Indogermanischen und das Englische (hoch im Norden), als Vergleich für das Germanische. 6
7 Die Erste oder germanische Lautverschiebung: Indogermanische Verschlusslaute (Tenues) p f t þ 9 k h lat. pater 10 engl. father lat. tres engl. three lat cornu engl. horn Erste Lautverscheibung zu stimmlosen Reibenlauten (germ.) Indogermanische stimmhafte Verschlusslaute (Mediae) b d g idg. *slabós lat. decem idg. *agros Erste Lautverscheibung zu stimmlosen Verschlusslauten (germ.) p t k germ. *slapas (wird später zu nhd. schlaff) engl. ten germ. *akraz (wird später zu nhd. Acker) Indogermanische behauchte stimmhafte Verschlusslaute (Mediae aspiratae) b h d h g h idg. *b h râtêr idg. *med h ios idg. *g h istis Erste Lautverscheibung zu stimmhaften Reibelauten (germ.) b d g germ. *broþer (wird später zu nhd. Bruder) got. midjis gasts (wird später zu nhd. Gast) Kurzübersicht Erste Lautverschiebung: p, t, k f, þ, h b, d, g p, t, k b h, d h,g h b, d, g 7
8 Die Zweite oder hochdeutsche Lautverschiebung: Germanische stimmlose Reibelaute f þ h engl. father engl. three engl. horn Zweite Lautverschiebung (ahd./mhd.) f d h ahd. fater ahd. drî ahd. horn Germanische stimmlose Verschlusslaute p t k Zweite Lautverschiebung zu Reibelauten/Affrikaten (ahd./mhd.) ff/pf zz/tz hh, cc, h/kch Germanische stimmhafte Reibelaute b d g Zweite Lautverschiebung zu Verschlusslauten (ahd./mhd.) b t g Die Verschiebungen von p, t, k in der Zweiten Lautverschiebung gestalten sich als etwas komplexer. Je nach Stellung im Wort veränderten sich p, t, k: Verschluss- Stimmlose laute p t k Zweite Lautverschiebung zur Doppelspirans 11 (ahd./mhd.) ff zz hh Merksatz: In- und auslautend nach Vokal, verdoppelt sich die Zahl. Beispiel: engl. ship ahd. scif 8
9 Verschluss- Stimmlose laute p pf t tz k kch 12 Zweite Lautverschiebung zur Affrikate (ahd./mhd.) Merksatz: In G, im A, nach K: zur Affrikata. Das heißt: Standen p, t, k in der Gemination 13, im Anlaut oder nach Konsonant, verschoben sie sich zu Affrikte. Kurzübersicht Zweite Lautverschiebung: f, þ, h d, f, h b, d, g b, t, g p, t, k Doppelspirans/Affrikate Grammatischer Wechsel und das Verner sche Gesetz: Exkurs: Sprachwissenschaft (Linguistik): Man kann Sprache grundsätzlich auf zwei Arten betrachten. Entweder man untersucht eine Sprache zu einem gewissen Zeitpunkt oder man untersucht die historischen Veränderungen einer Sprache. Man spricht von synchroner ( gleichzeitig ) und diachroner (= historische Betrachtung) Sprachwissenschaft. Alternieren 14 Laute miteinander spricht man deshalb auf synchroner Ebene von einem Wechsel und auf diachroner Ebene von einem Wandel. Bisher haben wir uns mit Sprachentwicklung beschäftigt, waren also auf der diachronen Ebene. Jetzt begeben wir uns auf die synchrone Ebene! Beim Grammatischen Wechsel handelt es sich um Laute, die in etymologisch verwandten Wörtern miteinander alternieren. 15 9
10 Der Grammatische Wechsel: Kurzfassung: f d h s b t g r Beispiele in verschiedenen Verbformen: dürf en (nhd.) snîden ziehen was darben sniten zugen warn Das Verner sche Gesetz: Zur Erinnerung: Verschiebung von t durch die Erste und Zweite Lautverschiebung: Indogermanisch Germanisch Hochdeutsch 16 t þ d Im Kapitel über die Erste Lautverschiebung wurde gesagt, dass idg. t zu germ. þwurde. Damit lässt sich erklären, dass der Römer frater und der Engländer brother sagt. Durch die Zweiten Lautverschiebung wird aus þd. Deshalb sagen wir heute Bruder. Bis Ende des 19. Jahrhunderts war allerdings folgendes ungeklärt: Der Römer sagt (oder würde sagen) pater, der Engländer father. Hätte hier auch die Zweite Lautverschiebung gegriffen, müssten wir heute auch Vader sagen, es heißt aber Vater! Der Däne Karl Verner, lieferte mit dem nach ihm benannten Vernerschen Gesetz die Antwort. Bevor wir aber dazu kommen, diese Ausnahme der Zweiten Lautverschiebung zu erklären, die wiederum den Grammatischen Wechsel erklärt, machen wir zwei Exkurse. 10
11 Exkurs: Wortakzente: Setzt man den Akzent des Wortes Blumentopferde (Blumen-topf-erde) etwas ungewohnt, erhält man das seltsam klingende Wort Blumento-Pferde (Blumentopférde Bluméntopferde). Im Indogermanischen gab es einen sogenannten freien Wortakzent, das heißt, dass die Stelle, auf der der Akzent lag flexionsabhängig war. Im Lateinischen ist das genauso. Der Römer würde sagen: Róma Románus Romanórum. Im Germanischen änderte sich das. Der Wortakzent lag hier auf der Wurzelsilbe. Nicht aus den Augen lassen: Der Grammatische Wechsel ist ein synchrones Phänomen, das Vernersche Gesetz ist die historisch-genetische Erklärung des Grammatischen Wechsels und damit auf der diachronen Ebene! Exkurs: stimmhafte Umgebung: Von einer stimmhaften Umgebung ist die Rede, wenn ein Konsonant zwischen zwei Vokalen oder nach einem Sonanten (m, n, l, r) steht. Das Verner sche Gesetz: Die Erste Lautverschiebung bewirkte: p, t, k f,, h f, þ, h wurden nicht von der Zweiten Lautverschiebung betroffen, wenn sie 1. in stimmhafter Umgebung standen und ihnen 2. der noch im Frühgermanischen freie Wortakzent folge. War dies also der Fall, entstanden aus f, þ, h (über Zwischenstufen) im Voralthochdeutschen b, d, g. Tritt Verners Gesetz ein, finden wir im Mittelhochdeutschen b, t 17, g. Daraus erklärt sich nun auch der Grammatische Wechsel von f und b, d und t und h und g: 11
12 Germanisch Zweite Lautverschiebung Verners Gesetz f f b d d t g h g Dentalberührung: Die Dentalberührung (auch Dentalberührungseffekt oder Primärberührungseffekt) erklärt, dass im Mittelhochdeutschen (synchrone Ebene!) folgende Laute alternieren: k, g, ch mit h, wenn vor einem t stehen p, b, pf, ff mit f, wenn sie vor einem t stehen Beispiele: Mittelhochdeutsch: mügen mohte oder schrîben schrif t. Folgt einem g oder einem k ein t, so wird es zu h. Verhärtungen: Auslautverhärtung: Im Wortauslaut sind im Mittelhochdeutschen b, d und g im Wortauslaut zu p, t und k verhärtet. Im heutigen Deutschen ist die Auslautverhärtung zwar in der Schreibung nicht zu sehen, in der Aussprache jedoch noch vorhanden. Mittelhochdeutsch Nominativ tac Tag Genitiv tages Tages Neuhochdeutsch Anlautverhärtung: Im Wortanlaut vor Konsonant wurde seit dem 13. Jahrhundert s zu einem Zischlaut (sch). So wurde aus mhd. swîn nhd. Schwein. Inlautverhärtung: Standen im Mittelhochdeutschen die Halbvokale w und j zwischen Vokalen, so sind sie ausgefallen. Mittelhochdeutsch: buwen Neuhochdeutsch: bauen 12
13 3 Lautwandel im Vokalismus Neuhochdeutsche Monophthongierung und Diphthongierung: 18 Neuhochdeutsche Monophthongierung: ie uo üe [i:] [u:] [y:] (ü) Die Neuhochdeutsche Monophthongierung findet man ab dem 11. Jahrhundert. Aus Diphthongen, also Zwielauten wurden (lange) Monophthonge. Merksatz: Mittelhochdeutsch liebe guote brüeder Neuhochdeutsch liebe gute Brüder Neuhochdeutsche Monophthongierung: î iu û ei eu au Aus den langen Monophthongen î, iu (sprich: ü) und û werden durch die neuhochdeutsche Diphthongierung die Diphthonge ei, eu und au. 19 Merksatz: Mittelhochdeutsch mîn niuwez hûs Neuhochdeutsch mein neues Haus 13
14 Neuhochdeutsche Dehnung: Exkurs: Tonsilben: Tonsilben können offen oder geschlossen sein. Eine Tonsilbe gilt als offen, wenn sie auf Vokal endet, als geschlossen, wenn sie auf einen oder mehrere Konsonanten endet. Offene Tonsilbe: Me-cha-ni-ker Geschlossene Tonsilbe: Fluss-lauf Mittelhochdeutsche Vokale, die in betont offener Silbe stehen, werden im Hochdeutschen gedehnt. Merksatz: Was will der Mensch am meisten Dehnen? Sein Leben! Aber nur, wenn der betont offen (soll heißen frei) leben kann. Beispiel: Mittelhochdeutsch le-ben wird zu Neuhochdeutsch leben. Neuhochdeutsche Kürzung: Die Vokalkürzung zum Hochdeutschen fand nicht so regelmäßig statt, wie die Dehnung. Vor ht und r + Konsonant wurden Vokale gekürzt. Merksatz: Was mich zum aufhorchen brachte, als ich meine Kollegen belauschte? Dass sie über eine Gehaltskürzung sprachen! Beispiele: Mittelhochdeutsch brâhte wird zu Neuhochdeutsch brachte. Mittelhochdeutsch hôrchen wird zu Neuhochdeutsch horchen. 14
15 Vokalschwund (Apokope/Synkope): Apokope: Ausfall eines unbetonten Vokals am Wortende. Synkope: Ausfall eines unbetonten Vokals im Wortinnern. Das folgende Beispiel zeigt sowohl eine Syn-, als auch eine Apokope: Das Vokaldreieck: Vokale lassen sich nach ihrer Artikulationsstelle in einem Dreieck, dem sogenannten Vokaldreieck, darstellen: 15
16 Senkung des ersten Diphthonganteils: Vom Mhd. zum Nhd. wurde (seit dem 13. Jh.) in der Regel der erste Bestandteil der Diphthonge /ei/, /öu/ und /ou/ sowohl gesenkt als auch geöffnet, so daß die betreffenden Diphthonge im Nhd. lauten: /ei/ [ai] ( ei, ai ), /eu/ [oö] ( eu, äu ) und /au/. Sie fallen also mit den durch die nhd. Diphthongierung entstandenen Diphthongen zusammen. 20 So wurde aus mhd. keiser nhd. Kaiser oder aus mhd. frouwe nhd. Frau. Warum von einer Senkung die Rede ist, wird bei einem Blick auf das Vokaldreieck klar. Rundung: Mittelhochdeutsch ie ü e ö â [o:] 21 i ü Neuhochdeutsch Merksatz: Wer lügt, kommt in eine Hölle ohne Würde! mhd.: liegen helle âne wirde nhd.: lügen Hölle ohne Würde Neuhochdeutsche Senkung: Vor Nasalen wurden die hohen Vokale u und ü vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen zu o und ö gesenkt (man vergleiche wieder das Vokaldreieck). Merksatz: Die Sonne senkt sich auf den König (oder Assoziation mit dem Sonnenkönig Ludwig XIV.) mhd.: sunne nhd.: Sonne mhd.: künec nhd.: König 16
17 Ablaut: Ablaut ist der geregelte Wechsel bestimmter Vokale an etymologisch verwandter Stelle. Es gibt zwei Arten des Ablauts: den quantitativen und den qualitativen. Beim quantitativen Ablaut erfolgt eine Abstufung der Klangdauer, beim qualitativen eine Abtönung in der Klangfarbe. Beispiele: Nhd.: binden band gebunden Der Ablaut wird uns bei den starken Verben noch beschäftigen. Umlaut: Der Umlaut (nicht zu verwechseln mit dem Ablaut!) lässt sich in drei verschiedene Arten einteilen. Den Primärumlaut, den Sekundärumlaut und den Restumlaut. Primärumlaut: Der Primärumlaut betrifft nur das kurze a, das zu einem e umgelautet wurde, wenn ein i oder ein j in der Folgesilbe standen. Beispiel: ahd. Sg. gast Pl. gasti mhd. Sg. gast Pl. gesti Sekundärumlaut Auch der Sekundärumlaut betrifft nur das kurze a. Dieses wird zu einem ä umgelautet, wenn: Zwischen Wurzelvokal a und dem umlautenden i bzw. j ht, hs oder rw stand oder wenn i oder j erst in der übernächsten Silbe stand. Beispiel: 17
18 ahd. Sg. maht Pl. mahti nhd. Sg. Macht Pl. Mächte Restumlaut Alle anderen umlautfähigen Vokale können ebenfalls durch ein nachfolgendes i oder j umgelautet werden. ô œ 22 u ü û iu â æ 18
19 4 Weitere wichtige Erscheinungen Proklise: Bei der Proklise lehnt sich ein unbetontes Wort an ein folgendes an: ich ne ine Enklise: Bei der Enklise lehnt sich ein unbetontes Wort an ein vorangehendes an: bist du bistu Assimilation: Ein Laut passt sich seinem Nachbarlaut an: umbe umme Kontraktion: Zwischen Vokalen schwinden im Mittelhochdeutschen b, d, g und h zwischen Vokalen, welche dann zusammengezogen werden: maget meit gibet - gît 19
20 5 Verben Da in mittelhochdeutschen Wörterbüchern wie in unseren heutigen Wörterbüchern auch Verben nur im Infinitiv zu finden sind, ist es wichtig, dass man in der Lage ist, von nicht im Infinitiv stehenden, also finiten Verben, die Infinitive zu rekonstruieren. Logisch, dass man das können muss, wenn man mittelhochdeutsche Texte übersetzen will. Die Verben werden hier natürlich nicht immer im Infinitiv stehen und erschließen kann man sich auch nicht alle Verben. Um also den Infinitiv eines Verbs zu rekonstruieren, bestimmt man zuerst, ob es sich um ein schwaches oder ein starkes Verb handelt. Die schwachen Verben: Schwache Verben zeichnen sich durch einen Verbstamm aus, der sich nicht verändert. Ein Beispiel für ein neuhochdeutsches schwaches Verb ist etwa sagen. Der Stamm des Verbs ist sag. Er verändert sich nicht, wenn man das Verb ins Präteritum setzt: Präsens: Ich sage Du sagst Er/Sie/Es sagt Wir sagen Ihr sagt Sie sagen. Präteritum: Ich sagte Du sagtest Er/Sie/Es sagte Wir sagten Ihr sagtet Sie sagten. Das Präteritum schwacher Verben wird durch ein -t gekennzeichnet, dass wahrscheinlich der Rest einer Präteritalform des Wortes tun ist. Man bezeichnet dieses -t als Dentalsuffix. Das -t wird an den Zähnen, also dental gebildet und an den Stamm angehängt. Man unterscheidet drei Klassen von schwachen Verben, aufgrund ihrer Suffixe im Germanischen (im Infinitiv): die jan-verben, die ôn-verben und die ên-verben. Am wichtigsten ist die Klasse der jan-verben. Aus den Suffixen ôn und ên wurde im Mittelhochdeutschen jeweils ên. Auch aus dem jan-suffix wurde im Mittelhochdeutschen ein en-suffix. Rückumlautende schwache Verben: Kurzübersicht: Verbart Präsens Präteritum Kurzwurzlige jan-verben Umlaut Umlaut Langwurzlige jan-verben Umlaut Kein Umlaut 20
21 1. Kurzwurzlige jan-verben Wie bereits besprochen bewirkt i oder j in der Folgesilbe Umlaut. So auch bei den kurzwurzligen jan-verben geschehen: got.: Infinitiv: lagjan; Präteritum: lagida mhd.: Infinitiv: legen; Präteritum: legete 2. Langwurzlige jan-verben In den langwurzligen jan-verben jedoch wurde das i im Präteritum so früh synkopiert 23, dass kein Umlaut mehr bewirkt wurde. Rückumlautende schwache Verben: Dass dieser Umlaut nicht bewirkt wurde (z.b. mhd. brennen (Infinitiv) aber mhd. brannte (Präteritum)) fiel Jacob Grimm auf. Fälschlicherweise nahm er an, dass doch ein Umlaut stattgefunden hätte, dieser aber wieder rückgängig gemacht wurde. Der Begriff rückumlautende schwache Verben wurde allerdings beibehalten. Heute spricht man aber von sogenannten rückumlautenden schwachen Verben. Die starken Verben: Die starken Verben im Mittelhochdeutschen können grundsätzlich in sieben Klassen (mit Unterklassen) eingeteilt werden, wobei die ersten fünf auf dem indogermanischen e/o- Ablaut beruhen. Hat man ein starkes Verb in einem Text als solches erkannt und seine Form bestimmt, kann man den Infinitiv anhand einer Tabelle rekonstruieren. Diese muss auswendig gelernt werden. Infinitiv Präsens Sg. Präteritum Sg. Präteritum Pl. Partizip II Ia rîten rîte reit riten geriten Ib zîhen zîhe zêh zigen gezigen IIa biegen biuge bouc bugen gebogen IIb bieten biute bôt buten geboten IIIa binden binde bant bunden gebunden IIIb werfen wirfe warf wurfen geworfen IV nemen nime nam nâmen genomen V geben gibe gap gâben (ge)geben VI varn var vuor vuoren gevarn VII heizen heize hiez hiezen geheizen 21
22 Am besten merkt man sich zuerst, dass es sieben Ablautreihen gibt und die ersten drei jeweils in a und b unterteilt sind. Danach merkt man sich die Verben mit Hilfe eines Merkspruchs. Ablautreihe Verb Merkspruch Ia rîten Ich ritt auf einen Hügel, Ib zîhen zog dem Pferd die Zügel IIa biegen um abzubiegen zu der Linden, IIb/IIIa bieten/binden welche sich anbot, anzubinden. IIIb werfen Mein Pferd das warf ein Fohlen hier, IV nemen das nahm kaum Notiz von mir. V geben Ich gab ihm eine Stange Lauch, VI varn denn Pferde fahren ab darauf, VII heizen wie auf Hafer heißt es auch. Nun lernt man entweder die Formen der Verben oder nur die einzelnen Buchstaben, was manchen mehr liegt, anderen weniger. Infinitiv Präsens Sg. Präteritum Sg. Präteritum Pl. Partizip II Ia î î ei i i Ib î î ê i i IIa ie iu ou u o IIb ie iu ô u o IIIa i (m/n) + K* i a u u IIIb e (l/r) + K* i a u o IV e (l/m/n/r) i a â o V i/e + K* i a â e VI a a uo uo a VII Vokal Vokal ie ie Vokal *K bedeutet Konsonant. Es ist aber sinnvoller sich Vokabelkarten anzulegen und auf eine Seite den Infinitiv und auf die andere Seite die Stammformen zu schreiben und zu lernen (Wichtig: lange Vokale auch lang sprechen und kurze kurz). Man schreibt am besten, wenn man sich sicher ist, alles gelernt zu haben die Tabelle ab und zu auf ein Blatt. In der Klausur kann man sich dann bequem die Tabelle aus dem Kopf auf ein Schmierblatt schreiben und dann gemütlich ablesen. Man darf auf keinen Fall aber vergessen, sich auch die Verbindungen der Reihen IIIa, IIIb, IV, V und VII aufzuschreiben (i (m/n) + K usw.) 22
23 Präterito-Präsentien: Definition: Präterito-Präsentien 24 sind Verben, deren starke Präteritalformen Präsensbedeutung angenommen haben. Man vergleiche dazu z.b. die lateinischen Verba defectiva, wie meminisse. Diese sollten auswendig gelernt werden, aber keine Angst, es gibt nur ein paar: Ablautreihe Infinitiv 1. Pers. Sg. Präs. 1. Pers. Sg. Prät. I wizzen weiz wisse/wesse/wiste/weste II tugen/tügen touc tohte III kunnen/künnen kann kunde/konde gunnen/günnen ich gan du ganst gunde/gonde durfen/dürfen ich darf du darfst dorfte turren/türren 25 ich (ge)tag du tars (ge)torste IV suln/süln ich sal/sol du solde/solte salt/solt V mugen/mügen/magen ich mac du maht mahte/mohte VI mouzen/müezen ich mouz du moust mouse/mouste 23
24 6 Syntax Die Syntax, also der Satzbau behandelt die Anordnungen und Beziehungen sprachlicher Elemente in einem Satz. Kasusgebrauch: Genitiv (Frage: wessen?) Der Genitiv taucht im Mittelhochdeutschen sehr häufig auf, häufiger als heute. 26 Deshalb ist immer Vorsicht geboten, wenn die Wörter des oder wes auftauchen. Wie im Lateinischen gibt es im Mittelhochdeutschen einen genitivus obiectivus. So kann eines anderen wîbes minne sowohl die Liebe zu einer anderen Frau, als auch die Liebe einer anderen Frau bedeuten. Auch der genitivus partitivus findet sich im Mittelhochdeutschen: wâfens genouc; also der Waffen genug = genügend Waffen Einige mittelhochdeutsche Verben verbinden sich mit dem Genitiv (z.b. eines dinges (be)gern). Akkusativ (Frage: wen oder was?) Bestimmte mittelhochdeutsche Verben verbinden sich mit dem Akkusativ: einem sûmen = jemanden aufhalten einen clagen = über jemanden klagen 24
25 Nebensatzeinleitende Konjunktionen: Nebensatzart Einleitende Wörter (mhd.) Einleitende Wörter (nhd.) Temporalsätze (Zeitsätze) dô unz sît sô nû als/nachdem bis seit/nachdem wenn als/wie nun Kausalsätze (Begründungssätze) Modalsätze (Art und Weise) Konditionalsätze (Bedingungssätze) Konzessivsätze (Einräumungssätze) sît wan(de) durch daz/umbe daz nû daz sô als sam swie daz ob sô aleine ob swie doch da/weil da/weil deshalb da nun wie/so wie wie wie/wie wenn wie (auch immer) in der Weise, dass wenn/falls wenn obwohl wenn auch wenn auch obgleich Finalsätze (Zwecksätze) daz/durch daz/ûf daz damit (+ Konjunktiv) Konsekutivsätze (Folgesätze) daz dass/sodass 25
26 Negation im Mittelhochdeutschen: Partikel und Pronomen, die im Mittelhochdeutschen Negation anzeigen: ne, en-, -n, n-, nie, niene, niht, niergen, nieman, nehein/dehein, neweder Eine doppelte Verneinung bewirkt im Mittelhochdeutschen eine Verstärkung. 27 Beispiel doppelte Verneinung: erne kuhmt niht er kommt bestimmt nicht Eine sogenannte pleonastische Verneinung 28 ist eine Verneinung mit einem (überflüssigen) Negationswort: Beispiel pleonastische Verneinung: ouch enwart da niht vergezzen wirn heten alles des die kraft daz man dâ heizet wirtschaft 29 Auch wurde da nicht versäumt, dass wir von all dem die Fülle hatten was man Bewirtung nennt Pleonastische Verneinung: Hauptsatz verneint, abhänginger Nebensatz, Negation, Konjunktiv. Der Exzeptivsatz (von lateinisch exceptio - Einschränkung) ist ein Satz, der eine Bedingung nennt, die die Aussage des Hauptsatzes aufhebt. Der Exzeptivsatz betont jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens der Ausnahme gering ist: 26
27 Beispiel Exzeptivsatz: dô riefens alle unter in er entaete sînen lewen hin, mit im envaehte niemen dâ. 30 Da riefen sie alle: niemand werde mit ihnen kämpfen, wenn er nicht seinen Löwen wegtäte 7 Nützliche Links im Weltnetz Link materialien/merkverse.html ls-bennewitz/literatur/literatur_ grundlegendes.htm Beschreibung Mediävistische Merkverse Mediävistisches Fachportal Eine nützliche Bibliographie gebrauchte Bücher 27
28 Endnoten 1 Affrikaten werden gebildet, indem zu einem Verschlusslaut ein homorgan gebildeter Reibelaut tritt: z = [ts]. Homorgan bedeutet, dass etwas an der gleichen Stelle (homo = gleich; Organ = Sprechorgan) gebildet wird. 2 In indogermanischen Sprachen gibt es auch behauchte Verschlusslaute: b h d h - g h. Man spricht von sogenannten aspirierten Obstruenten. 3 Wir unterscheiden zwischen Monophthongen und Diphthongen (Achtung jeweils mit zwei h!). Verbinden sich zwei Monophthonge (a e i o u) ergibt sich ein Diphthong (ei au eu). Das Mittelhochdeutsche iu ist kein (!) Diphthong, da bei der Aussprache nur ein Vokal zu hören ist (wie unser ü). 4 Aus dem lateinischen labellum = Lippe, wie unser Labello. 5 Einfach mit Zäpfchen-R aussprechen LaRRRRRRyngale. 6 Der medizinische Namen des Vordergaumens ist palatum durum. 7 Aus dem lateinischen velum für Segel (sogenanntes Gaumensegel). 8 In der Linguistik wird der Asteriskus übrigens eingesetzt um ungammatische Sätze zu markieren: *Paul Hund kauft immer. 9 Das Zeichen þ(thorn) spricht man wie das englische th aus (engl. three). 10 Das Lateinische und Englische dienen hier, wie bereits angesprochen, als Vergleichssprachen. 11 Spirant ist ein anderes Wort für Frikativ (Reibelaut). 12 Oft als ch geschrieben beschränkt sich auf den Süden. 13 Gemination ist nicht anderes als Verdopplung. In der Literaturwissenschaft gibt es übrigens ein Stilmittel namens Geminatio, das ist die Wiederholung eines Wortes: Hört, hört!. 14 Abwecheln. 15 So zum Beispiel mhd. verlorn (Partizip II ), aber mhd. verlust (Substantiv). 16 Dran denken: gemeint ist hier nicht Hochdeutsch im Sinne von Standartdeutsch. 17 d t. 18 Achtung! Sowohl Monophthong, als auch Diphthong schreibt man jeweils mit zwei h! 19 Achtung! Bei iu handelt es sich um einen Monophthong. Geschrieben wird er zwar mit zwei Vokalen, gesprochen aber wie ein langes ü. 20 Thordis Hennings: Einführung in das Mittelhochdeutsche. Berlin und New York S
29 21 Der Doppelpunkt weißt (wie das Zirkumflex) auf eine lange Aussprache hin. Die eckigen Klammern werden in der Phonetik verwendet. 22 Die Verschmelzung zweier Buchstaben zu einer optischen Einheit nennt man übrigens Ligatur. 23 Synkope: Ausfall eines unbetonten Vokals im Wortinnern. 24 Einige Dozenten sind sehr(!) verärgert, wenn man dieses Wort nicht richtig schreiben kann und vergeben dann auch keine Punkte! 25 Nhd. wagen. 26 Bastian Sick bemerkte ja bereits, dass der Dativ dem Genitiv sein Tot ist. 27 Wie in manchen deutschen Dialekten auch noch vorhanden (z.b. im bairischen Dialekten) oder im Französischen oder Englischen noch vorhanden (Bloodhound Gang:... we don t need no water... ) 28 Den Pleonasmus kennen wir auch als Stilmittel. Beim Pleonasmus werden verschiedene Wörter mit gleicher Bedeutung aneinandergereiht: hörbare Musik. 29 Hartmann von Aue: Iwein. V. 364 ff. 30 Hartmann von Aue: Iwein. V ff. 29
Einführung in das Mittelhochdeutsche
 De Gruyter Studium Einführung in das Mittelhochdeutsche Bearbeitet von Thordis Hennings überarbeitet 2012. Taschenbuch. X, 254 S. Paperback ISBN 978 3 11 025958 2 Format (B x L): 15,5 x 23 cm Gewicht:
De Gruyter Studium Einführung in das Mittelhochdeutsche Bearbeitet von Thordis Hennings überarbeitet 2012. Taschenbuch. X, 254 S. Paperback ISBN 978 3 11 025958 2 Format (B x L): 15,5 x 23 cm Gewicht:
Mittelhochdeutsche i Grammatik
 Mittelhochdeutsche i Grammatik von Helmut de Boor und Roswitha Wisniewski " i Zehnte Auflage Jiurchgesehen in Zusammenarbeit mit Helmut Beifuss i 'er- g wde G I 1998 i Walter de Gruyter Berlin New York
Mittelhochdeutsche i Grammatik von Helmut de Boor und Roswitha Wisniewski " i Zehnte Auflage Jiurchgesehen in Zusammenarbeit mit Helmut Beifuss i 'er- g wde G I 1998 i Walter de Gruyter Berlin New York
Vom Urgermanischen zum Neuhochdeutschen
 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Vom Urgermanischen zum Neuhochdeutschen Eine historische Phonologie
2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Vom Urgermanischen zum Neuhochdeutschen Eine historische Phonologie
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT ABKÜRZUNGEN UND ZEICHEN... 19
 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT... 13 ABKÜRZUNGEN UND ZEICHEN... 19 EINLEITUNG... 23 E 1 Geografische Lage... 23 E 2 Besiedlung im Laufe der Geschichte... 24 E 3 Der Name Laurein bzw. Lafreng... 26 E 4 Laureiner
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT... 13 ABKÜRZUNGEN UND ZEICHEN... 19 EINLEITUNG... 23 E 1 Geografische Lage... 23 E 2 Besiedlung im Laufe der Geschichte... 24 E 3 Der Name Laurein bzw. Lafreng... 26 E 4 Laureiner
Einführende Hinweise zum Mittelhochdeutschen
 Einführende Hinweise zum Mittelhochdeutschen Periodisierung der deutschen / germanischen Sprachgeschichte Sprachliche Kennzeichen Graphie und Aussprache Besondere sprachliche Erscheinungen Dr. Martin Schuhmann
Einführende Hinweise zum Mittelhochdeutschen Periodisierung der deutschen / germanischen Sprachgeschichte Sprachliche Kennzeichen Graphie und Aussprache Besondere sprachliche Erscheinungen Dr. Martin Schuhmann
DEUTSCHE MUNDARTKUNDE
 DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN VeröflFentlichungen des Instituts für deutsche Sprache und Literatur 25 V. M. SCHIRMUNSKI DEUTSCHE MUNDARTKUNDE Vergleichende Laut- und Formenlehre der deutschen
DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN VeröflFentlichungen des Instituts für deutsche Sprache und Literatur 25 V. M. SCHIRMUNSKI DEUTSCHE MUNDARTKUNDE Vergleichende Laut- und Formenlehre der deutschen
ALTENGLISCHE GRAMMATIK,
 KARL BRUNNER ALTENGLISCHE GRAMMATIK, NACH DER ANGELSÄCHSISCHEN GRAMMATIK VON EDUARD SIEVERS DRITTE, NEUBEARBEITETE AUFLAGE MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN 1965 INHALT (Die eingeklammerten Zahlen beziehen
KARL BRUNNER ALTENGLISCHE GRAMMATIK, NACH DER ANGELSÄCHSISCHEN GRAMMATIK VON EDUARD SIEVERS DRITTE, NEUBEARBEITETE AUFLAGE MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN 1965 INHALT (Die eingeklammerten Zahlen beziehen
Geschichte der deutschen Sprache
 ll tue Im Sclftmidlß Geschichte der deutschen Sprache Ein Lehrbuch für das germanistische Studium 8., völlig überarbeitete Auflage, erarbeitet unter der Leitung von Helmut Langner und Norbert Richard Wolf
ll tue Im Sclftmidlß Geschichte der deutschen Sprache Ein Lehrbuch für das germanistische Studium 8., völlig überarbeitete Auflage, erarbeitet unter der Leitung von Helmut Langner und Norbert Richard Wolf
Herbst 14 Thema 3 Teil II
 Herbst 14 Thema 3 Teil II Erklärungen von Lautgesetzen neuhochdeutsche Monophthongierung: spontaner Lautwandel: Diphthonge Monophthonge (Langvokale), diachrone Ebene, ab dem 11. bzw. 12. Jhd., in manchen
Herbst 14 Thema 3 Teil II Erklärungen von Lautgesetzen neuhochdeutsche Monophthongierung: spontaner Lautwandel: Diphthonge Monophthonge (Langvokale), diachrone Ebene, ab dem 11. bzw. 12. Jhd., in manchen
Spickzettel zum Materialpaket: Anlautbilder für DaZ Seite 1 von 5
 Spickzettel zum Materialpaket: Anlautbilder für DaZ Seite 1 von 5 Spickzettel Anlautbilder für DaZ In diesem Spickzettel findet ihr zusätzliche Informationen zum Materialpaket Anlautbilder für DaZ. Insbesondere
Spickzettel zum Materialpaket: Anlautbilder für DaZ Seite 1 von 5 Spickzettel Anlautbilder für DaZ In diesem Spickzettel findet ihr zusätzliche Informationen zum Materialpaket Anlautbilder für DaZ. Insbesondere
Lautwandel. als Thema im Deutschunterricht. Universität zu Köln Sprachgeschichte und Schule WS 2016/17
 Lautwandel als Thema im Deutschunterricht Universität zu Köln Sprachgeschichte und Schule WS 2016/17 Referenten: Julian Kallfaß, Carina Kohnen, Marina Hambach & Annika Huijbregts Übersicht Teil Ⅰ: Theoretische
Lautwandel als Thema im Deutschunterricht Universität zu Köln Sprachgeschichte und Schule WS 2016/17 Referenten: Julian Kallfaß, Carina Kohnen, Marina Hambach & Annika Huijbregts Übersicht Teil Ⅰ: Theoretische
NORWEGISCHE SPRACHGESCHICHTE
 NORWEGISCHE SPRACHGESCHICHTE VON DIDRIK ARUP SEIP BEARBEITET UND ERWEITERT VON LAURITS SALTVEIT w DE G WALTER DE GRUYTER BERLIN NEW YORK 1971 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort XIII Einleitung: Nordisch und Germanisch
NORWEGISCHE SPRACHGESCHICHTE VON DIDRIK ARUP SEIP BEARBEITET UND ERWEITERT VON LAURITS SALTVEIT w DE G WALTER DE GRUYTER BERLIN NEW YORK 1971 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort XIII Einleitung: Nordisch und Germanisch
FRÜHNEUHOCHDEUTSCHE GRAMMATIK
 OSKAR REICHMANN, KLAUS-PETER WEGERA (HRSG.) FRÜHNEUHOCHDEUTSCHE GRAMMATIK von ROBERT PETER EBERT, OSKAR REICHMANN, HANS-JOACHIM SOLMS UND KLAUS-PETER WEGERA MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN 1993 INHALT Verzeichnis
OSKAR REICHMANN, KLAUS-PETER WEGERA (HRSG.) FRÜHNEUHOCHDEUTSCHE GRAMMATIK von ROBERT PETER EBERT, OSKAR REICHMANN, HANS-JOACHIM SOLMS UND KLAUS-PETER WEGERA MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN 1993 INHALT Verzeichnis
Inhaltsverzeichnis. II.4. Phonetik und Phonologie II.4.A Zur Phonetik... 27
 Inhaltsverzeichnis Vorwort...xi Bibliographie...xiii I. Präliminarien... 1 I.1. Begrifflichkeiten... 1 I.1.A Zum Begriff Indogermanisch... 1 I.1.B Grundsprache und Gemeinsprache... 2 I.1.C Wandelprozesse...3
Inhaltsverzeichnis Vorwort...xi Bibliographie...xiii I. Präliminarien... 1 I.1. Begrifflichkeiten... 1 I.1.A Zum Begriff Indogermanisch... 1 I.1.B Grundsprache und Gemeinsprache... 2 I.1.C Wandelprozesse...3
Katharina Baier/Werner Schäfke. Altnordisch. Eine Einführung. narr
 Katharina Baier/Werner Schäfke Altnordisch Eine Einführung narr Inhaltsverzeichnis Vorwort vii Zeichenerklärung xi Abkürzungsverzeichnis xiii 1 Sprachgeschichte 1 2 Lautsystem 5 2.1 Übung zur Terminologie
Katharina Baier/Werner Schäfke Altnordisch Eine Einführung narr Inhaltsverzeichnis Vorwort vii Zeichenerklärung xi Abkürzungsverzeichnis xiii 1 Sprachgeschichte 1 2 Lautsystem 5 2.1 Übung zur Terminologie
DEUTSCHE DIALEKTOLOGIE. Prof. Nicole Nau, UAM 2016 Zweite Vorlesung,
 DEUTSCHE DIALEKTOLOGIE Prof. Nicole Nau, UAM 2016 Zweite Vorlesung, 03.03.2016 Fragen des Tages Wie und wann fing die deusche Dialektologie an? Was sind die Wenker-Sätze und wo findet man sie? Was unterscheidet
DEUTSCHE DIALEKTOLOGIE Prof. Nicole Nau, UAM 2016 Zweite Vorlesung, 03.03.2016 Fragen des Tages Wie und wann fing die deusche Dialektologie an? Was sind die Wenker-Sätze und wo findet man sie? Was unterscheidet
Wiederholung. Konsonantenchart des Deutschen nach Hall 2000
 Wiederholung Konsonantenchart des Deutschen nach Hall 2000 Die Anordnung der IPA-Tabelle spiegelt die verschiedenen Kriterien der Lautklassifizierung wider. Wiederholung Konsonanten Werden in der Regel
Wiederholung Konsonantenchart des Deutschen nach Hall 2000 Die Anordnung der IPA-Tabelle spiegelt die verschiedenen Kriterien der Lautklassifizierung wider. Wiederholung Konsonanten Werden in der Regel
Thordis Hennings Einführung in das Mittelhochdeutsche
 Thordis Hennings Einführung in das Mittelhochdeutsche Thordis Hennings Einführung in das Mittelhochdeutsche 3., durchgesehene und verbesserte Auflage De Gruyter ISBN 978-3-11-025958-2 e-isbn 978-3-11-025959-9
Thordis Hennings Einführung in das Mittelhochdeutsche Thordis Hennings Einführung in das Mittelhochdeutsche 3., durchgesehene und verbesserte Auflage De Gruyter ISBN 978-3-11-025958-2 e-isbn 978-3-11-025959-9
Einführung ins Frühneuhochdeutsche
 Gerhard Philipp Einführung ins Frühneuhochdeutsche Sprachgeschichte - Grammatik - Texte Quelle & Meyer Heidelberg Inhalt Einleitende Vorbemerkungen Abkürzungen IX XIII 1. Zur Bestimmung der frühneuhochdeutschen
Gerhard Philipp Einführung ins Frühneuhochdeutsche Sprachgeschichte - Grammatik - Texte Quelle & Meyer Heidelberg Inhalt Einleitende Vorbemerkungen Abkürzungen IX XIII 1. Zur Bestimmung der frühneuhochdeutschen
Arbeitsblatt 1: Transkription Konsonanten
 Übungen zu Modul A: Grundlagen der Phonetik, IPDS, WS 2005/06, T. Wesener 1 Arbeitsblatt 1: Transkription Konsonanten Aufgabe 1: Benennen Sie die in der Abbildung durchnummerierten Artikulationsorte bzw.
Übungen zu Modul A: Grundlagen der Phonetik, IPDS, WS 2005/06, T. Wesener 1 Arbeitsblatt 1: Transkription Konsonanten Aufgabe 1: Benennen Sie die in der Abbildung durchnummerierten Artikulationsorte bzw.
Mittelhochdeutsche Kurzgrammatik
 Mittelhochdeutsche Kurzgrammatik Ältere deutsche Literaturwissenschaft Institut für Deutsche Literatur und ihre Didaktik Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Stand: 10. September 2009 Inhaltsverzeichnis
Mittelhochdeutsche Kurzgrammatik Ältere deutsche Literaturwissenschaft Institut für Deutsche Literatur und ihre Didaktik Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Stand: 10. September 2009 Inhaltsverzeichnis
Hilkert Weddige. Mittelhochdeutsch. Eine Einführung. Verlag C. H. Beck München
 Hilkert Weddige Mittelhochdeutsch Eine Einführung Verlag C. H. Beck München Inhalt Vorbemerkung XI 1. Einleitung 1.1 Indoeuropäisch Germanisch Deutsch 1 1.1.1 Die indoeuropäischen (oder indogermanischen)
Hilkert Weddige Mittelhochdeutsch Eine Einführung Verlag C. H. Beck München Inhalt Vorbemerkung XI 1. Einleitung 1.1 Indoeuropäisch Germanisch Deutsch 1 1.1.1 Die indoeuropäischen (oder indogermanischen)
Inhaltsverzeichnis. Abkürzungen... 9 Niveaustufentests Tipps & Tricks Auf einen Blick Auf einen Blick Inhaltsverzeichnis
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abkürzungen... 9 Niveaustufentests... 10 Tipps & Tricks... 18 1 Der Artikel... 25 1.1 Der bestimmte Artikel... 25 1.2 Der unbestimmte Artikel... 27 2 Das Substantiv...
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abkürzungen... 9 Niveaustufentests... 10 Tipps & Tricks... 18 1 Der Artikel... 25 1.1 Der bestimmte Artikel... 25 1.2 Der unbestimmte Artikel... 27 2 Das Substantiv...
Varietäten und Register der deutschen Sprache
 Klaus Otto Schnelzer, M.A. Varietäten und Register der deutschen Sprache Masaryk-Universität Brünn Institut für Germanistik, Nordistik und Nederlandistik Frühjahrssemester 2012 Di, 2. April 2013 Was sind
Klaus Otto Schnelzer, M.A. Varietäten und Register der deutschen Sprache Masaryk-Universität Brünn Institut für Germanistik, Nordistik und Nederlandistik Frühjahrssemester 2012 Di, 2. April 2013 Was sind
Artikulationsstelle Lautbezeichnung Beispiel Nasenraum Nasale - n, m, ng Nase Mund - Gang Lippen Labiale (lat. labrum: die Lippe) b, Bär pusten -
 Laut und Buchstabe Ein Wort weckt (ausgesprochen oder im Schriftbild) im Hörer die Vorstellung eines Gegenstandes. Beispiel: WALD (Schriftbild) [valt] (Lautschrift) So besitzt jedes Wort eine Ausdrucks-
Laut und Buchstabe Ein Wort weckt (ausgesprochen oder im Schriftbild) im Hörer die Vorstellung eines Gegenstandes. Beispiel: WALD (Schriftbild) [valt] (Lautschrift) So besitzt jedes Wort eine Ausdrucks-
Althochdeutsch - Mittelhochdeutsch
 Udo Gerdes u^ Gerhard Spellerberg ^ Althochdeutsch - Mittelhochdeutsch Grammatischer Grundkurs zur Einführung und Textlektüre u 6., durchgesehene und ergänzte Auflage Athenäum Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung
Udo Gerdes u^ Gerhard Spellerberg ^ Althochdeutsch - Mittelhochdeutsch Grammatischer Grundkurs zur Einführung und Textlektüre u 6., durchgesehene und ergänzte Auflage Athenäum Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung
MITTELHOCHDEUTSCHE GRAMMATIK
 HERMANN PAUL MITTELHOCHDEUTSCHE GRAMMATIK 24. Auflage überarbeitet von PETER WIEHL UND SIEGFRIED GROSSE MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN 1998 Inhalt Vorworte XVII EINLEITUNG ( 1-23) Überarbeitet von Peter
HERMANN PAUL MITTELHOCHDEUTSCHE GRAMMATIK 24. Auflage überarbeitet von PETER WIEHL UND SIEGFRIED GROSSE MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN 1998 Inhalt Vorworte XVII EINLEITUNG ( 1-23) Überarbeitet von Peter
Vorwort zur 11. Auflage Aus dem Vorwort zur 6. Auflage Verzeichnis der Abbildungen und Karten Abkürzungsverzeichnis
 Vorwort zur 11. Auflage Aus dem Vorwort zur 6. Auflage Verzeichnis der Abbildungen und Karten Abkürzungsverzeichnis V VII XVII XIX 0. Einführung 1 0.1. Sprache als gesellschaftliche Erscheinung 1 0.2.
Vorwort zur 11. Auflage Aus dem Vorwort zur 6. Auflage Verzeichnis der Abbildungen und Karten Abkürzungsverzeichnis V VII XVII XIX 0. Einführung 1 0.1. Sprache als gesellschaftliche Erscheinung 1 0.2.
Vorwort zur 11. Auflage... Aus dem Vorwort zur 6. Auflage... Verzeichnis der Abbildungen und Karten... Abkürzungsverzeichnis...
 IX 2. Inhaltsverzeichnis* Vorwort zur 11. Auflage......................................... Aus dem Vorwort zur 6. Auflage................................... Verzeichnis der Abbildungen und Karten.............................
IX 2. Inhaltsverzeichnis* Vorwort zur 11. Auflage......................................... Aus dem Vorwort zur 6. Auflage................................... Verzeichnis der Abbildungen und Karten.............................
LEKTION 7. DER VOKALISMUS
 LEKTION 7. DER VOKALISMUS Querschnitt durch das System der Vokalphoneme des Althochdeutschen im 9. Jahrhundert Kurze Vokale: a, ë, e, i, o, u: a ë (=germ. e) e (umgelautetes a) i o u ahto 'acht', tag 'Tag';
LEKTION 7. DER VOKALISMUS Querschnitt durch das System der Vokalphoneme des Althochdeutschen im 9. Jahrhundert Kurze Vokale: a, ë, e, i, o, u: a ë (=germ. e) e (umgelautetes a) i o u ahto 'acht', tag 'Tag';
MITTELHOCHDEUTSCHE GRAMMATIK
 HERMANN PAUL MITTELHOCHDEUTSCHE GRAMMATIK 25. Auflage neu bearbeitet von THOMAS KLEIN, HANS-JOACHIM SOLMS UND KLAUS-PETER WEGERA Mit einer Syntax von Ingeborg Schöbler, neubearbeitet und erweitert von
HERMANN PAUL MITTELHOCHDEUTSCHE GRAMMATIK 25. Auflage neu bearbeitet von THOMAS KLEIN, HANS-JOACHIM SOLMS UND KLAUS-PETER WEGERA Mit einer Syntax von Ingeborg Schöbler, neubearbeitet und erweitert von
Artikulations-, Hör- und Transkriptionsübung I
 Institut für Phonetik, Universität des Saarlandes Artikulations-, Hör- und Transkriptionsübung I Einführung, Teil 2 Konsonanten Einführung: IPA-Tabelle Struktur der IPA-Tabelle (1) Wie werden die pulmonalen
Institut für Phonetik, Universität des Saarlandes Artikulations-, Hör- und Transkriptionsübung I Einführung, Teil 2 Konsonanten Einführung: IPA-Tabelle Struktur der IPA-Tabelle (1) Wie werden die pulmonalen
Artikulation, Hör- und Transkriptionsübung
 Artikulation, Hör- und Transkriptionsübung IPA-Tabelle; Einführung in die Konsonanten; Plosive Stephanie Köser (M.A.), Sprachwissenschaft & Sprachtechnologie, Universität des Saarlandes Themen Internationales
Artikulation, Hör- und Transkriptionsübung IPA-Tabelle; Einführung in die Konsonanten; Plosive Stephanie Köser (M.A.), Sprachwissenschaft & Sprachtechnologie, Universität des Saarlandes Themen Internationales
Einführung in die Mediävistik - GK II. Übersetzungskurs
 Einführung in die Mediävistik - GK II Übersetzungskurs 1 Inhaltsverzeichnis TEIL 1 - THEORIE... 5 1. EINFÜHRUNG MITTELHOCHDEUTSCH... 6 1.1 BEGRIFFSBESTIMMUNG... 6 1.1.1 ZEITLICHE KOMPONENTE: MITTEL HOCH
Einführung in die Mediävistik - GK II Übersetzungskurs 1 Inhaltsverzeichnis TEIL 1 - THEORIE... 5 1. EINFÜHRUNG MITTELHOCHDEUTSCH... 6 1.1 BEGRIFFSBESTIMMUNG... 6 1.1.1 ZEITLICHE KOMPONENTE: MITTEL HOCH
.««JüetlCa.Jjyad Übungsbuch der deutschen Grammatik
 Dreyer Schmitt.««JüetlCa.Jjyad Übungsbuch der deutschen Grammatik Neubearbeitung Verlag für Deutsch Inhaltsverzeichnis Teil I < 1 Deklination des Substantivs I 9 Artikel im Singular 9 I Artikel im Plural
Dreyer Schmitt.««JüetlCa.Jjyad Übungsbuch der deutschen Grammatik Neubearbeitung Verlag für Deutsch Inhaltsverzeichnis Teil I < 1 Deklination des Substantivs I 9 Artikel im Singular 9 I Artikel im Plural
Dreyer Schmitt. Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatil< Hueber Verlag
 Hilke Richard Dreyer Schmitt Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatil< Hueber Verlag Inhaltsverzeichnis Teil I 9 13 Transitive und intransitive Verben, die schwer zu unterscheiden sind 75 1 Deklination
Hilke Richard Dreyer Schmitt Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatil< Hueber Verlag Inhaltsverzeichnis Teil I 9 13 Transitive und intransitive Verben, die schwer zu unterscheiden sind 75 1 Deklination
Übung: Phonetische Transkription
 Übung: Phonetische Transkription IPA-Tabelle, Transkription; Einführung in die Konsonanten Stephanie Köser (M.A.), Sprachwissenschaft & Sprachtechnologie, Universität des Saarlandes Hausaufgabe von letzter
Übung: Phonetische Transkription IPA-Tabelle, Transkription; Einführung in die Konsonanten Stephanie Köser (M.A.), Sprachwissenschaft & Sprachtechnologie, Universität des Saarlandes Hausaufgabe von letzter
Geschichte der deutschen Sprache
 Wilhelm Schmidt Geschichte der deutschen Sprache Ein Lehrbuch fürdas germanistische Studium 10., verbesserte und erweiterte Auflage, erarbeitet unter der Leitung von Helmut Langner und Norbert Richard
Wilhelm Schmidt Geschichte der deutschen Sprache Ein Lehrbuch fürdas germanistische Studium 10., verbesserte und erweiterte Auflage, erarbeitet unter der Leitung von Helmut Langner und Norbert Richard
Konsonanten
 WiSe16/17 Modul: Grundlagen der Germanistik (Schwerpunkt Sprachwissenschaft), 04-003-WBWS-1 Betreuung: Matthias Richter Studierende: Irina Prutskova, Merle Staege Konsonanten 24.10.2016 Artikulationsstellen
WiSe16/17 Modul: Grundlagen der Germanistik (Schwerpunkt Sprachwissenschaft), 04-003-WBWS-1 Betreuung: Matthias Richter Studierende: Irina Prutskova, Merle Staege Konsonanten 24.10.2016 Artikulationsstellen
ELS OKSAAR. Mittelhochdeutsch TEXTE KOMMENTARE S.PRACHKUNDE WÖRTERBUCH AWE. Almqvist & Wiksell STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA
 ELS OKSAAR Mittelhochdeutsch TEXTE KOMMENTARE S.PRACHKUNDE WÖRTERBUCH AWE Almqvist & Wiksell STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 TEXTE LYRIK 11 1. Namenlose Lieder 11 2. Der von
ELS OKSAAR Mittelhochdeutsch TEXTE KOMMENTARE S.PRACHKUNDE WÖRTERBUCH AWE Almqvist & Wiksell STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 TEXTE LYRIK 11 1. Namenlose Lieder 11 2. Der von
Einleitung 3. s Die unpersönlichen Sätze 14 Übungen Die bejahenden und die verneinenden Sätze 17 Übungen 20
 INHALTSVERZEICHNIS Einleitung 3 Kapitel I Der einfache Satz 1. Allgemeines 4 2. Der Aussagesatz, der Fragesatz und der Aufforderungssatz 5 6 3. Stellung der Nebenglieder des Satzes 8 1 9 4. Die unbestimmt-persönlichen
INHALTSVERZEICHNIS Einleitung 3 Kapitel I Der einfache Satz 1. Allgemeines 4 2. Der Aussagesatz, der Fragesatz und der Aufforderungssatz 5 6 3. Stellung der Nebenglieder des Satzes 8 1 9 4. Die unbestimmt-persönlichen
Stichwortverzeichnis. Anhang. Bedingungssatz siehe Konditionalsatz Befehlsform
 Anhang 130 A Adjektiv 68 73, 112 Bildung aus anderen Wörtern 69 mit Genitiv 63 Übersicht Deklination 108 109 Adverb 74 77, 112 Steigerung 76 Stellung 77 Typen (lokal, temporal, kausal, modal) 75 adverbiale
Anhang 130 A Adjektiv 68 73, 112 Bildung aus anderen Wörtern 69 mit Genitiv 63 Übersicht Deklination 108 109 Adverb 74 77, 112 Steigerung 76 Stellung 77 Typen (lokal, temporal, kausal, modal) 75 adverbiale
Langenscheidt Deutsch-Flip Grammatik
 Langenscheidt Flip Grammatik Langenscheidt Deutsch-Flip Grammatik 1. Auflage 2008. Broschüren im Ordner. ca. 64 S. Spiralbindung ISBN 978 3 468 34969 0 Format (B x L): 10,5 x 15,1 cm Gewicht: 64 g schnell
Langenscheidt Flip Grammatik Langenscheidt Deutsch-Flip Grammatik 1. Auflage 2008. Broschüren im Ordner. ca. 64 S. Spiralbindung ISBN 978 3 468 34969 0 Format (B x L): 10,5 x 15,1 cm Gewicht: 64 g schnell
Vorwort Abkürzungen Abbildungsnachweise. Indogermanisch - Aufgabe - Vom Indogermanischen zum Germanischen - Germanisch - Altnordisch
 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort Abkürzungen Abbildungsnachweise XI XIII XIII KAPITEL 1 I. INDOGERMANISCH - GERMANISCH - ALTNORDISCH 1 Indogermanisch - Aufgabe - Vom Indogermanischen zum Germanischen - Germanisch
INHALTSVERZEICHNIS Vorwort Abkürzungen Abbildungsnachweise XI XIII XIII KAPITEL 1 I. INDOGERMANISCH - GERMANISCH - ALTNORDISCH 1 Indogermanisch - Aufgabe - Vom Indogermanischen zum Germanischen - Germanisch
Was ist die Ortsergänzung? Wie fragt man nach der Ortsergänzung? Was ist das Subjekt? Wie fragt man nach dem Subjekt?
 Was ist das Subjekt? Wie fragt man nach dem Subjekt? Was ist die Ortsergänzung? Wie fragt man nach der Ortsergänzung? Was ist das Dativobjekt? Wie fragt man nach dem Dativobjekt? Was ist die Zeitergänzung?
Was ist das Subjekt? Wie fragt man nach dem Subjekt? Was ist die Ortsergänzung? Wie fragt man nach der Ortsergänzung? Was ist das Dativobjekt? Wie fragt man nach dem Dativobjekt? Was ist die Zeitergänzung?
Germanischdeutsche. Sprachgeschichte im Überblick
 Günther Schweikle Germanischdeutsche Sprachgeschichte im Überblick Vierte Auflage J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung Stuttgart Weimar Vorwort I n h a l t s v e r z e i c h n i s Grundlegender Teil 1
Günther Schweikle Germanischdeutsche Sprachgeschichte im Überblick Vierte Auflage J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung Stuttgart Weimar Vorwort I n h a l t s v e r z e i c h n i s Grundlegender Teil 1
Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache Handout I.
 Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache Handout I. 1. Verändert sich die Sprache überhaupt? Strukturalistische Auffassung (Ferdinand de Saussure): Nur durch gezielte Untersuchungen sichtbar, weil der
Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache Handout I. 1. Verändert sich die Sprache überhaupt? Strukturalistische Auffassung (Ferdinand de Saussure): Nur durch gezielte Untersuchungen sichtbar, weil der
Artikulatorische distinktive Merkmale der Konsonanten im Deutschen
 Referentinnen Ania Lamkiewicz Eva Mujdricza Computerlinguistik 1. FS Computerlinguistik 1. FS Romanistik 2. FS DaF Sprachwissenschaft 1. FS e-mail: al_smile@web.de e-mail: mujdricza@web.de Artikulatorische
Referentinnen Ania Lamkiewicz Eva Mujdricza Computerlinguistik 1. FS Computerlinguistik 1. FS Romanistik 2. FS DaF Sprachwissenschaft 1. FS e-mail: al_smile@web.de e-mail: mujdricza@web.de Artikulatorische
MITTELHOCHDEUTSCHE GRAMMATIK
 HERMANN PAUL MITTELHOCHDEUTSCHE GRAMMATIK 25. Auflage neu bearbeitet vou THOMAS KLEIN, HANS-JOACHIM SOLMS UND KLAUS-PETER WEGERA Mit einer Syntax von Ingeborg Schöbler, neubearbeitet und erweitert von
HERMANN PAUL MITTELHOCHDEUTSCHE GRAMMATIK 25. Auflage neu bearbeitet vou THOMAS KLEIN, HANS-JOACHIM SOLMS UND KLAUS-PETER WEGERA Mit einer Syntax von Ingeborg Schöbler, neubearbeitet und erweitert von
Mitlautverdopplung hören, sprechen und schreiben (Klasse 2)
 Germanistik Stefanie Maurer Mitlautverdopplung hören, sprechen und schreiben (Klasse 2) Unterrichtsentwurf Inhaltsverzeichnis 1. Sachanalyse... 1 1.1 Thema: Mitlautverdopplung... 1 Definition von Konsonanten...
Germanistik Stefanie Maurer Mitlautverdopplung hören, sprechen und schreiben (Klasse 2) Unterrichtsentwurf Inhaltsverzeichnis 1. Sachanalyse... 1 1.1 Thema: Mitlautverdopplung... 1 Definition von Konsonanten...
MUSTERLÖSUNGEN. 1. Übung 1
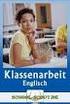 MUSTERLÖSUNGEN 1.1. Aufgabe. Transkribieren Sie ins IPA: 1. Übung 1 Bett - [bet] Decke - [dek@] Beet - [be:t] Apfel - [apf@l] oder [apfl " ] Madrid - [madrit] (mit alveolarem Trill, d.h. gerolltem Zungen-R
MUSTERLÖSUNGEN 1.1. Aufgabe. Transkribieren Sie ins IPA: 1. Übung 1 Bett - [bet] Decke - [dek@] Beet - [be:t] Apfel - [apf@l] oder [apfl " ] Madrid - [madrit] (mit alveolarem Trill, d.h. gerolltem Zungen-R
Sprachen. Christina Müller
 Sprachen Christina Müller Die lautliche Entwicklung exemplarischer Wörter vom Klassischen Latein über das Altfranzösische bis zum Neufranzösischen. (Wiedergabe des Wandels in Formeln) Studienarbeit Théories
Sprachen Christina Müller Die lautliche Entwicklung exemplarischer Wörter vom Klassischen Latein über das Altfranzösische bis zum Neufranzösischen. (Wiedergabe des Wandels in Formeln) Studienarbeit Théories
Substantiv / Artikelwort: Die Deklination
 Substantiv / Artikelwort: Die Deklination Das Substantiv hat ein Artikelwort. Das Artikelwort sagt uns: Das Substantiv ist mask., neutr. oder fem. Das Substantiv ist Sg. oder Pl. Das Substantiv bildet
Substantiv / Artikelwort: Die Deklination Das Substantiv hat ein Artikelwort. Das Artikelwort sagt uns: Das Substantiv ist mask., neutr. oder fem. Das Substantiv ist Sg. oder Pl. Das Substantiv bildet
Gitterrätsel
 Gitterrätsel 1 2 3 4 1 2 3 4 1 diu maget und der gast vil kûme erbiten under in, daz der tac geflüzze hin und si z'ein ander möhtent komen. (Troj. Krieg) Wie heißt der zu geflüzze? 2 er (wart) gefleischet
Gitterrätsel 1 2 3 4 1 2 3 4 1 diu maget und der gast vil kûme erbiten under in, daz der tac geflüzze hin und si z'ein ander möhtent komen. (Troj. Krieg) Wie heißt der zu geflüzze? 2 er (wart) gefleischet
1 Das Geschlecht der Substantive
 1 Das Geschlecht der Substantive NEU Im Deutschen erkennst du das Geschlecht (Genus) der Substantive am Artikel: der (maskulin), die (feminin) und das (neutral). Das Russische kennt zwar keinen Artikel,
1 Das Geschlecht der Substantive NEU Im Deutschen erkennst du das Geschlecht (Genus) der Substantive am Artikel: der (maskulin), die (feminin) und das (neutral). Das Russische kennt zwar keinen Artikel,
Herbert Penzl. Althochdeutsch. Eine Einführung in Dialekte und Vorgeschichte. PETER LANG Bern Frankfurt am Main New York
 Herbert Penzl Althochdeutsch Eine Einführung in Dialekte und Vorgeschichte PETER LANG Bern Frankfurt am Main New York Inhalts Verzeichnis Vorwort 13 1 S 2 3 4 5 6 S 7 8 9 10 11 12 13 Einleitung Die Perioden
Herbert Penzl Althochdeutsch Eine Einführung in Dialekte und Vorgeschichte PETER LANG Bern Frankfurt am Main New York Inhalts Verzeichnis Vorwort 13 1 S 2 3 4 5 6 S 7 8 9 10 11 12 13 Einleitung Die Perioden
Inhalt. Vorwort 3 Liste der verwendeten Abkürzungen 4
 Inhalt Vorwort 3 Liste der verwendeten Abkürzungen 4 TEIL I 1 Deklination des Substantivs I 13 I Deklination mit dem bestimmten Artikel 13 II Deklination mit dem unbestimmten Artikel 13 III Pluralbildung
Inhalt Vorwort 3 Liste der verwendeten Abkürzungen 4 TEIL I 1 Deklination des Substantivs I 13 I Deklination mit dem bestimmten Artikel 13 II Deklination mit dem unbestimmten Artikel 13 III Pluralbildung
Bemerkungen zur sprachgeschichtlichen Entwicklung der deutschen Sprache
 Bemerkungen zur sprachgeschichtlichen Entwicklung der deutschen Sprache Mit Lautverschiebung werden bestimmte systematische Lautwandel-Phänomene bezeichnet, welche im Laufe der Entwicklung einer Sprache
Bemerkungen zur sprachgeschichtlichen Entwicklung der deutschen Sprache Mit Lautverschiebung werden bestimmte systematische Lautwandel-Phänomene bezeichnet, welche im Laufe der Entwicklung einer Sprache
Übung: Phonetische Transkription
 Institut für Phonetik, Universität des Saarlandes Übung: Phonetische Transkription 29.10.2014 IPA-Tabelle, Transkription; Einführung in die Konsonanten Institut für Phonetik, Universität des Saarlandes
Institut für Phonetik, Universität des Saarlandes Übung: Phonetische Transkription 29.10.2014 IPA-Tabelle, Transkription; Einführung in die Konsonanten Institut für Phonetik, Universität des Saarlandes
Geschichte der deutschen Sprache
 Schmidt Geschichte der deutschen Sprache Ein Lehrbuch für das germanistische Studium 6. Auflage, erarbeitet unter der Leitung von Helmut Langner S. Hirzel Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart
Schmidt Geschichte der deutschen Sprache Ein Lehrbuch für das germanistische Studium 6. Auflage, erarbeitet unter der Leitung von Helmut Langner S. Hirzel Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart
Einführung in die Phonetik und Phonologie
 Einführung in die Phonetik und Phonologie Oro-nasaler Prozess Oro-nasaler Prozess Artikulationsprozess Oro-nasaler Prozess Luftstromprozess Phonationsprozess Fragen zur Konsonantenbeschreibung Man kann
Einführung in die Phonetik und Phonologie Oro-nasaler Prozess Oro-nasaler Prozess Artikulationsprozess Oro-nasaler Prozess Luftstromprozess Phonationsprozess Fragen zur Konsonantenbeschreibung Man kann
Wortarten Merkblatt. Veränderbare Wortarten Unveränderbare Wortarten
 Wortarten Merkblatt Veränderbare Wortarten Deklinierbar (4 Fälle) Konjugierbar (Zeiten) Unveränderbare Wortarten Nomen Konjunktionen (und, weil,...) Artikel Verben Adverbien (heute, dort,...) Adjektive
Wortarten Merkblatt Veränderbare Wortarten Deklinierbar (4 Fälle) Konjugierbar (Zeiten) Unveränderbare Wortarten Nomen Konjunktionen (und, weil,...) Artikel Verben Adverbien (heute, dort,...) Adjektive
Günther Thomé, Dorothea Thomé. Basiskonzept Rechtschreiben Was ist einfach, was ist schwierig zu schreiben? isb
 Günther Thomé, Dorothea Thomé Basiskonzept Rechtschreiben Was ist einfach, was ist schwierig zu schreiben? über 2.500 Haupteinträge 99 Bilder und mehr wichtige Tabellen und Übersichten orientiert an den
Günther Thomé, Dorothea Thomé Basiskonzept Rechtschreiben Was ist einfach, was ist schwierig zu schreiben? über 2.500 Haupteinträge 99 Bilder und mehr wichtige Tabellen und Übersichten orientiert an den
Inhalt. Vorwort 3 Liste der verwendeten Abkürzungen 4 TEIL I
 Inhalt Vorwort 3 Liste der verwendeten Abkürzungen 4 TEIL I 1 Deklination des Substantivs I 13 I Deklination mit dem bestimmten Artikel 13 II Deklination mit dem unbestimmten Artikel 13 III Pluralbildung
Inhalt Vorwort 3 Liste der verwendeten Abkürzungen 4 TEIL I 1 Deklination des Substantivs I 13 I Deklination mit dem bestimmten Artikel 13 II Deklination mit dem unbestimmten Artikel 13 III Pluralbildung
Nasale (und andere Konsonanten)
 Jochen Trommer jtrommer@uni-leipzig.de Universität Leipzig Institut für Linguistik Einführung in die Phonologie WS 2006/2007 Weitere Artikulationsarten Plosive Frikative Affrikaten Laterale Vibranten Approximanten
Jochen Trommer jtrommer@uni-leipzig.de Universität Leipzig Institut für Linguistik Einführung in die Phonologie WS 2006/2007 Weitere Artikulationsarten Plosive Frikative Affrikaten Laterale Vibranten Approximanten
12. Hat der Buchdruck die deutsche Sprache verändert?
 Inhalt Einleitung 11 Sprachgeschichte und Sprachwandel 13 1. Seit wann wird Deutsch gesprochen? 13 2. Gibt es im heutigen Deutschen noch Spuren des Indogermanischen und des Germanischen? 14 3. Seit wann
Inhalt Einleitung 11 Sprachgeschichte und Sprachwandel 13 1. Seit wann wird Deutsch gesprochen? 13 2. Gibt es im heutigen Deutschen noch Spuren des Indogermanischen und des Germanischen? 14 3. Seit wann
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT...17 I TEXTTEIL VORBEMERKUNGEN ZUM SPRACHWISSENSCHAFTLICHEN TEIL...19
 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT...17 I TEXTTEIL...19 1 VORBEMERKUNGEN ZUM SPRACHWISSENSCHAFTLICHEN TEIL...19 2 EINFÜHRUNG... 21 2.1 Vorbemerkungen zum Thema Regionalsprachgeschichte... 21 2.1.1 Bisherige Ansätze
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT...17 I TEXTTEIL...19 1 VORBEMERKUNGEN ZUM SPRACHWISSENSCHAFTLICHEN TEIL...19 2 EINFÜHRUNG... 21 2.1 Vorbemerkungen zum Thema Regionalsprachgeschichte... 21 2.1.1 Bisherige Ansätze
EINFÜHRUNG IN DAS ALTISLÄNDISCHE
 Astrid van Nahl EINFÜHRUNG IN DAS ALTISLÄNDISCHE Ein Lehr- und Lesebuch ÜNlVERS'TÄ rsü:5l.';0thek KIEL * 2 NTRALB!3UOTHEKtP BUSKE INHALTSVERZEICHNIS Vorwort Abkürzungen Abbildungsnachweise XI XIII XIII
Astrid van Nahl EINFÜHRUNG IN DAS ALTISLÄNDISCHE Ein Lehr- und Lesebuch ÜNlVERS'TÄ rsü:5l.';0thek KIEL * 2 NTRALB!3UOTHEKtP BUSKE INHALTSVERZEICHNIS Vorwort Abkürzungen Abbildungsnachweise XI XIII XIII
drei Hauptkomponenten der lautsprachlichen Kommunikation: Sprache und Laute
 Sprache und Laute 1: Phonetik Sprache und Laute drei Hauptkomponenten der lautsprachlichen Kommunikation: Die Lautproduktion (Phonation, Organogenese); beteiligt sind außer Lunge, Gehirn, die Artikulationsorgane,
Sprache und Laute 1: Phonetik Sprache und Laute drei Hauptkomponenten der lautsprachlichen Kommunikation: Die Lautproduktion (Phonation, Organogenese); beteiligt sind außer Lunge, Gehirn, die Artikulationsorgane,
Deutsches Seminar. Abteilung für Ältere deutsche Literatur. 152 Basismodul 1 ÄDL: Einführung in die Lektüre mittelhochdeutscher Texte
 Deutsches Seminar Abteilung für Ältere deutsche Literatur 152 Basismodul 1 ÄDL: Einführung in die Lektüre mittelhochdeutscher Texte Reader: Erläuterungen zur Einführung in die mittelhochdeutsche Grammatik
Deutsches Seminar Abteilung für Ältere deutsche Literatur 152 Basismodul 1 ÄDL: Einführung in die Lektüre mittelhochdeutscher Texte Reader: Erläuterungen zur Einführung in die mittelhochdeutsche Grammatik
HISTORISCHE LAUT- UND FORMENLEHRE DER LATEINISCHEN SPRACHE
 GERHARD MEISER HISTORISCHE LAUT- UND FORMENLEHRE DER LATEINISCHEN SPRACHE WISSENSCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT DARM STADT INHALT VORWORT BIBLIOGRAPHIE ABKÜRZUNGEN UND SYMBOLE XIII XVII XXIX 1. DIE LATEINISCHE
GERHARD MEISER HISTORISCHE LAUT- UND FORMENLEHRE DER LATEINISCHEN SPRACHE WISSENSCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT DARM STADT INHALT VORWORT BIBLIOGRAPHIE ABKÜRZUNGEN UND SYMBOLE XIII XVII XXIX 1. DIE LATEINISCHE
1. Sprachgeschichtliche Grundlagen
 1. Sprachgeschichtliche Grundlagen 1.1 Deutsch Germanisch Indogermanisch Genetische Sprachverwandtschaft 1.1.1 Die Sprachstufen des Deutschen Die deutsche Sprache lässt sich in ihrer historischen Dimension
1. Sprachgeschichtliche Grundlagen 1.1 Deutsch Germanisch Indogermanisch Genetische Sprachverwandtschaft 1.1.1 Die Sprachstufen des Deutschen Die deutsche Sprache lässt sich in ihrer historischen Dimension
Phonetische Transkription I
 Phonetische Transkription I IPA, Teil 2; Konsonanten: Einführung, Plosive Stephanie Köser (M.A.), Sprachwissenschaft & Sprachtechnologie, Universität des Saarlandes Inhalt Einführung in das IPA, Teil 2
Phonetische Transkription I IPA, Teil 2; Konsonanten: Einführung, Plosive Stephanie Köser (M.A.), Sprachwissenschaft & Sprachtechnologie, Universität des Saarlandes Inhalt Einführung in das IPA, Teil 2
HANDBUCH DER VERGLEICHENDEN GOTISCHEN GRAMMATIK
 E R N S T K I E C K E R S f HANDBUCH DER VERGLEICHENDEN GOTISCHEN GRAMMATIK Zweite, unveränderte Auflage 1960 MAX HUEBER VERLAG MÜNCHEN Inhaltsübersicht. Seite Zur Schreibung. XI Zu den fremden Alphabeten
E R N S T K I E C K E R S f HANDBUCH DER VERGLEICHENDEN GOTISCHEN GRAMMATIK Zweite, unveränderte Auflage 1960 MAX HUEBER VERLAG MÜNCHEN Inhaltsübersicht. Seite Zur Schreibung. XI Zu den fremden Alphabeten
Wortarten Merkblatt. Veränderbare Wortarten Unveränderbare Wortarten
 Wortarten Merkblatt Veränderbare Wortarten Deklinierbar (4 Fälle) Konjugierbar (Zeiten) Unveränderbare Wortarten Nomen Konjunktionen (und, weil,...) Artikel Verben Adverbien (heute, dort,...) Adjektive
Wortarten Merkblatt Veränderbare Wortarten Deklinierbar (4 Fälle) Konjugierbar (Zeiten) Unveränderbare Wortarten Nomen Konjunktionen (und, weil,...) Artikel Verben Adverbien (heute, dort,...) Adjektive
41. Rechtschreibung s-schreibung
 41. Rechtschreibung s-schreibung das oder dass? Viele Menschen haben Probleme, die beiden gleichlautenden Wörter dass und das richtig zu setzen. Er erklärte, dass er Probleme mit den beiden Wörtern habe.
41. Rechtschreibung s-schreibung das oder dass? Viele Menschen haben Probleme, die beiden gleichlautenden Wörter dass und das richtig zu setzen. Er erklärte, dass er Probleme mit den beiden Wörtern habe.
Übung: Phonetische Transkription
 Übung: Phonetische Transkription Stephanie Köser (M.A.) E-Mail: skoeser@coli.uni-saarland.de http://www.coli.uni-saarland.de/~skoeser/ Kursvoraussetzungen, Link-Tipps und Materialien 1 Kurze Vorstellungsrunde
Übung: Phonetische Transkription Stephanie Köser (M.A.) E-Mail: skoeser@coli.uni-saarland.de http://www.coli.uni-saarland.de/~skoeser/ Kursvoraussetzungen, Link-Tipps und Materialien 1 Kurze Vorstellungsrunde
Aktive Teilnahme. b. Geben Sie eine möglichst genaue phonetische Beschreibung folgender IPA Symbole:
 Universität Bielefeld Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft Wintersemester 2006/2007 Vorlesung Phonetik und Phonologie Module: BaLinM3, BaTT3, Ma Medienwiss.: Mod. 3, Wahlpfl. PD Dr. Ralf Vogel
Universität Bielefeld Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft Wintersemester 2006/2007 Vorlesung Phonetik und Phonologie Module: BaLinM3, BaTT3, Ma Medienwiss.: Mod. 3, Wahlpfl. PD Dr. Ralf Vogel
Konjunktivformen I + II
 www.klausschenck.de / Deutsch / Grammatik / Konjunktivformen / S. 1 von 5 Konjunktivformen I + II 1. an den Infinitivstamm werden die folgenden Konjunktiv- Endungen gehängt Singular Plural 1. Person -
www.klausschenck.de / Deutsch / Grammatik / Konjunktivformen / S. 1 von 5 Konjunktivformen I + II 1. an den Infinitivstamm werden die folgenden Konjunktiv- Endungen gehängt Singular Plural 1. Person -
Distribution Dieser Begriff bezieht sich nicht nur auf morphologische Einheiten, sondern ist z.b. auch auf <Phoneme anwendbar.
 Distribution Dieser Begriff bezieht sich nicht nur auf morphologische Einheiten, sondern ist z.b. auch auf
Distribution Dieser Begriff bezieht sich nicht nur auf morphologische Einheiten, sondern ist z.b. auch auf
Über die westgermanische Konsonantengemination
 Über die westgermanische Konsonantengemination Sayaka KUBO Bei der Ausgliederung des Westgermanischen aus dem Gemeingermanischen entstand eine Erscheinung, in der der einem Vokal folgende und einem Resonanten
Über die westgermanische Konsonantengemination Sayaka KUBO Bei der Ausgliederung des Westgermanischen aus dem Gemeingermanischen entstand eine Erscheinung, in der der einem Vokal folgende und einem Resonanten
Inhalt. Basisinfos Konjugieren Person/Numerus Tempora (Zeitstrahl) Das Verb: Stamm und Endung Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur
 Das Verb RS Josef Inhalt Basisinfos Konjugieren Person/Numerus Tempora (Zeitstrahl) Das Verb: Stamm und Endung Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur Basisinfo Verben können verändert werden
Das Verb RS Josef Inhalt Basisinfos Konjugieren Person/Numerus Tempora (Zeitstrahl) Das Verb: Stamm und Endung Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur Basisinfo Verben können verändert werden
Phonetische Transkription I Stunde 3. Marianne Pouplier
 Phonetische Transkription I Stunde 3 Marianne Pouplier Heute 1. Wiederholung der zweiten Stunde 2. Glottal Stop / Knacklaut 3. Stimmhaftigkeit bei Plosiven Wiederholung 2. Stunde Was sind Frikative? Eine
Phonetische Transkription I Stunde 3 Marianne Pouplier Heute 1. Wiederholung der zweiten Stunde 2. Glottal Stop / Knacklaut 3. Stimmhaftigkeit bei Plosiven Wiederholung 2. Stunde Was sind Frikative? Eine
Konsonantenverschiebung und Dialekte
 SPRACHGESCHICHTE UND SCHULE Unterrichtsentwurf zum Thema Konsonantenverschiebung und Dialekte Ronja Dichant, Lea Bönners, Johanna Vinnen, Julia Siemsen, Sabrina Braun VERLAUF DES VORTRAGES I. Darstellung
SPRACHGESCHICHTE UND SCHULE Unterrichtsentwurf zum Thema Konsonantenverschiebung und Dialekte Ronja Dichant, Lea Bönners, Johanna Vinnen, Julia Siemsen, Sabrina Braun VERLAUF DES VORTRAGES I. Darstellung
Karl Heinz Wagner
 Merkmale Merkmale, Merkmalsstrukturen, Unifikation Merkmale Merkmalstrukturen Unifikation Das Wort 'Merkmal' bedeutet im Prinzip soviel wie 'Eigenschaft' und bezieht sich auf die individuellen e,, die
Merkmale Merkmale, Merkmalsstrukturen, Unifikation Merkmale Merkmalstrukturen Unifikation Das Wort 'Merkmal' bedeutet im Prinzip soviel wie 'Eigenschaft' und bezieht sich auf die individuellen e,, die
Lösungsansätze Bestimmung der finiten Verben
 Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten Verb: Bestimmung der finiten Verben Lösung 1 Lösungsansätze Bestimmung der finiten Verben Unterstreiche zuerst in den folgenden Sätzen die konjugierten Verben und
Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten Verb: Bestimmung der finiten Verben Lösung 1 Lösungsansätze Bestimmung der finiten Verben Unterstreiche zuerst in den folgenden Sätzen die konjugierten Verben und
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Grammatik. Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Grammatik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de kurz & bündig Band 6 Hartwig Lödige Grammatik INHALT Inhalt Zur
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Grammatik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de kurz & bündig Band 6 Hartwig Lödige Grammatik INHALT Inhalt Zur
Inhaltsverzeichnis Nr. Seite
 Inhaltsverzeichnis Nr. Seite Vorwort Inhalt Grundzüge einer plattdeutschen Grammatik Einleitung Plattdeutsch, eine germanische Sprache Sprache und Sprachraum Entstehung und Verbreitung von Sprachen Keltisch
Inhaltsverzeichnis Nr. Seite Vorwort Inhalt Grundzüge einer plattdeutschen Grammatik Einleitung Plattdeutsch, eine germanische Sprache Sprache und Sprachraum Entstehung und Verbreitung von Sprachen Keltisch
Inhalt VORWORT I. KAPITEL Das Indoeuropäische, das Germanische
 Inhalt VORWORT... 9 I. KAPITEL Das Indoeuropäische, das Germanische.... 10 Indoeuropäische Sprachen-Übersicht:... 11 Kentum- und Satemsprachen.... 14 Gemeinsamkeiten indoeuropäischer Sprachen.... 14 Lexikalische
Inhalt VORWORT... 9 I. KAPITEL Das Indoeuropäische, das Germanische.... 10 Indoeuropäische Sprachen-Übersicht:... 11 Kentum- und Satemsprachen.... 14 Gemeinsamkeiten indoeuropäischer Sprachen.... 14 Lexikalische
Harry gefangen in der Zeit Begleitmaterialien
 Folge 091 Grammatik 1. Indirekte Rede Um wiederzugeben, was jemand gesagt hat, verwendet man oft die indirekte Rede. Direkte Rede Indirekte Rede Anna: "Ich fahre zu meiner Mutter." Anna hat gesagt, dass
Folge 091 Grammatik 1. Indirekte Rede Um wiederzugeben, was jemand gesagt hat, verwendet man oft die indirekte Rede. Direkte Rede Indirekte Rede Anna: "Ich fahre zu meiner Mutter." Anna hat gesagt, dass
Schwedische Phonetik
 Schwedische Phonetik für Deutschsprachige inkl. Audio CD von Christer Lindqvist 1. Auflage Buske 2007 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 87548 358 1 schnell und portofrei erhältlich bei
Schwedische Phonetik für Deutschsprachige inkl. Audio CD von Christer Lindqvist 1. Auflage Buske 2007 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 87548 358 1 schnell und portofrei erhältlich bei
Geschichte der deutsehen Sprache
 Wilhelm Schmidt Geschichte der deutsehen Sprache Ein Lehrbuch / für das germanistische Studium 7., verbesserte Auflage, erarbeitet unter der Leitung von Helmut Langner S. Hirzel Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
Wilhelm Schmidt Geschichte der deutsehen Sprache Ein Lehrbuch / für das germanistische Studium 7., verbesserte Auflage, erarbeitet unter der Leitung von Helmut Langner S. Hirzel Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
Englische Phonetik und Phonologie
 Englische Phonetik und Phonologie Günther Scherer und Alfred Wollmann 3., überarbeitete und ergänzte Auflage E R I C H S C H M I D T V E R L A G Vorwort i 5 Vorwort zur 3. Auflage 7 Abkürzungen und Zeichen
Englische Phonetik und Phonologie Günther Scherer und Alfred Wollmann 3., überarbeitete und ergänzte Auflage E R I C H S C H M I D T V E R L A G Vorwort i 5 Vorwort zur 3. Auflage 7 Abkürzungen und Zeichen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Klett Rechtschreibung im Griff Deutsch 7./8. Klasse
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Klett Rechtschreibung im Griff Deutsch 7./8. Klasse Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhaltsverzeichnis So
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Klett Rechtschreibung im Griff Deutsch 7./8. Klasse Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhaltsverzeichnis So
Inhalt. Dank Morphologie Der Aufbau von Wörtern... 47
 Inhalt Dank............ 8 1. Einleitung......... 9 1.1 Was ist Linguistik?........................... 9 1.1.1 Die Linguistik und ihre Nachbarwissenschaften..... 9 1.1.2 Prinzipien der modernen Sprachwissenschaft......
Inhalt Dank............ 8 1. Einleitung......... 9 1.1 Was ist Linguistik?........................... 9 1.1.1 Die Linguistik und ihre Nachbarwissenschaften..... 9 1.1.2 Prinzipien der modernen Sprachwissenschaft......
