Elektrische Eigenschaften von Mörteln für kathodischen Korrosionsschutz
|
|
|
- Oldwig Brandt
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Elektrische Eigenschaften von Mörteln für kathodischen Korrosionsschutz Schlüsselwörter: Stahlbeton, Instandsetzung, kathodischer Korrosionsschutz, Einbettmörtel, Elektrotechnische Eignung Franz Pruckner Einleitung Die Technologie des kathodischen Korrosionsschutzes (KKS) wurde weltweit erstmals 1824 von Sir Humphrey Davy angewandt, der im Auftrag der britischen Admiralität die korrosionsgefährdete Kupferverkleidung eines Kriegsschiffes mit Opferanoden aus Eisen erfolgreich kathodisch schützte. Kathodischer Korrosionsschutz von Stahl in Beton wurde erstmals an der San Mateo Hayward Brücke über die Bucht von San Francisco angewandt. Dieses Forschungsprojekt wurde als Erfolg angesehen und bildete die Grundlage für die erste kommerzielle Installation von KKS an der Sly-Park Brücke mit elektrisch leitendem Asphalt als Anode im Jahre 1973 [1, 2]. KKS von Stahl in Beton hat seit dieser Zeit eine rasante Entwicklung durchgemacht, wie auch die Verwendung von verschiedenen Anodenmaterialien. Kathodische Korrosionsschutzsysteme lassen sich am einfachsten durch die verwendeten Anodenmaterialien unterscheiden. Die Anode ist die wichtigste Komponente einer kathodischen Korrosionsschutzanlage. Aufgrund der äußerst niedrigen Leitfähigkeit des Betons soll die Anode vorzugsweise die gesamte Oberfläche des Betons bedecken. Die laterale Schutzwirkung ist nur für kurze Distanz gegeben. Labormessungen zeigten einen lateralen Einfluß des Schutzstromes auf nur 15 cm für streifenförmige Anoden [3] (siehe Abbildung 1). Abbildung 1: Typisches Layout für streifenförmige Anode (links) und laterale Verteilung der Polarisierung der Bewehrung (rechts) Das heißt zum Beispiel, daß bei Verwendung von streifenförmigen Anoden der Abstand dieser Anoden voneinander 3 cm nicht überschreiten soll. Da beim kathodischen Korrosionsschutz die Korrosionsreaktion auf die Anode verlagert wird, ist die Anodenoberfläche extremen Bedingungen ausgesetzt. Des weiteren sollen die schädlichen Auswirkungen der anodischen Reaktion auf die Umgebung der Anode nicht unterschätzt werden. Verschiedene Anodensysteme weisen in der jetzt 3-jährigen Geschichte von KKS von Stahl in Beton eine beachtliche Referenzliste auf und die Bearbeitung ist für viele Materialien bekannt. Anodensysteme, die per dato eingesetzt werden, umfassen im wesentlichen folgende Materialien: Copyright 21 PP engineering GmbH info@pp-engineering.com 1
2 MMO-Titangitter, eingebettet in Spritzbeton 1 MMO-Titannetzstreifen, eingebettet in Mörtel Stabförmige Anoden aus Titan-MMO MMO-Titan Beschichtungen im Spritzverfahren Röhrenförmige Anoden aus leitender Keramik Leitende Beschichtungen auf Kohlenstoffbasis Netzförmige Anoden auf Kohlenstoffbasis elektrisch leitende Mörtel In dieser Arbeit wird das System der netzförmigen Titananode, eingebettet in Spritzbeton behandelt, und speziell auf das Einbettmaterial näher eingegangen. Die netzförmige Titananode in zementöser Einbettung Netzförmige Anoden als Streckmetallgitter aus MMO beschichtetem Titan für kathodischen Schutz von Stahl in Beton wurden erstmals ca eingesetzt [4]. Dieses Anodenmaterial zeichnet sich durch extreme Langlebigkeit aus die Lebensdauer wird praktisch nur durch die Einbettmasse beschränkt - und durch eine sehr gleichmäßige Schutzstromverteilung. Dieser Anodentyp ist heute der am häufigsten eingesetzte. Das System besteht aus der netzförmigen "Sekundäranode" (erhältlich in Rollen zu ca. 7-8 m Länge und ca. 1.2 m Breite) und Titanblechstreifen, welche als Primäranode für die Stromzuführung sorgen (Abbildung 3). Die Titanblechbänder werden via Kabel an den positiven Ausgang des Gleichrichters angeschlossen, die Bewehrung, dagegen an den negativen Ausgang. Die Anodenmaterialien werden mit nichtmetallischem Befestigungsmaterial in Rücksicht auf Kurzschlußgefahr auf der Betonoberfläche befestigt (Abbildung 2) und in die zementöse Überschichtung eingebettet (Abbildung 4). Befestigungsdübel Primäranode Abbildung 2: Befestigung des Gitters Abbildung 3: Anoden-Layout 1 MMO (engl.) "mixed metal oxide". Titan ist mit Mischmetalloxiden beschichtet, welche die elektrochemischen Eigenschaften der Titananode ermöglichen. Es handelt sich hierbei um eine Mischung von Edelmetalloxiden (z.b.: Ir 2 O 3, Ru 2 O 3 ) Copyright 21 PP engineering GmbH info@pp-engineering.com 2
3 Abbildung 4: Aufbringen des Einbettmörtels Bekannte Probleme mit Einbettmörteln a) betontechnologische Probleme Das Einbettmaterial, oftmals als Spritzmörtel aufgebracht, zeigte in der Vergangenheit bestimmte Probleme. Vor allem die Haftung des Spritzmörtels zum Untergrund erwies sich als entscheidender, die Lebensdauer beeinflussender Parameter (siehe Abbildung 5). Es wurden zahlreiche Untersuchungen angestellt und Versuche durchgeführt, dieses Problem zu minimieren. Frühe Empfehlungen darauf waren umfassende Oberflächenbehandlung durch Sandstrahlen, Verwendung von Abstandshaltern, welche das Titangitter mehrere Millimeter von der gereinigten Oberfläche entfernt halten, Oberflächenkonditionierung durch Wassersättigung vor Aufbringen der Einbettmasse und Aushärten der Einbettmasse unter erhöhter Umgebungsfeuchte [5]. Diese Haftungsprobleme sind jedoch betontechnologischer Natur und haben mit den elektrochemischen Reaktionen und den physikalisch/chemischen Transportprozessen nicht direkt etwas zu tun [6]. In weiterer Folge wird diese Problematik nicht weiter behandelt. Abbildung 5: Ablösungserscheinungen eines Einbettmörtels aufgrund äußerer Einflüsse. b) elektrochemische und physikalisch/chemische Probleme Diese Art der Probleme wird hauptsächlich durch "ungünstige chemische Eigenschaften" des Einbettmaterials verursacht. Dazu zählen: ungenügende alkalische Pufferkapazität ungenügende elektrische Leitfähigkeit Diese beiden Parameter (Pufferkapazität, Leitfähigkeit) werden im folgenden unter verschiedenen Gesichtspunkten abgehandelt. Copyright 21 PP engineering GmbH 3
4 Die alkalische Pufferkapazität Einen wesentlichen und für die Langlebigkeit des Anodensystems bedeutenden Parameter stellt die alkalische Pufferkapazität des Einbettmaterials dar. Die Pufferkapazität wird durch den Portlanditgehalt des Zementsteins gewährleistet. Portlandit (oder Ca(OH) 2 ), entstanden durch die Hydratisierung der Calciumsilikate des Zementklinkers steht für etwa 2 % des Zementsteins und sorgt durch eine Gleichgewichtsreaktion zwischen festem und gelöstem Calciumhydroxid für einen konstanten ph-wert des Betonporenwassers von (theoretisch) Ca(OH) 2, fest Ca 2+ gelöst + 2OH - gelöst Formel 1 Wenn die Konzentration von OH - im Porenwasser einen gewissen Grenzwert überschreitet, wird Calciumhydroxid aus der Porenlösung ausgefällt, nimmt andererseits die Konzentration an Hydroxylionen im Porenwasser ab, so geht Calciumhydroxid in Lösung. Dadurch wird ein konstanter ph-wert von ca im Betonporenwasser aufrechterhalten. Durch die elektrochemische Reaktion an der Anode 4OH - O 2 + 2H 2 O + 4e - Formel 2 werden die Hydroxylionen des Betonporenwassers ständig verbraucht. Andererseits werden immer wieder "neue" Hydroxylionen aus dem Betonporenwasser an die Anode nachgeliefert, welche aufgrund der Gleichgewichtsreaktion, beschrieben mit Formel 1, ständig nachgebildet werden. Können die Hydroxylionen jedoch nicht schnell genug aus dem Betonporenwasser nachgeliefert werden, oder ist der Portlandit vollständig aufgebraucht, so bildet sich rund um die Anode ein stark saurer Elektrolyt, welcher schädigend auf das Zementsteingefüge einwirkt und so die Kontaktfläche zwischen Anode und Beton verringert. Der Grad der Ansäuerung läßt sich einfach durch die Indikatorreaktion mit Phenolphtalein nachweisen, wie aus zwei Proben mit unterschiedlicher Pufferkapazität in Abbildung 6 und Abbildung 7 gezeigt. Diese Ansäuerungserscheinung man bezeichnet sie als Anodenhof wurde auch in der Praxis beobachtet [6]. Ansäuerung keine Ansäuerung Abbildung 6 Einbettmaterial mit geringer Pufferkapazität (Indikatorreaktion zeigt Ansäuerung rund um die Anode) 2. Abbildung 7 Einbettmaterial mit hoher Pufferkapazität (Indikatorreaktion zeigt keine Ansäuerung rund um die Anode) 2. 2 Luc Westhof, Copyright 21 PP engineering GmbH info@pp-engineering.com 4
5 Naturgemäß steigt die Pufferkapazität mit dem Gehalt an Zement. Je höher der Zementgehalt, desto höher der Gehalt an Portlandit. Ebenfalls beeinflussen der Zementtyp und der Zusatz an puzzolanischen Stoffen die Pufferkapazität. Die Pufferkapazität läßt sich annähernd bestimmen, wenn einer aufgeschlämmten Probe aus pulverisiertem Beton soviel Säure zugesetzt wird, bis ein ph-wert von 1 erreicht ist. Resultate aus solch einer Meßserie sind in Tabelle 1 für unterschiedliche Zementmörtel, welche sich nur durch die Art des Binders unterscheiden, gelistet. verwendeter Zementtyp (275 kg/m 3 ) Säuremenge [mol/kg Probe] Portlandzement 2.3 Sulfatbeständiger Zement 2.8 Portlandzement + 3 % Flugasche 1.83 Portlandzement + 65 % Hochofenschlacke 1.73 Tabelle 1: Menge an Säure, die nötig ist um den ph Wert von Aufschlämmungen von pulverisierten Zementmörtelproben auf 1 zu reduzieren (aus[7]) Bei der anodischen Reaktion wird pro umgesetztem Elektron gemäß Formel 2 ein Säuremolekül frei. Unter der Annahme, daß die Masse des Einbettmörtels 25 kg/m 2 beträgt (1 cm Dicke, Dichte: 25 kg/m 3 ) wäre bei einer Schutzstromdichte von 1 ma/m 2 Betonoberfläche die gesamte Alkalität des Einbettmaterials (Portlandzementgehalt: 275 kg/m 3 ) nach 17.6 Jahren aufgebraucht (Gleichung 1): PK m L = i t Mörtel s F Gleichung 1 mit: L... Lebbensdauer [Jahre] PK... Pufferkapazität [mol/kg Mörtel] m Mörtel... Mörtelmasse pro Einheitsfläche [kg/m 2 ] F... Faradaykonstante (96485 C/mol) i... Stromdichte [A/m 2 ] t s... Ein Jahr in Sekunden ( s/jahr) Nun wird aber in den Anforderungsspezifikationen an KKS oft eine Designlebensdauer von 4 Jahren angegeben. Für diese Designlebensdauer wäre demnach bei gleicher Schichtdicke und gleicher Schutzstromdichte ein Mörtel mit einem Portlandzementgehalt von 625 kg/m 3 nötig. Dann wäre die Pufferkapazität des Einbettmaterials theoretisch erst nach 4 Jahren aufgebraucht. Steinkohlenflugasche, aber vor allem Silicastaub (Microsilica) reduzieren die alkalische Pufferkapazität beträchtlich. Bei einer Zugabe von über 15 M-% an Silicastaub wird Portlandit vollständig verbraucht [8]. Eine Einbettmasse mit beträchtlichen Mengen an Silicastaub hätte demzufolge eine sehr stark erniedrigte Pufferkapazität verglichen mit reinem PZ-Mörtel, und sie wäre durch die elektrochemische Reaktion an der Anode sofort aufgebraucht. Silicastaubmodifizierter PZ-Mörtel soll daher nicht als Einbettmaterial verwendet werden. Copyright 21 PP engineering GmbH info@pp-engineering.com 5
6 Abbildung 8: Entwicklung des Portlandit-Gehaltes mit der Zeit für Portlandzement (links) und Hochofenzement (rechts) mit verschiedenen Zusatzstoffen (aus [8]). Die Pufferkapazität kann durch aufwendige Säuretitration, wie in Referenz [7] beschrieben, bestimmt werden. Kann davon ausgegangen werden, daß der Einbettmörtel nur Portlandzement enthält, so ist es auch möglich, die Pufferkapazität durch eine einfache Siebanalyse abzuschätzen (siehe Abbildung 9). 1 Siebdurchgang [M-%] 75 5 Produkt A 25 Produkt B Produkt C Produkt D,625,125,25, Sieböffnung [mm] Abbildung 9: Siebanalyse von verschiedenen handelsüblichen Einbettmaterialien Durch elektrochemische Potentialmessungen der Anode läßt sich feststellen, ob der anodische Bereich bereits angesäuert ist oder nicht. Da bei der elektrochemischen Reaktion an der MMO/Titan-Anode die Sauerstoffentwicklung gegenüber der Chlorentwicklung bevorzugt ist (sie erfolgt bei niedrigeren anodischen Potentialen, siehe Abbildung 1), bestimmt die Reaktion nach Formel 2 das Ausschaltpotential der Anode. Bei alkalischer Umgebung der Anode (ph = ) liegt das Ausschaltpotential der Anode bei (theoretisch) +17 bis +35 mv gegen CSE, bei saurer Umgebung (ph = 1 3) jedoch bei (theoretisch) +73 bis +85 mv gegen CSE 3. Nach einer bestimmten Zeit, abhängig von der angelegten Stromdichte, steigt das Ausschaltpotential der Anode an, was einer Ansäuerung des Anodenbereiches entspricht (siehe Abbildung 11). 3 CSE "Copper Sulfate Electrode": Englische Bezeichnung für die Cu/CuSO 4 -Referenzelektrode Copyright 21 PP engineering GmbH info@pp-engineering.com 6
7 E aus gegen Cu/CuSO 4 [mv] Cl - Cl 2 + 2e - Ausschaltpotential sauer 4OH - O 2 + 2H 2 O + 4e - Ausschaltpotential alkalisch ph Zeit bis zum Potentialanstieg [Tage] Schutzstromdichte [ma/m 2 ] Abbildung 1: Ausschaltpotentiale für Anoden in alkalischer und saurer Umgebung Abbildung 11: Zeitpunkt des Potential-anstieges der Anode bei unterschiedlicher Stromdichte und Umgebungsfeuchte = 7 % (aus Referenz [9]) Bei anodischer Ansäuerung steigt also das Ausschaltpotential der Anode gemäß Formel 2 an. Bei hohen Stromdichten erfolgt der Potentialanstieg nach kurzer Zeit, bei hinreichend niedrigen Stromdichten erst nach sehr, sehr langer Zeit. Der Verlauf der Ausschaltpotentiale für unterschiedliche Stromdichten ist in Abbildung 12 ersichtlich [9]. Abbildung 12: Anodischer Potential/Zeit-Verlauf für PZ-Mörtelproben. Links oben: i = 2 ma/m 2 ; rechts oben: i = 5 ma/m 2 ; links unten: i = 2 ma/m 2 (aus [9]). Diffusion und elektrischer Widerstand Die Zeit, die vergeht bis die anodische Ansäuerung Auswirkungen am Potentialverhalten der Anode und letztlich an der Integrität des Betongefüges zeigt, ist nicht nur abhängig von der Pufferkapazität des Copyright 21 PP engineering GmbH info@pp-engineering.com 7
8 Einbettmaterials und der angelegten Stromdichte, sondern auch vom Nachtransport der Hydroxylionen zur Anode. Dieser Transport erfolgt durch Diffusion. Die Diffusionskonstante ein Maß für die Diffusionsgeschwindigkeit ist nun aber mit dem elektrolytischen Betonwiderstand gekoppelt: Je höher der Betonwiderstand, desto niedriger die Diffusionsgeschwindigkeit und vice versa. Mathematisch wird dieser Sachverhalt durch die Nernst-Einstein Beziehung beschrieben: D RT = 2 z 2 F λ Gleichung 2 mit: D... Diffusionskonstante [m 2 /s] R... universale Gaskonstante ( Jmol -1 K -1 ) T... absolute Temperatur [K] z... Ionenwertigkeit λ... spezifische Leitfähigkeit für das diffundierende Ion [Ω -1 mol -1 m 2 ] Die spezifischen Leitfähigkeiten aller im Porenwasser vorhandenen Ionen bestimmen die Gesamtleitfähigkeit des Mörtels oder Betons (Kehrwert des Betonwiderstandes). Einen wesentlichen Anteil an der Betonleitfähigkeit tragen dabei die Hydroxylionen. Diese werden im elektrischen Feld durch Migration gemäß Gleichung 3 zur Anode hingezogen. j i = z if Dic RT i E x Gleichung 3 mit: j i... Ionenfluß der Ionentype i [mol/m 2 s] D i... Diffusionskonstante für das Ion i [m 2 /s] c i... Konzentration des Ions i [mol/m 3 ] z i... Wertigkeit des Ions i E... Elektrische Feldstärke [V/m] x Aus Gleichung 3 ist ersichtlich, daß andere Ionen ebenfalls im elektrischen Feld wandern. Besonders Chloridionen konkurrieren mit den Hydroxylionen in der Wanderung zur Anode hin. Um die Leitfähigkeit des Einbettmaterials zu verbessern, soll daher keineswegs Salz zugesetzt werden! Der Betonwiderstand ist auch sehr wesentlich abhängig von der Wassersättigung des Betons. Die Wassersättigung ist in erster Linie gegeben durch die Umgebungsfeuchte, aber auch durch die Porengrößenverteilung und durch den Gehalt an synthetischen Zusatzstoffen. Sehr deutlich ersichtlich ist die Bedeutung des Betonwiderstandes anhand von Abbildung 13. Einbettmaterialien mit niedrigem elektrischem Widerstand ermöglichen eine raschere Diffusion. Copyright 21 PP engineering GmbH info@pp-engineering.com 8
9 Zeit bis zum Potentialanstieg [Tage] ρ Beton (7% RF) [kωcm] Abbildung 13: Zeitpunkt des Potentialanstieges der Anode als Funktion des Betonwiderstandes (Umgebungsfeuchte = 7 %. Schutzstromdichte = 5 ma/m 2, aus Referenz [9]) Vorzugsweise ist für Einbettmaterialien daher ein möglichst niedriger spezifischer Betonwiderstand anzustreben, damit eben die Nachdiffusion der Hydroxylionen zur Anode hin schnell genug erfolgen kann. Mann kann also die Eignung der Einbettmaterialien durch deren Betonwiderstand charakterisieren. Messung des spezifischen Mörtelwiderstandes Die Messung des spezifischen Mörtelwiderstandes ist mit einigen praktischen Schwierigkeiten verbunden. Einerseits ist es nötig verschiedene Materialien bei Standardumweltbedingungen zu messen, andererseits variieren die Umweltbedingungen im Feld so stark, daß der Wertevergleich bei Standardbedingungen oft nicht aussagekräftig ist. Die Messung der Standardwerte für den Betonwiderstand erfolgt für gewöhnlich nach Lagerung von 28 Tagen im Wasser. Danach, so nimmt man an, ist die Betonprobe vollständig wassergesättigt. Dem Autor sind zwar keine oberen und unteren Grenzwerte für den elektrischen Widerstand von Einbettmaterialien bekannt, sehr wohl aber gibt es Empfehlungen für Mörtel, mit welchen lokale Ausbesserungen vor Aufbringung der Anode vorgenommen werden. Für derartige Materialien soll der elektrische Betonwiderstand unter Standardbedingungen zwischen 2 kωcm und 2 kωcm betragen [1]. Ein niedriger Widerstand ist wichtig, um schutzbedürftige Bewehrung unterhalb (oder hinter) der Ausbesserung nicht elektrisch abzuschirmen. Für die optimale Stromverteilung ist zwar der Widerstand des Einbettmaterials nicht so eminent wichtig wie für Saniermörtel, jedoch ist aus Gründen der Diffusion ein niedriger elektrischer Widerstand des Einbettmaterials ebenfalls anzustreben. Abbildung 14 zeigt die Widerstandswerte unter Standardbedingungen für zwei Einbettmassen, für einen Labormörtel mit PZ und für einen Fertigmörtel. Die Widerstandswerte differieren nicht stark, und liegen für eine KKS-Anwendung noch im akzeptablen Bereich. Copyright 21 PP engineering GmbH info@pp-engineering.com 9
10 25 2 Einbettung A: Labormörtel Maximalkorn: 5 Zementgehalt: 45 w/z:.4 mm kg/m3 ρ Beton [kωcm] Einbettung A Einbettung B Einbettung B: Fertigmörtel Maximalkorn: 4 Zementgehalt: hoch w/z: niedrig mm Abbildung 14: Standardwerte für den spezifischen Betonwiderstand (28 Tage Wassersättigung, 2 C, von [9]). In natura ist Beton variierender Umgebungsfeuchte ausgesetzt, nicht oft beträgt die Umgebungsfeuchte 1 % RF und nur selten ist Beton wassergesättigt. Betone und Mörtel zeigen nun - abhängig von ihrer Zusammensetzung - eine unterschiedliche Abhängigkeit des elektrolytischen Betonwiderstandes von der Umgebungsfeuchte. Für die beiden Einbettmaterialien aus Abbildung 14 ist die Abhängigkeit für Einbettung B von der Umgebungsfeuchte weniger stark ausgeprägt als für Einbettung A. Selbst bei relativ niedriger Umgebungsfeuchte liegt hier der spezifische Betonwiderstand noch bei niedrigen Werten. Die anodische Ansäuerung wird bei Einbettung B praktisch doppelt so schnell durch Nachdiffusion von Hydroxylionen aus dem Mörtelinneren kompensiert wie in Einbettung A. ρ Beton [kωcm] Maximalkorn 5 mm Zementgehalt: 45 kg/m 3 w/z:.4 Einbettung A 43% RF 7% RF 63% RF 8% RF 2 1% RF Lagerungsdauer [Tage] ρ Beton [kωcm] Maximalkorn 4 mm Zementgehalt: hoch w/z: niedrig Einbettung B 43% RF 4 7% RF 2 63% 8% RF 1% RF Lagerungsdauer [Tage] Abbildung 15: Entwicklung des spezifischen Betonwiderstandes für die beiden Einbettmassen A und B bei unterschiedlicher Umgebungsfeuchte. Eine mögliche Erklärung für die unterschiedliche Abhängigkeit des Betonwiderstandes von der Umgebungsfeuchte kann durch die Porosität und die Porendurchmesserverteilung gegeben werden: Ein großer Gelporenanteil hält auch noch bei niedriger Außenfeuchte viel Wasser zurück, während Poren mit großem Durchmesser schon bei höherer Außenfeuchte austrocknen (beschrieben durch die Kelvin-Laplace Gleichung). Zementmörtel, welche also mit niedrigem W/Z-Wert hergestellt wurden, daher einen höheren Gelporenanteil haben, weisen bei niedriger Außenfeuchte höhere Leitfähigkeiten auf als Mörtel mit hohem W/Z-Wert siehe Abbildung 16 und Referenz [11]) Copyright 21 PP engineering GmbH info@pp-engineering.com 1
11 Abbildung 16: Abhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit von der Aussenfeuchte für verschiedene Beton- und Mörtelproben (PC-B: junger PZ- Beton, PC-M, junger PZ-Mörtel, B-alt: alter PZ-Beton, BFSC, Beton mit Hochofenschlacke; aus Referenz [11]) Die Diffusionsgeschwindigkeit der Hydroxylionen kann auch durch Kunststoffzusatz erniedrigt werden. Es wurde beobachtet, daß es bei kunststoffmodifizierten Mörteln eher zu Gefügestörungen rund um die Anode kam, als bei kunststofffreien Mörteln [9]. Schlußfolgerungen Um bei kathodischen Korrosionsschutzanlagen den Verbund Anode/Einbettmörtel möglichst lange in optimaler Funktion zu erhalten sind folgende Punkte zu beachten. 1. Die Einbettmasse soll eine hohe alkalische Pufferkapazität aufweisen 2. Das Bindemittel der Einbettmasse soll gewöhnlicher Portlandzement sein und keine puzzolanischen Stoffe, welche den Portlanditgehalt der Zementmatrix verringern (wie z.b. Microsilica), enthalten. 3. Der Wasser-Zementwert der Einbettmasse soll niedrig sein, um ein Austrocknen bei niedriger Außenfeuchte zu vermeiden. 4. Die Einbettmasse soll keine, allenfalls möglichst niedrige Kunststoffzusätze aufweisen, um die Diffusion von Hydroxylionen nicht zu behindern. 5. Die Einbettmasse soll keine Chloride beinhalten. Literaturzitate 1 R.F. Stratfull Experimental Cathodic Protection of a Bridge Deck California Department of Transportation, Report CA-DOT-TL , Sacramento, CA 9587, January 1974 Copyright 21 PP engineering GmbH info@pp-engineering.com 11
12 2 G.H.C. Chang, J.A. Apostolos, F.A. Myhres, Cathodic Protection Studies of Reinforced Concrete California Department of Transportation, Report No. FHWA/CA/TL-81/2, March R.F. Stratfull Criteria for the cathodic protection of bridge decks in: "Corrosion of Reinforcement in Concrete Construction" ed. A.P. Crane, The Society of Chemical Industry, Ellis Horwood Ltd, 1983 (ISBN ) 4 B.L. Martin, J.E. Bennett An Activated Titanium Mesh Anode for the Cathodic Protection of Reinforcing Steel in Concrete CORROSION'87, Paper 147, San Francisco, California, March 9-13, D.M. Harriott, M. Laylor, J.P. Broomfield, A. Saccomano, K.B. Brosseau Cathodic Protection of Reinforced Concrete Bridge Elements: A State-of-the-Art Report SHRP-S-337, Strategic Highway Research Program, National Research Council, Washington, DC F. Hunkeler Untersuchungen zum kathodischen Korrosionsschutz von Stahlbeton im Tunnel San Bernardino Eidgenössisches Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement, Bundesamt für Strassenbau, Schweizerische Gesellschaft für Korrosionsschutz, Zürich, Oktober G.K. Glass, B. Reddy, N.R. Buenfeld Corrosion inhibition in concrete arising from its acid neutralisation capacity Corrosion Science, 42, (2) 8 B. Meng, U. Wiens Einfluß von Puzzolanen als Betonzusatzstoff auf die Alkalität der Porenlösung 4. Internationales Kolloquium Werkstoffwissenschaften und Bauinstandsetzen, Technische Akademie Esslingen, Dez R.O Müller, K Holtzhauer Kathodischer Korrosionsschutz von Bewehrungsstählen Langzeitbeständigkeit von Anodenmaterialien und Mörteln Bericht Nr /92.16, Technische Forschungs- und Beratungsstelle der Schweizerischen Zementindustrie Wildegg, August S.M. Soltesz Cementitious materials for thin patches Final Report Report No.: FHWA-OR-DF-1-18, Oregon Department of Transportation Research Group, June F. Hunkeler Monitoring of Repaired Reinforced Concrete Structures by Means of Resistivity Measurements Materials Science Forum, 247, (1997) Copyright 21 PP engineering GmbH info@pp-engineering.com 12
Leitende Beschichtungen als Anodenmaterial für KKS F. Pruckner
 Leitende Beschichtungen als Anodenmaterial für KKS F. Pruckner Einleitung Die Technologie des kathodischen Korrosionsschutzes (KKS) wurde weltweit erstmals 18 von Sir Humphrey Davy angewandt, der im Auftrag
Leitende Beschichtungen als Anodenmaterial für KKS F. Pruckner Einleitung Die Technologie des kathodischen Korrosionsschutzes (KKS) wurde weltweit erstmals 18 von Sir Humphrey Davy angewandt, der im Auftrag
Korrosion von Stahl in Beton
 Korrosionsschutz für Meerwasserbauwerke Workshop 29.10.2014 Hamburg Kathodischer Korrosionsschutz von Stahlbeton ein Überblick Dipl.-Ing. M. Bruns Alle Rechte vorbehalten 1 Korrosion von Stahl in Beton
Korrosionsschutz für Meerwasserbauwerke Workshop 29.10.2014 Hamburg Kathodischer Korrosionsschutz von Stahlbeton ein Überblick Dipl.-Ing. M. Bruns Alle Rechte vorbehalten 1 Korrosion von Stahl in Beton
Leitende Beschichtungen als Anodenmaterial für KKS
 Leitende Beschichtungen als Anodenmaterial für KKS Franz Pruckner * V&C Kathodischer Korrosionsschutz Ges.m.b.H. Josef Perger-Straße /A-5 A-331 Pressbaum VCK Betonschutz + Monitoring GmbH Robert Bosch
Leitende Beschichtungen als Anodenmaterial für KKS Franz Pruckner * V&C Kathodischer Korrosionsschutz Ges.m.b.H. Josef Perger-Straße /A-5 A-331 Pressbaum VCK Betonschutz + Monitoring GmbH Robert Bosch
Experimentalphysik 2
 Repetitorium zu Experimentalphysik 2 Ferienkurs am Physik-Department der Technischen Universität München Gerd Meisl 5. August 2008 Inhaltsverzeichnis 1 Übungsaufgaben 2 1.1 Übungsaufgaben....................................
Repetitorium zu Experimentalphysik 2 Ferienkurs am Physik-Department der Technischen Universität München Gerd Meisl 5. August 2008 Inhaltsverzeichnis 1 Übungsaufgaben 2 1.1 Übungsaufgaben....................................
Stahlbeton - Sanierungsprinzipien
 Stahlbeton - Sanierungsprinzipien Instandsetzungs- Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (RiLi DafStb) von Daniel Schweer Inhaltsverzeichnis: 1. Allgemeines 2. Vorbeugender Korrosionsschutz
Stahlbeton - Sanierungsprinzipien Instandsetzungs- Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (RiLi DafStb) von Daniel Schweer Inhaltsverzeichnis: 1. Allgemeines 2. Vorbeugender Korrosionsschutz
Schäden durch Korrosion der Bewehrung Einleitung
 Schäden durch Korrosion der Bewehrung Einleitung Die Korrosion der Bewehrung in Stahlbeton und aller korrodierbaren, metallischen Einbauteile tritt nur unter bestimmten Randbedingungen auf. Sie kann durch
Schäden durch Korrosion der Bewehrung Einleitung Die Korrosion der Bewehrung in Stahlbeton und aller korrodierbaren, metallischen Einbauteile tritt nur unter bestimmten Randbedingungen auf. Sie kann durch
Einführung. Galvanische Zelle. Korrosion + - Univ.-Prof. Dr. Max J. Setzer Vorlesung - Korrosion Seite 1
 Univ.-Prof. Dr. Max J. Setzer Vorlesung - Korrosion Seite 1 Einführung MWG 8 / Die Korrosion ist ein Redox-Prozess Bei der Änderung der Oxidationsstufe entstehen Ionen geladene Teilchen. Der Oxidationsprozess
Univ.-Prof. Dr. Max J. Setzer Vorlesung - Korrosion Seite 1 Einführung MWG 8 / Die Korrosion ist ein Redox-Prozess Bei der Änderung der Oxidationsstufe entstehen Ionen geladene Teilchen. Der Oxidationsprozess
Innovation in der Instandhaltung Aachener Baustofftag November 2015 RWTH Aachen
 Innovation in der Instandhaltung + 50. Aachener Baustofftag 19. - 20.November 2015 RWTH Aachen 1 Thema: KKS-Textilbeton der direkt befahrbare KKS-Parkhausbelag allgemein anerkannte Regeln der Technik,
Innovation in der Instandhaltung + 50. Aachener Baustofftag 19. - 20.November 2015 RWTH Aachen 1 Thema: KKS-Textilbeton der direkt befahrbare KKS-Parkhausbelag allgemein anerkannte Regeln der Technik,
Flugasche und Sulfatwiderstand
 47. Aachener Baustofftag, 9. April 214 Flugasche und Sulfatwiderstand Johannes Haufe Institut für Bauforschung der RWTH Aachen University (ibac) Gliederung Sulfatbeanspruchung von Beton Schadensmechanismen
47. Aachener Baustofftag, 9. April 214 Flugasche und Sulfatwiderstand Johannes Haufe Institut für Bauforschung der RWTH Aachen University (ibac) Gliederung Sulfatbeanspruchung von Beton Schadensmechanismen
M. Brianza: Empfehlungen zu den Expositionsklassen XA FSKB Frühjahrstagung FSKB Empfehlungen zu den Expositionsklassen XA
 Frühjahrstagung FSKB 2006 Empfehlungen zu den 1 Beanspruchung von Beton Angriff auf die Bewehrung Schädigung des Betongefüges Meerwasser S F Frost (mit/ohne Taumittel) Chloride D 0 A chemischen Angriff
Frühjahrstagung FSKB 2006 Empfehlungen zu den 1 Beanspruchung von Beton Angriff auf die Bewehrung Schädigung des Betongefüges Meerwasser S F Frost (mit/ohne Taumittel) Chloride D 0 A chemischen Angriff
Mit 29 Farb- und 192 sw-abbildungen und 42 Tabellen
 Herausgegeben vom F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar Mit 29 Farb- und 192 sw-abbildungen und 42 Tabellen VII Inhaltsverzeichnis Einführung 1 1 Kenngrößen und Einflussfaktoren
Herausgegeben vom F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar Mit 29 Farb- und 192 sw-abbildungen und 42 Tabellen VII Inhaltsverzeichnis Einführung 1 1 Kenngrößen und Einflussfaktoren
Jochen Stark Bernd Wicht Dauerhaftigkeit von Beton Der Baustoff als Werkstoff
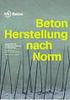 Jochen Stark Bernd Wicht Dauerhaftigkeit von Beton Der Baustoff als Werkstoff Herausgegeben vom F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar Mit 29 Färb- und 192 sw-abbildungen
Jochen Stark Bernd Wicht Dauerhaftigkeit von Beton Der Baustoff als Werkstoff Herausgegeben vom F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar Mit 29 Färb- und 192 sw-abbildungen
B DAW SE Geschäftsbereich Disbon Roßdörfer Straße Ober-Ramstadt. Geschäftsbereich Disbon Roßdörfer Straße Ober-Ramstadt
 Ingenieurbüro Raupach Bruns Wolff GmbH & Co. KG Büchel 13/15 52062 Aachen DAW SE Geschäftsbereich Disbon Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt Vorgang: B 5831 Kontakt: Herr Dipl.- Ing. Michael Bruns
Ingenieurbüro Raupach Bruns Wolff GmbH & Co. KG Büchel 13/15 52062 Aachen DAW SE Geschäftsbereich Disbon Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt Vorgang: B 5831 Kontakt: Herr Dipl.- Ing. Michael Bruns
Beschichtungen und Kathodischer Korrosionsschutz: Grundlagen und Voraussetzungen. Lisa Herter, M.Sc.
 Beschichtungen und Kathodischer Korrosionsschutz: Grundlagen und Voraussetzungen Lisa Herter, M.Sc. Steffel KKS GmbH Im Bulloh 6 29331 Lachendorf Tel.: +49 5145 9891310 E-Mail: lisa.herter@steffel.com
Beschichtungen und Kathodischer Korrosionsschutz: Grundlagen und Voraussetzungen Lisa Herter, M.Sc. Steffel KKS GmbH Im Bulloh 6 29331 Lachendorf Tel.: +49 5145 9891310 E-Mail: lisa.herter@steffel.com
Bewehrungskorrosion. Stahl + Feuchte + Sauerstoff + (aggr. Medien) ---> Korrosionsprodukte. Fe + H 2 O + O 2 + (K) ---> 2FeO(OH) + H 2 O
 Bewehrungskorrosion Stahl + Feuchte + Sauerstoff + (aggr. Medien) ---> Korrosionsprodukte Fe + H 2 O + O 2 + (K) ---> 2FeO(OH) + H 2 O Bewehrungskorrosion Dauerhaftigkeit des Stahls im Beton in Abhängigkeit
Bewehrungskorrosion Stahl + Feuchte + Sauerstoff + (aggr. Medien) ---> Korrosionsprodukte Fe + H 2 O + O 2 + (K) ---> 2FeO(OH) + H 2 O Bewehrungskorrosion Dauerhaftigkeit des Stahls im Beton in Abhängigkeit
KKS mit eingeschlitzten Bandanoden Grundlagen und Ergebnisse von Laboruntersuchungen
 KKS mit eingeschlitzten Bandanoden Grundlagen und Ergebnisse von Laboruntersuchungen Prof. Dr.-Ing. Christoph Dauberschmidt Hochschule München, Fakultät für Bauingenieure, München, Deutschland Dipl.-Ing.
KKS mit eingeschlitzten Bandanoden Grundlagen und Ergebnisse von Laboruntersuchungen Prof. Dr.-Ing. Christoph Dauberschmidt Hochschule München, Fakultät für Bauingenieure, München, Deutschland Dipl.-Ing.
Korrosionsschutz im Massivbau
 Korrosionsschutz im Massivbau Vermeidung und Sanierung von Korrosionsschäden im Stahl- und Spannbeton Dr.-Ing. habil. Ulf Nürnberger Dr.-Ing. Bernd Isecke Dipl.-Ing. Bernd Neubert Dr.-Ing. Günter Rieche
Korrosionsschutz im Massivbau Vermeidung und Sanierung von Korrosionsschäden im Stahl- und Spannbeton Dr.-Ing. habil. Ulf Nürnberger Dr.-Ing. Bernd Isecke Dipl.-Ing. Bernd Neubert Dr.-Ing. Günter Rieche
Thema: Kathodischer Korrosionsschutz mit Textilbeton: Anspruch, Entwicklung, Performance und Langzeiterfahrung
 1 Parkbauten Kolloquium TAE 26. - 27. Januar 2016- Ostfildern Thema: Kathodischer Korrosionsschutz mit Textilbeton: Anspruch, Entwicklung, Performance und Langzeiterfahrung (D. Koch, M. Mahjoori) Dipl.-
1 Parkbauten Kolloquium TAE 26. - 27. Januar 2016- Ostfildern Thema: Kathodischer Korrosionsschutz mit Textilbeton: Anspruch, Entwicklung, Performance und Langzeiterfahrung (D. Koch, M. Mahjoori) Dipl.-
Die Wirksamkeit des kathodischen Korrosionsschutzes bei Abschirmung: Enthaftete Werks- und Nachumhüllungen
 Die Wirksamkeit des kathodischen Korrosionsschutzes bei Abschirmung: Enthaftete Werks- und Nachumhüllungen Dr. Markus Büchler 12. Praxistag Korrosionsschutz SGK Schweizerische Gesellschaft für Korrosionsschutz
Die Wirksamkeit des kathodischen Korrosionsschutzes bei Abschirmung: Enthaftete Werks- und Nachumhüllungen Dr. Markus Büchler 12. Praxistag Korrosionsschutz SGK Schweizerische Gesellschaft für Korrosionsschutz
C Säure-Base-Reaktionen
 -V.C1- C Säure-Base-Reaktionen 1 Autoprotolyse des Wassers und ph-wert 1.1 Stoffmengenkonzentration Die Stoffmengenkonzentration eines gelösten Stoffes ist der Quotient aus der Stoffmenge und dem Volumen
-V.C1- C Säure-Base-Reaktionen 1 Autoprotolyse des Wassers und ph-wert 1.1 Stoffmengenkonzentration Die Stoffmengenkonzentration eines gelösten Stoffes ist der Quotient aus der Stoffmenge und dem Volumen
Kathodischer Korrosionsschutz mit Textilbeton: Anspruch, Entwicklung, Performance und Langzeiterfahrung. Detelf Koch Koch GmbH, Kreuztal
 Kathodischer Korrosionsschutz mit Textilbeton: Anspruch, Entwicklung, Performance und Langzeiterfahrung Detelf Koch Koch GmbH, Kreuztal 1 Parkbauten Kolloquium TAE 26. - 27. Januar 216- Ostfildern Thema:
Kathodischer Korrosionsschutz mit Textilbeton: Anspruch, Entwicklung, Performance und Langzeiterfahrung Detelf Koch Koch GmbH, Kreuztal 1 Parkbauten Kolloquium TAE 26. - 27. Januar 216- Ostfildern Thema:
Kathodischer Korrosionsschutz bei Offshore-Windenergieanlagen. Lisa Herter, M.Sc.
 Kathodischer Korrosionsschutz bei Offshore-Windenergieanlagen Lisa Herter, M.Sc. Steffel KKS GmbH Im Bulloh 6 29331 Lachendorf Tel.: +49 5145 9891310 E-Mail: lisa.herter@steffel.com HTG-Workshop Korrosionsschutz
Kathodischer Korrosionsschutz bei Offshore-Windenergieanlagen Lisa Herter, M.Sc. Steffel KKS GmbH Im Bulloh 6 29331 Lachendorf Tel.: +49 5145 9891310 E-Mail: lisa.herter@steffel.com HTG-Workshop Korrosionsschutz
Kathodische Enthaftung insbesondere bei Polyurethan Beschichtungen. Betrachtung der Grundlagen und normativen Anforderungen Ashokanand Vimalanandan
 Kathodische Enthaftung insbesondere bei Polyurethan Beschichtungen Betrachtung der Grundlagen und normativen Anforderungen Ashokanand Vimalanandan Inhalt 2 Normative Anforderungen/Prüfungen bezüglich kathodischer
Kathodische Enthaftung insbesondere bei Polyurethan Beschichtungen Betrachtung der Grundlagen und normativen Anforderungen Ashokanand Vimalanandan Inhalt 2 Normative Anforderungen/Prüfungen bezüglich kathodischer
6.2.6 Ohmsches Gesetz ******
 6..6 ****** Motivation Das Ohmsche Gesetz wird mithilfe von verschiedenen Anordnungen von leitenden Drähten untersucht. Experiment 6 7 8 9 0 Abbildung : Versuchsaufbau. Die Ziffern bezeichnen die zehn
6..6 ****** Motivation Das Ohmsche Gesetz wird mithilfe von verschiedenen Anordnungen von leitenden Drähten untersucht. Experiment 6 7 8 9 0 Abbildung : Versuchsaufbau. Die Ziffern bezeichnen die zehn
Ausgewählte Anwendungen der Elektrochemie
 Ausgewählte Anwendungen der Elektrochemie 1. Korrosion 2. Passivierung 3. Nervenleitungsmodell 4. Halbleiterelektroden 5. Photoelektrochemische Solarzellen http://userpage.fu-berlin.de/~lap/lppciii.htm
Ausgewählte Anwendungen der Elektrochemie 1. Korrosion 2. Passivierung 3. Nervenleitungsmodell 4. Halbleiterelektroden 5. Photoelektrochemische Solarzellen http://userpage.fu-berlin.de/~lap/lppciii.htm
E7 Elektrolyse. Versuchsprotokoll von Thomas Bauer und Patrick Fritzsch. Münster, den
 E7 Elektrolyse Versuchsprotokoll von Thomas Bauer und Patrick Fritzsch Münster, den 18.12.2000 INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung 2. Theoretische Grundlagen 2.1 Elektrolyse 2.2 Die FARADAYschen Gesetze der
E7 Elektrolyse Versuchsprotokoll von Thomas Bauer und Patrick Fritzsch Münster, den 18.12.2000 INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung 2. Theoretische Grundlagen 2.1 Elektrolyse 2.2 Die FARADAYschen Gesetze der
Moderate Betontemperatur.
 Moderate Betontemperatur. Riteno 4 Beton für massige Bauteile Holcim (Süddeutschland) GmbH Massenbeton mit Riteno und Flugasche Bei großen Bauteilstärken, wie bei Tunnelsohlen, -decken, massigen Bodenplatten
Moderate Betontemperatur. Riteno 4 Beton für massige Bauteile Holcim (Süddeutschland) GmbH Massenbeton mit Riteno und Flugasche Bei großen Bauteilstärken, wie bei Tunnelsohlen, -decken, massigen Bodenplatten
METTLER TOLEDO Prozessanalytik. Online-Prozessund Reinwassersysteme. Leitfaden für Online-Leitfähigkeitsmessungen Theorie und Praxis
 Leitfaden Schulexperimente Leitfähigkeit METTLER TOLEDO Prozessanalytik Online-Prozessund Reinwassersysteme Leitfaden für Online-Leitfähigkeitsmessungen Theorie und Praxis Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung
Leitfaden Schulexperimente Leitfähigkeit METTLER TOLEDO Prozessanalytik Online-Prozessund Reinwassersysteme Leitfaden für Online-Leitfähigkeitsmessungen Theorie und Praxis Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung
Physikalische Chemie Praktikum. Elektrolyte: Dissoziationskonstante von Essigsäure λ von NaCl ist zu ermitteln
 Hochschule Emden/Leer Physikalische Chemie Praktikum Vers. Nr. 16 April 2017 Elektrolyte: Dissoziationskonstante von Essigsäure λ von NaCl ist zu ermitteln In diesem Versuch soll die Dissoziationskonstante
Hochschule Emden/Leer Physikalische Chemie Praktikum Vers. Nr. 16 April 2017 Elektrolyte: Dissoziationskonstante von Essigsäure λ von NaCl ist zu ermitteln In diesem Versuch soll die Dissoziationskonstante
E5: Faraday-Konstante
 E5: Faraday-Konstante Theoretische Grundlagen: Elektrischer Strom ist ein Fluss von elektrischer Ladung; in Metallen sind Elektronen die Ladungsträger, in Elektrolyten übernehmen Ionen diese Aufgabe. Befinden
E5: Faraday-Konstante Theoretische Grundlagen: Elektrischer Strom ist ein Fluss von elektrischer Ladung; in Metallen sind Elektronen die Ladungsträger, in Elektrolyten übernehmen Ionen diese Aufgabe. Befinden
Praktische Anwendungen des KKS im Hoch- und Ingenieurbau Ausführungen an der Brücke L 53
 Praktische Anwendungen des KKS im Hoch- und Ingenieurbau Ausführungen an der Brücke L 53 N. Effler 1) 1) V&C Stahlbetonschutz V&C Kathodischer Korrosionsschutz GmbH Alxingergasse 34 A-1100 Wien Kurzfassung
Praktische Anwendungen des KKS im Hoch- und Ingenieurbau Ausführungen an der Brücke L 53 N. Effler 1) 1) V&C Stahlbetonschutz V&C Kathodischer Korrosionsschutz GmbH Alxingergasse 34 A-1100 Wien Kurzfassung
Effizienter Schutz für Stahlbeton
 Text steht online unter: pr-nord.de -> Pressezentrum -> Pressetexte /-fotos 01/17-02 Kathodischer Korrosionsschutz: Effizienter Schutz für Stahlbeton Mit dem kathodischen Korrosionsschutz (KKS) können
Text steht online unter: pr-nord.de -> Pressezentrum -> Pressetexte /-fotos 01/17-02 Kathodischer Korrosionsschutz: Effizienter Schutz für Stahlbeton Mit dem kathodischen Korrosionsschutz (KKS) können
Sensoren für die Bauwerksüberwachung und Korrosionsmonitoring der Bewehrung
 Sensoren für die Bauwerksüberwachung und Korrosionsmonitoring der Bewehrung Franz Pruckner Einleitung Die automatisierte Überwachung der Korrosion und des Korrosionsschutzes von Bewehrungsstahl hat sich
Sensoren für die Bauwerksüberwachung und Korrosionsmonitoring der Bewehrung Franz Pruckner Einleitung Die automatisierte Überwachung der Korrosion und des Korrosionsschutzes von Bewehrungsstahl hat sich
Widerstände. Schulversuchspraktikum WS 2000/2001 Redl Günther und 7.Klasse. Inhaltsverzeichnis:
 Schulversuchspraktikum WS 2000/2001 Redl Günther 9655337 Widerstände 3. und 7.Klasse Inhaltsverzeichnis: 1) Vorraussetzungen 2) Lernziele 3) Verwendete Quellen 4) Ohmsches Gesetz 5) Spezifischer Widerstand
Schulversuchspraktikum WS 2000/2001 Redl Günther 9655337 Widerstände 3. und 7.Klasse Inhaltsverzeichnis: 1) Vorraussetzungen 2) Lernziele 3) Verwendete Quellen 4) Ohmsches Gesetz 5) Spezifischer Widerstand
Betonschäden und Betoninstandsetzung
 Betonschäden und Betoninstandsetzung Bauschäden - Schadenserkennung und Prüfungen am Bauwerk Sicherheit Werterhaltung Standsicherheit des Bauwerks Sicherheit der Nutzer Dauerhaftigkeit des Bauwerks Verwitterungsbeständigkeit
Betonschäden und Betoninstandsetzung Bauschäden - Schadenserkennung und Prüfungen am Bauwerk Sicherheit Werterhaltung Standsicherheit des Bauwerks Sicherheit der Nutzer Dauerhaftigkeit des Bauwerks Verwitterungsbeständigkeit
Eine Brennstoffzelle, die Umkehr der Wasserelektrolyse
 Wasserelektrolyse Peter Bützer Inhalt Eine Brennstoffzelle, die Umkehr der Wasserelektrolyse 1 Einleitung/Theorie... 1 2 Datenbasis... 2 2.1 Aufgabenstellung... 2 2.2 Durchführung... 2 2.3 Beobachtungen/Messungen...
Wasserelektrolyse Peter Bützer Inhalt Eine Brennstoffzelle, die Umkehr der Wasserelektrolyse 1 Einleitung/Theorie... 1 2 Datenbasis... 2 2.1 Aufgabenstellung... 2 2.2 Durchführung... 2 2.3 Beobachtungen/Messungen...
Nr Herausgegeben. im Auftrage des Ministerpräsidenten Dr. Pranz Meyers. von Staatssekretär Professor Dr. h. c. Dr. E. h.
 FORSCHUNGSBERICHTE DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN Nr.1510 Herausgegeben im Auftrage des Ministerpräsidenten Dr. Pranz Meyers von Staatssekretär Professor Dr. h. c. Dr. E. h. Leo Brandt Dipl.-Cbem. Dr.
FORSCHUNGSBERICHTE DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN Nr.1510 Herausgegeben im Auftrage des Ministerpräsidenten Dr. Pranz Meyers von Staatssekretär Professor Dr. h. c. Dr. E. h. Leo Brandt Dipl.-Cbem. Dr.
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg
 TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg PROTOKOLL SEKUNDARSTUFE I Modul: Versuch: Korrosionsschutz durch metallische
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg PROTOKOLL SEKUNDARSTUFE I Modul: Versuch: Korrosionsschutz durch metallische
Hochofenzement CEM III/A 52,5 N-HS
 Hochofenzement CEM III/A 52,5 N-HS Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten SCHWENK Mischmeisterschulung 2015 Wolfgang Hemrich SCHWENK Zement KG hemrich.wolfgang@schwenk.de Entwicklung des Zementes Projekt
Hochofenzement CEM III/A 52,5 N-HS Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten SCHWENK Mischmeisterschulung 2015 Wolfgang Hemrich SCHWENK Zement KG hemrich.wolfgang@schwenk.de Entwicklung des Zementes Projekt
KORROSION UND KORROSIONSSCHUTZ VON METALLEN
 11. Einheit: KORROSION UND KORROSIONSSCHUTZ VON METALLEN Sebastian Spinnen, Ingrid Reisewitz-Swertz 1 von 16 ZIELE DER HEUTIGEN EINHEIT Am Ende der Einheit Korrosion und Korrosionsschutz von Metallen..
11. Einheit: KORROSION UND KORROSIONSSCHUTZ VON METALLEN Sebastian Spinnen, Ingrid Reisewitz-Swertz 1 von 16 ZIELE DER HEUTIGEN EINHEIT Am Ende der Einheit Korrosion und Korrosionsschutz von Metallen..
Grundlagen: Galvanische Zellen:
 E1 : Ionenprodukt des Wassers Grundlagen: Galvanische Zellen: Die Galvanische Zelle ist eine elektrochemische Zelle. In ihr laufen spontan elektrochemische Reaktionen unter Erzeugung von elektrischer Energie
E1 : Ionenprodukt des Wassers Grundlagen: Galvanische Zellen: Die Galvanische Zelle ist eine elektrochemische Zelle. In ihr laufen spontan elektrochemische Reaktionen unter Erzeugung von elektrischer Energie
Elektrochemie HS Zusatzübung. Übung Assistent: Olga Nibel. Tel.:
 Elektrochemie HS 2016 Übung 13 19.12.2016 Assistent: Olga Nibel Tel.: 056-310-2326 E-mail: olga.nibel@psi.ch Adresse: 5232 Villigen PSI, OVGA 101A Zusatzübung Kenngrössen Dichte (Fe): 7.87 g cm -3 Molare
Elektrochemie HS 2016 Übung 13 19.12.2016 Assistent: Olga Nibel Tel.: 056-310-2326 E-mail: olga.nibel@psi.ch Adresse: 5232 Villigen PSI, OVGA 101A Zusatzübung Kenngrössen Dichte (Fe): 7.87 g cm -3 Molare
7 Korrosion und Korrosionsschutz
 7 Korrosion und Korrosionsschutz 7.1 Metallkorrosion lat. corrodere = zernagen, zerfressen Veränderung eines metallischen Werkstoffs durch Reaktion mit seiner Umgebung Beeinträchtigungen der Funktion Substanzverlust,
7 Korrosion und Korrosionsschutz 7.1 Metallkorrosion lat. corrodere = zernagen, zerfressen Veränderung eines metallischen Werkstoffs durch Reaktion mit seiner Umgebung Beeinträchtigungen der Funktion Substanzverlust,
Elektrizität. = C J m. Das Coulomb Potential φ ist dabei:
 Elektrizität Die Coulombsche potentielle Energie V einer Ladung q im Abstand r von einer anderen Ladung q ist die Arbeit, die aufgewendet werden muss um die zwei Ladungen aus dem Unendlichen auf den Abstand
Elektrizität Die Coulombsche potentielle Energie V einer Ladung q im Abstand r von einer anderen Ladung q ist die Arbeit, die aufgewendet werden muss um die zwei Ladungen aus dem Unendlichen auf den Abstand
Die spezifische Leitfähigkeit κ ist umgekehrt proportional zum Widerstand R:
 Institut für Physikalische Chemie Lösungen zu den Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie II im WS 206/207 Prof. Dr. Eckhard Bartsch / M. Werner M.Sc. Aufgabenblatt 3 vom..6 Aufgabe 3 (L) Leitfähigkeiten
Institut für Physikalische Chemie Lösungen zu den Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie II im WS 206/207 Prof. Dr. Eckhard Bartsch / M. Werner M.Sc. Aufgabenblatt 3 vom..6 Aufgabe 3 (L) Leitfähigkeiten
Versuch Leitfähige Polymere (engl. Conductive Polymer)
 Versuch Leitfähige Polymere (engl. Conductive Polymer) Themenbereiche Konjugierte Polymere, Elektropolymerisation, dünne Filme, (spezifische) Leitfähigkeit, (spezifischer/flächen-) Widerstand, Stromdichte,
Versuch Leitfähige Polymere (engl. Conductive Polymer) Themenbereiche Konjugierte Polymere, Elektropolymerisation, dünne Filme, (spezifische) Leitfähigkeit, (spezifischer/flächen-) Widerstand, Stromdichte,
Korrosion von Aluminium durch Zementmörtel (Fortsetzung)
 Korrosion von Aluminium durch Zementmörtel (Fortsetzung) Autor(en): Endtinger, F. / Weber, H. Objekttyp: Article Zeitschrift: Cementbulletin Band (Jahr): 34-35 (1966-1967) Heft 11 PDF erstellt am: 20.09.2017
Korrosion von Aluminium durch Zementmörtel (Fortsetzung) Autor(en): Endtinger, F. / Weber, H. Objekttyp: Article Zeitschrift: Cementbulletin Band (Jahr): 34-35 (1966-1967) Heft 11 PDF erstellt am: 20.09.2017
EinFaCh 1. Studienvorbereitung Chemie. Einstieg in Freibergs anschauliches Chemiewissen Teil 1: Redoxreaktionen und Elektrochemie.
 Studienvorbereitung Chemie EinFaCh 1 Einstieg in Freibergs anschauliches Chemiewissen Teil 1: Redoxreaktionen und Elektrochemie www.tu-freiberg.de http://tu-freiberg.de/fakultaet2/einfach Was ist eine
Studienvorbereitung Chemie EinFaCh 1 Einstieg in Freibergs anschauliches Chemiewissen Teil 1: Redoxreaktionen und Elektrochemie www.tu-freiberg.de http://tu-freiberg.de/fakultaet2/einfach Was ist eine
Einführung in die Baustoffkunde
 Instandsetzung von Trinkwasserbehältern Untersuchungsmethoden Einführung in die Baustoffkunde für die Bauzustandsanalyse und die Qualitätssicherung Einführungen in die Baustoffkunde Prof. Dr.-Ing. M. Breitbach
Instandsetzung von Trinkwasserbehältern Untersuchungsmethoden Einführung in die Baustoffkunde für die Bauzustandsanalyse und die Qualitätssicherung Einführungen in die Baustoffkunde Prof. Dr.-Ing. M. Breitbach
Inhaltsverzeichnis. Vorwort...7. Inhalt...11
 Vorwort....7 Inhalt...11 1. Elektrochemische Grundlagen der Korrosion und des kathodischen Korrosionsschutzes....19 1.1 Allgemeine Korrosionsvorgänge...19 1.2 Korrosion durch galvanische Elementbildung...24
Vorwort....7 Inhalt...11 1. Elektrochemische Grundlagen der Korrosion und des kathodischen Korrosionsschutzes....19 1.1 Allgemeine Korrosionsvorgänge...19 1.2 Korrosion durch galvanische Elementbildung...24
Korrosion von Magnesiumlegierungen: Richtlinie für Korrosionsuntersuchungen und -prüfungen
 Korrosion von Magnesiumlegierungen: Richtlinie für Korrosionsuntersuchungen und -prüfungen Revisionsstand: 20. April 2015 Arbeitsgruppe Korrosionsuntersuchungen/-prüfungen für Magnesiumlegierungen im GfKORR-Arbeitskreis
Korrosion von Magnesiumlegierungen: Richtlinie für Korrosionsuntersuchungen und -prüfungen Revisionsstand: 20. April 2015 Arbeitsgruppe Korrosionsuntersuchungen/-prüfungen für Magnesiumlegierungen im GfKORR-Arbeitskreis
Bewertung von Mantelrohren gemäß DVGW 20 (A) / AfK-Nr. 1
 Bewertung von Mantelrohren gemäß DVGW 20 (A) / AfK-Nr. 1 Dipl.-Ing. Ulrich Bette www.ifb-wuppertal.de 27.06.2018 1 DVGW 20 (A) AfK 1 KKS- Anlage Fehlstellen in der Umhüllung des Produktrohres im Mantelrohr
Bewertung von Mantelrohren gemäß DVGW 20 (A) / AfK-Nr. 1 Dipl.-Ing. Ulrich Bette www.ifb-wuppertal.de 27.06.2018 1 DVGW 20 (A) AfK 1 KKS- Anlage Fehlstellen in der Umhüllung des Produktrohres im Mantelrohr
Aufgabenblatt Z/ 01 (Physikalische Größen und Einheiten)
 Aufgabenblatt Z/ 01 (Physikalische Größen und Einheiten) Aufgabe Z-01/ 1 Welche zwei verschiedenen physikalische Bedeutungen kann eine Größe haben, wenn nur bekannt ist, dass sie in der Einheit Nm gemessen
Aufgabenblatt Z/ 01 (Physikalische Größen und Einheiten) Aufgabe Z-01/ 1 Welche zwei verschiedenen physikalische Bedeutungen kann eine Größe haben, wenn nur bekannt ist, dass sie in der Einheit Nm gemessen
2. Teilklausur zum Chemischen Grundpraktikum im WS 2014/15 vom
 2. Teilklausur zum Chemischen Grundpraktikum im WS 2014/15 vom 21.01.2015 A1 A2 A3 F4 R5 E6 Note 8 12 5 9 8 8 50 NAME/VORNAME:... Matrikelnummer:... Pseudonym für Ergebnisveröffentlichung Schreiben Sie
2. Teilklausur zum Chemischen Grundpraktikum im WS 2014/15 vom 21.01.2015 A1 A2 A3 F4 R5 E6 Note 8 12 5 9 8 8 50 NAME/VORNAME:... Matrikelnummer:... Pseudonym für Ergebnisveröffentlichung Schreiben Sie
Erich Tag Elektrochemie
 STUDIENBÜCHER CHEMIE Erich Tag Elektrochemie Eine Einführung in die Theorie elektrochemischer Gleichgewichte und elektrochemischer Prozesse Herausgegeben von W. Botsch, E. Höfling und J. Mauch VERLAG MORITZ
STUDIENBÜCHER CHEMIE Erich Tag Elektrochemie Eine Einführung in die Theorie elektrochemischer Gleichgewichte und elektrochemischer Prozesse Herausgegeben von W. Botsch, E. Höfling und J. Mauch VERLAG MORITZ
Messung der Leitfähigkeit wässriger Elektrolytlösungen
 Versuch Nr. 10: Messung der Leitfähigkeit wässriger Elektrolytlösungen 1. Ziel des Versuchs In diesem Versuch sollen die Leitfähigkeiten von verschiedenen Elektrolyten in verschiedenen Konzentrationen
Versuch Nr. 10: Messung der Leitfähigkeit wässriger Elektrolytlösungen 1. Ziel des Versuchs In diesem Versuch sollen die Leitfähigkeiten von verschiedenen Elektrolyten in verschiedenen Konzentrationen
Trinkwasserbehälter Beschichtungen von. Trinkwasser genießen mit epasit
 Trinkwasserbehälter Beschichtungen von Trinkwasser genießen mit epasit Über 30 Jahre Innenbeschichtungen in Trinkwasserbehältern Planung Die Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser muss sicher gestellt
Trinkwasserbehälter Beschichtungen von Trinkwasser genießen mit epasit Über 30 Jahre Innenbeschichtungen in Trinkwasserbehältern Planung Die Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser muss sicher gestellt
Demonstrations-Planar-Triode
 Demonstrations-Planar-Triode 1. Anode 2. Gitter 3. Halter mit 4-mm-Steckerstift zum Anschluss des Gitters 4. Heizwendel 5. Katodenplatte 6. Verbindung der Heizfadenzuführung mit der inneren Beschichtung
Demonstrations-Planar-Triode 1. Anode 2. Gitter 3. Halter mit 4-mm-Steckerstift zum Anschluss des Gitters 4. Heizwendel 5. Katodenplatte 6. Verbindung der Heizfadenzuführung mit der inneren Beschichtung
Physikalisches Anfaengerpraktikum. Dissoziationsgrad und Gefrierpunkterniedrigung
 Physikalisches Anfaengerpraktikum Dissoziationsgrad und Gefrierpunkterniedrigung Ausarbeitung von Marcel Engelhardt & David Weisgerber (Gruppe ) Montag, 1. Februar 00 1. Versuchsaufbau Um den Dissoziationsgrad
Physikalisches Anfaengerpraktikum Dissoziationsgrad und Gefrierpunkterniedrigung Ausarbeitung von Marcel Engelhardt & David Weisgerber (Gruppe ) Montag, 1. Februar 00 1. Versuchsaufbau Um den Dissoziationsgrad
MÖCHTEN SIE BEI DER WEITERENTWICKLUNG VON SOLARENERGIE MITWIRKEN? LASSEN SIE IHRE ALTEN SOLARMODULE ZEIGEN, WAS SIE KÖNNEN!
 MÖCHTEN SIE BEI DER WEITERENTWICKLUNG VON SOLARENERGIE MITWIRKEN? LASSEN SIE IHRE ALTEN SOLARMODULE ZEIGEN, WAS SIE KÖNNEN! Die Gemeinschaft hat Fördergelder vom Horizont 2020 Forschungs- und Innovationsprogramm
MÖCHTEN SIE BEI DER WEITERENTWICKLUNG VON SOLARENERGIE MITWIRKEN? LASSEN SIE IHRE ALTEN SOLARMODULE ZEIGEN, WAS SIE KÖNNEN! Die Gemeinschaft hat Fördergelder vom Horizont 2020 Forschungs- und Innovationsprogramm
Einführung in die Elektrochemie
 Einführung in die Elektrochemie > Grundlagen, Methoden > Leitfähigkeit von Elektrolytlösungen, Konduktometrie > Elektroden Metall-Elektroden 1. und 2. Art Redox-Elektroden Membran-Elektroden > Potentiometrie
Einführung in die Elektrochemie > Grundlagen, Methoden > Leitfähigkeit von Elektrolytlösungen, Konduktometrie > Elektroden Metall-Elektroden 1. und 2. Art Redox-Elektroden Membran-Elektroden > Potentiometrie
Schalungskorrosion Ursachen und Vermeidungsstrategien
 Schalungskorrosion Ursachen und Vermeidungsstrategien Dr.-Ing. Till Felix Mayer Ingenieurbüro Schießl Gehlen Sodeikat, München Motivation dieser Arbeit - Fertigteilherstellung rd. 30% des deutschen Gesamtzementverbrauchs
Schalungskorrosion Ursachen und Vermeidungsstrategien Dr.-Ing. Till Felix Mayer Ingenieurbüro Schießl Gehlen Sodeikat, München Motivation dieser Arbeit - Fertigteilherstellung rd. 30% des deutschen Gesamtzementverbrauchs
Stoffe oder Teilchen, die Protonen abgeben kånnen, werden als SÄuren bezeichnet (Protonendonatoren).
 5 10 15 20 25 30 35 40 45 O C 50 Chemie Technische BerufsmaturitÄt BMS AGS Basel Kapitel 6 SÄuren und Basen Baars, Kap. 12.1; 12.2; 13 Versuch 1 Ein Becherglas mit Thermometer enthält violette FarbstofflÅsung
5 10 15 20 25 30 35 40 45 O C 50 Chemie Technische BerufsmaturitÄt BMS AGS Basel Kapitel 6 SÄuren und Basen Baars, Kap. 12.1; 12.2; 13 Versuch 1 Ein Becherglas mit Thermometer enthält violette FarbstofflÅsung
05 Beton. LE 4 5 Ursachen und Verhütung von Betonschäden 6 Instandsetzung, Rückbau und Recycling
 05 Beton LE 4 5 Ursachen und Verhütung von Betonschäden 6 Instandsetzung, Rückbau und Recycling 5.1 Entmischung des Betons Erscheinungsformen Kiesnester Schleppwasser Bluten Mikroentmischungen Ursachen
05 Beton LE 4 5 Ursachen und Verhütung von Betonschäden 6 Instandsetzung, Rückbau und Recycling 5.1 Entmischung des Betons Erscheinungsformen Kiesnester Schleppwasser Bluten Mikroentmischungen Ursachen
MASTERPRÜFUNG Prüfungsfach: Sonderbetone und Baustoffkreislauf am:
 UNIVERSITÄT DER BUNDESWEHR MÜNCHEN Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen Institut für Werkstoffe des Bauwesens Univ.-Prof. Dr.-Ing. K.-Ch. Thienel MASTERPRÜFUNG Prüfungsfach: Sonderbetone und
UNIVERSITÄT DER BUNDESWEHR MÜNCHEN Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen Institut für Werkstoffe des Bauwesens Univ.-Prof. Dr.-Ing. K.-Ch. Thienel MASTERPRÜFUNG Prüfungsfach: Sonderbetone und
Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen (EF)
 Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen (EF)... interpretieren den zeitlichen Ablauf chemischer Reaktionen in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (u.a. Oberfläche, Konzentration, Temperatur)
Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen (EF)... interpretieren den zeitlichen Ablauf chemischer Reaktionen in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (u.a. Oberfläche, Konzentration, Temperatur)
Strömungssimulation in Li-Dualinsertationszellen
 Strömungssimulation in Li-Dualinsertationszellen Christoph Wiesian, Dennis Dieterle, Sven Wagner c.wiesian@uni-muenster.de dennis.dieterle@uni-muenster.de sven.wagner@uni-muenster.de 22.12.2009 Wiesian,
Strömungssimulation in Li-Dualinsertationszellen Christoph Wiesian, Dennis Dieterle, Sven Wagner c.wiesian@uni-muenster.de dennis.dieterle@uni-muenster.de sven.wagner@uni-muenster.de 22.12.2009 Wiesian,
Die spezifische Leitfähigkeit κ ist umgekehrt proportional zum Widerstand R:
 Institut für Physikalische Chemie Lösungen zu den Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie II im WS 205/206 Prof. Dr. Eckhard Bartsch / M. Werner M.Sc. Aufgabenblatt 3 vom 3..5 Aufgabe 3 (L) Leitfähigkeiten
Institut für Physikalische Chemie Lösungen zu den Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie II im WS 205/206 Prof. Dr. Eckhard Bartsch / M. Werner M.Sc. Aufgabenblatt 3 vom 3..5 Aufgabe 3 (L) Leitfähigkeiten
Korrosionsschutzmechanismen bei TiMgN-Hartstoffschichten auf Stahl
 Korrosionsschutzmechanismen bei TiMgN-Hartstoffschichten auf Stahl Andreas Heyn (OvGU Magdeburg) Martin Balzer, Martin Fenker, Herbert Kappl (fem Schwäbisch Gmünd) Thoralf Müller (BAM Berlin) HE 6160 /
Korrosionsschutzmechanismen bei TiMgN-Hartstoffschichten auf Stahl Andreas Heyn (OvGU Magdeburg) Martin Balzer, Martin Fenker, Herbert Kappl (fem Schwäbisch Gmünd) Thoralf Müller (BAM Berlin) HE 6160 /
SAKRET Betoninstandsetzungssysteme für Trinkwasserbauwerke
 SAKRET Bausysteme 01/2013 SAKRET Betoninstandsetzungssysteme für Trinkwasserbauwerke Dicht und Hygienisch Wasser die Quelle des Lebens Wasser zählt zu den wertvollsten Stoffen unserer Erde. Sauberes Trinkwasser
SAKRET Bausysteme 01/2013 SAKRET Betoninstandsetzungssysteme für Trinkwasserbauwerke Dicht und Hygienisch Wasser die Quelle des Lebens Wasser zählt zu den wertvollsten Stoffen unserer Erde. Sauberes Trinkwasser
Gutachten. über die Eignung von Lakosa-behandeltem Zeolith. zur Bindung freier Radikale
 Gutachten über die Eignung von Lakosa-behandeltem Zeolith zur Bindung freier Radikale Bericht Zl. 56/2018 Datum 18. Mai 2018 Auftraggeber Ausführung/ Gutachter Seitenanzahl 7 Lakosa Handels GmbH Hubdörfl
Gutachten über die Eignung von Lakosa-behandeltem Zeolith zur Bindung freier Radikale Bericht Zl. 56/2018 Datum 18. Mai 2018 Auftraggeber Ausführung/ Gutachter Seitenanzahl 7 Lakosa Handels GmbH Hubdörfl
Schwindreduzierung durch dauerhafte Nachbehandlung
 Schwindreduzierung durch dauerhafte Nachbehandlung Reduction of Shrinkage by Durable Curing,, Würselen, Germany Dipl.-Ing. Thorsten Schneider, Henkel Polybit Ltd., Sharjah. U.A.E. Esslingen, 18. Jan. 2007
Schwindreduzierung durch dauerhafte Nachbehandlung Reduction of Shrinkage by Durable Curing,, Würselen, Germany Dipl.-Ing. Thorsten Schneider, Henkel Polybit Ltd., Sharjah. U.A.E. Esslingen, 18. Jan. 2007
Grundbegriffe der Elektrotechnik
 Grundbegriffe der Elektrotechnik Inhaltsverzeichnis 1 Die elektrische Ladung Q 1 2 Die elektrische Spannung 2 2.1 Die elektrische Feldstärke E....................................................... 2 2.2
Grundbegriffe der Elektrotechnik Inhaltsverzeichnis 1 Die elektrische Ladung Q 1 2 Die elektrische Spannung 2 2.1 Die elektrische Feldstärke E....................................................... 2 2.2
Auswirkungen externer Streustromquellen auf Pipelinenetze
 Jahrestagung 2017 der BDEW- und DVGW-Landesgruppe Mitteldeutschland Auswirkungen externer Streustromquellen auf Pipelinenetze Begriffe - DIN EN ISO 8044 Fremdstromkorrosion Elektrochemische Korrosion als
Jahrestagung 2017 der BDEW- und DVGW-Landesgruppe Mitteldeutschland Auswirkungen externer Streustromquellen auf Pipelinenetze Begriffe - DIN EN ISO 8044 Fremdstromkorrosion Elektrochemische Korrosion als
Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz
 Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz Protokoll «A10 - AVOGADRO-Konstante» Martin Wolf Betreuer: Herr Decker Mitarbeiter: Martin Helfrich Datum:
Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz Protokoll «A10 - AVOGADRO-Konstante» Martin Wolf Betreuer: Herr Decker Mitarbeiter: Martin Helfrich Datum:
Auswirkung von Chloriden im Beton, Abhängigkeit von Betoneigenschaften
 Auswirkung von Chloriden im Beton, Abhängigkeit von Betoneigenschaften Prof. Dr.-Ing. Michael Raupach Institut für Bauforschung der RWTH Aachen,, 1 Einführung Stahl ist bekanntermaßen in ordnungsgemäß
Auswirkung von Chloriden im Beton, Abhängigkeit von Betoneigenschaften Prof. Dr.-Ing. Michael Raupach Institut für Bauforschung der RWTH Aachen,, 1 Einführung Stahl ist bekanntermaßen in ordnungsgemäß
Chem. Grundlagen. ure-base Begriff. Das Protonen-Donator-Akzeptor-Konzept. Wasserstoff, Proton und Säure-Basen. Basen-Definition nach Brønsted
 Der SäureS ure-base Begriff Chem. Grundlagen Das Protonen-Donator-Akzeptor-Konzept Wasserstoff, Proton und Säure-Basen Basen-Definition nach Brønsted Wasserstoff (H 2 ) Proton H + Anion (-) H + = Säure
Der SäureS ure-base Begriff Chem. Grundlagen Das Protonen-Donator-Akzeptor-Konzept Wasserstoff, Proton und Säure-Basen Basen-Definition nach Brønsted Wasserstoff (H 2 ) Proton H + Anion (-) H + = Säure
U-Wert Bestimmung für eine unbekannte Gebäudehülle mit dem gskin U-Value KIT der
 U-Wert Bestimmung für eine unbekannte Gebäudehülle mit dem gskin U-Value KIT der greenteg AG Dr. Zoltán Nagy, Architektur und Gebäudesysteme, ETH Zürich http://systems.arch.ethz.ch nagy@arch.ethz.ch +41
U-Wert Bestimmung für eine unbekannte Gebäudehülle mit dem gskin U-Value KIT der greenteg AG Dr. Zoltán Nagy, Architektur und Gebäudesysteme, ETH Zürich http://systems.arch.ethz.ch nagy@arch.ethz.ch +41
Einfluss von K 2 SO 4 auf das rheologische Verhalten von Zementleimen mit Fließmitteln
 Einfluss von K 2 auf das rheologische Verhalten von Zementleimen mit Fließmitteln Hana Kučerová Institut für Baustofftechnologie und Bauteile Technische Universität in Brno (CZ) Christiane Rößler F.A.
Einfluss von K 2 auf das rheologische Verhalten von Zementleimen mit Fließmitteln Hana Kučerová Institut für Baustofftechnologie und Bauteile Technische Universität in Brno (CZ) Christiane Rößler F.A.
Hinweise zu Betonkonsistenz 2016
 Hinweise zu Betonkonsistenz 2016 Beton-Sortenschlüssel Verdichtungsmass-Klasse Ausbreitmass-Klasse Klasse Verdichtungsmass Klasse Ausbreitmass (Durchmesser in mm) C0 1.46 F1 340 C1 1.45 1.26 F2 350 410
Hinweise zu Betonkonsistenz 2016 Beton-Sortenschlüssel Verdichtungsmass-Klasse Ausbreitmass-Klasse Klasse Verdichtungsmass Klasse Ausbreitmass (Durchmesser in mm) C0 1.46 F1 340 C1 1.45 1.26 F2 350 410
1 Einsatzgrenzen von ZM-Auskleidungen für den Trinkwassertransport
 1 Einsatzgrenzen von ZM-Auskleidungen für den Trinkwassertransport Der Einsatzbereich von ZM-Auskleidungen als Korrosionsschutz ist sehr weitreichend. Derartig ausgekleidete Rohre sind geeignet zum Transport
1 Einsatzgrenzen von ZM-Auskleidungen für den Trinkwassertransport Der Einsatzbereich von ZM-Auskleidungen als Korrosionsschutz ist sehr weitreichend. Derartig ausgekleidete Rohre sind geeignet zum Transport
1. Klausur Allgemeine und Anorganische Chemie B.Sc. Chemie
 1. Klausur Allgemeine und Anorganische Chemie B.Sc. Chemie Name: Vorname: Matrikel Nr.: 15.12.2010 Die Durchführung und Auswertung der 12 Aufgaben im zweiten Teil dieser Klausur mit je vier Aussagen (a-d)
1. Klausur Allgemeine und Anorganische Chemie B.Sc. Chemie Name: Vorname: Matrikel Nr.: 15.12.2010 Die Durchführung und Auswertung der 12 Aufgaben im zweiten Teil dieser Klausur mit je vier Aussagen (a-d)
FD und FDE - Betone. Prof. Dr.-Ing. R. Dillmann Institut für Bauphysik und Materialwissenschaft IBPM Universität Duisburg - Essen
 Institut für n FD und FDE - Betone Prof. Dr.-Ing. R. Dillmann Institut für Universität Duisburg - Essen 2004 Prof. Dr. Dillmann 1 Beton beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Institut für Für das sekundäre
Institut für n FD und FDE - Betone Prof. Dr.-Ing. R. Dillmann Institut für Universität Duisburg - Essen 2004 Prof. Dr. Dillmann 1 Beton beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Institut für Für das sekundäre
KKS mit Textilbeton. Dipl.-Ing. Amir Asgharzadeh Institut für Bauforschung RWTH Aachen / Deutschland
 KKS mit Textilbeton Dipl.-Ing. Amir Asgharzadeh Institut für Bauforschung RWTH Aachen / Deutschland Univ.-Prof. Dr.-Ing. Michael Raupach Institut für Bauforschung RWTH Aachen Deutschland Dipl. Chem. Detlef
KKS mit Textilbeton Dipl.-Ing. Amir Asgharzadeh Institut für Bauforschung RWTH Aachen / Deutschland Univ.-Prof. Dr.-Ing. Michael Raupach Institut für Bauforschung RWTH Aachen Deutschland Dipl. Chem. Detlef
(1) und ist bei unserem Versuch eine Funktion der Temperatur, nicht aber der Konzentration.
 Praktikum Teil A und B 15. AUFLÖSUNGSGESCHWINDIGKEIT Stand 11/4/1 AUFLÖSUNGSGESCHWINDIGKEIT EINES SALZES 1. ersuchsplatz Komponenten: - Thermostat - Reaktionsgefäß mit Rührer - Leitfähigkeitsmessgerät
Praktikum Teil A und B 15. AUFLÖSUNGSGESCHWINDIGKEIT Stand 11/4/1 AUFLÖSUNGSGESCHWINDIGKEIT EINES SALZES 1. ersuchsplatz Komponenten: - Thermostat - Reaktionsgefäß mit Rührer - Leitfähigkeitsmessgerät
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg
 TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg PROTOKOLL SEKUNDARSTUFE II Modul: Versuch: Elektrochemie 1 Abbildung 1:
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg PROTOKOLL SEKUNDARSTUFE II Modul: Versuch: Elektrochemie 1 Abbildung 1:
Klausur 12/1 Physik LK Elsenbruch Di (4h) Thema: elektrische und magnetische Felder Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung
 Klausur 12/1 Physik LK Elsenbruch Di 18.01.05 (4h) Thema: elektrische und magnetische Felder Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung 1) Elektronen im elektrischen Querfeld. Die nebenstehende Skizze
Klausur 12/1 Physik LK Elsenbruch Di 18.01.05 (4h) Thema: elektrische und magnetische Felder Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung 1) Elektronen im elektrischen Querfeld. Die nebenstehende Skizze
ME-METALS& ME-Plating
 ME-METALS& t e c h n o l o g i e s ME-Plating ME-Metals & Technologies liefert: Anodenkörbe (einschließlich Anodesäcke) Platinierte und Ir-Mischoxid-Anoden ME-CuTi Stromzuführungen und -Draht-Anoden Pb-
ME-METALS& t e c h n o l o g i e s ME-Plating ME-Metals & Technologies liefert: Anodenkörbe (einschließlich Anodesäcke) Platinierte und Ir-Mischoxid-Anoden ME-CuTi Stromzuführungen und -Draht-Anoden Pb-
Die Reaktion von Steinkohlen- Flugaschen in hydraulisch und karbonatisch aushärtenden Bindemitteln
 Bauforschung Die Reaktion von Steinkohlen- Flugaschen in hydraulisch und karbonatisch aushärtenden Bindemitteln T 2294 Fraunhofer IRB Verlag T 2294 Dieser Forschungsbericht wurde mit modernsten Hochleistungskopierern
Bauforschung Die Reaktion von Steinkohlen- Flugaschen in hydraulisch und karbonatisch aushärtenden Bindemitteln T 2294 Fraunhofer IRB Verlag T 2294 Dieser Forschungsbericht wurde mit modernsten Hochleistungskopierern
(Atommassen: Ca = 40, O = 16, H = 1;
 1.) Welche Molarität hat eine 14,8%ige Ca(OH) 2 - Lösung? (Atommassen: Ca = 40, O = 16, H = 1; M: mol/l)! 1! 2! 2,5! 3! 4 M 2.) Wieviel (Gewichts)%ig ist eine 2-molare Salpetersäure der Dichte 1,100 g/cm
1.) Welche Molarität hat eine 14,8%ige Ca(OH) 2 - Lösung? (Atommassen: Ca = 40, O = 16, H = 1; M: mol/l)! 1! 2! 2,5! 3! 4 M 2.) Wieviel (Gewichts)%ig ist eine 2-molare Salpetersäure der Dichte 1,100 g/cm
Der Mensch kann ohne Gold, nicht aber ohne Salz leben.
 Text aus Schroedel, Chemieheute: Chloralkali-Elektrolyse "Der Mensch kann ohne Gold, nicht aber ohne Salz leben." Dieser Satz stammt von dem römischen Geschichtsschreiber CASSIODORUS, der vor etwa 1500
Text aus Schroedel, Chemieheute: Chloralkali-Elektrolyse "Der Mensch kann ohne Gold, nicht aber ohne Salz leben." Dieser Satz stammt von dem römischen Geschichtsschreiber CASSIODORUS, der vor etwa 1500
Physikalische Chemie II (für Biol./Pharm. Wiss.) FS Lösung 7. Musterlösung zum Übungsblatt 7 vom
 Physikalische Chemie II (für Biol./Pharm. Wiss.) S 207 Lösung 7 Musterlösung zum Übungsblatt 7 vom 0.04.207 Diffusionspotential. Zu dieser Teilaufgabe vgl. Adam, Läuger, Stark, S. 326/327 und Skript I.3.3.
Physikalische Chemie II (für Biol./Pharm. Wiss.) S 207 Lösung 7 Musterlösung zum Übungsblatt 7 vom 0.04.207 Diffusionspotential. Zu dieser Teilaufgabe vgl. Adam, Läuger, Stark, S. 326/327 und Skript I.3.3.
SS Thomas Schrader. der Universität Duisburg-Essen. (Teil 8: Redoxprozesse, Elektrochemie)
 Chemie für Biologen SS 2010 Thomas Schrader Institut t für Organische Chemie der Universität Duisburg-Essen (Teil 8: Redoxprozesse, Elektrochemie) Oxidation und Reduktion Redoxreaktionen: Ein Atom oder
Chemie für Biologen SS 2010 Thomas Schrader Institut t für Organische Chemie der Universität Duisburg-Essen (Teil 8: Redoxprozesse, Elektrochemie) Oxidation und Reduktion Redoxreaktionen: Ein Atom oder
Referenzen im Bereich des Kathodischen Korrosionsschutzes von Stahl im Beton
 Referenzen im Bereich des Kathodischen Korrosionsschutzes von Stahl im Beton Tiefgarage Parkhaus Hügelstraße Darmstadt KKS an Decken, Stützen und Wänden (), Schutzfläche: rd. 6.000 m² 2009 2011 Prüfung
Referenzen im Bereich des Kathodischen Korrosionsschutzes von Stahl im Beton Tiefgarage Parkhaus Hügelstraße Darmstadt KKS an Decken, Stützen und Wänden (), Schutzfläche: rd. 6.000 m² 2009 2011 Prüfung
E3: Potentiometrische Titration
 Theoretische Grundlagen Als potentiometrische Titration bezeichnet man ein Analyseverfahren, bei dem durch Messung der Gleichgewichtsspannung einer galvanischen Kette auf die Menge des zu titrierenden
Theoretische Grundlagen Als potentiometrische Titration bezeichnet man ein Analyseverfahren, bei dem durch Messung der Gleichgewichtsspannung einer galvanischen Kette auf die Menge des zu titrierenden
Versuch 41: Viskosität durchgeführt am
 Physikalisch-chemisches Grundpraktikum Gruppe 6 Philipp von den Hoff Andreas J. Wagner Versuch 4: Viskosität durchgeführt am 26.05.2004 Zielsetzung: Ziel des Versuches ist es, die Viskosität von n-butan-2-ol
Physikalisch-chemisches Grundpraktikum Gruppe 6 Philipp von den Hoff Andreas J. Wagner Versuch 4: Viskosität durchgeführt am 26.05.2004 Zielsetzung: Ziel des Versuches ist es, die Viskosität von n-butan-2-ol
Physik für Naturwissenschaften (HS 2016) Lösungen
 Physik für Naturwissenschaften (HS 2016) Lösungen students4students info@students4students.ch 1 Inhaltsverzeichnis 1 Serie 1 1 1.1 Elektrostatisches Pendel....................... 1 1.1.1 Aufgabe............................
Physik für Naturwissenschaften (HS 2016) Lösungen students4students info@students4students.ch 1 Inhaltsverzeichnis 1 Serie 1 1 1.1 Elektrostatisches Pendel....................... 1 1.1.1 Aufgabe............................
Festlegung der Eigenschaften von Gärsaftabscheidern in Anlehnung DIN Inhalt
 Festlegung der Eigenschaften von Gärsaftabscheidern in Anlehnung DIN 11622 Inhalt Inhalt... 1 Abbildungsverzeichnis... 1 Tabelle B 1 Normenverzeichnis... 2 Tabelle B 2 Symbole... 2 Tabelle B 3 Expositionsklassen...
Festlegung der Eigenschaften von Gärsaftabscheidern in Anlehnung DIN 11622 Inhalt Inhalt... 1 Abbildungsverzeichnis... 1 Tabelle B 1 Normenverzeichnis... 2 Tabelle B 2 Symbole... 2 Tabelle B 3 Expositionsklassen...
Korrosion und Korrosionsschutz
 Korrosion und Korrosionsschutz Von Tobias Reichelt und Birte Schwan Teil A I. Einleitung II. Thermodynamik III. Kinetik Teil B I. Korrosionsarten (atmosphärischer Korrosion) II. Vermeidungsstrategien III.
Korrosion und Korrosionsschutz Von Tobias Reichelt und Birte Schwan Teil A I. Einleitung II. Thermodynamik III. Kinetik Teil B I. Korrosionsarten (atmosphärischer Korrosion) II. Vermeidungsstrategien III.
