PHYTOGENE ZUSATZSTOFFE IN DER TIERERNÄHRUNG
|
|
|
- Arthur Bernd Schwarz
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Aus dem Institut für Physiologie, Physiologische Chemie und Tierernährung der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München Geschäftsführender Vorstand: Prof. Dr. H.-J. Gabius Arbeit angefertigt unter der Leitung von Prof. Dr. W.A. Rambeck PHYTOGENE ZUSATZSTOFFE IN DER TIERERNÄHRUNG Inaugural-Dissertation zur Erlangung der tiermedizinischen Doktorwürde der tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München von Miriam Ehrlinger aus Nürnberg München 2007
2 Gedruckt mit Genehmigung der Tierärztliche Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München Dekan: Referent: Korreferent: Univ.-Prof. Dr. E.P. Märtlbauer Prof. Dr. Rambeck PD. Dr. Scholz Tag der Promotion: 9. Februar 2007
3 für meine Großeltern Rosa und Josef
4 INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG SCHRIFTTUM Futterzusatzstoffe Antibiotische Leistungsförderer Futterzusatzstoffe als Alternative zu antibiotischen Leistungsförderern Probiotika Prebiotika Organische Säuren Enzyme Seltene Erden Pflanzliche Futterzusatzstoffe Abgrenzung Phytobiotika zu Phytotherapeutika Rechtlicher Rahmen Sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe Alkaloide Amara Bitterstoffdrogen Flavonoide Alliine Saponine Gerbstoffe Schleimstoffe i
5 Scharfstoffe Ätherische Öle Technologische Eigenschaften von ätherischen Ölen Pansenstabilität von ätherischen Ölen Verfahren zum Nachweis pflanzlicher Zusatzstoffe Wirkungen pflanzlicher Zusatzstoffe im Allgemeinen In vitro-versuche Antimikrobielle Aktivität Antivirale Aktivität Anthelmintische Aktivität Beeinflussung der Mastleistung Beeinflussung der Stressempfindlichkeit Beeinflussung des Magen-Darm-Traktes Beeinflussung der Darmgesundheit Beeinflussung der Eubiose Beeinflussung der Nährstoffverdaulichkeit Beeinflussung der Pansenfermentation/ Methangasproduktion Sonstige Wirkungen auf den Magen-Darm-Trakt Antioxidative Wirkungen Beeinflussung des Immunsystems Beeinflussung der Qualität von tierischen Produkten Beeinflussung der Futteraufnahme Beeinflussung des Respirationstraktes Tabellarische übersicht über die Wirkungen pflanzlicher Zusatzstoffe ii
6 2.5 Wirkmechanismen und Resorption pflanzlicher Futterzusätze Wirkmechanismen pflanzlicher Futterzusätze Resorption pflanzlicher Futtermittelzusätze Resorption über den Verdauungstrakt Resorption über die Lunge Resorption über die Haut Pharmakologie von planzlichen Futtermittelzusätzen Pharmakokinetik von pflanzlichen Futterzusätzen Metabolismus von pflanzlichen Futterzusätzen Ausscheidung von pflanzlichen Futterzusätzen Probleme beim Einsatz pflanzlicher Zusatzstoffe in der Tierernährung Toxikologie und Nebenwirkungen Standardisierung Rückstandsbildung Pflanzliche Futtermittelzusätze auf dem Markt AUSBLICK ZUSAMMENFASSUNG SUMMARY LITERATURVERZEICHNIS ANHANG 1: WIRKUNGEN DER VERSCHIEDENEN ÄTHERISCHEN ÖLE iii
7 ANHANG 2: CHEMISCHE STRUKTUREN DER BESTANDTEILE ÄTHERISCHER ÖLE DANKSAGUNG LEBENSLAUF iv
8 TABELLENVERZEICHNIS Tabelle 1: Zuordnung und Zahl der gegenwärtig in der EU als Futterzusatzstoff zugelassenen Mikroorganismen 9 Tabelle 2: Kategorien von Zusatzstoffen 24 Tabelle 3: Tabelle 4: Tabelle 5: Prozentuale und relative Wiederfindung (%) der ätherischen Öle in den unterschiedlich behandelten Futtermischungen Anitimikrobielle Aktivität von Kräuterextrakten nach Wasser- und Ethanolextraktio bei drei verschiedenen Mikroorganismen Wirkungen pflanzlicher Zusatzstoffe bei äußerlicher und innerlicher Anwendung Tabelle 6: Antimikrobielle Wirkung einiger Kräuter in vitro im Vergleich zu Carbadox 54 Tabelle 7: Überblick über die antimikrobielle Wirksamkeit einiger ätherischer Öle 57 Tabelle 8: Überblick über die antimikrobielle Wirksamkeit einiger Bestandteile der ätherischen Öle 58 Tabelle 9: Antivirale Wirksamkeit einiger ätherischer Öle 61 Tabelle 10: Einsatz von Kräutern und ätherischen Ölen als Futterzusatzstoff (Literaturrecherche) 72 ff. Tabelle 11: Durchfallhäufigkeit in den Gruppen 83 v
9 Tabelle 12: Beeinflussung der Pansenfermentation durch Pflanzenzusätze und Sekundärmetaboliten bei ph 7,0 91 Tabelle 13: Beeinflussung der Pansenfermentation durch Pflanzenextrakte und Sekundärmetabolite bei ph 5,5 91 Tabelle 14: Tabelle 15: Tabelle 16: Auswirkungen der Zulage eine Futterzusatzes aus Eugenol und Zimtaldehyd auf den Proteinabbau und das Fettsäurenmuster Auswirkungen der Zulage eines Futterzusatzes aus Eugenol und Zimtaldehyd auf die unveresterten Fettsäuren im Blut Übersicht über die Wirkungen pflanzlicher Stoffe auf den Magen-Darm-Trakt f. Tabelle 17: Tabelle 18: Einfluss der Echinacea-Zulage auf die Entwicklung der Rotlauf-Antikörpertiter (Extinktion x 10-3 ) von Mastschweinen Fettsäurenmuster der Eidotterfette (%) der Gesamtfettsäuren) - Institutsversuch Tabelle 19: Fettsäurenmuster der Eidotterfette (%) der Gesamtfettsäuren) - Praxisversuch 115 Tabelle 20: Die Resultate der biochemischen Untersuchunge des Blutserums der Versuchstiere im Versuchszeitraum 121 Tabelle 21: Tabelle 22: Tabelle 23: Serumaktivitäten von LDH bei Pferden mit Influenza vor und nach einer vierwöchigen Behandlung mit einem Heilkräutergemisch Wirkungen von Bronchipret auf die Lungenfunktionsparameter und die semiquantitative Zytologie der bronchoalveoläre Lavage von fünf Pferden mit RAO Literaturauswertung der Wirkungen pflanzlicher Futtermittelzusätze ff. vi
10 Tabelle 24: Wiederfindung der ätherischen Öl-Komponenten Carvacrol und Thymol in den einzelnen Geweben 141 Tabelle 25: Pflanzliche Futterzusatzstoffe auf dem Markt 167 ff. vii
11 ABBILDUNGSVERZEICHNIS Abbildung 1: Bedeutung von Futterzusatzstoffen in der verschiedenen Wachstumsphasen von Nutztieren 4 Abbildung 2: Zusammensetzung von Gewürzpflanzen 26 Abbildung 3: Heterozyklische Ringsysteme als Grundkörper von Alkaloiden 28 Abbildung 4: Pregnanderivate als Bitterstoffe 29 Abbildung 5: Sesquiterpenbitterstoffe 30 Abbildung 6: Flavonoidglycoside 31 Abbildung 7: Alliin und seine Folgeprodukte 32 Abbildung 8: Polyuronide (Teilstrukturen) 35 Abbildung 9: Capsaicinoide 36 Abbildung 10: Inhaltsstoffe des Ingwers 37 Abbildung 11: Glucosinolate des Senfes 38 viii
12 Abbildung 12: Monoterpene vom p-menthan-typ als Bestandteile ätherischer Öle 39 Abbildung 13: Azyklische Monoterpene als Bestandteile ätherischer Öle 39 Abbildung 14: Bizyklische Monoterpene als Bestandteile ätherischer Öle 39 Abbildung 15: Phenylpropanderivate als Bestandteile ätherischer Öle 40 Abbildung 16: Wirkungen ätherischer Öle 41 Abbildung 17: Abbildung 18: Abbildung 19: Abbildung 20: Abbildung 21: Abbildung 22: Futteransatz von Kälbern, denen ein Milchersatz gefüttert wurde, der einerseits Antibiotika (MRA) und andererseits Enteroguard (MRE) enthielt Das Verhältnis zwischen Futterverwertung und Tageszunahmen nach Zusatz eines Leistungsförderers bzw. eines pflanzlichen Futtermittelzusatzes Größe der Peyer schen Platten im Ileum nach Zusatz eines Leistungsförderers, bzw. eines pflanzlichen Futtermittelzusatzes Summe aerobische Keime in den verschiedenen Darmabschnitten bei Schweinen der Kontrollgruppe und nach Zulage von ätherischen Ölen bzw. Avilamycin Summe der anaerobischen Keime in den verschiedenen Darmabschnitten bei Schweinen der Kontrollgruppe und nach Zulage von ätherischen Ölen bzw. Avilamycin Aktivität von Antioxidantien bei monogastrischen Tieren Abbildung 23 Antioxidative Kapazität von Rosmarin und Rosmarinextrakten (Oxyless U), Olivenöl, Olivenölextrakten und verschiedenen Teesorten 104 ix
13 Abbildung 24 Abbildung 25: Abbildung 26: Gehalte (mg) an ω-3-fettsäuren und α-linolensäure pro Ei (65 g mit 10% Rohfett) nach Zulage verschiedener Ölarten Futteraufnahme, Zuwachs und Proteinverwertung bei Mastschweinen mit und ohne Zulage vom 150 ppm Digestarom 1307 Mast Beispiel für die Biotransformationsschritte eines Phenylprobankörpers (Anethol) Abbildung 27: Metabolisierung von Monoterpenen 148 Abbildung 28: Vorgeschlagene Stoffwechselwege von trans-anethol bei Ratte und der Maus 153 Abbildung 29: Der Markt für Futterzusatzstoffe in Deutschland 166 x
14 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS Abkürzung: ALT AST ATPase bzw. C C 14 C Ca 2+ Cav. CFU C max CO 2 d d.h. dl DNA et al. g E EG EKG Begriff: Alaninaminotransferase Aspartataminotransferase Adenosintriphosphatase beziehungsweise Kohlenstoff Grad Celsius radioaktiv markierter Kohlenstoff Calciumionen Cavanilles Kolonie-bildende Einheiten maximale Konzentration eines Stoffes nach Verabreichung Kohlenstoffdioxid Tag das heißt Deziliter Desoxyribonucleinsäure und Mitarbeiter Gramm Einheiten Europäische Gemeinschaft Elektrokardiogramm xi
15 EU ETEC EWG FCR ff. FM FS GABA GH γ-gt h HSV HPLC Hrsg. IGF Ig G Ig M Il kg KG kj l L 3 LD 50 LDH Europäische Union enterotoxische Escherichia coli-bakterien Europäische Wirtschaftsgemeinschaft Feed convertion rate folgende Futtermittel Fettsäuren γ-aminobuttersäure Wachstumshormon γ-glutamyl-transferase Stunde Herpes simplex Virus Hochleistungs-Flüssigkeits-Chromatographie Herausgeber Insulin-like growth factor Immunglobulin G Immunglobulin M Interleukin Kilogramm Körpergewicht Kilojoule Liter drittes Larvenstadium Dosis, bei der 50% der Versuchstiere sterben Laktatdehydrogenase xii
16 log meq mg Mg2+ min ml ng µg µl mm mm/ mmol N N. Na n.b. NDF NEFA NFκB nm Nr. NSP OH PGE PGF 2α ppm Logarithmus Milliequivalent Milligramm Magnesiumionen Minute Milliliter Nanogramm Mikrogramm Mikroliter Milimeter Milimol Stickstoff Nervus Natrium nicht bekannt neutral detergent fiber unveresterte Fettsäuren Nekrosefaktor κb Nanometer Nummer Nicht-Stärke-Polysaccharide Hydroxylgruppe Prostaglandin E Prostaglandin F 2α parts per million xiii
17 PRRSV p. os RAO S Serum-AGP t T T3 T4 TM t max TNFα VC 50 VFA vs v/v z.b. Porcines Respiratorisches und Reproduktions Virus per os Recurrent Airway Obstruction Schwefel Serum-α1-Säure Glykoprotein Zeitpunkt Tonne Trijodthyronin Thyroxin Trockenmasse Zeitpunkt an dem ein Stoff in der maximalen Konzentration vorliegt Tumornekrosefaktor α Konzentration, bei der 50% der Viren abgetötet werden Flüchtige Fettsäuren versus Volumen/ Volumen zum Beispiel xiv
18 Einleitung 1 EINLEITUNG Im letzten Jahrhundert nahm die in Weltbevölkerung in einem besonders hohen Maß zu. Nach Schätzungen der WHO (2005) werden in etwa 25 Jahren auf der Erde nahezu neun Milliarden Menschen leben, die mit ausreichend Nahrung versorgt werden müssen. Das stellt ausgesprochen hohe Anforderungen an die Nahrungsmittelproduktion, welche, um diesen Erwartungen zu genügen, ein jährliches Wachstum von etwa 2% aufweisen müsste. Nachdem in den Entwicklungsländern nicht mit einem solchen Anstieg gerechnet werden darf, werden die Anforderungen an die Industrieländer umso höher gestellt (WENK, 2005). Ferner muss berücksichtigt werden, dass intensive Tierproduktion zu einer starken Belastung der Umwelt führt und somit auch die Verhinderung einer ökologischen Katastrophe zu einem der Hauptanliegen gehören muss. Es müssen also Wege gefunden und entwickelt werden welche die Effizienz der Tierproduktion steigern können, ohne dabei eine negative Beeinflussung der tierischen Produkte und der Umwelt zu bewirken. Seit Jahrzehnten werden deshalb Futterzusatzstoffe bei Nutztieren mit großem Erfolg zur Leistungsabsicherung und steigerung eingesetzt. Ihre Verwendung erfolgt inzwischen weltweit. Obwohl mit den verschiedenen Futterzusatzstoffen das gleiche Ziel erreicht werden soll, sind ihre Wirkungsweisen sehr unterschiedlich. Futterzusatzstoffe werden mit dem Ziel eingesetzt, die Gewichtszunahme bzw. die Futterverwertung zu verbessern. Ferner können sowohl die technologischen Eigenschaften als auch die Qualität von Futtermitteln und tierischen Produkten positiv beeinflusst werden (WENK, 2003). Nicht zuletzt wird dem Umweltaspekt Rechnung getragen, da durch die Zulage von bestimmten Futtermittelzusätzen eine Verringerung der tierischen Ausscheidungen und damit eine Reduzierung der Umweltbelastung erreicht werden kann (GOLLNISCH, 2002; JUGL-CHIZZOLA et al., 2003). Seit etwa 60 Jahren ist bekannt, dass die Verfütterung von antimikrobiellen Substanzen bei Nutztieren zu einer Steigerung der Lebendmassezunahme und einer Reduktion des Futteraufwandes führt. Allerdings waren in den letzen Jahren von diesen sogenannten Fütterungsantibiotika nur noch Salinomycin-Na, Flavophospholipol und Avilamycin zugelassen. Seit dem 1. Januar 2006 wurde nun auch diesen als 1
19 Einleitung Futterzusatz zugelassenen Antibiotika in der Europäischen Union die Zulassung entzogen. Ohnehin hatte das Interesse des Verbrauchers an ökologisch erzeugten Lebensmitteln und damit einer Fütterung der Nutztiere ohne chemisch-synthetische Zusätze in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Aus diesen Gründen wurde die Suche nach Alternativen zu den antibiotischen Leistungsförderern zunehmend verstärkt (JUGL- CHIZZOLA, 2003). In Frage kommen hierbei sowohl Probiotika, Prebiotika, organische Säuren, Enzyme und Seltene Erden als auch phytogene Zusatzstoffe wie Kräuter, Pflanzenteile sowie deren ätherische Öle. Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick über die zur Wirksamkeit pflanzlicher Futterzusatzstoffe vorhandene Literatur zu geben. Auch dem Wirkungsmechanismus, sowie der Resorption und Pharmakokinetik sollen in dieser Arbeit Beachtung geschenkt werden. Weiterhin soll kurz auf noch vorhandene Probleme in Bezug auf den Einsatz pflanzlicher Zusatzstoffe in der Nutztierhaltung und Möglichkeiten des Nachweises dieser Substanzen eingegangen werden. 2
20 Futterzusatzstoffe 2 SCHRIFTTUM 2.1 FUTTERZUSATZSTOFFE Nach dem Lebens- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) sind Leistungsförderer bzw. Futterzusatzstoffe nicht als Arzneimittel, sondern als Werkstoffe der Tierernährung zu betrachten. Sie fallen somit nicht unter die Bestimmungen des Arzneimittelgesetzes. Dennoch gibt es einige Futterzusätze, welche pharmakologische Wirkungen aufweisen, wie beispielsweise die sogenannten Leistungsförderer mit antibakterieller Wirkung, sowie Stoffe, die zur Prophylaxe bestimmter, verbreitet auftretender Erkrankungen wie der Coccidiose und der Histomoniasis eingesetzt werden (RICHTER und LÖSCHER, 2002). Leistungsförderer wurden früher auch als Wachstumsförderer bezeichnet, da man darunter Substanzen versteht, die zu einer Steigerung der Wachstumsrate und der Futterverwertung beitragen. Die bis zum 1. Januar 2006 noch zugelassenen Fütterungsantibiotika Salinomycin-Na, Flavophospholipol und Avilamycin durften ausschließlich als Leistungsförderer eingesetzt werden (RICHTER und LÖSCHER, 2002), um das Entstehen von Kreuzresistenzen mit den Antibiotika, die therapeutische Anwendung finden, zu verhindern. Auch einige Schwermetalle besitzen leistungsfördernde Effekte, beispielsweise Kupfer, das bei Schweinen noch bis zu einer Höchstmenge von 170 mg/ kg im Ferkelaufzuchtfutter, bzw. von 25 mg/ kg nach der 12. Lebenswoche zugelassen ist. Der Einsatz der Stoffgruppe der Anabolika, zu welcher man die Sexualhormone, die Wachstumshormone und die Gruppe der β-sympathomimetika zählt und die ebenfalls über starke leistungsfördernde Wirkungen verfügen, ist schon seit längerer Zeit innerhalb der Europäischen Union verboten (WENK, 2003). Daher sollen diese Stoffe in der vorliegenden Arbeit keinerlei Beachtung finden. Aufgrund der Probematik, die mit den klassischen Leistungsförderer verbunden ist, wurde die Suche nach und das allgemeine Interesse an Alternativen zu diesen Stoffen immer größer. Die Anforderungen, die an diese Alternativen gestellt werden, sind eine mit den Antibiotika vergleichbare Steigerung der Leistungsfähigkeit in Verbindung mit 3
21 Futterzusatzstoffe guter Verträglichkeit und geringem Gefahrenpotential, sowohl für den Tierbestand als auch für den Verbraucher. Unter den Futterzusatzstoffen werden den Probiotika, Prebiotika, organischen Säuren, Enzymen, Seltene Erden und der heterogenen Gruppe der pflanzlichen Stoffe eine besondere Bedeutung als Alternativen zu den antibiotischen Leistungsförderern zugeschreiben. Es muss berücksichtigt werden, dass die Auswahl des geeigneten Futterzusatzstoffes in erster Linie von dem Alter oder der Wachstumsphase, in der sich das Tier gerade befindet, abhängt. So spielen einige Futterzusätze während der Jungtierphase eine wichtige Rolle und andere in der Wachstums-Endphase, während wieder andere während der Zeitspanne des Fettansatzes von großer Bedeutung sind. Ebenso kann sich die Zielsetzung, die man durch den Einsatz eines Futtermittelzusatzes erreichen möchte, mit der Zeit verändern. Beispielsweise sind Antioxidantien während des Jungtierstadiums von großer Bedeutung, um das Tier vor oxidativem Stress zu schützen, während man in der Endphase der Mast durch den gleichen Futterzusatz die Qualität der tierischen Produkte verbessern möchte (WENK, 2003). Die Bedeutung von Futterzusatzstoffen unter Berücksichtigung der verschiedenen Wachstumsphasen wird in Abbildung 1 wiedergegeben. Abbildung 1: Bedeutung von Futterzusatzstoffen in den verschiedenen Wachstumsphasen von Nutztieren (WENK, 2005) 4
22 Antibiotische Leistungsförderer Antibiotische Leistungsförderer Fütterungsantibiotika sind Substanzen mikrobiellen Ursprungs, die in der Natur eigentlich nur in geringen Konzentrationen vorkommen. Ihre Wirkung richtet sich gegen andere Mikroorganismen, auf die sie wachstumshemmend bis letal wirken. Antibiotika können eine Reihe von unterschiedlichen bakteriellen Zielstrukturen und mechanismen beeinflussen. Dazu gehören Veränderungen der Enzyme der Zellwandbiosynthese, der Zellmembranen, der DNA-Replikation, der Proteinbiosynthese, der Transkription, der Translation und des Intermediärstoffwechsels (DOMIG, 2005). Neben der leistungsfördernden Wirkung konnte durch Zulage von Fütterungsantibiotika bei Schweinen auch eine Reduktion der Ausscheidung von Stickstoff, Phosphor und Gülle beobachtet werden, was zur Schonung der Umwelt beitrug (DOYLE, 2001). Nachdem Fütterungsantibiotika in Schweden bereits seit 1988 verboten sind und in Dänemark seit 1998 bei Mastschweinen bzw bei Ferkeln freiwillig auf den Zusatz verzichtet wird, trat am 1. Januar 2006 das EU-weite Verbot dieser Stoffe in Kraft. Davor wurden sie in sehr großem Umfang in Nutztierbeständen eingesetzt. Über lange Zeit hinweg waren sie fester Bestandteil in handelsüblichem Tierfutter. Im Schweinefutter, das zur Aufzucht und Anfangsmast eingesetzt wurde, machte ihr Anteil 1997 etwa 15% des Gesamtverbrauchs an Antibiotika bei Mensch und Tier innerhalb der EU aus (RICHTER und LÖSCHER, 2002). Fütterungsantibiotika entfalteten ihre Wirkung vor allem bei jungen wachsenden Schweinen und Rindern und zeigten besonders starke Leistungsverbesserungen, wenn die Tiere unter suboptimalen Klima- und Managementbedingungen gehalten wurden. Mit steigendem Alter reduzierte sich der positive Effekt und war in der Schlussphase der Mast oft gar nicht mehr erkennbar (WENK, 2003). Aus diesem Grund wurde von Fachleuten immer wieder darauf hingewiesen, dass durch den Einsatz von Leistungsförderern lediglich Hygienemängel kompensiert wurden und die in der Literatur angeführte Verbesserung der Gewichtsentwicklung um bis zu 10% und der Futterverwertung um 6% bei dem heute üblichen Hygienestandard nicht mehr zu erwarten war (RICHTER und LÖSCHER, 2002). 5
23 Antibiotische Leistungsförderer Trotz zahlreicher Untersuchungen konnte bis heute noch nicht restlos geklärt werden, worauf die leistungsfördernde Wirkung antimikrobieller Futterzusätze basiert. Vermutlich entwickeln sie ihre Aktivität im Magen-Darm-Trakt, bei Nicht-Wiederkäuern vor allem im Dünndarm. Indem das Wachstum von unerwünschten Mikroorganismen, die essentielle Nährstoffe verbrauchen bzw. unerwünschte oder toxische Substanzen bilden, unterdrückt wird, ergibt sich eine optimale Umgebung für die Mucosa (WENK, 2003), wodurch die Resorption von Nährstoffen erleichtert wird. Durch die verminderte mikrobielle Fermentation der Nährstoffe im Darm, bzw. durch die Beeinflussung der Fermentation im Pansen bei Wiederkäuern ergibt sich eine Steigerung der Verfügbarkeit von Energie und Nährstoffen. Das lymphatische System der Darmwände wird auf Grund der geringeren Toxin-Exposition entlastet. Dies wirkt einer übermäßigen Proliferation der Darmwände entgegen, was wiederum zu einer verbesserten Aufnahme der Nährstoffe aus dem Darm führt (RICHTER und LÖSCHER, 2002). In Versuchen mit Wachstumsförderern, die Chlortetracyclin, Penicillin und Sulfamethazin enthielten, konnte bei den behandelten Schweinen eine Erhöhung der Serumspiegel des Insulin-like Growth Faktor I beobachtet werden (HATHAWAY et al., 1996; HATHAWAY et al., 1999). Dies deutet darauf hin, dass die Wirkung von Antibiotika, in subtherapeutischen Dosierungen, über Effekte auf die Verdauung hinausgeht und metabolische Prozesse im ganzen Tier stimuliert. In den letzten Jahren wurden diese positiven Eigenschaften allerdings durch den immer größer werdenden Verdacht, dass antibiotische Leistungsförderer an der Entstehung von Resistenzen beteiligt sind, in den Hintergrund gedrängt (DOMIG, 2005). Parallel mit der Entdeckung und dem zunehmenden Einsatz antimikrobiell aktiver Substanzen entwickelten und verbreiteten sich antibiotikaresistente Bakterien in der Umwelt. Mittlerweile lassen sich resistente Bakterien aus allen Ökosystemen (Oberflächen- und Grundwasser, Erdboden, Pflanzen,...) isolieren, wobei die Häufigkeit der Resistenzen mit dem Einsatz der Antibiotika, insbesondere in der Humanmedizin, korreliert (FEUERPFEIL et al., 1999; KÜMMERER, 2004). Zwar besteht trotz einer intensiven wissenschaftlichen Diskussion keine einheitliche Meinung über den Zusammenhang zwischen der Verwendung von Antibiotika in der Tierzucht und der zunehmenden Entwicklung und Verbreitung von multiresistenten und human-pathogenen Bakterien (MCDERMOTT et al., 2002; PHILIPS et al., 2004), aber die Tatsache der Resistenzentwicklung, auch bei genetisch nicht verwandten Mikroorganismen, kann nicht vollständig geleugnet werden (MC DERMOTT, 2003). 6
24 Antibiotische Leistungsförderer Aus diesen Gründen wurde den antibiotischen Futterzusätzen, wie oben erwähnt, ab dem 1. Januar 2006 durch den Agrarministerrat die EU-weite Zulassung entzogen. Die ökologischen Folgen dieses Verbotes könnten enorm sein. So ist beispielsweise für die Kalbfleischproduktion eine Reduktion der Tageszunahmen um 7-8% und eine Vergrößerung des Futteraufwandes um 4-5% zu erwarten. In der Schweineproduktion kann, je nach Mastalter, von einer Reduktionen der Tageszunahmen von 2-8% und einer Steigerungen des Futteraufwandes um 1-5% ausgegangen werden (WENK, 2003). Um diese Probleme abzufangen, hat man sich vermehrt auf die Suche nach unbedenklichen Alternativen zu den Fütterungsantibiotika konzentriert. 7
25 Probiotika Futterzusatzstoffe als Alternative zu antibiotischen Leistungsförderern Probiotika Das Konzept des Probiotikaeinsatzes ist nahezu hundert Jahre alt und geht auf den Nobelpreisträger Elie Metschnikoff zurück. Bereits 1908 stellte er die These auf, dass Bakterien, die in fermentierten Milchprodukten enthalten sind, beim Menschen Fäulnisprozesse im Darm unterdrücken und der Ausbildung von Arteriosklerose entgegenwirken. Es dauerte einige Zeit, bis man herausfand, dass diese Wirkungen in erster Linie auf Lactobacillus acidophilus zurückzuführen waren (SIMON, 2005). Als besonders wirksam bei Menschen werden Stämme der Bakterienarten Lactobacillus acidophilus und Lactobacillus bifidus angesehen (DI RIENZO, 2000). Während man beim Menschen durch den Einsatz von Probiotika vor allem eine Stabilisierung der Gesundheit und Verlängerung des Lebens erreichen möchte, erfolgt der Einsatz in der Tierernährung meist mit einer kurzfristigeren Zielsetzung (SIMON, 2005). Probiotika werden in der Tierernährung vor allem bei Ferkeln und Kälbern, sowie bei Masthühnern eingesetzt. Am häufigsten wird für die Probiotika die Definition von FULLER (1989) verwendet. Er definiert die Probiotika als lebensfähige Formen von Mikroorganismen, die als Futterzusatzstoff appliziert werden und die auf Grund einer Unterstützung des Gleichgewichtes der Darmflora günstige Effekte für das Wirtstier haben. GIBSON und ROBERFROID (1995) definieren Probiotika als mikrobielle Nahrungs- bzw. Futterzusätze, die den Wirt positiv beeinflussen, indem sie für mikrobielle Ausgeglichenheit im Darm sorgen. Wirksame Probiotika stimulieren auf der einen Seite das Wachstum von nützlichen Bakterien im Gastrointestinaltrakt und unterdrücken andererseits durch kompetitiven Ausschluss das Wachstum pathogener Keime. Bei Wiederkäuern beispielsweise kann durch Hefekulturen das Wachstum von cellulosespaltenden Bakterien im Pansen stimuliert werden (DAWSON et al., 1990). Hinsichtlich der Anwendung von Probiotika als Futtermittelzusätze werden Anforderungen in Bezug auf deren Wirksamkeit wie auch auf Sicherheitsaspekte 8
26 Probiotika gestellt. Es darf weder die Gesundheit des Tieres, dem der Zusatz verabreicht wird, noch die der Personen, die mit dem Präparat umgehen, gefährdet sein. Probiotika müssen apathogen sein und es darf keine Toxinproduktion erfolgen. Sie dürfen nicht invasiv sein und keine Kontamination der tierischen Produkte verursachen. Auch muss die Förderung der Resistenzausbildung von Mikroorganismen durch den Einsatz der Probiotika ausgeschlossen werden können (SIMON, 2005). Tabelle 1 gibt die Zuordnung und Anzahl der gegenwärtig in der EU als Futterzusatz zugelassenen Mikroorganismen wieder. Tabelle 1: Zuordnung und Anzahl der gegenwärtig in der EU als Futterzusatzstoff zugelassenen Mikroorganismen (SIMON, 2005) Eizelner Mikroorganismus n Kombination von Mikroorganismen n Enterococcus faecium 6 Saccharomyces cerevisiae 5 Bacillus cereus 1 Lactobacillus farciminis 1 Pediococcus acidilactici 1 Lactobacillus casei Enterococcus faecium Enterococcus faecium ATTC Streptococcus infatarius Lactobacillus plantarum Enterococcus faecium Lactobacillus rhamnosus Bacillus licheniformis Bacillus subtilis Gesamt 14 Gesamt 5 n = Anzahl der zugelassenen Mikroorganismen Die meisten Untersuchungen zur Wirksamkeit von Probiotika liegen für Ferkel vor. Nach SIMON (2005) geht aus der Auswertung von über 40 publizierten Fütterungsversuchen hervor, dass in zwei Dritteln der Fälle sowohl für die Lebend- 9
27 Probiotika massezunahme als auch für den Futteraufwand eine numerische Verbesserung beobachtet werden konnte. Eine signifikante Reduzierung der Durchfallhäufigkeit bei Ferkeln konnte in den meisten Untersuchungen zur Wirksamkeit von Probiotika nachgewiesen werden, wobei es keine Rolle spielte, ob die Präparate Bacillus cereus, Enterococcus faecium oder Pediococcus acidilactici enthielten. Nach SIMON (2005) scheint für die Reduzierung der Durchfallhäufigkeit bei Aufzuchtsferkeln eine sehr frühe Verabreichung nach der Geburt bzw. an die Sau während Trächtigkeit und Laktation von großer Bedeutung zu sein. So konnte die Durchfallhäufigkeit im Vergleich zu den Kontrolltieren auf 10-50% reduziert werden. KYRIAKIS et al. (1999) konnten durch den Einsatz des Probiotikums LSP 122 (Alpharm) und Toyocerin in einem Ferkelaufzuchtsbetrieb mit Durchfallproblemen positive Effekt erzielen, wozu auch eine Verbesserung der Lebendmassezunahme und eine Senkung der Mortalität in jeweils signifikantem Umfang zählten. Durch Zusatz von Probiotika zu dem Futter kann man eine Modifizierung der mikrobiellen Besiedelung des Verdauungstraktes bewirken. Weiterhin können sekundäre Effekte erwartet werden, welche die Morphologie und Histologie der Darmschleimhaut (KLEIN und SCHMIDTS, 1997) und deren funktionelle Parameter des Nährstofftransportes (BREVES et al., 2000) betreffen. Die Wirkungsmechanismen von Probiotika bestehen nach DOYLE (2001) erstens aus der Anhaftung an die Darmmucosa, wodurch wiederum das Anhaften von pathogenen Keimen verhindert wird, zweitens aus der Produktion von bakteriellen Stoffen, wie Bakteriziden und organischen Säuren und drittens aus der Konkurrenz mit pathogenen Keimen um Nährstoffe. Weiterhin kann das Immunsystem durch Verfütterung von Probiotika stimuliert werden. 10
28 Prebiotika Prebiotika Eine weitere Gruppe alternativer Futtermittelzusatzstoffe, die durch das Verbot der Fütterungsantibiotika zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, sind die Prebiotika. Prebiotika wurden erstmals in Japan in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts mit dem Ziel eingesetzt, sowohl die Gesundheit als auch die Leistungsfähigkeit zu verbessern. Schon seit langer Zeit ist bekannt, dass Fructooligosaccharide günstige Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit besitzen (HIRAYAMA, 2002). Definitionsgemäß werden die Prebiotika, zu denen man auch die Fructooligosaccharide zählt, im vorderen Teil des Verdauungstraktes weder hydrolysiert noch absorbiert und stehen somit der intestinalen Flora im hinteren Verdauungstrakt als Substrat zur Verfügung (GIBSON und ROBERFROID, 1995). Prebiotika werden allgemein als unverdauliche Futterzusätze definiert, die einen günstigen Einfluss auf den Wirt ausüben, indem sie selektiv das Wachstum oder die Aktivität einer begrenzten Anzahl von Bakterien beeinflussen, die bereits im Darm angesiedelt sind und dadurch die Darmgesundheit verbessern. Prebiotika sind Oligosaccharide, zu denen Fructooligosaccharide, Oligofructose und Inulin zählen (KOCHER und SCHEIDEMANN, 2005). Sie werden in den hinteren Darmabschnitten selektiv durch Bakterienarten fermentiert, von denen eubiosefördernde Effekte zu erwarten sind. Durch die selektive Förderung bestimmter Keimarten und der positiven Beeinflussung der Dickdarmflora des Wirtstieres lassen sich gesundheitsfördernde und möglicherweise auch leistungssteigernde Wirkungen beim Einsatz in der Nutztierhaltung ableiten (ETTLE et al., 2005). Durch den Zusatz von Prebiotika sollen die Eubiose optimiert, die Verdauungskapazität verbessert und der Gesundheitsstatus des Tieres gesteigert werden. Der Prebiotikaeinsatz erscheint vor allem in der Ferkelaufzucht sinnvoll, da besonders beim Absatzferkel häufig Dysbiosen der Dickdarmflora auftreten können (AWAD- MASALMEH und WILLINGER, 1981). Mannanoligosaccharide beispielsweise, die aus den Zellwänden eines spezifischen Stammes von Saccharomyces cerevisiae gewonnen werden, sind in der Lage, die Besiedlung mit pathogenen Keimen zu verhindern, indem sie Typ-I Fasern blockieren, die den Pathogenen sonst das Anheften an die Darmwand ermöglichen würden (SPRING et al., 2000). 11
29 Prebiotika Um den Einfluss von Prebiotika auf das menschliche Immunsystem zu überprüfen, wurden Untersuchungen an Schweinen durchgeführt. Diese zeigten, dass Mannanoligosaccharide eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des darm-assoziierten Immunsystems spielen und die Struktur der Darmmucosa verbessern (KOCHER, 2004; MOURÃO et al., 2006; SMIRNOV et al., 2005). 12
30 Organische Säuren Organische Säuren Unter den organischen Säuren, die hier von Interesse sind, sind in erster Linie die Propion-, Ameisen-, Fumar-, Milch- und Citronensäure zu nennen. Auch deren Calcium-, Natrium- und Kaliumsalze kommen zum Einsatz, da sie den Vorteil bieten, im Gegensatz zu den freien Säuren in der Regel geruchlos, von fester Konsistenz bzw. weniger flüchtig und korrosiv zu sein, wodurch die technische Handhabung erleichtert wird (ROTH und ETTLE, 2005). Diese Säuren und ihre Salze werden schon seit mehreren Jahren erfolgreich in der Ferkelaufzucht eingesetzt (WENK, 2003). Die oben erwähnten organischen Säuren sind als besonders effektive Konservierungsmittel bekannt. Ein Teil der Wirkung beruht auf einer Erniedrigung des ph-wertes im Futter. Im Vergleich zu anorganischen Säuren liegt die Besonderheit der organischen Säuren darin, dass sie in undissoziierter Form durch die Zellmembran der Mikroorganismen in das Zytoplasma diffundieren können und erst im Inneren der Zelle dissoziieren. Dadurch wird das empfindliche ph-gleichgewicht der Zelle gestört und deren Enzyme und Transportsysteme für Nährstoffe beeinträchtigt (LÜCK, 1986). Organische Säuren können als Zusatzstoffe im Futter die Leistung von Schweinen verbessern (PARTANEN, 2001; ROTH und KIRCHGESSNER, 1998). In der Absatzphase haben Ferkel meist eine geringere Gewichtsentwicklung und Futteraufnahme und es kommt häufig zu Durchfallerkrankungen, so dass der leistungsfördernde Effekt der organischen Säuren in den ersten Wochen nach dem Absetzen besonders stark ausgeprägt ist (ROTH und ETTLE, 2005). Unter den Monocarboxylsäuren zeigen Ameisensäure, Milchsäure und Sorbinsäure eindeutige positive Auswirkungen auf die täglichen Zunahme (8-27%) und die Futterverwertung (2-8%). Essigsäure und Propionsäure hatten dagegen eine wesentlich geringere oder überhaupt keine Wirkung (ECKEL et al., 1992; KIRCHGESSNER und ROTH, 1982; KIRCHGESSNER et al., 1995; ROTH und KIRCHGESSNER 1988; ROTH et al., 1992). Neben den Monocarboxylsäuren werden auch noch andere organische Säuren, die als natürliche Verbindungen des zellulären Citratzyklus vorkommen, in der Ferkelfütterung eingesetzt, von denen insbesondere die Fumarsäure und die Citronensäure bereits seit längerer Zeit Verwendung finden (ROTH und ETTLE, 2005). In Fütterungs- 13
31 Organische Säuren versuchen konnte für Fumarsäure, Citronensäure und Apfelsäure eine Verbesserung des Gewichtszuwachses um 4-19% und der Futterverwertung um 5-9% festgestellt werden (KIRCHGESSNER und ROTH, 1976; KIRCHGESSNER und ROTH-MAIER, 1975; KIRCHGESSNER et al., 1992). Ferner wird die Energie im Futter über die organischen Säuren, die im Prozentbereich zugesetzt werden, erhöht, was ebenfalls berücksichtigt werden muss. Die Bruttoenergie schwankt in Abhängigkeit zu der Verbindung sehr stark und liegt zwischen etwa 6 kj/ g für Ameisensäure und 27 kj/ g für Sorbinsäure. Die Bruttoenergie kann in der Regel vollständig genutzt werden, da es sich bei den organischen Säuren um Stoffwechselbausteine handelt (ROTH und ETTLE, 2005). In Bezug auf den Wirkmechanismus organischer Säuren sind im wesentlichen drei verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, nämlich das Futter, der Verdauungstrakt und der intermediäre Stoffwechsel. Organische Säuren vermindern den ph-wert und die Pufferkapazität des Futters und beschleunigen durch die Erniedrigung des ph- Wertes im Magen die Resorption (ROTH und ETTLE, 2005). Da die Umwandlung von Pepsinogen in Pepsin erst bei einem ph-wert unter 5 erfolgt, und das Pepsin selbst sein Wirkungsoptimum erst bei ph-werten zwischen 3,5 und 2,0 entfaltet (TAYLOR 1959), ist diese Wirkung der organischen Säuren von großer Bedeutung. Die Verdaulichkeit von Protein und Energie konnte beispielsweise durch den Zusatz von Ameisensäure um bis zu 4 bzw. 2 Prozentpunkte verbessert werden, wobei die Effekte unmittelbar nach dem Absetzen am stärksten ausgeprägt waren (ECKEL et al., 1992). Organische Säuren verfügen weiterhin über antimikrobielle Eigenschaften (SINGH- VERMA, 1973). Auch die antimikrobielle Beeinflussung bleibt nicht auf das Futter beschränkt, sondern erstreckt sich bis in den Verdauungstrakt. Diese antimikrobiellen Effekte auf den Verdauungstrakt des Tieres stellen einen weiteren Wirkungspfad für die Steigerung des Wachstums durch organische Säuren dar, da durch Verminderung der intestinalen Flora dem Wirtstier mehr Nährstoffe und Energie zur Verfügung stehen. Durch diese Mechanismen wird ferner ein günstiger Einfluss auf die Effizienz des Stoffwechsels ausgeübt (ROTH und ETTLE, 2005). 14
32 Enzyme Enzyme Die Aufschlüsselung von hochverdaulichen Nährstoffen, wie Protein, Stärke und Fett ist von höchster Bedeutung für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit in der Nutztierhaltung. Exogene Enzyme werden eingesetzt, um die Verdauungskapazität vor allem von jungen oder kranken Tieren zu steigern. Als Beispiele können hier Carbohydrasen, welche die Verdauung von Kohlenhydraten verbessern, Proteinasen, welche die Ausnutzung von pflanzlichen Proteinen erhöhen und Lipasen, welche die Fettverdauung fördern, genannt werden. Ferner werden Phytasen, vor allem in Regionen mit ausgeprägter Intensivtierhaltung eingesetzt, um die Verfügbarkeit von Phosphor und anderen Mineralien zu erhöhen. Allgemein kann für den Einsatz von Enzymen gesagt werden, dass es bei Jungtieren besonders wichtig ist, dass die verwendeten exogenen Enzyme ähnliche Eigenschaften wie die endogen sezernierten aufweisen. Im Gegensatz dazu hängt die Auswahl bei adulten Tieren größtenteils von der Zusammensetzung des Futters ab (WENK, 2003). Phytasen werden zur Freisetzung des an Phytat gebundenen Phosphors eingesetzt. In Getreide, Hülsen- und Ölfrüchten liegen rund zwei Drittel des pflanzlichen Phosphors in gebundener Form vor. Um eine Abspaltung des Phosphors und damit dessen Verfügbarsein zu bewirken, muss dem Futter Phytase zugesetzt werden, da dieses Enzym im Magen-Darm-Trakt von Monogastriern nicht gebildet werden kann. Indem die Ausnutzung sowohl von organischen Stoffen als auch von Energie verbessert wird, sind günstige Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten, da dem Futter nun weniger Phosphor zugesetzt werden muss. Oftmals wird die Effizienz der Futterverwertung durch das Vorhandensein sogenannter Antinutritional Factors, beispielsweise durch Nicht-Stärke-Polysaccharide (NSP) limitiert (BEDFORD, 1995). Nicht-Stärke-Polysaccharide sind eine Stoffgruppe, die von Monogastriern nicht verwertet werden kann, da ihnen die zum Abbau nötigen Enzyme fehlen. Als Nicht-Stärke-Polysaccharide werden beispielsweise Cellulose, sowie Glycane und Pentosane bezeichnet, die insbesondere in den Zellwänden des Endosperms von Weizen, Roggen und Gerste gefunden werden. Die Pektine, welche vor allem in Nichtgetreide wie Soja, Raps und Sonnenblumen vorkommen, stellen eine weitere wichtige Fraktion der Nicht-Stärke-Polysaccharide dar. Nicht-Stärke- 15
33 Enzyme Polysaccharide besitzen, wie oben bereits erwähnt, antinutritive Eigenschaften (BEDFORD, 1995). Sie wirken über einen sogenannten Käfig-Effekt, d.h. sie kapseln als Zellwandkomponenten die Nährstoffe ein und bilden damit eine Barriere zwischen dem Verdauungstrakt und den Substraten (SCHURZ, 1997). Folglich können hochverdauliche Nährstoffe wie Proteine, Stärke und Fett nicht mehr aufgeschlossen werden. Nicht-Stärke-Polysaccharide verfügen über ein hohes Quell- und Wasserbindungsvermögen (JEROCH, 1991), weswegen es zu einer reduzierten Durchmischung des Darminhaltes mit körpereigenen Enzymen und einer herabgesetzten Diffusion von Substraten kommt (FENGLER und MARQUART, 1988). Durch den Zusatz NSP-spaltender Enzyme kann eine Steigerung der Verwertung vieler Futtermittel erreicht werden. Durch Einsatz dieser Enzyme können nicht nur die Nicht-Stärke-Polysaccharide als Nährstoffe verwertet werden, sondern es erfolgt ebenso die Beseitigung der oben genannten antinutritiven Faktoren. In der Schweinefütterung konnte durch Enzymzusatz die Futteraufnahme um 0,7-2,8% gesteigert werden. Die Zunahmen waren sowohl im Bereich der Vormast als auch im Bereich der Endmast um 4,2-10,5% bzw. um 3,3-5,1% erhöht und es konnte eine Reduktion des Futteraufwandes um 1,7-7,4% in der Vormast und um 2,4-3,3% in der Hauptmast erreicht werden (HABERER und SCHULZ, 1998). 16
34 Seltene Erden Seltene Erden In China werden bereits seit mehreren Jahrzehnten Seltene Erden zur Leistungssteigerung und absicherung von landwirtschaftlichen Nutztieren eingesetzt. Sie könnten in der Tierproduktion, und da insbesondere in der Mastschweinehaltung, als eine neue, sichere und kostengünstige Alternative zu den Fütterungsantibiotika von Interesse sein (RAMBECK und WEHR, 2005). Zu den seltenen Erden gehören 17 Übergangsmetalle aus der dritten Nebengruppe des Periodensystems. Dabei handelt es sich um die Elemente Lanthan, Scandium und Yttrium, sowie die Lanthanoide, welche die 14 auf das Lanthan folgenden Elemente darstellen (WEHR et al., 2005). Ungefähr 80% der weltweiten Ressourcen an Seltenen Erden befinden sich in China, dem diesbezüglichen Hauptproduzenten auf dem Weltmarkt (BROWN et al., 1990; PANG et al., 2002). Seltene Erden gehen hauptsächlich ionische Bindungen ein. Lanthanoidionen können auf Grund ihrer ähnlichen chemischen Eigenschaften und Ionenradien Ca 2+ -Ionen in vielen Strukturen isomorph ersetzen (BIRNBAUM et al., 1970; EVANS, 1990). Nach EVANS (1983) zeigen weder Calcium noch Lanthan signifikante kovalente Bindungen, können jedoch Komplexverbindungen mit Komplexzahlen von 6 bis 12 ausbilden, wobei Chelatbindungen vorherrschen. In wässrigen Lösungen bilden sich um die Ionen der Seltenen Erden Hydrathüllen (EVANS, 1990). Seltene Erden können biologische Membranen über membran-assoziierte Enzyme und neuromuskuläre Funktionen beeinflussen. Sie sind in der Lage, sich an Membranproteine zu binden, können aber auch in gesunde Zellen eindringen (EVANS, 1990). In vitro reagieren Lanthanoide mit den unterschiedlichsten Zellbestandteilen wie Nucleoproteinen, Plasmaproteinen, Aminosäuren, Phospholipiden, Enzymen, intermediären Metaboliten und inorganischen Phosphaten (DAS et al., 1988). Die Wirkungen von Lanthan-Ionen sind sehr vielfältig: Sie sind in der Lage, die Mg 2+ - ATPase sowie die Cholinesterase zu hemmen und sie können die Kinase C aktivieren (WADKINS et al., 1998). Sie bewirken eine Freisetzung von Neurotransmittern in Neuronen, blockieren jedoch an gleicher Stelle die Ca 2+ -abhängige Freisetzung von Neurotransmittern (PRZYWARA et al., 1992; VACCARI et al., 1999). Ferner besitzen sie die Fähigkeit, die Ca 2+ -ATPase im sarkoplasmatischen Retikulum der 17
35 Seltene Erden Skelettmuskulatur zu hemmen (VAN DER LAARSE et al., 1995), sowie die Kontraktion der glatten intestinalen Muskulatur zu unterdrücken. Dies erfolgt über Kompetition mit Ca 2+ um die Bindungsstellen (WEISS und GOODMAN, 1963). Weiterhin wird die Kontraktion des Herz- (FAWZI und MCNEILL, 1985) und der Skelettmuskulatur (HOBER und SPAETH, 1914) gedämpft. Auch eine Steigerung der Zellproliferation und eine Induktion der Apoptose kann beobachtet werden (GREISBERG et al., 2001). Neben ihrem Einsatz in der Industrie, im Glas- und Keramiksektor, der Elektronik und als Dünger werden Seltene Erden auch in der Medizin eingesetzt. Hierfür wurden antikoagulatorische, antiemetische, antituberkulöse, antiinflammatorische und antikanzerogene Wirkungen beschrieben (ELLIS, 1977; EVANS, 1990, LIU et al, 1999; WANG et al., 2003). Vor einiger Zeit konnte in humanmedizinischen Studien die Phosphatbindungsfähigkeit von Lanthan-Carbonat bestätigt werden, was den Einsatz dieses Stoffes bei der Behandlung von Dialyse-Patienten, in Form des Präparates Fosrenol, ermöglicht hat (DAMMENT und WEBSTER, 2003). Durch Verwendung hoher Konzentrationen Seltener Erden kommt es zu einer Wachstumshemmung von Bakterien, Pilzen und Hefen, wohingegen niedrige Konzentrationen auf das Bakterienwachstum stimulierend wirken (MUROMA, 1958). ZHANG et al. (2000) untersuchten die Wirkung von Cerium-Huminsäure und Cerium- Citrat auf verschiedene Bakterienpopulationen und stellten dabei gänzlich verschiedene bakteriostatische Wirkungen fest. Während das Bakterienwachstum durch Cerium-Huminsäure gehemmt wurde, führte Cerium-Citrat zu einer Stimulierung des bakteriellen Wachstums. Dies weist darauf hin, dass die Verbindungen und chemischen Eigenschaften der Komplexe vollkommen unterschiedlich sind. Nach ZHANG et al. (2000) ist die antibakterielle Aktivität umso größer, je niedriger die Stabilität der Salze der Seltenen Erden ist. Um zu untersuchen, ob auch unter westlichen Haltungsbedingungen eine entsprechende Leistungssteigerung möglich ist, wurden in den letzten Jahren auch im europäischen Raum zahlreiche Fütterungsversuche durchgeführt. RAMBECK et al. (1999) untersuchten die Wirkungen eines Zusatzes aus Seltenen Erden auf Leistung und Futterverwertung bei Absatzferkeln und konnten hier die beschriebene Leistungssteigerung und Verbesserung der Futterverwertung bestätigen. 18
36 Seltene Erden Wie bei vielen alternativen Futterzusatzstoffen ist auch bei den Seltenen Erden der genaue Wirkmechanismus bislang nicht vollständig geklärt. Ein Einflussfaktor scheint jedoch die Art des Anions zu sein, an welches die seltenen Erden gebunden werden (WEHR et al., 2005). 19
37 Pflanzliche Futterzusatzstoffe 2.2 PFLANZLICHE FUTTERZUSATZSTOFFE Bei der Suche nach Alternativen zu den antibiotischen Futtermittelzusätzen sind in den letzten Jahren immer mehr pflanzliche Stoffe in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Diese spielen bereits seit Jahrhunderten in Asien und bei den amerikanischen Ureinwohnern eine bedeutende Rolle zur Stabilisierung der Gesundheit und Ernährung des Menschen (BYE und LINARES, 1999). Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe pflanzliche bzw. phytogene Futterzusätze, Kräuter, Phytobiotika, Gewürze und ätherische Öle häufig synonym verwendet (WALD, 2003). Pflanzliche Zusatzstoffe werden als Kräutermischungen oder als Aromazusätze auf den Markt gebracht (JUGL-CHIZZOLA, 2003). Man unterscheidet zwischen verarbeiteten Ganzpflanzen, wie Gewürzen und Kräutern, Pflanzenteilen, wie Samen, Früchten und Wurzeln und Extrakten aus Ganzpflanzen, bzw. Pflanzenteilen (WENK, 2005). Die ätherischen Öle können entweder mit Hilfe von Wasserdampf oder Ethanol extrahiert werden, wobei die Extraktionsmethode einen großen Einfluss auf die Konzentration und die Wirksamkeit besitzt. Auf diesen Aspekt wird im Kapitel Technologische Eigenschaften von ätherischen Ölen näher eingegangen. Leider fehlen zu dieser umfassenden Thematik noch viele wissenschaftliche Grundlagen und eine systematische Erfassung wird durch die Vielzahl der Pflanzen, für die pharmakologische Wirkungen angenommen werden, sowie durch deren stark variierende Zusammensetzung erschwert (CHRISTOPH, 2001; SCHMIDT, 1998). Da sich die Wirksamkeit oft nicht auf einzelne Substanzen zurückführen lässt, sind die wirksamkeitsbestimmenden Substanzen häufig unbekannt oder als solche nicht zu identifizieren (JANSSEN et al., 1986). Phytogene Zusatzstoffe weisen selbst keinen Nährstoff-, Mineralstoff- oder Vitamincharakter auf, besitzen aber die Fähigkeit auf Grund ihrer aromatischen und funktionellen Eigenschaften einen positiven Einfluss auf die tierischen Leistungen auszuüben (WALD, 2003; WESTENDARP, 2003). WENK (2003) beschreibt Wirkungen der pflanzlichen Futterzusatzstoffe auf die Futteraufnahme, auf die Sekretion der Verdauungsenzyme und auf das Immunsystem ebenso wie mögliche antibakterielle, kokzidiostatische, antivirale, entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften. Die einzelnen Wirkungen dieser 20
38 Pflanzliche Futterzusatzstoffe Futterzusatzstoffe werden in den Kapitel bis in ausführlicher Form abgehandelt. 21
39 Abgrenzung Phytobiotika zu Phytotherapeutika Abgrenzung Phytobiotika zu Phytotherapeutika Phytogene Substanzen haben nicht nur in der Tierernährung, sondern auch im Rahmen der Veterinärmedizin an Bedeutung gewonnen. Der Begriff der Phytotherapie wurde von dem französischen Arzt Henri Leclerc ( ) geprägt. Hierzu zählt man, neben der medizinischen Anwendung von Pflanzen, die Phytochemie, die Phytopharmazie sowie die Phytopharmakologie und toxikologie. Bei LÖSCHER und RICHTER (2002) wird der Begriff Phytotherapeutikum folgendermaßen definiert: Phytotherapeutika bestehen ausschließlich aus pflanzlichen Bestandteilen. Pflanzen und Pflanzenteile wie Blüten (Flores), Blätter (Folia) und Wurzeln (Radix), in getrockneter Form als Drogen bezeichnet, dienen als Ausgangsmaterial für Arzneizubereitungen wie Preßsäfte, Extrakte, Tinkturen, die wirksame Bestandteile von Fertigarzneimitteln sind. Es handelt sich folglich um die gleichen Stoffe und Substanzen, die in der Tierernährung als Futterzusatzstoffe eingesetzt werden. Die Differenzierung zwischen dem Einsatz phytogener Substanzen als Futtermittelzusatz und als Arznei ist von großer Wichtigkeit, da pflanzliche Futterzusatzstoffe, die nicht mit dem Ziel der Krankheitsvorbeugung oder Therapie eingesetzt werden, nicht den Vorschriften der Arzneibücher entsprechen müssen. Damit dürfen sie nur zu den in der Verordnung (EG) 1831/2003 festgelegten Zwecken angewendet werden. Auf den rechtlichen Rahmen und die Einsatzmöglichkeiten pflanzlicher Futterzusatzstoffe wird in dem folgenden Kapitel genauer eingegangen. 22
40 Rechtlicher Rahmen Rechtlicher Rahmen Bis zum Oktober 2004 wurden Kräuter, Pflanzenextrakte und ätherische Öle als natürlich vorkommende Substanzen futtermittelrechtlich in der Richtlinie 70/524/EWG in Anlage 3, Absatz 3 geregelt. Sie wurden hierbei in den Bereich der Zusatzstoffe und dort wiederum in die Gruppe der Aroma- und appetitanregenden Stoffe eingeordnet. Für die Anerkennung als Futterzusatzstoff reichte eine Gruppenzulassung aus, weshalb die phytogenen Zusatzstoffe bis dahin kein amtliches Registrierungsverfahren durchlaufen mussten. Von den Herstellern wurden keine Studien über Wirksamkeit, Toxizität und Analysemethoden verlangt. Futterzusätze durften also bis dato mit dem Zweck der Leistungsförderung ohne Einschränkungen eingesetzt werden. Für den therapeutischen oder krankheitsvorbeugenden Einsatz, den die Produzenten oftmals angeführt haben, bestand hingegen auch damals schon keine Zulassung (GOLLNISCH, 2002). Auf Grund der Schwachstellen der bis dahin geltenden Richtlinie wurde sie am 19. Oktober 2003 von der Verordnung (EG) Nr. 1831/ 2003 des Europäischen Parlaments und des Rates von 22. September 2003, die am 19. Oktober 2004 verkündet wurde, abgelöst. In Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1831/ 2003 sind Futtermittelzusätze als Stoffe, Mikroorganismen oder Zubereitungen, die keine Futtermittelausgangserzeugnisse oder Vormischungen sind und die bewusst Futtermitteln oder Wasser zugesetzt werden, um insbesondere eine oder mehrere der in Artikel 5 Absatz 3 genannten Funktionen zu erfüllen, definiert. Ein Zusatzstoff muss: a) die Beschaffenheit des Futters positiv beeinflussen b) die Beschaffenheit tierischer Erzeugnisse positiv beeinflussen c) die Farbe von Zierfischen und vögeln positiv beeinflussen d) den Ernährungsbedarf der Tiere decken e) die ökologischen Folgen der Tierproduktion positiv beeinflussen 23
NEO - DYS NEO - DYS. - der verdauungs- und appetitanregende phytogene Bio-Regulator für Schweine NEO - DYS NEO - DYS 50. erfolgreich füttern
 - der verdauungs- und appetitanregende phytogene Bio-Regulator für Schweine 50 erfolgreich füttern Phyto-Dings - Was ist das eigentlich? Phytogene Zusatzstoffe = sekundare Inhaltsstoffe von Pflanzen Alternativen
- der verdauungs- und appetitanregende phytogene Bio-Regulator für Schweine 50 erfolgreich füttern Phyto-Dings - Was ist das eigentlich? Phytogene Zusatzstoffe = sekundare Inhaltsstoffe von Pflanzen Alternativen
Phytobiotika für wachsende Kälber. Carina Schieder Product Manager, Phytogenics
 Phytobiotika für wachsende Kälber Carina Schieder Product Manager, Phytogenics Photo: Fredleonero 2 Science & Solutions 200 Carina Schieder Produkt Manager, Phytobiotika Phytobiotika 150 100 50 25 für
Phytobiotika für wachsende Kälber Carina Schieder Product Manager, Phytogenics Photo: Fredleonero 2 Science & Solutions 200 Carina Schieder Produkt Manager, Phytobiotika Phytobiotika 150 100 50 25 für
Neue Futtermittel für f r die Ernährung der Schweine! Wo liegen die Chancen?
 Neue Futtermittel für f r die Ernährung der Schweine! Wo liegen die Chancen? W. Rambeck, U. Wehr Institut für Physiologie, Physiologische Chemie und Tierernährung Ludwig-Maximilians-Universität München
Neue Futtermittel für f r die Ernährung der Schweine! Wo liegen die Chancen? W. Rambeck, U. Wehr Institut für Physiologie, Physiologische Chemie und Tierernährung Ludwig-Maximilians-Universität München
Rahmenbedingungen der Tierernährung Politik Fokussierung Fokussierungauf auf Verbraucherschutz Verbraucherschutzund und Lebensmittelqualität Lebensmit
 Dr. H. Westendarp Fachgebiet Tierernä Tierernährung Bedeutung phytogener Stoffe in einer modernen & anspruchsvollen Ernährung der Nutztiere 23.11.2007 in Nürtingen 1 GLIEDERUNG 1. Definition 2. Rechtliche
Dr. H. Westendarp Fachgebiet Tierernä Tierernährung Bedeutung phytogener Stoffe in einer modernen & anspruchsvollen Ernährung der Nutztiere 23.11.2007 in Nürtingen 1 GLIEDERUNG 1. Definition 2. Rechtliche
10 Fragen zu. Levucell SC. 10 Fragen zu Levucell SC
 10 Fragen zu Levucell SC 1 Was ist Levucell SC? 2 Wie wurde Levucell SC entwickelt? 3 Warum wurde Levucell SC entwickelt? 4 Wie wirkt Levucell? 5 Welche positiven Effekte sind zu erwarten? 6 Ergebnisse
10 Fragen zu Levucell SC 1 Was ist Levucell SC? 2 Wie wurde Levucell SC entwickelt? 3 Warum wurde Levucell SC entwickelt? 4 Wie wirkt Levucell? 5 Welche positiven Effekte sind zu erwarten? 6 Ergebnisse
Einfluss von Zeolith und einem Milchsäurebakterien- Präparat auf Futteraufnahme und Milchleistung sowie Nährstoffverdaulichkeit von Milchkühen
 Einfluss von Zeolith und einem Milchsäurebakterien- Präparat auf Futteraufnahme und Milchleistung sowie Nährstoffverdaulichkeit von Milchkühen DI M. Urdl, DI A. Patz LFZ Raumberg-Gumpenstein 40. Viehwirtschaftliche
Einfluss von Zeolith und einem Milchsäurebakterien- Präparat auf Futteraufnahme und Milchleistung sowie Nährstoffverdaulichkeit von Milchkühen DI M. Urdl, DI A. Patz LFZ Raumberg-Gumpenstein 40. Viehwirtschaftliche
Fermentation mit SCHAUMALAC FEED. Dirk Breul
 Fermentation mit SCHAUMALAC FEED Dirk Breul Fermentation mit SCHAUMALAC FEED Welcher Beitrag kann zur Steigerung der Futtereffizienz geleistet werden? 2 Fermentation Enzymatische Umwandlung von organischen
Fermentation mit SCHAUMALAC FEED Dirk Breul Fermentation mit SCHAUMALAC FEED Welcher Beitrag kann zur Steigerung der Futtereffizienz geleistet werden? 2 Fermentation Enzymatische Umwandlung von organischen
Sauen/Ferkel/Mast Bullen
 2017 Sauen/Ferkel/Mast Bullen AGRO Agrarhandel GmbH- Aussiedlerhof 2-36137 Großenlüder Telefon: 06648-95220 Telefax: 06648-952214 www.agro-spezialfuttermittel.de Das GREEN Konzept: Was wird erreicht? -
2017 Sauen/Ferkel/Mast Bullen AGRO Agrarhandel GmbH- Aussiedlerhof 2-36137 Großenlüder Telefon: 06648-95220 Telefax: 06648-952214 www.agro-spezialfuttermittel.de Das GREEN Konzept: Was wird erreicht? -
EM Einsatz in der Tierernährung, Kotwasser und Koliken bei Pferden
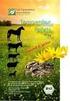 EM Einsatz in der Tierernährung, Kotwasser und Koliken bei Pferden Ablauf Was ist EM? Was macht EM? Wirkungsweise von EM im Boden Analogie zum Darm EM in der Verdauung Einsatz in der Tierernährung EM Einsatz
EM Einsatz in der Tierernährung, Kotwasser und Koliken bei Pferden Ablauf Was ist EM? Was macht EM? Wirkungsweise von EM im Boden Analogie zum Darm EM in der Verdauung Einsatz in der Tierernährung EM Einsatz
DER WEG ZUM WOHLBEFINDEN
 DER WEG ZUM WOHLBEFINDEN ASEA VIA Die Gesundheit hängt langfristig von der richtigen Ernährung ab. Aber selbst die sorgfältigste Auswahl an Lebensmitteln versorgt Dich vielleicht nicht mit den notwendigen
DER WEG ZUM WOHLBEFINDEN ASEA VIA Die Gesundheit hängt langfristig von der richtigen Ernährung ab. Aber selbst die sorgfältigste Auswahl an Lebensmitteln versorgt Dich vielleicht nicht mit den notwendigen
für Wirkstoffe in der Tierernährung
 ARBEITSGEMEINSCHAFT für Wirkstoffe in der Tierernährung Der Einsatz von Futterzusatzstoffen in der ökologischen/biologischen Tierproduktion im Einklang mit der EU VERORDNUNG (EG) Nr. 889/2008 und (EG)
ARBEITSGEMEINSCHAFT für Wirkstoffe in der Tierernährung Der Einsatz von Futterzusatzstoffen in der ökologischen/biologischen Tierproduktion im Einklang mit der EU VERORDNUNG (EG) Nr. 889/2008 und (EG)
zur Unterstützung des Magen-Darm-Traktes
 zur Unterstützung des Magen-Darm-Traktes Die Wirkstoffe Prebiotika bzw. Ballaststoffe aus Apfelfasern, Chicorée-Wurzel und Maltodextrin Probiotika von Lactobacillus Rhamnosus Lactobacillus Acidophilus
zur Unterstützung des Magen-Darm-Traktes Die Wirkstoffe Prebiotika bzw. Ballaststoffe aus Apfelfasern, Chicorée-Wurzel und Maltodextrin Probiotika von Lactobacillus Rhamnosus Lactobacillus Acidophilus
Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau FACHINFORMATIONEN. Versuchsbericht
 Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau Versuchsbericht Untersuchung zum Einsatz von Seltenen Erden in der Ferkelfütterung FACHINFORMATIONEN Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Arbeitsgruppe:
Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau Versuchsbericht Untersuchung zum Einsatz von Seltenen Erden in der Ferkelfütterung FACHINFORMATIONEN Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Arbeitsgruppe:
Zusätzliche Informationen
 MILCHSÄUREKULTUREN MINERALSTOFFE 6 Milchsäure Anleitung LP Die Lernenden wissen, dass im Körper und in Nahrungsmitteln verschiedene Bakterien vorkommen und dass Nahrungsmittel damit angereichert werden.
MILCHSÄUREKULTUREN MINERALSTOFFE 6 Milchsäure Anleitung LP Die Lernenden wissen, dass im Körper und in Nahrungsmitteln verschiedene Bakterien vorkommen und dass Nahrungsmittel damit angereichert werden.
AF 710 gekapselte Futtersäuren. Eine neue Generation der Futtersäuren
 gekapselte Futtersäuren Eine neue Generation der Futtersäuren Thematik allgemein Vertrieb Deutschland: R&G Agrar Ltd. & Co. KG Fachberatung Vertrieb Süd-/Ostdeutschland, Österreich, Schweiz Vertrieb Nord-/Westdeutschland,
gekapselte Futtersäuren Eine neue Generation der Futtersäuren Thematik allgemein Vertrieb Deutschland: R&G Agrar Ltd. & Co. KG Fachberatung Vertrieb Süd-/Ostdeutschland, Österreich, Schweiz Vertrieb Nord-/Westdeutschland,
Gemeinschaftsregister der Futtermittelzusatzstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003
 Gemeinschaftsregister der Futtermittelzusatzstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 Erläuterungen (Stand: Veröffentlichung im Noember 2006) [Rev. 6] Direktion D Tiergesundheit und Tierschutz Referat
Gemeinschaftsregister der Futtermittelzusatzstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 Erläuterungen (Stand: Veröffentlichung im Noember 2006) [Rev. 6] Direktion D Tiergesundheit und Tierschutz Referat
Der Einsatz von Probiotika lohnt sich. Geflügelernährung. Der Autor Dr. Detlef Kampf
 Fotos: agrarfoto (2), orffa (2) Geflügelernährung Der Einsatz von Probiotika lohnt sich Seit dem EU-Verbot antimikrobieller Leistungsförderer besteht ein gesteigertes Interesse an Alternativen zur Unterstützung
Fotos: agrarfoto (2), orffa (2) Geflügelernährung Der Einsatz von Probiotika lohnt sich Seit dem EU-Verbot antimikrobieller Leistungsförderer besteht ein gesteigertes Interesse an Alternativen zur Unterstützung
Bedeutung der metabolischen Azidose für den Verlauf der renalen Osteopathie bei Hämodialysepatienten.
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin II der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. Osten) Bedeutung der metabolischen Azidose für den Verlauf der renalen
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin II der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. Osten) Bedeutung der metabolischen Azidose für den Verlauf der renalen
Was bringen pflanzliche Zusatzstoffe in der ökologischen Schweinehaltung?
 Was bringen pflanzliche Zusatzstoffe in der ökologischen Schweinehaltung? Dr. Werner Hagmüller LFZ Raumberg-Gumpenstein Institut für Biologische Landwirtschaft Wels Einleitung Nahrung sei deine Medizin
Was bringen pflanzliche Zusatzstoffe in der ökologischen Schweinehaltung? Dr. Werner Hagmüller LFZ Raumberg-Gumpenstein Institut für Biologische Landwirtschaft Wels Einleitung Nahrung sei deine Medizin
ESSENTIAL. mit Mangostan, Acai & Aloe Vera 900ml
 ESSENTIAL mit Mangostan, Acai & Aloe Vera 900ml 2/16 3/16 01 MANCHE MENSCHEN BLEIBEN GESÜNDER; LEBEN LÄNGER UND ALTERN LANGSAMER; DA SIE IN IHRER ERNÄHRUNG NÄHRSTOFFMÄNGEL VERMEIDEN: EQ Essential ist die
ESSENTIAL mit Mangostan, Acai & Aloe Vera 900ml 2/16 3/16 01 MANCHE MENSCHEN BLEIBEN GESÜNDER; LEBEN LÄNGER UND ALTERN LANGSAMER; DA SIE IN IHRER ERNÄHRUNG NÄHRSTOFFMÄNGEL VERMEIDEN: EQ Essential ist die
Zur Aufzucht die Sicherheit
 Zur Aufzucht die Sicherheit Das BERGOPHOR MSS Die gesunde Aufzucht von Ferkeln und Kälbern legt die Basis für ein leistungsorientiertes und somit durchgehend wirtschaftliches Produktionsverfahren. In modernen
Zur Aufzucht die Sicherheit Das BERGOPHOR MSS Die gesunde Aufzucht von Ferkeln und Kälbern legt die Basis für ein leistungsorientiertes und somit durchgehend wirtschaftliches Produktionsverfahren. In modernen
Aspekte der Eisenresorption. PD Dr. F.S. Lehmann Facharzt für Gastroenterologie FMH Oberwilerstrasse Binningen
 Aspekte der Eisenresorption PD Dr. F.S. Lehmann Facharzt für Gastroenterologie FMH Oberwilerstrasse 19 4102 Binningen Chemische Eigenschaften Fe-II wird leichter aufgenommen als Fe-III wegen der besseren
Aspekte der Eisenresorption PD Dr. F.S. Lehmann Facharzt für Gastroenterologie FMH Oberwilerstrasse 19 4102 Binningen Chemische Eigenschaften Fe-II wird leichter aufgenommen als Fe-III wegen der besseren
TRÄNKEWASSER Ansäuerung des Tränkewassers zur Unterstützung der Tiere. Tiergesundheit
 TRÄNKEWASSER Ansäuerung des Tränkewassers zur Unterstützung der Tiere Tiergesundheit Standort Altmoorhausen BÜFA Chemikalien Neue Chemie. BÜFA Chemikalien ist Teil der BÜFA-Gruppe, einem mittelständischen,
TRÄNKEWASSER Ansäuerung des Tränkewassers zur Unterstützung der Tiere Tiergesundheit Standort Altmoorhausen BÜFA Chemikalien Neue Chemie. BÜFA Chemikalien ist Teil der BÜFA-Gruppe, einem mittelständischen,
Ein Antibiotikaresistenzmechanismus. Einleitung. Antibiotika werden durch Bakterien und Pilze hergestellt
 β-lactamase Ein Antibiotikaresistenzmechanismus Einleitung Antibiotika werden durch Bakterien und Pilze hergestellt Entwicklung eines Schutz- bzw. Resistenzmechanismuses gegen das eigene AB. Übergang des
β-lactamase Ein Antibiotikaresistenzmechanismus Einleitung Antibiotika werden durch Bakterien und Pilze hergestellt Entwicklung eines Schutz- bzw. Resistenzmechanismuses gegen das eigene AB. Übergang des
Antibiotika schützen Ihre Gesundheit. Schützen Sie Ihren Darm!
 Antibiotika schützen Ihre Gesundheit. Schützen Sie Ihren Darm! Manchmal sind Antibiotika unvermeidlich Bakterien sind überall. Viele sind gut für uns; so zum Beispiel diejenigen, die unseren Darm besiedeln
Antibiotika schützen Ihre Gesundheit. Schützen Sie Ihren Darm! Manchmal sind Antibiotika unvermeidlich Bakterien sind überall. Viele sind gut für uns; so zum Beispiel diejenigen, die unseren Darm besiedeln
Die neuen Ferkelmineralfutter Sichere Ferkelaufzucht
 Die neuen Ferkelmineralfutter Sichere Ferkelaufzucht Ferkel-Mineralfutter für hohe Leistungsansprüche Ihr Viehbestand in guter Hand Troumix Ferkel Novamin Das leistungsstarke Ferkel-Mineralfutter mit der
Die neuen Ferkelmineralfutter Sichere Ferkelaufzucht Ferkel-Mineralfutter für hohe Leistungsansprüche Ihr Viehbestand in guter Hand Troumix Ferkel Novamin Das leistungsstarke Ferkel-Mineralfutter mit der
(Text von Bedeutung für den EWR)
 23.10.2014 DE L 304/81 VERORDNUNG (EU) Nr. 1123/2014 DER KOMMISSION vom 22. Oktober 2014 zur Änderung der Richtlinie 2008/38/EG mit dem Verzeichnis der Verwendungen von Futtermitteln für besondere e (Text
23.10.2014 DE L 304/81 VERORDNUNG (EU) Nr. 1123/2014 DER KOMMISSION vom 22. Oktober 2014 zur Änderung der Richtlinie 2008/38/EG mit dem Verzeichnis der Verwendungen von Futtermitteln für besondere e (Text
Die Veredelung von Leinsamen erfolgt durch ein patentiertes mechanisch-thermisches Aufschlussverfahren hier in Deutschland.
 Die Herstellung des Extrulins erfolgt in Deutschland. Mittels eines definierten Aufschlussverfahrens werden die Eigenschaften des Leins positiv verändert. Das entstandene Produkt Extrulin zeichnet sich
Die Herstellung des Extrulins erfolgt in Deutschland. Mittels eines definierten Aufschlussverfahrens werden die Eigenschaften des Leins positiv verändert. Das entstandene Produkt Extrulin zeichnet sich
in der Rinderfütterung
 - regt die Verdauung an in der Rinderfütterung erfolgreich füttern www.likra.com - das phytogene Fütterungskonzept für Rinder LIKRA-San - Was ist das eigentlich? Mischung phytogener Zusatzstoffe = sekundäre
- regt die Verdauung an in der Rinderfütterung erfolgreich füttern www.likra.com - das phytogene Fütterungskonzept für Rinder LIKRA-San - Was ist das eigentlich? Mischung phytogener Zusatzstoffe = sekundäre
Gerhard Breves, Susanne Riede Physiologisches Institut
 Einfluss eines glyphosathaltigen Pflanzenschutzmittels auf die ruminale Fermentation und mikrobielle Gemeinschaft in vitro unter besonderer Berücksichtigung von Clostridia Gerhard Breves, Susanne Riede
Einfluss eines glyphosathaltigen Pflanzenschutzmittels auf die ruminale Fermentation und mikrobielle Gemeinschaft in vitro unter besonderer Berücksichtigung von Clostridia Gerhard Breves, Susanne Riede
TAF TEMPERATURE ADAPTED FEEDS. - Das richtige Futter für jede Saison TEMPERATURE ADAPTED FEEDS TM
 TEMPERATURE ADAPTED FEEDS - Das richtige Futter für jede Saison TEMPERATURE ADAPTED FEEDS - Das richtige Futter für jede Saison Die Wassertemperatur beeinflusst sowohl die Geschwindigkeit wie auch die
TEMPERATURE ADAPTED FEEDS - Das richtige Futter für jede Saison TEMPERATURE ADAPTED FEEDS - Das richtige Futter für jede Saison Die Wassertemperatur beeinflusst sowohl die Geschwindigkeit wie auch die
Lactobact. HLH BioPharma. Patientenbroschüre. Ein Leitfaden für die Wahl des richtigen Probiotikums. Patienteninformation
 Lactobact Patientenbroschüre Ein Leitfaden für die Wahl des richtigen Probiotikums Patienteninformation HLH BioPharma Inhaltsübersicht Probiotika gesundheitsbewusst leben 3 Probiotische Lebensmittel ausreichend
Lactobact Patientenbroschüre Ein Leitfaden für die Wahl des richtigen Probiotikums Patienteninformation HLH BioPharma Inhaltsübersicht Probiotika gesundheitsbewusst leben 3 Probiotische Lebensmittel ausreichend
Sekundärwand Zellumen
 Kohlenhydrate Kohlenhydrate in Pressschnitzeln Pressschnitzel bestehen überwiegend aus den Zellwand- oder Gerüstkohlenhydraten Pektin, Hemicellulose und Cellulose, wobei die anteilig jeweils etwas ein
Kohlenhydrate Kohlenhydrate in Pressschnitzeln Pressschnitzel bestehen überwiegend aus den Zellwand- oder Gerüstkohlenhydraten Pektin, Hemicellulose und Cellulose, wobei die anteilig jeweils etwas ein
ZEOFLORIN. Für Ihre Darmflora
 ZEOFLORIN Für Ihre Darmflora Zeoflorin Stimulierung der Eigenheilkräfte, da 80 % des Immunsystems des Menschen im Darm angeregt werden. Bildung der wertvollen Milchsäure damit Verhinderung von anaeroben
ZEOFLORIN Für Ihre Darmflora Zeoflorin Stimulierung der Eigenheilkräfte, da 80 % des Immunsystems des Menschen im Darm angeregt werden. Bildung der wertvollen Milchsäure damit Verhinderung von anaeroben
PHYTO-EXTRAKT. Aktuelles für Sie und Ihre Patienten
 Ausgabe 6 11.02.2014 Liebe Leserin, lieber Leser, PHYTO-EXTRAKT Aktuelles für Sie und Ihre Patienten heute vor 167 Jahren wurde Thomas Alva Edison geboren. Er meldete zahlreiche Patente bis ins Alter,
Ausgabe 6 11.02.2014 Liebe Leserin, lieber Leser, PHYTO-EXTRAKT Aktuelles für Sie und Ihre Patienten heute vor 167 Jahren wurde Thomas Alva Edison geboren. Er meldete zahlreiche Patente bis ins Alter,
Endfassung vom. 13. März 2006
 DFG - Senatskommission zur Beurteilung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Lebensmitteln Prof. Dr. G. Eisenbrand - Vorsitzender SKLM Natürliche Lebensmittel-Inhaltsstoffe: Beurteilung der Toxizität
DFG - Senatskommission zur Beurteilung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Lebensmitteln Prof. Dr. G. Eisenbrand - Vorsitzender SKLM Natürliche Lebensmittel-Inhaltsstoffe: Beurteilung der Toxizität
Agenda Futtersäuren Wirkungsweisen Unterschiede Futterstruktur Fein vs. grob Nettoenergie Vorteil der Stoffwechselentlastung Proteinbewertung Verdauli
 Erfolgreich Schweine mästen was kann die Fütterung leisten Andreas Stukenborg Agenda Futtersäuren Wirkungsweisen Unterschiede Futterstruktur Fein vs. grob Nettoenergie Vorteil der Stoffwechselentlastung
Erfolgreich Schweine mästen was kann die Fütterung leisten Andreas Stukenborg Agenda Futtersäuren Wirkungsweisen Unterschiede Futterstruktur Fein vs. grob Nettoenergie Vorteil der Stoffwechselentlastung
14. Gesetz zur Änderung des Arzneimittelgesetzes 14. AMG Novelle
 1 14. Gesetz zur Änderung des Arzneimittelgesetzes 14. AMG Novelle Registrierungsverfahren für traditionelle pflanzliche Arzneimittel in 39a bis 39d (RL 2004/24/EG) Nach diesem Verfahren besteht die Möglichkeit,
1 14. Gesetz zur Änderung des Arzneimittelgesetzes 14. AMG Novelle Registrierungsverfahren für traditionelle pflanzliche Arzneimittel in 39a bis 39d (RL 2004/24/EG) Nach diesem Verfahren besteht die Möglichkeit,
in der Schweinefütterung
 - regt die Verdauung an in der Schweinefütterung erfolgreich füttern www.likra.com - das phytogene Fütterungskonzept für Schweine LIKRA-San - Was ist das eigentlich? Mischung phytogener Zusatzstoffe =
- regt die Verdauung an in der Schweinefütterung erfolgreich füttern www.likra.com - das phytogene Fütterungskonzept für Schweine LIKRA-San - Was ist das eigentlich? Mischung phytogener Zusatzstoffe =
Forschung im Schweinestall Medau eine erste Bilanz
 Forschung im Schweinestall Medau eine erste Bilanz Erntedankfest, 18. September 2015 Lehr- und Forschungsgut Kremesberg der Vetmeduni Wien Isabel Hennig-Pauka, Mikroorganismen krankmachende Eigenschaften
Forschung im Schweinestall Medau eine erste Bilanz Erntedankfest, 18. September 2015 Lehr- und Forschungsgut Kremesberg der Vetmeduni Wien Isabel Hennig-Pauka, Mikroorganismen krankmachende Eigenschaften
Vormischungen, Mineralfutter und Zusatzmodule zur Herstellung von Schweinefutter
 Vormischungen, Mineralfutter und Zusatzmodule zur Herstellung von Schweinefutter Wünschen Sie sich eine betriebsspezifische Mischung? Zusammen finden wir die passende Lösung für Sie. Unsere moderne Produktionsanlage
Vormischungen, Mineralfutter und Zusatzmodule zur Herstellung von Schweinefutter Wünschen Sie sich eine betriebsspezifische Mischung? Zusammen finden wir die passende Lösung für Sie. Unsere moderne Produktionsanlage
Informationen zu Nährstoffen
 3. Verarbeitung von Lebensmitteln 3.3 Lebensmitteletiketten 3.3.2 Informationen zu Nährstoffen ENERGIEWERT UND NÄHRSTOFFE Neben den Produktinformationen beinhalten Etiketten auch Informationen über den
3. Verarbeitung von Lebensmitteln 3.3 Lebensmitteletiketten 3.3.2 Informationen zu Nährstoffen ENERGIEWERT UND NÄHRSTOFFE Neben den Produktinformationen beinhalten Etiketten auch Informationen über den
Thomas Zöller (Autor) Verbesserung des Auflösungsverhaltens von schwer löslichen schwachen Säuren durch feste Lösungen und Cyclodextrin- Komplexe
 Thomas Zöller (Autor) Verbesserung des Auflösungsverhaltens von schwer löslichen schwachen Säuren durch feste Lösungen und Cyclodextrin- Komplexe https://cuvillier.de/de/shop/publications/334 Copyright:
Thomas Zöller (Autor) Verbesserung des Auflösungsverhaltens von schwer löslichen schwachen Säuren durch feste Lösungen und Cyclodextrin- Komplexe https://cuvillier.de/de/shop/publications/334 Copyright:
3.1 Der Einfluß von oxidierten Fetten auf den Lipid- und Schilddrüsenhormonstoffwechsel bei unterschiedlicher Selenversorgung
 42 3.1 Der Einfluß von oxidierten Fetten auf den Lipid- und Schilddrüsenhormonstoffwechsel bei unterschiedlicher Selenversorgung 3.1.1 Leistungsparameter Tabelle 23 zeigt die Anfangs- und Endlebendmasse
42 3.1 Der Einfluß von oxidierten Fetten auf den Lipid- und Schilddrüsenhormonstoffwechsel bei unterschiedlicher Selenversorgung 3.1.1 Leistungsparameter Tabelle 23 zeigt die Anfangs- und Endlebendmasse
Amtsblatt der Europäischen Union L 289/33
 DE 31.10.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 289/33 DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1060/2013 DER KOMMISSION vom 29. Oktober 2013 zur von Bentonit als in Futtermitteln für alle Tierarten (Text von
DE 31.10.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 289/33 DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1060/2013 DER KOMMISSION vom 29. Oktober 2013 zur von Bentonit als in Futtermitteln für alle Tierarten (Text von
Taurin. Ursprung. Vorkommen
 Ursprung Taurin oder 2-Aminoethansulfonsäure ist eine organische Säure mit einer Aminogruppe und wird deshalb oft als Aminosäure bezeichnet es handelt sich jedoch um eine Aminosulfonsäure, da es statt
Ursprung Taurin oder 2-Aminoethansulfonsäure ist eine organische Säure mit einer Aminogruppe und wird deshalb oft als Aminosäure bezeichnet es handelt sich jedoch um eine Aminosulfonsäure, da es statt
Produktbeschreibung. ayobase Vet. Mineralfuttermittel für Katzen, Hunde und Pferde.
 R Produktbeschreibung ayobase Vet Mineralfuttermittel für Katzen, Hunde und Pferde www.rayonex.de Das Tier ist was es isst Der Säure-Basen-Haushalt von Tieren ist in hohem Maße von der Ernährung und den
R Produktbeschreibung ayobase Vet Mineralfuttermittel für Katzen, Hunde und Pferde www.rayonex.de Das Tier ist was es isst Der Säure-Basen-Haushalt von Tieren ist in hohem Maße von der Ernährung und den
EM Aktiv + Carbon Futter. Fermentierte Kräuterextrakte. Biologisch aktiviertes Fermentprodukt mit Pflanzenkohle (Bokashi) 2016/10 EM Schweiz AG
 EM Aktiv + Fermentierte Kräuterextrakte Carbon Futter Biologisch aktiviertes Fermentprodukt mit Pflanzenkohle (Bokashi) EM Aktiv+ für Pferde Fermentierte Kräuterextrakte. Gemäss FiBL für den biologischen
EM Aktiv + Fermentierte Kräuterextrakte Carbon Futter Biologisch aktiviertes Fermentprodukt mit Pflanzenkohle (Bokashi) EM Aktiv+ für Pferde Fermentierte Kräuterextrakte. Gemäss FiBL für den biologischen
Der Tiergesundheitsdienst. Pharmakologie
 Der Tiergesundheitsdienst Pharmakologie Definition Pharmakologie ist die Wissenschaft, die die Wirkung von Arzneimitteln auf den Organismus untersucht. Wieso ist dieses Wissen interessant, sogar sehr wichtig
Der Tiergesundheitsdienst Pharmakologie Definition Pharmakologie ist die Wissenschaft, die die Wirkung von Arzneimitteln auf den Organismus untersucht. Wieso ist dieses Wissen interessant, sogar sehr wichtig
Mikroimmuntherapie. Mikroimmuntherapie
 Ein neues therapeutisches Konzept mit breitem Wirkungsspektrum verbindet in idealer Weise Schulmedizin und ganzheitliche Ansätze. Dank der Fortschritte der experimentellen und klinischen Immunologie kann
Ein neues therapeutisches Konzept mit breitem Wirkungsspektrum verbindet in idealer Weise Schulmedizin und ganzheitliche Ansätze. Dank der Fortschritte der experimentellen und klinischen Immunologie kann
Einfluss der Phosphorversorgung auf die Knochengesundheit von Mastschweinen
 Einfluss der Phosphorversorgung auf die Knochengesundheit von Mastschweinen Annette Liesegang, Samuel Schmid Institut für Tierernährung Vetsuisse-Fakultät Zürich Hintergrund vermehrt unspezifische Lahmheiten
Einfluss der Phosphorversorgung auf die Knochengesundheit von Mastschweinen Annette Liesegang, Samuel Schmid Institut für Tierernährung Vetsuisse-Fakultät Zürich Hintergrund vermehrt unspezifische Lahmheiten
Lösungen zu den Aufgaben
 Informationsmaterialien über den ökologischen Landbau und zur Verarbeitung ökologischer Erzeugnisse für die Aus und Weiterbildung im Ernährungshandwerk und in der Ernährungswirtschaft (Initiiert durch
Informationsmaterialien über den ökologischen Landbau und zur Verarbeitung ökologischer Erzeugnisse für die Aus und Weiterbildung im Ernährungshandwerk und in der Ernährungswirtschaft (Initiiert durch
Schulung zu Spurenelemente beim Rind. Selko IntelliBond
 Schulung zu Spurenelemente beim Rind Selko IntelliBond Definition von Mineralen Anorganische Salze Sulfate, Carbonate, Chloride (löslich) Organische Chelate Aminosäuren, Proteine, Kohlenhydrate (gemischt
Schulung zu Spurenelemente beim Rind Selko IntelliBond Definition von Mineralen Anorganische Salze Sulfate, Carbonate, Chloride (löslich) Organische Chelate Aminosäuren, Proteine, Kohlenhydrate (gemischt
Natürliches Antibiotika
 Natürliches Antibiotika -Ganz leicht selber machen- Geschrieben von Erika West www.erneahrenswert.de Einführung Über Jahrzehnte wurden Antibiotika viel zu leichtfertig von Ärzten verschrieben und von Patienten
Natürliches Antibiotika -Ganz leicht selber machen- Geschrieben von Erika West www.erneahrenswert.de Einführung Über Jahrzehnte wurden Antibiotika viel zu leichtfertig von Ärzten verschrieben und von Patienten
Bakterien sind nicht nur Feinde, sondern auch Freunde - Kochen für die Darmflora
 Bakterien sind nicht nur Feinde, sondern auch Freunde - Kochen für die Darmflora 9. Fachtagung der Hauswirtschaft Schwalmstadt, 23. Februar 2018 Dr. Elke Jaspers mikrologos GmbH Ausgaben für Lebensmittel
Bakterien sind nicht nur Feinde, sondern auch Freunde - Kochen für die Darmflora 9. Fachtagung der Hauswirtschaft Schwalmstadt, 23. Februar 2018 Dr. Elke Jaspers mikrologos GmbH Ausgaben für Lebensmittel
Raumfahrtmedizin. darauf hin, dass es auch einen Zusammenhang zwischen Knochenabbau, Bluthochdruck und Kochsalzzufuhr gibt. 64 DLR NACHRICHTEN 113
 Raumfahrtmedizin Gibt es einen Die geringe mechanische Belastung der unteren Extremitäten von Astronauten im All ist eine wesentliche Ursache für den Knochenabbau in Schwerelosigkeit. Gleichzeitig haben
Raumfahrtmedizin Gibt es einen Die geringe mechanische Belastung der unteren Extremitäten von Astronauten im All ist eine wesentliche Ursache für den Knochenabbau in Schwerelosigkeit. Gleichzeitig haben
BERICHT. Nährwert in gasdicht eingelagertem Getreide im Vergleich mit lagerfestem Getreide. Hintergrund: Ziel:
 BERICHT Nährwert in gasdicht eingelagertem Getreide im Vergleich mit lagerfestem Getreide Hanne Damgaard Poulsen Forschungsleiterin 24. September 2010 Seite 1/5 Hintergrund: Die herkömmliche Getreidelagerung
BERICHT Nährwert in gasdicht eingelagertem Getreide im Vergleich mit lagerfestem Getreide Hanne Damgaard Poulsen Forschungsleiterin 24. September 2010 Seite 1/5 Hintergrund: Die herkömmliche Getreidelagerung
Zahngesundheit und Probiotika. Die wichtigsten Tipps.
 Zahngesundheit und Probiotika. Die wichtigsten Tipps. 1 Probiose bedeutet für das Leben. Wie wirken Probiotika? 2 Probiotika sind Präparate mit lebensfähigen Mikroorganismen, die dem Menschen einen gesundheitlichen
Zahngesundheit und Probiotika. Die wichtigsten Tipps. 1 Probiose bedeutet für das Leben. Wie wirken Probiotika? 2 Probiotika sind Präparate mit lebensfähigen Mikroorganismen, die dem Menschen einen gesundheitlichen
Zahngesundheit und Probiotika. Die wichtigsten Tipps.
 Zahngesundheit und Probiotika. Die wichtigsten Tipps. 1 Probiose bedeutet für das Leben. Probiotika sind Präparate mit lebensfähigen Mikroorganismen, die dem Menschen einen gesundheitlichen Vorteil bringen,
Zahngesundheit und Probiotika. Die wichtigsten Tipps. 1 Probiose bedeutet für das Leben. Probiotika sind Präparate mit lebensfähigen Mikroorganismen, die dem Menschen einen gesundheitlichen Vorteil bringen,
VERORDNUNGEN. (Text von Bedeutung für den EWR)
 L 69/18 VERORDNUNGEN DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/447 R KOMMISSION vom 14. März 2017 zur der Zubereitung aus Bacillus subtilis (DSM 5750) und Bacillus licheniformis (DSM 5749) als in Futtermitteln
L 69/18 VERORDNUNGEN DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/447 R KOMMISSION vom 14. März 2017 zur der Zubereitung aus Bacillus subtilis (DSM 5750) und Bacillus licheniformis (DSM 5749) als in Futtermitteln
PIP Moderne Stallhygiene
 PIP Moderne Stallhygiene Die Basis Probiotische Mikroklima-Regulation Das PIP Prinzip Das PIP Prinzip Ein breites Spektrum pathogener (krankmachende) Mikroorganismen verursachen zahlreiche gesundheitliche
PIP Moderne Stallhygiene Die Basis Probiotische Mikroklima-Regulation Das PIP Prinzip Das PIP Prinzip Ein breites Spektrum pathogener (krankmachende) Mikroorganismen verursachen zahlreiche gesundheitliche
Was geht ein urologisches Thema die Frauenärztin an? KFN-Pressekonferenz,
 Was geht ein urologisches Thema die Frauenärztin an? KFN-Pressekonferenz, 14.09.2016 1 Harnwegsinfekte in der Gynäkologie Frauen sind gehäuft betroffen, auf Grund ihrer Anatomie: kurze Harnröhre, Nähe
Was geht ein urologisches Thema die Frauenärztin an? KFN-Pressekonferenz, 14.09.2016 1 Harnwegsinfekte in der Gynäkologie Frauen sind gehäuft betroffen, auf Grund ihrer Anatomie: kurze Harnröhre, Nähe
L 330/14 Amtsblatt der Europäischen Union
 DE L 330/14 Amtsblatt der Europäischen Union 30.11.2012 DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1119/2012 DER KOMMISSION vom 29. November 2012 zur Zulassung der Zubereitungen aus Pediococcus acidilactici CNCM
DE L 330/14 Amtsblatt der Europäischen Union 30.11.2012 DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1119/2012 DER KOMMISSION vom 29. November 2012 zur Zulassung der Zubereitungen aus Pediococcus acidilactici CNCM
Gut essen. das Immunsystem stärken
 Gut essen das Immunsystem stärken 1 2 Wie können Sie Infektionen vermeiden? Hände waschen Menschenansammlungen meiden eigenes Ess-/Trinkgefäß benutzen ausreichend schlafen + entspannen sich bewegen reichlich
Gut essen das Immunsystem stärken 1 2 Wie können Sie Infektionen vermeiden? Hände waschen Menschenansammlungen meiden eigenes Ess-/Trinkgefäß benutzen ausreichend schlafen + entspannen sich bewegen reichlich
Ernährung und Chemie Thema: Präventive Ernährung Datum:
 Vitamine: Die Vitamine E, C und Beta-Carotin (Vorstufe des Vitamin A) werden als Antioxidantien bezeichnet. Antioxidantien haben die Eigenschaft so genannte freie Radikale unschädlich zu machen. Freie
Vitamine: Die Vitamine E, C und Beta-Carotin (Vorstufe des Vitamin A) werden als Antioxidantien bezeichnet. Antioxidantien haben die Eigenschaft so genannte freie Radikale unschädlich zu machen. Freie
EM Aktiv + Fermentierte Kräuterextrakte. Carbon Futter. Biologisch aktiviertes Fermentprodukt mit Pflanzenkohle (Bokashi)
 EM Aktiv + Fermentierte Kräuterextrakte Carbon Futter Biologisch aktiviertes Fermentprodukt mit Pflanzenkohle (Bokashi) Ergänzungsfuttermittel für Pferde, landwirtschaftliche Nutztiere sowie Haus- und
EM Aktiv + Fermentierte Kräuterextrakte Carbon Futter Biologisch aktiviertes Fermentprodukt mit Pflanzenkohle (Bokashi) Ergänzungsfuttermittel für Pferde, landwirtschaftliche Nutztiere sowie Haus- und
Standardarbeitsanweisung (SOP) zur (Nicht)Einstufung von Studienvorhaben als klinische Prüfung nach AMG
 Standardarbeitsanweisung (SOP) zur (Nicht)Einstufung von Studienvorhaben als klinische Prüfung nach AMG Die folgende SOP basiert auf dem EU-Guidance Dokument vom März 2010 mit seinem Decision Tree (siehe
Standardarbeitsanweisung (SOP) zur (Nicht)Einstufung von Studienvorhaben als klinische Prüfung nach AMG Die folgende SOP basiert auf dem EU-Guidance Dokument vom März 2010 mit seinem Decision Tree (siehe
Willkommen in der Welt der Mikroorganismen.
 Willkommen in der Welt der Mikroorganismen www.em-sachsen.de Mikroorganismen sind überall! Die Erde wäre komplett und flächendeckend rot, wenn Mikroorganismen rot wären! Kampf gegen Mikroorganismen ist
Willkommen in der Welt der Mikroorganismen www.em-sachsen.de Mikroorganismen sind überall! Die Erde wäre komplett und flächendeckend rot, wenn Mikroorganismen rot wären! Kampf gegen Mikroorganismen ist
Aus dem Institut für Lebensmittelhygiene des Fachbereichs Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin
 Aus dem Institut für Lebensmittelhygiene des Fachbereichs Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin Zur Notwendigkeit einer Voranreicherung im Verhältnis 1:100 beim Nachweis von Salmonellen in Gewürzen
Aus dem Institut für Lebensmittelhygiene des Fachbereichs Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin Zur Notwendigkeit einer Voranreicherung im Verhältnis 1:100 beim Nachweis von Salmonellen in Gewürzen
*DE A *
 (19) *DE102017004217A120180315* (10) DE 10 2017 004 217 A1 2018.03.15 (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: 10 2017 004 217.9 (22) Anmeldetag: 03.05.2017 (43) Offenlegungstag: 15.03.2018 (66) Innere
(19) *DE102017004217A120180315* (10) DE 10 2017 004 217 A1 2018.03.15 (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: 10 2017 004 217.9 (22) Anmeldetag: 03.05.2017 (43) Offenlegungstag: 15.03.2018 (66) Innere
Amtsblatt der Europäischen Union L 2/3
 DE 7.1.2014 Amtsblatt der Europäischen Union L 2/3 VERORDNUNG (EU) Nr. 5/2014 DER KOMMISSION vom 6. Januar 2014 zur Änderung der Richtlinie 2008/38/EG mit dem Verzeichnis der Verwendungen von Futtermitteln
DE 7.1.2014 Amtsblatt der Europäischen Union L 2/3 VERORDNUNG (EU) Nr. 5/2014 DER KOMMISSION vom 6. Januar 2014 zur Änderung der Richtlinie 2008/38/EG mit dem Verzeichnis der Verwendungen von Futtermitteln
Koifutter '17/'18. Dedicated to your performance. Koi CLAY. Sinkendes Futter Enthält Actigen. Schwimmendes Futter. Für kräftige Fischfarben
 Koifutter '17/'18 Dedicated to your performance Sinkendes Futter Enthält Actigen Schwimmendes Futter Für kräftige Fischfarben Präbiotisch und/oder probiotisch Mit Montmorillonit (clay) Omega-3-Fettsäuren
Koifutter '17/'18 Dedicated to your performance Sinkendes Futter Enthält Actigen Schwimmendes Futter Für kräftige Fischfarben Präbiotisch und/oder probiotisch Mit Montmorillonit (clay) Omega-3-Fettsäuren
(Text von Bedeutung für den EWR)
 6.5.2015 DE L 115/25 DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/724 DER KOMMISSION vom 5. Mai 2015 über die von Retinylacetat, und Retinylpropionat als e in Futtermitteln für alle Tierarten (Text von Bedeutung
6.5.2015 DE L 115/25 DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/724 DER KOMMISSION vom 5. Mai 2015 über die von Retinylacetat, und Retinylpropionat als e in Futtermitteln für alle Tierarten (Text von Bedeutung
Linusit. Natürliche Hilfe für Magen und Darm.
 Linusit. Natürliche Hilfe für Magen und Darm. Der Darm vielfältige Funktionen Der Darm ist der zentrale Teil des Verdauungstraktes und erfüllt mit seiner Oberfläche von bis zu 500m² viele verschiedene
Linusit. Natürliche Hilfe für Magen und Darm. Der Darm vielfältige Funktionen Der Darm ist der zentrale Teil des Verdauungstraktes und erfüllt mit seiner Oberfläche von bis zu 500m² viele verschiedene
Verordnung des EDI über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln
 Verordnung des EDI über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln (Fremd- und Inhaltsstoffverordnung, FIV) Änderung vom 26. November 2008 Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) verordnet: I Die
Verordnung des EDI über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln (Fremd- und Inhaltsstoffverordnung, FIV) Änderung vom 26. November 2008 Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) verordnet: I Die
50. Fortbildungsveranstaltung für Hals-Nasen- Ohrenärzte
 Expertenrunde: Informationen zu aktuellen medizinischen Themen: Evidente Therapie bei Infektionen Antibiotikaeinsatz, Indikationen für antivirale Therapie in der HNO Autor: Prof. Dr. med. Wolfgang Pfister,
Expertenrunde: Informationen zu aktuellen medizinischen Themen: Evidente Therapie bei Infektionen Antibiotikaeinsatz, Indikationen für antivirale Therapie in der HNO Autor: Prof. Dr. med. Wolfgang Pfister,
Nährstoffangepasste Fütterung
 Nährstoffangepasste Fütterung DBV-Veredlungstag 20.9.2017 Osnabrück Andrea Meyer, LWK Niedersachsen Gliederung 1. Situation in Niedersachsen 2. Möglichkeiten der nährstoffangepassten Schweinefütterung
Nährstoffangepasste Fütterung DBV-Veredlungstag 20.9.2017 Osnabrück Andrea Meyer, LWK Niedersachsen Gliederung 1. Situation in Niedersachsen 2. Möglichkeiten der nährstoffangepassten Schweinefütterung
Salmonellen: Überblick über die zur Verfügung stehenden Problemlöser
 Salmonellen: Überblick über die zur Verfügung stehenden Problemlöser Franz Korte, EXTRA-Vit GmbH Lembeck, 12.02.2016 1 2 Monitoring-Report 2015 (nach QS) 3 Futter nicht als Eintragsquelle, sondern als
Salmonellen: Überblick über die zur Verfügung stehenden Problemlöser Franz Korte, EXTRA-Vit GmbH Lembeck, 12.02.2016 1 2 Monitoring-Report 2015 (nach QS) 3 Futter nicht als Eintragsquelle, sondern als
Die Probiotika der neuen Generation
 Die Probiotika der neuen Generation Vielbeschäftigter Darm Das Multitalent hat viel zu tun Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint: Der Darm gehört zu den größten Organen des Menschen. Durch
Die Probiotika der neuen Generation Vielbeschäftigter Darm Das Multitalent hat viel zu tun Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint: Der Darm gehört zu den größten Organen des Menschen. Durch
Einführung in die Biochemie Wirkungsweise von Enzymen
 Wirkungsweise von en Am Aktiven Zentrum kann ein nur in einer ganz bestimmten Orientierung anlegen, wie ein Schlüssel zum Schloss. Dieses Prinzip ist die Ursache der spezifität von en. Dies resultiert
Wirkungsweise von en Am Aktiven Zentrum kann ein nur in einer ganz bestimmten Orientierung anlegen, wie ein Schlüssel zum Schloss. Dieses Prinzip ist die Ursache der spezifität von en. Dies resultiert
Hepar-SL. Der pflanzliche Spezialextrakt für eine rundum gute Verdauung
 Hepar-SL Der pflanzliche Spezialextrakt für eine rundum gute Verdauung Verdauung ein für den Menschen lebensnotwendiger Prozess. Unser Körper benötigt für seine vielfältigen Funktionen und Leistungen,
Hepar-SL Der pflanzliche Spezialextrakt für eine rundum gute Verdauung Verdauung ein für den Menschen lebensnotwendiger Prozess. Unser Körper benötigt für seine vielfältigen Funktionen und Leistungen,
Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie einen Mittelweg finden.
 Liebe Leserin, lieber Leser, ich freue mich, dass Sie sich für eine Darmsanierung interessieren und möchte Sie gerne dabei unterstützen, Ihre Gesundheit zu verbessern und Ihr Wohlbefinden zu steigern.
Liebe Leserin, lieber Leser, ich freue mich, dass Sie sich für eine Darmsanierung interessieren und möchte Sie gerne dabei unterstützen, Ihre Gesundheit zu verbessern und Ihr Wohlbefinden zu steigern.
Prof. Dr. G. BELLOF 1
 Raps und Körnerleguminosen im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie - Märkte und Potenziale für neue Verwertungskonzepte aus Sicht der Tierernährung - Prof. Dr. Gerhard Bellof UFOP-Perspektivforum
Raps und Körnerleguminosen im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie - Märkte und Potenziale für neue Verwertungskonzepte aus Sicht der Tierernährung - Prof. Dr. Gerhard Bellof UFOP-Perspektivforum
BIOKATGAS. Erhöhen Sie die Effizienz Ihrer Biogasanlage
 BIOKATGAS Erhöhen Sie die Effizienz Ihrer Biogasanlage Was ist Bio-Kat-Gas? Bio-Kat-Gas ist ein rein pflanzliches, vollkommen biologisch abbaubares Produkt aus einer speziellen Mischung von Katalysatoren
BIOKATGAS Erhöhen Sie die Effizienz Ihrer Biogasanlage Was ist Bio-Kat-Gas? Bio-Kat-Gas ist ein rein pflanzliches, vollkommen biologisch abbaubares Produkt aus einer speziellen Mischung von Katalysatoren
Schweinefütterung und Tiergesundheit. Welchen Beitrag kann die Fütterung zu einer Reduktion des Antibiotikaverbrauchs leisten?
 Schweinefütterung und Tiergesundheit Welchen Beitrag kann die Fütterung zu einer Reduktion des Antibiotikaverbrauchs leisten? 1. Schwerpunkt: Fütterung Absetzer Wie schaffen wir den Sprung? Vom Ferkel
Schweinefütterung und Tiergesundheit Welchen Beitrag kann die Fütterung zu einer Reduktion des Antibiotikaverbrauchs leisten? 1. Schwerpunkt: Fütterung Absetzer Wie schaffen wir den Sprung? Vom Ferkel
Wohlgefühl und Vitalität
 SOJA-ISOFLAVONE PLUS PROBIOTISCHE MILCHSÄUREBAKTERIEN Wohlgefühl und Vitalität NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL Liebe Leserin, auch die Wechseljahre können eine schöne, erfüllte und angenehme Lebenszeit sein.
SOJA-ISOFLAVONE PLUS PROBIOTISCHE MILCHSÄUREBAKTERIEN Wohlgefühl und Vitalität NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL Liebe Leserin, auch die Wechseljahre können eine schöne, erfüllte und angenehme Lebenszeit sein.
Möglichkeiten der Qualitätsbeurteilung von Fleisch und Fleischerzeugnissen durch den Verbraucher BAFF KULMBACH 2002 CH-SCHW
 Möglichkeiten der Qualitätsbeurteilung von Fleisch und Fleischerzeugnissen durch den Verbraucher Qualität von Fleisch und Fleischerzeugnissen Qualität Güte wertschätzend "Qualitätsfleisch Beschaffenheit
Möglichkeiten der Qualitätsbeurteilung von Fleisch und Fleischerzeugnissen durch den Verbraucher Qualität von Fleisch und Fleischerzeugnissen Qualität Güte wertschätzend "Qualitätsfleisch Beschaffenheit
Industriell hergestelltes Nebenprodukt in der Schweinefütterung. Problemstellung
 Industriell hergestelltes Nebenprodukt in der Schweinefütterung Problemstellung Der Einsatz von Nebenprodukten aus der Nahrungsmittelindustrie ist in der Mastschweinefütterung durchaus üblich und macht
Industriell hergestelltes Nebenprodukt in der Schweinefütterung Problemstellung Der Einsatz von Nebenprodukten aus der Nahrungsmittelindustrie ist in der Mastschweinefütterung durchaus üblich und macht
Kyäni Sunrise - eine Quelle aus folgenden Vitaminen:
 Die Bestandteile des Kyäni Gesundheitsdreiecks: Kyäni Sunrise - eine Quelle aus folgenden Vitaminen: Vitamin A ist wichtig für: die Bildung neuer Blutkörperchen und erleichtert den Einbau des Eisens stärkt
Die Bestandteile des Kyäni Gesundheitsdreiecks: Kyäni Sunrise - eine Quelle aus folgenden Vitaminen: Vitamin A ist wichtig für: die Bildung neuer Blutkörperchen und erleichtert den Einbau des Eisens stärkt
Kälbermilch PLUS AKUT PLUS AKUT. Das Sicherheitskonzept für die Biestmilchphase. Die Tränke mit dem Plus an Sicherheit.
 Kälbermilch Die Tränke mit dem Plus an Sicherheit. Der Tränkezusatz, der stabilisiert und beruhigt. Das Sicherheitskonzept für die Biestmilchphase Kälbermilch Das Sicherheitskonzept in der Biestmilchphase
Kälbermilch Die Tränke mit dem Plus an Sicherheit. Der Tränkezusatz, der stabilisiert und beruhigt. Das Sicherheitskonzept für die Biestmilchphase Kälbermilch Das Sicherheitskonzept in der Biestmilchphase
Mehrfach ausgezeichneter Pflanzendünger!
 Mehrfach ausgezeichneter Pflanzendünger! Powder Feeding Organische und mineralische Düngemittel werden bereits seit vielen tausenden Jahren in der Agrarwirtschaft eingesetzt, jedoch haben sich die Methoden
Mehrfach ausgezeichneter Pflanzendünger! Powder Feeding Organische und mineralische Düngemittel werden bereits seit vielen tausenden Jahren in der Agrarwirtschaft eingesetzt, jedoch haben sich die Methoden
Merkblatt. für die Zulassung und Registrierung. von Drittlandsvertretern. Futtermittelhygiene (Band 8)
 Merkblatt für die Zulassung und Registrierung von Drittlandsvertretern Futtermittelhygiene (Band 8) Stand 12.02.2009 Merkblatt für die Zulassung sowie Registrierung von Betrieben als Drittlandsvertreter,
Merkblatt für die Zulassung und Registrierung von Drittlandsvertretern Futtermittelhygiene (Band 8) Stand 12.02.2009 Merkblatt für die Zulassung sowie Registrierung von Betrieben als Drittlandsvertreter,
Amtsblatt der Europäischen Union
 4.1.2019 DE L 2/21 DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2019/12 DER KOMMISSION vom 3. Januar 2019 zur von L-Arginin als in Futtermitteln für alle Tierarten (Text von Bedeutung für den EWR) DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION
4.1.2019 DE L 2/21 DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2019/12 DER KOMMISSION vom 3. Januar 2019 zur von L-Arginin als in Futtermitteln für alle Tierarten (Text von Bedeutung für den EWR) DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION
Wie wir die Digitalisierung in den Hühnerstall bringen
 Wie wir die Digitalisierung in den Hühnerstall bringen Stefan Pelzer 5. Oktober 2017, Essen istock.com/gpointstudio 1 Eine wachsende Weltbevölkerung will ernährt werden BEVÖLKERUNGSWACHSTUM STEIGENDER
Wie wir die Digitalisierung in den Hühnerstall bringen Stefan Pelzer 5. Oktober 2017, Essen istock.com/gpointstudio 1 Eine wachsende Weltbevölkerung will ernährt werden BEVÖLKERUNGSWACHSTUM STEIGENDER
I nhaltsverzeichnis. 1 Einleitung 1 2 Schrifttum Nicht-Stärke-Polysaccharide (NSP) Überblick Einteilung / Differenzierung 4
 I nhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Schrifttum 3 2.1 Nicht-Stärke-Polysaccharide (NSP) 3 2.1.1 Überblick 3 2.1.2 Einteilung / Differenzierung 4 2.1.3 Analyse von NSP 5 2.1.4 Extraktviskosität
I nhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Schrifttum 3 2.1 Nicht-Stärke-Polysaccharide (NSP) 3 2.1.1 Überblick 3 2.1.2 Einteilung / Differenzierung 4 2.1.3 Analyse von NSP 5 2.1.4 Extraktviskosität
EMPFEHLUNG DER KOMMISSION
 15.1.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 11/75 EMPFEHLUNG DER KOMMISSION vom 14. Januar 2011 zur Festlegung von Leitlinien für die Unterscheidung zwischen Einzelfuttermitteln, Futtermittelzusatzstoffen,
15.1.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 11/75 EMPFEHLUNG DER KOMMISSION vom 14. Januar 2011 zur Festlegung von Leitlinien für die Unterscheidung zwischen Einzelfuttermitteln, Futtermittelzusatzstoffen,
Effekte - Nutzen zur Prophylaxe/ Metaphylaxe. TÄ Ines Leidel GP Leidel Naundorf/Sachsen
 Ziele - Effekte - Nutzen zur Prophylaxe/ Metaphylaxe TÄ Ines Leidel GP Leidel Naundorf/Sachsen 1. Entzündungshemmung: - Dämpfung der Entzündungsreaktion und Stabilisierung der Zellmembran - Wirkung im
Ziele - Effekte - Nutzen zur Prophylaxe/ Metaphylaxe TÄ Ines Leidel GP Leidel Naundorf/Sachsen 1. Entzündungshemmung: - Dämpfung der Entzündungsreaktion und Stabilisierung der Zellmembran - Wirkung im

![ll7 UJ)Lil Fil ~on~r;<;/ :(). - ) 0 9 0/';; C]OVI I') ll7 UJ)Lil Fil ~on~r;<;/ :(). - ) 0 9 0/';; C]OVI I')](/thumbs/30/14421450.jpg) ll7 U"J)Lil Fil ~on~r;
ll7 U"J)Lil Fil ~on~r;