Reproduktionsbiologie in Pflanzen mit und ohne Mendel
|
|
|
- Norbert Lorentz
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2006) 151 (4): Reproduktionsbiologie in Pflanzen mit und ohne Mendel Claudia Köhler (Zürich) Zusammenfassung Die Verschmelzung zweier männlicher Gameten mit zwei weiblichen Gameten, der Eizelle und der Zentralzelle, markiert den Beginn der Samenentwicklung in Blütenpflanzen. Aus der befruchteten Eizelle entwickelt sich der Embryo, während aus der befruchteten Zentralzelle das Nährgewebe hervorgeht. Die doppelte Befruchtung ist in den meisten Pflanzenarten notwendig, um lebensfähige Samen zu bilden, und die befruchtungsunabhängige autonome Samenentwicklung wird aktiv unterdrückt. Im Gegensatz dazu können apomiktische Pflanzen lebensfähige Samen ohne Befruchtung der Eizelle bilden. Durch genetische Untersuchungen an der Modellpflanze Arabidopsis konnte gezeigt werden, dass ein evolutionär konservierter Proteinkomplex die autonome Teilung von Ei- und Zentralzelle unterdrückt. In Mutanten, in denen dieser Mechanismus defekt ist, können sich auch ohne Befruchtung samenähnliche Strukturen entwickeln, die ein Nährgewebe aber keinen funktionellen Embryo enthalten. Der molekulare Mechanismus, der dieser Repression zugrunde liegt, ist derzeit Gegenstand intensiver Untersuchungen und wird innerhalb dieses Beitrags näher erläutert. Reproductive biology in plants with and without Mendel Seed development in flowering plants is initiated by the fusion of two male gametes with two female gametes, the egg cell and the central cell, leading to the formation of embryo and endosperm, respectively. In most plant species double fertilization is necessary for the initiation of seed development and autonomous development of egg and central cell are actively suppressed. In contrast, apomictic species can form viable seeds without fertilization of the egg cell. Genetic studies using the model plant Arabidopsis identified an evolutionary conserved protein complex repressing autonomous division of egg and central cell. Mutants defective in subunits of this complex can form seed-like structures without fertilization, containing endosperm but no viable embryos. The molecular basis inhibiting autonomous cell divisions is currently intensively investigated and will be subject of this overview. Schlagwörter: Apomixis Arabidopsis thaliana Genetik Mutanten Samenentwicklung 1 EINLEITUNG Die ersten Ansätze zum Verständnis der pflanzlichen Fortpflanzung reichen weit zurück; so wurden bereits 5000 vor Christus die weiblichen Blüten der Dattelpalme manuell mit Pollen der männlichen Blüten bestäubt. Es ist anzunehmen, dass bereits zu dieser Zeit die Notwendigkeit der Vereinigung zweier verschiedener Geschlechter für eine erfolgreiche Samenbildung erkannt wurde. Allerdings wurde diese Erkenntnis erst im 17. Jahrhundert durch die Arbeiten von Rudolph Camararius ( ) auf eine wissenschaftliche Grundlage gestellt. In seiner Abhandlung «Epistolae de sexu plantarum» schlug Camararius die Theorie vor, dass die Pollinierung ein für die Samenbildung notwendiger sexueller Akt ist. Camararius arbeitete mit Hanf, und er postulierte richtig, dass Hanf und einige andere Pflanzen getrennte Geschlechter haben. Carl von Linné ( ) bestätigte und erweiterte diese Ergebnisse und erkannte, dass der Pollen in die Narbe eindringt. Allerdings entdeckte Linné nicht den Pollenschlauch; dies gelang erst Giovanni Battista Amici ( ) (CARLSON, 2004). 113
2 Claudia Köhler Die Pflanzenforscher der vergangenen Jahrhunderte haben mit unterschiedlichen Pflanzenarten gearbeitet, was die Vergleichbarkeit der erzielten Ergebnisse erschwerte. Seit Ende des 20. Jahrhunderts konzentriert sich die Pflanzenforschung auf das Ackerunkraut Arabidopsis thaliana, die Ackerschmalwand. Arabidopsis avancierte aus vielfältigen Gründen zur Modellpflanze der modernen Pflanzenforschung; die entscheidenden Vorteile sind ihr schneller Generationswechsel, eine hohe Samenzahl pro Pflanze (eine Pflanze kann mehrere Tausend Samen generieren) und ihr kleines Genom (KONCZ et al., 1992). Arabidopsis besitzt fünf Chromosomen und hat eine Genomgrösse von 1, Basenpaaren. Das Genom des Menschen ist etwa 24-mal grösser, aber nicht wesentlich komplexer, denn die für Arabidopsis und Mensch vorhergesagten Genzahlen sind in einer vergleichbaren Grössenordnung (ca ). Die Genomsequenz von Arabidopsis wurde im Jahre 2000 veröffentlicht, und es gibt Datenbanken, in denen alle Arabidopsis-Gene und die für jedes Gen bereits vorhandenen Informationen gesammelt sind (HUALA et al., 2001). Die Kenntnis der Genomsequenz erleichtert die Identifizierung von Mutanten. Deshalb ist es jetzt möglich, ein mutiertes Gen innerhalb weniger Wochen aufzuspüren. Die phänotypische Analyse von Mutanten und die anschliessende Identifizierung des mutierten Gens hat grundlegende Erkenntnisse über die Entwicklung von Arabidopsis hervorgebracht und ist bis jetzt eine der wichtigsten Techniken in der modernen Entwicklungsbiologie. 2 DER REPRODUKTIONSZYKLUS VON ARABIDOPSIS Wie alle Blütenpflanzen, so durchläuft auch Arabidopsis einen Generationswechsel, der zwischen einer haploiden gametophytischen Phase und einer diploiden sporophytischen Phase alterniert. In den zweigeschlechtlichen Arabidopsis-Blüten befinden sich sowohl weibliche (Fruchtknoten) als auch männliche Blütenorgane (Staubgefässe), und innerhalb dieser Organe werden die Gameten gebildet. Die Gameten befinden sich in mehrzelligen Strukturen, den Gametophyten. Der männliche Gametophyt ist der Pollen, und der weibliche Gametophyt befindet sich in der Samenanlage. Es gibt sowohl zwei männliche Gameten, die Spermazellen, als auch zwei weibliche Gameten, die Eizelle und die Zentralzelle. Der männliche Gametophyt wächst zum Pollenschlauch aus, dringt in den Griffel ein und transportiert die Spermazellen zur Samenanlage. Eine der Spermazellen befruchtet die Eizelle, die andere die Zentralzelle. Als Resultat der doppelten Befruchtung entwickelt sich aus der befruchteten Eizelle der Embryo und aus der befruchteten Zentralzelle das Nährgewebe (Endosperm). Das Endosperm dient der Ernährung des Embryos und wird bei Arabidopsis während der Samenentwicklung fast vollständig aufgebraucht. Am Ende seiner Entwicklung füllt der Embryo den gesamten Samen aus und keimt nach einer Ruhephase erneut aus. Der sich aus dem keimenden Embryo entwickelnde Keimling wächst zu einer neuen Pflanze heran, die erneut Blüten bildet und den Generationswechsel fortsetzt (BOAVIDA et al., 2005). 3 APOMIXIS SAMENBILDUNG OHNE BEFRUCHTUNG 3.1 Mendels Dilemma Apomixis Die Befruchtung ist in den meisten Organismen, in Pflanzen wie auch in Tieren, eine notwendige Voraussetzung für die Entwicklung der neuen Generation. Allerdings können viele Pflanzen auch ohne Befruchtung lebensfähige Nachkommen erzeugen. Dieses Verhalten wird als Apomixis bezeichnet. Die so erzeugten Nachkommen sind genetisch identisch mit der Mutterpflanze und sind somit de facto Klone der Mutterpflanze (KOLTUNOW, 1993). Wie ist es möglich, dass sich ohne Befruchtung der Eizelle lebensfähige Samen entwickeln, die genetisch identisch mit der Mutterpflanze sind? An dieser fundamentalen Frage wird derzeit sehr intensiv geforscht, zumal Apomixis ein enormes Potential für die Landwirtschaft besitzt. Wenn Nutzpflanzen sich apomiktisch fortpflanzen würden, könnte jede gewünschte Eigenschaft genetisch fixiert werden, was die Züchtung deutlich vereinfachen würde. Das Phänomen Apomixis hat unbewusst bereits Gregor Mendel beschäftigt und hat zunächst die Erforschung der genetischen Grundgesetze stark zurückgeworfen. Gregor Johann Mendel ( ), der als Mönch in einem Kloster in Brünn lebte, kann wohl zu Recht als einer der Begründer der Genetik bezeichnet werden. Mendel hat durch die systematische Auswertung von Kreuzungsversuchen mit Erbsen zwei grundlegende Gesetze formuliert, die für die heutige Genetik nichts an ihrer Bedeutung verloren haben. Mendel beobachtete, dass nach einer Kreuzung zweier für eine bestimmte Eigenschaft reinerbiger Eltern (z. B. rote und weisse Blütenfarbe) alle F1-Nachkommen die gleichen Eigenschaften besitzen (z. B. rot oder rosa). Die Nachkommen dieser F1-Generation spalten dann in einem bestimmten Verhältnis auf. Wenn das für eine be- 114
3 Reproduktionsbiologie in Pflanzen mit und ohne Mendel stimmte Eigenschaft verantwortliche Allel dominant ist, ist das Aufspaltungsverhältnis 3:1 (rot : weiss), wenn beide Allele gleich stark sind, dann spalten die Nachkommen im Verhältnis 1:2:1 (rot : rosa : weiss) auf (Abb. 1). Das Konzept von Genen als partikuläre Träger von Erbeigenschaften war Mendel gänzlich unbekannt. Umso erstaunlicher sind die Schlussfolgerungen, die er aus seinen Experimenten zog. Es war ein unglückliches Schicksal, das Mendel veranlasste, seine Versuche mit Hieracium, dem Habichtskraut, zu wiederholen. Die Kreuzungen mit Hieracium lieferten komplett andere Ergebnisse; so waren die Nachkommen aller Kreuzungen immer der Mutter ähnlich und spalteten nicht in den angenommenen Verhältnissen auf, so dass keine Universalität der Ergebnisse, die er mit Erbsen erzielt hatte, angenommen werden konnte. An diesem Punkt hörte Mendel mit seinen Kreuzungsversuchen auf. Es brauchte mehr als 30 Jahre, bis der Grund für das unterschiedliche Verhalten von Hieracium und Erbse geklärt werden konnte und bis zur Wiederentdeckung der Mendelschen Gesetze. Heute ist uns bekannt, warum Hieracium eine denkbar schlechte Wahl für die Wiederholung der Experimente war. Viele Hieracium-Arten vermehren sich apomiktisch, und somit besitzen die Nachkommen den Genotyp der Mutterpflanze. Da es nicht zu einer Mischung der männlichen und weiblichen Erbinformation kommt, kann auch keine Aufspaltung dieser Information beobachtet werden. Welche Mechanismen ermöglichen die apomiktische Fortpflanzung? 3.2 Apomiktische Mutanten in Arabidopsis Apomiktische Pflanzenarten sind für genetische Untersuchungen schlecht geeignet, da ihr Genom meistens aus Abb. 1. Schematische Darstellung der Mendelschen Gesetze. Uniformitätsgesetz: Die F1-Nachkommen einer Kreuzung zweier reinerbiger Eltern haben die gleichen Eigenschaften. Im dargestellten Beispiel sind die Eltern reinerbig für die Blütenfarbe rot (AA, dominantes Allel) und weiss (aa, rezessives Allel). Die F1-Nachkommen dieser Eltern haben alle rote Blüten (Aa). Spaltungsgesetz: Die F2-Nachkommen spalten in einem bestimmten Verhältnis auf. Im dargestellten Beispiel ist das Verhältnis drei (AA und Aa, rot) zu eins (aa, weiss). Die rote Blütenfarbe wird durch grau symbolisiert. Fig. 1. Schematic presentation of first Mendelian law of independent segregation. The F1 progeny of a cross of two pure breeding parents have the same phenotype, whereas the F2 progeny will segregate in a defined ratio. In the shown example two parents are pure breeding for the flower color red (AA, dominant) and white (aa, recessive). The F1 progeny of these parents will all have red colored flowers (Aa). The F2 progeny will segregate in the ratio three (red) to one (white). Red flower color is symbolized by grey. 115
4 Claudia Köhler mehr als einem doppelten Chromosomensatz besteht (Polyploidie). Daher wurde versucht, die genetischen Ursachen für Apomixis in der Modellpflanze Arabidopsis zu finden. Arabidopsis pflanzt sich nicht apomiktisch fort, somit stellt sich die Frage, welcher Mechanismus verhindert Apomixis hier wie auch in den meisten anderen Pflanzen? Diese Frage wurde sehr erfolgreich durch genetische Experimente in Arabidopsis adressiert. Hierzu wurden Mutanten mit apomiktischen Eigenschaften gesucht. Dazu wurden die Samen einer konditional männlich sterilen Arabidopsis-Pflanze (d. h. man kann die Sterilität unter bestimmten Bedingungen revertieren) chemisch mutagenisiert. Die sich aus diesen mutierten Samen entwickelnden Pflanzen wurden untersucht, ob sie die Fähigkeit besitzen, trotz des fehlenden Pollens Samen zu bilden. Mutanten mit diesen Eigenschaften wurden tatsächlich gefunden. Allerdings kommt es in Abb. 2. Schema der befruchtungsunabhängigen Samenentwicklung in fis-mutanten im diesen Samen nicht zur Bildung Vergleich zur Samenentwicklung im Wildtyp. eines lebensfähigen Embryos, und Fig. 2. Scheme showing fertilization independent seed development in fis mutants in comsie abortieren (CHAUDHURY et al., parison to wild-type plants. 1997; OHAD et al., 1996). Aus diees erschien nahe liegend, dass diese Proteine miteinander sen Ergebnissen wurde geschlossen, dass Apomixis aktiv interagieren und einen Multiproteinkomplex bilden. Dies reprimiert wird und ein repressiver Mechanismus die autowurde tatsächlich nachgewiesen, und der gebildete Komnome Teilung der Eizelle und der Zentralzelle verhindert. plex wird als FIS- (FERTILIZATION INDEPENDENT Wenn durch eine Mutation dieser repressive Block zerstört SEED) Komplex bezeichnet (KÖHLER et al., 2003). Einen wird, dann können Eizelle und Zentralzelle sich autonom sehr ähnlichen Komplex gibt es in Tieren den so genannteilen und ein asexuelles Endosperm und einen parthenoten Polycomb repressive complex 2 (PRC2). Wie der Name genetischen Embryo bilden (Abb. 2). nahe legt, hatte man die für diesen Komplex kodierenden Gene zuerst in der Fruchtfliege Drosophila gefunden. Mutationen in Untereinheiten dieses Komplexes führen zur 4 MOLEKULARER MECHANISMUS DER vermehrten Ausbildung von Sexkämmen an den Beinen ZELLTEILUNGSREPRESSION der männlichen Fliegen. Dieser Phänotyp liess vermuten, dass der PRC2-Komplex für die Aufrechterhaltung be4.1 Repression der Zellteilung durch einen stimmter Genaktivitätszustände während der Drosophilaevolutionär konservierten Proteinkomplex Entwicklung nötig ist. Bildlich gesprochen bilden diese Die in den Mutanten betroffenen Gene wurden identifiproteine das molekulare Gedächtnis einer Zelle und stellen ziert, und die kodierten Proteine wurden charakterisiert. sicher, dass etablierte Transkriptionszustände während der 116
5 Reproduktionsbiologie in Pflanzen mit und ohne Mendel Zellteilung nicht vergessen werden. Insbesondere bewirken sie eine andauernde Inaktivierung von Genen, die in bestimmten Organen nicht mehr gebraucht werden. Wie funktioniert der molekulare Mechanismus? Die die Erbinformation kodierende DNA (Desoxyribonucleinsäure) liegt als Komplex mit DNA-bindenden Proteinen (z. B. Histonen) im Zellkern vor. Dieser DNA-Protein-Komplex wird als Chromatin bezeichnet. Der PRC2-Komplex bindet an das Chromatin und modifiziert bestimmte Histone durch das Anfügen von Methylgruppen. Diese Methylierung wird von einem anderen Proteinkomplex erkannt, dem PRC1-Komplex, der durch eine weitere Histonmodifikation das stabile Ausschalten der modifizierten Gene erreicht (RINGROSE et al., 2004). 4.2 Molekularer Mechanismus des FIS- Komplexes in Arabidopsis Wenn der pflanzliche FIS-Komplex genau wie der tierische PRC2-Komplex Gene inaktiviert, dann erwartet man, dass Gene, die normalerweise vom FIS-Komplex inaktiviert werden, in fis-mutanten, denen der FIS-Komplex fehlt, verstärkt aktiv sind. Nach solchen Genen wurde gezielt gesucht, indem die Genaktivitätsmuster von fis-mutanten und normalen Pflanzen (Wildtyp) verglichen wurden. Dieses Vorgehen führte zur Identifizierung von PHERES1, ein für einen Transkriptionsfaktor kodierendes Gen. Die Untersuchung der Histonmodifizierungen am PHERES1- Gen zeigten, dass auch PHERES1 durch den FIS-Komplex methyliert wird (KÖHLER et al., 2003; MAKAREVICH et al., 2006; Abb. 3). Es kann daher angenommen werden, dass die Funktionsweise der Polycomb-Komplexe evolutionär konserviert ist. Interessanterweise sind aber die Proteine, die für die Erkennung der modifizierten Histone verantwortlich sind und die transkriptionelle Repression bewirken, nicht evolutionär konserviert; sie wurden bislang in Pflanzen nicht gefunden. 5 POLYCOMB-KOMPLEXE REGULIEREN ALLEL- SPEZIFISCHE GENAKTIVITÄT 5.1 Funktion des PRC2-Komplexes im Menschen Der menschliche PRC2-Komplex spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Embryo und Plazenta. Für die normale Entwicklung eines menschlichen Embryos werden die von beiden Eltern geerbten Gene benötigt. Allerdings ist es für die normale Entwicklung essentiell, dass bei einigen Genen nur eines der geerbten Allele aktiv ist, also entweder das mütterliche (maternale) oder das väterliche (paternale) Allel. Dieses Phänomen der monoallelischen Genaktivität wird als Imprinting bezeichnet und wird unter anderem durch die Proteine des PRC2-Komplexes sichergestellt. Wenn die monoallelische Genaktivität gestört wird, führt dies zu schwerwiegenden Entwicklungsstörungen. Die wohl bekanntesten Beispiele hierfür sind das Prader-Willi-Syndrom (PWS) und das Angelmann-Syndrom (AS), die, obwohl die gleiche Region auf Chromosom 15 betroffen ist, ganz verschiedene Krankheitsbilder zeigen. Wenn zufällig diese Region auf dem väterlichen Chromosom deletiert ist, entwickelt sich das PWS, wenn hingegen das mütterliche Chromosom defekt ist, entwickelt sich das AS. Es spielt also eine entscheidende Rolle, von welchem Elter die Mutation geerbt wurde, eine klare Verletzung der Abb. 3. PHERES1-Aktivität kann mittels eines β-glucoronidase-reportergens visualisiert werden. (A) PHERES1-Aktivität wird im Wildtyp Samen durch den FIS-Komplex reprimiert. (B) In den fis-mutanten bleibt PHERES1 stark aktiv, bis der Samen abortiert. (C) Schematische Darstellung der PHERES1-Repression durch den FIS-Komplex. Kugeln symbolisieren Methylierung. Fig. 3. PHERES1 activity can be visualized using a β-glucoronidase reporter gene. (A) In wild-type, PHERES1 is repressed by the FIS complex. (B) In fis mutants, PHERES1 remains active until the seed aborts. (C) Schematic presentation of FIS complex mediated PHERES1 repression. Lollipops represent methylation. 117
6 Claudia Köhler Mendelschen Gesetze, die beinhalten, dass die Richtung der Vererbung keinen Einfluss auf den Phänotyp hat. Es gibt etwa 80 geimprintete Gene beim Menschen, und viele dieser Gene spielen eine wichtige Rolle bei der Plazentaentwicklung. 5.2 Regulation von Imprinting in Blütenpflanzen Die Plazenta ernährt den sich entwickelnden Embryo, und aus physiologischer Sicht gibt es viele Parallelen zwischen dem Endosperm in Blütenpflanzen und der Plazenta in Säugern. Auch das Endosperm wird nach der Befruchtung gebildet und versorgt den sich entwickelnden Embryo mit Nährstoffen, indem es den Transfer der Nährstoffe von der Mutterpflanze zum Embryo reguliert. Aufgrund dieser Parallelen war es eine nahe liegende Frage, ob der FIS-Komplex in Blütenpflanzen ebenfalls Imprinting reguliert. Dies ist tatsächlich der Fall. Bei PHERES1, dem Zielgen des FIS-Komplexes, ist vorrangig das paternal geerbte Allel aktiv, während das maternale Allel der Inaktivierung durch den FIS-Komplex unterliegt. Diese Ergebnisse zeigen, dass der FIS-Komplex Imprinting in Pflanzen reguliert (KÖH- LER et al., 2005). Was ist die biologische Relevanz von Imprinting in Pflanzen? Hinweise zu dieser Frage liefern Untersuchungen, in denen Arabidopsis-Pflanzen mit unterschiedlichen Chromosomenzahlen miteinander gekreuzt wurden. Auf einer tetraploiden Mutterpflanze (verdoppelte Chromosomenzahl), die mit Pollen einer Wildtyppflanze (einfache Chromosomenzahl, diploid) bestäubt wird, entwickeln sich sehr kleine Samen. Das Ergebnis der Kreuzung ist genau umgekehrt, wenn der Vater die doppelte Chromosomenzahl beisteuert, die Samen werden signifikant grösser. Dieses Experiment legt nahe, dass geimprintete Gene in Pflanzen die Samengrösse regulieren (SCOTT et al., 1998). Wie könnte Imprinting evolutionär entstanden sein? Zu dieser Frage haben David Haig und Mark Westoby eine allgemein akzeptierte Theorie vorgeschlagen (HAIG et al., 1989). Dieser Theorie liegen zwei Annahmen zugrunde; (1.) die Mutter stellt alle Nährstoffe für die sich entwickelnden Nachkommen zur Verfügung, während die väterlichen Investitionen vernachlässigbar sind, (2.) die Nachkommen einer Mutter können unterschiedliche Väter haben. Unter diesen Voraussetzungen kann man postulieren, dass eine väterlich vererbte Mutation, die das Grössenwachstum positiv beeinflusst, den Nachkommen dieses Vaters einen Wachstumsvorteil verschafft. Da die Mutter nur über limitierte Ressourcen verfügt, wird dieser Wachstumsvorteil auf Kosten der Geschwister erlangt, die diese Mutation nicht geerbt haben. Dies kreiert einen Konflikt zwischen einem kurzfristigen Vorteil für einige Individuen, der auf Kosten vieler anderer Individuen erreicht wird. Dieser Konflikt ist wahrscheinlich die Triebkraft für die Evolution von geimprinteten Genen. Dies wird durch die Tatsache bekräftigt, dass eine Vielzahl von geimprinteten Genen Wachstumsregulatoren kodieren. Wachstumsstimulierende Faktoren sind paternal aktiv und maternal inaktiv; wachstumsinhibierende Faktoren sind maternal aktiv und paternal inaktiv. 6 AUSBLICK Die Identifizierung der fis-mutanten und der in diesen Mutanten betroffenen Gene war ein Durchbruch für unser Verständnis der Unterdrückung der apomiktischen Fortpflanzung in sexuellen Arten, aber wichtige Fragen sind noch unbeantwortet: Welche Rolle spielen die FIS-Gene in apomiktischen Arten? Welche Proteine erkennen die Histonmodifizierungen und wie ist die Verbindung zwischen Histonmodifizierung und Geninaktivierung? Welche Gene werden durch Imprinting reguliert und was ist die Funktion dieser Gene? Geimprintete Gene regulieren das Grössenwachstum von Samen. Da Pflanzensamen die Grundlage für die menschliche und tierische Ernährung bilden, ist das Verständnis von den der Samenbildung zugrunde liegenden Prozesse ein notwendiges Interesse. 7 LITERATUR BOAVIDA, L.C., BECKER, J.D. & FEIJO, J.A The making of gametes in higher plants. The International Journal of Developmental Biology 49, CARLSON, E.A Mendel s Legacy-The origin of classical genetics. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, pp. CHAUDHURY, A.M., MING, L., MILLER, C., CRAIG, S., DENNIS, E.S. & PEACOCK, W.J Fertilization-independent seed development in Arabidopsis thaliana. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 94, HAIG, D. & WESTOBY, M Parent specific gene expression and the triploid endosperm. American Nature 134, HUALA, E., DICKERMAN, A.W., GARCIA-HERNANDEZ, M., WEEMS, D., REISER, L., LAFOND, F., HANLEY, D., KIPHART, D., ZHUANG, M., HUANG, W., MUELLER, L.A., BHATTACHARYYA, D., BHAYA, D., SOBRAL, B.W., BEAVIS, W., MEINKE, D.W., 118
7 Reproduktionsbiologie in Pflanzen mit und ohne Mendel TOWN, C.D. & SOMERVILLE, C The Arabidopsis information resource (TAIR): a comprehensive database and web-based information retrieval, analysis, and visualization system for a model plant. Nucleic Acids Research 29, KÖHLER, C., HENNIG, L., BOUVERET, R., GHEYSELINCK, J., GROSSNIKLAUS, U. & GRUISSEM, W Arabidopsis MSI1 is a component of the MEA/FIE Polycomb group complex and required for seed development. EMBO Journal 22, KÖHLER, C., HENNIG, L., SPILLANE, C., PIEN, S., GRUISSEM, W. & GROSSNIKLAUS, U The Polycomb-group protein MEDEA regulates seed development by controlling expression of the MADS-box gene PHERES1. Genes & Development 17, KÖHLER, C., PAGE, D.R., GAGLIARDINI, V. & GROSSNIKLAUS, U The Arabidopsis thaliana MEDEA Polycomb group protein controls expression of PHERES1 by parental imprinting. Nature Genetics 37, KOLTUNOW, A.M Apomixis: embryo sacs and embryos formed without meiosis or fertilization in ovules. Plant Cell 5, KONCZ, C., CHUA, N.-H. & SCHELL, J Methods in Arabidopsis Research. World Scientific Publishing Co., Singapore, pp. MAKAREVICH, G., LEROY, O., AKINCI, U., SCHUBERT, D., CLA- RENZ, O., GOODRICH, J., GROSSNIKLAUS, U. & KÖHLER, C Different Polycomb group complexes regulate common target genes in Arabidopsis. EMBO Reports, in press. OHAD, N., MARGOSSIAN, L., HSU, Y.-C., WILLIAMS, C. AND P. & FISCHER, R.L A mutation that allows endosperm development without fertilization. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 93, RINGROSE, L. & PARO, R Epigenetic regulation of cellular memory by the polycomb and trithorax group proteins. Annual Reviews of Genetics 38, SCOTT, R.J., SPIELMAN, M., BAILEY, J. & DICKINSON, H.G Parent-of-origin effects on seed development in Arabidopsis thaliana. Development, 125, Prof. Dr. Claudia Köhler, ETH Zürich, Institut für Pflanzenwissenschaften, LFW, E31, Universitätsstrasse 2, 8092 Zürich, koehlerc@ethz.ch 119
Grundlagen der Vererbungslehre
 Grundlagen der Vererbungslehre Zucht und Fortpflanzung Unter Zucht verstehen wir die planvolle Verpaarung von Elterntieren, die sich in ihren Rassemerkmalen und Nutzleistungen ergänzen zur Verbesserung
Grundlagen der Vererbungslehre Zucht und Fortpflanzung Unter Zucht verstehen wir die planvolle Verpaarung von Elterntieren, die sich in ihren Rassemerkmalen und Nutzleistungen ergänzen zur Verbesserung
Research Collection. Identification of imprinted genes and their functional roles in Arabidopsis thaliana. Doctoral Thesis.
 Research Collection Doctoral Thesis Identification of imprinted genes and their functional roles in Arabidopsis thaliana Author(s): Wolff, Philip Publication Date: 2015 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-010482475
Research Collection Doctoral Thesis Identification of imprinted genes and their functional roles in Arabidopsis thaliana Author(s): Wolff, Philip Publication Date: 2015 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-010482475
Mechanisms of polycomb group-mediated gene regulation in Arabidopsis thaliana
 Research Collection Doctoral Thesis Mechanisms of polycomb group-mediated gene regulation in Arabidopsis thaliana Author(s): Villar, Corina Belle R. Publication Date: 2010 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-006523012
Research Collection Doctoral Thesis Mechanisms of polycomb group-mediated gene regulation in Arabidopsis thaliana Author(s): Villar, Corina Belle R. Publication Date: 2010 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-006523012
Die Erbinformation ist in Form von Chromosomen = Kopplungsgruppen organisiert
 Die Erbinformation ist in Form von Chromosomen = Kopplungsgruppen organisiert Chromosom Chromatin Ausschnitt aus DNA-Doppelhelix Nukleosomen (Chromatin) Chromatinfaden höherer Ordnung Teil eines Chromosoms
Die Erbinformation ist in Form von Chromosomen = Kopplungsgruppen organisiert Chromosom Chromatin Ausschnitt aus DNA-Doppelhelix Nukleosomen (Chromatin) Chromatinfaden höherer Ordnung Teil eines Chromosoms
Mendel Gregor Mendel (*1822, 1884)
 Mendel Gregor Mendel (*1822, 1884) Mendels Vererbungsregeln 1. Mendel sche Regel Kreuzt man zwei reinerbige Rassen, die sich in einem Allelpaar unterscheiden, so sind die Nachkommen die erste Filialgeneration
Mendel Gregor Mendel (*1822, 1884) Mendels Vererbungsregeln 1. Mendel sche Regel Kreuzt man zwei reinerbige Rassen, die sich in einem Allelpaar unterscheiden, so sind die Nachkommen die erste Filialgeneration
Seminar zur Grundvorlesung Genetik
 Seminar zur Grundvorlesung Genetik Wann? Gruppe B1: Montags, 1600-1700 Wo? Kurt-Mothes-Saal, Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie Teilnahme obligatorisch, max. 1x abwesend Kontaktdaten Marcel Quint Leibniz-Institut
Seminar zur Grundvorlesung Genetik Wann? Gruppe B1: Montags, 1600-1700 Wo? Kurt-Mothes-Saal, Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie Teilnahme obligatorisch, max. 1x abwesend Kontaktdaten Marcel Quint Leibniz-Institut
Grundlagen der Genetik
 Grundlagen der Genetik Die Regeln der Vererbung Wer sind die Eltern? Alle Lebewesen vermehren sich. Dabei geben sie Eigenschaften an die Nachkommen weiter. Finden Sie heraus, wer die Eltern von Bully und
Grundlagen der Genetik Die Regeln der Vererbung Wer sind die Eltern? Alle Lebewesen vermehren sich. Dabei geben sie Eigenschaften an die Nachkommen weiter. Finden Sie heraus, wer die Eltern von Bully und
Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Tutorium SS 2016
 Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Tutorium SS 2016 Fragen für die Tutoriumsstunde 5 (27.06. 01.07.) Mendel, Kreuzungen, Statistik 1. Sie bekommen aus
Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Tutorium SS 2016 Fragen für die Tutoriumsstunde 5 (27.06. 01.07.) Mendel, Kreuzungen, Statistik 1. Sie bekommen aus
Natürliche Variation bei höheren Pflanzen Gene, Mechanismen, Natural variation in higher plants genes, mechanisms, evolution, plant breeding
 Natürliche Variation bei höheren Pflanzen Gene, Mechanismen, Natural variation in higher plants genes, mechanisms, evolution, plant breeding Koornneef, Maarten Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung,
Natürliche Variation bei höheren Pflanzen Gene, Mechanismen, Natural variation in higher plants genes, mechanisms, evolution, plant breeding Koornneef, Maarten Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung,
Genkartierung durch Rekombination in Drosophila. Chapter 4 Opener
 Genkartierung durch Rekombination in Drosophila Chapter 4 Opener Gekoppelte Allele werden zusammen vererbt n Figure 4-2 Crossing-Over erzeugt neue Allel-Kombinationen Figure 4-3 Crossover zwischen Chromatiden
Genkartierung durch Rekombination in Drosophila Chapter 4 Opener Gekoppelte Allele werden zusammen vererbt n Figure 4-2 Crossing-Over erzeugt neue Allel-Kombinationen Figure 4-3 Crossover zwischen Chromatiden
Learn4Med. Ein Gen steuert die Haarfarbe einer Katze. Es gibt ein Allel (also eine Version) für ein schwarzes Fell und ein Allel für rote Haare.
 1. Mendelsche Regeln Bei Mendel ist ein Gen als Teil des Erbmaterials definiert, der für die Ausbildung eines bestimmten Merkmals verantwortlich ist. Gibt es für dieses Gen verschiedene Ausprägungen, nennt
1. Mendelsche Regeln Bei Mendel ist ein Gen als Teil des Erbmaterials definiert, der für die Ausbildung eines bestimmten Merkmals verantwortlich ist. Gibt es für dieses Gen verschiedene Ausprägungen, nennt
science-live-lemgo Biotech-Labor für Schülerinnen und Schüler Inhaltsverzeichnis Liebe Schülerinnen und Schüler,
 Inhaltsverzeichnis Liebe Schülerinnen und Schüler, das folgende Material ermöglicht im Selbststudium - die Wiederholung der klassischen Genetik aus der Jahrgangsstufe 9 sowie - die Vorbereitung auf die
Inhaltsverzeichnis Liebe Schülerinnen und Schüler, das folgende Material ermöglicht im Selbststudium - die Wiederholung der klassischen Genetik aus der Jahrgangsstufe 9 sowie - die Vorbereitung auf die
Die Medelschen Regeln
 Die Medelschen Regeln Der erste Wissenschaftler, der Gesetzmäßigkeiten bei der Vererbung fand und formulierte, war Johann Gregor Mendel Mendel machte zur Erforschung der Vererbung Versuche und beschränkte
Die Medelschen Regeln Der erste Wissenschaftler, der Gesetzmäßigkeiten bei der Vererbung fand und formulierte, war Johann Gregor Mendel Mendel machte zur Erforschung der Vererbung Versuche und beschränkte
1 Regeln der Vererbung
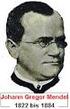 1 Regeln der Vererbung Natura Genetik 1 Regeln der Vererbung Lösungen zu den Aufgaben Seiten 6 7 1.1 Eltern geben genetisches Material weiter 1 Erstelle einen möglichen Karyogrammausschnitt für ein weiteres
1 Regeln der Vererbung Natura Genetik 1 Regeln der Vererbung Lösungen zu den Aufgaben Seiten 6 7 1.1 Eltern geben genetisches Material weiter 1 Erstelle einen möglichen Karyogrammausschnitt für ein weiteres
F2 aus der Kreuzung mit der ersten Mutante: 602 normal, 198 keine Blatthaare
 Klausur Genetik Name: Matrikelnummer: Sie haben 90 Minuten Zeit zur Bearbeitung der 23 Fragen (z. T. mit Unterpunkten). Insgesamt sind 42 Punkte zu vergeben. Die Klausur gilt als bestanden, falls 21 Punkte
Klausur Genetik Name: Matrikelnummer: Sie haben 90 Minuten Zeit zur Bearbeitung der 23 Fragen (z. T. mit Unterpunkten). Insgesamt sind 42 Punkte zu vergeben. Die Klausur gilt als bestanden, falls 21 Punkte
Seminar zur Grundvorlesung Genetik
 Seminar zur Grundvorlesung Genetik Wann? Gruppe B5: Donnerstags, 11 15-12 00 Wo? Raum 133 Teilnahme obligatorisch, max. 1x abwesend Kontaktdaten Marcel Quint Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie - Nachwuchsgruppe
Seminar zur Grundvorlesung Genetik Wann? Gruppe B5: Donnerstags, 11 15-12 00 Wo? Raum 133 Teilnahme obligatorisch, max. 1x abwesend Kontaktdaten Marcel Quint Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie - Nachwuchsgruppe
2. Übung: Chromosomentheorie
 Konzepte: 2. Übung: Chromosomentheorie Mitose/Meiose Geschlechtschromosomale Vererbung Chromosomentheorie Zellzyklus G 1 Phase: postmitotische Phase oder Präsynthesephase Zelle beginnt wieder zu wachsen
Konzepte: 2. Übung: Chromosomentheorie Mitose/Meiose Geschlechtschromosomale Vererbung Chromosomentheorie Zellzyklus G 1 Phase: postmitotische Phase oder Präsynthesephase Zelle beginnt wieder zu wachsen
Chromosomen & Populationsgenetik (1)
 Übungsblatt Molekularbiologie und Genetik für Studierende der Bioinformatik II 1 Name des Studierenden: Datum: 1 Karyogramme Chromosomen & Populationsgenetik (1) Bestimmen Sie den Karyotyp der folgenden
Übungsblatt Molekularbiologie und Genetik für Studierende der Bioinformatik II 1 Name des Studierenden: Datum: 1 Karyogramme Chromosomen & Populationsgenetik (1) Bestimmen Sie den Karyotyp der folgenden
Laborbiologie WS14/15 Drosophila-Kreuzungsgenetik Teil I
 Laborbiologie WS14/15 Drosophila-Kreuzungsgenetik Teil I Dr. Robert Klapper Ziele der beiden Kurstage: Verknüpfung von praktischen Erfahrungen in der Kreuzungsgenetik mit grundlegenden Methoden der Statistik
Laborbiologie WS14/15 Drosophila-Kreuzungsgenetik Teil I Dr. Robert Klapper Ziele der beiden Kurstage: Verknüpfung von praktischen Erfahrungen in der Kreuzungsgenetik mit grundlegenden Methoden der Statistik
-Generation sehen alle gleich aus (Uniformitätsregel). In der F 2. -Generation treten unterschiedliche Phänotypen auf (Spaltungsregel).
 Mendelsche Regeln 1 + 2 (1) Merkmale wie die Blütenfarbe können dominant-rezessiv oder intermediär vererbt werden. Bei einem intermediären Erbgang wird die Merkmalsausprägung von beiden Allelen (z. B.
Mendelsche Regeln 1 + 2 (1) Merkmale wie die Blütenfarbe können dominant-rezessiv oder intermediär vererbt werden. Bei einem intermediären Erbgang wird die Merkmalsausprägung von beiden Allelen (z. B.
Komplementation. Allelische Interaktionen. Gen Interaktionen
 3. Gen Interaktionen Konzepte: Komplementation Allelische Interaktionen Gen Interaktionen 1. Beschreiben Sie einen Mutagenese Screen (Genetic Screen). Wozu wird er angewendet? Ziel: Identifizierung von
3. Gen Interaktionen Konzepte: Komplementation Allelische Interaktionen Gen Interaktionen 1. Beschreiben Sie einen Mutagenese Screen (Genetic Screen). Wozu wird er angewendet? Ziel: Identifizierung von
Gregor Mendel. Gregor Mendel
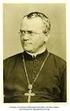 Gregor Mendel * 1822 in Brünn Studium der Physik, Mathematik u. Naturwissenschaften an der Univ. Wien Rückkehr nach Brünn in das Augustinerkloster 1857: Beginn der Experimente zur Vererbung 1865: Publikation
Gregor Mendel * 1822 in Brünn Studium der Physik, Mathematik u. Naturwissenschaften an der Univ. Wien Rückkehr nach Brünn in das Augustinerkloster 1857: Beginn der Experimente zur Vererbung 1865: Publikation
The role of the FIS polycomb group complex during seed development
 Research Collection Doctoral Thesis The role of the FIS polycomb group complex during seed development Author(s): Hehenberger, Elisabeth Christine Publication Date: 2011 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-006698643
Research Collection Doctoral Thesis The role of the FIS polycomb group complex during seed development Author(s): Hehenberger, Elisabeth Christine Publication Date: 2011 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-006698643
3. Gen-Interaktionen
 3. Gen-Interaktionen Rückblick: 1Gene(2 Allele ) Merkmal1 1Gene(2 Allele ) Merkmal2 1 Gen (2 Allele = dominant + rezessiv) 1 Merkmal mit 2 Phänotypklassen bisher: keine Gen-/Allel-Interaktionen berücksichtigt!
3. Gen-Interaktionen Rückblick: 1Gene(2 Allele ) Merkmal1 1Gene(2 Allele ) Merkmal2 1 Gen (2 Allele = dominant + rezessiv) 1 Merkmal mit 2 Phänotypklassen bisher: keine Gen-/Allel-Interaktionen berücksichtigt!
Research Collection. Arabidopsis MSI1 is required for the control of flowering time. Doctoral Thesis. ETH Library. Author(s): Möller-Steinbach, Yvonne
 Research Collection Doctoral Thesis Arabidopsis MSI1 is required for the control of flowering time Author(s): Möller-Steinbach, Yvonne Publication Date: 2009 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-006030648
Research Collection Doctoral Thesis Arabidopsis MSI1 is required for the control of flowering time Author(s): Möller-Steinbach, Yvonne Publication Date: 2009 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-006030648
Klassische Genetik. Die Mendelschen Regeln
 Klassische Genetik Die Mendelschen egeln Übersicht 1 Die klassische Genetik eine Einführung 1 2 Die Mendelschen egeln 1 2.1 Die Erste Mendel sche egel Die Uniformitätsregel..................... 3 2.2 Die
Klassische Genetik Die Mendelschen egeln Übersicht 1 Die klassische Genetik eine Einführung 1 2 Die Mendelschen egeln 1 2.1 Die Erste Mendel sche egel Die Uniformitätsregel..................... 3 2.2 Die
Einstieg: Fortpflanzung
 Einstieg: Fortpflanzung Wozu ist Sex gut? - Nachkommen werden gezeugt --> Erhalt der Spezies. - Es entstehen Nachkommen mit Merkmalen (z.b. Aussehen), die denen von Vater und Mutter ähneln. Beide Eltern
Einstieg: Fortpflanzung Wozu ist Sex gut? - Nachkommen werden gezeugt --> Erhalt der Spezies. - Es entstehen Nachkommen mit Merkmalen (z.b. Aussehen), die denen von Vater und Mutter ähneln. Beide Eltern
Die klassische Genetik nach Gregor Mendel: Dihybride Erbgänge
 Die klassische Genetik nach Gregor Mendel: Dihybride Erbgänge Stand: 10.01.2018 Jahrgangsstufen Fach/Fächer Vorklasse Biologie (Ausbildungsrichtungen Sozialwesen, Gesundheit) Übergreifende Bildungsund
Die klassische Genetik nach Gregor Mendel: Dihybride Erbgänge Stand: 10.01.2018 Jahrgangsstufen Fach/Fächer Vorklasse Biologie (Ausbildungsrichtungen Sozialwesen, Gesundheit) Übergreifende Bildungsund
Pharmazeutische Biologie Genetik
 Pharmazeutische Biologie Genetik N230-Raum 306 Tel. (069) 798-29650 dingermann@em.uni-frankfurt.de Gregor Mendel, 1822 1884 "Versuche üer Pflanzenhyriden" Uniformitätsgesetz: Nachkommen homozygoter Eltern
Pharmazeutische Biologie Genetik N230-Raum 306 Tel. (069) 798-29650 dingermann@em.uni-frankfurt.de Gregor Mendel, 1822 1884 "Versuche üer Pflanzenhyriden" Uniformitätsgesetz: Nachkommen homozygoter Eltern
Gesetzmäßigkeiten der Vererbung von Merkmalen: Die Mendelschen Regeln
 Die Mendelschen Regeln Mitte voriges Jahrhundert => DNS und Co noch unbekannt Versuche mit dem Ziel, die Gesetzmäßigkeiten der Vererbung von Merkmalen. Versuchsobjekt: Erbsen. Vorteile: 1. Variantenreich:
Die Mendelschen Regeln Mitte voriges Jahrhundert => DNS und Co noch unbekannt Versuche mit dem Ziel, die Gesetzmäßigkeiten der Vererbung von Merkmalen. Versuchsobjekt: Erbsen. Vorteile: 1. Variantenreich:
Modul Biologische Grundlagen Kapitel I.2 Grundbegriffe der Genetik
 Frage Was sind Fachbegriffe zum Thema Grundbegriffe der Genetik? Antwort - Gene - Genotyp - Phänotyp - Genom - Dexoxyribonucleinsäure - Träger genetischer Information - Nukleotide - Basen - Peptid - Start-Codon
Frage Was sind Fachbegriffe zum Thema Grundbegriffe der Genetik? Antwort - Gene - Genotyp - Phänotyp - Genom - Dexoxyribonucleinsäure - Träger genetischer Information - Nukleotide - Basen - Peptid - Start-Codon
Molekulargenetik der Eukaryoten WS 2014/15, VL 10. Erwin R. Schmidt Institut für Molekulargenetik
 Molekulargenetik der Eukaryoten WS 2014/15, VL 10 Erwin R. Schmidt Institut für Molekulargenetik Replikationsgabel bei Prokaryoten Replikationsgabel bei Eukaryoten Pol e Pol d GINS (Go, Ichi, Nii, and
Molekulargenetik der Eukaryoten WS 2014/15, VL 10 Erwin R. Schmidt Institut für Molekulargenetik Replikationsgabel bei Prokaryoten Replikationsgabel bei Eukaryoten Pol e Pol d GINS (Go, Ichi, Nii, and
Biologiestunde zusammengefasst von Danial Jbeil. K) Die klassische Vererbungslehre : Das erste Mendelsche Gesetz: Uniformitätsgesetz
 Biologiestunde zusammengefasst von Danial Jbeil K) Die klassische Vererbungslehre : Sie wurde von Gregor Mendel im 19.Jahrhundert begründet, die Menschen wussten damals nichts -kein Zellkern, keine DNA,
Biologiestunde zusammengefasst von Danial Jbeil K) Die klassische Vererbungslehre : Sie wurde von Gregor Mendel im 19.Jahrhundert begründet, die Menschen wussten damals nichts -kein Zellkern, keine DNA,
Mathematik in der Evolutionsbiologie
 Mathematik in der Evolutionsbiologie Vom Konflikt zwischen Mendelianern und Biometrikern zur modernen Populationsgenetik Wolfgang Stephan Abt. Evolutionsbiologie LMU München Reaktionen auf Darwins Evolutionstheorie
Mathematik in der Evolutionsbiologie Vom Konflikt zwischen Mendelianern und Biometrikern zur modernen Populationsgenetik Wolfgang Stephan Abt. Evolutionsbiologie LMU München Reaktionen auf Darwins Evolutionstheorie
Blütenbildung und Fruchtbarkeit: Wird sie von weiteren noch
 Blütenbildung und Fruchtbarkeit: Wird sie von weiteren noch Flowering and Fertility: beyond the MADS-box genes Huijser, Peter Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung, Köln Korrespondierender
Blütenbildung und Fruchtbarkeit: Wird sie von weiteren noch Flowering and Fertility: beyond the MADS-box genes Huijser, Peter Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung, Köln Korrespondierender
Pflanzenphysiologie 6: Blüten und Befruchtung
 Pflanzenphysiologie 6: Blüten und Befruchtung Auslösen der Blütenbildung Identität des Apikalmeristems Befruchtung und Embryogenese Copyright Hinweis: Das Copyright der in dieser Vorlesung genannten Lehrbücher
Pflanzenphysiologie 6: Blüten und Befruchtung Auslösen der Blütenbildung Identität des Apikalmeristems Befruchtung und Embryogenese Copyright Hinweis: Das Copyright der in dieser Vorlesung genannten Lehrbücher
Grundlagen zur Vererbung von Eigenschaften und Fehlern
 Züchterversammlung 2009 Grundlagen zur Vererbung von Eigenschaften und Fehlern (nach: Genetik und Züchtungslehre, von Heinrich Binder, Dr. med. vet., Dozent für Tierzucht am Tierspital ZH) überarbeitet
Züchterversammlung 2009 Grundlagen zur Vererbung von Eigenschaften und Fehlern (nach: Genetik und Züchtungslehre, von Heinrich Binder, Dr. med. vet., Dozent für Tierzucht am Tierspital ZH) überarbeitet
2. Übung: Chromosomentheorie
 Konzepte: 2. Übung: Chromosomentheorie Mitose/Meiose Geschlechtschromosomale Vererbung Chromosomentheorie Regeln zur Vererbung Autosomal rezessiv: - Merkmal tritt auf in Nachkommen nicht betroffener Eltern
Konzepte: 2. Übung: Chromosomentheorie Mitose/Meiose Geschlechtschromosomale Vererbung Chromosomentheorie Regeln zur Vererbung Autosomal rezessiv: - Merkmal tritt auf in Nachkommen nicht betroffener Eltern
Genetische Kontrolle der Entwicklung mehrzelliger Eukaryonten
 1. Was sind maternale Effektgene, wann entstehen aus diesen Genen Genprodukte und wo sind diese lokalisiert? Welche Aspekte der Entwicklung steuern maternale Effektgene? Übung 12 Entwicklungsgenetik Genetische
1. Was sind maternale Effektgene, wann entstehen aus diesen Genen Genprodukte und wo sind diese lokalisiert? Welche Aspekte der Entwicklung steuern maternale Effektgene? Übung 12 Entwicklungsgenetik Genetische
Mendel Labor, Euregio Kolleg, Würselen 1/
 Mendel Labor, Euregio Kolleg, Würselen 1/13 14.7.04 Projekt MendelLab Die klassische Genetik eignet sich als fachübergreifendes Thema für die Fächer Biologie, Mathematik (Stochastik) und Informatik. In
Mendel Labor, Euregio Kolleg, Würselen 1/13 14.7.04 Projekt MendelLab Die klassische Genetik eignet sich als fachübergreifendes Thema für die Fächer Biologie, Mathematik (Stochastik) und Informatik. In
Teil Osiewacz, 8 Fragen, 55 Punkte)
 Teil Osiewacz, 8 Fragen, 55 Punkte) Frage 1: 8 Punkte Die Kernteilungsspindel ist aus verschiedenen Fasern aufgebaut. a) Welche Fasern sind das? (3 Punkte) b) Welche dieser Fasern setzen in der Metaphaseplatte
Teil Osiewacz, 8 Fragen, 55 Punkte) Frage 1: 8 Punkte Die Kernteilungsspindel ist aus verschiedenen Fasern aufgebaut. a) Welche Fasern sind das? (3 Punkte) b) Welche dieser Fasern setzen in der Metaphaseplatte
3. Gen-Interaktionen. Konzepte: Komplementation. Allelische Interaktionen. Gen-Interaktionen
 3. Gen-Interaktionen Konzepte: Komplementation Allelische Interaktionen Gen-Interaktionen 1. Beschreiben Sie einen Mutagenese Screen (Genetic Screen). Wozu wird er angewendet? Ziel: Identifizierung von
3. Gen-Interaktionen Konzepte: Komplementation Allelische Interaktionen Gen-Interaktionen 1. Beschreiben Sie einen Mutagenese Screen (Genetic Screen). Wozu wird er angewendet? Ziel: Identifizierung von
1. Übung: Mendel. Konzepte: Genetische Information. Pro und Eukaryoten. Dominanz/Rezessivität. Mendelsche Gesetze
 1. Übung: Mendel Konzepte: Genetische Information Pro und Eukaryoten Dominanz/Rezessivität Mendelsche Gesetze Spaltungsanalyse Genetische Information 1. Wo und wie liegt sie im Organismus vor? Vergleichen
1. Übung: Mendel Konzepte: Genetische Information Pro und Eukaryoten Dominanz/Rezessivität Mendelsche Gesetze Spaltungsanalyse Genetische Information 1. Wo und wie liegt sie im Organismus vor? Vergleichen
"Chromosomen Didac 2" Einzelsatz Best.- Nr / Paket von 6 Sätzen
 "Chromosomen Didac 2" Einzelsatz Best.- Nr. 2013336 / 2013337 Paket von 6 Sätzen Zusammensetzung Der Einzelsatz besteht aus: 2 blauen Sätzen mit 3 Chromosomen + 1 Geschlechtschromosom + 1 Stück von einem
"Chromosomen Didac 2" Einzelsatz Best.- Nr. 2013336 / 2013337 Paket von 6 Sätzen Zusammensetzung Der Einzelsatz besteht aus: 2 blauen Sätzen mit 3 Chromosomen + 1 Geschlechtschromosom + 1 Stück von einem
3. Gen-Interaktionen. Konzepte: Komplementation. Allelische Interaktionen. Gen-Interaktionen
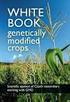 3. Gen-Interaktionen Konzepte: Komplementation Allelische Interaktionen Gen-Interaktionen 1. Beschreiben Sie einen Mutagenese Screen(Genetic Screen). Wozu wird er angewendet? Ziel: Identifizierung von
3. Gen-Interaktionen Konzepte: Komplementation Allelische Interaktionen Gen-Interaktionen 1. Beschreiben Sie einen Mutagenese Screen(Genetic Screen). Wozu wird er angewendet? Ziel: Identifizierung von
Teil Osiewacz, 5 Seiten, 5 Fragen, 50 Punkte
 Teil Osiewacz, 5 Seiten, 5 Fragen, 50 Punkte Frage 1: 10 Punkte a) Die Bildung der Gameten bei Diplonten und bei Haplonten erfolgt im Verlaufe von Kernteilungen. Ergänzen Sie die angefangenen Sätze (2
Teil Osiewacz, 5 Seiten, 5 Fragen, 50 Punkte Frage 1: 10 Punkte a) Die Bildung der Gameten bei Diplonten und bei Haplonten erfolgt im Verlaufe von Kernteilungen. Ergänzen Sie die angefangenen Sätze (2
Vorwort Seite 4. Einleitung Seite 5. Kapitel I: Zelluläre Grundlagen der Vererbung Seiten 6 28 VORSCHAU. Kapitel II: Vom Gen zum Merkmal Seiten 29 35
 Inhalt Vorwort Seite 4 Einleitung Seite 5 Kapitel I: Zelluläre Grundlagen der Vererbung Seiten 6 28 Vergleich Tier- und Planzenzelle Aufbau des Zellkerns Chromosomen Zellteilungsvorgänge Mitose Zellteilungsvorgänge
Inhalt Vorwort Seite 4 Einleitung Seite 5 Kapitel I: Zelluläre Grundlagen der Vererbung Seiten 6 28 Vergleich Tier- und Planzenzelle Aufbau des Zellkerns Chromosomen Zellteilungsvorgänge Mitose Zellteilungsvorgänge
Biologische Psychologie I Kapitel 2
 Biologische Psychologie I Kapitel 2 Evolution, Genetik und Erfahrung Von Dichotomien zu Beziehungen und Interaktionen Früher (z.t. auch heute noch) gestellte Fragen zum Verhalten: physiologisch oder psychologisch?
Biologische Psychologie I Kapitel 2 Evolution, Genetik und Erfahrung Von Dichotomien zu Beziehungen und Interaktionen Früher (z.t. auch heute noch) gestellte Fragen zum Verhalten: physiologisch oder psychologisch?
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Die klassische Genetik: T.H. Morgan und seine Experimente mit Drosophila melanogaster Das komplette Material finden Sie hier: Download
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Die klassische Genetik: T.H. Morgan und seine Experimente mit Drosophila melanogaster Das komplette Material finden Sie hier: Download
Kursexperiment Genkartierung in Caenorhabditis elegans. Peder Zipperlen-ThomasBerset
 Kursexperiment Genkartierung in Caenorhabditis elegans Peder Zipperlen-ThomasBerset Zeitplan Freitag 13.00-13.15 Theorie C.elegans: -Was ist C.elegans? 13.15-14.30 Theorie SNP und FLP Kartierung: -Was
Kursexperiment Genkartierung in Caenorhabditis elegans Peder Zipperlen-ThomasBerset Zeitplan Freitag 13.00-13.15 Theorie C.elegans: -Was ist C.elegans? 13.15-14.30 Theorie SNP und FLP Kartierung: -Was
Evolution und Entwicklung
 Evolution und Entwicklung Wie aus einzelnen Zellen die Menschen wurden: Phylogenese Klassische Genetik: Mendel Moderne Genetik: Watson & Crick Wie aus einer einzigen Zelle ein Mensch wird: Ontogenese Vererbung
Evolution und Entwicklung Wie aus einzelnen Zellen die Menschen wurden: Phylogenese Klassische Genetik: Mendel Moderne Genetik: Watson & Crick Wie aus einer einzigen Zelle ein Mensch wird: Ontogenese Vererbung
C SB. Genomics Herausforderungen und Chancen. Genomics. Genomic data. Prinzipien dominieren über Detail-Fluten. in 10 Minuten!
 Genomics Herausforderungen und Chancen Prinzipien dominieren über Detail-Fluten Genomics in 10 Minuten! biol. Prin cip les Genomic data Dr.Thomas WERNER Scientific & Business Consulting +49 89 81889252
Genomics Herausforderungen und Chancen Prinzipien dominieren über Detail-Fluten Genomics in 10 Minuten! biol. Prin cip les Genomic data Dr.Thomas WERNER Scientific & Business Consulting +49 89 81889252
Epigenetik pg. Molekulargenetik und Proteine Epigenetik. Ausblick. Schalter. Beispiele Prof. Dr. D. Hannemann, Epigenetik 2
 Epigenetik pg Kann der Mensch sein Erbgut verändern? 10.07.2011 Prof. Dr. D. Hannemann, Epigenetik 1 Einordnung Inhalt Molekulargenetik und Proteine Epigenetik Schalter Ist der Mensch was er isst? Beispiele
Epigenetik pg Kann der Mensch sein Erbgut verändern? 10.07.2011 Prof. Dr. D. Hannemann, Epigenetik 1 Einordnung Inhalt Molekulargenetik und Proteine Epigenetik Schalter Ist der Mensch was er isst? Beispiele
Referentinnen Lidia Vesic und Steffi Mairoser Seminar Vertiefung der Entwicklungspsychologie Kursleiterin Frau Kristen
 Referentinnen Lidia Vesic und Steffi Mairoser 25.10.2010 Seminar Vertiefung der Entwicklungspsychologie Kursleiterin Frau Kristen 1. Allgemeines zum wissenschaftlichen Ausgangsstand 2. Veranschaulichung
Referentinnen Lidia Vesic und Steffi Mairoser 25.10.2010 Seminar Vertiefung der Entwicklungspsychologie Kursleiterin Frau Kristen 1. Allgemeines zum wissenschaftlichen Ausgangsstand 2. Veranschaulichung
Zytologie, Zellteilung
 Biologie Zytologie, Zellteilung Zusammenfassungen Semesterprüfung Freitag, 17. Juni 2016 Zellbau Zelldifferenzierung Zellteilung (Zellzyklus, Mitose, Meiose) Marisa DESIGN + LAYOUT Steffi BIOLOGIE Zellbiologie
Biologie Zytologie, Zellteilung Zusammenfassungen Semesterprüfung Freitag, 17. Juni 2016 Zellbau Zelldifferenzierung Zellteilung (Zellzyklus, Mitose, Meiose) Marisa DESIGN + LAYOUT Steffi BIOLOGIE Zellbiologie
HISTONE MODIFICATIONS AND TRANSCRIPT PROCESSING DURING ARABIDOPSIS DEVELOPMENT
 DISS. ETH NO. 21256 HISTONE MODIFICATIONS AND TRANSCRIPT PROCESSING DURING ARABIDOPSIS DEVELOPMENT A dissertation submitted to ETH ZURICH for the degree of Doctor of Sciences presented by Walid Mahrez
DISS. ETH NO. 21256 HISTONE MODIFICATIONS AND TRANSCRIPT PROCESSING DURING ARABIDOPSIS DEVELOPMENT A dissertation submitted to ETH ZURICH for the degree of Doctor of Sciences presented by Walid Mahrez
Vererbungsgesetze, Modell
 R Vererbungsgesetze, Modell 65564.00 Betriebsanleitung Das Model besteht aus einem Satz von 204 Symbolkarten und 3 Kreuzungs- und Nachkommenslinien. 81 der Symbolkarten zeigen Erscheinungsbilder (Phänotypen),
R Vererbungsgesetze, Modell 65564.00 Betriebsanleitung Das Model besteht aus einem Satz von 204 Symbolkarten und 3 Kreuzungs- und Nachkommenslinien. 81 der Symbolkarten zeigen Erscheinungsbilder (Phänotypen),
Pinschertage der OG Bonn Grundlagen der Zucht
 Pinschertage der OG Bonn 31.05. - 01.06.2008 Grundlagen der Zucht von Ralf Wiechmann Der Phänotyp Ist die Gesamtheit der wahrnehmbaren Merkmale eines Organismus. das äußere Erscheinungsbild das Aussehen,
Pinschertage der OG Bonn 31.05. - 01.06.2008 Grundlagen der Zucht von Ralf Wiechmann Der Phänotyp Ist die Gesamtheit der wahrnehmbaren Merkmale eines Organismus. das äußere Erscheinungsbild das Aussehen,
Vererbung - Grundlagen
 Vererbung - Grundlagen Grundbegriffe Was wird vererbt? Dass Kinder ihren Eltern in vielen Eigenschaften ähnlich sind, ist ja keine Neuigkeit, aber wie ist das möglich? Kinder entwickeln sich ja aus einer
Vererbung - Grundlagen Grundbegriffe Was wird vererbt? Dass Kinder ihren Eltern in vielen Eigenschaften ähnlich sind, ist ja keine Neuigkeit, aber wie ist das möglich? Kinder entwickeln sich ja aus einer
Evolution, Genetik und Erfahrung
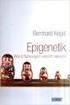 Chromosomen, Fortpflanzung und Genkopplung Entscheidende Entdeckung: Gene sind auf Chromosomen lokalisiert! 1 CHROMOSOM fadenförmige Strukturen im Kern der Zellen (wikipedia) Chromosomen in Körperzellen
Chromosomen, Fortpflanzung und Genkopplung Entscheidende Entdeckung: Gene sind auf Chromosomen lokalisiert! 1 CHROMOSOM fadenförmige Strukturen im Kern der Zellen (wikipedia) Chromosomen in Körperzellen
Genetik und Farbvererbung
 Genetik und Farbvererbung Grundbegriffe der Genetik - Lebewesen sind aus vielen Zellen aufgebaut im Zellkern: DNA (Träger der Erbinformation) - Gen = Erbanlage, DNA-Abschnitt der bestimmte Funktion eines
Genetik und Farbvererbung Grundbegriffe der Genetik - Lebewesen sind aus vielen Zellen aufgebaut im Zellkern: DNA (Träger der Erbinformation) - Gen = Erbanlage, DNA-Abschnitt der bestimmte Funktion eines
Genetik. Biologie. Zusammenfassungen. Prüfung 31. Mai Begriffserklärung. Dominant-Rezessiver Erbgang. Intermediärer Erbgang. Dihybrider Erbgang
 Biologie Genetik Zusammenfassungen Prüfung 31. Mai 2016 Begriffserklärung Dominant-Rezessiver Erbgang Intermediärer Erbgang Dihybrider Erbgang Geschlechtsgekoppelte Vererbung Vererbung der Blutgruppen
Biologie Genetik Zusammenfassungen Prüfung 31. Mai 2016 Begriffserklärung Dominant-Rezessiver Erbgang Intermediärer Erbgang Dihybrider Erbgang Geschlechtsgekoppelte Vererbung Vererbung der Blutgruppen
Wechselwirkungen zwischen Genen. Chapter 6 Opener
 Wechselwirkungen zwischen Genen Chapter 6 Opener Kurze Wiederholung: Mutationen Haplosuffizienter Gene sind oft rezessiv! DNA RNA Protein Funktional Figure Funktional 6-2 Defekt Funktional Defekt Defekt
Wechselwirkungen zwischen Genen Chapter 6 Opener Kurze Wiederholung: Mutationen Haplosuffizienter Gene sind oft rezessiv! DNA RNA Protein Funktional Figure Funktional 6-2 Defekt Funktional Defekt Defekt
BARNSTAR EIN VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG MÄNNLICH STERILER TOMATENPFLANZEN
 Institut für Biologie und Biotechnologie bei Pflanzen Seminar: Gentechnik in der Landwirtschaft Dozent: Dr. Maik Böhmer Referentin: Rieke Knüver BARNSTAR EIN VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG MÄNNLICH STERILER
Institut für Biologie und Biotechnologie bei Pflanzen Seminar: Gentechnik in der Landwirtschaft Dozent: Dr. Maik Böhmer Referentin: Rieke Knüver BARNSTAR EIN VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG MÄNNLICH STERILER
Ernst Peter Fischer. GENial! Was Klonschaf Dolly den Erbsen verdankt. Ein Streifzug durch die Genetik. Herbig
 Ernst Peter Fischer GENial! Was Klonschaf Dolly den Erbsen verdankt Ein Streifzug durch die Genetik Herbig gezählt wurden. Wie zu lesen ist, hatte Mendel, der zu den Gründern des Vereins gehörte, bei dieser
Ernst Peter Fischer GENial! Was Klonschaf Dolly den Erbsen verdankt Ein Streifzug durch die Genetik Herbig gezählt wurden. Wie zu lesen ist, hatte Mendel, der zu den Gründern des Vereins gehörte, bei dieser
Züchtungsverfahren im Pflanzenbau -Ein Überblick-
 Seite 1 Züchtungsverfahren im Pflanzenbau -Ein Überblick- Unterrichtsleitfaden an der Technikerschule für Agrarwirtschaft Triesdorf 2013 Quellennachweis und weiterführende Links s. Text Herzlichen Dank
Seite 1 Züchtungsverfahren im Pflanzenbau -Ein Überblick- Unterrichtsleitfaden an der Technikerschule für Agrarwirtschaft Triesdorf 2013 Quellennachweis und weiterführende Links s. Text Herzlichen Dank
Marco Plicht. Biologie
 Marco Plicht Biologie Zeichenlegende Die Uhr läuft mit: der Lernstoff ist aufgeteilt in Viertel-Stunden-Lernportionen. Zusammen ergibt das den 5h-Crashkurs! Weitere Titel dieser Reihe: Anatomie fast Chirurgie
Marco Plicht Biologie Zeichenlegende Die Uhr läuft mit: der Lernstoff ist aufgeteilt in Viertel-Stunden-Lernportionen. Zusammen ergibt das den 5h-Crashkurs! Weitere Titel dieser Reihe: Anatomie fast Chirurgie
Grundkenntnisse der Genetik
 Grundkenntnisse der Genetik Kynologischer Basiskurs 10./11. März 2018 in Ingolstadt Helga Eichelberg Zelle Zellkern Chromosomen Gene Hund: 39 Chromosomenpaare Begriffspaare: dominant rezessiv homozygot
Grundkenntnisse der Genetik Kynologischer Basiskurs 10./11. März 2018 in Ingolstadt Helga Eichelberg Zelle Zellkern Chromosomen Gene Hund: 39 Chromosomenpaare Begriffspaare: dominant rezessiv homozygot
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Der Mönch und die Erbsen (PDF-Datei) Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Der Mönch und die Erbsen (PDF-Datei) Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de VI Genetik und Biotechnologie Beitrag
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Der Mönch und die Erbsen (PDF-Datei) Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de VI Genetik und Biotechnologie Beitrag
Vorlesung Molekulare Humangenetik
 Vorlesung Molekulare Humangenetik WS 2013/2014 Dr. Shamsadin DNA-RNA-Protein Allgemeines Prüfungen o. Klausuren als indiv. Ergänzung 3LP benotet o. unbenotet Seminar Block 2LP Vorlesung Donnerstags 14-16
Vorlesung Molekulare Humangenetik WS 2013/2014 Dr. Shamsadin DNA-RNA-Protein Allgemeines Prüfungen o. Klausuren als indiv. Ergänzung 3LP benotet o. unbenotet Seminar Block 2LP Vorlesung Donnerstags 14-16
Detailliert beschrieben findet sich die Farbvererbung in folgendem Buch: Inge Hansen; Vererbung beim Hund; Verlag: Müller Rüschlikon Verlags AG
 Die Farbvererbung beim Hovawart Die drei Farbschläge des Hovawart sind: schwarz, blond und. Wie vererbt sich nun welcher Farbschlag? Welche Farben können bei bestimmten Verpaarungen fallen und welche nicht?
Die Farbvererbung beim Hovawart Die drei Farbschläge des Hovawart sind: schwarz, blond und. Wie vererbt sich nun welcher Farbschlag? Welche Farben können bei bestimmten Verpaarungen fallen und welche nicht?
Grundkenntnisse der Genetik
 Grundkenntnisse der Genetik VDH-Basiskurs 14./15. November 2015 in Kleinmachnow Helga Eichelberg Zelle Zellkern Chromosomen Gene Hund: 39 Chromosomenpaare Begriffspaare: dominant rezessiv homozygot - heterozygot
Grundkenntnisse der Genetik VDH-Basiskurs 14./15. November 2015 in Kleinmachnow Helga Eichelberg Zelle Zellkern Chromosomen Gene Hund: 39 Chromosomenpaare Begriffspaare: dominant rezessiv homozygot - heterozygot
Gezielte Modifikation pflanzlicher Erbinformation mittels Designer-Endonukleasen
 Gezielte Modifikation pflanzlicher Erbinformation mittels Designer-Endonukleasen Jochen Kumlehn Plant Reproductive Biology Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) Gatersleben
Gezielte Modifikation pflanzlicher Erbinformation mittels Designer-Endonukleasen Jochen Kumlehn Plant Reproductive Biology Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) Gatersleben
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Genetik & Vererbung. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: : Genetik & Vererbung Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Inhalt Vorwort Seite 4 Einleitung Seite
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: : Genetik & Vererbung Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Inhalt Vorwort Seite 4 Einleitung Seite
Pharmazeutische Biologie Grundlagen der Biochemie
 Pharmazeutische Biologie Grundlagen der Biochemie Prof. Dr. Theo Dingermann Institut für Pharmazeutische Biologie Goethe-Universität Frankfurt Dingermann@em.uni-frankfurt.de Empfohlene Literatur Empfohlene
Pharmazeutische Biologie Grundlagen der Biochemie Prof. Dr. Theo Dingermann Institut für Pharmazeutische Biologie Goethe-Universität Frankfurt Dingermann@em.uni-frankfurt.de Empfohlene Literatur Empfohlene
Das Problem der Reduktion: Wie die Chromosomenverteilung in der
 Das Problem der Reduktion: Wie die Chromosomenverteilung in der Meiose reguliert wird The Dbf4-dependent Cdc7 kinase initiates processes required for the segregation of homologous chromosomes in meiosis
Das Problem der Reduktion: Wie die Chromosomenverteilung in der Meiose reguliert wird The Dbf4-dependent Cdc7 kinase initiates processes required for the segregation of homologous chromosomes in meiosis
Vererbung. Die durch Fortpflanzung entstandene Nachkommenschaft gleicht den Elternorganismen weitgehend
 Vererbung Die durch Fortpflanzung entstandene Nachkommenschaft gleicht den Elternorganismen weitgehend Klassische Genetik Äußeres Erscheinungsbild: Phänotypus setzt sich aus einer Reihe von Merkmalen (Phänen))
Vererbung Die durch Fortpflanzung entstandene Nachkommenschaft gleicht den Elternorganismen weitgehend Klassische Genetik Äußeres Erscheinungsbild: Phänotypus setzt sich aus einer Reihe von Merkmalen (Phänen))
Die klassische Genetik nach Gregor Mendel: Monohybride Erbgänge
 Die klassische Genetik nach Gregor Mendel: Monohybride Erbgänge Stand: 10.01.2018 Jahrgangsstufen Fach/Fächer Vorklasse Biologie (Ausbildungsrichtungen Sozialwesen, Gesundheit) Übergreifende Bildungsund
Die klassische Genetik nach Gregor Mendel: Monohybride Erbgänge Stand: 10.01.2018 Jahrgangsstufen Fach/Fächer Vorklasse Biologie (Ausbildungsrichtungen Sozialwesen, Gesundheit) Übergreifende Bildungsund
ERBKRANKHEITEN (mit den Beispielen Albinismus, Chorea Huntington, Bluterkrankheit u. Mitochondriopathie)
 ERBKRANKHEITEN (mit den Beispielen Albinismus, Chorea Huntington, Bluterkrankheit u. Mitochondriopathie) Als Erbkrankheit werden Erkrankungen und Besonderheiten bezeichnet, die entweder durch ein Gen (monogen)
ERBKRANKHEITEN (mit den Beispielen Albinismus, Chorea Huntington, Bluterkrankheit u. Mitochondriopathie) Als Erbkrankheit werden Erkrankungen und Besonderheiten bezeichnet, die entweder durch ein Gen (monogen)
Sind MADS-Box-Gene ein Schlüssel zum Verständnis der Entwicklung und Evolution der Gametophyten-Generation von Landpflanzen?
 P flanzenforschung Sind MADS-Box-Gene ein Schlüssel zum Verständnis der Entwicklung und Evolution der Gametophyten-Generation von Landpflanzen? Verelst, Wim; Münster, Thomas; Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung,
P flanzenforschung Sind MADS-Box-Gene ein Schlüssel zum Verständnis der Entwicklung und Evolution der Gametophyten-Generation von Landpflanzen? Verelst, Wim; Münster, Thomas; Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung,
Chromatin structure and gene control
 Chromatinstruktur und die Kontrolle von Genen Chromatin structure and gene control Turck, Franziska Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung, Köln Korrespondierender Autor E-Mail: turck@mpiz-koeln.mpg.de
Chromatinstruktur und die Kontrolle von Genen Chromatin structure and gene control Turck, Franziska Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung, Köln Korrespondierender Autor E-Mail: turck@mpiz-koeln.mpg.de
Einblicke in die Entwicklung des menschlichen Gehirns anhand von Untersuchungen in der Fruchtfliege Drosophila melanogaster. Tuesday, March 27, 12
 Einblicke in die Entwicklung des menschlichen Gehirns anhand von Untersuchungen in der Fruchtfliege Drosophila melanogaster Wozu ist Forschung mit der Fruchtfliege nuetzlich? "You've heard about some of
Einblicke in die Entwicklung des menschlichen Gehirns anhand von Untersuchungen in der Fruchtfliege Drosophila melanogaster Wozu ist Forschung mit der Fruchtfliege nuetzlich? "You've heard about some of
VORSCHAU. zur Vollversion. Internet. Materialübersicht. Für diese Einheit benötigen Sie:
 2 von 12 mendelsche Regeln Die Inhalte werden von den Lernenden am besten verstanden, wenn sie in einer Art Chronologie dargeboten werden. Dazu wird die 1. mendelsche Regel (M 2) auf Folie kopiert und
2 von 12 mendelsche Regeln Die Inhalte werden von den Lernenden am besten verstanden, wenn sie in einer Art Chronologie dargeboten werden. Dazu wird die 1. mendelsche Regel (M 2) auf Folie kopiert und
Diversität in der Gattung Sorbus: Hybridisierung, Apomixis, taxonomische Probleme
 Diversität in der Gattung Sorbus: Hybridisierung, Apomixis, taxonomische Probleme Gregor Aas & Martin Feulner 1. Die Gattung 2. Diversität durch Hybridisierung Polyplodisierung Apomixis 3. Konsequenzen
Diversität in der Gattung Sorbus: Hybridisierung, Apomixis, taxonomische Probleme Gregor Aas & Martin Feulner 1. Die Gattung 2. Diversität durch Hybridisierung Polyplodisierung Apomixis 3. Konsequenzen
Hypothetische Modelle
 Hypothetische Modelle Heutiges Paper Vorgehensweise: Screening nach neuen Mutanten mit neuen Phänotyp Neuer Phänotyp: CPD, NPA- Resistenz (CPD, NPA: Wachstumshemmung durch Inhibierung des Auxin- Transport
Hypothetische Modelle Heutiges Paper Vorgehensweise: Screening nach neuen Mutanten mit neuen Phänotyp Neuer Phänotyp: CPD, NPA- Resistenz (CPD, NPA: Wachstumshemmung durch Inhibierung des Auxin- Transport
5. Selbstreplikation wie funktioniert Replikation bei natürlichen Organismen?
 5. Selbstreplikation wie funktioniert Replikation bei natürlichen Organismen? Grundlagen der Genetik Grundvorstellung: Bauplan des Organismus gespeichert in DNA-Molekülen, diese werden repliziert DNA als
5. Selbstreplikation wie funktioniert Replikation bei natürlichen Organismen? Grundlagen der Genetik Grundvorstellung: Bauplan des Organismus gespeichert in DNA-Molekülen, diese werden repliziert DNA als
Grundlagen der biologischen Evolution
 Ausgewählte Grundlagen der biologischen Evolution Grundlagen der biologischen Evolution Chromosome und Gene Genotyp und Phänotyp Evolutionsfaktoren Epigenetik und was wir sonst noch nicht verstanden haben
Ausgewählte Grundlagen der biologischen Evolution Grundlagen der biologischen Evolution Chromosome und Gene Genotyp und Phänotyp Evolutionsfaktoren Epigenetik und was wir sonst noch nicht verstanden haben
Wiederholung Dissimilation; biologische Oxidation; Atmung Hydrolyse der Stärke; Endo- ( -Amylase) und Exoamylasen ( -Amylase) Phosphorolyse der Stärke
 Wiederholung Dissimilation; biologische Oxidation; Atmung Hydrolyse der Stärke; Endo- ( -Amylase) und Exoamylasen ( -Amylase) Phosphorolyse der Stärke Wiederholung 1. Glukoseaktivierung 2. Glykolyse 3.
Wiederholung Dissimilation; biologische Oxidation; Atmung Hydrolyse der Stärke; Endo- ( -Amylase) und Exoamylasen ( -Amylase) Phosphorolyse der Stärke Wiederholung 1. Glukoseaktivierung 2. Glykolyse 3.
dipl. Natw. ETH vorgelegt von geboren am 10. Mai 1952 Angenommen ABHANDLUNG EIDGENOESSISCHEN TECHNISCHEN EINFLUSS VON DNA-REPARATURMUTANTEN
 Diss. ETH Nr. 6844 EINFLUSS VON DNAREPARATURMUTANTEN AUF DIE ENTSTEHUNG VON CHROMOSOMENABERRATIONEN BEI DROSOPHILA MELANOGASTER ABHANDLUNG zur Erlangung des Titels eines DOKTORS DER NATURWISSENSCHAFTEN
Diss. ETH Nr. 6844 EINFLUSS VON DNAREPARATURMUTANTEN AUF DIE ENTSTEHUNG VON CHROMOSOMENABERRATIONEN BEI DROSOPHILA MELANOGASTER ABHANDLUNG zur Erlangung des Titels eines DOKTORS DER NATURWISSENSCHAFTEN
Characterization of Drosophila Lnk an adaptor protein involved in growth control
 Research Collection Doctoral Thesis Characterization of Drosophila Lnk an adaptor protein involved in growth control Author(s): Werz, Christian Publication Date: 2009 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-006073429
Research Collection Doctoral Thesis Characterization of Drosophila Lnk an adaptor protein involved in growth control Author(s): Werz, Christian Publication Date: 2009 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-006073429
Hilfe 1. Wissenschaft. Traditionen und. Hilfe 1
 Hilfe 1 Hilfe 1 Erklärt euch gegenseitig die Aufgabe noch einmal in euren eigenen Worten. Klärt dabei, wie ihr die Aufgabe verstanden habt und was euch noch unklar ist. Antwort 1 Wir sollen einen Stammbaum
Hilfe 1 Hilfe 1 Erklärt euch gegenseitig die Aufgabe noch einmal in euren eigenen Worten. Klärt dabei, wie ihr die Aufgabe verstanden habt und was euch noch unklar ist. Antwort 1 Wir sollen einen Stammbaum
Die klassische Genetik nach Gregor Mendel: Intermediäre Erbgänge
 Die klassische Genetik nach Gregor Mendel: Intermediäre Erbgänge Stand: 10.01.2018 Jahrgangsstufen Fach/Fächer Vorklasse Biologie (Ausbildungsrichtungen Sozialwesen, Gesundheit) Übergreifende Bildungsund
Die klassische Genetik nach Gregor Mendel: Intermediäre Erbgänge Stand: 10.01.2018 Jahrgangsstufen Fach/Fächer Vorklasse Biologie (Ausbildungsrichtungen Sozialwesen, Gesundheit) Übergreifende Bildungsund
Von Virchows Cellularpathologie zur Molekularen Medizin
 Inaugural Symposium RZPD Tissue Interface Von Virchows Cellularpathologie zur Molekularen Medizin (From Virchow s Cellularpathology towards Molecular Medicine) Karl Sperling Charité Universitätsmedizin
Inaugural Symposium RZPD Tissue Interface Von Virchows Cellularpathologie zur Molekularen Medizin (From Virchow s Cellularpathology towards Molecular Medicine) Karl Sperling Charité Universitätsmedizin
VORANSICHT. Der Mönch und die Erbsen die mendelschen Vererbungsregeln. Das Wichtigste auf einen Blick
 VI Genetik und Biotechnologie Beitrag 6 Mendelsche Vererbungsregeln (Kl. 9/10) 1 von 26 Der Mönch und die Erbsen die mendelschen Vererbungsregeln Ein Beitrag nach einer Idee von Prof. Dr. Joachim Venter,
VI Genetik und Biotechnologie Beitrag 6 Mendelsche Vererbungsregeln (Kl. 9/10) 1 von 26 Der Mönch und die Erbsen die mendelschen Vererbungsregeln Ein Beitrag nach einer Idee von Prof. Dr. Joachim Venter,
Heinrich Zankl. Phänomen Sexualität. Vom kleinen" Unterschied der Geschlechter. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt
 Heinrich Zankl Phänomen Sexualität Vom kleinen" Unterschied der Geschlechter Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt Einleitung Sexualität - was ist das? 9 Es geht auch ohne Sex Die ungeschlechtliche
Heinrich Zankl Phänomen Sexualität Vom kleinen" Unterschied der Geschlechter Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt Einleitung Sexualität - was ist das? 9 Es geht auch ohne Sex Die ungeschlechtliche
