DAS WESEN DES CHRISTENTUMS
|
|
|
- Gerhardt Busch
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 PROF. DR. TH. RUSTER UNIVERSITÄT DORTMUND SOMMERSEMESTER 2000 SKRIPT ZUR VORLESUNG DAS WESEN DES CHRISTENTUMS (EINFÜHRUNG IN GRUNDFRAGEN)
2 Inhaltsverzeichnis 1. Adolf von Harnack, Das Wesen des Christentums (1899/1900) 3 2. Zwischenüberlegung: Zur Frage nach dem Wesen des Christentums 5 3. Ernst Troeltschs Anfrage an Harnacks Wesen des Christentums (1903) 6 4. Leo Baeck, Das Wesen des Judentums ( / ) 7 5. Paul Tillich, Der Mut zum Sein (1952) 9 6. Exkurs, Der Fluch des Christentums. Reaktion auf Herbert Schnädelbachs Artikel in: Die Zeit, Nr. 20, 11. Mai 2000, S. 41f Karl Barth, Dogmatik im Grundriss (1946) Hans Urs von Balthasar, Mysterium Paschale (1969) Romano Guradini, Das Wesen des Christentums (1939): Der Herr (1937) Karl Rahner, Kurzformeln des Glaubens (1976) Dorothee Sölle, Stellvertretung. Ein Kapitel Theologie nach dem Tode Gottes (1965) Was wurde gedacht, wozu hat es geführt, was ist davon heute noch brauchbar? Rückblick auf ein Jahrhundert Theologie Neue Glaubensbekenntnisse. Christlicher Glaube an der Jahrtausendwende Weiterführende Literaturempfehlungen 30 2
3 Ein Jahrhundert Theologie in Deutschland... Was wurde gedacht, wozu hat es geführt, was ist davon heute noch brauchbar für ein zukünftiges Christentum? 1. Adolf von Harnack, Das Wesen des Christentums (1899/1900) Ausgabe: A. von Harnack, Das Wesen des Christentums, hg. und kommentiert von Trutz Rendtorff, Gütersloh: Kaiser/Gütersloher Verlagshaus Folgende Seitenangaben daraus. 1.1 Person und Werk 1851 (Dorpat)-1930; Protestantischer Kirchenhistoriker und Wissenschaftsorganisator. Devise: Das Dogma ist nicht Richtschnur, sondern Gegenstand der historischen Arbeit = liberale Theologie im Einklang mit dem Wissenschaftsideal des 19. Jhds. Seit 1888 Prof. in Berlin, 1890 Mitglied der preußischen Akademie der Wissenschaften, 1911 Präsident der Kaiser-Wilhelms-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, 1914 geadelt. Hauptwerke: Lehrbuch der Dogmengeschichte, 1886ff; Geschichte der altchristlichen Literatur, 1893ff; Das Wesen des Christentums, 1900; Marcion. Das Evangelium vom fremden Gott, Begriff des Wesens H. weiß: Alles vollzieht sich in der Geschichte, Menschen sind nur in ihrem geschichtlichen Zusammenhang zu erfassen. Darüber hinaus giebt es keine Menschen (61). Aber: Es kommt darauf an, das Wesentliche in der Erscheinung zu fassen und Kern und Schale zu unterscheiden (ebd.). Wesen = das Wertvolle, das Bleibende, das Evangelium im Evangelium (62), nämlich das Evangelium Jesu Christi. Dieses liegt schon im NT selbst in Schalen, nämlich im jüdischen Kontext. Im Laufe der Geschichte nimmt der Kern immer neue Schalen (Metamorphosen) an, er kann mehr oder weniger verborgen sein. Aufgabe des Historikers ist es, das Wesentliche immer neu aufzuspüren. Exkurs: Jesu Verhältnis zum Judentum. Jesu Botschaft führt auf Höhen, von welchen aus die Beziehung zum Judentum nur noch eine lockere ist. Jesus hat einfach den Menschen ins Auge gefasst, der im Grunde stets derselbe bleibt (63). - Auf den Einwand, Jesus habe nichts Neues gebracht, alle seine Lehren waren schon im Judentum vorhanden: Die reine Quelle des Heiligen war zwar längst erschlossen, aber Sand und Schutt war über sie gehäuft worden und ihr Wasser war verunreinigt (85). Bei Jesus sprudelt die Quelle wieder frisch, das Neue bei ihm ist das Reine, Frische, Gewaltige. Über die Juden: Sie dachten sich Gott als einen Despoten, der über dem Zeremoniell seiner Hausordnung wacht. Sie sahen ihn nur in seinem Gesetze, das sie zu einem Labyrinth von Schluchten, Irrwegen und heimlichen Auswegen gemacht hatten.... Sie hatten aus der Religion ein irdisches Gewerbe gemacht es gab nichts Abscheulicheres (87). 1.3 Inhalt des Wesens des Christentums H. erblickt das Wesen in den drei Kreisen der Verkündigung Jesu: Erstlich, das Reich Gottes und sein Kommen, Zweitens, Gott der Vater und der unendliche Wert der Menschenseele, Drittens, die bessere Gerechtigkeit und das Gebot der Liebe (87). Zu 1.: Reich Gottes = Kommen der Gotteskraft in die Seele des einzelnen! Die äußerliche Vorstellung des Reiches hat Jesus aus der Überlieferung, sie ist nicht sein Eigenes. Das Reich ist inwendig, ist Erlösung des Individuums, nicht des Volkes oder des Staates. Es kommt in Dämonenaustreibung und Heilungen (die H. zeitgeschichtlich zu erklären sucht). Das Reich ist a) überweltlich, eine Gabe von oben, nicht der Natur; b) rein religiös, es verbindet mit dem lebendigen Gott; c) es durchdringt den Menschen ganz, als sein Wichtigstes. (88-95) Zu 2.: In der Gotteskindschaft liegt der unendliche Wert der Seele begründet, das hat Jesus verkündigt. Er hat damit die Menschheit auf eine neue Stufe gehoben, hat das Höchste getan. Der Mensch gehört auf die Seite des Ewigen (101), der Wert unseres Geschlechts ist gesteigert. Diese Rede ist paradox, sie ist aus nichts Weltlichem ableitbar, sie zeigt das letzte, überweltliche Wesen der Religion. Das Christentum ist damit keine Religion wie die anderen, es ist die Religion schlechthin. Es steht über allen Gegensätzen. Erste Folgerung: Wirkliche Ehrfurcht vor dem Menschlichen ist, ob sie s weiß oder nicht, die praktische Anerkennung Gottes als des Vaters (ebd.). (95-101) Zu 3.: Jesus stellt die Ethik ganz auf die Liebe und die Gesinnung (= Trennung von Ethik und Kultus, technisch-religiösen Übungen (102), Gesetz). Das ist zunächst nur gemeine Moral (103), wenn auch die höchste. Das Religiöse kommt nur hinzu als Demut und Liebe (ebd.), aber das ist entscheidend: Die Gerechtigkeit ist der Barmherzigkeit unterworfen. Religion ist die Seele der Moral und die Moral der Körper der Religion (ebd.). Jesu Ethik (Bergpredigt) ist von allem Äußerlichen und Partikularen befreit (104) Das ist ein ungeheurer Fortschritt in der Geschichte der Religion (105). ( ) 1.4 Praktische Folgerungen H. wendet das Evangelium auf verschiedene Gebiete und Fragen an: Beziehung zu Welt, Frage der Askese: Christentum ist nicht asketisch, keine Weltverneinung, aber Kampf gegen Mammon, Sorge und Selbstsucht. ( ) Beziehung zur Armut, soziale Frage: Aus dem Evangelium ist kein soziales Programm abzuleiten, wohl aber der Geist der Brüderlichkeit. ( ) 3
4 Beziehung zum Recht, Frage nach den irdischen Ordnungen: Religion und Politik haben nichts miteinander zu tun, Christen respektieren die Obrigkeit fraglos. Nur geistliche Obrigkeit (bei Juden, Katholiken) werden kritisiert. Das Recht aus dem Geist der Liebe anwenden, d.h. auch auf eigene Rechte verzichten können. Sollen Christen den Kampf der Arbeiterschaft unterstützen? Dazu sagt dasevangelium nichts, es liegt über den irdischen Entwicklungen. ( ) Beziehung zur Arbeit, Frage der Kultur: Ist das Christentum kulturfeindlich? Kultur etc. sind nur vergängliche Dinge, Christen sind vom Licht des Ewigen umflossen und dem Dienst des vergänglichen entrückt (140). Trotzdem soll man mit den Talenten wuchern. Wahre Gotteserkenntnis ist die Quelle aller Kultur. Je mehr Christlichkeit, um so höher die Kultur einer Nation. ( ) Die Frage der Christologie: Jesus muss nicht als Sohn Gottes bekannt und verehrt werden. Er ist Sohn Gottes, weil er den Vater kennt. Den Messiastitel war ihm nur Mittel, um sich damals Anerkennung zu verschaffen. Jesus ist nichts selbst Gegenstand der Verkündigung: nur Gott und die Seele, die Seele und ihr Gott (154). Die christologischen Dogmen sind nicht verpflichtend. ( ) Frage des Bekenntnisses: Auf das lehrhafte Bekenntnis kommt es nicht an, nur auf die Tat ( Abkehr von der Welt und Zukehr zu Gott, 157f). Letztendlich geht es um die Überwindung des Gegensatzes von Gott und Welt, um die Einheit, und das kann kein Denken leisten, nur die lebendige Religion. ( ) 1.5 Bewertung des Christentums in der Geschichte Am Maßstab des Wesens beurteilt H. die Erscheinungsformen des Christlichen in der Geschichte. Apostolisches Zeitalter: Erlebte Religion ohne feste äußere Ordnung. (Kreuz und Auferstehung werden zur Bestätigung von Überzeugungen: an die sittliche Kraft des Mitleidens, an die Überwindung des Todes aus dem Wissen um den Wert der Seele). 2. Jahrhundert: Es entsteht die Lehr- und Gesetzeskirche in der Übernahme des Hellenismus und der Abwehr der Gnosis: victi victoribus legem dederunt (199). Griechischer Katholizismus: Ist nur griechische Religion mit christlichem Einschlag, hat mit der Religion Christi gar nichts zu tun (220f). Intellektualistisch (= es kommt auf das Bekenntnis an), traditionalistisch und ritualistisch. Lehre vom Gottmenschentum (Nizäa/Chalcedon) ist bibelfern. Einziges Verdienst: Das Evangelium überliefert zu haben. Römischer Katholizismus: Complexio oppositorum von griechischem Katholizismus, lateinischem Herrschaftsdenken (Kirche wie ein irdischer Staat) und augustinischer Innerlichkeit ( Getröstetes Sündenelend, 234). Als Herrschaftsform fehlt dieser Kirche jeder Zusammenhang mit dem Evangelium... totale Verkehrung (235). Ihre Kraft ist im Schwinden. Protestantismus: Rückkehr zum wahren Evangelium (Innerlichkeit, Geistigkeit, gnädiger Gott, Kirche als Gemeinschaft des Glaubens). Germanisches Christentum (im Gegensatz zum morgenländischen und zum lateinischen). Schwächen der ev. Kirche kommen aus der Inkonsequenz Luthers: Er war noch zu sehr katholisch. Gegenwärtige Gefahr der Rekatholisierung: Massen wollen Autorität und Ritual, streben zur natürlichen Religion. Letzter Satz: Meine Herren! Die Religion, nämlich die Gottes- und Nächstenliebe, ist es, die dem Leben einen Sinn gibt; die Wissenschaft vermag das nicht (261). 1.6 Würdigung und Kritik H. hat das Christentum entschlossen mit den Werten der Neuzeit versöhnt. Jede/r Gebildete/r seiner Zeit stimmte den Werten zu, die er als wesentlich christlich bezeichnete: Unendlicher Wert der eigenen Person, Subjektivität, Individualität, Geistigkeit. Er bestätigte die Zeit in dem, was ihr wichtig und wertvoll war. Das Christentum ist die allgemeine Religion, weil es einfach die allgemeinen Werte verkündigt. Mit Recht sah er, dass die Wertschätzung jedes einzelnen Menschen aus der biblischen Botschaft folgt und ein Erbe des Christentums ist. Eine theologische Begründung dafür bleibt er jedoch schuldig (Gotteskindschaft ist nur Metapher). Die neuzeitliche Philosophie war auch ohne Bibel zu diesem Ergebnis gekommen. H. griff einfach das allen Selbstverständliche auf (und machte den Glauben eigentlich überflüssig). Deshalb war er auch blind für die negativen Effekte, die Menschen verursachen, die ihre eigene Seele für unendlich wertvoll halten (Imperialismus, Kolonialismus, Ausbeutung der Arbeiter). Der ethische Impuls H.s ist schwach (Barmherzigkeit über Gerechtigkeit, Linderung der Not der Brüder). Indem H. das Christentum über die irdischen Entwicklungen erhob, zog er ihm alle kritischen Zähne. Politisches und sozialethisches Engagement hielt er von den Christen fern: bürgerliche Religion, Kulturprotestantismus. Der Grund für diese Unschädlichmachung und Verallgemeinerung des Christentums war seine methodische und inhaltliche Abwendung vom Jüdischen in der Bibel. Sowohl in der Deutung der Botschaft Jesu wie in der ethischen Dimension abstrahierte er von aller Konkretion, die eben aus der Verbindung Jesu zur Geschichte Israels und aus den Gesetzen der Tora kommt. So gewann er das Christentum als allgemeines Prinzip. Den Juden gegenüber war er voller Vorurteile; sein Antijudaismus war der gewöhnliche seiner Zeit. H. reflektiert nicht, nach welchen Kriterien er das Wesentliche von den Erscheinungen unterscheidet. H.s christliche Affirmation der bürgerlichen Kultur verlor nach dem Krieg ihre Bedeutung. 4
5 2. Zwischenüberlegung: Zur Frage nach dem Wesen des Christentums Wie kommt es bei Harnack erstmals, und dann das ganze Jahrhundert hindurch zur theologischen Frage nach dem Wesen des Christentums? Die (neue) Frage setzt eine (neue) Fraglichkeit voraus. Die Unsicherheit über das, was das Christentum eigentlich oder wesentlich ist, begleitet die Theologie des 20. Jhds. Dabei ist gemäß philosophischer Tradition immer zwischen Wesen und Erscheinung, also zwischen dem, was man wahrnehmen kann, und dem, was durch ideelle Schau oder begriffliche Anstrengung als das unsichtbare Eigentliche einer Sache zu entdecken ist, zu unterscheiden. Die Erscheinung des Christentums am Ende des 19. Jahrhunderts war offenbar nicht mehr eindeutig. Es genügte nicht mehr, die Glaubensbekenntnisse/ Bekenntnisschriften/ Dogmen zur Kenntnis zu nehmen, um zu wissen, was das Christentum ist. * Zu dieser Fragwürdigkeit tragen verschiedene Gründe bei: Die Vielfalt christlicher Kirchen und Konfessionen. Ihr pluriformes Mit- und Gegeneinander war zu einer unhintergehbaren Tatsache geworden. Keine Konfession konnte sich als die einzig wahre behaupten und hoffen, die anderen davon zu überzeugen. Bei H. ist zu sehen, wie er einen Standpunkt jenseits der Konfessionen sucht und diese von dort aus beurteilt. Die historische Kritik an der Bibel. Spätestens seit Ferdinand Christian Baur ( ) war die Bibel der freien historischen Forschung ausgesetzt. Der Wahrheitsanspruch der Bibel wurde kritisch hinterfragt. David Friedrich Strauß ( ) hatte die geschichtlichen Grundlagen des Christentums nachhaltig erschüttert: Das Neue Testament enthalte nur Mythologisches, nichts Historisches (Das Leben Jesu, kritisch betrachtet, 1835/36). Auch H. bezieht sich häufiger auf Strauß. War das Christentum nur eine Idee oder Erfindung ohne geschichtlichen Grund? Das Wissen um den geschichtlichen Wandel des Christentums. Auf geisteswissenschaftlichem Gebiet traute man am Ende des 19. Jahrhunderts am ehesten der Geschichtswissenschaft Wissenschaftlichkeit zu. H. betrachtete seine Wesensbestimmung denn auch als eine rein historische Sache; Spekulation (Hegel!) hielt er für nutzlos. Da man aber nun zunehmend genauer wusste, wie sehr sich das Christentum in der Geschichte verändert hatte, musste die Frage nach dem Wesentlichen gestellt werden. In seiner Dogmengeschichte hatte H. selbst die Hellenisierungsthese verfochten: Die Begegnung mit der hellenistischen Kultur habe das Christentum von seinen Ursprüngen entfremdet. Was war aber dann das Bleibende in aller Veränderung? Die Frage nach der normativen Bedeutung der Vergangenheit für die Gegenwart. Was geht uns eine Geschichte, was geht uns eine Person an, die vor neunzehnhundert Jahren gelebt hat? (54), fragt H. Für den linearen Fortschrittsglauben des 19. Jhds. konnte die Vergangenheit allenfalls als Ausgangspunkt einer Entwicklung gelten, für die Gegenwart hat sie keine eigene Bedeutung. H.s Wesensbegriff deutet dagegen das Evangelium als normatives Kriterium für die Christentumsgeschichte, ja für die ganze Religion. Außerchristliche, philosophische Christentumsdeutungen. Auch Nichtchristen/ Nichttheologen erörterten das Wesen des Christentums. Ludwig Feuerbachs Das Wesen des Christentums (1841) hatte das Christentum gleichsam von außen betrachtet und es psychologisch-genetisch als Projektion menschlichen Selbstbewusstseins in eine jenseitige Sphäre enttarnen wollen. Seitdem standen atheistische und christliche Christentums-Deutung in Konkurrenz zueinander. H. erwähnt Feuerbach nicht, obwohl er ihn sicherlich kannte ahnte er, dass seine Rede vom unendlichen Wert der Menschenseele allzu leicht der Projektionsthese zugeschlagen werden konnte? Die Zukunft des Christentums in einer säkularisierten Welt. Es mehren sich die Stimmen, so H., die verkünden, die christliche Religion habe sich überlebt (55). Die Frage nach dem Wesen des Christentums wird in einer Zeit zunehmender Kirchenferne und Glaubenslosigkeit gestellt. Es steht fest, dass es dauerhaft nicht mehr nur Christen geben wird. Wie sollen Christen ihren heilsnotwendigen Glauben verstehen, wenn ihn nicht mehr alle Menschen teilen? Was bedeuten der christliche Glaube und sein Heilsanspruch für die Ungläubigen? Wie steht es mit der universalen Geltung der christlichen Wahrheit? Dieses Problem wird in allen theologischen Wesensentwürfen des 20.Jhds. geklärt. Unter diesen Voraussetzungen müssen wir an alle theologischen Wesensbestimmungen folgende zwei Fragen stellen: 1. Wie werden sie mit dem geschichtlichen Wandel des Christentums fertig? Finden sie etwas Bleibendes, etwas zeitlos Gültiges in allem Wandel, oder können sie im Wandel selbst das Wesentliche * Im Hintergrund der Vorlesungen Harnacks stand der sog. Apostolikumsstreit (um 1892). Ev. Pfarrer weigerten sich, bei der Taufe das apostolische Glaubensbekenntnis zu sprechen, weil sie meinten, es passe nicht mehr in die Zeit, sie könnten dessen Aussagen nicht mehr verantworten. Der Ruf nach einem neuen Bekenntnis wurde laut, den auch Harnack unterstützte. 5
6 entdecken? (H.s Antwort ist klar: Das Unwandelbare liegt am Anfang ( Kern ), es bekommt in der Geschichte nur immer neue Hüllen, die es mehr oder weniger verhüllen. ) 2. Was geht die Wahrheit des christlichen Glaubens die Ungläubigen an? Wir werden finden, dass sich die Antworten in zwei Gruppen teilen lassen: a. Das Christentum enthält eine allgemeine (religiöse, b. Gott hat in Christus etwas getan, was die Lage aller philosophische, existentielle) Wahrheit, die auch Menschen objektiv verändert hat, vorgängig zu deren Nichtchristen teilen können. Um die Zustimmung zu Glauben. Dies ist aus dem Zentrum des Glaubens dieser Wahrheit wird mit philosophischen Mitteln heraus streng theologisch zu erweisen. Bsp.: Der Tod geworben. Bsp.: Vertrauen ist heilsam. ist überwunden. Besonders interessant sind Entwürfe, die beides vereinigen (Rahner!) Zu welcher Richtung gehört Harnack? 3. Ernst Troeltschs Anfrage an Harnacks Wesen des Christentum (1903) E. Troeltsch: Was heißt Wesen des Christentums, in: Ges. Schriften Bd. 2, Aalen 1962, In der lebhaften Debatte um Harnacks Vorlesungen ragt der Beitrag von Ernst Troeltsch heraus ( , streng historisch arbeitender ev. Theologe mit großer Nähe zur Religionsgeschichte; sein Schwerpunkt war die Sozialgeschichte des Christentums). Seine Kritik hilft uns, das Problem der Wesenbestimmungen genauer zu verstehen. T. bestritt, dass man wie Harnack ein überzeitliches Wesen aus der Geschichte herauslösen kann. Abstraktion von der Geschichte ist nicht möglich. Jeder Wesensbestimmung liegt historische Erkenntnis und eine normative Entscheidung zugrunde, sie markiert den Übergang von der Erforschung der Geschichte zur Geschichtsphilosophie. Der Wesensbegriff ist immer zugleich Abstraktionsbegriff, kritischer Maßstab, Entwicklungsbegriff und Idealbegriff. Wer nach dem Wesen fragt und das wollte auch T. muss klären, wie er zu seinen subjektiven, normativen Urteilen gelangt (was Harnack nicht getan hatte). T. erkannte: Jeder Gläubige, der nach dem Wesen des Christentums fragt, hat bereits aus seinem Glauben an Christus eine bestimmte Einstellung. Mit dieser betrachtet er die Geschichte des Christentums und unterscheidet mit ihr zwischen dem Wesentlichen und dem Unwesentlichen bzw. dem Wesen Widersprechenden. Die Wesensbestimmung impliziert also eine wertende Unterscheidung und Kritik. Dabei wirkt die streng historische Befassung mit der Geschichte auf die gläubige Einstellung zurück; hier gibt es also einen Zirkel. Dieser umfasst aber nicht nur die Vergangenheit, sondern auch und primär die Gegenwart und die Zukunft. Jemand wählt aus der Vergangenheit das als wesentlich aus, was ihm in der Gegenwart als zukunftsträchtig erscheint. Die Vergangenheit wird also jeweils neu gesehen (man kann sagen: erfunden ). Aber eine solche Wesensbestimmung kann nicht beliebig sein, sondern muss sich an den objektiven Fakten der Vergangenheit ausrichten. T.: Wesensbestimmung ist die Herausarbeitung der wesentlichen Idee des Christentums aus der Geschichte so, wie sie der Zukunft leuchten soll, und zugleich eine lebendige Zusammenschau der gegenwärtigen und zukünftigen Welt in diesem Lichte. Die jeweilige Wesensbestimmung ist die jeweilige Neugestaltung des Christentums (431). Die Wesensbestimmung hat nicht nur die Geschichte als Gegenstand, sondern ist selbst Moment der Geschichte des Christentums. T. hat also einen Wesensbegriff gefunden, der sich nicht mehr an etwas Überzeitliches und Ungeschichtliches halten muss. Die Geschichte des Christentums besteht in der immer neuen Suche nach seinem Wesen: Wesensbestimmung ist Wesensgestaltung (ebd.)! Mit jeder Wesensbestimmung wird das Christentum eine neue Religion. Indem T. den Anteil der Subjektivität bei der Wesensbestimmung aufdeckte (die sich gleichwohl an die Geschichte halten muss den richtigen Hauptzug zu treffen, das hängt für ihn von der Reife der Urteilskraft des Historikers ab, es ist eine Sache historischer Meisterschaft (408)), wurde ihm zugleich die unhintergehbare Pluralität der Wesensbestimmungen deutlich. Die Frage nach dem Wesen passt deshalb in die Zeit eines subjektivierten und pluralisierten Christentums es ist eine moderne Frage! Er sah voraus: In der Moderne sind es nicht mehr die Dogmen und Bekenntnisse, die die Identität des Christentums bewahren, sondern die unterschiedlichen Wesensentwürfe gelehrter Leute (gelehrt müssen sie schon sein, denn sie müssen ja die Geschichte kennen). Die Wesensbestimmungen sind der funktionale Ersatz der Dogmen unter den Bedingungen der Moderne. Indem sie jeweils das ganze Christentum ins Auge fassen, relativieren sie die dogmatischen, lebensweltlichen und historischen Gegensätze. Sie schaffen Orientierung und bieten (interkonfessionelle) Verständigung an, und sie ermöglichen zugleich den Dialog mit distanzierten Gläubigen und Ungläubigen. So tragen sie zur Vergegenwärtigung des Christentums bei. Dazu gehört viel Treue in der historischen Versenkung und Hingabe, vor allem in der Hingabe an Jesus, aber auch das Wagnis, aus dem Historischen die lebendige Idee für die Gegenwart hervorzuholen und es mit dem Mut des in Gott gebundenen Gewissens in die Gedankenwelt der Gegenwart hineinzustellen: das macht die Arbeit am Wesen des Christentums aus (448-Schlusssatz). 6
7 4. Leo Baeck: Das Wesen des Judentums ( / ) Ausgabe: L. Baeck, Das Wesen des Judentums, hg. von A.H.Friedländer u. B. Klappert, Gütersloh: Güterlsoher Verlagshaus Folgende Seitenangaben nicht nach dieser, sondern nach allen übrigen Ausgaben seit Zur Person , Rabbiner in Oppeln, Düsseldorf und Berlin, dort auch Dozent an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, 1933 Präsident der Reichsvereinigung des dt. Judentums, 1943 nach Theresienstadt deportiert, lebt nach der Befreiung in London, entscheidend an der dt.-jüd. Versöhnung beteiligt Leo-Baeck-Institut in New York. 4.2 Begriff des Wesens Wesensbestimmung ist rückwärts- und vorwärtsgewandte Prophetie (vgl. Troeltsch). Wesen bestimmt sich von einem Problem her, das immer wieder zur Aufgabe wird (Umkehrung!). Wir sind, was wir geworden sind, nicht was wir von Hause aus sind. Jede Zeit hat ihre eigene Bibel; Mose erkennt seine Tora bei R. Akiba nicht wieder (17). Nichts Unveränderliches, aber ruhende Elemente (Bibel, Talmud) und treibende Kräfte. 4.3 Inhalt des Wesens des Judentums Ethischer Monotheismus : Gott offenbart nicht sein Wesen, sondern seinen Willen. Im Judentum wird alles Gegebene zur Aufgabe, jede Tatsache zur Pflicht (213). Die Menschenpflicht steht vor dem Wissen von Gott (5). Gott ist darin der Eine, Einzige und Heilige, dass er anders ist als alles, was es gibt nämlich indem er allem Gegebenen im Gebot voraus ist. Die Einzigkeit ist nicht die der ersten Ursache, sondern die der einen Gerechtigkeit, der einen Heiligkeit. Wer oder was Gott ist, begegnet im Gebot. Den Monotheismus hat die Einsicht in die Unbedingtheit der sittlichen Forderung geschaffen (56). Die Wahrheit Gottes (im Gebot!) steht somit gegen alle Tatsachen! Es gibt kein Schicksal, kein Fatum, kein Du musst, sondern das Du sollst, weil du kannst (93). Größter Gegensatz ist der Buddhismus: Religion der Trägheit (248). Die von Gott kommende sittliche Forderung ist universal, sie gilt der Menschheit, sie hat aber ihren geschichtlichen Ort in Israel (Licht der Völker), denn sie muss getan werden. Israel ist auserwählt, wenn es sich selbst auserwählt (65). Nicht Mythos und Dogma (=das Feststellende) sind deshalb die Sprache der jüd. Religion, sondern Gebot, Gleichnis und Metapher (= das darüber hinaus Weisende). Die gute Tat verbindet Wissende und Unwissende, nicht, wie im Christentum, die Glaubensformel. Es geht nicht um Weltanschauung, Erklärung der Welt, Ergriffenheit, Erleuchtung, Gefühl, sondern um das rechte Tun. Das Gebot betrifft alle, die Tora ist eine für alle; es gibt keine Hierarchie, keine geistlichen Ämter, keine Sonderung in Geweihte und Profane, kein Mittlertum im Judentum. Die Gedanken Gottes sind fern, aber seine Gebote sind jedem nah. So gibt es nur eine Vernunft und eine Gottesnähe: die, welche durch die rechte Tat erworben wird (34). Im Judentum soll die Religion nicht nur erlebt, sondern gelebt werden (52). Gott bezeugt sich in der Welt durch die, die seine Gebote halten. Das sittliche Tun wird zum Gottesbeweis (190). 4.4 Gabe Gottes, Gebot und Verheißung Der Mensch ist von Gott geschaffen, um schaffen zu können (Ebenbild). Aus dem Erlebnis des Guten kommt die Forderung und das Gebot des Guten. Erst diese beiden Momente machen das Judentum aus: Der Gott der schaffenden, schenkenden Liebe ist zugleich der heilige, sittliche Wille, er ist der Gott des Gebotes, der Gott der fordernden Gerechtigkeit (133). Das sind nicht zwei Phasen (erst geben, dann fordern), sondern die Tora, die fordert, ist die Gabe: wir dürfen schaffen, dürfen gerecht sein. Das Gebot ist heilig wie Gott, denn es ist der Widerspruch zu allem, was es (bloß) gibt, damit auch der ewige Widerspruch gegen alles Niedrige und Gemeine. Der Gerechte, der Gottes Gebot erfüllen will, arbeitet mit Gott gegen dieses Gemeine, er ist mit Gott einig auch in dessen Zorn. Man kann es nicht, daß Gott der Vater im Himmel ist, preisen, und daß er der Zürnende genannt wird, tadeln (144). Jedes Unrecht, das einem einzelnen angetan wird, schreit zu Gott. Wer das Gebot hat, hat die Verheißung (251). Die Verheißung liegt im Gebot selbst dass es erfüllt werde. Das ewige Leben, die Erfüllung, die Unsterblichkeit, liegt in der Überwindung der Diastase von gutem Tun und Gutem (Rehabilitation des Lohngedankens: dass aus der guten Tat das Gute erwächst). Das bedeutet dann: Das Irdische versöhnt sich mit der Unendlichkeit (202). Für den einzelnen liegt die Erfüllung im Jenseits, für die Menschheit im Diesseits. Und doch ist das Ewige schon da in jeder guten Tat, in jeder geschehenen Versöhnung. In jedem Augenblick kann sich die Menschheit neu schaffen. Das Ewige ist nur die Offenbarung dessen, was in jeder guten Tat geschieht (Gericht!). Ziel und Weg offenbaren einander und sichern einander ihr Recht (259). R. Jacob: Mehr ist eine Stunde in Umkehr und guten Taten in dieser Welt als alles Leben der kommenden Welt (206). 4.5 Die Liebe zu Gott, die Sünde und die Umkehr Gott zu lieben ist nicht einfach die Erwiderung von Gottes Liebe zu uns, sondern wenn wir erleben, daß wir Gott dienen, dann fühlen wir die Liebe zu ihm, wir fühlen, daß wir uns Gott anschließen, uns mit ihm verbinden (140). Das umfasst das ganze Leben, nicht nur ein Gefühl. 7
8 Sünde ist zu unterscheiden von unserer normalen Unfähigkeit, Gottes Gebot ganz zu genügen (gegen Paulus und Luther?); sie ist das Handeln gegen das Gebot, gegen Gottes Lebenswillen. Sie ist immer Sünde des einzelnen. Sie trennt niemals ganz von Gott, denn Gott bleibt vor und nach der Sünde derselbe. Er hat sich definitiv für uns entschieden (Bund). Gottes Größe ist seine Vergebung! Umkehr ist immer möglich, d.h.: wieder gerecht handeln können! Jede Umkehr ist Wiedergeburt, und zugleich unsere Tat: Ohne seinen Willen ward er geboren, durch seinen Willen wird er wiedergeboren (187). Judentum ist die Religion der Versöhnung; Versöhnung ist nur der Anfang zum Tun des Guten (=keine Selbstgerechtigkeit). 4.6 Freiheit und Würde des Menschen Als Täter der freien Tat ist der Mensch wirklich frei. Alles ist in Gottes Hand, nur nicht des Menschen Gottesfurcht (134). Wir können Gott gegenüber etwas tun, müssen nicht dienen und buckeln wie vor den Götzen. Im Handeln tritt der Mensch ins Klare, wird er eindeutig; ist er als Subjekt gemeint. Daraus folgt die Ehrfurcht vor sich selber (unsere Größe) ist das Sittliche, das Fordernde inmitten des Gegebenen (170) und nicht irgendetwas, was wir sind oder haben. Die drei Paradoxien: - Gott in der Ferne, und doch mein Gott; - der Mensch ein Geschaffener und doch ein Schöpfer; - der Wert des Menschseins, der zugleich unerfüllbare Forderung ist (173f). 4.7 Verhalten zu Leid und Tod Keine fatalistische Ergebung in die Not! In guten und schlechten Tagen wird Gott gepriesen. Es ist das Gebot im Judentum, daß der Mensch dem Leiden gegenüber ein Schaffender und Umgestaltender sein soll, einer, der nicht aufhört, Gott zu dienen (229): das Leid als Prüfung des Gerechten. Das du sollst bleibt gegenüber allem du musst des Verhängnisses; die Kraft, Subjekt gegenüber dem Schicksal zu bleiben, zu erwählen und nicht nur geschehen zu lassen (192). Letzte Konsequenz ist das Martyrium (Kiddush ha Schem, Heiligung des göttlichen Namens): Der Mensch bleibt auch gegenüber dem Tod ein Wählender, er erwählt den Willen Gottes, er erwählt durch den Tod sein Leben. Im Martyrium hört der Tod auf, ein Schicksal zu sein (191) [Kann man mehr zu Holocaust und Kreuz sagen?] Die Übereinstimmung mit der Tora gibt jedem Augenblick Sinn (vgl. dazu K.H. Menke in: Mit Gott streiten, hg. von H. Wagner, QD 169, Freiburg 1998, ). 4.8 Die Menschheit, der Grundsatz Macht vor Recht und das Reich Gottes Durch die universale Verheißung des Gebotes gibt es erst die Menschheit. Sie ist nicht nur etwas, sie hat ein Ziel, d.h. eine Bedeutung. Die wahre Weltgeschichte ist die Geschichte des Guten (261), was die Menschen und Völker dazu beitragen, das ist wertvoll an ihnen. Was dagegen ist, vergeht (Erfahrung Israels!). Der Kampf für das Gute ist der Kampf gegen die reine Macht, jeder Bau der Macht ist Götzenbild. Dagegen: Die Macht Gottes ist, daß er das Recht liebt.... Nur diese Macht, die Recht ist, wird bleiben (263- vgl. M. Voigts in: R. Faber (Hg.), Politische Religion religiöse Politik, Würzburg 1997, 75-92!). Alle Völker sind zu dieser Aufgabe gerufen, sie können, sie müssen wählen das ist das Gericht in der Geschichte (263). Erst dadurch hat die Geschichte Einheit und Ziel. Aber das ist nicht aus der Historie zu erkennen, sondern aus dem Willen Gottes. Reich Gottes: ein Reich, das nicht in der Gewalt gegründet ist, sondern im Gebote Gottes ein Werdendes, kein Gewordenes, eine Aufgabe, kein Besitz (Kritik des Christentums). 4.9 Nächsten- und Feindesliebe, Gerechtigkeit Der andere soll Mitmensch immer erst werden durch das, was ich an ihm tue! Gerechtigkeit beruht auf dem Recht, das der andere an mir hat; nicht: gleiches Recht für alle, sondern: gerecht werden. Da geht es nicht um Gefühle, sondern um nüchterne Tat (alle sozialen Bestimmungen der Bibel ). Der Fremdling hat die Humanität gelehrt (219), in den Pflichten ihm gegenüber, nicht in einer allgemeinen Idee. Die messianische Qualität des Armen: Am Armen wird begriffen, was ein Mensch als Mitglied der Gemeinschaft zu fordern berechtigt ist; Recht gegen die Armen üben ist Gottesdienst. Feindesliebe: das ist das Schwerste, das Böse, das Gottwidrige nicht zu hassen. Aber: Seine Unvollkommenheit ist immer geringer als die Schuldigkeit unserer Liebe (238). Gesellschaft ist: einander vor dem Bösen bewahren und zum Guten führen Das Judentum in der Geschichte Aus dem Getto kann man keine Mission betreiben. Hauptaufgabe: Selbstbewahrung, das ist: Sich unterscheiden als Verkündigung. Satzungen (Talmud etc.) dienten vielleicht zu sehr der Abgrenzung, aber: jedem Juden ist alles zugetraut! Jeder Jude vertritt die ganze Religion (nicht nur: Glied der Kirche ). Die jüd. Gemeinde vertritt das sittliche Prinzip der Minderheit (306): gegen die Wahrheit von Macht und Erfolg. Siege über die Juden wurden nur mit Macht errungen. Verhalten zu den Juden ist der Gradmesser für die Sittlichkeit eines Volkes; wer Juden unterdrückt, unterdrückt auch andere und umgekehrt. Wir verlangen nicht, daß man uns ehre, sondern nur, daß man das Recht und die Wahrheit ehre (311) 4.11 Würdigung, keine Kritik Baecks Wesen des Judentums ist das beste Wesen des Christentums! Besser hat in diesem Jhd. keiner gesagt, was die Bibel will. Christen, so zeigt sich jetzt, haben das Gesetz (haben Paulus) nicht verstanden und auf die Macht nicht verzichten wollen. Zu den beiden Fragen (oben S.3f): zu 1.s. 4.2; zu 2.: B. gehört zu Typ b). Die Gabe des Gebots ist für alle, Israel übt Stellvertretung an allen, aber alle können daran mitwirken. Jesus vermittelt das bis an die Enden der Erde (so auch B., vgl. 275f). 8
9 5. Paul Tillich, Der Mut zum Sein (1952) Dt. Ausgabe: Der Mut zum Sein, Stuttgart Ferner: Ges. Werke, hg. von R. Albrecht, 14 Bde, Stuttgart (=GW); Ergänzungs- und Nachlaßbände zu den GW, 8 Bde., Stuttgart/Berlin 1991ff (=EW); Systematische Theologie, 3 Bde., Stuttgart , Nachdruck Berlin 1987 (=ST) 5.1 Person und Werk 1886 (Starzeddel, heute Polen) 1965 (Chicago). Studium der ev. Theologie in Berlin, Tübingen, Halle, 1909 Pfarrer Promotion Dr. phil., 1912 Lic. theol. (beides über Schelling) freiwilliger Feldgeistlicher, Erschütterung durch Krieg Professuren (bzw. Priv.-Doz.) für Syst. Theologie, Philosophie, Religionswissenschaft, Soziologie in Berlin, Marburg, Dresden, Frankfurt. Bekenntnis zum religiösen Sozialismus. Wichtige Werke dieser Zeit: Über die Idee einer Theologie der Kultur, 1919; Rechtfertigung und Zweifel, 1924; Die religiöse Lage der Gegenwart, 1926; Das religiöse Symbol, Suspendierung vom Amt und Emigration in die USA. Nach schwierigen Anfangsjahren 1940 Professur in New York, 1955 in Harvard, 1962 in Chicago Japanreise Friedenspreis des dt. Buchhandels. Zahlreiche Werke, vor allem Systematic Theology, ; Courage to be, 1952; Christianity and the Encounter of the World Religions, Gedankengang von Der Mut zum Sein T. hat kein Buch zum Wesen des Christentums geschrieben, sein meistgelesenes Werk bündelt aber seine wesentlichen, Zeit seines Lebens im Kern unveränderten Gedanken. Der Mut zum Sein ist ethisch und ontologisch, er ist der Akt, in dem der Mensch sein eigenes Sein bejaht trotz jener Elemente seiner Existenz, die seiner essentiellen Selbstbehauptung widerstreiten (8), ist Selbstbejahung trotzdem (28). Hauptalternative zum Christentum ist diesbezüglich der Stoizismus: Stoiker bejahen ihr vernünftiges Wesen und den Logos des Seins trotz Leidenschaften und Ängsten (aber sie können nicht sagen, warum sie das tun; Stoa bleibt Sache eine Elite). Mut richtet sich gegen die Angst (T. entwickelt eine Ontologie der Angst ). Angst gehört zum Wesen des Menschen, sie fürchtet das Nicht-Sein, entweder als Tod, als geistige Leere oder als Schuld und Verdammung. Dagegen gibt es zwei Formen des Muts zum Sein: entweder Mut als ein Teil zu sein (Partizipation, in Kollektivismus (z.b. Mittelalter), in Neokollektivismus wie z.b. Kommunismus, Faschismus, oder in demokratischem Konformismus ), oder Mut man selbst zu sein (Individuation, etwa in der Romantik, heute vor allem im Existentialismus; kann zum Mut der Verzweiflung, zum Zynismus führen oder in Kollektivismus NS! umschlagen, ). Beide Formen müssen zusammenkommen. Das geschieht im Christentum bzw.der Religion, nämlich in der Mystik (=Partizipation) und der persönlichen Gottesbegegnung (= Individuation). Beides wurzelt im absoluten Glauben, im Ergriffensein durch das, was uns unbedingt angeht (124). Im Glauben gibt die Erfahrung der Macht des Seins-selbst, die alles Nicht-sein in sich begreift und überschreitet, den Mut zum Sein (125). Glaube ist Ergriffensein von der Macht des Seins, trotz der überwältigenden Erfahrung des Nichtseins (127). Der absolute Glaube macht die Erfahrung, dass das Sein-selbst Seinsmächtigkeit hat, die das Nichtsein umschließt und sich gegen es durchsetzt. Das Nichtsein ist dialektisches Moment des Seins. Dieser Glaube richtet sich nicht auf einen bestimmten Gott (den, den der Atheismus bestreitet), er hat keinen spezifischen Inhalt, sondern er transzendiert jede Gottesidee im Gott über [dem] Gott [des Theismus] (131). Der Gott über Gott ist die Macht des Seins, er ist nicht Objekt, er ist ohne Namen, Theologie und Kirche (und liegt doch diesem allem zugrunde). Er wird am ehesten in der Mystik angetroffen, von ihm ist nur symbolisch zu reden. Er überwindet das Hauptproblem der Moderne, die Sinnlosigkeit. Der Mut zum Sein wurzelt in dem Gott, der erscheint, wenn Gott in der Angst des Zweifels verschwunden ist (137 letzter Satz). Von hier aus lassen sich die Grundlinien der Theologie Tillichs aufzeigen: 5.3 Die Rechtfertigung des Zweifels und der absolute Glaube Der 1. Weltkrieg hatte T.s selbstverständlichen Glauben und die kulturprotestantische Synthese zerstört. Er sieht das Recht des Zweifels bei den Zeitgenossen und hat sein reformatorisches Schlüsselerlebnis: Der moderne Zweifel an Gott ist durch die Rechtfertigung aus Glauben gerechtfertigt! Als Glaube, durch den Rechtfertigung geschieht, nimmt T. den Durchbruch der unbedingten Gewißheit durch die Sphäre der Ungewißheiten an; es offenbart sich der Gott der Gottlosen, die Wahrheit der Wahrheitslosen (GW VIII, 91f). Der Grund dafür ist nicht, dass Gott den Zweifler bejaht, sondern die implizite Anerkennung letzter Gewissheit im Akt des Zweifels. Dieser ursprüngliche (ungegenständliche, absolute) Glaube, die Geburtsstunde der Religion in jedem Menschen (ebd.), glaubt nicht an Christus, er ist vielmehr die Voraussetzung für den Glauben an Christus (G. Wenz: Theologie ohne Jesus ). 5.4 Der Gott über Gott T.s Ausgangspunkt ist die Kritik des Theismus. Darunter versteht er, dass Gott zu einem - wenn auch dem höchsten - Seienden gemacht worden sei und demgemäß zu einem Objekt. Dieser Gott als Objekt steht dann dem Subjekt gegenüber die Wirklichkeit ist zerrissen. Dieser Gott ist unter dem modernen Zweifel gestorben. Der Gott über Gott ist nicht ein Seiendes, sondern das Sein-selbst, demgemäß kein Objekt. Weil alles Denken in der Subjekt-Objekt-Struktur verbleibt, kann er nur im unmittelbaren, vorbewussten Ergriffensein erfasst werden, das Glauben und Zweifel umfasst und übersteigt. Darin wird dann die Einheit der Wirklichkeit erfahren (vgl. Schellings Identitätsphilosophie!). Gott ist das, was uns unbedingt angeht (ultimate concern im Gegensatz zu 9
10 dem, was uns so unbedingt angeht wie Geld und Erfolg ist er das, was uns wirklich unbedingt angeht, weil er der wahrhaft Unbedingte ist). Das Ergriffensein durch das Sein-selbst schenkt das Neue Sein. Christl. Glaube ist Zustand des Ergriffenseins durch das Neue Sein, wie es in Jesus als dem Christus erschienen ist (ST III, 156). 5.5 Die Theologie der Kultur und das Symbol Gott ist letztlich allem gegenwärtig und damit auch die Religion (= Dimension des Unbedingten = weiter Religionsbegriff). Trennung von sakral und profan, von Religion und Kultur ist Ausdruck der Entfremdung, deren Überwindung in einer idealen Theonomie erhofft wird: Jeder Akt des Lebens sollte über sich hinausweisen (ST III, 118). Alles kann Gegenstand von Theologie werden (und ist es bei T. auch geworden), alles ist auf seine Dimension der Tiefe und des Unbedingten anzusprechen. (Beten Sie, Herr T.? Always and never ) Innerhalb aller Wirklichkeit verweisen nur Symbole auf Gott. Sie verweisen auf das wahre Sein und partizipieren an ihm, ohne es doch zu enthalten (=defizienter Modus). Auch das Wort Gott ist nur ein Symbol für Gott: Gott transzendiert seinen eigenen Namen (GW III, 141). Symbole müssen Ausdruck lebendiger Erfahrung sein, sonst sterben sie. Sie sind im kollektiven Unterbewusstsein (C.G.Jung) verwurzelt. Darin, dass Theologie nur symbolische Sprache haben kann, unterscheidet sie sich von der Wissenschaft; der Konflikt zwischen Theologie und Wissenschaft ist gelöst. 5.6 Theologie der Religionen Zwei Typen von Religionen: der sakramental-priesterliche (=Immanenz) und der prophetische (=Transzendenz, Kritik). Gefahr der Vereinseitigung beider (Bedingtes wird zum Unbedingten gemacht nur negative Kritik, Aufhebung von Religion). Synthese beider ist die höchste Religion, sie nimmt das kritische Element in sich auf, richtet ihre Bedingtheit vom Unbedingten her: Christentum mit dem Symbol des Kreuzes! Aber das kann auch in anderen Religionen geschehen (Buddhismus?), nach Jesus aber nur noch als Analogat. 5.7 Die Zweideutigkeit der menschlichen Situation und der Kairos Die Lage der Menschen ist unaufhebbar zweideutig! In der konkreten Existenz kann ihr essentiales Sein nicht rein gelebt werden Entfremdung von Gott, vom Nächsten und sich selbst! Alles ist zweideutig (niemals eindeutig gut oder schlecht). Das ist die tragische Situation des Menschen (Bsp.: Selbsterhaltung ist notwendig, kommt aber nie ohne Gewalt aus; Fortschritt ist Segen, aber auch Hybris als Überwindung der Endlichkeit). Ethik: die Stimme der Essenz im Gewissen hören. Das Gebot kommt nicht von außen, es ist die Struktur unseres wahren Seins, das im moralischen Gebot zu uns spricht (GW IV,49). Die Versöhnung, das Neue Sein, die Überwindung der Differenz ist in Christus schon erschienen, dies kann aber nur fragmentarisch in die Welt einbrechen und die Zweideutigkeit nie ganz überwinden. Erhoffbar ist nur hin und wieder ein kairos, in dem das Göttliche das Widergöttliche, Dämonische (die Endlichkeit, die sich absolut setzen will) durchbricht. Dann zeigt sich der Sinn des Lebens. Er kann aber auch ausbleiben. 5.8 Die Methode der Korrelation T. bringt diesen Begriff in der Theologie auf (GW IX, 243 u.ö.) und denkt selbst stets korrelativ. Er ist bei ihm aus der Erfahrung des Religionsunterrichts entstanden: Schüler verstehen die Lehre der Kirche nicht. Deshalb: Die Fragen, die die Schüler (oft unbewusst) haben, herausarbeiten und den Glauben als Antwort präsentieren. Allgemein in der Theologie: Offenbarung kann nur als Antwort auf Existenzprobleme verständlich gemacht werden. Diese müssen zuvor mit rein philosophischen Mitteln aufgewiesen werden (philosophia ancilla theologiae). Die Antwort der Theologie kann allerdings nicht aus den Fragen abgeleitet werden, darum ist das keine Natürliche Theologie (meint T.)! 5.9 Würdigung und Kritik T. (der Tänzer) hat das kirchlich-theologische Ghetto verlassen, ist Denker auf der Höhe der Zeit, hat eine wirklich dialogfähige Theologie betrieben. Von daher die große Rezeption und seine Wirkung vor allem auf den Religionsunterricht. Aber: Allen alles werden, das ist eine Überforderung. T.s Interpretation des Lebens überzeugt nicht, sie richtet die Fragen immer schon auf die Antwort aus. Bonhoeffer: T. wollte die Welt besser verstehen als sie sich selbst, aber die Welt warf ihn aus dem Sattel (Widerstand u. Ergebung, Mn 1966, 218); Barth: diese breite allgemeine Glaubens- und Offenbarungswalze, die alles und nichts ausrichtend über [alles] hinweggeht (GW VII, 234). T.s theologische Antwort: Der Gott über Gott ist nichts Bestimmtes zugleich etwas Verwechselbares, das Unbedingte und etwas Defizientes (im Symbol). T.s Gott ist nicht inkarniert. Indem T. das Ghetto verließ, hat er zugleich den biblischen Gott verlassen. Seinen Namen will er transzendieren, da bleibt ihm nichts. Das Ergriffensein ist zuletzt nur ein unbestimmtes Gefühl. Christliche Glaubensgehalte werden nur formelhaft beibehalten und dabei missverstanden: Rechtfertigung ohne Glauben an Christus ist nicht möglich. Das Neue Sein in Christus ist unvermittelt und unbestimmt. Biblische Geschichte spielt (sowenig wie andere Geschichte) eine Rolle. Zur Lage des Menschen: Sie ist und bleibt für T. unaufhebbar tragisch. Die Existenz steht in bleibendem Widerspruch zur Essenz. Erlösung geschieht nicht, nur der status quo wird erträglich gemacht: Sinngebung, das ist bürgerlich. Zu den beiden Fragen (s.o.2.): T. hat aus dem Christentum eine zeitlose, allgemeine Lehre gemacht. Er hat das Christentum der Ontologie unterworfen, er war gegen seinen Anspruch mehr Philosoph als Theologie. Er kam mit seiner Sache nicht zurande, konnte nicht aufhören zu lehren. 10
11 6. Exkurs: DER FLUCH DES CHRISTENTUMS. Reaktion auf Herbert Schnädelbachs Artikel in DIE ZEIT Nr. 20, 11. Mai 2000, S. 41f. 6.1 Die Position Herbert Schnädelbachs S.s Behauptung: Durch das Christentum lastet ein Fluch auf der Zivilisation, der bis in die Katastrophen des 20. Jhds. reicht. Was Christen an Unheil anrichteten, ist nicht trotz sondern wegen des Christentums geschehen. Das Mea Culpa des Papstes reicht deswegen nicht aus. Nur die Selbstaufgabe des Christentums kann diesen Fluch lösen. S. listet sieben Geburtsfehler des Christentums auf, diese sind: 1. Die Erbsünde. Eine Erfindung des Paulus: Wenn der Tod der Sünde Sold ist, dann muss überall da, wo gestorben wird, auch Sünde gewesen sein. Nur Gott kann aus der Sünde retten, aber er tut das ungerecht (Prädestination). Diese Lehre ist menschenverachtend. Alle müssen sich für verderbt halten, für unfähig zum Guten. Keiner darf gerecht sein = gegen das Judentum und seine Gerechten = Verachtung für das Gesetz = Rechtfertigung für Judenmission. Ungetauften, Heiden hat die Kirche immer das volle Menschenrecht vorenhalten; die Idee der allgemeinen Menschenwürde und rechte musste erst gegen das Christentum durchgesetzt werden. 2. Die Rechtfertigung als blutiger Rechtshandel. Bei der Auferstehung hätte man es bewenden lassen können, aber Paulus will auch der Kreuzigung noch einen Sinn verleihen und findet ihn im jüdischen Sühneritual. Das unschuldige Lamm muss zur Schlachtbank geführt werden und dieses Lamm ist Gottes Sohn selbst. Gott versöhnt sich mit den Menschen erst durch das blutige Opfer seines Sohnes. Durch dieses Szenario kommt Blutrünstigkeit und Grausamkeit in das Christentum, die in der Folter, der Inquisition, der Behandlung der Heiden und Ketzer ihren Ausdruck fanden und bis zu den heutigen Gewaltvideos reichen (können). Das Christentum hat nichts zur Humanisierung der Menschheit geleistet, im Gegenteil: die Geschichte der Martyrer des Humanismus ist wohl noch zu schreiben. 3. Der Missionsbefehl. Der Missionsbefehl ist die Aufforderung zur Intoleranz (die Heiden werden nicht gefragt, ob sie zu Jüngern gemacht werden wollen); er bedeutet letztlich den Auftrag zur Ausrottung der Heiden und die Rechtfertigung eines christlichen Kulturimperialismus. Missionare hatten nichts dagegen, wenn nach ihnen die Händler und die Kanonenboote kamen... Wo das Christentum tolerant wird, hat es sich in Wahrheit schon aufgegeben. 4. Der christliche Antijudaismus. Vor allem das MtEv geht, anders als Paulus, zu offenem Antijudaismus über. Von dem Sein Blut komme über uns und unsere Kinder (Mt 27,25) und der Zuweisung der Schuld am Tod Jesu an die Juden zieht sich eine Blutspur über die ungezählten Judenpogrome in Europa, die letztlich bis in den rassischem Antisemitismus reicht. Der Holocaust war ohne das Christentum nicht möglich, die Kirche hat dazu geschwiegen, und zu diesem Schweigen schweigt der Papst bis heute. 5. Die christliche Eschatologie. Die schrecklichen Bilder der Offenbarung des Johannes haben das ganze Abendland terrorisiert und in Angst versetzt. Mit den Bildern vom feurigen Pfuhl hat die Kirche ihre Leute diszipliniert und zu ihren Heilsmitteln getrieben: Erlösung als Ausweg aus von ihm selbst erzeugten Ängsten. Daneben gibt es die politische Wirkungsgeschichte der Apokalyptik. Der Versuch, selbst den Neuen Himmel und die Neue Erde zu schaffen, führt bis zu Lenin, Stalin, Pol Pot und Hitler. E. Bloch: Ubi Lenin ibi Jerusalem. 6. Der Import des Platonismus. Das Christentum hat sich aus apologetischen Motiven mit dem platonischen Dualismus arrangiert und schließlich, als ihm die topologische Verortung des Himmels durch die Wissenschaft unmöglich gemacht wurde, den Himmel oder das Reich Gottes in s Jenseits, in den Bereich des Geistigen und Idealen verlegt. Das bedeutete die Denunziation der Realität, der wirklichen Wirklichkeit, gegen die die ganze Neuzeit ankämpfte. Das verband sich mit einer dualistischen Anthropologie, der Abwertung des Leiblichen, Sexuellen, Weiblichen. Viele machte das zu psychischen Krüppeln ; die platonische Leib-Seele- Schizophrenie ging in manifeste Krankheit über. 7. Der Umgang mit der historischen Wahrheit. Das MtEv vor allem erfindet dreist historische Tatsachen, die nicht stimmen (Besuch der drei Weisen, Flucht nach Ägypten, Kindermord in Betlehem etc.): Hier wird absichtlich und zweckrational gelogen, um Jesus als Erfüllung der atlichen Verheißungen darstellen zu können. Das Christentum kann aber von diesem strategischen Umgang mit der Wahrheit nicht ablassen, denn was bliebe vom Kern des Christentums, wenn man seine fiktiven Schalen entfernt? vor allem im Hinblick auf das leere Grab:...Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist all unsere Predigt vergeblich (1 Kor 15,14). 8. Christentum heute? Wenn das Christentum seine Geburtsfehler beseitigte, bliebe von ihm nichts mehr übrig. Das Beste an ihm ist ohnehin sein Jüdisches [S. hebt das Judentum immer wieder, wenn auch nicht ganz konsequent, positiv vom Christentum ab!]. Die wenigen humanen Potenzen, die es hatte, sind längst in den profanen Humanismus übergegangen. Das Christentum hat sein Ende längst hinter sich, aber ohne dies bemerkt zu haben. Tatsächlich würden die inkriminierten Punkte in der christlichen Verkündigung heute stillschweigend fallengelassen. Fazit: Erst in seinem Verlöschen könnte sich der Fluch des Christentums doch noch in Segen verwandeln. 6.2 Erwiderung: Ein Streit um s Wirklichkeitsverständnis S.s Insistieren auf der wirklichen Wirklichkeit, die in der Aufklärung rehabilitiert worden sei, sein Vorwurf an das Christentum, die Realität denunziert zu haben, seine Behauptung, im NT werde gelogen, führen die 11
SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
 PAUL TILLICH SYSTEMATISCHE THEOLOGIE BAND I EVANGELISCHES VERLAGSWERK STUTTGART INHALTSVERZEICHNIS EINLEITUNG A Der Standpunkt 1. Botschaft und Situation 9 2. Die apologetische Theologie und das Kerygma
PAUL TILLICH SYSTEMATISCHE THEOLOGIE BAND I EVANGELISCHES VERLAGSWERK STUTTGART INHALTSVERZEICHNIS EINLEITUNG A Der Standpunkt 1. Botschaft und Situation 9 2. Die apologetische Theologie und das Kerygma
Tod, wo ist dein Stachel? (1 Kor 15,55) Unsere Sterblichkeit und der Glaube an die Auferstehung. Impuls-Katechese, Altötting
 Tod, wo ist dein Stachel? (1 Kor 15,55) Unsere Sterblichkeit und der Glaube an die Auferstehung Impuls-Katechese, Altötting 14.10.2017 Die Angst vor dem Tod Heb. 2:14 Da nun die Kinder Menschen von Fleisch
Tod, wo ist dein Stachel? (1 Kor 15,55) Unsere Sterblichkeit und der Glaube an die Auferstehung Impuls-Katechese, Altötting 14.10.2017 Die Angst vor dem Tod Heb. 2:14 Da nun die Kinder Menschen von Fleisch
Glaube kann man nicht erklären!
 Glaube kann man nicht erklären! Es gab mal einen Mann, der sehr eifrig im Lernen war. Er hatte von einem anderen Mann gehört, der viele Wunderzeichen wirkte. Darüber wollte er mehr wissen, so suchte er
Glaube kann man nicht erklären! Es gab mal einen Mann, der sehr eifrig im Lernen war. Er hatte von einem anderen Mann gehört, der viele Wunderzeichen wirkte. Darüber wollte er mehr wissen, so suchte er
PREDIGT: Epheser Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
 PREDIGT: Epheser 2.17-22 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde! In den letzten Jahre sind viele Menschen
PREDIGT: Epheser 2.17-22 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde! In den letzten Jahre sind viele Menschen
Unterrichtsinhalte Religion
 Unterrichtsinhalte Religion Jahrgangsstufe 5 Ankommen im Religionsunterricht/Freundschaft Schöpfung Abraham Mose Jesus Entdecken Verstehen Gestalten Ankommen im Religionsunterricht Schöpfung: Staunen Erkennen
Unterrichtsinhalte Religion Jahrgangsstufe 5 Ankommen im Religionsunterricht/Freundschaft Schöpfung Abraham Mose Jesus Entdecken Verstehen Gestalten Ankommen im Religionsunterricht Schöpfung: Staunen Erkennen
Predigt zum Sonntag Laetare über Johannes 6, 51 63
 Predigt zum Sonntag Laetare über Johannes 6, 51 63 Liebe Gemeinde, Was ist ein Versprechen wert? Diese Frage stellt sich in unserem Alltagsleben immer wieder. Da hören wir von den Politikern, der EURO
Predigt zum Sonntag Laetare über Johannes 6, 51 63 Liebe Gemeinde, Was ist ein Versprechen wert? Diese Frage stellt sich in unserem Alltagsleben immer wieder. Da hören wir von den Politikern, der EURO
1. Johannes 4, 16b-21
 Predigt zu 1. Johannes 4, 16b-21 Liebe Gemeinde, je länger ich Christ bin, desto relevanter erscheint mir der Gedanke, dass Gott Liebe ist! Ich möchte euch den Predigttext aus dem 1. Johannesbrief vorlesen,
Predigt zu 1. Johannes 4, 16b-21 Liebe Gemeinde, je länger ich Christ bin, desto relevanter erscheint mir der Gedanke, dass Gott Liebe ist! Ich möchte euch den Predigttext aus dem 1. Johannesbrief vorlesen,
Predigtthema: >>Gottes Willen erkennen & Nach Gottes Willen leben<<
 Predigtthema: >>Gottes Willen erkennen & Nach Gottes Willen leben
Predigtthema: >>Gottes Willen erkennen & Nach Gottes Willen leben
Inhaltsverzeichnis.
 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Allgemeine Aufgabenbeschreibung 9 2. Die didaktische Struktur der Rahmenrichtlinien 12 2.1 Didaktische Konzeption Fünf Lernschwerpunkte als Strukturelemente 13 2.2 Beschreibung
Inhaltsverzeichnis Seite 1. Allgemeine Aufgabenbeschreibung 9 2. Die didaktische Struktur der Rahmenrichtlinien 12 2.1 Didaktische Konzeption Fünf Lernschwerpunkte als Strukturelemente 13 2.2 Beschreibung
Die allgemeine Menschenliebe unseres Heiland-Gottes
 Die allgemeine Menschenliebe unseres Heiland-Gottes Wie tief muss Gottes Liebe sein Er liebt uns ohne Maßen Hat seinen Sohn an unsrer Statt Für alles büßen lassen Als alle Sünde auf ihm lag Der Vater sein
Die allgemeine Menschenliebe unseres Heiland-Gottes Wie tief muss Gottes Liebe sein Er liebt uns ohne Maßen Hat seinen Sohn an unsrer Statt Für alles büßen lassen Als alle Sünde auf ihm lag Der Vater sein
Offenbarung hat Folgen Predigt zu Mt 16,13-19 (Pfingsten 2015)
 Offenbarung hat Folgen Predigt zu Mt 16,13-19 (Pfingsten 2015) Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in der Schriftlesung haben wir die
Offenbarung hat Folgen Predigt zu Mt 16,13-19 (Pfingsten 2015) Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in der Schriftlesung haben wir die
Warum? Was wuerdest Du fuer eine Welt erschaffen Wenn Du Gott waerst?
 Warum? Wenn Gott allwissend, allmaechtig und voller Liebe ist... Wuerde er dann eine Welt wie unsere erschaffen? Was wuerdest Du fuer eine Welt erschaffen Wenn Du Gott waerst? --Eine Welt ohne Leiden --Eine
Warum? Wenn Gott allwissend, allmaechtig und voller Liebe ist... Wuerde er dann eine Welt wie unsere erschaffen? Was wuerdest Du fuer eine Welt erschaffen Wenn Du Gott waerst? --Eine Welt ohne Leiden --Eine
wie könnten wir unsere Orientierung in dieser Zeit als Christen finden? Kann das Wort Gottes uns helfen und uns unsere Fragen beantworten?
 Die Freudenboten 1. Im Jahre 1993 schrieb der amerikanische Schriftsteller Samuel Huntington sein Buch Kampf der Kulturen. Dieses Buch spricht über den Konflikt zwischen den Kulturen als unvermeidliches
Die Freudenboten 1. Im Jahre 1993 schrieb der amerikanische Schriftsteller Samuel Huntington sein Buch Kampf der Kulturen. Dieses Buch spricht über den Konflikt zwischen den Kulturen als unvermeidliches
Predigt über Offenbarung 21, 1-7 am in Altdorf (Pfr. Bernd Rexer)
 1 Predigt über Offenbarung 21, 1-7 am 21.11.2010 in Altdorf (Pfr. Bernd Rexer) wir sitzen heute mit sehr unterschiedlichen Gefühlen hier im Gottesdienst. Einige von uns haben in diesem Jahr einen Angehörigen
1 Predigt über Offenbarung 21, 1-7 am 21.11.2010 in Altdorf (Pfr. Bernd Rexer) wir sitzen heute mit sehr unterschiedlichen Gefühlen hier im Gottesdienst. Einige von uns haben in diesem Jahr einen Angehörigen
Advent Advent feiern heißt warten können. Warten kann nicht jeder: nicht der gesättigte, zufriedene und nicht der respektlose. Warten können nur Mensc
 Advent Advent feiern heißt warten können. Warten kann nicht jeder: nicht der gesättigte, zufriedene und nicht der respektlose. Warten können nur Menschen, die eine Unruhe mit sich herumtragen und Menschen,
Advent Advent feiern heißt warten können. Warten kann nicht jeder: nicht der gesättigte, zufriedene und nicht der respektlose. Warten können nur Menschen, die eine Unruhe mit sich herumtragen und Menschen,
Ewige Errettung Joh 10, u.a.
 Ewige Errettung Joh 10, u.a. Auszug Glaubensbekenntnis Alle wahren Gläubigen können auf der Grundlage der Autorität des Wortes Gottes wissen, daß sie errettet sind (1Joh 5,13; Röm 5,1). Diejenigen, die
Ewige Errettung Joh 10, u.a. Auszug Glaubensbekenntnis Alle wahren Gläubigen können auf der Grundlage der Autorität des Wortes Gottes wissen, daß sie errettet sind (1Joh 5,13; Röm 5,1). Diejenigen, die
Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist Predigt zu Röm 9, (10. So n Trin, )
 Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist Predigt zu Röm 9,1 8.14 16 (10. So n Trin, 31.7.16) Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der
Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist Predigt zu Röm 9,1 8.14 16 (10. So n Trin, 31.7.16) Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der
Grundlagen des Glaubens
 Grundlagen des Glaubens Einheit 4 Jesus Christus Mehr als ein Mythos? Was sagen die Leute? Jesus hat nie existiert Die Gestalt Jesus war nur eine Fiktion Selbst wenn er je gelebt hätte, wissen wir nichts
Grundlagen des Glaubens Einheit 4 Jesus Christus Mehr als ein Mythos? Was sagen die Leute? Jesus hat nie existiert Die Gestalt Jesus war nur eine Fiktion Selbst wenn er je gelebt hätte, wissen wir nichts
Predigt zu Johannes 14, 12-31
 Predigt zu Johannes 14, 12-31 Liebe Gemeinde, das Motto der heute beginnenden Allianzgebetswoche lautet Zeugen sein! Weltweit kommen Christen zusammen, um zu beten und um damit ja auch zu bezeugen, dass
Predigt zu Johannes 14, 12-31 Liebe Gemeinde, das Motto der heute beginnenden Allianzgebetswoche lautet Zeugen sein! Weltweit kommen Christen zusammen, um zu beten und um damit ja auch zu bezeugen, dass
Kompetenzorientiertes Schulcurriculum für das Fach Evangelische Religionslehre für die Jahrgangsstufen 7 bis 9
 Kompetenzorientiertes Schulcurriculum für das Fach Evangelische Religionslehre für die Jahrgangsstufen 7 bis 9 Inhaltsfelds 1: Entwicklung einer eigenen religiösen Identität Inhaltlicher Schwerpunkt: Luther
Kompetenzorientiertes Schulcurriculum für das Fach Evangelische Religionslehre für die Jahrgangsstufen 7 bis 9 Inhaltsfelds 1: Entwicklung einer eigenen religiösen Identität Inhaltlicher Schwerpunkt: Luther
Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe.
 Ich lese aus dem ersten Johannesbrief 4, 7-12 Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt
Ich lese aus dem ersten Johannesbrief 4, 7-12 Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt
Wo weht der Geist Gottes?
 Wo weht der Geist Gottes? Aufgabenblatt 5 a Wo weht der Geist Gottes? - Vom Wesen und Wirken des Heiligen Geistes 1. Wo im Alten Testament hören wir zuerst etwas vom Geist Gottes? Was wirkt Gott allgemein
Wo weht der Geist Gottes? Aufgabenblatt 5 a Wo weht der Geist Gottes? - Vom Wesen und Wirken des Heiligen Geistes 1. Wo im Alten Testament hören wir zuerst etwas vom Geist Gottes? Was wirkt Gott allgemein
Gottesdienst für August 2017 Wer ist Jesus für mich?
 Gottesdienst für August 2017 Wer ist Jesus für mich? Kreuzzeichen Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Einführung Damals und heute begeistert Jesus viele Menschen. Und sie
Gottesdienst für August 2017 Wer ist Jesus für mich? Kreuzzeichen Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Einführung Damals und heute begeistert Jesus viele Menschen. Und sie
Predigt zum Thema Wann ist ein Christ ein Christ?
 Predigt zum Thema Wann ist ein Christ ein Christ? Texte: Johannes 1,12; 3,1-13; 6,67-69 Amazing grace - wie schön, wenn jemand die wunderbare, unfassbare Gnade Gottes erfährt! Dieses Wunder kann in einem
Predigt zum Thema Wann ist ein Christ ein Christ? Texte: Johannes 1,12; 3,1-13; 6,67-69 Amazing grace - wie schön, wenn jemand die wunderbare, unfassbare Gnade Gottes erfährt! Dieses Wunder kann in einem
Der Weg Jesu Christi
 Jürgen Moltmann Der Weg Jesu Christi Christologie in messianischen Dimensionen Chr. Kaiser INHALT Vorwort 11 I. DAS MESSIANISCHE 1 Die Entstehung der Messiashoffnung 21 2 Die Entwicklung der Messiasgestalt
Jürgen Moltmann Der Weg Jesu Christi Christologie in messianischen Dimensionen Chr. Kaiser INHALT Vorwort 11 I. DAS MESSIANISCHE 1 Die Entstehung der Messiashoffnung 21 2 Die Entwicklung der Messiasgestalt
Predigt zu allein die Schrift und allein aus Gnade am Reformationstag 2017
 Predigt zu allein die Schrift und allein aus Gnade am Reformationstag 2017 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit Euch allen. Amen
Predigt zu allein die Schrift und allein aus Gnade am Reformationstag 2017 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit Euch allen. Amen
)Hl. Franz von Assisi) Allgemeines Friedensgebet
 Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst; dass ich verzeihe, wo man beleidigt; dass ich verbinde, wo Streit ist; dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; dass ich
Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst; dass ich verzeihe, wo man beleidigt; dass ich verbinde, wo Streit ist; dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; dass ich
1 Was leisten Rituale?
 1 Was leisten Rituale? a Kann man Rituale abschaffen? 12 Wozu brauchen wir Rituale? ^ 14 Was macht ein Ritual aus? 16 Wie viel individuelle Bedeutung halten Rituale aus? 18 Wann sind Rituale lebensfeindlich?
1 Was leisten Rituale? a Kann man Rituale abschaffen? 12 Wozu brauchen wir Rituale? ^ 14 Was macht ein Ritual aus? 16 Wie viel individuelle Bedeutung halten Rituale aus? 18 Wann sind Rituale lebensfeindlich?
Grundlagen des Glaubens
 Grundlagen des Glaubens Einheit 2 Was ist ein Christ? Typische Vorstellungen Was soll die Frage wir sind doch alle Christen Schließlich leben wir doch im christlichen Abendland Ein Christ ist ein moralisch
Grundlagen des Glaubens Einheit 2 Was ist ein Christ? Typische Vorstellungen Was soll die Frage wir sind doch alle Christen Schließlich leben wir doch im christlichen Abendland Ein Christ ist ein moralisch
Predigt für die Weihnachtszeit
 Predigt für die Weihnachtszeit Kanzelgruß: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir hören ein Wort heiliger Schrift
Predigt für die Weihnachtszeit Kanzelgruß: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir hören ein Wort heiliger Schrift
Gott schenkt uns Fixpunkte, Anker, (Pfähle) für unseren Glauben.
 Gott schenkt uns Fixpunkte, Anker, (Pfähle) für unseren Glauben. Momente, bei denen Wissen und Verstehen sich mit emotionalen positiven Erfahrungen verknüpfen. Gott schenkt uns Fixpunkte, Anker, (Pfähle)
Gott schenkt uns Fixpunkte, Anker, (Pfähle) für unseren Glauben. Momente, bei denen Wissen und Verstehen sich mit emotionalen positiven Erfahrungen verknüpfen. Gott schenkt uns Fixpunkte, Anker, (Pfähle)
Die dunkle Spur im Denken
 I, Markus Kneer Die dunkle Spur im Denken Rationalität und Antijudaismus 2003 Ferdinand Schöningh Paderborn München Wien Zürich Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 Einleitung 13 1. Umriß und Begründung des Forschungsgegenstands
I, Markus Kneer Die dunkle Spur im Denken Rationalität und Antijudaismus 2003 Ferdinand Schöningh Paderborn München Wien Zürich Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 Einleitung 13 1. Umriß und Begründung des Forschungsgegenstands
Mit Jesus gestorben, mit Jesus auferstanden (Taufe: Teil 2) Römer 6,3-13; Kol. 2,12-15
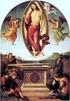 6. Mai 2012; Andreas Ruh Mit Jesus gestorben, mit Jesus auferstanden (Taufe: Teil 2) Römer 6,3-13; Kol. 2,12-15 Wichtige Vorbemerkung: Der Glaube, Wachstum im Glauben, das Geheimnis des Glaubens ist immer
6. Mai 2012; Andreas Ruh Mit Jesus gestorben, mit Jesus auferstanden (Taufe: Teil 2) Römer 6,3-13; Kol. 2,12-15 Wichtige Vorbemerkung: Der Glaube, Wachstum im Glauben, das Geheimnis des Glaubens ist immer
Einführung in die Ethik
 Helmut Burkhardt Einführung in die Ethik Teill Grund und Norm sittlichen Handelns (Fundamentalethik) BIRIUININIEIN VERLAG GIESSEN-BASEL Inhalt Vorwort 13 A. Vorfragen der Ethik: Was ist Ethik? 15 I. Klärung
Helmut Burkhardt Einführung in die Ethik Teill Grund und Norm sittlichen Handelns (Fundamentalethik) BIRIUININIEIN VERLAG GIESSEN-BASEL Inhalt Vorwort 13 A. Vorfragen der Ethik: Was ist Ethik? 15 I. Klärung
Zweijahresplan Kurzübersicht Grundschule 3/4
 Zweijahresplan Kurzübersicht Grundschule 3/4 Stand: 12.04.2008 können aus dem Alten Testament die Erzählung von der Befreiung (Exodus) wiedergeben (3.1); entdecken, dass in vielen biblischen Texten Erfahrungen
Zweijahresplan Kurzübersicht Grundschule 3/4 Stand: 12.04.2008 können aus dem Alten Testament die Erzählung von der Befreiung (Exodus) wiedergeben (3.1); entdecken, dass in vielen biblischen Texten Erfahrungen
Gottesdienst Trinitatis Dreieinheit und wir? Joh 14, Liebe Dreieinigkeits-Gemeinde, Alle guten Dinge sind drei die Zahl 3 hat
 Gottesdienst 22.5.16 Trinitatis Dreieinheit und wir? Joh 14,1-7.16-17.26.27 Liebe Dreieinigkeits-Gemeinde, Alle guten Dinge sind drei die Zahl 3 hat es in sich. Seit uralten Zeiten ist sie die Zahl der
Gottesdienst 22.5.16 Trinitatis Dreieinheit und wir? Joh 14,1-7.16-17.26.27 Liebe Dreieinigkeits-Gemeinde, Alle guten Dinge sind drei die Zahl 3 hat es in sich. Seit uralten Zeiten ist sie die Zahl der
Versöhnt mit dem Vater. Über das Geheimnis der Beichte Believe and Pray,
 Versöhnt mit dem Vater Über das Geheimnis der Beichte Believe and Pray, 18.9.2016 Schuld und Sünde Was ist Schuld? Ein komplexer Begriff! Verfehlung gegen etwas Gesolltes zwischen Menschen (sittlich, moralisch,
Versöhnt mit dem Vater Über das Geheimnis der Beichte Believe and Pray, 18.9.2016 Schuld und Sünde Was ist Schuld? Ein komplexer Begriff! Verfehlung gegen etwas Gesolltes zwischen Menschen (sittlich, moralisch,
Dreifaltigkeitsikone von Andrej Rubljow
 Der Dreieine Was haben wir vor? Mittwoch 16.10.: Einführung Sonntag 20.10.: Die Dreieinigkeit Gottes was bringt es, daran zu glauben? Mittwoch 23.10.: Biblische Begründung der Lehre von der Dreieinigkeit,
Der Dreieine Was haben wir vor? Mittwoch 16.10.: Einführung Sonntag 20.10.: Die Dreieinigkeit Gottes was bringt es, daran zu glauben? Mittwoch 23.10.: Biblische Begründung der Lehre von der Dreieinigkeit,
Glaubensgrundkurs Lektion 7: Buße, Bekehrung, Rechtfertigung
 Glaubensgrundkurs Lektion 7: Buße, Bekehrung, Rechtfertigung Wir haben bisher über die Bibel gelernt, über Gott, den Menschen, die Sünde und über die Person und das Werk von Jesus Christus. Was bedeutet
Glaubensgrundkurs Lektion 7: Buße, Bekehrung, Rechtfertigung Wir haben bisher über die Bibel gelernt, über Gott, den Menschen, die Sünde und über die Person und das Werk von Jesus Christus. Was bedeutet
Bibelgesprächskreis. Neugeboren Leben in einer neuen Dimension Joh Ablauf
 Bibelgesprächskreis Neugeboren Leben in einer neuen Dimension Joh 3.1-21 Ablauf 1. Rückblick 2. Neugeboren Das neue Wesen des Geistes 3. Zeichen seiner Liebe Das Kreuz Johannes Kapitel 3,1 21 1 Eines Nachts
Bibelgesprächskreis Neugeboren Leben in einer neuen Dimension Joh 3.1-21 Ablauf 1. Rückblick 2. Neugeboren Das neue Wesen des Geistes 3. Zeichen seiner Liebe Das Kreuz Johannes Kapitel 3,1 21 1 Eines Nachts
Eph. 2,4-10 Predigt am 7. August 2016 in Landau. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
 Eph. 2,4-10 Predigt am 7. August 2016 in Landau Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 1 4 Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen
Eph. 2,4-10 Predigt am 7. August 2016 in Landau Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 1 4 Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen
INHALT. Kapitel I Die Existenz eines sich offenbarenden Gottes 12
 INHALT Kapitel I Die Existenz eines sich offenbarenden Gottes 12 Der Gott der Philosophen und der Gott der Offenbarung 14 2. Die Offenbarung Gottes in der Geschichte und in 16 2.1 Die natürliche Offenbarung
INHALT Kapitel I Die Existenz eines sich offenbarenden Gottes 12 Der Gott der Philosophen und der Gott der Offenbarung 14 2. Die Offenbarung Gottes in der Geschichte und in 16 2.1 Die natürliche Offenbarung
Besondere Gaben des Heiligen Geistes. 1Kor 12,4-11
 Besondere Gaben des Heiligen Geistes 1Kor 12,4-11 Einführung Übergreifendes Thema in 1Kor 12-14: Wie können wir als Gläubige in der Gemeinde zusammen unseren Glauben leben? Die Gemeinde ist von Spaltungstendenzen
Besondere Gaben des Heiligen Geistes 1Kor 12,4-11 Einführung Übergreifendes Thema in 1Kor 12-14: Wie können wir als Gläubige in der Gemeinde zusammen unseren Glauben leben? Die Gemeinde ist von Spaltungstendenzen
Philosophie des 19. Jahrhunderts. Emerich Coreth Peter Ehlen Josef Schmidt. Grundkurs Philosophie 9. Zweite, durchgesehene Auflage
 Emerich Coreth Peter Ehlen Josef Schmidt Philosophie des 19. Jahrhunderts Grundkurs Philosophie 9 Zweite, durchgesehene Auflage Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln Inhalt A. Von Kant zum Deutschen
Emerich Coreth Peter Ehlen Josef Schmidt Philosophie des 19. Jahrhunderts Grundkurs Philosophie 9 Zweite, durchgesehene Auflage Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln Inhalt A. Von Kant zum Deutschen
Das Gesetz: Die Lebensregel des Christen? Johannes 14,21; 1.Johannes 3,21-24; Römer 7 8
 Das Gesetz: Die Lebensregel des Christen? Johannes 14,21; 1.Johannes 3,21-24; Römer 7 8 Charles Henry Mackintosh Heijkoop-Verlag,online seit: 28.10.2003 soundwords.de/a780.html SoundWords 2000 2017. Alle
Das Gesetz: Die Lebensregel des Christen? Johannes 14,21; 1.Johannes 3,21-24; Römer 7 8 Charles Henry Mackintosh Heijkoop-Verlag,online seit: 28.10.2003 soundwords.de/a780.html SoundWords 2000 2017. Alle
Weinfelder. Predigt. Als Christ in der Welt leben. Januar 2015 Nr aus Johannes 17,15-18
 Weinfelder Januar 2015 Nr. 761 Predigt Als Christ in der Welt leben aus Johannes 17,15-18 von Pfr. Johannes Bodmer gehalten am 28.12.2014 Johannes 17,15-18 Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen,
Weinfelder Januar 2015 Nr. 761 Predigt Als Christ in der Welt leben aus Johannes 17,15-18 von Pfr. Johannes Bodmer gehalten am 28.12.2014 Johannes 17,15-18 Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen,
Predigt am 6. Sonntag der Osterzeit 2015 Lesung: Apg, Evangelium Joh 15,9-17. Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe.
 Predigt am 6. Sonntag der Osterzeit 2015 Lesung: Apg, Evangelium Joh 15,9-17 Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Liebe Schwestern und Brüder, irgendwie ahnen wir, dass diese
Predigt am 6. Sonntag der Osterzeit 2015 Lesung: Apg, Evangelium Joh 15,9-17 Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Liebe Schwestern und Brüder, irgendwie ahnen wir, dass diese
3.Missionsreise Paulus aus Korinth Gläubige in Rom Wunsch dorthin zu reisen den Gläubigen dienen Reise nach Spanien
 Während der 3.Missionsreisevon Paulusim Jahr 56/57 aus Korinth geschrieben (Röm15,25-28; 16,1+23; Apg 20,3). an Gläubige in Rom; Gemeinde dort wurde nicht durch Paulus gegründet, er ist bislang nichtdort
Während der 3.Missionsreisevon Paulusim Jahr 56/57 aus Korinth geschrieben (Röm15,25-28; 16,1+23; Apg 20,3). an Gläubige in Rom; Gemeinde dort wurde nicht durch Paulus gegründet, er ist bislang nichtdort
Weinfelder. Predigt. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Juni 2016 Nr Römer 8,38-39
 Weinfelder Juni 2016 Nr. 777 Predigt Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes Römer 8,38-39 von Pfr. Johannes Bodmer gehalten am 27. Juni 2016 Römer 8,38-39 Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von
Weinfelder Juni 2016 Nr. 777 Predigt Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes Römer 8,38-39 von Pfr. Johannes Bodmer gehalten am 27. Juni 2016 Römer 8,38-39 Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von
Sequenzplan Abitur 2014 Kompetent in Religion
 Einführungsphase verbindliche Grundbegriffe inhaltsbezogene Kompetenzen Themen in den 5 Arbeitsheften der Reihe Kompetent in Religion historischer Jesus/verkündigter Christus Mythos - Logos Säkularisierung
Einführungsphase verbindliche Grundbegriffe inhaltsbezogene Kompetenzen Themen in den 5 Arbeitsheften der Reihe Kompetent in Religion historischer Jesus/verkündigter Christus Mythos - Logos Säkularisierung
Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft
 Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft Teilband 2 Hans-Georg Gadamer I Heinrich. Fries Mythos und Wissenschaft Alois Halder / Wolf gang Welsch Kunst und Religion Max Seckler I Jakob J. Petuchowski
Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft Teilband 2 Hans-Georg Gadamer I Heinrich. Fries Mythos und Wissenschaft Alois Halder / Wolf gang Welsch Kunst und Religion Max Seckler I Jakob J. Petuchowski
Jesus = Das Wort Gottes
 Jesus = Das Wort Gottes Wir sehen Jesus Christus in der Bibel Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Johannes 1, 1 Jesus Christus kennen! Christus ist das Abbild Gottes
Jesus = Das Wort Gottes Wir sehen Jesus Christus in der Bibel Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Johannes 1, 1 Jesus Christus kennen! Christus ist das Abbild Gottes
Predigt des Erzbischofs Friedrich Kardinal Wetter beim Pontifikalgottesdienst zum Weihnachtsfest 2007
 1 Predigt des Erzbischofs Friedrich Kardinal Wetter beim Pontifikalgottesdienst zum Weihnachtsfest 2007 Das Evangelium der Hl. Nacht hat uns nach Betlehem geführt zum Kind in der Krippe. Das Evangelium
1 Predigt des Erzbischofs Friedrich Kardinal Wetter beim Pontifikalgottesdienst zum Weihnachtsfest 2007 Das Evangelium der Hl. Nacht hat uns nach Betlehem geführt zum Kind in der Krippe. Das Evangelium
Die letzte Vorlesung vor Weihnachten findet am 16. Dezember 2016 statt. Am 13. Januar 2017 muss die Vorlesung ausfallen, weil der Saal besetzt ist.
 Lieferung 7 Die letzte Vorlesung vor Weihnachten findet am 16. Dezember 2016 statt. Am 13. Januar 2017 muss die Vorlesung ausfallen, weil der Saal besetzt ist. Die erste Vorlesung nach Weihnachten findet
Lieferung 7 Die letzte Vorlesung vor Weihnachten findet am 16. Dezember 2016 statt. Am 13. Januar 2017 muss die Vorlesung ausfallen, weil der Saal besetzt ist. Die erste Vorlesung nach Weihnachten findet
Eine starke Gemeinde (2)
 Eine starke Gemeinde (2) Taufe und Nachfolge Radikal und voller Freude Taufgottesdienst, 23.08.2015 Taufe bedeutet: Gott sieht seine Menschen. Denn Taufe ist ein Ausdruck der Beziehung von Gott und Mensch.
Eine starke Gemeinde (2) Taufe und Nachfolge Radikal und voller Freude Taufgottesdienst, 23.08.2015 Taufe bedeutet: Gott sieht seine Menschen. Denn Taufe ist ein Ausdruck der Beziehung von Gott und Mensch.
Klasse 7 Leitthema Jona 1. Halbjahr, 1. Quartal. Didaktisch-methodische Zugriffe
 Klasse 7 Leitthema Jona 1. Halbjahr, 1. Quartal W3: Situationen beschreiben, in denen existenzielle Fragen des Lebens auftreten De1: Grundformen religiöser und biblischer Sprache sowie individueller und
Klasse 7 Leitthema Jona 1. Halbjahr, 1. Quartal W3: Situationen beschreiben, in denen existenzielle Fragen des Lebens auftreten De1: Grundformen religiöser und biblischer Sprache sowie individueller und
jemand segnet? Wie werde ich für andere zum Segen? 1- Mein erster Gedanke: Die verfehlte Wahrheit,
 Der Segen Heute geht es um das Thema Segen. Und aus diesem Grund möchte ich mit ihnen, die bekannteste Segnung der Bibel lesen, die Segnung Abrahams in 1 Mose 12, 1-2 Und der HERR sprach zu Abraham: Geh
Der Segen Heute geht es um das Thema Segen. Und aus diesem Grund möchte ich mit ihnen, die bekannteste Segnung der Bibel lesen, die Segnung Abrahams in 1 Mose 12, 1-2 Und der HERR sprach zu Abraham: Geh
Version 25. Juni 2015 Heilsgewissheit Einbildung oder Wirklichkeit?
 www.biblische-lehre-wm.de Version 25. Juni 2015 Heilsgewissheit Einbildung oder Wirklichkeit? 1. Erkennungszeichen: Vertrauen in die Heilige Schrift... 2 2. Erkennungszeichen: Rechte Selbsterkenntnis und
www.biblische-lehre-wm.de Version 25. Juni 2015 Heilsgewissheit Einbildung oder Wirklichkeit? 1. Erkennungszeichen: Vertrauen in die Heilige Schrift... 2 2. Erkennungszeichen: Rechte Selbsterkenntnis und
Was bedeutet Dir die Auferstehung? Welche Auswirkung hat sie auf dein Leben?
 Was bedeutet Dir die Auferstehung? Welche Auswirkung hat sie auf dein Leben? Bedeutung der Auferstehung: Der Beweis, dass der Vater das Erlösungswerk Jesu angenommen hat, es bestätigt hat. Der Beweis,
Was bedeutet Dir die Auferstehung? Welche Auswirkung hat sie auf dein Leben? Bedeutung der Auferstehung: Der Beweis, dass der Vater das Erlösungswerk Jesu angenommen hat, es bestätigt hat. Der Beweis,
Predigt über Joh 16,5-15, Pfingstsonntag, den
 Predigt über Joh 16,5-15, Pfingstsonntag, den 12.6.2011 Kanzelgruß: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus Amen. Liebe Gemeinde! Wir hören sie in unseren
Predigt über Joh 16,5-15, Pfingstsonntag, den 12.6.2011 Kanzelgruß: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus Amen. Liebe Gemeinde! Wir hören sie in unseren
Believe and Pray. 11. Januar Der du bist im Himmel... was beten wir eigentlich? Vater Unser Teil I. Bischof Stefan Oster
 Believe and Pray 11. Januar 2015 Der du bist im Himmel... was beten wir eigentlich? Vater Unser Teil I Bischof Stefan Oster Der du bist im Himmel... Was beten wir eigentlich? Vater Unser Teil I So sollt
Believe and Pray 11. Januar 2015 Der du bist im Himmel... was beten wir eigentlich? Vater Unser Teil I Bischof Stefan Oster Der du bist im Himmel... Was beten wir eigentlich? Vater Unser Teil I So sollt
Was kommt nach dem Tod?
 Hans Kessler Was kommt nach dem Tod? Über Nahtoderfahrungen, Seele, Wiedergeburt, Auferstehung und ewiges Leben Butzon & Bercker Inhalt Vorwort 11 Einleitung: Was kommt nach dem Tod? Ein verwirrendes Spektrum
Hans Kessler Was kommt nach dem Tod? Über Nahtoderfahrungen, Seele, Wiedergeburt, Auferstehung und ewiges Leben Butzon & Bercker Inhalt Vorwort 11 Einleitung: Was kommt nach dem Tod? Ein verwirrendes Spektrum
Leiter- und Arbeitsunterlagen
 ü Leiter- und Arbeitsunterlagen YOUBehave = handeln nach Gottes Plan -Jakobus 3, 17-24 Was sagt diese Bibelstelle aus? Jakobus geht es NICHT darum, dass wir möglichst viel für Gott und die Gemeinde tun
ü Leiter- und Arbeitsunterlagen YOUBehave = handeln nach Gottes Plan -Jakobus 3, 17-24 Was sagt diese Bibelstelle aus? Jakobus geht es NICHT darum, dass wir möglichst viel für Gott und die Gemeinde tun
Die Entrückung Die Erste Auferstehung
 Die Entrückung Die Erste Auferstehung (The Rapture) Offenb. 20,6 1.Thess. 4,13-18, Matthäus 24,40-44 DER NÄCHSTE SCHRITT IN GOTTES PLAN!...Denn ihr wißt weder Tag noch Stunde in der der Menschensohn kommen
Die Entrückung Die Erste Auferstehung (The Rapture) Offenb. 20,6 1.Thess. 4,13-18, Matthäus 24,40-44 DER NÄCHSTE SCHRITT IN GOTTES PLAN!...Denn ihr wißt weder Tag noch Stunde in der der Menschensohn kommen
KC Evangelische Religion Leitfrage: Nach dem Menschen fragen. Erwartete Kompetenzen. 1./2. Schuljahrgang 3./4 Schuljahrgang
 KC Evangelische Religion Leitfrage: Nach dem Menschen fragen Erwartete Kompetenzen 1./2. Schuljahrgang 3./4 Schuljahrgang nehmen Freude, Trauer, Angst, Wut und Geborgenheit als Erfahrungen menschlichen
KC Evangelische Religion Leitfrage: Nach dem Menschen fragen Erwartete Kompetenzen 1./2. Schuljahrgang 3./4 Schuljahrgang nehmen Freude, Trauer, Angst, Wut und Geborgenheit als Erfahrungen menschlichen
Sünde WAS IST DAS? UND WIE KANN MAN DARÜBER REDEN? DAS WESEN DER SÜNDE PERSPEKTIVEN DES DIALOGS
 Sünde WAS IST DAS? UND WIE KANN MAN DARÜBER REDEN? DAS WESEN DER SÜNDE PERSPEKTIVEN DES DIALOGS Die vier Punkte Sündenerkenntnis nur im Glauben Röm.1,16: Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und
Sünde WAS IST DAS? UND WIE KANN MAN DARÜBER REDEN? DAS WESEN DER SÜNDE PERSPEKTIVEN DES DIALOGS Die vier Punkte Sündenerkenntnis nur im Glauben Röm.1,16: Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und
Neues Leben - ist Leben im Licht! Eph.5,1-21
 4. Nov. 2012; Andreas Ruh Neues Leben - ist Eph.5,1-21 Wie kommt es zu diesem neuen Leben? Dadurch, dass ich die Nähe Gottes suche! Dies bedeutet aber immer, sich seinem Licht auszusetzen, weil Gott selbst
4. Nov. 2012; Andreas Ruh Neues Leben - ist Eph.5,1-21 Wie kommt es zu diesem neuen Leben? Dadurch, dass ich die Nähe Gottes suche! Dies bedeutet aber immer, sich seinem Licht auszusetzen, weil Gott selbst
1 Ist Religion an Worte und Orte gebunden? 10
 1 Ist Religion an Worte und Orte gebunden? 10 Wo findet man Religion? 12 Religion als Suche? 14 Was ist Religion? 16 Was sind religiöse Erfahrungen? 18 Klingt in allen Menschen eine religiöse Saite? 20
1 Ist Religion an Worte und Orte gebunden? 10 Wo findet man Religion? 12 Religion als Suche? 14 Was ist Religion? 16 Was sind religiöse Erfahrungen? 18 Klingt in allen Menschen eine religiöse Saite? 20
HGM Hubert Grass Ministries
 HGM Hubert Grass Ministries Partnerletter 12/14 Gott hat dir bereits alles geschenkt. Was erwartest du von Gott, was soll er für dich tun? Brauchst du Heilung? Bist du in finanzieller Not? Hast du zwischenmenschliche
HGM Hubert Grass Ministries Partnerletter 12/14 Gott hat dir bereits alles geschenkt. Was erwartest du von Gott, was soll er für dich tun? Brauchst du Heilung? Bist du in finanzieller Not? Hast du zwischenmenschliche
Inhalt. Vorwort... ix
 Inhalt Vorwort... ix Wer hat euch behext?... 1 Das Vorbild des Glaubens... 21 Die Unerbittlichkeit des Gesetzes... 39 Der Gerechte wird aus Glauben leben... 47 Losgekauft vom Fluch des Gesetzes... 59 Was
Inhalt Vorwort... ix Wer hat euch behext?... 1 Das Vorbild des Glaubens... 21 Die Unerbittlichkeit des Gesetzes... 39 Der Gerechte wird aus Glauben leben... 47 Losgekauft vom Fluch des Gesetzes... 59 Was
Was meint Glaube? Vortrag
 1 Vortrag Vortrag Einleitung Stellt man in einem Interview auf Straße die Frage:, so würde die häufigste und typische Antwort lauten: Glaube heißt, ich weiß nicht so recht. Glaube heutzutage meint NichtWissen-Können.
1 Vortrag Vortrag Einleitung Stellt man in einem Interview auf Straße die Frage:, so würde die häufigste und typische Antwort lauten: Glaube heißt, ich weiß nicht so recht. Glaube heutzutage meint NichtWissen-Können.
34. Sonntag im Jahreskreis - Christkönigssonntag - Lk 23, C - Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst
 34. Sonntag im Jahreskreis - Christkönigssonntag - Lk 23, 35-43 - C - Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst Wir hören König und denken an Macht und Glanz auf der einen, gehorsame
34. Sonntag im Jahreskreis - Christkönigssonntag - Lk 23, 35-43 - C - Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst Wir hören König und denken an Macht und Glanz auf der einen, gehorsame
Die ersten Schritte. Ein Bibelkurs für Menschen, welche Gott, die Bibel und die Grundlagen des christlichen Glaubens kennenlernen möchten.
 Die ersten Schritte Ein Bibelkurs für Menschen, welche Gott, die Bibel und die Grundlagen des christlichen Glaubens kennenlernen möchten. Die Themen: Lektion 1: Wer ist Gott? Lektion 2: Was ist der Mensch?
Die ersten Schritte Ein Bibelkurs für Menschen, welche Gott, die Bibel und die Grundlagen des christlichen Glaubens kennenlernen möchten. Die Themen: Lektion 1: Wer ist Gott? Lektion 2: Was ist der Mensch?
Religion, Bildung und Erziehung bei Schleiermacher
 Christiane Ehrhardt Religion, Bildung und Erziehung bei Schleiermacher Eine Analyse der Beziehungen und des Widerstreits zwischen den»reden über die Religion«und den»monologen«v&r unipress DANKSAGUNG 5
Christiane Ehrhardt Religion, Bildung und Erziehung bei Schleiermacher Eine Analyse der Beziehungen und des Widerstreits zwischen den»reden über die Religion«und den»monologen«v&r unipress DANKSAGUNG 5
5. Sonntag der Fastenzeit C 13. März 2016
 5. Sonntag der Fastenzeit C 13. März 2016 iudica - Lektionar III/C, 100: Jes 43,16 21 Phil 3,8 14 Joh 8,1 11 Mit dem Passionssonntag, dem 5. Fastensonntag treten wir in die engere Vorbereitungszeit vor
5. Sonntag der Fastenzeit C 13. März 2016 iudica - Lektionar III/C, 100: Jes 43,16 21 Phil 3,8 14 Joh 8,1 11 Mit dem Passionssonntag, dem 5. Fastensonntag treten wir in die engere Vorbereitungszeit vor
irdischen Pilgerschaft in die Herrlichkeit der Auferstehung folgen, wo sie nun mit ihm am Herzen des Vaters ruht.
 1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Weihnachtsfest am 25. Dezember 2011 im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern Unser heutiges Weihnachtsevangelium beginnt mit
1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Weihnachtsfest am 25. Dezember 2011 im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern Unser heutiges Weihnachtsevangelium beginnt mit
HEILIGER ARNOLD JANSSEN, Priester, Ordensgründer Hochfest
 15. Januar HEILIGER ARNOLD JANSSEN, Priester, Ordensgründer Hochfest ERÖFFNUNGSVERS (Apg 1, 8) Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen
15. Januar HEILIGER ARNOLD JANSSEN, Priester, Ordensgründer Hochfest ERÖFFNUNGSVERS (Apg 1, 8) Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen
JESUS ist auferstanden!
 JESUS ist auferstanden! Was heißt das konkret? Warum ist das wichtig? Was bedeutet das für dich und mich? 1. Petr. 3:15 Lasst Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein!' Und wenn man euch nach eurer
JESUS ist auferstanden! Was heißt das konkret? Warum ist das wichtig? Was bedeutet das für dich und mich? 1. Petr. 3:15 Lasst Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein!' Und wenn man euch nach eurer
Predigtmanuskript. Thema: Wer ist Jesus für dich?
 Predigtmanuskript Thema: Wer ist Jesus für dich? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Predigttext für den letzten Sonntag nach Epiphanias
Predigtmanuskript Thema: Wer ist Jesus für dich? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Predigttext für den letzten Sonntag nach Epiphanias
Vernetzung der Bereiche, Schwerpunkte (*) und Kompetenzen (+) in Ich bin da 4
 Vernetzung der Bereiche, Schwerpunkte (*) und Kompetenzen (+) in Ich bin da 4 Ich, die anderen, 1. Gemeinschaft erleben +beschreiben die Einmaligkeit jedes Menschen mit seinen Fähigkeiten, Möglichkeiten
Vernetzung der Bereiche, Schwerpunkte (*) und Kompetenzen (+) in Ich bin da 4 Ich, die anderen, 1. Gemeinschaft erleben +beschreiben die Einmaligkeit jedes Menschen mit seinen Fähigkeiten, Möglichkeiten
Bistum Münster und Bistum Aachen Wortgottesdienst für Januar 2013 Die Hochzeit in Kana (vom 2. Sonntag im Jahreskreis C auch an anderen Tagen möglich)
 WGD Januar 2013 Seite 1 Bistum Münster und Bistum Aachen Wortgottesdienst für Januar 2013 Die Hochzeit in Kana (vom 2. Sonntag im Jahreskreis C auch an anderen Tagen möglich) L = Leiter des Wortgottesdienstes
WGD Januar 2013 Seite 1 Bistum Münster und Bistum Aachen Wortgottesdienst für Januar 2013 Die Hochzeit in Kana (vom 2. Sonntag im Jahreskreis C auch an anderen Tagen möglich) L = Leiter des Wortgottesdienstes
Veranstaltungen. Wintersemester. Biblische Theologie
 Veranstaltungen Die nachfolgende, rechtlich nicht verbindliche Tabelle bietet einen nach Fächern gegliederten Überblick über die in jedem Winter- bzw. Sommersemester angebotenen Veranstaltungen. In der
Veranstaltungen Die nachfolgende, rechtlich nicht verbindliche Tabelle bietet einen nach Fächern gegliederten Überblick über die in jedem Winter- bzw. Sommersemester angebotenen Veranstaltungen. In der
Rettung. ist möglich!
 Rettung ist möglich! Alles wird neu! Es gibt vieles, was einmal aufhört; Dinge, die plötzlich oder irgendwann ihr Ende finden. Wir spüren mit zunehmendem Alter, dass die Spannkraft, das Gedächtnis, die
Rettung ist möglich! Alles wird neu! Es gibt vieles, was einmal aufhört; Dinge, die plötzlich oder irgendwann ihr Ende finden. Wir spüren mit zunehmendem Alter, dass die Spannkraft, das Gedächtnis, die
Jesus, unser Herr! Seine Existenz vor der Schöpfung
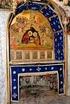 Jesus, unser Herr! Seine Existenz vor der Schöpfung Jesus, unser Herr! Seine Existenz vor der Schöpfung I. Die Frage nach der Identität von Jesus A. Wer ist Jesus, laut Aussagen von Menschen heute? a.
Jesus, unser Herr! Seine Existenz vor der Schöpfung Jesus, unser Herr! Seine Existenz vor der Schöpfung I. Die Frage nach der Identität von Jesus A. Wer ist Jesus, laut Aussagen von Menschen heute? a.
VII INHALT. Die Kirchliche Dogmatik Die Lehre vom Wort Gottes 665 Die Lehre von Gott 765 Die Lehre von der Versöhnung 851
 VII INHALT Die Kirchliche Dogmatik V Die Lehre vom Wort Gottes 665 Die Lehre von Gott 765 Die Lehre von der Versöhnung 851 Kommentar 1037 Siglenverzeichnis 1250 Literaturverzeichnis 12 51 Zeittafel zu
VII INHALT Die Kirchliche Dogmatik V Die Lehre vom Wort Gottes 665 Die Lehre von Gott 765 Die Lehre von der Versöhnung 851 Kommentar 1037 Siglenverzeichnis 1250 Literaturverzeichnis 12 51 Zeittafel zu
Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Fest Peter und Paul in der Münchner Liebfrauenkirche am 29.
 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Fest Peter und Paul in der Münchner Liebfrauenkirche am 29. Juni 2011 Heute vor 60 Jahren wurde der Heilige Vater Papst Benedikt
Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Fest Peter und Paul in der Münchner Liebfrauenkirche am 29. Juni 2011 Heute vor 60 Jahren wurde der Heilige Vater Papst Benedikt
Das Evangelium von Jesus Christus
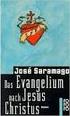 Das Evangelium von Jesus Christus Es ist vielen Menschen nicht bekannt, dass wir gerade heute in der Zeit leben, in welcher man mehr und mehr die Bibel neben die Zeitung legen kann. Die Jahrtausende alten
Das Evangelium von Jesus Christus Es ist vielen Menschen nicht bekannt, dass wir gerade heute in der Zeit leben, in welcher man mehr und mehr die Bibel neben die Zeitung legen kann. Die Jahrtausende alten
Der Schöpfer und die Menschen in ihren Sünden Warum ein Menschenopfer nötig war (Teil 1)
 Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Joh 1,37 Wie alles begann... Der Schöpfer und die Menschen in ihren Sünden Warum ein Menschenopfer nötig war (Teil 1) 2014 Jahrgang 1 Heft
Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Joh 1,37 Wie alles begann... Der Schöpfer und die Menschen in ihren Sünden Warum ein Menschenopfer nötig war (Teil 1) 2014 Jahrgang 1 Heft
Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde! Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus!
 PREDIGT über Apostelgeschichte 1,8: Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde! Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus! Unter uns geht eine Angst
PREDIGT über Apostelgeschichte 1,8: Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde! Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus! Unter uns geht eine Angst
Gott kennen..??!! - Der Titel meiner Predigt lautet Gott kennen..??!!
 Predigt von Mario Pavlovic 5.6.16 Gott kennen..??!! - Ich möchte euch alle recht herzlich an diesem Gottesdienst willkommen heissen. - Es ist sehr belebend und herausfordernd Gott zu dienen. Ist dies nicht
Predigt von Mario Pavlovic 5.6.16 Gott kennen..??!! - Ich möchte euch alle recht herzlich an diesem Gottesdienst willkommen heissen. - Es ist sehr belebend und herausfordernd Gott zu dienen. Ist dies nicht
Katholiken und Evangelikale. Gemeinsamkeiten und Unterschiede Teil 2
 Katholiken und Evangelikale Gemeinsamkeiten und Unterschiede Teil 2 Katholiken und Evangelikale Gemeinsamkeiten und Unterschiede 1. Einführung a. Ziele und Methode der Vortragsreihe b. Quellen c. Was sind
Katholiken und Evangelikale Gemeinsamkeiten und Unterschiede Teil 2 Katholiken und Evangelikale Gemeinsamkeiten und Unterschiede 1. Einführung a. Ziele und Methode der Vortragsreihe b. Quellen c. Was sind
Die biblische Taufe Seite Seite 1
 Die biblische Taufe Seite Seite 1 1. Was bedeutet das Wort "taufen"? Die Wortbedeutung nach dem Duden bzw. Herkunftswörterbuch rterbuch lautet: "Das mhd. toufen, ahd. toufan, got. daupjan ist von dem unter
Die biblische Taufe Seite Seite 1 1. Was bedeutet das Wort "taufen"? Die Wortbedeutung nach dem Duden bzw. Herkunftswörterbuch rterbuch lautet: "Das mhd. toufen, ahd. toufan, got. daupjan ist von dem unter
Ulrich HJ. Körtner. Einführung in die theologische Hermeneutik
 Ulrich HJ. Körtner Einführung in die theologische Hermeneutik Inhalt Vorwort 9 I. Theologie als hermeneutische Wissenschaft 11 1. Was ist Hermeneutik? 11 a) Die Fragenach der Frage, auf die die Hermeneutik
Ulrich HJ. Körtner Einführung in die theologische Hermeneutik Inhalt Vorwort 9 I. Theologie als hermeneutische Wissenschaft 11 1. Was ist Hermeneutik? 11 a) Die Fragenach der Frage, auf die die Hermeneutik
Predigt für Sonntag, den 2. April Thema: Das Wirken des Heiligen Geistes. Text: Römer 5,1-6
 Predigt für Sonntag, den 2. April 2017 Thema: Das Wirken des Heiligen Geistes Text: Römer 5,1-6 Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus
Predigt für Sonntag, den 2. April 2017 Thema: Das Wirken des Heiligen Geistes Text: Römer 5,1-6 Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus
Mit Jesus gestorben und auferstanden!
 Mit Jesus gestorben und auferstanden! Römer-Brief 6, 3-11 Gedanken zur Taufe Gliederung I. WIE WENN WIR UNSERE SCHULD BEZAHLT HÄTTEN II. WIE WENN WIR AUFERSTANDEN WÄREN 1 Einleitende Gedanken Heute Morgen
Mit Jesus gestorben und auferstanden! Römer-Brief 6, 3-11 Gedanken zur Taufe Gliederung I. WIE WENN WIR UNSERE SCHULD BEZAHLT HÄTTEN II. WIE WENN WIR AUFERSTANDEN WÄREN 1 Einleitende Gedanken Heute Morgen
Joh. 1,29-34 Predigt am 1.n.Epiphanias in Landau - Lichtergottesdienst
 1 Joh. 1,29-34 Predigt am 1.n.Epiphanias in Landau - Lichtergottesdienst Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. (Text einblenden) 29 Am nächsten Tag sieht
1 Joh. 1,29-34 Predigt am 1.n.Epiphanias in Landau - Lichtergottesdienst Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. (Text einblenden) 29 Am nächsten Tag sieht
A,4 Persönliches sich Mitteilen in der Gegenwart des Herrn (Schritt 4 und 5)
 A: Bibel teilen A,4 Persönliches sich Mitteilen in der Gegenwart des Herrn (Schritt 4 und 5) Zur Vorbereitung: - Bibeln für alle Teilnehmer - Für alle Teilnehmer Karten mit den 7 Schritten - Geschmückter
A: Bibel teilen A,4 Persönliches sich Mitteilen in der Gegenwart des Herrn (Schritt 4 und 5) Zur Vorbereitung: - Bibeln für alle Teilnehmer - Für alle Teilnehmer Karten mit den 7 Schritten - Geschmückter
Römer 14, Denn unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. 8 Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir
 Römer 14, 7-9 7 Denn unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. 8 Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir
Römer 14, 7-9 7 Denn unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. 8 Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir
Gemeinschaft mit den Menschen
 1 Gottes Plan: Gemeinschaft mit den Menschen GOTT HAT DEN MENSCHEN ZU SEINER EHRE GESCHAFFEN, UM MIT IHM GEMEINSCHAFT ZU HABEN UND DAMIT ER IHM DIENEN. DIE BIBEL SAGT: «Du bist würdig, unser Herr und Gott,
1 Gottes Plan: Gemeinschaft mit den Menschen GOTT HAT DEN MENSCHEN ZU SEINER EHRE GESCHAFFEN, UM MIT IHM GEMEINSCHAFT ZU HABEN UND DAMIT ER IHM DIENEN. DIE BIBEL SAGT: «Du bist würdig, unser Herr und Gott,
Berlin, / Dr. Volker Rabens
 Berlin, 23.06.2014 / Dr. Volker Rabens I. Was ist Sünde? 1. Sünde in der öffentlichen Wahrnehmung Video-Clip: http://www.youtube.com/watch?v=3tafstbvqfm Volker Rabens : Der Paulinische Sündenbegriff Folie
Berlin, 23.06.2014 / Dr. Volker Rabens I. Was ist Sünde? 1. Sünde in der öffentlichen Wahrnehmung Video-Clip: http://www.youtube.com/watch?v=3tafstbvqfm Volker Rabens : Der Paulinische Sündenbegriff Folie
