Die Fossilgeschichte der Heteroptera ein Überblick
|
|
|
- Leonard Haupt
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Mainzer naturwiss. Archiv / Beiheft 31 S Abb. Mainz 2007 Die Fossilgeschichte der Heteroptera ein Überblick TORSTEN WAPPLER, SONJA WEDMANN & JES RUST Kurzfassung Die Heteroptera sind eine seit langem erfolgreiche Insektengruppe, deren Ursprung bis in das späte Perm zurückverfolgt werden kann. Aktuell werden sieben Untergruppen der Wanzen unterschieden, für die jeweils ein kurzer Abriss ihrer Fossilgeschichte gegeben wird. Ferner werden einige fossile Wanzenfaunen von wichtigen tertiären Fossillagerstätten Europas vorgestellt. So zeichnet sich die Wanzenfauna des untereozänen Moler (Dänemark) besonders durch den Artenreichtum an Vertretern der Gerromorpha aus, während andere Gruppen der Wanzen sehr individuenreich, aber artenärmer überliefert sind. In der mitteleozänen Fossillagerstätte Grube Messel (Deutschland) stellen Wanzen einen relativ großen und diversen Anteil der Insektenfunde, während sie in dem mitteleozänen Eckfelder Maar und der oberoligozänen Fundstelle Enspel (beide Deutschland) deutlich seltener sind. Abstract Fossil history of Heteroptera: The True bugs an overview Heteroptera is an insect group that has been successful for a long time. The oldest fossils are known from the Permian period. Actually, true bugs comprise seven subgroups. A short review of the fossil history of these subgroups is given. Additionally, fossil bug faunas of several important European Fossillagerstätten are presented. The lower Eocene Moler (Denmark) is characterized by a diverse Gerromorphan fauna, while fossils of other bug taxa are very abundant, but not as diverse. In the middle Eocene fossil site Messel pit the Heteroptera represent a quite large portion of the insects, while true bugs are significantly rarer in the middle Eocene Eckfeld maar and in Enspel (all Germany). Key words: Fossil history, Insecta, Hemiptera, Heteroptera, Paraneopteran orders Abkürzungen: LfD Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz; msfossil Firma msfossil in Sulzbachtal; NHMM Naturhistorisches Museum Mainz, Landessammlung für Naturkunde Rheinland-Pfalz; SMF Senckenbergmuseum Frankfurt; SMNS Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart 1. Einleitung Die Insekten haben sich im Laufe der Evolution als eine der erfolgreichsten Tiergruppen erwiesen. Ihre ältesten Nachweise reichen weit bis in das Erdaltertum (Devon, ca. 400 Millionen Jahre) zurück relativ kurz nach dem Auftreten der ersten Landpflanzen. Hier handelt es sich um Reste ursprünglicher, ungeflügelter Insekten mit einer einzelnen dicondylen Mandibel (GRIMALDI & ENGEL 2005). Mit dem eher unvermittelten Auftreten der ersten geflügelten Insekten im Ober-Karbon (BRAUCKMANN & SCHNEIDER 1996, PROKOP et al. 2005) zeigt sich, welch schnelle Entwicklung sich innerhalb der Insekten während diesem Abschnitt der Erdgeschichte abspielte. Innerhalb der Insekten bilden die schon seit dem Perm bekannten Paraneoptera (= Psocoptera, Phthiraptera, Hemiptera) eine morphologisch und ökologisch besonders vielgestaltige Gruppe. Ihre Monophylie sowie die Monophylie der Hemiptera wird durch eine ganze Reihe von sehr charakteristischen, abgeleiteten Merkmalen begründet (u. a. HENNIG 1981, AX 1999, YOSHIZAWA & SAIGUSA 2001). Hingegen lässt sich die traditionelle Aufteilung der Hemiptera in Ho- 47
2 moptera und Heteroptera nicht aufrechterhalten, denn für die Homoptera konnten bislang keine Synapomorphien nachgewiesen werden (HENNIG 1981, STRÜMPEL 1983, CARVER et al. 1991, WHEELER et al. 1993a, b, AX 1999). Bei den Paraneoptera zeigt sich eine graduelle Entwicklung von eher borsten- oder meißelförmigen Mundwerkzeugen der Psocoptera, über einfach gestaltete stechendsaugende Mundwerkzeuge innerhalb der Phthiraptera, hin zum mehrgliederigen Stechrüssel der Wanzen, der für die Aufnahme flüssiger, sowohl tierischer als auch pflanzlicher Nahrung, dient. Die Wanzen (Heteroptera) bilden neben den Zikaden (Auchenorrhyncha) die größte Teilgruppe der Paraneoptera und sind weltweit verbreitet. Es gibt kaum Lebensräume, in denen keine Wanzen existieren, wodurch ihr Potential für die Fossilüberlieferung erheblich erhöht wird. Einige Arten aus der Gruppe der Meerwasserläufer (Halobatinae), mit der schon aus dem Eozän bekannten Gattung Halobates, leben als einzige Insekten sogar permanent auf dem offenen Ozean. Die einzelnen Arten können unterschiedlich stark ausgeprägte Standortansprüche aufweisen. Weltweit sind bisher rund Wanzenarten beschrieben worden, die meisten leben in den Tropen und Subtropen der Alten und Neuen Welt (vgl. DECKERT & GÖLLNER- SCHEIDING 2003). 2. Heteroptera Fossilien und Alter Die Heteroptera bilden ohne Zweifel eine monophyletische Gruppe, denen die Coleorrhyncha als Schwestergruppe gegenübergestellt werden (WHEELER et al. 1993b, CAMPBELL et al. 1995). Die Coleorrhyncha sind eine heute artenarme Gruppe, die mit nur einer Familie (derzeit 25 beschriebene Arten), eine typische Gondwana- Verbreitung in Australien, Neuseeland und der Südspitze Südamerikas zeigen. Dort leben sie auf Moosen in den Nothofagus- Wäldern. Fossil treten Stammgruppenvertreter der Coleorrhyncha bereits im späten Jura auf, was aber je nach Auffassung verschiedener Autoren (u. a. SHCHERBAKOV & POPOV 2002) unterschiedlich bewertet wird. Sie vermuten, dass die Progonocimicidae eine Teilgruppe innerhalb der Coleorrhyncha bilden, wodurch deren Ursprung weit bis in das Perm zurückverlegt wird. Die Heteroptera sind eine sehr alte Insektengruppe und ihre frühesten Fossilfunde reichen ebenfalls bis in das späte Perm (vor ca. 252 Mio. Jahren) zurück (EVANS 1950). Ab dem Jura sind viele Teilgruppen der Heteroptera bereits äußerst formenreich vertreten und nur relativ wenige Taxa haben älteste Fossilbelege, die nur aus känozoischen Ablagerungen bekannt sind. Allgemein ist die Systematik der Wanzen noch immer unzureichend geklärt. Früher teilte man die Wanzen nach ihrer Lebensweise in die Gruppen Hydrocorisae (Wasserwanzen), Amphibiocorisae (Wasserläufer) und Geocorisae (Landwanzen). Seit der Arbeit von LESTON et al. (1954) unterscheidet man heute die folgenden sieben Unterordnungen innerhalb der Wanzen (WHEELER et al. 1993b), die aufgrund ihrer ökologischen Ansprüche unterschiedlich stark im Fossilbericht dokumentiert sind. 1. Enicocephalomorpha STICHEL, Dipsocoromorpha MIYAMOTO, Gerromorpha POPOV, Nepomorpha POPOV, Leptopodomorpha POPOV, Cimicomorpha LESTON, PENDERGRAST & SOUTHWOOD Pentatomomorpha LESTON, PENDERGRAST & SOUTHWOOD 1954 Die Enicocephalomorpha gelten heute als die ursprünglichste Wanzengruppe. Zur Zeit sind weltweit etwa 450 Arten bekannt. Zur interessanten Biologie dieser Tiere gehören Schwarmflüge und eine mehr oder weniger ausgeprägte subterrane Lebensweise. Als Schwestergruppe aller restlichen Wanzen sollten sie schon im Fossilbericht der Trias zu finden sein. Älteste Nachweise sind bislang aber nur aus dem kretazischen Bernstein des Libanons bekannt (ca Mio. Jahre alt) (vgl. Zusammenstellung der übrigen Fossilfunde in GRIMALDI & ENGEL 2005). Die Dipsocoromorpha sind kleine, nur 0,5-4 mm große Tiere, die vor allem an feuchten Standorten vorkommen. Vergleichbar den Enicocephalomorpha finden sich auch 48
3 hier die ältesten Fossilnachweise im Libanesischen Bernstein der Unterkreide. Zu den Nepomorpha gehören alle aquatischen Wanzen. Die Nepidae (Wasserskorpione) sind eine vorwiegend tropisch verbreitete Familie mit etwa 230 Arten. Nahe verwandt mit den Nepiden sind die Belostomatiden oder Riesenwasserwanzen. Die Arten können bis zu 12 cm groß werden. Wie auch die Wasserskorpione leben sie räuberisch und haben die Vorderbeine zu Fangbeinen umgestaltet, die Mittel- und Hinterbeine sind noch deutlicher als bei den Nepiden als Schwimmbeine ausgebildet. Zurzeit sind weltweit rund 150 Arten bekannt, die vorwiegend in den Tropen vorkommen. Angehörige der Nepomorpha treten bereits sehr artenreich im Fossilbericht der Kreide auf (vgl. Übersicht in RASNITSYN & QUICKE 2002). Vor allem in den Ablagerungen der Santana Formation von Brasilien zählen sie mit zu den häufigsten Fossilfunden (Abb. 1). Zu den Gerromorpha gehört unter anderem die Familie der Wasserläufer (Gerridae), die wohl von den meisten Laien als Angehörige der großen Gruppe der Wanzen erkannt wird. Bisher sind fossil 38 Arten aus sechs Familien bekannt (ANDERSEN & GRI- MALDI 2001), die insgesamt ein Zeitintervall von rund 120 Millionen Jahren umspannen (ANDERSEN 1998, ANDERSEN & GRIMALDI 2001, NEL & POPOV 2000) (Abb. 2). Die meisten Funde stammen jedoch aus dem Paläogen. Hier sind insbesondere die Funde aus der Fur- und Ølst-Formation und dem Baltischen und Dominikanischen Bernstein zu nennen. Allein aus den Ablagerungen der Fur- und Ølst-Formation sind sieben Arten aus drei Familien (Gerridae, Hydrometridae, Macroveliidae) beschrieben worden (s. u.). Damit nimmt die alttertiäre dänische Fauna weltweit eine herausragende Stellung ein. Aber auch die etwas jüngeren Funde aus dem Eckfelder Maar liefern wichtige Details zur Vervollständigung paläobiologischer und biogeographischer Fragestellungen, vor allem, da es sich fast ausnahmslos um Taxa handelt, die bislang nur aus fossilisierten Baumharzen bekannt waren (WAPPLER 2003a). Insgesamt umfasst die Gerromorpha-Fauna heute nahezu 1800 Arten in acht Familien, die weltweit verbreitet sind (ANDERSEN 1982, ANDERSEN & GRIMALDI 2001, DAM- GAARD et al. 2005). Ihre größte Diversität haben sie in den Tropen, Zentral-Afrika und im indomalayischen Raum. Etwa 10% der Arten lebt heute in rein marinen Habitaten (z. B. Halobates sp.). Abb. 1: Verschiedene Vertreter der Nepomorpha aus den Plattenkalken der Araripe-Group / Crato-Formation / Nova-Olinda-Member (U-Kreide, Aptium-Albium, 115 Mio. J., NE-Brasilien in der Umgebung von Nova Olinda im Bundesstaat Ceará). a.) Larve einer Riesenwasserwanze (Belostomatidae) (SMNS 66563). b.) Angehöriger der Schwimmwanzen (Naucoridae) (msfossil G58). c.) Adultes Exemplar einer Riesenwasserwanze (Belostomatidae) (SMF B122); (Maßstab 5 mm). 49
4 Abb. 2: Angehörige der Gerromorpha aus den Plattenkalken der Araripe-Group / Crato- Formation / Nova-Olinda-Member (U-Kreide, Aptium-Albium, 115 Mio. Jahre, NE-Brasilien in der Umgebung von Nova Olinda im Bundesstaat Ceará). a.) Angehöriger der Mesoveliidae oder Archegocimicidae (SMNS 66371). b.) Unbestimmter Teichläufer (Hydrometridae) (SMNS 64654); (Maßstab 5 mm). Die Unterordnung der Leptopodomorpha ist nur eine sehr kleine Teilgruppe mit schätzungsweise 300 Arten. Ihre größte Familie bilden die Saldidae mit ca. 270 Arten. Die Tiere besitzen sehr große, oft nierenförmige Augen, mit denen sie ihre Beute ausmachen. Sie leben vor allem in Gewässernähe und sind sehr agil. Fossil tritt diese Gruppe erst recht spät in Erscheinung. So sind sie erst aus dem Miozän des Dominikanischen und Mexikanischen Bernsteins bekannt (mündl. Mittl. Dr. Solórzano Kraemer 2007). Die Unterordnung der Cimicomorpha enthält zur Zeit 16 Familien, darunter die beiden artenreichsten Taxa Miridae und Reduviidae. Die Raubwanzen (Reduviidae) haben einen kräftigen, kurzen Rüssel, mit dem die Beute angestochen und ausgesaugt wird. Alle 6500 bekannten Arten sind räuberisch. Typisch für optisch orientierte Jäger sind die großen Augen. Die Vorderbeine sind meist zu Fangbeinen umgebildet. Die meisten Raubwanzen können Laute produzieren, indem sie mit dem Rostrum an einer wellblechartigen Struktur am Prosternum reiben. Ähnlich den Nepomorpha treten Angehörige der Reduvioidea im Grenzbereich Jura/Kreide, vor ca. 145 Mio. Jahren, erstmals im Fossilbericht auf (SHCHERBAKOV & POPOV 2002). Mit ca bekannten Arten stellen die Weichwanzen (Miridae) die größte Gruppe innerhalb der Heteroptera (WACHMANN et al. 2004). Es handelt sich meist um kleine Tiere. Die Körpergestalt ist sehr variabel. Die Mehrzahl der Arten hat einen weichen, langovalen Körper, es gibt jedoch auch sehr schmale, stabförmige Tiere und kurze gedrungene Arten. Die meisten Miriden sind Pflanzensaftsauger, nur wenige Arten sind räuberisch, einige omnivor. Unter den phytophagen Arten gibt es polyphage Arten, viele sind jedoch auch ausgesprochen spezifisch in ihren Nahrungsansprüchen. Ihr Fossilnachweis reicht weit bis in den Jura zurück. Älteste Vertreter der Miroidea sind aus dem Mittel-Jura (ca. 170 Mio. Jahre alt) bekannt (u. a. SHCHERBAKOV & POPOV 2002). 50
5 Die große Gruppe der Pentatomomorpha enthält 29 Familien und zeichnet sich unter anderem durch abdominale Trichobothrien aus. Aber auch die Aradidae und Termitaphididae (Aradoidea) werden hierher gestellt, obwohl sie keine abdominalen Trichobothrien besitzen; sie werden den übrigen Pentatomomorpha mit Trichobothrien ("Trichophora") als Schwestergruppe gegenübergestellt. Der Fossilbericht dieser Großgruppe ist außerordentlich gut und reicht bis in den Jura zurück. Vertreter moderner Familien der Cimicoidea (Abb. 3), Pentatomoidea, Coreoidea, Lygaeoidea und Pyrrhocoroidea findet man jedoch nicht vor der Kreide im Fossilbericht (GRIMALDI & ENGEL 2005). Ein Hauptteil ihrer Entwicklung vollzog sich erst im Laufe des frühen Tertiärs. Abb. 3: Proxylastodoris gerdae BECHLY & WITTMANN, 2000 (Heteroptera: Thaumatocoridae) aus dem Baltischen Bernstein (SMNS BB-2368; Gesamtlänge 3 mm). Die Gattung scheint nahe verwandt zu sein mit der aus der Neotropis bekannten Gattung Xylastodoris BARBER (HEISS & POPOV 2002). 3. Die Wanzenfaunen ausgewählter tertiärer Fundstellen 3.1 Moler Mit etwa 20% aller Funde und mindestens 30 verschiedenen Arten bilden die Wanzen eine der häufigsten und artenreichsten Insektengruppen der marinen Ablagerungen der dänischen Ølst- und Fur- Formation, die auch als Moler bekannt sind (RUST 1999). Bei den ca. 60 m mächtigen Sedimenten, die mit einem Alter von ca. 54 Millionen Jahren in das tiefste Eozän datiert werden, handelt es sich vorwiegend um helle Diatomite, in die ca. 200 vulkanische Aschenlagen und mehrere Horizonte von stark verfestigten Konkretionen eingeschaltet sind. In diesen so genannten Zementsteinen sind die Insekten äußerst detailreich und oft dreidimensional überliefert. Sie sind hauptsächlich durch aktiven Flug oder durch Luftströmungen über das offene Meer gelangt, denn die Ablagerungen wurden in der ehemaligen Nordsee, etwa 50 bis 100 km von der damaligen skandinavischen Küste entfernt, gebildet. Von den Wanzen des Moler sind die Gerromorpha mit zahlreichen Individuen von sieben Arten aus den Gruppen der Gerridae, Hydrometridae und Macroveliidae dank der langjährigen Forschungen von Dr. Nils Møller Andersen vom Zoologischen Museum in Kopenhagen besonders gut untersucht (z. B. ANDERSEN 1982, 1998). Wenn man bedenkt, dass bislang nur wenig mehr als 30 fossile Arten der Gerromorpha beschrieben wurden, wird die herausragende Stellung des dänischen Vorkommens verständlich. Bei den Gerridae des Moler handelt es sich zudem um die bislang ältesten Fossilnachweise dieser Gruppe. Von den aquatischen Wanzen der Nepomorpha sind dagegen nur wenige Exemplare der Belostomatidae, Nepidae und Notonectidae aus dem dänischen Vorkommen bekannt. Vorbehaltlich gewisser systematischer Unsicherheiten befinden sich darunter auch die ältesten Vertreter der Gattung Belostoma, die mit zwei Arten vorkommt, von denen die eine fast 4 cm Körperlänge erreicht (RUST 1999). 51
6 Abb. 4: Fossile Insekten aus dem Eozän des dänischen Moler. a.) Fossil einer ursprünglich nur schwach sklerotisierten Alydidae (Länge 14 mm). b.) Weitgehend vollständiges Exemplar einer Lygaeidae (Länge 10 mm). c.) Pentatomidae mit Überlieferung der ehemaligen Musterung (Länge ohne Antennen 14 mm). d.) Weibchen eines Vertreters der Pentatomorpha mit in situ überlieferten, dreidimensionalen Eiern. Die Ovarien waren ursprünglich in Längsrichtung angeordnet, wurden aber während der Fossilisation durch die abdominalen Segmentgrenzen überprägt (Gesamtlänge 17 mm). 52
7 Die Miridae (Weichwanzen) sind mit mindestens fünf Arten überliefert. Wegen der nur schwachen Sklerotisierung der Kutikula ist die Erhaltung von wichtigen diagnostischen Merkmalen aber oft nicht gut genug für weitergehende systematische Bestimmungen. Ein unvollständiges Exemplar der häufigsten Art der Miridae ist früher auf der Basis eines Einzelfundes als Larve einer Chironomidae beschrieben worden (KOH- RING 1994). Erst später zeigte sich, dass es sich gleichsam um ein spezifisches Zerfallsstadium einer Weichwanze handelt, deren Körper postmortal nach einem ganz charakteristischen Schema während der Drift im Wasser disartikuliert wurde (RUST 1998). Alle übrigen Wanzen aus dem Moler gehören den Pentatomorpha an, deren zahlreiche Teilgruppen äußerst vielgestaltig sein können. Sie bilden die mit Abstand häufigsten Funde der Wanzen in den dänischen Vorkommen. Von den Erdwanzen (Cydnidae) liegen mindestens vier Arten vor, von denen eine Art, Teleocydnus transitorius, schon von dem dänischen Entomologen Dr. Kai L. Henriksen 1922 beschrieben wurde. Die häufigste Wanze aus dem dänischen Moler gehört zu den Baumwanzen (Pentatomidae), von denen mindestens sechs Arten vorliegen (RUST 1999). Unter mehr als Einzelfunden dieser Art gibt es zahlreiche Individuen, die noch die ursprüngliche, lebhafte Musterung der Antennen und des Connexivums zeigen (Abb. 4c). Auffällig sind auch Funde, bei denen im Bereich des Scutellums vermutlich fossilisierte Reste von Pflanzensaft oder -harz als dunkelrote, bernsteinartige Substanz überliefert sind. Ein besonderes Phänomen sind ferner große Ansammlungen von fossilen Baumwanzen in der unmittelbaren Umgebung von fossilem Treibholz. Diese schwimmenden Inseln wurden von den Tieren während ihres Überflugs über die damalige Nordsee offenbar gezielt angeflogen. Von den übrigen Teilgruppen der Pentatomorpha kommen schließlich noch die Bodenwanzen (Lygaeidae) mit drei Arten (Abb. 4b) und die Krummfühlerwanzen (Alydidae) mit nur einer Art vor (RUST 1999). Von den heute nur mit ca. 250 Arten bekannten Alydidae ist bisher nur ein einziger Fund gemacht worden, der aber hervorragend erhalten ist (Abb. 4a). Aus der großen Vielzahl von nicht näher bestimmbarem Fossilmaterial ist ein Einzelfund eines Wanzenweibchens erwähnenswert, bei dem die hellbraun gefärbten Eier, teilweise noch völlig intakt im Inneren des Abdomens erhalten geblieben sind (Abb. 4d). Eine solche herausragende Fossilüberlieferung, die enorme Individuenzahl und der große Artenreichtum machen den dänischen Moler zu einem der weltweit bedeutendsten Vorkommen fossiler Wanzen. 3.2 Messel Maar Die Fossillagerstätte Grube Messel liegt etwa 9 km nordöstlich von Darmstadt. Hier wurde bis 1971 der so genannte Ölschiefer abgebaut. Bekannt ist Messel vor allem durch seine sehr gut erhaltenen Wirbeltier- Fossilien. Nichtsdestotrotz stellen Insekten und Blätter den Großteil der geborgenen Fossilien. Die Genese des ehemaligen Messel-Sees blieb lange Zeit umstritten. Den Beweis, dass es sich um ein Maar handelt, erbrachte eindeutig allerdings erst die 2001 abgeteufte Forschungsbohrung (FELDER & HARMS 2004). Diese Bohrung lieferte auch frisches Material, um das genaue Alter der Entstehung mit radiometrischen Methoden genauer einzugrenzen. Danach entstand das Maar vor ungefähr 48 Mio. Jahren (MERTZ & RENNE 2005). Der Anteil der Wanzen an der derzeit etwa Messel-Insekten umfassenden Sammlung des Forschungsinstituts Senckenberg (SMF) beträgt 10,7% (unpublizierte Daten S.W.). Wasserbewohnende Wanzen sind in Messel sehr selten, es dominieren die landbewohnenden Gruppen (vgl. Anmerkungen zum Eckfelder Maar). Unter den bis zur Familie bestimmten Wanzen sind Erdwanzen (Cydnidae) mit Abstand am häufigsten, was bereits LUTZ (1990) festgestellt hat. Viele Erdwanzen schillern in blaumetallischen Strukturfarben. Außerdem sind in Messel folgende Familien nachgewiesen: Baum- oder Schildwanzen (Pentatomidae), Raubwanzen (Reduviidae), Blindwanzen (Miridae) und Gitterwanzen (Tingidae). Selten sind Sichelwanzen (Nabidae), Bodenwanzen (Lygaeidae) und Rindenwanzen (Aradidae). Die seltenen Wasserwanzen sind durch Rückenschwimmer (Notonectidae) und die semiaquatisch lebenden Wasserläufer (Gerridae) vertreten, außerdem gibt es Einzelfunde von Riesenwanzen (Belostomatidae). 53
8 Abb. 5: Verschiedene Vertreter der Heteroptera aus der Fundstelle Messel. a.) Neuroctenus kotejai WAPPLER & HEISS, 2006a (SMF MeI 11628; Länge ca. 5 mm). b.) Rekonstruktionszeichnung des Holotypus von N. kotejai. c.) Rekonstruktionszeichnung des Holotypus von Exmesselensis disspinosus WAPPLER, 2003b. d.) E. disspinosus (SMF MeI 6301; Länge 2,5 mm). 54
9 Eine umfassende Bearbeitung der Heteropteren-Fauna steht noch aus. Bislang sind nur einzelne Teilgruppen der Pentatomorpha (KINZELBACH 1970, WAPPLER & HEISS 2006a), der Cimicomorpha (WAPPLER 2003b, 2006) und der Gerromorpha (WAPPLER & ANDERSEN 2004) bearbeitet worden. Innerhalb der Aradidae sind in Messel die Gattungen Neuroctenus und Mezira bekannt (WAPPLER & HEISS 2006a) (Abb. 5ab). Interessanterweise liegt das Hautverbreitungsgebiet der Gattung Mezira im subtropisch-tropischen Klimabereich. Einzige Ausnahmen bilden die Arten Mezira tremulae (GERMAR, 1822), die in der westlichen Paläarktis vorkommt, sowie eine beschriebene Art aus dem Baltischen Bernstein (vgl. WEITSCHAT & WICHARD 2002) und die bekannten Arten aus Messel und Eckfeld. Ein ähnliches Verbreitungsmuster findet sich bei einer Vielzahl anderer aus Messel geborgener Insekten-Taxa, wie z. B. den Tingiden, die insgesamt mit vier Arten aus Messel vorliegen (WAPPLER 2003b, 2006) (Abb. 5cd). 3.3 Eckfelder Maar Das ca. 2 km nordwestlich von Eckfeld bei Manderscheid, am Südwestrand des tertiären Hocheifel-Vulkanfeldes gelegene Eckfelder Maar (PIRRUNG et al. 2001), ist das bislang älteste bekannte Eifel-Maar. Radiometrische Datierungen ergaben für seine Entstehung ein Alter von ca. 44 Mio. Jahren (MERTZ et al. 2000). Es gehört mit zu den bedeutendsten Fossillagerstätten des Eozäns, die nunmehr seit 20 Jahren vom Naturhistorischen Museum Mainz und der Landessammlung für Naturkunde Rheinland-Pfalz intensiv untersucht wird. Neben zahlreichen Wirbeltierfunden, die teilweise sogar mit Haut und Haaren überliefert sind, machen vor allem Insekten und Blätter den größte Teil der geborgenen Funde aus. Inzwischen wurden ca Insekten aus 12 Ordnungen geborgen, die vor allem für die Rekonstruktion der naturräumlichen Gliederung des ehemaligen Lebensraumes unverzichtbar sind (WAPPLER 2003a). Nach Auswertung der gesamten Insektenfauna stellen die Coleoptera nahezu 84% aller Funde, was im Vergleich zu anderen Fundstellen ein überdurchschnittlicher Wert ist, der vor allem auf spezifische taphonomische Bedingungen und die Morphometrie des ehemaligen Maar-Sees zurückzuführen ist (u. a. LUTZ & KAULFUß 2006). Neben Angehörigen der Hymenoptera stellen die Heteroptera mit ca. 2,5% die dritthäufigste Ordnung innerhalb der Taphozönose (WAPPLER 2003a). Zusammengenommen liegen derzeit knapp über 100 Funde von Wanzen vor, wovon 29% der Teilgruppe der Cydnidae zugeordnet werden können. Insgesamt ist die überlieferte Wanzenfauna individuenund artenarm. Allgemein dominieren Angehörige der terrestrisch lebenden Teilgruppen, speziell der Pentatomorpha (Abb. 6ad). Ein Phänomen, welches auch in vergleichbaren Fundstellen zu beobachten ist. Wasserwanzen (Nepomorpha) sind bislang nicht nachgewiesen. Interessanterweise liegen von semiaquatischen Wanzen (Gerromorpha) derzeit 11 Funde vor. Der allgemeine Habitus und speziell der verlängerte Mesothorax, die relativ kurzen Vorderbeine und die stark verlängerten mittleren und hinteren Extremitäten, machen eine Zugehörigkeit zu den Gerridae sehr wahrscheinlich und grenzt sie gegenüber den anderen Familien innerhalb der Gerromorpha ab (WAPPLER & ANDERSEN 2004) (Abb. 6e-f). Eine weitere taxonomische Eingrenzung, welche die Erhaltung der Kopf- Beborstung, eine mögliche Ausbildung eines prätarsalen Aroliums und die Struktur der metathorakalen Duftdrüsen voraussetzen würde, sind bei den Eckfelder Exemplaren nicht erhalten. Bei zwei Exemplaren handelt es sich vermutlich um Nymphalstadien der Gattung Gerris FABRICIUS. Bei xerothermophilen Taxa, wie den Angehörigen der Cydnidae (Erdwanzen), zeigt sich eine mögliche Korrelation ihres Auftretens mit bestimmten Faziesbereichen: Die Auswertungen der bislang 31 Funde deuten auf ein episodisches Auftreten dieser Gruppe hin (WAPPLER 2003a). So ist sicher, dass in Eckfeld Hangrutschungen im Bereich der Kraterinnenböschungen vorübergehend gut drainierte (Tuffe!) und deshalb vergleichsweise trockene Freiflächen geschaffen haben. Die zahlreich in das Grabungsprofil eingeschalteten Turbidite und Debrite gehen zumindest teilweise auf solche subaerischen Hangrutsche zurück. Das heißt, dass in Eckfeld temporär immer wieder solche vegetationsfreien Flächen entstanden, die allerdings von der umgebenden Vegetation 55
10 56
11 vielleicht schon binnen weniger Monate wieder überwachsen wurden. Xerotherme Habitate waren also zumindest kleinräumig und zeitlich befristet vorhanden und könnten xerothermophilen Insekten episodisch günstige Lebensbedingungen geboten haben. In Ergänzung zur Beschreibung fossiler Aradiden aus Messel und Enspel (WAPPLER & HEISS 2006a, c), konnten in Eckfeld drei neue Arten nachgewiesen werden, die alle zur Unterfamilie Mezirinae gestellt wurden (WAPPLER & HEISS 2006b) (Abb. 6c). Insgesamt ist die Überlieferung der Rindenwanzen aber eher schlecht, sowohl in Sedimenten, als auch im Bernstein. Aus dem Baltischen Bernstein sind bislang nur 27 Arten aus 5 Gattungen bekannt, wobei Angehörige der Aradinae am artenreichsten sind (HEISS 2007). Angesichts der Tatsache, dass Aradiden vor allem an der Borke von Laub- und Nadelbäumen vorkommen, ist es überraschend wie arten- und individuenarm die Aradiden Bernsteinfauna ist. 3.4 Enspel In der oberoligozänen Fossillagerstätte Enspel im Westerwald stellen Wanzen mit etwa 1% der Funde nur einen sehr kleinen Anteil der Insekten. Der ehemalige Enspeler See war wahrscheinlich meso- bis eutroph und bildete sich in einer durch explosiven Maar-Vulkanismus entstandenen Caldera (PIRRUNG et al. 2001). Neben Insekten sind Pflanzenfossilien besonders zahlreich (KÖHLER 1998). Die biostratigraphische Datierung mit Hilfe eines hervorragend erhaltenen Eomyiden-Skelettes (STORCH et al. 1996) wurde durch direkte radiometrische Datierungen, die ein Alter von etwa 25 Mio. Jahren ergeben, bestätigt (MERTZ et al. 2007). Bei den Wanzen sind sowohl aquatisch lebende als auch landbewohnende Wanzengruppen vorhanden. Bisher sind Riesenwanzen, Wasserläufer, Rindenwanzen, Weichwanzen und Baum- oder Schildwanzen bekannt (WEDMANN 2000). Die räuberisch lebenden Riesenwanzen (Belosto- matidae) sind in Enspel sowohl durch erwachsene wie auch durch juvenile Stadien belegt (Abb. 7a, b). Ihre Vorderbeine sind als Raubbeine ausgebildet (Abb. 7a), die vorderen Beinglieder können gegeneinander eingeklappt werden und dienen zum Festhalten der Beutetiere. Die beiden hinteren Beinpaare sind abgeflacht und dienen zum Schwimmen. Bei den juvenilen Tieren ist die Hell-Dunkel-Zeichnung des Abdomens (Abb. 7a) gut zu erkennen, bei erwachsenen Tieren ist der Hinterleib von den dunklen Hemielytren bedeckt (Abb. 7b). Das Vorkommen der nicht flugfähigen juvenilen Exemplare belegt die autochthone Entwicklung der Riesenwanzen im Uferbereich des ehemaligen Enspeler Sees. Wasserläufer (Gerridae) sind nur durch ein unvollständig überliefertes Fossil belegt (WEDMANN 2000). Die bisher einzige Rindenwanze (Aradidae) aus Enspel wurde als Neuroctenus enspelensis beschrieben (WAPPLER & HEISS 2006c, Abb. 7d). Abbildung 7c zeigt ein Exemplar der Weichwanzen (Miridae), die sich zumeist phytophag ernähren. Unter den Enspeler Baumwanzen (Pentatomidae) ist eine sehr charakteristisch gemusterte Art (Abb. 7e) mit sechs relativ gut erhaltenen Fossilfunden vertreten (WEDMANN 2000). Andere Baumwanzen von Enspel wurden durch postmortale Zerfallsprozesse stärker disartikuliert (Abb. 7f). Insgesamt ist die in Enspel überlieferte Wanzenfauna erstaunlich individuen- und artenarm, was mit Sicherheit taphonomische Ursachen hat. 4. Danksagung Für die Einladung, diesen Artikel zu verfassen, bedanken wir uns herzlich bei den Editoren. Für die Bereitstellung von Fossilmaterial und den Zugang zu den jeweiligen Sammlungen danken wir den Herren Henrik Madsen, Bent Søe Mikkelsen und Erwin Rettig für die Moler-Insekten, Herrn Dr. S. Schaal (SMF) für die Messel-Insekten, Herrn Dr. H. Lutz (NHMM) für die Eckfeld- Insekten und Herrn Dr. M. Wuttke (LfD) für die Enspel-Insekten. Abb. 6: Verschiedene Vertreter der Heteroptera aus der Fundstelle Eckfeld. a.) Unbestimmte Pentatomidae (Baumwanze) (NHMM PE1994/184 a+b, LS; Gesamtlänge 13,5 mm). b.) Unbestimmte Lygaeidae (Bodenwanze) (NHMM PE1990/87, LS; Länge 5,7 mm). c.) Mezira eckfeldensis WAPPLER & HEISS, 2006b (NHMM PE1990/4, LS; Gesamtlänge 5,6 mm). d.) Nahezu vollständig erhaltene Baumwanze (Pentatomidae) (NHMM PE1992/323 a+b, LS; Gesamtänge 7,86 mm). e.) Gerris sp. indet. (Nymphe) (NHMM PE2000/2, LS; Länge 3,4 mm). f.) Lutetiabates eckfeldensis WAPPLER & ANDERSEN, 2004 (NHMM PE2000/542 a+b, LS), komplett erhaltener Angehöriger der Gerriden in lateraler Ansicht (Gesamtlänge 3,6 mm). 57
12 58
13 5. Schriftenverzeichnis ANDERSEN, N. M. (1982): The semiaquatic bugs (Hemiptera, Gerromorpha). Phylogeny, adaptations, biogeography, and classification. Entomonograph 3: Klampenborg. ANDERSEN, N. M. (1998): Water striders from the Paleogene of Denmark with a review of the fossil record and evolution of semiaquatic bugs (Hemiptera, Gerromorpha). Biologiske Skrifter 50: Copenhagen. ANDERSEN, N. M. & GRIMALDI, D. (2001): A fossil water measurer from the mid- Cretaceous Burmese amber (Heteroptera: Gerromorpha: Hydrometridae). Insect Systematics & Evolution 32: Copenhagen. Ax, P. (1999): Das System der Metazoa II. Ein Lehrbuch der phylogenetischen Systematik. 383 S., Jena Stuttgart (Gustav Fischer Verlag). BECHLY, G. & WITTMANN, M. (2000): Two new tropical bugs (Insecta: Heteroptera: Thaumatocoridae Xylastodorinae and Hypsipterygidae) from Baltic amber. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie B (Geologie und Paläontologie) 289: Stuttgart. BRAUCKMANN, C. & SCHNEIDER, J. (1996): Ein unter-karbonisches Insekt aus dem Raum Bitterfeld/Delitzsch (Pterygota, Arnsbergium, Deutschland). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte 1996 (1): Stuttgart. CAMPBELL, B. C., STEFFEN-CAMPBELL, J. D., SORENSON, J. T. & GILL, R. J. (1995): Paraphyly of Homoptera and Auchenorrhyncha inferred from 18S rdna nucleotide sequences. Systematic Entomology 20 (3): Oxford. CARVER, M., GROSS, G. F. & WOODWARD, T. E. (1991): Hemiptera (bugs, leafhoppers, cicadas, aphids, scale insects etc.). In: NAUMANN, I. D. (ed.): The insects of Australia. A textbook for students and research workers. 1: , 2. Aufl., Melbourne (Melbourne University Press). DAMGAARD, J., ANDERSEN, N. M. & MEIER, R. (2005): Combining molecular and morphological analyses of water strider phylogeny (Hemiptera-Heteroptera, Gerromorpha): effects of alignment and taxon sampling. Systematic Entomology 30 (2): Oxford. DECKERT, J. & GÖLLNER-SCHEIDING, U. (2003): 24. Ordnung Heteroptera, Wanzen. In: DATHE, H. (Hrsg.): Wirbellose Tiere, 5. Teil: Insecta: , Heidelberg Berlin (Spektrum Akademischer Verlag). EVANS, J. W A re-examination of an Upper Permian insect, Paraknightia magnifica Ev. Records of the Australian Museum 22 (3): Sydney. FELDER, M. & HARMS, F.-J. (2004): Lithologie und genetische Interpretation der vulkano-sedimentären Ablagerungen aus der Grube Messel anhand der Forschunhsbohrung Messel und weiterer Bohrungen. Courier Forschungsinstitut Senckenberg 252: Frankfurt am Main. GRIMALDI, D. & ENGEL, M. S. (2005): Evolution of the Insects. XV S., New York (Cambridge University Press). HEISS, E. (2007): Aradidae Flat bugs in amber. What is known what is missing? (Heteroptera, Aradidae). In: ALONSO, J. (Ed.): III. International Meeting on Palaeoarthropodology, Abstract book: 84, Vitoria-Gasteiz, Spain (Alava Museum of Natural History). HEISS, E. & POPOV, Yu. A. (2002): Reconsideration of the systematic position of Thaicorinae with notes on fossil and extant Thaumastocoridae (Hemiptera: Heteroptera). Polish Journal of Entomology 71: Wrocław. Abb. 7: Verschiedene Vertreter der Heteroptera aus der Fundstelle Enspel. a.) Larve einer Riesenwasserwanze (Belostomatidae) (Slg-Nr. 8694); (Gesamtlänge 12 mm). b.) Adultes Exemplar einer Belostomatidae (Slg-Nr. 9112); (Gesamtänge 14 mm). c.) Nahezu vollständig erhaltene Weichwanze (Miridae) mit Flügelmusterung (Slg-Nr. 9545); (Gesamtlänge 7 mm). d.) Neuroctenus enspelensis WAPPLER & HEISS, 2006c (Slg-Nr. 5992); (Gesamtlänge ca. 4,5 mm). e.) Unbestimmter Angehöriger der Pentatomoidea (PE 97/5009); (Fossillänge 11,4 mm). f.) Vertreter der Baumwanzen, der durch durch postmortale Zerfallsprozesse stark disartikuliert wurde (Slg-Nr. 7898); (Flügellänge 10 mm). 59
14 HENNIG, W. (1981): Insect phylogeny (edited and translated by A.C. Pont). XXII S.; New York (Wiley & Sons). HENRIKSEN, K. (1922): Eocene insects from Denmark. Danmarks geologiske Undersøgelse 2 (37): København. KINZELBACH R. (1970): Wanzen aus dem eozänen Ölschiefer von Messel (Insecta: Heteroptera). Notizblatt des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung 98: Wiesbaden. KOHRING, R. (1994): Eine Chironomiden- Larve (Insecta: Diptera) aus der Fur- Formation (Paleozän,? Unter-Eozän; NW-Dänemark). Paläontologische Zeitschrift 68 (3/4): Stuttgart. KÖHLER, J. (1998): Die Fossillagerstätte Enspel. Vegetation, Vegetationsdynamik und Klima im Oligozän. Dissertation Universität Tübingen, 211 S., Tübingen. LESTON, D., PENDERGRAST, J. G. & SOUTH- WOOD, T. R. E. (1954): Classification of the terrestrial Heteroptera (Geocorisae). Nature 174: London. LUTZ, H. (1990): Systematische und palökologische Untersuchungen an Insekten aus dem Mittel-Eozän der Grube Messel bei Darmstadt. Courier Forschungsinstitut Senckenberg 124: Frankfurt am Main. LUTZ, H. & KAULFUß, U. (2006): A dynamic model for the meromictic lake Eckfeld Maar (Middle Eocene, Germany). Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften 157 (3): Stuttgart. MERTZ, D. F., RENNE, P. R. (2005): A numerical age for the Messel fossil deposit (UNESCO World Heritage Site) derived from 40Ar/39Ar dating on a basaltic rock fragment. Courier Forschungsinstitut Senckenberg 255: Frankfurt am Main. MERTZ, D. F., RENNE, P. R., WUTTKE, M. & MÖDDEN, C. (2007): A numerically calibrated reference level (MP28) for the terrestrial mammal-based biozonation of the European Upper Oligocene. International Journal of Earth Sciences 96 (2): Berlin, Heidelberg. MERTZ, D. F., SWISHER, C. C., FRANZEN, J. L., NEUFFER, F. O. & LUTZ, H. (2000): Numerical dating of the Eckfeld maar 60 fossil site, Eifel, Germany: a calibration mark for the Eocene time scale. Naturwissenschaften 87 (6): Berlin, Heidelberg. NEL, A. & POPOV, Yu. A. (2000): The oldest known fossil Hydrometridae from the lower Cretaceous of Brazil (Heteroptera: Gerromorpha). Journal of Natural History 34: London. PIRRUNG, M., BÜCHEL, G. & JACOBY, W. (2001): The Tertiary volcanic basins of Eckfeld, Enspel and Messel (Germany). Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 152 (1): Stuttgart. PROKOP, J., NEL, A. & HOCH, I. (2005): Discovery of the oldest known Pterygota in the Lower Carboniferous of the Upper Silesian Basin in the Czech Republic (Insecta: Archaeorthoptera). Geobios 38: Amsterdam. RASNITSYN, A. P. & QUICKE, D. L. J. (eds.) (2002): History of Insects. XII S.; Dordrecht (Kluwer Academic Publishers). RUST, J. (1998): Biostratinomie von Insekten aus der Fur-Formation von Dänemark (Moler, oberes Paleozän / unteres Eozän). Paläontologische Zeitschrift 72 (1/2): Stuttgart. RUST, J. (1999): Biologie der Insekten aus dem ältesten Tertiär Nordeuropas. - Habilitationsschrift 1999: 482 S., 34 Taf., Biologische Fakultät, Universität Göttingen. SHCHERBAKOV, D. E. & POPOV, YU. A. (2002): Superorder Cimicidea Laicharting, Oder Hemiptera Linné, The bugs, cicadas, plantlice, scale insects, etc. (= Cimicida Laicharting, 1781, = Homoptera Leach, Heteroptera Latreille, 1810). In: RAS- NITSYN, A. P. & QUICKE, D. L. J. (eds.): History of Insects: , Dordrecht (Kluwer Academic Publishers). STORCH, G., ENGESSER, B. & WUTTKE, M. (1996): Oldest fossil record of gliding in rodents. Nature 379: London. STRÜMPEL, H. (1983): Homoptera (Pflanzensauger). In: FISCHER, M. (Hrsg.): Handbuch der Zoologie, 4: XI+222 S., Berlin, New York (de Gruyter).
15 WACHMANN, E, MELBER, A. & DECKERT J. (2004): Wanzen, Band 2: Cimicomorpha: Microphysidae (Flechtenwanzen), Miridae (Weichwanzen). In: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile 75: 288 S., Keltern (Goecke & Evers). WAPPLER, T. (2003a): Die Insekten aus dem Mittel-Eozän des Eckfelder Maares, Vulkaneifel. Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, Beiheft 27: Mainz. WAPPLER, T. (2003b): New fossil lace bugs (Heteroptera: Tingidae) from the Middle Eocene of the Grube Messel (Germany), with a catalog of fossil lace bugs. Zootaxa 374: Auckland. WAPPLER, T. (2006): Lutetiacader, a puzzling new genus of cantacaderid lace bugs (Heteroptera: Tingidae) from the Middle Eocene Messel maar, Germany. Palaeontology 49 (2): London. WAPPLER, T. &. ANDERSEN, N. M. (2004): Fossil water striders from the Middle Eocene fossil sites Eckfeld and Messel, Germany (Hemiptera, Gerromorpha). Paläontologische Zeitschrift 78 (1): Stuttgart. WAPPLER, T. & HEISS, E. (2006a): Flatbugs from Paleogene limnic sediments. I. Grube Messel (Heteroptera: Aradidae). Polish Journal of Entomology 75: Wrocław. WAPPLER, T. & HEISS, E. (2006b): Flatbugs from Paleogene limnic sediments. II. Eckfeld maar (Heteroptera: Aradidae). Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv 44: Mainz. WAPPLER, T. & HEISS, E. (2006c): Flatbugs from Paleogene limnic sediments. III. Enspel (Heteroptera: Aradidae). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen 58: Wien. WEDMANN, S. (2000): Die Insekten der oberoligozänen Fossillagerstätte Enspel (Westerwald, Deutschland) Systematik, Biostratinomie und Paläoökologie. Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, Beiheft 23: Mainz. WEITSCHAT, W. & WICHARD, W. (2002): Atlas of Plants and Animals in Baltic Amber. 256 S., München (Verlag Friedrich Pfeil). WHEELER, W. C., CARTWRIGHT, P. & HAYA- SHI, C. Y. (1993a): Arthropod phylogeny: A combined approach. Cladistics 9: Westport. WHEELER, W. C., SCHUH, R. T. & BANG, R. (1993b): Cladistic relationships among higher groups of Heteroptera: Congruence between morphological and molecular data sets. Entomologica Scandinavica 24: Copenhagen. YOSHIZAWA, K. & SAIGUSA, T. (2001): Phylogenetic analysis of paraneopteran orders (Insecta: Neoptera) based on forewing base structure, with comments on monophyly of Auchenorrhyncha (Hemiptera). Systematic Entomology, 26 (1): Oxford. Anschrift der Verfasser: Torsten Wappler, Sonja Wedmann & Jes Rust, Institut für Paläontologie, Universität Bonn, Nussallee 8, Bonn twappler@uni-bonn.de; swedmann@uni-bonn.de; jrust@uni-bonn.de Aktuelle Anschrift: Sonja Wedmann, Foschungsinstitut Senckenberg, Forschungsstation Grube Messel, Markstr. 35, Messel Manuskript eingegangen am:
16 62
Flatbugs from Paleogene limnic sediments. III. Enspel (Heteroptera: Aradidae)
 Z.Arb.Gem.Öst.Ent. 58 39-44 Wien, 28.4.2006 ISSN 0375-5223 Flatbugs from Paleogene limnic sediments. III. Enspel (Heteroptera: Aradidae) TORSTEN WAPPLER & ERNST HEISS A b s t r a c t Neuroctenus enspelensis
Z.Arb.Gem.Öst.Ent. 58 39-44 Wien, 28.4.2006 ISSN 0375-5223 Flatbugs from Paleogene limnic sediments. III. Enspel (Heteroptera: Aradidae) TORSTEN WAPPLER & ERNST HEISS A b s t r a c t Neuroctenus enspelensis
Wanzen (Heteroptera) in Berlin und Brandenburg Literatur
 Wanzen (Heteroptera) in Berlin und Brandenburg Literatur ACHTZIGER, R. & NIGMANN, U. (2008): Neue Nachweise von Arocatus longiceps STÅL 1872 in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg
Wanzen (Heteroptera) in Berlin und Brandenburg Literatur ACHTZIGER, R. & NIGMANN, U. (2008): Neue Nachweise von Arocatus longiceps STÅL 1872 in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg
Wedmann, S. (2010). A brief review of the fossil history of plant masquerade by insects. Palaeontographica B 283,
 Publications Sonja Wedmann Dlussky, G. M., Wedmann S. (in press). Poneromorph ants (Hymenoptera, Formicidae: Amblyoponinae, Ectatomminae, Ponerinae) of Grube Messel, Germany: Diversification during the
Publications Sonja Wedmann Dlussky, G. M., Wedmann S. (in press). Poneromorph ants (Hymenoptera, Formicidae: Amblyoponinae, Ectatomminae, Ponerinae) of Grube Messel, Germany: Diversification during the
Die Fossilgeschichte der Jagdkäfer (Trogossitidae)
 Die Fossilgeschichte der Jagdkäfer (Trogossitidae) 117 Entomologie heute 23 (2011): 117-122 Die Fossilgeschichte der Jagdkäfer (Trogossitidae) The Fossil Record of the Bark-gnawing Beetles (Trogossitidae)
Die Fossilgeschichte der Jagdkäfer (Trogossitidae) 117 Entomologie heute 23 (2011): 117-122 Die Fossilgeschichte der Jagdkäfer (Trogossitidae) The Fossil Record of the Bark-gnawing Beetles (Trogossitidae)
Bivalven des höchsten Oberdevons im Bergischen Land (Strunium; nördliches Rhein. Schiefergebirge)
 41 Geologica el Palaeonlologica 5.41-63 3 Abb., 1 Tab., 4 Taf. ~arburg, 28.9.1990 Bivalven des höchsten Oberdevons im Bergischen Land (Strunium; nördliches Rhein. Schiefergebirge) ~ichael R. W. AMLER,
41 Geologica el Palaeonlologica 5.41-63 3 Abb., 1 Tab., 4 Taf. ~arburg, 28.9.1990 Bivalven des höchsten Oberdevons im Bergischen Land (Strunium; nördliches Rhein. Schiefergebirge) ~ichael R. W. AMLER,
Legekreis. "Heimische Insekten"
 Legekreis "Heimische Insekten" Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Ameisen Ameisen leben in großen Staaten und jede Ameise hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Ameisen haben sechs
Legekreis "Heimische Insekten" Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Ameisen Ameisen leben in großen Staaten und jede Ameise hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Ameisen haben sechs
Ein Stein 100 Fossilien: Erfassung einer paläontologischen Sammlung in digicult
 Ein Stein 100 Fossilien: Erfassung einer paläontologischen Sammlung in digicult Ulrich Kotthoff Universität Hamburg Centrum für Naturkunde Geologisch-Paläontologisches Museum ulrich.kotthoff@uni-hamburg.de
Ein Stein 100 Fossilien: Erfassung einer paläontologischen Sammlung in digicult Ulrich Kotthoff Universität Hamburg Centrum für Naturkunde Geologisch-Paläontologisches Museum ulrich.kotthoff@uni-hamburg.de
VORSCHAU. zur Vollversion. Wie entstehen Fossilien? Echte Versteinerung
 AV Echte Versteinerung Tod vor 70 Millionen Jahren - Haut, Fleisch und innere Organe wurden zersetzt. Knochen und Zähne blieben übrig. Wie entstehen Fossilien? Schlick und Sand bedeckten das Skelett. In
AV Echte Versteinerung Tod vor 70 Millionen Jahren - Haut, Fleisch und innere Organe wurden zersetzt. Knochen und Zähne blieben übrig. Wie entstehen Fossilien? Schlick und Sand bedeckten das Skelett. In
Taphonomie. Prof. H. U. Pfretzschner. Institut für Geowissenschaften, Tübingen. Prof. H. U. Pfretzschner
 Taphonomie Institut für Geowissenschaften, Tübingen Die Taphonomie befasst sich mit allen Prozessen, die vom Tod eines Organismus bis zum fertigen Fossil ablaufen. http://www.geology.wisc.edu/homepages/g100s2/public_html/geologic_time/l10_devonia
Taphonomie Institut für Geowissenschaften, Tübingen Die Taphonomie befasst sich mit allen Prozessen, die vom Tod eines Organismus bis zum fertigen Fossil ablaufen. http://www.geology.wisc.edu/homepages/g100s2/public_html/geologic_time/l10_devonia
71. Pontosphaera indooceanica Čepek (1973)
 71. Pontosphaera indooceanica Čepek (1973) Pl. 1, figs 1-4 Figs. 1-4. Pontosphaera indooceanica n. sp. Fig. 1. Distale Ansicht, Holotypus. Indischer Ozean ("Meteor"-Reise, 1965), Kolbenlotkern KK-167,
71. Pontosphaera indooceanica Čepek (1973) Pl. 1, figs 1-4 Figs. 1-4. Pontosphaera indooceanica n. sp. Fig. 1. Distale Ansicht, Holotypus. Indischer Ozean ("Meteor"-Reise, 1965), Kolbenlotkern KK-167,
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Informationen 15. Exotische Gehölze
 Exotische Gehölze im KIRCHHEIMER-Arboretum Freiburg des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg mit 47 Farbaufnahmen von HELMUT PRIER Bearbeiter: HELMUT PRIER DIETHARD H. STORCH
Exotische Gehölze im KIRCHHEIMER-Arboretum Freiburg des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg mit 47 Farbaufnahmen von HELMUT PRIER Bearbeiter: HELMUT PRIER DIETHARD H. STORCH
Leben auf der Erde früher und heute
 1 1 Leben auf der Erde früher und heute Das Leben auf der Erde sah nicht immer so aus, wie wir Menschen es heute kennen. Im Laufe der Geschichte unseres Planeten haben sich alle Ökosysteme immer wieder
1 1 Leben auf der Erde früher und heute Das Leben auf der Erde sah nicht immer so aus, wie wir Menschen es heute kennen. Im Laufe der Geschichte unseres Planeten haben sich alle Ökosysteme immer wieder
2 Belege für die Evolutionstheorie
 2 Belege für die Evolutionstheorie 2.1 Homologie und Analogie Die systematische Einordnung von Lebewesen erfolgt nach Ähnlichkeitskriterien, wobei die systematischen Gruppen durch Mosaikformen, d.h. Lebewesen
2 Belege für die Evolutionstheorie 2.1 Homologie und Analogie Die systematische Einordnung von Lebewesen erfolgt nach Ähnlichkeitskriterien, wobei die systematischen Gruppen durch Mosaikformen, d.h. Lebewesen
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek
 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Richard Hesse Zoologe Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Richard Hesse Zoologe Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
3 Chronostratigraphie
 3 Chronostratigraphie 40 3 Chronostratigraphie Die Chronostratigraphie des Buntsandsteins beruht auf zwei Methoden: Biostratigraphie und Magnetostratigraphie. Für die biostratigraphischen Gliederungen
3 Chronostratigraphie 40 3 Chronostratigraphie Die Chronostratigraphie des Buntsandsteins beruht auf zwei Methoden: Biostratigraphie und Magnetostratigraphie. Für die biostratigraphischen Gliederungen
Über Eintagsfliegen Stand: : 2. korrigierte Fassung Dr. Arne Haybach * Ephemeroptera Germanica
 Ephemeroptera Germanica http://www.ephemeroptera.de 1 Über Eintagsfliegen Stand: 29.08.2002: 2. korrigierte Fassung Dr. Arne Haybach * Ephemeroptera Germanica Die Frage, was eine Eintagsfliege ausmacht
Ephemeroptera Germanica http://www.ephemeroptera.de 1 Über Eintagsfliegen Stand: 29.08.2002: 2. korrigierte Fassung Dr. Arne Haybach * Ephemeroptera Germanica Die Frage, was eine Eintagsfliege ausmacht
K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 2014
 K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 2014 Montag, den 29. September 2014, 10.00 11.00 Uhr Name: (deutlich in Blockschrift schreiben) Matrikelnummer: (wichtig: unbedingt angeben!)
K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 2014 Montag, den 29. September 2014, 10.00 11.00 Uhr Name: (deutlich in Blockschrift schreiben) Matrikelnummer: (wichtig: unbedingt angeben!)
Vier neue Arten der Gattung Cartodere (Aridius) C. G. THOMSON, 1859 aus Papua-Neuguinea und Neuseeland (Coleoptera: Latridiidae)
 Vier neue Arten der Gattung Cartodere (Aridius) C. G. THOMSON, 1859 aus Papua-Neuguinea und Neuseeland (Coleoptera: Latridiidae) WOLFGANG H. RÜCKER Abstract Three new species of the genus Cartodere C.G.
Vier neue Arten der Gattung Cartodere (Aridius) C. G. THOMSON, 1859 aus Papua-Neuguinea und Neuseeland (Coleoptera: Latridiidae) WOLFGANG H. RÜCKER Abstract Three new species of the genus Cartodere C.G.
Die Grabungssaison in Messel
 Die Grabungssaison in Messel Die Grabungsaktivitäten des Forschungsinstituts Senckenberg in der Grube Messel liefern jedes Jahr aufsehenerregende Fossilfunde. Die Grube Messel ist seit 1995 als Welterbestätte
Die Grabungssaison in Messel Die Grabungsaktivitäten des Forschungsinstituts Senckenberg in der Grube Messel liefern jedes Jahr aufsehenerregende Fossilfunde. Die Grube Messel ist seit 1995 als Welterbestätte
Neuer Nachweis von Triops cancriformis (Crustacea, Notostraca) in Mecklenburg-Vorpommern
 Neuer Nachweis von Triops cancriformis (Crustacea, Notostraca) in Mecklenburg-Vorpommern WOLFGANG ZESSIN, Schwerin Einleitung Die Ordnung der Blattfußkrebse (Phyllopoda) ist in Mitteleuropa mit etwa hundert,
Neuer Nachweis von Triops cancriformis (Crustacea, Notostraca) in Mecklenburg-Vorpommern WOLFGANG ZESSIN, Schwerin Einleitung Die Ordnung der Blattfußkrebse (Phyllopoda) ist in Mitteleuropa mit etwa hundert,
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage. utb 4401
 utb 4401 Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage Böhlau Verlag Wien Köln Weimar Verlag Barbara Budrich Opladen Toronto facultas Wien Wilhelm Fink Paderborn A. Francke Verlag Tübingen Haupt Verlag Bern Verlag
utb 4401 Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage Böhlau Verlag Wien Köln Weimar Verlag Barbara Budrich Opladen Toronto facultas Wien Wilhelm Fink Paderborn A. Francke Verlag Tübingen Haupt Verlag Bern Verlag
Torsten van der Heyden. Mitglied des Redaktionskomitees von BV news Publicaciones Científicas Hamburg (Deutschland)
 Ein aktueller Nachweis von Zelus renardii (Kolenati, 1856) auf Kreta/Griechenland (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Harpactorinae) Una cita reciente de Zelus renardii (Kolenati, 1856) en Creta/Grecia
Ein aktueller Nachweis von Zelus renardii (Kolenati, 1856) auf Kreta/Griechenland (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Harpactorinae) Una cita reciente de Zelus renardii (Kolenati, 1856) en Creta/Grecia
-Archäopteryx- Adrian Hinz, Marc Häde und Mirko Spors
 -Archäopteryx- Adrian Hinz, Marc Häde und Mirko Spors Langschwanzflugsaurier Kurzschwanzflugsaurier Lebensweise Anatomie Flugsaurier der verschiedenen Zeiten Archäopteryx besitzen einen langen Schwanz
-Archäopteryx- Adrian Hinz, Marc Häde und Mirko Spors Langschwanzflugsaurier Kurzschwanzflugsaurier Lebensweise Anatomie Flugsaurier der verschiedenen Zeiten Archäopteryx besitzen einen langen Schwanz
Gliederung. Informationsgrundlage Probleme EOL Schätzungsmöglichkeiten Beschriebene + geschätzte Artenzahl Ausblick
 How Many Species are There on Earth? Lehrveranstaltung: Biodiversität ität und Nachhaltigkeit it Dozent: Dr. H. Schulz Referentin: Sonja Pfister Datum: 12.11.2009 11 2009 Gliederung Informationsgrundlage
How Many Species are There on Earth? Lehrveranstaltung: Biodiversität ität und Nachhaltigkeit it Dozent: Dr. H. Schulz Referentin: Sonja Pfister Datum: 12.11.2009 11 2009 Gliederung Informationsgrundlage
Insecta. Arthropoda, wichtige Klassen Arachnida Myriapoda Insecta
 Insecta Arthropoda, wichtige Klassen Arachnida Myriapoda Insecta Insecta Wichtige Ordnungen U.Kl. Entognatha Collembola U.Kl. Ektognatha Saltatoria Hemimetabole Insekten Dermaptera Thysanoptera Heteroptera
Insecta Arthropoda, wichtige Klassen Arachnida Myriapoda Insecta Insecta Wichtige Ordnungen U.Kl. Entognatha Collembola U.Kl. Ektognatha Saltatoria Hemimetabole Insekten Dermaptera Thysanoptera Heteroptera
Zur Evolution der Libellen fossile Funde aus Nordrhein-Westfalen
 Zur Evolution der Libellen fossile Funde aus Nordrhein-Westfalen Die Libellen und ihre nächsten Verwandten (Odonatoptera) zählen zu den stammesgeschichtlich ältesten Insekten und, gemeinsam mit den Eintagsfliegen
Zur Evolution der Libellen fossile Funde aus Nordrhein-Westfalen Die Libellen und ihre nächsten Verwandten (Odonatoptera) zählen zu den stammesgeschichtlich ältesten Insekten und, gemeinsam mit den Eintagsfliegen
Neue Erkentnisse über die Gehäusegestalt von Hyphantoceras reussianum
 Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen Band 29, S. 45 52, 2003 Neue Erkentnisse über die Gehäusegestalt von Hyphantoceras reussianum (D Orbigny, 1850) aus dem Bereich des Hyphantoceras-Event (Ober-Turonium)
Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen Band 29, S. 45 52, 2003 Neue Erkentnisse über die Gehäusegestalt von Hyphantoceras reussianum (D Orbigny, 1850) aus dem Bereich des Hyphantoceras-Event (Ober-Turonium)
Zeitreise in die Erdgeschichte
 Zeitreise in die Erdgeschichte 1. Einschätzen des Alters der Erde und der Organismen: a) Wann ist die Erde entstanden? vor 5,7 Millionen Jahren vor 4,5 Milliarden Jahren vor 750 Millionen Jahren vor 250.000
Zeitreise in die Erdgeschichte 1. Einschätzen des Alters der Erde und der Organismen: a) Wann ist die Erde entstanden? vor 5,7 Millionen Jahren vor 4,5 Milliarden Jahren vor 750 Millionen Jahren vor 250.000
 Elefanten Elefanten erkennt man sofort an ihren langen Rüsseln, mit denen sie Gegenstände greifen und festhalten können, den gebogenen Stoßzähnen und den riesigen Ohren. Da Elefanten nicht schwitzen können,
Elefanten Elefanten erkennt man sofort an ihren langen Rüsseln, mit denen sie Gegenstände greifen und festhalten können, den gebogenen Stoßzähnen und den riesigen Ohren. Da Elefanten nicht schwitzen können,
Stammbaum der Photorezeptoren
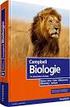 Das Farbensehen der Vögel, Arbeitsmaterial 2 - Evolution des Farbensehens Stammbaum der Photorezeptoren AB 2-1 Arbeitsaufträge: 1. Vervollständigen Sie den Stammbaum der Photorezeptoren, indem Sie folgende
Das Farbensehen der Vögel, Arbeitsmaterial 2 - Evolution des Farbensehens Stammbaum der Photorezeptoren AB 2-1 Arbeitsaufträge: 1. Vervollständigen Sie den Stammbaum der Photorezeptoren, indem Sie folgende
Neue Namen für südamerikanische Zwergbuntbarsche
 Neue Namen für südamerikanische Zwergbuntbarsche Wolfgang Staeck Ende Januar ist der seit Jahren angekündigte und daher lange überfällige zweite Band vom Cichliden Atlas aus dem Mergus Verlag ausgeliefert
Neue Namen für südamerikanische Zwergbuntbarsche Wolfgang Staeck Ende Januar ist der seit Jahren angekündigte und daher lange überfällige zweite Band vom Cichliden Atlas aus dem Mergus Verlag ausgeliefert
Literaturrecherche & richtiges Zitieren
 Literaturrecherche & richtiges Zitieren Dipl.-Biol. Henning Langguth Dipl.-Biol. Simon Kleinhans Quelle: www.spektrum.de/fm/862/thumbnails/titelseite.jpg.1219182.jpg Quelle: www.necnet.de/planckwelt/bild%20der%20wissenschaft%20einstein.jpg
Literaturrecherche & richtiges Zitieren Dipl.-Biol. Henning Langguth Dipl.-Biol. Simon Kleinhans Quelle: www.spektrum.de/fm/862/thumbnails/titelseite.jpg.1219182.jpg Quelle: www.necnet.de/planckwelt/bild%20der%20wissenschaft%20einstein.jpg
Eine neue Gottesanbeterin der Gattung Psezcduyersinia von den Kanarischen Inseln (Mantodea, Mantidae)
 26 1 Eine neue Gottesanbeterin der Gattung Psezcduyersinia von den Kanarischen Inseln (Mantodea, Mantidae) von Martin WIEMERS Zusammenfassung: Von Fuerteventura wird eine neue Gottesanbeterinnen- Art der
26 1 Eine neue Gottesanbeterin der Gattung Psezcduyersinia von den Kanarischen Inseln (Mantodea, Mantidae) von Martin WIEMERS Zusammenfassung: Von Fuerteventura wird eine neue Gottesanbeterinnen- Art der
ARBEITSKREIS PALÄONTOLOGIE HANNOVER
 HEFT 1 01 36 44. JAHRGANG 2016 ARBEITSKREIS PALÄONTOLOGIE HANNOVER NEUMANN, CHR. In ARBEITSKREIS PALÄONTOLOGIE HANNOVER 44 (2016), 23 32 23 Über Ameisen im Baltischen Bernstein Christian NEUMANN Während
HEFT 1 01 36 44. JAHRGANG 2016 ARBEITSKREIS PALÄONTOLOGIE HANNOVER NEUMANN, CHR. In ARBEITSKREIS PALÄONTOLOGIE HANNOVER 44 (2016), 23 32 23 Über Ameisen im Baltischen Bernstein Christian NEUMANN Während
Scydameniden (Coleoptera) aus dem baltischen Bernstein
 Scydameniden (Coleoptera) aus dem baltischen Bernstein von H. Franz In Bernstein eingeschlossene fossile Scydmaeniden wurden bisher meines Wissens nur von Schaufuss (Nunquam otiosus III/7, 1870, 561 586)
Scydameniden (Coleoptera) aus dem baltischen Bernstein von H. Franz In Bernstein eingeschlossene fossile Scydmaeniden wurden bisher meines Wissens nur von Schaufuss (Nunquam otiosus III/7, 1870, 561 586)
und im Bau der Extremitäten hervortritt. Die mittleren Backzähne ihm entgegenarbeitende erste untere Molar als Reißzähne" mit
 SP a" CD f Q Ol o 2 p et- 199 Sinopa rapax Leidy. Mit 4 Abbildungen. Die Raubtiere der Gegenwart bilden, wenn man von den Omnivoren Bären absieht, trotz aller Mannigfaltigkeit eine einheitliche Gruppe,
SP a" CD f Q Ol o 2 p et- 199 Sinopa rapax Leidy. Mit 4 Abbildungen. Die Raubtiere der Gegenwart bilden, wenn man von den Omnivoren Bären absieht, trotz aller Mannigfaltigkeit eine einheitliche Gruppe,
Literatur zu den Vorlesungen Allgemeine Psychologie I
 Literatur zu den Vorlesungen Allgemeine Psychologie I gültig ab WiSe 2015/2016 Primäres Lehrbuch B.G.1 Lernen, Gedächtnis und Wissen (Hilbig) Lieberman, D.A. (2012). Human learning and memory. Cambridge:
Literatur zu den Vorlesungen Allgemeine Psychologie I gültig ab WiSe 2015/2016 Primäres Lehrbuch B.G.1 Lernen, Gedächtnis und Wissen (Hilbig) Lieberman, D.A. (2012). Human learning and memory. Cambridge:
HUG THE Bug. For love of True Bugs Festschrift zum 70. Geburtstag von Ernst Heiss. Wissenschaftliche Redaktion: W. RABITSCH
 HUG THE Bug For love of True Bugs Festschrift zum 70. Geburtstag von Ernst Heiss Wissenschaftliche Redaktion: W. RABITSCH Impressum Kataloge der Oberösterreichischen Landesmuseen N. S. 50 Katalog / Publication:
HUG THE Bug For love of True Bugs Festschrift zum 70. Geburtstag von Ernst Heiss Wissenschaftliche Redaktion: W. RABITSCH Impressum Kataloge der Oberösterreichischen Landesmuseen N. S. 50 Katalog / Publication:
Das Zeitalter des Trias
 Das Zeitalter des Trias Der Trias umfaßt den frühen Teil des Erdmittelalters, d.h. den Zeitraum zwischen 251 und 200 Ma Ausgangssituation: Am Ende des Perms haben sich alle Kontinente zu einem gemeinsamen
Das Zeitalter des Trias Der Trias umfaßt den frühen Teil des Erdmittelalters, d.h. den Zeitraum zwischen 251 und 200 Ma Ausgangssituation: Am Ende des Perms haben sich alle Kontinente zu einem gemeinsamen
K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 2015
 K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 015 Donnerstag, den. Juli 015, 14:00 15:00 Uhr Name: (deutlich in Blockschrift schreiben) Matrikelnummer: (wichtig: unbedingt angeben!) Kreuzen
K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 015 Donnerstag, den. Juli 015, 14:00 15:00 Uhr Name: (deutlich in Blockschrift schreiben) Matrikelnummer: (wichtig: unbedingt angeben!) Kreuzen
Kristallhöhle Kobelwald
 Kristallhöhle Kobelwald Entdeckt im Jahre 1682. 1702 von Johann Jakob Scheuchzer erstmals in der Literatur erwähnt. Gesamtlänge der Höhle beträgt 665 m, davon sind 128 Meter ausgebaut und touristisch zugänglich
Kristallhöhle Kobelwald Entdeckt im Jahre 1682. 1702 von Johann Jakob Scheuchzer erstmals in der Literatur erwähnt. Gesamtlänge der Höhle beträgt 665 m, davon sind 128 Meter ausgebaut und touristisch zugänglich
Als die heiße Erde eine feste Erdkruste bildete, wurde sie von heftigen Vulkanausbrüchen erschüttert.
 Sternzeit (Entstehung der Erde) und Urzeit (vor 4,5 bis 3,8 Milliarden Jahren) Wissenschaftler vermuten, dass die Erde vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren entstand. Man geht davon aus, dass es in der ersten
Sternzeit (Entstehung der Erde) und Urzeit (vor 4,5 bis 3,8 Milliarden Jahren) Wissenschaftler vermuten, dass die Erde vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren entstand. Man geht davon aus, dass es in der ersten
Wie teilt man Lebewesen ein? 1. Versuch Aristoteles ( v.chr.)
 Taxonomie Kladistik Phylogenese Apomorphien& Co. Fachwissenschaft & Methodik bei der Ordnung und Einteilung von Lebewesen Bildquellen: http://www.ulrich-kelber.de/berlin/berlinerthemen/umwelt/biodiversitaet/index.html;
Taxonomie Kladistik Phylogenese Apomorphien& Co. Fachwissenschaft & Methodik bei der Ordnung und Einteilung von Lebewesen Bildquellen: http://www.ulrich-kelber.de/berlin/berlinerthemen/umwelt/biodiversitaet/index.html;
Ein Ort voller Legenden. Was lebt noch in den Höhlen? Geschützter Wald. Einzigartige Vogelwelt. Wiederentdeckung der Höhlen
 Die im Fiordland Nationalpark sind Teil einer In der Mitte des 20. Jahrhunderts waren die ein Die Glühwürmchen-Höhlen befinden sich am Westufer des Lake Te Anau. Sie sind Teil eines 6,7 km langen Kalksteinlabyrinths,
Die im Fiordland Nationalpark sind Teil einer In der Mitte des 20. Jahrhunderts waren die ein Die Glühwürmchen-Höhlen befinden sich am Westufer des Lake Te Anau. Sie sind Teil eines 6,7 km langen Kalksteinlabyrinths,
Übersicht über die Stationen
 Übersicht über die Stationen Station 1: Station 2: Station 3: Station 4: Station 5: Station 6: Station 7: Station 8: Die Erdkröte Der Grasfrosch Die Geburtshelferkröte Der Feuersalamander Tropische Frösche
Übersicht über die Stationen Station 1: Station 2: Station 3: Station 4: Station 5: Station 6: Station 7: Station 8: Die Erdkröte Der Grasfrosch Die Geburtshelferkröte Der Feuersalamander Tropische Frösche
Was fliegt denn da? Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Die SuS sammeln Bilder von Insekten, ordnen diese und erzählen und benennen, was sie bereits wissen. Sie suchen gezielt nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Ziel
Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Die SuS sammeln Bilder von Insekten, ordnen diese und erzählen und benennen, was sie bereits wissen. Sie suchen gezielt nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Ziel
9. Thüringer Landesolympiade Biologie Klassenstufe 9
 9. Thüringer Landesolympiade Biologie 2011 Klassenstufe 9 Wer kann teilnehmen? Teilnehmen können alle an der Biologie interessierten Schülerinnen und Schüler der Klassen 8, 9 und 10 der Thüringer Gymnasien.
9. Thüringer Landesolympiade Biologie 2011 Klassenstufe 9 Wer kann teilnehmen? Teilnehmen können alle an der Biologie interessierten Schülerinnen und Schüler der Klassen 8, 9 und 10 der Thüringer Gymnasien.
Besondere Erhaltungsformen
 Besondere Erhaltungsformen Institut für Geowissenschaften, Tübingen http://www.lwl.org/pressemitteilungen/daten/bilder/22011.jpg Mammutfunde im Dauerfrostboden Das Beresowka-Mammut (1901) http://hanskrause.de/images/hkhpe12/image015.jpg
Besondere Erhaltungsformen Institut für Geowissenschaften, Tübingen http://www.lwl.org/pressemitteilungen/daten/bilder/22011.jpg Mammutfunde im Dauerfrostboden Das Beresowka-Mammut (1901) http://hanskrause.de/images/hkhpe12/image015.jpg
Kontinentaldrift Abb. 1
 Kontinentaldrift Ausgehend von der Beobachtung, dass die Formen der Kontinentalränder Afrikas und Südamerikas fast perfekt zusammenpassen, entwickelte Alfred Wegener zu Beginn des 20. Jahrhunderts die
Kontinentaldrift Ausgehend von der Beobachtung, dass die Formen der Kontinentalränder Afrikas und Südamerikas fast perfekt zusammenpassen, entwickelte Alfred Wegener zu Beginn des 20. Jahrhunderts die
Fachbereich Geowissenschaften. Layoutbeispiel einer Bachelorarbeit
 Fachbereich Geowissenschaften Institut für Meteorologie Layoutbeispiel einer Bachelorarbeit Bachelorarbeit von Max Mustermann Gutachter: Prof. Dr. Ulrich Cubasch Prof. Dr. Uwe Ulbrich 14. Januar 2011 Zusammenfassung
Fachbereich Geowissenschaften Institut für Meteorologie Layoutbeispiel einer Bachelorarbeit Bachelorarbeit von Max Mustermann Gutachter: Prof. Dr. Ulrich Cubasch Prof. Dr. Uwe Ulbrich 14. Januar 2011 Zusammenfassung
Wanzen (Heteroptera) aus dem Kalktal im Nationalpark Gesäuse
 Abhandlungen Zool.-Bot. Ges. Österreich 38, 2012, 115 121 Wanzen (Heteroptera) aus dem Kalktal im Nationalpark Gesäuse Thomas Friess & Johann Brandner Am Tag der Artenvielfalt 2010 im Nationalpark Gesäuse
Abhandlungen Zool.-Bot. Ges. Österreich 38, 2012, 115 121 Wanzen (Heteroptera) aus dem Kalktal im Nationalpark Gesäuse Thomas Friess & Johann Brandner Am Tag der Artenvielfalt 2010 im Nationalpark Gesäuse
Paläontologie. Ernst Probst. Löwenfunde in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit Zeichnungen von Shuhei Tamura. Fachbuch
 Paläontologie Ernst Probst Löwenfunde in Deutschland, Österreich und der Schweiz Mit Zeichnungen von Shuhei Tamura Fachbuch Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek
Paläontologie Ernst Probst Löwenfunde in Deutschland, Österreich und der Schweiz Mit Zeichnungen von Shuhei Tamura Fachbuch Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek
Schulmaterial Haie und Rochen
 Schulmaterial Haie und Rochen Informationen für Lehrer und Schüler Haie und Rochen Jeder hat in Film und Fernsehen schon einmal einen Hai oder einen Rochen gesehen. Meist bekommt man hier die Bekanntesten
Schulmaterial Haie und Rochen Informationen für Lehrer und Schüler Haie und Rochen Jeder hat in Film und Fernsehen schon einmal einen Hai oder einen Rochen gesehen. Meist bekommt man hier die Bekanntesten
EVOLUTION DES PFERDES. Thomas Stocker
 EVOLUTION DES PFERDES Thomas Stocker Allgemeines Klasse: Mammalia (Säugetiere) Ordnung: Perissodactyla (Unpaarhufer) Familie : Equidae (Pferde) Allgemeines eine der kleinsten Familien der Säugetiere 3
EVOLUTION DES PFERDES Thomas Stocker Allgemeines Klasse: Mammalia (Säugetiere) Ordnung: Perissodactyla (Unpaarhufer) Familie : Equidae (Pferde) Allgemeines eine der kleinsten Familien der Säugetiere 3
10.07 Tanyderidae Primitive Crane Flies
 Contents 01 Introduction Einführung...9 02 Odonata Damselflies and Dragonflies Libellen...19 03 Ephemeroptera Mayflies Eintagsfliegen...30 04 Plecoptera Stoneflies Steinfliegen...39 05 Heteroptera True
Contents 01 Introduction Einführung...9 02 Odonata Damselflies and Dragonflies Libellen...19 03 Ephemeroptera Mayflies Eintagsfliegen...30 04 Plecoptera Stoneflies Steinfliegen...39 05 Heteroptera True
Mobile Museumskiste Artenvielfalt Lebensraum Gewässer. Arbeitsblätter. mit Lösungen
 Mobile Museumskiste Artenvielfalt Lebensraum Gewässer Arbeitsblätter mit Lösungen WAHR und UNWAHR 1. Gelbrandkäfer holen mit dem Hintern Luft! 2. Muscheln suchen sich eine neue, größere Schale, wenn sie
Mobile Museumskiste Artenvielfalt Lebensraum Gewässer Arbeitsblätter mit Lösungen WAHR und UNWAHR 1. Gelbrandkäfer holen mit dem Hintern Luft! 2. Muscheln suchen sich eine neue, größere Schale, wenn sie
Manfred Keller (1937-2012)
 Manfred Keller (1937-2012) Manfred Keller wurde am 23. März 1937 in Chemnitz (Sachsen) geboren. Infolge von Kriegswirren erfolgte 1945 ein Umzug nach Unterfranken. 1952 verzog er nach Frankfurt am Main,
Manfred Keller (1937-2012) Manfred Keller wurde am 23. März 1937 in Chemnitz (Sachsen) geboren. Infolge von Kriegswirren erfolgte 1945 ein Umzug nach Unterfranken. 1952 verzog er nach Frankfurt am Main,
Systematik und Evolution - der Pflanzen J.R. Hoppe, Institut für Systematische Botanik und Ökologie, WS 2009/2010
 Systematik und Evolution - der Pflanzen J.R. Hoppe, Institut für Systematische Botanik und Ökologie, WS 2009/2010 Modul: Systematik und Evolution 1. Semester Systematik und Evolution 2. Semester Pflanzenbestimmungsübungen
Systematik und Evolution - der Pflanzen J.R. Hoppe, Institut für Systematische Botanik und Ökologie, WS 2009/2010 Modul: Systematik und Evolution 1. Semester Systematik und Evolution 2. Semester Pflanzenbestimmungsübungen
Hintergrund zur Ökologie von C. elegans
 GRUPPE: NAME: DATUM: Matrikelnr. Genereller Hinweis: Bitte den Text sorgsam lesen, da er Hinweise zur Lösung der Aufgaben enthält! Hintergrund zur Ökologie von C. elegans Der Fadenwurm Caenorhabditis elegans
GRUPPE: NAME: DATUM: Matrikelnr. Genereller Hinweis: Bitte den Text sorgsam lesen, da er Hinweise zur Lösung der Aufgaben enthält! Hintergrund zur Ökologie von C. elegans Der Fadenwurm Caenorhabditis elegans
Phrynovelia philippinensis sp.n. (Heteroptera: Mesoveliidae) von der Insel Polillo, Philippinen
 Linzer biol. Beitr. 36/2 1353-1358 30.11.2004 Phrynovelia philippinensis sp.n. (Heteroptera: Mesoveliidae) von der Insel Polillo, Philippinen H. ZETTEL Abstract: Phrynovelia philippinensis sp.n. from Polillo
Linzer biol. Beitr. 36/2 1353-1358 30.11.2004 Phrynovelia philippinensis sp.n. (Heteroptera: Mesoveliidae) von der Insel Polillo, Philippinen H. ZETTEL Abstract: Phrynovelia philippinensis sp.n. from Polillo
Die Klimazonen der Erde
 Die Klimazonen der Erde Während wir in Deutschland sehnsüchtig den Frühling erwarten (oder den nächsten Schnee), schwitzen die Australier in der Sonne. Wieder andere Menschen, die in der Nähe des Äquators
Die Klimazonen der Erde Während wir in Deutschland sehnsüchtig den Frühling erwarten (oder den nächsten Schnee), schwitzen die Australier in der Sonne. Wieder andere Menschen, die in der Nähe des Äquators
STEPHEN EMMOTT ZEHN MILLIARDEN. Aus dem Englischen von Anke Caroline Burger. Suhrkamp
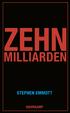 Für die Herstellung eines Burgers braucht man 3000 Liter Wasser. Wir produzieren in zwölf Monaten mehr Ruß als im gesamten Mittelalter und fliegen allein in diesem Jahr sechs Billionen Kilometer. Unsere
Für die Herstellung eines Burgers braucht man 3000 Liter Wasser. Wir produzieren in zwölf Monaten mehr Ruß als im gesamten Mittelalter und fliegen allein in diesem Jahr sechs Billionen Kilometer. Unsere
Populationsbiologie gefährdeter Arten
 Populationsbiologie gefährdeter Arten Determinants of plant extinction and rarity 145 years after european settlement of Auckland, New Zealand Duncan & Young 2000 Referent: Karsten Meyer Gliederung - Einführung
Populationsbiologie gefährdeter Arten Determinants of plant extinction and rarity 145 years after european settlement of Auckland, New Zealand Duncan & Young 2000 Referent: Karsten Meyer Gliederung - Einführung
Ergebnisse neuer Forschungsbohrungen in Baden-Württemberg
 Ergebnisse neuer Forschungsbohrungen in Baden-Württemberg Bearbeiter: Dr. Matthias Franz, Dr. Helmut Bock, Andreas Etzold, Dr. Eckard Rogowski, Dr. Theo Simon & Dr. Eckhard Villinger LGRB-Informationen
Ergebnisse neuer Forschungsbohrungen in Baden-Württemberg Bearbeiter: Dr. Matthias Franz, Dr. Helmut Bock, Andreas Etzold, Dr. Eckard Rogowski, Dr. Theo Simon & Dr. Eckhard Villinger LGRB-Informationen
Torsten van der Heyden Mitglied des Redaktionskomitees von BV news Publicaciones Científicas, tmvdh@web.de
 Erste Fotos von Anisoscelis podalicus (Brailovsky & Mayorga, 1995) im Internet (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae: Anisoscelidini) Primeras fotografías de Anisoscelis podalicus (Brailovsky & Mayorga, 1995)
Erste Fotos von Anisoscelis podalicus (Brailovsky & Mayorga, 1995) im Internet (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae: Anisoscelidini) Primeras fotografías de Anisoscelis podalicus (Brailovsky & Mayorga, 1995)
Neues zur Kärntner Arthropodenfauna
 Carinthia II 173./93. Jahrgang S. 137-141 Klagenfurt 1983 Neues zur Kärntner Arthropodenfauna Von Paul MILDNER Mit 4 Abbildungen Zusammenfassung: Die aus den USA stammende Gitterwanze Corythucha ciliaca
Carinthia II 173./93. Jahrgang S. 137-141 Klagenfurt 1983 Neues zur Kärntner Arthropodenfauna Von Paul MILDNER Mit 4 Abbildungen Zusammenfassung: Die aus den USA stammende Gitterwanze Corythucha ciliaca
Regulatory Social Policy
 Berner Studien zur Politikwissenschaft 18 Regulatory Social Policy The Politics of Job Security Regulations von Patrick Emmenegger 1. Auflage Regulatory Social Policy Emmenegger schnell und portofrei erhältlich
Berner Studien zur Politikwissenschaft 18 Regulatory Social Policy The Politics of Job Security Regulations von Patrick Emmenegger 1. Auflage Regulatory Social Policy Emmenegger schnell und portofrei erhältlich
Braunkohlengrube Gnade Gottes bei Bommersheim
 Braunkohlengrube bei Bommersheim Anbau mit Schacht auf dem Anwesen Ruppel 2014 Quelle: OpenStreetMap Karte von 2015 Karte von 1948 Braunkohlengrube bei Bommersheim 1816/17? Versuchsbohrungen und Abteufungen
Braunkohlengrube bei Bommersheim Anbau mit Schacht auf dem Anwesen Ruppel 2014 Quelle: OpenStreetMap Karte von 2015 Karte von 1948 Braunkohlengrube bei Bommersheim 1816/17? Versuchsbohrungen und Abteufungen
Paläobiologie terrestrischer Wirbeltiere
 Paläobiologie terrestrischer Wirbeltiere Prof. H. U. Institut für Geowissenschaften Tübingen Das menschliche Skelett enthält 206 Knochen Aus: Tortora und Derrickson (2008) Anatomie und Physiologie.
Paläobiologie terrestrischer Wirbeltiere Prof. H. U. Institut für Geowissenschaften Tübingen Das menschliche Skelett enthält 206 Knochen Aus: Tortora und Derrickson (2008) Anatomie und Physiologie.
Hinweise zur Zitation in naturwissenschaftlichen Arbeiten
 Hinweise zur Zitation in naturwissenschaftlichen Arbeiten Im Text werden alle aus der Literatur übernommenen Gedanken bzw. Aussagen mit einem Zitat der Quelle belegt. Wörtliche Zitate (in Anführungszeichen)
Hinweise zur Zitation in naturwissenschaftlichen Arbeiten Im Text werden alle aus der Literatur übernommenen Gedanken bzw. Aussagen mit einem Zitat der Quelle belegt. Wörtliche Zitate (in Anführungszeichen)
ab 10 Jahre Muster Original für 50 Cent im Museum Wale
 Schloss Am Löwentor Rosenstein ab 10 Jahre Wale Wale gehören sicher zu den interessantesten Tiere, die es gibt: Perfekt ans Wasser angepasste Säugetiere, deren Vorfahren an Land gelebt haben. Natürlich
Schloss Am Löwentor Rosenstein ab 10 Jahre Wale Wale gehören sicher zu den interessantesten Tiere, die es gibt: Perfekt ans Wasser angepasste Säugetiere, deren Vorfahren an Land gelebt haben. Natürlich
Some Theory on magnetic susceptibility logging
 Some Theory on magnetic susceptibility logging Based on the publication: Nowaczyk, N.R. (2001): Logging of magnetic susceptibility, in: Tracking Environmental Changes in Lake Sediments: Basin Analysis,
Some Theory on magnetic susceptibility logging Based on the publication: Nowaczyk, N.R. (2001): Logging of magnetic susceptibility, in: Tracking Environmental Changes in Lake Sediments: Basin Analysis,
1000 Jahre Ort Weidenbach! ( ) Millionen Jahre Leben in Weidenbach -
 1000 Jahre Ort Weidenbach! (1016-2016) - 400 Millionen Jahre Leben in Weidenbach - Fossilien in der Umgebung von Weidenbach von Werner Jung Auf den Ackerflächen östlich von Weidenbach sind in den letzten
1000 Jahre Ort Weidenbach! (1016-2016) - 400 Millionen Jahre Leben in Weidenbach - Fossilien in der Umgebung von Weidenbach von Werner Jung Auf den Ackerflächen östlich von Weidenbach sind in den letzten
Die Wanzen des Fürstenbergs in Konstanz am Bodensee (Baden-Württemberg)
 Ber. Naturf. Ges. Freiburg i. Br., 97/1, S. 103-116, Freiburg 2007 Die Wanzen des Fürstenbergs in Konstanz am Bodensee (Baden-Württemberg) R alf Heckmann Stichwörter Wanzen, Heteroptera, Microphysidae,
Ber. Naturf. Ges. Freiburg i. Br., 97/1, S. 103-116, Freiburg 2007 Die Wanzen des Fürstenbergs in Konstanz am Bodensee (Baden-Württemberg) R alf Heckmann Stichwörter Wanzen, Heteroptera, Microphysidae,
isbn
 Mónica M. Solórzano Kraemer, Xavier Delclòs, Enrique Peñalver, Ana Rodrigo:»Vongy: Ein Abenteuer unter Wissenschaftlern«isbn 978 3 00 053389 1 Vongy: Ein Abenteuer unter Wissenschaftlern Die Idee, unsere
Mónica M. Solórzano Kraemer, Xavier Delclòs, Enrique Peñalver, Ana Rodrigo:»Vongy: Ein Abenteuer unter Wissenschaftlern«isbn 978 3 00 053389 1 Vongy: Ein Abenteuer unter Wissenschaftlern Die Idee, unsere
Dr. Matthias Jenny Direktor des Palmengartens
 Gewandert, mitgereist, ausgebüchst, verwurzelt, benachbart, essbar, international, problematisch, erforscht über Neophyten gibt es viel zu berichten. Aber was sind Neophyten eigentlich genau? Es sind Pflanzenarten,
Gewandert, mitgereist, ausgebüchst, verwurzelt, benachbart, essbar, international, problematisch, erforscht über Neophyten gibt es viel zu berichten. Aber was sind Neophyten eigentlich genau? Es sind Pflanzenarten,
Die Fabel, ihre Entstehung und (Weiter-)Entwicklung im Wandel der Zeit - speziell bei Äsop, de La Fontaine und Lessing
 Germanistik Stephanie Reuter Die Fabel, ihre Entstehung und (Weiter-)Entwicklung im Wandel der Zeit - speziell bei Äsop, de La Fontaine und Lessing Zusätzlich ein kurzer Vergleich der Fabel 'Der Rabe und
Germanistik Stephanie Reuter Die Fabel, ihre Entstehung und (Weiter-)Entwicklung im Wandel der Zeit - speziell bei Äsop, de La Fontaine und Lessing Zusätzlich ein kurzer Vergleich der Fabel 'Der Rabe und
Ozeane bedecken ~70% des blauen Planeten
 IPCC WGII AR5, März 214 Verwundbare Systeme im Klimawandel: der globale Ozean Meere werden wärmer, sie versauern und verlieren Sauerstoff, der Meeresspiegel steigt HansO. Pörtner, koordinierender Leitautor,
IPCC WGII AR5, März 214 Verwundbare Systeme im Klimawandel: der globale Ozean Meere werden wärmer, sie versauern und verlieren Sauerstoff, der Meeresspiegel steigt HansO. Pörtner, koordinierender Leitautor,
Fossilien. Reproduktion des Berliner Exemplars des Archaeopteryx (Belgrad)
 Fossilien 3 Nur ein winziger Bruchteil aller Tiere bleibt erhalten Man nimmt an, dass seit Beginn des Erdaltertums vor 541 Millionen Jahren eine Milliarde Tier- und Planzenarten entstanden (und größtenteils
Fossilien 3 Nur ein winziger Bruchteil aller Tiere bleibt erhalten Man nimmt an, dass seit Beginn des Erdaltertums vor 541 Millionen Jahren eine Milliarde Tier- und Planzenarten entstanden (und größtenteils
suhrkamp taschenbuch 4560 Zehn Milliarden Bearbeitet von Anke Caroline Burger, Stephen Emmott
 suhrkamp taschenbuch 4560 Zehn Milliarden Bearbeitet von Anke Caroline Burger, Stephen Emmott 1. Auflage 2015. Taschenbuch. 204 S. Paperback ISBN 978 3 518 46560 8 Format (B x L): 10,9 x 17,8 cm Gewicht:
suhrkamp taschenbuch 4560 Zehn Milliarden Bearbeitet von Anke Caroline Burger, Stephen Emmott 1. Auflage 2015. Taschenbuch. 204 S. Paperback ISBN 978 3 518 46560 8 Format (B x L): 10,9 x 17,8 cm Gewicht:
Dixa cimbrica n. sp., ein Vertreter der Dixidae (Diptera, Nematocera) aus der oberpaleozänen/untereozänen Fur-Formation (Moler) Jütlands (Dänemark)
 N.Jb. Geol. Paläont. Mh. Stuttgart, Sept. 1992 Dixa cimbrica n. sp., ein Vertreter der Dixidae (Diptera, Nematocera) aus der oberpaleozänen/untereozänen Fur-Formation (Moler) Jütlands (Dänemark) Dixa cimbrica
N.Jb. Geol. Paläont. Mh. Stuttgart, Sept. 1992 Dixa cimbrica n. sp., ein Vertreter der Dixidae (Diptera, Nematocera) aus der oberpaleozänen/untereozänen Fur-Formation (Moler) Jütlands (Dänemark) Dixa cimbrica
Das Wichtigste auf einen Blick... 66
 Inhaltsverzeichnis Bio 5/6 3 Inhaltsverzeichnis 1 Biologie Was ist das?... 8 Kennzeichen des Lebens.... 9 1 Lebendes oder Nichtlebendes?... 10 Arbeitsgebiete und Arbeitsgeräte der Biologen... 11 Tiere
Inhaltsverzeichnis Bio 5/6 3 Inhaltsverzeichnis 1 Biologie Was ist das?... 8 Kennzeichen des Lebens.... 9 1 Lebendes oder Nichtlebendes?... 10 Arbeitsgebiete und Arbeitsgeräte der Biologen... 11 Tiere
Bestimmungsschlüssel der Flusskrebse in Sachsen
 Rostrum Abdomen Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft - Fischereibehörde Bestimmungsschlüssel der Flusskrebse in Sachsen Rückenfurchen Nackenfurche Fühlerschuppe Scherengelenk Augenleisten ja - rote
Rostrum Abdomen Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft - Fischereibehörde Bestimmungsschlüssel der Flusskrebse in Sachsen Rückenfurchen Nackenfurche Fühlerschuppe Scherengelenk Augenleisten ja - rote
Nachhaltigkeit im Nationalpark Alejandro. de Humboldt Kuba
 CITMA Nachhaltigkeit im Nationalpark Alejandro de Humboldt Kuba Überblick Naturschutzgebiete auf Kuba Der Nationalpark Alejandro de Humboldt Finanzierungskonzepte Zusammenfassung Sistema Nacional de de
CITMA Nachhaltigkeit im Nationalpark Alejandro de Humboldt Kuba Überblick Naturschutzgebiete auf Kuba Der Nationalpark Alejandro de Humboldt Finanzierungskonzepte Zusammenfassung Sistema Nacional de de
Aufgabenblatt Gruppe1: Brachiosaurus brancai (Giraffatitan brancai)
 Gruppe1: Brachiosaurus brancai (Giraffatitan brancai) Kleiner Kopf im Verhältnis zum Körper, lange Zähne, keine Mahlzähne, lange Vordergliedmaßen (Brachiosaurus bedeutet Armechse ), steil aufgerichteter
Gruppe1: Brachiosaurus brancai (Giraffatitan brancai) Kleiner Kopf im Verhältnis zum Körper, lange Zähne, keine Mahlzähne, lange Vordergliedmaßen (Brachiosaurus bedeutet Armechse ), steil aufgerichteter
Eine zweite Art der Gattung Phlogophora Treitschke, 1825: Phlogophora lamii spec. nov. (Lepldoptera, Noctuidae) von
 Atalanta (Dezember 1992) 23(3/4):589-591, Würzburg, ISSN 0171-0079 Eine zweite Art der Gattung Phlogophora Treitschke, 1825: Phlogophora lamii spec. nov. (Lepldoptera, Noctuidae) von Gerhard Schadewald
Atalanta (Dezember 1992) 23(3/4):589-591, Würzburg, ISSN 0171-0079 Eine zweite Art der Gattung Phlogophora Treitschke, 1825: Phlogophora lamii spec. nov. (Lepldoptera, Noctuidae) von Gerhard Schadewald
Amphibien. Froschlurche (Kröten, Unken und Frösche)
 Auriedbewohner Arbeitsblatt 1 Amphibien Zu den Amphibien oder Lurchen gehören Salamander, Molche, Kröten, Unken und Frösche. Im Mittelland kommen 14 verschiedene Amphibienarten vor. Folgende 8 Arten kannst
Auriedbewohner Arbeitsblatt 1 Amphibien Zu den Amphibien oder Lurchen gehören Salamander, Molche, Kröten, Unken und Frösche. Im Mittelland kommen 14 verschiedene Amphibienarten vor. Folgende 8 Arten kannst
Das Forschungsranking
 Centrum für Hochschulentwicklung Das Forschungsranking deutscher Universitäten Analysen und Daten im Detail Jura Dr. Sonja Berghoff Dipl.-Soz. Gero Federkeil Dipl.-Kff. Petra Giebisch Dipl.-Psych. Cort-Denis
Centrum für Hochschulentwicklung Das Forschungsranking deutscher Universitäten Analysen und Daten im Detail Jura Dr. Sonja Berghoff Dipl.-Soz. Gero Federkeil Dipl.-Kff. Petra Giebisch Dipl.-Psych. Cort-Denis
Das Rheintal zwischen Bingen und Bonn
 Das Rheintal zwischen Bingen und Bonn 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. von Prof. Dr. WILHELM MEYER
Das Rheintal zwischen Bingen und Bonn 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. von Prof. Dr. WILHELM MEYER
Workshop des AK Ökosystemforschung "Bedeutung von Langzeitbeobachtungen im
 Workshop des AK Ökosystemforschung 24. - 26.03.2004 "Bedeutung von Langzeitbeobachtungen im Langzeituntersuchungen zur Arthropodenfauna von Küsteninseln - Methoden, Ergebnisse, Probleme - Oliver-D. Finch
Workshop des AK Ökosystemforschung 24. - 26.03.2004 "Bedeutung von Langzeitbeobachtungen im Langzeituntersuchungen zur Arthropodenfauna von Küsteninseln - Methoden, Ergebnisse, Probleme - Oliver-D. Finch
HIR Method & Tools for Fit Gap analysis
 HIR Method & Tools for Fit Gap analysis Based on a Powermax APML example 1 Base for all: The Processes HIR-Method for Template Checks, Fit Gap-Analysis, Change-, Quality- & Risk- Management etc. Main processes
HIR Method & Tools for Fit Gap analysis Based on a Powermax APML example 1 Base for all: The Processes HIR-Method for Template Checks, Fit Gap-Analysis, Change-, Quality- & Risk- Management etc. Main processes
Stress bei Frauen ist anders bei Führungsfrauen erst recht
 2 Stress bei Frauen ist anders bei Führungsfrauen erst recht Sie werden sicherlich sagen, Stress ist Stress und bei Männern und Frauen gibt es kaum Unterschiede. Tatsache ist, dass es kaum Untersuchungen
2 Stress bei Frauen ist anders bei Führungsfrauen erst recht Sie werden sicherlich sagen, Stress ist Stress und bei Männern und Frauen gibt es kaum Unterschiede. Tatsache ist, dass es kaum Untersuchungen
Neotropische Biodiversität. Die Bedeutung kryptischer Arten
 Neotropische Biodiversität Die Bedeutung kryptischer Arten Gliederung Definition kryptischer Arten Artkonzepte DNA barcodes distinguish species of tropical Lepidoptera HAJIBABAEI, M. et al., PNAS 2005
Neotropische Biodiversität Die Bedeutung kryptischer Arten Gliederung Definition kryptischer Arten Artkonzepte DNA barcodes distinguish species of tropical Lepidoptera HAJIBABAEI, M. et al., PNAS 2005
Eine neue Unterart von Cyrtodactylus kotschyi von den griechischen Inseln Nisos Makri und Nisos Strongili (NW Rhodos)
 Ann. Naturhist. Mus. Wien 83 539-542 Wien, Dezember 1980 Eine neue Unterart von Cyrtodactylus kotschyi von den griechischen Inseln Nisos Makri und Nisos Strongili (NW Rhodos) Von FRANZ TIEDEMANN & MICHAEL
Ann. Naturhist. Mus. Wien 83 539-542 Wien, Dezember 1980 Eine neue Unterart von Cyrtodactylus kotschyi von den griechischen Inseln Nisos Makri und Nisos Strongili (NW Rhodos) Von FRANZ TIEDEMANN & MICHAEL
Business administration and the quest for a theoretical framework for the observation of economic, political and social evolution
 Business administration and the quest for a theoretical framework for the observation of economic, political and social evolution Abstract Vasilis Roussopoulos Dept. Of Accounting, T.E.I. of Larissa, GR
Business administration and the quest for a theoretical framework for the observation of economic, political and social evolution Abstract Vasilis Roussopoulos Dept. Of Accounting, T.E.I. of Larissa, GR
