BRAUNSCHWEIGISCHES JAHRBUCH FÜR LANDESGESCHICHTE IM AUFTRAGE DES BRAUNSCHWEIGISCHEN GESCHICHTSVEREINS HERAUSGEGEBEN VON HORST-RÜDIGER JARCK
|
|
|
- Adolph Wagner
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 GF-?- A2\f Sifo Digitale Bibliothek Braunschweig BRAUNSCHWEIGISCHES JAHRBUCH FÜR LANDESGESCHICHTE IM AUFTRAGE DES BRAUNSCHWEIGISCHEN GESCHICHTSVEREINS HERAUSGEGEBEN VON HORST-RÜDIGER JARCK Der ganzen Reihe Band SELBSTVERLAG DES BRAUNSCHWEIGISCHEN GESCHICHTSVEREINS
2 Das Braunschweigische Jahrbuch für Landesgeschichte erscheint in der Regel jährlich. Die Zusendung von Manuskripten erbitten wir an die Schriftleitung in: Wolfenbüttel, Forstweg 2, Telefon (05331) Anmeldungen zur Mitgliedschaft im Verein, die zum freien Bezug der Zeitschrift berechtigt, werden an die gleiche Anschrift erbeten. Über das Programm und die Aktivitäten informiert auch Der Mitgliedsbeitrag beträgt 21,00, für Jugendliche in der Ausbildung 10,00. Bankkonten: NORD/LB, Kontonr , BLZ Postbank Hannover, Kontonr , BLZ Schriftleitung: Ltd. Archivdirektor Dr. Horst-Rüdiger Jarck Bibliographie: Bibliothekarin M. A. Ewa Schmid Rezensionen und Anzeigen: Archivdirektor Dr. Ulrich Schwarz Vertrieb: Buchhandlung Graff Sack Braunschweig ISSN Druck und Verarbeitung: poppdruck, Langenhagen
3 Vorstandsmitglieder des Braunschweigischen Geschichtsvereins 1. Vorsitzender Dr. Horst-Rüdiger Jarck 2. Vorsitzender Dr. Walter Hagena Schatzmeister Dipl.-Kfm. Sascha Köckeritz Geschäftsführer Johannes Angel Ehrenmitglieder Dr. Richard Moderhack Dr. Günter Scheel Beirat Dr. Annette Boldt-Stülzebach Dr. Martin Eberle Dr. Gudrun Fiedler Dr. Manfred Garzmann Dr. Han~-Henning Grote Dr. Hans-Ulrich Ludewig Prof. Dr. Wolfgang Milde Prof. Hartmut Rötting M. A. Dr. Bettina Schmidt-Czaia Dr. Ulrich Schwarz Prof. Dr. Harrnen Thies Ehrenbeirat Dr. Dieler Lent Prof. Dr. Gerhard Schildt Dr. Gerd Spies Dipl.-Kfm. Klaus Webendoerfer Dr. Mechthild Wiswe
4
5 UNSEREM EHRENMITGLIED LTD. ARCHIVDIREKTOR A. D. DR. GÜNTER SCHEEL DEM LANGJÄHRIGEN VORSITZENDEN UND HERAUSGEBER DES JAHRBUCHS 1982 BIS 1991 ZUM 80. GEBURTSTAG AM GEWIDMET DER VORSTAND
6
7 INHALT Aufsätze Dörfer und Burgen. KarolingerzeitIiche Entstehung von Dörfern im Nordharzvorland von Wolfgang Meibeyer Verdener Güter im Braunschweigischen. Ein Beitrag zur Geschichte von tramsleben und t Hohnstedt von Arend Mindermann Herzogliche Scharfrichter und Abdecker des Landes Braunschweig in der Frühen Neuzeit von Gesine Schwarz "... und besahe, was noch denckwürdiges darinne wahr... ". Zum Aufenthalt Prinz Albrechts von Sachsen-Gotha in Wolfenbüttel und Braunschweig im Mai 1670 von Annette Faber Lauern auf den Vasallentod. Das Ende der Herren von Bartensleben auf Schloss Wolfsburg 1742 von Martin Fimp~ Die Scharffsche Tuchmanufaktur in Wolfenbüttel ( ) und ihr Konkurs ( RR) von Victor-L. Siemers Kirchen im Bombenkrieg. Folgen des Luftkriegs von auf dem Gebiet der Braunschweigischen Landeskirche von Birgit Hoffmann Kleinere Beiträge Wo ruhen Heinrich und Mathilde? Fragen nach den Grabstätten im Braunschweiger Dom. Plädoyer für eine DNA-Analyse von Arnold Rabbow Verzeichnis der Veröffentlichungen von Günter Scheel von Günter Scheel und Sibylle Weitkamp
8 Bibliographie Bibliographie zur Braunschweigischen Landesgeschichte mit Nachträgen von Ewa Schmid Rezensionen und Anzeigen Bei er, F.: Die Geschichte der Stadt Wolfenbüttel1933 bis Zeitzeugen - Fotos - Dokumente (D. Lent) Be r g B. u. P. Alb re c h t : Presse der Regionen Braunschweig/ Wolfenbüttel- Hildesheim - Goslar. Kommentierte Bibliographie... bis zum Jahre 1815 (D. Lent) Be r g M.: Jüdische Schulen in Niedersachsen. Tradition - Emanzipation - Assimilation. Die Jacobson-Schule in Seesen ( ). Die Samsonschule in Wolfenbüttel ( ) (S. Wagener-Fimpel) B i e gel G. u. H. -J. Der d a (Hg.): Blutige Weichenstellung. Massenschlacht und Machtkalkül bei Sievershausen 1553 (M. Fimpel) B re c h t M.: J.V. Andreae und Herzog August zu Braunschweig-Lüneburg. Ihr Briefwechsel und ihr Umfeld (M. Fimpel) Ca sem i r K.: Die Ortsnamen des Landkreises Wolfenbüttel und der Stadt Salzgitter (H. Blume) Da h m s Tb.: Die Hagen von Salzgitter-Gebhardshagen, Braunschweig, Gandersheim und des Klützer Ortes. Eine regionale Vergleichsstudie zur mittelalterlichen Wald- und Siedlungsgeschichte (W. Meibeyer) Doll e J. (Bearb.): Urkundenbuch der Stadt Braunschweig Bd. 7: (u. Schwarz) D 0 w i d a t V.: Polizei im Rückspiegel: Die Geschichte der Polizei direktion Braunschweig (H.-M. Arnoldt) E dei man n H.: Heinz Nordhoff und Volkswagen. Ein deutscher Unternehmer im amerikanischen Jahrhundert (G. Fiedler) Fes s n e r M., A. Fr i e d r ich, Ch. Bar tel s : "Gründliche Abbildung des uralten Bergwerks". Eine virtuelle Reise durch den historischen Harzbergbau (A. Bingener) F i e die r G. u. H.-U. Lud e w i g (Hg.): Zwangsarbeit und Kriegswirtschaft im Lande Braunschweig (H.Ch. Mempel)
9 G r a ben h 0 r s t C.: Voigtländer & Sohn. Die Firmengeschichte von 1756 bis 1914 (N.-M. Pingel) H u c k erb. U.: Otto IV. Der wiederentdeckte Kaiser (C.-P. Hasse) Kr a s c he w ski H.-J.: Betriebsablauf und Arbeitsverfassung des Goslarer Bergbaus am Rammelsberg vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (M. Fessner) Li p p e I t Ch. u. G. Sc h i I d t (Hg.): Braunschweig-Wolfenbüttel in der Frühen Neuzeit. Neue historische Forschungen (M. Fimpel) Mol t man n - Wen dei E.: Macht der Mütterlichkeit. Die Geschichte der Henriette Schrader-Breymann (S. Wagener-Fimpel) Sc h leg e I B. (Hg.): Industrie und Mensch in Südniedersachsen - vom 18. bis zum 20. Jahrhundert (G. Fiedler) Sc h war z U. (Hg.): Auf dem Weg zur herzoglichen Residenz. Wolfcnbüttcl im Mittelalter (B. Streich) So h n W.: Im Spiegel der Nachkriegsprozesse: Die Errichtung der NS-Herrschaft im Freistaat Braunschweig (M. Bemhardt) S t rat h man n G.: Das ehemalige Herzogtum Braunschweig unter dem Aspekt der Auswanderung - bei besonderer Berücksichtigung der westlichen Landkreise Holzminden und Gandersheim - von 1750 bis 1900 (E. Niewöhner) Chronik Chronik des Braunschweigischen Geschichtsvereins vom Oktober 2003 bis Oktober VERZEICHNIS DER AlITOREN: Dr. Annette Faber, Sondheiml Grabfeld Dr. Martin Fimpel, Wolfenbüttel Birgit Hoffmann M.A., Cremlingen Prof. Dr. Wolfgang Meibeyer, Braunschweig Dr. Arend Mindermann, Stade Dr. Amold Rabbow, Braunschweig Dr. Günter Scheel, Wolfenbüttel Dr. Victor-L. Siemers, Braunschweig Dr. Gesine Schwarz, Wolfenbüttel Sibylle Weitkamp, Hannover
10 Dörfer und Burgen Karolingerzeitliche Entstehung von Dörfern im Nordharzvorland von Wolfgang Meibeyer Ausgehend von siedlungsgeographischen Befunden soll in den folgenden Ausführungen der Versuch gemacht werden, die frühmittelalterliche Entstehung einiger kleiner Gruppen von Dörfern (und Wüstungen!) nachzuzeichnen, weiche jeweils im näheren Umfeld von Burgen gelegen, mit eben diesen genetisch mutmaßlich in Zusammenhang zu bringen sind. Über Anfänge und früheste Geschichte sowohl der Dörfer wie der betreffenden Burgen liegt eine schriftliche Überlieferung - wie in unserem Gebiet auch sonst - gar nicht vor, so dass sich die einschlägigen Forschungsüberlegungen nur auf mittelbare Informationsquellen und deren Verknüpfung stützen können. Dazu gehören in erster Linie die Orts- und Wüstungsnamen sowohl im einzelnen als auch hinsichtlich ihres räumlichen Gefüges ("Namenlandschaft"), sodann vielseitige siedlungsgeographische Ortsmerkmale von natürlichen und chorologischen Lagebedingungen bis hin zu Topographie und Formgestalt der Ortsanlagen und Wüstungen, gelegentlich vorhandene archäologische Befunde, schließlich Erkenntnisse zur allgemeinen (Kultur-),Landschaftsentwicklung in der Frühzeit und selbstverständlich die allgemeine regional-relevante Historiographie. Die Burgen, um deren Bereiche es gehen soll, liegen sämtlich im Nordharzvorland beiderseits der weit gespannten Niederung des Großen Bruches, weiches im Frühmittelalter als natürliche Grenzzone den nördlichen Derlingau vom südlichen Harzgau schied. Aktuelle archäologische Befunde aus neuester Zeit liegen vor für die "Hünenburg" bei Watenstedt (Kr. He\mstedt) am westlichen Heeseberg bei lerxheim aus den dort 1998 bis 2001 von I. Heske unter maßgeblicher Mitwirkung von W.-D. Steinmetz und Mitgliedern der "Freunde der Archäologie im Braunschweiger Land (FABL e. V.)" getätigten erfolgreichen Grabungen. Ebenfalls früher dem alten Braunschweiger Land zugehörig gewesen ist die nur nach Namen und ungefährer Lage bekannte, obertägig aber verschwundene "Hühnenburg" westlich von Hessen (Kr. Halberstadt). Als dritter Burgort kommt das Städtchen Derenburg (Kr. Wernigerode), westlich von Halberstadt an der Holtemme gelegen, in Betracht, und als weiterer Burgplatz das erst 1942 aus dem Halberstädtischen an Braunschweig gekommene Hornburg (Kr. Wolfenbüttc\) am nordwestlichen Rand des Kleinen Fallstein über dem I1seflüßchen direkt am Großen Bruch. (Vgl. Kartenabbildung)
11 14 Wolfgang Meibeyer Sunte...? BarnstOff T alston ~ Mehrdorfer Hof T.? Hohen- Nefnstedt ~ Heese-Berg HÜNENBURG Watensted! ~ '\n/j?7 h. ~P""Jerx etm Wentorl Bruch-=-_-_- -_-G~,,~.,.,,_=-=-= ~~~-~-~~-~-~~~~-=~~ ~ e Suderode Dardeshelm o Vienenburg Burgen und von diesen aus gegründete Orte o Langein Burgen 11 Urpfarrei/Archidiakonatssitz Wichhusen... A Orte und Wüstungen (kursiv) A ~==='-= Altstraßen (Auswahl) 0 Orientierungsorte 10 km t Entwurf und Zeichnung W. Meibeyer, 2004 Bbhnshusen.A. Die Hünenburg bei Watenstedt Die Dörfer auf der nördlichen Seite des Großen Bruches zwischen der Oker und dem Heeseberg bei 1erxheim gelten auf Grund ihrer Ortsnamen zu Recht als sehr alt. Während die mit den Grundworten -heim (u. a. 1erxheim, Börßum, Kalme) und -bere (z. B. Hedeper) gebildeten Namen die Entstehung dieser Dörfer als relativ jüngere im frühen 8. 1ahrhundert annehmen lassen, reichen die übrigen vor allem mit Namen auf -stedt wie Watenstedt und auf -leben wie Gevensleben in noch ältere Zeit zurück l. Vor der westlichen Spitze des Heesebergs, der den Schmalsattel der Asse nach Südosten mit Gesteinen des Buntsandstein und Muschelkalk geologisch und morphologisch fortsetzt und die offene Ackerlandschaft der fruchtbaren Lößbörde als markante steile Erhebung bis über 100m überragt, findet sich mit Barnstorf ein Zum aktuellen Stand der regionalen sprachwissenschaftlichen Namenkunde vgl. K. Casemir, Dazu Rezension von W. Meibeyer in Nds. Jb. für Landesgesch. 76, 2004, S Zu den siedlungsgeographischen Aspekten der Namenkunde vgl. W. Meibeyer, 2000 sowie 2005.
12 Dörfer und Burgen im Nordharzvorland 15 einzelner Vertreter für Ortsnamen auf -dorf (966 Bernsherdestorp, 1188 Bernesdorp, 1550 Barnstorff)2, der diesem eine deutlich jüngere Entstehungszeit als den umliegenden -leben-, -stedt- und -heim-dörfern zuweist. Diese ist den siedlungsgeographischen Forschungen über die Anfänge der Siedlungen in der Region des Nordharzvorlandes zu Folge etwa um 800, also zu Lebzeiten Karls d. Gr., anzunehmen 3 Aber Barnstorf ist gar nicht immer der einzige Vertreter von -dorf-orten am Heeseberg gewesen. Die Siedlungsforschung förderte noch drei weitere, erst im späten Mittelalter durch Wüstungsprozesse verloren gegangene ehemalige Dörfer mit derselben Ortsnamenbildung in unmittelbarer Nachbarschaft zu Tage; Bistorf (1224 Biscopistorp), Mehrdorfer Hof (1135 Merdorp) und ein schriftlich nicht bezeugtes Wentorf. Daneben finden sich noch die Wüstungen Hohen-Neinstedt (1135 Nienstede) sowie zwischen Watzum und Barnstorf Sunte ( Sudda, 1294 Sunten)4. Die hier in Erscheinung tretende Vierergruppe von -dorf-orten (der wahrscheinlich die Wüstungen Hohen-Neinstedt und wohl auch Sunte noch hinzuzurechnen sind) bildet inmitten einer wesentlich älteren Ortsnamenlandschaft mit ihren Feldmarken ein zusammenhängendes Gebiet in räumlich direktem Anschluss an die im 18 Jahrhundert noch resthaft bewaldete Erhebung des Heesebergs. Es stellt sich die Frage, unter welchen Umständen diese isolierte Zelle jüngerer Dörfer inmitten eines wesentlich älter besiedelten Raumes entstanden sein könnte, d. h. nach dem jüngsten Abschnitt im Ablauf des frühmittelalterlichen Siedlungsganges im südlichen Derlingau zwischen Elm und Großem Bruch. Eine Durchmusterung des Heeseberg-Gebietes unter siedlungsgeographischen Aspekten lässt auf das Dorf Watenstedt aufmerksam werden. Dessen dem Halberstädter Bistumsheiligen Stephanus geweihte Kirche offenbart als Urpfarrei und Archidiakonatssitz frühe geistliche Zentralität des Ortes. So ist die Barnstorfer Kirche ihr Filial. Aber als noch bedeutsamer will die Hünenburg erscheinen, eine etwa 500m östlich des Dorfes rund 40m höher auf dem Heeseberghang gelegene, mit starken Wällen wohlbefestigte großflächige Burganlage. Die jüngst durchgeführten archäologischen Grabungen haben sie als eine immer wieder erneut genutzte mehrphasige Anlage erwiesen, mit z. T. großartigen Besiedlungsbefunden aus dem späten Neolithikum, der mittleren und jüngeren Bronzezeit sowie der älteren Eisenzeit. Für unsere anstehende Frage sind freilich nur die jüngsten Nutzungsperioden der ausgehenden Völkerwanderungszeit (4.-6. Jh.) und aus dem frühen Mittelalter (6.-9.Jh.) von besonderem Interesse 5 ; Nach Siedlungsleere während der Römischen Kaiserzeit wurde das Gelände erneut befestigt mit einer wohl in altsächsische Zeit zu datierenden mächtigen Steinmauer. Diese wurde später zerstört, einplaniert und unmittelbar da- 2 Die Altnamen-Bclege wurden entnommen für braunschweigisches Gebiet H. Kleinau, Geschichtliches Ortsverzeichnis, 1967/68; für halberstädtisches Gebiet O. Doering, Bau- und Kunstdenkmäler Kr. Halherstadt, Vgl. W. Meiheyer, 2000, S. 281 ff. sowie Vgl. W. Erbens, 1964 sowie Bericht über die Grabung in Hohen-Ncinstcdt von H.-A. Schultz,1957, jedoch ohne nähere Angaben zur Entstehungszeit des Ortes. S Vgl. Beiträge insbesondere von I. Heske, W.-D. Steinmetz und K.-H. Willroth. in: Die Hünenburg bei Watenstedt. Ausgrabungsergebnisse , sowie I. Heske, Hünenburg, (Diss). Diesem danke ich für bereitwillige Überlassung von Teilen des Manuskripts seiner Dissertation.
13 16 Wolfgang Meibeyer nach von den neuen Machthabern durch ein noch stärkeres Schutzbollwerk ersetzt, nämlich einen mächtigen Erdwall mit einem Graben davor von 6m Breite und 3m Tiefe. Die archäologisch in das 8. Jahrhundert zu datierende "stark befestigte, strategisch ht:rausragend gelegene Burg" bringen die Ausgräber mit den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Franken und Sachsen und letztlich mit der Unterwerfung des Landes in Verbindung. Nach Einschätzung von w'-d. Steinmetz "manifestiert eine als Eroberer ins Land gekommene Fürstenschicht ihren Herrschaftsanspruch" (2001, S. 39) mit diesem aufwändigen Ausbau der Burg. Die von ihm darüber hinaus aufgeworfene Frage nach ihrer Identifikation mit der in den Quellen des 8. Jahrhunderts wiederholt genannten Hohseoburg sei hier offen gelassen. Auf ihre auffallend günstige verkehrliche Lage im damaligen Altstraßennetz hat kürzlich auch R. Siebert aufmerksam gemacht 6 Sie ist gelegen sowohl an einer bedeutenden West Ost-Verbindung (Ohrumer Deiweg) als auch an eint:r alten, das Große Bruch kreuzenden, als Pfahlbrücke I Steindamm ausgeführten Wegführung, die nach W. Freist eine Verbindung zur bisher nicht datierten Westerburg (bei Rohrsheim) hergestellt haben könnte 7 Zwar lassen sich zwischen der Gruppe der oben angeführten -dorf-orte und der schließlich fränkisch besessenen Burg oberhalb von Watenstedt keine genetischen Beziehungen direkt nachweisen. Schriftgut existiert keines! Andererseits kann die Koinzidenz von unmittelbarer räumlicher Nachbarschaft und zeitlicher Parallelität von Ausbau der Burg und Neugründung der Dörfer in ihrem direkten Umfeld kaum als nur eine zufällige angesehen werden. Es darf davon ausgegangen werden, dass Teile des Heesebergs selbst sowie seiner Nachbarschaft vor 800 noch von Wald bedeckt waren, der in fränkisches Konfiskationsgut übergegangen war. Dessen Rodung und Besiedlung mit Orten, welche nach einer der damaligen "Namenmoden" (hier mit dem Grundwort -dorf) benannt wurden, soll zunächst erst einmal hypothetisch ins Auge gefasst werden. Über die in den Ortsnamen enthaltenen Bestimmungsworte (z. B. bei Barnstorf der Personenname Bernhard, bei Bistorf das Appellativ Bischofll) kann hinsichtlich deren Informationsgehalts bezüglich der Orts-Gründungsbeteiligten spekuliert werden. Derenburg Namengebender genetischer Kern des Städtchens Derenburg ist eine über dem östlichen Ufer des Harzflusses Holtemme auf dem steil ansteigendenen Plateau aus Sandsteinen der Oberkreide gelegene ehemalige (Pfalz-)Burg unweit der Furtstelle, wo eine von der Oker über Hornburg her kommende Altstraße in Richtung Quedlinburg den Fluss überquerte. Die Befestigung wird allgemein für eine Anlage aus der Zeit der Ungarnkriege Heinrichs I gehalten, ohne dass diese Einschätzung bisher jedoch 6 Vgl. R. Siebert, 2001, S. 44 und Karte 1. 7 Vgl. W. Freist, 1960, S. 124 ff. 8 Vgl. K. Casemir, 2003, S. 81 (Barnstorf) sowie S. 98 (Bistorf).
14 Dörfer und Burgen im Nordharzvorland 17 von Schriftzeugnissen oder archäologischen Funden gestützt wird 9 Auch die Lage der Burg auf dem Ostufer, der potenziellen "Angreiferseite" an statt auf der taktisch günstigeren "Verteidigerseite" auf dem Westufer, will nicht so recht dazu passen. Auch hier zeigt sich eine kleine zusammenhängende Gruppe von vier sämtlich wieder wüstgefallenen Dörfern, deren Ortsnamenbildung auf -husen - von nur zwei entfernt davon und getrennt voneinander gelegenen Einzelfällen abgesehen - im Harzgau sonst überhaupt nicht vorkommt. Es sind dieses neben der Wüstung eines älteren -leben-dorfes Utzleben nahe bei Derenburg (1084 Uttislevo), dessen Kirche auch zu den halberstädtischen Urpfarreien zählte, die im späten Mittelalter abgegangenen Orte Böhnshusen (937 Bionshus, Anf. 13. Jh. Buneshusen, später als Domäne wieder aufgesiedelt), (Alt-) Goddenhusen (937 Godehuse), Sievershusen (995 Sigefrideshusen, 1197 Siverthusen) und Wichhusen (937 Wighusen) 10. Die Feldmarken dieser -husen-wüstungen haben zusammen mit jener von Utzleben zum Zustandt:kommen der großen Gemarkung von Derenburg geführt. Ob dieser Ort selbst ursprünglich eine eigene altangestammte Flur besessen hat, scheint wenig wahrscheinlich, wenn man davon absicht, dass der 1009 von Kaiser Heinrich 11 dem Kloster Gandersheim übereignete Königshof in Derenburg wohl mit Gewissheit über eine eigene Sallandflur verfügt hat. Ht:rvorzuheben ist die räumliche Geschlossenheit des Verbandes der fünf ehemaligen Dörfer mit der Burganlage, um deren Standort sie ringsum angeordnet angelegt erscheinen. Dieser räumlich direkte Bezug von der Burg und den -husen Orten rundherum deutet hier in ähnlicher Weise wie bei der Watenstedter Hünenburg auf eine gezielte Planung und Anlage dieser Dörfer von der Burg aus hin. Unfern von dieser lag der Altort Utzleben, weicher - analog zu Watenstedt - wohl auch wegen seiner Burgnähe nicht ohne Zufall zum frühzentralen Standort einer Stephani-Urpfarrei und späterem Archidiakonatssitz, eben nahe bei dem auch Schutz bietenden befestigten Sitz eines regionalen Befehlshabers o. ä., ausgewählt worden sein dürfte. Diese im Zusammenhang mit der Mission und dem Aufbau einer kirchlichen Organisation in Ostsachsen seit dem Paderborner Reichstag 777 zu sehenden Beobachtungen deuten schon von sich aus eine karolingerzeitliche Richtung in der regionalen Entwicklung der Verhältnisse an. Diesen Datierungsansatz weiter stützende Indizien zeichnen sich ab mit der unübersehbaren Übereinstimmung der Platzwahl und der örtlichen topographischen Verhältnisse von Burg und mutmaßlicher Lage des Königshofes in Derenburg mit der von H.-J. Nitz in Königsdahlum bei Bockenem herausgearbeiteten karolingischen Burg- und Königshof-Anlage ll sowie der vorottonischen Burg auf dem Kanstein bei Langelsheim am Harz 12. Darüber hinaus untermauert aber ganz besonders die namenkundliche Datierung von Ortsnamenbildungen mit -husen im Harzrandgebiet den zeitlich in den letzten Jahrzehnten des 8. bis ins frühe 9. Jahrhundert hinein anzusetzenden Ablauf dieser Siedlungsvorgänge. R. Wenskus bemerkte dazu, dass Ortsnamen mit dem Grundwort -husen "zur Zeit der Sachsen- 9 Vgl. B. Schwineköper, 1987, S. 75 f. 10 Angaben zu den Wüstungen sind insbesondere entnommen aus G. Reischel, Geschichtliche Karte Kr. Halberstadt, 1902 sowie O. Doering, 1902 (wie Anm. 2). 11 Vgl. H.-J. Nitz, 1989, S. 4R9 ff. 12 Vgl. W. Meibeyer, 2002, S. 115 ff.
15 18 Wol/gang Meibeyer kriege gerade "in Mode" waren" 13. An einem spätestens karolingerzeitiichen Alter der Anfänge der Derenburger Burg zumal am Holtemme-Übergang einer als bedeutsam einzuschätzenden AItstraße wird bei einer Gesamtschau aller Fakten kaum noch zu zweifeln sein. Archäologische Grabungen könnten diese Einschätzung vielleicht zukünftig verifizieren. Es liegt augenscheinlich dieselbe zeiträumliche Koinzidenz von fränkischer Burg und von dieser ausgehender Rodungs- und Siedlungsaktivitäten in ihrem Umfeld vor wie bei der Watenstedter Hünenburg. Siedlungsgeographische Analyse konnte im weiteren Nordharzvorland das Alter der Orte mit Namensbildungen auf -dorf und -husen als weitgehend gleichzeitig erweisen 14 Damit stellt sich noch die Frage nach möglichen Gründen für das Zustande kommen der unterschiedlichen Namensbildungen für die Neusiedlungen bei der Hünenburg im Derlingau (-dorf) und bei der Derenburg im Harzgau (-husen). Naheliegend ist hier an spezifische Namengewohnheiten adliger Grafen- und Grundherrengeschlechter zu denken. Wie die an der fränkischen Eroberung und Inbesitznahme Sachsens stark beteiligten, dem Königshaus auch verwandtschaftlich nicht femstehenden Liudolfinger wiederholt in ihrer Familie bevorzugt verwendete Personennamen als Leitnamen in die Bestimmungswörter von Namen neu gegründeter Orte ganz besonders in ihrem Gandersheimer Gebiet einbrachten, so scheint von ihnen mit einiger Vorliebe gleichzeitig auch das Grundwort -husen benutzt worden zu sein. Als Beispiele dafür seien der spätere Klosterort Brunshausen und die Wüstungen Ludolfshausen dort beigebracht. Liudolfingischer Eigenbesitz an Orten und Rechten gelangte etwa auf dem Wege von Stiftungen bevorzugt in die Hände des Gandersheimer Klosters bzw. des späteren ottonischen Reichsstiftes l5 Womöglich signalisieren die vorgefundenen -husen-ortsnamen bereits in die Zeit vor 800 zurückreichende, schon mit der fränkischen Durchdringung und Besitzsicherung Ostsachsens in Verbindung stehende liudolfingische Beziehungen in den Harzgau, wenn sie auch hier hinter diesen Namensbildungen vermutet werden dürfen. Freilich kommt liudolfingischer bzw. Gandersheimer Einfluss etwa in Quedlinburg erst in ottonischer Zeit direkt schriftlich bezeugt zu Tage. In Derenburg gelangte der Königshof zwar erst 1009 durch Kaiser Heinrich II (Königsgut vielleicht aus liudolfingischcm Vorbesitz?) an das Gandcrshcimer Stift. Dass dort aber bereits 998 die Äbtissin eine Gerichtsversammlung veranlassen konnte 16, lässt eigentlich den Schluss auf zuvor bereits bestehende örtliche Beziehungen des Stiftes in Form von Besitzungen oder Rechten aus älterem liudolfingischen Vorbesitz zu. Zeitlich zurückgedacht hieße das, Liudolfinger oder von diesen bestimmte Burgherren auf der karolingisch besetzten Derenburg an einer strategisch wichtigen Stelle am Holtemme-Übergang der Altstraße anzunehmen. Mit deren Initiativen wären dann die hier in Rede stehenden Ortsneugründungen im Umfeld zu erklären sowie 13 Vgl. R. Wenskus, 1976, S Vgl. W. Meibeyer " Vgl. C. Märt1, 2000, S. 141 ff. 16 Vgl. B. Schwincköper (wie Anm. 9).
16 Dörfer und Burgen im Nordharzvorland 19 dcren Benennung mit Namensformen auf -husen, welche eben familiengebräuchlich waren und derart in das Gebiet Eingang fanden. Bemerkenswerterweise stehen auch die schon früher angesprochenen übrigen beiden, als solche singulär gelegenen, -hausen-orte im Harzgau ebenfalls mit alten Burgen in Verbindung: Kloster Wend hausen in Thale wird als Neugründung auf einer karolingischen Burganlage angenommen 17 Der Ortsname von Westerhausen, das an derselben Altstraße zwischen Derenburg und der Quitilingaburg (Quedlinburg) liegt, ist mit seinem Bestimmungswort fraglos himmelsrichtungsmäßig auf diese letztere bezogen. - Vielleicht ein Hinweis auf die Besetzung aller dieser drei Burgen mit Liudolfingem oder ihren Gefolgsleuten. Die "Hühnenburg" bei Hessen Andcrs als im Derlingau, wo -heim-orte und -Wüstungen zu etwa einem Fünftel statistisch am stärksten vertreten sind, kommt diese ihrer Entstehung nach frühestens in die erste Hälfte des 8. Jahrhunderts anzusetzende Namengruppe 18 im Harzgau südlich des Großen Bruches gar nicht weittlächig verbreitet vor. Lediglich eine kleine Anzahl von acht Orten und Wüstungen, die mit ihren Feldmarken auffälligerweise wiederum eine ursprünglich geschlossen zusammenhängende Kleinregion um den früher zum Lande Braunschweig gehörigen Flecken Hessen bilden 19, findet sich im nordwestlichen Randbereich des Harzgaues. Hier berührt diese unmittelbar sowohl die den Gau abgrenzende Niederung des Großen Bruches als auch den bewaldeten Muschelkalk-Breitsattcl des Großen Fallstein. Eben diesen "Felestcin" erweist 997 ein Diplom Kaiser Ottos III ebenso wie die Höhenzüge dcr Umgebung (u.a. Elm und Asse, Huy und Hakel) als ehemaliges Königsgut 2o Die konzentrierte Geschlossenheit ihrer Verbreitung - zum al in derart pointierter Lagebeziehung -legt auch für die hier liegenden acht -heim-orte einen Entstehungsvorgang nahe, hinter dem ein von ordnender Hand planmäßig vorgenommencr einheitlicher Kolonisationsakt anzunehmen ist. Das unmittelbar nachbarliche Angrenzen an den (durch Konfiskation als fränkisches Krongut in Anspruch genommenen?) Königsforst des Fallstein lässt sogar eine Überlassung des neu aufgesiedclten Gcbietes aus dcssen Bezirk durch den König in Betracht ziehen. Im Falle Hessens lässt sich nun eine Beziehung zur Schriftüberlieferung der karolingischen Reichsgeschichte herstellen. Im Jahre 775 -also dem dritten Jahr nach dem Beginn der Sachsen kriege - unterwarf sich dem Frankenkönig Karl d. Gr. an der Oker der Anführer Hassio (oder Hessi) der OstIeute mit seinen Leutcn und schwor unter Stellung von Geiseln dem König treue Gefolgschaft. Später begegnet er als 17 Vgl. B. Schwineköper, 1987, S. 462 ff. 18 So W. Meibeycr, 2000, S. 287 ff. und erneut Dagegen abweichend aus sprachwissenschaftlichnamenkundlicher Sicht K. Cascmir, 2003, S Im Feldmarksbereich von Hessen später nachgcsiedelte Orte, die Wüstungen Linder sowie wohl Kalbke (0. ä.) und Wentorf, sind für die älteren Entstehungsumstände der -heim-siedlungen hier ohne Belang. 20 Vgl. Halberstädter Urkundenbuch 1, Nr. 58, S. 43 f.
17 20 Wolfgang Meibeyer Schenker reichen Gutes an das Bonifatius-Stift in Fulda. In dieses ist er in seinen späten Tagen als Mönch eingetreten und dort 804 verstorben 21 C. Märtl weist weiter darauf hin, dass in den Dienst des fränkischen Königtums aufgenommene sächsische Adlige in Ämter als Grafen der neu gebildeten Gaue eingesetzt wurden, in den Besitz konfiszierter Güter gelangten und auf diese Weise Teile der alten sächsischen Führungsschicht in den fränkischen Reichsadel Aufnahme fanden. Mit P. J. Meier darf wohl erneut an einen Zusammenhang des Ostfalenführers Hessi (oder eines gleichnamigen Angehörigen seiner Sippe ein oder zwei Generationen vor ihm) mit der Namenbildung von Hessen (966 Hessenheim, Haessinhem) gedacht werden 22, in dessen Ortsname der Personenname Hcssi als Bestimmungswort enthalten ist. Seine Sippe würde demnach als Verursacherin der ins Auge gefassten -heim-orte Kolonisation am Fallstein in Betracht kommen. Ohne Frage ist dieser Sippe eine befestigte Residenz, eine Burg also, zuzuordnen - aber wo? In der Ortslage Hessen seibst wird diese wohl auch nach P. Grimms Ansicht schwerlich zu suchen sein. Ein tragfähiger Hinweis auf eine solche findet sich jedoch knapp zwei km westlich des Fleckens auf dem höheren Osthang des Großen Fallstein. Obertägige Spuren von der dort im Feldriss der Braunschweigischen Generallandesvermessung 1755 lediglich als Flurname genannten "Hühnenburg" lassen sich auch nach den Überprüfungen durch P. Grimm 1958 und Fr. Stolberg 1968 nicht mehr ausmachen 23. Auf Grund ihrer günstigen Topographie ist jedoch an dem früheren Bestehen einer Burganlage dort nicht zu zweifeln. Nicht nur die Nähe eines Quellhorizontes sondern auch die Lage an der dort vorbeiführenden Altstraße, welche von (der) Hornburg aus nördlich um den Fallstein herum in Richtung Deersheim verläuft (1755: "Deitweg") bezeichnen die auch den anderen hier behandelten Burgen vergleichbare gute Lagequalität. Gewiss ist, dass auch bei Hessen der genetische Zusammenhang zwischen einer karolingerzeitlichen Burgsippe und einer isoliert auftretenden kleinen Gruppe von Orten mit spezifischer Ortsnamenbildung mehr als wahrscheinlich ist. Die Homburg Die Homburg (994 Hornaburhc) befindet sich in exzellenter topographischer Lage auf dem nordwestlichen Ausläufer der steil aus der I1seniederung aufsteigenden Schichtrippe des Kleinen Fallstein im nordwestlichen Winkel des Harzgaues, wo das Große Bruch gegen Norden und das weite Okertal gegen Westen das Gaugebiet als breite Niederungslandschaften markant abgrenzen. Von der Burg aus ließ sich der 21 Vgl. C. Mänl, 2000, S. 138 ff. 22 Dazu meint P. J. Meier, 1906, S. 187, ~ daß es nicht unberechtigt erscheint, in dem Gründer des Ortes einen Mann vornehmen Standes zu erkennen und hei ihm an jenen Führer der Ostfalen Hessi oder Hassio zu denken, der sich nach den Ann. Lauriss. 775 dem bis zur Oker vordringenden König Karl unterwarf... u 23 Der Feldriss Hessen (StAWf, K 5694) verzeichnet den Rumamen "die Hühnenhurg" für Wanne 4 des Winterfeldes und daneben einen Anger "an der Hunenburg". Vgl. auch P. Grimm, 1958, S. 59 f. sowie S. 336 und Fr. Stolberg, 1968, S. 359.
18 Dörfer und Burgen im Nordharzvorland 21 Übergang der wichtigen Altstraße über die Oker überwachcn und ebenso ein wahrscheinlich auch schon in früher Zeit hier von Norden her über das Große Bruch kommender Weg. Vor karolingische Altbesiedlung entlang dem I1setal beginnt erst mit der Wüstung Bistedt und dem Dorf Bühne (1224 Bunethe) wenige km flussaufwärts von Hornburg und setzt sich in Richtung Osterwieck nach Ostcn hin fort. Das übrige Gebiet, der westliche Grenzraum bis zur Oker sowie nach Osten gegen den Großen Fallstein, war noch bis über 800 hinaus bewaldet. Die dort fast ausschließlich mit dem Grundwort -rode gebildeten Ortsnamen belegen dieses auf sinnfällige Weise 24 Eine genetische Beziehung dieser Rode-Dörfer zur nahe gelegenen Hornburg kann, braucht damit aber angesichts der großflächigen Ausbreitungvon -rode-orten bis an den Harz und entlang dessen Rand nicht unbedingt unterstellt werden. Dennoch sind offensichtlich vier von diesen Orten zumindest ihrer Benamung nach in einem besonderen -wie anders als genetischen? - Bezug zu der Burg anzunehmen, worauf es an dieser Stelle aufmerksam zu machen gilt. Der jeweils dem Bestimmungswort in ihrem Ortsnamen entsprechenden Himmelsrichtung nach sind von der Hornburg aus gesehen lage mäßig korrekt angeordnet: Eine Wüstung Nordrode (1128 Northrode), die Dörfer Osterode (1136 Osterrode) und Suderode (1106 Suderoth) sowie die der Burg distanziell am nächsten gelegene, als früherer Sitz eines Archidiakonatssitzes (!) bekannte Wüstung Westerode ( Weesterrode )25. Derartig namensmäßig nach Himmelsrichtungen orientierte Vorkommen von Dörfern und Wüstungen sind durchaus nicht selten, zumal sie zumeist auf Burgen als zentrale Bezugspunkte ausgerichtet sind 26 Naheliegend ist in solchen Fällen die Mutmaßung von der jeweiligen Burgstelle ausgehender Initiativen der Gründung bzw. auch der Benennung dieser Orte. Der Entstehungszeit der -rode-orte im Okergebiet zu Folge ist demnach von einer Existenz der Hornburg mindestens seit den ersten Jahrzehnten des 9. Jahrhunderts auszugehen 27 Ergebnisse Als Resümee der vorstehenden vier Fallstudien ergeben sich die folgenden Feststellungen und Thesen: 1. Es finden sich von ihrer umgebenden, älter geprägten Siedlungslandschaft im Nordharzvorland durch spezifische Ortsnamenbildung (Grundworte -dorf, -husen, -heim, -rode) wiederholt abweichende, geschlossene, gleichsam isolierte Kleingruppen von Orten bzw. Wüstungen. 24 Vgl. W. Mcibeyer, Vgl. K. Ca.~emir, 2003, S. 256 (Nordrode), S. 359 (Westerode) sowie O. Doering, Vgl. dazu auch ehr. Jochum-Godglück, 1991, passim. 27 Vgl. W. Meibcycr, 1986, S. 20f: Ein gewisser Turinc, dessen Lebenszeit in die ersten Jahrzehnte des 9. Jahrhunderts fällt, schenkte dem Fuldaer Stift ein nach ihm benanntes neues Dorf ("novale") Duringesrod nahe dem Okerfluss.
19 22 Wol[gang Meibeyer 2. Diese bildeten mit ihren Feldmarken in der Frühzeit ihrer Entstehung räumlich zusammenhängende geschlossene Areale, welche hier stets in direktem Anschluss oder in engnachbarlicher Beziehung zu Burgbefestigungen gelegen sind. 3. Daraus resultiert, dass diese burgnahen Bezirke zunächst noch unbesiedelt (wahrscheinlich bewaldet?) vorgelegen haben müssen und auf Grund der engen Lagebeziehung nur von den Burgen aus planmäßig gerodet und aufgesiedelt worden sein können. Dafür spricht auch die in allen FäHen konstante Ortsnamengebung innerhalb der jeweiligen Dörfergruppe. 4. Zeitliche Einschätzungen dieser Vorgänge führen in allen FäHen in die Karolingerzeit - und zwar mit unterschiedlichen, voneinander unabhängigen durchaus fachverschiedenen Datierungsmitteln: a. Die enge distanzielle Nachbarschaft der mit dem Aufbau der kirchlichen Organisation eingerichteten Urpfarreien des Halberstädter Bistums bald nach 800 bringt offensichtlich ihr Schutzbedürfnis bei den Burgen zum Ausdruck und trägt damit zum Nachweis für deren damaliges Vorhandensein entscheidend bei. b. Für die Watenstedter Hünenburg liegen zweifelsfreie archäologische Befunde vor. Hier wurde eine altsächsische Burg von den Franken als neuen Machthabern in Besitz genommen, zerstört und bedeutend ausgebaut und neu befestigt. c. Im Hessener -heim-orte-gebiet kann zwar Hessis Burg nicht als sicher identifiziert gelten, die angeführten Schriftzeugnisse sprechen jedoch eine eindeutige Sprache über die damaligen regionalen sächsisch-fränkischen Machtverhältnisse. d. Historische und siedlungsgeographische Befunde daticren die Orte mit den genannten Ortsnamensbildungen im Harzvorland in die Zeit der fränkischen Eroberung und Machtergreifung in Ostsachsen. 5. Zusammenschau und Vergleich der bei den hier untersuchten Burgen und Orten zu Tage geförderten Einzelheiten und Zusammenhänge erweisen in hohem Maße Übereinstimmungen bzw. weitgehende Ähnlichkeit der vorgefundenen Merkmale und Strukturen. Sie erhalten so argumentatives Gewicht für die Annahme weitgehend ähnlich veriaufener Abläufe der frühmittelalterlichen Siedlungsgenese im Umfeld der Burgen. 6. Prinzipiell scheint einer Zuordnung der ausgemachten burgbezogenen Siedlungsbezirke zu dem Modell der Burgwarde, wie sie bereits in karolingischer Zeit etwa an der Saale eingerichtet wurden, nichts Wesentliches entgegen zu stehen 28 Die im Vorstehenden besonders mit siedlungsgeographischen Mitteln herausgearbeiteten Entstehungsumstände einzelner Gruppen von Orten in unserer komplexen ostfälischen Siedlungslandschaft ermöglichen Einblicke in einige schon recht späte Abschnitte der Entwicklung der Kulturlandschaft während der beginnenden Frankenzeit des Jahrhunderts 29 Diese erreichte im Nordharzvorland mit den Grün- '" Vgl. H. K. Schulze, 1983, Sp ff. 29 Verfasser weist darauf hin, dass hinsichtlich der Datierung der Ortsnamen bzw. der Entstehung insbesondere der -heim-orte seitens der germanistischen Namenforschung,- vertreten durch J. Udolph,
20 Dörfer und Burgen im Nordharzvorland 23 dungen der -ingerode-dörfer bis etwa ins 11. Jahrhundert im ländlichen Bereich einen vorläufigen Abschluss. Wesentliche Ergänzungen brachte dann nur noch das Aufblühen der Städte im 12. und 13. Jahrhundert. Damit sowie mit dem Fußfassen der Zisterzienserklöster und mit der einsetzenden Auflösung der Villikationen setzte bereits zu jener Zeit ein Rückgang im ländlichen Siedlungswesen ein, welcher schließlich in der spätmittelalterlichen Wüstungsperiode des 14. und 15. Jahrhunderts seinen Höhepunkt ereichte. Verwendetes Schrifttum und Quellen K. CASEMIR (2003): Die Ortsnamen des Landkreises Wolfenbüttel und der Stadt Salzgitter. Nieders. Ortsnamen buch 3 = Veröff. d. Inst. f. Histor. Landesforschung der Univ. Göttingen 43. Bielefeld. O. DOERING (1902): Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler der Kr. Halberstadt Land und Stadt. Halle/ S. W. ERBENS (1964): Wüstungsgeographie des Raumes Wolfenbütte!. Ungedr. Examensarbeit am Inst. f. Geoökologie der Techn. Univ. Braunschweig. W. FREIST (1960): Zwei alte Wege durch das Große Bruch. In: BsJb. f. Landesgesch. 41. P. GRIMM (1958): Die vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle der Bezirke Halle und Magdeburg. Handbuch vor- und frühgeschichtlicher Wall- und Wehranlagen 1 = Deutsche Akad. d. Wiss. z. Berlin, Sehr. d. Sektion f. Vor- u. Frühgeschichte 6. Berlin. I. HESKE (2001): Die Hünenburg. Neue archäologische Forschungen In: Die Hünenburg bei Watenstedt. Ausgrabungsergebnisse = Bsg. Landesmuseum. Informationen und Berichte. DERs. (in Druckvorbereitung): Die Hünenburg bei Watenstedt, Kr. Helmstedt - eine urund frühgeschichtliche Befestigung und ihr Umfeld. = Göttinger Diss Chr. JOCHUM-GODGLÜCK (1991): Die orientierten Siedlungsnamen auf -heim, -hausen, -hofen und -dorf im frühdeutschen Sprachraum und ihr Verhältnis zur fränkischen Fiskalorganisation. Frankfurt a.m. u. a. Orte. H. KLEINAU (1967/68): Geschichtliches Ortsverzeichnis des Landes Braunschweig. 2 Bde. = Geschieht!. Ortsverz. v. Nieders. 2. Veröff. d. Histor. Komm. f. Nds. 30. C. MÄRTL (2000): Die ostsächsische Frühzeit und die Ottonen (8. Jahrhundert bis 1024). In: H.-R. JARCK u. G. SCHILDT (Hg.): Die Braunschweigische Landesgeschichte. Jahrtausendrückblick einer Region. Braunschweig. W. MEIBEYER (1986): Siedlungsgeographische Beiträge zur vor- und frühstädtischen Entwicklung von Braunschweig. In: BsJb. f. Landesgesch. 67. DERs. (2000): Die Anfänge der Siedlungen. In: H.-R. JARCK u. G. SCHILDT (Hg.): Die Braunschweigische Landesgeschichte. Jahrtausendrückblick einer Region. Braunschweig. DF.Rs. (2002): Die "Kanstein-Burg" im früh mittelalterlichen Siedlungsraum des Harzvorlandes. Eine historisch-siedlungsgeographische Betrachtung. In: W-D. STEINMETZ: Ar- 1998, sowie neuerdings auch durch seine Schülerin K. Casemir, gegenüber den hier erneut ausgebreiteten Ergebnissen der Siedlungskunde erhebliche Unterschiede bestehen. Es scheint an der Zeit, diese endlich einmal interdisziplinär gemeinsam und angemessen zu diskutieren.
21 24 Wolf gang Meibeyer chäologie und Geschichte der karolingisch-ottonischen Burg auf dem Kanstein bei Langelsheim. = Veröff. d. Bsg. Landesmus DERs. (vorr. 2005): Zur frühmittelalterlichen Siedlungslandschaft des Halberstädter Harzvorlandes. In: A. SIEBRECHT (Hg.): Geschichte und Kultur des Bistums Halberstadt. Symposium anläßiich 1200 Jahre Bistumsgründung Halberstadt. (im Druck). P. J. MEIER (1906): Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Wolfenbüttel. Wolfenbüttel. H.-J. NITZ (1989): Siedlungsstrukturen der königlichen und adligen Grundherrschaft der Karolingerzeit. In: W. RösENER (Hg.): Strukturen der Grundherrschaft im frühen Mittelalter. Göttingen. G. REISCHEL (1902): Geschichtliche Karte des Stadt- und Landkreises Halberstadt = Veröff. d. Histor. Komm. f. d. Provo Sachsen u. d. Hzgtm Anhalt. G. SCHMIDT (1883): Urkundenbuch des Hochstifts Halberstadt und seiner Bischöfe 1. Leipzig. H. K. SCHULZE (1983): Stichwort Burgward, Burgwardverfassung. In: Lexikon des Mittelalters 2. München und Zürich. H.-A. SCHULTZ (1957): Hohen-Neinstedt, ein wüst gewordenes Dorf bei Ingeleben. Die Ergebnisse der Grabung In: Bsg. Heimat. R. SIEBERT (2001): Die Fernstraßen zwischen Oker, Lappwald, Harz und Aller bis zum 9. Jahrhundert. Gab es eine frühmittelalterliche Süd-Nord-Fernstraße östlich der Oker? In: BsJb. f. Landesgesch. 82. W.-D. STF.INMETZ (2001): Die Hünenburg und die Identifikation der Hohseoburg. In: Die Hünenburg bei Watenstedt. Ausgrabungsergebnisse = Bsg. Landesmuseum. Informationen und Berichte. J. UDOLPH (1998): Fränkische Ortsnamen in Niedersachsen? In: P. AUFGEBAUER u. a. (Hg.): Festgabe für Dieter Neitzert zum 65. Geburtstag. = Göttinger Forschungen zur Landesgesch. 1. R. WENSKUS (1976): Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel. = Abh. d. Akad. d. Wiss. in Göttingcn. Phil.-Histor. Klasse 3, 93. K.-H. WILLROTH (2001): Die Erforschung der Hünenburg bei Watenstedt- ein vorläufiges Resümee. In: Die Hünenburg bei Watenstedt. Ausgrabungsergebnisse = Bsg. Landesmuseum. Informationen und Berichte.
22 Verdener Güter im Braunschweigischen Ein Beitrag zur Geschichte von tramsleben und t Hohnstedt. Von Arend Mindermann I. tramsleben Am 23. März 1031 schenkte Kaiser Konrad 1I. der Verdener Kirche und dem Verdener Bischof Wigger das Gut tramsleben, das einst ein gewisser Tammo besaß (tenuit), gelegen im Harzgau, in der Grafschaft des Grafen Liutger, mit allem Zubehör zu vollem Eigentum. Die Schenkung erfolgte pro remedio anime des Kaisers, seiner Ehefrau Gisela und deren Kinder; im Verdener Dom sollte aus den Erträgen jenes Guts die memoria der kaiserlichen Familie begangen werden. Die Schenkung gewinnt dadurch den Charakter einer Memorienstiftung. Das verschenkte Gut war als Erbe an Konrad 11. gefallen 1. Wie Giese ermitteln konnte, liegt hier einer von insgesamt überhaupt nur zwei überlieferten Fällen vor, in denen Konrad IL hereditario iure Güter in Ostsachsen/Nordthüringen eingezogen hatz. Der heute wüste Ort Ramsleben lag zwischen Hessen (Kr. Halberstadt) und Dardesheim (Kr. Halberstadt), im Gebiet des späteren Vorwerks Hessenbau, wo der Aurname "Ramslebener Feld" noch belegt ist 3 [... ] etiam pro remedio animae nostrae, eoniugis prolisque nostrae ae memoria tale predium quale tenuit Tammo in Ramaslava in pago Hardagouue in eomitatu Liutgeri comitis quod nobis legaliter pupblice {sie} hereditate venilf sanetf Mariae sanetaeque Cecilie in Virduna ae Uuikero eiusdem aecclesiae venerabili episcopo concedimus et in proprium damus, f... /. MGH D K II Nr. 164: jüngster Druck (mit weiteren Nachweisen): Arend MINDFRMANN (Bearb.), Urkundenbuch der Bischöfe und des Domkapitels von Verden, Bd. 1: Von den Anfängen bis BOO. Stade 2001 (SchrrReiheLandschaftsverbandEhemHerzogtümerBrcmVerd 13; VeröffHistKommNdSachs 205) (im folgenden zitiert: UB Verden 1), Nr Wolfgang GIESE, Reichsstrukturprobleme unter den Saliern - der Adel in Ostsachsen, in: Stcfan WEINFURTER (Hg.), Die Salier und das Reich, Bd. 1: Salier, Adel und Reichsverfassung. Sigmaringen 1991, S , hier: S Zur Lokalisation vgl. Enno HEYKEN, Die älteste Bischofsurkunde von Verden (zwischen 1014 und 1031). Untersuchungen über Bl.'Sitz der Verdener Kirche um Paderborn, über die ehemalige Bistumsgrenze um Zeven, über den wüsten Kirchort.Nianford" und über Ortsnamen um Zeven und Sittensen (Ldkr. Bremervörde) und um Hollenstedt (Ldkr. Harburg). In: JbGcsNdsKG 65, 1967, S , hier: S. 37; Hermann KLEINAU, Geschichtliches Ortsverzeichnis des Landes Braunschweig. Bd (VeröffHistKommNds 30.2). Hildesheim , hier: Bd. 2, S. 469 f., Nr. 1649; vgl. auch Thomas VOGTIIERR. Die Herkunft Bischof Richberts von Verden ( /84). In: StadJb N.F. 79, 1989, S , hier: S Die Angabe, dass tramsleben im Kr. Wolfenbüttelläge (MGH D K II 164; Richard DRÖGE REIT, (t), Materialien zur Geschichte des ehemaligen Bistums Verden. Nach einem unvollendeten Manuskript aus dem Nachlaß [oo.j hg. vom Verdener Heimatbund. Verden 1981, S. 40; Ernst SCIIUBERT, Geschichte Niedersachscns vom 9. bis zum ausgehenden 15. Jahrhundert, in: DERs. (Hg.), Geschichte Niedersachscns Bd. 2.1: Politik, Verfassung, Wirtschaft vom 9. bis zum aus-
23 26 Arend Mindermann Die Schenkung geschah auf Bitten und Intervention seiner Ehefrau und seines Sohnes, der Kaiserin Gisela und des Königs Heinrich (des späteren Kaisers Heinrich III.), sowie des Bischofs Meinwerk von Paderborn. Kaiserin Gisela war zuvor mit dem Grafen Brun von Braunschweig (t 1012), dem Stammvater der Brunonen, verheiratet gewesen, so dass ihr gemeinsamer Sohn Liudolf ein Halbbruder Kaiser Heinrichs III. war 4 ; sowohl die als Intervenientin genannte Kaiserin als auch ihr Sohn verfügten demnach über enge verwandtschaftliche Beziehungen zur sächsischen Adelsfamilie der Brunonen, die wahrscheinlich "nach Namenschatz und Besitzübereinstimmung ein Seitenzweig der Liudolfinger" waren 5, mithin des Königshauses der Ottonen. Der Besitz der Brunonen konzentrierte sich "im späteren Braunschweiger Raum"6 bzw. "im westlichen Teil der Diözese Halberstadt"7, also genau in dem Gebiet, in dem tramsleben lag. Bischof Meinwerk von Paderborn wiederum gehörte zur sächsischen Adelsfamilie "der Immedinger, die mit dem ottonischen Haus verwandt waren"s. Aufgrund dieser Verwandtschaftsverhältnisse sind m. E. zwei Möglichkeiten denkbar, woher der hier verschenkte Besitz gestammt haben könnte: Entweder dürfte es sich um brunonisches Gut gehandelt haben oder um altes ottonisches Reichsgut. Die genannten Intervenienten und ihre angeführten verwandtschaftlichen Beziehungen könnten ein Hinweis darauf sein, dass der hier verschenkte Besitz aus brunonischem Erbe stammte und über Konrads Ehefrau Gisela als ererbtes Gut in kaiserlichen Besitz gelangt ist, wobei in diesem Fall der genannte Tammo als Angehöriger jener Familie aufzufassen wäre. Vielleicht noch etwas wahrscheinlicher dürfte aber die ebengenannte zweite Möglichkeit sein, dass es sich hier um altes ottonisches Reichsgut gehandelt hat. Die Nennung des früheren Besitzers Tammo steht dem m.e. nicht entgegen, denn es heißt von ihm ja ausdrücklich, dass er das Gut tramsleben tenuit, also nicht etwa possedit. Diese Wortwahl könnte darauf hindeuten, dass er dieses Gut nicht als Eigengut besessen hat, sondern lediglich zu Lehen. Auch das eben angeführte Faktum, dass sich im Gebiet um tramsleben herum Besitz der Brunonen konzentriert hat, muss nicht unbedingt dagegen sprechen, dass es sich bei dem Gut in gehenden 15. Jahrhundert. (VeröffHistKommNds ) Hannover 1997, S , hier: S. 261), beruht auf den Kreisgrenzen von vor 1945, als dieses Gebiet zum Kr. Wolfenbüttel gehörte. 4 Lutz FENSKE, Adclsopposition und kirchliche Reformbewegung im östlichen Sachsen, (VeröffMPIG 47) Göttingen 1977, S. 23 mit Anm. 44; SCHUBERT (wie Anm. 2), S. 215; Claudia MÄRTL, Ostsachsen zur Zeit der Salier, in: Horst-Rüdiger JARcK/Gerhard SCHILD (Hgg.), Die Braunsehweigische Landesgeschiehe. Jahrtausendrückblick einer Region. Braunschweig 2000, S , hier: S. 171 f.; vgl. auch Ludger KÖRNTEN, Ottonen und Salier. Darmstadt 2002, S SCHUBERT (wie Anm. 3), S. 189 (mit weiteren Nachweisen); vgl. MÄRTL (wie Anm. 3), S SCHUBERT (wie Anm. 3), S MÄRTL (wie Anm. 3), S. 171; vgl. auch Gudrun PISCHKE (Bearb.), Geschichtlicher Handatlas von Niedersachsen. Neumünster 1989, Karte 16 (,Herrschaftsbereich der Billunger, der Grafen von Northeim und Lothers von SLipplingenburg'), wo diese Besitzungen als Besitz Kaiser Lothars III. von Süpplingenburg, des Erbes der Brunonen, kartiert sind. 8 SCHUBERT (wie Anm. 3), S. RR; vgl. ebd., S. 145 (mit weiteren Nachweisen). - Zu Bischof Meinwerk von Paderbom grundlegend: Meinwerk von Paderbom, , Ausstellungskatalog. Paderbom 1986; hierin spez. S : Manfred BALZER, Meinwerk von Paderbom ( ). Ein Bischof in seiner Zeit; vgl. zuletzt: Tilman STRUVE, Artikel "Meinwerk, Bf. v. Paderbom". In: LexMA 6. München, Zürich 1993, Sp. 475 (mit weiteren Nachweisen).
24 Verdener Güter im Braunschweigischen 27 tramsleben um Reichsgut gehandelt hat, da hier, im Gebiet rund um den Harz herum, ebenso eine starke Massierung alten ottonischen Reichsguts zu finden ist 9. Das unstrittige grundsätzliche Verbot, Reichsgut zu veräußern, steht der Möglichkeit, dass tramsleben altes Reichsgut war, ebenso wenig entgegen, da der Kaiser stets das Recht besaß, das eigentlich unveräußerliche Reichsgut als Seelgerät an Reichskirchen zu stiften, "wobei das Obereigentum des Reiches am Reichskirchengut vorausgesetzt wurde"lo. Und genau von dieser Möglichkeit einer Seelgerät- bzw. Memorienstiftung hat Kaiser Konrad H. mit der Schenkung des Gutes tramslebens an die Verdener Kirche ja, wie eingangs ausgeführt, Gebrauch gemacht. Letztlich wird man mangels Quellen keine der beiden Möglichkeiten völlig sicher ausschließen können, wenngleich die gewichtigeren Indizien wohl doch, wie erwähnt, für die zweite Möglichkeit sprechen dürften. 9 PISCHKE (wie Anm. 7), Karte 14 (,Reichsgut im und am Harz'), wo tramsleben als Reichsgut eingetragen ist. 10 D[ieterJ HÄGERMANN, Artikel,Reichsgut'. In: LexMA 8. München 1997, Sp , hier Sp. 621.
25 28 Arend Mindermann Mit der in Goslar ausgestellten Urkunde über jene Schenkung 11 legte Konrad 11. den Grundstein für einen durchaus nicht unbedeutenden Verdener Güterkomplex im Gebiet südöstlich von Wolfenbüttel, der sich immerhin nahezu drei Jahrhunderte hindurch im Besitz der Verdener Kirche befand, der aber in der Braunschweigischen Landesgeschichte nahezu völlig in Vergessenheit geraten ist 12 Zugleich bildet diese Urkunde die älteste Erwähnung t Ramslebens 13 Ganz offenbar hat Bischof Wigger, der bereits am 16. August desselben Jahres starb, einige der ihm soeben geschenkten Güter in tramsleben unverzüglich an das Verdener Domkapitel weiterverschenkt. Dies zeigen zwei Einträge in den beiden (inzwischen verlorenen) Verdener Nekrologen von 1364 und Beide Nekrologe geben zu Bischof Wigger übereinstimmend an, er habe dem Domkapitel "ein Gut in tramsleben geschenkt" 14. Anders als der Wortlaut der beiden eben angeführten Nekrologeinträge zunächst vermuten lässt, ist aber mit Sicherheit nicht das gesamte, von Konrad 11. verschenkte Gut in tramsleben an das Verdener Domkapitel gelangt. Dies ergibt zum einen aus einem im folgenden näher betrachteten bischöflichen Lehensregister, das wohl aus der Zeit um 1220 stammt. Zum anderen ergibt sich dies aus den unten noch näher betrachteten Verkaufsurkunden von Welche Bedeutung dieser Schenkung in Verden beigemessen wurde, zeigen nicht nur die beiden genannten Nekrologeinträge, sondern auch die älteste Verdener Bischofschronik von etwa Der unbekannte Chronist bietet ein recht ausführliches Regest der kaiserlichen Schenkung, in welchem er auch die Mitwirkung der Kaiserin sowie des Paderborner Bischofs Meinwerk festhält l5 Das Regest nimmt mehr als die Hälfte des gesamten Bischof Wigger betreffenden Eintrags in jener Chronik ein, bildete für den unbekannten Chronisten also ohne Zweifel das wichtigste Ereignis aus dessen Pontifikat. Das eben erwähnte, wohl um 1220 angelegte Lehcnregister erlaubt erstmals etwas genauere Aussagen darüber, welchen Umfang das 1031 von Kaiser Konrad 11. ver- 11 Wie Anm Vgl. z. B. jüngst larck / SCHILD (wie Anm. 4), S (Register, s.v.,verden'); tramsleben erscheint hier gar nicht. - Eine Ausnahme bildet, soweit ich sehe, lediglich KLEINAU (wie Anm. 3), Bd. 2, S. 469 f., Nr KLEINAU (wie Anm. 3), Bd. 2, S. 469 f., Nr Nekrolog von 1364: Wicgerus [... / dedit predium in Romsc/eue. Druck: Friedrich WICHMANN, Untersuchungen zur älteren Geschichte des Bistums Verden. In: ZHistVNds 1904, S [TI.1]; 1905, S [TI. 2] u. S [TI. 3], hier: TI. 1, S. 339, Anm Nekrolog von 1525: Wiggerus episcopus XIX, qui dedit predium in Rameslo. Druck: H(ugo) HOLSTEIN (Hg.), Nekrologium Verdense vel Regula Chori per Heinonem de Mandelslo scripta 1525, in: StadArch A.F. 11, IH86, S , hier: S. 167 (zum 16. August). Beide Einträge zuletzt gedruckt in: VB Verden 1 (wie Anm. 1), Nr Vvitgerus huius ecclesie episcopus XVIIII {...j. Hic pontifex venerandus intercedente secum Gisla imperatrice et fllio suo rege Hinrico prediclo necnon Meghenwardo venerabili episcopo Padeburnensi optinuit ab eodem imperatore predium in Romesleue sancte Marie sancteque Cecilie in Verda et Witghero suo episcopo et suis successoribus cum omnibus appendiciis, edificiis, mancipiis, agris cum omni iure et ut idem episcopus et sui successores ordinandi de predictis bonis pro usu ecclesie liberam habeant potestatem. Chronicon episcoporum Verdensium. Die Chronik der Verdener Bischöfe, hg., kommentiert und übersetzt von Thomas VOGTIIERR. (SchrrReiheLandschaftsverbandEhemHerzogtümerBremVerd 10) Stade 1998, S. SO, Nr. 19; Übersetzung: ebd., S. 120.
26 Verdener Güter im Braunschweigischen 29 schenkte Gut in tramsleben besessen hat, wenngleich mit dem Lehenregister ganz sicher nicht der gesamte Besitz erfasst worden ist, da die domkapitularischen Güter nicht genannt sind. Das Register verzeichnet zunächst eine Reihe von Hufen an ungenanntem Ort. Bei jenen Hufen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass es sich hierbei um Güter in tramsleben selbst handelt, oder, etwas präziser, in der Feldmark, die tramsleben zugerechnet wird. Für diese Annahme spricht insbesondere die große Zahl von Hufen in tramsleben, die beim Verkauf 1318 genannt werden. Zudem wird man wohl doch annehmen dürfen, dass der Schreiber nur bei denjenigen Hufen auf eine zusätzliche Lokalisierungsangabe verzichten konnte, die zu t Ramsleben selbst gehörten, also zu dem Ort, nach dem der gesamte Güterkomplex immer benannt blieb, mithin dem ursprünglichen Villikationszentrum. Allen Beteiligten dürfte klar gewesen sein, dass diese Güter sich nur im Hauptort dieses Güterkomplexes, im Villikationszentrum, also in tramsleben, befunden haben konnten. Dem Lehenregister von etwa 1220 zufolge besaßen folgende Personen die im folgenden genannten Güter vom Verdener Bischof zu Lehen: 16 der Edelherr Luthard 11. von Meinersen: 4 Hufen (in tramsleben) sowie weitere 9 Hufen in Bornem, womit wohl Bomum bei Kissenbrück (Kr. Wolfenbüttel) gemeint sein dürfte; ein (sonst unbekannter) Edelherr Dietrich: 2 Hufen (in tramsleben). Johann Duvel: 1 Hufe (in tramsleben); Johann von Ramsleben (de Rameslo): 3 Hufen (in tramsleben); RudolfTocht: 15 Hufen (in tramsleben); (nicht namentlich genannte) Söhne eines von Wedtlenstedt: 6 Äcker und eine (dazugehörige) Hofstätte (in tramsleben) sowie eine weitere Hofstätte in t Ramsleben (Rameslo) ohne Äcker; der Edc1herr Konrad l. von Mahner: 1 Hufe (in tramsleben); der Edelherr Heinrieh von Volkmarode: 3 Hufen in Hedeper (Kr. Wolfenbüuc1) (Hathebere); Konrad und Bertold von Schöningen: 3 Hufen in Hedeper. Ferner wird hier genannt: ecclesia V mansos et molandinum. Diesen Eintrag wird man dahingehend deuten dürfen, dass die Kirche in tramsleben, deren Patronatsrecht, wie noch auszuführen ist, nachweislich beim Verdener Bischof lag, den angeführten Besitz vom Verdener Bischof zu Lehen besaß. Insgesamt bestand demnach der zum Gut t Ramslcben gehörige, vom Verdener Bischof zu Lehen ausgegebene Besitz seinerzeit aus 46 Hufen Landes, davon 31 in tramsleben, 9 in Bornum, auf die unten noch zurückzukommen ist, 6 Hufen in Hedeper, von denen 5 bereits UB Verden 1 (wie Anm. I), Nr. 246; zur Datierung sowie 2ur Lokalisierung der genannten Orte vgl. ebd., Anm. 1 u Die große Bedeutung und das Alter dieses Lehenregisters sind erstmals 19H9 von Thomas Vogtherr erkannt und gewürdigt worden. VOGTHFRR (wie Anm. 3), S. 48 f. - Der in demselben Lehenregister angeführte bischöfliche Lehenbesitz in t Walstorpe an der EIbe kann hier unberücksichtigt bleiben, da er nicht zu den Ramslebener Gütern gehört hat.
27 30 Arend Mindermann als Verdener Lehen bezeugt sind 17, sowie aus einer Mühle und 2 Hofstätten in t Ramsleben, eine davon mit 6 verlehnten Äckern, die andere ohne verlehnte Äcker. Zumindest für einige der angeführten Güter ist mit einiger Sicherheit davon auszugehen, dass sie von den genannten Verdener Lehensleuten unterverlehnt worden sind. So hat der Edelherr Luthard 11. von Meinersen um 1220 insgesamt 29 Hufen in Bornum zu Lehen ausgegeben, nämlich 18 an die von Esbeck, 9 an die von Osterode und 2 an die von Dingelstedt 18 Bei 9 dieser Hufen dürfte es sich, wie schon Kleinau annimmt, um die angeführten Verdener Lehen gehandelt haben 19 Die naheliegende Annahme, dass die 9 Hufen Verdener Lehen, die Luthard 11. von Meinersen in Bornum besessen hat, mit den 9 an die von Osterode (unter-) verlehnten Hufen in Bornum identisch sind, lässt sich allerdings gegenwärtig, anhand der bisher bekannten Quellen nicht mit letzter Sicherheit beweisen. Angehörige von Familien aus dem Braunschweigischen Adel, die als Verdener ministeriales Güter in tramsleben zu Lehen besaßen, konnten auch zu Zeugendiensten herangezogen werden. Dies konnte durchaus auch bei Urkunden geschehen, die im Bistum Verden ausgestellt wurden, also in recht großer Entfernung von tramsleben. In einer Urkunde aus dem Jahr 1272 beispielsweise, ausgestellt in Lüneburg von Graf Burchard von Wölpe zugunsten des damaligen Tutors und postulierten Bischofs von Verden, Konrad I. von Braunschweig-Lüneburg, erscheinen unter anderem die Ritter Gebhard d.ä. von BortfcId und Rudolf Koz als Zeugen. Beide Ritter, die 1274 ebenfalls Lehen der Edelherren von Meinersen in der Nähe tramslebens besaßen 20, werden in der Zeugenliste ausdrücklich als "Ministerialen der Verdener Kirche auf den Gütern zu tramsleben" bezeichnetli. Dies dürfte, Kleinau folgend, bedeuten, dass sie seinerzeit Ramslebener Güter zu Lehen trugen 22 Möglicherweise ist es nicht zufällig, dass diese bei den Ritter ausgerechnet während des Pontifikats Bischof Konrads I. von Verden ( ) im Bistum Verden als Zeugen erscheinen, war doch jener Bischof als Sohn eines welfischen Herzogs des öf- 17 Bischof Thietmar 11. von Verden hatte sich am 28. September 1123 bei einem Gütertausch, bei dem er ein bischöfliches Gut in Hedeper (predium sanct~ Mari~ quod est in Hathebere) an Gisela von Veekenstedt übertragen hatte, ausdrücklich 5 Hufen zurückbehalten, die an zwei Ministerialen verlehnt waren. VB Verden 1 (wie Anm. 1), Nr " Hans SUDENDORF (Hg.), Vrkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande. Bd Bd. 11 (Register) hg. v. Carl SATTLER. Hannover und Göttingen (im folgenden zitiert: VB Herzöge), hier: Bd. 1, Nr Zur Datierung auf,um 1220' (gegen die ältere Datierung auf,um 1226'), vgl. Claus-Petcr HASSE, Die welfischen Hofämter und die welfische Ministerialität in Sachsen (HistStud 443). Husum 1995, S. 89 (mit weiteren Nachweisen). 19 Kleinau (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 87 f., Nr. 295 (Bomum), hier: S. 87, Abschn. 4.a. 20 VB Herzöge (wie Anm. 17), Bd. 1, Nr. 79, hier S. 52, Z. 1-5 u. 12 f. 21 [... 1, Gevehardus miles dictus de Bortvelde, RadalJus mi/es dictus Koz, ministeriales ecc/esie Verdensis de bonis Romesleve [ VB Verden 1 (wie Anm. 1), Nr. 542 (1272 Dezember 5) (mit weiteren Nachweisen) 22 KLElNAU (wie Anm. 3), Bd. 2, S. 469 f., Nr. 1649, hier: S Kleinau a. a. O. bezieht dies aufgrund eines Lesefehlers in älteren Editionen lediglich auf Rudolf Koz, da er, einem Lesefchler in älteren Editionen folgend, die in der Vrk. (wie Anm. 14) gebotene Kürzung ministerial. als Kürzung für ministerialis statt für ministeriales auffasst; vgl. hierzu jetzt VB Verden 1 (wie Anm. 1), S. 583, Anm. 1 zu Nr. 542.
28 Verdener Güter im Braunschweigischen 31 teren selbst in der welfischen Residenzstadt Braunschweig anzutreffen 23 Diese persönlichen Aufenthalte des Verdener Bischofs in der Stadt Braunschweig werden sicherlich beigetragen haben zu einer Verfestigung und deutlichen Intensivierung der Bindungen zwischen den Verdener Bischöfen und dem Verdener Domkapitel auf der einen und denjenigen Adeligen, die Verdener Besitzungen im Braunschweigischen zu Lehen trugen, auf der anderen Seite. Bischof Konrad konnte ja bei seinen Besuchen in Braunschweig auch einzelne Verdener Ministerialen antreffen, wenn diese sich auf ihren dortigen Stadthöfen aufhielten 24 Ein Gebhard von Bortfeld beispielsweise besaß im Jahr 1318 zwei Höfe in der Stadt Braunschweig als herzogliche Lehen z 5, dürfte sich demnach zumindest gelegentlich in Braunschweig aufgehalten haben. Unklar bleibt allerdings, ob hier noch der ebengenannte Verdener Ministeriale und Ritter Gebhard von Bortfeld d.ä. gemeint ist oder bereits dessen 1328 bezeugter gleichnamiger Sohn 26 Die hier deutlich zum Vorschein kommende enge Verbindung zwischen einzelnen Braunschweigischen Adeligen und den Bischöfen von Verden dürfte sicherlich auch dazu beigetragen haben, dem einen oder anderen Braunschweigischen Adeligen den Weg ins Verdener Domkapitel zu öffnen. Ein besonders prägnantes Beispiel hierfür ist die Karriere des Heinrich von Biwende, der aus einer Familie stammt, deren namengebender Stammsitz, das Dorf Klein-Biewende (Kr. Wolfenbüttcl), nur wenige Kilometer von tramsleben entfernt liegt 27 Heinrich von Biwende erscheint zuerst im Jahr 1252, während des Pontifikats Bischof Gerhards I. von Verden ( ), als bischöflicher Kleriker 28, später als Pfarrer der St. Johanniskirche in Lüneburg (1294/1295)29, als Verdener Domherr und Propst im Stift Bardowick (1294)30, als Domthesaurar (1295)31 sowie außerdem 23 Ebd., Nr. 571, 580, 581, (i Am Göttinger Beispiel konnte nachgewiesen werden, dass die Adeligen ihre Stadthöfe keineswegs ständig selbst bewohnt haben; vgl. Arend MINDERMANN,,.De lude, de de sitten in des von Plesse [... J husen", oder: Wer bewohnte im späten Mittelalter die Göttinger Adelshöfe?, in: Der Adel in der Stadt des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit. Beiträge zum VII. Symposion des Weserrenaissance -Museums Schloß Brake vom 9. bis zum 11. Oktober 1995, veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Institut für vergleichende Städtegeschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, hg. von Vera LÜPKES und Heiner BORGGREFE sowie Peter JOHANF.K, Redaktion Anke HUFscHMIDT (MaterialienKunstKulturGNordWestDtld 25). Marburg 1996, S S UB Herzöge (wie Anm. 17), Bd. 1, Nr. 303; Bemd FLENTJE / Frank HENRICIIVARK, Die Lehenbücher der Herzöge von Braunschweig von 1318 und 1344/65 (StudVorarbHistAtlasNds 27). Hildesheim 1982, S. 34, Nr. 61 (Geuehardlls de Bortvelt 2 curias in Brllnswich); hierzu Arno WEINMANN, Braunschweig als landesherrliche Residenz im Mittelalter (BeihBsJb. 7). Braunschweig 1991, S. 197; Arend MINDER MANN, Adel in der Stadt des Spätmittelalters. Göttingen und Slade 1300 bis 1600 (VeröfflnstHistLdForschUnivGött 35). Bielefeld 1996, S 333 f. 26 Vgl. MINDERMANN (wie Anm. 24), S C[hristophJ v. SCHMIDT-PHISELDECK, Geschichte der Edlen von Biewende und ihrer Herrschaft im dreizehnten Jahrhundert. Wcmigerode 1875, S Für den Hinweis auf diesen Titel danke ich Uwe Ohainski, Göttingen / Hannover. 2. [oo.j, Heynricus clericus nosrer dicrus de Biwende, [00.J. UB Verden 1 (wie Anm. 1), Nr. 429 (1252 Mai 9). 29 Ebd., Nr. 702, 709.,,, Ebd., Nr. 699, Nr Ebd., Nr. 710.
29 32 Arend Mindermann und vor allem von bis zu seinem Tod am 19. März 1300 oder als Verdener Domdekan 34 Der Verdener Chronik des Domdekans Andreas von Mandesloh aus dem späten 16. Jahrhundert (die 1720/21 unter dem Pseudonym Cyriakus Spangenberg im Druck erschien), verdanken wir den Hinweis, dass der Domdekan Heinrich von Biwende im Jahr 1288 immerhin 7 Mark Silber aus eigenen Mitteln aufgewandt hat, um das grosse Antiphonarium mit den Regeln musices durch einen Vicarium B. Mariae Magdalenae im Thumb zu Vehrden schreiben zu lassen 35 Er blieb dadurch den Domherren also über Jahrhunderte in Erinnerung. Ist bei Heinrich von Biwende aufgrund seines Namens die Verbindung zu den Verden er Gütern in tramsleben recht sicher zu erschließen, so ist sie bei zwei anderen Angehörigen seiner Familie, bei Konrad und Borchard von Biwende, völlig sicher belegt: Beide besaßen im Jahr 1318 mehrere Güter in tramsleben von der Verdener Kirche zu Lehen, ebenso wie auch die Edelherren von Hessen, die, wie oben erwähnt, als Verdener Lehenmänner ja schon im Lehenregister von etwa 1220 erscheinen. Belegt sind die Lehen der von Biwende und von Hessen in zwei Urkunden vom 23. Februar 1318, die von grundlegender Bedeutung für die weitere Geschichte t Ramslebens werden sollten, handelt sich hier doch um die Urkunden über den Verkauf der Ramslebener Güter an die Klöster Wasserleben (Waterler) und Wöltingerode. An diesem Tag bezeugten Bischof Nikolaus von Verden, der Verdener Domdekan Ludolf von Bernau, der Domscholaster Johann Schinkel sowie das gesamte übrige (in der Zeugenliste teilweise namentlich genannte) Verdener Domkapitel in der ersten jener bei den Urkunden, dass sie dem Propst und dem Konvent des Klosters Wasserleben einige ihrer Güter in tramsleben für 10 Mark Silber verkauft hatten. Sie bezeugen zugleich, dass sie Kaufpreis bereits erhalten hatten und nannten sehr detailliert die einzelnen verkauften Güter. Es handelt sich demnach um Hufen, einen Fronhof und ein Grundstück, genannt "Grashof", sowie ein Stück Land, genannt "Grasblek", die der Ritter bzw. der Adelige (militaris) Konrad von Biwende von den Ausstellern zu Lehen trug, 2 Hufen mit zwei Fronhöfen, die ein Edelherr von Hessen von den Ausstellern zu Lehen trug, sowie 112 Hufe und 112 Fronhof, den der Ritter oder 32 Ebd., Nr Ebd., Nr J4 Ebd., Nr. 602, 614, 645, 646, 648, 652, , 666, 667, 675, 677, 678, 684, , 694, ,705,706,709,710,712,713,719,735,738,741, 747, 748, 750, 751, 753, 754, 756, 762, 765, 769; vgl. auch Enno HEYKEN, Die Altäre und Vikarien im Dom zu Verden. Ein Beitrag zur Rechts-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte eines mittelalterlichen Sakralraumes (VeröffInstHistLd ForschUnivGött 29). Hildesheim 1990, S. 59 f. - Unzutreffend ist von Heyken a. a. O. übernommene Angabe bei Christian SCHLÖPKE, Chronicon oder Beschreibung der Stadt und des Stiffts Bardewick. Lübeck 1704 (ND Darmstadt oj.) S. 24Of., wonach Heinrich von Biwende bereits seit 1275 Verdener Domdekan gewesen sei. Zu dieser Zeit amtierte noch der Domdekan Gerhard, vgl. UB Verden I (wie Anm. 1), Nr Cyriakus SPANGENBERG [Pseudonym), Chronicon oder Lebens-Beschreibung und Thaten aller Bischöffe des Stiffts Verden [... ). Hamburg 0.1. [1720/21), S. 87; zuletzt gedruckt in UB Verden 1 (wie Anm.2), Nr Zu Entstehungszeit dieser Chronik und zum Verfassernamen vgl. Enno HEYKEN, Chroniken der Bischöfe von Verden aus dem 16. Jahrhundert (VeröfflnstHistLdForschUnivGött 20). Hildesheim 1983, S
30 Verdener Güter im Braunschweigischen 33 Adelige (militaris) Borchard von Biwende von den Ausstellern zu Lehen trug 36 In der zweiten ebengenannten Urkunde bezeugten dieselben Aussteller, dass sie dem Propst und dem Konvent des Klosters Wöltingerode für 50 Mark Silber ihre gesamten Güter in tramsleben verkauft haben, mit Ausnahme derjenigen, die an Kloster Wasserlcben verkauft worden sind. Auch hier wird angegeben, dass der Kaufpreis bereits bezahlt sej37. Nur wenige Wochen später, am 25. April 1318, erwarb Kloster Wasserleben von Konrad von Biwende, der hier als Knappe (famulus) bezeichnet wird, auch das Eigentumsrecht der bereits genannten 21f2 Hufen Landes, von denen es jetzt heißt, sie lägen in der Feldmark des Dorfes t Ramsleben 38 Allerdings erfolgte dieser letztgenannte Verkauf unter dem Vorbehalt, dass Konrad von Biwende von den Bauern (coloni), die jene Hufen bewirtschafteten, auf Lebenszeit genau bezeichnete Abgaben erhalten sollte: Von I1f2 Hufen mussten 20 Malter des jährlichen Sommer- und Winterertrags abgegeben werden, die entweder nach Goslar oder nach Hornburg oder nach Osterwieck zu liefern waren. Von der verbleibenden einen Hufe musste jährlich 112 Mark abgegeben werden. Nach dem Tod des Konrad von Biwende sollten diese Abgaben dem Kloster Wasserleben zufallen, das dafür jährliche Seelmessen für Konrad von Biwende selbst und für dessen Eltern, Konrad und Alveradis von Biwende, abhalten musste 39 Mit diesen Verkäufen vom 25. Februar und 25. April 1318 endete nach nahezu 300 Jahren die Verdener Präsenz in und bei tramsleben. Der Verkauf der Ramsleben er Güter erfolgte nicht zufällig während des Pontifikats des Bischofs Nikolaus ( ). Ebenso wie sein Vorgänger Bischof Gerhard I. ( ), der eine ähnliche Erwerbspolitik verfolgte 4o, hat Bischof Nikolaus damit begonnen, die bischöflichen Güter im Gebiet des Hochstifts Verden zu konzentrieren 41 Und ebenso 36 [ J vendidimus pro decem marcis puri argen ti nobis persolutis preposito et conventui monasterii in Waterlere Halberstadensisa dyocesis duos mansos et dimidium sitos in campis ville Romesleve predicte dyocesis et unam curiam in eadem villa et unam aream vulgariter dictam GrashoJ et qlloddam terre spacium dictum Grasblek, que a nobis habebat in pheodo Conradus de Bywende militaris, et duos mansos cum duabus curiis, quos a nobis habebat in pheodo.. nobilis de Hesnem, et insuper dimidium mansum, quem cum dimidia area a nobis habebat in pheodo Borchardus de Bywende militaris, cum omnibus eorum utilitatibus, iuribus et percinenciis, quibus ea pacijice possedimus, perpetuo possidenda. Zuletzt gedruckt: Arcnd MINDERMANN (Bearb.), Urkundenbuch der Bischöfe und des Domkapitels von Verden, Bd. 2: Stade 2004 (SchrrRcihcLandschaftsverbandEhemHcrzogtümerBremVerd 21; VeröffHistKommNds 220) (im folgenden zitiert: UB Verden 2), Nr. 159; vgl. SCHMIDT-PIIISELDECK (wie Anm. 26), S. 31 u. S. 68, Anm. 14; KLEI NAt: (wie Anm. 3), S. 470, Nr J7 Zuletzt gedruckt: UB Verden 2 (wie Anm. 35), Nr. 160 (mit weiteren Nachweisen). 38 [ ) proprietatem duorum mansorum cum dimidio sitorum in campis ville Romesleve, quos in Jeo J9 do tenuit a venerabili domino episcopo ae ab ecclesia Verdensi, f...}. Ebd., Nr Ebd. 40 Arend MINDERMANN, Zur Frühgeschichte des Hochstifts Verden. Grundlagen, Anfänge, Entwicklungsmöglichkeiten und Ausgestaltung der bischöflichen Landesherrschaft bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. In: Immunität und Landesherrschaft. Beitr. zur Gesch. des Bistums Verden, hg. von Bernd KAPPELHoFF u. Thomas VOGTHERR unter Mitarb. v. Michael EHRHARDT u. Arend MINDERMANN, (SchrrRciheLandschaftsverbandEhemHerzogtümerBremVerd 14). Stade 2002, S , hier: S. 98 f. 41 Ebd., S
31 34 Arend Mindermann wie Bischof Gerhard I. 42 ließ auch Bischof Nikolaus ein Verzeichnis der Verdener Güter erstellen, um sich so einen Überblick über die bischöflichen Besitzungen zu verschaffen. Im Falle Bischof Nikolaus' handelt es sich hierbei insbesondere ein Verzeichnis der Verdener Vogteigüter 43. Um innerhalb des Hochstifts Verden weitere Besitzungen erwerben zu können, wurden entfernter liegende Güter verkauft. Bereits 1312 beispielsweise wurde der große Verdener Hof in Uelzen-Oldenstadt mit einzeln aufgeführtem Zubehör an das Kloster Oldenstadt verkauft 44 Ist in diesem Fall der Zweck des Verkaufs nur zu erschließen, so wird der direkte Zusammenhang zwischen dem Verkauf auf der einen und dem bischöflichen Bestreben nach Besitzkonzentration im Hochstift Verden auf der anderen Seiten beim Verkauf der Ramslebener Güter ganz deutlich. In der Urkunde über den Verkauf an Kloster Wasserleben wird von den Ausstellern explizit ausgeführt, dieser Verkauf diene, unter Berücksichtigung der Nützlichkeit und der Bequemlichkeit der Verdener Kirche, dazu, näher gelegene Güter erwerben zu können 45 Der Verkauf der Ramslebener Güter ist aber auch in anderer Hinsicht bemerkenswert. Er zeigt ganz deutlich, dass von Verden aus künftig keinerlei Versuche mehr unternommen werden würden, die Güter im Braunschweigischen eventuell zu kleinen territorialen Exklaven auszubauen. Dass es derartige Versuche gab, erweist die Besitzgeschichte des Verdener Hofes in t Hohnstedt, die im folgenden betrachtet werden soll. 11. t Hohnstedt In einer im Original erhaltenen, undatierten, mit einiger Sicherheit 1075/76 ausgestellten Urkunde bezeugt Bischof Richbert von Verden, dass er mit Zustimmung seines zwischenzeitlich verstorbenen Neffen, des Grafen Gebhard, dem Verdener Domkapitel unter anderem einen Herrenhof (curtis) in Haonstede geschenkt hat 46.Thomas Vogtherr konnte sicher ermitteln, dass jener Verdcner Bischof aus der Familie der Süpplingenburger stammte und dass es sich bei dem genannten Grafen Gebhard um den Vater Kaiser Lothars III. gehandelt hat, dass also Bischof Richbert ein Großonkel dieses Kaisers war 47 Aufgrund dieser Familienzugchörigkcit hat Vogtherr m.e. völlig zu Recht erschlossen, dass es sich bei Haonstede um t Hohnstedt gehandelt haben muss 48, eine Wüstung östlich von Süpplingen, innerhalb der Gemarkung der Stadt Helmstedt, an der von Braunschweig auf Helmstedt zulaufenden Stra- 42 VB Verden 1 (wie Anm. 1), Nr. 433 ([1252 naeh Mai 9]). 43 VB Verden 2 (wie Anm. 35), Nr. 102 ([ 1312 Juni Mitte Februar 11]).... Ebd., Nr. 105 (1312 Dezember 1).., [... ] eonsiderata utilitate ae comoditate [sie] eec/esie nostre atque nostra ad comparandum viciniora nobis bona [... ]. ljb Verden 2 (wie Anm. 35), NT VB Verden 1 (wie Anm. 1), Nr VOGTHERR (wie Anm. 3), S. 49 f. 48 Ebd.
32 Verdener Güter im Braunschweigischen 35 W;}!!Jf1J IUfYul~R~Jf cf 11 ((Lt ( _ n i' 1~~f ( ~f~~{~~~f L:#LU1vn ~l>~ll ~:fl=> ","""t='j,,/!,<jj, +1",.1-.,." "r'ä.,c q-= r.j.",f 1 1 r.~ f.1;~ #1 f..~f- '_l""j.l'" i~lj"=fi.l_!.\f J 1p~trl<1 a1"t W'~"' f.-.ujlf "itrr1~~rl,;;,;lf<#nj:fj~, :f-17'-)'~"1.~.,.+~ , -",'" W4.wt~*'>J".,....,_.tu.t-""trJ.. ' ) ' '7m'7L~,r-,~.ncn~~t[Lt{Lr.J~un,,:r,... <'<. '..,f':'" _.. "'''!'' -_.-::;,.. ;PO,,'" ~ltdr'~~"if.i ~~~=~.t.,lf.nj~jr--m J!..~ oui '... ~~ Ausschnitt aus der Urkunde Bischof Richberts von Verden von [1075/76J; Nennung des Ortsnamens Haonstede in der 3. Zeile von oben, 4. Wort von rechts. (Niedersächsisches Staatsarchiv Stade, Rep. 2, Nr. 19). ße 49. Ebenso wie bei den Gütern in tramsleben hielt auch bei den Gütern in t Hohnstedt der unbekannte Verfasser der ältesten Verdener Bischofschronik von etwa 1331 sie für so wichtig, dass er auch von dieser Urkunde ein recht ausführliches Regest bietet 50. Für diesen Herrenhof t Hohnstedt erwarb Bischof Rudolf ( ), der ebengenannten ältesten Verdener Chronik von etwa 1331 und dem Verdener Nekrolog von 1525 zufolge, die Vogteirechte und übertrug sie seiner Kirche 51. Damit war, wie schon an anderer Stelle ausgeführt, für diese Güter der Grundstein gelegt, sie später gegebenenfalls zu einer kleinen territorialen Exklave ausbauen zu können 52. Rudolfs Nachfolger unternahmen allerdings ganz offenbar keinerlei weitere Aktivitäten in die- 49 KLEINAU (wie Anm. 3), Bd, 1, S, 293, Ne 1004, 50 Ricbertus huius ecclesie episcopus XX/lI. [".1. Hic fratribus ecclesie Verdensis consentiente filio fratris sui comite Geuehardo curtem, quam hereditario tenuit iure in Honstede, cum omnibus ad eam pertinentibus contuut [... 1, Chron. episc. Verd. (wie Anm. 10), S. 88; Übersetzung: ebd., S, 89, 51 Rodolphus huius ecclesie episcopus XXX r..j. Hic acquisivit ecclesie advocaciam in Honstede et multa bona aua [ Chron. episc. Verd. (wie Anm. 15), S. 102; Übersetzung: ebd., S, Obiit Rodolphus episcopus XXXmus, qui contuut advocatiam in Honstede. Regula chori (wie Anm, 14), S. 161 zum 29. Mai. - Letzter Druck bei der Einträge: VB Verden 1 (wie Anm. 1), Nr MINDERMANN (wie Anm. 39), S. 79.
33 36 Arend Mindermann se Richtung, jedenfalls gibt es hierfür keinerlei Belege oder auch nur Indizien. Die Errichtung einer eigenen Landesherrschaft gelang ihnen nur im Gebiet des späteren Hochstifts Verden 53. Wie oben ausgeführt, haben bereits die Bischöfe Gerhard I. ( ) und Nikolaus ( ) damit begonnen, die eigene Herrschaft in diesem Gebiet gezielt auszubauen und aus diesem Grund entfernter liegende Besitzungen abzustoßen. Offenbar traf dies bereits zu einem recht frühen Zeitpunkt auch für den Verdener Besitz in t Hohnstedt zu, denn aus der Zeit nach dem Pontifikat Bischof Rudolfs I. sind bisher keinerlei Quellen über Verdener Besitz in t Hohnstedt bekannt geworden. Die eben genannten Quellen aus dem Pontifikat der Bischöfe Richbert und Rudolf I. blieben also singulär. Herrschaftsrechte und Besitzungen der Verdener Bischöfe und des Verdener Domkapitels in t Hohnstedt gerieten derart in Vergessenheit, dass selbst ein so akribisch arbeitender Forscher wie Kleinau sie nicht mehr nachzuweisen vermochte 54. Im Falle t Hohnstedts hätten sich die Verdener Bischöfe aber bei einem Versuch, hieraus eine kleine territoriale Enklave zu schaffen, in jedem Fall mit den übrigen Hohnstedter Grundherren, insbesondere den Edelherren von Warberg, der Reichsabtei Werden und deren Tochterkloster St. Ludgeri in Helmstedt, auseinandersetzen müssen 55 *** Die Bischöfe und das Domkapitel von Verden waren, wie gezeigt, nahezu drei Jahrhunderte lang, vom frühen 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert, als durchaus nicht unbedeutende Grundherren im Braunschweigischen präsent. Mit der weiteren, hier nicht mehr thematisierten Geschichte der Orte tramsleben und t Hohnstedt, die beide im 16. Jahrhundert wüst gefallen sind 56, hatten die Verdener Bischöfe und das Verdener Domkapitel nichts mehr zu tun. Dies gilt in gleicher Weise für die Geschichte der Orte Bornum (bei Kissenbrück) und Hedeper 57, in denen sich, wie oben ausgeführt, nachweislich Verdener Lehensbesitz befand, der dem Gut t Ramslcben zuzurechnen ist. S3 Ebd., S Vgl. KLEINAU (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 293, Nr. 1004, dem die oben angeführten Quellen zum Verdener Besitz in t Hohnstedt erstaunlicherweise entgangen sind. ss Ebd., Bd. 1, S. 293, Nr (mit weiteren Nachweisen); zu den Edelherren von Warberg vgl. auch Amold BERG, Die Herren von Werberg, in: ArchSippenForsch 20, 1943, S u ; zur Abtei Werden jetzt grundlegend Wilhelm STÜW~;R, Die Reichsabtei Werden an der Ruhr (GermSacra N.F. 12: Das Erzbistum Köln 3). Berlin 1980; zum Besitz des Klosters St. Ludgeri in Helmstedt vgl. Christof RÖMFR, Helmstedt, St. Ludgeri, in: Ulrich FAUST (Hg.), Die Benediktinerklöster in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen, (GermBenedikt 6). St. Ottilien 1979, S sowie PISCHKE (wie Anm. 7), Karte 22 (,Der Besitz des Klosters St. Ludgeri Helmstedt Mitte des 12. Jahrhunderts') sowie ebd., Textteil, S. 11 f. den dazugehörigen Beitrag von Klaus NASS (beide mit umfangreichen Literatumachweisen). S6 t Hohnstedt wurde "wüst vor 1547" (KLEINAU (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 293, Nr. 1004); tramsleben wurde "wüst vor 1584 U (ebd., Bd. 2, S. 469 f., Nr. 1649, hier: S. 470). S7 Zur Besitzgeschichte beider Orte vgl. die Nachweise in ebd., Bd. 1, S. 87 f., Nr. 295 (Bomum) u. S , Nr. 885 (Hedeper).
34 Herzogliche Scharfrichter und Abdecker des Landes Braunschweig in der Frühen N euzeit* von Gesine Schwarz Scharfrichter im 16. Jahrhundert - Abdecker im 16. Jahrhundert - Registratur der Straftaten 1569 bis Neue Scharfrichtereien ab Scharfrichter in Wolfenbüttel bis Schmutzige Aufgaben - Hans Adams" Tagebuch" 1656 bis Scharfrichter in Wolfenbüttel ab Niedergang im 18. Jahrhundert - Scharfrichter als Heilkundige - Nachleben im 19. Jahrhundert Mitte Oktober 1853 wurde der Perücken macher Dombrowsky in Wolfenbüttel hingerichtet 1 Recht und Rechtsauffassung waren erst kurz zuvor neu durchdacht und die Rechtsprechung im Land Braunschweig liberal geregelt worden. Es hieß, dass hier "die Todesstrafe (... ) für seltene Fälle lediglich mit Rücksicht auf die sie ebenfalls verwendenden Nachbarländer beibehalten worden" sei 2 Im Jahrzehnt zuvor war eine Ära der Rechtsprechung zu ende gegangen, die Geständnisse unter Einsatz von Folter erzwang und mit ihren Strafen vor ähnlichen Taten abschrecken wollte. Diese Hinrichtung wurde nicht mehr wie in den vorangehenden Jahrhunderten vom Wolfenbütteler Scharfrichter vorgenommen. Er reiste vielmehr mit seinen Gehilfen aus Berlin an und führte das Urteil vor Gerichtsdeputierten in der Strafanstalt am Ausgangspunkt waren die Scharfrichter der Residenzstadt Wolfenbüttel, auf die ich während der Beschäftigung mit dem Dorf Groß Stöckheim traf; s. Anm. 81. Es zeigte sich, dass der Wolfenbütteler Scharfrichter Vorgesetzter aller Abdecker des Landes Braunschweig war. Deshalb waren beide Berufszweige im Land zu verfolgen, wenn auch nicht vollständig zu erfassen. - Ulrich Schwar.l, meinem Mann, danke ich fur Hinweise und die kritische Durchsicht des Beitrages. Dombrowsky (*1812), Sohn eines Lakaien am sächsischen Hof in Dresden, war in den dreißiger Jahren als Perückenmachergeselle nach Braunschwcig gekommen. Veruntreuungen und Schmuggel schadeten hier seinem Leumund wie zuvor Hausdiebstähle in Berlin Taler Mitgift seiner ersten Frau erlaubten ihm, 1843 die Konzession in Wolfenbüttel zu erwerben heiratete er vier Monate nach ihrem Tod erneut. Seinen Anträgen um die Zulassung zum Pfandmakler, 1852 um den Titel eines Hoffriseurs - wurde nicht entsprochen. Zum Leben des Dombrowsky: Staatsarchiv Wolfenbüttel - im folgenden StA WF - 34 N Wenige Tage, nachdem ihm seine zweite Frau ihr Vermögen im April 1853 notariell überschrieben hatte, war sie tot: Giftmord. Bereits im August war der Mörder durch das Geschworenengericht zum Tod durchs Schwert verurteilt. Zwei Gnadengesuche wurden abschlägig beschieden; es gab niemanden, der die Tat nicht als erwiesen ansah, obwohl Dombrowsky nicht gestanden hatte. Zu Prozess, Urteil und Hinrichtung: StA WF 38 Neu 6 :-.Ir Zum Braunschweiger Strafgesetzbuch von 1840 s. Eberhard SCHMIDT, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege. Göttingen 1965 (3. Aufl.) 282; 283; zur Todesstrafe S Fälle aus den vorangehenden Jahrzehnten zeigen, dass man nun nicht mehr immer bei Mord oder Brandstiftung die Todesstrafe verhängte: z. B. StA WF 32 Neu Nr (eine Brandstifterin wird zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt); StA WF 32 Neu Nr (eine Giftmörderin wird zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt).
35 38 Gesine Schwarz Philippsberg in Wolfenbüttel aus 3 Das war die längste Zeit anders gehandhabt worden. Seit 1590 war der Wolfenbütteler Scharfrichter am Juliusdamm im Norden der Festung und späteren Stadt Wolfenbüttel ansässig gewesen. Dort, wo einst eine alte Ost-West-Verbindung zwischen Magdeburg und Minden die Oker querte, spielte sich Jahrhunderte lang ein Leben in schwer zu erhellendem Dunkel ab. Sein Handwerk übte der Scharfrichter an wechselnden Orten aus. Direkte Nachrichten aus der Scharfrichterei auf dem Juliusdamm sind rar. Hinweise auf das Leben von Scharfrichtern und über ihren Lebensumkreis sind fast nur in anderem Kontext zu finden. Wer mehr über Lebenszusammenhang und Milieu der Menschen, die dort lebten, wissen will, muss sich ihnen aus wechselnder Perspektive nähern. An erster Stelle steht die Frage nach den Aufgabenbereichen der Scharfrichter, die in den Bestallungen genannt werden, die hochnotpeinlichen Aufgaben als Mittel der Justiz zum einen und zum anderen die Abdeckerei. In diesen Bestallungen wird auch die Vergütung geregelt. Daneben gab es noch weitere Verdienstmöglichkeiten; diese Nebenverdienste bleiben in den Bestallungsdokumenten unerwähnt. Im Lauf der Jahrhunderte haben die Aufgabenbereiche unterschiedliches Gewicht; den Ursachen wird nachzugehen sein. Zum zweiten soll das Image dieses Berufszweigs, die öffentliche Meinung, interessieren. Sie war zwiespältig; die Gründe dafür liegen scheinbar auf der Hand, doch ist das frühere Rechtsdenken dem unseren fremd und wir schließen zu kurz, wenn wir unsere Maßstäbe anlegen. In Prozessakten treten die dem Recht damals zugrundeliegenden Vorstellungen entgegen. Punktuell erlebt man da Scharfrichter in Aktion. Dann lässt sich ahnen, wie Scharfrichter, aber auch ihre Helfer oder Knechte, Halbmeister und Abdecker, eingeschätzt wurden. Die Beurteilung durch die Zeitgenossen wandelte sich allmählich; ein Konfliktpotential wird sichtbar. Und drittens: Wie sahen Scharfrichter und ihre Knechte sich selbst und die Welt? Ihre Lebensspuren finden sich in Eintragungen in Kirchen- und Amtsbüchern, sie geben sowohl Aufschluss über das Selbstverständnis und über den persönlichen Umkreis der Angehörigen dieser Berufe, wie über ihre Möglichkeiten, zu Geld zu kommen. Aus ihren eigenen Gesuchen wie aus Beschwerden über sie sind Schlüsse auf ihr Auftreten und ihre Intentionen zu ziehen. Diese drei Fragenkomplexe sind nicht voneinander zu trennen, deshalb werden Leben und Wirken der Scharfrichter durch die Jahrhunderte verfolgt - und immer, wenn einer dieser Aspekte in den Vordergrund tritt, weil er die Gemüter bewegte, wird ihm nachgegangen. Zunächst ist der Scharfrichter nur als verlängerter Arm der Obrigkeit recht zu verstehen, für die er die Urteile ausführte und in deren Auftrag er peinliche Verhöre vornahm, d. h. folterte. Wie entwickelte sich dieses Tätigkeitsfeld? Sieht man einmal davon ab, dass punktuell auf dem flachen Lande bis ins 15. Jahrhundert Recht von den Betroffenen selbst geahndet wurde, also Diebe vom Bestohlenen gehängt und Mörder 3 So nach den Aktcn (5. Anm. 1). Später erzählte man, Dombrowsky sei auf dem Marktplatz von Wolfenbüttel hingerichtet worden; dazu StA WF VI Hs 15 Nr. 80! 1 (handschriftliche Aufzeichnungen von Heinz-Bruno Krieger).
36 Scharfrichter und Abdecker 39 von der Verwandtschaft des Ermordeten gerichtet wurden, so oblag es im niederdeutschen Raum und vor allem im ländlichen Bereich zunächst Fronboten, die als Gerichtsdiener der Obrigkeit Nachrichten überbrachten, auch in deren Namen Hinrichtungen durchzuführen, wie der Sachsenspiegel es schon in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts belegt. Um dieselbe Zeit begegnen auch erste Scharfrichter in norddeutschen Städten, allen voran in Braunschweig. Schon früher waren solche in süddeutschen Reichsstädten eingestellt, die vom Kaiser die Freiheit der BlutgeriChtsbarkeit erhalten hatten. 4 In der Residenz Wolfenbüttel wird dieser Berufszweig sporadisch seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert fassbar. Von einem Scharfrichter in Wolfenbüttel hören wir zum ersten Mal im Tagebuch des Hildesheimers Henning Brandis. Dieser schildert, wie Doktor Stauffme1 im Juli 1499 vom Herzog in Neubrück aus dem Bett gezerrt und gebunden nach Wolfenbüttel gefahren wurde, um dort vom Henker, den man aus Braunschweig geholt hatte, nach brutaler Folter und Verhör (gantz jamerliken plagen unde vragen) hingerichtet zu werdens. Prozessakten begann man erst vor der Mitte des 16. Jahrhundert zu führen. In späterer Zeit erlauben sie Rückschlüsse auf Tätigkeit und Arbeitsanfall des Scharfrichters. Ihre Stellung lässt sich zunächst nur über die Urteilsfindung ergründen. Das Rechtsverständnis jener Zeit gerät in den Blick; uns treten fremde Formen von Glauben und Aberglauben entgegen, die die Urteile nachhaltig beeinflussten. Darüber hinaus werden die Techniken der damals üblichen Befragung, das inquisitorische Vorgehen mit Nötigung und Folter, und die verschiedenen Formen der Bestrafung deutlich. Der Sachsenspiegel hielt im 14. Jahrhundert fest, dass Diebe zu hängen, Totschläger, Diebe von Pflügen und Diebe in Mühlen, in Kirchen oder auf Kirchhöfen zu rädern (radebraken) und aufs Rad zu binden, Brandstifter mit dem Schwert zu richten 4 Albrecht KELLER, Scharfrichter in der deutschen Kulturgeschichte. liildesheim 1921 (I'achdruck 1968) nennt Beispiele aus dem 15. und 16. Jahrhundert, etwa aus Dithmarschen 1417 (S. 49 f.), Thüringen 1470 (S. 60), u. ö. - Büttel, Henker, Scharfrichter werden 1321 (1341/42) in Braunschweig zuerst genannt; dazu Urkundenhuch der Stadt Braunschweig Bd. 1: Statuten und Rechtsbriefe , hg. von Ludwig HAENsELMANN. Braunschweig 1873, S. 29 I'r wird in Augsburg ein erster Scharfrichter erwähnt; in der Folge begegnen sie in anderen Städten, dazu Andreas DEUTSCH, Die Henker - Außenseiter von Berufs wegen? Leipziger Juristische Vorträge 50. Leipzig 2001, S. 8-12, wo er einen Zusammenhang zwischen der Aufzeichnung des Augsburgcr Stadtrechts von 1276 und dem ebenfalls in Augsburg aufgezeichneten Schwabenspiegel von 1275 sieht. In Norddeutschland erscheint die Entwicklung verzögert, ehd. S Gisela Wn.BERTz, Scharfrichter und Abdecker. Aspekte ihrer Sozialgeschichte vom 13. bis zum 16. Jahrhundert, in: Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft, hg. von Bemd-Ulrich HERGEMÖLLER. Warendorf 1994 (2. Aufl.), S Zu Braunschweig s. Otto SCnÜTIE, Scharfrichter in Braunschweig, in: Festschrift für Paul Zimmermann, Wolfenbüttel 1914, S Allgemein: Heinz-Bruno KRIEGER, Von Pflichten und Künsten der alten Scharfrichter im Lande Braunschweig, in: Braunschweigische Heimat 38, 1952, S ; 75-78; ; ebd. 39, 1953, S ; 49-52; Viele Details, die Krieger mitteilt, sind nicht überprüfhar oder unstimmig. - Nebeneinnahmen, deren Wurzeln im allgemeinen Aberglauben beruhten, werden nicht berücksichtigt; viel dazu KRIEGER, Pflichten (wie oben) 38, S : Scharfrichter als Zauberer. S Zu dieser ersten bekannten Hinrichtung "vor Wolfenbüttel": Henning Brandis Diarium, hg. Ludwig HAENSELMANN. Hildesheim 1896; S. 155 f., auch Bruno KRUSCH, Der Eintritt gelehrter Räthe in die Braunschweigische Staatsverwaltung und der Hochverrath des Dr. jur. Stauffmei, in: Zs. des historischen Vereins für Nds. Jg. 1891, S , v. a. S. 75 f.
37 40 Gesine Schwarz waren, ebenso wie Friedensbrecher und Verräter, Mörder, Räuber und alle, die Frauen oder Mägde vergewaltigt hatten. Zauberer, "Hexen", Giftmischer galten als Verbündete des Teufels und waren als solche zu verbrennen 6 Diese althergebrachten Regeln galten mit gewissen Abwandlungen viele Jahrhunderte hindurch; bei der Ausführung dieser Strafen waren Scharfrichter nötig. Es bedurfte bis zu der Neuordnung der Rechtsprechung im 19. Jahrhundert vieler Schritte, die zu einem völlig veränderten Rcchtsdcnken führten und es vorbereiteten. Sie werden aus dem Scharfrichteralltag, den wir verfolgen wollen, hier und da erkennbar. Scharfrichter im 16. Jahrhundert Erste Protokolle von "peinlichen Halsgerichten" im Land Braunschweig liegen seit 1535 vor. In Seesen ging es da um einen Pferdedieb aus dem Halberstädtischen, der mit dem Schwert gerichtet wurde. Der Name des Scharfrichters wird nicht genannt. Fünf Jahre später wurde in Schöningen ebenfalls über einen Pferdedieb zu Gericht gesessen, der die Tat im hildesheimischen Algerrnissen begangen und in Velpke gefasst worden war. Man beschloss diesmal, von den Schöffenstühlen in Magdeburg und Leipzig Rat einzuholen 7 Ausführlich ist von einem Scharfrichter in Wolfenbüttel 1537 zu hören, als dem Lübecker Bürgermeister Jürgen Wullenweber das Urteil auf dem Tollenstein unweit der Residenz gesprochen wurde R Dieses weithin berühmte Urteil führt beispielhaft die wichtige Rolle der Scharfrichter bei der Urteilsfindung vor. Der Prozess wird deshalb nach dem Protokoll des kaiserlichen Notars Warnecke skizziert. Es ist überschrieben: "Wer Menschenblut vergeust, deßen Blut soll wiederum vergossen werden." Damit wird einem alten und gewichtigen Rechtsgrundsatz Ausdruck gegeben, dass Gleiches mit Gleichem zu vergelten sei; dass, wie man es ausdrückte, die Tat in der Strafe gespiegelt sein sollte 9 6 Zu den Strafarten im Sachsenspiegel s. DEUTSCH, Henker (wie Anm. 4), S. 8. Deutsch folgt Keller bei der Darstellung des Übergangs von der privaten zur obrigkeitlichen Wahrnehmung des Rechts, mit der die Einstellung von Scharfrichtern einherging: KELLER, Scharfrichter (wie Anm. 4) passim. 7 Seesen: StA WF 2 Alt fol. lr-8v; Schöningen: StA WF 2 Alt Der Tollenstein ist unweit der Kreuzung der Straße von Goslar nach Braunschweig mit der alten Ost West-Handelsstraße nördlich der Burg und späteren Festung Wolfenbüttcl zu suchen, und lag vermutlich da, wo sich auch heute noch das Gasthaus "Zum Zollen" befindet. An diesem Platz wurde schon im 16. Jahrhundert kein Zoll mehr erhoben. Unweit davon lag der Garthof, wo Herzog Julius nach 1584 seinen Lustgarten einrichten ließ und später die Auguststadt entstand. Er ist mehrfach als Platz von l.andgerichten genannt; dazu s. u. zur Verurteilung 1575 der Sömmeringbande. Er war 1583 Gerichtsstätte des Landgerichts Beddingen, dazu Friedrich TIIÖNE, Wolfenbüttel unter Herzog Julius ( ). Topographie und Baugeschiehte, in: Bs./b. 33, 1952, S (P 1). - Voges hat den Tollenstein am Damm unweit des Lessinghauses vermutet; s. Theodor VOGES, Der Tollenstein, die Richtstätte Jürgen Wullenwevers zu Wolfenbüttel, in: Braunschweigisches Magazin 35, 1929, Sp Die Richtstätte vermutet Voges zurecht beim Garthof vorm Milhlenthor, wo auch die Sömmering-Bande zu Tode kam, also unweit vom Tollenstein (Zum Zollen). 9 Dieses Taliunsprinzip "Auge um Auge... " wurde bei Femegericht oder Blutrache der Verwandten vom Geschädigten bereits befolgt, als die Bestrafung der Täter noch eine Privatangelegenheit war. Dazu s. Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte Bd. 5, 1998, Sp s. v. Taliun. -
38 Scharfrichter und Abdecker 41 Worum ging es in diesem Prozess? Der Angeklagte Wullenweber war in den dreißiger Jahren Rädelsführer der ersten protestantischen Bürgerbewegung in der Hansestadt und erschien damit der alten Führungsschicht verdächtig, weil er den Patriziern die Führung streitig gemacht und ihre Interessen verraten hatte. Er musste fliehen, wurde vom Bremer Bischof gefangen genommen und von diesem seinem Bruder, dem Wolfenbütteler Herzog Heinrich d. J. und der Justiz ausgeliefert. So kam es, dass ihm das Urteil in Wolfenbüttel gesprochen wurde. Im Verlauf der Landsgerichtssitzung war es Hans Steyr, der dem Wunsch des Richters folgte und die Umstehenden fragte, wer das Urteil fällen solle. Einhellig war die Meinung, dass dies dem Scharfrichter obliege, der auch das Urteil ausführen müsse. Daraufhin wird Hans Steyr vom Richter als Meister, der damals allgemeinen Anrede an den Scharfrichter, angesprochen und gebeten, das Strafmaß zu bestimmen - genauer noch, als "Meister Hans aus Gilzum" (= Gi/sen). Seine Herkunft aus dem Dorf Gilzum rund 15 km östlich von Wolfenbüttellässt die Vermutung zu, dass er kontinuierlich als Scharfrichter im nächsten Umkreis von Wolfenbüttel oder Braunschweig tätig war. Voller Selbstbewusstsein nahm Hans aus Gilzum sein Amt wahr und verkündete dem Richter und Täter, den Beisitzern und Vertretern der Stadt Lübeck und der Volksmenge Art und Weise der Hinrichtung, die er für angemessen hielt: so ick ehme dat ordel finden schall, so will ick ehme heruth jöhren, ehm in veer dehlen und leggen ehn up veer Rade und richten ehn twischen Hemmel und Erden, dat he daßen nicht mehr dohe, und ein andern daran gedenke. 10 Zweierlei erfahren wir daraus: 1. Der Scharfrichter war in seinem Amt allgemein, vom Volk, Richter, Beisitzern und Täter, anerkannt. Nicht er sondern der Täter war ehrlos und stand tief in der Achtung aller Anwesenden. 2. Meister Hans Steyr empfahl die denkbar härteste und entehrende Strafe für die zur Last gelegten Vergehen - vielfältigen Verrat an der Stadt Lübeck, an Kaiser und Reich, Aufwiegelung und gezielte Irreführung -, und begründete seinen Spruch damit, dass die Strafe abschrecken und moralische Wirkung zeitigen solle. Ein weiterer Scharfrichter begegnet uns erst dreißig Jahre später, 1568/69, in Wolfenbüttel und zwar zunächst als Zeuge in einem Prozess. Zwei Landsknechtsfrauen wurden darin der Hexerei verdächtigt. Marlten, der Scharfrichter, hatte im Vorbeigehen zum Mann der älteren gemeint, er werde sie verbrennen, wenn der ihm dafür ein Stübchen Bier ausschenke. Das heißt soviel, dass er ihr zauberische Machenschaften zutraute, sie für eine Hexe hielt. Andere Aussagen verdichteten diesen Verdacht gegen die Frau. ll Hier nach den Abschriften im StA WF VII C Hs I06 fo!. 43v-48v (auch: StA WF IV Hs 54, S.80-95). 10 "Wenn ich das Urteil finden soll, so will ich ihn <aus dem gehegten Gericht> herausführen, ihn vierteilen und ihn auf vier Räder legen und ihn zwischen Himmel und Erde richten, damit er das nicht mehr tue und andern zur Warnung". Dazu auch KELLER (wie Anm. 4), S. 65 f. 11 Der Prozess: StA WF 2 Alt In der vergangenen Generation waren in Wolfenbüttcl die herzogliche Kanzlei und 1548 eine erste Kanzleiordnung entstanden, die die Rechtsprechung regelte.
39 42 Gesine Schwarz Sie kam nämlich von weither aus dem Halberstädtischen und war einst mit einem Schäferknecht verheiratet gewesen, was Vertrautheit mit dem Übernatürlichen nahelegte, denn Schäfer kannten sich besser als andere in der Natur und mit Himmelszeichen aus, so meinte man, und wurden den unehrlichen Leuten zugerechnet 12 Auch weitere Zeugen bezichtigten die Frau der allgegenwärtigen Zauberei: Hatte sie nicht Wasser ohne einen Eimer holen können oder nach Kräutern für Eierkuchen gesucht? Ein kleines Kind wurde sogleich ruhig, als sie es auf den Ann nahm. Tortur oder Folter, der übliche Weg, aus verstockten Verdächtigen ein Geständnis zu entlocken, bewirkten nichts. Sie und ihre angebliche Komplizin leugneten hartnäckig, Teufelsbuhlinnen zu sein und zaubern zu können, was sie vorm sicheren Tod bewahrte. Das Urteil lautete schließlich für die ältere auf Landesverweis. Mehr als ein loses Mundwerk war ihr nicht nachzusagen; die jüngere ging ohne Strafe aus 13 Unser Meister Martten war sicher identisch mit Martin Greger, dem wir 1570 auch als Abdecker des Amts Wolfenbüttel begegnen. Ihm wurde damals das Scharfrichter-Privileg bestätigt, das erstmals 1565 ausgestellt worden war; und schon 1561 für das Amt Seesen galt 14 Der dritte Scharfrichter in Wolfenbüttel, den wir kennen lernen, ist Meister Georg Fröling (= Fröhlich). Er erhielt 1574 vom Herzog seine Bestallung; es ist die erste bekannte im Fürstentum. Ihm wurde die Meisterci in Gandersheim zugewiesen, von wo aus er für Dörfer, Städte und Ämter im weiteren Umkreis zuständig sein sollte wie vor ihm Meister Martin, dem wir bereits in den sechziger Jahren in Wolfenbüttel begegnet sind. Dies ist ein Hinweis darauf, dass spätestens seit 1574 mehrere Scharfrichter für klar umgrenzte Regionen des Fürstentums auf ihre Aufgaben verpflichtet waren. Außerdem wurden Fröling die Städte Alfeld, Holzminden, Stadtoldendorf und die Ämter im Gebiet zwischen Leine und Weser überantwortet. Fröling wurde 1574 auch angewiesen, Mantel oder Umhang am linken Arm mit Galgen und Rad zu zeichnen. Diesc\ben Zeichen sollte er an seinem Haus in Gandersheim anbringen (Abb. 1), er und sein Umfeld also für jedermann erkennbar sein. Das war bereits 1414 im nahen Braunschweig nicht anders - und ebenso noch 1584, als man dort den Scharfrichter anwies, das Ratswappen gut sichtbar auf dem rechten Ärmel zu tragen. Diesem gestand die Stadt auch einen seidenen Umhang und Hut mit Feder zu. Abgrenzung gegenüber der Bevölkerung steht neben der Anerkennung sei- 1556/57, als das Hofgericht eingesetzt wurde, folgte die erste Hofgerichtsordnung. Prozesse sollten von da ab schriftlich festgehalten werden. Der Sohn Heinrichs d.j., Herzog Julius ( ),legte wie sein Vater Gewicht auf die Befolgung der ersten allgemein gültigen Strafprozessordnung Kaiser Karls V., die Carolina (= CCC) von 1532, und ließ die Hofgerichtsordnung modifizieren. Teils wurde in der "Ratsstube" der Kanzlei, und teils vorm Hofgericht verhandelt. - Dazu Wilhelm HERsE, Die ersten Jahrzehnte des Braunschweig-Wolfenhüttclschen Hofgerichts, in: Werner SPIESS, Beiträge zur Geschichte des Gerichtswesens im Lande Braunschweig. Braunschweig 1954, S. 1-10, v.a. S. 3 f. 12 Werner DANcKERT, Unehrliche Leute. Die verfemten Berufe. Bern/ München 1963, S Parallclüberlieferung im Hauptstaatsarchiv Hannover; s. Gerhard SCIIORMANN, Hexenprozesse in Nordwcstdcutschland. Hildesheim 1977, S. 130 f. 14 Für zahlreiche Bestallungen von Scharfrichtern s. StA WF 2 Alt 2266 passim (Martin Greger fol. 41r). Dazu auch Gisela WILBERTZ, Scharfrichter (wie Anm. 4), S. 138.
40 Scharfrichter undabdecker 43 Abb : Rad und Galgen unter dem Bestallungsrevers des Scharfrichters Fröling ner Funktion für die Obrigkeit. Das Verhältnis diesem Berufszweig gegenüber war also ambivalent 15. Die Bestallung des Scharfrichters Georg Fröling wurde kaum zufällig 1574 vom Herzog Julius in Wolfenbüttel vorgenommen, war doch dieser kurz zuvor unter den Einfluss des Sömmering und seiner Leute geraten, die ihm vorgegaukelt hatten, Gold fabrizieren zu können. Es war ihnen gelungen, den Herzog nach Strich und Faden auszunehmen 16. Anfang 1574 wurde offenkundig, dass er Hochstaplern und Betrügern aufgesessen war. Er schickte nach einem Scharfrichter von auswärts und zwar nach dem des Kurfürsten Johann Georg von Brandenburg. Der Herzog bat um diesen Scharfrichter für die "peinliche Befragung", also Folter, um so aus Sömmering und seinen Kumpanen Geständnisse zu erzwingen. Diesem Meister ging weit über Brandenburg hinaus ein Ruf als Inquisitor voraus, hatte er doch erst ein Jahr zuvor einen Betrüger überführt, der dem Kurfürsten nach dem Leben getrachtet hatte und sich 15 Georg Frölings Bestallung: StA WF 3 Alt 25 fol. 4r. - In Braunschweig sollte der Scharfrichter schon 1414 durch eine gelbe Kapuze kenntlich sein. Man erwartete 1584, dass ihm Achtung gezollt werde; dazu SCHÜTTE, Scharfrichter (wie Anm. 4), S Zum Verhältnis der Scharfrichter zur Gesellschaft s. Gisela WILBERTZ, Standesehre und Handwerkskunst, in: Archiv für Kulturgeschichte 54, 1976, S Das Problem verfolgt v. a. DEUTSCH, Außenseiter (wie Anm. 4), passim. 16 Nach A RHAMM, Die betrüglichen Goldmacher am Hofe des Herzogs Julius von Braunschweig. Wolfenbüttel 1883.
41 44 Gesine Schwarz dazu übernatürlicher Kräfte bedient hatte, wie man glaubte. Seine bloße Anwesenheit in Wolfenbüttel brachte die Angeklagten dazu, ihre Schuld eingestehen 17. Als der weithin beachtete Sömmering-Prozess Anfang Februar 1575 zu Ende geführt wurde, fanden letzte Verhandlung und Verurteilung im Beisein von Kanzler und Hofstaat, in Gegenwart des Landadels und der Geistlichkeit "auf dem Lusthause" vor Wolfenbüttel (= Garthof vor dem Mühlentor) statt. Der gerade zehn Jahre alte Herzogssohn Heinrich Julius, der 1589 Herzog werden würde, leitete sie ein. Die Urteile von den Schöffengerichten in Brandenburg und Magdeburg wurden öffentlich verlesen; die Todesstrafe war in allen denkbaren Varianten vorgesehen 18. Wir erfahren nicht, wer sie ausführte, ob Meister Martin Greger, der schon 1565 und bis in die siebziger Jahre in Wolfenbüttel begegnet, oder ein Scharfrichter von außerhalb, denn im Fürstentum Wolfenbüttcl waren damals bereits mehrere tätig. Und es sollten noch mehr werden. Wenn in den folgenden Jahrzehnten keine Scharfrichter mit Namen begegnen, so wird doch ihr Wirken aus vollzogenen Urteilen wie den Urteilssprüchen des Magdeburger Schöffenstuhls aus den Jahren 1574 bis 1589 greifbar 19 Auf Anfrage erteilte dieses überregionale Gericht lokalen Instanzen Hilfe bei besonderen Fällen. Dem empfohlenen Urteil war jedes Mal eine Zusammenfassung des Falles vorangestellt. Gewicht wurde allgemein darauf gelegt, dass die Täter während des Landgerichts "frey, ledig und ungebunden" die Tat noch einmal gestanden. Die vorangehenden Maßnahmen zur Tatermittlung, Tortur oder Zeugenaussagen, fielen weniger ins Gewicht als das Schuldgeständnis des Täters als ungebundener Mann vor Gericht. In diesen Jahren wurden folgende Strafen empfohlen: 5x Tod durch Hängen bei Diebstahl, z. B. von Pferden; 17 Er hatte 1573 ein Geständnis vom Zauberer erzwungen, der den verstorbenen Kurfürsten bestohlen und vergiftet hatte; in Wolfenhüttcl hlieh er nur kurz; dazu StA WF 1 Alt 9 Nr. 307 fol. 215r. Er erhielt kurfürstliches Geleit bis Calvörde, um ihn vor anderen Scharfrichtern zu schützen, wo er Leuten des Wolfenbüttcler Herzogs überantwortet wurde; nach Ende seines Geschafts von diesen Geleitschutz bis Tangermünde. Im Anschreiben des Brandenburger Kurfürsten heißt es anerkennend über ihn (fol. 222r):... der wirtt... dem Pfaffenn wissen, die Weihe abzunehmenn... '" Die Bürgermeister der Kkinstädte waren zugegen, Braunschweig hatte nur Vertreter geschickt; dazu RHAMM, Goldmacher (wie Anm. 16), Anm. 113 auf S Die fünf Hauptangeklagten wurden wegen vielfacher Verbrechen verurteilt und - wie die Carolina vorschrieb - drei Tage darauf vorm Mühlentor hingerichtet. Jeder der Sömmeringhande wurde mehrfach verurteilt: Das Urteil enthielt 13x Landesverweis wegen Betrugs, versuchten Diebstahls, Zauberei, Verbalinjurien gegen den Herzog, Unzucht, zauberischer Speise, Kindsmord, 6x Tod durchs das Schwert wegen Mords, Fhebruehs, falschem Zeugnis, 5x Tod durch Rädern / aufs Rad binden wegen Giftmischerei, Mord, Raub, Doppelbestallung, 4x Tod durch Verbrennen wegen Giftmischerei, 2x durch den Strang wegen Diebstahl, 2x Zangenreißcn; nach RHAMM, Goldmacher (wie Anm. 16), Anm. 118 auf S. 100 f. 19 Die Neuordnung des Gerichtswesens während der Regierung Herzogs Julius, die Befolgung der Prozessordnung der Carolina, der das Römische Recht zugrunde lag, und auch die Rechtsgutachten von der Juristischen Fakultät der 1576 gegründeten Universität Helmstedt, die in 114 Konzeptbänden überliefert sind, betrafen - so scheint es - vor allem Formalien. "ach wie vor wurde althergebrachtem Recht gefolgt. Zu der vielfältigen Stellungnahme zu Zauherei und Hexenglauben der Theologischen, Juristischen und Medizinischen Fakultäten der Universität Hclmstedt: Claudia KAUERTZ, Wissenschaft und Hexenglaube. Die Diskussion des Zauber- und Hexenwesens an der Universität Hclmstedt ( ). Bielefeld 2001.
42 Scharfrichter und Abdecker 45 4x durchs Schwert; und zwar wegen Straßenraubs in zwei Fällen, je einmal bei Totschlag und bei vielfach wiederholter Unzucht und Ehebruch; 4x Geldstrafen; nämlich bei erfolglosem Pferdediebstahl, bei Verdacht auf versuchte, jedoch geleugnete Vergewaltigung, bei unerlaubter Eheschließung außerhalb des Fürstentums und bei versuchtem, aber missglücktem Totschlag. 3x ewige Landesausweisung mit oder ohne Staupenschlag; bei einem Wilddieb, bei einer Kupplerin, die abtrieb und Kindsmord vertuschte, sich auch Strick und andere Zaubermittel vom Galgen beschaffte, und bei "einem jungen Jesuiten", der als Schatzgräber auftrat, weissagte und es wagte, Wasser zu weihen. 2x Rädern; Kirchenraub und vorsätzlicher Mord mit Raub und versuchtem Vertuschen der Untat waren den Tätern nachgewiesen. In vier Fällen, in denen kein Urteil vorgeschlagen sondern rückgefragt wurde, ging es um zwei Nahrungsdiebstähle, und einen dritten Diebstahl, bei dem Stücke aus der herzoglichen Silberkammer verschwunden waren, und schließlich um eine Frau, die sich der Zauberei verdächtig gemacht hatte, als sie in der Walpurgisnacht im Fluss badete. Schöffenstühle wie der in Magdeburg folgten bei der Beurteilung der Straffälle altem Herkommen. Die Aufzählung zeigt, dass Urteile und Urteilsfindung sich im Rahmen des aus dem Sachsenspiegel Bekanntt:n bewegten 2o Diese Fälle vermitteln einen Überblick über Delikte und Strafmaß in jener Zeit und damit über das Aufgabenfeld des Wolfenbütteler Scharfrichters. Bei der Ermittlung mit Hilfe von Folter wie der Ahndung aller dieser Straftaten war er immer gefragt. Abdecker im 16. Jahrhundert In Gregers wie Frölings Bestallung wird auch die zweite hoheitliche Aufgabe erwähnt, die Scharfrichter neben der Ausübung der peinlichen Gerichtsbarkeit zu erfüllen hatten, nämlich das Abdecken von verendetem Vieh. Seit wann es diese Verbindung zwischen dem Beruf des Scharfrichters und des Abdeckers gab, ist nicht sicher auszumachen 21 Bereits in den frühesten Erwähnungen weisen Abdecker darauf hin, dass schon Vater, Onkel, Großvater dieser Aufgabe "seit alters" nachgingen. Die Abdecker erscheinen eng mit den Ämtern des Landesherrn verknüpft. Sie waren vielleicht bereits am Werk, bevor Scharfrichter eingestellt waren. Schon in der ersten bekannten Bestallung eines Scharfrichters wird diesem die Aufsicht über Abdeckereien in mehreren Ämtern und Städten der Umgebung seiner Scharfrichterei zugewiesen. In späteren wurden Abdecker oder auch Scharfrichter verpflichtet, alljährlich den 20 StA WF 2 Alt Meist richtete der Propst von Wöltingerode und Oberlandes fiskal Garße diese Anfragen an das Schöffengericht. Als Oberlandcsfiskal nahm er zunächst landesherrliche fiskalische Interessen wahr, er entwickelte sich bald zum amtlichen Ankläger in Kriminalsachen; so Gerhard SCHORMANN, Strafrechtspflege in Braunschweig-Wolfenbüuel , in: Bmunschweigisches Jahrbuch 55, 1974, S , bes. S Zu dieser Entwicklung s. WILBERTZ, Scharfrichter (wie Anm. 4), S
43 46 Gesine Schwarz Amtsleuten Handschuhe zu liefern - neben der praktischen Bedeutung ein Zeichen ihrer Unterordnung. 22 In den kommenden bei den Jahrzehnten begegnen wir Fröling immer wieder, weil Abdecker sich über ihn beschwerten. 23 Er lebte im calenbergischen Bockenern, wo er schon vor 1574 Scharfrichter gewesen war - und nicht in Gandersheim. Nachdem er nun auch in die Scharfrichterei in Gandersheim unter sich hatte, versuchte er, die Abdeckereien um Gandersheim nach seinem Gutdünken zu besetzen. In Gandersheim selbst lebte schon vor 1574 Georg Greger als Abdecker. Er trug nicht zufällig den gleichen Zunamen wie der Scharfrichter in Wolfenbüttel, Martin Greger. Georg Greger beschwerte sich 1577 darüber, dass Fröling ihn aus seiner Abdeckerei treiben wolle, um dort seinen eigenen Schwager unterzubringen. Es half Georg Greger freilich nichts, er musste sich fügen. Fröling nahm nur sein Recht wahr. Im selben Jahr beschwerte sich auch der Abdecker in Seesen, Hermen Sachse (auch: Sasse) über Fröling, er wolle ihn aus den Abdeckereien der Stadt Seesen und der Ämter Stauffenburg und BilderIahe drängen und andere damit berechtigen. Diese seien jedoch seiner Frau Catharina als Witwe des Meisters Martin (Greger), des verstorbenen Scharfrichters von Wolfenbüttel und Seesen, und deren beider Sohn Asmus auf Lebenszeit verschrieben. Ähnliche Klagen richteten auch die Nachfolger von Greger und Sachse bis 1594 an den Herzog. Dabei beriefen sich verschiedene Kläger darauf, dass schon Vater und Großvater - meist in zwei oder drei Ämtern - tätig gewesen waren. In diesen Beschwerden wurde Fröling auch allerhand nachgesagt; so habe er ein Mädchen, seine ehemalige Geliebte gezwungen bei ihm zu bleiben, obgleich sie sich einem anderen versprochen hatte; oder er sei als Scharfrichter ungeschickt und brutal, weshalb ihm 1584 Herzog Julius die Abdeckerei im Amt Wicken sen abnahm und dem Scharfrichter auf der Erichsburg zuwies. Aber im Grunde half es alles nichts. Fröling war 1574 als Scharfrichter auch mit der Abdeckereigerechtsame der Region versehen worden und also auch Vorgesetzter aller Abdecker in diesem Gebiet in seiner Bestallung hieß es, dass ihm im Amt Wohldenberg, Stadt und Amt Gandersheim, in den Gerichten, Städten, Flecken und Dörfern BilderIahe, Stauffenburg, Winzenburg, Greene, Alfeld, Wickensen, Fürstenberg, Holzminden, Hohenbüchen, Forst, Ottenstein die Scharfrichterei wie auch die Abdeckerei übertragen werde. An ihm als Vornehmstem unter den Abdeckern sei es, die Nebenabdecker in ihre Schindereien einzuweisen und Gebühren von ihnen einzuziehen. Für die Abdecker-Gerechtsame hatte er 30 Taler und jede 20. Haut von den abgedeckten Tieren sowie 100 Pfund Pferde- und Kuhhaare im Jahr an den Herzog abzuführen. Aus 20 Fellen ungeborner Kälber solle er für den Herzog Pergament gerben 22 Berent SCHWINEKÖPER. Der Handschuh im Recht. Ämterwesen. Brauch, Volksglauhcn. Sigmanngen 1981 (Nachdr. der Diss. von 1938), S (Lehnsvcrhältnis). Handschuhe vom Abdekker / Scharfrichter: 1623 (Peine) StA WF 2 Alt 2266 fol. 32 r/v; 1643 (WolfcnbiIUcl): StA WF 50 Neu 2 Woltb /1732 (Vorsfcldc) StA WF 10 Alt Gr. Twülpst 44 (Nr. 25: 12. Okt. 1719; 1732); 1753 (Stadtoldcndorf) StA WF 2 Alt 12360; 1833 ein Reichstaler als Handschuhgeld (Amt Lichtenberg): StA WF 34 N Nr. 2675; u. Ö. 23 Beschwerden des Gcorg Grcgcr: StA WF 2 Alt 12347, des Hermen Sachse: StA WF 2 Alt fol. Ir-Sr. Scharfrichter mit Namen Sachse sind von Hessen bis Holzmindo:n und Wittingo:n Kr. Gifuom zu finden; s. GLENZDORF / TRFICHEL, Henker (wie Anm. 19) Bd. 2, S. 91 f.
44 Scharfrichter und Abdecker 47 lassen und alle 14 Tage am Sonnabend mit den herzoglichen Amtsleuten auf einem Kerbholz Rechnung über alle Tierhäute von verendetem Vieh legen. Georg Frölings Aufgabenbereich tritt uns klar entgegen. Aus den Beschwerden der Abdecker, die ihm unterstellt waren, wird deutlich, dass diese neue Regelung nicht unangefochten war. Herzog Heinrich Julius bestätigte Fröling 1589 in seinen Rechten. Ihm folgte sein Sohn Adam Frölich. Als der 1616 starb, ging die Gerechtsame in diesem Gebiet an den Wolfenbütteler Scharfrichter Dietrich Fahner. Sie wurde 1626 auch seinem Nachfolger bestätigt, der Fahners Witwe geheiratet hatte. Die Regelung, dass Scharfrichter als Vorgesetzte der Abdecker fungierten, war allgemein üblich. So wurde der Wolfenbütteler Scharfrichter Urban Fritze, als Herzog Heinrich Julius ihn 1590 in Wolfenbüttcl einsetzte, auch für die Ämter Wolfenbüttel, Schöningen und Seesen als Scharfrichter wie Vorgesetzter der Abdecker zuständig und erhielt beide Funktionen 1603 für Stadt und Amt Peine 24 Registratur der Straftaten 1568 bis 1633 Als Herzog Heinrich Julius 1589 die Regierung übernahm, setzte er sogleich neben Ratsstube und Kanzlei, in denen Urteile gesprochen wurden, ein neues, das peinliche Gericht und einen Gerichtssekretär dafür ein und bestallte 1590 einen neuen Scharfrichter, Urban Fritze. Der Gerichtssekretär ürtlep wurde vom Herzog beauftragt, alle Urteile, auch die der Kanzlei, zu katalogisieren. Er nahm sich seiner Aufgabe ab 1597 gründlich an und erfasste Straftaten und Urteile ab ob alle ist nicht klar - und bis 1633, dem Todesjahr des Sohnes und Nachfolgers von Heinrich Julius. Aber nur die Angaben aus der Regierungszeit des Heinrich Julius und bis etwa 1620 erscheinen vollständig und erlauben Einblick in die Strafpraxis seiner Zeit ( )25. Mit dem Regierungsantritt von Herzog Heinrich Julius 1589 stiegen die Zahlen steil an. Wenn angenommen wird, dass im ersten Jahrzehnt von Heinrich Julius Regierungszeit die Todesstrafe sehr viel häufiger verhängt wurde als zuvor, so ist das vor allem mit den Sammelprozessen zu erklären, die er zu Beginn seiner Herrschaft gegen alle der Zauberei Angeklagten im Fürstentum machte. Nach dem Tod Erichs gehörte auch das Fürstentum Calenberg-Göttingen zu Wolfenbüttel, das damit so groß wie nie zuvor geworden war. Aus allen Regionen wurden die der Hexerei oder Zauberei Angeklagten zur Hinrichtung nach Wolfenbüttel gebracht. Sie hinterließen nachhaltig Eindruck und prägten das Bild des von Aberglauben und Hexenwahn be- 24 Zur Bestallung des Urban Fritzc 1590 s. StA WF 2 Alt fol. 2r-3r (Abschrift); zu seiner Einsetzung in Peine s. Anm SCHORMANN, Strafrechtspnege (wie Anm. 20) passim. Vor 1589 wirkt die Aufstellung des Ortlep unvollständig, mit Beginn des Dreißigjährigen Krieg schwer nachvollziehbar. So verzeichnet Ortlep für das Schicksalsjahr 1627, als die Festung über Monate von dem kaiserlichen General Pappenheim belagert und schließlich eingenommen wurde, keine Gerichtsakten mit Urteilen, so SCHORMANN (wie oben) S Die zeitgenössischen bildlichen Zeugnisse zum Hinrichtungsplatz am nordwestlichen Ende des Lechlumer Holzes sind zusammengestellt bei Wilhclm BORNsTEDT, Das Herzogliche»Hohe Gericht" im Stöckheimer Streithorn am LecheIn Holze vom 16. bis zum 19. Jahrhundert (Diebstahl, Mord, Raub und Hexenverbrennung). Braunschweig 1982.
45 48 Gesine Schwarz I : :' -- ~ \. Abb : Am Lechlumer Holz und an der Richtstätte vorbei ziehen herzogliche Fähnlein gen Braunschweig (StA WF K Ausschnitt) sessenen Fürsten, das bis heute nachwirkt (Abb. 2). Zugleich war Heinrich Julius ein guter Jurist und an der Rechtsprechung nach römischem Recht sehr interessiert. 26 Ein zweiter Anstieg fast aller Delikte vor Gericht ist im zweiten Jahrzehnt von Heinrich Julius Regierungszeit zu greifen ( ), bei Diebstahl zusammen mit Wilddiebereien und Raub, bei Mord und Totschlag sowie Sittlichkeitsdelikten und Kindsmord. Man schiebt diese überbordende Kriminalität auf den anhaltenden Konflikt mit der Stadt Braunschweig, denn 1605, im Jahr der härtesten Gegensätze, stiegen die Zahlen wiederum drastisch an. In diesem Jahr wurden 45 Diebstähle; 57mal Mord! Totschlag und 45 Sittlichkeitsverbrechen erfasst. 26 Dazu z. B. Albert RHAMM, Hexenglaube und Hexenprocesse, vornämlich in den braunschweigischen Landen. Wolfenbüttel 1882, S. 76; auch Richard FRIEDENTHAL, Herzog Heinrich Julius von Braunschweig als Dramatiker (1922), hg. und mit einem Nachwort versehen von Gerd Biegel. Braunschweig 1996, S. 24. Beide zitieren Rehtmeyer (Chron. S. 1099) als Gewährsmann, dass der Galgenberg vorm Lechlumer Holz damals mit den vielen Brandpfählen einem kleinen Wald gleichgesehen haben soll; G. Schormann kommt zum Ergebnis, dass dieser Eindruck der Korrektur bedarf; s. SCHORMANN, Hexenprozesse (wie Anm. 13) S. 53.
46 Scharfrichter und Abdecker 49 Die folgende Tabelle fasst die Straffälle in Zehnjahresschritten bis 1633 zusammen. 15R Mord/ Totschlag Diebstahl Wilddiebstahl Raub Kirchenraub Sittlichkeits delikte Kindsmord Zauberei 1588/ :10 Verbalinjurien mehrere Delikte Summe: Vor Wolfenbüttclcr Gerichten verhandelte Stmffälle (zusammengestellt nach Schormann, Strafrechtspflege, S. 97 f.) Diese zeitgenössische Datenerhebung gibt nicht preis, weiche Urteile in den registrierten Fällen gesprochen wurde. Statistisch aufgeschlüsselt lassen diese Fälle von Jahrzehnt zu Jahrzehnt im Umgang mit den Delikten und in der Beurteilung Veränderungen erkennen. In den beiden Jahrzehnten von Heinrich Julius Herrschaft unterschieden sich die Urteile deutlich, wie die folgende Tabelle zcigt: in den Jahren in den Jahren Geahndete Verbrechen ca. 385 ca. 760 zusammen Todesstrafe 84% 25% Landesverweis 10% 45% Geldstrafe 6% 30% Ergangene Urteile (zusammengestellt nach Schormann, Strafrechtspflege, S )
47 50 Gesine Schwarz Statt der Todesstrafe überwogen im zweiten Jahrzehnt Landesverweis und zeitweilig auch Geldstrafen. Schon seit 1598 wurden Landesverweis, um 1605 Geldstrafen bevorzugt 27 Wenn in die ersten Regierungsjahre des Herzogs die Bestallung des Urban Fritze und die Einrichtung der neuen Seharfrichterei auf dem Juliusdamm fallen, so war dies kaum ein Zufall. Urban Fritze übte von 1590 an 15 Jahre bis zu seinem Tod 1605 seinen Beruf aus. Es ist kaum vorstellbar, dass er allein alle Geständnisse erzwang und Urteile ausführte, die den Tod der Verurteilten oder Landesverweis vorsahen, dem Brandmarken, Stäupen, Pranger, Karrenziehen, Ausklingen oder -streichen voranging. In Seesen wurde gerade in diesem Jahrzehnt, in Schöningen im folgenden die Scharfrichterei eingerichtet. Eine Frage, die uns besonders interessiert, ist die nach dem Milieu der Täter. Es ist nur aus Prozessakten zu erschließen. Aus den Jahren 1596 und 1597 zeigen einige Protokolle von Prozessen, dass Derbheit im Umgangston, Kränkungen und beleidigende Wortwechsel schnell zu Tätlichkeiten führten, auf die Mord und Totschlag folgen konnten. Drei Beispiele sollen genügen: 1. Im Mai 1596 wurde ein Schäferknecht nach einem Totschlag mit dem Schwert hingerichtet. Aus der Zeugenbefragung ist der Tathergang zu rekonstruieren: Er hatte einen Bauern umgebracht, der ihm einen Schelm und Dieb geschimpft hatte, weil er seine Schafe über das Feld des Bauern getrieben hatte. Dieser wurde dann auch handgreiflich, und wollte ihn vom Feld jagen. Der Knecht wehrte sich daraufhin und schlug ihm mit seinem Schäferstab beim ersten Hieb den Hut vom Kopf. Es blieb nicht dabei; als der Bauer die Flucht ergriff, traf er ihn noch zweimal auf den Kopf und einmal am Rücken. Der Bauer starb an den Folgen. 2. Ausführlicher wird im folgenden Jahr geschildert, wie auf einer Hochzeit in Apelnstedt der spätere Angeklagte erschienen war und sich als Verwandter der Braut an den Tisch der Geladenen und nicht zu den Knechten gesetzt hatte, was einen anderen Knecht störte. Am folgenden Abend behielt dieser eine Magd, mit der er zuvor getanzt hatte, bei sich und wurde ausfallend, als der andere kam, um sie zum Tanz zu bitten. Der Pastor und der Sohn des Vogts griffen ein, als sich daraus eine Rauferei entwickelte. Der Kontrahent war sehr wütend und lief wutschnaubend hinter ihnen her, als der Pastor mit dem anderen weggehen wollte. Er wurde wiederum ausfallend, worauf der Angeklagte ihm das Messer in die Brust stieß. Er war zu Tode erschrokken, als er begriff, dass er seinen Rivalen getötet hatte. Diese Totschläge fanden auf dem Lande statt; heide Täter wurden zum Tod durchs Schwert verurteilt. Bevor sie handgreiflich wurden, hatten ihre Kontrahenten sie beschimpft, angegriffen, bis aufs Blut gereizt. Die Taten waren also in Affekt begangen worden. Das Urteil orientierte sich - anders als in der modernen Rechtsprechung - ausschließlich am Sachverhalt der Tötung. Nicht geglückter Totschlag wurde viel gnädiger geahndet. 27 Die Einnahmen dienten dazu, anstelle der alten Marienkapcllc in der Wolfenbütteler Heinrichstadt eine protestantische Kirche zu erbauen, die dem Vergleich mit den gotischen Hallenkirchen in Braunschweig standhielt. Dazu SCIIORMANN, Strafrechtspflege (wie Anm. 20) S. 100 f. - Auch der Wolfenbüttel er Scharfrichter Urban hitze (t 1605) begünstigte in seinem Vermächtnis die Marienkirche; dazu Landeskirchliches Archiv Wolfcnbüttel (=im folgenden LKA WF) V 169.
48 Scharfrichter und Abdecker Auch in Wolfenbüttel in nächster Nähe des Hofes folgten Straftaten häufig auf Hänseleien, wie ein dritter Prozess aus derselben Zeit belegt. Zeuge war diesmal ein Bettler, der den folgenden Wortwechsel zwischen Spielleuten und einem Schneider angeblich am Tisch des Herzogs verfolgt hatte, was der Richter ihm kaum glauben wollte. Der Schneider sei von den Spielleuten seiner kurzen und krummen Füße wegen gehänselt worden - ein klassischer Fall, war doch die sitzende Haltung der Schneider allgemein Ziel der Spottlust. Sie hätten ihm auch nicht zugestanden, Fleisch aus der Schüssel zu nehmen, worauf er wütend geworden sei und sie aufgefordert habe, mit ihm vor die Tür zu gehen. Dort erstach er den einen, den zweiten verwundete er tödlich. Unklar blieb, ob er dabei aus Notwehr gehandelt hatte. Ein Urteil ist nicht überliefert. Doch ist wohl der Schneider nur mit dem Leben davon gekommen, weil der Richter dazu neigte, den Bettler nicht als Zeugen zu akzeptieren 28 Neue Scharfrichtereien ab 1589 In den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts wurden einige Scharfrichtereien neu eingerichtet; und damit auch die Zuständigkeiten über die Abdeckereien neu geregelt: - In Seesen wird 1589 der Scharfrichter Claus Gürttler bestallt wurde Urban Fritze, der Scharfrichter Herzogs Heinrich Julius in Wolfenbüttel, auf Ratsbeschluss der Stadt auch in Amt und Stadt Peine Scharfrichter und zuständig für die Abdeckerei, die schon 1543 dem Hildesheimer Scharfrichter, Meister Simon, auf Ersuchen bei der Stadt Hildesheim übertragen gewesen war. Fritzes Nachfolger im Stadt und Amt Peine wurde sein zweiter Sohn Hans, der auch die Abdeckerei-Gerechtsame im Amt Steuerwald erhielt 3o - In Schöningen begegnet 1610 noch Meister Dietrich, also vermutlich der Wolfenbütteler Scharfrichter Dietrich Fahner; 1627 wird Hans Cammermann erwähnt, der seit zwölf Jahren hier Dienst tat. Er war also seit 1615 hier tätig und hätte das Amt gern erblich erhalten. Die Gerechtigkeit wurde aber erst 1643 Christoph Förster für 300 Taler erbeigentümlich erteilt. Sie erstreckte sich über die Ämter Jerxheim, Vogtsdahlum und die Klöster, Komtureien, Adelssitze und Städte des Gebietes beschwerte Förster sich, dass der Helmstedter Meister in seine Rechte eingreife, wenn er im Kloster Marienthai bestimme, wer dort die Abdeckerei betreiben solle 3l wird aus Holzminden berichtet, dass der Scharfrichter dort davongelaufen sei; man bittet zugleich, wegen der Abdeckerei Hilfe zu schaffen 32 '" Alle diese Prozesse sind überliefert in StA WF 2 Alt StA WF 2 Alt fo!. 25r-26v; Scharfrichter dieses Namens sind aus Worbis, Hannoversch Münden, Göttingen und Duderstadt bezeugt; s. Johann GLENZDORF, Fritz TREICHEL, Henker, Schinder und arme Sünder. Bad Münder 1970, Bd. I, S StA WF 2 Alt 2266 fo!. 2Sr-v. - Scharfrichter mit Namen Fritze sind v. a. aus Magdchurg und Wolfenbüttel bekannt; s. GLENZDORF / TREICHEL, Henker (wie Anm. 29) S StA WF 2 Alt fo!. 36r-43r; dazu Karl ROSE, Nachrichter in Schöningen, in: BsJb. 42, 1961, S StA WF 2 Alt foi.23r-24r.
49 52 Gesine Schwarz 1666 werden die Nachrichter Leue und Nikolaus Fahnert aus der Scharfrichterei in Vorsfeide erwähnt, die angeblich seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert die von Bartensleben unterhielten. Sie waren auch für die Abdeckerei auf den Gütern Groß Twülpstedt und Groß Sisbeck zuständig, und hatten dafür fünf Taler im Jahr Gebühren zu zahlen 33. Beschwerden von Abdeckern gingen laufend aus den verschiedenen Regionen des Fürstentums ein. Fassbar wird auch, dass man regelmäßig nicht dem Herzog unterstehende Scharfrichter aus Orten außer halb des Fürstentums heranzog, die auch die Abdeckerei zu organisieren hatten, wie seinerzeit schon Georg Fröling aus Bockenem. Die Abdeckereien gingen also an Schinder, die auswärtigen Scharfrichtern unterstellt waren: - In den Ämtern Liebenburg, Vienenburg (damals zu Wolfenbüttel gehörig) und Harzburg sollte ab 1606 nach dem Tod des zuständigen Wolfenbütteler Scharfrichters der Goslarer Nachrichter Dienst tun, und damit den Meister in Wolfenbüttcl entlasten wurde Langelsheim der Scharfrichterei in Goslar unterstellt, was schon 1667 durch Vergleich zwischen den Scharfrichtern Krause aus Goslar und Förster aus Seesen neu geregelt wurde, nun sollte sie letzterem zustehen erhielten der Scharfrichter aus dem magdeburgischen Neuhaldensleben, Jacob Kohlstedt, und sein Sohn Jürgen "Scharfrichterdienst und Canillerey" im wolfenbüttelschen Amt Calvörde übertragen. Die Abdeckerei nahmen dort zehn Jahre darauf der Sohn zusammen mit seinem Schwiegervater Andreas Bühr wahr, denn Jacob Kohlstedt war inzwischen auch Scharfrichter in Nordhausen. Die Schinderei in Calvörde hätte ihnen gern der Meister in Gardelegen und Magdeburg streitig gemacht Im wolfenbüttelschen Amt Bahrdorf hatte der Scharfrichter in Oebisfelde einen Halbmeister aus dem nahen magdeburgischen Wcfcrlingen mit der Abdeckerei beauftragt, worüber sich 1655 der Wolfenbütteler Scharfrichter beschwerte, weil Bahrdorf schon seinem Vorgänger verschrieben gewesen war; damit nehme der Herzog "mich und meine armen Stiffkinder... gleichsam das Brodt vor dem Munde hinweg"3? Es gab also auch in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts mehr Abdeckereien als Scharfrichtercien im Land Braunschweig - und die Landesgrenzen hinderten nicht, auswärtige Scharfrichter heranzuziehen, wenn es Not tat. 33 StA WF 10 Alt Gr. Twülpst. 44 (Nr. 25: 17. Aug. 1766; 30. Okt. 1677; 8. Sept. 1688) 34 StA WF 2 Alt fol. 5r. 35 StA WF 8 Alt Se 16 Nr. 1 fol. 6r-7v. 36 StA WF 2 Alt fol. 13r-16r. - Die Geschichte der Scharfrichterei und Abdeckerei dort hat Klaus Wolff erschöpfend dargestellt; Klaus WOLFF, Braunschweigische Medizinalgeschichte(n). Von Medicis, Badern und Apotheckern, von Hebammen, Scharffrichtern und andern, item von Rescripten, Ordnungen und Verfügungen im Herzogthum, in specie im Ambte Calvörde, das 18. und 19. Jahrhundert betr.. Eilsieben 2004, S ebd. fol. 4r-9v.
50 Scharfrichter und Abdecker '1.:".~. \'. - ".1,. ".~ "., "., I ' ~'.~\ " ",:\ ~'~'.,, 'I" ~ -,-'" \. '\." ". :l: J. Abb : Elias Holwein. Umgebung von Wolfenbüttel. (1) Richtstätte am Tollenstein (1537/1575). - Eingetragen sind (A) Anwesen der Scharfrichter auf dem luliusdamm, und die Richtstätten (2) am Lechumer Holz, (3) an der Straße nach Linden, (4) an der Straße nach Ahlum (StA WF K7 Ausschnitt) Scharfrichter in Wolfenbüttel bis 1675 Es war Urban Fritze, der 1590 von Herzog Heinrich Julius als neuer Scharfrichter in Wolfenbüttel eingesetzt wurde. Zugleich wurde ihm Haus und Hof "auf dem Juliusdamm" abseits von Festung und der Wolfenbütteler Heinrichsstadt zugewiesen, was ihn wie die Abdeckerei ausgrenzte. Früher hatte hier, flussabwärts der Residenz, wo die alte Straße zwischen Magdeburg und Minden die Oker querte, ein Lohgerber sein Handwerk ausgeübt StA WF 2 Alt fol. 2r-3r (Abschrift der Bestallung des Urban Fritze 1590); Auf den J u I i u s da rn m gleich östlich der Oker führt der westlich gelegene Juliusweg zu. Zur Zeit des Herzogs Julius ( ) verlief dort der von Minden nach Magdeburg führende Fernverkehrsweg; so THÖNE, Wolfenbüttel (wie Anm. 8) S. 23, S. 45 u. Ö. - Allgemein wohnten Scharfrichter zunächst inden
51 54 Gesine Schwarz Urban Fritze war 1590 noch für die Ämter Wolfenbüttel, Schöningen und Seesen als Scharfrichter und vorgesetzter Abdecker eingesetzt. Das sollte nicht mehr lange so bleiben, begegnet doch schon 1589 in Seesen ein eigener Scharfrichter. Als 1643 David Fuchs als Scharfrichter von Herzog August dj. eingesetzt wurde, war sein Hoheitsbereich nur mehr auf die Ämter Wolfenbüttel, Lichtenberg, Harzburg und Neubrück mit den Klöstern und Komtureien (also Riddagshausen, Steterburg, Lutter, Lucklum) sowie auf die adeligen Sitze Sambleben, Brunsrode und einige Städte, nämlich die Wolfenbütteler Heinrichsstadt, Schöppenstedt und Königslutter beschränkt. In Seesen wie Schöningen waren inzwischen neue Scharfrichtereien eingerichtet, denen die Abdeckereien in den Ämtern der Umgebung unterstanden. Peine wird 1643 ebenfalls nicht mehr erwähnt. Fritze wurden 1590 als jährliche Vergütung abgesehen von Haus und Hof 24 Scheffel Hafer neben zwei Pferden, drei Scheffeln Roggen und vier Scheffeln Gerste auch Mastschweine und ein Rind zugesichert. Für jeden Dclinquenten, dem er "Recht fertigte", sollte er einen Taler, für die Anklage einen Gulden erhalten. Daneben erwartete man, dass er Vögten und Schreibern in allen herzoglichen Ämtern, wo er für die Abdeckerei zuständig war, zweimal im Jahr ein Paar Sommer- und ein Paar Wintcrhandschuhe stellte, eine Forderung mit ebenso praktischer wie symbolträchtiger Bedeutung. Ob Urban Fritze seit 1590 die vielen Urteile vollzog, die damals gefällt wurden, ist kaum in Erfahrung zu bringen: Er hätte dann alle Hände voll zu tun gehabt. Der Nachfolger ab 1605, Dietrich Fahner, erhielt die Stellung nur auf Zeit, denn die Scharfrichter-Gerechtsame war erblich. Nur solange die Söhne Fritze minderjährig waren, konnte er das Amt ausüben, bis einer der Sohn sechzehn und damit erwachsen wurde und im Amt geübt genug war, um es auszufüllen. Fahner war Sohn des Scharfrichters in Wernigerode, woher vermutlich auch Urban Fritze gekommen war, und dessen Vetter 39 Von den drei unmündigen Söhne des Fritze starb dcr älteste bald, der mittlere wurde Nachfolger des Vaters in Peine und Steuerwald. Fahner suchte 1614 nach, Fritzes rechtmäßiger Nachfolger zu werden. Dem wurde nicht stattgegegeben, obwohl der jüngste Sohn des Fritze nicht imstande war, als Scharfrichter zu arbeiten. J9 Städten, jedoch verlegte man ihre Wohnung in der Regel bald an den Stadtrand; dazu DEUTSCH, Außenseiter (wie Anm. 4) S In Braunschweig lag die Scharfrichterei bis 1403 in der Echtemstraße unweit dcs Aitstadtmarktes; danach bis 1756 in der Mauemstraße, dazu Karl STEINACKER, Von Galgen, Pranger und Nachrichter(n) Braunschweigs, in: Braunschweigische Heimat 24,1933, S In bei den Straßen lebten auch die Dirnen der Stadt, die der Braunschweiger Scharfrichter zu beaufsichtigen hatte; dazu Hilmar VON STROMBECK, Leibzeichen und das rothe Kloster in Braunschweig, in: Zs. des historischen Vereins für Nds. 1860, S In Lünehurg befand sich das Scharfrichter Haus unweit des Marktes, das Gefangnis in seinem Keller; dazu: W. REIN ECKE, Das Scharfrichteramt in Lüneburg, in: Lüneburger Blätter 1, 1950, S Familiäre Beziehungen des Fahner(t): Nicolaus Fahner(t) 1660 in Königslutter; sein Sohn Hans Christoph t 1740 (Grabstein im Krcuzgangs dcs Doms), 1764 Hans Martin F. "Frciknecht" in Königslutter; nach StA WF V1 Hs 15 Nr. 80/1 (Heinz-Bruno Krieger); 1686/1688 ist ein Nikolaus Fahnert Scharfrichter in Vorsfelde; so StA WF 10 Alt Gr. Twillpst. 44 (Nr. 25). Scharfrichter mit Namen Fahner waren v. a. in Thüringen und bis nach Flensburg zu finden, s. GLENZ DORF / TREICHEL, Henker (wie Anm. 29) S erhan Fritze hatte sein Vermögen in Wemigerode angelegt und vermachte die Gewinne von 500 Gulden der Marienkirche in Wolfenbüttd, die bei seinem Tod gerade im Bau war; dazu LandeskirchI. Archiv (LKA) V 169.
52 Scharfrichter und Abdecker 55 Nach Fahners Tod gingen 1617 die Rechte zunächst auf diesen über. Aber schon 1618 erhielt Hans Günther die Stelle in Wolfenbüttel. Er kam aus Goslar und war wie Fahner mit der Familie Fritze verwandt 4o War kein Sohn vorhanden, so gelangte der Nachfolger in vielen Fällen an die Meisterei, indem er die Witwe des Vorgängers heiratete, was in späteren Bestallungen ausdrücklich vorgesehen und geregelt wird. So machte es auch der Nachfolger des Hans Günther, der sein Sohn oder Bruder war. Esaias Günther heiratete Fahners Witwe und legte damit den Grund für seine Karriere als Scharfrichter in Wolfenbüttel und in weiten Teilen des Fürstentums. Diese IIeiratspolitik war allgemein üblich, nicht anders als im städtischen Zunftwesen. So erklärt es sich, dass Scharfrichter weit über die Region hinaus mit Berufskollegen und deren Familien verwandt waren und Umgang miteinander pflegten. Mit Mitgliedern der ehrlichen Zünfte kamen sie weniger in Berührung, auch wenn Begegnungen aus der Sache heraus notwendig waren 41 Klarer als in der ersten Bestallung von 1590 werden alle Aufgaben des Scharfrichters genannt, als Herzog August d. J. kurz vor Ende des Dreißigjährigen Krieges 1643 David Fuchs zum Scharfrichter in Wolfenbüttel ernannte 42 Er hatte dieses Amt seit 1638 für die Stadt Braunschweig wahrgenommen. In seiner Bestallung ist das Verhältnis zwischen dem Herzog und ihm klar geregelt. David Fuchs hatte wie seine Nachfolger auf dem Juliusdamm dem Herzog für sein Amt eine einmalige Zahlung von 1000 Talern zu leisten und damit erkaufte so die erbliche Scharfrichter-Gerechtigkeit. Er sollte für die Ämter Wolfenbüttel, Lichtenberg, Harzburg in südlichen Teil des Fürstentums, und im Norden des Elms für die Ämter Königslutter, Bahrdorf, Neuhaus und Neubrück zuständig sein. In See sen und Schöningen waren bereits zuvor eigene Scharfrichtereien eingerichtet worden. Auch diese wurden 1643 neu vergeben. Mit dem von Herzog August d. J bestallten David Fuchs (oder Voß) aus Braunschweig gelangte ein anderer Familienkreis in die Wolfenbütteler Meisterei. Fuchs Bestallung bringt deutlich zum Ausdruck, dass das Amt zur Wahrung des 40 Esaias Günther hob hervor. dass er ein Vetter des Urban Fritze iun. sei. Scharfrichter mit Namen Günther waren weit verbreitet zwischen lbüringen, Basel, an der Weser; s. GLENZDORF / TREICHEL, Henker (wie Anm. 29) S. 375 f. Gleichnamige Scharfrichter waren auch entlang der Weser und im Schaumburger Land im 18. Jahrhundert nachzuweisen; s. WILBERTZ, Scharfrichter (wie Anm. 4) Index s. v. Günther. 4' Beispiele für eine starke Ausgrenzung finden sich bei DF.UTSCH, Henker (wie Anm. 4) S. 34; sie stammen übewiegend aus Süddeutschland. WILBHTZ, Scharfrichter (wie Anm. 4) S konnte dagegen zeigen, dass in Nordwestdeutschland die Hemmschwelle nicht so hoch war; es mag kaum anders im Fürstentum Wolfenbüttel zugegangen sein. 42 StA WF 50 Neu 2 Wolfb Nr. 314 (27. November 1782). Zu David Fuchs in Braunschweig s. Werner SPIESS, Die Gerichtsverfassung der Stadt Braunschweig zur Hansezcit (his 1671), in: ders., Beiträge (wie Anm. 11) S , v.a. S. 77. Zu Scharfrichtern mit Namen Fuchs s. GLENZDORF I TREICHEL, Henker (wie Anm. 29) S Der in Seesen hestallte Halbmeister Förster hatte im selben Jahr 200 Gulden für die Gerechtsame (s. StA WF 2 Alt 12354), der in Schöningen 300 Gulden zu zahlen (s. StA WF 2 Alt fol. 43r); 1685 waren für die Gerechtsame in Braunschweig vom Nachrichter Johann Christoph Pfeffer 1400 Gulden zu leisten: StA WF 2 Alt fol. 3r-v. - Auch die Scharfrichterfamilie Fuchs, oder Voß, ist weitverbreitet, s. WILBERTZ, Scharfrichter (wie Anm. 4), Index s. v. Fuchs/ Voß. Dasselbe gilt für die bereits um 1630 in Bremen nachweisbare Familie Adam. Dazu ebd., Index s. v. Adam.
53 56 Gesine Schwarz Rechts notwendig war, der Scharfrichter also verlängerter Arm der Herrschaft war und als solcher Ansehen genoss. Es heißt da:... bevorab aber, wann er an ein ander Amt oder Ort zu Examinir- und lustificirung der armen Sünder und Uebelthäter gefordert und verordnet wird, Er sich also dann in aller Discretion in der Totur (sic) und Hinausführung zu der Gerichtsstatt gegen dieselbige nach Beschaffenheit der begengen delictorum bezeigen und den Uebelthätern aus Gottes Wort, mit einen tröstlichen Worte mit zusprechen sothan, also daß er es gegen Gott im Himmel, uns und in seinen eigenen Gewißen wol verantworten kan. Drei Instanzen werden genannt, denen der Meister folgen sollte, wenn er die Verurteilten zur Hinrichtung begleitete: Gott, dem Landesherrn und seinem eigenen GewIssen. Aus der Bestallung des Jahres 1643 erfahren wir, dass in der Zwischenzeit die alte Scharfrichterei abgebrannt war, vermutlich, als die in der Festung Wolfenbüttel liegenden dänischen Soldaten in der Nacht vom 26. auf den 27. Juni 1627 zahlreiche Dörfer und zwei Klöster anzündeten, um dem heranrückenden kaiserlichen Heerhaufen unter dem Oberbefehl des Generals Pappenheim die Versorgung während der Belagerung der Festung zu erschweren. Der Scharfrichter Esaias Günther, seit 1620 im Amt, besaß in Groß Stöckheim, dem nächstgelegenen Dorf jenseits der Oker, einen Kothof und etwas Land, hat aber wohl kaum dort gelebt. Auch dieser Hof war wüst, als er ihn in den dreißiger Jahren der Kirche in Groß Stöckheim überließ 4 3. Nun wies Herzog August d. J. seinem Nachfolger David Fuchs (oder Voß) 1643 also wieder den Ort am Juliusdamm an, wo sich einst schon sein Vorgänger Urban Fritze eingerichtet hatte. David Fuchs solle die Scharfrichter-Gerechtsame erhalten und die Scharfrichterei auf eigene Kosten wieder errichten, hieß es. Das tat Fuchs umgehend, im Januar 1645 wurde auf dem Juliusdamm ein Sohn von ihm getauft 44. Dieser abgelegene Ort außerhalb der Stadt ist von da ab bis ins 19. Jahrhundert kontinuierlich Mittelpunkt des Lebens der Wolfenbütteler Scharfrichter und ihrer Helfer geblieben. Schon fünf Jahre später, am 15. August 1648, starb David Fuchs und wurde "christlich zu Erde bestättigct". Die Kirchenbücher der Wolfcnbütteler Trinitatiskirche verzeichnen seither regelmäßig, wenn David Fuchs und seine Nachfolger eines ihrer vielen Kinder taufen oder begraben ließen, oder wenn der Nachrichter eine zweite oder dritte Ehe schloss, was meist in dem einsamen Gehöft auf dem Juliusdamm stattfand. David Fuchs Nachfolger wurde der noch nicht zwanzigjährige Hans Adam, denn Fuchs Söhne waren noch lange nicht volljährig. Er nahm die Witwe Fuchs zur Frau, um an die 43 Dazu SCHWARZ, Groß Stöckheim, (wie Anm. 81) S und S Ein Esaias Günther, vermutlich verwandt mit dem ersten, wird 1643 als Halbmeister und Abdecker für die Ämter Seesen und Staufenberg bestätigt; dazu StA WF 2 Alt fol. lr-2v. 44 Zur Taufe StA WF 1 Kb 1344, S Das Okerufer hinterm Scharfrichtergehöft ist 1694/95 erneut befestigt worden; dazu StA WF 8 Alt Wolfb. Nr. 476; rund zehn Jahre später entstand die jetzige Scharfrichterci (heute: Grünlandweg 6 t).
54 Scharfrichter und Abdecker 57 Scharfrichterei zu gelangen und als diese 1654 starb, hat er ein zweites Mal und später noch ein drittes Mal geheiratet 45. Die Inhaber der Wolfenbütte1er Scharfrichterei ab 1590 waren: Urban Fritze sen (f) Dietrich Fahner ab 1605-? und Vertreter für unmündigen Urban Fritze iun. - bis 1618 (f) Sohn des U. Fritze sen. und unfähig die SR zu führen Hans Günther bewirbt sich als Verwandter Esaias Günther (?) Vetter von Urban Fritze iun. David Fuchs/ Voß sen Bestallung Hz. Augusts Hans Adam (f) heiratet 1. Witwe des David Fuchs; 2. T des SRs in Münden; 3. Ilsabe Förster, Schwester des SRs in See sen Johann Heinrich ält. Sohn des David Fuchs Fuchs/Voß David Fuchs/ Voß iun. 1678/1679 jg. Sohn von Fuchs, Bruder wird SR in Hildesheim Christoph Adam Adam 1680/1681 (f) wohl verwandt mit H. Adam Hans Martin Kannenberg heiratet heiratet am 21. Feb.l682; 1. Witwe Chr. A. Adams 5 Töchter in der ersten, (t 1699), 2 in der 2. Ehe 2. Maria Hillebrand August Andreas (t Feb. 1740) verh. mit Hedwig Erfurter; Kannenberg keine Erben Johann Conrad Matthias (t 19. Jan. heiratet Witwe Kannendurch selbst ausgelösten berg Schuss) Hans Martin Matthias interimistisch zuvor SR in Diepholz und Schwiegervater der Witwe Johann Jacob Dietrich? (f) Bruder von verh. mit Johann Sophie Matthias Johann C. M., SR in Schö- Strasburger, T des tsr aus ningen, Sohn des Hans Bögen, Sachsen Martin Matthias 45 StA WF 1 Kb 1344 (S. Trinitatis Wolfenbüttel) S Weitere Angaben aus dem Kirchenbuch: ebd. S. 212,S. 216,S. 222,5. 272,S. 275.
55 58 Gesine Schwarz Johann Christian Matthias interimistisch Bruder des Johann Jacob D. M., SR in Königslutter Johann Friedrich Holdorf Sohn des SRs in Halberstadt; heiratet Tochter des Johann J. Chr. Matthias in Wolfenbüttel J ohann Christoph Conrad ältester Sohn von J ohann Holdorf F. Holdorf, verh. mit Johanne Christiane Fedisch Carl Eduard Holdorf (t) jüngerer Bruder des Joh. Chr. C. Holdorf Der Jäger Waldemeyer aus Thanhof, Kgr. Württemberg, heiratet 1838 die Witwe Holdorf (geb. Fedisch) und arbeitet als Abdecker. Seine erste Frau hatte David Fuchs zwei Söhne und dann auch Hans Adam zwei Kinder geboren. Adams folgenden zwei Ehen entstammten weitere acht Kinder. Von den fünfen aus Hans Adams Ehe mit einer Tochter des Scharfrichters in Münden starben vier und seine zweite Frau gleichzeitig mit dem letzten 16664(;. Auch seine dritte Frau, Ilsabe Förster aus Seesen, kam aus einer Scharfrichterfamilie. Vater und Brüder waren Scharfrichter, resp. Halbmeister in verschiedenen Meistereien des Braunschweiger Landes. Von ihren drei Kindern überlebte keines die ersten Lebensjahre. Nach Adams Tod wechselten die Meister auf dem Juliusdamm rasch. Beide Söhne seines Vorgängers Fuchs wurden nur für kurze Zeit Scharfrichter in Wolfenbüttel. Der ältere übernahm 1678 die Scharfrichterei in Hildesheim; der jüngere zog es vor, in der Nachrichterei in Schöningen zu bleiben, wo er die Witwe seines Vorgängers geheiratet hatte 47 Schmutzige Aufgaben In David Fuchs Bestallung wird neben den Aufgaben der peinlichen Gerichtsbarkeit die Abdeckerei und noch eine weitere Verpflichtung genannt, die in früheren Bestallungen noch nicht erwähnt wurde. Er sollte nämlich seine Gehilfen aus allen Abdekkereien des Landes anleiten und beaufsichtigen, wenn sie in Wolfenbüttei die heimlichen Gemächer des Schlosses und der Kanzlei, die Kloaken und Kanäle der Stadt räumten und reinigten. Entsprechende Verpflichtungen enthält auch in die herzogli- 46 Adams Schwiegervater war der Scharfrichter Peter Albrecht in Münden; dazu StA WF 2 Alt fol. 7r-8r (8. Juni 1657). Von diesem ging das Anrecht an der Scharfrichterei in Kclbra und Herringen auf ihn über, das der Graf von Schwarzburg vergab. 47 David Fuchs/ Voß iun., 1645 geboren, hatte 1670 die Scharfrichterswitwe Förster in Schöningen geheiratet (dazu StA WF 1 Kb 1344 S. 275) und war dort zunächst Halbmeister. Er war nur kurz Nachrichter in Wolfenbüttcl und blieb in Schöningen, wo er 1705 starb, und Heinrich Christoph Förster, der Sohn seines Vorgängers übernahm die Schöninger Nachrichterei; dazu ROSE, Schöningen (wie Anm. 31) S
56 Scharfrichter und Abdecker 59 che Bestallung des Nachrichters Förster in Schöningen aus dem seibern Jahr4 8 Für die herzoglichen Amtshaushalte waren sie gleichfalls zuständig. In Wolfenbüttel sollten sie, solange sie mit diesen Arbeiten beschäftigt waren, von Bürgern mit Speisen und Getränken und vom Apotheker mit Mitteln gegen den üblen Geruch und Geschmack versorgt werden. Diese schmutzige Aufgabe oblag auch schon vor dem Dreißigjährigen Krieg dem Wolfenbütte1er Scharfrichter mit seinen Gehilfen und war bereits damals eine Quelle ständigen Streits und ständiger Unruhe. Auch dieser Verpflichtung kamen dic Meister nicht selbst nach, und ihre Helfer fanden sich zu dieser widerlichen Arbeit ebenfalls nur höchst ungern bereit. Dietrich Fahner, zwischen 1605 und 1617 Scharfrichter in Wolfenbüttel, fiel 1617 negativ auf, weil er den Knechten in ihrer vorsetzlichen und augenscheinlichen Faulheit allerdings zu siehet, wodurch dann der hochnothige Ockerstrom, so sonderlich zu Aussauberung der Canale abgelassen und deshalb an noch mit großem Schaden unnd Gefahr ufgehalten wirf/wo Ihm wurde eine Strafe bis 100 Goldgulden und seinen Abdeckergehilfen Gefängnis angedroht, damit sie diese Arbeiten zügig fortführten. Jahr um Jahr ergingen Aufforderungen an den Scharfrichter, die Halbmeister und Abdecker aus den Schindereien der herzoglichen Ämter und der Städte im Fürstentum anzufordern, damit sie diese degradierenden Arbeiten ausführten. Alle Scharfrichter im Lande wurden ersucht, sich einzufinden und die Abdecker aus ihrem Bereich nach Wolfenbüttel zu befehlen. Der Wolfenbütteler Scharfrichter war ihr Vorgesetzter und hatte diese Arbeit zu organisieren; er konnte diese Aufgabe nur durch Androhung von Strafen durchsetzen. Auch Hans Adam, der Nachfolger von David Fuchs, beschwerte sich, wie mühsam es war, die Knechte aus den auswärtigen Abdeckereien zu zwingen, Kloaken und Kanäle zu säubern 5o Sie arbeiteten nachts in Trupps von zwei bis zu zwölf, um den Unrat fortzuschaffen. Um so dringender war Adams Bitte an die Kammer, die Bezahlung dieser Knechte von auswärts nicht zu verzögern 51 Das war auch 1790 noch nicht anders. Über diese Gehilfen, die Halbmeister und Abdeckerknechte, ist weniger in Erfahrung zu bringen als über die Scharfrichter. Sie wurden beschäftigt, weil es dem Selbstverständnis des Scharfrichters nicht entsprach, sich persönlich mit diesen schmutzigen Arbeiten der Abdeckerei oder den diffamierenden Tätigkeiten, wie Prügeln oder Hängen von Verurteilten, zu befassen. Die anfallenden Aufgaben hätten die Arbeitskraft eines einzelnen überstiegen. In Kirchenbüchern stößt man von Zeit zu Zeit auf sie. So ließ 1649 ein Meisterknecht seinen Sohn taufen; Gevatter stand u. a. die Witwe Fuchs (Voß), die bald darauf Adam ehelichte. Einzelne kamen aus Scharfrichter- 48 ROSE, Schöningen (wie Anm. 31) S StA WF 2 Alt fol. 38r, v. '0 StA WF 2 Alt 12355, ebd. (Ermahnung an Fahner); fol. 28r (Ermahnung an Esaias Günther); fol. 69r, v (Beschwerde des Hans Adam). StA WF 8 Alt Gand 402 (herzogliche Aufforderung an Scharfrichter). " StA WF 4 Alt 19 Nr. 449 fol. 53r. Pro Nacht standen jcdem 9 Mariengroschen dafür zu.
57 60 Gesine Schwarz familien von weither. So heiratete hier 1660 der Sohn David des Scharfrichters Rekkewerk aus Stade, der damals Knecht in der Wolfenbütteler Meisterei war. In kleineren Ortschaften wie Königslutter waren meist nur Halbmeister tätig, die nicht das Richtschwert führen durften, und die vor allem die Abdeckerei betrieben. Die meisten stammten von Scharfrichtern ab, wie die Namen eindeutig belegen. Hans Adams "Tagebuch" 1656 bis 1672 Hans Adam notierte zwischen 1656 bis 1672 Leistungen, die er dem Herzog und der herzoglichen Kammer in Rechnung stellte, weil die Entlohnung oft lange auf sich warten ließ. Nach seinen Notizen konnte die ausstehende Bezahlung berechnet werden. Tortur und Hinrichtungen wurden wie eh und je Fall für Fall abgerechnet. Waren im 16. Jahrhundert dafür ein Taler und nicht mehr zu zahlen, so waren inzwischen für jede Leistung drei Gulden (= 1 Taler 24 gute Groschen) fällig, gleich ob es sich um leichte oder schwere Tortur, um die Wasserprobe oder um Hinrichtungen durchs Schwert handelte, oder um Strafen, die Ehre und Ansehen beschädigten, wie Hängen, Anschließen an den Pranger, Stäupen und schimpflichen Landesverweis, die der Bevölkerung ebenso hart erschienen sein mögen wie die Todesstrafen. Zwischen 1656 und 1672 hat Adam für Herzog und Gericht 200 Verrichtungen vorgenommen, ohne Lohn dafür zu erhalten. Es standen also 600 Gulden aus. Seine Dienste wurden meistens in Wolfenbüttel gebraucht; die bereits abgeurteilten Straftäter wurden zur Bestrafung nach Wolfenbüttel gebracht. Sie kamen aus Holzminden im Solling oder Marienthal nördlich des Elms, auch aus Vorsfelde ganz im Nordosten, aus Heimburg und Blankenburg im Südosten des Fürstentums, aus HasseIfeIde und Stiege im Harz, aus Königslutter und Warberg am Elm. Gelegentlich war Adam auch unterwegs, um seine Aufgaben wahrzunehmen. So reiste er 1660 auf Befehl des Herzogs ins Amt Wickensen im Solling, "wegen etzlicher Hexen, welche erstiich gebadet, darnach verbrandt worden". Der Amtmann verwies ihn danach an den Herzog, damit die Kammer die fälligen 33 rheinischen Gulden zahle. Ein anderes Mal erhielt Adam sein Geld vom Amtmann am Ort. Aus der Zeit zwischen 1655 und 1666 liegen vereinzelt auch Quittungen vom herzoglichen Landgerichtsprokurator, Heinrich Schwan ecke, vor, der den sog. peinlichen Landgerichten der Ämter im Umkreis der Residenz vorstand 52 Vergleicht man seine Quittungen mit den Notizen des Scharfrichters Adam, der die ergangenen Urteile zu vollstrecken hatte, so wird deutlich, dass Adam nicht alle den peinlichen Landgerichten vorausgehenden Folterungen, noch alle den Urteilen folgenden Bestrafungen im herzoglichen Residenzamt erfasst hatte. Einige seiner Leistungen waren also doch beglichen worden. Bis 1668 war das Wolfenbütteler Residenzamt Hans Adam die Bezahlung während vieler Jahre in der Regierungszeit des Herzogs August d. J. schuldig geblieben und als 52 Hans Adam s. StA WF 4 Alt 19 Nr Auch Schwanecke hielt ausstehende Zahlungen fest; je Gerichtssitzung erhielt er anderthalb Taler; dazu StA WF VI Hs 24 Nr. 10 Bb 1.
58 Scharfrichter und Abdecker 61 es nun ans Bezahlen ging, sollte Hans Adam sich noch gedulden. Damals standen rund 140 Taler aus. Adam beging den Fehler diese zu quittieren, bevor er das Geld in Händen hielt. Nun wurden sie ihm streitig gemacht. Diese Tatsache beunruhigte den alternden Scharfrichter in den folgenden Jahren immer mehr und er legte Wert darauf, dass seine Belege in chronologischer Reihenfolge abgeschrieben und notariell bestätigt wurden, als er schon auf dem Krankenbett lag. Adams Witwe stellte gleich nach seinem Tod Anfang Juni 1675 das Gesuch, man möge ihr diese Außenstände zahlen. Die vorliegenden Unterlagen stärkten ihre Position, auch wenn sie unterm Strich kaum 90 Taler erhielt. Was aber verzeichnete er? Adam hat notiert, wann er zur Tortur greifen musste, um Angeklagte zu überführen. Er nennt die Verbrechen, die die Angeklagten gestanden und auch regelmäßig die Strafe, mit der diese Delikte geahndet wurden, hat also gewissermaßen ein "Scharfrichter-Tagebuch" geführt, wie man sie auch andernorts kennt 53 Aus diesen Notizen wird erkennbar, welche Delikte Adam in den 18 Jahren als Scharfrichter zu ahnden hatte. Das Verbrechen, das Adam in seiner Amtszeit mit Abstand am schärfsten bestrafen musste, fand in seinem nächsten Umkreis statt. Die Frau seines Halbmeisters Peter Haferkamp in Königslutter hatte 1656 ihren Liebhaber dazu angestiftet, diesen umzubringen. Mit Witwe wie Liebhaber wurde kein langes Federlesens gemacht. Sie endeten Ende März 1657 in Wolfenbüttel durch schmähliche Strafen, die Adam danach nie wieder auszuführen hatte 54 Es lohnt, seine Angaben nach Geschlechtern getrennt zu betrachten, denn die meisten Delikte waren geschlechtsspezifisch und wiederholten sich auch regelmäßig. Männer mussten vielfach für Totschlag büßen, dem meist Streit vorausgegangen war, hatten Vieh-, meist Pferdediebstähle begangen oder auch wiederholt. Frauen wurden meist bezichtigt, hexen oder zaubern zu können, d. h. also Teufelsbuhlinnen zu sein, oder ihr Neugeborenes getötet zu haben. Auf Mord stand die Hinrichtung durchs Schwert, auf Viehdiebstahl der Tod durch den Strang, Kindsmord wurde wie seit alters mit Ertränken, auch im Sack, erwiesene Zauberei und Brandstiftung durch Verbrennen geahndet. Allerdings konnten von den sieben des Mordes an ihrem Neugeborenen angeklagten Frauen in diesen 18 Jahren drei nicht überführt werden; ebenso wurden von den elf der Zauberei und des Pakts mit dem Teufel Angeklagten fünf 53 Das älteste ist Maister Franntzn Schmidts Nachrichters inn Nürmberg all sein Richten. nach der Handschrift hg. von Albrecht KELI.ER, 1913 (Nachdruck Neustadt 1979, mit einer Einleitung von W. LEISER). Es umfasst die Zeit von 1573 bis 1615, in der Schmidt an 706 Menschen Strafen vollzog, 361 kamen durch ihn zu Tode, 345 wurden verstümmelt oder gezüchtigt. Der Nürnberger war nicht mit der Abdeckerei befasst, ebd. S. Xf. 54 Adam musste den Mörder. um ein Geständnis zu erzwingen. dreimal foltern. und ihn rädern. Diese Strafe war nur einmal im Jahr zuvor verhängt worden. Die Frau sollte er auf dem Weg zur Richtstätte dreimal mit glühenden Zangen greifen, und sie dann enränken; danach wurde auch sie aufs Rad gebunden; StA WF 4 Alt 19, Nr. 449 fol. Iv. - Gelegentlich ist zu erfahren. wie es in anderen Meistereien des Landes zuging: So musste 1667 die Tochter des Scharfrichters Meisner aus Gandersheim wegen Hurerei Kirchenouße tun. Der Valer ihres außerehelichen Kindes könnte ein Spielmann oder ein auswärtiger Scharfrichterssohn sein, teilte sie mit; dazu StA WF 8 Alt Gand wurde der letzte Sproß Matthias vierzehnjährig im Auftrag seines Stiefvaters umgebracht, der sich die Abdeckerei bei Königslutter sichern wollte; dazu StA WF VI Hs 15 Nr. 80/1 (H.-B. Krieger).
59 62 Gesine Schwarz nach Folter und Wasserprobe wieder auf freien Fuß gesetzt, weil sie standhaft leugneten. Gerade bei den Festnahmen dieser Frauen werden böser Leumund, nicht gerechtfertigte Denunziation vorangegangen sein. Die je vier des Diebstahls und der Unzucht überführten Frauen nehmen sich im Vergleich harmlos daneben aus; bis auf eine wurden sie alle des Landes verwiesen oder an den Pranger gestellt. Hans Adam hatte weit häufiger zu foltern als Urteile zu vollstrecken. In den ersten acht Jahren musste er laut seinen Aufzeichnungen 66mal dazu hinters Schloss kommen. Sechsmal war die Wasserprobe vorzunehmen. Wer nicht gestand, wurde wiederholt der Tortur ausgesetzt. Vor der Tortur wurden dem Verdächtigen immer die Folterwerkzeuge gezeigt, was häufig zum Geständnis führte. Es folgte die leichte Tortur, die nicht länger als eine Stunde dauern durfte 55 Es wurde sofort innegehalten, wenn der Verdächtige zum Geständnis bereit war, denn dieses war nur beweiskräftig, wenn der überführte Täter sein Geständnis nach abgebrochener Tortur machte. Er musste es vor der Urteilsverkündung noch einmal freiwillig wiederholen. Die Tortur fand "in Gegenwart der Herren", also vor herzoglichen Amtsinhabern und häufig hinter dem Schloss statt. Frauen, die des Kindsmordes angeklagt waren, wurden meist "uffm Regiment", der Amtsverwaltung des Residenzamtes gefoltert, das sich damals in der Heinrichsburg des Schlosses befand, die wenige Jahre darauf abgerissen wurde. Der nächste Schritt war die schwere Tortur. Zu dieser griff man, wenn die leichte kein Geständnis gebracht hatte. Auch sie durfte eine Stunde nicht überschreiten und nicht dazu führen, dass der Angeklagte zu Tode kam. Diese schwere Tortur wurde wenigstens zweimal von Meister Adam bei Frauen angewandt, die der Hexerei verdächtig waren. Einmal halfen ihm der Scharfrichter in Seesen und ein Halbmeister dabei, beide waren Brüder seiner dritten Frau. In beiden Fällen standen die Angeklagten unter dem Verdacht der Zauberei. Man stellte sich vor, dass Zauberer und Hexen einen Pakt mit dem Teufel geschlossen oder Frauen mit diesem Beischlaf getrieben hätten. Nach ihrem Geständnis wurden sie verbrannt. Brandstifter erlitten dieselbe Strafe, denn auch diesen unterstellte man, dass sie vom Teufel besessen waren. Ein angeblicher "Hexenmeister" wurde 1662 dreimal der Tortur unterzogen und danach wieder ins Gefängnis gebracht, wo er bald von einem Spießgesellen befreit wurde. Zwei Jahre später war er wieder gefasst, gefoltert und schließlich "aufs Wasser gesetzt". Die Wasserprobe hielt man für geeignet, I Iexen zu überführen; sie wurde angewandt, wenn die Verdächtigen strikt leugneten. Dahinter stand die Vorstellung, dass Verbündete des Teufels ihr Gewicht verlören, also nicht versänken und Wasser, als Element der Taufe, Teufelsbuhlen abstoße 56 Diesmal blieb auch das Gottesurteil ohne Ergebnis. Der angebliche Hexer kam lebend davon, er wurde auf ewig des Landes verwiesen. 51 Belege zu Folter und zugrundeliegenden Vorstellungen bei KELLER, Scharfrichter (wie Anm. 4), S Belege bei SCHORMANN, Hexenprozesse (wie Anm. 13), passim. Er unterstreicht: "Hexenprozesse sind Strafverfahren ohne Straftat" (S. 1). - Die schwierige Rechtslage wurde schon in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts von Professoren diskutiert. Es war 1588 Johann Bökcl, der Leibarzt des braunschweigischen Herzogs Julius, der sich strikt dagegen wandte; zur Diskussion am Hclmstedter Juleum s. KAuERTZ, Diskussion (wie Anm. 19), zusammenfassend S
60 Scharfrichter und Abdecker 63 In den letzten acht Jahren der Tätigkeit des Hans Adam gingen Tortur wie Todesstrafe stark zurück. Zwischen 1665 und 1672 wurde Adam zur Tortur noch siebenmal, zur Wasserprobe nur noch ein einziges Mal befohlen. Die Unterlagen des Hans Adam zeigen, dass die Strafen viel milder ausfielen, wenn der Verdächtige bei der Tortur nicht gestand. Da gab es des Pferdediebstahls Verdächtige, die bei ihrer Behauptung blieben, die Pferde gekauft zu haben, oder junge Mütter, die ihr Neugeborenes tot zur Welt gebracht hatten und daran während der Folter festhielten. Was folgte, war dann meist Landesverweis. Diebstahl in Kirchen oder bei Amtspersonen wurde nun, je nachdem, ob der Diebstahl vorsätzlich, heimtückisch oder Mundraub war, mit dem Strang oder durch Landesverweis geahndet. Wem Inzest oder Vielweiberei nachgewiesen wurde, fiel unter dem Schwert. Totschlag als Ergebnis eines Streits wurde mit Landesverweis geahndet. Vor 1660 fanden die Hinrichtungen allgemein am Lechlumer Holz, nach 1660 immer öfter auf dem Wolfenbütteler Marktplatz statt. Adams Aufzeichnungen belegen, dass im Verlauf der 18 Jahre immer seltener auf die Todesstrafe erkannt wurde. Das ab 1670 am häufigsten ausgesprochene Urteil, der Landesverweis, wurde nun in Fällen gewählt, auf denen noch fünf Jahre zuvor die Todesstrafe erfolgt wäre, wie Betrug mit Bettel-oder Brandbriefen, Unzucht, Schwängern der Schwiegertochter, Bigamie, Injurien, Erschießen oder Erstechen aus Versehen, Betrug und Kirchendiebstahl 57 Sie gingen vielfach mit Schandsteine Tragen, Anschließen an den Schandpfahl oder aus dem Tor Ausklingen und Ausstreichen einher. All das war entehrend, wurde aufmerksam von der Bevölkerung verfolgt und machte ein Bleiben am Ort unmöglich. Im Lauf der 18 Berichtsjahre des Hans Adam fällt also zweierlei auf: Zum einem ging die Anwendung von Tortur nach der Mitte der 60er Jahre deutlich zurück. In den ersten fünf Jahren verhielt sich das Verhältnis von Strafe zu Tortur wie 1: 3, in den fünf Jahren darauf wie 1:2, zuletzt etwa wie 2:3. Anfangs wurde also häufiger gefoltert als später. Zum anderen wurden Delikte, auf denen die Todesstrafe stand, seltener. Brutaler Mord war nicht mehr so häufig; Pferdediebstähle nahmen dagegen in den 60er Jahren noch einmal zu. Des Kindsmordes wurde 1665, der Hexerei oder Zauberei zuletzt 1666 eine Frau in Adams Dienstzeit angeklagt. Scharfrichter in Wolfenbüttel ab 1675 Hans Adam folgten im Wolfenbütteler Scharfrichteramt die Söhne seiner ersten Frau aus ihrer Ehe mit David Fuchs und auf diese ein Angehöriger aus der Familie Adam, wenn auch nur auf kurze Zeit 58 Nach seinem Tod heiratete Hans Martin Kannenberg Adams Witwe, um Meister in der Wolfenbütteler Scharfrichterei zu werden. Vermutlich war er da noch sehr jung, denn sein Leben in der Scharfrichterei ist über fast 50 Jahre zu verfolgen. Immer seltener hatte er hochnotpeinliche Aufgaben wahrzuneh- 57 SCHORMAI'N, Hexenprozesse (wie Anm. 13) S. 54 f., kommt zum gleichen Ergebnis. 58 Am 19. Mai 1680 wird die Tochter des Nachrichters Adam Adam, Eva Elisabeth, getauft; dazu StA WF 1 Kb 1345 S Vielleicht wurde er 1678 eingestellt; dazu StA WF 50 Neu 2 Wolfb Nr. 314 passim.
61 64 Gesine Schwarz men. Im Jahr 1710/11 standen eine Landesverweisung, drei Torturen und eine Visitierung an; drei Frauen, die an den Pranger gestellt werden sollten, wurden begnadigt. All das brachte gerade 15 Taler ein. 59 Umso wichtiger wurden die übrigen Aufgaben, die er und seine Gehilfen auszuführen hatten. So wundert es nicht, dass statt der Scharfrichter, die nun meist als Nachrichter bezeichnet wurden, immer häufiger Halbmeister oder Abdecker im Herzogtum angestellt waren. Die meisten kamen aus Scharfrichterfamilien, die schon im 16. oder 17. Jahrhundert im Braunschweiger Land oder benachbarten Gebieten lebten und arbeiteten 6o Wenn später Nachrichter wieder häufiger genannt werden, so war das vielleicht Etikettenschwindel; Abdecker oder Halbmeister versuchten ihre Tätigkeit aufzuwerten, indem sie sich als Nachrichter bezeichneten. Von Kannenbergs vielen Kindern aus zwei Ehen sind mehrere Töchter erwachsen geworden, vier Kinder starben, darunter der einzige Sohn. Als eine der Töchter 1712 heiraten wollte, beantragte der Nachrichter für seinen Schwiegersohn, einen Wolfenbüttder Handwerker, beim Herzog ein Unbedenklichkeitszeugnis. Es ist offensichtlich, dass der Scharfrichter seiner Tochter eine Zukunft in bürgerlichem Milieu ermöglichen wollte 61 Auch im 18. Jahrhundert bestanden enge verwandtschaftliche Bindungen zwischen den verschiedenen Scharfrichterfamilien der weiteren Region und über die Landesgrenzen hinaus. So war Hans Martin Kannenberg mit der Familie Fröling/ Fröhlich versehwägert 62. Sein Nachfolger wurde ein Kannenberg, der aber nicht sein Sohn war. Verschiedene Kannenbergs halfen in der Scharfrichterei, darunter Hans Martins Vater (ti713) und Nikolaus Kannenberg (ti714), der die Tochter eines Weingärtners aus dem Dorf Hessen geheiratet hatte 63 Nikolaus Frau wie Tochter 59 Er berechnete für jede Dienstleistung 1 Taler 24 gute Groschen, mithin 3 Gulden, wie seinerzeit Hans Adam, s. StA WF 4 Alt 19 Nr. 449 fol. 129r. Ein Scharfrichter mit Namen Kannenberg ist auch aus Fallersleben bekannt, ansonsten aber selten, s. Bibliographie von Fritz TREICHEL, Scharfrichter und Abdecker im deutschsprachigen Raum, in: Herold-Jahrbuch, N.F. 1, 1996, S (Nr. 338). 60 Die Kopfsteuerbeschreibung von 1678 nennt Halhmeister als Henker und Abdecker in Hünerdorf (Amt Calvörde), Oberlutter (Amt und Stadt Königslutter), und im Amt Vorsfclde. Nachrichter sind außer in Wolfenhüttel in Stadtoldendorf, Helmstedt, Holzminden, Einbeck (fürs Amt Greene) und in Schöningen für die umliegenden Ämter zuständig gewesen und beschäftigten Abdeckerknechte und -jungen. Dazu Heinrich MfDEFIND, Die Kopfstellerbeschreihllng des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel. Hannover 2000, Index s. v. Halhmeister, Nachrichter, Scharfrichter. Zur "lahrliste 1715": StA WF 50 Neu 2 Wollb. Nr. 314 (5. April). Halbmeister mit Namen Förster sind in Seesen, Stadtoldendorf und Schöningen, mit Namen Fahner(t) in Königslutter bezeugt. 61 StA WF 2 Alt Ca. 30 Jahre später bedürfen Nachfahren von Scharfrichtern nach zwei Generationen keines solchen Nachweises mehr, wenn sie Zugang zu ehrlichen Berufen suchen. 62 Seine Mutter Anna Frölig stand Patin bei der ersten Tochter und Heinrich F/'Ölingk, Meister zu Ütze, bei der zweiten; so StA WF 1 Kb 1346 S. 39, S. 44. Verwandtschaft mit dem ersten 1574 für Gandersheim bestallten herwglichen Scharfrichter ist wahrscheinlich. In Braunschweig war Claus Fröli(n)g von Scharfrichter; dazu SCHÜTTE, Scharfrichter (wie Anm. 5) S Seine Tochter heiratete seinen Nachfolger Hans Pfeffer; so StA WF 2 Alt fol. Ir-2r, der zuvor als Scharfrichter im Amt Vorsfc1de sein Amt zur Zufriedenheit der von Bartensleben geführt hatte, so StA WF 2 Alt fol. 33r. Scharfrichter mit Namen Fröhlich / Früling sind weit verbreitet. Sie finden sich in Thüringen, Regensburg, Württemberg, Hoya; s. GLENZDORF I TREICHEL, Henker (wie Anm. 29) S StA WF 1 Kb 496 im Jahr 1702 (Groß Stöckheim).
62 Scharfrichter undabdecker 65 blieben bis an ihr Lebensende in der Meisterei in Wolfenbüttel 64. Wenn der Scharfrichter, seine Frau, Kinder oder Eltern, Knechte oder Halbmeister beerdigt wurden, fand das oft in aller Stille statt. Es ist aber kaum glaubhaft, dass sie unweit der Oker bestattet wurden, wo man auch Selbstmörder und Straftäter begrub, wie noch nach der Mitte des 18. Jahrhunderts mitgeteilt wird. Die Witwe des Nachrichters Fahnert aus Königslutter wurde 1749 mit großem Geläut der Marienkirche in Wolfenbüttel zu Grabe getragen (Abb. 4)65. Abb : Grabstein des Nachrichters Fahnert, Königslutter (nach Ms. H. Medefind, Inschriften Königslutters Nr Detail) Scharfrichter Kannenbergs Mitarbeiter, etwa ein Ackerjunge (t1718) oder ein "fremder Bursche" (t1719), ein Knecht (t1736) und die Tochter einer Frau, die dort spinnen half (t 1740), werden nur vage greifbar, wenn ihr Tod registriert wird. Sie bleiben namenlos. Die Witwe des zweiten, kinderlosen Kannenberg heiratete nach seinem Tod einen Scharfrichterssohn aus der Familie Matthias, von denen viele zwischen Diepholz, Wunstorf, Vechta, Bückeburg und bis nach Quakenbrück als Halbmeister oder Scharfrichter tätig waren, andere auch in Königslutter begegnen 66. Der erste Matthias war nicht lange in Wolfenbüttel Meister. Am 12. Januar 1742 machte er seinem Leben unbeabsichtigt mit einem Schuss ein Ende. An seiner Beerdigung nahm die Öffent- 64 Kirchenbuch (Trinitatiskirche Wolfenbüttel) StA WF 1 Kb 1348 (11) (in den Jahren 1728, 1729). 65 Zur Familie Fahner(t) vgl. Anm Beerdigung der Witwe Fahnert Sta WF 1 Kb 1348 (III) Dazu s. Gisela WILBERTZ, Scharfrichter (wie Anm. 4), Index s.v. Matthias, sowie StA WF VI Hs 15 Nr. 80/ 1 (H.-B. Krieger).
63 66 Gesine Schwarz Iichkeit regen Anteil 67 Der Vater des tödlich verunglückten Matthias war als Nachrichter in Diepholz alt geworden und trat an die Stelle seines Sohnes. Ihm folgt ein dritter Matthias und Bruder des ersten, der 1763 die Tochter eines Scharfrichters aus Sachsen heiratete (Abb. 5). Als er 1782 starb, waren seine drei Töchter noch nicht volljährig, so dass zunächst ein Bruder des Verstorbenen, Nachrichter Matthias aus Königslutter, ihn vertrat, bis die älteste Nichte 1783 den Sohn des Scharfrichters Holdorf aus Halberstadt zum Mann nahm. Dem jungen Holdorf wurde das Scharfrichter Privileg erst 1790 erteilt, da er bei der Eheschließung den Meistertitel noch nicht vorweisen konnte, das heißt soviel, dass er noch keine Enthauptung vorgenommen hatte, als er heiratete 68 Niedergang im 18. Jahrhundert Schon als Meister Adam seine Aufzeichnungen machte, wurde ein allmählicher Wandel der Auffassungen über Rechtsfindung und über die Art und Weise, Recht zu üben, erkennbar. Diese Entwicklung setzte sich fort. Hexenprozesse wurden immer problematischer, da der Nachweis von Zauberei kaum je gelingen konnte fand der letzte im Fürstentum Wolfenbüttel statt wurde Folter generell, mit Ausnahme von Daumenschrauben, verboten und diese 1763 ein letztes Mal eingesetzt 7o Als in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Gandersheimer Nachrichter Tobias Vogel aufgefordert wurde, zwei Verdächtigen Folterwerkzeuge zu zeigen, musste er sich die erst besorgen und bei seinem Schwiegervater Holdorf in Blankenburg nachfragen, wieviel er dafür verlangen könne. Die Tortur war fast in Vergessenheit geraten 71 Hinrichtungen waren aber noch lange nicht endgültig abgeschafft. Wenn solche mit dem Strang bevorstanden, musste der Galgen am Lechlumer Holz wieder hergerichtet werden. Die Gerichtsstätte am Lechlumer Holz war allen ungeheuer. Wenn die Zimmerleute dort hinaus ziehen sollten, um Reparaturen am Galgen vorzunehmen, wurde die gesamte Gilde daran beteiligt wurde allen 83 Handwerkern reichlich Bier, Brot und Speck ausgegeben und ein Zuschlag auf den Lohn gezahlt. Und 1730, 67 Alle Angaben aus den Kirchenbüchern (frinitatiskirche Wolfenbüttel) StA WF 1 Kb ; im besonderen: StA WF 1 Kb 1348 Bd. 11 S. 134: Januar 1742 ist der Nachrichter Matthies öffentlich beerdiget, welcher sich, in dem er aus dem Schiff steigen und sich an einem geladenen Gewehr halten wollte, selbst erschosßcn."; weitere Begebnisse: StA WF 1 Kb 1350 (11) S. 152; S "" StA WF 34 N Nr (Privileg vom 11. F~bruar 1790 in Abschrift). Damals wurden ihm Meisterei und Abdeckerei in Wolfenbüttel und Schöppenstedt, in den Ämtern Wolfenbüttel, Rothenhof, Salzdahlum, Achim, Winnigstedt, Lichtenberg, Salder, Gebhardshagen, im Amt Neuhaus Volkmarsdorf und in den adeligen Gerichten ühertragen. Königslutter hatte damals seine eigene Meisterei. - Die Scharfrichterfamilie Hol(l)dorf begegnet außer in Halberstadt und Wolfenbüttel auch in Lüneburg, Schöningen (StA WF 8 Alt Schö Nr. 126a) und Blankenburg (StA WF 8 Alt Gand 406). 69 ROSE, Schöningen (wie Anm. 31) S Daumenschrauben werden zuletzt 1763 bei einer Bettlerin in Braunschweig durch den Nachrichter aus Wolfenbüttel eingesetzt: A. LIJDEWIG, Ein Strafverfahren in guter alter Zeit, in: Braunschweigisches Magazin 1903, S StA WF 8 Alt Gand 406.
64 Scharfrichter undabdecker 67 Abb : Räder und Galgen am alten Weg nach Braunschweig beim Lechlumer Holz (StA Wolfenbüttel K 1873, Ausschnitt) als wieder einmal "die neue Justiz" am Lechlumer Holz errichtet werden musste, forderten sie eine Kapelle an, die ihnen aufspielen solle, wenn sie hinauszögen , als der Galgen auf den Wendesser Berg im Südosten der Stadt verlegt werden sollte, wurde dem Scharfrichter befohlen, dafür zu sorgen den alten Galgen abzubrechen und am neuen Platz aufzurichten. Das letztere sei nicht ihr Handwerk, war seine Antwort, die Zimmerleute seien ja auch nicht bereit, den alten Galgen abzubrechen 73. Hinrichtungen mit dem Schwert wurden nach wie vor auch auf dem Wolfenbütteler Markt vorgenommen. An Urteilsfindung, -verkündung und -vollstreckung hatte sich grundsätzlich nicht viel geändert, wie das folgende Beispiel belegt. Es geht dabei um die Tat des Hofjägers Johann Georg Hoffmann. Er hatte seit 1722 Dienst beim Herzog getan. Seine Tat hatte in der Ratsstube der Kanzlei, also im Gerichtssaal, stattgefunden, und sich gegen einen hohen Staatsdiener, den Vizekanzler, gerichtet, den er 72 StA WF 8 Alt Wolfb Nr. 1090, fol. 4r-5v (1703); fol. 8r-9v (1730). 73 Dazu Erich ISENsEE, Die Verlegung des Hohen Gerichts vom Lecheinholze zum Wendesser Berge, in: Heimatbuch des Landkreises Wolfenbüttel14, 1983, S. 133 f. Der Scharfrichter weigert sich, den Galgen umzusetzen: StA WF 8 Alt Wolfb Nr
65 68 Gesine Schwarz mit seinem Hirschfänger schwer verletzt hatte. Das harte Strafmaß, Rädern bei lebendigem Leibe, war vom Herzog persönlich gemildert worden; es blieb grausig genug. Das Urteil wurde am 26. März 1743 vor dem Wolfenbütteler Rathaus im Beisein von Obrigkeit und gaffendem Volk gefällt, nachdem der Täter losgeschlossen war und auf eigenen Wunsch sein Geständnis vor der Menge wiederholt hatte. Es erging der Spruch, daß er auf der vor der Cantzley aufgerichteten Richtstatt mit dem Sch werd vom Leben zum Tode zu bringen, dahin jedoch zu schleiffen, ihm al/da vor der Enthauptung die rechte Hand abzuschlagen und hernach der Cörper aus der Stadt zur ordentlichen Fehmestedte weiter zu schleiffen und daselbst auf das Rad zu flechten, auch der Kopf samt der Hand über selbiges zu stecken und zu heften sei. Die Vollstreckung fand gleich im Anschluss statt. Ausnahmsweise war das Schafott vor der Kanzlei errichtet, wo das Verbrechen stattgefunden hatte; dorthin setzten sich die Amtsträger in Bewegung. Das Recht als solches war in Frage gestellt worden - nun wurde demonstriert, dass es mit aller Härte gewahrt wurde 74 Im Lauf dieses Jahrhunderts wurde für Kinder aus den Scharfrichtereien immer schwieriger, den Beruf ihrer Vorfahren auszuüben. Engel Heyland, die Witwe des Scharfrichters Dietrich Förster aus Seesen konnte um 1700 noch alle drei Söhne aus erster Ehe mit Nachrichtereien versorgen, nachdem ihr zweiter Mann, der Nachrichter in Stadtoldendorf gestorben war. Sie eröffnete ihnen, dass dem ältesten die Meisterei des Stiefvaters in Stadtoldendorf zufiele, der mittlere war in Einbeck untergekommen, für Seesen hatte sie ihren Jüngsten vorgesehen. Aber die Einnahmen gingen stetig zurück. 20 Jahre später wurde die Seesener Nachrichterei für 120 Taler im Jahr verpachtet, denn der Ehemann von Engel Heylands Großtochter namens Gebhard war in Kassel unabkömmlich, wo er Nachrichter war. Johann Georg Förster, ebenfalls ein Enkel von Engel Heyland, hatte 1753 in Stadtoldendorf schon seit Jahren nicht die Handschuhe aus Hundeleder gestellt, die dem Magistrat zustanden, und zahlte auch nur ungern stattdessen drei Taler 75 Die längste Zeit mag es in der Scharfrichterei von Wolfenbüttel besser hergegangen sein. Sie war einst eine Goldgrube gewesen, wurde doch bei der Ehestiftung des Paares Matthias-Holdorf im Herbst 1783 ihr Wert auf 5000 Taler veranschlagt. Das ist nur mit der Abdeckerei, ihrer Organisation und weiteren Einnahmequellen zu erklären. So gut wie einst mag die materielle Grundlage allerdings auch hier nicht mehr gewesen sein, denn es waren Schulden in Höhe von 2000 Talern aufgelaufen. Der Vater des Bräutigams Johann Friedrich Holdorf und Scharfrichter aus Halberstadt beglich die Schulden auf der Stelle mit Goldtalern. Hatte sich die Wirtschaftslage in den letz- 74 Prozess in: StA WF 8 Alt Wolfb. Nr. 1098; Begnadigung zum Tod durchs Schwert, persönlich unterzeichnet von Herzog Kari!., ebd. fol. 35r-v. - Andere B~ispiel~: 1736 wunlcn eine Kindsmörderin, 1737 ein Soldat, der seine Braut erstochen hatte, auf dem Markt von Wolfenbüttel enthauptet (StA WF V1 Hs 15 Nr. 112, fol. 116r, li!lv), 1740 ein Delinquent gehenkt (StA WF 8 Alt Wolfb Nr fol. 26v), 1735 wurde ein Landeskind und 1756/57 zwei Zigeunerinnen, die mit ihren Kindern durehs Land zogen und sich mit "Planeten-Lesen, Betrügerey" und Diebstählen durchbrachten, nach Staupenschlag des Landes verwiesen (ebd. fol. 42r), 1759 die drei Brüder See geköpft (ebd.). " StA WF 2 Alt
66 Scharfrichter und Abdecker 69 ten Jahrzehnten verschlechtert, wie die aufgelaufenen Schulden des verstorbenen Nachrichters in Wolfenbüttel andeuten, oder war es auf seine Neigung zurückzuführen, auf zu großem Fuß zu leben? Jedenfalls hatte er aus der Abdeckerei sein Leben gut bestreiten können 76,/~ Abb : Die Witwe Matthias unterzeichnet mit drei Kreuzen und eigenem Siegel. (StA WF 50 Neu 2 Woltb Nr 314) Es blieb vor allem die Abdeckerei, die schon 1574 erwähnt worden war. Sie wurde immer wichtiger, je mehr die eigentlichen Aufgaben des Scharfrichters in den Hintergrund traten. Waren 1678 noch sechs Scharfrichter und drei Halbmeister oder Abdekker im Land Braunschweig beschäftigt, so hatte sich 1715 das Zahlenverhältnis umgedreht: Außer Nachrichtern in Wolfenbüttel und Stadtoldendorf waren in den übrigen Meistereien des Landes nur Halbmeister oder Abdecker registriert. Eine Verschiebung zwischen den beiden Tätigkeitsfeldern ist deutlich. Später begegnen zwar im Land Braunschweig wieder mehr Nachrichter, wie man Scharfrichter nun allgemein nannte, doch haben diese sich den Titel wohl selbst zugelegt, um ihr Ansehen zu he- 76 Ehestiftung: 50 Neu 2 Wolfb. Nr. 314 (24. September 1783) war die Scharfrichterei eine Erbverschreibung; das dazu gehörige Land kam zu Erbenzins von der Stadt für jährlich 12 Reichstaler 8 gute Groschen. An Gewerbesteuer gingen nach der Verordnung von Reichstaler an das Amt Wolfenbüttel; ebenso hoch lagen die Abdeckereizinsen; je 5 Reichstaler waren für die Ämter Gebhardshagen, Achim und Lichtenberg, für das letzte auch einen Reichstaler als Handschuhgeld zu zahlen; dazu StA WF 34 N Nr
67 70 Gesine Schwarz ben. Das Schwergewicht verlagerte sich jedenfalls auf die Abdeckerei, die schon zuvor bei weitem lukrativste Aufgabe des Wolfenbütteler Nachrichters, der für ein weites Gebiet zuständig war. Den untergeordneten Abdeckern und Halbmeistern ging es viel schlechter. Immer wenn Rind oder Pferd verendet waren, musste der Abdecker verständigt werden und zur Stelle sein, um den Kadaver aus der Haut zu schlagen und zu entsorgen. Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges wurde diese Regelung immer missachtet und Nachrichter oder Abdecker kämpften darum, dass die Entsorgung der Kadaver nicht insgeheim von den Bauern selbst vorgenommen wurde. Besonders kritische Zeiten brachen an, wenn Tierseuchen übers Land hingingen. Landbevölkerung wie Obrigkeit konnten gleichermaßen schlecht damit umgehen, denn die Seuchen nahten unaufhaltsam. Zunächst wurde die Seuche als ferne Bedrohung in entlegenen Fürstentümern registriert, und die Obrigkeit reagierte mit Verordnungen; der Viehhandel über Grenzen hinweg war nur unter strengen Auflagen durchführbar. War die Seuche nähergerückt, wurde den Bauern empfohlen, wie sie in Stall und auf der Weide die Ansteckungsgefahr niedrig halten könnten. Erst einmal im Lande sprang die Seuche in Wochenfrist von einem auf das nächste Dorf über. Schon 1680 sollten Scharfrichter und Abdecker das an der Seuche erkrankte Vieh unabgedeckt vergraben. Damit entging ihnen der Verdienst, der aus dem Verkauf der Häute an Gerber und Schuster erzielt wurde. Die Bauern vergruben gern die Kadaver der erkrankten Tiere selbst, um die Abdeckergebühren zu sparen, so entging den Abdeckern auch diese Einnahme. Als es im Jahr 1712 wieder einmal so weit war, wurde befohlen, dass Pferde-, Viehärzte und Schmiede die Kadaver des erkrankten Viehs begutachten sollten. Alles verendete Vieh war dem Nachrichter zu melden, um die Kadaver der erkrankten Tiere mit Haut und Haaren umgehend abzuholen und zu verscharren. Dafür wurde von den Bauern Bezahlung in doppelter Höhe erwartet 77 Abdecker machten sich strafbar, die sich der Häute des verseuchten Viehs bemächtigen wollten erging der Erlass, die Bauern sollten das verseuchte Vieh selbst vergraben. Für den Scharfrichter als Zulieferer wie für Gerber, Sattler, Riemer und Schuster war es von Nachteil, da die Bauern das Vieh insgesamt nun selbst zu entsorgen begannen 78 Vierzig Jahre später hatten der Nachrichter aus Wolfenbüttcl und aus Stadtoldendorf das verendete Vieh zu obduzieren und konnten angeblich keine Anzeichen der Seuche feststellen. Als die Seuche rasch um sich griff, wurden die Behörden eines Besseren belehrt. Offensichtlich nahmen die Gutachter es mit der Wahrheit nicht genau, damit ihnen nicht die Häute entgingen 79. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts hätten viele Bauern viel darum gege- 77 StA WF 2 Alt fol. 24r-27r enthält die Verordnung von Anton U1rich; fol. 24v den Hinweis, dass die Scharfrichter / Abdecker für die Entsorgung zuständig seien; fol. 87r-88r (Vorschlag des Scharfrichters Kannenberg). 78 StA WF 2 Alt fol. 28r-29v. 79 Für Groß Stöckheim ist es 1754/55 belegt; dazu StA WF 2 Alt StA WF 2 Alt fol. 10r-v (Zweifel am Urteil das Scharfrichters Matthias 1754); StA WF 2 Alt (dto 1757 Amt Rathenhof). - StA WF 2 Alt fol.l3r (Urteil des Scharfrichters Förster aus Stadtoldendorf 1757), StA WF 2 Air fol.4r-v (Zweifel an diesem Urteil).
68 Scharfrichter und Abdecker 71 ben, das geheime Rezept des Braunschweiger Nachrichters zu erfahren, mit dem die Seuche erfolgreich bekämpft worden war, obwohl das Braunschweigische Obersanitäts-Kollegium auf ähnliche bekannte und bewährte Medikamente hinwies Ro Abdeckern stand man allgemein ablehnend gegenüber, wie eine Auseinandersetzung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zeigt. Die Gehilfen aus der Wolfenbüttel er Meisterei auf dem Juliusdamm gehörten im nahegelegenen Dorf Groß Stöckheim zur Gemeinde, wo sie auch einen Kirchenstuhl hatten und begraben werden sollten. Schon 1747 hatte es Ärger gegeben, denn der Scharfrichter hatte protestiert, weil der Pastor seinen Untergebenen das Abendmahl nicht hatte reichen wollen. Im Jahr 1767 kam es zum Eklat, als wieder der Pastor den Abdeckern das Abendmahl versagte. Ende Januar beschwerte sich der Scharfrichter beim Herzog, und löste damit einen Zwist zwischen Gemeinde und Pastor in Groß Stöckheim auf der einen, Konsistorium und Herzog in Wolfenbüttel auf der anderen Seite aus. Gemeinde und Pastor wünschten, dass die Abdeckerknechte und Halbmeister wie der Scharfrichter und seine Familie in die Trinitatiskirche in Wolfenbüttel eingepfarrt würden, weil sie der Verachtung ausgesetzt seien, wenn die Abdecker gemeinsam mit ihnen zum Abendmahl gingen, und für den Pastor der Weg zum Juliusdamm über Wolfenbüttel führe und zu lang sei, wenn er ihnen bei Krankheit und Sterben beistehen solle. Ihrem Antrag wurde stattgegeben. Doch nun hatten der Pastor der Trinitatiskirchc, der Generalsuperintendent und der Gerichtsschultheiß Einwände. Sie suchten einen Platz in der Kirche, wo die Abdecker die übrigen Kirchgänger nicht stören würden. Da die Trinitatiskirche Garnisonskirche war, hatten Kommandant und Prediger von der Garnison auch ein Wörtchen mitzureden. Durch den einzigen Eingang der Kirche sei es unvermeidlich, "daß dieselben <Kneehte>beym Ein- und Herausgehen in der Kirche andere Leute berühren würden", die "malitieuse, verwegene und gottlose Menschen seien". Es kam, wie sie befürchteten. Am Sonntag, den 4. Dezember war es so unruhig in der Kirche, als die Scharfrichterknechte "mit ihrer verwegenen vornehmen und sehr impertinenten, halsstarrigen Aufführung" mitten unter den Soldaten Platz genommen hatten, dass noch vor dem Buß- und Bettag am 7. Dezember an den Nachrichter der Befehl des Herzogs erging, seinen Knechten den Kirchgang nach St. Trinitatis zu untersagen R1 Während es Kindern von Nachrichtern gelegentlich gelang, den Weg in die Bürgerlichkeit zu gehen, wie das Beispiel der Tochter des Kannenberg 1712 zeigte, war es um Abdeckerkinder schlechter bestellt. Zwar war man sich schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts des Problems bewusst, wie das kaiserliche Edikt von 1731 zeigt, dass eine Lösung dieses Problem anstrebte. Es erwies sich aber bis zum Ende des Jahrhunderts als schwer umsetzbar StA WF 2 Alt ' Dazu Gesine SCHWARZ, Geschichte des Dorfes Groß Stöckheim, Wolfenbüttel 2003, S. 85 f. 82 StA WF 2 Alt 4259; nach 1772 waren auch Abdeckerkinder zunftfähig, wenn sie nicht zuvor im Metier ihrer Väter beschäftigt gewesen waren; dazu WILBERTZ, Scharfrichter (wie Anm. 4) S. 315.
69 72 Gesine Schwarz Scharfrichter als Heilkundige Unter Hans Adams Aufzeichnungen fanden sich auch Hinweise auf einträglichere Geschäfte des Scharfrichters als Hinrichtungen mit dem Schwert, Rad, am Galgen oder die Tortur. Die rechte Tortur wollte gelernt sein, sollte der Übeltäter doch danach sein Geständnis zu Protokoll geben. Die Hinrichtungen setzten praktische Kenntnisse vom menschlichen Körper und eine sichere starke Hand und Übung in der Handhabung des Richtschwertes voraus. Diese Fähigkeiten hoben die Scharfrichter weit über den Kreis seiner Gehilfen, der Halbmeister und Abdecker, hinaus. Kenntnisse über den menschlichen Körper hatten viele Scharfrichter den Ärzten ihrer Zeit voraus. Schon 1471 war es in Hildesheim der vii/er, der vor der Einbalsamierung des verstorbenen Bischof Ernst die Eingeweide entfernte. 83 Auch Hans Adam wurde immer wieder zu medizinischen Hilfeleistungen herangezogen. Er kurierte 1656 erfolgreich zwei Baut:rn nach Unfällen im Herrt:ndit:nst; die Heilungen stellte er der herzoglichen Kammer in Rechnung. Jeder von ihnen hatte sich Rippen, Arm und Jochbein gebrochen, Stauchungen und Blutergüsse oder innere Blutungen erlitten. Auch 1670 wurde er nach Unfällen von Bauern im Herrendienst tätig. Adam berechnete dafür weit mehr als für dit: Pflichtt:n im Dienst der herzoglicht:n Rechtsprechung, 1656 je neun und zehn Taler; 1670 zwischen drei und sieben Taler. R4 Die Heilkunst war also eine lukrative Einnahmequelle und es ist anzunehmen, dass die Bauern auch nach Unfällen im eigenen Haus und Hof oder während der Arbeiten auf ihren Feldern Rat und Hilfe bei ihm holten. Auch als Tierärzte waren Scharfrichter lange Zeit gefragt. Die Wahl nach dem Tod des Dietrich Fahner 1617/18 fiel vielieicht auf Hans Günther, weil die Herzoginwitwe Elisabeth ihm bestätigte, dass er sich als Pferdearzt bewährt habe. 85 Gegen Ende des 17. Jahrhunderts versuchten Dekan und Professoren von der Medizinischen Fakultät der Universität IIelmstedt sich dagegen zu verwahren, dass dort "Nachrichter, alte Weiber, Bader" den Chirurgen, wie man Mediziner zusammenfassend bezeichnete, ins Handwerk pfuschten. Noch 1736 wurde der Helmstedter Nachrichter Scherrnester durch herzogliches Privileg beim "Curiren geringen Schadens" geschützt, wenn auch später behauptet wurde, er habe es sich vom Vogt der Stadt durch Zahlungen erschlichen. 86 Von Staats wegen erlaubte man heilkundigen Laien eher Hilfeleistungen bei äußeren Verletzungen als die Heilung innerer Krankheiten. Kurz vor der Mitte des 18. Jahrhunderts beginnen sich einerseits Beschwerden der Ärzte beim Herzog zu häufen, die "Curen" von Badern, Apothekern, Scharfrichtern oder ihrer Frauen und Töchter verhindern wollten, weil die die Einnahmen der Me-.3 Hcnning Brandis Diarium (wie Anm. 5), S. 2. Dcr Begriff Filler steht in späteren Jahrhunderten nur für Abdecker, wird von Brandis aber regelmäßig im Sinne von henger (=Henker, Scharfrichter) gebraucht..4 StA WF 4 Alt 19 Nr. 449 fol. 51r, fol. 114r. Dazu auch WOLFF, Mcdizinalgcschichte(n) (wie Anm. 36) S.70f. " KRIEGER, Pflichten (wie Anm. 5) 1953, S. 12. R6 StA WF 2 Alt fol. 34r-41 v. Scharfrichter mit Namen Schermesser I Schermester sind in Sachsen, Thüringen, Hclmstedt häufig und bis Hamburg-Bergedorfbelegt; s. GLENZDORF/TREICHEL, Henker (wie Anm. 19) Bd. 2, S
70 Scharfrichter und Abdecker 73 diziner schmälerten, andererseits nahmen Anträge von Scharfrichtern um die Konzession zu, auch weiterhin heilen zu dürfen. Der Nachrichter Hans Martin Matthias aus Königslutter begründcte 1751 seinen Antrag damit, dass die Pflichten der Nachrichter voraussetzten, dass diese "einen vernünfftigen actum torturae" nur mit guten Kenntnissen des menschlichen Körpers durchführen könnten, und auch die dabei entstehenden Schäden Nachrichter am besten heilen könnten. Er erinnert daran, dass man Scharfrichtern immer gestattet habe, ihre Heilkunst zu üben, weil ihnen eine Jahrhundcrte alte und vielfach bewährte Erfahrung zugrunde liege, die die Nachrichter einzig und allein an ihre Söhne weitergäben. 87 Aber die Zeiten änderten sich und bald wurde den Nachrichtern auch ihre Fähigkeiten streitig gemacht, Verrenkungen von Gliedmaßen zu beheben, Verbände anzulegen, heilkräftige Salben gegen äußere Verletzungen aufzutragen. Dem Antrag des Holzmindener Nachrichters, der von seinem Vater viel gelernt, im Siebenjährigen Krieg praktiziert und sein Wissen erweitert hatte, wurde 1771 nicht stattgegeben, obwohl er komplizierte Beinbrüche in Gegenwart der Ärzte der Stadt gerichtet hatte, nachdem diese versagt hatten. Weitere Erfolge waren aktenkundig, aber das Medizinal-Kollegium in Braunschweig lehnte mit fadenscheinigen Gründen ab, ihm die Konzession zu erteilen. R8 In Calvörde wurde 1758 beim Abdecker und Pferdedoktor Peter Kratzer auf Befehl des Amts eingebrochen und seine Sammlung an Kräutern und Heilwässern beschlagnahmt, da er die nur bei Menschen anwenden könne. Sein Neffe argumentierte knapp 20 Jahre später, dass er Mensch und Vieh heilen müsse, weil seine Einkünfte als Abdecker nicht ausreichten. Er habe das von seinem Vater gelernt, der als Heilkundiger im Brandenburgischen einen sehr guten Ruf hatte und war selbst erfolgreich, wie ihm der Pastor bestätigte. Eine Generation später wurde sein Sohn Arzt, und erhielt 1795 die Erlaubnis, Patienten mit Arzneien auch nach den Rezepturen seines Vaters zu versorgen. Auch im Land Braunschweig studierten nun wie anderswo Söhne von Nachrichtern vor der Wende zum 19. Jahrhundert Medizin und griffen als ausgebildete Ärzte auf die Heilkunst ihrer Vorfahren zurück. 89 Nachleben im 19. Jahrhundert Auch im 19. Jahrhundert wurden Hinrichtungen noch bei Wolfenbüttel vollzogen, aber immer seltener. Als ein Knecht, der 1799 seine Braut erschlagen hatte, 1807 am Wend esser Berg mit dem Schwert hingerichtet wurde, erschien ein Extrablatt in Braunschweig. Zwar wurde sein infames Verhalten, als er gleich nach der Tat das Aufgebot bestellte und diese zunächst leugnete, verurteilt, aber man verglich doch den forschen Kerl mit dem über die sieben Prozessjahre hin abgemagerten und stark B1 StA WF 2 Alt fol. 39r-v. " StA WF 2 Alt passim. Jüngst hat sich zu diesem Thema geäußert: Jutta NOWOSADKO, Rationale Hcilbchandlung odcr abergläubische Pfuscherei? Die medizinische Kompetenz von Scharfrichtern und ihre Ausgrenzung aus heilenden Tätigkeiten im 18. Jahrhundert, in: Zwischen Aufklärung, Policey und Verwaltung. Zur Genese des Medizinalwesens (= Wolfcnhüttcler Forschungen 102), Wiesbaden 2003, S g9 StA WF 2 Alt Ausführlich dazu WOLFF, Medizinalgeschichte(n) (wie Anm. 36) S
71 74 Gesine Schwarz gealterten Verurteilten; Mitgefühl ist unverkennbar. Die Exekution wurde vom Wolfenbütteler Marktplatz auf den Wendesser Berg verlegt, weil die Schaulustigen, mit deren Teilnahme man rechnete, zwar Platz gefunden hätten, aber man die Unruhe in der Stadt scheute. 9o Die hochnotpeinlichen Aufgaben, die die Scharfrichter im Dienst von Herzog und Öffentlichkeit zu verrichten hatten, waren längst von der Abdeckerei weit an den Rand gedrängt worden, aus der der Lebensunterhalt schon lange bestritten wurde. Die Häute des Viehs konnten die Abdecker, ihre Knechte oder die Scharfrichter bis auf die aus den herzoglichen Ämtern und Amtshäusern, die im herzoglichen Besitz blieben, weiter behandeln oder verkaufen. Noch um 1860 wurden in den verschiedenen Landesteilen Aufgaben und Bezahlung der Abdecker unterschiedlich ge handhabtyl Nachrichter, die nur noch als Abdecker fungierten, blieben ihren Zeitgenossen auch unheimlich, als kaum noch Hinrichtungen stattfanden. Umso mehr fingen die Gerüchte um den Berufszweig und um die finsteren Machenschaften in den Meistereien an zu blühen. Die letzte Scharfrichterswitwe auf dem Juliusdamm in Wolfenbüttel war Johanne Christine Fedisch, verehelichte Holdorf. Als ihr Schwager 1835 starb, fand sie bald einen Verlobten in dem Jäger Waldemeyer aus dem Königreich Württemberg, der beim herzoglichen Hofjägermeister von Kalm in Halchter beschäftigt war. Es gab einige Hürden zu überwinden, ehe die Ehe geschlossen werden konnte. Sie musste auf dem Amt versichern, einen guten Halbmeister einzustellen und, falls je eine Hinrichtung angeordnet würde, einen fähigen Scharfrichter zu besorgen. Der Bräutigam erklärte sich bereit, sich zum Scharfrichter ausbilden zu lassen. Geheiratet wurde 1838 im Mai und das Abdeckergeschäft fortgeführt, bis Mitte der fünfziger Jahre Abdeckerei und ehemalige Scharfrichterei verkauft wurden. Es folgten mehrere Besitzerwechsel; die meisten Eigentümer hatten beruflich mit Tierhäuten oder Leder zu tun. Nun wohnten wieder Gerber auf dem Juliusdamm wie vor 1590, ehe Urban Fritze dort seine Scharfrichterei einrichtete, oder aber Schuhmacher. 92 Was man von Scharfrichtern wusste, ging in phantastische Erzählungen und dichterisch ausgesponnene Episoden ein. So wusste der Bürgermeister Grütter aus Walsrode zu berichten, dass ihn in seiner Jugend Begegnungen mit einem ernsten, schweigsamen Mann gefesselt hätten, der ihm seinen Werdegang erzählt habe. Es war der Scharfrichter Holdorf. Sein Vater, der Lüneburger Scharfrichter, so Holdorf, wollte ihm den Weg in die Bürgerlichkeit ebnen und schickte ihn zum Studium auf die Universität Helmstedt. Als er die Verwandten in der Wolfenbütteler Scharfrichterei besuchte, habe er erlebt, wie seine Vettern sich im Köpfen an einer Lederpuppe üb- 90 StA WF 8 Alt Wolfb. Nr passim. 91 Im Amt Schöningen standen dem Abdecker nur die Häute des Viehs zu, das er entsorge; er müsse aber während Viehseuchen das Vieh unentgeltlich verscharren. Im Amt Wickensen hatte er alle Häute des ausgewachsenen Viehs mit 16 guten Groschen zu bezahlen, Fohlen- und Kalbshäute standen ihm unentgeltlich zu; so: StA WF 50 Neu 2 Wolfb. Nr. 314 (8. Juni 1860 Schöningen; 3. Juni 1860 Wickensen). 92 Waldemeyer, Konzession 1838: StA WF 34 N Nr. 3055; Nachfolger Körber, Bode des Waldemeyer: StA WF 34 N Nr
72 Scharfrichter und Abdecker 75 ten, und es ihnen gleichtun wollen. Bei einer Enthauptung von drei Brüdern auf dem Wolfenbütteler Marktplatz habe er seinem Onkel das Richtschwert entwunden und die Verbrecher mit drei geziehen Hieben zu Tode gebracht - es war sein Meisterstück. Er wurde aus der Universität Helmstedt ausgeschlossen und Scharfrichter. 93 Viele Details dieser Erzählung sind unstimmig - aber Tatsache oder nicht, sie zeigt, dass denen, die zu Beginn des 19. Jahrhundert berechtigt waren, diesen Beruf auszuüben, ein Makel anhing. Um den Elm wurde der "Scharfrichter Uder" aus Königslutter um die Mitte des Jahrhunderts berühmt, weil er heil- und zauberkundig sei. In den Erzählungen, die sich um seine Person ranken, zeigt er sich als Menschenkenner mit einer freundlichen Verschlagenheit, die er erfolgreich nutzte, um seine angeblichen Kräfte ins rechte Licht zu setzen. Als Scharfrichter war Ud er freilich nie tätig, wie behauptet wurde, und auch nicht bei der Hinrichtung des Dombrowsky anwesend und schon gar nicht an der Exekution beteiligt.94 Von der Scharfrichterei blieben nur vage Vorstellungen, die das Gruseln lehrten. Während um diese Braunschweiger Gestalten die Phantasien ihrer Zeitgenossen ins Kraut schossen, dichtete Heinrich Heine in seinen "Memoiren" um, was zu ihm drang. Er gab makabren wie aufreizenden Gefühlen Ausdruck, als er von seiner Jugendliebe, dem "roten Sefchen" erzählte, der zauberischen Scharfrichterstochter mit ihren blutroten Haaren, die in der einsamen Scharfrichterei bei Düsseldorf aufgewachsen war. Es mag um 1815 gewesen sein, als sie ihm berichtete, dass sie als Kind Zeugin einer nächtlichen Feier wurde und gesehen habe, wie ihr Großvater im Beisein von Gästen, lauter vor Trauer versteinerten Scharfrichtern, feierlich sein Richtschwert der Erde übergab, mit dem 100 Hinrichtungen vorgenommen worden waren. Sie habe es Heine gezeigt und dazu das Lied der Otilje gesungen, das Heine mit den Worten enden lässt: "Willst Du küssen das blanke Schwert, das der liebe Gott beschert?" Dichterische Phantasie und Aberglauben durchziehen Heines Erinnerungen. Als er sie um die Mitte des Jahrhunderts aufzeichnete, suchte er mit seiner Antwort auf diese Frage die Bürger des Biedermeiers und ihre überholten Gefühle zu provozieren: "Ja, trotz dem Richtschwert, womit schon hundert arme Schelme geköpft wurden, und trotz der Infamia, womit jede Berührung des unehrlichen Geschlechtes jeden behaftet, küßte ich die schöne Scharfrichterstochter. Ich küßte sie nicht bloß aus zärtlicher Neigung sondern auch aus Hohn gegen die alte Gesellschaft und alle ihre dunklen Vorurteile". 95 Das allgemeine Urteil über diesen Berufszweig hatte sich gewandelt. Als der Berliner Scharfrichter 1853 pflichtgemäß vor Zeugen im Wolfenbütteler Gefängnis die 93 Diese Lebensgeschichte referiert KRIEGER, Pflichten (wie Anm. 5). Sein Hinweis auf Friedrich Grütter, ~AlIerlei Leute", 1878, ist nicht korrekt. Auch der Kern dieser Erzählung war nicht zu verifizieren. 9' StA WF VI Hs 15 Nr. 80/1 und 2 (Aufzeichnungen von Heinz-Bruno Krieger als Nachfahre der Familie Uder). 9\ Heinrich HEINE, Memoiren und Geständnisse, mit einem Nachwort von Walter ZIMORSKI und Anmerkungen von Bernt KORTLÄNDER, Darmstadt 1997, S Zu der Episode s. Ebcrhard GALLEY, Das rote Sefchen und ihr Lied von der Otilje. Ein Kapitel Dichtung und Wahrheit in Heines ~Memoiren", in: Heine-lahrbuch 14, 1975, S
73 76 Gesine Schwarz letzte Hinrichtung vollzog, waren über 300 Jahre vergangen, seit Hans Stcyr aus Gilzum auf dem Tollenstein bei Wolfenbüttel in aller Öffentlichkeit und selbstbewusst sein Amt wahrgenommen hatte. Damals erkannten die Anwesenden Meister Hans und seine Autorität an und ordneten sich ihr unter. Am Ende der Entwicklung vollzog der Berliner Scharfrichter die Strafe im Verborgenen - eine Strafe, die Gericht und Geschworene nach der neuen und liberalen Gesetzgebung beschlossen hatten. Die Zeiten waren vorbei, in denen man schaudernd zurückwich, wenn der Scharfrichter, erkennbar an Rad und Galgen am linken Arm, vorbeiging oder man ihm Wasser über die Schulter nachschüttete, um Unheil von sich und den Seinen, von Haus und Hof abzuwehren. 96 "" Davon berichtet der Scharfrichter Martin Greger im eingangs erwähnten Wolfenbütteler Prozess des Jahres Als Folge erkrankte er schwer. StA WF 2 Alt (wie Anm. 11).
74 "... und besahe, was noch denckwürdiges d annne wa h" r... Zum Aufenthalt Prinz Albrechts von Sachsen-Gotha in Wolfenbüttel und Braunschweig im Mai 1670 von Annette Faber Prinz Albrecht, der 1648 geborene Sohn Herzog Ernst des Frommen von Sachscn Gotha und Altenburg ( ), verlässt auf einen specialbefehl seines Vaters hin am 4. Mai 1670 mit einer kleinen Gruppe von Begleitcrn das heimatliche Gotha. - Noch eine Kavalierstour, so möchte man meinen, war doch der Prinz schon 1668 von Tübingen aus durch die Schweiz, Savoyen und die Dauphine, im Jahr darauf in die Niederlande gereist. Auch die in seinem Alter längst anstehende Brautschau in standesgemäßen Kreisen scheint keineswegs vordringliches Ziel gewesen zu sein. Albrecht ( ) hat vielmehr den diplomatischen Auftrag, in den protestantischen Königreichen Dänemark und Schweden die Fühler für ein großes und - nebenbei bemerkt - nie verwirklichtes Vorhaben seines Vaters auszustrecken: das Collegium Hunnianum. Unter dem Eindruck der Schrecknisse des 30jährigen Krieges hatte Ernst der Fromme nach der Unterzeichnung des Westfälischen Friedens schon 1648 versucht, eine evangelische Landessynode zu gründen, um Streitfragen innerhalb des Luthertums friedlich beizulegen. Als dies scheiterte, beschäftigte er sich mit der Gründung eines Collegiums, das als»aufsichtsbehörde zur Erörterung theologischer Streitigkeiten, zur Publikation nützlicher Schriften und zur Kontrolle und Zensur aller Vorgänge und Veröffentlichungen in Kirche und Universitäten" dienen sollte. Benannt war es nach dem Lübecker Superintendentcn Nicolaus Hunnius ( ), der als erster den Vorschlag eines permanent tagenden lutherischen Gremiums aus zwölf Theologen gemacht hatte, um aufkommenden Differenzen friedlich zu entscheiden. Das am 11. April 1670, also nur wenige Tage vor der Abreise des Prinzen, gestiftete und finanziell gut ausgestattete Collegium sollte seinen Sitz im ehemaligen Kloster Reinhardsbrunn bei Gotha nehmen 1. Damit Herzog Ernst stets genau unterrichtet ist, hat die Reisegesellschaft regelmäßige Berichte mit zuverlässiger Post abzuliefern, ein volkammen diarium zu führen I August BEcK, Ernst der Fromme, Herzog zu Sachsen-Gotha und Altenburg. Ein Beitrag zur Geschichte des 17. Jahrhunderts. Teill. Weimar IS65, S. 615 ff. - Stephanie HARTMANN, Das Collegium Hunnianum. In: Ernst der Fromme - Staatsmann und Reformer Wissenschaftliche Beiträge und Katalog zur Ausstellung, hg. von Roswitha JACOBSEN und Hans-Jörg RUGE. Jena 2002, S. 387 f.
75 78 Annette Faber Abb. 1: Albrecht von Sachsen-Coburg ( ). Kupferstich, Kunstsammlungen der Veste 1...,.~;."J'w:" Coburg, Inv. Nr. I/I, 533,23. und alle notabilia darin zu verzeichnen und solches succesive ein zue schicken 2 Dass der Prinz das Tagebuch nicht selbst führt, hat gute Tradition: nur von wenigen berühmten Reisenden der Barockzeit ist ein eigenhändiger Bericht überliefert. Schließlich war hier kein individuelles Erleben gefragt, sondern ein halböffentliches Zeugnis der geleisteten diplomatischen und kulturellen Arbeit, das an den langen Abenden bei Hofe gelesen, sogar vorgelesen wurde. Was Prinz Albrecht oder seine Begleiter wirklich dachten und empfanden, wenn sie nach den körperlichen Strapazen der Reise oder an den von zeremoniellen Zwängen geprägten Höfen einmal tatsächlich allein waren, erfahren wir nicht einmal zwischen den Zeilen. Das Reisediarium ist in zwei Fassungen erhalten; ein Exemplar befindet sich in der Bristish Library, London, Sign. Manuscripts, Add SCH , ein zweites bewahrt das Staatsarchiv Coburg, Sign. LA A 1647i., auf. Das Londoner Manuskript scheint einen ersten Entwurf darzustellen, denn der Coburger Text ist ausführlicher, außerdem um Namen und Orte sowie eine Abbildung ergänzt. 2 Thüringisches StA Gotha (ThStGo), Geheimes Archiv E IV 7-7b, fol. 249 ff. - Der erste Teil dieses Reisetagebuchs wurde von der Verfasserin bereits veröffentlicht. Annette FADER, Von Gotha nach Gottorf - Prinz Albrechts Reise in die nordischen Königreiche In: Jb. der Coburger Landesstiftung Bd. 47. Sonnefeld 2004, S Der vorliegende Beitrag ist eine gekürzte, leicht veränderte Fassung.
76 "... und besahe, was noch denckwürdiges darinne wahr... " 79 Der im barocken Deutsch mit unverkennbar thüringischem Idiom verfasste Text ist hier zum besseren Verständnis mit einigen Änderungen ediert. Bis auf Eigennamen sind alle Begriffe klein geschrieben, das willkürlich verwendete barocke "ß", bzw. "ss" ist vereinheitlicht und die Zeichensetzung im modernen Sinn überarbeitet. Reise DIARIUM oder Beschreibung deßen, was bey der Anno 1670 von Hertzog Albrechts zu Sachsen Gotha Fürstlicher Durchlaucht Nacher Hollstein, Dennemarck und Schweden gethanen Reyse von tage zu tage passirt und vorgangen [fol. 1] Auf empfangenen gnädigsten specialbefehl des durchlauchtigsten fürsten und herrn, herrn Ernsts, hertzogs zu Sachsen, Jülich, Cleve und Berg etc., fürstlicher durchlaucht, begaben dero hertzgeliebter anderer sohn, der auch durchläuchtige fürst und herr, herr Albrecht, hertzog zu Sachsen etc., nach vorhero von des herrn vaters und der frau mutter, dero ältern herrn bruders frau gemahlin, fürstliche durchlaucht, der fräulein schwester und beyden jüngeren herrn brüder, fürstlichen durchlaucht, genommenen abschiede, mittwochen den 4. Mai anno 1670 vormittage umb 9 uhr sich von dem fürstlichen hause Friedenstein auf den weg. Seiner fürstlichen durchlaucht wahren zu dero aufwartung bestendig mit zugeordnet und gegeben folgende bedienten: 1. Johann Balthaser von Gablkoven, cammerjunker. 2. M[agister] Wilhelm Verpoorthen, kirchenrath. 3. L[icentiatus] Hieronymus Brückner, secretarius. 4. Johann Ludwig Breithaupt, cammerdiener. 5. Philipp Brückner, des kirchenraths diener 6. Hans Conrad Seyvard, laquey, und 7. Hans Andreas Schmidt, des von Gablkovens knecht hierzu kahm noch zu Gottdorff von Kie/ aus 8. Friedrich Adam von Bergen. [fol. 1'] Mehr hochgedachter seiner fürstlichen durchlaucht gaben das geleyte bis etwa eine halbe stunde vor die stadt dero beyde jüngere herrn brüdern, der herr obriste von Thillitsch, herr hofrath Lüdolph bis nach Wiege/eben [Wieglcben] aber dero ältester herr bruder, hertzog Friedrichs fürstliche durchlaucht, der cammerjuncker von Rumrodt, der herr rentmeister Breithaupt und der frantzösische sprachmeister St. Paul. Des mittags um 12 uhr kahmen sie zu gedachtem Wiegeleben wohl an und hielten da die mittagsmahlzeit. Umb 2 uhr zochen sie, nach genommenem abschiede von des herrn bruders fürstlicher durchlaucht und denen anderen, so mit bis dahin gereyset, von dar wieder aus, kahmen vor Langensaltza vorbey durch Thomasbrücken [Thamsbrück] und des abends umb 6 uhr zu Volckenroda an. Da hielten seine fürstliche durchlaucht in dem fürstlichen ambthause dero nachtlager... [fol. 3] Sonnabent den 7. May... Nachmittage nach zwey uhren ging die reyse weiter auf Beinen [Beinum], Machtersen [Lobmachtersen], Behrum [Barum]2 stun-
77 80 Annette Faber den ferner auf Immendorf, Arßen [Adersheim] bis Wolffenbüttel2 stunden. Daselbst kahmen sie glock sieben an. Weile der wirth zu Gittelde den printzen gekennet und seine anwesenheit daselbst dem ambtmanne zu Stauffenburg wissent gemacht, hatte derselbe solches an hertzog Rudolphs Augusti fürstliche durchlaucht alsobald berichtet. Welcher dann dem printzen etwan eine gute viertel stunde vor die stadt mit dem jüngsten grafen von Schwartzburg von Sondershausen, sieben cavalliers und 18 reitern von der guardie entgegen kahmen, denselben bewillkommeten und in dero hofstad unter lösung 6 stücke von dem walle einführeten. Die bedienten wurden in das neheste wirtshaus am schlosse Zum Löwen einlogiret. Die stad und festung Wolffenbüttel sambt dem schlosse wird in mehr angezogener topographia der fürstenthümer Braunschweig und Lüneburg p. m. 207 et seqq. ausführlich beschrieben und mit unterschiedlichen kupfern und [fol. 4] rissen eigentlich vorgestellet, daß also alhier mehr darvon zu gedencken ohnnötig ist. Nur ist zu erwehnen, daß ob zwar das schloß ein schön und groß gebäude ist, doch weyl es zu unterschiedenen zeiten und von unterschiedenen herren nach der bequemlichkeit, die in den gemächern und logementern gesuchet worden, erbauet ist, es sehr winckelicht und irregular kommet. Es hat einen weiten umbfang und großen hof Auf demselben waren dazumahl unterschiedliche frembde thiere, als ein kameel, ein rennthier, ein luchs, ein kranich, eine wasserpompe etc. Abb. 2: Wolfenbüttel, Stadtansicht nach Merian (1654). StA Wf Sonntag den 8. May fuhren ihre durchlaucht der printz mit hertzog Rudolfs Augusti fürstlicher durchlaucht in die neue hauptkirche in der Henrichs Stadt. Da selbst legte herr d[octor] Brandanus Detrius, oberhofprediger und abt zu Riddagshausen, das sonntags evangelium, nachmittag aber der herr superintendens Christophorus Hardhenius die epistel aus und hielt kinderlehre. Nach verrichtetem gottesdienste führete hertzog Rudolphs Augusti fürstliche durchlaucht den printzen in das gewölbe selbiger schönen und großen kirchen, darinnen die fürstlichen begräbnüsse waren. Des letztverstorbenen hertzog Augusti fürstliche leiche stunde noch außerhalb dem untern gewölbe in einem gantz messingen sarge, mit schönen erhobenen bildern und folgender grabschrift: D.T.S. / DOLETE BONI / VIRTUTIS EX EXPERIENTIAE THESAURUM / MORS INVIDA ERI PUlT ORBI. / CONDITUR IN HAC URNA / SACRI ROMANI IMPERII SPLENDOR / DOMUS BRUNS: EX LUNEB: FULCRUM [fol. 4'] / AUGUSTUS GERMANIAE SIDUS / SERENISSIMUS PRINCEPS AC
78 "... und besahe, was noch denckwürdiges darinne wahr... u 81 DOMINUS, DNS. / AUGUSTUS / BRUNSV: AC LUNEB.: DUX / PRINCEPS IUSTISSIMUS I HEROS FORTlSS-IMUS / SENEX PRUDENTISSIMUS / QUI AETATE AC SAPIENTIA / PAREM / TOT SECULIS NON HABUIT I H1C / HENRICI PROBI FILIUS / ERNESTI CONFESSORIS NEPOS / REGIAE STlR PIS PROGENIES / NATUS / DANNEBERGAE X APRILIS / AO. M.D.LXXIX I RARISSMIS NA TURAE DOTIBUS / SUBLIMI SPIRITU / FACTlS PRAECLARIS I SUB V. IMPERATORIBUS / TOGA SAGOQUE FUIT INSIGNIS / RELIGIONIS ORTHODOXAE, BONIQUE PUBLICI / ACRIS DEFENSOR / SUMMUS STUDIORUM PATRONUS / INCOMPARABILIS BIEBLIOTHECAE COLLECTOR / POST QUAM DUCATUS EX COMITATUS SUOS / XXXII ANNOS / FELICITER EX GLORIOSE REXERAT / UTRIUSQUE PROLIS PATER EX AVUS, / SENIO TANDEM CONFECTUS I TERRENI DOMINII SATUR / DEVOTA INTER SUSPIRIA I DEO AVOCANTE / [fol. 5) EX AVITA GlJELPHORUM SEDE, BEAT ISSIMO / DE CESSU COELESTEM REGIAM INTRAVIT / XVII. SEPTEMBRIS AO I EXAC T1S AETATIS SUAE ANNIS LXXXVII.! MENSIUM 5. DIERUM 7 I PATRIAE TOTIUSQUE ORBIS DESIDERIUM / RELlQUIIS DOMINI PARENTIS / ANIMAE OLIM RESTITUENDIS / IN MAXIMO LUCTU EX FILIALI PIETATE I SUMMUS SUCCESSOR MONUMENTlJM HOC / CONSF.CRAVIT / AD VERTE QUI TRANSIS: / CADIT QVOQVE MORTE SELENVs. [1666) Hertzog Rudolph Augusti fürstliche durchlaucht haben verordnet, daß alle zeit des letzt verstorbenen regierenden herrns leiche so lange oben außer dem gewölbe auf der bahre mit dem leich tuche stehen sol/, bis durch absterben des nachfolgers solche stelle durch deseiben leiche wieder bekleydet und der vorige in die grufft zu den andern gebracht wird. Montag den 9. May vormittage wurde das hagelfest celebriret und bey öffentlichem gottesdienste gott der herr umb verleyhung gutes gewitters zum wachsthumb der feldfrüchte angerufen. Es predigte wieder der herr superintendens Christophorus Hardenius und verlase zum text aus dem 104. K. [?) vers 5-16, erklärte aber nur den 13. vers. Nachmittage fuhren hertzogs Rudolphs Augusti und dero herrn bruders hertzog Anthon Ulrichs fürstliche durchlaucht mit dem printzen nacher Braunsch weig und besahen daselbst den dom St. Blasii, darinnen sehr viel aus dem pabsthumb noch überbliebene und in kostbahren gülden und silbernen gefäßen verwahrte, auch mit edelgesteinen reich besetzte heyligthümer wahren. [fol. 5') Dinstags den 10. May vormittage thate der herr kirchenrath auf der cantzeley seine proposition, worbey neben denen darzu deputierten cantzier, cammerpräsident, d[ octor) Brandano auch hertzog Anthon Ulrichs fürstliche durchlaucht wahren und dieselbe mit anhöreten. Unterdessen schriebe der printz nach hause. Nachmittage fuhren hertzog Rudolphs Augusti fürstliche durchlaucht mit dem printzen auf ein dorf etwan eine meile von der stadt, Gießenbück [Kissenbrück) genannt, da hatten selbige vor wenig jahren eine neue kirche bauen lassen, welche sie dem printzen zeigeten. Es war aber dieselbe in form eines creutzes gemacht und die winckel stumpf abgeschnitten, daß es in der mitten ein achteck gab. Zu solchen 4 abgeschnitten wincke/n wahren 4 fenster, worvon die kirche gantz helle war. Unten in dreyen ecken des creutzes gingen thüren hinein und neben denselben wahren die weiberstühle, in dem vierten ecke war der altar und über demselben die cantzel. Oben in dreyen ecken wahren doppelte bohrkirchen [Emporen) für die mannspersohnen übereinander. In dem ecke gegen den altare und der cantzel über war das fürstliche kirchgemach. Gegen das dach zu war die kirche in der mitten spitzig zugethürmet, gleichwie der neue thurn auf dem
79 82 Annette Faber r I Abb. 3: Grundriss der Kirche in Kissenbrück. Federzeichnung, Reisediarium, 1670, fol. Sv, Staatsarchiv Coburg LA A 1674i. schlosse Friedenstein und der saal auf dem weymarischen schlosse, daß die musicanten oben stehen und musiciren konnten. Die gestalt derselben war ohngefehr diese: a. der altar b. die fenstern c. die frawenstühle, über welchen die bohrkirche der männer standt d. die thüren e. die dicke der mauern [fol. 6] In demselben dorfe wahr auch ein forwerck und auf demselben ein lustig haus von unterschiedlichen schönen fürstlichen gemächern, die Hedwigsburg genannt, welches auch von hertzog Rudolphs Augusti fürstlicher durchlaucht vor etlichen jahren von neuem wieder erbauet worden ist. Darauf wurde des abends oben in dem höhesten gemache, da man von allen seiten einen lustigen prospect in das feld hatte und die festung Wolffenbüttel übersehen konnte, gespeiset. Nach der mahlzeit fuhren sie wieder nach Wolffenbüttel. Mittwochen den 11. May vormittage wurde der printz von dem major'3 umb die festung geführet und dieselbe ihm gezeiget, die beschreibung derselben ist in angezo- 3 Der Name ist nicht nachgetragen, im Text dafür eine Lücke gelassen.
80 "... und besahe, was noch denckwürdiges darinne wahr... u 83 gener topographia der fürstenthümer Braunschweig und Lüneburg benebenst dem grundrisse enthalten. Es mußte der printz auch, so lange er zu Wolffenbüttel wahr, ohngeachtet er sich dessen lange weigerte und sich entschuldigte, dem major alle abend die parole geben. Gegen den Mittag wurde der trompeter Rauchmaul mit denen bis dahin genommenen wagen und pferden wieder zurück und nach hause geschickt. Nachmittage wurde der printz in die bibliothec geführet. Von derselben hat d[octor] Conring einen eigenen tractat geschrieben und ist wohl die äußerliche, als innerliche gestalt des gebäudes, darinnen dieselbe stehet, in oftangezogener topographia in etlichen kupferstücken eigentlich zu sehen. Die anzahl der darinnen vorhandenen büchern soll sich ietz auf volumina belaufen. Der hauptcatalogus darüber bestehet in 7 dicken folio bänden, darvon hertzog Augustus - hochseeligster gedachtnüß - 4 mit eigner hand geschrieben. Derselbe ist hauptsächlich eingerichtet nach denen unterschiedlichen materien, welcher titel d[ octor] Conring in gedachtem tractat specijiciret, und nach den formaten. In den formaten aber ist sonderlich auch dar [fol. 6']auf gesehen worden, daß alle, die einer höhe sind, beysammen seyn, und nicht eines höher oder niedriger als das andere stehet. Weyl aber bücher von einerley materien, ja auch gar von einerley format einander nicht eben so schnurg/eich sind, auch sich oft zuträget, daß ein buch von etlichen tomis, welche zu unterschiedlicher zeit gebunden worden, ungleicher höhe sind, in dem eines von dem buchbinder mehr als das andere beschnitten worden, haben nothwendig durch diese in die augen wohlfallende ordnung viel, theils gar zusammengehörende, theils aber der gleichheit der materien nach sich wohl zusammenfügende bücher in unterschiedliche fächer voneinandner müssen distrahiret werden. Damit man aber doch flux, was zusammen gehöret, finden könnte, hat der seelig-verstorbene herr meistentheils selbst die mühe genommen und zu iedem buche in dem cata/ogo auf dem rande geschrieben, auf welchem blatte und in welchem fache die anderen darzugehörigen tomi im ca ta logo zu finden sind. Und darmit man auch flugs alle au/ores, die begehret werden, finden möchte, ist ein absonderlicher index autorum verfertiget, der weiset bey iedem in dem hauptcatalogum, wo das buch zu finden. Nach hertzog Augusti seeligster gedächtnüs tode ist in vorschlag gekommen, ob die bibliothec nicht besser ordiniret werden könnte. Weyle es aber bey so einer großen menge bücher eine schreckliche mühe würde veruhrsacht haben und die vorigen catalogi alle dardurch undüchtig gemachet worden weren, so ist es endlich bey den vorigen ca ta logis gelassen wordten. Es werden aber ietzt durch alle facultäten und gattungen bücher indices materiarum tabellen weise gemachet, die weisen alle in den hauptcatalogum, daß man also auf solche maße auch [fol. 7] bald wissen kann, was vor autores in ieder materia geschrieben und an welchem orthe dieselben in der bibliothec zu finden sind. Über solche bibliothec ist ein eigener bibliothecarius - ietzo herr mag[ister] David Hanisius gesetztet, dem sind würcklich zwey cammerschreiber zugegeben, und über dieselbigen hat er auch einen eigenen schreiber benebenst einem handlanger, welche alle ordentlich nicht anders als mit der bibliothec und verfertigen und richtighaltung der catalogorum zu thun haben. Der bibliothecarius sagte, daß der dritte cammerschreiber hiebevor schon auch darbey gewesen wehre, künftig auch wieder darzu kommen sollte. An einem repositorio in der einen cammer stund folgendes
81 84 Annette Faber distichon: PAULATIM QUOQUE ROMA SUIS PROGRESSIBUS USA CREVIT ID EXEMPLUM BIBLIafHECA SEQUOR. Aus der bibliothec ging der printz in die rüsteammer über derselbigen, darinnen wahren viel alte turniersättel, lantzen, harnische, partisanen, schlachtschwehrter, degen, allerhand künstliche pistohlen, undter anderem auch ein paar mit gläsernen läuffen, welche aber inwendig mit dünnen meßingen rohrlein gefüttert wahren, flinten, auch viel köstliche alte sätel und zeuge, vielerley gattung marechirstäbe, ein türckischer säbel mit vielen großen türckisen besetzet. Des seelig verstorbenen hertzogs Augusti leibgutsehe, darinnen inwendig in der mitten der decke eine uhr, und die gutsehe durchaus mit schwartzen sammet gefüttert war. Ein wagen mit drey rädern, ein schöner brautwagen mit rothem sammet gefüttert und von golde reich gesticket, einer pollnisehen princessin, die darauf nach Wolffenbüttel ihre heimführung gehalten. Es wahren auch viel edelgesteine, item [fol. 1'] gantz massiv silberne und vergüldete löwen daran gestanden, welche aber die keyserlichen und beyerischen im vorigen kriege ausgehoben und darvon geschnitten. In zweyen nebencammern waren unterschiedene, schöne gestickte sättel und pferdezeuge. Von dar gingen sie in das zeughaus. In dessen unterstem boden waren 2 überaus lange von eysen geschmiedete stücke auf laveten, darvon das eine 36, das andere aber 40 schuh lang war, und jenes 10 dieses aber 24 pfund eysen schießet. Item 20 unterschiedene große und kleine metalline stücke, 3 halbe carthaunen, 7 kleine und 6 große metalline, item 3 eyserne mörser sambt vielen kugeln, bley und lunten. Auf dem anderen stocke waren viel harnische, musketen, pistohlen, schlachtsch werter eie. Zu dem dritten und obersten boden hatte der capitain die schlüssel nicht, kahmen also auch auf denselbigen nicht. Wie der printz aus dem zeughause kam, wurde eben durch den guarnisonprediger mit den soldaten, welche alle um ihn herum stunden, betstunde gehalten auf der parade vor dem schlosse, welches wöchentlich drey mahl geschiehet. Die guarnison bestehet ietzt von 5 compagnien, einer zu pferde, so rittmeister Kotwitz commandiret, und vieren zu fueß, deren iedere von 200 bis 250 mann starck ist. Von ieder compagnie ziehen täglich 50 mann auf die wache, welche auf der parade untereinander vermenget werden. In dem schloß aber halten allein die von des obristen Schön bergs compagnie die wache, welche alle grüne aufschläge auf grauen rocken an den ermeln tragen. Dieselben sind meistentheils gefreyete und werden auch zu der aufwartung vor den gemächern als trabanten gebraucht. Einer von denselben bekommet [fol.8] monatlich 2 1/2 thaler und 15 brote, der anderen soldaten einer aber 2 thaler und so viel brote als die anderen. Die andere compagnie des majors führet rothe, die dritte des stückhauptmanns blaue und die vierte des andern capitains gelbe aufschläge an den ermeln. Von der parade ging der printz zu hertzog Anthon Ulrich fürstlicher durchlaucht in dero logement nechst an dem schlosse. Dieselbe zeigeten dem printzen dero kunstcammer von vielen raritäten, die bibliothec von einer großen anzahl guter bücher und ein cabinet von vielen köstlichen schildereyen. Unter andern raritäten in der kunstkammer war auch noch ein alt original von der Teutschen ihren götzen Kroto; item eine bleyerne tafel, so zu Königslutter in keysers Lotharii noch unversehrten begräbnüsse mit dem reichsapfel und einem creutze darauf von eisen gefunden wordten. Die Schrift auf der bleyernen Tafel war diese: LoTHARIUS - DEI GRATIA ROMANORUM IMPERATOR AUGUSTUS REGNAVIT ANNOS XlI.
82 "... und besahe, was noch denckwürdiges darinne wahr... «85 MENSES 111. DIES XII. OBIIT AUTEM 111. NONAS DECEMBRIS. VIR IN CHRISTO FIDELISSIMUS, VERAX, CONSTANS, PACIFICUS, MILES IMPERTERRITUS, REDIENS AB ApULlA SARACENIS OC CISIS ET EIECTIS. Donnerstag den 12. May war himmelfahrt. Der printz war wieder mit hertzog Rudolphs Augusti fürstlicher durchlaucht in der haupt stadtkirche, da predigte vormittage der herr kirchenrath Verpoorthen auf begehren ihr fürstlichen durchlaucht des hertzogs über das ordentliche evangelium, und nachmittags der herr hof prediger Overbeck über die epistel. Auf den abend war der printz bey hertzog Anthon Ulrich fürstlicher durchlaucht zu gaste. Freytag den 13. May praeparirte sich der printz wieder zu der abreyse. Die fürnehmsten räthe und junckern bey hofe zu Wolfenbüttel sindt: Hermannus Höpffner J. UD. cantzlar und geheimbder cammerrath. Friedrich [fol. 8'] von Heimburgk auf Bo/tern etc. geheimbder rath, cammerpraesident und vice-hofrichter, auch berghauptmann. Busso von Mönchshausen, geheimber und legationsrath. D[octor] Johann Luningck, geheimbder cammer- und consistorialrath, Johann Friedrich Söhle, geheimder hofrath. Justus Georgius Schottelius J. UD. hofcammer- und consistorialrath, auch hofgerichts assessor. D[octor] Casparus Alexandri, geheimbder hofrath und anietzo auf dem reichtstag zu Regenspurg abgesandter. Balthasar Hoyer, geheimbder hof-und cammerrath. Andreas von Schönbergk, obrister und commendant der festung Wolffenbüttel. Engelhard von Henningen, jägermeister und cammerjuncker. OltO Günther Kragen, hof- undjagtjuncker. Leopold Joachim von Neuendorf, thumherr [Domherr] zu Magdeburg, hojjuncker. Augustus von Wartenberg, hojjuncker und hofgerichtsassessor. N. von Bestebörstel, hojjuncker. Christian Ileinrich von Ende, hojjuncker. Sonnabent den 14. May nach gehaltener tafel um 2 uhr reysete der printz nach genommenem abschiede von hertzog Anthon Ulrichs fürstlicher durchlaucht (welche selbigen tag eben artzney gebraucht hatten und deswegen nicht auskahmen) wieder von Wolfenbüttel unter lösung 8 stücke geschütz aus. llertzog Rudolphs Augusti fürstliche durchlaucht gaben dem printzen das geleite bis etwa auf halben weg nach Braunschweig, darnach kehrten sie nach genommenem abschiede wieder zurück. Und der printz fuhr auf der von gedachter seiner fürstlichen durchlaucht bis nacher Hamburg mitgegebenen gutsehe benebenst einem bagagewagen 4 und zweyen guarde reitern selbigen abend bis nach Braunschweig; daselbst kahm er um 4 uhr an und logirte bey dem bürgermeister Franz Dohausen gegen der müntze über. Weil der printz [fol. 9] neulich in dem dome nicht alles wegen kürtze der zeit recht besehen können, also ging er ietzt noch einmahl hinein und besahe, was noch denckwürdiges darinne wahr. An einer alten tafel in dem chore ist nachfolgendes in niedersächsischer sprache aufgezeichnet, welches auf hochteutsch also lautet: In dieser nachfolgenden schrift findet man verzeichnet die stiftung der kirchen S. Blasi und was für herren und fürstinnen alhier begraben, mit der jahrzahl auf das kürtzeste verfasset: ALS MAN SCHRIEB NACH GOTTES GEBURTH 861 HAT HERTZOG DANCKWERTH ZU SACH SEN ERSTLICH DIESE BURG BEMAURET UND DANCKQUORDERODE GEHEISSEN UND NENNEN 4 Gepäckwagen
83 86 Annette Faber LASSEN. ANNO 1030 IST DIE KIRCHE DANCKQUORTERODE ZU EHREN DER HEILIGEN APO STELN PETRI UND PAULI GEWEYHET WORDTEN VON GOTTHARDO DEM 14. BISCHOFE ZU HIL DESHEIM. ANNO ill7 IST GESTORBEN GERTRUDIS, MARGRAFEN EGGEBRECHTES TOCHTER, UND ZU BRAUNSCHWEIG IN DIE KIRCHE BEGRABEN WORDTEN. SIE HAT S. AUCTORS LEICH NAM VON TRI ER NACH BRAUNSCHWEIG GEBRACHT. (Nb. Der steinerne sarg dieser Gertrudis mit ihren gebeinen ist allererst 1668 den 22. Junii kundt wardten, in dem die maurer denselben für einen gemeinen großen stein gehalten und mit ihren hebeisen aufheben wollen, da ist er in der mitten zerbrochen und menschengebeine in ledernen habieth mit folgender schrifft auf einem bleyernen täfelein darinne gefunden worden: HIC REQUIESCIT GERTRUDIS DEVOTA CHRISTI FAMULA XII. IDUS AUGU STI. Dieser sarg stehet im dom unten in der kruft neben dem großen cruzifix der Era, königs von Engeland tochter). ANNO D72 HAT HERTZOGK HEINRICH DER LÖWE DIE ALTE KIRCHE AUF DANCKQUORTERODE, ZU EHREN S. PETER UND PAULS GEWEYHET, LASSEN ABBRECHEN UND EINEN NEUEN DOM ZU EHREN S. BLAS 11 UND S. JOHANNIS BAP T1STAE LASSEN AUFRICHTEN UND AUCH DIE ZWO CAPELLEN S. JÜRGEN UND S. GERTRUDEN SAMBT ANDEREN [fol. 9'] TREFFLICHEN GEBÄUDEN DIESER STAD ANGERICHTET. IN DEMSEL BIGEN JAHR IST AUCH DER LAUENSTEIN [Löwenstein] ZU EINER EWIGEN GEDÄCHTNÜSS VON HERTZOG HENRICHEN AUFGERICHTET WORDEN. ANNO D95 IST GESTORBEN DER GE WALTIGE UND STREITBAHRE FÜRST HERTZOG HENRICH DER LÖWE AM ABEND JACOBI Apo STOLI UND IN DEN DOM ZU BRAUNSCHWEIG BEGRABEN WORDTEN. ANNO 1208 IST GESTOR BEN DIE DURCHLÄUCHTIGE FÜRSTIN FRAU BEATRIX, EINE TOCHTER DES RÖMISCHEN KÖNIGS PHILIPPI UND EIN GEMAHL KEYSER OTTENS DES IV., EIN HERR ZU BRAUNSCHWEIG, UND ALHIER IN DIE KIRCHE BEGRABEN WORDTEN. ANNO 1218 IST ZU DER HARTZBURG DER GROSSMÄCHTIGE KEYSER OTTO, DES NAHMENS DER N., EIN HERR ZU BRAUNSCHWEIG, HERTZOG HENRICH DES LöWEN SOHN, GESTORBEN UND IN DIE KIRCHE S. BLASII IN BRAUNSCHWEIG BEGRABEN WORDEN. ANNO 1227 HAT PFALTZGRAF HENRICH, EIN HERR ZU BRAUNSCHWEIG UND KEYSER ÜTTENS BRUDER, SEINEN LETZTEN TAG IN GOTT BESCHLOS SEN UND [ist] ALHIER BEY SEINEN VORELTERN BEGRABEN WORDTEN. ANNO 1252 IST ABGE SCHIEDEN VON DIESEM ERDREICH OTTO DER ERSTE, HERTZOG ZU BRAUNSCHWEIG UND LÜNEBURG ETC. UND IN DIE KIRCHE S. BLASII BEGRABEN. BEY DIESES FÜRSTEN ZEITEN HAT DIE HERRSCHAFT DEN NAHMEN ZU SACHSEN VERLOHREN UND DIE CHUR UND DAS CHURFÜRSTENTHUMB SACHSEN WARD GRAF ALBRECHTEN ZU ANHALT VON DEM KEYSER GEGEBEN UND WARD BELEHNT MIT DEM ROTHEN SCHWERTE, WELCHES ALLES ZUVOR DEN HERTZOGEN ZU BRAUNSCHWEIG GEHÖRETE, UND SIEDER [seither] DIESES HERTZOGS OT TEN ZEITEN DARVON VERLOHREN WORDEN. ANNO 1278 STARB HERTZOG ALBRECHT, DER GROSSE GENANNT, DIE ZEIT SEINES LEBENS MIT MANCHEN KRIEGEN BELADEN, UND IST ZU S. BLASIEN BEGRABEN. ANNO 1292 HAT GEENDIGET SEINEN LETZTEN TAG HERTZOG WIL HELM, HERTZOG ALBRECHTS SOHN, UND IN DEN DOM ZU BRAUNSCHWEIG BEGRABEN. BEY DIESES HERRN ZEITEN IST DAS FÜRSTENTHUMB BRAUNSCHWEIG IN DREY THEILE [fol. 10] GETHEILET UND GESCHIEDEN WORDEN. ANNO 1373 NACH MANCHER NIEDERLAGE UND VER LOHRENEN SCHLACHTEN IST HERTZOG MAGNUS ZU BRAUNSCHWEIG ETC. ZWISCHEN DESS TER UND LAINE VON G1U.FEN OTTEN BESTRITTEN IN DER SCHLACHT GESTORBEN UND WARD BEGRABEN ZU S. BLASIO IN BRAUNSCHWEIG. ANNO 1400 WAR EINE VERSAMMLUNG DER CHURFÜRSTEN IN DER ERWEHLUNG EINES KEYSERS ZU FRANCKFORT UND DIE MEISTEN
84 "... und besahe, was noch denckwürdiges darinne wahr... " 87 STIMMEN DERSELBEN ERWEHLUNG FIELEN AUF HERTZOG FRIEDRICHEN ZU BRAUNSCHWEIG UND LÜNEBURGK. ALS SIE ABER DURCH WIEDERSPRECHUNG DES BISCHOFS VON MAINTZ ENDLICH VON EINANDER GANGEN, IST HERTZOG FRIEDERICH IN GUTEM SICHERN GELEITE BEY FRISSLAR [Fritzlar] ERSTOCHEN UND IN DEM DOM ZU BRAUNSCHWEIG BEGRABEN. ANNO 1427 IST CECILIA, EINE GEBOHRNE MARGGRÄFlN UND HERTZOG WILHELMS, GE NANNT "DIE GOTTESKUHE", GEMAHLIN GESTORBEN UND IN DIE BURGK BEGRABEN WOR DEN. ANNO 1468 IST GESTORBEN METILDA, GEBORENE VON SCHOMBORCH, HERTZOG WIL HELMS AN DER GEMAHL, UND ZU S. BLASIEN BESTÄTIGET WORDEN. ANNO 1471 IST ALHIER IN DIE KIRCHE BEGRABEN FÜRSTIN HELENA, EINE GEBORNE VON CLEVE, UND HERTZOG HEINRICHS, "LAPPENKRICH" GENANNT, GEMAHL. ANNO 1482 HAT SEINEN LETZTEN TAG BESCHLOSSEN HERTZOG WILHELM "GOTTESKUHE", EIN ERNSTLICHER BERÜHMTER KRIEGSFÜRST, DER BEY SEINEN TAGEN SIEBEN GEWALTIGE HAUPTSTREITE ERHALTEN UND GEWONNEN, UND UMB S. JACOBSTAG IN DEN DOM ZU BRAUNSCHWEIG BEGRABEN WORDTEN. ANNO 1514 AM ABEND JOHANNES BAl'TISTAE HAT HERTZOG HENRICH DER ELTERE, EIN BE RÜHMTER KRIEGSFÜRST, SEINEN LETZTEN TAG IN FRIESLAND GEENDIGET, UND ALHIER ZU S. BLASIEN BEGRABEN WORDTEN. - In der domkirchen stehet auch noch in einer capel Ien in einem höltzernen sarge mit sammet überzogen hertzog Friedrich Ulrichs, so anno 1634 ohne kinder [fo!. 10'] gestorben, und mit seinen landen seine herren vettern, die anitzo regierende herren hertzoge von Braunschweig und Lüneburg befället, leiche, über dessen solennen begräbnis die fürstlichen herren erben sich noch bis dato nicht verglichen haben. Ingleichen ist neulich ein fürstliches kind des jüngern wolfenbüttelsehen herrns, herrn Ferdinand Albrechts, neben gedachte leiche ohne einige solennitäten beygesetzet worden. Morgenwarts nahe an diese domkirchen lieget die alte burg Danckwerderoda, welche vor vielen jahren durch eine feuersbrunst verdorben, anitzo aber wieder renevirt ist und das Marshaus genannt wird. Bey demselben ist mittagswarts das maurwerck des Henrici Aucupis zu sehen. Noch vor selbiger burgk ist ein großer platz, in dessen mitte stehet auf einer hohen, von quadersteinen aufgeführten pyramidalseulen ein großer ährener [eherner] übergüldeter löwe mit au!gespereten rachen und zu dessen füßen forne auf einem breiten steine folgende schrifft: ANNO SALUTlS HUMANI GENERIS MENS. AUG: ILLMS [illustrissimus] PRINCEPS, DO MINUS, DNS. [DOMINUS]: FRIDERICUS HULDARICUS, HENRICI JULII FILIUS, BRUNSV. & LUNEBURG. Dux, HOC ANTIQUUM MONUMENTUM GENTlLlTlUM, TEMPORIS & COELlINHJRIA COLLAPSUM, RESTAURARI & PRISTINO NITORI RESTITUI CURAVlT, POSTQUAM ANNO PRAECE DENTI URBEM HANC ACERRIMA OBSIDIONE A 22. JULII USQUE AD 1I. NOVEMBR. CINXJSSET EX TANDEM SOLUTA EA MENS. FEBR: PAX & CONCORDIA HOMAGIO SUB IURAMENTI FIDE PRAESTITO FIRMATA ESSET, IN REI PERENNEM MEMORIAM. Aus der domkirchen ging der primz in das eine zeughaus. Darinnen wahr in zweyen hauptgemächern ein großer vorrath von allerhand gewehr, in dem einen stunde fornen an diese schrift: FELIX ILLA CIVITAS, QUAE TEMPORE PACIS COGITAT DE BELLO. - [fo!. 11] Unter andern war auch darinne eine sonderliche invention von einer handmühle mit einem eisernen scharfen schraubgewinde, fast wie die würtzmühlen zu seyn pflegen, darauf in einer stunde eine himbte korn gemahlen werden könnte. Item 3 große mörser, viel harnische, pertuisanen, schlachtschwerter, musqueten, pistohlen undfeuerröhren. Ein gezelt, welches sie bey der letzten belagerung dem könige in Den-
85 88 Annette Faber nemarck in einem ausfalle, wie auch unterschiedliche fahnen, so sie dazumahl dem hertzoge von Braunschweig abgenommen. Es hing auch darinne und wurde gezeiget des major Fillers bildnüß mit einen breiten schlagschwerte und pistohlen, so er geführet. Der ist anno 1615 gebohren und anno 1662 ohne erben gestorben. In das zeughaus, da ihre stücke eine stehen, konnte der printz nicht kommen, weil sie daseibe frembden nicht gern sehen lassen, wie auch nicht auf den wall um die festung, weyl die Braunschweiger sich dazumahl eben wegen der differentien, welche die herren hertzogen von Braunschweig und Lüneburg mit dem churfürsten von Brandenburgk über der grafschaft Regenstein hatten, und zu beylegung derselben in Braunschweig ihre zusammenkünften hielten, sich sehr fürchten und ihre stad fleißiger als sonst iemahls in acht nahmen. Sonst ist die situation der festung in der oft angezogenen topographia der fürstenthümer Braunschweig und Lüneburgk an angezogenen orte p. 208 und der eußerliche prospect der stadt mit einer beschreibung p. 57 et sequentes zu befinden. Die stadt wird in fünf weichbilder abgetheilet (1) die alte stad, (2) den Hagen, (3) Newstadt, (4) alten Wiek (5) Sack. Jeder weich/fol.ll 'lbild hat sein eigen rathhaus und burgemeister, etliche zwey, etliche auch mehr, und kann kein bürger in prima instantia außer seinen weichbilde belanget werden. In der Neustad aber ist das rathhaus, darauf der gantze rath (an welchen auch die appellationes aus allen weichbildern gehen) das ordentliche stadtregiment führet. Derselbe bestehet von vierzehen burgemeistern, 17 cammerern und 28 rathsherrn. Die bürgerschaft wird in zünfte und die gemeine eingetheilet, über welche gewisse gildemeister und hauptleuhte gesetzet sind. Sontag den 15. May vormittage ging der printz in die dom kirche, daselbst legte herr Hantelmann das evangelium aus. Als der printz aus der kirchen kahm, schickte der syndicus Baumgarten zu demselben, mit vermelden, daß ihr fürstliche durchlaucht im nahmen des raths er unterthänigst aufwarten und dieselbe dem herkommen gemäß bewillkommen wollte. Es ließ sich aber der printz gegen denselben entschuldigen, daß weyl er ietzt incognito und nur als ein graf von Bröna hier durch passiren wollte, dergleichen complimenten unnöthig weren. Da ihm aber der herr syndicus vor sich zusprechen wollte, sollte ihme solches lieb seyn. Hierauf kahm derselbe auch alleine, machete im nahmen des raths ein compliment, gratulirte dem printzen zu seiner reyse und bliebe bey der mahlzeit. Als dieselbe geschehen und sich der printz wieder auf den weg machen und den wirth abzahlen lassen wollte, vermeldete derselbe, daß der rath ihr fürstliche durchlaucht auslösen würdte. Worbey es auch nach gethaner verehrung in das haus sein bewenden hatte, und reysete der [fol. 12] printz umb 2 uhr nachmittage wieder aus Braunschweig auf Wannebrügk 2 stunden, Fährdorf [Vordorf] 2 stunden, Ripsbüttel [Ribbesbüttel]1 stunde, Giffhorn 2 stunden (videatur topographie sape allegata fol. 90) und kahmen abends glock 6 zu Gamsen auf der Lüneburger /leyde an... Ernst der Fromme hat diese Reise seines Sohnes Albrecht mit der pedantischen Gründlichkeit, die seinem Wesen zu eigen war, vorbereitet, um nichts dem Zufall überlassen zu müssen. Dies, obwohl sein zweitältester Sohn Albrecht schon im 22. Lebensjahr stand - immerhin ein Alter, in dem andere Zeitgenossen, z. B. Ludwig XIV. von Frankreich ( ), bereits bedeutende Königreiche lenkten. Sorgfäl-
86 "... und besahe, was noch denckwürdiges darinne wahr... " 89 tig und eigenhändig erarbeitete der Herzog vorab sogar eine mehrseitige Instruclion wornach sich der veste, unser cammerjuncker und lieber getreuen Johann Balthasar von Gablkoven auf der mit unserem freundlich geliebten sohn Albrecht, hertzogen zue Sachsen, nach Dennemarck und andere nordische königreiche bevorstehende reise, und ihrer darbey aufgetragenen direction und aufsicht in achten und zu halten hars. Der Jurist Johann Balthasar von Gabclkovcn ( ) war seit 1664 einer der Erzieher der Gothaer Prinzen und muss nun die volle Verantwortung für das Unternehmen tragen. Schließlich soll sich Albrecht... in unterschiedlichen seiner person und stande wohl anstehenden qualitäten üben, auch in etlichen zum regiment und haushaltung näthigen stücken, so fern sich dieselben auf das vaterland appliciren laßen, mehrere erfahrung erlangen, und also der mal einst in seinem künftigen beruf gottes ehre... möge befördern helfen. Von Gabelkoven hat nicht nur die knapp bemessene Reisekasse zu verwalten, damit alle unnöhige aufwendung vermieden bleibe..., und auf die Einhaltung von gottesfurcht und übung des christentums zu achten. Schwieriger dürfte es noch gewesen sein, den zu Hause knapp gehaltenen Prinzen von den allseits lockenden Versuchungen einer solchen Reise femzuhalten. Peinlich zu achten hat er daher auf den gesellschaftlichen Umgang Albrechts, der sich - ginge es nach den Vorstellungen seines patriarchalischen Vaters - kaum alleine bewegen darf,... damit nicht etwa böße exempel anderer hohen personen oder gesellschaft seinesgleichen und anderer leuthe, denen man gern zu gefallen leben wil, bey unserem sohne einige widrige impression causiren. - Die größte Sorge des misstrauischen Herzog bleibt allerdings, dass... das hauptabsehen dieser reise auf eine bloße kurzweil oder ersehung der raritäten hinauslaufen könnte 6. Auf Anraten des Vaters, der jedes Aufsehen, vor allem aber die damit verbundenen standesgemäß zu verursachenden Kosten vermeiden will, muss der Prinz dänisch und schwedisch lernen und anonym als Herzog von Bröhna reisen. Neben Gabelkoven hat er weitere erfahrene Weggenossen dabei: Hieronymus Brückner ( ), seit 1665 einer der Erzieher am Gothaer Hof und Verfasser des Reisetagebuchs 7, sowie den Theologen und Hofprediger Wilhelm Verporthen ( ), der die lutherische Angelegenheit an den besuchten Höfen vorzutragen hatte. Er sollte dem späteren Hofstaat Herzog Albrechts als Generalsuperintendent bis zum Umzug in die Coburger Residenz treu bleiben 8 Die im Thüringischen Staatsarchiv Gotha erhaltenen, sorgfältig abgehefteten und nach den Posten Zehrung, Pferde, Post ect. geordneten Rechnungsbelege, die persönlichen Briefe Albrechts und die Berichte seiner Begleiter sind nicht nur eine wichtige Ergänzung zum offiziellen Diarium, sondern in ihrer korrekten Nüchternheit auch eine unbestechliche kulturgeschichtliche Quelle über adeliges Reisen in der Barockzeit., Wie Anm. 2, fol. 249 ff. 6 Wie Anm. 2, fol. 249ff. 7 BECK (wie Anm. 1), S. 9. Thilo KRIW, Das geehrte und gelehrte Coburg. Bd. 1, Coburg 1927, S. 75 ff.
87 90 Annette Faber Prinz Albrecht selbst geht seine Reise pragmatisch an. Er kauft - erst am Tag der Abfahrt und noch in Gotha - für 10 Groschen zwei Geldbeutel, eines zum golde, und den anderen zum anderen gelde, sowie zwei Anlegeschlösser für seine Koffertruhe. Ausgaben, die als Teil der Reisekosten gleich zu Beginn penibel vermerkt sind und die ihm zu wirtschaften helfen sollen. Später erwirbt er weitere geldsäcke, die empfangenen WechselgeIder darinnen zu verwalten, sicher eine Erleichterung in einem Deutschland der tausend kleinstaatlichen Währungen. Welche Vorbereitungen er sonst noch traf, wissen wir nicht 9 Am 4. Mai 1670 geben drei seiner Brüder Albrecht das zeremonielle Geleit aus der Stadt. Friedrich ( ), der älteste von ihnen, notiert am gleichen Tag in sein Tagebuch: zog Bruder Albrecht mittden gabelkofen und kirchenrath in Dennemarck, ich gab Ihnen das gleid bis Wiege/eben... NB wahr Jahrmarck wie gewöhnlich auf dem Marckt Der H. Vatter war in deßen nach Georgenthal gefahren 10. Am 7. Mai erreicht die Reisegruppe Wolfenbüttel, die erste Station der diplomatischen Mission. Schon unterwegs nimmt die Gesellschaft gerne den neuesten Reiseführer zur Hand, Matthäus Merians 1654 posthum erschienene und von Conrad Buno aufwändig illustrierte Topographia der hertzogthümber Braunschweig und Lüneburg. Sie ist mit ihren sorgfältig edierten Texten bestens geeignet, das historische und geographische Wissen des Prinzen zu vertiefen und auch unterwegs den Anforderungen seines Vaters zu genügen 11. Im Herzogtum Braunschweig-Lüneburg hatte nach dem Tod des kunstsinnigen Herzogs August d. J. ( ) sein ältester Sohn Rudolf August ( ) die Herrschaft übernommen, die er indirekt schon bald und ab 1685 offiziell mit seinem jüngeren, politisch aktiveren Bruder Anton Ulrich ( ) teilte. Selbstverständlich hatte Ernst der Fromme dem wolfenbüttelschen Hof die bevorstehende Ankunft seines Sohnes längst mitgeteilt und von dort erwartungsgemäß die höfliche Versicherung erhalten, dass man... herrn sohns hertzog Albrechts anherokunft zu unserer residentz mit verlangen erwarten... und... solche visite zu sonderbahren gefallen gereichen... werde 12 Mehr als befriedigt notiert das Diarium daher den zeremoniellen Empfang vor der Stadt. Rudolf August empfängt den Prinzen in Begleitung von sieben Kavallieren, achtzehn Reitern sowie dem jüngsten Grafen von Glücksburg und lässt sechs Böllerschüsse abfeuern. Nicht ohne Stolz berichtet Gabelkoven später nach Gotha, dass der Herzog ihnen mit 30 Pferden entgegen gekommen sei, sicher ein fürstlicher Anblick 13 Selbstverständlich wird der Prinz im Schloss untergebracht, seine Begleitung hingegen im Wirtshaus. Als nicht ganz standesgemäß musste es der jun- 9 ThStAGo, Kammer Immediate Nr. 1653b, Acta zue Her/zog Albrechts Reiße n. Dennemarck und Schweden vom 4. May 1670 mit Gott angetretten. Rechnungßbelege, fol Friedrich I. von Sachsen-Gotha und Altenburg. Die Tagebücher Bd. Tagebücher bearbeitet von Roswitha JACOBSEN unter Mitarbeit von Juliane BRANDSCH. Weimar 1998, S Topographia und eigentliche Beschreibung der vomembsten Stäte, Schlösser auch anderer Plätze und Örter in denen Hertzogthumer(n) Braunschweig und Lüneburg... Bey Matthei MERlANS Erbe[nl, MDCLlIII [Frankfurt IZ Wie Anm. 9, fol. 287 und 302: Briefwechsel vom und Il Wie Anm. 9, fol. 301, Brief Gabdkovens an Herzog Ernst vom
88 "... und besahe, was noch denckwürdiges darinne wahr... «91 ge sächsische Herzog daher empfinden, dass er, der solchermaßen geehrte Staatsgast, allabendlich dem wachhabenden Major die Parole zu geben hatte, was er mit dem Unterton leichter Empörung nach Hause berichten lässt. Trotz des Verweises auf die ausführliche Beschreibung Wolfenbüttels bei Merian kann sich Albrecht (oder sein Sekretär Brückner) eine fast schon persönliche Bemerkung über die zwar geschichtsträchtige, aber letziich doch altmodisch winckelichte und irregu/are Residenz nicht verkneifen. Man war schließlich in Gotha zu Hause, wo das 1643 bis 1655 neu erbaute, imposante Schloss Friedenstein als früheste deutsche Dreiflügc1anlage alle Anforderungen an eine zentralistisch-moderne Residenz erfüllte. Interessanter als das aus einer mittelalterlichen Wasserburg entstandene Wolfenbütteler Schloss erscheint dem Prinzen allemal die Menagerie fremder Tiere, die hier offenbar frei herumlaufen dürfen. Am Sonntag dem 8. Mai 1670 beginnt das offizelle Programm mit einer Messe in der schönen und großen Marienkirche. Ab 1608 von Paul Francke (1537/ ) erbaut, galt sie schon den Zeitgenossen als das erste bedeutende Gotteshaus des Protestantismus. Für Albrecht ist sie jedoch keinesfalls der Ort vorbildhaft moderner, ja geradezu aufregend politischer Architektur (wie der heutige, gebildete Leser meinen möchte), sondern lutherischer Gottesdienste. Pflichtbewusst lässt er, der gut erzogene Sohn Ernsts des Frommen, für die Daheimgebliebenen sogar die Prediger notieren - mit Brandanus Dätrius ( ) hört er hier gewiss einen der wichtigsten Theologen seiner Zeit. Übrigens sind auch die seinem Stand entsprechenden Gaben in den Klingenbeutel stets peinlich gen au in den Rechnungsbe1egen verzeichnet. Im Anschluss an die nachmittägliche Predigt besichtigt Albrecht zusammen mit Rudolf August die fürstlichen Begräbnisse unter der Kirche. Lange steht er hier vor dem Sarg des vier Jahre zuvor verstorbenen Herzogs August, der zu diesem Zeitpunkt nach einer Verordnung Rudolph Augusts noch außerhalb der eigentlichen Gruft aufgebahrt war. Man kann nur hoffen, dass Sekretär Brückner die lateinische Widmungsinschrift auf dem aufwändigen Sarg nicht vor Ort im Schein einer Fackel abschreiben musste, sondern sich den langatmigen Text bei Hofe noch einmal geben lassen konnte l4. - Ob Albrecht damals schon ahnte, dass er vor dem Sarg seines späteren Schwiegervaters stand? Schließlich sollte er 1676 Marie Elisabeth ( ) heiraten, die jüngste Tochter Herzog Augusts aus dritter Ehe und seit 1668 verwitwete Gemahlin Herzog Adolph Wilhelms von Sachsen-Eisenach. Lernte er die junge Witwe vielleicht bei dieser Reise am Wolfenbütteler Hof kennen (und lieben)? - das unpersönliche Diarium schweigt dazu eisern, listet dagegen nüchtern weitere Besichtigungen auf. Zum Beispiel den nachmittäglichen Ausflug in den Braunschweiger Dom mit seinem damals noch beinahe vollständigen mittelalterlichen Reliquienschatz. Von Wolfenbüttel nach Braunschweig war die Reisezeit auch im 17. Jahrhundert schon so kurz, dass sich die Fahrt am 9. Mai 1670 lohnte. Regelmäßig und selbst sehr begeistert 14 Wie Anm. 9, fol. 3. Bei der Besichtigung der Hauptkirche in Wolfenhüttel wird insgesamt über 1 Reichsthaler Trinkgeld bezahlt. - Vgl. die ausführliche Beschreibung des Sarges und die Abschrift des Textes bei Mechthild WISWE, Die Särge im Grahgewölbe. In: Die Hauptkirche Beatae Mariae Virginis in Wolfenbüttel. Forschungen der Denkmalpflege in Nds. Bd. 4, hg. v. Hans MÖLLER. Hannover 1987, S. 199 f.
89 92 Annette Faber führte Herzog Anton Ulrich die dort verwahrten Reliquien aus dem Welfenschatz - im Jahr 1482 werden 1220 Reliquien von 286 Heiligen genannt - seinen interessierten Besuchern vor. Zum Schrecken des machtlosen Stiftskapitels forderte er davon immer wieder "Leihgaben" ein, die er zum Teil seiner eigenen Sammlung einverleibte, aber auch gern verschenkte l5 Die mit edelgesteinen reichbesetzte[ n 1 heyligthümer mögen in dem jungen Lutheraner wohl gleichermaßen Ehrfurcht und heilige Schauer, vor allem aber Neugier ausgelöst haben. Einige Tage später macht Albrecht nochmals in Braunschweig Station um sich allein alles noch genauer ansehen zu können. - Den Ausflug nach Braunschweig nutzen Albrecht und seine Gastgeber zu einem Besuch in der Buchhandlung von Erasmus Carlson. Hier kauft der Prinz eine weitere Ausfertigung von Merians Topographia des Fürstentums Braunschweig und Lüneburg für 5 Reichsthaler und 12 Groschen und lässt sie auch binden. Außerdem erwirbt er die von Martin Zeiler ( ) verfasste Beschreibung der 10 Reichskreise als weitere Reiselektüre 16. Nicht unerwähnt lässt das Diarium die intimen Abendessen auf der Hedwigsburg, dem nahen Landsitz und privaten Refugium Rudolf Augusts 17. Hier - abseits der lästigen, dem Bruder übertragenen Regierungsgeschäfte - verbrachten er und seine Gemahlin Christiane Elisabeth gerne ihre Zeit in der eigenen Bibliothek 18 Der Besuch dürfte nicht nur eine willkommene Abwechslung, sondern gleichermaßen eine Auszeichnung und ein Beweis für den freundschaftlichen Umgang mit dem älteren Herzog gewesen sein. Als private Pfarr- und Schlosskirche hatte Herzog Rudolf August im nahen Dorf Kissenbrück 1662 bis 1664 die Kirche St. Stephan erbauen lassen. Anton Reinhardt ( ) entwarf diesen ersten Zentralbau im Herzogtum Wolfenbüttel, der als eine der ältesten und bemerkenswertesten lutherischen Predigtkirchen gilt. Eine zweistöckige Empore schuf ausreichend Platz für die Gottesdienstbesucher und ermöglichte allen den Blick auf die reichverzierte Kanzelaltarwand mit der Darstellung der Leidenswerkzeuge Christi. In Anlehnung an französische Vorbilder bündelt der kreuzförmige Grundriss im Kanzelaltar Theologie und Architektur l9 Dies ist Albrecht sicher nicht nur aus Höflichkeit gegenüber seinen Gastgebern neben einer ausführlichen Beschreibung auch die einzige Zeichnung im Diarium wert. Am meisten beeindruckt hat Albrecht in Wolfenbüttel jedoch die in ganzt Europa berühmte Bibliothek des leidenschaftlichen Bücher- und Kunstsammlers Herzog Au- " Andrea BOOCKMANN, Die verlorenen Teile des Welfenschatzes. Göttingen 1997, S. 65,91,98 und Nach der Eroberung Braunschweigs durch die Truppen Herzog Rudolf Augusts am musste das Stiftskapitel den Kirchenschatz an die herzogliche Geheime Kammer abliefern. Sie wird als Gegenleistung dem verbündeten Herzog lohann Friedrich von Hannover zugesichert. So konnte der drohende Verkauf abgewendet und die Sammlung beinahe geschlossen erhalten werden. " Wie Anm. 9, fol. 2v; Martin ZEIL(L)~R, Von den zehen deß H. Römischen Teutschen Reichs=Kraisen. 2. Auflage Vlm ltiti5. 17 Schloss Hedwigsburg wurde 1944 durch Kriegseinwirkung total zerstört und nicht wieder aufgebaut. 18 Mechthild RAABE, Die fürstliche Bibliothek in Wolfenbüttcl und ihre Leser. Wolfenbüttel 1997, S Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von UIrich THIEME und Felix BECKER, 2. Auflage 1992, Bd. 27/28, S. 121.
90 "... und besahe, was noch denckwürdiges darinne wahr... " 93 gust d.j., die wohl zu Recht als größte des 17. Jahrhunderts bezeichnet wird. Der Herzog hatte sie über der restaurierten Rüstkammer des alten Marstalls unterbringen lassen und alles fürstlich und zierlich mit grossen unkosten angestellt und ordinieret. Unabhängig von der ausführlichen, wohlwollenden Beschreibung und den Abbildungen der Bibliothek in der Topographia 2o - schließlich hatte Herzog August diesen Band durch kostenlose Lieferungen von sechs Zentnern Kupfer tatkräftig gefördert 21 - widmet der Prinz dieser damals schon legendären Einrichtung, deren Besuch kaum ein vornehmer Reisender seiner Zeit ausließ, einen detaillierten Bericht. Er kennt die von dem berühmten Helmstädter Professor und Braunschweig-Wolfenbütteler Rat Hermann Conring ( ) herausgegebene Publikation Epistola de Bibliotheca Augusta, Wolfenbüttel 1661, und begeistert sich über die in Jahrzehnten konsequent zusammengetragenen mehr als Bände. Besonders ihre zugegebenermaßen etwas umständliche Katalogisierung interessiert ihn sehr, auch wenn Albrecht - wie die Erben und andere gelehrte Zeitgenossen - die nach Formaten geordnete, ästhetischen Gesichtspunkten folgende Aufstellung modern gesagt "unpraktisch" findet und ihren Sinn nicht mehr ganz nachvollziehen kann. Fast ungläubig berichtet das Diarium von dem seit 1666 angestellten bibliothecarius, dem Theologen David Hanisius (gest. 1681). Ihm sind sogar würcklich noch zwei bis drei Kammerschreiber, u.a. der Sekretär Johann Heinrich Arlt, und ein Handlanger zur Seite gestellt 22. Obwohl auch Ernst der Fromme ab 1647 eine bedeutende Bibliothek im Westturm von Schloss Friedenstein angelegt hatte, mit ständigen Ankäufen ganzer Sammlungen vervollständigte und 1657 eine erste Katalogisierung vorgenommen worden war, brachten die Wolfenbütteler Verhältnisse den Prinzen zum Staunen 23 Er lässt sich die ausführliche Besichtigung vier Reichsthaler an Trinkgeldern für den fürstl. bibliothecario kosten und darf später - gegen eine kleine Zahlung - auch Bücher entleihen 24 Weichen Bänden er seine Aufmerksamkeit schenkte, ist nicht mehr zu ermitteln; die seit 1664 erhaltenen Ausleihbücher erwähnen Prinz Alhrecht nämlich nicht 25 Auch die privaten Sammlungen Anton Ulrichs werden besichtigt. Offenbar nahm dieser sich aber keine Zeit für den Gast aus Gotha, sondern überließ dies einem Kerl, der über Herzog Anton Ulrichs Kunstcammer bestellt wa,z6. Der außerordentlich kunstsinnige Herzog hatte sich seit 1663 in seinen privaten Gemächern im sog. Kleinen Schloss ein eigenes Sammlerkabinett eingerichtet und unabhängig von seinem 20 Topographia (wie Anm. 11), S Bücher und Bibliotheken im 17. Jahrhundert in Deutschland. Wolfenbütteler Schriften zur Gesch. des Buchwesens. Bd. 6, hg. von Paul RAABE. Hamburg 1980, S Paul RAAUE, Herzog August und Merians Topographie. In: Sammler Fürst Gelehrter, Herzog August zu Braunschweig und Lüneburg, Ausstellungskatalog, Wolfenbüttel 1979, S RAAUE (wie Anm. 1/l) S. 36 ff. H Juliane Ricarda BRANDSCH, Die Friedensteinische Kunstkammer Herzog Ernst I des Frommen von Sachsen-Gotha und Altenburg. In: Ernst der Fromme ( ), Bauherr und Sammler. Katalog zum 400. Geburtstag. Gotha 2001, S. 23 f. 24 Wie Anm. 9, fol Mechthild RAABE, Leser und Lektüre vom 17. zum 19. Jahrhundert, die Ausleihbücher der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel Teil C, Bd. 1, Chronologisches Verzeichnis München 1998, S Wie Anm. 9, fol. 3.
91 94 Annette Faber o Abb. 4: "Abgott Crodo zur Harsburg". Federzeichnung ; Braunschweig, Herzog Anton-Ulrich Museum; Repra: Museumsfoto: lutta Streitfel/ner. -! t.t Abb. 5: Grabbeigaben Kaiser Lothars IlI., Braunschweig, Herzog Antan-Ulrich Museum, Inv. Nr. MA 64/65, 1137; Repra: Museumsfata Bernd-Peter Keiser.
92 "... und besahe, was noch denckwürdiges darinne wahr... " 95 Vater viele italienische Gemälde, sog. schildereyen, Kupferstiche, Bücher, vor allem Architekturtraktate, und andere Kostbarkeiten zusammengetragen 27 Hier zeigt man Albrecht die vorchristlich-germanische Götzenfigur Kroto, als Crodo zur Haßburg noch in einem illustrierten Inventar Herzog August Wilhelms ( ) aufgeführt 28 Zu den bestaunten Raritäten gehören außerdem die aus dem Grab in Königslutter geborgenen Beigaben des 1137 verstorbenen Kaisers Lothar III. von Supplinburg ( ). Stellvertretend für die kostbaren Reichsinsignien waren ihm ein schmuckloser Reichsapfel und eine kleine Inschrifttafel aus Blei - deren Text getreulich abzuschreiben selbstverständlich nicht vergessen ist - beigelegt worden. Die 1620 aus dem Sarg entnommen Gegenstände sind heute im Museum der Burg Dankwarderode, Braunschweig, ausgestellt2 9 Als angehender Regent und Staatsmann blüht Prinz Albrecht jedoch erst richtig auf, als ihm ein Iieutenant nach den intellektuellen Genüssen endlich die über der Bibliothek gelegene Rüstkammer und das von Paul Francke erbaute Zeughaus zeigt3o. Das Diarium wird nicht müde, die hier verwahrten viel alten turniersättel, künstlichen pistohlen, köstlichen alte Sätel und andere Kostbarkeiten zu beschreiben. Auch die mit Edelsteinen geschmückten Kutschen der Herzöge rufen sein Entzücken hervor: etwa der rdch bestickte Brautwagen der polnischen Prinzessin Sophia ( ) aus dem Jahr 1556, der zweiten Ehefrau Herzog Heinrichs des Jüngeren, oder die Leibkutsche Herzog Augusts dj., der sich als passionierter Uhrensammler inwendig in der mitten der decke eine uhr hatte anbringen lassen. Vergleichbar ist diese Begeisterung vielleicht mit den glänzenden Augen, die die Luxuskarossen unserer Zeit hervorrufen. - Sachkundig und ganz in seinem Element, beurteilt Albrecht auch das Zeughaus. Dessen Besichtigung stellte ein fürstliches Vergnügen dar, das sicher nur unter befreundeten Adelshäusern möglich war, und ihm auf seiner Reise nicht immer vergönnt sein sollte. Das in Wolfenbüttel angehäufte hochmoderne Waffenarsenal verschiedenster Kanonen samt Zubehör, so zwey überaus lange und dicke eiserne Stücke... darunter das eine das allergrößeste und längste in ganz Deutschland ist, fand sogar Eingang in die Topographia Merians 3l. Eines dieser Geschützrohre ist möglicherweisse jene Feldschlange mit dem bezeichnenden Namen der Wilde Mann, die 1586 im Auftrag Herzog Julius von Braunschweig aus einzelnen Eisenstäben zusammengeschmiedet worden war. Dieser Hinterlader mit Keilverschluss stellte eine besondere technische Rarität dar, die dem waffenkundigen Prinzen bestimmt nicht entging. Das berühmte Geschütz gelangte 1875 zusammen mit zwei Bockbüchsen aus dem herzoglichen Museum in Braunschweig in das Berliner Zeughaus, wo es heute 27 Hel7.og Anton Vlrich von Rraunschweig, Leben und Regieren mit der Kunst. Ausstellungskatalog HAUM, Braunschweig 1983, S. 18 ff., 153, 160. '" Rudolf-Alexandcr SCHÜTTE, Die Kostbarkeiten der Renaissance und des Barock - Pretiosa und allerley Kunstsachen aus den Kunst- und Raritätenkammem der Herolöge von Braunschweig-Lüneburg aus dem Hause Wolfenhüttel. Braunschweig 1997, S Kunst dl's Mittelalters. HAUM Braunschweig, Burg Dankwarderode. Braunschweig 1981, Inv. Nm. MA 64, 65, Kat. Nr. 12, S. 9 f. 30 Wie Anm. 9, fol3. 31 Topographia (wie Anm. 11) S Der entsprechende Text wurde allerdings von der herzoglichen Verwaltung selbst geliefert.
93 96 Annette Faber Abb. 6: Geschütz" Wilder Mann", Detail, 1586, aus dem Zeughaus Wolfenbüttel, Berlin, Zeughaus Museum. noch zu bestaunen ist. In Wolfenbüttel hat sich von den Prunkwaffen genauso wenig erhalten wie vom legendären herzoglichen Fuhrpark 32 - In den Bereich der vom Diarium beschriebenen Militaria gehört auch das Uniformwesen am Wolfenbütteler Hof. Genau notiert sind die farbigen Aufschläge an den Ärmeln der Waffenröcke, die mit jeder der fünf Kompagnien der Garnison wechseln. Ein farbenfroher, beinahe ballettartiger Anblick muss es gewesen sein, wenn bei der täglichen Parade von ieder compagnie mann... untereinander vermenget werden. Dass es in Wolfenbüttel vor allem das diplomatische Anliegen Ernst des Frommen vorzutragen galt, bestätigt das Diarium nur indirekt. Trotz der gebotenen Freundlichkeit der Herzöge gegenüber dem Prinzen ließ man ihn doch überraschend lange auf eine entsprechende dimission wanen, wie Gabelkoven schließlich nach Gotha berichten muss 33. Erst am 10. Mai thate der herr kirchenrath [Verporthen] auf der cantzley seine proposition. Rudolf August, selbst tief religiös, war von der Bedeutung des geplanten Collegium Hunnianum zwar überzeugt, maßgeblich fördern wollte er es mit Rücksicht auf bestehende Empfindlichkeiten zwischen den lutherischen Staaten aber nicht. In Wolfenbüttel widmete sich Prinz Albrecht schließlich nicht nur seinen höfischen und diplomatischen Verpflichtungen sowie der von seinem Vater erlaubten ersehung der raritäten; er scheint sich nach sieben Reisetagen auch erstmals der Körperpflege 32 Freundliche Mitteilung Dr. QUAAS, Berlin, Deutsches Historisches Museum. 33 Wie Anm. 9, fol. 322, Brief Gabelkovens an Herzog Ernst aus Hamburg vom
94 "... und besahe, was noch denckwürdiges darinne wahr... " 97 hingegeben zu haben. Am Gothaer Hof auf Anweisung Ernsts des Frommen zu strenger, für die Zeit ganz ungewöhnlicher Reinlichkeit bis hin zur täglichen Mundhygiene erzogen, muss dies dem Prinzen ein echtes Anliegen gewesen sein 34 Die Rechnungen verraten, dass er am 11. Mai zum Barbier ging, was ihn 18 Groschen kostete, und seine Unterwäsche, das weißzeuge, für 22 Groschen und 8 Pfennige zum Waschen gab 35 Am 14. Mai reist die Delegation aus Gotha ohne Eile weiter, Albrecht speist nochmals bei Hofe, verabschiedet sich vom erkrankten Anton Ulrich und lässt sich zeremoniell von Rudolf August verabschieden. Dieser gibt Albrecht unter nunmehr acht Böllerschüssen (zur Begrüßung waren es nur sechs Böller gewesen!) das Geleit aus der Stadt und stcllt ihm aus eigenen Beständen bis Hamburg eine Kutsche zur Verfügung. Der von Herzog Ernst angeordnete Verkauf der eigenen Pferde war nämlich an deren schlechtem Zustand gescheitert, sie waren schlichtweg zu alt und unverkäuflich 36 Das wenig repräsentative Gothaer Gefährt samt Pferden hatte man mit Trompeter Rauchmaul schon am 11. Mai in Richtung Heimat verabschiedet, diesem für die Rückreise 12 Reichsthalcr mitgegeben 37 Er kam schon drei Tage später zusammen mit einem Brief Albrechts an Bruder Friedrich wieder in Schloss Friedenstein an. Seiner Mutter hatte Albrecht bei dieser Gelegenheit einen sinken [Schinken], knackwürste und vier große Sekrebse mitgeschickt, wie Friedrich seinem Tagebuch - nicht ohne Appetit - anvertraut 38 ; Delikatessen war man am sparsamen Hof Ernsts des Frommen schließlich nicht gewohnt. Da die westfälischen Spezialitäten nicht in den Rechnungsbüchern erscheinen, möchte man fast vermuten, es handle sich um Aufmerksamkeiten des Wolfenbütteler Herzogshauses. Auf dem Weg nach Hamburg erlaubt es sich die Reisegesellschaft trotz der strengen Anweisungen Herzog Ernsts nochmals in Braunschweig, der Stadt Heinrichs des Löwen ( ), halt zu machen. Angekommen logiert man sich - nun wieder incognito - bei Bürgermeister Dohausen ein. Da der Prinz beim Aufbruch in Wolfenbüttel sein Nachtzeug vergessen hatte, muss sofort ein Reiter zurückgeschickt werden, um dieses unverzichtbare Reiseaccessoire beim dortigen Bettmeister abzuholen 39 Die Gesellschaft nimmt sich genügend Zeit, die am 9. Mai bei Erasmus Carlson zurückgelassene Topographia fertig gebunden abzuholen und ganz privat die alte Stadt zu besichtigen. Als gälte es einen eigenen Cicerone zu verfassen - oder musste hier nur der pädagogischen Anweisung Ernst des Frommen entsprochen werden? -, widmet sich das Diarium wiederum der ausführlichen, seitenlangen Wiedergabe historischer Inschriften. - Der Prinz lässt sich vom Kirchner zum zweiten Mal den Dom St. Blasius mit dem berühmten kirchenschaz zeigen und zahlt dafür gerne ein Trinkgeld 4o Lange muss es gedauert haben, die geschichtsträchtige, im niedersächsischen Dialekt verfasste Tabula Blasiana abzuschreiben. Die hölzerne, mit Pergament bespannte Tafel, 34 Jutta SIEGERT, Alltag der herzoglichen Familie. In: Ernst der Fromme (wie Anm. 1) S J5 Wie Anm. 9, fol. 4 und 4v. 36 Wie Anm. 2, fol. 261, Nebenpuncta. 37 Wie Anm. 9, fol. 2. '" JACOBSEN (wie Anm. 10) S Wie Anm. 9, fol. 3v. 40 Wie Anm. 9, fol. 3v.
95 98 Annette Faber wohl zwischen 1514 und 1520 entstanden, hing 1670 noch im Chor nahe der Fürstengräber von Heinrich dem Löwen und seiner Gemahlin Mathilde. Die neueste Forschung wertet sie als posthumen Nekrolog, da die Grabmäler seibst keine überlieferten Inschriften aufwiesen. Die Tafel wurde 1707 in die Sakristei gestellt und gilt heute als verschollen. Die bisher früheste vollständige Abschrift datiert in das Jahr ; die Wiedergabe im Reisediarium von 1670, noch dazu vom niedersächsischen Platt in's barocke Hochdeutsch übertragen, dürfte eine der Forschung bisher unbekannte, noch ältere Variante des Textes darstellen. Man kann davon ausgehen, dass Sekretär Brückner auf eine damals schon vorhandene Abschrift zurückgreifen konnte; ist es doch schwer vorstellbar, dass er im dunklen Dom mit Papier, Feder und Tintenfass stand, den schwierigen Originaltext gleichzeitig entzifferte und schreibend übersetzte, um ihn dann auch noch mit vor Ort gehörten Kommentaren zu versehen. So gibt das Reisetagebuch dem modernen Kunsthistoriker einen Hinweis auf das nach 1173 entstandene, romanische Imerward-Cruzifix. Es wurde im 17. Jahrhundert mit der legendären englischen Prinzessin Era in Verbindung gebracht, die sich in einen bärtigen Mann verwandelt haben soll, um den Nachstellungen ihres eigenen Vaters zu entgehen - mittelalterliche Legenden, die es in der aufgeklärt protestantischen Welt des Gothaer Hofes nur noch hinter vorgehaltener Hand gegeben haben dürfte 42 - Mit den historischen Irrtümern der Tafel, die erst späteren Jahrhunderten auffielen, beschäftigt sich der Schreiber und Kommentator verständlicherweise nicht - er beschränkt sich darauf, den historischen Text für die daheim gebliebenen Leser verständlich zu machen und mit Geschichten aus Braunschweig anzureichern. Hautnah der mittelalterlichen Reichsgeschichte auf der Spur, darf die Reisegesellschaft die Besichtigung des 1166 gegossenen Braunschweiger Löwen nicht vergessen. Der große, ährene übergülte löwe mit aufgesperetem rachen vor der renovierten Burg Dankwarderode, damals Mos,- Most- oder Marshaus genannt 43, war erst 1616 restauriert worden. Davon zeugt die zu Füßen des Löwen angebrachte Steintafel, deren Text das unermüdlich alle geschichtlich bedeutsamen Inschriften überliefernde Diarium als bisher früheste erhaltene Quelle der Nachwelt erhalten hat 44 Aber - sollte der beflissene Brückner etwa vergessen haben, die ebenfalls mit einer Widmung versehene, an Heinrich den Löwen erinnernde Inschrift auf der Brust des Löwen abzuschreiben? Hier könnte das Reisetagebuch von 1670 indirekt jene Theorie unterstützen, dass diese Kartusche tatsächlich erst im 18. Jahrhundert entstand Die Inschriften dcr Stadt Braunschweig bis Bearb. v. Andrea BOOKMANN. Wiesbaden 1993, Nr. 356, S. 218 bis 221. " Monika SOFFNER, Der Braunschweiger Dom. Passau 1999, S Topographia (wie Anm. 11) S. 58. HMosthaus"; Jürgen MERTENS, Die ncuere Geschichte der Stadt Braunschweig in Karten, Plänen und Ansichten. Braunschweig 1981, S. 61 ff. - Das 1635 restaurierte Mosthaus wurde 1763 weitgehend wieder abgebrochen. 44 Die Tafel von 1616 wurde 1858 durch eine neue ersetzt, das Original befindet sich heute im Städtischen Museum Braunschweig. - Gerd SPIES (Hg.), Der Braunschweiger Löwe. Braunschweig 1985, S. 51 und Abb. 20, Die Inschriften der Stadt Braunschweig von 1529 bis Gesammelt und bearb. v. Sabine WEHKING. Wiesbaden 2001, Nr. 746, S. 268 f.
96 "... und besahe, was noch denckwürdiges darinne wahr... «99 Wie schon vorher zitiert das Reisetagebuch auch in Braunschweig fleißig aus Merians Topographia, in der die Stadtgeschichte, besonders aber die Entwicklung der eigenständigen Stadtteile und ihrer Verwaltung mit vielen Details wiedergegeben ist 46 Selbstverständlich ist für den Prinzen auch hier der obligatorische Rundgang durch das Zeughaus, das einen großen Vorrath von allerhand gewehr bereit hält Neben Kuriosem, wie einer besonders schnell arbeitenden Mühle, und dem erbeuteten Zelt des dänischen Königs sowie allerhand historischer Waffen bekommt der Fremde trotz eines großzügigen Trinkgeldes von zwei Reichsthalern nicht allzu viel Militärisches, vor allem keine Kanonen, zu sehen 47 Stand doch die unabhängige und wohlhabende Bürgerstadt Braunschweig damals unmittelbar vor einem Krieg gegen die vereinten Häuser der welfischen Herzöge und ließ sich verständlicherweise nicht in die Karten, respective Waffenarsenale, blicken. - Albrecht nimmt sich stattdessen einen Führer und lässt sich als Privatmann ohne viel Aufhebens Braunschweig, eine der größten Städte Norddeutschlands, zeigen. Der Rat der Stadt bemüht sich auch dem als Graf von Bröhna auftretenden Prinzen gegenüber um standesgemäße Höflichkeit und begleicht im Wirtshaus die Rechnung des darob verdutzten Gastes. Diesem bleibt nur noch das obligatorische Trinkgeld, die verehrung in das haus, zu hinterlassen, dann setzt er am 15. Mai mit seinen Begleitern und der in Wolfenbüttel geliehenen Kutsche die Reise über Lüneburg und Hamburg in die nordischen Königreiche fort... Topographia (wie Anm. 11) S. 59 ff. 47 Wie Anm. 9, fol. 3.
97
98 Lauem auf den Vasallentod Das Ende der Herren von Bartensleben auf Schloss Wolfsburg 1742 von Martin Fimpel Verzweiflung, Verdrängung oder Zuversicht ruft der herannahende Tod bei den betroffenen Menschen hervor. Was empfindet aber ein Adliger, der nicht nur sein eigenes Lebensende vor Augen hat, sondern auch der letzte Überlebende seines uralten Geschlechts ist? Die Brisanz des Geschehens liegt nicht nur im Bewusstsein, der Letzte zu sein, sondern in der offenen Situation, die sein Sterben hinterlassen würde. Das Aussterben adliger Familien hat vielfältige Konsequenzen und zeugt Gewinner und Verlierer. Aus der Sicht des Historikers sind Verlierer ganz allgemein vor allem früh ausgestorbene Adelsfamilien. Denn sie haben traditionell einen schweren Stand in der Geschichtsschreibung, wenn sie nicht Kronen auf ihren Häuptern trugen oder zumindest Landesherren waren. Auch die auf Schloss Wolfsburg residierende Familie von Bartensleben teilt dieses Schicksal, obwohl sie jahrhundertelang zu den mächtigsten Adclsfamilien in den welfischen und branden burg-preußischen Territorien zählte. Erschwerend im Wolfsburger Fall kam sicher hinzu, dass die nationalsozialistische Stadtgründung 1938 viele Traditionen überdeckte. An die Stelle der alten ländlichen Gesellschaft trat in kürzester Zeit eine moderne und verwischte viele ihrer alten Spuren. Heute denkt kaum jemand daran, dass Wolfsburg etwas anderes bedeuten könnte als eine Industriestadt ohne weitreichende historische Wurzeln. Aber gerade hieraus entwickelte sich ein lehrreicher historischer Stoff. Schloss Wolfsburg wurde Mitte des 18. Jahrhunderts Schauplatz eines makabren Schauspiels um Spione, Intrigen und Tod. Es ist ein Modellfall für die komplizierten politischen Konstellationen in einer Grenz- und Konfliktzone des Alten Reiches. Machtpolitik, Lehnswesen und Reichsverfassung lassen sich hier in selten dramatischer Verdichtung veranschaulichen. Seit dem 14. Jahrhundert besaßen die Herren von Bartensleben das Schloss und umfangreiche Ländereien in seiner Umgebung!. Durch geschickte Seitenwechsel und 1 Urkundliche Ersterwähnung der Wolfsburg: Codex Diplomaticus Brandenburgensis A 17, XX, III, Damals war sie bereits im Besitz des Geschlechts derer von Bartensleben. Eine wissenschaftliche Geschichte dieses Adelsgcschlechts liegt noch nicht vor. Aber einige Darstellungen zur Geschichte Wolfsburgs befassen sich intensiver mit einigen Angehörigen der Familie: Bernhard GERICKE, Geschichte des Raumes Wolfsburg. Von den Anfängen bis zum Übergang des Besitzes an die Familie von der Schulenburg. Masch. Wolfsburg [1956J; Klaus-Jörg SIEGt'RIED (Hrsg.), Schloss Wolfsburg. Geschichte und Kultur. Wolfsburg 2002; DERS. (Hrsg.), Geschichte Vorsfeldes, Bd. 1. Vom Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts (Texte zur Geschichte Wolfsburgs 25). Wolfsburg 1995; Martin FIMPEL, Schloss Wolfsburg , in: Nds. Jb. für Landesgesch., Bd. 75,2003, S Dar-
99 102 Martin Fimpel Mehrfachvasallitäten gelang es den Bartenslt:ben, sich in einem schwierigen Umfeld mit zahllosen kriegerischen Auseinandersetzungen im späten Mittelalter zu behaupten. Wie andere Adelsfamilien in diesem Raum kommerzialisierten sie ihre Burg, indem sie Öffnungsrechte an Kriegsparteien verkauften. Sie erwarben auf diesem Wege zahlreiche Lehnsbesitztitel, die sie jahrhundertelang nicht mehr aus der Hand gaben 2 Ihre verstreuten Lchnsstückc aus welfischer, magdeburgischer und brandenburgischer Hand erstreckten sich von Wolfsburg im Süden bis nach Tangermünde in der östlichen Altmark 3 Zweifellos profitierte das Adelsgeschlecht bei seiner spätmittelalterlichen "Herrschaftsbildung" von der Konkurrenz zwischen Welfen und Brandenburg in diesem Raum. Ihre vielen Besitztitel retteten sie danach in eine Zeit, die sie mit kriegerischen Mitteln nicht mehr anfocht. Zu größerem Reichtum gelangten die Bartensleben, wie viele Adelsgeschlechter, besonders in der Zeit der hohen Agrarkonjunktur des 16. Jahrhunderts. Landbesitzer konnten damals dank des großen städtischen Bevölkerungswachstums riesige Gewinne erzielen. Signifikant für diesen Wohlstand ist der Beiname von Hans von Bartensleben, der als "der Reiche" in die Geschichte eingegangen ist. Er begann mit dem Ausbau der Wolfsburg zu einem großen Renaissanceschloss, das in dieser Form in weiten Teilen noch heute zu sehen ist und den historischen Anziehungspunkt der jungen Stadt Wolfsburg bildet. Durch eine bedeutende Armenstiftung mit Legaten in verschiedenen Städten der Region ist der Name Bartensleben bis heute dort ein Begriff geblieben 4 Das Kemgebiet der Bartensleben mit der größten Herrschaftsdichte lag zwischen dem Dorf Hehlingen südlich von Wolfsburg und Brome im NordenS. Hier regierten die Bartensleben nahezu wie Landesherren. Sie waren nicht nur Grundherren, sondern dominierten den Raum auch als Gerichts- und Patronatsherren. Wolfsburg war mit seinen Dörfern eine adelige Herrschaftsinsel, vor der auch das Vordringen des frühneuzeitlichen Staates weitgehend Halt machte. Die Zugehörigkeit zu den Territorien ihrer Lehnsherren, des Königs von Preußen, des Kurfürsten von Hannover und des Herzogs von Braunschweig-Wolfenbüttel war kaum spürbar. Die RechtssteIlung der Bartensleben gegenüber ihren Bauern unterschied sich kaum von derjenigen eines stellungen der besitzrechtlichen und genealogischen Entwicklung der Bartensleben sind im Zusammenhang mit dem Heimfall der Bartenslebischen Lehen an Braunschweig-Wolfenbüttel Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden: StA WF VII Hs Inzwischen ist auch eine von der Volkswagenstiftung geförderte und am Institut für Museen und Stadtgeschichte Wolfsburg sowie am Nds. Institut für Historische Regionalforschung Hannover entstandene und dort zugängliche Datenbank zur Geschichte des Schlosses Wolfsburg erarbeitet worden: Klaus FESCHE, Martin FIMPt:L, Martin STÖßER, Spezialinventar der archivalischen Quellen zur Geschichte des Schlosses Wolfsburg. Wolfsburg Zu dieser Praxis von Burgherren im Spätmittelalter: Peter-Michael HAHN, Fürstliche Territorialhoheit und lokale Adelsgewalt. Die herrschaftliche Durchdringung des ländlichen Raumes zwischen Eibe und Aller ( ). Berlin 1989, S. 52f. J Eine nach Lehnsherren differenzierte Auflistung der Bartenslebischen Lehen findet sich in: StA WF VII A Hs Nr. 91. Vgl. auch StA WF 27 Alt, Nr Zu Hans dem Reichen: SIEGFRIED, wie Anm. 1, S , Eine Karte zu den Bartenslebischen Besitzverhältnissen im Raum Wolfsburg zeigt: SIEGFRIED, Schloss Wolfsburg, wie Anm. 1, S. 88.
100 Lauern auf den Vasallen tod 103 Landesherren. Augenscheinlich kommt dies zum Ausdruck auf der Richtstätte der Hehlinger Feldmark, auf der die Bartensleben auch Todesurteile vollstrecken ließen 6 Das Lehnswesen als Fessel landesherrlicher Ziele Wie starb ein Adelsgeschlecht eigentlich aus? Eine scheinbar banale Frage. Es liegt doch auf der Hand, vom Aussterben zu sprechen, wenn der letzte Träger des Geschlechtsnamens verstorben ist. Bei näherer Betrachtung gerät diese scheinbare Selbstverständlichkeit allerdings ins Wanken. Biologisch-genetische Forschungen, die Änderungen des Namensrechts, Stärkung von Frauenrechten lassen auch den traditionellen Geschlechterbegriff stürzen, der von alters her nicht neutral, sondern sehr männerorientiert war. Veranschaulicht werden kann dies in der Rechts- und Sozialgeschichte an zahllosen Beispielen, so besonders auch anhand der Geschichte des Lehnswesens. Das mittelalterliche Reich entwickelte in der Karolingerzeit ein tausendjährig gültiges Rechts- und Sozialsystem, das auf dem sogenannten Lehnswesen fußte. Im engeren Sinn ist mit Lehnswesen die Verleihung eines Besitztitels, in der Regel von Grundbesitz gemeint. Der Lehnsgeber (Lehnsherr) verzichtet dabei auf die Nutzung von Grundbesitz zugunsten des Lehnsnehmers (Vasall), ohne dabei seine Besitzrechte auf Dauer völlig abzutreten. Im Laufe des Mittelalters gelang es den Vasallen, die Vererbbarkeit ihrer Lehen durchzusetzen. Zwar machte der Tod des Lehnsherrn oder des Vasallen erneute Belehnungsakte notwendig, doch waren dies Routineangelegenheiten, wenn legitime Nachkommen oder nahe Verwandte am Leben waren. Oft wurden die Lehnsbriefe auf einen Teil oder alle lebenden, männlichen Angehörigen eines Adelsgeschlechts ausgestellt, sogenannte Lehen zur gesamten Hand (Samtlehenf. Auf diese Weise verloren die Lehnsherren sowohl auf Reichs- als auch auf Landesebene erheblich an Machtvollkommenheit. Lehnsberechtigt waren allerdings nur Männer. Verstarb der letzte männliche Namensträger eines Geschlechts, so galt es im Rahmen des damaligen Lehnssystems als erloschen, auch wenn erbberechtigte Töchter noch lebten. Die dem verstorbenen Vasallen gehörenden, nicht allodialen Gebiete fielen an den Lehnsherm zurück ("Heimfall"). So lautete jedenfalls die Theorie des Lehnswesens 8 Wie kompliziert sich so ein Heimfall gestalten konnte, zeigt das Beispiel Wolfsburg Mitte des 18. Jahrhunderts. Karten zu den territorialen Verhältnissen in der Frühen Neuzeit konzentrieren sich oft nur auf äußere Abgrenzungen von Herrschaft und vereinfachen - aus nachvollziehbaren, pragmatischen Gründen - häufig die wahren Herrschaftsverhältnisse im 6 HStAH Hann 74 Fallersleben Nr belehnte Herzog August Wilhelm von Braunsehweig-Wolfenbüttel zugleich Achaz Günther und seinen jüngeren Bruder Gebhard Wemer von Bartensleben. StA WF 26 Alt Nr Knappe rechtsgeschichtliche Zusammenfassung des Lehnswesens: Ulrich EISENHARD, Deutsche Rechtsgeschichte. 2. Auf!.. München 1995, S. I!!.
101 104 Martin Fimpel Inneren eines Territoriums 9 Nur wenn sie die Ämtergrenzen aufführen und zugleich daneben auch die adligen Gerichte aufzeigen, deuten sie die unterschiedlichen Zugriffsmöglichkeiten des Landesherrn auf seine "Untertanen" an lo Die Territorialhoheit brachte den Fürsten in den Gerichtsbezirken des Adels kaum etwas ein. Der Adel war dort so stark privilegiert, dass er seine Bauern höchstens im Rahmen der sogenannten Landfolge (Arbcitseinsätze im allgemeinen Landesinteresse vor allem im Kriegsfall und Katastrophenfällen) für den Herzog arbeiten lassen musste. Genau diese starke Rechtsstellung des Adels innerhalb des eigenen Territoriums war für die Landesherren und ihren frühneuzeitlichen Staat problematisch. Denn der Adel entzog dem Fürsten nicht nur Befugnisse über Land und Leute, sondern vor allem auch erhebliche finanzielle Mittel. Allein die braunschweigischen Lehen der Herren von Bartensleben umfassten den Flecken Vorsfelde und 17 Dörfer überwiegend im Vorsfelder oder, wie er damals meist genannt wurde, Wolfsburger Werder 11, 10 Wüstungen, 6 Wassermühlen, 2 Windmühlen, 9 Teiche, 46 Holzungen, 16 Äcker, 19 Wiesen, 14 Krüge, 13 Zehnte l2 Sie erbrachten um 1740 jährlich fast Reichstaler an Einnahmen 13. Das weckte natürlich Begehrlichkeiten bei den Fürsten, die meist aufgrund aufwändiger Hofhaltung und zunehmender Militärausgaben hoch verschuldet waren. Die Staatsverschuldung allein des Herzogtums Braunschweig Wolfenbüttel stieg im 18. Jahrhundert auf atemberaubende 10 Millionen Taler l4 Aus fiskalischer Sicht war das Lehnswesen ein veraltetes System, das es zu überwinden galt. Preußen spielte dabei eine Vorreiterrolle verkündete der preußische König die Aufhebung der Lehen und zugleich ihre Allodifizierung. Auf den ersten Blick schien dies eine sehr adelsfreundliche Lösung zu sein, versprach es doch eine unabhängige Stellung vom bisherigen Lehnsherrn. Aber der einsetzende heftige Widerstand verdeutlicht, dass es in AdeIskreisen durch diese königliche Entscheidung auch viele Verlierer gab. Dies waren vor allem diejenigen, die Anwartschaften auf Lehen anderer erworben hatten. Darüber hinaus sollten die allodifizierten Lehen künftig besteuert werden. Zuvor reichte bei der Lehnsübertragung die Übersendung eines Lehnspferdes und eine einmalige Zahlung von höchstens einigen hundert Reichstalern aus l5 9 Vgl. die Karten über die welfische Territorialhoheit in: Horst-Rüdiger larck und Gerhard SCHILDT, Die Braunschweigische Landesgeschichte. lahrtausendrückblick einer Region. Braunschweig 2000, S. 453 und Vgl. die Karte über den Bartenslebischen Lehnsbesitz im Raum Wolfsburg, in: SIEGFRIED, Schloss Wolfsburg, wie Anm. I, S Beispiele für die Bezeichnung.. Wolfshurger Werder": StA WF K 7657 und StA WF 26 Alt Nr. 362, BI Eine Untersuchung der Lehnsstücke ergab jährliche Einnahmen in Höhe von Taler und 20 Gulden. StA WF 26 Alt Nr. 365 Bd. I, BI Peter ALBRECIIT, Das Zeitalter des Aufgeklärten Absolutismus ( ), in: H.-R. larck und G. SCHILDT, wie Anm. 9, S Gebhard Werner hatte neben einer Gebühr von rund 200 Reichstalern für seine Belehnung nach dem Regierungsantritt König Friedrichs 11. ein weißes Pferd und einen weißen Stock übersandt. StA WF 26 Alt Nr. 366, BI. 75.
102 Lauern auf den Vasallen tod 105 :'~r...i.,... ;..;...:'t..;': 26. :6?i::: 1: iib-", /',:J~'N'r' Abb. 1: Vorsfelder Werder. Cop. A. C. Conradi StA WF K 7657
103 106 Martin Fimpe/ Der Grundbesitz des Adels hätte sich durch diese Reform erheblich verteuert und auch die Arrondierungsperspektiven durch Lehnsanwartschaften wären weggefallen. Tatsächlich ließ sich dieses Gesetz zunächst gegen den adligen Widerstand nicht flächendeckend umsetzen, weil eine Prozessflut drohte 16 Dieses Scheitern ist auch ein Lehrbeispiel für das Misslingen der noch heute oft zu beobachtenden positivistischen Gleichsetzung von Gesetzen des absolutistischen Staates mit historischen Fakten. Der königliche Wille lief hier ins Leere. Die Allodifizierung musste zugunsten eines Kompromisses verschoben werden. Der Kompromiss sah vor, dass als nlehnskanon" in den ersten fünf Jahren nach einer Lehnserteilung jährlich 40 Reichstaler an die zuständigen Kriegs- und Domänenkammern zu zahlen war!7. Offensichtlich trug auch der Wolfsburger Schlossherr Gebhard Wemer von Bartensleben diesen Kompromiss mit. Denn er wurde vom preußischen König Friedrich Wilhelm I wieder belehnt 18 Wenn man sich vom Lehnswesen nicht gleich trennen wollte oder - wie gesehen - nicht konnte, gab es noch eine andere Möglichkeit, eine systemimmanente Variante, die teilweise zu grotesken Szenarien führte: Das gezielte Warten auf den Tod des Vasallen, mit dem sein Geschlecht im Mannesstamm erlosch. Zynisch gesprochen, konnte dies allerdings eine sehr zeitaufreibende Angelegenheit werden. Braunschweig Wolfenbüttel ging diesen Weg des Wartens, ja in der letzten Phase eines Entscheidungsprozesses sogar eines regelrechten nlauems" auf den Tod des Vasallen im Bezug auf die Lehen der Herren von Bartensleben!9. Gebhard Wemer von Bartensleben war seit den 1720er Jahren mit einer Zukunftsperspektive konfrontiert, die mehr und mehr realistische Züge gewann: Er war der letzte männliche Überlebende seines uralten Geschlechts, das seit über vierhundert Jahren die Region um Schloss Wolfsburg und weit darüber hinaus bestimmt hatte. Dabei hatte Gebhard Wemer scheinbar ausreichend für Nachwuchs gesorgt. Nun drohte dennoch das überraschende Ende. Die erhaltenen Stammbäume erhellen die Tragik des Geschehens 2o 1718 waren immerhin noch vier männliche Bartensleben am Leben. Gebhard Werner, Schatzrat des Herzogtums Braunschweig-Wolfenbüttel und damit dort Mitglied des einflussreichen Engeren Ausschusses der Landschaft (Ständevertretung), ein Bruder und zwei Söhne. Tragische Schicksalsschläge führten aber innerhalb nur eines halben Jahres dazu, dass das Geschlecht vor dem Aussterben stand. Im Juli 1719 starb Gebhards Wemers Bruder Achaz Günther. Im Dezember 1719 folgte sein Sohn Burkhard und im Januar 1720 der zweite Sohn Hans Danic!. Beide studierten an der Universität Halle und starben an einer Pockeninfektion 21 Das Geschlecht der Bartensle- 16 So jedenfalls argumentierte die Adelsfamilie von der Schulenburg gegen die Allodifizierung. HStAH Dep 82 Schulenburg-Hehlen 11 Nr StA WF 26 Alt Nr. 369 BI StA WF 26 Alt Nr Zu den Braunschweigischen Lehen der Herren von Bartenslehen vgl. Anm Stammtafeln sind in StA WF HS VII A 89a sowie StA WF Hs VII A 90, S enthalten. 21 StA WF 26 Alt Nr. 369 BI. 149.
104 Lauern auf den Vasallen tod 107 ben stand damit, wie es die zeitgenössische Fachsprache formulierte, "auf zwei Augen" und dem "äußerten Fall"22. Plötzlich schien der Heimfall der Lehen aus herzoglicher Sicht in greifbarer Nähe. Aber Erfolgsgarant für eine Arrondierung war diese Ausgangsposition für Braunschweig-Wolfenbüttel noch keineswegs. Denn es mussten noch etliche Unabwägbarkeiten ins Kalkül gezogen und Probleme beseitigt werden. Die Hauptschwierigkeit war zunächst, dass das Aussterben des Geschlechts von Bartensleben im Mannesstamm für den Heimfall der Lehen gar nicht ausreichte. Von alters her hatte sich nämlich die Praxis erhalten, Adelsgeschlechter aus politischen oder fiskalischen Gründen mit Anwartschaften (Expektanzen) auf Lehnsbesitz zu versorgen 23 Das blockierte natürlich den Zugriff für den Lehnsherrn über den Tod des besitzenden Vasallen hinaus. Im Fall Bartensleben galt dies sogar in doppelter Weise. Denn die Herzöge hatten nicht nur eine, sondern zwei Anwartschaften vergeben. Zunächst sollte der Reichshofrat von Danekelmann mit seinen männlichen Verwandten und Nachkommen in den Genuss der Lehen kommen, um dann nach deren Tod vom Schwiegersohn des letzten Bartensleben, Adolf Friedrich von der Schulenburg, beerbt zu werden 24 Bis 1735 wurden diese Anwartschaften von den regierenden Herzögen immer wieder bestätigt, obwohl der Zugriff auf die Lehen verlockend erschien 25. Danach kam aber mit Braunschweig-Bevern eine welfische Seitenlinie in Wolfenbüttel an die Regierung. Sie war entschlossen, alte Fesseln des Lehnswesen abzuschütteln. Ihre juristischen Berater negierten spitzfindig die Gültigkeit der Anwartschaften mit dem Argument, dass die früheren Herzöge des neuen braunschweigischen Herzoghauses die Expektanzen zwar für sich und ihre Nachkommen gewährt hätten. Die Beverner Linie sei jedoch mit diesen nur verwandt, stelle aber keine direkten Nachkommen. Entsprechend wurden die Anwartschaften nicht erneuert 26 Abgesehen davon, dass mit Widerstand der betroffenen Adligen zu rechnen war, hörten die Probleme damit aber nicht auf. Es reichte nicht aus, den Heimfall einfach zu erklären. Wolfsburg und die umliegenden Lehnsstücke befanden sich in einer umstrittenen Grenzzone zwischen Nachbarterritorien, unter denen Braunschweig-Wolfenbüttel das schwächste war. Preußen und Kurhannover hatten den Herzögen im 18. Jahrhundert längst den Rang abgelaufen. Deshalb galt es deren Position sorgfältig auszuloten, wenn es sein musste, auch auszuspionieren. Der Rivale in Hannover war das geringere Problem. Mit der exponierten Wolfsburg als magdeburgischem Lehen hatten beide welfischen Linien traditionell Schwierigkeiten und besaßen deshalb eine gemeinsame Grundhaltung, welche zur Zusammenarbeit führte. Noch 1721, als eine falsche Todesmeldung aus Wolfsburg das an- 22 StA WF 26 Alt Nr. 366 BI Walter DEETERs, Miszellen zum neuzeitlichen Lehnswesen im Fürstentum Wolfenbüttel, in: BsJb. 56, 1975, S DEETERs, wie Anm. 23, StA WF 26 Alt Nr. 366, RI Zu Adolf Friedrich von der Schulenburg: SIEGFRIED, wie Anm. 1, S S StA WF 26 Alt Nr. 362, BI Auflistung der braunschwcigisch-wolfenbüuelschen Lehen der Herren von Bartensleben: StA WF 26 Alt Nr. 362, BI DEETERs, wie Anm. 23, S. 179.
105 108 Martin Fimpel gebliche Aussterben der Bartensleben anzeigte, wollte Hannover mit Wolfenbüttel handstreichartig die Wolfsburg besetzen 27 Beide Linien erhoben Ansprüche auf die Wolfsburg selbst. Hannover reklamierte die Hälfte des Schlossareals, Wolfenbüttel sogar das Ganze für sich 2!!. Zwar hatten sich alle konkurrierenden Fürsten in Magdeburg 1668 auf einen Status Quo geeinigt, der die Anerkennung Wolfsburgs mit Hehlingen und Hesslingen als magdeburgisches Lehen beinhaltete. Dieser Vergleich wurde aber bewusst als Zwischenlösung eingestuft (zumal ihn die Regierung in Magdeburg gar nicht ratifiziert hatte). Die Parteien verständigten sich It!diglich darauf, im Konfliktfall auf Gewalt zu verzichten und eines der Reichsgerichte anzurufen 29 Im Schatten der preußischen Aufrüstung unter dem Soldatenkönig traten welfische "Eroberungspläne" später stärker in den Hintergrund, zumal Preußen seine Exklave meist mit einem kleinen Militärkontingent schützte 3o In den 1730er Jahren ging es nur noch um die Besitzergreifung der un- bzw. weniger umstrittenen Lehnsstücke. Wolfenbüttel konzentrierte sich deshalb auf den Heimfall seiner Lehen vorwiegend im Bereich des Vorsfelder Werders, des unmittelbaren Gebietes nördlich des Schlosses Wolfsburg 31 Dieses Ziel zu erreichen, war aber noch diffizil genug. Für Lösungsvorschläge besaß der Herzog eigens sogenannte Grenzräte als Experten für Grenzstreitigkeiten. Grenzrat Schlüter gab einen kenntnisreichen Lagebericht. Er kam zu dem überraschenden Ergebnis, dass die eigentliche Gefahr hier nicht von den Nachbarn ausging, sondern von den betroffenen Adelsfamilien Danekelmann und Schulenburg. Wenn es diesen gelang, eines der Reichsgerichte oder doch einen der Nachbarn für sich zu gewinnen, rückte die Besitzergreifung in weite Ferne. Er empfahl die handstreichartige Besitzergreifung eben wegen der Gefahr, dass die Adelsfamilien ihr Recht an einem der Reichsgerichte einklagen würden. Der Rechtsanspruch des Lehnsherrn musste seiner Ansicht nach durch diese Aktion untermauert werden. Angesichts der üblichen langen Dauer solcher Gerichtsverfahren konnte man sich die Nutznießung der Lehen zumindest vorläufig sichern 32. Außerdem bekam man so ein Druckmittel in die Hand, um die Adligen eventuell durch einen Vergleich abzufinden. Das war eine keineswegs seltene Lösung reichsgerichtlicher Auseinandersetzungen. Dieser wichtige Aspekt des gütlichen Vergleichs in der Reichsjustiz wurde lange verkannt. Historiker wie Juristen blickten verwundert auf die Schwächen der Reichsexekutive, die mit der augenfälligen Attraktivität der Reichsgerichte - dokumentiert durch die Flut von Verfahren - unvereinbar schien. Nicht in der vollen Durchsetzung von Rechtsansprüchen lag offensichtlich das Geheimnis des Erfolges 27 StA WF 26 Alt Nr. 363, BI. 8. Hannover wollte diese Chance nutzen, weil angeblich zu diesem Zeitpunkt keine preußischen Soldaten auf der Wolfsburg waren.,. StA WF 26 Alt Nr. 366, BI StA WF 26 Alt Nr. 366, BI. 73. JO StA WF 26 Alt Nr. 363, BI. 109; StA WF, Nr. 366, BI. 70 ff. 31 Historische Karten des Vorsfelder Werders: SIEGFRIED, Geschichte Vorsfeldes Bd. I, wie Anm. I, S. 47 und S StA WF 26 Alt Nr. 366, BI
106 Lauern auf den Vasallen tod 109 ti /!. I, \ ')-'''1~/dl!. \ I I, ", Abb. 2: Schloss Wolfsburg. Ausschnitt aus StA Wf K 7657 der Reichsjustiz. Gradmesser für deren Effizienz ist nicht ihre Vollstreckung, sondern die Zahl der erzielten Vergleiche im Zusammenhang mit Reichsgerichtsprozessen 33. Ausspionierung der Wolfsburg Seit Mitte der 1730er Jahre bereitete sich Wolfenbüttel auf die Übernahme des Vorsfelder Werders vor. Immer wieder wurde speziell der Amtmann zu Neuhaus bei gesundheitlichen Krisen des letzten Herrn von Bartensleben in Bereitschaft versetzt 34. Die Gesundheit Bartenslebens war seit langem angeschlagen. Bereits 1720 hatte sich 33 Martin FIMPEL, Reichsjustiz und Territorialstaat. Württemberg als Kommissar von Kaiser und Reich im Schwäbischen Kreis ( ). Tübingen 1999, S Zumindest wenn sowohl der Lehnsherr als auch der Vasall Reichsstände waren, endeten derartige Reichsgerichtsverfahren nicht immer glimpflich für den Lehnsherrn. Beispielsweise besetzte 1787 der Landgraf von Hessen die Grafschaft Schaumburg-Lippe, weil er den Nachkommen des verstorbenen Vasallen als nicht lehnberechtigt ansah. Der Reichshofrat setzte aber Preußen und Kurhannover als Kommissare ein, welche die Hessen zum Rückzug aus Schaumburg-Lippe zwangen. Vgl. Martin FIMPEL, Abhängigkeit von der Außenwelt. Vier kaiserliche Kommissionen in Schaumburg-Lippe im 18. Jahrhundert, in: Hubert HöING, 8chaumburg und die Welt. Zu Schaumburgs auswärtigen Beziehungen in der Geschichte. Bielefeld 2002, , bes. S StA WF 26 Alt Nr. 365 Bd. 1, BI. 2; 8tA WF 26 Alt Nr. 366, BI. 21 ff.
107 110 Martin Fimpe/ der damals berühmte Helmstedter Chirurg Lorenz Heister mit ihr auseinandergesetzt und eine mysteriöse Schlafkrankheit bei dem "dicken Cavalier", wie er ihn nannte, festgestellt. Selbst beim Sprechen verlöre Bartensleben immer wieder die Konzentration und schliefe sogar ein 35 Mit wochenlangen Brunnenkuren in Pyrmont und anderen Bädern versuchte Gebhard Werner, seinen Gesundheitszustand zu bessern 36 Immerhin gelang es ihm, sich auf diese Weise noch zwanzig Lebensjahre zu sichern. Im September 1741 verschlechterte sich der Zustand Gebhard Werners jedoch zusehends. Rasch platzierte Wolfenbüttel Kundschafter in der Umgebung des Schlosses, und es gelang auch, direkt in die Nähe des todkranken Gebhard Werner vorzudringen. Der Amtmann von Neuhaus, Lambrecht, wurde mit der Organisation der Geheimaktion beauftragt. Er wählte einen Spion aus, der ideale Voraussetzungen für diese Aufgabe mitbrachte. Denn er besaß einen Bruder, der im Dienst der Bartensleben stand, so dass ein Blick in die inneren Schlossverhältnisse und der unverdächtige Meinungsaustausch gesichert schien. Nachdem er vereidigt worden war, bekam er auch den Auftrag, ältere Leute ausfindig zu machen, die über die Braunschweigischen Grenzen Bescheid wussten 37 Zwar gab es in dieser Zeit schon ausreichend Vermessungen und Kartierungen, doch die unumstrittene Anerkennung der Grenzen war längst nicht in Sicht. Zeugen waren notwendig und vor allem Zeugen mit hohem Alter. Die lange Dauer eines Rechtszustands galt als Gradmesser für seine Gültigkeit. "Das alte Herkommen" war ein Leitbegriff für die Rechtsprechung im Alten Reich, über den man sich nicht ohne weiteres hinwegsetzen durfte. Zeugenaussagen Älterer unter Eid boten teilweise größere Beweiskraft als Schriftstücke oder sollten zumindest deren Glaubwürdigkeit unterstützen. Wichtiger für die juristische Absicherung des Vorgehens war die Hinzuziehung von Notaren. Sie mussten die Besitzergreifung begleiten und notariell beglaubigen. Vier Gespanne waren in Bereitschaft, um alle in Frage kommenden Orte gleichzeitig zu besetzen. Zu diesen gehörten auch vier Notare, welche die Inbesitznahme rechtskräftig dokumentieren sollten. Alle vier Gruppen verfügten über eine detaillierte Auflistung der Bartenslebischen Lehensstücke, so dass hier Fehler oder Auslassungen vermieden werden konnten 38 Der Einsatz von Notaren in solchen brisanten Aktionen ist Beleg für den Verrechtlichungsprozess im Alten Reich. Es ist ein herausragendes Beispiel für die Funktionsfähigkeit des Reiches, dass Konflikte mit rechtlichen Mitteln ausgetragen wurden, selbst wenn es um den Besitz von beträchtlichen Ländermassen ging. Reichskammergericht und Reichshofrat boten Lösungswege an, die zwar nicht immer überzeugten, aber doch eine willkommene Alternative zu militärischen Abenteuern waren. Instrumente in diesen brisanten Konfliktfcldcrn waren zunächst Notarc. Sic bürgten mit ihrem Ansehen und Namen für die Rechtmäßigkeit einer Besitznahme. Durch ihr kaiserliches Notariatsprivileg galten sie formal als verlängerter Arm des Kaisers, die 31 Hartwig HOIINSBEIN, Begegnungen mit der Wolfsburger Geschichte. Wolfsburg, 1977, S. 12. J6 HStAH Hann 74 Fallcrsleben 153, Wolfsburg, StA WF 26 Alt, Nr. 366, BI S StA WF 26 Alt, Nr. 366, BI. 23..
108 Lauern auf den Vasallen tod 111 Kraft dieses Amts Autorität besaßen, Rechtsgeschäfte zu beglaubigen. Man musste sich dieser Männer versichern, um vor Gericht ein überparteiliches Beweisstück über die Rechtmäßigkeit des eigenen Anspruchs zu haben 39 Die eingesetzte Spionage- und Besitzergreifungskommission um den Amtmann von Neuhaus berichtete täglich über ihre Beobachtungen nach Braunschweig 4o Ihr Auftrag schickte sie auf eine komplizierte Gratwanderung. Denn es war klar, dass Schloss Wolfsburg dem Heimfall des Lehens nicht widerstandslos zusehen würde. Es suchte Verbündete, um doch das Lehen noch für die Familie Schulenburg zu retten. Aufgrund der vielfältigen dienstlichen und privaten Kontakte der Adelsfamilie in Kurhannover und Preußen schienen hier auch gute Chancen zu bestehen. Und tatsächlich fürchtete Wolfenbüttel diese Kontakte. Immer wieder ließ sich die eingesetzte Kommission von Gerüchten über hannoversche oder preußische Kommissare in der nahen Umgebung verunsicherny Da die Familie nicht kooperierte, versuchten die herzoglichen Räte, die Dienerschaft auf der Wolfsburg auf ihre Seite zu ziehen. Reich fließende Bestechungsgelder konnten karg chargiertes Personal schwach machen, und mit dieser Taktik hatte man auch Erfolg. Informanten waren aber nicht nur einzelne Bediente, sondern auch ein Geistlicher, der anfangs direkten Zugang zu dem Patienten hatte. Um Gewissheit über den Gesundheitszustand des Kranken zu erlangen, musste aber vor allem auch die Arbeit der Ärzte aus nächster Nähe beobachtet werden. Während des besonders kritischen Zustands zog die Herrin von Bartensleben einen ganzen Stab von Medizinern hinzu. Darunter waren auch mehrere Bader aus der Umgebung 42 Führend waren aber die Ärzte Hintze aus dem preußischen Garddegen und der besonders renommierte Helmstedter Chirurgieprofessor Heister. Im Januar 1720 hatte der damalige Professor der Universität Altdorf bei Nürnberg eine Berufung der Medizinischen Fakultät der Universität Helmstedt angenommen 43 Über die welfische Alma Mater erlangte er rasch einen europaweiten, sehr guten Ruf als Medizintheoretiker, aber vor allem auch als praktischer Arzt erhielt er ein russisches Angebot, in die neue Hauptstadt des Zarenreichs, St. Petersburg, überzusiedeln. Heister nutzte dies zu Verhandlungen mit dem Herzog über eine Besoldungserhöhung. Hierin verwies er auf seine praxisbezogene medizinische Wissenschaft und vor allem auf seine chirurgische Tätigkeit und seine Überlegenheit darin gegenüber seinen Professorenkollegen: Ingleichen hat nie hier kein Professor die chirurgische operation es (als bey schweren Geburten und andern wichtigen Zufällen) selbsten mit eigener Hand zu verrichten ge wust, oder verrichtet, gleichwie ich bey allen vor- 39 Zum Verrechtlichungsprozess im Alten Reich: Ingrid SCIIEURMANN (Hrsg.), Frieden durch Recht. Das Reichskammergericht von 1495 bis Mainz StA WF 26 Alt Nr. 366, BI. 21 ff. 41 StA WF 26 Alt Nr. 366, BI. 37, 39 und 54. Zum Geschlecht von der Schulenburg: Dietrich Werner VON D~:R SCHULENBURG und Hans WÄTJEN, Geschichte des Geschlechts von der Schulenburg. Wolfsburg StA WF 26 Alt Nr. 366, BI. 21. Zu den Badern und anderem medizinischen Personal im Herzogtum Braunschweig: Mary LINDEMANN, Health and Healing in Eighteenth-Century Gerrnany. Baltimore 1996; Klaus WOLFF, Braunschweigische Medizinalgeschichte(n). Eilsieben StA WF 37 Alt Nr. 439 Annahme der Berufung durch Heister am
109 112 Martin Fimpel fallenden Gelegenheiten selbsten thue 44 Heisters Personalakte im Staatsarchiv Wolfenbüttel bestätigt, dass diese Ansicht keine Selbstüberschätzung war, sondern dass auch die zeitgenössischen Patienten - nicht zuletzt höhergestellte Persönlichkeiten - Heisters ärztliche Kunst schätzten beispielsweise erhielt der Helmstedter Professor den Auftrag, den kursächsischen Geheimen Rat von Rex zu behandeln 45, und acht Jahre später bat er um Reisegenehmigung, weil er die erkrankte Herzogin von Mecklenburg-Schwerin heilen sollte 46 Hier ging der Adel auf der Wolfsburg also das Risiko ein, dass Heister, der ja im Braunschweigischen Territorium lehrte, zumindest eine Informationsquelle für den Wolfenbütteler Hof sein konnte. Und tatsächlich bestätigen die Berichte des Neuhäuser Amtmanns diesen Verdacht. Heister reiste mehrmals von Wolfsburg zurück nach Helmstedt, wo er von herzoglichen Beamten regelmäßig nach Bartenslebens Zustand befragt werden solite 47 Jahre später bestätigte Heister diese Parteinahme in einem Schreiben an den Herzog und bat gleichzeitig um eine Besoldungserhöhung, weil diese Mithilfe ihm nicht nur Unkosten, sondern auch einen immensen Schaden zugefügt hätte. Denn nicht nur die Frau von Bartensleben verzichtete seit der Verweisung aus der Wolfsburg auf seine Kuren, sondern auch die gesamte Familie von der Schulenburg und von Veltheim 48 Dass diese Hilfe über Nachrichten betreffs verabreichter Medikamente und Zustandsbeschreibungen hinaus ging, darf jedoch nicht angenommen werden. Heister war kein Mann, der den Heilungsprozess im Interesse seines Landesherrn hintertrieb 49 Dafür hatte er auch gewiss keinen Auftrag, und es gibt auch keine Hinweise darauf, dass der Herzog in diese Richtung Gedanken geäußert hätte. Man traute Heister aber zu, dass er einem Patienten vorzeitig den Rücken kehren könnte, um dem Eindruck auszuweichen, seine ärztliche Kunst hätte versagt50. Auf der Wolfsburg standen die Ärzte stets wie der Patient selbst unter Beobachtung. Behandlungsmethoden, Beurteilungen des Stuhlgangs, Schlafs und der SpeisefolgeSt gelangten zielsicher an die braunschweigischen Kundschafter 52. Diese über- 44 StA WF 37 Alt Nr. 439, BI ' StA WF 37 Alt Nr. 439, BI <6 StA WF 37 Alt, Nr. 439, BI StA WF 26 Alt Nr. 366, BI "Was ich Serenissimo vor gute dienste sowohl in der Bartenslebischen als Neudorfischen Lehens Sachen, nicht ohne aufgewandte Kosten, und zwar in der ersten auch mit meinem jährlichen sehr großen Schaden... geleistet habe, da ich die Frau von Bartensleben, die Schulen burg. und Veltheimische famillie, welche mir vorher ein ansehnliches, durch die euren bei denselbigen eingebracht, dadurch verloh ren habe". (StA WF 37 Alt Nr. 440 BI. 35). 49 Beleg dafür ist auch folgendes Zitat der Besitzergreifungskommission: "Und daß er [der Patient) den Mund beständig offen halte, und auf dem Rücken liegt, das sind alles solche Umstände, die den bald folgenden Todt marquiren, welches man sich anders nicht vorstellen darff, wenn gleich zehn Heisters noch anderer Meynung seyn wollten." (StA WF 26 Alt Nr. 366, BI. 40). 50 "So ist eher zu glauben, daß der Hoffraht [Heister) den ohnvermeidlich folgenden Todt des von Bartcnsleben durch seine Abwesenheit und nicht recht applicirte Medicamenta entschuldigen wolle." (StA WF 26 Alt Nr. 366, BI. 26). 1I "Des Morgends ist er 2 Stunde, und des Nachmittags 3 Stunde munter gewesen, hat ein wenig Bouillon und Biscuit genossen". (StA WF 26 Alt Nr. 366, BI. 36).
110 Lauern auf den Vasallen tod 113 mittelten ihre Nachrichten an das Amt Neuhaus, wo die Kommission in LauersteIlung lag, welche den Werder in Besitz nehmen sollte. Von dort wurde dem Herzog täglich wiederum Bericht erstattet. Teilweise widersprachen sich die Meldungen über den Patienten aber deutlich. Wenn sich für die einen eine Besserung abzeichnete, sprachen andere schon vom unmittelbar bevorstehenden Tod. 53 Das Auf und Ab im Krankheitsbild Gebhard Werners gab ihnen manches Rätsel auf5 4 Wenn die Kommission schon drauf und dran war, die Pferde zu besteigen, um die Lehen in Besitz zu nehmen, so kam im nächsten Augenblick die Botschaft, der Patient habe plötzlich gegessen, zum Beispiel Fisch, und sich erholt 55 Schon vierundzwanzig Stunden darauf lag er angeblich wieder im Sterben und die Ärzte diagnostizierten ein Fieber zum Tode 56 Ein Wechselbad der Gefühle für alle Beteiligten und eine ausgesprochene Nervenprobe. Die Mediziner waren sich offensichtlich selbst unsicher über Krankheitsbild und Krankheitsverlauf. Heister hielt es für podagra, also Gicht, die mit der ständigen Gefahr eines Schlaganfalls (Schlagflusse) einherging 57 Anstrengender Aderlass, Schröpfen, übelriechende Spanische Fliegen 58 und Einreiben der Beine waren die wichtigsten Behandlungsmethoden. Medizingeschichtlich bieten diese Anwendungen keine Überraschungen. Chirurgische Eingriffe wurden offensichtlich nicht vorgenommen, obwohl sich Heister auf diese Kunst verstand. 52 "Der Patient habe sich gantz verändert, sey so schwach, alß er niemalen gewesen, das erste laxativ, 4. maliges Aderlassen, Schröpfen, Spanische Riegen und dergleichen extrema, hätten ihn gantz entkräftet, die Unempfindlichkeit, da der Patient nicht mehr weiß, wenn er Urin läst, oder Öffnung hat, und daß er den Mund allezeit weit offen halte, röchele zuweilen mit der Brust" (StA WF 26 Alt Nr. 366, BI )." Von unserm Kundschafter in Vorsfelde [Nachricht] erhalten, daß es schr schlecht um den Patienten stehe, und man selbigen mit warmen Tüchern reibe, um dem Schlagflusse vor zu kommen." (StA WF 26 Alt Nr. 366, BI. 37). 53 StA WF 26 Alt Nr. 366, BI. 58: Ein langes Leben wurde Bartensleben nicht mehr zugetraut, "jedoch ist der Patient in solchen Umständen, daß er so gleich nicht sterben wird... tonus nervorum aber ist noch nicht restituiret, und daher rühret es, daß der Patient gar nicht empfindet, wenn die Natur ihre excretiones machet." 54 StA WF 26 Alt Nr. 366, BI. 61: Doktor Hintze vermutete aufgrund von Leibschmerzen "podagra". Bericht eines Baders: "Er sähe aus wie eine Leiche, und wenn er die Augen zuhielte, könne man ihn nicht anders als für todt halten, und seiner Meynung nach, könne er es nicht lange mehr machen". Ebd. BI. 53: Heister und Hintze stuften den Zustand Bartenslebens wieder als gefährlich ein. Nur ein Lakai durfte noch zu ihm. Bartensleben sollte "schon ohne Vernunfft liegen". Ebd. BI. 50: "Medici haben Patient außer Gefahr deklariert". Ebd. BI. 46: "Das schlechte Wetter soll dem Berichte nach des Patienten Krankheit immer gefährlicher machen, und dessen Gemahlin und Tochter besorgen alle Augenblick einen tödtlichen Sehlagfluß oder Jammer, welehes dcnenselben ohne Zweiffel die Medici müssen vorher gesagt haben." Ebd. BI. 46: Der von der Kommission für richtig befundene Bericht hielt den Patienten nach wie vor im kritischen Bereich: "Der Appetit zum essen, ist gantz weg, und weil der Patient nichts mehr, als zuweilen einen Trunck von Kaltenschale genießet, im übrigen aber mit Medicamenten erhalten wird... so stehet bey des Patienten Alter kein ander Schluß vernünfftigerweise zu machen, als daß diese Krankheit das Lebens-Ende mit ihm beschließen werde." 55 StA WF 26 Alt Nr. 366, BI. 50: Patient habe "von einer carrausche gegessen". 5. StA WF 26 Alt Nr. 366, BI. 24 und Zu "Schlagfluss": Johann Heinrich ZEDLEK, [00'] Universallexikon Bd. 2, Halle und Leipzig 1732, S. 905 (Stichwort "Apoplexia").,. Behandlung aus einem Extrakt aus den sogenannten Spanischen Fliegen oder Goldkäfern. Vgl. ZED LEK, wie Anm. 57, Bd. 9, S
111 114 Martin Fimpel Wege des Widerstands Die Besitzer der Wolfsburg bemerkten rasch, dass sie unter Beobachtung standen. Wie war aber der Heimfall des Werders an das Herzogtum zu verhindern? Eine Lösung war nicht in Sicht. Die Lehnsanwartschaft gegenüber Wolfenbüttel durchzusetzen, war gescheitert, und Fürsprecher in Hannover und Berlin hatten offensichtlich auch keinen Erfolg. Kurhannover war zwar der zuverlässigste Partner, weil es die Anwartschaft der Schulenburg anerkannt hatte 59, wirklich hilfreiche Unterstützung, die auch den Konflikt mit Braunschweig nicht scheute, war aber auch von dort nicht zu erwarten. Aufgrund dieser Ausgangsposition blieb dem Patienten und seiner Familie nur die Hoffnung auf gesundheitliche Besserung und eine eventuell doch eintretende Unterstützung von außen. Deshalb setzten sie auf Zeitgewinn. Wenn sich das Leben Gebhard Werners nicht beliebig verlängern ließ, so sollte doch seine Todesstunde verheimlicht werden, um die Grundlage für ein Eingreifen des Lehnsherrn zu entziehen oder zumindest aufzuschieben. Dazu ersann die Familie mit Hilfe der adligen Verwandtschaft eine Reihe von Täuschungsmanövern, die alle das Ziel hatten, eine Besserung des Gesundheitszustands des Schlossherrn vorzutäuschen. Beispielsweise ließ sie eine Jagd inszenicren, an der angeblich auch Gebhard Werner in einer Kutsche teilnahm. Wie zufällig ließ ein ergebener Diener Bartenslebens in einem Vorsfelder Wirtshaus einen Zettcl vor die Füße des mutmaßlichen Braunschweiger Kundschafter fallen, auf dem eine gesundheitliche Besserung des Patienten vermerkt und seine Jagdteilnahme angekündigt war 60 Immer wieder kämpfte die Besitzergreifungskommission mit Falschmeldungen über eine Besserung Bartenslebens. So kursierten Gerüchte, der Patient habe sein Bett längere Zeit verlassen, normal speisen können und schmiede schon wieder Pläne. Dicse Nachrichten seien aber sämtlich ertichtet, heißt es in einem Bericht von Amtmann Lambrecht6 1 Schloss Wolfsburg wusste gen au über den "Belagerungszustand" Bescheid, konnte daraus aber kein entscheidendes Kapital schlagen. Eine Falle, weiche die Braunschweiger Kommission am meisten fürchtcte, stellte er nicht: Durch einen "gespielten" Tod hätte Bartcnslcben die Braunschweiger zum vorschnellen Handeln und damit zu einem lehnsrechtlichen Vergchen provozieren können, das als Felonie (Treuebruch) ausgelegt werden konnte. In diesem Fall hätte der Lehnsherr seine Feudalrechte womöglich verlieren können 62. Aber offensichtlich wurde Preußen dennoch schon als Adressat für eine verfrühte Todesnachricht von dcr Wolfsburg ausgewählt, um ein Gegengewicht gegen Wolfenbüttel zu schaffen. In Berlin ging bereits am 11. Oktober 59 StA WF 26 Alt Nr. 366, BI StA WF 26 Alt Nr. 366, BI. 34. Einen weiteren Täusehungsversuch mit gezielten Fehlinformationen über die Besserung des Patienten streute ein Vorsfelder Bader aus, der "per tertium bringen wollen, daß der Patient gestern sich rasiren lassen, angekleidet gewesen, und unter seinen Freunden in Compagnie gegessen. Wir wissen aber, daß alles dieses nicht wahr sey, und daß der Bader den Patienten nicht gesehen, viel weniger rasiret habe". (StA WF 26 Alt Nr. 366, BI. 40). 61 StA WF 26 Alt Nr. 366, BI StA WF 26 Alt Nr. 366, BI. 54: Die Kommission erhielt jetzt nur alle 24 Stunden sichere Nachricht über den Zustand "und würde es eine hesliche faute seyn, wenn wir bey lebendigem Leibe Possession nehmen".
112 Lauern auf den Vasallen tod eine verfrühte Todesnachricht ein, deren Unglaubwürdigkeit aber noch rechtzeitig klar wurde 63 Es blieb bei der Verschleierungstaktik, die ihren Höhepunkt erreichte, als die Herrin von Bartensleben ihren Mann völlig von der Außenwelt abschirmte. Misstrauisch gegen Mediziner und Bediente, ließ sie alle Türen bis auf die zu ihrem Schlafgemach vernageln und ließ nur noch einen besonders vertrauten Diener und die engsten Familienangehörigen zu dem Patienten 64 Zuvor wurde den Bedienten die Folter angedroht, falls sie irgendwelche Informationen nach außen geben würden. 65 Und der Medizinprofessor Heister war wegen Spionageverdacht bereits längst von der Behandlung ausgeschlossen worden 66 Letztlich waren die medizinischen Bemühungen aber doch noch kurzfristig von Erfolg gekrönt. Gebhard Werners Zustand stabilisierte sich zunehmend im Laufe des Oktobers 1741, so dass er für einige Stunden sogar das Bett verlassen konnte. Als die Kommission die neue Situation realisierte, bat sie den Herzog, die LauersteIlung verlassen zu dürfen 67 Für die Wolfsburg war die Lage aber nur kurze Zeit entspannt. Im November 1741 verschlechterte sich der Gesundheitszustand Bartenslebens wieder ~ramatisch. Um nicht dem Katz-und-Maus-Spicl mit Braunschweig der letzten Monate erneut ausgeliefert zu sein und um andere Spezialisten zu konsultieren, entschloss sich Bartensleben, Schloss Wolfsburg zu verlassen. Seine Wahl fiel nicht zufällig auf Hannover. Hier, in der Residenzstadt des Kurfürstentums, das die Anwartschaft seines Schwiegersohns von der Schulenburg anerkannt hatte, fühlte er sich sicherer. Dort fand er auch vermeintlich unparteiische Ärzte. Er quartierte sich in der Schenke "London" ein und empfing regelmäßig hannöversche Ärzte, an der Spitze den Hofrat Hugo. Der Gastwirt und seine Bedienten hatten die Anweisung, den Zustand Bartenslebens schön zu reden und von einer baldigen Rückkehr auf die Wolfsburg zu sprechen 68 Seine Medikamente wurden für die innere Behandlung in Hannover und für die äußere in Fallersleben und Helmstedt hergesteilt. Der Name des Patienten wurde aber falsch angegeben, um keine Einblicke in die Behandlungsweise zu gewähren 69 Ende Dezember 1742 standen nicht weniger als zwanzig Sänften in Wartestellung vor der Schenke, die aue zu Medizinern gehörten, welche sich zur Visite bei dem todkranken Bartensleben einfanden. Das erregte natürlich großes Aufsehen, dessen es aber gar nicht bedurft hätte, um Wolfenbüttel wieder auf die Spur des Patienten zu bringen. Denn dieser hatte sein verräterisches Umfeld und die Findigkeit der Braunschweiger Kundschafter unterschätzt. Sie verkehrten beispielsweise ungehindert im Haus des führenden Arztes Hugo. Zum Jahresende 1741 schien endgültig klar, dass 63 StA WF 26 Alt Nr. 369, BI StA WF 26 Alt Nr. 366, BI. 65 und 67. os Diejenigen, die in Verdacht standen, mit der Wolfenbütteler Kommission zu korrespondieren n werden alle gedrohet, daß sie so gekniffen und geklemmet werden sollen, daß sie damn gedächten". (StA WF 26 Alt Nr. 366, ). 66 StA WF 26 Alt Nr. 366, S StA WF 26 Alt Nr. 366, BI. 68. '" StA WF 26 Alt Nr. 366, BI StA WF 26 Alt Nr. 366, BI. 150.
113 116 Martin Fimpel Abb. 3: Porträt von Gebhard Werner von Bartensleben. Foto Jutta Brüdern der seit 1721 wiederholt totgesagte Patient jetzt tatsächlich nur noch wenige Tage zu leben hatte 7o. Anfang des Jahres 1742 ging es dem Patienten so schlecht, dass er den Tod herbeisehnte 71. Um ganz schnell die mögliche Todesnachricht zu erhalten, platzierte Wolfenbüttel einen Kundschafter direkt im Gasthaus des Patienten. Der Sohn des Neuhäuser Amtmanns Lambrecht wurde für diese brisante Aufgabe ausersehen 72. Er musste, anders als die Kommission im Herbst, nicht lange vor Ort bleiben, denn schon Anfang Januar verstarb Bartensleben 73. Nun griffen die Besetzungspläne, die im Herbst zurückgestellt werden mussten. Die winterliche Witterung behinderte die Amtsbedienten und Notare kaum, und es gab auch offensichtlich keine Widerstände gegen die Vereinnahmung durch Braunschweig in der Bevölkerung. Alles verlief planmäßig und ruhig. Die Ängste des Wolfenbütteler Hofes vor hannöverschen oder preußischen Eingriffen waren gegen- 70 StA WF 26 Alt Nr. 366, BI StA WF 26 Alt Nr. 369, BI StA WF 26 Alt Nr. 366, BI Porträt von Gebhard Werner von Bartensleben, in: SIEGFRIED, Schloss Wolfsburg, wie Anm. 1, S Gruft der Kirche SI. Marien in Wolfsburg, ebd. S. 131; Epitaph Gebhard Werners von Bartensleben, ebd., S. 75.
114 Lauern auf den Vasallen tod 117 standslos 74 Die Eingliederung der heimgefallenen Lehen in das Braunschweigische Ämtersystem machte offensichtlich keine Schwierigkeiten. Für die betroffenen Bauern schien sich nicht viel zu ändern. Das Herzogtum Braunschweig galt als Land mit einer vergleichsweise starken bäuerlichen Rechtsstellung. Während einzelne Lehnsstücke dem Amt Bahrdorf zufielen 75, wurde im Vorsfelder Werder das neue Amt Vorsfelde gegründet1 6 Die Erben der von Bartensleben, die Grafen von der Schulen burg, begründeten in Wolfsburg eine neue Linie. Der älteste Enkel des letzten Herrn von Bartensleben hatte den Vornamen seines Großvaters Gebhard Werner erhalten und erhielt die Wolfsburg mit den umliegenden Dörfern und Liegenschaften 77 Den Verlust des Vorsfelder Werders empfand auch er als nicht hinnehmbar. Juristisch wurde der Streit um die Lehnsstücke noch jahrzehntelang ausgetragen. Ein Prozess vor dem Reichskammergericht brachte 1778 noch eine Abfindung von Reichstalern für die ignorierte Lehnsanwartschaft im geschätzten Wert von Reichstalern 78 Allerdings musste WolfenbüUel kurz nach der Besitzergreifung einsehen, nicht alle Ziele erreicht zu haben. Die Unzufriedenheit auf Seiten der aus ihrer Sicht "teilenteigneten" Adelsfamilie Schulenburg konnte nach wie vor unangenehme Konsequenzen haben. Vor allem fürchteten der Herzog und sein Geheimer Rat die nicht ausgeräumten Differenzen mit Preußen. Schon kurz vor dem Tod Bartenslebens beschwerten sich seine Angehörigen über Übergriffe der braunschweigischen Ämter Bahrdorf und Neuhaus, welche auch die preußische Territorialhoheit verletzten. Wolfenbüttel bemühte sich, die Situation zu entschärfen. Offensichtlich läge hier eine Schulen burgische Intrige vor, welche nur das Ziel hätte, Berlin und Wolfenbüttel in eine" widrige" Korrespondenz zu verstricken. Der Herzog drohte deshalb mit einem Felonieprozess gegen Schulenburg 79 Die Witwe Bartenslebens und ihre Tochter sahen in Preußen ihren wichtigsten Verbündeten, wollten sie einen Verlust der Wolfsburg verhindern. Denn nicht nur der Vorsfelder Werder stand auf dem Spiel, sondern auch der Stammsitz selbst, den Han- 74 StA WF 26 Alt Nr. 365 Bd. 2, BI. 10. Amtmann Lambrecht führte die Besitzergreifung am 7. und 8. Januar 1742 durch: "Gestern Nachmittag, die verwichene gantze Nacht bis heute Nachmittag um 3 Uhr mit Ergreiffung der possession nebst dem Notario Hclper beschäfftiget gewesen". Vgl. auch Details zur Besitzergreifung in: StA WF 26 Alt Nr. 365 Bd. 3. n StA WF 4 Alt Bahrdorf Nr Anke RATIIERT, Die Entstehung des Amtes Vorsfelde im Jahre Aspekte seiner Aufgaben und Tätigkeit, in: SIEGFRIED (Hrsg.), Geschichte Vorsfeldes, Bd. 1., wie Anm. 1, S Zu Gebhard Werner von der Schulenburg-Wolfsburg: SIEGFRIED, wie Anm. 1, S H StA WF 6 Alt, Nr und StA WF 27 Alt, Nr Vgl. SCHULENBURGI WÄTJEN, wie Anm. 41, S Kurz vor einem Vergleich war das Geschlecht von Danckelmann Mitte der 1740er Jahren im Mannesstamm ausgestorben. Vgl. DEETERs, wie Anm. 23, S Wolfenbüttel war rasch bemüht, die Wogen zu glätten. In einem undatierten Schreiben des Premierministers von Münchhausen nach Berlin heißt es: "Es ist uns nicht in die Gedanken kommen, auff der Wolfsburg selbst possession zu nehmen, um dem Könige LU keinem Missvergnügen den gedachten Anlass zu gehen, obwohl insgemein darvor gehalten wird, die Grentze gienge durch die Küchc. Es ist aber schandlich dass Vasalli ihre Lensherren in disput zu bringen mit intriguen und Bestechungen suchen wollen - würde es ein Schrecken darunter bringen, wenn Sie dem HI. v. S[chulenburg]. sagten, der Herzog würde mit dem Könige wegen der felonie ein wenig reden." (StA WF 26 Alt Nr. 363, BI. 45).
115 118 Martin Fimpel nover zur Hälfte, Wolfenbüttel aber ganz beanspruchte 8o Die adligen Frauen und ihr befreundetes Umfeld wussten, dass der Herzog Preußen fürchtete. Unter dem Schutz des auf der Wolfsburg stationierten preußischen Militärs begannen sie Besitzansprüehe Wolfenbüttels auf einzelne Lehnsstücke zu unterwandern. Dies veranlasste den Herzog noch einmal zu einem Vorstoß in Berlin. Im Rahmen eines Tauschprojekts sollte Wolfsburg endgültig in das braunschweigische Territorium eingegliedert werden. Grenzrat Schlüter bekam den Auftrag, auf Reisen nach Magdeburg und Berlin die Chancen für ein solche Tauschprojekt zu prüfen und, wenn möglich, zum Erfolg zu führen 81 Dieser trat jedoch nicht ein. König Friedrich 11. hatte bereits im Frühjahr 1742 die Anweisung an die Magdeburgische Regierung gegeben, Anna Adelheid von der Schulenburg als Besitzerin der Wolfsburg und der magdeburgischen Lehnsstücke in das einschlägige Landbuch einzutragen 82 Wenigstens hier erzielte die bedeutende altmärkische Adelsfamilie einen Teilerfolg am Berliner Hof. Wahrscheinlich profitierte sie auch davon, dass Friedrich 11. in Kriegszeiten Konflikten mit dem Adel auswich. So blieb Wolfsburg eine Exklave. Auch nachdem das Königreich Hannover von Preußen 1866 annektiert wurde, war Wolfsburg mit den Dörfern Hchlingen und Hesslingen Teil Preußens. Das Streitobjekt Vorsfelder Werder dagegen blieb der nordöstlichste Ausläufer des Landes Braunschweig bis zu dessen Aufgehen im heutigen Bundesland Niedersachsen so StA WF 26 Alt Nr. 366, BI VgJ. auch StA WF 26 Alt Nr. 368, BI. 18. R1 StA WF 26 Alt Nr. 369, BI
116 Die Scharffsche Tuchmanufaktur in Wolfenbüttel ( ) und ihr Konkurs von Victor-L. Siemers Auf dcm Areal des sogenannten Kleinen Schlosses in Wolfenbüttel wurde im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts eine Tuchmanufaktur betrieben. Die Unterstützung, die Herzog Karll. (1713/ ) dem Göttinger Kommerzien-Kommissar Johann Heinrich Scharff zuteil werden licß, als dieser sich erbot, in Wolfenbüttel eine Tuchmanufaktur zu errichten, gehörte zu den vielen Aktivitäten zur Förderung der Gewerbe im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel. Karl I. hatte dabei nicht nur allgemeine Gesichtspunkte der Wirtschaftsförderung im Sinn, sondern er wollte die Uniformen des Hofs und der Armee seines Landes aus Tuch von inländischer Produktion schneidern lassen. So sollte das Land unabhängiger werden vom Import der Uniformtuche, die bis dahin zum Teil von braunschweigischen Tuchmachern als verlegte Meister, vielfach aus Göttingen (Kurhannover) geliefert wurden. Johann Heinrich Scharff ( ) entstammte einer angesehenen Göttinger Tuchmanufakturisten- und Färberfamilie und war über Göttingen hinaus für die besonders schönen und dauerhaften Farben seiner Uniformtuche bekannt. Über die Gründe für Scharffs Weggang von Göttingen ist nichts bekannt. Im Jahre 1762 erteilte Herzog Karl ein Privileg, das Scharff gestattete, in Wolfenbüttel eine Woll- und Halbwollfabrik anzulegen, und diesem eine Reihe von Vergünstigungen für die Errichtung und den Betrieb zusagte. Wenig später wurde ihm der Titel eines Kommerzienrats verliehen. Nach einigen erfolgreichen Jahren geriet Scharff in finanzielle Schwierigkeiten, die 1773 in einen Konkurs mündeten. Dieser zog sich bis 1788 hin und ist interessant, da er erst durch einen Eingriff des Herzogs Kar! Wilhelm Ferdinand beendet werden konnte. Scharff ging 1774 nach Kassel, wo ihm die Direktion der 1765 von Landgraf Friedrich II. gegründeten Herrschaftlichen Feintuchmanufaktur übertragen wurde. Nach fünf Jahren hat Scharff dicse Manufaktur hauptsächlich durch unangemessene Investitionen in Bauten und Materialeinkäufe sowie durch ein völlig undurchsichtiges Rechnungswesen heruntergewirtschaftet, und er wurde unrühmlich entlassen verstarb er verarmt in Göttingen. Schwerpunkt diescr Arbeit ist dic Tätigkeit Scharffs in Wolfenbüttel sowie die Geschichte des Scharff'schen Konkurses. Hauptsächlich aus den Akten dieses Konkurses lässt sich der Geschäftsgang der Manufaktur rekonstruieren. Als Unternehmer war Scharff nicht verpflichtet, Geschäftsunterlagen auch nur mittelfristig aufzubewahren.
117 120 Victor-L. Siemers Dagegen gelangten die Konkursakten in das herzogliche Archiv und damit in das Niedersächsische Staatsarchiv in Wolfenbüttel, da herzogliche Behörden an diesem Verfahren beteiligt waren. Das Konvolut der Scharff'schen Archivalien wurde erst vor wenigen Jahren verzeichnet und wird mit dieser Arbeit erstmalig bearbeitet. Herrn Lt. Archivdirektor Dr. Horst-Rüdiger Jarck und seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen danke ich sehr für die Unterstützung bei dieser Arbeit, besonderer Dank gilt Frau Dr. Ulrike Strauss für die Anregung zu dieser Untersuchung. Zusätzliche Informationen konnte ich der unveröffentlichten Scharff'schen Familienchronik entnehmen, aus der mir Frau Ursula Held in Lüneburg einige Kopien überlassen hat, wofür ihr mein herzlicher Dank gesagt sei. Tuchmanufakturen in Kurhannover, Braunschweig-Wolfenbüttel und Hessen-Kassel Zum Manufakturwesen in der Wolltuchherstellung soll hier nur soviel erklärt werden, wie nötig ist, um die Aktivitäten von Johann Heinrich Scharff einschätzen zu können. In allen drei Staaten, in denen dieser im Laufe seines Lebens tätig war, wurden Tuchmanufakturen betrieben, um den steigenden Bedarf der stehenden Heere an Uniformtuchen in großen Mengen mit einheitlichen Farben, gleichmäßigen Qualitäten und zu verlässlichen Terminen zu decken. Die Funktionsweise und die Eigentumsstrukturen dieser Manufakturen waren durchaus unterschiedlich. In Göttingen betrieben im 18. Jahrhundert drei Familien als Fabrikanten der Königlichen Fabrik von einander unabhängige Tuchmanufakturen. Das Fabrikwesen war vom König begründet worden und wurde von ihm erhalten durch die Vergabe von Privilegien und Titeln, sowie durch die Bereitstellung von Kapital. Die Unternehmer bildeten als Königliche Kommissare eine Art eigenen Standes mit weitgehender Unabhängigkeit von den alten städtischen Ordnungen Göttingens. Jede dieser drei Familien arbeitete völlig auf eigenes Risiko, vom König jedoch abhängig wegen der Tilgung und Verzinsung der ihnen aus dessen Kasse zur Verfügung gestellten Gelder sowie wegen der Lieferverträge für die Uniformtuche, die die Beschäftigung der Manufakturen sicherstellten. Die Familie Scharff brachte es als zweitbedeutentste dieser drei Familien in der Mitte des Jahrhunderts zu solidem Reichtum, der auch über die Zeiten des siebenjährigen Krieges gerettet werden konnte!. Die Fabrikanten waren zur Zeit des Weggangs von Scharff eher Verleger, die zünftigen Handwerkern das Rohmaterial lieferten, die Produkte zu vereinbarten Preisen abnahmen und auch die Endausrüstung der Tuche nicht in einem Fabrikgebäude, sondern in eigenen oder gepachteten Walk- und Färbemühlen und von zünftigen Meistern durchführen ließen. Selbst die Lagerung der Fertigprodukte erfolgte nicht bei den Fabrikanten, sondern im städtischen Zeughaus bis zur Ablieferung an den Auftraggeber 2 I Vgl. Dieter KOCH, Das Göttinger Honoratiorenturn. Göttingen 1958, S. 132 ff. 2 Vgl. KOCH wie Anm. 1, S. 121 f.
118 Scharff'sche Tuchmanufaktur in Wolfenbüttel 121 In Wolfenbüttel dagegen hat es diese Konstruktion einer Herzoglichen Fabrik nicht gegeben. Herzog Karl I. beschränkte sich darauf, den Unternehmer Scharft in jeder erdenklichen Weise bei seinem Vorhaben zu unterstützen, so wie er auch andere von auswärts zuziehende Entrepreneurs zum Wohle des Landes förderte. Er überließ Scharft geeignete Gebäude kostenlos zu Eigen, stellte Kapital zur Verfügung, sicherte ihn gegen etwaige Konkurrenzunternehmen ab, verfügte Zoll- und Abgabenfreiheit und stellte Lieferverträge für die Mondierung der Hofbedienten und des Militärs in Aussicht. Eigentümer der Manufaktur war jedoch allein der Unternehmer, der auch das volle technische und kaufmännische Risiko zu tragen hatte. Dabei startete Scharff nach einem entwickelteren Konzept als in Göttingen, indem er einen Teil der Webstühle und die Ausrüstung in die ihm überlassenen Gebäude verlegte und von seinen eigenen Arbeitern besorgen ließ. Bei den Planungen für eine erweiterte Manufaktur für feine und Mitteltuche, die er 1770 vorlegte, sollte auch die Vorbereitung der Wolle für das Spinnen in das Fabrikgebäude gezogen werden, wo dann alle Arbeitsgänge konzentriert waren. Nur das personalaufwendige Spinnen sollte noch an Spinner und Spinnerinnen auf dem Lande vergeben werden. Wie unten gezeigt werden wird, konnte Scharff dieses Konzept in Wolfenbüttel nur teilweise realisieren. In Kassel dann waren die Eigentums- und Risikoverhältnisse ähnlich eindeutig, nur dass hier der Landgraf Eigentümer der Manufaktur war, die er seit Gründung im Jahre 1765 von Beamten leiten ließ. Hier war Scharff ein gut bezahlter Direktor, der, als er die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllte, ebenso schnell entlassen wurde, wie er zuvor zu dieser herausragenden Stellung gekommen war. Hier fand der Direktor eine, zumindest im Konzept, zentralisierte Manufaktur vor, bei der auch das Spinnen in Räumen des Unternehmens besorgt werden sollte. Bis zu seinem Ausscheiden hat er die Zentralisierung weiter vorangetrieben. Danach haben Seharffs Nachfolger den Betrieb dezentralisiert, nur die Weberei verblieb im Gebäude der Manufaktur und die Ausrüstung wurde, völlig untypisch, zünftigen Meistem übergeben wurde das Etablissement geschlossen 3 Die Familie Scharff in Göttingen Johann Georg Scharff, der Vater von Johann Heinrich, stammte aus Thüringen, war seit 1705 als Schönfärber Bürger von Langensalza und ein vermögender Mann 4 Der Aufschwung der Göuinger Tuchmacherei dürfte der Grund dafür sein, dass er sich um 1730 dort niederließ. Er erwarb bereits 1731 das Göttinger Bürgerrecht, errichtete als Faktor im Rahmen der Königlichen Fabriken eine Färberei und pachtete daneben den Weinkeller der Universität. In den 40er Jahren wurde er zum Kommerzien-Kommissar ernannt. Er starb bereits Während der älteste Sohn, Johann Georg im väterlichen Betrieb mitarbeitete, hatte er seinem zweiten Sohn, Johann Heinrich in den 40er Jahren die Färberei in Langensalza überlassen. Dieser Sohn er- 3 Vgl. Ottfried DASCHfR, Das Textilgewerhe in Hessen-Kassel vom 16. bis 19. Jahrhundert. Marburg 1968, S. 58 f. 4 Vgl. KoCII, wie Anm. 1, S. 108 ff.
119 122 Victor-L. Siemers hielt darüber hinaus das Privileg, zwischen Göttingen und Langensalza eine Universitätspost zu betreiben. Wöchentlich einmal fuhr er mehrere Jahre lang uniformiert mit einer roten Kutsche zwischen den bei den Städten hin und her. Nach dem Tode des Vaters errichtete Johann Heinrich in Weende bei Göttingen eine Walkmühle, durfte in einer eigenen Fabrik nun auch Uniformtuche sowie Kamelot 5 herstellen lassen und erhielt neben dem Titel eines Kommerzien-Kommissars Lieferaufträge für das Heer soll er schon vier Häuser in Göttingen besessen haben und baute noch ein Fabrikgebäude 6 Im Jahre 1753 verlieh ihm der König in Anbetracht der guten Dienste, so er bisher bei dem Göttingenschen Manufakturwesen geleistet und ferner zu leisten sich anheischig gemacht, eine Anwartschaft auf ein Bürgerlehen mit einem Jahresertrag von Talern 7 Scharffs besondere Stärke lag im Färben. Im späteren Konkursverfahren wurde sein guter Ruf durch einige Zitate aus Enzyklopädien und Zeitungen untermauert. Danach berichtete Büschings Erdbeschreibung, Tom. 111, 3. Band, 3. Auflage 8, pag. 2452, 2639, besonders 2597: Die meisten und besten Wollen-Manufakturen sind zu Göttingen von dem Oberkommissar Graetzel und Kommerzien-Kommissar Scharff angelegt worden; und die Waren, welche diese geschickten Männer liefern, sind sowohl wegen ihrer Güte, als schönen Farben sehr berühmt und beliebt. Herr Scharff lässt auch sowohl leichte als schwere feine Tücher und Rattine von der besten spanischen Wolle nach engländischer Art verfertigen, welche ungezogen oder krumpfrei und ohne die SaalIcisten eine Brabanter Elle breit sind, jedes Stück aber 2 Kleider ausmacht. Diese vortrefflichen Tücher sind so fein, und von so dauerhafter schöner Farbe, dass ihnen die besten Holländischen Tücher nicht vorgezogen werden können, und werden doch zu einem ganz mäßigen Preis verkauft. Und die Hamburger Zeitung 9 in ihrem 52. Stück des Jahres 1752 wurde wie folgt zitiert: Man hat seit einiger Zeit sichere Nachrichten, dass die vor etwa anderthalb Jahren bei Göttingen neu angelegte Scharffsche Camelott- und Barracan-Fabrik ungemein glücklich von statten gehe und die Arbeiten der Zeuge sowohl, als die Dauer der Farben den Beifall der Kenner erhalten. Unter anderem hat der Herr Kommerzien-Kommissar Johann Heinrich Scharff vor kurzem nach einer vieljährigen Übung und nach oft wiederholten kostbaren Versuchen eine vortreffliche hochro- S Auch Camelottl Kamlot: Gutes dünnes Zeug (Wollgewebe aus Kammgarn, ungewalkt), zuweilen auch mit Beimischung von Seide. Vgl. Horst KRÜGER, Zur Geschichte der Manufakturen und der Manufakturarbciter in Preussen, Berlin 1958, S Vgl. KOCH, wie Anm. 1, S Niedersächsisehes Staatsarchiv Wolfenbüttcl (in den folgenden Anmerkungen mit StA WF abgekürzt), 7 Alt Nachtrag Nr D. Anton Friedrich BÜSCIIINGS Neuer Erdbeschrcibung dritten Teils dritter Band, dritte Auflage. Hamburg Gemeint ist hier die Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unparteyischen Correspondenten.
120 Scharff'sche Tuchmanufaktur in WolJenbüttel 123 te Farbe erfunden, welche mit Recht ponceau sans pareil genannt zu werden verdient. Wir haben viele Proben davon in dieser Gegend gesehen, auch sie gegen die besten rotgefärbten Zeuge, und vornehmlich gegen das sonst für unverbesserlich angesehene ecarlate des gobelins gehalten, allemal aber befunden, dass dieselben alles andere Rot an Feuer und Leben übertreffen, und solches in einer merklichen Mattigkeit, die ins Dunkle und Schwärzliche sich verliert, hinter sich zurücklassen. Ja, dem Erhabenen der Farben kommt die Röte mit dem berühmten sächsischen Blau und Grün gen au überein, doch hat es wohl hierinnen einen großen Vorzug, dass es die Luft, desgleichen saure urineuse Dinge, auch merkliche Hitze, wie uns angestellte Proben davon überzeugt haben, ohne sonderlichen Nachteil seines Glanzes vertragen könne. Der Herr Scharff aber besitzt das Geheimnis, diese Farbe nicht allein mit dem Wasser der Leine, sondern auch mit allen anderen süßen Wassern zu färben. Es wird ihm daher das Publikum für seine nützliche Erfindung verbunden sein, und eben demselben zu GefalIen haben wir diese Anzeige um so viel mehr mitteilen wollen, da es eine Pflicht ist, Erfindungen, die einen Einfluss in Handel und Wandel haben, bekannter zu machen. Auch gegen die Behauptung, dass seine Ware der des Konkurrenten Graetzel nicht gleich käme, konnte Scharff sich mit Erfolg wehren, wie das folgende Zitat aus dem Frankfurter Jouma/ IU, Anhang zum 73. Stück vom 5. Mai 1752 zeigt: Es ist in dem 66. Stück dieser Zeitung unter dem 24. April der neuen Scharffschen Camelott-Fabriken zu Göttingen Erwähnung geschehen, und daselbst versichert worden, dass die Scharffschen Waren denen Graetzel'schen nicht gleich kämen, dessen im 52. Stück des Hamburgischen Correspondenten gerühmte neue hochrote Farbe matt und nicht dauerhaft, auch nicht durchgefärbt sei und weder Luft noch Wasser vertragen könne. Als man aber nunmehr, nachdem man von der von dem Kommerzienkommissar Scharff gelieferten und hochrot gefärbten Ware gesehen und damit Versuche angestellt, zuverlässig versichert ist, dass die selbige nicht allein von besonderer Güte, in sonderheit auch dessen neues Hochrot wohldurchgefärbt ist, einen ausnehmenden Glanz und Vorzug vor anderen Ponceau besitzt, und nicht allein Luft und Wasser, sondern auch ziemliche Hitze, saure und urineuse Dinge ohne Nachteil vertragen kann. Man hat der Wahrheit zur Steuer nicht ermangeln wollen, hiermit anzuzeigen, dass man mit der im 66. Stück dieser Zeitung befindlichen Nachricht hintergangen worden, gestalten ein jeder durch den Augenschein, Gegeneinanderhaltung des bisherigen und des Scharffschen Ponceau, auch durch beliebige Proben von der Zuverlässigkeit des jetzt Gemeldeten sich überzeugen kann ll Mit seinem größeren Unternehmer-KolIegen Graetzellieferte sich Scharff einen erbitterten Konkurrenzkampf, nicht nur um die Militär-Aufträge aus Hannover, son- 10 Gemeint sein dürfte: Journal in Franckfurt am Mayn, Vorläufer des Frankfurter Journals. 11 Diese Zitate nach den Abschriften in den Konkursakten, StA WF, 4 Alt 1 ]l;r. 2954, Anlagen zu von Brincken vom 24. Dezember 1774.
121 124 Victor-L. Siemers dem auch um die besten Tuchmacher am Ort. In seinem unten ausführlich wiedergegebenen Plan für die Errichtung einer Fabrik in groben und feinen Tüchern erwähnte Scharff, dass er in Göttingen 1757 mit einer feinen Tuchfabrik angefangen und dazu spanische und portugiesische Wolle in Amsterdam gekauft habe. Den Siebenjährigen Krieg überstanden die Brüder Scharff ohne große Einbußen. Sie hatten die für sie arbeitenden Tuchmacher zu gleichen Teilen unter sich aufgeteilt und nutzten das ihnen zusammen mit ihrem Kollegen Funcke erteilte Privileg für die Herstellung und den Verkauf bestimmter Tuche in und um Göttingen. Johann Heinrich Scharff gründet eine Tuchmanufaktur in Wolfenbüttel Warum der in Göttingen so gerühmte Manufakturist Johann Heinrich Scharff im Jahre 1760 neben seiner dortigen Fabrik und der Färberei in Weende sich um eine neue Existenz in Wolfenbüttel bemühte, ist aus den Akten nicht zu erkennen. Seine Göttinger Aktivitäten haben ihm anscheinend keinen großen finanziellen Nutzen gebracht, denn er verfügte bei seinem Einzug in Wolfenbüttel zwar über einen wohiausgestatteten Haushalt, aber über keine Rarmittel als Start kapital. Das von Herzog Karll. erteilte Privileg vom 6. November 1762, das Grundlage der Scharff'schen Aktivitäten im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel war, sagt in der Einleitung, dass der Herzog sich entschlossen habe, zum Besten des Landes und besonders der Stadt Wolfenbüttel eine Woll- und Halbwollmanufaktur anlegen und einem der Wichtigkeit und dem Aufwande des Werks gewachsenen Entrepreneur gewisse Gebäude dazu einräumen zu lassen. Scharft habe sich darum beworben und für diesen habe vor anderen Bewerbern gesprochen, dass er bereits erworbene bekannte Einsicht und Erfahrung in Fabriksachen habe. Daher sei er anderen, dem ersten Ansehen nach weit vorteilhafteren Anerbietungen vorgezogen worden und die weiter mit ihm gepflogene Unterhandlung habe zur Ratifikation dieses Geschäftes geführt 12. Diese Formulierungen, sowie die Tatsache, dass Scharff bereits am Ausstellungstage des Privilegs einen unterschriebenen Gesellschaftsvertrag für die geplante Manufaktur vorlegen konnte, sprechen dafür, dass längere Verhandlungen mit dem Herzog und den künftigen Gesellschaftern vorausgegangen waren. Das genannte Privileg bestimmte im Wesentlichen: Scharff wird die Anlegung einer Fabrik von Kamelott und anderen wollenen und halbwollenen Waren und einer Färberei für sich und andere in Wolfenbüttel gestattet und der Herzog und seine Nachfolger nehmen das Unternehmen in ihren besonderen landesherrlichen Schutz. Scharff wird gestattet, mit einem oder mehreren Mitgenossen in eine Societaet zu treten und mit diesen gemeinsam das Privileg zu nutzen. Ein dazu führender Vertrag ist der Regierung zur Bestätigung vorzulegen. 12 StA WF, 4 Alt Nr
122 Scharff'sche Tuchmanufaktur in Wolfenbüttel 125 Scharff werden im einzelnen genannte Gebäude eingeräumt. Das Hofmarschallamt soll baldmöglichste Räumung und Übergabe besorgen und die Gebäude bis zur Übergabe in Dach und Fach erhalten. Der Paragraph 4 des Privilegs spielt im Verlauf des späteren Konkurses eine wichtige Rolle, er wird daher hier im Wortlaut wiedergegeben. Alle diese Gebäude, Plätze und Gerechtsame sollen ihm, dem Kommissar Scharff, so wie sie jetzt von allen Oneribus, Service und Auflagen frei sind, und frei bleiben sollen, ohne alles Entgeld überlassen werden, auch ihm, seinen Erben und Erbnehmern eigentümlich sein, um sie nach freier Willkür zum Behuf der Fabrik und Färberei einzurichten und zu gebrauchen; wohingegen derselbe sich, seine Erben und Erbnehmer verpflichtet, die Fabrik und Färberei jederzeit in einem beträchtlichen Stande zu erhalten, auch von den Gebäuden keines eingehen zu lassen, außer das sub V. und dem Scheuerhause bei W, deren Abbrechung und Verbrauchung der Materialien ihm gestattet ist. Scharff darf innerhalb des ihm überlassenen Grundstücks eine Kommunikationsbrücke über die Oker anlegen. Scharff wird gegen Beeinträchtigung des durch das Grundstück fließenden Wassers (der Oker) geschützt. Scharff erhält das Recht, in der am Mühlentor gelegenen Mahlmühle einen Mahlgang und den dazu nötigen Raum für die Anlegung einer Walkmühle oder für andere Zwecke zu nutzen. Als Beihilfe für die Ersteinrichtung der Manufaktur erhält Scharff ein Geschenk von Talern. Für die Fabrik soll Scharff jährlich bis zu 100 Klafter zu sechs Kubikfuß gutes Buchen-Kluftholz aus dem fürstlichen Holzmagazin erhalten. Scharff erhält Freiheit von Zoll, Akzise, Impost und allen anderen Belästigungen für sämtliche Rohstoffe und Fertigfabrikate seiner Manufaktur. Scharff wird zugesagt, dass der Bedarf der Hofstatt und der Miliz an feinen und groben Tüchern vorzüglich bei ihm gedeckt werden soll und entsprechende Kontrakte so bald wic möglich abzuschließen sind. Scharff darf mit seinen Rohstoffen und Fertigfabrikaten überall im Land Großund Einzelhandel betreiben. Alle Vereinbarungen sollen auch für Scharffs Erben und Erbnehmer gelten. Scharff sollen keine Hindernisse gegen den weiteren Betrieb seiner Fabrik in Göttingen in den Weg gelegt werden. Bei den übertragenen Gebäuden handelte es sich um eine Häusergruppe, das Kleine Schloss genannt, die am Schlossplatz direkt neben dem alten Schloss gelegen, Sitz der Ritterakademie und später Witwensitz der Herzogswitwe Antoinette Amalie war. Ihretwegen wurde hinsichtlich des Hauptgebäudes innerhalb des übertragenen Areals
123 126 Victor-L. Siemers eine Sonderregclung getroffen. Zur Zeit der Ausstellung des Privilegs war dieses noch von den Schwestern der Herzogswitwe bewohnt. Hier sollte der Übergang in das Eigentum Scharffs spätestens nach Ablauf von fünf Jahren erfolgen. Da Scharff trotz seines gut gehenden Göttinger Unternehmens offensichtlich nicht über das Kapital verfügte, um das herzogliche Privileg allein zu nutzen, hatte er die Gründung einer Societaet vorbereitet und konnte den unterschriebenen Gründungsvertrag für die Firma Johann Heinrich Scharf! & Compagnie am Ausstellungsdatum des Privilegs vorweisen 13. Danach hatte er sowohl Finanziers in der Person der Braunschweiger Bankiers Buttger Heinrich Klünder und Johann Friedrich Schwarz gewonnen als auch mit Johann Gottfried Cüntzel aus Hildcsheim einen Kaufmann mit Kapital, der das Warenlager und den Debit, den Warenverkauf, übernehmen sollte. Für Cüntzel hat der Herzog ein der Kammer gehörendes Haus am Eiermarkt bereitgestellt, was für die Ernsthaftigkeit der Pläne des Hildesheimer Kaufmanns spricht. Das Nachbarhaus war vom Herzog für die oben genannten Bankiers vorgesehen 14 Scharff selber wollte sich nach dem Vertrag hauptsächlich um den Wolleinkauf, die Produktion mit Schwerpunkt Ausrüstung (Walken, Färben usw.) und die Lieferverträge für Uniformtuche mit den herzoglichen Behörden kümmern. Für die Fabrik war zu Beginn der Einsatz von 20 Webstühlen vorgesehen, wobei nicht eindeutig ist, ob diese Anzahl nur die in der Fabrik Aufzustellenden meinte oder auch den Verlag selbständiger Meister. Cüntzel hat sehr schnell ein Kapital von Talern zur Verfügung gestellt und zugesagt, nach Braunschweig zu ziehen. Den unterschriebenen Vertrag sandte Scharff, wie im Privileg verlangt, am 13. November der herzoglichen Geheimratsstube zur Genehmigung ein. Scharff und seine Fabrik zwischen 1762 und 1774 Es muss hier vorausgeschickt werden, dass über Scharffs Vermögen im Jahre 1773 der Konkurs eröffnet wurde. Denn fast alle Informationen über den Geschäftsgang der Fabrik verdanken wir den Akten des späteren Konkursverfahrens, auf das in einem eigenen Kapitel eingegangen werden soll. Zwei Eigenheiten dieses Konkurses sind die Ursache für das Vorliegen dieser Informationen. Nach damaligem Konkursrecht wurden die angemeldeten und anerkannten Forderungen nicht prozentual aus der Konkursmasse befriedigt, sondern in einer Reihenfolge, für die das Entstehungsdatum der Forderung von großer Bedeutung war. Da die Konkursmasse natürlich nicht zur Befriedigung aller Gläubiger ausreichte, konnten nur diejenigen auf Bezahlung hoffen, die ein frühes Entstehungsdatum zweifelsfrei nachweisen konnten. Diese Nachweise sind die eine aussagefähige Quelle. Die andere Eigenheit ist ein lange währender Rechtsstreit zwischen der herzoglichen Kammer und dem Kurator, dem Konkursverwalter, über das Eigentum an den 13 StA WF, 4 Alt 1 Nr Vgl. StA WF, 2 Alt Nr
124 Scharff'sche Tuchmanufaktur in Wolfenbüttel 127 mit zwei Hypotheken belasteten Schlossgebäuden. Bcide Seiten konnten ihren Standpunkt nur durch Darstellung des Geschäftsganges der Fabrik nachweisen. Bei Ausstellung des Privilegs sah alles nach einem planmäßigen Start der Manufaktur aus, bis im Jahre 1762 (das genaue Datum ist aus den Akten nicht zu ersehen) Scharffs Finanziers, die bei den Bankiers Klünder und Schwarz, Konkurs anmelden mussten und daher die vereinbarte Kapitaleinlage nicht leisten konnten 15 Einiges spricht dafür, dass dieser Umstand den Kaufmann Cüntzcl veranlasst hat, sich seinerseits aus dem Vertrag zurückzuziehen, obwohl er bereits eine Zahlung von Talern an Scharff geleistet hatte und ein Haus für ihn in Braunschweig vorgesehen war. Ob er den Vertrag durch den Konkurs der beiden anderen Gesellschafter für erledigt und den Start des Unternehmens dadurch für aussichtslos hielt, oder sein Rückzug mit ungewissen Plänen für eine Zusammenarbeit in Göttingen zusammenhingen, muss offen bleiben. Hinweise auf Göttingen enthielt bereits der Sozietätsvertrag von 1762, in dessen Paragraph 9 festgelegt wurde, dass im Falle einer Übergabe der Graetzel'schen Privilegien an Cüntzel und Scharff nicht diese beiden, sondern die in Braunschweig gegründete Firma Johann Heinrich Scharff & Compagnie das Geschäft übernehmen sollte. Dazu gibt es zwei Schreiben des Hannoverschen Geheimen Kabinettssekretärs Ubbeloh vom 18. und 26. Oktober 1763 an Cüntzel 16 In denen teilte jener mit, dass der Geheimrat von Hacke daran interessiert sei, dass Cüntzel, evtl. in Zusammenarbeit mit Scharff, in die Privilegien eintrete, die bisher der Oberkommissar Graetzel, Scharffs größter Konkurrent in Göttingen, innehatte. Graetzel hatte sich in Hannover unbeliebt gemacht, weil er wegen der französischen Besetzung Göttingens sich nach Blankenburg abgesetzt und dort im Ausland entgegen den Vereinbarungen mit der Regierung wieder eine Manufaktur eröffnet hatte. Von Hacke erwartete das baldige Ableben des über 70 Jahre alten Oberkommissars, so dass über die Privilegien hätte verfügt werden können. Ubbeloh empfahl Cüntzel, sein Hildesheimer Geschäft aufzugeben und nach Göttingen zu ziehen, um dort nicht nur die Privilegien Graetzels, sondern auch die diesem gewährten Darlehen zu übernehmen. Cüntzel hat sich jedoch auch hier zurückgehalten und damit aus heutiger Sicht richtig gehandelt, denn Graetzel, schon Ende 1762 nach Göttingen zurückgekehrt, konnte seine dortige Manufaktur, wenn auch in geringerem Umfang, wieder in Gang setzen und starb erst Da Cüntzel auf Scharffs Briefe nicht antwortete, blieb diesem nichts anderes übrig, als seinen Vertragspartner vor dem Magistrat in Braunschweig auf Erfüllung zu verklagen 18 Dieses Verfahren zog sich hin, der Magistrat verlangte die Vorlage des Originalvertrages, der immer noch beim Geheimen Rat lag. Am 20. März 1766 bestätigte der Geheime Rat das Vorhandensein und die Genehmigung des Vertrages und ver- IS Der Konkurs hat offenbar nur das Bankgeschäft betroffen, denn Schwarz, jetzt als Kaufmann bezeichnet, bezog das vom Herzog für das Bankgeschäft vorgesehene Haus und wurde so zum Nachbarn des Leihhauses, das 1765 in das Eckhaus zum Eiermarkt einzog. Vgl. StA WF, 2 Alt Nr Vgl. StA WF, 4 Alt 1 Nr Vgl. KOCH wie Anm. I, S 154 ff. 18 Vgl. StA WF, 4 Alt 1 Nr
125 128 Victor-L. Siemers sprach baldige Übersendung. Diese folgte endlich am 1. April Die Gründe für diese Verzögerung konnten niemals aufgeklärt werden. Für den Kläger bedeutete das jedoch, dass er keine Möglichkeit bekam, Cüntzel auf diesem Wege zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen zu zwingen. Inzwischen war Scharff mit Familie und Dienstboten nach Wolfenbüttel gezogen und hatte begonnen, seine Manufaktur einzurichten. Durch den Ausfall seiner vorgesehenen Gesellschafter war er, inzwischen zum Kommerzienrat ernannt, ständig in Geldnot. Er musste sein Unternehmen wesentlich bescheidener aufziehen, als er geplant hatte. Im Sozietätsvertrag von 1762 war von der Anlegung von 20 Webstühlen gesprochen, nun musste er mit nur 10 Stück beginnen. Der Färbergeselle Ludewig Meyer sagte als Zeuge im Konkursverfahren 1783 aus: es habe derselbe {Scharffl viel Figur anfänglich gemacht, Equipage und Bediente gehalten, durch welchen Aufwand derselbe vermutlich bankrott geworden 19. Ähnlich urteilte Scharffs langjähriger Förderer, Schrader von Schliestedt, in einer Notiz aus dem Jahre Er sah das Hauptproblern des Kommerzienrats darin, dass er sich nicht an die kleineren Verhältnisse anpassen konnte, Anstalten ins Große machte und sich in kostbaren Bauten pp. verblutete 2o Meyer und ein weiterer Zeuge behaupteten zu wissen, dass Scharff zwar einige Fabrikgerätschaften und 800 Stücke Tuch, aber kein Kapital aus Göttingen mitgebracht habe 2!. Auch sprachen die Zeugen von einem wohleingerichteten Haushalt und von Pretiosen, die Frau Scharff von ihren vermögenden Eltern her besaß. Den gleichen Eindruck vermittelt eine Aufstellung der von Frau Scharff in die Ehe eingebrachten Sachen, die im späteren Konkurs vorgelegt wurde mit dem Ziel der Aussonderung aus der Konkursmasse. Diese Liste umfasst die Aussteuer, die Hochzeits- und Patengeschenke mit insgesamt 62 Positionen sowie 462 Positionen Erbstücke nach dem Tod (1753) ihres Vaters Johann Otto Bachmann. Dieses Erbe war sehr umfangreich, es reichte von sieben Positionen goldene Schmuckstücke und 43 Positionen Tafelsilber, Schmuck und Tischwaren über Bettzeug, Zinn und Glas/ Porzellan bis zu allerhand Haushaltsgeräten. Ob alle diese Dinge mit nach Wolfenbüttel gebracht wurden, ist nicht bekannt, eine Reihe der Gegenstände taucht jedoch in der im gleichen Zusammenhang erstellten Liste der bis 1773 verpfändeten Sachen auf2 2 Zu Beginn der Fabrik gab es einige Schwierigkeiten mit herzoglichen Behörden wegen der vereinbarten Brennholzlieferungen und der zugesagten Abgabenfreiheit für die Hin- und Herlieferungen zwischen Braunschweig und WolfenbütteI. Erst 1764 fand Scharff in dem Kaufmann Johann Dietrich Krause einen Geschäftspartner für den Debit, das heißt, Krause übernahm die nicht an den Hof bzw. das Militär gehende produzierte verkaufsfertige Ware, verkaufte diese und besorgte sowie finanzierte mit dem Erlös den Wolleinkauf und daneben auch den Kauf von Hilfsmaterialien sowie Einkäufe für den Scharff'schen Haushalt. Zwischen dcn Familien Scharff und Krause 19 StA WF, 7 Alt Nachtrag Nr (24. Juli 1783). 20 Vgl. StA WF, 4 Alt 1 Nr Vgl. StA WF, 7 Alt Nachtrag :-.Ir. 1614, und Vgl. StA WF, 7 Alt Nachtrag Nr. 996.
126 Scharff'sche Tuchmanufaktur in Wolfenbüttel 129 entwickelte sich neben den Geschäftsbeziehungen ein reger gesellschaftlicher Kontakt. Nach einem Start, in dem Scharff nur Militäraufträge hatte, konnte er sich mit Hilfe von Krause eine bessere Beschäftigung für die Fabrik verschaffen. Aber bereits 1767 beklagte er sich bei Krause, dass er kein ganzes Fuder Mecklenburgischer Wolle einkaufen könne, da seine von Hannover erwarteten bewussten Gelder noch ausblieben begann eine Reihe von Vorschuss- und Anleiheanforderungen in relativ kleinen Beträgen (20/30/100 Taler?3. Begründet wurden diese Kalamitäten fast immer mit ausstehenden Geldern aus seinem Göttinger Betrieb. Dort hatte es bereits 1763 den Vorwurf aus Hannover gegeben, er habe bei einer Militärlieferung fremde Tuche unter seine eigenen Produkte gemischt. Scharff behauptete in dem Verfahren unwidersprochen, dass er den abnehmenden Quartiermeister auf diese Beimischung hingewiesen hätte, und so hatte er das Glück, dass das Hannoversche Staatsministerium dem König empfahl, Scharff wegen dieses einmaligen Vorfalls nicht alle Militäraufträge zu entziehen 24 Schwer nachprüfbar ist Scharffs Behauptung von 1774, er habe in Göttingen in den Jahren Lieferaufträge für Tuche und Futterstoffe für das Militär im Umfang von Talern für jeweils zwei Jahre gehabt. Durch Cüntzels Vertragsbruch haben diese Aufträge nicht ordnungsgemäß abgewickelt werden können. Aus dem gleichen Grund habe ihn sein Buchhalter um erhebliche Geldbeträge betrügen können 25. Statt Geld von dort zu bekommen, musste er ständig Zahlungen für laufende Prozesse leisten. In einem Kommissionsbericht über die Situation Scharffs vom 21. Juni 1773 werden Zahlungen nach Göttingen von insgesamt etwa Talern aufgeführt, die durch später nur teilweise getilgte Darlehen des Erbprinzen Karl Wilhe1m Ferdinand und des Leihhauses aufgebracht werden konnten 26. Selbst Guthaben in Göttingen verwandelten sich in Schulden, die später noch eine Rolle im Konkurs spielten. Scharff hatte Warenreste aus der Handlung seines verstorbenen Schwiegervaters Bachmann im Wert von Talern an den Kaufmann Lauer verkauft. Die daraus resultierende Forderung hatte er an dcn Verwalter Böse zur Abdeckung von dessen Forderungen gegen Scharff abgetreten. Als Lauer insolvent wurde und Scharff den Betrag nicht heranschaffen konnte, sicherte letzterer gemeinsam mit seiner Frau Böses Forderung durch eine Hypothek auf die Schlossgebäude und deren Inhalt. Die Hypothek wurde am 21. April 1769 von der Justizkanzlei genehmigt27. Diese Anerkennung wurde im Konkursverfahren als Beweis des Eigentumsrechts angeführt, das Scharff an den Gebäuden habe. Einblicke in den Geschäftsverlauf in Wolfenbüttel seit 1765 erlaubt eine Reihe von Briefen Scharffs an Johann Dietrich Krause und dessen Bruder Conrad Wilhe1m, der bei Abwesenheit und nach dem Tode Johann Dietrichs dessen Geschäfte führte 28. In diesen Briefen wurde häufig aufgeführt, welche Lieferungen mit welchem Wert an 2J Vgl. StA WF, 7 Alt Nachtrag Nr Vgl. ebd. Nr Anlage T zur Excemptionsschrift v. Brincken vom 28. Mai 1774, vgl. StA WF, 4 Alt 1 Nr Vgl. StA WF, 4 Alt 1 Nr Vgl. StA WF, 4 Alt 1 Nr. 2954; auch 7 Alt Nachtrag I\'r Vgl. StA WF, 7 Alt Nachtrag Nr. 978.
127 130 Victor-L. Siemers Krause erfolgt waren, welche Rückstände bestanden und zu welchen Terminen diese aufgearbeitet werden sollten. Dann folgten Bestellungen über Farbe und Färbematerialien verschiedenster Art für die Fabrik sowie solche für den Scharff'schen Haushalt wie für Zucker, Kaffee, Wein, Bier, Gewürze u.ä. Viele Briefe zeugen von den gesellschaftlichen Kontakten der Familien. Der Ton war stets ausgesprochen höflich, der Empfang von Krauses Briefen wurde mit ausführlichen Dankesformeln bestätigt und kein Brief endet ohne die Bitte einer Empfehlung an die verehrte Eheliebste. Leider ist kein Brief der Brüder Krause erhalten, so dass wir nicht wissen, ob diese ebenso formvollendet schrieben. Die Scharff'schen Briefe lassen darauf schließen, dass er und seine Familie ein gutbürgerliches Haus führten. Scharffs und Krauses besuchten sich gegenseitig, Krause war bei der Besorgung von Opernplätzen für die Familie samt Freunden und der dafür erforderlichen Nachtquartiere behilflich und machte auch auf Unterhaltungen aufmerksam, Spectaceln genannt, die in Braunschweig stattfinden sollten. Als Beispiel für Scharffs amüsanten Briefstil sei hier der Dank für einen solchen Hinweis wörtlich zitiert:... Für die wegen den dortigen Spectacels, dass diese auf nächste Ostern erst wiederum angehen, sagen die Meinigen als Groß und Klein, uns gegebener Nachricht verbindlichen Dank; seinerzeit werden diese nicht verfehlen, weilen Sie es so haben wollen, dass Sie mit einem ganzen Wagen voll sollen inkommodiert werden 29 Auch der Geheimrat Schrader von Schliestedt mit Töchtern beehrte Scharff mit seinem Besuch und äußerte sich sehr angetan von der besichtigten Fabrik. Scharff unterhielt ein Gespann Pferde für seine Kutsche und für den Waren transport. Auf der anderen Seite muss Scharff auch zu dieser Zeit schon oft an Mangel an barem Gelde gelitten haben. Neben der Anforderung von Beträgen von 25 bis 30 Talern, die dem normalen Kontokorrent belastet werden sollten, finden sich bereits 1767 unter Hinweis auf ausstehende Zahlungen aus Göttingen Bitten um jeweils 40 bis 50 Taler, die kurzfristig zurückgezahlt werden sollten und deren Rückzahlung sich immer wieder verschob. Im Laufe der Jahre vermehrten sich diese Bitten und setzten sich auch nach dem Tod von Johann Dietrich Krause fort, nun mit Conrad Wilhelm Krause als Adressaten. Zum Geschäftsverlauf in den 10 Jahren des Betriebes der Manufaktur sollen hier einige globale Zahlen folgen: Der seit 1763 in der Manufaktur beschäftigte Färberknecht Meyer und der Werkmeister Vogel berichteten im Konkursverfahren über die Anzahl der in Betrieb gewesenen Webstühle: 1764: zehn Webstühle für Camelot und Barakan 1765: deren : deren : 11 bis : 11 bis : 9 bis : 6 Kamelott- und 2 Thchstühle 29 StA WF, 7 Alt Nachtrag Nr. 978.
128 Scharff'sche Tuchmanufaktur in Wolfenbüttel : 5 Kamelott- und 2 Tuchstühle 1772: 4 Kamelott- und 2 Tuchstühle und bis gegen Herbst bis 2 Kamelott- und 1 Tuchstuhl 3o Dazu heißt es in der Aussage der beiden Beschäftigten, dass man von 1770 bis 1773 Anstalten gemacht habe, eine Spanische Tuchmanufaktur einzurichten, man habe Arbeiter aus Göttingen, Holland und anderen Orten geholt, die sich auf die Verarbeitung hochwertiger Wolle verstanden. Aber aus Mangel an spanischer Wolle hätten diese Leute dann die hiesige der spanischen nicht ungleich herrichten können. Über seine Verkäufe in den Jahren 1764 bis 1774 lieferte Scharff 1774 eine Aufstellung 3!. Danach hat er geliefert: Uniformtücher unterschiedlicher Qualität und Farbe, wie Pagen-, Leibjäger-, Heyducken-, Bedienten-, Lakaien- und Stalllivree-Tücher, sowie die der einzelnen Regimenter; Futter und Unterfutter Barakan (Berkan, Barracan): dicht gewebter gewalkter Wollzeug, ursprünglich aus Kamel- oder Ziegenhaar, wegen der dichten Webart wasserdicht, daher für Mäntel geeignet Boy: leichter tuchartiger Futterstoff Camelot (Kamelott): gutes ein- oder mehrfarbiges (Woll-)Zeug, zuweilen auch mit Seiden-Beimischung Chalong: wollener Zeug von besserer Wolle, gewalkt, für Unterfutter Sarge (Serge): geköperter Wollzeug 32 Alle diese Sorten waren Konsumqualitäten und, wie Scharff später zugeben musste, nichts was nicht schon bisher von den inländischen Tuchmachern hergestellt worden war. Außerdem färbte er auch von Kunden angelieferte Wollstoffe und stellte gefärbte Game für die Produktion von changierendem Kamelott her. Auch über die gelieferten Mengen gibt diese Aufstellung Auskunft. Danach hat Scharff verkauft: an das Militär Ellen für Taler an den Hof Ellen für Taler an zivile Kunden Ellen für Taler über Kaufmann Krause Ellen für Taler direkt vom Lager Ellen für 505 Taler insgesamt Ellen für Taler 30 StA WF, 4 Alt 1 Nr Zahlen aus StA WF, 4 Alt 1 Nr Erklärungen nach Ottfried DASCHER, Das Textilgewerbe, wie Anm. 4, S. 251 f; Horst KRÜGER, Manufakturen, wie Anm. 5, S. 713 ff.; ZEDLER Bd. 34, sp. 101 und Bd. 45, sp ff.
129 132 Victor-L. Siemers In seinem Gutachten vom 27. Februar 1770, auf das weiter unten näher eingegangen wird, nannte Scharff die Jahres-Produktion eines Webstuhls mit etwa Ellen. Durchschnittlich neun Stühle hätten demnach in 10 Jahren etwa Ellen herstellen können. Die in Scharffs oben herangezogener Aufstellung genannten etwa Ellen entsprechen diesem Wert ungefähr, wenn in Rechnung gestellt wird, dass Scharff noch einiges an Tüchern aus seiner Göttinger Manufaktur nach Wolfenbüttel hat bringen können 33 Ob er mit diesen durchschnittlich Talern Jahresumsatz einen Gewinn erzielt hat, aus dem er seinen zumindest in den ersten Jahren ziemlich aufwendigen Lebensstil finanzieren konnte, ist schwer zu sagen. Für seine Göttinger Produktion nannte er 15% vom Umsatz Gewinn als normal, das wären 900 Taler im Jahr. Davon konnte er keinesfalls neben seinem Lebensunterhalt die zu Beginn aufgenommenen Kredite verzinsen, geschweige denn zurückzahlen. Ob es der spärliche Gewinn aus dieser Produktion oder die oben erwähnten Geldabflüsse nach Göttingen waren, die Scharff in immer neue Schulden stürzten, ist aus den Akten nicht klar zu ersehen. Erkennbar ist jedoch, dass er bei zahlreichen Leuten seit 1763 Darlehen zwischen 50 und 500 Talern aufnahm, die Brenn- und Bauholzrechnungen der Kammer nicht immer und seine Unterlieferanten nur unregelmäßig bezahlte, sowie bei den Militärlieferungen stets nicht vereinbarte Vorschüsse erbat. Bereits 1765, kurz nach Beginn der Zusammenarbeit mit dem Kaufmann Krause, hat dieser zusammen mit seiner Frau eine Bürgschaft für ein Darlehen des Leihhauses von Talern übernommen und wurde dafür mit einer Hypothek auf das gesamte Vermögen der Scharffs, insbesondere auf die Schlossgebäude abgesichert. Auch diese Hypothek vom 19. Januar 1767 wurde wie die spätere vom Herzog genehmigt34. Ein anderer größerer Schuldbetrag war das Darlehen, das Scharff im Jahre 1768 von dem Kriegskommissar August Ferdinand Friedrich Kraus in zwei Beträgen zu insgesamt Talern erhielt. Auch von diesem Betrag ist nicht zu erkennen, ob er für den Betrieb in Wolfenbüttel verwendet oder nach Göttingen transferiert wurde. Im Jahre 1772 waren trotz anderslautender Zusagen weder das Kapital noch Zinsen bezahlt worden 35. Im Konkursverfahren nannte Scharff als eine der Ursachen des Niedergangs seiner Fabrik das Mühlenproblem. Im 7 seines Privilegs war ihm die Nutzung eines Gangs der Dammmühle und entsprechend Raum in der Mühle für die Anlegung einer Walke zugesagt. Aus Gründen, die aus den Akten nicht erkennbar sind, konnte die Kammer diese Zusage nicht einhalten und bot Scharff als Ersatz die Schlentermühle an. Er akzeptierte das, und es wurde am 8. März 1765 eine 11 Absätze umfassende Vereinbarung getroffen, in der Scharff keinerlei Vorbehalte gemacht hat. Im Verfahren ließ er nun seinen Konkursverwalter ausführen, er habe 1764 eine vom Wasserrad getriebene Spinnmaschine erfunden und bauen lassen, für deren Antrieb zusätzlich zur Walke die Wasserkraft der Schlentermühle jedoch nicht ausgereicht habe. Daher musste er 33 So zu Beginn seiner Tätigkeit 800 Stück (=3.200 Ellen), vgl. StA WF 7 Alt Nachtrag Nr. 1614, Zeugenaussage vom 24. Juli Vgl. StA WF, 7 Alt Nachtrag Nr Vgl. StA WF, 7 Alt Nachtrag Nr. 888.
130 Scharff'sche Tuchmanufaktur in Wolfenbüttel 133 seine Spinnmaschine durch ci ne Trete-Maschine antreiben lassen, wofür zwei bis drei Leute nötig gewesen seien, denen er je acht Mariengroschen Lohn pro Tag bezahlen musste. Erst 1768, also vier Jahre später, seien Wasserrad und Wasserbauten an der Fabrik für den Antrieb fertig gewesen. Dies dürfte einer der kostbaren Bauten gewesen sein, auf die Schrader von Schliestedt in seiner Notiz von 1770 verwies. Verschärfend auf Scharffs Geldnöte wirkte sich aus, dass sich das ihm 1753 in Göttingen zugesagte Bürgerlehen, als es ihm 1770 endlich verliehen wurde, als wertlos erwies. Es war mit so hohen Schulden belastet, dass er keinerlei Erträge daraus ziehen konnte 36 Als sein Geschäftspartner Krause im Jahr 1770 starb, kumulierten Scharffs GeIdprobleme. Das veranlasste ihn, die Flucht nach vorn anzutreten. Er besann sich auf eine seiner unstreitigen Stärken, die Ausarbeitung von Planungen, die durch ihren eingängigen Stil und den eindrucksvollen Zahlenreichtum glänzten. Am 27. Februar des Jahres legte er dem Geheimrat Schrader von Schliestedt ein Promemoria Die Fabrik in grob und feinen Tüchern betreffend vor3 7 Einleitend schrieb er: Da Euer Excellenz den Debit der groben und feinen Tücher mir neulich zu versprechen geruhten, so handle [ich) nur im gegenwärtigen U.P.M., wie dergleichen Manufaktur mit Gleichförmigkeit der Beschaffenheit unseres Landes und deren darinnen befindlichen Arbeiter nicht allein übereinkommen, sondern auch wie darinnen sowohl grobe als feine Tücher mit auswärtigen in gleicher Bonität verfertigt, und vor die hergebrachten Preise geliefert werden mögen, ab. Es folgte eine 23 Paragraphen umfassende Darstellung davon, wie eine Tuchmanufaktur organisiert werden könnte, mit besonderem Schwerpunkt auf der Herstellung feiner Sorten. Grundannahme war darin, dass in der Manufaktur alle im Land gebrauchten Tuchqualitäten hergestellt werden sollten. Scharff definierte neun Qualitäten und postulierte, dass wegen der wünschenswerten Spezialisierung der Tuchmacher auf einem Webstuhl immer nur eine Qualität gewebt werden sollte. Daraus ergab sich für sein Modell eine Kapazität von neuen Webstühlen. Später sollte die Anzahl der Stühle dem Bedarf angepasst werden. Neben genauen Preisangaben für die verschiedenen Provenienzen deutscher Rohwolle lieferte Scharff detaillierte Beschreibungen der Preisbildung und der Handelsusancen für spanische und portugiesische Wolle am Handelsplatz Amsterdam. Während er für die fünf unteren Tuchqualitäten nur den Wolleinkauf zentralisieren und die Verarbeitung bis zum Weben den zünftigen Tuchmachern in traditioneller Arbeitsweise überlassen wollte, beschrieb er für die Vorbereitung der hochwertigen spanischen und portugiesischen Rohwolle für das Weben neun Arbeitsgänge vom Reinigen bis zum Spinnen und nannte für jede dieser Arbeiten die Art der benötigten Arbeitskräfte - Männer, Frauen oder Kinder - und bezifferte gen au deren jeweilige tägliche Arbeitsleistung und den Lohn. Auffällig ist, dass dieser so exakten Zusammenstellung wesentliche Positionen wie der Weberlohn ebenso fehlten wie eine Durchrechnung bis zu den gesamten Herstellungskosten und deren Gegenüberstel- J6 Vgl. Scharff'sche Familienchronik, Manuskript im Besitz der Scharff'schen r-;achkommen, S Vgl. StA WF, 7 Alt Nachtrag Nr. 982.
131 134 Victor-L. Siemers lung mit den erzielbaren Verkaufspreisen. Ich habe aus den Angaben Scharffs über die vorbereitenden Arbeiten einen Personalbedarf von acht Männern, 19 Frauen und 23 Kindern errechnet, die nötig waren, damit die vier Webstühle für feine Qualitäten produzieren konnten. Ein Webstuhl erforderte demnach außer dem Weber zwei Männer, fünf Frauen und fünf bis sechs Kinder. Für die Chronologie der Scharff'schen Manufaktur ist festzuhalten, dass ein Kernpunkt des Promemoria vom 27. Februar 1770 die Finanzierung war. Scharff schlug vor, eine gemeinnützige Landesanstalt zu begründen, in der die Landstände Finanzierung und Oberaufsicht übernehmen sollten, diesen daher auch der Gewinn zustehen sollte. Er selber sah sich als eine Art Direktor, der alle Arbeitsabläufe überwachte. Auf sein eigenes Risiko wollte er nur die Ausrüstung in seiner Fabrik übernehmen, den Teil also, auf den er sich gut verstand. Die Landstände hatte Scharff deswegen als Finanziers ausgesucht, weil zu der Zeit wohl bekannt war, dass der Herzog wegen der Überschuldung aller seiner Kassen die Landstände einberufen hatte. Diese besaßen das alleinige Recht der Steuerbewilligung, und das hieß für Scharff, dass sie auch über die Mittel verfügen sollten, um die von ihm vorgeschlagene Anstalt zu betreiben. Ein weiterer Kernpunkt von Scharffs Vorschlägen war die Ansiedlung der gesamten Wollverarbeitung für die feinen Qualitäten im herzoglichen Werkhaus - und nicht in Scharffs Fabrik oder bei den zünftigen Meistern. Begründet wurde das mit der Gefahr von Unterschleifen bei diesem so teuren Rohstoff. Das Promemoria zeigte Wirkung. Von Scharffs Finanzierungsmodell war nicht mehr die Rede, aber an der Erweiterung der Manufaktur waren der Herzog und der Geheime Rat durchaus interessiert, denn hier wurde eine Möglichkeit zur Stärkung der Wirtschaftskraft des Landes gesehen. Daher erschien am 20. April 1771 folgender Text in den Braunschweigischen Anzeigen: Da auf der von des Herrn Herzogs, unseres gnädigsten Herrn Durchlaucht, gnädigst privilegierten Manufaktur des Kommerzienrats Scharff zu Wolfenbüttel nicht nur die derselben gnädigst beigelegten Lieferungen der Tücher und Futter zu den Livrees der Fürst\. Hofstatt und Montierung der Fürst\. Truppen besorgt, sondern auch die Fabrizierung feiner und ordinärer Tücher begonnen werden soll, so wird den inländischen Tuchmachern und sonstigen Arbeitern, welche etwa bei gedachter Fabrik Arbeit suchen möchten, solches hiermit bekannt gemacht. Braunschwcig, den 12. April Zwei Monate später berief Herzog Karl I. eine Kommission aus dem Hofrat von Dürr und dem Bürgermeister Koch unter Leitung des Geheimrats von Schliestedt, mit einem Auftrag, der wie folgt begann: Man ist im Begriff, durch den Kommerzienrat Scharf! eine feine Tuchfabrik anlegen, und auf die [Verfertigung] von Mitteltüchern extendieren zu lassen 38 Die Kommission habe den Kommerzienrat zu vernehmen und darüber zu berichten. Für das erste Gespräch mit der Kommission legte Scharff am 25. Juni 1771 den Vorläufigen Plan zur Einrichtung einer feinen und mittelfeinen Tuchfabrik 39vo~ der 38 StA WF, 4 Alt 1 Nr Vgl. StA WF, 7 Alt Nachtrag Nr. 982.
132 Scharff'sche Tuchmanufaktur in Wolfenbüttel 135 in dem technischen Teil Bezug auf das Pro Memoria vom 27. Februar 1770 nahm. Neu war hier, dass die Verarbeitung der spanischen und portugiesischen Wolle statt in einem Werkhaus in der Scharff'schen Fabrik geschehen sollte und zwar unter Einsatz von Waisenkindern aus dem Braunschweigischen und dem Wolfenbüttelschen Waisenhaus. Ferner war der Anspruch aufgegeben, alle benötigten Tuchqualitäten anzubieten, und die Kapazität für die feinen Sorten wurde nach der handelsüblichen Mindest-Einkaufsmenge an spanischer und portugiesischer Wolle bemessen. Zehn Ballen Wolle zu Taler sollten gekauft und auf einem Webstuhl innerhalb 17 Monaten verarbeitet werden. Mit der Vorbereitung der Wolle sollten fünf Waisenknaben und fünf Waisenmädchen unter Berücksichtigung der Schulzeit etwa die gleichen 17 Monate beschäftigt werden und dabei eine Art Lehre machen, die sie später zu einem eigenen Lebensunterhalt befähigen sollte. Scharff wollte den Waisenhäusern, in denen die Kinder weiter wohnen sollten, 30 Taler je Kind im Jahr bezahlen, wofür sie 12 Stunden am Tag arbeiten sollten. Dieses Geld wollte er nicht in bar, sondern überwiegend mit der Lieferung der für die Einkleidung aller Waisenkinder nötigen Tuche bezahlen. Daneben wollte Scharff auf einigen weiteren Webstühlen die ordinären Sorten von verlegten Meistem herstellen lassen, wofür die Fabrik nur den Wolleinkauf zu übernehmen hätte. Für die Finanzierung von Wollcinkauf und Fabrikeinrichtung forderte er einen zinslosen Vorschuss von Talern, besichert durch Übereignung aller in der Fabrik befindlichen Halb- und Fertigfabrikate. Wie in seinem ersten Plan wollte er auch hier den Debit der produzierten Ware nicht übernehmen, sondern einem Kommissionär übertragen. Am 15. Juli 1771 vernahm die Kommission Scharff aus der Basis seiner Vorschläge. Wegen der angeforderten Waisenkinder hatte man den Konsistorialrat Engelbrecht als Mitglied der Waisenhaus-Kommission hinzugezogen. Diese Arbeitskräfte erwiesen sich als das schwierigste Problem. Das Wolfenbütteler Waisenhaus hatte längst nicht so viele Waisenkinder, wie Scharff sie haben wollte, und es hätte auch von Braunschweig nach dort gesandte Kinder aus Platzmangel nicht unterbringen können. Vor allem aber hielt Engelbrecht die von Scharff vorgesehenen Arbeitszeiten von täglich 12 Stunden für die Konfirmierten und zweimal drei Stunden für die Jüngeren für unzumutbar. Auch sei ein derartiger kommerzieller Einsatz der Waisenkinder mit dem Stiftungszweck des Waisenhaus unvereinbar. Im Bericht der Kommission an von Schliestedt wurde aus wirtschaftlicher Sicht der Start mit einem schon vorhandenen Webstuhl für feine, und zwei neuen für mittelfeine Tücher für realisierbar gehalten; ohne Berechnung von Lagerkosten und Zinsen hätte in den ersten 15 Monaten ein Überschuss von 567 Talern entstehen können. Als Hauptproblern wurde die Bereitstellung der Waisenkinder dargestellt. Die einzige Möglichkeit wäre deren Unterbringen in der Scharff'schen Fabrik gewesen. Dann würde es sich um eine Lehrzeit handeln, für die das Waisenhaus Kleidung und Wäsche stellen könnte, wie solches schon bei anderen Professionen geschiehfo. 40 Vgl. StA WF, 7 Alt Nachtrag Nr. 982.
133 136 Victor-L. Siemers Schon am 20. Juli fand das nächste Gespräch mit Scharff in Anwesenheit von von Schliestedt statt. Der Kommerzienrat wurde mit seinem Schuldenstand von etwa Talern konfrontiert und gefragt, wie er ohne Geldmittel die vereinbarten Liefertermine für die Militär- und Hoflieferungen sicherstellen wolle. Er verwies auf erwartete Zahlungen aus Göttingen von Talern und versprach, einen neuen Zahlungsplan vorzulegen. Wegen der von ihm angeforderten Waisenkinder wurde ihm bedeutet, dass er selber Vorschläge machen sollte, wie diese untergebracht und unterhalten werden könnten. Eine Zusage für den geforderten Vorschuss zur Einrichtung der erweiterten Manufaktur erhielt er nicht. Von nun an kämpfte Scharft gewissermaßen an zwei Fronten. Um seine Lieferverträge zu erfüllen und damit die Voraussetzung für die Anschlussaufträge zu schaffen, musste er seine Gläubiger nicht nur hinhalten, sondern auch versuchen, Wolle auf neuen Kredit heranzuschaffen. Das führte zu Klagen der Tuchhändler und Tuchmacher in Braunschweig, die vor Scharffs Auftreten die Militärlieferungen im Verlagssystem abgewickelt hatten. Die Händler fanden kein obrigkeitliches Gehör, die Tuchmacher aber, die Scharff als verlegte Meister für seine Manufaktur beschäftigt hatte, waren wegen Wollmangel arbeitslos, klagten ihr Leid beim Herzog und bewirkten wenigstens, dass ihnen Teile ihres Arbeitslohnes zu Lasten von Scharff aus der Kriegskasse bezahlt wurden. Das nun wieder verschärfte dessen Geldprobleme. Im Herbst 1771 wurde deutlich, dass Scharff nicht nur die zugesagte Beschäftigung der Braunschweigischen Tuchmacher nicht sicherstellen konnte, sondern nun auch noch Qualitätsprobleme bekam, weil er keinen vereidigten Werkmeister mehr hatte, der die vorgeschriebene Schau der fertigen Tuche vor Ablieferung vornehmen konnte. Nur mit geschickten Verhandlungen konnte Scharff die Abnahme durch den Kriegsrat von Dürr erreichen 41 Auf der anderen Seite versuchte Scharff, sein Projekt der erweiterten Manufaktur voranzutreiben, immer in der Hoffnung, hier das Geld verdienen zu können, das er für die Abdeckung seiner Schulden brauchte. Auch ohne eine Geldzusage von der Regierung startete er mit der Einstellung geeigneter Arbeiter, wie aus der oben schon erwähnten Aussage seiner früheren Arbeiter hervorgeht. Der von ihm geplante Einsatz von Waisenkindern als billige Arbeitskräfte scheiterte jedoch an der Unvereinbarkeit von Scharffs Forderungen mit den Möglichkeiten und den berechtigten Bedenken der Waisenhausleitung. Da die Regierung nicht bereit war, ihm den geforderten Vorschuss von Talern zu gewähren, konnte er dieses Projekt nicht realisieren. Über einige Anfertigungen feiner Tücher auf ein bis zwei Stühlen in den Jahren kam er nie hinaus. Die Akten der Jahre 1771 bis 1773 sind voll von beredten Klagen der Tuchmacher, die drohen wegen Arbeitsmangel ins Ausland abwandern zu müssen, Teilzahlungen der herzoglichen Kassen, Lieferproblemen Scharffs und dessen immer neuen Zahlungsplänen. Um etwas Geld zu verdienen, versuchte sich Scharff als Lotterie-Einnehmer für die Waisenhaus-Lotterie und blicb auch hier die Abführung der einge- 4' Vgl. StA WF, 7 Alt Nachtrag Nr. 983.
134 Scharff'sche Tuchmanufaktur in Wo/fenbüttel 137 nommenen Einsätze schuldig 42 Daneben liefen Klagen des Leihhauses gegen die Erben des Kaufmanns Krause auf Herausgabe des beim Tode Krauses vorhandenen Scharff'schen Warenlagers, das sowohl Krause als auch dem Leihhaus und dem Kriegskommissar Kraus verpfändet war 43 Für seinen und seiner Familie Lebensunterhalt hatte Scharff bis dahin insges. 272 Positionen Wertsachen, Tisch- und Bettwäsche und Haushaltsgegenstände bei Pfandleihern, Schutzjuden und dem herzoglichen Leihhaus verpfändet und dafür Taler erhalten. Keines dieser Pfänder konnte er selber einlösen, hatte das vermutlich auch gar nicht beabsichtigt, da vieles davon Teile des Bachmann'schen Erbes waren, die im Scharff'schen IIaushalt nicht unbedingt benötigt wurden. Als zum Jahresende 1772 Bürgermeister Koch berichtete, dass die Fabrik in den letzten Zügen liege, und die Tuchmacher in einer Eingabe an den Erbprinzen fragten: Wer kann uns von der Hand eines Mannes befreien, der eine Geißel so vieler Untertanen ist?, bat Scharff den Herzog um eine Kommission, die seine Finanzen und die Situation der Fabrik klären sollte 44 Im Auftrage des Herzogs übernahm Koch unter der Leitung der Herren von Schliestedt und von Dürr diese Kommission und verhandelte mit den Gläubigern, mit Scharff sowie mit dessen Werkmeister Vogel. Der Kommerzienrat machte dabei unterschiedliche Vorschläge für die Fortführung der Fabrik, auf die im Einzelnen hier nicht eingegangen werden kann; sie liefen sämtlichst auf neue Vorschüsse in der Höhe von etwa Talern hinaus und boten trotzdem keine Gewähr, dass die Unterlieferanten in angemessener Zeit befriedigt werden würden. Am 8. Juli 1773 beschloss daher die Kommission, dass Scharff für den beantragten Vorschuss keinerlei Sicherheit biete und dass wegen Stillstandes der Fabrik kein Anspruch auf das zugesagte Gehalt und die Nutzung der Walkmühle bestehe. Wenige Tage später berichtete daraufhin Geheimrat von Schliestedt an den Erbprinzen über den Stand der Dinge, stellte den Schuldenstand Scharffs mit etwa Talern fest und bat Karl Wilhelm Ferdinand um Anweisung, wie in der Sache weiter verfahren werden solle 45 Bevor es hier zu einer Entscheidung kam, zeigte Scharff am 13. September 1773 der Justizkanzlei an, dass er zum beneficium der cessionis bonorum habe Zuflucht nehmen müssen, d. h. er erklärte sich für zahlungsunfähig und bat um Eröffnung des Konkursverfahrens 46 Der Konkurs Johann Heinrich Scharffs Dieses Verfahren lässt sich in drei Linien darstellen. Die erste Linie besteht in dem hinhaltenden Kampf von Frau Scharft um ihre Aussteuergüter und darum, dass ihre Ehegüter, also die innerhalb der Ehe angeschafften und geerbten Güter, in der Prio- 4' Vgl. StA WF, ebd. Nr Vgl. StA WF, ebd. Nr Vgl. StA WF. 7 Alt Nachtrag Nr , Vgl. StA WF, 7 Alt Nachtrag Nr und Vgl. StA WF, 7 Alt Nachtrag Nr
135 138 Victor-L. Siemers ritätsliste vor die Forderungen der herzoglichen Behörden zu positionieren seien. Zum besseren Verständnis sei hier noch einmal der Verteilungsmodus nach damaligen Konkursrecht vorgestellt: Die angemeldeten und anerkannten Forderungen wurden nicht prozentual aus der Konkursmasse befriedigt, sondern in der Reihenfolge: Lohnforderungen, Ansprüche der Ehefrau aus eingebrachten Aussteuergütern, staatliche Forderungen, Ansprüche der Ehefrau und der Kinder aus Ehegütern und Patengeschenken und dann alle dinglich gesicherten Forderungen in der Reihenfolge ihres Entstehens, die ältesten zuerst, und zwar jeweils in voller Höhe. Dann folgten alle nicht gesicherten Forderungen wieder in der Reihenfolge ihres Entstehens. Da die Konkursmasse natürlich nicht zur Befriedigung aller Gläubiger ausreichte, konnten nur diejenigen auf Bezahlung hoffen, die ein frühes Entstehungsdatum zweifelsfrei nachweisen konnten. Die nachgewiesenen und anerkannten Forderungen wurden in einer Prioritätsliste dokumentiert. Da Scharff immer behauptete, erhebliche ausgeklagte Forderungen aus seinen Göttinger Aktivitäten zu haben, bestand trotz der geringen Wolfenbütteler Konkursmasse die Hoffnung, aus diesen Ehegütern, die Frau Scharff ohne ausreichenden Nachweis mit Talern bewertete, Geld vor den Ansprüchen der herzoglichen Behörden für die Familie zu retten. Auch dieser Kampf erwies sich als fruchtlos, da im September 1774 auch für das in Kurhannover befindliche Vermögen Scharffs der Konkurs eröffnet und aueh dort eine die Kosten deckende Masse nicht vorhanden war. Die zweite Linie besteht aus den zahlreichen, von Scharff veranlassten Versuchen des Kurators, aus echten und vermeintlichen Versäumnissen herzoglicher Behörden Schadensersatzansprüche gegen diese in Höhe von vielen tausend Talern abzuleiten und als Forderungen der Konkursmasse geltend zu machen. Nur diese Ansprüche erklären die intensiven Bemühungen um eine günstige Positionierung in der Prioritätenliste. Anerkannt wurden davon am Ende einige kleine Positionen mit wenig über 100 Talern. Die dritte Linie ist der bereits oben erwähnte Streit zwischen der herzoglichen Kammer und dem Kurator (Konkursverwalter) über die Eigentumsrechte an den Schlossgebäuden und damit deren Einbeziehung in die Konkursmasse. Dieser Streit konnte nie entschieden werden und wurde erst durch einen geschickten Zug des Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand beendet. Frau Scharffs Kampf um ihr Eigentum Frau Scharff stammte, wie oben gezeigt, aus einer vermögenden Göttinger Familie. Sie hatte außer einer kompletten Aussteuer ein Brautgeld von Talern in die Ehe mitgebracht und nach dem Tode ihres Vaters Bargeld, Forderungen, Schmuck sowie Wert- und Haushaltsgegenstände geerbt. Das meiste davon war bei Konkurseröffnung verkauft oder versetzt. Einige Pfänder waren noch nicht verfallen, die Pfandgüter also noch vorhanden. Zum Kurhannoverschen Konkurs hat Frau Scharff
136 Scharff'sche Tuchmanufaktur in Wolfenbüttel 139 ebenso wie im Wolfenbüttelschen den Wert des Bachmannschen Erbes mit Talern angegeben und für diesen Betrag am 8. Februar 1777 den Nachweis aus dem Hauptbuch ihres Vaters führen können. Die im folgenden vereinfacht wiedergegebene Prioritätsliste vom 8. August 1776 zeigt, wie wichtig es für Frau Scharff war, eine Positionierung ihrer Ansprüche vor den Forderungen der herzoglichen Behörden zu erreichcn 47 Sententia prioritat. publicata, [veröffentlichte Prioritätsliste im Konkurs Scharff] Durch den in Hannover eröffneten Partikular-Konkurs ist die Masse erheblich vermindert und noch nicht bestimmbar, daher sind erst die Gerichtsgebühren und die Kosten des Kurators zu bezahlen und dann die Kreditoren in folgender Reihenfolge zu befriedigen: Gläubiger Grund der Forderung Betrag in Taler. Mariengrosehen. Pf 1) Haushälterin N. C. Stol- Liedlohn berg 2) Domestik A. H. Gün- Liedlohn ther für 1 Livree 40 3) Färberkneeht L. Meyer Wochenlohn ) Frau Scharff DotaIgeld 1000 Wert der nicht mehr vorhandenen Aussteuer- Gegenstände und dem Pfandschilling für die verpfändeten Aussteuer- Gegenstände, soweit sie deren Zugehörigkeit zur Aussteuer nachweisen kann unbestimmt 5) Herzogliche Kammer Baumaterial und Brenn holz geliefert ) dieselbe dto. geliefert ) dieselbe wg. Vorschuss vom , der noch nachzuweisen ist 8) dieselbe wg. Darlehen vom ) dieselbe wg. Darlehen vom '7 Vgl. STA WF, 4 Alt 1 Nr
137 140 Victor-L. Siemers Gläubiger Grund der Forderung Betrag in Taler. Mariengroschen. Pf 10) die selbe bzw. Hofmar- lt. noch zu verifizieren schallamt der Abrechnung vom ) Herzogliche Kriegskasse wg. noch nachzuweisen der Abrechnung vom ) Frau Scharff Pfandschilling und Wert unbestimmt der Ehegüter, soweit sie nachgewiesen werden können. Hierzu gehört das Erbe nach Otto Bachmann mit Talern 13) KinderScharff Pfandschilling und Ko- unbestimmt sten für versetzte Patengeschenke 14) Herzogliches Leihhaus Darlehen vom Zinsen für 2 Jahre 15) Verwalter Döse Obligation vom Zinsen für 2 Jahre. Hypotheken-Rechte beider Gläubiger gegen Schlossgebäude werden anerkannt 16) Marie D. Leonhard Obligation von ) Oberfechtmeister Rahn Obligation vom ) Des verst. Dr. Leonhard Obligation vom Tochter Vormund ) Herzogliches Leihhaus Obligation vom ) Des verst. JD. Krause Wechsel vom Erben Vormund wenn nicht jure separationis zu befriedigen 21) Herzogliches Leihhaus Obligation vom ) MD. Leonhard Obligation vom
138 Scharff'sche Tuchmanufaktur in Wolfenbüttel 141 Gläubiger Grund der Forderung Betrag in Taler. Mariengroschen. Pf dto. vom dto. vom ) Des verst. Kriegskom- aus Vergleich vom missars Kraus Erben ) Senator Schachtrup aus Wolllieferung It Kontrakt vom Nov ) MD. Leonhard Schuldschein vom dto. vom [Summe der quantifizierten Forderungen T. Die Forderungen ab 14) stehen sub hypotheca bonorum, d. h. sie sind durch Abtretung des Eigentums des Schuldners gesichert.] Wenn vorstehende Gläubiger befriedigt sind, und noch etwas übrig bleibt, werden auch folgende chirographarii Buch- und Warenschulden, jedoch alle zugleich und ohne Unterschied der Zeit pro rata befriedigt, als nämlich: [folgen 25 Positionen Waren-, Wechsel-, Schuldschein- und sonstige Forderungen mit ca T.] Als chirographarii Schulden wurden solche Masse-Schulden bezeichnet, die nicht bevorrechtigt oder dinglich gesichert waren. Die Hoffnung, dass aus den zahlreichen Schadenersatzforderungen, die Scharff gegen die herzoglichen Behörden stellte, einiges anerkannt werden würde, hat Frau Scharff nicht aufgegeben, ebenso wenig den Glauben, dass aus der Verwertung des Fabrikinventars Geld zur Verfügung stehen würde. Um von diesen Geldern so viel wie möglich für sich zu sichern, blockierte sie zum einen alle Versuche des Kurators, die wenigen vorhandenen Aktiva zu verauktionieren, um zu einem schnellen Ende des Verfahrens zu kommen. Zum anderen kämpfte sie darum, mit ihren unter 12) in der Prioritätsliste anerkannten Ansprüchen vor die Nummern 5) bis 11), die Forderungen der herzoglichen Behörden, positioniert zu werden 48 Mit immer neuen Eingaben an die Justiz-Kanzlei begründete ihr Rechtsanwalt dieses Verlangen mit langen Schriftsätzen, denen prompt die Abweisung folgte, bis auf sein Verlangen die Akten am 14. Dezember 1779 für ein höchstinstanzliches Urteil an die Juristenfakultät der Universität Jena geschickt wurden. Gleichzeitig machte Frau Scharff, immer mit der Voraussetzung, dass ihr aus der Konkursmasse erhebliche Ansprüche zustünden, alle möglichen Vergleichsvorschläge. Als Jena am 24. Januar 1780 für Recht erklärte, dass es bei der Prioritätsliste vom 8. August 1776 zu bleiben habe, die Ansprüche der herzoglichen Behörden (Nr. 5)-11» jedoch nur aus Vermögensteilen befriedigt werden dürften, die als Er- 48 Vgl. STA WF, 4 Alt Nr
139 142 Victor-L. Siemers gebnisse der Lieferkontrakte zwischen Scharff und diesen Behörden entstanden seien, hatte Frau Scharff gesiegt. Ihre unter Nr. 12 genannten Ansprüche bezogen sich auf Werte und Gegenstände, die sie eingebracht hatte und die nicht aus den Geschäften ihres Ehemannes herrührten. Gegen das Urteil Jena legten trotzdem heide Parteien Einspruch ein und verlangten ein weiteres Juristen-Urteil. Dieses erfolgte am 27. Januar 1783 durch die Juristenfakultät der Universität Erfurt, die den Spruch der Vorinstanz bestätigte 49 Daraufhin bot Frau Scharff an, ihre gesamten Ansprüche, die ihr Anwalt mit Talern bezifferte, an die Kammer abzutreten gegen die Gewährung einer Rente für sie und Stellungen im Dienste des Herzogs für ihre bei den Söhne, die Jura studiert hatten. Damit könnte das Verfahren erheblich verkürzt werden, da die Konkursmasse sowie der Wert der Gebäude für die übrigen Gläubiger nicht ausreichte und dabei die Rechte aus den beiden Hypotheken zu berücksichtigen seien. Die Kammer könnte so die Gebäude sofort wieder nutzen. Alternativ schlug sie vor, die Manufaktur fortzuführen auf Rechnung des Herzogs oder eines zu findenden Entrepreneurs, um damit Gebäude und Fabrikgerätschaften sinnvoll zu verwenden und die Erträge für die Gläubiger zu verwenden. Alle diese Vorschläge wurden von der Justizkanzlei abgelehnt, da sie offensichtlich unrealistisch waren. So hat Frau Scharff am Ende zwar Recht bekommen, aber nichts gewonnen außer dem Zugriff auf einige noch vorhandene Haushaltsgegenstände und der Berechtigung, die ihr zuzurechnenden Pfänder einzulösen. Die von ihr mitverschuldete Länge des Verfahrens hatte dazu geführt, dass dessen Kosten die geringen Erlöse aus den versteigerten Inventarien völlig aufgezehrt hatten. Lediglich die drei Lohnempfänger an der Spitze der Prioritätsliste konnten ausgezahlt werden. Scharffs Schadenersatzansprüche Scharff war fest davon überzeugt, dass nicht er sondern andere an seinem finanziellen Ruin schuld seien. Insbesondere das Handeln bzw. Nichthandeln herzoglicher Behörden hätten ihn um sichere Gewinne gebracht. Wichtigstes Monitum war die nicht bestrittene Tatsache, dass die herzogliche Geheimratsstube ihm zwar das Vorliegen und die Genehmigung des Sozietätsvertrages vom 6. November 1762 bestätigt, die Herausgabe des Vertrags-Originals jedoch bis April 1773 verzögert hat, ohne dass dafür ein Grund erkennbar war. Der Magistrat in Braunschweig hat jedoch den Original Vertrag sehen wollen, bevor er über Scharffs Klage gegen seinen Vertragspartner Cüntzel auf Vertragserfüllung entscheiden könnte. Keinen Zweifel ließ Scharff daran zu, dass er nach Vorlage des Vertrages mit seiner Klage obsiegt hätte und Cüntzel daraufhin seinen Zusagen aus dem Vertrag nachgekommen wäre. Der Ausfall von Cüntzel habe dazu geführt, dass Scharff seine gut laufende Göttin ger Manufaktur nicht ausreichend hätte beaufsichtigen können. Dadurch seien laufende Lieferungen für das Militär nicht oder nicht vertragsgemäß ausgeführt worden., vgl. StA WF, 7 Alt Nachtrag ~r und 1614.
140 Scharff'sche Tuchmanufaktur in Wolfenbüllel 143 Deshalb habe die Hannoversche Kriegskasse statt zu zahlen, Schadenersatzansprüche gestellt. Außerdem habe er lukrative Zivilaufträge nicht ausführen können, weil er seine verlegten Tuchmacher in Göttingen nicht mit Wolle habe versorgen können. Zudem habe er fest zugesagte Militäraufträge in erheblicher Höhe wegen seiner Lieferprobleme nicht erhalten. Bis hierhin erscheint seine Darstellung nachvollziehbar. Bei der Berechnung des ihm dadurch entstandenen Schadens gegenüber dem Geheimen Rat machte er jedoch geradezu abenteuerliche Rechnungen auf. So machte er Zinsverluste aus den nicht erhaltenen Teilzahlungen der Hannoverschen Kriegskasse geltend, ohne Berücksichtigung der Tatsache, dass er diese Gelder zur Bezahlung seiner Unterlieferanten sofort wieder hätte ausgeben müssen. Oder er reklamierte entgangenen Gewinn aus den nicht produzierten Zivilaufträgen und aus den nicht erhaltenen zukünftigen Militäraufträgen in Göttingen. Zinssätze ebenso wie Gewinnmargen entbehrten jeder realistischen Grundlage. In diesem Streit veranlasste Scharff lange Schriftsätze des Kurators, die mit ebenso langen Begründungen von der Justizkanzlei zurückgewiesen wurden. Von der herzoglichen Kriegskasse forderte er den Ersatz von Zinsverlusten aus versprochenen, aber nicht gezahlten Vorschüssen, verzögerter Abnahme fertiger Ware (die jedoch wegen Qualitätsmängeln beanstandet war) und deswegen nicht gezahlter Abschläge und aus Abrechnungen, die sämtlichst unvollständig waren. Gegen das herzogliche Holzmagazin klagte er wegen nicht erhaltener oder zu teuer berechneter Brennholzlieferungen. Insgesamt kam er so auf Schadenersatzforderungen gegen herzogliche Behörden von über Talem 5o Bis auf eine relativ unbedeutende Position aus dem Bereich Brennholz-Versorgung lehnte die Justizkanzlei mit Bescheid vom 29. Juni 1775 alle Forderungen Scharffs ab. Forderungen und Gegenforderungen mit ihren ausführlichen juristischen Begründungen können hier nicht detailliert dargestellt werden. Nach Ende dieses Streits konnte am 8. August 1776 endlich die Prioritätsliste vorgelegt werden. Zu dieser Zeit bestand noch die Hoffnung, aus dem Verkauf der restlichen Haushaltsgegenstände und des Fabrikinventars einige Beträge für die Konkursmasse erlösen zu können. Auf dieses Geld und auf die viel zu hoch veranschlagten Erlöse aus der Verwertung der Schlossgebäude bezogen, schien der oben dargestellte Kampf der Frau Scharff um die Positionierung ihrer Ansprüche in der Prioritätsliste sinnvoll. Als deutlich wurde, dass die Erlöse aus den genannten Verkäufen kaum die Kosten des Verfahrens deckten, haben alle nicht hypothekarisch gesicherten Gläubiger bis auf Frau Scharff den Kampf aufgegeben und sich mit dem Verlust ihrer Gelder abgefunden. Frau Scharff jedoch versuchte auch noch nach dem Tod ihres Mannes im Jahre 1781 Einfluss auf die Verwertung der Schlossgebäude zu nehmen, ohne jeden Erfolg. 50 Vgl. StA WF, 4 Alt 1 :-Ir
141 144 Victor-L. Siemers Das Eigentum an den Schloss gebäuden Die dritte Linie dieses Konkurses war der Streit zwischen der herzoglichen Kammer und dem Kurator über das Eigentum an den Schlossgebäuden. Diese waren Scharff in dem oben (S. 125) wiedergegebenen Paragraph 4 des Privilegs vom 6. November 1762 mit folgender Formulierung übergeben worden: [Die Gebäude sollen ihm lohne alles Entgeld überlassen werden, auch ihm, seinen Erben und Erbnehmern eigentümlich sein, um sie nach freier Willkür zum Behuf der Fabrik und Färberei einzurichten und zu gebrauchen; wohingegen derselbe sich, seine Erben und Erbnehmer verpflichtet, die Fabrik und Färberei jederzeit in einem beträchtlichen Stande zu erhalten. Mit Reskript vom 28. Dezember 1765 bestätigte der Herzog, dass die Scharff für sein Etablissement überlassenen Gebäude und Plätze sein uneingeschränktes Eigentum seien. Darüber hinaus genehmigte der Herzog am 19. Januar 1767 eine von Scharff ausgestellte Hypothek auf die Gebäude zu Gunsten des Ehepaars Johann Dietrich Krause, das die Bürgschaft gegenüber dem Leihhaus für eine Schuldverschreibung des Ehepaars Scharff über Taler übernommen hatte. Ebenso genehmigte der Herzog am 15. Dezember 1768 eine weitere Hypothek zu Gunsten des Verwalters Böse in Göttingen, die Scharff zur Besicherung einer dort entstandenen Schuld von Talern ausgestellt hat. Die ausdrückliche Bestätigung und die Genehmigung der Hypotheken spricht dafür, dass es zu dieser Zeit keine Zweifel an den Eigentumsrechten des Kommerzienrats gab. Am 6. Oktober 1773, also vier Wochen nachdem dieser die cessio bonorum erklärt hatte, wie man damals den Konkursantrag nannte, berichtete die Kammer, dass sie aus der Zeitung von Scharffs Zahlungseinstellung erfahren habe. Es wurde angefragt, wie wegen der Anmeldung von Forderungen verfahren werden solle, zumahlen da fürst!. Kammer nicht bekannt ist, was wegen den dem Kommerzienrat eingeräumten Schlossgebäuden mit demselben ausgemacht und unter welchen Bedingungen ihm solche eingegeben worden. Im Geheimen Rat war es offenbar schnell zu einer Meinungsbildung gekommen, denn schon am 18. Oktober erhielt die Kammer den Bescheid, dass Seharff sich durch seinen Konkurs außerstande gesetzt habe, die Fabrik jederzeit in einem beträchtlichen Stande zu erhalten, wie es das Privileg von ihm verlangte. Damit falle das ihm sub expressa conditione überlassene Eigentum an den Herzog zurück. Die Kammer habe bei der Justizkanzlei zu veranlassen, dass Seharff zur Räumung angehalten werde 51 Daraufhin machte die Kammer dem Kurator Mitteilung von dem Rückfall des Eigentums, die Gebäude seien extra concursum herauszugeben. Nach der Aktenlage darf bezweifelt werden, dass der Geheime Rat oder die Kammer sich darüber im klaren waren, dass die Gebäude mit zwei Hypotheken von zusammen über Talern belastet waren. Da diese Hypotheken ausdrücklich vom Geheimen Rat genehmigt worden waren, hätte die Kammer sie bei Rückfall des Eigentums bedienen müssen, es sei denn, die Konkursmasse hätte zur Befriedigung dieser bei den Gläubiger ausgereicht. I1 Vgl. STA WF, 4 Alt 1 Nr
142 Scharff'sche Tuchmanufaktur in Wolfenbüttel 145 Das war die Ausgangslage für einen Streit der Juristen, der sich bis in das Jahr 1788 hinzog. Erst Herzog Karl Wilhelm Ferdinand fand eine Lösung, die ihm erlaubte, sein Gesicht zu wahren und den Schaden für die herzoglichen Kassen zu minimieren. Doch davon später. Bis dahin weigerte sich der Kurator beharrlich, die Eigentumsansprüche der Kammer anzuerkennen. Zunächst argumentierte er mit der Genehmigung der beiden Hypotheken, die niemals hätte erfolgen dürfen, wenn Scharff nicht uneingeschränkter Eigentümer der belasteten Gründstücke gewesen wäre. Zusätzlich versuchte er nachzuweisen, dass sich die Fabrik durchaus in einem beträchtlichen Zustand befunden habe. Er benannte Zeugen, die Auskunft gaben über die Anzahl der in Betrieb gewesenen Webstühle. Was dabei unter einem beträchtlichen Zustand zu verstehen wäre, sollten Unterlagen erhellen über Gespräche zwischen dem Herzog und Scharff, die der Ausstellung des Privilegs vorangegangen sein müssten. Diese Unterlagen müssten sich bei der Kammer oder Geheimratsstube finden. Eine weitere Verteidigungslinie versuchte der Kurator aufzubauen, dabei sicher intensiv unterstützt von Scharff selber, indem er für den nicht zu bestreitenden Niedergang der Fabrik die Schuld nicht Scharff, sondern verschiedenen herzoglichen Behörden zuwies. Auch hier wurden wieder Schadensberechnungen vorgelegt, wie sie der Kommerzienrat aus allen möglichen Anlässen zu konstruieren verstand 52 Die Kammer, die sich zunächst mit dem nicht zu bezweifelnden Stillstand der Fabrik auf der sicheren Seite fühlte, reagierte auf die maßlosen Gegenforderungen und Schuldzuweisungen des Kurators mit Erweiterungen ihrer Vorwürfe. Der von Scharff selber nachgewiesene Verkaufsumsatz von etwa Talern in 10 Jahren sei im Vergleich mit der Manufaktur seines Göttinger Konkurrenten Graetzel nicht als beträchtlich zu bezeichnen; dieser habe in normalen Jahren Waren für jeweils Taler produziert. Daher sei Scharff nie in den Besitz der Gebäude gelangt. Er habe sich das Privileg erschlichen, da er überhaupt nicht in der Lage gewesen wäre, die versprochene Manufaktur einzurichten und zu betreiben. Er habe sich im Lande Braunschweig nur die Mittel beschaffen wollen, um seine Göttinger Anlagen zu erhalten, wie der ständige Gcldabfluss nach dort zeige. Soweit in sehr groben Zügen die Argumentation beider Seiten, nach der die Justizkanzlei als erste Instanz am 29. Juni 1775 entschied, dass Scharffwegen des Stillstandes der Fabrik seine Verpflichtungen aus dem Privileg nicht erfüllt habe, die Gebäude daher an die Kammer zurückfielen und innerhalb vier Wochen zurückzugeben seien. Die Rechte der Hypothekengläubiger wurden anerkannt, alle Gegenrechnungen des Schuldners zurückgewiesen. Einige kleinere Forderungen aus nicht erfolgten Brennholzlicferungen und unrechtmäßig erhobener Akzise sollten bei ordnungsgemäßer Nachweisung anerkannt werden. Beide Seiten legten Einspruch gegen dieses Urteil ein und verlangten Versand der Akten an eine JuristenfakuItät, um ein nächstinstanzliches Urteil zu erlangen. Wegen des oben dargestellten Streits um die Prioritätsliste erfolgte dieser Versand erst am 9. Juni Am 14. April 1781 entschied die Juristenfakultät der Universität Kiel, dass es bei der Entscheidung der Justizkanzlei vom 29. Juni 1775 zu bleiben hätte. Den Einspruch des Kurators dagegen lehnte die Ju- S2 Vgl. STA WF. 7 Alt Nachtrag Nr. 993.
143 146 Victor-L. Siemers stizkanzlei ab. Damit fielen die Gebäude endgültig an die Kammer zurück, belastet jedoch mit den beiden Hypotheken 53 Während der oben geschilderte Streit um die Positionierungen in der Prioritätsliste bis zu einem Urteil der Juristenfakultät der Universität Erfurt im Januar 1783 und einigen Nachgefechten weiterging, begann der letzte Akt im Drama dieses Konkurses. Das Leihhaus hatte mit seinem Schuldscheinanspruch vom Januar 1767 über Taler zuzüglich Zinsen die kleinere, aber ältere Hypothek; der Verwalter Böse hatte den mit Talern zuzüglich Zinsen aus der Schuldverschreibung vom Dezember 1768 höheren, aber jüngeren Anspruch. Auch hier galt wieder die Regel, dass aus dem Erlös einer Versteigerung der Schlossgebäude zuerst die ältere Forderung voll und danach die jüngere zu befriedigen sei, soweit dafür noch Mittel zur Verfügung standen. Am 1. Juli 1783 griff Herzog Karl Wilhc\m Ferdinand erstmalig in das Verfahren ein, verlangte die Beschleunigung des Versteigerungsverfahrens und beauftragte den Kammerrat Dedekind mit der Abwicklung von Seiten der Regierung. Da abzusehen war, dass der Erlös zur Befriedigung beider Gläubiger nicht ausreichen würde, verlangten die Erben des Verwalters Böse und der Anwalt Seiden für das Leihhaus, dass beider Forderungen vor Übergabe an die Kammer befriedigt würden, konnten sich damit jedoch nicht durchsetzen. Die Kammer ihrerseits fragte bei Dedekind an, ob es nicht ratsam sei, den bei den Gläubigern die Gebäude gegen ihre Hypotheken zu überlassen, so dass diese das Risiko der Versteigerung zu tragen hätten. Dedekind lehnte ab, und so nahm das Versteigerungsverfahren seinen Lauf. Der Herzog verlangte, besorgt um die Reputation des Herzogshauses, dass in den Versteigerungsanzeigen das Objekt nicht als fürstliche Schlossgebäude, sondern mit einem anderen, jedoch eindeutigen Namen bezeichnet würde. In dem Subhastations-Patent vom 3. Februar 1784 ebenso wie in den Zeitungsanzeigen in Braunschweig und Kurhannover wurden daher die Gebäude einzeln benannt; das heute noch zum Teil erhaltene eigentliche Kleine Schloss wurde darin als das sogenannte Angermannsehe Haus bezeichnet. Ein erster Versteigerungstermin am 30. August 1784 wurde verschoben auf den 28. Januar Für die Versteigerung hatte sich der Herzog bzw. seine Berater eine Strategie überlegt, mit deren Hilfe Böses Erben ausmanövriert werden sollten, so dass am Ende nur zwei herzogliche Behörden sich gegenüberstanden, die Kammer als Hypothekenschuldner und das Leihhaus als Gläubiger. Mit einem verdeckten Geldkreislauf sollte dazu ein Strohmann in der Versteigerung bis zu Taler für die Gesamtheit der Gebäude bieten; im Falle des Zuschlags würden die Böseschen Erben leer ausgehen, die Hypotheken eingelöst, bzw. wertlos und die Kammer am Ende Eigentümer des unbelasteten Gebäude werden. Den Strohmann fand man in der Person des Wolfenbütteler Bürgermeisters Bruns, von dem bekannt war, dass er seinen Grundbesitz zu erweitern trachtete. Druns erhielt gen aue Anweisung, wie er im Termin zu agieren habe, und die Zusicherung, dass er selber von allen Verbindlichkeiten aus diesem Geschäft freigestellt sei. Er sollte nur für die Gesamtheit aller Gebäude bieten und bis zu S3 Vgl. StA WF, 4 Alt 1 Nr S4 Für das gesamte Versteigerungsverfahren: vgl. StA WF, 4 Alt 1 Nr
144 Scharff'sche Tuchmanufaktur in Wolfenbüttel Talern gehen. Bei einem höheren Angebot hatte er um 14 Tage Erklärungsfrist zu bitten. Am ersten Versteigerungstermin, dem 28. Januar 1785, bot Bruns wie verabredet Taler und der Bauverwalter Strauss für das Angermannsche Haus 30 Taler. Beide Gläubiger erklärten das Angebot als kein pretium adaequatum und baten um einen neuen Termin, der auf den 31. Mai festgesetzt wurde. In diesem Termin verlangte der Vertreter der Böseschen Erben, dass die Gebäude von zwei Schätzern taxiert und auf der Basis dieser Taxe realiter geteilt werden sollten. Das wurde erwartungsgemäß abgelehnt und wieder nur das Angebot Bruns mit und vom Gastwirt Schulze eines von 35 Taler für das Angermannsche Haus vorgelegt. Der Partei Böse wurde angeboten, die Gebäude taxieren zu lassen, wenn diese sich bereit erklärten, die Gebäude zu diesem Taxpreis zu übernehmen. Darauf gab es für lange Zeit kein Echo von dieser Seite, so dass die Sache bis zum August 1787 liegen blieb. Am 4. Dezember 1787 fand ein neuerlicher Versteigerungsversuch statt. Diesmal bot der Anwalt Meibom im Auftrag des Bürgermeisters Bruns Taler, Syndikus Thomae hielt für das Leihhaus mit Talern dagegen und für das Angermannsche Haus wurden 240 Taler geboten. Nach einer Erklärungsfrist und gegen den Antrag des Leihhauses baten die Böseschen Erben nochmals um einen neuen Termin. Die Justizkanzlei stimmte einem letztmaligen Versuch zu. Inzwischen schlug die Kammer dem Herzog eine neue Strategie vor. Es hatte sich herumgesprochen, dass Bruns nicht auf seine Rechnung, sondern für die Kammer bot. Hinzu kam, dass Gerüchte besagten, es hätten sieh einige particuliers zusammengetan, um mitzubieten, einige der Gebäude abzureißen und aus dem Verkauf des Baumaterials ihr Gebot wieder hereinzubekommen. Eile tat also Not, und so wurde beschlossen, dass das Leihhaus bis zur Höhe des Angebots Bruns mithalten und Bruns sich dann mit dem Argument, seine Pläne wegen zunehmender Altersschwäche aufgegeben zu haben, zurückziehen sollte. Bruns wurde angewiesen, nicht über bis Taler zu gehen. Das Leihhaus sollte dann die Gebäude an die Kammer übertragen. Am Termin, dem 18. Juli 1788, lief das Verfahren nach Plan ab, das Leihhaus bekam den Zuschlag für Taler. Da die Justizkanzlei keinen weiteren Versteigerungsversuch gestattete, blieb den Böseschen Erben nichts anderes übrig, als dieses Ergebnis zu akzeptieren und damit ihre Forderung in den Wind zu schreiben. Herzog Karl Wilhelm Ferdinand hat damit erreicht, die Schlossgebäude auf juristisch unangreifbare Weise frei von allen Lasten zu machen und sie wieder in seinen Besitz zu bringen. Am 30. Januar 1791 wurde der Gebäudekomplex an den damaligen Wolfenbüttel er Polizeidirektor Drost Johann Georg Konrad Raeber von Rodenberg verkauft, der einen Teil der Gebäude abreißen und einen Park anlegen ließ. Über verschiedene Erb- und Verkaufsfälle kam das Gelände 1869 in den Besitz des Bankiers Gustav Seeliger, der den stehen gebliebenen Flügel des Kleinen Schlosses zu seinem Wohnhaus umbaute Vgl. Gerd BIEGEL, Bankhaus C. L. Seeliger. Wolfenbütlel 1994, S
145 148 Victor-L. Siemers Die Scharff'sche Tuchmanufaktur als Objekt obrigkeitlicher Wirtschaftsförderung Der Versuch, in Wolfenbüttel eine leistungsfähige Tuchmanufaktur errichten zu lassen, hat Herzog Karl I. insgesamt etwa Taler an Barmitteln in Form von Startkapital, Zuschüssen und nicht gesicherten Darlehen gekostet, einschließlich des Aufwandes zur Wiedererlangung des Eigentums am Kleinen Schloss. Beamte, Handwerker, Kaufleute, Freunde und Verwandte Scharffs im Herzogtum und in Göuingen haben darüber hinaus nach Ausweis der Konkurstabelle (Prioritätsliste) etwa Taler verloren. Dafür hat Scharff für etwa acht Jahre Uniformtücher in seiner Manufaktur und durch verlegte Meister hergestellt und in einigen dieser Jahre auch die fertigen Uniformen schneidern und ausstatten lassen. Daneben hat er, wie die oben (S. 131) gezeigte Aufstellung nachweist, für den zivilen Markt, auch außerhalb des Herzogtums, Tuche verschiedenster Qualität geliefert. Ein direkter Ertrag für den Herzog ist daraus nicht generiert worden, auch deswegen, weil Scharff für seine Geschäfte Freiheit von allen Abgaben zugesagt worden war. Er hat aber zumindest zeitweilig einiges Geld aus dem Ausland ins Land gezogen und eine Reihe von Handwerkern und Arbeitern in Lohn und Brot gehalten und so einen Beitrag zum wirtschaftlichen Wohlergehen des Landes geleistet. Der Unternehmer Johann Heinrich Scharff Zu den Verlierern der Wolfenbütteler Unternehmung zählt Scharff selber und besonders seine Familie. In Göttingen waren sie offensichtlich angesehene Leute; ob es Probleme mit Scharffs dortigen Geschäften waren, die ihn zum Umzug nach Wolfenbüttel veranlassten, ist nicht sicher festzustellen. Für diese Annahme spricht, dass er während seiner Wolfenbütteler Jahre ständig Geld nach Göttingen schicken musste. Sein Start in Wolfenbütte1 war wohlvorbereitet; nach seinem Konzept hätte er sich hauptsächlich um das kümmern müssen, was er gut verstand: Das Färben und die Ausrüstung der unter seiner Regie erzeugten Tücher und die Vertragsverhandlungen mit den herzoglichen Behörden als wichtigste Auftraggeber sowie den Wolleinkauf im In- und Ausland. Für die Beschaffung des notwendigen Betriebskapitals und den Debit, den Verkauf an den zivilem Markt hatte er Partner gefunden, die ihn von den Gelddingen freihalten sollten. Ob seine Preise kostendeckend waren, lässt sich aus den Akten nicht feststellen. Als bei seinem Start in Wolfenbüttel seine Finanziers und der Kaufmann Cüntzel ausfielen, zeigte sich eine weitere Stärke des nunmehrigen Kommerzienrats, das Eröffnen von Geldquellen. Ob von Herzog, Erbprinz, Schrader von Schliestedt, der Familie seiner ersten Frau, ob von Geschäftspartnern oder dem Leihhaus, von überall her wusste er sich Geld zu beschaffen. Er muss daher einen sehr vertrauenswürdigen Eindruck gemacht haben. Dabei ist nicht auszuschließen, dass er seinen Versprechungen hinsichtlich der Rückzahlung dieser Gelder selber geglaubt hat; einzuhalten wa-
146 Scharff'sche Tuchmanufaktur in Wolfenbüttel 149 ren sie nicht. Daher konnte er seine Manufaktur nur halb so groß aufziehen, als er geplant hatte, und der daraus zu ziehende Gewinn reichte sicher nicht aus, seinen aufwendigen Haushalt zu finanzieren, geschweige denn, Zinsen oder Tilgungen zu bezahlen. Am Ende hat Scharff in den 12 Wolfenbütteler Jahren (und gleichzeitig in Göttingen) die im vorigen Kapitel genannten Taler und das eingebrachte Vermögen seiner Frau verwirtschaftet, das im Konkursverfahren mit etwa Talern angegeben war. Geblieben ist der Familie lediglich das wenige Haushaltsgerät, das bei Konkurseröffnung noch vorhanden, bzw. bei Pfandleihern noch nicht verfallen war. Seinen 1755 und 1763 geborenen Söhnen konnte Scharff ein Jurastudium ermöglichen und seiner 1758 geborenen Tochter einen Kanonissinnenplatz im Kreuzkloster zu Braunschweig sichern. Scharffs Söhne hatten offensichtlich kein Interesse an der Verwertung der Farbrezepturen ihres Vaters, die dieser akribisch festgehalten hatte. Sie ließen die Texte 1788 im Druck erscheinen 56 In der im Privatbesitz befindlichen Scharff'schen Familienchronik charakterisierte sein jüngerer Sohn den Vater wie folgt: [... ] Allein wie es dem Genie geht, war er zu sehr von Projekten eingenommen, die in Verbindung natürlicher Freigiebigkeit, für ein ansehnliches Vermögen papierne Forderungen zurückließen. 56 Johann Heinrich SCHARFF, Recepte üher verschiedene Gattungen von Farben. Göttingen 1788.
147
148 Kirchen im Bombenkrieg Folgen des Luftkriegs von auf dem Gebiet der Braunschweigischen Landeskirche von Birgit Hoffmann Vor 60 Jahren überzogen die gegnerischen Mächte im 2. Weltkrieg einander mit auf beiden Seiten verheerenden Luftangriffen. Auf vielfältige Weise wird derzeit der Folgen des vom nationalsozialistischen Deutschland ausgehenden Krieges gedacht, der allen Seiten ungeheure Opfer abverlangte. In der Stadt Braunschweig gruppieren sich die Gedenkveranstaltungen traditionsgemäß um den Oktober, an dem im Jahr 1944 ein Feuersturm, ausgelöst durch die Bomben von 240 britischen Kampfflugzeugen, zu einer nahezu vollständigen Zerstörung der Innenstadt führte. Auch in anderen zum früheren Land Braunschweig gehörigen Städten und Dörfern konzentriert sich das Gedenken auf die Daten besonders schwerer lokaler Angriffe. Der Landkreis Wolfenbüttel erlebte beispielsweise im Angriff britischer Bomber vom 14. Januar 1944 die ausgedehntesten und schwersten Zerstörungen. Fast zeitgleich zu den Gedenkveranstaltungen finden gegenwärtig vielerorts, insbesondere im kirchlichen Bereich, Jubiläumsfeierlichkeiten für die vor 50 Jahren wieder aufgebauten oder neu eingeweihten Gebäude statt. So wurde beispielsweise die am total zerstörte Kirche in Heerte im Oktober 1954 wieder eingeweiht. Heute, 50 Jahre später, vereint sich das Gedenken an den Schock der Zerstörung von 1945 mit der Würdigung der Wiederaufbauleistung 1 Ähnliche Feiern in anderen Kirchengemeinden haben bereits statt gefunden und werden in den kommenden Jahren folgen - Anlass genug für einige zusammenfassende Betrachtungen über die Rolle und Situation dcr Kirche im 2. Weltkrieg, die Folgen des Luftkriegs für die Braunschweigische Landeskirche sowie den kirchlichen Wiederaufbau in der Nachkriegszeit. I. Mit dem Ausbruch des 2. Weltkriegs durch den deutschen Angriff auf Polen am 1. September 1939 schien das Verhältnis zwischen nationalsozialistischem Staat und offiziellen Kirchen zunächst in Richtung eines kirchlichen Burgfriedens zu tendieren. Der von Adalf Hitler zu Kriegsbeginn ausgegebenen Parole, jegliche kirchenfeindlichen Aktionen während des Krieges zu unterlassen, entsprachen auf Seiten der offi- 1 Vgl. Artikel "Mit Leben erfüllt" in: Salzgitter Zeitung vom
149 152 Birgit Hoffmann ziellen Kirchenleitungen Gefolgschaftszusagen und Appelle, die innerkirchlichen Auseinandersetzungen während des Krieges zu beenden 2 Wie Günter Brakelmann für die evangelische Kirche zusammenfasste, war die glaubens- und gewissensgegründete Pflicht zum vaterländischen Dienst trotz eincr unterschiedlich weitgehenden Identifizierung mit dem NS-Staat und seiner Politik Grundkonsens der Deutschen Christen wie auch der Glieder der Bekennenden Kirche 3 In Predigten, Schriften und Rüstveranstaltungen trugen daher Geistliche vor und nach Kriegsbeginn zur Stärkung des deutschen Wehrwillens bei 4 Wie der braunschweigische Landesbischof Helmut Johnsen erhielten zahlreiche Pfarrer ab 1937 ihre Bereitstellungsbefehlc; zu Anfang des Krieges wurden aus der braunschweigischen Landeskirche 45 Pfarrer, 6 Vikare und 20 Kirchenbeamte und Angestellte eingezogen. Insgesamt traten bis zum Kriegsende 115 Pfarrer aus unterschiedlichen Motiven in den Kriegsdiensts. Immer mehr Ehrenamtliche, insbesondere aber Pfarrfrauen, Gemeindehelferinnen und Mitglieder der Frauenhilfe übernahmen die Aufgaben in den Kirchengemeinden. Die zu Beginn des Krieges gehegte Hoffnung auf eine Rücknahme der Einschränkungen, mit denen der nationalsozialistische Staat die Kirchen nach und nach belegt hatte, sollte sich jedoch ebenso wenig erfüllen wie diejenige auf ein schnelles und erfolgreiches Ende des Krieges. Ungeachtet der vordergründigen Burgfriedenspolitik zielten nationalsozialistische Führungskreise auf eine möglichst weitgehende Entkirchlichung der Bevölkerung und Einschränkung der kirchlichen Rechte. Ein Instrument dieser Politik waren die seit der zweiten Hälfte der 30er Jahre bei den Landeskirchenämtern eingesetzten staatlichen Finanzabteilungen 6 Beabsichtigte man einerseits, die Kirchen für das Gelingen der Kriegsziele einzuspannen, misstraute man andererseits kirchlichen Solidaritätsbekundungen und der seelsorgerlichen Begleitung der Frontsoldaten zutiefst. So entsprach die tatsächliche Religionspolitik des Staates keineswegs den ausgegebenen Burgfriedensparolen, woraufhin sich bei Kirchenleitungen und Teilen der Pfarrerschaft bereits nach einigen Kriegsmonaten eine tiefe Beunruhigung über ihre Zukunft nach Beendigung des Krieges auszubreiten begann. Daraus resultierende Loyalitätskonflikte fanden weitere Nahrung in den Nachrichten über Judenverfolgung, 2 Vgl. Kurt MEIER, Kreuz und Hakenkreuz. Die evangelische Kirche im Dritten Reich, überarb. Neuausg. München 2001, S Vgl. Günter BRAKELMANN (Hrsg.), Kirche im Krieg. Der deutsche Protestantismus am Beginn des 2. Weltkrieges. In: Studienbücher zur Kirchlichen Zeitgeschichte. Bd. 1/2, München 1979, S Vgl. Dietrich KUESSNER, Geschichte der Braunschweigischen Landeskirche im Überblick. Offieben 1981, S. 105 f. (= Jb. der Gesellschaft für Nds. Kirchengeschichte Bd. 79, 1981, S ). Vgl. ebd., S. 107 f, sowie Dietrich KUESSNER, Kirche und Nationalsozialismus in Braunschweig. Braunschweig 1980, S. 24. Listen der zum Heeresdienst berufenen Pfarrer siehe in: Landeskirchliches Archiv Wolfenbüttel (LAW), LKA In der Braunschweigischen Landeskirche wurde die Finanzabteilung am 26. Februar 1936 eingerichtet; mit dem seit 30. Mai 1938 vorgesetzten Oberregierungsrat Hoffmeister aus dem Braunschweigisehen Staatsministerium entwickelte sie sich zu einer Art Staatskommissariat über die Landeskirche (vgl. KUEssNER, Geschichte (wie Anm. 4), S. 88 f. Nach dem Geschäftsverteilungsplan vom wurde das Rest-Landeskirchenamt zu einer "Pfarrabteilung" für die rein innerkirchlichen Angelegenheiten reduziert, alle übrigen Geschäfte übernahm die Finanzabteilung, vgl. u. a. LAW, FinAbt 11.
150 Kirchen im Bombenkrieg 153 J'I::~~d.io\lhI.t9' '' 9'l fij LiebT, $1.& r~''' ''' b~" t1 ~ I\ Soh" 9~Q"'dc~ Il!\q,!.l.\t~",J~ " glqu.b4"', l\ic~l-1..,dl)j"ell "",.. Ii/l", r~l1df'f'"d.qp"'91i"i..oii~!!~!l.~~ '~lin,. J","~!e. W ::~~:,:~' ~7~~;;~~r~.t ~. J... ~n Abb. 1: handschriftliche Bibellese für Frontsoldaten, gefertigt von Frau Gisela Bonar!, Braunschweig, März 1942, aus LA W, NL ]ürgens Euthanasieaktionen und Gewaltakten gegenüber der Geistlichkeit in den östlichen Annexionsgebieten. Verschärfend wirkten sich auch die zunehmende Dauer des Krieges, die Gefallenenmeldungen und nicht zuletzt der Bombenkrieg und seine zerstörerischen Auswirkungen aus. Aber auch die nationalsozialistischen Strategien zur Marginalisierung der Kirchen in der Gesellschaft waren letztlich erfolglos. Die wachsenden Kriegsnöte und allgegenwärtigen Schicksalsschläge führten statt zu einer fortschreitenden Entkirchlichung der Bevölkerung vielmehr zu einer volkskirchlichen Stabilisierung, da sich die Trostfunktion der christlichen Verkündigung und Seelsorge gegenüber den nationalsozialistischen Zeremonien als überlegen erwies und Auftrag und Wesen der Kirche gerade unter den erschwerten Bedingungen der Kriegszeit besonders hervortraten 7. In diesem Sinne notierte Pfarrer Ferdinand Böhnig nach dem ersten Luftangriff auf die Stadt Braunschweig am 27. September 1943 in der Volkmaroder Kirchenchronik die folgenden Gedanken und Hoffnungen: " Welch eine Verirrung und Verblendung, wenn die Partei schon jahrelang glaubt, in ihren Veranstaltungen einen Ersatz für die auf göttlichen Befehl beruhenden und in göttlicher Verheißung Ewigkeitswerte spendenden Taufe, Konfirmation und Trauung gefunden zu haben. Dies heißt soviel, wie Stein statt Brot zu reichen. Andererseits ist das aber ein Beweis dafür, dass der Führungsanspruch (der NSDAPj auf die Verdiesseitigung des Lebensgefühls abzielt, zur Vergötterung menschlicher Werte und Fähigkeiten in Rasse und Leistung treibt oder im Materialismus endet. Möchten nun die Gemeindeglieder des Kirchspiels Volkmarode besser die Zeichen der Zeit verstehen, damit nicht das drohende Gericht noch wahr werde, das der Heiland einst über Jerusalem vor jenem Untergang sprach:» Wie oft habe ich euch versammeln wollen wie eine Henne ihre Küken. «Aber nun ist es vor ihren Augen verborgen. Dies» Zu spät«und» Ihr habt nicht gewollt! «kann keine Ewigkeit wieder gutmachen. Möchte sich zur Zeit und Unzeit eine immer größere Zahl von Gläubigen in den beiden Kirchen Volkmarode und Weddel sammeln. Erst die Ewigkeit wird offenbaren, dass Gott die tiefste Not und Leidenszeit des deutschen Volkes heraufgeführt, vornehmlich durch Verführung und Verblendung. Dadurch hat es sich um Gottes Segen gebracht. '<8 7 Vgl. zu dem Absatz allg. M EIER, Kreuz und Hakenkreuz (wie Anm. 2) S Pfarrer Ferdinand BÖHNIG, Aus der Chronik der Kirchengemeinde Volkmarode, zit. nach Braunschweig im Bombenkrieg. Teil Il. Dokumente von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zur Ausstellung "Bomben auf Braunschweig" im Landesmuseum, Braunschweig 1994, S. 99 f.
151 154 Birgit Hoffmann 11. Die Möglichkeit eines Luftkrieges im eigenen Land war von deutscher Seite offenkundig lange vor Beginn des Krieges einkalkuliert worden, was auch der Pfarrerschaft nicht verborgen geblieben sein konnte. Wie viele andere Einrichtungen hatte auch die Landeskirche schon ab 1933 immer wieder Aufforderungen erhalten, sich an Luftschutz- und Verdunklungsübungen zu beteiligen. Bereits 1934 wurden im Landeskirchenamt zwei Luftschutzwarte gewählt 9 Am 24. August 1942, nachdem reichsweit bereits zahlreiche Kirchengebäude erhebliche Schäden erlitten hatten, empfahl der Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten den Kirchenleitungen der Deutschen Evangelischen Kirche die Entnahme des Kirchengestühls als vorbeugende Brandschutzmaßnahme. Diese solle sich jedoch auf die luftgefährdetsten Gebiete und Großstädte und darin auf Kirchen mit besonders hervorragendem Denkmalswert beschränken 10. Anweisungen zum Schutz kirchlicher Kunstwerke hatte die Deutsche Evangelische Kirchenkanzlei in Berlin bereits am 27. September 1939 sowie am 11. Oktober 1940 mit dem Hinweis erlassen, dass ausgelagerte Kunstwerke in diesem Zuge nicht etwa verkauft oder auf andere Weise den Kirchen, aus denen sie stammten, entfremdet werden dürftenli. Am 13. Juni 1942 erinnerte die Finanzabteilung die Kirchenvorstände der Landeskirche nochmals an die Sicherstellung wertvoller kirchlicher Kunstgegenstände und spezifizierte, welche in bombensichere Räume, Luftschutzräume, feuersichere Schränke zu verbringen oder durch Holzverschalungen gegen Splitterwirkungen zu schützen seien. Nur 20 Kirchengemeinden berichteten hierauf von der Unterbringung ihrer Kunstgegenstände oder Vasa Sacra in (feuerfesten) Stahlschränken; einige wenige hatten andere Maßnahmen zur Unterbringung getroffen, beispielsweise in den Pfarrhäusern oder Kellern von Privathäusern. Die Kirchen in Königslutter deponierten ihre Kunstgegenstände in der dortigen Filiale der Braunschweigischen Staatsbank; in Ildehausen bewahrte der Lehrer den Kelch und das Taufbecken auf und war verpflichtet, sie bei Fliegeralarm in den Keller mitzunehmen 12 Nach Wolfgang A. lünke erfolgten in der Stadt Braunschweig we- 9 Vgl. KUESSNER, Geschichte (wie Anm. 4) S Nach Ausbruch des Krieges wurden die zuvor eingeübten Schutzmaßnahmen zur Pflicht. Wie sehr sie die bedrohliche Realität des Krieges nun auch in den kirchlichen Alltag hineinbrachten, zeigt besonders deutlich eine Vorschrift der Finanzahteilung vom über die Gestaltung der Verdunklungsmaßnahmen bei Gottesdienstveranstaltungen am Heiligen Abend, in: LAW, FinAbt 103. Immer wieder wurden auch die kirchlichen Mitarbeiter zur genauen Beachtung der VenJunklungsvorschriftt:n angehaltt:n, vgl. LAW, FinAbt LAW, LKA Beide Runderlasse der Kirchenkanzlei der Deutschen Evangelischen Kirche in: LAW, S 669. Zeitgleich wurde den kirchenleitenden Behörden aufgegeben, Kunstwerke und geschichtlich bedeutsame Gegenstände, die vom Jahr 1600 an in die Hände der Kriegsgegner gelangt oder von diesen zerstört worden seien, aufzuführen. Für die Braunschweigische Lamlt:skirche vt:rneinte der Leitt:r dt:r Finanzabteilung beim Landeskirchenamt, Hoffmeister, derartige Vorkommnisse, vgl. Runderlass Deutsche Evangelische Kirche - Kirchenkanzlei vom , in: ebd 12 Rundverfügung Finanzabteilung und Auswertung der eingehenden Berichte aus den Kirchengemeinden, in: ebd. Zu den einzelnen Berichten siehe LAW, S Entsprechende Sicherungsmaßnahmen wurde am auch zur Bewahrung der wertvollen kirchlichen Archivalien angeordnet (LAW, S 669 sowie FinAbt 115). Weitere Einzelheiten zur Erfa~sung der kirchlichen Kunstgegenstände im
152 Kirchen im Bombenkrieg 155 sentliche Sicherungsmaßnahmen für die kirchlichen Kunstwerke erst ab Als Schutzräume dienten der Südturm von St. Martini sowie die Taufkapelle und der Kreuzgang der Brüdernkirche, auch an weiteren Stellen innerhalb und außerhalb der Stadt wurden kirchliche Kunstwerke eingelagert 13 Recht spät bemühte man sich offenbar auch in der Wolfenbütteler Hauptkirche B.M.V. um die Sicherung der Kunstgegenstände, deren Möglichkeiten im Sommer 1942 noch geprüft wurden. Aus der bereits 1940 von einem Luftangriff betroffenen Kirchengemeinde Bortfeld konnte in diesem Zusammenhang nur gemeldet werden, dass bereits ein alter in Holzschnitzerei gefertigter Taufstein durch fliegerbomben beschädigt worden, zur Zeit aber sicher gesteilt sei 14. Viele weitere Gemeinden verneinten den Besitz von wertvollen kirchlichen Kunstgegenständen oder versuchten, den Wert der vorhandenen herunter zu spielen, möglicherweise, um die Kosten für die Schutzmaßnahmen zu sparen oder weil sie nicht befürchteten, angegriffen zu werden. So schrieb der Blankenburger Bürgermeister und Finanzbevollmächtigte beim dortigen Stadtkirchenverband, dass ein aus Rübeländer Marmor hergestellter Altar von 1743 "im Schadenfalle jederzeit ersetzlich" seils. Rückblickend erwiesen sich allerdings auch in vielen anderen Kirchen die teilweise mangels Alternativen, in großer Eile und mit nur knapp vorhandenem Material getroffenen Vorkehrungen für Gebäude und Kunstgegenstände als unzureichend. Die verheerenden Folgen der Luftangriffe konnten sie reichsweit wie auf dem engeren Gebiet der braunschweigischen Landeskirche allenfalls mindern. Um die Besucher von Gottesdiensten während Luftangriffen zu schützen, waren ebenfalls Vorkehrungen zu treffen. Hinsichtlich der Ahlumer Kirche versicherte Propst Strothmann der Finanzabteilung am : "Die Haupttür ist so groß, dass jederzeit alle Kirchenbesucher bei Fliegeralarm und Feuersgefahr die Kirche mit gtößter Beschleunigung verlassen können. Außerdem ist in dem benachbarten Pfarrhaus ein recht großer Luftschutzkeller mit so starkem Gewölbe, dass er durch Bomben nicht gefährdet werden kann "16. Propst Otto Gremmelt notierte 1943 in der Kirchenchronik von Ölper: "Den Vorschriften entsprechend ist im Keller des Sonnenbergsehen Wohnhauses (Kirchbergstr. 9) ein Raum als Luftschutzkeller für die Gottesdienstbesucher aus kirchlichen Mitteln hergerichtet. Der Keller in der Pfarrscheune ist für den unmittelbaren Selbstschutz der Kirche eingerichtet. Die erforderlichen Luftschutzgeräte sind angeschafft"17. Am wies der Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten in einem Runderlass nochmals auf geltende Vorschriften über die Öffnung der Kirchen und das Läuten der Glocken nach öffentlicher Luftwar- Zusammenhang ihrer Sicherstellung sowie ihrer Prüfung auf kriegsrelevante Metallgehalte siehe in LAW, FinAbt Vgl. Wolfgang A. JÜNKE. Zerstörte Kunst aus Braunsehweigs Gotteshäusern. Innenstadtkirchen und Kapellen vor und nach Groß Oesingen 1994, S Siehe LAW, S 669 und zu dem Bericht des Bortfelder Pfarrers Denecke vom LAW, S S Schreiben des Blankenburger Bürgermeisters vom , in: LAW, S Bericht Pfarrer Strothmann vom , in: LAW, Ortsakten Ahlum Propst Otto Gremmclt, Kirchenchronik von Ölper, zit. nach Braunschweig im Bombenkrieg. Teil 11 (wie Anm. 8) S. 100.
153 156 Birgit Hoffmann nung hin. Bei Vorliegen einer solchen seien Versammlungen und Veranstaltungen zu unterbrechen und die Teilnehmer darauf hinzuweisen, damit sie sich" luftschutzmäßig " verhalten könnten. Danach seien die Veranstaltungen unter Inkaufnahme von Verlusten durch Zufallstreffer aber fortzuführen 18. Bereits im Herbst 1940 lernte die braunschweigische Landeskirche erstmals die Schrecken des Luftkrieges kennen. Am 24. Oktober 1940 wurde die Bortfelder Kirche durch eine englische Fliegerbombe so schwer getroffen, dass sie für den Gottesdienst unbrauchbar wurde. Dieser musste in der unmittelbaren Folgezeit in dem nahe gelegenen Saal einer Wirtschaft, später im Pfarrhaus im Konfirmandenzimmer und im extra dafür ausgeräumten Schlafzimmer des Pfarrehepaars stattfinden 19. Ein Schlaglicht auf die zu jener Zeit herrschenden Machtverhältnisse in der Leitung der Landeskirche wirft in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass am Tag nach der Bombardierung dem stellvertretenden Landesbischof und Oberlandes kirchenrat Röpke weder die eigenständige Fahrt im Dienstwagen der Landeskirche noch die Begleitung des Beamten der Finanzabteilung zum Ort des Geschehens gestattet wurde 2o Die Inneneinrichtung der Kirche wurde größtenteils zerstört, die Bergung der weniger beschädigten Gegenstände durch die Trümmermenge erschwert. Mehrfache Anträge des Bortfelder Pfarrers Denecke auf Einleitung der notwendigen Aufräum arbeiten blieben ungeachtet seiner Hinweise auf die Unzufriedenheit der Gemeinde über die Verzögerungen erfolglos, so dass die Einwohner im Januar 1942, nachdem durch das Arbeitsamt die Reparatur des zerstörten Kirchendaches veranlasst worden war, bei einer sich anschließenden Aufräumaktion letztlich selbst Hand anlegten. "Es war nicht möglich, alle Willigen zu beschäftigen", berichtete Pfarrer Denecke der Finanzabteilung mit unverhohlener Befriedigung. Bei einem Angriff in der Nacht zum 10. November 1942 wurde als nächstes Gebäude der braunschweigischen Landeskirche die Kapelle in Nordassel durch Brandbomben total zerstört. Dieses zu verhindern, sei nach Aussage des zuständigen Pfarrers Runge allein deswegen nicht möglich gewesen, weil der aus dem Jahr 1611 stammende Fachwerkbau sofort lichterloh gebrannt habe und die Anwohner ausreichend damit beschäftigt gewesen seien, den Übergriff des Brandes auf ihre benachbarten 18 Siehe Runderlass des Reichsministers für kirchliche Angclegenheiten vom in: LAW, FinAbt 145. Mutete man dem durchführenden Personal, beispielsweise den Pfarrern, damit eine erhöhte Gefahr zu, schonte man aber auch die kirchlichcn Beamtcn ebensowenig wie die übrigen öffentlichen Beamten. So wurden auch die Gefolgsschaftsmitglieder in der Finanzabteilung einem Runderlass des Rcichsministcriums dcs Innern vom entsprechend dazu angchaltcn, bei erlittenen Luftkriegsschäden die Regelung ihrer persönlichen Angelegenheiten zugunsten der Fortführung ihrer Arbeit hintanzustellen, in: LAW, FinAbt Siehe Bericht der Beamten der Finanzabteilung vom , in: LAW, Ortsakten Bortfeld 27. Vgl. auch Rudolf PA~S, Chronik von Bortfeld, Bortfeld 1983, S. 75. Paes vermutet in Übereinstimmung mit der mündlichen Überlieferung in der Gemeinde mangelhafte Verdunklung als Grund für diesen Einzc1angriff britischcr Bombcr. (vgl. Mittcilung dcs gcgenwärtigen Bortfelder Ortshcimatpflegers Bodo Fricke vom ). 20 Siehe Vermerk Röpkes vom 24. Oktober 1940, in: LAW, LBF Weitere Interventionen Röpkes bci der Deutschen Evangelischen Kirchenkanzlei und beim Landratsamt Wolfenbüttel blieben in diesem Fall ebenso erfolglos wie bei anderen Anlässen. Verwiesen wurde in der Rcgel auf die kriegsbedingte Benzinknappheit und bestehende Autobusverbindungen.
154 Kirchen im Bombenkrieg 157 Abb. 2 u. 3: Kirche in Bortfeld, Außenansicht und Innenraum, [Anfang 1942} Fotos: Privatbesitz Bodo Fricke, Bortfeld Häuser zu verhindern. Seinen Bericht an das Landeskirchenamt schloss der NordasseIer Geistliche mit der Bitte: "Sehr erwünscht wäre mir der recht baldige Ersatz der Agende, des Perikopenbuches, des Quartgesangbuches. Für die Bibel habe ich Ersatz. " Zu den Verlusten aus dem Innenraum der Kapelle zählten nämlich neben den Holzernporen und Priechen, der Kanzel und dem Hochaltar, der Uhr, der Glocke und dem Harmonium, der noch sehr neuen elektrischen Licht- und Heizungsanlage und den Messingleuchtern alle noch in der Sakristei befindlichen Bücher 21. Anlässlich dieser beiden ersten kirchlichen Schadensfälle zeigte sich recht bald, wie gering angesichts des allgemeinen Ausmaßes der Kriegsschäden die Chance der Landeskirche war, schnellen Ersatz für ihre zerstörten Gebäude zu erhalten. Deren volkswirtschaftliche Bedeutung wurde nach Maßgabe der Kriegssachschädenverordnung vom zu gering eingeschätzt, als dass Arbeit und Kapital zur Beseitigung von Schäden, "die ohne Gefahr für den Geschädigten und die Gemeinschaft auch nach Beendigung des Krieges behoben werden könn[tjen ", eingesetzt werden durften. So hielt ein Beamter der Finanzabteilung in einem Vermerk über die Besichtigung der zerstörten Nordasseier Kapelle am fest: "Nach übereinstimmender Ansicht des Arbeitsamtes Braunschweig, des Br(aunJschw[eiJg(ischenJ Ministers für Volksbildung, des Vertreters des Reichsinteresses und der Feststellungsbehörde besteht an der alsbaldigen Wiederherstellung des beschädigten Kirchengebäudes in Bortfeld kein so erhebliches volkswirtschaftliches Interesse, dass mit Rücksicht auf die z. Zt. äusserst angespannte Arbeitseinsatzlage und die Materialverknappung die Durchführung der Instandsetzungsarbeiten im augenblicklichen Zeitpunkt vertreten werden könnte. Was für Bortfeld gilt, kommt auch für Nordassel in Frage, sodass mit der Erstellung eines neuen Kapellengebäudes in Nordassel während des Krieges in keinem Fall gerechnet 21 Siehe Bericht des Pfarrers Runge (Abschrift vom ), in: LAW, Ortsakten Nordassel 3. VgL zur Geschichte des Wiederaufbaus der Nordasseier Kirche Kurt HASSELBRINK, Geschichte des Dorfes Nordassel sowie der Kirche und des Schlosses Burgdorf, Nordassel 1979, S. 86 (mit Abbildung des zerstörten Innenraums der Kapelle auf S. 87).
155 158 Birgit Hoffmann werden kann '122. Während in Bortfcld immerhin Aufräum-, Sicherungs- und erste Reparaturarbeiten erfolgten, konnten die Bemühungen um den Wiederaufbau der Kapelle in Nordassel tatsächlich erst nach Kriegsende überhaupt einsetzen. Der Gottesdienst musste auf Jahre hin in der Schule gehalten werden. Die Gemeinde sammelte nach Kriegsende entsprechend der ersten Schadensschätzung eine Summe von Reichsmark für den Wiederaufbau ihres Gotteshauses. Dieser Plan scheiterte jedoch zunächst an der allgemeinen Baumaterialknappheit. Vor allem Holz für den Wiederaufbau des Fachwerkgotteshauses war nicht zu bekommen. Durch die Währungsreform von 1948 schmolz auch der große Spendenbetrag dahin; erst im Jahr 1956 konnten der Gemeinde schließlich wieder die nötigen Geldmittel zur Verfügung gestellt werden und die Bauarbeiten beginnen, die bis 1959 andauerten. Am erfolgte die Weihe der als massiver Neubau ausgeführten Kirche St. Michaelis in Nordassel 23 Ab 1943 wurden die Luftangriffe in der Region Braunschweig intensiviert und erreichten 1944/45 ihren Höhepunkt. Am stärksten betroffen waren die Städte Braunschweig mit rund 40 Angriffen und Salzgitter mit 44 Angriffen 24 Besonders gravierende Schäden an den kirchlichen Gebäuden entstanden in den Angriffswellen vom 14.1., 10.2., 23.4., und 14./ Im schwersten Bombenangriff auf Braunschweig in der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober 1944 fügte der durch das Flächenbombardement ausgelöste Feuersturm auch den besonders exponierten innerstädtischen Kirchen, wie der Martinikirche am Altstadtmarkt 25 und der bereits am 10. Februar 1944 getroffenen Katharinenkirche am Hagenmarkt, erhebliche Schäden ZU 26 Erneut davon betroffen war auch die Andreaskirche, die ebenfalls am 10. Februar und am 13. August 1944 bereits schwere Schäden davon getragen hatte und nun noch das von Jonas Weigel stammende barocke Orgelgehäuse von 1634 verlor 27 Mit geringerem Schaden kamen nur der Dom, die Michaeliskirche und das dazu gehörige Pfarrhaus sowie das Gemeindehaus von St. Jakobi davon. Vollständig zerstört wurden in der Nacht zum 15. Oktober auch die Pfarrhäuser und kirchlichen Verwaltungs- 22 Vermerk Streck vom , in: LAW, Ortsakten Nordassel3. 23 Siehe zu den Remühungen um den Wiederaufbau der Kirche nach 1945 LAW, Ortsakten Nordas.<;e13, sowie HASSELBRINK, Nordassei (wie Anm. 21) S. 86 f. 24 Vgl. Dieler LENT, Kriegsgeschehen und Verluste im zweiten Weltkrieg, in: Die Braunschweigische Landesgeschichte. Jahrtausendrückblick einer Region, hrsg. von Horst-Rüdiger JARCK und Gerhard SCHILDT, Braunschweig 2000, S , hier: S u 's Vgl. zur Martinikirche: Braunschweig im Bombenkrieg, Teil I1 (wie Anm. 8), S. 104 f (Erinnerungen des Pastorensohns Eberhard Rohde) sowie LAW, NL RÜH 2 (u. a. Auszug aus dem Chronikbuch des Pastors Gerhard Rohde). 26 Vgl. zu den Ereignissen dcr Bombenangriffe allgemein: Rudolf PRESCHER, Der rote Hahn über Braunschweig, Luftschutzmaßnahmen und Luftkriegsereignisse in der Stadt Braunschweig 1927 bis 1945, Braunschweig 1955 (; Werkstücke Bd. 18); Eckhart GROTE, Target Brunswick Luftangriffsziel Braunschweig, Dokumente der Zerstörung, Braunschweig 1994; Gerd BIEGEL (Hrsg.), Bomben auf Braunschweig. Ausstellungsbroschüre, Braunschweig 1994 (; Veröffentlichungen des Braunschweigischen Landesmuseums Nr. 77); Braunschweig im Bombenkrieg. 2 Teile. Dokumente von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zur Ausstellung "Bomben auf Braunschweig" im Landesmuseum, , Braunschweig Vgl. JÜNKE, Zerstörte Kunst (wie Anm. 13), S. 74.
156 Kirchen im Bombenkrieg 159 gebäude an der Petrikirche, Güldenstraße, Schützenstraße, Goslarsche Straße und Fallersleber Straße sowie die Kirchenvogtshäuser Weberstraße und Schützenstraße. Wertvolle nicht ausreichend geschützte Kunstobjekte, sakrale Gefäße und sonstiges Kircheninventar sowie Kirchenbücher, Archivalien und Schriftgut aus den Pfarrhäusern wurden Opfer der Bomben und Flammen. Zuvor waren bereits St. Magni, St. Georg, St. Ulrici, St. Pauli und St. Petri von Bomben getroffen worden, die drei letzten bei dem schweren Angriff vom 10. Februar Das Brüdernkloster brannte vollständig aus. Von den stadt-braunschweigischen Kirchen erfuhr die Magnikirche das größte Ausmaß an Zerstörung. Von ihr blieben nach verheerenden Treffern am nur noch das Westwerk, die Arkadenreihen und Teile der Umfassungswände stehen. Abb. 4: Brüdernkirche in Braunschweig nach der Zerstörung Foto: LA W Die alliierten Bombenangriffe trafen auch im östlichen Niedersachsen nicht nur die großen Städte und Industriezentren, sondern zugleich die benachbarten Dörfer. Insbesondere die Ortschaften des alten Landkreises Wolfenbüttel mussten starke Bombardements über sich ergehen lassen, in denen neben vielen Wirtschaftsgebäuden und Privathäusern auch 30 Kirchengebäude beschädigt wurden, davon die meisten bei dem Angriff vom 14. Januar Am stärksten zerstört wurden in diesem Kreis neben der bereits 1942 verbrannten Nordasseier Kapelle die Kirchen in Kalme, Kissenbrück, Remlingen, Weferlingen und Wendessen. 2ll Vgl. zur Schadensbilanz an den Braunschweiger Kirchen: Jahre Stadtkirchenbauamt, hrsg. vom Stadtkirchenverband Braunschweig 1996, S. 5,6, 12.
157 160 Birgit Hoffmann Schwerere Beschädigungen erlitten auch die Dorfkirchen von Ahlum, Adersheim, Groß Biewende, Bornum, Börßum, GeiteIde, Groß Denkte, Salzdahlum und Wetzleben. Geringere Zerstörungen erfuhren die Kirchen in Apelnstedt, Atzum, Bettingerode, Dettum, Ha1chter, Hedeper, Klein Denkte, Leinde, Linden, Mönche-Vahlberg, Neindorf, Seinstedt, Sottmar, Groß Stöckheim und Volzum. Zu den am schwersten betroffenen Dorfkirchen der übrigen auf dem Gebiet der braunschweigischen Landeskirche liegenden Landkreise gehörten diejenigen aus Bortfeld, Rüningen, Völkenrode, Timmerlah und Stöckheim im Kreis Braunschweig-Land, Klein Mahner im Kreis Goslar, Billerbeck bei Kreiensen im Kreis Gandersheim und Heerte im Landkreis Watenstedt-Salzgitter. 29 Abb. 5: Kirche in Wendessen. Foto: LAW Bei Kriegsende musste die Braunschweigische Landeskirche die erschreckende Bilanz ziehen, dass von ihren 395 Kirchen und Kapellen 9 restlos zerstört und 26 schwer beschädigt worden waren, darunter 18 Dorfkirchen. Dazu kamen 50 leichter beschädigte Kirchen in Stadt und Land. Von 253 Pfarrhäusern waren 2 restlos zerstört, 16 schwer und 26 leicht beschädigt worden. Fünf sonstige kirchliche Gebäude wurden vollkommen zerstört, 8 weitere schwer und 7 leicht beschädigt3o. Dazu zählten auch die Verluste und Schäden, die die Innere Mission zu verzeichnen hatte: Das Braunschweiger Altersheim Bethanien wurde restlos zerstört, 7 weitere Einrichtungen, darunter das Krankenhaus Marienstift in Braunschweig, sehr schwer, 4 weitere schwer und 2 leicht beschädigt. Nur vier ihrer insgesamt 18 Einrichtungen blieben unver- 29 Siehe Schadensaufstellungen in: LAW, LKA 181l. 30 Bericht Oberlandeskirchenrat Röpkes an die alliierte Militärregierung vom , in: LAW, LKA Vgl. auch Falko ROST, Bautätigkeit nach der Verselbständigung der Landeskirche von 1918 von 1918 bis 1947, S. 35, und Werner TAEGER, 50 Jahre Baureferat der Landeskirche. Teilbericht für die Zeit von 1948 bis 1983, Braunschweig 1998, S. 5 (= Bauen in der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig seit der Reformation, hrsg. vom Landeskirchenamt Wolfenbüttel. Teilband II, Wolfenbüttel 2004 und Teilband III, Wolfenbüttel 2000).
158 Kirchen im Bombenkrieg 161 Abb. 6: Gottesdienst Gottesdienst in der zerstörten Magnikirche. Foto: LA W sehrt 31. Für die Angabe menschlicher Opferzahlen bei der Zerstörung der kirchlichen Gebäude fehlen exakte Aufstellungen; eine Vorstellung vom Ausmaß des Leides geben aber die zahlreichen überlieferten Augenzeugenberichte. Gottesdienste und kirchlicher Unterricht mussten während und nach dem Krieg dort, wo die Kirchen zerstört worden waren, in Gemeinde- und Privathäuser, Schulen, Wirtschaften und Baracken verlegt werden 32. Die Möglichkeit der kurzfristigen Errichtung von Notkirchen war sehr begrenzt. Man teilte sich die Räume mit den katholischen Gemeinden, Schulklassen, Vereinen und sonstigen Gruppen. Manche 31 Bericht des Evangelischen Vereins für Innere Mission an das Landeskirchenamt vom , in: LAW, LKA Gelegentlich wurde bei der Ausweichung auf nichtkircheneigene Räume die Genehmigung der Geheimen Staatspolizei eingeholt, so beispielsweise im Fall der am 14. Januar 1945 völlig zerstörten Kirche in Heerte. Der Gottesdienst sollte in einer Gastwirtschaft abgehalten werden, vgl. LAW, Ortsakten Heerte 22. Über die Notwendigkeit der Einschaltung der Geheimen Staatspolizei bestand jedoch zwischen der Finanzabteilung und Oberlandeskirchenrat Röpke keine Einigung, vgl. Schriftwechsel im April 1944, in: LAW, FinAbt 11.
159 162 Birgit Hoffmann Gottesdienste fanden auch weiter in den behelfsmäßig gesicherten Kirchen 33 oder, wie ein eindrucksvolles Foto aus der total zerstörten Braunschweiger Magnikirche zcigt34, zwischen Mauerresten unter freiem Himmel statt. III. Für den kirchlichen Wiederaufbau mussten vor allem von den Kirchengemeinden selbst enorme Summen aufgebracht werden. Genauer gesagt, geschah die Finanzierung der Bauarbeiten im Rahmen ihrer Haushaltspläne durch Zuweisung der im Haushaltsplan der Landeskirche vorgesehenen "Beihilfen für kirchliche Bauten", durch Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock sowie durch Baudarlehen, Landesmittel, Kollekten, Sammlungen und private Spenden. Die für die Braunschweiger Kirchen 1947 angegebenen Schadenssummen bewegten sich zwischen und Reichsmark pro Gebäude, wobei St. Magni mit , St. Ulrici mit , St. Martini mit , St. Katharinen mit und St. Andreas mit Reichsmark am stärksten zu Buche schlugen. Die Schadenssummen für die stark zerstörten Dorfkirchen Kissenbrück und Heerte wurden auf bzw Reichsmark geschätzt 35. Hatten sich die Baurnaßnahmen während des Krieges wegen fehlender Genehmigungen, Arbeitskräfte und Baumaterialien nur auf die nötigsten Sicherungsarbeiten beschränkt, konnte nach Kriegsende mit den ersten Arbeiten begonnen werden, da die britische Militärregierung nach und nach die erforderlichen Lizenzen erteilte. Eine strenge Kontingentierung, zeitweilig auch das gänzliche Fehlen geeigneter Baumaterialien im regulären Handel und ein Mangel an qualifizierten Bauarbeitskräften, von denen sich viele in Kriegsgefangenschaft befanden, führten dennoch zu langen Verzögerungen in der Wiederaufbauarbeit der Nachkriegszeit, so dass sich die Fertigstellung vieler Dorfkirchen bis zum Ende der 50er Jahre hinzog So wurde die Ahlumer Kirche Ende 1944 trotz ihrer Schäden sowohl von der evangelischen Gemeinde des Ortes als auch von der katholischen Gemeinde Wolfenbüttels für Gottesdicnste benutzt. Zum Vertrag mit der katholischen Gemeinde siehe LAW, Ortsakten Ahlum 10. Auch die evangelische Kirchengemeinde Hcerte teilte sich von 1946 bis 1948 eine Baracke mit der katholischen Gemeinde, musste jedoch aufgrund ihres bcfristeten Mietverhältnisses stets befürchten, wegen anderweitiger Nutzung derselben erneut zur Suche nach geeigneten Räumlichkeiten gezwungen zu werden, vgl. LAW, Ortsakten Heerte In: LAW, Bildermappe Landeskirche, acc. 19/ Vgl. Aufstellungen für den Niedersächsischen Kultusminister in LAW, LKA Die genauen Daten über Fertigstellung und (Wieder-)Einweihung der betroffenen Kirchen können den jeweiligen Kirchenbauakten in den Ortsakten dcs Landeskirchenamtes im Landeskirchlichcn Archiv sowie der reichhaltigcn Kirchenchronikliteratur entnommen werden. Für die Braunschweiger Kirchen vgl. Festschrift Stadtkirchenbauamt (wie Anm. 28). Aufstcllungen über Baumaßnahmcn in bestimmten zeitlichen Abschnitten sind in den Akten des Stadtkirchenverbandes sowie in LAW, LKA 1830, enthaltcn. Danach konntcn bis Ende 1949 die Wiederaufhauarbeiten an den kriegszerstörten Kirchen Wendessen, Watenstedt, Bortfeld, Kalme, Groß Dcnkte, Völkenrode, Querum und SI. Pauli, Braunschweig, soweit durchgeführt werden, dass diese wieder eingeweiht und in den gottesdienstlichen Gebrauch genommen werden konnten.
160 Kirchen im Bombenkrieg 163 Abb. 7: Kirche St. Andreas, Braunschweig. Holzschnitt von Bruno Skibbe, Die Wege, an Baumaterial zu gelangen, waren oftmals verschlungen oder entpuppten sich als Sackgassen. Direkte Anträge auf Holzzuteilung der auf den Wiederaufbau ihrer Kirchen drängenden Kirchengemeinden bearbeiteten die zuständigen Forstämter gar nicht erst oder verwiesen darauf, dass jene von der oberen Kirchenbehörde gestellt werden müssten. Eine gewisse Erfolgschance bot der Weg, Handwerksbetriebe für den Wiederaufbau namhaft zu machen, damit diesen das notwendige Material als Sonderration zugeteilt werden konnte 37 Auch die am durchgeführte Währungsreform hatte zunächst einen dämpfenden Effekt, da sie erst einmal zu einer Verknappung des vorhandenen Kapitals führte. Insgesamt waren jedoch die erhöhte Kaufkraft der DM und die Eindämmung des Schwarzmarkthandels notwendige Voraussetzungen für die umfangreichen Bauvorhaben der Nachkriegszeit. 37 Vgl. beispielsweise verschiedene Berichte des Pfarrers Denecke aus den Jahren 1947 und 1948 über die Versuche, den Wiederaufbau der Bortfelder Kirche zu beschleunigen, in: LAW, Ortsakten Bortfeld Druck und Foto, LAW. (Etwaige Nutzungsrechte Dritter konnten nicht ermittelt werden.)
161 164 Birgit Hoffmann Zur Behebung der schwersten Schäden und Verhütung des weiteren Verfalls der betroffenen braunschweigischen Kirchengebäude beschloss der Stadtkirchenverband Braunschweig ein Baunotprogramm zur Substanzsicherung, für das eine Summe von Reichsmark zur Verfügung gestellt wurde, von der bis zur Währungsreform immerhin gut die Hälfte verbaut werden konnte. Danach schloss ein kurzfristiger Bankkredit über DM die Lücke, die durch die Kapitalabwertung entstanden war. Die Finanzlage des Stadtkirchenamtes war wie diejenige vieler Kirchengemeinden nun jedoch schwierig geworden, zumal für die sich ausbreitenden neuen Stadtteile in den Außengebieten Braunschweigs die Planung und Errichtung von Notkirchen zunehmend dringlicher wurde 39 Die wesentliche Betreuung der Baumaßnahmen wurde weiterhin von den bereits vor dem Krieg als nebenamtliche Bausachverständige für die Landeskirche tätigen Architekten Pramann, Schadt und Leppla vorgenommen. Zur Koordinierung wurde am das Stadtkirchenbauamt Braunschweig unter der Leitung von Dr. Friedrich Bemdt eingerichtet. Die Wiederaufbauarbeit erfolgte nach der Leitlinie "Denkmalpflege und den liturgischen Forderungen des ev. Gottesdienstes baulichen Ausdruck verleihen"4o. Bemdt sollte zunächst fünfzig Stunden seiner Jahresarbeit dem Landeskirchenamt in Wolfenbüttel zur Verfügung stellen. Da sich dieses als nicht ausreichend erwies, wurde am auch im Landeskirchenamt ein hauptamtliches Baureferat eingerichtet, zu dessen Leiter ebenfalls Bemdt berufen wurde, der somit bis 1971 für die gesamte Bautätigkeit in der Landeskirche verantwortlich war. Anhand einer Dringlichkeitsliste wurden die Wiederaufbaumaßnahmen in Angriff genommen; zu den größeren Projekten zählten die Neubauten in Kissenbrück, Nordassel und der Wiederaufbau der Kirche von Salzgitter-Heerte 4 1, die bis auf den Turm zerstört worden war. Neben der Beseitigung der Kriegszerstörungen waren im Rahmen der Baupflege auch sekundäre Folgen der während der Vorkriegs- und Kriegszeit stark rationierten kirchlichen Bauunterhaltung wie Schwamm- und Wurm befall zu bekämpfen 42. Soweit der kirchliche Wiederaufbau im Überblick. Jenseits dieser reinen Fakten und Zahlen gilt es jedoch auch festzuhalten, dass in den Bauanträgen der Pfarrer und Kirchengemeinden während und nach dem Krieg fast durchgängig vom ausdrücklichen Wunsch der Gemeindemitglieder nach Reparatur, Wiederaufbau oder Ersatz der zerstörten Kirchen die Rede ist 43 Wo dieser nicht sofort bewilligt wurde, fasste 39 Vgl. Friedrich BERNDT, Vom Wiederaufbau der Braunschweiger evangelischen Stadtkirchen. Vortrag am 5. Dezember 1948 in der St. Johannis-Gemeinde in Braunschweig (Manuskript). In: Stadtkirchenbauamt Braunschweig, Akte , S Zu den sogenannten "Notkirehen" zählte in Braunschweig beispielsweise die Dankeskirche in der Schuntersiedlung. die zwischen 1952 und 1954 als erste Nachkriegskirche errichtet wurde. 40 Vgl. Stadtkirchenbauamt (wie Anm. 28) S. 13, sowie ROST, Bautätigkeit (wie Anm. 30) S. 35 f. 41 Vgl. zu diesen drei Baurnaßnahmen TAEGER, 50 Jahre Baureferat (wie Anm. 30) S. 16 f. 4' Ebd., S. 5 f. 43 Sinngemäß schrieb auch Pastor Reinhard Herdieckerhoff an lässlich der Wiedereinweihung der Rüninger Kirche St. Petri 1953:.AIs noch im letzten Kriegsjahr, während der Amtszeit des Pastors Paul Neulen, die Rüninger Kirche von Bomben getroffen wurde und ausbrannte und der Kirchhof ringsum wüst aussah, fehlte der Gemeinde die Mille. Das empfanden die Einheimischen und
162 Kirchen im Bombenkrieg 165 man, wie beispidsweise in Bortfeld, bei den Aufräumarbeiten selbst an, spendete zum Teil beachtliche Beträge und zeigte sich an der architektonischen Ausführung interessiert 44 Vielerorts erfüllten somit die Gemeindemitglieder eine Forderung, die der Braunschweiger Stadtkirchenbaurat Dr. Bemdt 1948 angesichts der durch das Ausmaß der Kriegszerstörungen bevorstehenden "grossen Periode des protestantischen Kirchenbaues" geäußert hatte, nämlich,,[... j, dass diese Aufgaben nur in gemeinsamer Arbeit zwischen Architekt und der Kirchengemeinde als Bauherrn in Angriff genommen werden" könnten, da eine Besonderheit des Kirchenbaus darin bestünde, dass der Bauherr eine Gemeinschaft von Menschen sei, eben die Kirchengemeinde, die innerlich am Kirchenbau beteiligt sein müsse 45 Auch wenn es heute makaber anmutet, trugen Kriegszerstörungen und die einende Erfahrung des Wiederaufbaus letztlich offenbar zu der bereits im Krieg einsetzenden volkskirchlichen Stabilisierungstendenz bei, die im scharfen Gegensatz zu der von nationalsozialistischen Führungskreisen beabsichtigten Entkirchlichung der Bevölkerung stand. ebenso die vielen Flüchtlinge aus dem Osten Deutschlands, die hier Aufnahme fanden. Die zerstörte Kirche war lange Jahre ein erschütterndes Zeichen, das manchen stumm, aber eindringlicher als vordem anredete. Das.Haus des Friedens' durch Menschenhaß zerstört! Vielen wurden die Augen aufgetan zu erkennen, daß der Friede verloren war, als man Gott verlassen hatte. Ein ausgebrannter und verstümmelter Kirchturm schien zu mahnen: der letzte Halt im Leben zerbricht, wenn er nicht geachtet wird.", in: Evangelisch-Lutherische Kirche SI. Petri zu Rüningen (Festschrift anlässlich der Wiedereinweihung am 18. Dezember 1953), S Vom Engagement und Interesse der Kirchengemeinde zeugt auch die Auseinandersetzung des Kissenbrücker Kirchenvorstandes mit dem Baurcferat der Landeskirche über den geeigneten Ersatz ihrer völlig zerstörten Kirche, vgl. LAW, Ortsakten Kissenbrück 36. 4S BERNDT, Wiederaufbau (wie Anm. 39) S. 15 f.
163
164 Kleinere Beiträge Wo ruhen Heinrich und Mathilde? Fragen nach den Grabstätten im Braunschweiger Dom. Plädoyer für eine DNA-Analyse von Arnold Rabbow Alle Geschichtsschreibung schildert weniger das, was "wirklich gewesen", als vielmehr das, was schon die Zeitgenossen und, auf ihnen und ihren Zeugnissen aufbauend, die Geschichtsschreiber für wahr halten - und überdies offenbart sie manchmal mehr über die Chronisten als über ihren Gegenstand. Allerdings sollte man meinen, dass es Sachverhalte gebe, die so direkt erfassbar sind, dass sie der Interpretation enthoben sind und mithin unterschiedliche Meinungen überflüssig machen. Seit mehr als 800 Jahren ruhen Heinrich der Löwe und seine zweite Gattin Mathilde im Brauschweiger Dom, was ebenso lange bekannt ist und nie ernstlich bezweifelt wurde. Dessen ungeachtet flammt seit siebzig Jahren der Streit um ihre Gräber immer wieder auf, zuweilen in persönlich gefärbten Fehden ausgetragen und vor dreißig Jahren vermeintlich entschieden. Ziel der folgenden Ausführungen ist es nicht, die schwelende Kontroverse wieder anzufachen und neue Gegenpositionen zu den bisher verteidigten einzunehmen. Sie wollen vielmehr sine ira et studio einige bisher nicht endgültig beantwortete Fragen abermals aufwerfen und im übrigen - dies das eigentliche Ziel - den Anstoß dazu geben, die Streitfrage mit neuem wissenschaftlichem Instrumentarium, wie es jetzt zur Verfügung steht, zweifelsfrei - und nunmehr wohl endgültig - zu beantworten. Die an die Funde von 1935 anschließenden Auseinandersetzungen spiegeln naturgemäß zum einen die weniger wissenschaftliche als politische Motivation der damaligen Ausgrabungen und in der Folge die Gegenreaktion bundesrepublikanischer Vergangenheitsbewältigung, für die seinerzeitige Erkenntnisse wegen des ideologischen Umfeldes grundsätzlich verdächtig und widerlegungsbedürftig waren. Doch haben Rätsel und offene Fragen um das Herrscherpaar, dessen steinernes Doppelbildnis über der Thmba scheinbar unerschütterlich im Mittelschiff des Domes ruht, die Gräberfrage nahezu von Anfang an begleitet. Eben dieses Doppelgrabmal, auf dem Herzog Heinrich zur Rechten seiner Gemahlin, mit einem Modell seines Domes und mit dem Schwert in seinen Händen, liegt, ist erst 30 bis 40 Jahre nach dem
165 168 Amold Rabbow Tod der Dargestellten errichtet worden und bildet sie daher als Idealgestalten ab. Dennoch glaubten die Menschen des Mittelalters bis in die Neuzeit natürlicherweise, dass die Grabplastik die tatsächliche Lage der eigentlichen Gräber unter ihnen wiedergebe. Die Ausgräber von 1935 gewannen hingegen durch den Grabungsbefund die Überzeugung, dass es sich umgekehrt verhalte, und gruppierten die beiden Gestalten andersherum! wurden sie wieder in ihre ursprüngliche und vermeintlich richtige Lage gebracht. Doch hat Ulrike Strauß mit zum Teil zuvor unbekannten Zeitzeugnissen klargestellt, dass die Graböffnung von 1935 keineswegs die erste war 2 Schon 1640, 1707, 1814 und 1880 kam es zu Grabungen, die teilweise auch die enthaltenen Relikte berührten, darüber hinaus vielleicht sogar zu einer illegalen Öffnung. Überdies sind beide Gräber 1946 nochmals geöffnet worden, wobei Herzog Ernst August von Braunschweig und Lüneburg zwei der 1935 entnommenen Haarproben in die Sarkophage zurücklegte 3 Was bei den früheren Graböffnungen im Einzelnen geschah, ist allenfalls teilweise zu klären. Immerhin scheinen die Gebeine in den zwei seinerzeit bekannten steinernen Sarkophagen (einer davon der 1880 aufgefundene Kindersarg) im wesentlichen unberührt geblieben zu sein. Dass sich unter der Tumba nicht zwei, sondern sogar drei Grabstätten befanden, war seit dem 12. Jahrhundert in Vergessenheit geraten und wurde erst 1935 entdeckt. Betritt man heute die Gruft, so findet man drei Sarkophage vor. Doch ist nur einer, der schlichteste mit flacher Deckplatte, einer der drei ursprünglichen und darüber hinaus der einzige, der sich im wesentlichen an seinem alten Aufstellungsort befindet. Linkerhand steht ein Sarkophag mit gewölbter Deckplatte, der die Überreste eines sehr großen Menschen birgt. Diese waren, was jahrhundertelang niemand mehr wusste, ehedem von einer ledernen Hülle umwickelt in einem Holzsarg bestattet gewesen, von dem nur noch Spuren aufgefunden wurden. Der sie umgebende Sarkophag wurde erst 1940 gefertigt. Hinter diesen beiden Sarkophagen und quer zu ihnen steht heute ein dritter, 1688 gehobener, in dem die Gebeine dreier Brunonen, der älteren Gertrud (gest. 1077), 1 Jochen v. GRUMBKOW, Die Umgestaltung des Grabmals Heinrichs des Löwen im Dom zu Braunschweig 1935 bis In: BJb. 79, 1998, S Merkwürdig ist, dass die beiden Figuren schon vorher mindestens einmal umgruppiert gewesen waren. Ein Stich im Werk von W. BODE, Geschichte der deutschen Plastik. Berlin 1887, S. 50 bildet die Doppelplastik bereits so ab, wie sie dann von 1935 bis 1950 gruppiert war. Bei der Abbildung handelt es sich nicht um ein gekontertes Bild; vielmehr hält Heinrich sein Schwert richtig in der Linkcn, das Dommodcll in der Rechten. Andcrcrscits war diese Anordnung 1814 noch nicht gegeben gewesen, denn da man damals den großen steinernen Sarkophag unter dem Bildnis Mathildes entdeckte (STRAUSS, wie Anm. 2, S. 153), muss damals die Anordnung so gewesen sein wie heutzutage. Auch 1880, als das Mittelschiff neu gepflastert wurde, fand man den Befund von 1814 bestätigt. Wann also zwischen 1880 und 1887 die Grabplastiken umgestellt wurden und wie lange, ist ein bislang ungelöstes Rätsel. Auch die Ausgräber von 1935 wurden auf die Abbildung von 1887 aufmerksam gemacht, gingen zwar der Sache nicht weiter nach, zogen aber daraus in Bezug auf Heinrich die Schlussfolgerung, dass "die Feststellung des Toten nicht ohne weiteres aus der Lage der Skulpturen erschlossen werden konnte" (HOFMEISTER, Anm. 5, Bericht, S. 12). 2 Ulrike STRAUSS, Neues zu Grabungen in der Gruft Heinrichs des Löwen im Dom zu Bmunschweig. In: Blb. 74, 1993, S J Grumbkow, wie Anm. I,S. 214.
166 Wo ruhen Heinrich und MathUde? 169 und seit 1968 auch ihrer Enkel, des 1090 erschlagenen Markgrafen Ekbert H. und seiner Schwester Gertrud der] üngeren (gest. 1117), der Erbauerin der Ägidienkirche zu Braunschweig, getrennt voneinander in Zinksärgen geborgen sind 4 Gerade dieser nicht welfische Sarkophag kann - was man nicht vermuten würde und hier schon vorausgeschickt sei - bei der Identifizierung Heinrichs entscheidende Hinweise liefern. Die Ausgrabungen von 1935, auf Initiative des damaligen braunschweigischen NS Ministerpräsidenten Klagges veranlasst, dienten nicht der historischen Wahrheitsfindung, sondern bereiteten die Umwidmung des christlichen Domes in eine pseudosakrale Weihestätte vor, in der Heinrich der Löwe als Pionier der Ostkolonisation gewürdigt werden sollte. Doch waren die Ausgräber unter der Leitung des braunschweigisehen Landesarchäologen Hermann Hofmeister auf das, was sie dann fanden, gar nicht gefasst gewesen und mussten plötzlich Antworten auf Fragen suchen, die bis dahin gar nicht als offen gegolten hatten 5 Als ersten fanden sie den noch heute vorhandenen steinernen Sarg. Darin lagen Gebeine, an denen sofort eine schwere Hüftverletzung mit erheblicher Verkürzung des linken Beines auffiel. Die Identifizierung lag scheinbar auf der Hand. Wie bekannt, war Herzog Heinrich bei einer Überquerung des vereisten Harzes im Februar 1194 mit seinem Pferd gestürzt. An der dabei erlittenen schweren Beinverletzung laborierte der Kranke bis zu seinem Tode am 6. August Dass der (oder die) nur etwa 1,65 Meter große Tote, wie auch aus den gefundenen bräunlichen Haar-Überresten zu schließen war, kein blonder germanischer Recke nach nationalsozialistischen Wunschvorstellungen war, konnte indes historische gebildete Fachleute nicht verwundern, denn Heinrich war nach einem Augenzeugenbericht des kaiserlichen Podesta von Lodi, Acerbus Morena, mittelgroß und von schwarzer bzw. dunkler ("capillis quasi nigris") Haarfarbe 6 Eigentümlich war, dass keine Spuren von Barthaar zu entdecken waren, obwohl Bildzeugnisse den Herzog als bärtig bezeugen - allerdings ist er auch auf seinem Grabmal, das ihn freilich nicht in seinem wahren Lebensalter, sondern jünger abbildet, bartlos dargestellt. Als Anthropologe wurde die seinerzeit führende Kapazität im Reich, Prof. Eugen Fischer aus Berlin, hinzugezogen, der die Gebeine als die Heinrichs identifizierte. Indes - dies sei hier vorweggenommen - sind zwar Fischers akribische Messungen in ihren Ergebnissen erhalten geblieben, nicht jedoch sein eigentlicher Bericht, den er eigentümlicherweise erst 1936 abfasste, aber auf Weisung von Klaggcs nicht vcröffentlichte und der bis heute verschollen ist. Zum Glück ist der ebenfalls 1936 in nur wenigen Exemplaren gedruckte und nicht veröffentlichte Bericht Hofmeisters einschließlich zahlreicher Dokumentarfotos erhalten geblieben. 4 Mechthild Wiswe: In der Gruft des Braunschweiger Domes, Braunschweig 1990, S Im Stadtarchiv Braunschwcig befinden sich Hofmeisters Tagebuch über die Aufdeckung der Gruft (Sign. H III 1 Nr. 43a), ein danach erstellter Bericht (Sign. HIlI 1 Nr. 43), Fotografien von der Ausgrabung (Sign. H III 1 Nr. 42 und 42a). Das Wesentliche in gedruckter Fonn zugänglich in: Hermann HOFMEISTER, Bericht über die Aufdeckung der Gruft Heinrichs des Löwen im Dom zu Braunschweig im Sommer 1935, hrsg. in Zusammenarbeit mit dem Archiv-Verlag und dc:m Ev. Dompfarramt Braunschweig. Braunschweig Acerbus MORENA, Historia Frcderici I, hrsg. v. Ferdinand GÜTERBOCK, MG SS rcr. Germ. Nova series 7 (1930), S. 169.
167 170 Arnold Rabbow Als zweiten Sarg fanden die Ausgräber - ungefähr an der Stelle, an der heute der Sarkophag mit dem gewölbten Deckel steht - den steinernen Kindersarg mit eisernen Trageringen wieder auf, der seit 1880 bekannt war und in dem sich die Gebeines eines Kindes, wohl eines jung gestorbenen Sohnes Heinrichs, befanden. Erst nach längerem Suchen fand man schließlich eine dritte Grabstätte, zwischen den beiden steinernen Sarkophagen. Hier entdeckte man die fast vergangenen Reste eines Holzsarges und darin einen Leichnam in einer Lederhülle. Dieser maß nicht weniger als 210 Zentimeter! Allerdings hatten herabgefallene Steine das zwar zu einer bröseligen Masse umgewandelte, aber als solches noch gut erkennbare Skelett auseinandergedrückt. Aber selbst wenn der oder die Tote zu Lebzeiten "nur" 1,90 oder 1,85 Meter gemessen haben sollte, handelte es sich für die damalige Zeit um einen außergewöhnlich großen Menschen. Die Ausgräber waren überdies beeindruckt von dem noch hervorragend erhaltenen goldblonden Haar. Zudem fanden sich hier die einzigen Ziergegenstände, ein mit Textilborte in Brettchenweberei (jetzt im Braunschweigischen Landesmuseum) umwickelter Holzriegel und ein zu Silberrost zerfallenes rundes Schmuckstück. Dies alles deutete auf eine Frau, mithin auf die anglonormannische Königstochter Mathilde, in deren Familie Bestattungen in Lederhüllen nicht ungewöhnlich waren. Ohnehin schien durch die zuvor geklärte Identifizierung Heinrichs die Identität Mathildes doppelt erwiesen. Übrigens verloren die Nationalsozialisten recht bald das Interesse an den Gräbern. Obwohl Hitler den Dom besuchte, wurde weiter kein Aufhebens um den Löwen gemacht. Denn dem Diktator war wohl klar geworden, dass ein Rebell gegen die zentrale ReichsgewaIt - Kaiser Friedrich I. Barbarossa, der im Dritten Reich Wertschätzung bis hin zur Namensgebung des Feldzugsplanes gegen die Sowjetunion genoss - sich nicht zur Identifikationsfigur im Führerstaat eignete 7 Heinrich Himmler, ansonsten dem Germanenturn zugetan, interessierte sich mehr für den in Quedlinburg begrabenen König Heinrich 1., für dessen Reinkarnation er sich hielt. An den 1935 erfolgten Zuweisungen der Gräber wurden zunächst auch bei der bisher letztmaligen Öffnung 1946 keine Zweifel geäußert. Dies änderte sich jedoch 1952, als kurioserweise Fischer selbst mit einer Schilderung der Grabungsergebnisse die Kontroverse lostrat, die ihn fast erledigte und bis zu seinem Tode 1967 beschäftigte. Quasi als Ersatz für seinen - aus welchen Gründen auch immer - verschollenen eigentlichen Grabungsbericht gab Fischer 1952 eine mit Fotos bebilderte Schilderung der Grabung und seiner daraus gewonnen Erkenntnisse: "Heinrichs des Löwen sterbliche Reste"8. Für ihn gab es keinen Zweifel an der Leiche in dem großen Steinsarkophag. Die Farbe der gefundenen Haare - ein mittelhelles Braunrot - erklärte der Anthropologe als ursprünglich Braun oder Dunkelbraun, gemäß den aus anderen Fun- 7 Bemd SCHNEIDMÜLLER, Die Welfen, Herrschaft und Erinnerung. Stuttgartl Berlinl Köln 2000, S Eugen FISCHER, Heinrichs des Löwen sterbliche Reste; in: Die Welt als Geschichte, XII. Jg. 1952, H. 4, S ; eine kürzere Fassung im BJb. DERs., Die anthropologische Untersuchung der Gebeine Heinrichs des Löwen; in: BJb. 34, 1953, S Fischers Messprotokoll im Nds. Staatsarchiv Wolfenbüttel (299 N 72, Dom, Maßtabelle von den Gebeinen des Herzogs/1935 (1953).
168 Wo ruhen Heinrich undmathilde? 171 den bekannten Veränderungen bei langer Lagerung im Erdreich. Die "zierliche Gestalt" des Toten erklärte Fischer als Erbe von dessen italienischen Ahnen (wobei er sich allerdings von einem modernen Fehlschluss täuschen ließ, denn diese Ahnen - das Haus Este - waren germanischen Stammes gewesen). Den in der Lederhülle aufgefunden Leichnam identifizierte Fischer wiederum als den Mathildes. Auch er hob das reichliche Haar, das bis über die Schultern ging, hervor. Es war von rotblonder Farbe und mutmaßlich zu Lebzeiten ein reineres Blond gewesen. Zu der Kindesleiche "im frühen Säuglingsalter" in dem mit Trageringen versehenen kleineren Sarkophag, deren Knochen in unterschiedlicher Erhaltung vorlagen, konnte Fischer außer den Messergebnissen naturgemäß keine näheren biographischen Angaben machen, da Heinrich der Löwe mehrere Kinder durch frühzeitigen Tod verloren hatte. Fischers Darlegung löste eine ebenso unerwartete wie massive Gegenreaktion aus. In einer mediävistischen Fachzeitschrift warf der Historiker Walther Holtzmann, unterstützt von dem Orthopäden Matthias Hackenbroch, unter der Überschrift "Die angeblichen Überreste Heinrichs dcs Löwen" Fischer eine gravierende Fehldiagnose vor 9 Kernpunkt ihrer Kritik war, dass Fischer die - durch den Chronistenbericht Gerhards von Steterburg noch zu Heinrichs Lebzeiten als unfallbedingt bestätigte - Hüftdeformation falsch gedeutet habe, dass es sich vielmehr um eine angeborene Hüftluxation handele. Denn die auch von Fischer beschriebene Atrophie von Oberschenkel und Knie könne nicht in den Heinrich nach dem Unfall verbliebenen anderthalb Jahren entstanden sein, sondern nur durch jahrzehntelange Minderbeanspruchung infolge einer angeborenen oder schon im Kindesalter erworbenen Behinderung. Demzufolge könnten die Gebeine eben gerade nicht jene Heinrichs des Löwen sein. Vorausgesetzt, dass der orthopädische Befund von Hackenbroch richtig gedeutet war, lag diese Schlussfolgerung nahe, denn zum einen wird von keinem Chronisten berichtet, dass Heinrich vor seinem Unfall gehinkt habe, und zum anderen wäre ein Leben im Sattel, wie Heinrich es führte, mit einer derartigen frühen Behinderung schlechterdings nicht möglich gewesen. Um weiche andere Persönlichkeit es sich handele, stellten die Autoren den "wohl erprobten Geschichtsforschern in Braunschweig" anheim. Begreiflicherweise fühlte Fischer sich in seiner fachlichen Ehre getroffen, zumal ihn zeitweise Selbstzweifel plagten. Da ihn die Angelegenheit von nun an ruhelos umtrieb, kam ihm, wie er in seinen "Begegnungen mit Toten" berichtet, der Gedanke, dass die zweifelsfrei vorhandene Knochenschrumpfung erst im Grabe vor sich gegangen sein könne, und zwar als eine in der Chirurgie nach erheblichen Verletzungen bekannte "Sudecksche Dystrophie"lO. Ob diese sich auch postmortal in verletzungsbedingt entkalkten Knochen entwickeln könne, war bis dato nicht untersucht worden. Also betrat Fischer notgedrungen wissenschaftliches Neuland. In einer Versuchsreihe mit Tier- und Menschenknochen konnte er in der Tat erstmals beweisen, dass "maze- 9 Matthias HACKENBROCH U. Walther HOLTZMANN, Die angeblichen Überreste Heinrichs des Löwen; in: Deutsches Archiv für die Erforschung des Mittelalters, Jg. 10, 1953/54, S. 488ff. \0 Eugen FISCHER, Begegnungen mit Toten. Freiburg i. Br. 1959, S. 21.
169 172 Amold Rabbow rierte" Knochen beträchtlich schrumpfen können, um bis zu 18,3 Prozent - der linke Schenkelknochen im Braunschweiger Sarkophag war im Vergleich zum gesunden um 15,6 Prozent gegenüber dem gesunden geschrumpft vorgefunden worden legte Fischer darüber in Fachzeitschriften Rechenschaft ab 11 Da aber ein Sudeck sich nicht als Folge angeborener Fehlbildung, sondern nur nach traumatischer Verletzung herausbildet, konnte Fischer annehmen, seinen orthopädischen Gegner widerlegt zu haben, und deshalb an seiner Identifizierung Heinrichs festhalten. Die Ruhe erwies sich jedoch nach einigen Jahren als trügerisch (veröffentlicht 1974) rollte der Tübinger Historiker Tilmann Schmidt in einer weit ausholenden und gut belegten Studie 12 den Komplex neu auf, indem er behauptete, dass die vermeintlichen Gebeine Heinrichs sowieso nicht die eines Mannes, sondern einer Frau seien. Dabei ließ er sich vor allem von der Annahme leiten, die - unzweifelhaft vorhandene - Hüftluxation sei eine angeborene. Indem er demgemäß ausschloss, dass sie erst später, etwa durch einen Unfall, entstanden sein könnte, brachte er sich selbst in den Zugzwang, nun - wenngleich mit schwächeren Argumenten - im Umkehrschluss dcn Leichnam in der Lederhülle als den Heinrichs zu deuten. Zwar erhob sich gegen Schmidts als revolutionär empfundene - obwohl die Frage der Geschlechtsbestimmung schon 1935 die Ausgräber und Braunschweiger Wissenschaftler beschäftigt hatte 13 - Thesen bereits nach seinem 1973 vor dem Braunschweigischen Geschichtsverein gehaltenen Vortrag 14 Widerspruch, so von dem Braunschweiger Gynäkologen Dr. Karl-Rudolf Döhne1 1 5, doch hatte Schmidt dank etlicher starker Argumente - und wohl auch dank des allgemeinen Ruhebedürfnisses, das nun endlich die NS-Zeit auch auf diesem Gebiet aufgearbeitet wähnte - die interessierte Öffentlichkeit für längere Zeit auf seine Seite gebracht. Einen postmortalen "Todesstoß" gegen Eugen Fischer führte schließlich der Veterinärmediziner und kritische Fischer-Biograph (,Rasse als Konstrukt", Frankfurt/ M. 1997) Niels C. Lösch, der zugleich die bis dahin beste Zusammenfassung des Konfliktes lieferte l6 Er unterstellte dem Anthropologen, der auch als rassebiologischer Gutachter tätig gewesen war, vorsätzlichen Irrtum, weil dieser als ausgewiesener Fachmann den tatsächlichen Sachverhalt zwar erkannt, aber geleugnet habe, da Heinrich der Löwe mit einer angeborenen Hüftluxation nach den nationalsozialistischen Ras- 11 Eugen FISCHER, Angeborene oder traumatische Hüftgelenksluxation an den Herzog Heinrich dem Löwen zugeschriebenen Gebeinen?, in: Archiv f. orthopäd. u. Unfall-Chirurgie 48, 1956, S ; DERs., Postmortale Knochenschrumpfung und Sudecksehe Knochendystrophie, in: Zs. f. Morphologie u. Anthropologie 48, 1957, S Tilmann SCHMIDT, Die Grablege Heinrichs des Löwen im Dom zu Braunschweig, in: Blb. 55, 1974, S Schon kurz nach Beginn der Ausgrabung 1935 hatte der Geschichtsprofessor Ernst Roloff von der Technischen Hochschule Braunschweig die Meinung geäußert, dass der vermeintliche Sarg Heinrichs nicht diesen, sondern seine Gemahlin enthalte, was Schmidt "erstaunlicherweise" (Lösch, wie Anm. 16, S. 244 f.) nicht erwähnte, obwohl es ihm hätte bekannt sein können. 14 Bericht darüber in der Braunschweiger Zeitung vom 27. Oktober IS Brief an Dr. Paul Danncnbaum (der Hackcnbrochs Diagnose 1971 bestätigt hatte, vgl. Braunschweiger Zeitung vom 24. August 1971) vom ; Leserbrief von Dr. Döhnel "Eindeutig identifiziert" in der Braunschweiger Zeitung. 16 Nils C. LöSCH, Die "Erhgesundheit" Heinrichs des Löwen; in: Blb. 78, 1997, S
170 Wo ruhen Heinrich und Mathilde? 173 segesetzen nicht erbgesund gewesen wäre - ein im NS-Staat mit Sterilisation bedrohtes Krankheitsbild. Gemäß dem Zeitgeist deutscher Vergangenheitsbewältigung reichte bereits dieser - wie Lösch selber einräumte 17, nicht durch konkrete Beweise untermauerte - Verdacht, um Fischer und seine Findungen ein für allemal zu erledigen. Die braunschweigische evangelisch-lutherische Landeskirche, die alljährlich am Todestag Herzog Heinrichs, des Stifters ihrer Bischofskirche, einen Kranz auf dem rechten Steinsarkophag niederlegte, fand einen eleganten Ausweg, indem man fortan zwei Gebinde, auf jedem der beiden fraglichen Grabstätten eines, deponierte. Seither herrscht Ruhe, obwohl auch in der umfänglichen Beweisführung von Tilmann Schmidt bei genauerem Hinsehen einige schwache Stellen als noch offene Fragen auf Antworten harren. Die wichtigste: Die Deutung des circa 1,65 Meter (die bei Hofmeister (S. 11) angeführte und von Schmidt übernommene Messung von 1,62 Mcter ist wegcn des fehlenden Schädels problematisch) großen Skeletts als eines weiblichen ist trotz scheinbar sehr überzeugender Messergebnisse z. B. bei der sog. Schambeinfuge nicht über Zweifel erhaben. Orthopäden und Gynäkologen haben unterschiedliche Deutungen zu Protokoll gegeben. Und wenn denn dieses Skelett dasjenige Mathildes wäre, dann hätte die englische Prinzessin sich zeitlebens mit einem schweren Hüftleiden plagen müssen. Ob sie dann überhaupt einem bedeutenden Fürsten als Gattin angedient worden wäre, anstatt in ein Kloster gesteckt zu werden, ist auch trotz des politisch motivierten Heiratsplans fraglich. Erst recht, wenn man bedenkt, dass Mathilde binnen zwölf Jahren sechsmal schwanger wurde. Auch hätte dann wohl ein Minnesänger wie Bertrand de Born - obwohl natürlich Schmeicheleien zu seinem Beruf gehörten - die körperliche Schönheit Mathildes, "an der er eine verwegene Entkleidung" 18 vollzog, kaum in kühnen erotischen Wendungen gepriesen, sondern - natürlich ohne ihre Missbildung zu erwähnen - eher in etwas gedämpfteren Tönen beleuchtet. Davon abgesehen, ist die Frage, wie groß Mathilde war, nach dem zeitgenössischen abbildlichen Befund des Helmarshausener Evangeliars nicht endgültig beantwortet, je nachdem ob sie auf dem berühmten Krönungsbild steht oder, wie Heinrich auch, kniet, in welch letzterem Falle sie ihren Gemahl um Haupteslänge überragt hätte l9 Schmidt wurde von seinem scheinbar bewiesenen Ausgangspunkt, dem vermeintlich weiblichen Skelett im quaderförmigen Sarkophag, im Umkehrschluss zu der unwahrscheinlicheren und auch von ihm selbst nicht sehr entschieden ausgesprochenen These verleitet, die - sehr große - Leiche in der Lederhülle sei dann eben Heinrich gewesen - wer auch sonst, an so zentraler Stelle im von Heinrich erbauten Dom 2o Allerdings - Heinrich hatte seinen Dom von vornherein als Grablege für sich und sein 17 Ebd., S SCHMIDT, wie Anm. 12, S. 31. Beman de Born, Nr. 34 u. 35, hrsg. v. Albert STIMMING (1913), S. 129 f., 131 f. " Zu beiden Deutungen vgl. Reinhard STAATS, Heinrich der Löwe und RY7.an7, Wolfcnhüttel 199R, S. 50, Anm. 25. Staats erweitert die Evangcliarhild-Diskussion um das zuvor kaum gewürdigte Motiv der gekreuzten Hände im Krönungsakt (S. 17 ff.). 20 SCHMIDT, wie Anm. 12, S. 44 f.
171 174 Amold Rabbow Geschlecht geplant und erbaut. Er starb 1195 in Braunschweig. Warum hätte er dann lediglich in einem Ledersack und Holzsarg beigesetzt worden sein sollen? Er brauchte ja nicht transportiert bzw. provisorisch beigesetzt zu werden wie allenfalls seine vor ihm gestorbene Gattin. Vor allem aber: Heinrich war, wie durch Augenzeugen bestätigt, keineswegs ein Riese wie der oder die Tote in der Lederhülle. Wäre er es gewesen, so hätten die Zeitgenossen es für wert befunden, eigens vermerkt zu werden. Heinrich war nach einem Augenzeugenbericht nur mittelgroß, was wiederum zum hüftkranken Skelett passt. Und blondes Haar hatte er schon gar nicht, sondern - nigris kann sowohl dunkel als auch schwarz bedeuten - dunkleres, eher wie der hüftverletzte und keinesfalls wie der Lederhüllen-Leichnam. Wenn letzterer gleichwohl Heinrich zuzuordnen wäre, dann hätte er Spuren des Unfalls von 1194 aufweisen müssen, was auch an dem zwar stark zerfallenen, aber in seinen Umrissen noch gut sichtbaren Skelett feststellbar gewesen wäre, aber nicht der Fall war. Eines der stärksten Argumente Schmidts ist freilich der Bericht Gerhards von Steterburg über die Beisetzung. Gerhard führt aus, Heinrich sei "in dextro latere uxoris suae" bestattet worden, also zur rechten Seite seiner Gemahlin. Es lässt sich auch nicht nach Ernst Jandls satirischem "Werch ein IIItum!", das eine im Alltag auch heutzutage häufige Verwechslung beschreibt, entkräften. Aber Domprediger Joachim Hempel macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass zu Heinrichs Zeit der Haupteingang zum Dom sich nicht dort befand, wo er heute der Allgemeinheit offen steht, sondern weiter östlich, nahe dem Verbindungsgang zwischen der Burg Dankwarderode und dem Dom. Wenn Gerhard die Beisetzung von hier aus beobachtete, also zu Füßen der Toten, befand sich der Leichnam Heinrichs zwar nicht zur Rechten seiner Gattin, aber aus Gerhards Blickwinkel immerhin rechts von ihr. Wie auch immer - die Wissenschaft verfügt neuerdings über ein Instrumentarium, das alle diese offenen Fragen ohne weitere mehr oder weniger gut begründete Mutmaßungen beantworten könnte, und zwar durch eine auch nach Jahrhunderten noch mögliche Feststellung der Abkunft eines Individuums von der Mutterseite. Zum menschlichen Erbgut gehört außer der "normalen" Desoxyribonukleinsäure (DNS, englisch DNA) auch eine DNA, die in den Mitochondrien angesiedelt ist. Über diese Mitochondrien-DNA verfügen sowohl Männer als auch Frauen, aber nur Frauen können sie vererben, weil die väterliche Mitochondrien-DNA nicht in der Lage ist, in die weibliche Eizelle einzudringen. Der Nachteil, dass auf diese Weise nur die Abstammung von weiblichen Vorfahren feststellbar ist, wird aufgewogen durch den großen Vorteil, dass diese spezielle DNS über sehr lange Zeiträume hinweg stabil ist. Eine Mutation ist im statistischen Mittel nur alle zehntausend Jahr zu erwarten, kann also in dem hier zu betrachtenden Zeitraum von rund achthundert Jahren als unwahrscheinlich gelten. Auf diese Weise sind im Jahre 1994 die Gebeine der 1918 in Jekaterinburg ermordeten russischen Zaren familie nicht nur als die einer Familie erkannt worden, sondern es gelang auch, den Zaren Nikolaus 11. zu identifizieren, der mit zwei noch lebenden entfernten Verwandten, dem exilrussischen Bankier Graf Trubezkoi und dem britischen Prinzgemahl Philip, Herzog von Edinburgh, gemeinsame weibliche Vorfahren
172 Wo ruhen Heinrich und Mathilde? 175 hat, was durch gespendete Haarproben der Vergleichspersonen einerseits und durch eine Probe von den Gebeinen des letzten Zaren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bewiesen wurde 21 Quasi nebenbei wurde mit dieser Untersuchungsmethode auch festgestellt, dass die angebliche Zarentochter "Anastasia", Anna Anderson (von der zufällig Gewebeproben in einer Berliner Klinik erhalten waren), mit dem Zaren nicht verwandt war 22 Im Fall von Heinrich und Mathilde geben genealogische Daten die Forschungsrichtung vor. Beider Gebeine sind ungeachtet der noch ungesicherten Identifizierung erhalten, wobei die Mathildes al1erdings erheblich mehr vergangen sind. Doch existieren Haarproben des Ehepaares im Braunschweigischen Landesmuseum und möglicherweise auch noch in Privatbesitz. Dabei konzentriert sich die Abstammungserforschung zunächst auf Mathilde. Sie hatte außer Söhnen eine Tochter, die kinderlos blieb. Mithin leben von Mathilde gegenwärtig zwar zahllose Nachkommen, aber keine in direkter weiblicher Linie. Dass in Bezug auf die andere Mathilde, Heinrichs Konkubine, mit der er eine Tochter hatte, - die er dem Sohn des mecklenburgischen Fürsten Pribislaw, Heinrich Borwin 1., zur Frau gab und von der unter anderen das gesamte mecklenburgische Herzogshaus abstammt, - nicht ganz auszuschließen ist, dass noch heute Nachkommen in rein weiblicher Linie unerkannt unter uns leben, hilft hier freilich nicht weiter. Diese stammen dann zwar von Heinrich ab, die mitochondriale DNA-Sequenzierung in Richtung auf das Ehepaar Heinrich und Mathilde ist jedoch hier nicht anwendbar. Kann also die weibliche Nachkommenschaft von Heinrichs Gattin Mathilde nicht in Richtung Gegenwart verfolgt werden, so nichtsdestoweniger ihre weibliche Abstammung nach "oben" und von dort aus wieder nach "unten". Ihre Mutter war die berühmte Eleonore von Aquitanien (gest. 1204). Sie liegt im französischen Fontevrault neben ihrem zweiten Gatten Heinrich 11. von England begraben, doch wurde die Grabstätte während der französischen Revolution gestört. Die englischen Könige Richard I. Löwenherz (gest. 1199) und Johann ohne Land (gest. 1216), ihre Söhne, besitzen die gleiche Mitochondrien-DNA-Sequenz wie sie. Nachkommen Eleonores in weiblicher Linie sind unter anderen (über ihre gleichnamige Tochter (gest. 1214) und ihre Enkelin Blanka, gest. 1252) die Könige Ludwig IX. von Frankreich (gest. 1270) und Kar! I. Stephan von Neapel und Sizilien (gest. 1285), (über ihre Enkelin Urraca) die Könige Sancho 11. (gest. 1248) und Alfons III. (gest. 1279) von Portugal sowie (über ihre Tochter Marie (gest. 1198) aus erster Ehe mit dem französischen König Ludwig VII.) König Heinrich von Jerusalem (gest. 1197). Doch müssen Vergleichsproben nicht, unter voraussehbaren Schwierigkeiten, im Ausland gesucht werden. Vielmehr sind drei Söhne Mathildes, mit der gleichen mitochondrialen DNA-Sequenz, in unmittelbarer Nähe zu finden, nämlich im Braunschweiger Dom: Kaiser Otto IV. (gest. 1218), Pfalzgraf Heinrich (gest. 1227) und das Kind unbekannten Namens aus dem 1935 wieder aufgefunden Kindersarkophag. Die 21 Bryan SVKES (Genetikprofessor am Institut f. Molckularmedizin der Universität Oxford), Die sieben Töchter E\'as. Bergisch Gladbach 2001, S. 75 ff. 22 Ebd, S. 84 ff.
173 176 Amold Rabbow Gebeine Ottos und Heinrichs liegen allerdings seit 1707 zusammen mit denen anderer Welfen in einem Massengrab, der Tumba in der Nordostecke des Doms. Diese Tumba wurde übrigens wiederum im Zuge der Vergangenheitsbewältigung - unter Leitung des Dompredigers Hempel geöffnet, weil an der Zinkhülle 1938 ein Hakenkreuz angebracht worden war 23 Jedenfalls waren die Gebeine noch recht gut erhalten. Wenn ein Vergleich mit Proben aus der Thmba eine Sequenzgleichheit mit einer der Personen aus den beiden großen Sarkophagen ergibt, dann ist diese Person Mathilde und eine bis heute offene Frage endgültig beantwortet. Noch einfacher ist aber der Vergleich mit dem Kind in dem heute den Blicken entzogenen Sarg mit den Trageringen. Dieser befindet sich gegenwärtig hinter der abschließenden Wand der Gruft, vor der jetzt der Brunonensarg steht. In dem Kindersarg liegt ein jung verstorbener Sohn Heinrichs, entweder der mit seiner ersten Gattin Clementia gezeugte und nach einem Unglück - seine Amme ließ ihn von einem Tisch fallen - früh verstorbene Erstgeborene des Löwen, der wie er den Namen Heinrich trug, oder, was wahrscheinlicher ist, der in Argentan 1182 von Mathilde geborene und früh verstorbene Kleine unbekannten Namens. Ergibt der Sequenzvergleich mit den Toten in den beiden großen Sarkophagen eine Übereinstimmung, dann handelt es sich um den Sohn Mathildes und auch deren Identität ist somit geklärt. Doch auch für Heinrich selbst liefert die Genealogie Lösungswege, und zwar über seine weiblichen Vorfahren. Heinrich stammte in weiblicher Linie über seine Mutter Gertrud (gest. 1143, begraben in Klostemeuburg), Tochter Kaiser Lothars III., und über deren Mutter, die Kaiserin Richenza (gest. 1141) - sie ist begraben im Kaiserdom zu Königslutter -, von seiner Urgroßmutter Gertrud ab. Diese, die "jüngere Gertrud" genannt (gest. 1117), ruht zusammen mit ihrem Bruder, dem brunonischen Markgrafen Ekbert 11. (erschlagen 1090), in dem Brunonensarg, der heute als dritter sichtbarer Sarkophag hinter und quer zu den beiden anderen Sarkophagen in der Gruft steht. Beide haben dieselbe mitochondriale DNA-Sequenz wie Heinrich, weil die jüngere Gertrud und Ekbert Kinder derselben Mutter sind, nämlich von Heinrichs Ururgroßmutter Irrngard. Zu Heinrich gibt es überdies dank neue ster Untersuchungsmethoden noch einen anderen Weg, und zwar über das y-chromosom. Dieses vererbt sich in männlicher Linie. Da im Braunschweiger Dom drei Söhne Heinrichs liegen (Otto IV., Pfalzgraf Heinrich und das Kind unbekannten Namens, wobei es in seinem Fall, anders als bei der Mitochrondrien-DNA, keine Rolle spielt, ob es ein Kind Clementias oder Mathildes war), ist die Feststellung der Identität Heinrichs auch auf diesem Wege möglich. Davon abgesehen kann, sozusagen als Einstieg in die endgültige Klärung, die morphologisch bis heute nicht zweifelsfrei beantwortete Frage, ob die Gebeine in dem großen Steinsarkophag männlich oder weiblich sind, neuerdings auch ungeachtet sonstiger Verwandtschaftsverhältnisse direkt beantwortet werden. Dabei könnte das Institut für historische Anthropologie und Humanökologie an der Universität Göttingen, das - u. a. am Ort der mutmaßlichen Grablege Widukinds 23 Bericht von Eckhard Schimpf in der Braunschweiger Zeitung vom 5. Juni 1998.
174 Wo ruhen Heinrich und Mathilde? 177 in der Stiftskirche zu Enger in Westfalen - auf diesem Gebiet erfolgreich tätig ist, entscheidende Hilfestellung leisten. Die Feststellung, wer Heinrich ist und wer Mathilde, ist also für beide nunmehr abschließend möglich. Die Kontroverse kann mithin bald ein Ende nehmen und das Herrscherpaar seine endgültige Ruhe finden.
175
176 Verzeichnis der Veröffentlichungen von Günter Scheel vom Autor und Sibylle Weitkamp 1. Monographien und Quelleneditionen 1. " Wincheringen". Untersuchungen zu den mittelalterlichen Herrschaftsverhältnissen im Saar-Moselgebiet. Phi!. Diss. Berlin 1952, 173 gez. BI., 9 ungez. BI. 4 (Maschinenschrift. ) 2. Gottfried Wilhe1m Leibniz: Sämtliche Schriften und Briefe (Akademie-Ausgabe), hrsg. von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, ab 1975 von der Akademie der Wissenschaften der DDR. Reihe I: Allgemeiner, politischer und historischer Briefwechsel, ab Bd. 7, 1964 hrsg. vorn Leibniz-Archiv der Niedersächsischen Landesbibliothek Hannover. Bearbeiter der Bände 6, 1957 (mit Kurt Müller), 7, 1964 und 8, 1970 (mit Kurt Müller u. Georg Gerber), 9,1975 und 10, 1979 (mit Kurt Müller u. Gerda Utermöhlen), Supplementband: Harzbergbau, 1991 (Selbständig.) 3. Ursachen und Folgen. Vorn deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung Deutschlands in der Gegenwart. Herausgeber u. Bearbeiter: Herbert Michaelis, Ernst Schraepler u. Günter Scheel. Band 1-26, 2 Bände Indices, Berlin Zweihundert Jahre Brunnenhaase , Wiesbaden 1971, 29 S. 5. Kumulative Bibliographie zur Geschichte des Landes Braunschweig für die Jahre , Wolfenbüttel1989. Bearbeiter. 2 Bde mit Personen- und Ortsindex. (Maschinenschrift, für den Dienstgebrauch im Niedersächsischen Staatsarchiv Wolfenbüttel vervielfältigt.) 2. Aufsätze 6. Die Stellung der Reichsstände zur Römischen Königswahl seit den Westfälischen Friedensverhandlungen. In: Forschungen zu Staat und Verfassung. Festgabe für Fritz Hartung zum 75. Geburtstag. Hrsg. von Richard Dietrich u. Gerhard Oestreich, Berlin 1958, S Leibniz als herzoglicher Bibliothekar im Leineschloß. In: Georg Schnath: Das Leineschloss, Hannover 1962, S
177 180 Günter Scheel und Sibylle Weitkamp 8. Briefe der Kurfürstin Sophie von Hannover an die Landgräfm Marie Amalie von Hessen-Kassel ( ). In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 36,1964, S Hannovers politisches, gesellschaftliches und geistiges Leben zur Leibnizzeit. In: Leibniz. Sein Leben - sein Wirken - seine Welt. Hrsg. von Wilhelm Totok u. Carl Haase, Hannover 1966, S Leibniz als Historiker des Welfenhauses. In: Ebda, S Leibniz und die geschichtliche Landeskunde Niedersachsens. In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 38, 1966, S Fürstbistum und Stadt Osnabrück im Leben und Werk von G. W. Leibniz. In: Osnabrücker Mitteilungen, Bd. 74,1967, S Leibniz historien. In: Leibniz-Aspects de l'homme et de l'oeuvre, Paris 1968, S Leibniz' Pläne für das.,opus historicum" und ihre Ausführung. In: Akten des (1.) Internationalen Leibniz-Kongresses, Hannover , Bd. 4, Wiesbaden 1969, S Winchcringen im Spannungsfeld von Kurtrier und Luxemburg. In: Heimatbuch des Kreises Saarburg, 1969, S Der Regierungsbezirk Hannover als geschichtliche Landschaft. In: Niedersachsen. Hrsg. von Carl Haase, Göttingen 1971, S Leibniz als Direktor der Bibliotheca Augusta in Wolfenbüttel. In: Akten des 2. Internationalen Leibniz-Kongresses, Hannover, , Bd. 1, Wiesbaden 1973, S Leibniz' Beziehungen zur Bibliotheca Augusta in Wolfenbüttel. In: Braunschweigisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 54,1973, S Leibniz und die deutsche Geschichtswissenschaft um In: Historische Forschungen im 18. Jahrhundert. Hrsg. von Karl Hammer u. Jürgen Voss, Bonn 1976, S Die Anfänge der Arbeiterbewegung im Königreich Hannover zwischen Integration und Emanzipation. In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 48,1976, S Drei Denkschriften von Leibniz aus den Jahren über den Charakter, den Nutzen und die finanzielle Ausstattung der hannoverschen Bibliothek. In: Die Niedersächsische Landesbibliothek. Hrsg. von Wilhe1m Totok u. Karl-Heinz Weimann, Frankfurt a. M. 1976, S Von der herzoglichen Bibliothek im Leineschloß zur Niedersächsischen landesbibliothek in der Waterloostrasse - Eine Geschichte ihrer Standorte. In: Ebda, S Leibniz, die Alchimie und der absolute Staat. In: Theoria cum praxi. Akten des 3. Internationalen Leibnizkongresses, Hannover November 1977, Bd. 1, Wiesbaden 1980, S Leibniz' Eintritt in den braunschweigischen Staatsdienst und seine Wolfenbütteler Wohnung. In: Braunschweigische Heimat, Bd. 68, 1982, S Wiederabdruck in: Zur Stadtgeschichte Wolfenbütte1s. Hrsg. von Hans-Georg Reuther, Wolfenbüttel 1988, S
178 Veröffentlichungen von Günter Scheel Hennann Conring als historisch-politischer Ratgeber der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg. In: Hennann Conring: Beiträge zu Leben und Werk. Hrsg. von Michael Stolleis, Berlin 1983, S Anton Ulrich und Leibniz. In: Herzog Anton Ulrich von Braunschweig. Leben und Regieren mit der Kunst. Zum 350. Geburtstag am 4. Oktober Ausstellungskatalog Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig, Braunschweig 1983, S Leibniz' historiographisches Erbe als Aufgabe für Hannovers Bibliothekare von Eckhart bis Pertz. In: Leibniz, Werk und Wirkung. Akten des 4. Internationalen Leibniz-Kongresses, Hannover Vorträge, Hannover 1983, S R. Die Anfänge des Braunschweigischen Landesvereins für Heimatschutz nach neu erschlossenen Quellen. In: Braunschweigische Heimat, Bd. 70, 1984, S Braunschweig-Lüneburgische Hausgeschichtsschreibung im 18. und 19. Jahrhundert im Anschluss an das historiographische Erbe von G. W. Leibniz. In: Beiträge zur niedersächsischen Landesgeschichte. Zum 65. Geburtstag von Hans Patze. Hrsg. von Dieter Brosius u. Martin Last, Hildesheim 1984, S Das Staatsarchiv Wolfenbüttel fertigte das Gastgeschenk für den Spanienbesuch des Niedersächsischen Ministerpräsidenten. In: Archive in Niedersachsen, Bd. 8, Hannoverl986, S Leibniz auf den Spuren von Alchemisten in Berlin zur Zeit König Friedrichs I. In: Leibniz in Berlin. Hrsg. von Hans Poser u. Albert Heinekamp, Stuttgart 1990, S (studia Leibnitiana. Sonderheft 16.) 32. Erweiterungsbau für das Staatsarchiv Wolfenbüttel. In: Archive in Niedersachsen, Bd. 9, Hannover, 1990, S Die Anfänge und das Wirken der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft. In: 25 Jahre Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft, Hannover 1992, S.lI Technologietransfer für Bergbau und Hüttenwesen im Harz von der Mitte des 17. bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts. In: Geschichte in der Region. Zum 65. Geburtstag von Heinrich Schmidt. Hrsg. von Dieter Brosius u.a., Hannover 1993, S, Lcibniz' Wirken für Kaiser und Reich im Jahre 1688 in Wien nach bisher unbekannten Quellen. In: Leibniz und Europa. 6. Internationaler Leibniz-Kongress, Hannover Juli Vorträge Teil 1, Hannover 1994, S Braunschweig-Wolfenbüttel und Sachsen-Weimar in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Wolfenbütteler Beiträge. Hrsg. von Paul Raabe. Bd. 9, Wiesbaden 1994, S Nachruf auf Joseph König. In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 68, 1996, S Leibniz als politischer Ratgeber des Welfenhauses. In: Leibniz und Niedersachsen. Hrsg, von Herbert Breger u. Friedrich Niewöhner, Stuttgart 1999, S Leibniz' Helmstedter Gehilfen bei der Vervollkommnung der Rechenmaschine In: Nihil si ne ratione. 7. Internationaler Leibniz-Kongress, Berlin Vorträge Teil 3. Hrsg. von Hans Poser, Berlin 2001, S
179 182 Günter Scheel und Sibylle Weitkamp 40. Helmstedt als Werkstatt für die Vervollkommnung der von Leibniz erfundenen und konstruierten Rechenmaschine ( ). In: Braunschweigisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 82, 2001, S Die Emigranten der Französischen Revolution im Herzogtum Braunschweig Wolfenbüttel. In: Braunschweigisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 83, 2002, S Leibniz und Reiske über Wolfenbüttel im Mittelalter. Ein gelehrter Briefwechsel vom Jahre In: Auf dem Weg zur herzoglichen Residenz. Wolfenbüttel im Mittelalter. Hrsg. von Ulrich Schwarz. Braunschweig 2003, S (Quellen und Forschungen zur braunschweigischen Landesgeschichte. Bd. 40.) 3. Beiträge in Handbüchern 43. Deutsche Verwaltungsgeschichte. Hrsg. von Kurt G. A. Jeserich, Hans Pohl, Georg-Christoph von Unruh. Bd. 1: Vom Spätmittelalter bis zum Ende des Reiches, Stuttgart 1983, S : Kurbraunschweig und die übrigen welfischen Lande. 44. Staatslexikon der GÖrres-Gesellschaft. 7. Auflage. Bd. 3, Freiburg, Basel, Wien, 1987, Sp : Leibniz. 45. Neue Deutsche Biographie. Bd. 16, 1990, S : Asche Christoph von Marenholtz ( ). 46. Lexikon zur Geschichte und Gegenwart der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Hrsg.von Georg Ruppelt u. Sabine Solf, Wiesbaden 1992, S : Gottfried Wilhelm Leibniz. 47. Braunschweigisches Biographisches Lexikon und 20. Jahrhundert. Hrsg. von Horst-Rüdiger Jarck u. Günter Scheel, Hannover 1996:Ahlborn, Gustav Ludwig; AnscheI, Auguste; Bangemann, Oskar; Behrenroth, Erich; Benze, Erich; Bercht, Ludwig Julius; Bischoff, Johann Heinrich Christian; Blasius, Wilhe1m; Boden, Hans Constantin; Campe, Julius; Castries,Charies Eugene Gabriel de la Croix, Marquis de; Dedekind, Alexander; Denckmann, Friedrich Ludolf; Dinckelberg, Hugo Lebrecht; Dunker, Wilhelm; Dyrssen, Carl Ludwig; Ebcling, Alfred; Eisner, Martin; Fritze, Carl Wilhe1m August; GarBen, Adolf von; Girsewald Wilhelm von; Haberland, Heinrich Theodor Wilhelm Albert; Hackethal, Christoph; Horn, Gottlieb Friedrich Carl; Karsten, August; Knittel, Edmund; Knost, Friedrich August; Leiste, Johann Christian; Linke, Franz; Löbbecke, Alfred; Mackensen, Georg Anton; Meyer, Karl; Oesterreich, Franz; Olfermann, Johann Elias; Pirscher, Christian Karl Dietrich; Pockels, August; Praun, Carl von; Prcen, Carl Wilhclm Hermann; Rauch, Gustav von; Rocmcr Jakob Ludwig; Rommel, Erwin; Rose, Karl; Sachsen-Weimar-Eisenach, Anna Amalie Herzogin von; Schloenbach, Albert; Schloenbach, Urban; Schmidt, Karl Wilhe1m; Schrader, Alexander von; Schulz, Friedrich; Stangen, Christian Wilhe1m von; Steinakker, Heinrich Friedrich Karl; Thielemann, Otto; TrausteI, Sergei; Unger Friedrich Wilhelm von; Unger, Julius von; Unger, Urban von; Voigts-Rhetz, Konstantin Bernhard von; Wäterling, Friedrich Christoph; Wagner, Karl Wilhelm Ulrich; Weitenkampf, Heinrich Wilhe1m Benjamin; Wernsdorf, Christian Gottlieb; Willikens, Werner; Witte, Ernst.
180 Veröffentlichungen von Günter Scheel Herausgabe und Schriftleitung 48. Veröffentlichungen der Niedersächsischen Archivverwaltung. Inventare und kleinere Schriften des Staatsarchivs Wolfenbütte1, Heft 2-5, Göttingen Braunschweigisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd , Beihefte zum Braunschweigischen Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 1-8, Quellen und Forschungen zur Braunschwcigischen Geschichte, Bd , Vereinstätigkeit und Jahresberichte 52. Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen, Schriftführer von 1973 bis Jahresberichte der Historischen Kommission für die Geschäftsjahre In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 46/47, 1975, S ; Bd.48, 1976,S ; Bd.49, 1977,S ; Bd. 50, 1978,S Braunschweigischer Geschichtsverein, Vorsitzender von 1982 bis Chronik des Braunschweigischen Geschichtsvereins für die Jahre In: Braunschweigisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Jg. 63, 1982, S. 199f.; 64, 1983,S ; 65, 1984,S ; 66, 1985,S ;67, 1986, S ; 68, 1987,S ;69, 1988,S ; 70, 1989,S ; 71, 1990,S ;72, 1991,S ;73, 1992,S ;74, 1993,S Diskussionsbeiträge 55. Humanismus und Naturrecht in Berlin-Brandenburg-Preussen. Ein Tagungsbericht. Hrsg. von Hans Thieme, Berlin, New York 1979, S. 112, (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin. Bd. 48.) 56. Res publica. Bürgerschaft in Stadt und Staat. Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in Hofgeismar am 30./31. März Redaktion Gerhard Dileher. "Der Staat", Beiheft 8, Berlin 1988, S Rezensionen 57. Waltraud Fricke: Leibniz und die englische Sukzession des Hauses Hannover, Hildesheim (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens. Bd. 56.) In: Deutsche Literaturzeitung, Jg. 80, 1959, Spalte Paul Wiedeburg: Der junge Leibniz, das Reich und Europa. Teil 1: Mainz, Wiesbaden (Historische Forschungen im Auftrag der Historischen Kommission der Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Bd. 4.) In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 36, 1964, S
181 184 Günter Scheel und Sibylle Weitkamp 59. Wilhelm Kohl: Christoph Bernhard von Galen. Politische Geschichte des Fürstbistums Münster , Münster (Veröffentlichungen der Historischen Kommission Westfalens. XVIII: Westfälische Biographien. III.) In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 37, 1965, S Ursula Schelm-Spangenberg: Die Deutsche Volkspartei im Lande Braunschweig. Gründung, Entwicklung, soziologische Struktur, politische Arbeit, Braunschweig (Braunschweiger Werkstücke. Bd. 30.) In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 37, 1965, S Ernst-August Roloff: Bürgertum und Nationalsozialismus Braunschweigs Weg ins Dritte Reich, Hannover Derselbe: Braunschweig und der Staat von Weimar. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft , Braunschweig (Braunschweiger Werkstücke. Bd. 31.) In: Niedcrsächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 37, 1965, S Walter Junge: Leibniz und der Sachsen-Lauenburgische Erbfolgestreit, Hildesheim (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens. Bd. 65.) In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 38, 1966, S Wilhelm Winkel: Geschichte der Stadt Neustadt a. Rbge. Unter Mitarbeit von Dietrich Bohnsack, Hans Pupke u. Dietrich Redecker, (Neustadt a. Rbge 1966). In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 39, 1967, S Herbert Lommatzsch: Von Leibniz bis Roemer. Skizzen und Bilder aus der Geschichte von Wissenschaft und Technik, Forschung und Lehre im Oberharzer Erzbergbau und in der Hochschulstadt Clausthal-Zellerfeld, Clausthal-Zellerfeld (1966). In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 39, 1967, S. 378 f. 66. Gottfried Wilhelm Leibniz: Reisejournal Hildesheim Eduard Bodemann: Der Briefwechsel des Gottfried Wilhelm Leibniz in der Königlichen öffentlichen Bibliothek zu Hannover. Mit Ergänzungen und Register. Ebd Derselbe: Die Leibniz-Handschriften der Königlichen öffentlichen Bibliothek zu Hannover. Mit Ergänzungen und Register. Ebd In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 39, 1967, S. 393 f. 69. Gottfried Wilhe1m Leibniz: Politische Schriften. Bd.1.2. Herausgegeben u. eingeleitet von Hans Heinz Holz (Reihe: Politische Texte.). Frankfurt am Main, Wien In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 39, 1967, S Hermann Leskien: Johann Georg von Eckhart ( ). Das Werk eines Vorläufers der Germanistik, Phi!. Diss. Würzburg (Maschinenschrift!. vervielfältigt.). In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 40, 1968, S. 257 f. 71. Johanna Sophie Gräfin zu Schaumburg-Lippe: Briefe an die Familie von Münchhausen zu Remeringhausen Bearbeitet von Friedrich Wilhelm Schaer, Rinteln (Schaumburger Studien. H. 20.) In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 40, 1968, S. 261 f. 72. Armin Reese: Die Rolle der Historie beim Aufstieg des Welfenhauses , Hildesheim (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens.
182 Veröffentlichungen von Günter Scheel 185 Bd. 71.) In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 40, 1968, S. 186 f. 73. Peter Gerrit Thielen: Karl August von Hardenberg Eine Biographie, (Köln, Berlin 1967). In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd ,1970, S Alwin Hanschmidt: Franz von Fürstenberg als Staatsmann. Die Politik des münsterschen Ministers , Münster (Veröffentlichungen der Historischen Kommission Westfalens. XVIII: Westfälische Biographien Y.) In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 43, 1971, S. 304 f. 75. Paul Morand: Sophie Dorothea von Celle. Die Geschichte eines Lebens und einer Liebe, aus dem Französischen ühertragen von Peter Mortzfeld, Hamburg (1970). In: Blätter für deutsche Landesgeschichte, Jg. 108, 1972, S. 617 f. 76. Hclga Simon: Wunstorf. Rechts- und Herrschaftsverhältnisse von den Anfängen bis ins 18. Jahrhundert. Wunstorf, In: Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Bd. 59,3, 1972, S. 430 f. 77. Geschichte der deutschen Länder. "Territorien-Ploetz": Hrsg. von Georg Wilhelm Sante und A. G. Ploetz Verlag. Bd. 2: Die deutschen Länder vom Wicner Kongreß bis zur Gegenwart, Würzburg (1971). Geschichte des Landes Niedersachsen: Hrsg. von Georg Schnath, Hermann Lübbing u. a. Neuausgabe, Würzburg (1973). (Geschichte der deutschen Länder. Territorien-Ploetz. Sonderausgaben). In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 45, 1973, S Horst Eckert: Gottfried Wilhelm Leibniz' Scriptores rerum Brunsvicensium. Entstehung und historiographische Bedeutung, Frankfurt a. Main (1971). (Veröffentlichungen dcs Leibniz-Archivs. 3.) In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 45, 1973, S Charlotte Ziegler: Volkshochschule Hannover. Eine pädagogisch-historische Studie, Hannover Lutz Rössner: Erwachsenenbildung in Braunschweig. Vom Arbeiterverein 1848 bis zur Volkshochschule 1971, Braunschweig (Braunschweiger Werkstücke Bd. 44). In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 45, 1973, S. 454 f. 81. Karl Birker: Die deutschen Arbeiterbildungsvereine , Berlin (EinzclveröffentIichungen der Historischen Kommission zu Berlin. Bd. 10.) In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 46/47, , S Das Bistum Hildesheim : Eine Dokumentation. Unter Mitarbeit von Winfried Haller, Joseph König u. a. hrsg. von Hermann Engfer, Hildcsheim (Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart. Jg. 38/39, ) In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 46/47, , S Hans Hoffmann: Johann Georg Spangen berg Arzt und Medizinalbeamter in Göttingen und Hannover. Zugleich der Versuch der Darstellung einer niedersächsischen Gclchrtenfamilie, Hildesheim (Selbstverlag) In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 48, 1976, S. 532.
183 186 Günter Scheel und Sibylle Weitkamp 84. Justus Mösers Sämtliche Werke. Dritte Abteilung: Osnabrückische Geschichte und historische Einzelschriften. Bearb. von Paul Göttsching. Bd. XIV,I: Historische Aufsätze Historische Handschriften, Oldenburg In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 50, 1978, S Peter Schmidt: Studien über Justus Möser als Historiker. Zur Genesis und Struktur dcr historischen Methode Justus Mösers, Göppingen (Göppinger Akademische Beiträge. 93.) In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 50, 1978, S. 468f. 86. Karl Teppe: Provinz, Partei, Staat. Zur provinziellen Selbstverwaltung im Dritten Reich, untersucht am Beispiel Westfalens, Münster (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen. XXXVIII: Beiträge zur Geschichte der preußischen Provinz Westfalen. Bd. 1). In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 51, 1979, S Henning Rischbieter: Hannoversches Lesebuch oder: Was in Hannover und über Hannover geschrieben, gedruckt und gelesen wurde. Bd. 2, Velber In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 51, 1979, S. 419 f. 88. Aspekte des europäischen Absolutismus: Vorträge aus Anlaß des 80. Geburtstages von Georg Schnath. Hrsg. von Hans Patze, Hildesheim In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 52, 1980, S. 369 f. 89. Toni Offermann: Arbeiterbewegung und liberales Bürgertum in Deutschland , Bonn (Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung. Reihe: Politik und Gesellschaftsgeschichte. Bd. 5.) In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 53, 1981, S Peter Klaus Schwarz: Nationale und soziale Bewegung in Oldenburg im Jahrzehnt vor der Reichsgründung, Oldenburg (1979). (Oldenburger Studien. Bd. 17.) In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 53, 1981, S Hermann von Berg: Ent<;tehung und Tätigkeit der Norddeut<;chen Arbeitervereinigung als Regionalorganisation der Deutschen Arbeiterverbrüderung nach der Niederschlagung der Revolution von 1848/49, Bonn In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 56,1984, S Leibniz-Bibliographie: Die Literatur über Leibniz bis Begründet von Kurt Müller. Hrsg. von Albert Heinekamp. 2., neu bearb. AufI., Frankfurt a. Main (Veröffentlichungen des Leibniz-Archivs. Bd. 10.) In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 58, 1986, S Akten und Urkunden zur Außenpolitik Christoph Bemhards von Galen ( ). Hrsg. von Wilhelm Kohl. T. 1-3, Münster (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen. XLII: Quellen und Forschungen zum Absolutismus in Westfalen. Bd. 1.) 94. Teil 1: Vom Antritt der Regierung bis zum Frieden von Kleve ( ) Teil 2: Vom Frieden von Kleve bis zum Kölner Frieden ( ) Teil 3: Vom Kölner Frieden bis zum Tode des Fürstbischofs ( ) In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 60, 1988, S Acta Pacis Westphalicae. Serie III, Abt. C: Diarien. Bd. 3: Diarium Wartenberg. Teil Bearb. von Joachim Foerster, Münster In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 63, 1991, S
184 Veröffentlichungen von Günter Scheel Barbara Stadler: Pappenheim und die Zeit des Dreissigjährigen Krieges, Winterthur In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 65, 1993, S Acta Pacis Westphalicae. Serie 11: Korrespondenzen, Abt. C: Die schwedischen Korrespondenzen. Bd. 4: Bearb. von Wilhelm Kohl unter Mitarb. von Paul Nachtsheim. Teil 1.2, Münster In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 68,1996, S Heinz Duchhardt, Gerd Dethlefs, Hermann Queckenstedt: "zu einem stets währenden Gedächtnis". Die Friedenssäle in Münster und Osnabrück und ihre Gesandtenporträts. Hrsg. von Kar! Georg Kaster u. Gerd Steinwascher. Mit heraldischen Beiträgen von UIf-Dietrich Korn, Brarnsche (Osnabrücker Kulturdenkmäler. Bd. 8.) In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd.70, 1998, S Lcibniz-Bibliographie: Bd. 2: Die Literatur über Leibniz Begründet von Kurt Müller. Hrsg. von Albert Heinekamp unter Mitarb. von Marlen Mertens, Frankfurt a. Main (Veröffentlichungen des Leibniz- Archivs. Bd. 12.) In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 70, 1998, S. 525 f Gottfried Wilhelm Leibniz: Allgemeiner, politischer und historischer Briefwechsel. Hrsg. unter der Aufsicht der Akademie der Wissenschaften in Göttingen vom Leibniz-Archiv der Niedersächsischen Landesbibliothek in Hannover. Bd. 14: Mai-Dezember Bearb. von Gerda UtermöhIen, Sabine Sellschopp u. Wolfgang Bungies, Berlin (Gottfried Wilhelm Leibniz: Sämtliche Schriften und Briefe. Hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Reihe I, Bd 14.) In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 71, 1999, S Acta Pacis Westphalicae. Serie III, Abt. A: Protokolle. Bd. 3: Die Beratungen des FÜTstenrates in Osnabrück. T. 1: T. 2: Bearb. von Maria-Elisabeth Brunert. Münster, In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 72, 2000, S Gottfried Wilhelm Leibniz: Allgemeiner, politischer und historischer Briefwechsel. Hrsg. vom Leibniz-Archiv der Niedersächsischen Landesbibliothek Hannover. Bd. 15: Januar bis September Bearb. von Wolfgang Bungies u. Gerda Utermöhlen (t), Berlin (Gottfried Wilhelm Leibniz: Sämtliche Schriften und Briefe. Hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Reihe I, Bd. 15.) In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 72, 2000, S Gottfried Wilhelm Leibniz: Allgemeiner, politischer und historischer Briefwechsel. Hrsg. vom Leibniz-Archiv der Niedersächsischen Landesbibliothek Hannover. Bd. 16: Oktober 1698 bis April Bearb. von Malte-Ludolf Babin, Reinhard Finster u. Gerd van den Heuve1, Berlin (Gottfried Wilhelm Leibniz: Sämtliche Schriften und Briefe. Hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Reihe I, Bd. 16.) In: Braunschweigisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 83, 2002, S Acta Pacis Westphalicae. Serie 11: Korrespondenzen. Abt. A: Die kaiserlichen Korrespondenzen. Bd. 4: Bearb. von Hubert Salm u. Brigitte Wübbeke Pflüger unter Benutzung der Vorarbeiten von Wilhelm Engels, Manfred KIett u.
185 188 Günter Scheel und Sibylle Weitkamp Antje Oschmann, Münster In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 74, 2002, S Gottfried Wilhelm Leibniz: Politische Schriften. Hrsg. von der Leibniz-Editionsstelle der Berlin-Brandenhurgischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 4: Bearb. von Friedrich Beiderbeck, Rosemarie Caspar u.a., Berlin (Gottfried Wilhdm Leibniz: Sämtliche Schriften und Briefe. Hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Akademie dcr Wissenschaften in Göttingen. Reihe IV, Bd 4.) In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 75, 2003, S
186 Bibliographie zur Braunschweigischen Landesgeschichte mit Nachträgen Berücksichtigt auch Literatur der 1978 zum Regierungsbezirk Braunschweig hinzugekommenen Kreise in Auswahl bearbeitet von Ewa Schmid Allgemeines, Landeskunde 1. ARTELT, Peter: Halberstadt, eine Zufluchtsstätte dcr Hugenotten. In: Unser Harz. Jg S , 2 Abb. 2. BERG, Britta, Peter ALBRECHT: Presse der Regionen Braunschweigl Wolfenbüttel, Hildesheim-Goslar. Kommentierte Bibliographie der Zeitungen, Zeitschriften, Intelligenzblätter, Kalender und Almanache sowie biographische Hinweise zu Herausgebern, Verlegern, Druckern und Beiträgern periodischer Schriften bis zum Jahre Bd. 3.1: Braunschweig; Bd. 3.2: Blankenburg, Clausthal, Goslar, lielmstedt, Hildesheim, Holzminden, Schöningen, Wolfenbüttel. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann Holzboog S. (Deutsche Presse. Biobibliographische Handbücher z. Gesch. d. deutschsprachigen periodischen Presse von den Anfängen bis 1815, ) 3. BERNATZKY, Monika, Joachim SCHMID: Von den Anfängen bis zur Gegenwart. In: Landkreis Helmstedt. Deutsche Landkreise im Portrait. Red.: Gerhard KILIAN. 4., völlig neue Ausg. Oldenburg: Verl. f. Kommunikation u. Wirtschaft (Edition "Städte - Kreise - Regionen"). S , Abb. 4. BERNSDORF, Sabine: Moorforschung im Harz. Entwicklung und Schutz der Moore im Nationalpark Hochharz. In: Scientia Halensis. 2003,4. S BINNER, Jens: Ein Spaziergang durch das jüdische Peine. Peine: Peiner Bündnis f. Zivilcourage u. Toleranz S., Abb. 6. BORNEMANN, Manfred: Erinnerungen an die alte Mansfelder Ölmühle. In: Unser Harz. Jg S , Abb. 7. DAHMS, Thomas: Die Hagen von Salzgitter-Gebhardshagen, Braunschweig, Gandersheim und des Klützer Ortes. Eine regionale Vergleichsstudie zur mittelalterlichen Wald- und Siedlungsgeschichte in Niedersachsen und Mecklenburg. Salzgitter: Archiv der Stadt S., Abb. (Salzgitter-Forschungen 4) 8. DANNowsKI, Hans Wemer: Klosterfahrten. Zwischen Harz und Heide, Weser und Leine. Hannover S., Abb.
187 190 Ewa Schmid 9. DITTMANN, Rainer: Ein ehemalig königlich-preußisches Hütten-Amt. Historisches über Sorge im Harz. In: Der Harz. 2003,9. S EDELING, Karl-Dietrich: Wüstungen im Gebiet des ehemaligen Reichsstiftes Quedlinburg. In: Unser Harz. Jg S , Abb. 11. FLAKE, Uwe, Walter WIMMER: Radtouren um Braunschweig und Salzgitter. Braunschweig: Braunschw. Zeitungsverlag S., Abb. (Braunschw. Zeitung Spezial 6) 12. FRÜHAUF, Wolfgang: Die Stolperfalle von 1,20 m auf dem Brocken. In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003] ,4 Abb. 13. GATTERMANN, Claus Heinrich: Der Ausländereinsatz im Landkreis Osterode Berlin: Lukas-Verl S., Abb. (Harz-Forschungen 18) 14. GELDERDLOM, Bernhard: Jüdisches Leben im mittleren Weserraum zwischen Hehlen und Polle. Von den Anfängen im 14. Jahrhundert bis zu seiner Vernichtung in der nationalsozialistischen Zeit. Ein Gedenkbuch. Holzminden: Mitzkat S., Abb. 15. HARY, Jürgen: Deuregio Ostfalen e. V. - ein Verbund mit Zukunft. In: Landkreis HeImstedt. Deutsche Landkreise im Portrait. Red.: Gerhard KILIAN. 4., völlig neue Ausg. Oldenburg: Verl. f. Kommunikation u. Wirtschaft (Edition "Städte - Kreise - Regionen"). S , Abb. 16. Der Harz. Ein praktischer Reiseführer durch Deutschlands nördlichstes Mittelgebirge. 4., völlig überarb. Auf). Wernigerode: Schmidt S., Abb. 17. KARSTEN, Martin, Heike WOHLTMANN: Stadtumbau in Niedersachsen. Ansätze der Pi Iotstädte Wilhelmshaven und Salzgitter im ExWoSt-Forschungsfeld Stadtumbau (West). In: Neues Archiv f. Nds S , Abb. 18. KIEHL, Ernst: "Wir kamen durch lauter schöne Gegenden". T Der Harz in Tagebüchern und Werken Joseph von Eichendorffs. In: Sachsen-Anhalt. Bd , 3.S.7-15;4.S KLOSE, Frank, Sabine STEIN ER: Die schönsten Routen im Harz. München: Bruckmann S., Abb. 20. KRÜGER, Matthias: Soziale Verantwortung - von Menschen für Menschen. In: Landkreis Helmstedt. Deutsche Landkreise im Portrait. Red.: Gerhard KILIAN. 4., völlig neue Ausg. Oldenburg: Verl. f. Kommunikation u. Wirtschaft (Edition "Städte - Kreise - Regionen"). S , Abb. 21. LoRIN, Uwe: Profile des Landkreises Osterode am Harz. 1. Auf). Bertsdorf-Hörnitz: Becker S., Abb. (Profile - Bürger unserer Zeit) 22. MEIBEYER, Wolfgang: Die Dörfer und Höfe in der Vogtei Wahrenholz. In: Gifhorner KreiskaI [2003]. S , 7 Abb. 23. Niedersächsische Landesbibliothek. Niedersächsische Bibliographie. Regionalbibliographie für die Bundesländer Niedersachsen und Bremen. Bd. 18. Berichtsjahr Bearb. v. Siegfried HÜBNER und Ulrich BREDEN. (Hannover: Nds. Landesbibl.). Hameln: Niemeyer XXXVI, 519 S. [1. Allgemeines, "atur, Volkskunde, Freizeitgestaltung, Sport, Siedlung, Gesellschaft und Statistik, Staat und Politik, Recht, Verwaltung und Militär, Soziales und Gesundheit, Land-, Forstwirtschaft und Fischerei, Wirtschaft, Kultur, Künste, Religion und Kirche, Geschichte, Landeskunde, Person, Familie. 2. Verfasser- und Titelregister, Orts-, Personen- und Saehrcgistcr.]
188 Bibliographie zur Braunschweigischen Landesgeschichte NIELBOCK, Ralf: Der Geopark Harz. In: Heimatbl. f. d. süd-westl. Harzrand S , Abb. 25. REUSCHEL, Andreas: Der "Dieckhoffturm" auf dem Ebersnacken im Vogler. In: Jb. f. d. Landkr. Holzminden. Bd [2003]. S ,6 Abb. 26. Samtgemeinde Asse. Informationen für Gäste und Bürger. Nordhorn: BVB-Verlagsgesellschaft S., Abb. 27. Samtgemeinde Bad Grund Harz. Info. [Hrsg. in Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Bad Grund Harz]. Nordhorn: BVB-Verlagsgesellschaft S., Abb. 28. SCHMIDT, Marion, Thorsten SCHMIDT: Wemigerode. Ein Führer durch die bunte Stadt am Harz. 7. Auf!. Wemigerode: Schmidt S., Abb. 29. SCHRADER, Henning: Eine Reise durch den Landkreis - Städte und Gemeinden im Profil. In: Landkreis Helmstedt. Deutsche Landkreise im Portrait. Red.: Gerhard KI L1AN. 4., völlig neue Ausg. Oldenburg: Verl. f. Kommunikation u. Wirtschaft (Edition "Städte - Kreise - Regionen"). S , Abb. 30. SCHULZE, Peter: Mit Davidsschild und Menora. Bilder jüdischer Grabstätten in Braunschweig, Peine, Homburg, Salzgitter und Schöningen. Ausstellung Braunschweig S., Abb. (Regionale Gewerkschaftsblätter 18) 31. SEELIGER, Matthias: Bibliographie zur Geschichte des Landkreises Holzminden, 2002/2003 «mit Nachträgen». In: Jb. f. d. Landkr. Holzrninden. Bd [2003]. S STANDKE, K.-H. c.: Das Wasser - Geschichte des lebenswichtigen Elements. In Zukunft ein Wirtschaftsgut? In: Braunschw. KaI [2003]. S , Abb. 33. THoMAE, Matthias: Geologie und Tourismus - Geopark Harz - Braunschweiger Land - Ostfalen. In: Sachsen-Anhalt/ Landesamt f. Geologie und Bergwesen. Bd [2003]. S Unterwegs im Harz. Leipzig: VSR-Verlag S., Abb. 35. Das Weserbergland. Bilder und Texte aus einer erlebnisreichen Kulturlandschaft. Fotos v. Sigurd ELERT. Holzminden: Mitzkat S., Abb. 36. WOLTER, Manfred: Erlebnis- und Freizeitziele - Lüneburger Heide, Harz, Weserbergland, Werra- und Leinetal, Eichsfcld, Kyffhäuser und Thüringer Wald. Petersburg: Imhof S., Abb. 37. ZEIDLER, Sascha: Deutschlands nördlichstes Mittelgebirge. Der Harz. In: Lebensstil. 2003,20. S Quellenkunde und Historische Hilfswissenschaften 38. ARNOLDT, Hans-Martin: Aus der Frühzeit der regionalen Kartographie: Die Arbeiten des Geometers Caspar Dauthendey und seine Karte des Herzogtums Braunschweig von In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003]. S ,5 Abb. 39. BREDE, Hermann: Die Motiv-Darstellungen auf den Ausbcutetalern der Grube "Segen Gottes" von 1761 und In: Allgern. Harz-Berg-Kal [2003]. S , Abb. 40. Ecc1esiastica officia. Gebräuchebuch der Zisterzienser aus dem 12. Jahrhundert. Lateinischer Text nach den Handschriften Dijon 114, Trient 1711, Ljubljana 31, Paris
189 192 EwaSchmid 4346 und Wolfenbüttel Codex Guelferbytanus Langwaden: Bernardus-Verl S. (Quellen u. Studien z. Zisterzienserliteratur 7) 41. KELLNER-DEPNER, Christine: Außergewöhnliche Münzfunde aus dem Landkreis Peineo In: Die Kunde. N. F. 54. S ,5 Abb. 42. LAMPE, Wolfgang: Das Bergarchiv Clausthal. In: Allgern. Harz-Berg-Kal [2003]. S , Abb. 43. RABBOW, Arnold: Neues braunschweigisches Wappenbuch. Die Wappen und Flaggen der Gemeinden und Ortsteile in den Stadt- und Landkreisen Braunschweig, Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine, Salzgitter, Wolfenbüttel, Wolfsburg. Braunschweig: Braunschw. Zeitungsverl S., Abb. 44. SCHWARZ, Ulrich: Die Rechnungen des Wolfenbütteler Amtmanns Hilbrand van dem Dyke In: Auf dem Weg zur herzoglichen Residenz. Wolfenbüttel im Mittelalter, hrsg. V. Ulrich SCHWARZ. Braunschweig: Appelhans S. (Quellen U. Forschungen Z. Braunschw. Landesgesch. 40). S , Abb. 45. SEELIGER, Matthias: Aus der Bildsammlung des Holzmindener Stadtarchivs. Luftaufnahmen aus den 1950er Jahren. In: Jb. f. d. Landkr. Holzminden. Bd [2003]. S ,7 Abb. 46. SEELIGER, Matthias: Bauakten (1826 bis 1925) der Kreisdirektion im Stadtarchiv Holzminden. Das Beispiel Mühlenberg. In: Jb. f. d. Landkr. Holzminden. Bd [2003]. S ,8 Abb. 47. SISSAKIS, Manuela: Territoriale Rechnungslegung in der Frühen Neuzeit. Quellenkritische Anmerkungen anhand der Kammerrechnungen des 16. Jahrhunderts im Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel. In: Braunschweig-Wolfenbüuel in der Frühen Neuzeit. Hrsg. V. Christian LIPPELT U. Gerhard SCHILDT. Braunschweig: Appelhans (Quellen U. Forschungen Z. Braunschw. Landesgesch. 4 t). S Urkundenbuch der Stadt Braunschweig. Bd Bearb. V. Josef DOLLE. Hannover: Hahn S. (Veröff. d. Hist. Komm. f. Nds. U. Bremen 215) Allgemeine Geschichte in zeitlicher Reihenfolge 49. GAUDZINSKI, Sabine: Die Rentierjäger von Salzgitter-Lebenstedt. Zur Jagd der Neandertaler. Gelsenkirchen S., Abb. (Archäologie d. Eiszeit 8) 50. WALLBRECHT, Andreas: Nördlichste Burganlage der Vorrömischen Eisenzeit. Die Scheverlingenburg von Walle, Ldkr. Gifhorn. In: Die Kunde. N. F S , Abb. 51. FRÜHAUF, Wolfgang: Braunschweiger Epochen im Bereich der wieder ausgebauten Burgruine Hohnstein. In: Braunschw. KaI [2003]. S , Abb. 52. HESKE, Immo: Herausragende Fundobjekte von der Hünenburg. In: Braunschw. Landesmuseum. Informationen U. Berichte [2003]. S , Abb. 53. WIETHOLD, Julian: Emmer, Hirse und Seebinse: Verkohlte Pflanzenreste von der Hüncnburg. In: Braunschw. Landesmuseum. Informationen U. Berichte [2003]. S , Abb. 54. HESKE, Immo: Die Hünenburg: Neue archäologische Forschungen In: Braunschw. Landesmuseum. Informationen U. Berichte [2003]. S , Abb.
190 Bibliographie zur Braunschweigischen Landesgeschichte HESKE, Immo: Die Hünenburg bei Watenstedt, Ldkr. Helmstedt. Vorbericht über die Prospektionsgrabungen der Jahre 1998 bis In: Nachrichten aus Nds. Urgesch. Bd S ,13 Abb. 56. POSSELT, Martin: Spurensuche mit dem Magnetometer an der Hünenburg. In: Braunschw. Landesmuseum. Informationen u. Berichte [2003]. S , Abb. 57. STEINMETZ, Wolf-Dieter: Die Hünenburg - Geschichte ihrer Erforschung. In: Braunschw. Landesmuseum. Informationen u. Berichte [2003]. S. 8-14, Abb. 58. STEINMETZ, Wolf-Dieter: Hünenburg und Hohseoburg-Identifikation. In: Braunschw. Landesmuseum. Informationen u. Berichte [2003]. S , Abb. 59. WILLROTH, Karl-Heinz: Die Erforschung der Hünenburg bei Watenstedt. Ein vorläufiges Resümee. In: Braunschw. Landesmuseum. Informationen u. Berichte [2003]. S , Abb. 60. GRUNWALD, Lutz: Schutz und Trutz in eindrucksvoller Manier - die Befestigungsanlagen im Reitlingstal. In: Nachrichten aus Nds. Urgesch. Bd S , 9 Abb. 61. HEINE, Hans-Wilhelm: "... und buweden vor 5 nige slote... " In: Archäologie i. Nds. Bd S. 5963, 6 Abb. 62. GESCHWINDE, Michael: Angriff im Morgengrauen? In: Archäologie i. Nds. Bd S , 4 Abb. 63. BUDDE, Thomas: Aufschlußreiche Flaschenfunde aus dem Peiner Stadtgraben. In: Archäologie i. Nds. Bd S , 5 Abb. 64. LAUB, Gerhard: Zu den Grabungen auf Sudburger Gelände bei Goslar vor 70 Jahren. In: Unser Harz. Jg S , 5 Abb. 65. SCHUBERT, Ernst: Die ottonische Kirche in Memleben. In: Sachsen u. Anhalt. Bd /2003.S HEHL, Ernst-Dieter: Otto der Große, Magdeburg und Europa. Erträge und Perspektiven einer Ausstellung. In: Sachsen u. Anhalt. Bd /2003. S HUCKER, Bernd Ulrich: Otto IV. Der wiederentdeckte Kaiser. Eine Biographie. Frankfurt a. M.: Insel-Verl S., Abb. 68. Heinrich der Löwe. Herrschaft und Repräsentation. Hrsg. v. Johannes FRIED. Ostfildem: Thorbecke VI, 449 S. (Vorträge u. Forschungen, Konstanzer Arbeitskreis f. mittelalterliche Gesch. 57) 69. OHAlNSKI, Uwe: Amold von Dorstadt. Ostfälischer Adliger im Umkreis Friedrich Barbarossas und Heinrichs des Löwen - Stifter des Augustinerchorfrauenstiftes Dorstadt. In: Braunschw. Jb. f. Landesgesch. Bd S ELfERS, Bettina: Gertrud von Braunschweig (gest. 1117). Die Akkumulation von Macht durch Herkunft und Heirat. In: Regieren, Erziehen, Bewahren S ZUNKER, Diana: Adel in Westfalen: Strukturen und Konzepte von Herrschaft ( ). Husum: Matthiesen S.(Historische Studien 472) [Braunschweig-Bezug PETKE, Wolfgang: Reichstruchseß Gunzelin (+1255) und die Ministerialen von Wolfenbüttel-Asseburg. In: Auf dem Weg zur herzoglichen Residenz. Wolfenbüttel im
191 194 EwaSchmid Mittelalter, hrsg. v. UIrich SCHWARZ. Braunschweig: Appelhans S. (Quellen u. Forschungen z. Braunschw. Landesgesch. 40). S , Abb. 73. Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch. Teilbd. 1: Dynastien und Höfe; Teilbd. 2: Residenzen. Hrsg. v. Werner PARAVICINI, bearb. v. Jan HIRSCHBIEGEL u. Jörg WETTLAUFER. Ostfildem: Thorbecke , 721 S. (Residenzenforschung 15,1) 74. Mittelalter im Weserraum. [Hrsg.: Stift Fischbeck. Red.: Dagmar KÖHLER.] Holzminden: Mitzkat S., Abb. (Veröff. aus dem Stift Fischbeck 1) 75. SCHWARZ, Gesine: Männersache, Frauensachen. Sachgut des spätmittelalterlichen Bürgertums und Adels nördlich des Harzes nach schriftlichen Quellen. In: Tradition und Erinnerung in Adelsherrschaft und bäuerlicher Gesellschaft, hrsg. v. Werner Rö SENER. Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht 2003, S , Abb. 76. Blutige Weichenstellung. Massenschlacht und Machtkalkül bei Sievershausen Hg.: Gerd BIEGEL, Hans-Jürgen DERDA. Mit Bcitr. v. Peter BESSIN... Braunschweig: Braunschw. Landesmuseum S., Abb. (Veröff. d. Braunschw. Landesmuseums 107) 77. BORGGREFE, Heiner, Bettina MARTEN: "Pensionario alemano de su Magestad". Herzog Erich 11. von Braunschweig-Calenberg in den Diensten König Philipp 11. von Habsburg nach unveröffentlichten Quellen im spanischen Zentralarchiv zu Simancas. In: Kunst und Repräsentation. Studien zur europäischen Hofkultur im 16. Jahrhundert. Hrsg. v. Heiner BORGGREFE u. Barbara UPPENKAMP. Bamberg: Weserrenaissance-Museum Schloß Brake (Materialien z. Kunst- u. Kulturgesch. in Nord- u. Westdeutschland 29). S , 18 Abb. 78. KEIL, loge: Von Ocularien, Perspicillen und Mikroskopen, von Hungersnöten und Friedensfreuden, Optikern, Kaufleuten und Fürsten. Materialien zur Geschichte der optischen Werkstatt von Johann Wiesel ( ) und seiner Nachfolger in Augsburg. Augsburg: Wißner-Veriag S., CD-ROM. (Dokumenta Augustana 13) [Braunschweig-Bezug] 79. STEINERT, Mark Alexander: Die alternative Sukzession im Hochstift Osnabrück. Bischofswechsel und das Herrschaftsrecht des Hauses Braunschweig-Lüneburg in Osnabrück Osnabrück: Verein f. Gesch. u. Landeskunde von Osnabrück S. (Osnabrücker Geschichtsquellen u. Forschungen 47) 80. FOUCHER-WOLNIEWICZ, Christiane: La fete -Ie pouvoir -Ie prince. Partage des nourritures, manieres conviviales et art de la table comme instruments de gouvernements. Une approche du pouvoire absolu par le biais de la politique de prestige de Loius XIV et du Duc Antoine-Ulric de Brunswick-Wolfenbüttel. Villeneuve d'ascq: Presses Univ. du Septentrion S., Abb. 81. HERFoRDT, Ewa: Die fremden Gäste los seyn: Die Präsenz der Franzosen und ihre Wahrnehmung im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel während des Siebenjährigen Krieges ( ). In: Braunschweig-Wolfenbüttel in der Frühen Neuzeit. Hrsg. v. Christian LIPPELT u. Gerhard SCHILDT. Braunschweig: Appelhans (Quellen u. Forschungen z. Braunschw. Landesgesch. 41). S LEVIN, Leonid: Macht, Intrigen und Verbannung. Welfen und Romanows am russischen Zarenhof des 18. Jahrhunderts. Deutsch: Irina PONOMAREWA, Bearb.: Fabian DAMM. 2., neu überarb. Aufl. Göttingen: Matrix-Media-Verl S., Abb.
192 Bibliographie zur Braunschweigischen Landesgeschichte STRATHMANN, Gabrie\e: Das ehemalige Herzogtum Braunschweig unter dem Aspekt der Auswanderung - bei besonderer Berücksichtigung der westlichen Landkreise Holznlinden und Gandersheim - von 1750 bis Braunschweig: Appelhans S. (Beih. z. Braunschw. Jb. 17) 84. HODEMACHER, Jürgen: Das Gefecht bei Ölper. Nach Tagebuchaufzeichnungen des Johann Grüttermann und des Generals von Wachholtz. In: Braunschw. Kal [2003). S , Abb. 85. JANETZKE, Norbert: der Verlust der Mitte. Der "Geist des Aufstandes" und Umbruchs Anfang des 19. Jahrhunderts am Beispiel der Vormärzerhebung in Osterode am Harz. In: Nds. Jb. f. Landesgesch. Bd S , Abb. 86. REINBOTH, Fritz: Zeitgenössische Berichte über den Invasionsversuch des Herzogs earl II. von Braunschweig bei Ellrich am 30. November In: Beitr. z. Gesch. aus Stadt u. Kreis Nordhausen. Bd S AGHTE, Kai: Erlebnisse des Philosophen Theodor Lessing bei Kriegsbeginn 1914 in Goslar. In: Unser Harz. Jg S , Abb. 88. ROLOFF, Ernst-August: Wie braun war Braunsehweig. HitIer und der Freistaat Braunschweig. Braunschweig: Braunschweiger Zeitung S., Abb. 89. GRÖCHTEMEIER, Markus: "Die Gedanken sind frei?" Gelenkte Hcimatpflege und Volksbildung in der NS-Zeit. In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003). S KNOLLE, Friedhart: NS-Rüstungsbetriebe in der Bergbaufolge\andschaft Sperrluttertal: die Metallwerke Silberhütte, Schmiedag und Odertal. In: Allgern. Harz-Berg Kal [2003). S , Ahh. 91. VÖGEL, Bernhild: "Wir waren fast noch Kinder". Die Ostarbeiter vom Ramme\sberg. Goslar: Verl. Goslarsche Zeitung S., Abb. (Rammelsberger Forum 2) 92. JANZ, Wolfgang: Erinnerungsstätten an Unmenschlichkeit des Nationalsozialismus im Landkreis Goslar. Goslar: Verein Spurensuche Goslar e. V S., Abb. 93. TECH, Andrea: Arbeitserziehungslager in Nordwestdeutschland Mit zwei Abbildungen. Hrsg.: Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung und wissenschaftlicher Beirat für Gedenkstättenarbeit. Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht S. (Bergen-Be\sen Schriften 6) 94. Industrie und Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Mercedes Benz - VW - Reichswerke Hermann Göring in Linz und Salzgitter. Hrsg.: Gabriella HAUCH. Innsbruck: Studien-Verl S., Abb. (Studien z. Gesellschafts- u. Kulturgesch. 13) 95. Zwangsarbeit und Kriegswirtschaft im Lande Braunschweig Hrsg. v. Gudrun FIEDLER, Hans-Ulrich LUDEWIG. Braunschweig: Appelhans S., Abb. (Quellen u. Forschungen z. Braunschw. Landesgesch. 39) [Mit Beitr. von: Gudrun Fiedler, Joanna Licdke, Karl Licdke, Hans-Ulrich-Ludewig, Anke Menzel Rathcrt, Heike Petry, Nonnan-Mathias Pingel, Joachim Schmid, Ewa Schmid) 96. OERTEL, Ulrich: Luftschutzmaßnahmen in Peine mit Hinweisen auf den Luftschutzbunker der "Bauart Winkel" im Peiner Walzwerk. In: IBA-Informationen S , Abb. 97. Neubeginn und Entwicklung politischen Lebens nach Hrsg.: Braunschw. Landschaft e. V. Red.: Reinhard FÖRSTERLING. Braunschweig S. (Braunschw. Landschaft im Blick 3)
193 196 Ewa Schmid 98. EDER, Ekkehard: Abschied von der Osteroder Kaserne. In: Allgern. Harz-Berg-Kal [2003]. S , Abb. 99. HILDEBRANDT, Werner: Ein weiteres Relikt des Kalten Krieges ist auf den Harzer Höhen verschwunden. In: Allgern. Harz-Berg-Kal [2003]. S , Abb OWCZARSKI, Rolf: Blick in die Vergangenheit In: Landkr. Helmstedt. Kreisbuch [2003]. S , Abb STERL Y, Marita: Grenzenlos - Wege zum Nachbarn. In: Landkreis Helmstedt. Deutsche Landkreise im Portrait. Red.: Gerhard KILIAN. 4., völlig neue Ausg. Oldenburg: Verl. f. Kommunikation u. Wirtschaft (Edition "Städte - Kreise - Regionen"). S , Abb. Rechts-, Verfassungs- und Verwaltungs geschichte 102. BAUMANN, W.: Braunschweiger Fehde gegen Nordhausen. Die befestigte Stadt hielt stand. Rechtsstreit zwischen den beiden Städten. In: Nordhäuser Nachrichten. Bd S BECKMANN, Jens: Die Presseberichterstattung über die Justiz in Braunschweig im Zweiten Weltkrieg. Braunschweig: Verf S BERNHARDT, Markus: Politische Justiz? - Gerichtsurteile zum Generalstreik im April 1919 in Braunschwcig. In: Braunschw. Jb. f. Landesgesch. Bd S BJARSCH, Hans-Joachim: Bausteine des Kreises. Ein Beitrag zur Kreisgeschichte nach In: Landkr. HeImstedt. Kreisbuch [2003]. S , Abb BÖRNER, Karl-Heinz: Grenzschmuggel im Unterharz in den Jahren der Zollvereinsgründung. In: Allgern. Harz-Berg-Kal [2003]. S BRÜCK, Alexandra: Die Polizeiordnung Herzog Christians von Braunschweig-Lünneburg vom 6. Oktober Frankfurt a. M.: Lang IX, 288 S. (Rechtshist. Reihe 276) 108. Das Goslarer Stadtrecht. Hrsg.: Maik LEHMBERG. Gütersloh: Eimer S., Abb. (Beitr. z. Gesch. d. Stadt Goslar; Goslarer Fundus 52) 109. Helmstedter Kreisdirektoren, Oberkreisdirektoren und Landräte von 1833 bis In: Landkr. Helmstedt. Kreisbuch [2003]. S JACOBS, Rainer: Braunschweigische Militärverwaltung im 17. und 18. Jahrhundert. In: Braunschweig-Wolfenbüttel in der Frühen Neuzeit. Hrsg. v. Christi an LIPPELT u. Gerhard SCHILDT. Braunschweig: Appelhans (Quellen u. Forschungen z. Braunschw. Landesgesch. 41). S LIPPELT, Christian: Etzliche ursachen des verderbens der armen leute im ambt Wulffenbuttel. Edition und Kommentar. In: Braunschw. Jb. f. Landesgesch. Bd S LIPPELT, Christian: Hoheitsträger und Wirtschaftsbetrieb: Die herwgliche Amtsverwaltung zur Zeit der Herzöge Heinrich der Jüngere, Julius und Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel ( ). In: Braunschweig-Wolfenbüttel in der Frühen Neuzeit. Hrsg. v. Christian LIPPELT u. Gerhard SCHILDT. Braunschweig: Appelhans (Quellen u. Forschungen z. Braunschw. Landesgesch. 41). S
194 Bibliographie zur Braunschweigischen Landesgeschichte Niedersächsische Juristen. Ein historisches Lexikon mit einer landesgeschichtlichen Einführung und Bibliographie hrsg. v. Joachim RÜCKERT... Unter Mitarb. v. Andre DEPPING. Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht LV, 606 S. [Braunschweig-Bezug] 114. OHAINSKI, Uwe: Die Landtage des Fürstt!ntums Braunschweig-Wolfenbüttcl von 1568 bis Tabellarische Zusammenstellung der Verhandlungen und Abschiede aus gedrucktem und archivalischem Material. Hannover: HiKo o. S. (Niedersächsische Landtags- und Ständegesch.) 115. SCHILDT, Bernd: Inhaltliche Erschließung und ideelle Zusammen führung der Prozessakten des Reichskammergerichts mittels einer computergestützten Datenbank. In: Zs. f. Neuere Rechtsgesch. Jg S SOHN, Werner: Im Spiegel der Nachkriegsprozesse. Die Errichtung der NS-Herrschaft im Freistaat Braunschwcig. Braunschwcig: Appelhans S., Abb Zwischen Aufklärung, Policey und Verwaltung. Zur Genese des Medizinalwesens Hrsg.: Bcttina WAHRIG und Werner SOHN. Wiesbaden: Harrassowitz S. (Wolfenbütteler Forschungen 102) Kirchengeschichte 118. BOCKISCH, Sabine: Die Braunschweigische Landeskirche - geistliche Belange und weltliche Administration in der Frühen Neuzeit. In: Braunschweig-Wolfenbüttel in der Frühen Neuzeit. Hrsg. v. Christian LIPPELT u. Gerhard SCHILDT. Braunschweig: Appelhans (Quellen u. Forschungen z. Braunschw. Landesgesch. 41). S BUFF, Joachim: Kostbare Jahre. Geschichte der Ev.-luth. Kreuzkirche Osterode am Harz im gesellschaftlichen Wandel Oausthal-Zellerfeld: Pieper S., Abb Bugenhagen und Braunschweig , 475 Jahre Reformation in Braunschweig, Begleitheft zur Ausstellung in der Brüdernkirche. Braunschweig: Predigerseminar ,8 S., Abb Essen und die sächsischen Frauenstifte im Frühmittclalter. Hrsg. v. Jan GERCHOW u. Thomas SCHILP. 1. Auf!. Essen: Klartext Verlag S., Abb. (Essen er Forschungen z. Frauenstift 2) (Braunschweig-Bezug] 122. Evangelische Landeskirchen der Harzterritorien in der frühen Neuzeit. [Tagung des Arbeitskreises Kirchengeschichte des Harzvereins für Geschichte und Altertumskunde... am 15. September 2001 im Tagungsheim der Evangelischen Landeskirche im Kloster Drübeck bei IJsenburg] Hg.: Christof RÖMER. 1. Aufl. Berlin: Lukas-Verl S.: Ill., Kt. (Harz-Forschungen 15) 123. Die Geschichte der Reformation in der Stadt Braunschweig. Beiträge von Klaus JÜR GENS und Wolfgang A. JÜNKE. Wolfenbüttel: Landeskirchenamt S. (Quellen u. Beitr. z. Gesch. d. Evang.-luth. Landeskirche in Braunschweig 13) 124. HEITZMANN, Christian: "Ganze Bücher von Geschichten". Bibeln aus Niedersachsen. Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek S., Abb. (Ausstellungskataloge d. Herzog August Bibliothek 81)
195 198 EwaSchmid 125. SCHÖN BERG, Lore: Zur Seelsorge an Todeskandidaten in der Strafanstalt Wolfenbüttel von 1935 bis In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003]. S SIMON, Christian: Die braunschweigische Landeskirche und das Volksschulwesen in Niedersachsen nach Wolfenbüttel: Landeskirchenamt S. (Quellen u. Beitr. z. Gesch. d. Evang.-Iuth. Landeskirche in Braunschweig 11) 127. WAGNITZ, Friedrich: Die ersten Bischöfe der Braunschweigischen Landeskirche. Wolfenbüttel: Landeskirchenamt S., Abb. (Quellen u. Beitr. z. Gesch. d. Evang.-Iuth. Landeskirche in Braunschweig 12) Wirtschafts- und Verkehrs geschichte Bergbau, Hütten 128. ALPER, Götz: "Johanneser Kurhaus". Ein mittelalterlicher Blei-/ Silbergewinnungsplatz bei Clausthal-Zellerfeld im Oberharz. Mit Beitr. v. Christiane RÖMER-STREHL. Rahden/ Westf.: Leidorf S., Abb. (Materialhefte z. Ur- u. Frühgesch. Nds. R. A: Monographien 32) 129. ARTELT, Peter: Der Harzer Bergbau während der napoleonischen Zeit. In: Unser Harz. Jg S ,5 Abb FESSNER, Michael: Die Schmelzhütten am Rammelsberg bei Goslar an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert. In: Braunschweig-Wolfenbüttel in der Frühen Neuzeit. Hrsg. v. Christian LIPPELT u. Gerhard SCHILDT. Braunschweig: Appelhans (Quellen u. Forschungen z. Braunschw. Landesgesch. 41). S , Tab FISCHER, Hermann: Drei ehemalige Öischiefer-Abbaugebiete im Bereich der Ortschaft Schandelah. In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003]. S , Abb HESKE, Immo: Frühe Bronzegießer am Nordharz. In: Archäologie i. Nds. Bd S , 2 Abb KOCH, Michael: Experimentelle Archäologie und Schlackenbolde auf Domäne Heidbrink. Versuche zur Rekonstruktion des mittelalterlichen Rennfeuerverfahrens. In: Jb. f. d.landkr. Holzminden. Bd [2003]. S , 15 Abb KÜNTZEL, Thomas [u. a.]: 30 m unter Tage. In: Archäologie i. Nds. Bd S , 4 Abb KURTH, Horst: Der Harz, seine natürlichen Reichtümer und ihre Nutzung. Mengersgereuth-Hämmern S., Abb. (Freie Schriftenreihe/ Europäischer Köhlerverein 7) 136. LAUB, Gerhard: Nickel im Harzgebiet - Wunschbild und Wirklichkeit. In: Allgern. Harz-Berg-Kal [2003]. S , Abb LEPPER, Jochen [u.a.]: Eisenerz-Vorkommen im Solling, Reinhardswald und Bramwald (Südniedersachsen und Nordhessen) und deren geochemische Charakterisierung im Rahmen eines Archäometallurgie-Projekts. In: Nachrichten aus Nds. Urgesch. Bd S ,3 Abb MÜLLER, Karl: Die Entstehung des Roteisensteins bei Lerbach. In: Allgern. Harz Berg-Kai [2003]. S , Abb.
196 Bibliographie zur Braunschweigischen Landesgeschichte NIETZEL, Hans-Hugo: Georg Andreas Steltzner: Von Wasserleitungen und Teichbau und dem Hutthaler Widerwaagesystem. Aufzeichnungen zur Oberharzer Wasserwirtschaft. Clausthal-Zcllcrfcld: Obcrharzer Bergwerksmuscum S., Abb PFLAUMANN, Ingrid: Ocr Maaßcncr Gaipel bei Lautcnthal. In: Allgcm. Harz-Berg Kal [2003]. S , Abb HÄDICKE, Manfred: Die Innerstetalsperre, ein altes Bergbaugebiet. In: Allgem. Harz Berg-KaI [2003]. S , Abb RADDAY, Helmut: Die Bergbau- und Hüttenmuseen im Harz. Clausthal-Zellerfeld: Pieper S., Abb WEDEMEYER, Gerhard: Ein Oberharzer Bergmann erzählt «6»: Januar/ Februar 1985: Im Kaiser-Wilhelm-Schacht und Wiemannsbucht-Schacht sind die Förderkörbe im Eis festgefroren. In: Allgem. Harz-Berg-Kal [2003]. S , Abb. Land- und Forstwirtschaft, Industrie, Handel Jahre Volkswagen Werbung. Es gibt Formen, die man nicht verbessern kann. Berlin: DDB Berlin Werbeagentur S., Abb Jahre Geschichte der Braunschweigischen Maschinenbauanstalt BMA. - Braunschweig: BMA S., 1 CD-ROM. (Informationen BMA) 146. DELFs, Jürgen: Hut und Weide. Waldweide im Kreis Gifhorn und in der Südheide. Gifhorn: Kreisarchiv S., Abb.(Schriftenreihe d. Kreisarchivs Gifhorn 21) 147. EDELMANN, Heidrun: Heinz Nordhoff und Volkswagen. Ein deutscher Unternehmer im amerikanischen Jahrhundert. Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht S., Abb ELTENBACH, Dietrich: Die Domäne der Herzoglichen Braunschweigischen Kammer in Hessen. In: Uhlenklippen-Spiegel. Nr S , Abb FELLECKNER, Stefan: Handwerk gestern und heute. Betriebsgeschichten aus der Gifhorner Region. AG Handwerksgeschichte des Kreisarchives Gifhorn. Gifhorn: Landkr. Gifhorn S., Abb. (Materialien z. Archivarbeit 6) 150. GERSDORF, Bernd: Salzgitter AG - Wissenskooperation mit der Region. In: Braunschw. KaI [2003]. S , Abb Großraum Braunschweig. Forstlicher Rahmenplan. Wolfenbüttel: Nds. Forstplanungsamt S., Abb. (Schriftenreihe Waldentwicklung in Nds. 11) 152. Industrie und Mensch in Südniedersachsen vom 18. bis zum 20. Jahrh. Hrsg. v. Birgit SCHLEGEL. Duderstadt S., Abb. (Schriftenreihe d. Arbeitsgem. Südniedersächsischer Heimatfreunde 16) 153. JAHNS, Wemer: Die Wirtschaft im Braunschweiger Weserkreis von 1816 bis 1839 im Spiegel des Exports nach Bremen. In: Jb. f. d. Landkr. Holzminden. Bd [2003]. S Käfer ade: Das Buch von Volkswagen zum Bandablauf des letzten Käfer in Mexiko. [Text: Jörn RADTKE, Markus ROLoFF]. Wolfsburg: Volkswagen AG, Konzemkommunikation-Unternchmensarchiv S., Abb KOHLRAUSCH, Jürgen: Arbeit mit Phosphor und Blei. Die Zündholzherstellung in Benneckenstein. In: Allgem. Harz-Berg-Kal [2003]. S , Abb.
197 200 EwaSchmid 156. KRÄMER, Martin: Etwas besseres finden wir überall - Grünenplaner Wirtschaftsflüchtlinge in Osteuropa, In: Jb. f. d. Landkr. Holzminden. Bd [2003]. S , 2 Abb KRAUS, Wilfried: Königslutters Konservenindustrie. In: Braunschw. KaI [2003]. S KRUEGER, Thomas: Frühindustrialisierung und Forstwirtschaft im Weserdistrikt. In: Braunschweig-Wolfenbüttel in der Frühen Neuzeit. Hrsg. v. Christian LIPPELT u. Gerhard SCHII.DT. Braunschweig: Appelhans (Quellen u. Forschungen z. Braunschw. Landesgesch. 41). S KULHAWY, Andreas: Das Herzogliche Leihhaus Braunschweig als Instrument der Modernisierung in Braunschweig-Wolfenbüttel(1832 bis 1918). In: Braunschweig-Wolfenbüttel in der Frühen Neuzeit. Hrsg. v. Christian LIPPELT u. Gcrhard SCHILDT. Braunschweig: Appelhans (Quellen u. Forschungen z. Braunschw. Landesgesch. 41). S MÄRZ, Olaf: Kleinstadt - Flecken - Dorf. Soziale und ökonomische Übergänge ländlicher Siedlungsformen im Braunschweiger Weserdistrikt in der Mitte des 18. Jahrhunderts. In: Braunschweig-Wolfenbüttel in der Frühen Neuzeit. Hrsg. v. Christian LIPPELT u. Gerhard SCHILDT. Braunschweig: Appelhans (Quellen u. Forschungen z. Braunschw. Landesgesch. 41). S , Abb MAll TZ, Horst: Die Lefeldt-Entrahmungszentrifuge. In: Braunschw. KaI [2003]. S NITscHKE, Claudius: Handwerk - mit Tradition in die Zukunft. In: Landkreis Helmstedt. Deutsche Landkreise im Portrait. Red.: Gerhard KILIAN. 4., völlig neue Ausg. Oldenburg: Verl. f. Kommunikation u. Wirtschaft (Edition "Städte - Kreise - Regionen"). S , Abb POIIL, Jörg: Dienstleistungen auf dem Vormarsch. In: Landkreis Helmstedt. Deutsche Landkreise im Portrait. Red.: Gerhard KILIAN. 4., völlig neue Ausg. Oldenburg: Verl. f. Kommunikation u. Wirtschaft (Edition "Städte - Kreise - Regionen"). S , Abb POHL, Jörg: Großbetriebe und Mittelstand - Stützpfeiler der Wirtschaft. In: Landkreis Helmstedt. Deutsche Landkreise im Portrait. Red.: Gerhard KILIAN. 4., völlig neue Ausg. Oldenburg: Verl. f. Kommunikation u. Wirtschaft (Edition "Städte - Kreise - Regionen"). S , Abb POHL, Jörg: Wirtschaftsförderung und "Pro Helmstedt" -leistungsstarke Partner. In: Landkreis Helmstedt. Deutsche Landkreise im Portrait. Red.: Gerhard KILIAN. 4., völlig neue Ausg. Oldenburg: Verl. f. Kommunikation u. Wirtschaft (Edition "Städte - Kreise - Regionen"). S , Abb Regionalbericht 2002, Wirtschaftsraum Braunschwcig, Salzgitter, Wolfsburg. Aktuelle wirtschaftliche Entwicklung in den kreisfreien Städten Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg, in den Landkreisen Helmstedt, Gifhorn, Goslar, Peine und Wolfenbüttel sowie in deren Städten und Gemeinden (Samtgemeinden). Von Hans-Ulrich JUNG. Unter Mitarbeit v. Klaus-Jürgen HENTSCHEL. Hannover: Nds. Institut f. Wirtschaftsforschung VIII, 187 S RICHTER, Ralf: Ivan Hirst: Britischer Offizier und Manager des Volkswagenaufbaus. Wolfsburg: Unternehmensarchiv d. Volkswagen AG, S., Abb. (Historische Notate. Schriftenreihe d. Unternehmensarchivs d. Volkswagen AG 8)
198 Bibliographie zur Braunschweigischen Landesgeschichte SEBBESSE, Wolf-Dieter: Die landwirtschaftlichen Betriebe im Dorfe Hessen bis zum Jahre In: Uhlenklippen-Spiegel. Nr S , Abb SIEMERS, Victor-L.: Braunschweigs Papiermüller als "Anhänger alten Herkommens"? Die Handpapiermacherei im 18. und einige Ursachen ihres Niedergangs im 19. Jahrhundert. In: Braunschweig-Wolfenbüttc1 in der Frühen Neuzeit. Hrsg. v. Christian LIPPELT u. Gerhard SCHILDT. Braunschweig: Appelhans (Quellen u. Forschungen z. Braunschw. Landesgesch. 41). S SI EMERS, Victor-L.:Die Papierfabrik Gebr. Vieweg in Wendhausen bei Braunschweig « In: Braunschw. Jb. f. Landesgesch. Bd S SPILIOTIS, Susanne-Sophia: Verantwortung und Rechtsfrieden. Die Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft. Frankfurt a. M: Fischer-Taschenbuch-Verl S., Abb. [Braunschweig-Bczug] 172. STÜCKE, Otto: Strukturwandel in der Landwirtschaft. In: Landkreis Helmstedt. Deutsche Landkreise im Portrait. Red.: Gerhard KILIAN. 4., völlig neue Ausg. Oldenburg: Verl. f. Kommunikation u. Wirtschaft (Edition "Städte - Kreise - Regionen"). S , Abb Süd-Ost-Niedersachsen. Wirtschaftsstandort und Kulturraum. Projektleitung: Jörg SCHWEWE. München S., Abb., Kt. Post, Verkehr 174. ACKERMANN, Gerhard: Braunschweig im Luftverkehr. In: Braunschw. KaI [2003]. S , Abb BORNEMANN, Manfred: Vor 75 Jahren Aufbruch in technisches Neuland im und am Harz. In: Unser Harz. Jg S ,3 Abb DITTMANN, Manfred: Lokomotiven und Tender aus Zorge - ein Kapitel aus der Eisenbahn-Pioniergeschichte. In: Allgern. Harz-Berg-Kal [2003]. S , Abb GEBHARDT, Günter: Die Wege häuser im westlichen Harz in der Zeit von 1828 bis In: Unser Harz. Jg S , Abb KAMMEYER, Thomas, Dieter HÖLTGE: 75 Jahre Stadtlinienverkehr in Braunschweig mit BÜSSING- und MAN Omnibussen 1928 bis Braunschweig: Lithoscan S., Abb KUTSCHER, Rainer: Vor 160 Jahren fand Lerbach Anschluß an die neue Zeit. In: Allgern. Harz-Berg-Kal [2003]. S , Abb MARTINI, Joachim, Bemd SCHURADE: Beiträge zur Eisenbahngeschichte im Landkreis Gifhorn. Bildband. 1. Auf). Gifhom: Landkr. Gifhom S., Abb. (Bausteine 5) 181. PESCHKF., Siegmar: Vor einhundert Jahren: Zwei Postvertretungen in Frellstedt. In: Landkr. Helmstedt. Kreisbuch [2003]. S , Abb PRESIA, Edgar: Die Eisenbahnprojekte im Unterharz bis zum Jahre In: Unser Harz. Jg S , 7 Abb SCHURADE, Bemd: Bausteine. Beiträge zur Eisenbahngeschichte im Landkreis Gifhorn, H. 4. März 2003: Bilder vom Eisenbahnbetrieb im Landkreis Gifhom , Teil 1 (nördlicher Bereich). Gifhorn: Kreisarchiv Gifhom S.
199 202 Ewa Schmid 184. SIEGERT, Reinhard: Überregionale Verkehrsadern - in einer starken Wachstumsregion. In: Landkreis Helmstedt. Deutsche Landkreise im Portrait. Red.: Gerhard KILI AN. 4., völlig neue Ausg. Oldenburg: Verl. f. Kommunikation u. Wirtschaft (Edition "Städte - Kreise - Regionen"). S , Abb WATSACK, Carsten: Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. I1sede S., Abb. Geschichte des geistigen und kulturellen Lebens Universitäten, Schulen Jahre Schule Comeniusstraße Beiträge zur Geschichte einer Schule. Braunschweig: Oeding S., Abb AHRENS, Sabine: Die Academia Julia - Universitätsgeschichte in Helmstedt. In: Landkreis HcImstedt. Deutsche Landkreise im Portrait. Red.: Gerhard KILIAN. 4., völlig ncue Ausg. Oldenburg: Verl. f. Kommunikation u. Wirtschaft (Edition "Städte - Kreise - Regionen"). S , Abb BALLOF, Rolf, Joachim FRASSL: 200 Jahre Jacobson-Schule Seesen. Dokumentation eines Jubiläums und seiner Feiern. Seesen: Verf S., Abb BAUERDORF, Karl: Die Schulsituation im Herzogtum Braunschweig im 17. Jahrhundert am Beispiel Münchehof. In: Allgem. Harz-Berg-KaI [2003]. S , Abb BERG, Meike: Jüdische Schulen in Niedersachsen. Tradition - Emanzipation - Assimilation. Die Jacobson-Schule in Seesen « ». Die Samsonschule in Wolfenbüttel « ». Köln [u.a.]: Böhlau S. (Beitr. z. Hist. Bildungsforschung 28) BLOEMERS, Bärbel: Die Schule im Landeskrankenhaus Königslutter, Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, stellt sich vor. In: Landkr. Helmstedt. Kreisbuch [2003]. S , Abb BRAUN, Bernd: Die Kreisvolkshochschule Helmstedt. Dienstleistungsbetrieb für Bildung, Qualifizierung und Kultur. In: Landkr. Hclmstedt. Kreisbuch (2003). S BRAUN, Bernd, Horst KARRASCH: Berufliche Bildung als Standortfaktor. In: Landkreis Helmstedt. Deutsche Landkreise im Portrait. Red.: Gerhard KILIAN. 4., völlig neue Ausg. Oldenburg: Verl. f. Kommunikation u. Wirtschaft (Edition "Städte - Kreise - Regionen"). S , Abb FLEISCHER, Michael: Das Gymnasium am Bötschenberg in Helmstedt. In: Landkr. Helmstedt. Kreisbuch [2003]. S , Abb FRASSL, Joachim: Suche nach dem Erinnern. Dcr Jacobstempcl, die Synagoge der Jacobsonschule in Seesen. Seesen: Ev. Kirchengemeinde Seesen S., Abb JOHANSEN, Meisene: Einfache christliche Erziehung im evangelisch-lutherischen Sinn. Die Klosterschule St. Marienberg «1872 bis 1940». In: Landkr. Helmstedt. Kreisbuch (2003). S KRAUS, Wilfried: Die Entwicklung des allgemein bildenden Schulwesens im Landkreis Helmstedt von 1945 bis zur Gegenwart. In: Landkr. HcImstedt. Kreisbuch [2003]. S , Abb.
200 Bibliographie zur Braunschweigischen Landesgeschichte LINNE, Volker: Eh'ich's vergesse. Erinnerungen an die Zwergschule im Brunnental. In: Landkr. Helmstedt. Kreisbuch [2003]. S , Abb MICHALSKI, Claudia: Eine Marketingstrategie für die Fachhochschule Braunschweig/ Wolfenbüttel am Beispiel einer Befragung am Standort Salzgitter. Braunschweig: Verf S., Abb MITGAU, Wolfgang: Ein Weg durch das Landschulheim am Solling. Ein historischer Rundgang. Hilzminden: Mitzkat S., Abb NEBRICH, Gero: Die Entwicklung der Lehrschen Schule - und Schwerpunkte heutiger inhaltlicher Arbeit im Sekundarbereich 1. In: Landkr. Helmstedt. Kreisbuch [2003]. S , Abb NOFFKE, Herbert: Unsere Schule Wolfshagen im Harz. Aus dem Leben und der Geschichte eines alten Schulhauses. Oausthal-Zellerfeld: Papierflieger S., Abb OLTHOfF, Roland: Regionale und soziale Unterschiede des Elementarbildungsstandes der wolfenbüttelschen Bevölkerung um In: Braunschweig-Wolfenbüttel in der Frühen Neuzeit. Hrsg. v. Christian LIPPELT u. Gerhard SCHILDT. Braunschweig: Appelhans (Quellen u. Forschungen z. Braunschw. Landesgesch. 41). S OWCZARSKI, Rolf: Die Amerikanische Schule in Helmstedt. In: Landkr. Helmstedt. Kreisbuch [2003]. S , Abb SCHÖNIJAHN, Torsten: Deutsche Technische Akademie Helmstedt (DTA). In: Landkreis Helmstedt. Deutsche Landkreise im Portrait. Red.: Gerhard KILIAN. 4., völlig neue Ausg. Oldenburg: Verl. f. Kommunikation u. Wirtschaft (Edition "Städte - Kreise - Regionen"). S , Abb SCHULZE, Reinhold: Die Entwicklung der Berufsbildenden Schulen für den Landkreis Helmstedt in Helmstedt und ihr heutiger Stand. In: Landkr. Helmstedt. Kreisbuch [2003]. S , Abb SCHWARZ, Michael: 40 Jahre HBK. Braunschweig: Hochschule f. Bildende Künste S., Abb WEIHMANN, Susanne: Antigoonje macht Mittlere Reife. Zur Geschichte des Instituts Wittcke-Lademann. In: Landkr. Helmstedt. Kreisbuch [2003]. S , Abb KLOTH, Wiebke: Die Universität Hclmstedt und ihre Bedeutung für die Stadt Helmstedt. Helmstedt: Landkr. Helmstedt S., Abb. (Beitr. z. Gesch. d. Landkr. HcImstedt u. d. ehern. Univ. Helmstedt 16) 210. WIRTH, Wolfgang: Die Katholische Schule in Helmstedt. In: Landkr. Helmstedt. Kreisbuch [2003]. S , Abb. Architektur, Kunstgeschichte und Denkmalpflege 211. BESSIN, Peter: "Der Fürst als Bauherr - Architektur als Spiegel von Absolutismus und Aufklärung". Das Stemhaus und Richmond. In: Braunschweig-Wolfenbüttel in der Frühen Neuzeit. Hrsg. v. Christian LIPPELT u. Gerhard SCHILDT. Braunsehweig: Appelhans (Quellen u. Forschungen z. Braunsehw. Landesgesch. 41). S BOLLMOHR, Uta: Kirchen, Klöster, Baudenkmäler - Wege in die Romanik. In: Landkreis Helmstedt. Deutsche Landkreise im Portrait. Red.: Gerhard KILIAN. 4., völlig
201 204 EwaSchmid neue Ausg. Oldenburg: Verl. f. Kommunikation u. Wirtschaft (Edition "Städte - Kreise - Regionen"). S , Abb Die Braunschweiger Reiterstandbilder. Dokumentation ihrer Restaurierung Mit Beiträgen von Rainer FIGuR. Heike WETZIG, Dieter W. ZACHMANN. Braunschweig: Städtisches Museum, S., Abb. (Braunschweiger Werkstükke 107) 214. Dokumentation Salon Salder Neues aus Niedersächsischen Ateliers; Kulturamt - Schloß Salder - Bildende Künste. Salzgitter: Schloß Salder S., Abb ELSTERMANN, Sigrid: Das restaurierte Altarbild des "HI. Petrus thronend" in der Kapelle von Alexisbad. In: Unser Harz. Jg S ,6 Abb Eric FischI. Gemälde und Zeichnungen [Anläßlich der Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg... Wolfsburg: Kunstmuseum S., Abb Die gute Stube. Begleitband zur Ausstellung "Die gute Stube", Museum- und Porzellanmanufaktur Fürstenberg... Hg.: Karl-Heinz ZIESSOW, Thomas KRUEGER. C1oppenburg 2003, 158 S., Abb. (Materialien u. Studien z. Alltagsgesch. u. Volkskultur in Nds.35) 218. Heide Lühr-Hassels. Ölbilder und Mischtechniken. Kunstverein Salzgitter e. V. Salzgitter: Kunstverein S., Abb HÖLLER. Klaus Albert: Das Dommodell in der Hand Heinrichs des Löwen. In: Braunschw. Jb. f. Landesgesch. Bd S , 6 Abb Karl Heinz Droste. Fotoarbeiten und Pastellzeichnungen Kunstverein Salzgitter e. V. Salzgitter: Kunstverein S., Abb KEMMER, C1aus: Von Cranach bis Baselitz. Meisterwerke des C1airobscur-Holzschnitts. Mit einem Beitrag von Jochen KÖHN. Braunschweig: Herzog Anton Ulrich Museum S., Abb KLESSMANN, Rüdiger: Die flämischen Gemälde des 17. und 18. Jahrhunderts. Herzog Anton Ulrich-Museum, Kunstmuseum des Landes Niedersachsen. München: Hirmer S., Abb. (Sammlungskataloge d. Herzog Anton Ulrich-Museums Braunschweig 12) 223. NEUMANN, Hartrnut: Tierlandschaften. Hartrnut Neumann begegnet alten Meistern. Braunschweig: Herzog Anton Ulrich-Museum S., Abb Painting pictures. Malerei und Medien im digitalen Zeitalter. [Anläßlich der Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg... ] Bielefeld: Kerber S., Abb PAXMANN, Jürgen: Lebendige Kultur auf Schritt und Tritt - Museen, Konzerte, Theater. In: Landkreis Helmstedt. Deutsche Landkreise im Portrait. Red.: Gerhard KILI AN. 4., völlig neue Ausg. Oldenburg: Verl. f. Kommunikation u. Wirtschaft (Edition "Städte - Kreise - Regionen"). S , Abb ROST, Falko: Kirchliche Bauten des 19. Jahrhunderts im Gebiet der Kreisdirektion Hclmstedt. In: Landkr. Helmstedt. Kreisbuch [2003]. S , 16 Abb SCHlLLlG, Christiane: Nach Drachen und Höllenhunden plötzlich Engel. In: Uhlenklippen-Spiegel. Nr S , Abb. [Betr. Die Hauptkirche BMV in Wolfenbüttell 228. SEELIGER. Matthias: Aus dem Besitz des Holzrnindener Stadtmuseums: Reservistenpfeife des Feldartillerie-Regiments 10. In: Jb. f. d. Landkr. Holzminden. Bd [2003]. S ,5 Abb.
202 Bibliographie zur Braunschweigischen Landesgeschichte SENO, Eva-Maria: Stadt - Idee und Planung. Neue Ansätze im Städtebau des 16. und 17. Jahrhunderts. München; Berlin: Dt. Kunstver! S., Abb. [Braunschweig-Bezug] 230. Troia - Traum und Wirklichkeit. Ein Mythos in Geschichte und Rezeption. Tagungsband zum Symposion im Braunschw. Landesmuseum am 8. u. 9. Juni 2001 im Rahmen der Ausstellung "Troia - Traum und Wirklichkeit". Hrsg. v. Hans-Joachim BEHR. Braunschweig: Braunschw. Landesmuseum S., Abb. (Veröff. d. Braunschw. Landesmuseums 101) 231. Von Rubens bis heute. 250 Jahre Herzog Anton Ulrich-Museum. Heidelberg: Vernissage-Ver! S., Abb Voss, Gotthard: Hermann Giesau - Denkmalpflege im Bereich Halberstadt! Harz. In: Sachsen u. Anhalt. Bd /2003. S WANDERSLEB, Martin: Vorreformatorische Kunst und Barockisierung in Luthertum und Katholizismus. Helmstedt: Verf S. Literatur 234. Bücher als Argumente. Lessing zwischen Bibliothek und Öffentlichkeit. Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek S., Abb HOFFMEISTER, Kurt: Braunschweigs Literaten. 140 Autorenporträts. Eine etwas andere Literaturgeschichte. Braunschweig: Hoffmeister S., Abb Hi:BNER, Georg: Lessings Flucht von Hamburg nach Wolfenbütte!. Die Rolle Prof. Johann Arnold Eberts bei diesem folgenschweren Entschluß dokumentiert an hand des Briefwechsels zwischen ihm und G.E. Lessing. Hamburg: Lessing-Ges S. (Schriftenreihe d. Lessing-Ges. e. V. 13) 237. KAUFMANN-VILLMOW, Sabine: Der Harz. Gedichte und Erzählungen. Frankfurt a. M.: Fischer S., Abb LESSING. Gotthold Ephraim: Gotthold Ephraim Lessing. Eine Auslese. Wien: Tosa S. (Klassiker-Edition) 239. Die Nibelungen. Sage - Epos - Mythos. Hrsg.: Joachim HEINZLE, Klaus KLEIN, Ute OB HOF. 1. Aufl. Wiesbaden: Reichert S., Abb. [Braunschweig Bezug) 240. "Uns ist in alten Mären... ": Das Nibelungenlied und seine Welt. Darmstadt: Primus S., Abb. [Braunschwcig-Bezug) Theater, Musik 241. KLEIN, Angela: "... als ich Göthe's ächten Faust unverfälscht intendire... " Erste öffentliche Aufführung von Goethes "Faust" in Braunschweig in einer Bearbeiteung von August Klingemann vor 175 Jahren, am 19. Januar 1829 in Braunschweig. In: Braunschw. KaI [2003]. S , Abb LEHMANN-WERMSER, Andreas: "... es waren ja nicht viele Musikbegeisterte bei uns in der Klasse... "Musikunterricht an den höheren Schulen im Freistaat Braunschweig Hannover: Institut f. Musikpädagogik IIl, 272 S., Abb.
203 206 EwaSchmid 243. SCHMIDT, Hanns H. E: Der Harz als romantische Opern kulisse. In: Unser Harz. Jg S ,8 Abb STROEVE, Barbara: Endlich hat man auch auf die Richtigkeit, Deutlichkeit und Reinigkeit des Ausdrucks die möglichste Sorgfalt genommen [... ]. Zur Gesangbuchreform im Herzogtum Braunsehweig am Ende des 18. Jahrhunderts. In: Braunschweig Wolfenbüttel in der Frühen Neuzeit. Hrsg. v. Christian LIPPELT u. Gerhard SCHILDT. Braunschweig: Appelhans (Quellen u. Forschungen z. Braunschw. Landesgesch. 41). S Volkskunde, Sprachgeschichte, Namenkunde 245. BECKER, Dörte: Mode der 50er Jahre für Jedefrau und Jedermann... "Sich-Kleiden" in der Zeit des Aufbaus und des Wirtschaftswunders. Braunschweig: Appelhans S., Abb. (Schriftenreihe d. Kreismuseurns Peine 28) 246. CASEMIR, Kirstin: Die Ortsnamen des Landkreises Wolfenbüttel und der Stadt Salzgitter. Bielefeld: Verl. f. Regionalgesch S. (Nds. Ortsnamenbuch 3; Veröff. d. Instituts f. Hist. Landesforschung d. Univ. Göttingen 43) 247. ECKEBRECHT, Peter: "Im Alten Dorfe", ein Flurname bei Burgdorf.ln: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003]. S ,6 Ahb GREVE, Anneliese: Menschenopfer in Kult- und Opferstätten unserer Vorfahren in unserer Heimat. In: Allgem. Harz-Berg-Kal [2003]. S , Abb KIEHL, Ernst: Leben und Singen im 20. Jahrhundert - am Beispiel des Schicksals von Anna ter Smitten in C1austhal-ZellerfcId. In: Unser Harz. Jg S , Abb KIEHL, Ernst: Von Bergsängern im Ober- und im Unterharz. In: Allgem. Harz-Berg Kal [2003]. S , Abb KRÄMER, Rainer: Die Geschichte des Schachspiels. Von Herzog August und Lessing bis zur Gegenwart. In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003]. S ,6 Abb MEYERHOFF, Kurt: Ortsbezeichnungen Hahnenklee und Bockswiese. In: Allgem. Harz-Berg-Kal [2003]. S , Abb SCHWARZ, Gesine: Täglich Brot und Festgelage beim Wolfenbütteler Herzog im 15. Jahrhundert. In: Auf dem Weg zur herzoglichen Residenz. Wolfenbüttel im Mittelalter, hrsg. v. Ulrich SCHWARZ. Braunschweig: Appelhans S. (Quellen u. Forschungen z. Braunschw. Landesgesch. 40). S , Abb., Tab STELZEL, Ulla: Aufforderungen in den Schriften Herzogin Elisabeths von Braunschweig-Lüneburg. Eine Untersuchung zum wirkungsorientierten Einsatz der direktiven Sprachhandlung im Frühneuhochdeutschen. Hildesheim: Olms X, 376 S., Abb. (Documenta linguistica: Studienreihe 5) 255. WILLIGES, Bernhard: Erfassung, Deutung und Geschichte von 400 Flurnamen in: Ahnsen, Böckelse, Hardesse, Höfen, Hünenberg, Päse, Seershausen, Siedersdamm und Warmse. Flettmar: Verf S.
204 Bibliographie zur Braunschweigischen Landesgeschichte 207 Natur, Umweltschutz 256. ANDERSSON, Harry, Ursula KLEBER, Rainer KRÄMER: Natur-und kulturgeschichtlicher Erlebnispfad Asse. 1. Aufl. Königslutter: Freilicht- und Erlebnismuseum e. V S., Abb. (FEMO 11) 257. ARNOLDT, Hans-Martin: Säger - fischfressende Tauchenten auf der Oker. In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003). S , Abb BAESKE, Klaus: Pflanzen-Arterhaltung - Samen sammeln. In: Braunschw. Kal [2003). S , Abb BARTHOLD, Sebastian: Erstellung eines Umweltinformationssystems für Walkenried mit der GIS-Anwendung ArcView 3.1. Göttingen:Verf., S BORNEMANN, Manfrcd: Von dicken Tannen und knorrigen Eichen. In: Unser Harz. Jg S ,9 Abb Gartendenkmalpflegerische Untersuchung des Bcrggartens im Niedersächsischen Landeskrankenhaus Königslutter. Hannover: Univ S., Kt HEUER, Jürgen: Zur Situation der Saatkrähe Corvus frllgilegus im südöstlichen Niedersachsen von In: Milvus Braunschweig. Jg S ,2 Abb HEVERS, Jürgen: Braunschweiger Dioramen. Tiere in natürlicher Umgebung. Mit dem vollständigen Text der Hörführung zu den Dioramen von Isabell ZIEKUR. Braunschweig: Staatl. Naturhist. Museum S., Abb HÖRMANN, Dieter: Bärlappgcwächse im Rumohrtal bei Holzminden. In: Jb. f. d. Landkr. Holzminden. Bd [2003). S. 7-12, 5 Abb HUMMEL, Jörg: Erfolgreiche Brut einer Schnatterente (Anas strepera) im "Wasservogelreservat Schöppenstedter Teiche". In: Milvus Braunschweig. Jg S , 2 Abb JÜRGENS, Rolf: Bemerkenswerte Haubentaucher-Bruten im Wasservogel reservat Schöppenstedter Teiche. In: Milvus Braunschweig. Jg S , 2 Abb JÜRGENS, Rolf: Der Mauersegler - Vogel des Jahres In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003). S , Abb JÜRGENS, Rolf: Die Vögel im Landschaftsschutzgebiet "Lah und Küblinger Trift". In: Milvus Braunschweig. Jg S , 3 Abb KIRcHHoFF, Hans-Henning: Das Rückhaltebecken der Salzgitter Flachstahl GmbH bei Salzgittcr-Üfingen und seine Vogclwelt. In: Milvus Braunschweig. Jg S , 2 Abb KONRAD, Volker: Erstnachweis eines Thorshühnchens (Phalaropus fulicarius) am Oberwesertal. In: Jb. f. d. Landkr. Holzminden. Bd [2003). S , 3 Abb KRÜGER, Matthias: Natur- und Landschaftspflege im Landkreis Hclmstedt. In: Landkreis Helmstedt. Deutsche Landkreise im Portrait. Red.: Gerhard KILIAN. 4., völlig neue Ausg. Oldenburg: VerI. f. Kommunikation u. Wirtschaft (Edition "Städte - Kreise - Regionen"). S , Abb MOHRMANN, Wilfried: Orchideen im Landkreis Holzmindcn: das Knabenkraut. In: Jb. f. d. Landkr. Holzminden. Bd [2003). S. 1-6,9 Abb OLDEKOP, Werner: Zum gegenwärtigen Brutbestand des Rothalstauchers in der Umgebung Braunschweigs. In: Milvus Braunschweig. Jg S.
205 208 EwaSchmid 274. OLDEKOP, Werner, Bernd HERMENAU, Friedmund MELCHERT: Limikolenbeobachtungen 2002 mit Rückblick auf frühere Jahre. In: Milvus Braunschweig. Jg S ,20Abb POENICKE, Mathias: Vegetations- und Schälmonitoring in einem Rotwildrevier des Nationalpark Harz. Göttingen: Verf S ROCKSTEDT, Gerhard: Von einstmals "grausamen, groben und gefährlichen Raubthieren" im Harz (1-2). In: Unser Harz. Jg S ; , Abb SAUER, Hans-Jürgen: Der Beberbach - naturfern - naturnah. In: Milvus Braunschweig. Jg S , 3 Abb SCHRADER, Henning: Unterwegs im Naturpark Elm-Lappwald. In: Landkreis Helmstedt. Deutsche Landkreise im Portrait. Red.: Gerhard KILIAN. 4., völlig neue Ausg. Oldenburg: VerI. f. Kommunikation u. Wirtschaft (Edition "Städte - Kreise - Regionen"). S , Abb VELTEN, Peter: Das Schutzgebiet Gröpelnkuhle. In: Milvus Braunschweig. Jg S ,2 Abb VELTEN, Peter, Bernd HERMENAU: Vermehrtes Auftreten von Tcmminckstrandläufern (Calidris temminickii) auf dem Heimzug In: Milvus Braunschweig. Jg S VOWINKEL, Klaus: Leitbild der Grünlandentwicklung im Harz. (1-2). In: Unser Harz. Jg S ; , Abb WALTHER, Jörg: RieseIbetrieb Steinhof - Abwasserbehandlung und Naturschutz. In: Milvus Braunschweig. Jg S , 3 Abb WINKEL, Wolfgang, Doris WINKEL: Feldforschung mit Tradition - das Braunschweiger Höhlenbrüterprogramm des Instituts für Vogelforschung "Vogelwarte HeIgoland" vorgestellt am Beispiel des Trauerschnäppers (Ficedula hypoleuca). In: Milvus Braunschweig. Jg S. 1-16,11 Abb WULFERT, Katrin: Potenzielle Beiträge der Landschaftsplanung zur effektiven Reduzierung betrieblicher Umweltauswirkungen im Rahmen vom EMAS. Dargestellt am Beispiel der Stadt Wolfenbüttel. Hannover: Inst. f. Landschaftspflege u. Naturschutz S., Abb. (Arbeitsmaterialien 48) Geschichte einzelner Orte 285. LILGE, Andreas: ARlI01-ZEN im 16. bis 18. Jahrhundert. Aufzeichnungen über Gerichtssachen erzählen vom Alltag der Bauern. In: Jb. f. d. Landkr. Holzminden. Bd [2003]. S EHRHARD, Friedrich: [BAD] H,IRZHlJRGER Heimatkunde. Schule im Wandel der Zeit. Aufzeichnungen aus dem Jahre Teil 2-5. In: Uhlenklippen-Spiegel. Nr S. 6-19; 5-12; 4-7; 7-15, Abb HEINEMANN, Wolfgang: Die Chronik des Amtes Harzburg. Von den Anfängen bis zum Jahre Hanau: Verf S SCHULZ, Harald: Der Bad Harzburger "Jungbrunnen" - ein Erlebnisbrunnen. In: Uhlenklippen-Spiegel. Nr S , Abb ZADACH-BuCHMEIER, Frank: Integrieren und Ausschließen. Prozesse gesellschaftlicher Disziplinierung. Die Arbeits- und Besserungsanstalt BEVERN im Herzogtum
206 Bibliographie zur Braunschweigischen Landesgeschichte 209 Braunschweig auf dem Weg zur Fürsorgeerziehungsanstalt (1834 bis 1870). Hannover: Hahn S., Abb. (Veröff. d. Hist. Komm. f. Nds. u. Bremen 212) BR,WNSCHIIF./G s. auch Nr. 2, 11,48, 88, 102, 103, 104, 120, 123, 145, 174, 178, 186,207, 213,231, Jahre Krankenhaus Holwedestraße. [Projcktlcitung: Marion LENZ, Ulrike SCHELLlNG). Braunschweig: Städt. Klinikum S., Abb Jahre Stiftung Bahn-Sozialwerk Braunschweig Braunschweig S, Abb Jahre St. Johannis Braunschweig. Die Geschichte der Gemeinde und des Kirchenbaus von Braunschweig: Kirchengemeinde St. Johannis S.,Abb ALB RECHT, Peter: Gastronomie und Geselligkeit. Die Stadt Braunschweig als Beispiel In: Formen dcr Geselligkeit in Nordwestdeutschland Hrsg. v. Peter ALBRECHT, Hans Erlch BÖDEKER und Ernst HINRICHS. Tübingen: Niemeyer (Wolfenbütte1cr Studien z. Aufklärung 27). S BIEGEL, Gerd: Der Bürgerhauptmann Henning Brabandt «um ». Das blutige Scheitern der Demokratisierung des Braunschweiger Rates im Jahre In: Braunschw. Kal [2003). S , Abb Braunschweig. Stadt und Region der Fotografie und neuen Medien. Preojektbeauftragter: Lars SPENGLER. Braunschweig: Stiftung Nord/ LB S., Anh Das Bucharchiv des Vieweg-Verlages in der Universitätsbibliothek Braunschweig. Zsgest. v. Michael KUHN u. Klaus D. OBERDIECK. Braunschweig: Universitätsbibliothek [481) S., Abb CAMERER, Luitgard: Wohnungsstiftungen für alte Männer in Braunschweig im 19. und 20. Jahrhundert. In: Braunschw. Jb. f. Landesgesch. Bd S Geschichte des Forschungsstandortes Braunschweig-Völkenrode. Hrsg. v. Rolf AH LERS und Gerhard SAUERBECK. Braunschweig: Appelhans S., Abb GRUNER, Manfred: Braunschweig... bietet mehr als nur den Löwen. Stadt rundgänge. Mit 122 Fotogr. v. Dieter HEITEFUSS. 3., aktual. Auf!. Braunschweig: Heitefuß S GURATSCH, Dankwart: Wieviel ist Braunschweig seine Mitte wert? Die Stadt, das Schloß und das Center. Mit einer Einführung von Gerd BI EGEL. Braunschweig: Braunschw. Landesmuseum S., Abb. (Braunschw. Museumsvorträge 5) 301. HEITEFUSS, Dieter: Braunschweigs Wiederaufbau nach In: Braunschw. KaI [2003). S , Abb HODEMACHER, Jürgen: Braunschweiger Geschichten. Braunschweig: Mcyer S.,Abb HUCK, Bemd: Der Kunstverein Braunschweig. In: Braunschw. Kal [2003). S JOGER, Ulrich: Die Rübeländer Höhlen - aus der Geschichte der Braunschweigischen naturhistorischen Sammlungen. In: Braunschw. Kal [2003). S KABLlTZ, Karsten: Mit Meßseil und Rutenstab. In: Archäologie i. Nds. Bd S , 5 Abb.
207 210 EwaSchmid 306. LACZNY, Wolfgang: Europäisches Rotationsprinzip oder "vordrängein gibt es nicht". Braunschweig und die Region - Kulturhaupt~tadt Europas 201O? In: Braunschw. KaI [2003]. S LASKOWSKI, Nicole: Jahre Braunschweigische Landesbrandversicherungsanstalt. In: Braunschw. KaI [2003]. S , Abb LUCKHARDT, Jochen: Das Herzog Anton Ulrich-Museum und sein Jubiläumsjahr. In: Braunschw. Kai [2003J. S , Abb MEYER, Ralph-Herbert: Braunschweig und Basketball - eine Erfolgsgeschichte. In: Braunschw. KaI [2003]. S MIITMANN, Markus: Bauen im Nationalsozialismus. Braunschweig, die "Deutsche Siedlungsstadt" und die Mustersiedlung der "Deutschen Arbeitsfront" Braunschweig-Mascherode. Ursprung - Gestaltung - Analyse. Hameln: Nicmeyer S., Abb MODERHACK, Richard: Der Graue Hof, das erste Braunschweiger Residenzschloß und seine Ausstattung um In: Braunschw. KaI [2003J. S , Abb OHM, Matthias: 3 ossen tungen, 10 swynes fote und 2 met worste. Das Schossmahl des Jahres 1517 im Braunschweiger Weichbild Sack «mit einer Edition der Rechnung». In: Braunschw. Jb. f. Landesgesch. Bd S , Abb PINGEL, Norman-Mathias: Brennpunk Odeon. Braunschweiger Politik und Gesellschaft um In: Braunschw. KaI [2003]. S , Abb SCHMUHL, Hans-Walter: Die Bürger der Stadt - die Stadt der Bürger. Beiträge zur Geschichte des Bürgertums in Braunschweig im 19. Jahrhundert. Braunschweig: Stadtarchiv S., Abb. (Quaestiones Brunsvicenses 13) 315. SIMON, Ursula: 100 Jahre AItewiek Apotheke Braunschweig: Verf., ungez. BI Stadt im Sinn. Braunschweig! Foto - Sinn - Thesen. Ein Projekt im Rahmen der Bewerbung Braunschweigs und der Region zur Kulturhauptstadt Europas Red.: Sandra PECH MANN. Braunschweig S., Abb Das Team für Braunschweig. Stadt der Wissenschaft Braunschweig bewirbt sich. Konzept u. Text: Dirk HANs. Braunschweig: Stadt Braunschweig S., Abb Vernetztes Gedächtnis. Topografie der nationalsozialistischen Herrschaft in Braunschweig 1930 bis Hrsg. v. Anja HEssE. Braunschweig: AppeIhans S., Abb WARNECKE, Burchardt: Das Braunschweiger Neustadtrathaus. In: Braunschw. Heimat. Jg. 89, S. 8-10, Abb WARN ECKE, Burchardt: Der Braunschweiger Nußberg und seine Umgebung. Ein Stück Stadtgeschichte aus dem Osten der Stadt Braunschweig. 7., erw. Aufl. Braunschweig: Appelhans S., Abb WESSELHÖFT, Daniel: Die Beziehungen zwischen der Stadt und der Garnison Braunschweig Braunschweig: Verf S FÖRSTERLlNG, Reinhard, Sigrid Lux, Gudrun PISCHKE: CALHEClIT, Engerode, Gebhardshagen, Heerte. "Ortschaft West" in alten Ansichten. Salzgitter: Archiv der Stadt Salzgitter S., Abb. (Beitr. z. Stadtgesch. 14) CLAL'STHAI,-Zt:LLEHFELD s auch Nr. 2,42, 249, 397.
208 Bibliographie zur Braunschweigischen Landesgeschichte LICHTENBERG, Rolf: Aufruhr in Zellerfeld. In: Allgern. Harz-Berg-Kal [2003]. S , Abb HEl SE, Friedrich: Sintemal je näher der Hils je gröher die Knorren! Aus der Geschichte der Delligser Kirche. [DELLlG.W ;:V]. In: Jb. f. d. Landkr. Holzminden. Bd [2003]. S ANDERS, Wolfgang, DetIef CKEYDT: Das Rittergut DENKIl':HAUSfN und die Weiße Mühle. In: Jb. f. d. Landkr. Holzminden. Bd [2003]. S , 5 Abb. ENGERROf)E s. Nr HILLMAR, Eckehard: Jubiläum Jahre EI'I'.SSf;V, 850 Jahre Gilzum. In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003]. S , Abb. GEBHARDSHAGE:V s. Nr GILZU.\I s. Nr GOS1.AR s. auch Nr. 92, Goslar im Mittelalter. Vorträge beim Geschichtsverein. Hrsg. v. Hansgeorg ENGELKE. BieJefeJd: Verl. f. Regionalgesch S., Abb. (Beitr. z. Gesch. d. Stadt Goslar. Goslarer Fundus 51) 328. HESSE, Otmar: Zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte Goslars. Unter Mitarb. v. Christoph GUTMANN. Goslar: Verl. d. Buchhandlung Brumby S., Abb. (Forum Goslar 1) 329. KELICHHAUS, Stephan: Goslar um Bielefcld: Verl. f. Regionalgeseh S.: Ill., graph. Darst., Kt. (Göttinger Forschungen z. Landesgesch. 6) 330. LAUB, Gerhard: Vor neun Jahrhunderten - ein folgenschwerer Blitzschlag in der Goslarer Kaiserpfalz. In: Unser Harz. Jg S , 4 Abb LAUF, Ulrich: St. Johannis [Goslar] und das älteste Hospital für Bergleute. Neue Hypothesen zum Ursprung der Knappschaft. In: Der Anschnitt. Jg S. 2-11, Abb Zwischen den Mauem. Der jüdische Friedhof zu Goslar an der Glockengießerstrasse. Dokumentation der Grabstätten und Inschriften. Bearb. v. Bemdt SCHALLER, Jens BEHNSEN. Fotografiert von Friedhelm GEYER. Goslar: Stadt Goslar S., Abb BREUSTEDT, Alfred, Konrad Wilhelm DEGE, Bemd JÄCKEL: 950 Jahre HARI.1N(jEROLJE Ortschronik. Harlingcrode: Verf S., Abb. H,1RZ s. Nr. 4, 16, 18, 19,24, 27, 33, 34, 36, 37,129, 132, 135, 136, 142, 143,237, BRUER, Gustav: Zwei Schicksale von Einwohnern des Dorfes HAVERLAlI im 19. Jahrhundert. In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003]. S , Abb. HH:R11:. S. Nr HH.MSTHJT s. auch Nr. 2, 187, 192, 194,204,205,206,209, SCHMID, Wolf-Michael: HeJmstedt - zukunftsorientierter Wirtschaftsstandort in der Mitte Europas. In: Landkreis Helmstedt. Deutsche Landkreise im Portrait. Red.: Gerhard KILIAN. 4., völlig neue Ausg. Oldenhurg: Verl. f. Kommunikation u. Wirtschaft (Edition "Städte - Kreise - Regionen"). S , Abb Vom Bibliothekssaal in den Weinkeller. Aus der Geschichte des Kreis- und Universitätsmuseums Hclmstedt. Mit Beitr. v. Matthias KRÜGER u. Marita STERL Y. Helmstedt (Veröff. d. Kreismuseen Helmstedt 8)
209 212 EwaSchmid HOl.ZMlNIJI:.N s. Nr. 2,31,45, WIEGAND, Christian: Von Bauern, Hirten und Mönchen. Kulturhistorische Zeugnisse in der Landschaft um HONIJEI,AGE. Braunschweig: Förderkreis Umwelt- u. Naturschutz Hondelage S., Abb Fachwerk in HORNBL'RG. Wenn Häuser erzählen. [Red.: Paul-Josef RAuE]. Braunschweig: Braunschw. Zeitungsverl S., Abb KÖNIGFELD, Peter, Anja STADLER: Die evangelische Stadtkirehe B.M.V. in Homburg - zur Bedeutung und Restaurierung ihrer nachreformatorischen Ausstattung. In: Berichte z. Denkmalpflege in Nds. Jg S ,5 Abb. KÖNlGSLUITI::R s auch Nr. 157, 191, Mein lieber Papa... Vom Leiden psychisch kranker Menschen im Freistaat Braunschweig und der Landes-Heil- und Pflegeanstalt Königslutter zwischen 1933 und [Hrsg.: JÜrgen-H. MAuTHE; Angela WAGNER]. Königslutter: J.-H. Mauthe S., Abb JANSSEN, Willi: Alte Bibeln der Nicolai Kirche NElVf)ORf: In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg. SO [2003]. S , Abb Chronik OUjIlL'RG Ölsburg: Verein f. Heimatgesch. e. V S., Abb AHRENS, Hermann: Zur Geschichte des alten OHRuMer Kothofes Nr. 6. In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003]. S , Abb VOLKMANN, Rolf: 800jähriges Bestehen der Gemeinde QUERENHORST. In: Landkr. Helmstedt. Kreisbuch [2003]. S KRATHGE, Willi: Haus-Hof-Erb-Besitz-Folge in RICKENSIJORF von Rikkensdorf: Verf ungez. BI. SALZGITTER s. auch NT. 7, 17,49,150, Burgkurier. Burg Lichtenberg. Salzgitter: Förderverein Burg Lichtenberg e. V., S., Abb ECKARDT, Andrea: Diskutieren, Streiten, Mitgestalten! 30 Jahre Kampf um Arbeit im weltgrößten Motorenwerk Volkswagen Salzgitter. Hamburg: VSA-Verl S.,Abb Burgkurier: Burg Lichtenberg. Salzgitter: Förderverein Burg Lichtenherg e. V S., Abb GESCHWINDE, Michael, Horst-Rüdiger JARCK, Andreas WOLFF: Burg Lichtenberg: 29. Oktober In: Archäologie i. Nds. Bd S ,5 Abb Ein halbes Jahrhundert. Beiträge zur Geschichte der IG Metall in Salzgitter. Ein Lese-Bilder-Buch. IG Metall Verwaltungsstelle Salzgitter (Hrsg.). Hamburg: VSA-Verl S., Abb PISCHKE, Gudrun: Burg Lichtenberg. Feste - Amtssitz - Ruine. Eingenommen - verwaltet - verpfändet - zerstört - wiederentdeckt. Salzgitter: Förderverein Burg Lichtenberg e. V S., Abb PAPST, H.-GÜnter: SAMBL/:.'BI:.N - Fakten und Visionen. In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003] , Abb KRAM ER, Uwe: Brandstiftung in SCIILII::STEIJT anno In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003]. S
210 Bibliographie zur Braunschweigischen Landesgeschichte KRAMER, Uwe: Schliestedt, eine Dorfbeschreibung von In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenhüttel. Jg [2003). S THON, Ekkehard: SCHÖPI'ENSTEIH; unsere Kleinstadt am Elm. Sammlung historischer Texte und Fotos, Band 3. Horb am Neckar: Geiger-Verlag S., Abb THON, Ekkehard, Markus GRÖCHTEMEIER: Außerhalb der nationalsozialistischen " Volksgemeinschaft". Zigeuner in der Stadt Schöppenstcdt 1939 bis In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003]. S , Abb. Sf:ESI:;V s. auch Nr. 188, 190, Über-Lebensgeschichten: Kurzbiografien Seesener Frauen im 19. und 20. Jahrhundert. [Ein Projekt der Frauenbeauftragten der Stadt Seesen). Stadt Seesen [Hrsg.); LUDWIG, Elvira [Recherche] Bockenern: Druckerei Lühmann, S. SJEVT;RSIiAUSJ:'N S. Nr RUHLENDER, Margot: Die Damen von Stift Steterburg Jahre Stift SmlJ-.'RIIL'RG. Braunschweig: Meyer S., Abb WACIITER, Gerhard, Kurt BARTELS: Ortsfamilienbücher Ohre- und Bördekreis. Band 26: UTHII(i/)!::V 1665 bis Kappeln: Verf S. (Quellen u. Schriften z. Bevölkerungsgesch. Mittcldeutschlands) 360. Quellenbuch zur Ortsgeschichte VUI.K.I1ARVIJE. [Gestaltung u. Zusammenstellung: Fritz KOCH, Sigrid und Michael KOCH]. Braunschweig: Documaxx Hessler Digitaldr S., Abb WEIDNER, Karl Hermann: W,\RLE, ein Bauerndorf? In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfcnbüttel. Jg [2003). S , Abb BARTELS, Wilfried: WARTJENSTWT feierte seinen 850. Geburtstag. In: Heimathuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003]. S , Abb. WATE.VSTI:'I)TS. Nr 55, WAGENER, Karl-Heinz: 777 Jahre WWDEL. In: Hcimatbuch f. d. Landkr. Wolfcnbüttel. Jg [2003]. S WOLfJ::NHÜTTEL s. auch Nr. 2, 124, 125, 190,203, BARTKOWSKI-STIEMERT, Barbara, Kerstin GOEBEL: Klimmzüge. Die Wolfenbütteler Gymnasial-Tumgemeinde. Ein Beitrag zur Schul- und Sozialgeschichte. 1. Auf!. Wolfenbüttel: Gymnasium Große Schule S., Abb DOLLE, Dietmar: Wolfenhüttel auf alten Ansichtskarten. Ein Rundgang durch die Innenstadt anhand von alten Ansichtskarten aus der Sammlung Dolle. Wolfenbüttel: Aktionsgemeinschaft Altstadt Wolfenbüttel S., Abb. (Spurensuche 2) 366. GARBER, Jörn: Wolfenbüttel in Halle? Paul Raabe und die Aufklärungsforschung in Halle ( ). In: Entdeckung, Begegnung, Bewegung S GROTE, Hans-Henning: Die Baugeschichte der Burg Wolfenbüttel im Mittelalter und in der Renaissance. In: Auf dem Weg zur herzoglichen Residenz. Wolfenbüttel im Mittelalter, hrsg. v. U1rich SCHWARZ. Braunschweig: Appelhans S. (Quellen u. Forschungen z. Braunschw. Landesgesch. 40) , Abb HODEMACHER, Jürgen: Wolfenbüttel und Lessing. In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003]. S , Abb MEIBEYER, Wolfgang: Was war in Wolfenbüttel, bevor die Herzöge kamen? Die Anfänge von Burg und Siedlung. In: Auf dem Weg zur herzoglichen Residenz. Wolfen-
211 214 EwaSchmid büttel im Mittelalter, hrsg. v. Ulrich SCHWARZ. Braunschweig: Appelhans S. (Quellen u. Forschungen z. Braunschw. Landesgesch. 40). S ÜHAINSKI, Uwe: Von der herzoglichen Niederungsburg zum Herrschaftszentrum des Braunschweiger Landes - Wolfenbüttel 1283 bis In: Auf dem Weg zur herzoglichen Residenz. Wolfenbüttel im Mittelalter, hrsg. v. Ulrich SCHWARZ. Braunschweig: Appelhans S. (Quellen u. Forschungen z. Braunschw. Landesgesch. 40). S , Abb RAABE, Paul: Kulturstadt Wolfenbüttel? In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003). S RAHN, Kerstin: "Zu Trost und Gewinn... unserer und unserer Kinder Seele". Die Memorialgemeinschaft der Wolfenbütteler Marienbruderschaft im 15. Jahrhundert. In: Auf dem Weg zur herzoglichen Residenz. Wolfenbüttel im Mittelalter, hrsg. v. Ulrich SCHWARZ. Braunschweig: Appelhans S. (Quellen u. Forschungen z. Braunschw. Landesgesch. 40). S , Abb SCHÖNBERG, Lore: Zum 50-jährigen Jubiläum des Heimatbuches. In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003]. S SCHWARZ, Gesine: Geschichte des Dorfes Groß Stöckheim. Wolfcnbüttel: Stadt Wolfenbüttel S., Abb. (Beitr. z. Gesch. d. Stadt Wolfenbüttel 10) 375. THlEL, Theodore: Das herzogliche Waisenhaus in Wolfenbüttel. WolfenbütteI: Verf S., Anh UPPENKAMP, Barbara: Ein Inventar von Schloß Wolfenbüttel aus der Zeit des Herzogs Julius von Braunschwig und Lüneburg. In: Kunst und Repräsentation. Studien zur europäischen Hofkultur im 16. Jahrhundert. Hrsg. v. Heiner BORGGREFE u. Barbara UPPENKAMP. Bamberg: Weserrenaissance-Museum Schloß Brake (Materialien z. Kunst- u. Kulturgesch. in Nord- u. Westdeutschland 29). S , 16 Abb Verborgen im Buch, verborgen im Körper. Haut zwischen 1500 und Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek S., Abb. (Ausstellungskataloge d. Herzog August Bibliothek 82) 378. VOLK ER, Horst: Wann und warum wurde die Donnerburgbrücke zerstört. In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003]. S , Abb BLISCHKE, Anja: Wir und unsere Stadt. WOI,F.\'BURG. Sechs Jahrzehnte Stadtgeschichte. 1. Aufl. Gudensherg-Gleichen: Wartberg S., Abb BLÜMEL, Matthias: Der Taufstein der St. Petrus-Kirche zu Wolfsburg-VorsfcIde. Wolfsburg: EV.-Iuth. Kirchengemeinde ungez. BI., Abb FIMPEL, Martin: Schloss Wolfsburg In: Nds. Jb. f. Landesgesch. Bd S LINDEMANN, Maik: Wolfsburg. Erbe des nationalsozialistischen Siedlungsbaus. 1. Aufl. Weimar: Edition M S., Abb. (Grundrisse: Schriften z. Architekturu. Stadtbaugesch. 9) 383. MÜLLER, Maike: Instrumente zur Profilierung einer Stadt als Marke - arn Beispiel Wolfsburg. Wolfsburg: Verf VI, 80 S., Abb Peter Keetmann, Volkswagenwerk Katalog-Konzeption: Gijs van Tun. BieIefeld: Kerber S., Abb WINTZINGERODE-KNORR, Karl-Wilhelm von: Wolfsburg-Nordsteimke, Ev.-Iuth. St. Nicolai-Kirehe. Passau: Kunstverl. Peda S., Abb. (Peda-Kinstführer 198)
212 Bibliographie zur Braunschweigischen Landesgeschichte 215 ZI::U,F.RH:LD s. Clausthal-Zellerfeld 386. BARTELS, Kurt: Ortsfamilienbüeher Ohre- und Bördekreis. Band 32: ZOHIlFNlTZ 1665 bis Kappe1n: Verf S. (Quellen u. Schriften z. Bevölkerungsgesch. Mitteldeutschlands) Bevölkerungs- und Personengeschichte 387. BÖHLAND, Reinhard: Profile aus dem Landkreis Wolfenbütte!. Bürger unserer Zeit. Bertsdorf-Hörnitz S., Abb. (Edition Profile. Profile - Bürger unserer Zeit) 388. DORNACK, Jens: Verzeichnis der Orte im deutschen Raum mit erfaßten Trauregistern. Braunschweig: Verf S. (Quellen u. Schriften z. Bevölkerungsgesch. Norddeutschlands) 389. EDEH, Yawovi Emmanucl: Die Grundlagen der philosophischen Schriften von AllO. In welchem Verhältnis steht Amo zu Christian Wolff, daß man ihn als "einen führenden Wolffianer" bezeichnen kann? Essen: Verl. Die Blaue Eule S. (Philosophie in d. Blauen Eule 53) 390. KRÜGER. Matthias: Ein Mann am Anfang von 75 Jahren Kreismuseumsgeschichte: Kreisdirektor Dr. Erwin B1.ASIL'S. In: Landkr. Helmstedt. Kreisbuch [2003]. S , Abb LAUTERBACH, Irene R.: Hermann BI.U.IIENAU « »- Hermann Trommsdorff « ». Ihr Briefwechsel aus 1841 bis Transkription und Kommentierung. In: Braunschw. Jb. f. Landesgesch. Bd S , Abb. BRAHANDr, Henning s. Nr AHLERS, Rolf: Zur Erinnerung an den 200. Geburtstag des Künstlers. Heinrich BRMVDI;S, Braunschwiger Landschaftsmaler ( ). In: Braunschw. Heimat. Jg. 89, S. 4-6, Abb Die Familie BRFssn aus Klein Bartensleben. Ihre Vorfahren, ihre Nachfahren, die Teilnehmer am Familientreffen in Bad Helmstedt vom August Zsstellung u. Hrsg.: Sigurd BRESSEL. Bornum am Harz: Bressel S., Abb. DEUS, Wolfgang s. Nr. 413 DYKE, Hilbrand van dem s. Nr. 44. GI/'SAU, Herrnann s. Nr Briefwechsel einer Braunschweiger Familie [HAEUSI.ER] aus den Jahren 1841 bis Übetr. u. komment. v. Ditmar HAEusLER. Braunschweig: Stadtarchiv S., Abb. (Quaestiones Brunsvicenses 14) 395. GROBIS, Heike: Peter HAlI17./VG ( ) - ein Deutsch-Japaner im Harz. In: Heimatb!. f. d. süd-west!. Harzrand S , Abb ROST, Falko: August Hf.UE.IIANN, Wilhelm Mertens, Carl Stellin. Drei Kreisbaumeister im Dienst der Verkehrspolitik des Finanzdirektors Philipp von Amsberg zwischen 1819 und In: Hcimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003]. S ,2 Abb THRuL, Peter: Der Clausthaler Wilhelm LAHIIHER - ein Pionier der Elektrotechnik. In: Allgern. Harz-Berg-Kal [2003]. S , Abb SCHEEL, Günter: LEIIINI17. und Reiske über Wolfenbütte1 im Mittelalter. Ein gelehrter Briefwechsel vom Jahre In: Auf dem Weg zur herzoglichen Residenz. Wolfen-
213 216 EwaSchmid büttel im Mittelalter, hrsg. v. Ulrich SCHWARZ. Braunschweig: Appelhans S. (Quellen u. Forschungen z. Braunschw. Landesgesch. 40). S , Abb. LJ.:SS/NG, Gotthold Ephraim s. auch Nr. 234, 236, 238, HILDEBRANDT, Dieter: Lessing. Biographie einer Emanzipation. München: Dt. Taschenbuch-Ver! S. MERnNs, Wilhelm: s. Nr LAMMERS, Uwe: Friedrich August MÖHlUS. In: Braunschw. Heimat. Jg. 89, S , Abb DIESTELMANN, Jürgen: Joachim MÖRLIN. Luthers Kaplan - Papst der Lutheraner. Ein Zeit- und Lebensbild aus dem 16. Jahrhundert. Neuendettelsau: Freimund-Ver! S., Abb SCHWARZ, Ulrich: Ludolf QUIRRE (ca ), Dompropst von Halberstadt. Der langsame Aufstieg eines Bürgers in der Kirche. In: Mitteldeutsche Lebensbilder. Menschen im späten Mittelalter. Hrsg. v. Werner Freitag. Köln [u.a.]: Böhlau S RE/SKE, Johannes s. auch Nr LENT, Dieter: Johannes Reiske und die frühneuzeitlichen Anfänge der Historiographie zur mittelalterlichen Geschichte von Wolfenbüttel. In: Auf dem Weg zur herzoglichen Residenz. Wolfenbüttel im Mittelalter, hrsg. v. Ulrich SCHWARZ. Braunschweig: Appelhans S. (Quellen u. Forschungen z. Braunschw. Landesgesch. 40). S , Abb MAAss, Rainer: "Compliment und Gegencompliment": Ein Bericht Johann Wilhelm RII..'IJESEI5 über seinen Aufenthalt am Braunschweiger Hof aus dem Jahre In: Braunschw. Jb. f. Landesgesch. Bd S SCHIRMER, Hans-Harald: Aus dem Leben meiner Eltern Hans und Luise SCIIIRJIER und aus meinem, ihres Sohnes, in Wolfenbüttel von 1924 bis Von den Lebensbedingungen einer Arbeiterfamilie und ihrer Verwandten in den Kriesenjahren nach der Inflation 1923, unter der Nazidiktatur ab 1933 bis zum Kriegsende 1945 und vom Neubeginn. Stade: Verf S PFINGSTEN, Otto: Dr. Gerhard SWRAOER ( ). Dcr Erfinder des Schädlingsbekämpfungsmittels E 605. In: Braunschw. Heimat. Jg. 89, S , Abb PFINGSTEN, Otto: Dr. Gerhard Schrader: der Erfinder des Schädlingsbekämpfungsmittels E 605. Wendeburg: Uwe Krebs S., Abb. (Wendeburger Heimatkunde 24) 408. KRÜGER, Matthias: Heinrich SCHRAIJER aus Jenrneim der "Priester alles Schönen". Hoforganist, Musikdirektor, Professor. In: Braunschw. Heimat. Jg. 89, S , Abb MOLTMANN-WENDEL, Elisabeth: Macht der Mütterlichkeit. Die Geschichte der Henriette SCIIRAI)EIrBREYMANN. Berlin: Wiehern S STARKE, Günter K. P.: Deutscher Hermann. Ein origineller Typ in der Welfenstadt [Julius SKASA]. In: Braunschw. KaI [2003]. S , Abb BOESTFLEISCH, Rainer: Hans Smf..,ER ( ). Einführung in Leben und Werk. In: Mitteldeutsches Jb. f. Kultur u. Gesch. Bd S SrEtLlN, Carl s. Nr. 396.
214 Bibliographie zur Braunschweigischen Landesgeschichte PANNE, Kathrin: Albrecht Daniel TIIAER. Der Begründer der rationellen Landwirtschaft ( ). In: Braunschw. Heimat. Jg. 89,2. S. 4-8, Abb Schulanfang im Zweiten Weltkrieg - Erinnerungen. (Christian THlfS, Wolfgang Delfs). In: Heimatbuch f. d. Landkr. Wolfenbüttel. Jg [2003). S , Abb LAMMERS, Uwe: Alfred TOllE ( ). "Der Mann, der die Steine zum Reden brachte". In: Braunschw. Heimat. Jg. 89, S , Abb KRÜGER, Matthias: Helmstedts Bürgermeister zur Zeit der Weimarer Republik. Vom Aufstieg und Fall des Dr. Hermann VELKE. Helmstedt: Verf ungez. BI., Abb VOGT, H.: XXIX. Auszug aus der Ahnenliste VUGT. Ahnen der Magdal. Paul. Kleemann aus dem Südharz. CelIe: Verf S.
215
216 Rezensionen und Anzeigen Kirstin Ca sem i r, Die Ortsnamen des Landkreises Wolfenbüttel und der Stadt Salzgitter (Veröffentlichungen des Instituts für Historische Landesforschung der Universität Göttingen 43; Niedersächsisches Ortsnamenbuch III). Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 2003, 635 S., Karten, 34 Der hier anzuzeigende Band (zugleich Diss. Göttingen 2002) ist Teil einer von J. Udolph (Göttingen/ Leipzig) initiierten und herausgegebenen Reihe von Repertorien, die den Ortsnamenschatz Niedersachsens Landkreis für Landkreis historisch-genetisch untersuchen und darstellen. Erschienen sind bislang vier Bändel, weitere sind in Vorbereitung. Unter "Ortsnamen" (ON) werden in dieser Reihe bewußt nur die Siedlungsnamen verstanden, von diesen werden wiederum nur die bis 1500 belegten (einschließlich der WÜstungsnamen) erfaßt. Jüngere Namen (im Untersuchungsgebiet z. B. Kolonie Fümmelse, Monplaisir, Stemhaus) bleiben außcrhalb der Betrachtung. Die breitgefächerte Anlage der Reihe ermöglicht für jeden der behandelten Siedlungsnamen eine Fülle der Belegdarbietung und eine Intensität der Diskussion von Pro und Contra unterschiedlicher Erklärungsansätze, wie sie sonst selten anzutreffen ist. 2 Die Verf.in hat diese günstige Ausgangssituation zu nutzen gewußt: Für jeden ON wird eine - soweit möglich - lange Liste von Belegformen dargeboten, der Quellenwert einzelner Belege bei Bedarf kritisch erörtert, die ältere Forschung ausführlich referiert. Keineswegs ühergangen wird dabei die sog. Laienforschung, die gerade im Falle der ON ja in Ortschroniken, Festschriften zu Dorfjubiläen, älteren Büchern und Aufsätzen zur Volksund Heimatkunde und dergleichen reichlich vorliegt und die bisweilen auch das Richtige in Ansätzen trift, die in der Regel aber die wissenschaftliche Begründung der Namendeutung schuldig bleibt. Nicht einmal die Namendeutungen aus - horribile dictu - H. Bahlows "Deutschlands geographische[r] Namenwelt" (1985), einem Buch, das sämtliche deutschen ON zu Sumpf-, Moder- und Morastbezeichnungen erklären möchte, die aus einer unbekannten Sprache stammen sollen, werden verschwiegen, allerdings dann sofort auch wieder begründet zurückgewiesen. Die von der Verf.in gebotenen eigenen, methodisch sicher erarbeiteten Erklärungen der ON sind in der Entscheidung für oder gegen einen der möglichen Deutungsversuche in erfreulicher Weise abwägend formuliert. Was als eindeutig und sicher gelten kann, wird als solches bezeichnet (z. B. steckt in Sauingen zweifelsfrei die indogerm. Wurzel seu-,saft', enthalten auch in althochdt. sou,saft', neuisländisch söggugur,feucht, naß', weiterhin in dt. saugen, Suppe u.a.m. Sauingen liegt also auf feuchtem Boden). Wo mehrere Deutungen in Betracht kommen, wird dies dargestellt (Rhene kann 1 Außer dem hier vorliegenden Bd. 1II noch: Bd. I: Uwe Ohainski, Jürgen Udolph: Die Ortsnamen der Stadt und des Landkreises Hannover. 1998; Bd. 11: Uwe Ohainski, Jürgen Udolph: Die Ortsnamen des Landkreises Osterode. 2000; Bd. IV: Kirstin Casemir, Uwe Ohainski, Jürgen Udolph: Die Ortsnamen des Landkreises Giittingcn Man vergleiche etwa das (im übrigen vorzügliche) "Historische Ortsnamenbuch von Schieswig-Holstein" von Wolfgang Laur (2. Auf!. Neumünster 1992), das den gesamten ON-Vorrat eines Bundeslandes in einem einzigen Hand abhandelt.
217 220 Rezensionen undanzeigen lauthistorisch problemlos mit Rain,Wegesrand', mit rinnen, mit ON wie z. B. Rheine, aber auch mit isländisch rani,felsnase' in Verbindung gebracht werden); manchmal wird dann einer der Möglichkeiten der Vorzug gegeben, manchmal bleiben sie gleichrangig nebeneinander stehen (wie bei Rhene, Denkte, Destedt). In einzelnen Fällen bleibt nur festzustellen, daß eine sprachhistorische Deutung des betreffenen ONs (bislang) nicht oder nicht sicher möglich ist (so etwa bei den Namen Calbecht und Engelnstedt). Die weitaus überwiegende Zahl der ON des Untersuchungsgebietes findet im vorliegenden Buch aber ihre Erklärung, und in nicht wenigen Fällen bilden die Deutungen der Verf.in die ersten verläßlichen Deutungen des betreffenden ONs überhaupt (z. B. Berel, +Bungenstedt, Cremlingen, Drütte, Gitter, Reppner). Der Innovations- und Informationswert des Buches ist somit beachtlich. Ortsnamen lassen sich nur aus Wörtern derjenigen Sprachen erklären, die in historischer oder prähistorischer Zeit vor Ort einmal gesprochen worden sind. Für das Untersuchungsgebiet sind dies: Mittelniederdt. (seit ca. 1200, bis ca. 1650), Altniederdt.! Altsächsisch (seit ca. 750), voraltsächsisches Germanisch (seit ca. dem 1. Jahrtausend v. ehr.), vorgerm. Indogermanisch (davor). Da die Überlieferung der meisten hiesigen ON in altsächsischer Zeit einsetzt, lassen sie sich oft allein schon mithilfe des überlieferten altsächsischen Wortschatzes erklären. Wo dieser nicht ausreicht, ist es methodisch zulässig, in anderen germ. Sprachen nach Etyma zu suchen, jeweils in der Annahme, daß es das altsächsische Pendant zu einem nur (noch) im Nordgerm., Gotischen, Englischen etc. bekannten Wort auch hierzulande einmal gegeben habe. So enthält z. B. der Name Hedeper ein bei uns untergegangenes Gegenstück zum altengl. Wort bearu,wald'. Wo die Suche innerhalb der germ. Sprachen ergebnislos bleibt, ist der weiter reichende Blick in andere verwandte Sprachen, die indogermanischen, methodisch gestattet. Ein Beispiel hierfür bietet der ON Heiningen, dessen Belege vom 11. bis ins frühe 14. Jh. immer nur Heningen lauten und in dem deshalb nicht das altsächsische Wort hagan,hagen' enthalten sein kann, wie dies bisweilen fälschlich vermutet worden war. Weder aus dem Wortschatz des Altsächsischen noch aus dem der übrigen germ. Sprachen läßt sich nun ein Etymon für den altsächsischen ON Heningen gewinnen, wohl aber gibt es eine indogerm. Wurzel *koino-,gras', die in litauisch sienas,heu' und in bedeutungsgleichen Wörtern anderer baltischer sowie slavischer Sprachen belegt ist. Im Namen Heiningen dürfte deshalb (so die Verf.in) ein frühgerm.wortstamm *hain-,gras, Heu' konserviert sein, der bereits so früh aus dem Wortschatz der germ. Sprachen geschwunden ist, daß er die Epoche ihrer Verschriftlichung nicht mehr erreicht hat. Die Ansetzung eines Etymons für die Erklärung eines ONs hat die Gesetze der historischen Lautentwicklung in den Einzelsprachen zu berücksichtigen, die von Indogermanistik und Germanistik seit dem frühen 19. Jh. bis in unsere Zeit hinein erkannt und formuliert worden sind. Die strenge Beachtung dieser empirisch gewonnenen historischen Lautgesetze muß Grundlage jeder wissenschaftlichen Deutung von ON sein. Bloß impressionistisch wahrgenommene Lautähnlichkeiten (wie die Ähnlichkeit von Heiningen und Hain) sind, wenn sie einer lauthistorischen Überprüfung nicht genügen, unbrauchbar. Die Verf.in ist in dieser Hinsicht mit großer Sorgfalt vorgegangen; der lautgeschichtliche Aspekt der ON-Entwicklung steht jeweils im Zentrum der Diskussion ihrer ON-Artikel. Die Ergebnisse ihrer Untersuchung sind deshalb als insgesamt sehr verläßlich und als dauerhaft einzuschätzen. Der indogermanistische Ansatz der vorliegenden Arbeit führt die Betrachtung der Entstehung der ON z.t. auch in deutlich vorkarolingische Epochen zurück. Dem Blick der historischen Siedlungsgeographie, die kein vergleichbares Erkenntnis-Instrumentarium besitzt, öffnen sich diese in viel geringerem Maße. Die Siedlungsgeographie neigt deshalb dazu, das Gros der hiesigen Dorfgründungen in karolingisch-ottonischer Zeit zu vermuten.
218 Rezensionen undanzeigen 221 In einem Einleitungskapitel, das den Erkenntnisstand der archäologischen Forschung systematisch zusammenfaßt, hält die Verf.in dagegen fest, "daß das Untersuchungsgebiet bereits in vorschriftlicher Zeit breit besiedelt war. Dies gilt insbesondere für die Zeit ab de[r] römischen Kaiserzeit, d. h. seit um Christi Geburt. Eine SiedlungsJcere in der Völkerwanderungszeit konnte anhand der archäologischen Funde nicht festgestellt werden." (S. 35). Im Anschluß an das ZentralkapiteJ, das die Entstehung und Entwicklung der untersuchten ON in alphabetischer Folge ausführlich erörtert, liefert die Verf.in eine gleichfalls alphabetisch gegliederte namenhistorische Analyse der im Untersuchungsgebiet vorkommenden ON-Grundwörter (z. B. beke, berg, dorp, h~m, mar, rode) und ON-Suffixe (z. B. -i/hi, t-suffix, r-suffix). Einen Überblick von solcher Breite und Präzision wird man andernorts kaum finden. Das Buch schließt mit einem kurzen, aber instruktiven Kapitel über die "sekundären differenzierenden Elemente" von ON wie Groten, Lutken, Maiori, Parvo, Wester, Oster etc. und einem Register der in der Arbeit erörterten ON, ON-Varianten und Etyma. Kirstin Casemir hat mit ihrer rundum ergiebigen Dissertation einen gewichtigen Beitrag zur niedersächsischen Ortsnamenforschung geleistet, der von bleibendem Wert ist. Dazu darf man ihr gratulieren. Herbert Blume Thomas D ahm s, Die Hagen von Salzgitter-Gebhardshagen, Braunschweig, Gandersheim und des Klützer Ortes. Eine regionale Vergleichsstudie zur mittelalterlichen Waldund Siedlungsgeschichte in Niedersachsen und Mecklenburg (Salzgitter-Forschungen 4), Salzgitter: Ruth Printmedien Braunschweig 2003, 160 S., Karten, 15 Die Göttinger Dissertation ist Siedlungen mit dem Grundwort -hagen als Bestandteil ihres Ortsnamens gewidmet, dessen Wortbedeutung landläufig ein sehr vielseitiges und unterschiedliches Verständnis gefunden hat. Dieserart benannte Orte werden als hochmittc1alterliche Ausbausiedlungen oft in Verbindung gebracht u. a. mit Merkmalen wie dem sog. Hägerrecht und über die Hagenkolonisation auch mit der besonderen breitstreifigen Ortsbzw. Aurform, wie sie auch die Hagenhufendörfer des Schaumburger Landes aufweisen. Diesen wiederum wird häufig eine direkte genetische Beziehung zu den im mecklenburgisehen Neusiedlungsland ostseenah verbreiteten -hagen-orten wie selbstverständlich unterstellt. Im Vordergrund der Arbeit steht die Frage nach den Bedeutungsinhalten von "Hagen" vor allem hinsichtlich seines Auftretens und seiner Involvierung als Ortsnamens Grundwort. Darüber hinaus wird vermittcjs historischer "Besiedlungsanalyse" unter vertiefter Behandlung regionaler Auswahlfälle kritisch vergleichend die Entwicklung von Hagen-Siedlungsplätzen im nordwestlichen Harzvorland sowie im nördlichen Mecklenburg aufzuzeigen versucht. Dabei weicht die Berücksichtigung exemplarischer Orte etwas von den im Titel genannten ab und legt deren niedersächsischen Schwerpunkt in das nordwestliche Harzvorland überhaupt. Die Gesamtbetrachtung blickt freilich regional sogar über diesen engeren Raum hinaus. An Beispielen mehrerer" Waldhagen" deutet sich als einer der begrifflichen Inhalte von Hagen ein herrschaftliches Verfügungsrecht an ehemaligem Gemeinschaftsland (insbesondere Wald) an, welches ausgesondert wurde, gehegt ("territorialisiert") und womöglich auch besiedelt werden konnte. Manche mit einschlägigem Namen versehene adlige oder fürstliche Vorwerke brauchen demnach gar nicht auf gleichnamige Hagen- oder Hägersiedlungen zurückgeführt werden, sondern können erst später nachgesiedejt worden sein. Als "Burghagen" begegnen solche Waldhagen im näheren Umfeld von Burgplätzen als geradezu selbstverständliches Attribut dem Siedlungskundler häufiger (z. B. der Hagen in Braun-
219 222 Rezensionen undanzeigen schweig bei der Burg Dankwarderode). Ohne vollständig zu sein führt Dahms dafür allein über 30 Exemplarfälle auf. Das Bemühen um inhaltliche Klärung so nahe verwandter aber dennoch unterscheidungsbedürftiger Begriffe wie Hagenrecht, Hegerecht, Hägerrecht kommt in zahlreichen Beispielsfällen durch detaillierte quellennahe Analysen zum Ausdruck. Erheblichen Umfang nimmt die besiedlungshistorische Untersuchung von zehn ausgewählten Hagen-Plätzen im nordwestlichen Harzvorlandes in der Arbeit ein, darunter besonders die salzgitterschen Gebhardshagen und Altenhagen, Wolfshagen im Harz, einige Vorwerke und Wüstungen. Wiewohl die nicht unkomplizierte Materie von den Schriftquellen her durchaus gründlich angegangen wird, können die jeweils angestellten Rekonstruktionsversuche für den örtlichen Entwicklungsablauf dennoch nicht immer überzeugen. Mitunter fehlt es auch einfach an hinreichenden Quellen. Die eingangs der Arbeit angekündigte "interdisziplinäre Forschungsmethode" (S. 15) kommt hier freilich viel zu kurz, wie denn auch der Abdruck einiger (Flur-) Karten eher als Beiwerk und weniger als Quellen-Hilfsmittel erscheint. Die Einbeziehung der Orts- und der Flurformen gerade wegen der oft im Zusammenhang mit Hagen-Orten zu sehenden Breitstreifen würde wesentlich weiter gehende Erkenntnisse erwarten lassen. Und das in noch höherem Maße bei den zu Vergleichen herangezogenen Hagen-Orten des mecklenburgischen Klützer Gebietes, auf deren ansonsten überaus formalistisch geratene Behandlung hier nicht weiter einzugehen ist. Als ein wesentliches (Neben-)Ergebnis sei aber hingewiesen auf die nun nicht mehr aufrecht zu erhaltende Behauptung einer direkten kolonisationsmäßigen Übertragung der Hagenhufendörfer durch die Schaumburger Grafen nach Mecklenburg (Selbst im Holsteiner Wirkungsbereich der Grafen mangelt es an -hagen-orten!). Neben zwei den Band beschließenden Anhang-Teilen mit den Hagen-Geschlechtemamen sowie einem Verzeichnis der Katzenhagen im Harzvorland (Anhang I) und Abdruck einiger Quellen (Anhang 11) sei ganz besonders hingewiesen auf den davor stehenden übersichtlichen subsummarischen "Versuch einer Definition" (Kap. 4.3), durch welchen sich die vorliegende Arbeit für alle künftig an Hagen-Orten und -Namen Interessierten als ein wertvoller Ansatz zu einführender Information und kritischer Auseinandersetzung mit der Hagen-Problematik empfiehlt: Es ergibt sich für "Hagen" eine noch größere als erwartete Vielfalt an Bedeutungen. Es kann bedeuten: "hauen"; "Grenze" (Verhau, lebender Zaun); "Bereich privatrechtlicher Nutzung"; "Grundstück"; "Wald(bezirk)" (= Sunder, herrschaftliches Recht zur Aussonderung, "Territorialisierung"). Hagenrecht meint die Inbesitznahme von Land, wohingegen das Hägerrecht, davon unabhängig entwickelt, lediglich ein besonderes Erb- und Verwaltungsrecht (Hägergericht) darstellt. Wolfgang Meibeyer Bemd Ulrich H u c k er, Otto IV Der wiederentdeckte Kaiser. Eine Biographie (insel taschenbuch 2557). Frankfurt am Main und Leipzig: Insel Verlag 2003, 676 Seiten, Abb., 16 Viele Historiker des 19. und auch noch des 20. Jahrhunderts schrieben die Geschichte des mittelalterlichen römisch-deutschen Kaiserreichs in Dynastien. Die großen Herrschergeschlechter der Ottonen, der Salier, der Staufer sowie der Luxemburger und Habsburger faszinierten so sehr, dass diejenigen Herrscher, die nicht zu ihnen gehörten, bisweilen nur als mehr oder weniger lästige "Zwischenkaiser" oder Gegenkönige aufgefaßt wurden. Inzwischen hat sich der Blick der Mediävistik geweitet, gleichwohl das veraltete Forschungs-
220 Rezensionen undanzeigen 223 bild - wie jüngste Veröffentlichungen zeigen - immer noch nicht ganz überwunden scheint. Ähnlich wie Wolfgang Petke mit seinen Forschungen die neue Sicht auf die Herrscherleistung Kaiser Lothars III. ( ) beförderte, so facettierten die Forschungen von Bernd Ulrich Hucker das Leben und Werk des aus der Familie der Welfen stammenden Kaisers Otto IV. ( ). Mit seiner 1990 in den MGH-Schriften gedruckten Habilitationsschrift "Kaiser Otto IV." weitete der Autor unseren Blick auf diesen europaweit agierenden Herrscher. Diese Arbeit wurde vielerorts, u.a. von dem Rezensenten, dankbar und zugleich kritisch diskutiert. OUo IV. wie auch Lothar BI. wurden danach 1995 im Rahmen der vom Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig organisierten niedersächsischen Landesausstellung "Heinrich der Löwe und seine Zeit. Herrschaft und Repräsentation der Welfen " mit eigenen Ausstellungsabteilungcn gcwürdigt. Auch die vorliegende Arbeit Huckers stellt eine umfassende Darstellung Kaiser OUos IV. dar, ist aber keineswegs nur eine Taschenbuch-Ausgabe des Buchs von Nach einem kurzen Vorwort entwickelt der Verf. in zehn großen Kapiteln seinen Blick auf das Lebcn und die Wirkungen Kaiser OUos IV. Der nun durchgehende chronologische Aufbau erleichtert dabei das Verständnis für die eingefügten Querschnittsthemen. Das erste Kapitel "Alter und Jugend" (S ) spannt den Bogen vom herrscherlichen Selbstverständnis bis zur vornehmen Erziehung des Fürsten am Hofe der Plantagenets. "Der König" (S ), "Ohnmacht" (S ) und "Die Wende" (S ) zeigen die Schwierigkeiten auf, denen die deutschen Herrscher des Mittelalters ausgesetzt waren. Das Kapitel "Der Kaiser ( )" (S ) leitet in diejenigen Bereiche über, die von dem künstlerischen und literarischen Schaffen am Hof OUos IV. sowie von seinem imperialen Anspruch erzählen: "Bau und Kulturblüte" (S ), "Könige treten auf den Plan" (S ), "Der beherrschte und versöhnte Erdkreis" (S ). Das politische und vitale Ende des Herrschers sowie sein Nachleben werden in den Kapiteln "Niedergang " (S ) und "Tod und Nachleben" (S ) gewürdigt. Die große Stärke von Huekers Buch liegt sicher in der Interdisziplinarität seiner Forschungen begründet. Ganz nah an den Originaldenkmälern der Zeit entwickelt er ein umfassendes Bild von der Kaiseridee Ottos IV., die 1214 ihren Höhepunkt erreichte. An die Buchkapitel schließen sich ein besonders für den Laien hilfreiches Glossar mit häufig vorkommenden Personen und Begriffen an sowie drei wichtige Exkurse: zu zeitgenössischen Anspielungen auf Otto IV. in Wolfram von Eschenbachs Parzival-Roman, zur Datierung des "Buchs von den Wundem der Welt" des Gervasius von Tilbury und der vom Vf. präferierten Frühdatierung der Ebstorfer Weltkarte sowie zum Aufbau und zur Tendenz der Chronik Ottos von St. Blasien (1209). Eine vorzügliche Zeittafel, ein übersichtlich geordnetes Verzeichnis der Quellen und Literatur sowie 30 Abbildungsseiten (schwarz/weiß) komplettieren das Werk. Obwohl sich der Autor - wie er selbst im Vorwort schreibt - "um eine Form der Darstellung bemüht, die einen allgemeinen Leserkreis anspricht", weist das Buch am Schluß dennoch einen starken Anmerkungsapparat von 1488 Fußnoten auf. Ein fehlendes Orts- und Personenregister mag der eine oder andere bedauern, es hätte aber wohl auch aufgrund der Komplcxität des Buchcs den Rahmen der Überschaubarkeit gesprengt. Für die wissenschaftliche Welt hat Bernd U1rich Hucker "seinen Kaiser" OUo IV. schon 1990 "wiederentdeckt". Das nun vorliegende Taschenbuch möge dies - wie es der NebentitcI schon ausdrückt - hoffentlich auch für den interessierten Bildungsbürger leisten. Dennoch ist das Buch ein ganz anderes als dasjenige von 1990 geworden. Da der Autor neue Aspckte in seine Darstellung eingebaut und seither erschienene Literatur eingearbeitct bzw. diskutiert hat, ist das Werk gerade auch für Historiker, Kunsthistoriker, Numismatiker und Germanisten von großer Bedeutung. Bernd U1rich Hucker Icgt mit diesem Buch eine neue, relativ erschwingliche Monographie über Kaiser Otto IV. vor, deren Lektüre man
221 224 Rezensionen und Anzeigen breiteren Schichtcn ancmpfehlen kann. Es sollte aber auch für alle Mediävisten eine obligatorische Anschaffung und Lektüre darstellen, um fortgesetzt die vom Vf. entwickelten Thesen zu diskutieren. Claus-Peter Hasse Josef 0 0 ll e (Bearb.), Urkundenbuch der Stadt Braunschweig Bd. 7: (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bramen 215). Hannover: Hahnsche Buchhandlung 2003, 1263 S., 65,50 Mit Band 7 setzt Josef Dolle die Reihe der von ihm bearbeiteten Urkundenbücher der Stadt Braunschweig fort (Bd. 5: , erschienen 1994 s. Braunschw.Jb. 76, 1995, S. 209f. - Bd , erschienen 1998, BraunschwJb. 79,1998, S. 273 ff.). Der Band deckt mit den Jahren eine kritische Phase der Stadtgeschichte ab, die geprägt war von den Umwälzungen der "Großen Schicht" von Bis 1380 zogen sich die Verhandlungen des neuen, "revolutionären" Rates der Stadt mit den anderen hansischen Städten und mit den braunschweigischen Emigranten hin, bis eine Aussöhnung erreicht war. Diese Verhandlungen finden vereinzelt durchaus Niederschlag in dem UB (z. B. NT. 8, 273, , 504, 521 etc.). Wie in den vorangegangenen Bänden wird die ganze Fülle der Überlieferung in chronologischer Folge ausgebreitet. Dabei machen die Urkunden im klassischen Sinn (unter Beachtung bestimmter Formen abgefasste Dokumente über Vorgänge rechtlicher Natur) im Umfang durchaus den Hauptteil der Edition aus. In den meisten Fällen ist der Rat der Stadt Aussteller, aber auch Urkunden der Päpste, Könige, der benachbarten Bischöfe, der welfischen Herzöge, der Oberhäupter kirchlicher Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt, von Adeligen der engeren und weiteren Umgebung, einzelner Braunschweiger Bürger und von Bürgern und Räten anderer Hansestädte fanden Aufnahme in den Band. Die landesherrliche Überlieferung, die im Staatsarchiv Wolfenbüttel aufbewahrt wird, ergänzt die reiche Überlieferung des Stadtarchivs Braunschweig. So konnte der Bearb. dem (Auslauf-)Register Herzog Friedrichs, seit 1381 Herr des Braunschweiger Landes, zahlreiche Urkunden entnehmen, die sonst nicht überliefert sind (seinerzeit von Sudendorf gcdruckt). Ein vergleichbares städtisches Auslaufregister konnte erstmals für den vorliegenden Band ausgewertet werden. Die Findigkeit des Bearb., der auch an entlegenen Stellen dieser bei den Archive Quellen aufspürt, ist bemerkenswert und kann nicht hoch genug gerühmt werden (Beispiele: eine cedula, die eine Salzrente aus Lüneburg betrifft, Nr. 610, oder eine verlorene Herzogsurkunde von 1384 in einem Archivrepertorium von 1541, Nr. 810). So erbrachte auch die Recherchierung in nicht-braunschweigischen Archiven, die naturgemäß nie ganz abgeschlossen sein kann, eine beachtliche Ausbeute (Beispiel: Auflistung verlorener Ware Braunschweiger Kaufleute in Aandern, NT ). Auch wenn vieles an anderer Stelle bereits gedruckt vorliegt, ist doch die Zusammen führung disparater Zeugnisse im vorliegenden UB für den Benutzer von hohem Wert. Neben den Urkunden findet sich in Dolles UB immer wieder zeiuypisches Geschäftsschriftgut in der Form von Briefen, die mit Verschlusssiegel versehen sind (s. Sachindex unter dem Stichwort brer, S. 1194ff.). Sie dokumentieren vor allem die auswärtigen Beziehungen der Stadt. An Bürgertestamenten enthält der Band etwas weniger als der Vorgängerband (s. Bd. 7, Sachindex S. 1250, Bd. 6, Sachindex S. 1152), darunter wieder viele Stücke, die von Mack nicht erfasst worden sind. Die Stadtbücher mit ihren protokollartigen Notizen werden entsprechend dem Schema der vorangegangenen Bände nicht im Zusammenhang ediert, sondern jahresweise in Ab-
222 Rezensionen undanzeigen 225 schnitten dargeboten (jeweils am Beginn des Kalenderjahres). Wer sich einen Eindruck verschaffen will, wie ein solches Stadtbuch aussieht, kann auf die Edition des ersten Gedenkbuches des Gemeinen Rates von Hellfaier zurückgreifen, die ihren Wert behält (Braunschweiger Werkstücke 73, 1989). Dolle zieht neben dem ersten auch das zweite Gedenkbuch des Gemeinen Rates heran, außerdem die sogenannten Degedingbücher der einzelnen Weichbilde, Neubürgerbücher und Verfestungsbücher, soweit erhalten. Wie keine andere Quelle führen die Stadtbücher zu den Bewohnern und ihren Häusern hin, geben Einblick in das Innenleben der Stadt, freilich nur der besitzenden Ober- und Mittelschicht. Die im Bearbeitungszeitraum jetzt erstmals überlieferten Steuerbücher (Schossregister) von 1385 für die Neustadt und von 1387 für die Altstadt hat Dolle allerdings aus guten Gründen beiseite gelassen. Die Überlieferung von Stadtrechnungen ist auch für die Zeit von 1374 bis 1387 nur sehr fragmentarisch (s. Sachindex S. 1239). Ein schmale Kämmereirechnung des Gemeinen Rates stammt von 1384 (Nr. 805), aus der Altstadt ist dagegen eine umfangreiche Kämmereirechnung von 1385 erhalten (Nr. 856). Vor dieser Zeit ist dergleichen nur für die Jahre 1354 und 1355 überliefert (Bd. 5 Nr. 128, 129, 166, 167; Bd. 6 Nr. 905). Im vorliegenden Band ist auch die Kirchenrechnung von St. Ulrici (am Kohlmarkt) hervorzuheben, die Dolle in einem Rechnungsbuch von St. Martini identifizieren konnte (Nr. 98). Als für Braunschweig sensationell wird man ein Verzeichnis der Grundzinse der Altstadt von 1377/78 einstufen (Nr. 246). Es ist zweisprachig (lateinisch-mittelniederdeutsch) überliefert und wird vom Bearb. übersichtlich in parallelen Spalten geboten. Die Bewohner werden einzeln je nach neyburscap (vicinitas) aufgeführt, das sind für die Altstadt St. Michael, Hohes Tor, St. Petri, St. Ulrici. Damit haben wir einen sehr frühen Beleg für die sog. Bauerschaften der Altstadt. Auch die anderen Weichbilde Braunschweigs waren in Bauerschaften eingeteilt, die bis ins 18. Jahrhundert fortbestanden. Dolle bietet in seinem Band ein Quellenmosaik, das aus rund 1200 Einzelstücken besteht, die durchnummeriert sind und im Fall der Stadtbuchabschnitte in einzelne mit Buchstaben gekennzeichnete Absätze aufgegliedert sind. Zahlen und Buchstaben bilden das Bezugssystem für den "Index der Personen- und Ortsnamen" und den "Index der ausgewählten Wörter und Sachen". Diese Indices sind nach dem Muster der vor dem Ersten Weltkrieg erschienenen Bände angelegt und weisen ein so hohes Maß an Differenzierung auf, dass die Benutzung zur Entdeckungsreise wird und "Zahlenfriedhöfe" fast ganz vermieden sind. Allein das Stichwort Braunschweig ist in 21 Abschnitte aufgeteilt, die ein lebendiges Bild der städtischen Topographie ergeben, weil sie sie mit Personen verknüpfen. Auf den Sachindex, der auch Worterklärungen enthält, wurde oben schon im Zusammenhang mit Testamenten und Briefen verwiesen. Zum Begriff Brief (bref), nur das sei ergänzt, führt der Bearb. jeweils Absender und Adressat namentlich an und erschließt dem Benutzer damit eine ganze Quellengattung. Der Bearbeiter, das Stadtarchiv, die Stadt Braunschweig und die Geldgeber seien zu diesem neuen Band des Urkundenbuchs beglückwünscht! Welche Stadt in Niedersachsen kann eine vergleichbare Quellenfülle in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts vorweisen? Ulrich Schwarz
223 226 Rezensionen und Anzeigen Ulrich S c h war z (Hg.), Auf dem Weg zur herzoglichen Residenz. Wolfenbüttel im Mittelalter (Quellen und Forschungen zur braunschweigischen Landesgeschichte 40). Braunschwcig: Appelhans-Verlag 2003,399 S., Abb., 22 (für Mitglieder des Braunschweigischen Geschichtsvereins 14,30 ) Wolfenbüttel: dieser Name steht heute meist synonym für die Herzog August Bibliothek, dcren Begründung im Jahre 1646 zugleich einen Höhepunkt der kulturellen Entwicklung der frühneuzeitlichen Residenz bildet. Aus dieser Zeit stammen Behördenbauten, die für das Bild kleinerer Residenzstädte des 17. und 18. Jhs. so prägend sind: z. B. Neue Kanzlei und Zeughaus (heute Bibliothek). Doch wo liegen die Anfänge der Residenz, wie verlief ihre mittelalterliche Geschichte? Diese Forschungslücke will der vorliegende Band schließen, der sich in einen Aufsatz- und in einen Editionsteil gliedert. Als "hypothetisches Konstrukt" bezeichnet Wolfgang Meibeyer seine Thesen über die frühesten Anfänge W.s (Was war in w., bevor die Herzöge kamen? Die Anfänge von Burg und Siedlung). Mit Hilfe von Befunden der Siedlungskunde und der Ortsnamensforschung datiert M. die Anfänge W.S in die Zeit der Ungarneinfälle des 10. Jhs. und konstruiert einen Zusammenhang mit der sog. Burgenhauordnung König Heinrichs 1., worauf auch die Patrozinien der Longinus- und der Laurentiuskapelle hindeuten. Bevor die Welfen W. zu ihrem Herrschaftsmittelpunkt machten, war die Burg einer von drei Stützpunkten der Ministerialen von Wolfenbüttel-Asseburg im Braunschweiger Land, wie Wolfgang Petke darlegt (Reichstruchseß Gunzelin [t 1255] und die Ministerialen von Wolfenbüttel-Asseburg). Herausragende Bedeutung hatte der Reichstruchsess Gunzelin, der am Hof König Ottos IV. und später auch Friedrichs II. vielfältige Funktionen wahrnahm; er war es auch, der W. nach der Zerstörung durch die Welfen 1192 neu errichtete. In der sog. Asseburger Fehde büßte das Geschlecht die Burg endgültig ein, die 1255 wiederum zerstört wurde und fortan in welfischem Besitz blieb. Die Entwicklung W.s zum welfischen Herrschaftsmittelpunkt untersucht Uwe Ohainski (Von der herzoglichen Niederungsburg zum Herrschaftszentrum des Braunschweiger Landes - Wolfenbüttel von 1283 bis 1432) von den Welfenherzögen wieder aufgebaut, tritt die Burg seit Ende des 13. Jhs. zunehmend als politisches Zentrum hervor, ablesbar an vermehrten Aufenthalten der Landesherren. Diese förderten auch die Marien- und die Longinuskapelle, deren Friihdatierung durch Meibeyer O. zurückweist. Der Wille zur Zentralisierung der Verwaltung und der Hofversorgung zeigt sich an der Einrichtung einer Vogtei, später Großvogtei, mit W. als Mittelpunkt. Die Gründung einer Kalandsbruderschaft Ende des 14. Jhs. an der Marienkapelle diente demgegenüber der Intensivierung des geistlichen Lebens. Der Kaland, der in enger Verbindung zum welfischen Hof stand, hatte zudem, wie Kerstin Rahn schreibt, eine Mittelpunktsfunktion für den Klerus des Landes. Religiöse Hauptaufgabe war die Abhaltung von Memoria, die in erster Linie der herzoglichen Familie zu Gute kam. (Zu Trost und Gewinn... unserer und unserer Kinder Seele. Die Memorialgemeinschaft der Wolfenbütteler Marienbruderschaft im 15. Jh.). Gesine Schwarz analysiert anhand der Wolfenbütteler Rechnungen von die Ernährung am Hof. Aufschlussreiche Ergebnisse gewinnt sie durch den Vergleich der nur vereinzelt erhaltenen Wolfenbütteler Hofhaltungsrechnungen mit denen aus der Lüneburger Residenz Celle. Insgesamt gewinnt man den Eindruck einer sehr üppigen Lebenshaltung (Täglich Brot und Festgelage beim Wolfenbütteler Herzog im 15. Jh.). Der "Baugeschichte der Burg W. im Mittelalter und in der Renaissance" widmet sich Hans-Henning Grote, beschreibt als mittelalterliche Relikte Teile des Hausmanns-, des Schalen- und des Wohnturmes und erschließt mit Hilfe des Holzschnittes von der Belagerung W.s im Jahre 1542 von Lucas Cranaeh eine kleine, von einem Bergfried überragte Kernburg im Südwesten als ältesten Baukörper. Zwei weitgehend unbekannte Geschichtsschreiber behandelt Dieter Lent (Johannes Reiske und die frühneuzeitlichen Anfänge der
224 Rezensionen undanzeigen 227 Historiographie zur mittelalterlichen Geschichte Wolfenbüttels). Johannes Reiske schrieb Ende des 17. Jhs. eine Geschichte W.S in lateinischer Sprache, der Jurist Rudolf August Nolte entwarf 50 Jahre später eine von Karl dem Großen bis ins 18. Jh. reichende Wolfenbütteler Historie, die allerdings nur im Entwurf erhalten ist. Reiske stand in regem brieflichen Austausch mit Leibniz, wie der Aufsatz von Günter Scheel, "Leibniz und Reiske über Wolfenbüttel im Mittelalter. Ein gelehrter Briefwechsel vom Jahre 1687", dem auch die Edition eines bislang unbekannten Briefes von Leibniz beigefügt ist, zeigt. Seiner Edition der "Rechnungen des Wolfenbütteler Amtmanns Hilbrand van dem Dyke " hat Ulrich Schwarz eine Auswertung vorangestellt, in der er Nachrichten über den Schreiber, den Amtmann und Kleriker Hilbrand van dem Dyke, seinen Aufgabenbereich und seinen Aktionsradius, zusammenträgt und die Auswertungsmöglichkeiten der Hofrechnungen in Bezug auf Aufenthalte und Reisen des Welfenherzogs überprüft. Aus den Rechnungen filtert er sodann bestimmte Rubriken wie Botengänge, Bauunterhaltung und Angaben zu den sonst kaum fassbaren Hofbediensteten heraus. Die Edition selbst umfasst knapp 60 Seiten und wird durch verschiedene Indices erschlossen. Das Buch ist mit zahlreichen Abbildungen ausgestattet. Aufsätze und Edition vermitteln ein sehr anschauliches und spannungsreiches Bild von der Vorgeschichte der Residenz Wolfenbüttel und von der Zeit ihrer ersten Ausprägung im 15. Jh. Einziges Monitum sind die verschiedenen Ansätze zur Datierung der Longinus-Kapelle, die den Leser ein wenig ratlos zurücklassen. Brigitte Streich Gerd Biegel u. Hans-Jürgen Derda (Hg.), Blutige Weichenstellung. Massenschlacht und Machtkalkül bei Sievershausen 1553 (Veröffentlichung des Braunschweigischen Landesmuseums 107). Braunschweig: Heckner Wolfenbüttel 2003, 112 S., Abb., 10 Die Darstellung militärischer Ereignisse gehörte nach 1945 jahrzehntelang in die historiographische Schmuddelecke. Dort wollte man sich nicht die Finger schmutzig machen und schon gar nicht in den Ruf geraten, sich für Militärgeschichte zu interessieren. Das hat sich bis heute kaum geändert, obwohl die Einsicht bei manchem Historiker wieder wächst, dass Ereignisgeschichte auch etwas mit Geschichte zu tun hat. Das zu besprechende Buch ist ein Begleitband zu einer vom Braunschweigischen Landesmuseum zusammen mit dem Arbeitskreis für Ortsgeschichte Sievershausen erarbeiteten Ausstellung zum Gedenken an die Schlacht von Sievershausen vom 9. Juli Es ist die Rede von einem Schattendasein, das die Schlacht bei Sievershausen bisher in der Geschichtswissenschaft führte. Überraschenderweise bleibt es aber auch in diesem Werk dabei. Denn die Schlacht selbst wird nur auf lediglich sechs Seiten abgehandelt. Das historische Ereignis, das über Vernachlässigung klagt, erliegt im eigenen Buch einer erdrückenden Übermacht von Nebenkriegsschauplätzen. Das Hauptaugenmerk der Autoren gilt der Vor- und Wirkungsgeschichte der Schlacht. Das politische und religiöse Geschehen im 16. Jahrhundert wird dabei ausführlich dargestellt. Ausstellungsmacher schöpfen in der Regel von der vorliegenden Literatur und Handbuchwissen, ohne selbst in neue Forschungen zu investieren. Über weite Strecken folgt das Buch diesem Prinzip, bietet aber auch Ausnahmen. Einen originellen Aspekt des Buches stellt die kunstgeschichtliche Interpretation von Männerporträts in Rüstungen von Peter Bessin dar. Nur scheinbar unerwartet ist der Beitrag von Friedrich Wagnitz über den ersten Lebensabschnitt des Herzogs Julius ( ). Immerhin hat dieser seine Regierung der Schlacht bei Sievershausen zu verdanken. Denn da seine älteren Brüder dort fielen, kam er an die Reihe, das Herzogtum zu regieren. Diese biographi-
225 228 Rezensionen undanzeigen sche Skizze sollte zu weiteren Forschungen anregen, zumal sie selbst nicht ganz wissenschaftliches Niveau erreicht. Raum wird auch der interessanten Rezeptionsgeschichte der Schlacht geboten. Die verschiedenen Formen der Gedenkfeiern sind interessante Beispiele dafür, wie man in Deutschland mit Geschichte in den letzten 150 Jahren umging. Die (werbewirksame) Einstufung der Schlacht als blutigste Schlacht des 16. Jahrhunderts auf deutschem Boden ist Teil dieser Wirkungsgeschichte und wird in dem Buch wiederholt aufgegriffen. Sie scheint aber offensichtlich falsch zu sein, wenn man die Opferzahlen der großen Bauernkriegsschlachten heranzieht. Zumindest die Schlacht bei Frankenhausen hat mit großer Wahrscheinlichkeit mehr Opfer gefordert. Aber dies nur am Rande. Natürlich ist es etwas zynisch, der einen Schlacht den makabren blutigen Superlativ zu nehmen, um es einer anderen anzuhängen. Aber diese althergebrachte "Spitzenposition" von Sievershausen hat wohl auch damit zu tun, dass hier im Vergleich zu den Bauernkriegsschlachten sehr viele Adlige den Tod fanden. Damit steht eine Ungleichgewichtung von Menschenleben im Raum, die wir eigentlich überwunden glaubten. Deshalb ist eine Korrektur dieser Wertung vielleicht weniger zynisch, als sie so stehen zu lassen. Trotz dieser Anmerkungen hahen Ausstellung und Begleitbuch ein wichtiges Ziel erreicht: Ein breiteres Publikum für Sievershausen und die historischen Zusammenhänge des 16. Jahrhunderts zu interessieren. Martin Fimpel Martin B re ch t, J.V. Andreae und Herzog August zu Braunschweig-Lüneburg. Ihr Briefwechsel und ihr Umfeld (Oavis Pansophiae. Eine Bibliothek der Universalwissenschaften in Renaissance und Barock 8). Stuttgart-Bad Cannstatt: Friedrich Frommann Verlag. Günther Holzboog 2003, 295 S., Abb., 56 Auch die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts war eine Blütezeit des intellektuellen Briefwechsels. Gelehrte pflegten häufig europaweite Kontakte zu Briefpartnern, die überaus wertvolle Einblicke in das damalige politische und kulturelle Zeitgeschehen erlauben. Dazu zählt auch die Korrespondenz zwischen dem berühmten württembergischen Theologen Johann Valentin Andreae ( ) und Herzog August von Braunschweig-Wolfenbüttel ( ). Beide waren herausragende Persönlichkeiten ihrer Zeit. Für Herzog August schien die Aussicht, selbst zur Regierung zu kommen, lange Zeit nicht zu bestehen. Erst im fortgeschrittenen Alter von 55 Jahren wurde er mitten im Dreißigjährigen Krieg - Herzog des jetzt stark verkleinerten Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel. Nach seinem Studium, vor allem in Tübingen, und europaweiten Bildungsreisen residierte er drei Jahrzehnte lang im abgeschiedenen Hitzacker, wo er viel Muße hatte, sich seinen vielseitigen Interessen zu widmen. Die kulturhistorische Leistung Augusts bestand in der in Tübingen begonnenen und dann ständig fortgesetzten bibliophilen Sammlungstätigkeit mit dem Ziel, eine universale Bibliothek einschließlich eines reichen Handschriftenbestands zu schaffen. Die auf ihn zurückgehende und nach ihm benannte Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel zählt noch heute zu den bedeutendsten Bibliotheken der Welt. Ein weiteres wichtiges Interessengebiet von Herzog August war die Theologie und speziell die Bibelwissenschaft. In den politischen und religiösen Wirren seiner Zeit galt er als Mann des Ausgleichs und der Verständigung zwischen den Konfessionen. Theologisch war Herzog August von der Tübinger Orthodoxie geprägt, wandte sich aber auch der von dieser verfolgten Erbauungstheologie des zeitweiligen Generalsuperintendenten von Lüneburg, Johann Arndt, zu. Der gemeinsame Tübinger Hintergrund und die Verteidigung Amdts gcgen die protestantische Orthodoxie bildeten die wichtigsten Brücken zwischen
226 Rezensionen undanzeigen 229 Herzog August und Johann Valentin Andreae, der Ende der 1630er Jahre zum Konsistorialrat und Hofprediger in Stuttgart aufgestiegen war. Bemerkenswerterweise haben sich heide nie gesehen. Ihre Beziehung blieb eine reine Brieffreundschaft. Sie entstand nach einem vereinzelt gebliebenen Brief Andreaes von 1630 erst ein Jahrzehnt später 1640 auf Initiative Herzog Augusts. Dieser erarbeitete persönlich eine Evangelienharmonie, deren ersten Teil er Andreae zukommen ließ. So entstand eine enge Beziehung, die sich in über 1200 gegenseitigen Briefen ausdrückte. Beide profitierten aber nicht nur durch den geistigen Austausch voneinander. Andreae wurde von Herzog August zum Geistlichen Rat ernannt und erhielt dafür 400 Reichstaler im Jahr, ohne das Amt wirklich vor Ort auszuüben. Dafür entwickelte Andreae eine vielseitige Agententätigkeit, um für den Herzog Bücher, Kunstgegenstände und nicht zuletzt auch Musikinstrumente für dessen Sammlungen zu besorgen. Brecht ist emeritierter Münsteraner Kirchenhistoriker, aber sein Schwerpunkt liegt auch auf der württemhergischen Kirchengeschichte. Entsprechend wertet er den Briefwechsel stärker aus württembergischer Sicht aus. Dieser Schwerpunkt liegt aber auch daran, dass der Herzog sich aus Zeitmangel meist erheblich kürzer fasst als Andreae und weniger Informationen in seinen meist eigenhändig geschriebenen Briefen bietet. Dennoch wird das bisherige Bild des Herzogs, über den, wie für die Mehrzahl der braunschweigisehen Herzöge, noch keine wissenschaftliche Biographie vorliegt, um wertvolle Details ergänzt. Wenn man es gewohnt ist, die herzogliche Sphäre nur an hand von Verwaltungsakten zu erkunden, tut es gut, auch auf einen solchen Schatz an persönlichen, ja intimen Äußerungen zurückgreifen zu können. Breiten Raum nehmen die Schilderungen der Kriegsverhältnisse bei beiden Korrespondenzpartnern ein. Einquartierungen und Truppendurchzüge belasteten sowohl Württemberg als auch Braunschweig-Wolfenbüttel. Andreae selbst wurde Opfer des Krieges und verlor bei der Zerstörung Calws Hab und Gut, nicht zuletzt seine wertvolle Bibliothek. Diese Erfahrungen und die enge Beziehung zu seinem gelehrten Briefpartner Herzog August haben Andreae veranlasst, seinen literarischen Nachlass und zahlreiche seiner Bücher dem Herzog für seine Bibliothek zu überlassen. Da sich dort jedoch nur wenige für den württembergischen Theologen interessierten, ist der Nachlass lange in Vergessenheit geraten. Erst Brecht hat ihn systematisch ausgewertet und kommt zur neuen Erkenntnis, dass das letzte Drittel von Andreaes Leben an geistiger Schaffenskraft den vorangegangenen Lebensabschnitten in nichts nachstand. Der Verfasser lässt den lateinunkundigen Leser nicht mit den zahlreich gebotenen Briefzitaten allein, sondern bietet, wann immer notwendig, Übersetzungen dieser Passagen. Die wissenschaftliche Auswertung Brechts ist heeindruckend. Es gelingt ihm, die komplizierten Briefinhalte durch sein herausragendes Hintergrundwissen über das wissenschaftliche und politische Geschehen in der Mitte des 17. Jahrhunderts verständlich und souverän zu präsentieren. Auffallend ist jedoch, dass sich dieses Wissen kaum in Hinweisen auf einschlägige Forschungsliteratur niederschlägt. An eine Edition des Briefwechsels wagte sich Brecht angesichts der Fülle des Materials nicht heran. Aber vielleicht kann er mit seinem Buch andere dazu ermutigen, in dieser Richtung zu denken. Martin Fimpel
227 230 Rezensionen undanzeigen Hans-Joachim Kr ase h e w ski, Betriebsablauf und Arbeitsverfassung des Goslarer Bergbaus am Rammelsberg vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum 115: Montanregion Harz 5). Bochum: Deutsches Bergbau-Museum S., Abb., 23 Die vorliegende Studie von Hans-Joachim Kraschewski behandelt den Bergbau am Rammelsberg vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Diese Arbeit wurde im Rahmen des von Professor Dr. Kar! Heinrich Kaufhold geleiteten Forschungsschwerpunktes zum Harzer Montanwesen erstellt, die in der von Christoph BarteIs, Karl Heinrich Kaufhold und Rainer Slotta herausgegebenen neuen Reihe "Montanregion Harz" als fünfter Band erschienen ist. Kraschewskis Ausführungen basieren auf der Auswertung der einschlägigen Archive in Oausthal-Zellerfeld, Goslar, Hannover, Marburg, Weimar und Wolfenbüttel sowie der Bestände der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Die Forschungsergebnisse seiner bereits zahlreich erschienenen Publikationen zum Harzer Montanwesen sind mit in dieser Studie einbezogen worden. Die Monografie zählt sechs systematisch gegliederte Kapitel. Der Anhang umfasst drei ausführliche Quellenauszüge, ein Verzeichnis über Münzen, Maße und Gewichte und ein nach Orten, Personen, Sachen und Gruben unterteiltes Stichwortverzeichnis. Zahlreiche Tabellen und Abbildungen veranschaulichen die schriftlichen Ausführungen. Diese formalen Kriterien bieten dem Leser einen direkten Zugang zu den vorgelegten Forschungsergebnissen. Der Rammelsberg bei Goslar gilt gemeinhin als die Ikone des Harzer Montanwesens. Das 16. Jahrhundert stellte für den Bergbau am Rammelsberg bei Goslar eine Epoche der strukturellen Veränderungen dar, dessen Zäsur im Jahre 1552 liegt, als der braunschweigwolfenbüttelsche Landesherr Herzog Heinrich der Jüngere mit dem Riechenberger Vertrag der freien Reichsstadt Goslar seine Bedingungen aufzwang. Die Stadt verlor die Obrigkeit, Jurisdiktion, Vogtei und den Gerichtszwang, das Vorkaufsrecht und die Verwaltung am Rammelsberg sowie fast alle Nutzungsrechte an den umliegenden Forsten. Die Auswirkungen dieser Umbruchperiode können für die Arbeiter und Gewerken am Rammelsberg wie folgt umschreiben werden: Vom Lehnhäuer zum Lohnarbeiter, vom klein räumlichen Grubenteil zum umfassenden Bergwerksbetrieb, von der privatrechtlichen Verfügungsrnacht über den einzelnen Bergteilbesitz mit dessen selbst erarbeiteten Erträgen bis hin zur landesherrschaftiichen geregelten und finanzierten Betriebsorganisation. Kraschewski analysiert in seinen sechs Kapiteln diesen spannungsreichen Transformationsprozess von der Mitte des 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts sehr differenziert, wobei die beiden Seiten Arbeiter und Gewerken besondere Berücksichtigung finden. Die konkrete Arbeitsplatzstruktur mit breit gefächerten Entscheidungsräumen für den einzelnen Bergmann wie für Gruppen unter Tage änderte sich unter den Bedingungen des Direktionsprinzips nur wenig. Dahingegen wurde der gesamte Bergwerksbetrieb in ein vorstaatliches reguliertes Unternehmen im Laufe der Zeit umgewandelt, indem sich die Lohnarbeit konsequent durchsetzen ließ: Aus ursprünglichen freien Bergleuten wurden lohnabhängige Bergarbeiter. Der Rat der reichsfreien Stadt Goslar, der nach den braunschweig-wolfenbüttelschen Herzögen weiterhin der größte Privatgewerke am Rammelsberg war, unterlag völlig den landesherrlichen Zugriffen und Direktiven, wodurch er in allen betrieblichen Fragen von den Entscheidungen der Bergämter in Zellerfeld und Goslar abhängig war. Das Direktionsprinzip transformierte die Goslarer Gewerken zu bloßen Geldgebern, die aus der Unternehmensführung verdrängt und nur noch auf den Besitz verhandcibarer Anteilsscheine von Gruben reduziert wurden. Die landesherrschaftliche Bergverwaltung verweigerte der
228 Rezensionen und Anzeigen 231 Stadt jegliche unternehmerisehe Entscheidung, wie z. B. bei der Festsetzung der Erzpreise. Sie diktierte den städtischen Gruben den Preis, sodass sie unrentabel arbeiten mussten und auf ständige Zuschüsse der Stadt angewiesen waren. Der vorliegende Band liefert wesentliche neue Erkenntnisse über den Bergbau am Rammelsberg für das 16. bis 18. Jahrhundert. Summa summarum: Kraschewski hat mit seiner fundierten und quellengesättigten Arbeit eine weitere Forschungslücke geschlossen und trägt somit zum besseren identifikationsfördernden Verständnis dieser über Jahrhunderte vom Montanwesen geprägten Region bei. Michael Fessner Michael Fes s n er, Angelika Fr i e d r ich, Christoph Bar tel s, "Gründliche Abbildung des uralten Bergwerks". Eine virtuelle Reise durch den historischen Harzbergbau (Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum 107: Montanregion Harz 3). CD u. Textband. Bochum: Deutsches Bergbau-Museum S., 1 CD ROM,28 Die zu rezensierende Arbeit (CD-ROM und Begleitband) entstand im Rahmen eines Forschungsprojektes zum Schwerpunkt "Harzer Montangeschichte" in einer Kooperation des Deutschen Bergbau-Museums in Bochum und des Rammelsberger Bergbaumuseums in Goslar. Ziel war es, eine Reihe von Grubenrissen, Plänen und Karten des historischen Harzbergbaus, d. h. Oberharz und Rammelsberg, aus dem 17. und 18. Jahrhundert mit Hilfe der modernen Möglichkeiten der Informationstechnologie für die Benutzer aufzubereiten und darzubieten. Während die Begleittexte auf der CD und der Textband von Michael Fessner (Hüttenwesen) und Christoph Barteis (Bergbau) erstellt wurden, sorgte Angelika Friedrich für die Digitalisierung der historischen Bildquellen. Dabei war eine Bearbeitung der z.t. großformatigen Risse und Karten notwendig. Einzelne Pläne existieren nur in Buchform, können im Original vom Betrachter nur nach und nach rezipiert werden. Die teilweise in mehreren einzelnen Blättern existierenden Grubenrisse wurden für die vorliegende CD-ROM ohne siehtharen Spuren aneinandergefügt. Einzelheiten, etwa winzige Bergleute vor Ort, Maschinen, Stollen, Schächte und Gebäude lassen sich nun mit Hilfe elektronischer Werkzeuge vergrößern oder verkleinern. Ohne Blättern fährt man zu den einzelnen Objekten hin, die für eine Obduktion ausgewählt wurden. Die Möglichkeiten, die die CD-ROM dem Benutzer zur Interaktion mit den beigegebenen Bildmedien bietet, gehen weit über eine bloße Abbildung des ausgewählten historischen Bildmaterials hinaus. So bieten beispielsweise die drei großformatigen Grubenrisse von Zaeharias Koch (Markscheider) und Daniel Lindemeir (Kupferstecher) aus dem Jahr 1606 mit einer Darstellung des Oberharzer Bergbaus zwischen Wildemann und Zellerfeld sowie die beiden Risse von Daniel Flach von 1661 (Zellerfelder Gangzug) und Adam IIIig von 1661 (Burgstätter Gangzug) eine zweidimensionale Abbildung der Grubengebäude im Maßstab von 1:500. Details, z. B. arbeitende Bergleute vor Ort, wichtige Maschinen und Gebäude wurden dagegen z.t. im Maßstab 1: 100 oder 1:200 wiedergegeben. Als sich die reichen Silbererzlagerstätten ab der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts erschöpften und man auf die ärmeren silberhaitigen Bleierze zurückgreifen musste, bedingte dies eine Ausdehnung der Grubengebäude in immer größere Teufen, die Anlage neuer saigerer Schächte und/oder den Ausbau von tief gelegenen Wasserlösungsstollen. Dies führte zu einer stetigen Erweiterung der Grubengebäude, was sich auf der CD-ROM mit Hilfe der Computeranimation, denen zusätzlich noch die Originalpläne unterlegt werden können, nachvollziehen läßt.
229 232 Rezensionen und Anzeigen Besonders deutlich werden die Möglichkeiten der Digitalisierung von historischen Karten bei der Nutzung der Wasserkraft. Zwischen 1640 und 1680 erbaute man im Oberharz insgesamt 28 neue Stauteiche mit nahezu vier Millionen m 3 Speichervolumen. Das Wasser wurde über Kanäle, Stollen und Schächte auf diverse Kunst- und Kehrräder verteilt. Durch die Animation mit Fließgraphiken wird deutlich, dass hier nicht nur einzelne Wasserräder hintereinander gesetzt betrieben wurden, sondern dass versierte Techniker im 17. und 18. Jahrhundert ein Verbundsystem geschaffen hatten, das mit Hilfe der Wasserkraftmaschinen den gestiegenen Anforderungen an die Wasserhaltung bei zunehmender Teufe sowie der Förderung der Erze und Berge gewachsen war. Der Begleitband recherchiert die montanhistorischen Hintergründe während des 17. und 18. Jahrhunderts, also im Entstehungszeitraum der verwendeten Grubenrisse, Pläne und Karten. Dabei wird die Geschichte der Berg- und Hüttenwesens im nordwestlichen Harzraum erläutert, wobei die frühesten archäologischen Funde mittlerweile Bergbau und Verhüttungstätigkeit im Oberharz und am Rammelsberg bereits seit dem 3. Jahrhundert n. Chr. belegen. Der Leser findet ebenso ausführliche Informationen zu den naturräumlichen Voraussetzungen (S.27-32), zum Markscheidewesen (S.63-70), Hüttenwesen (S ), zur Holzwirtschaft im Harz (S ) oder zur Wasserhaltung und Wasserwirtschaft (S ). Einzeln vorgestellt werden die bergbaulichen Aktivitäten auf dem Zellerfelder Gangzug, auf dem Burgstätter Gangzug und am Rammelsberg vom 16. bis 18. Jahrhundert. Die CD-ROM kann auf jedem handelsüblichen PC gestartet werden. Ein Arbeitsspeicher von 128 MB RAM und eine Grafikkarte mit 32 MB sind empfehlenswert. Man sollte allerdings darauf achten, dass der Monitor eine Auflösung mit 1024 x 768 Pixel aufweist, damit alle Schaltflächen zur Navigation sichtbar sind. Den Autoren ist eine überaus gelungene digitale Präsentation historischen Bildmaterials in Verbindung mit einem wissenschaftlich breit angelegten und informativen Begleitband geglückt. Die beigefügte CD-ROM ist weit mehr als nur ein digitales Bilderbuch. Die "virtuelle Reise durch den historischen Harzbergbau" hält auch für die wissenschaftliche Forschung noch einige Überraschungen bereit. Die Kombination von Begleitband und CD ROM setzt dabei neue Maßstäbe. Andreas Bingener Christian Li P P e I t und Gerhard S chi I d t (Hg.), Braunschweig-Wolfenbüttel in der Frühen Neuzeit. Neue historische Forschungen (Quellen und Forschungen zur Braunschweigischen Landesgeschichte 41). Braunschweig: Appelhans Verlag 2003, 246 S., 19 (für Mitglieder des Braunschweigischen Geschichtsvereins 12,35 ) Die Geschichte des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel in der Frühen Neuzeit ist trotz zahlreicher Arbeiten und einer hervorragenden Überlieferung immer noch vergleichsweise wenig erforscht. Um so erfreulicher ist es, dass sich eine Tagung des Historischen Seminars der TU Braunschweig im Oktober 2002 um eine Standortbestimmung der Braunschweigischen Frühneuzeitforschung bemüht hat und ihre Ergebnisse auch veröffentlicht hat. Die Herausgeber sind sich bewusst, dass sich mit diesem Band die Lücken in der frühneuzeitlichen Forschung Braunschweigs kaum schließen lassen. Aber es sind Beiträge dabei, die viele Entwicklungen zumindest streifen: Verwaltung, Militär, Kirche, Wirtschaft, Agrarstruktur, Bildung, Architektur. Die "Hauptlast" der Tagungsbeiträge wird von jungen Historikern geschultert, die hier meist Vorarbeiten aus ihren Dissertationsprojekten vorstellen. Das hat den Nachteil, dass vielfach Beiträge mit vorläufigem
230 Rezensionen und Anzeigen 233 Charakter präsentiert werden. Dennoch ist dieses Buch wichtig, weil es Forschungstendenzen aufzeigt und eine Fülle von wichtigen Thesen, Literaturhinweisen und Beurteilungen bereits vorliegender Studien bietet. In seinem Beitrag zur Verwaltungs ge schi eh te geht Christian Lippelt einen Weg, der für das Fürstentum Braunschweig noch neu, andernorts aber schon vielfach erprobt ist. Er fragt nach Rolle der Ämter im territorialen Modernisierungsprozess. Zu erfahren, "was wirklich unten ankam", die Umsetzung von Entscheidungen der Zentralverwaltung, ist sicher ein lohnendes Ziel. Lange wurden die Ämter zugunsten der Zentral verwaltung von den Historikern vernachlässigt. Aber auf Amtsebene zeigt sich doch erst, was die Zentrale wert ist, welche Wirkung sie im Land entfalten konnte. Rainer Jacobs skizziert die Entwicklung der braunschweigischen Militärverwaltung des 17. und 18. Jh. Die Söldner- und Kompaniewirtschaft, die dem Kompaniechef fast mehr Rechte gegenüber dem einfachen Soldaten einräumte als dem Landesherrn, wird im Laufe des späten 17. Jh. durch eine planvollere Verwaltung abgelöst. Dennoch verblieb das Militär weitgehend in der Selbstverwaltung. Die Offiziere mit Kommandogewalt agierten bis 1806 als selbständige Unternehmer. Diese "Privatisierung" der Truppe sparte Verwaltungskosten und erleichterte für die Herzöge auch die Verleihung der Soldaten an das Ausland. Eine starke Bindung an einen Landesherrn oder gar an ein Land existierte noch nicht. Es war ein flexibles System, das so ganz anders geartet war als die nationalstaatlichen Armeen des 19. und 20. Jahrhunderts. Sabine Bockischs Aufsatz über die Landeskirche wirft zunächst einen Blick auf die kirchliche Situation unter Herzog Heinrich dem Jüngeren. Hier zeigt sich, dass nicht erst die Reformation das landesherrliche Kirchenregiment hervorbrachte. Vielmehr gab es dazu schon Ansätze in früheren Jahrhunderten, und Heinrich der Jüngere war auf dem Weg zu einer Art katholischer Landeskirche mit nur noch wenigen bischöflichen Eingriffsmöglichkeiten. Nach der Einführung der Reformation unter Herzog Julius entwickelte sich die kirchliche Verwaltung zunächst im direkten Kontakt mit dem Landesherrn. Zunehmend verlor sie aber die Verbindung zum Fürsten und geriet unter die Dominanz der weltlichen Administration. Die Folge war nicht zuletzt eine Vernachlässigung kirchlicher Kernaufgaben. Viktor- L. Siemers' Untersuchung zu den braunschweigischen Papiermühlen ist deshalb aufschlussreich, weil sie nicht nur einen Zustand in einem bestimmten engen Zeitraum beschreibt, sondern Epochengrenzen überschreitet und nach langfristigen Entwicklungen fragt. Siemers stellt die wichtige Frage nach der Zukunftssicherheit des Gewerbes im 19. Jahrhundert und erklärt, warum die Antwort negativ ausfallen muss. Kapitalkräftige, risikofreudige Kaufleute, die in neue Technologien, in diesem Fall konkret in Papiermaschinen aus England, investierten, fehlten im Land. So blieb man bei der Handpapiermacherei stehen und wurde unversehens von der flexibleren schwäbischen Konkurrenz überrollt. Siemers kritisiert dabei die merkantilistische Politik, welche die Konkurrenz im Land weitgehend ausschaltete, indem sie den Papiermüllern bestimmte Bezirke zuteilte, in denen sie allein die vorhandenen Lumpen verarbeiten durften. Diese Politik, so Siemers, hinderte die Zukunftssicherheit des Gewerbes. Für manchen wird diese Kritik gerade mit ängstlichem Blick auf die heutige wirtschaftliche Entwicklung zu hart ausfallen. Die Sehnsucht nach einem Staat, der noch Möglichkeiten besaß, Konkurrenzdruck und Konzentrationsprozesse zu mildern, wächst. Einen sehr verdienstvollen kritischen Blick auf die territoriale Rechnungslegung wirft der Aufsatz von Manuela Sissakis. Sie hinterfragt die manchmal allzu naive und bequeme Zahlenhörigkeit von Historikern und fordert Misstrauen faktisch gegenüber jeder überlieferten Zahl in den frühneuzeitlichen Rechnungen. Bei aller Skepsis bietet sie aber auch In-
231 234 Rezensionen und Anzeigen terpretationshilfen an, um das diffuse Bild der Rechnungen doch noch einigermaßen in den Griff zu bekommen. Thomas Krueger widmet sich den bislang vernachlässigten wirtschaftsgeschichtlichen Aspektcn des Wcserdistrikts des Herzogtums Braunschweig. Exemplarisch untersucht er fiskalische Betriebe der Eisen- und Glasverhüttung (bei Delligsen und Grünenplan) sowie die berühmte Fürstenberger Porzellanmanufaktur. Wichtig ist bei seinem methodischen Ansatz das Auge für die Vernetzung dieser Betriebe untereinander und speziell dcr Einfluss der Zentral- und Forstverwaltung auf den wirtschaftlichen Erfolg. Hervorzuheben ist dabei auch, dass Krüger der oft so entmenschlichten Wirtschaftsgeschichte ein Gesicht verleiht, indcm er sie mit Personen verknüpft. Peter Bessins Aufsatz beschäftigt sich mit zwei fürstlichen Bauprojekten: dem Sternhaus bei Wolfenbütte1 und Schloss Richmond in Braunschweig. Er analysiert dabei die landesherrliche Motive für Bau und Ausgestaltung der Objekte und stellt sie in den kunstgeschichtlichen Zusammenhang ihrer Zeit. Während das Stemhaus nach dem Vorbild eines privaten Rückzugschlösschens Ludwigs XIV. konzipiert ist, war Richmond an englischen Vorbildern orientiert und betrat damit Neuland in Deutschland. Roland Olthoffs Arbeit setzt die in ganz Deutschland verbreitete Forschung über die Alphabetisierung für Teile des Herzogtums Braunschweig um. Die Signierfähigkeit der Bevölkerung als Indiz für deren Bildungsstand zu werten, ist eine mittlerweile anerkannte Methode. Spannend ist dabei nicht nur das Verhältnis zwischen Alpha- und Analphabeten eincr Region, sondern vor allem auch die Ursachen, welche das Verhältnis bestimmen. Olthoff bietet eine Vielzahl von Erklärungen. Ihn interessiert der Zusammenhang zwischen Fruchtbarkeit der Böden und Lesefähigkeit und damit zwischen Bildung und Reichtum der Bauern ebenso wie die Effizienz von Bildungsprogrammcn dcr frühneuzeitlichen Regierungen. OIaf März stellt die Frage nach den sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Stadt und Land im braunschweigischen Weserdistrikt. Er sieht seinen Beitrag auch verknüpft mit dem Forschungsziel, dass der ländliche Raum nicht weiter durch die moderne Historiographie vernachlässigt wird. Und es ist gerade der Raum und nicht der einzelne Ort, um den es geht. Zu Recht kritisicrt März, dass Ortsgeschichten in den überwiegenden Fällen ignorieren, dass Orte in einem Siedlungskontext standen und stehen, der ihre Entwicklung entscheidend beeinflusste. Als Quellengrundlage dient ihm die Braunschweigische Landesaufnahme aus der Mitte des 18. Jh., die eine Fülle von aussagekräftigen Datcn über die dörfliche und städtische Entwicklung bietet. Andreas Kulhawy widmet sich der Rolle des herzoglichen Leihhauses im 19. Jahrhundert. Als staatliches Kreditinstitut sollte es im 19. Jh. eine wichtige Rolle spielen vor allem bei der Finanzierung der Ablösung, der Staatseisenbahnen und der Realisierung kommunaler Vorhaben, welche die Urbanisierung des Herzogtums entscheidend voran brachten. Es fällt auf, dass Investitionen in industrielle Projekte auch in der ersten Hochphase der Industrialisierung keine Bedeutung hatte. Michael Fessner fragt nach dem ökonomischen Erfolg der Rammelsberger Schmelzhütten und weist nach, dass der Niedergang bereits Ende des 16. Jahrhunderts einsetzte. Hauptursachen dafür waren der hohe Holzbedarf der Verhüttung und die schwindenden Holzressourcen im Harz. Die Braunschweigische Gesangbuchreform des 18. Jahrhunderts, die Barbara Stroeve untersucht, stand ganz im Zeichen der Aufklärung. Wenn man fragt, wo Aufklärung wirklich den gemeinen Mann erreichte, so hier in dcr Kirchc. Die Reform sortierte das lateinische Liedgut aus und integrierte viele Texte aufklärerischer Dichter in die Liturgie. Was der doch einem relativ kleinen adeligen und bürgerlichen Kreis vorbehaltene Aufklärung sonst
232 Rezensionen undanzeigen 235 nicht gelang, im Gesangbuch überschritt sie die Grenze hin zum Volk - mit allerdings zweifelhaftem Erfolg. Ewa Herfordt zeichnet ein Bild von der französischen Besatzungszeit in Braunschweig Wolfenbüttel während des Siebenjährigen Kriegs. Als "fremde Gäste" wurden die Franzosen dabei eingestuft. Dies zeigt an, dass es um eine ziemlich milde Besatzung handelte. Das französische Kriegskommissariat war im Vergleich zu anderen Armeen hervorragend organisiert. Planvoll und deshalb sehr schonend für die Zivilbevölkerung wurden Magazine angelegt und die Zusammenarbeit mit den lokalen Amtsträgern gesucht. So wurde eine zügellose Soldateska vermieden und die Lastenverteilung relativ gerecht organisiert. Das Chaos des Dreißigjährigen Krieges wiederholte sich aufgrund dieser neuen Form der Truppenverpflegung und Disziplinierung nicht, auch wenn längst nicht alle Armeen das französische Niveau in dieser Hinsicht erreichten. Wertvoll an diesem Band ist, wie gesagt, nicht zuletzt die breite Diskussion von jüngerer Forschungsliteratur. Dennoch fällt auf, dass vergleichsweise wenig landesgeschichtliche Forschungen aus anderen Regionen herangezogen werden. Insbesondere die süddeutsche Landesgeschichte, die eine Fülle von vergleichbaren Methoden, Fragestellungen und Auswertungen liefert, wird nahezu völlig ausgeblendet. Das Beharrungsvermögen der These, Nord- und Süddeutschland hätten eigentlich nichts miteinander zu tun, wird gerade auch unter Landeshistorikern auffallend intensiv gepflegt, obwohl die gemeinsamen Brücken unübersehbar sind. Das gilt insbesondere für die Frühe Neuzeit. Wichtigste Gemeinsamkeit war die Zugehörigkeit zum Heiligen Römischen Reich und die Bindung an dessen Verfassung. Auch wenn man von einer schwächeren Rolle des Alten Reiches im Norden auszugehen hat, so hatte es doch auch hier Bedeutung. Der Kontakt zu Wien und dem katholischen Reich brach auch nach der Reformation keineswegs ab. Wien, Reichstag, Reichskreise und besonders die Reichsgerichte blieben Ansprechpartner für eine Vielzahl von Problemen. Landesgeschichte der Frühen Neuzeit muss die Reichsgeschichte und die Geschichte anderer Territorien berücksichtigen, will sie sich nicht isolieren und damit zu Fehlschlüssen kommen bzw. wichtige Fragestellungen außer Acht lassen. Reichsterritorien sind eben nicht völlig souverän, sondern nur ein Teil eines Ganzen und vielfachen Einflüssen ausgesetzt. Dies als Ergänzung zum Tagungsresümee der Herausgeber, welche über die Zukunft ihres Fachgebiets nachdenken und einen Abschwung der in den letzten Jahrzehnten so starken Wirtschafts- und Sozialgeschichte zugunsten einer Mentalitäts- und Kulturgeschichte erwarten. Die Vielfalt der Themen und deren anspruchsvolle Bearbeitung lässt darauf hoffen, da'>s die Frühneuzeitforschung auch im Braunschweigischen eine gute Zukunft hat. Martin Fimpel Britta Be r g u. Peter Alb re e h t, Presse der Regionen Braunschweig/ Wolfenbüttel - Hildesheim - Goslar. Kommentierte Bibliographie der Zeitungen, Zeitschriften, Intelligenzblätter, Kalender und Almanache sowie biographische Hinweise zu Herausgebern, Verlegern, Druckern und Beiträgern periodischer Schriften bis zum Jahre 1815, Bd. 3.1 Braunschweig, Bd. 3.2 Blankenburg - Oausthal - Goslar - Helmstedt - Hildesheim - Holzminden - Schöningen - Wolfenbüttel (Holger Böning, Deutsche Presse. Biobibliographische Handbücher zur Geschichte der deutschsprachigen periodischen Presse von den Anfängen bis 1815, Band ). Stuttgart-Bad Cannstatt: Friedrich Frommann Verlag. Günther Holzboog 2003, CXIV und 1278 Spalten, 442
233 236 Rezensionen und Anzeigen Obwohl die Geschichtsforschung die Bedeutung der Presse als hochwichtige Quellengattung schon seit über 100 Jahren erkannt hat, fehlte hierzulande bisher ein wissenschaftlich fundiertes Nachschlagewerk, in dem man sich detailliert über die älteren Presseerzeugnisse in der gesamten Landesregion Braunschweig informieren konnte. Die Diplombibliothekarin B. Berg hat 1995 die Zeitungen und Zeitschriften aus den Städten Braunschweig, Helmstedt und Wolfenbüttel bibliographisch erstmals umfassend Titel für Titel gründlich erfasst und nachgewiesen. Das vorliegende, an Akribie und Stofffülle nicht mehr zu überbietende Standardwerk bietct nun weit mehr: es ist ein bibliographischer, reich kommentierter Katalog der Presse in den Städten Braunschweig, Blankenburg, Helmstedt, Holzminden, Schöningen, Wolfenbüttel, Goslar, Oausthal und Hildesheim. Dieses zweibändige Werk erbringt mit einer ganz vorzüglichen Einführung, die auch als eigenständige Arbeit separat für sich bestehen könnte, sowie drei umfangreichen Registern (Personen, Sachen und Orte, Titel) einen enormen Informationsfundus für verschiedenste Bereiche der braunschweigischen Geschichte, den nlan schwerlich hinter dem Buchtitel vermuten würde. Das gesamte Opus könnte man eher als katalogartige Darstellung des hiesigen Pressewesens bezeichnen. Das Ziel der Reihe "Deutsche Presse" ist eine Gesamtbiobibliographie deutschsprachiger periodischer Literatur, d. h. als periodische Schrift wird erfasst, was über einen gewissen Zeitraum hinweg in regelmäßigen Abständen als Druckschrift herausgegeben wurde (S. XII). Im Sinne dieses weitgefassten Pressebegriffs wurden deshalb auch neben Zeitungen und Zeitschriften als klassischem Pressegut auch Druckschriften nachgewiesen, die man gemeinhin nicht unter der Quellengattung Presse vermuten würde, wie Zeitungsextrakte, Semestral- oder Meßreiationen, Annualschriften (Musenalmanache, Kalender, Taschenbücher, Neujahrsglückwünsche etc.), Predigtentwürfe, ferner weitere periodisch erscheinende Schriften (wie Lottolisten, Nachschlagewerke usw.). Nicht aufgenommen wurden Flugblätter, Flugschriften sowie die nichtperiodischen frühen sog. "Neuen Zeitungen". Verzeichnet werden bei den Titelaufnahmen neben sämtlichen Titelvarianten (Stücktitel, Band-, Jahres-, Monatstitel etc.), Erscheinungszeitraum, Herausgeber, Redakteure, Korrespondenten, Verlags- und Druckorte, Verleger, Drucker, Verwahrungsstandorte. Besonders interessant und informativ sind natürlich die jedesmaligen Kommentare zu den Inhalten der einzelnen Periodika, die auf ausführlichen - z. T. allerdings ausufernden - Zitaten aufbauen oder bestehen, aber auch Informationen zur Rezeption usw. der Stücke enthalten. Die mit 65 Druckseiten sehr umfangreiche Einleitung erbringt erstmals einen fundierten zusammenhängenden und detaillierteren Überblick über die Pressegeschichte des Braunschweiger Landes. Im ersten Teil der Einführung stellen die Verfac;ser folgende Druckorte vor: Bevem, Blankenburg, Braunschweig, Gandersheim, He\mstedt, Holzminden, Königslutter, Remlingen (die berühmte Privatdruckerei des G. E. von Löhneysen!), Schöningen, Schöppenstedt, Wolfcnbüttel, Goslar, Oausthal und Zellcrfe\d. Dann werden von beiden Autoren bestimmte herausragende Periodika der Region, wie Zeitungen, Intelligenzblätter, Zeitschriften, Kalender, Vorlesungsverzeichnisse und Schulprogramme charakterisiert. Damit bieten sie dem Benutzer des Werkes eine sehr erwünschte, differenzierte Essenz aus der schwer übersehbaren gewaltigen Materialfülle des eigentlichen Hauptteils, dem bibliographischen Katalog. Albrecht beschreitet im zweiten Teil der Einführung (S ) Neuland, indem er "Verleger, Drucker, Buchhändler im Blick der Obrigkeit" untersucht und die technischen, verwaltungsmäßigen, finanziellen, organisatorischen und rechtlichen Verhältnisse dieser Pressehersteller und -vermittler darstellt. Daraus wird größtenteils (S ) eine Geschichte der Zensur im Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel, die dort - insbesondere bei politischen Dingen - auffallend milde gehandhabt worden ist. Schon mit diesem ganzen Einführungsteil (bis S. 114) ist das Werk als ein Markstein der hiesigen Presseforschung zu bezeichnen.
234 Rezensionen und Anzeigen 237 Im eigentlichen Hauptteil, den chronologisch und nach Städten geordneten bibliographischen Nachweisungen der Periodika in den o. g. Druckorten (ohne Bevern, Gandersheim, Königslutter, Remlingen, Schöningen, Schöppenstedt, Zellerfeld) werden 245 Titel für Braunschweig (beginnend 1506),52 für Helmstedt und 33 für Wolfenbüttel (beginnend 1568) aufgeführt. Die inhaltlich erstaunliche Verschiedenheit der Presseprodukte kann hier nicht charakterisiert werden, da nicht wenige absonderliche Titel mehr der allgemeinen Kulturgeschichte als der herkömmlichen Pressegeschichte anzugehören scheinen (z. B. historische Tabellen, astrologische Prognostica, Kupferstichverzeichnisse). Von 385 katalogisierten Pressetiteln (ohne Hildesheim) sind im Braunschweigischen nur 41 vor 1700 erschienen, d. h. das hiesige Pressewesen korrespondiert größtenteils mit der Aufklärungsepoche. Das spiegelt sich in sehr vielen Titeln und vor allem in den von den Bearbeitern aufs reichste kommentierten Inhalten der regionalen Presse in 7.ahllosen Zitaten sehr gleichförmig ab. Insofern ist dieses Handbuch auch ein ganz neuartiger fundamentaler Beitrag zu dem im Fürstentum Braunschweig historisch so bedeutsamen AufkJärungszeitalter. Die hiesige Ideen-, Kultur-, Mcntalitäts- und Literaturgeschichte erhält dadurch eine schärfere Beleuchtung. Für die allgemeine Geschichte wichtig sind als mediale Hauptindikatoren in erster Linie Zeitungen und Zeitschriften. Braunschweig und Wolfenbüttel waren allerdings eigentlich nie (mit wenigen Ausnahmen) Standort bedeutender überregionaler Zeitungen, weil diese Blätter nur von den Redakteuren nicht weiter bearbeitete Nachrichten aus zweiter Hand enthielten. In Braunschweig erschien seit 1629 ca. 150 Jahre lang eine politische Zeitung mit wechselnden Titeln (insbesondere Post-Zeitung). Die Residenzstadt Wolfenhütte1 kann bekanntlich den Ruhm beanspruchen, mit dem "Aviso" (von 1609 bis 1626) die zweitälteste regelmäßig erscheinende Zeitung der Welt hervorgebracht zu haben. Die sehr spannende, genau hundertjährige Forschungsgeschichte zu dieser ehrwürdigen Pressequelle werden ebenso wie deren protestantische Tendenz, der relativ elitäre Bezieherkreis, die auswärtigen Korrespondenten, die Drucker usw. gen au analysiert. Ebenfalls in Wolfenbüttel erschien als eine der bedeutendsten Pionier- und Meistcrleistungen des 18. Jahrhunderts die sehr bekannte "Zeitung... für die... Landleute" des Pfarrers Braess. Dieses durch und durch volksaufklärerische Blatt für die meist leseunkundige Landbevölkerung war ein Muster an Volkstümlichkeit der Inhaltsvermittlung und Schreibweise und druckte auch Leserbriefe. Sie war um 1802 auch eine der meistgelesenen Zeitungen in Norddeutschland bei den Gebildeten. Die Zeitschriften aus dem Braunschweiger Raum waren zwar zahlreich, aber mit Ausnahmen (Das Braunschweigische Journal seit 1788) ebcnfalls überregional nicht bedeutend. Überwiegend aufklärerisch klingen schon oft die Titel, beispielsweise: Wirt und Wirtin, Volksarzt, Der lachendc Einsiedler, Der musikalische Patriot. Neben gelehrten Zeitschriften (u. a. Universitätsstadt Helmstedt) bilden philanthropische Kinder- und Jugendschriften einen Schwerpunkt in der hiesigen Presseregion. Angekündigt, aber wohl nicht erschienen ist 1794 in Braunschweig ein regionalkundliches "Archiv für Niedersachsen" - eine große Seltenheit, weil dieser Raumbegriff damals wenig gebräuchlich war. Ferner gab es viele Fach- und Unterhaltungszeitschriftcn in unserer Rcgion. Sehr bedeutend und verbreitet war das von Profcssor Häherlin in Hclmstedt seit 1796 herausgegebene "Staatsarchiv", eine staatsrechtlich-historisch-politische Zeitschrift, die für Reformen, aber auch für die Erhaltung der alten Reichsverfassung eintrat. Von unschätzbarem Nutzen ist der große Registerteil dieses Standardwerkes (Sp ). Das wohl von Albrecht überwiegend verantwortete sehr umfangreiche Personenregister (Sp ) hat den Charakter eines biographischen Spezialhandbuches mit Kurzbiographien. Aufgenommen wurden darin neben den im Buchtitel angegebenen Personen auch Redakteure, Buchhändler und für den Vertrieb der Periodika wichtige
235 238 Rezensionen und Anzeigen Leute. Außer biographischen Angaben (u. a. presserelevante und sonstige literarische Tätigkeit) wird Literatur zu diesen Personen genannt, die bisher großenteils mehr oder weniger inexistent in biographischen Nachschlagewerken geblieben sind. Ein Orts- und sehr ausführliches Sach- sowie Titelregister erschließt das große Werk erschöpfend (Sp und 1220: Nachweis aller politischen Periodika und Betreffe). Von den weit mehr als deutschsprachigen Periodika vor 1815 sind hiermit insgesamt 439 Stück aus dem südostniedersächsischen Braunschweigisch-Hildesheimer Raum unübertrefflich an das Licht gebracht. Ob eine derart gleich bleibend akribische Behandlung der noch unbearbeiteten deutschen Presseregionen angesichts des von Berg/ A1- brecht aufgewendeten Arbeitsaufwandes durchführbar ist, scheint mehr als fraglich. Dieter Lent Gabriele S t rat h man n, Das ehemalige Herzogtum Braunschweig unter dem Aspekt der Auswanderung - bei besonderer Berücksichtigung der westlichen Landkreise Holzminden und Gandersheim - von 1750 bis Motive, Verlauf und Folgen der Auswanderungsbewegung (Beihefte zum Braunschweigischen Jahrbuch 17). Braunschweig: Appelhans Verlag 2003, 384 S., Abb., 24 (für Mitglieder des Braunschweigischen Geschichtsvereins 15,60 ) Nach zwei kürzlich erschienenen Veröffentlichungen zum Thema Auswanderung aus dem Herzogtum Braunschweig, dem Katalog "Brücken in eine neue Welt" (vgl. Braunschw. Jb. 81, 2000, S. 291 f.) und der Arbeit von Cornelia Pohlmann, Die Auswanderung aus dem Herzogtum Braunschweig im Kräftespiel staatlicher Einflussnahme und öffentlicher Resonanz (vgl. Braunschw. Jb. 83, 2002, S. 273 f.), liegt nun ein drittes Werk vor, das seine Entstehung dem Projekt der Verzeichnung aller Auswanderer aus dem Herzogtum Braunschweig im 18. und 19. Jahrhundert im Niedersächsischen Staatsarchiv in Wolfenbüttel in den Jahren verdankt. Das Ziel des vorliegenden Buchs ist es, "ein Beitrag zur Vervollständigung des Gesamtbildes deutscher Auswanderungsgeschichte" zu sein. Es soll den schon vorhandenen "Arbeiten regionalen Charakters hinzugefügt werden, um auch die braunschweigische Region mit ihren Besonderheiten genau erfasst zu haben". Das gelingt nicht wirklich, denn wie schon aus dem Titel hervorgeht, konzentriert sich die Arbeit auf die beiden braunschweigisehen Landkreise Holzminden und Gandersheim. Nach einem einleitenden Kapitel zu Forschungsstand und Untersuchungsmethoden (25 Seiten), einem Überblick über die "deutsche Auswanderungsbewegung" (10 S.) und einer Beschreibung der wirtschaftlichen Verhältnisse im Herzogtum im 18. und 19. Jahrhundert "als Ursache der Auswanderung" (42 S.), werden in zwei Kapiteln, getrennt nach 18. und 19. Jahrhundert, zahlreiche EinzeIschicksale von Auswanderern in Zitaten aus den vor allem im Niedersächsischen Staatsarchiv in Wolfenbüttel eingesehenen Akten dargelegt (79 S.). Es folgt ein Kapitel über Auswanderungen aus der Korrektionsanstalt Bevern, auch dies durch Darstellungen von Einzelschicksalen bereichert (40 S.), und schließlich noch ein Kapitel "Die Reise" (19 S.), in dem die Erörterung über Bremen bzw. Bremerhaven als Auswanderungsorte etwas zu breiten Raum einnimmt. Nach einem Quellen- und Literaturverzeichnis (58 S.) werden im Anhang verschiedene Dokumente angefügt, hauptsächlich transkribierte Briefe von Auswanderern (32 S.). Viel gibt es an diesem Buch auszusetzen, zu viel, um es im Einzelnen aufzuführen. Vor allem die Uneinheitlichkeit der Darstellung macht dem Leser zu schaffen; man merkt, daß einzelne Kapitel zu verschiedenen Zeiten geschrieben wurden und der Autorin oft nicht
236 Rezensionen undanzeigen 239 mehr recht in Erinnerung gewesen zu sein scheint, daß sie bestimmte Themen schon anderswo erörtert hatte. Wenn sie aber auf solche Überschneidungen hinweist, ist dies so vage ("vgl. dazu Kapitel 6 dieser Arbeit"), daß es dem Leser nicht viel nützt. Es ist bedauerlich, daß die Autorin die von der Universität Bremen angenommene Dissertation vor der Veröffentlichung nicht noch einmal überarbeitet hat. Es hätte auch nicht geschadet, wenn die im Staatsarchiv in Wolfenbüttel erarbeitete und im Internet zugängliche Auswandererliste für das ehemalige Herzogtum Braunschweig etwas deutlicher hervorgehoben worden wäre, denn auf ihr basiert die Arbeit mit ihren zahlreichen statistischen Angaben. Wer aber die vorgeführten Einzelschicksale liest und sie im größeren Zusammenhang der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Zeit betrachtet, gewinnt nicht nur ein lebendiges Bild von den Nöten der Auswanderung, sondern gelangt auch zu der Einsicht, daß seiten jemand freiwillig die Heimat verläßt. Elke Niewöhner Meike Be r g, Jüdische Schulen in Niedersachsen. Tradition - Emanzipation - Assimilation. Die Jacobson-Schule in Seesen ( ). Die Samsonschule in Wolfenbüttel ( ) (Beiträge zur historischen Bildungsforschung 28). Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2003, XIV, 287 S., 29,90 Im 19. Jahrhundert entstand neben der traditionellen Religionsschule eine neue jüdische Schulform. Die Freischule, in der jüdische Kinder aus minderbemittelten Familien schulgeldfrei aufgenommen wurden, nahm eine Schlüsselrolle für die jüdische Emanzipationsund Assimilationsgeschichte und auch für das christlich-jüdische Verhältnis in der deutschen Gesellschaft ein. In ihrer Hildesheimer Dissertation beschäftigt sich Meike Berg mit der Geschichte zweier solcher Freischulen, nämlich der Jacobson-Schule in Seesen und der Samsonschule in Wolfenbüttel, "den" jüdischen Schulen schlechthin im niedersächsischen Gebiet. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage nach dem Beitrag der Schulen zur jüdischen Emanzipations- und Assimilationsbewegung. Stifter der Seesener Schule war der wohlhabende Kaufmann Israel Jacobson, ein Vertreter der jüdischen Aufklärung und Anhänger der christlichen pädagogischen Forderungen seiner Zeit erhielt er die Genehmigung zur Gründung einer Erziehungs- und Bildungsanstalt in Seesen für mittellose jüdische Jungen, die mit etlichen herzoglichen Privilegien verbunden war. Die Betonung der kostenlosen Ausbildung sollte dabei auf den handwerklichen Fähigkeiten liegen, um die Zöglinge zu nützlichen Gliedern der Gesellschaft zu machen. Hier sollte also die deutsch-christliche Form der Industrieschule mit der jüdischen Religionslehre verknüpft werden. Aufbildungspolitischem Wege wollte Jacobson seine Glaubensgenossen aus den traditionellen Fesseln lösen, um auf diesem Wege zur jüdischen Emanzipation beizutragen. Seinem nationalen Umfeld öffnete er sich, indem er religiöse Rituale, die den Nicht juden unverständlich erschienen, dem protestantischen Ritus anpasste, die deutsche Sprache im jüdischen Gottesdienst und sogar eine Konfirmation nach christlichem Muster einführte sowie generell für eine deutsche Erziehung der Kinder sorgte. Bahnhrechend war darüher hinaus Jaeobsons Konzept, von Anfang an auch christliche Schüler zuzulassen. Seine Gründung wurde damit zur ersten jüdisch-christlichen Simultanschule überhaupt. Christliche Schüler besuchten nicht nur als Externe den Schulunterricht, sondern konnten auch in das angeschlossene Internat aufgenommen werden, einige Bedürftige sogar als Freischüler. Auch die Lehrerschaft war konfessionell gemischt.
237 240 Rezensionen undanzeigen Im Sinne der Aufklärung beteiligte Jacobson sich 1807 auch an der Neugründung der Samsonschule in Wolfenbüttel, die aus mehreren Stiftungen der Familie seiner Frau hervorgegangen war. Aufgrund der schlechteren Quellensituation wird sie in der vorliegenden Arbeit weit weniger ausführlich behandelt als die Seesener Schule, die insbesondere durch das im Staatsarchiv Wolfenbüttel hinterlegte Schularchiv gut dokumentiert ist. In der Gliederung folgt Bergs Arbeit der Chronologie der jeweiligen unterschiedlichen Staatsformen, bei der Jacobson-Schule wird darüber hinaus nach den jeweiligen Direktoren untergliedert. Bei der Seesener Schulgründung vollzog sich im Laufe der Zeit ein qualitativer Wandel der Schule von der ursprünglich geplanten Religions- und Industrieschule zu einer Bürgerschule, nach Jacobsons Tod sogar zu einer Realschule zweiter Ordnung, der zuletzt ein Realprogymnasium angeschlossen war. Bedingt durch den Umstand, dass die Jacobson-Schule für ihre Existenz auf die Anwesenheit zahlender Schüler und Pensionäre angewiesen war, hob sich ihr Niveau entsprechend den Wünschen der wohlhabenderen Eltern immer mehr an. Auch wegen ihrer stets modernen Pädagogik erfuhr sie regen Zulauf, teilweise sogar aus dem nichtdeutschen Ausland. Insgesamt haben in den ersten 100 Jahren des Bestehens über 4000 Schüler zwischen 8 und 15 Jahren die Jacobson-Schule besucht. Besonders attraktiv wurde sie 1870 durch die Vergabe der Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienst, wodurch ihren Absolventen die dreijährige Militärpflicht erspart blieb. Während die Schule in den Anfangsjahren sich dank herzoglichem Wohlwollen unbeeinflusst vom kirchlichen Konsistorium und anderen Behören entwickeln durfte, ging sie seit der Jahrhundertmitte und besonders nach der Reichsgründung immer mehr im Schulsystem des Deutschen Reichs auf und wurde in ihren Rechten durch die Aufsicht der staatlichen Oberschulkommission eingeschränkt. Interessant stellt sich das Verhältnis zwischen der Stadt Seesen und der Jacobsonschule dar. Waren die Seesener erst ablehnend eingestellt, so änderten sie ihre Haltung rasch, als sich die Bedeutung der Schule als Wirtschaftsfaktor für die Stadt zeigte. Vor allem hatte eine höhere Schule am Ort den Vorteil, dass die Schüler aus Seesen und dem Umland für eine bessere Ausbildung nicht frühzeitig das Elternhaus verlassen mussten. Nach dem Ersten Weltkrieg ging es jedoch mit der Jacohsonschule bergab. Die schlechte Wirtschaftslage und Inflation hatten bald das Stiftungskapital aufgezehrt, so dass die Schulverwaltung 1922 die Verstaatlichung zulassen musste, was einem Verlust des jüdischkonfessionellen Charakters der Schule gleichkam. Einen ähnlichen Verlauf, wenn auch zeitlich verzögert, nahm die Entwicklung der Samson-Schule in Wolfenbüttel, deren Geschichte Berg auf die zeitlich entsprechenden Kapitel der Jacobsonschule folgen lässt. Vor allem in organisatorischer Hinsicht orientierte sich die Wolfenbütteler Samsonschule am Seesener Vorbild. Im Unterschied zu Seesen wurden christliche Schüler hier allerdings erst lange nach Jacobsons Tod, nämlich seit 1881, zugelassen, was damit zusammenhing, dass in einer Stadt mit hinreichend christlichen Schulen ein geringerer Bedarf vorhanden war. Ein weiterer Unterschied lag in der stärkeren Betonung der Traditionen und des religiösen Elements in Wolfenbüttel. Wie die Jacobsonschule, hat auch die Samson-Schule die Folgen des Ersten Weltkriegs finanziell nicht überlebt und musste 1928 ihre Pforten schließen. Beiden Einrichtungen blieb es damit erspart, die Vernichtung jüdischen Lebens unter dem Nationalsozialismus direkt mitzuerleben, wenngleich erste antisemitische Anzeichen sich schon einige Jahre früher erstmals bemerkbar machten. Die Schwerpunkte von Bergs Darstellung liegen bei bei den Schulen auf Lehrkonzepten und Lehrerpersönlichkeiten, Unterrichtsgestaltung, Internatsleben, baulichen Veränderungen und dem Verhältnis zwischen Schule und Behörden im Wandel der Zeiten. Persönliche
238 Rezensionen und Anzeigen 241 Stellungnahmen und Erinnerungen der Schüler fehlen mangels Quellen. Eine Ausnahme bilden hier lediglich die Erinnerungen des wohl bedeutendsten Schülers der Samsonschule, nämlich des Begründers der Wissenschaft vom Judentum, Leopold Zunz. Ergänzt wird die Arbeit durch eine statistische und tabellarische Auswertung der Schülerfrequenz beider Schulen. In einem abschließenden Kapitel streicht die Autorin noch einmal die Bedeutung beider Schulen für die Emanzipations- und Assimilationsbewegung des Judentums heraus. Sowohl die Jaeobson-Schule als auch die Samsonschule demonstrierten eine bis dahin beispiellose Toleranz und Offenheit gegenüber ihrer christlichen Umgebung und, wie der Lehrplan beider Schulen zeigt, ein Bemühen um kulturelle Assimilation in das deutsche Umfeld, ohne ihr jüdisches Selbstbewusstsein außer Acht zu lassen. Mit diesem Konzept waren sie für die Entwicklung des jüdischen Bildungswesens im gesamten deutschen Sprachraum wegbereitend. Mit ihrer materialreichen, methodisch gründlich gearbeiteten und gut lesbaren Darstellung arbeitet die Autorin einen wichtigen Abschnitt jüdischer Schul- und Bildungsgeschichte des 19. Jahrhunderts im niedersächsischen Gebiet auf und leistet einen Beitrag zur Stadtgeschichte von Seesen und Wolfenbüttel, wo immerhin nicht nur die beiden gegen Ende des 19. Jahrhunderts neu errichteten Alumnatsgebäude erhalten sind, sondern auch das Seesener "Jacobsongymnasium" mit seinem Namen an die erste höhere Bildungsanstalt der Stadt erinnert. Silke Wagener-Fimpel Elisabeth Mol t man n - Wen dei, Macht der Mütterlichkeit. Die Geschichte der Henriette Schrader-Breymann. Pädagogin und Gründerin des Berliner Pestalozzi-Fröbel-Hauses. Berlin: Wiehern-Verlag 2003, 208 S., Abb., 14 Heute erinnert nur noch ein Straßenname in Wolfenbüttel an Henriette Schrader, geb. Breymann. Er verweist auf eine höchst anerkannte und erfolgreiehe Pädagogin des 19. Jahrhunderts, die an dieser Stelle ein Erziehungsinstitut von internationalem Ruf ins Leben gerufen hat. Trotzdem ist ihr Name heute allenfalls noch in der wissenschaftlichen Pädagogik ein Begriff, während die Frauenforschung bislang von ihr kaum Notiz genommen hat. Die feministische Theologin und Publizistin Elisabeth Moltmann-Wendel zeichnet in dem vorliegenden Band das Leben der Henriette Schrader-Breymann nach, die 1827 als älteste Tochter einer kinderreichen Pastoren familie in Mahlum geboren wurde. Entscheidend für ihren späteren Lebensweg wurde ab 1848 die Ausbildung bei ihrem Großonkel, dem Reformpädagogen Friedrich Fröbel, auf den auch die Idee des Kindergartens zurückgeht. Nach mehreren auswärtigen Tätigkeiten kehrte sie 1854 zu ihrer Familie zurück, die mittlerweile in Watzum ein geräumiges Pfarrhaus bezogen hatte. Hier gründete Henriette ein Mädchenpensionat, das nach Fröbelschen Grundsätzen geführt wurde und an dem ihre ganze Familie mitwirkte. Dahinter stand das Konzept einer ganzheitlichen Erziehung, die Kopf- und Handarbeit gleichermaßen umfassen, Gefühle und Intellekt ansprechen sollte. Anfang der 1860er Jahre entstand in Watzum zusätzlich eine Ausbildungsklasse für künftige Kindergärtnerinnen; der Lehrkindergarten in Schöppenstedt, den Henriettes Schwester Marie, ebenfalls Fröbelschülerin, leitete, war der erste im Herzogtum Braunschweig. Bald gewann das "Breymannsche Institut" überregionale Bekanntheit, und Henriette erhielt sogar Vortragseinladungen ins Ausland. Angesichts der großen Nachfrage erfolgte 1864 wegen Raummangel der Umzug nach Wolfenbüttel in die Nähe des Lechlumer Hol-
239 242 Rezensionen undanzeigen zes, wo das Institut unter dem Namen "Neu-Watzum" eröffnet wurde. Hier gab es zwei Abteilungen für 12-14jährige sowie 14-17jährige Mädchen, einen Kindergarten, eine Elementarklasse und eine Fortbildungsklasse für angehende Lehrerinnen. Innerhalb von zehn Jahren war es Henriette gelungen, eine funktionierende und begehrte Mädchenpension aufzubauen, die ihren Ideen von den Frauen als Mittelpunkt von Haus und Familie entsprach. Darüber hinaus engagierte sie sich auch in Wolfenbüttel und regte dort die Bildung eines "Vereins für Erziehung" an, der 1866 im Schloss einen Kindergarten und eine Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen einrichtete. Nachdem Henriette die Anstalten gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Anna Vorwerk geleitet hatte, kam es nach vier Jahren wegen unterschiedlicher Vorstellungen bei den Unterrichtszielen zur Trennung. Enttäuscht zog sich Henriette von dem Projekt zurück. Ihre eigene Anstalt wurde von ihrer Familie weitergeführt, übrigens bis 1942, als sie geschlossen werden musste heiratete sie den späteren liberalen Reichstagsabgeordneten Karl Schrader, mit dem sie ihre Vorstellungen von einer gleichberechtigten Partnerschaft verwirklichen konnte, und folgte ihm nach Berlin. Dort gründete sie 1874 den "Berliner Verein für Volkskindergarten und Volkserziehung" und schuf ihr Lebenswerk, das "Pestalozzi-Fröbel-Haus" mit zuletzt elf Anstalten aus den Bereichen Erziehung und Bildung sowie Haushaltung. Aus der Bekanntschaft Henriettes mit der Kronprinzessin Victoria erwuchs eine 22jährige Freundschaft, die um soziale Fragen kreiste und sich an politischen Themen entzündete. Welchen Einfluss man ihr bei der späteren Kaiserin zutraute, belegt Bismarcks Rücktrittsdrohung, der sich einer "Unterrock-Politik" unter der Regentschaft Victorias und der "Mme. Schrader" nicht beugen wollte starb Henriette und wurde in Wolfenbüttel beigesetzt. Moltmann-Wendel setzt in ihrem Buch besondere Schwerpunkte, die in einem auf die eigentliche Biographie folgenden Abschnitt noch einmal besonders herausgearbeitet werden. So geht es ihr zum einen um Henriettes Standort in der frühen Frauenbewegung. Obwohl selbst eher uninteressiert an Gleichberechtigungs- und Rechtsfragen, stand sie doch mit bedeutenden Frauen ihrer Zeit in Verbindung, beispielsweise mit Helene Lange, der späteren zentralen Gestalt der bürgerlichen Frauenbewegung. Einen weiteren Schwerpunkt in der Biographie bildet die religiöse Entwicklung der Pfarrerstochter Henriette, die nach Ansicht der Autorin prägend für ihr - im Buchtitel aufgegriffenes - Konzept der "geistigen Mütterlichkeit" war. Dieser auch von dem gemäßigten flügel der deutschen Frauenbewegung viel verwendete Begriff wurde von der zeitlebens kinderlosen Henriette mit neuem Inhalt gefüllt. Die noch für Fröbel so elementare Mutter Kind-Beziehung erweiterte sie zu einer Lebensdevise, die für alle Frauen Geltung haben sollte und sich beispielsweise auch in einem gleichberechtigten Verhältnis zwischen Ehepartnern zeigen konnte. Nachdem sich Henriette nach und nach von den als zu dogmatisch empfundenen Lehren des Vaters und der Kirche gelöst hatte, fand sie einen neuen Zugang zur Religion, in dem auch so unkonventionelle Vorstellungen wie Frauen im Predigt amt denkbar waren. Moltmann-Wendel schöpft für ihre Darstellung vor allem aus den Brief- und Tagebuchsammlungen der Breymann-Schülerin Mary Lyschinska sowie aus Materialien zur Frauengeschichte und zeitgenössischen Biografien. Im Anhang sind außerdem einige Briefe von CIara Schumann an Henriette veröffentlicht, in denen es um die Erziehung der jüngsten Schumann-Tochter in Neu-Watzum geht. Sie stammen aus dem im Staatsarchiv Wolfenbüttel verwahrten Nachlass der Familie Breymann, der noch reichliches Material zur Geschichte des Breymannschen Institutes bietet.
240 Rezensionen und Anzeigen 243 Die Arbeit beansprucht nicht, eine wissenschaftliche Abhandlung zu sein oder Henriette als Pädagogin in jeder Hinsicht gerecht zu werden. Vielmehr ist der Autorin eine unterhaltsame und spannend geschriebene Biographie gelungen, die nicht nur ein vergessenes Stück Frauengeschichte wieder entdeckt, sondern auch alle an Wolfenbütteler Stadt- und Schulgeschichte Interessierten ansprechen wird. Silke Wagener-Fimpel Hans-Walter S c h muh I, Die Bürger der Stadt - Die Stadt der Bürger. Beiträge zur Geschichte des Bürgertums in Braunschweig im 19. Jahrhundert (Quaestiones Brunsvicenses. Berichte aus dem Stadtarchiv 13). Braunschweig: Stadt Braunschweig 2003, 108 S., Abb., 9 Mit der vorliegenden Publikation wurden zwei bisher unveröffentlichte Kapitel der Habilitationsschrift des Autors (vgl. Braunschw. Jb. 80, 1999, S. 296ff) veröffentlicht. Der erste Beitrag "Das Braunschweiger Bürgertum, die Religion und die städtische Selbstverwaltung im 19. Jahrhundert" beschäftigt sich mit der Konfessionsstruktur der städtischen Führungsgruppen und der Rolle der Religion im Prozess der Elitenbildung des 19. Jh. Braunschweig war zu dieser Zeit eine protestantische Stadt (1910 waren 89,9% der Bevölkerung ev.-iuth., 1,9% ev.-ref., 6,5% kath., 0,5% jüdisch, 0,4% Dissidenten, 0,8% anderen Konfessionen zugehörig). Auch die städtische Führungsgruppe setzte sich im 19. Jh. zu mindestens vier FünfteIn aus Lutheranern zusammen; Reformierte und Juden waren in der zweiten Hälfte des 19. Jh. in der Führungsgruppe überrepräsentiert, während die Katholiken etwa entsprechend ihres Bevölkerungsanteiles beteiligt waren. Die ev.-luth. Landeskirche stellte in der zweiten Jahrhunderthälfte eine Hochburg der liberalen Theologie dar, so dass das liberale Bürgertum der Stadt der lutherischen Amtskirche nahe stand. Die reformierte Gemeinde nahm in der Stadt eine Schlüsselstellung ein; durch den Zuzug innovativer Unternehmerfamilien - vor allem der Familien Löbbecke und Vieweg - erlebte der politische Liberalismus in der Stadt einen Aufschwung, und die reformierten "newcomer" wuchsen in die städtische Führungsgruppe hinein, was durch Mischehen mit lutherischen Frauen noch begünstigt wurde. Die Katholiken schafften erst durch die Familie Buchler und ihren wirtschaftlichen Erfolg den Aufstieg in die städtische Führungselite, wobei auch hier Mischehen und ein liberales politisches Profil den Weg ebneten. Die jüdischen Mitbürger hatten 1845 ihr Erfolgserlebnis, als Ludwig Helfft als erster Jude in die Stadtverordnetenversammlung gewählt wurde. Die jüdische Minderheit wuchs durch die regelmäßige Teilnahme am städtischen Vereins- und Stiftungswesen und durch das politische Engagement für einen gemäßigten Liberalismus in das städtische Bürgertum hinein; nichtsdestotrotz blieb eine relative soziale Distanz zwischen jüdischem und nicht jüdischem Bürgertum vorhanden. Die städtische Selbstverwaltung des 19. Jh. in Braunschweig entsprach so nahezu der liberalen Ziclutopie, wonach jeder Mann - unabhängig von seiner Konfession - sich aufgrund von Vermögen, Bildung oder Engagement für eine Führungsrolle in der Stadtpolitik qualifizieren konnte. Die städtische Selbstverwaltung stellte gerade auch für die Angehörigen konfessioneller Minderheiten ein Sprungbrett in die bürgerliche Gesellschaft dar, und der überproportional hohe Anteil dieser Minderheiten an der politischen Elite der Stadt zeigt auch, dass diese Chancen genutzt wurden. Erst das 20. Jahrhundert mit seinem politisch sanktionierten Antisemitismus hat dieser liberalen Utopie ein Ende gesetzt.
241 244 Rezensionen undanzeigen In seinem zweiten Beitrag "Das Braunschweiger Bürgertum und die Einführung der Gasbeleuchtung, " untersucht Schmuhl am Beispiel der Debatte um den Bau und die Kommunalisierung des Gaswerks die Rolle der bürgerlichen Honoratioren im städtischen Entscheidungsprozess. Langfristig hatte es bei der Einführung der Gasbeleuchtung in Braunschweig nur zwei Alternativen gegeben: die Ansiedlung der städtischen Versorgungsbetriebe im privatwirtschaftlichen Bereich oder die Bildung von städtischen Regiebetrieben bzw. gemischtwirtschaftlichen Unternehmen mit starker Beteiligung der Stadtgemeinde. Bürgerliche Honoratioren (u.a. Eduard Vieweg und Ludwig Hc\fft) hatten - getragen von Gemeinwohlideen und Fortschrittseuphorie - in Braunschweig die Einführung der Gasbeleuchtung vorangetrieben. Der aus Berufsbeamten bestehende Magistrat hatte eher zögerlich reagiert und die Einführung von Gasbeleuchtung nicht als notwendig erachtet. Da von daher ein Gaswerk in städtischer Regie zunächst nicht durchsetzbar war, hatte man 1851 ein privates Komitee zur Einführung der Gasbeleuchtung in der Stadt Braunschweig begründet und das Gaswerk in Form einer Aktiengesellschaft aufgezogen. Prominente Braunschweiger Bürger zeichneten Aktien unter der Bedingung, dass auch die Stadt sich verpflichte, Aktien in bestimmter Höhe zu erwerben. Der Magistrat stimmte nun der Aktiengesellschaft zu, da man inzwischen doch die Notwendigkeit zur kommunalen Daseinsvorsorge erkannt hatte. Und 1864 stand dann nach vielen Auseinandersetzungen auch einer Kommunalisierung des Gaswerks - d. h. der Überführung in städtische Regie - nichts mehr im Wege. Dieselben Honoratioren, die das Projekt vor 20 Jahren auf den Weg gebracht hatten, übernahmen nun die parlamentarische Kontrolle über den städtischen Regiebetrieb. Das Gaswerk ebnete - als erster Gemeindebetrieb - den Weg zum Auf- und Ausbau einer modernen urbanen Infrastruktur. Dazu beigetragen hatten letztendlich die Flexibilität, Kreativität und das Innovationspotential derjenigen Bürger, die im Rahmen der städtischen Selbstverwaltung den Modernisierungsprozess energisch vorangetrieben hatten. Der Autor hat mit den vorliegenden Studien vor allem dies deutlich gemacht: mit wc\ ehern Engagement Braunschweiger Bürger - unabhängig von ihrer konfessionellen Herkunft - die kommunale Selbstverwaltung nutzten, um die "Herrschaft über die Stadt" mit zu gestalten, und wie sie in diesem Rahmen die durch die Verstädterung aufgeworfenen Probleme weitgehend zu lösen verstanden. Es ist sehr zu begrüßen, dass diese bisher unveröffentlichten Kapitc\ der lesenswerten Studie SchmuhIs über die "Herren der Stadt" nun auch einer größeren Leserschaft zugänglich sind. Erika Eschebach Carsten G r a ben h 0 r s t, Voigtländer & Sohn. Die Firmengeschichte von 1756 bis Braunschweig: Appelhans Verlag 2002,228 S., Abb., 19,80 Zu den Glanzstücken der Braunschweigischen Industriegeschichte gehörte das optische Unternehmen Voigtländer, das 1756 als Handwerksbetrieb in Wien gegründet wurde, 1849 als Zweigfabrik in der Stadt Braunschweig zu Beginn der Industrialisierung errichtet wurde, sich in Braunschweig zu einem international bekannten Großunternehmen der optischen Industrie entwickelte und ungeachtet seiner Qualitätsproduktion 1972 der internationalen Konkurrenz erlag und stillgelegt wurde. Der Braunschweiger Historiker Carsten Grabenhorst hat nun eine kenntnisreiche und sorgfältig erarbeitete wissenschaftliche Untersuchung über die Geschichte des Unternehmens von seinen Anfängen bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs vorgelegt. Grabenhorst zeichnet nicht nur die Entwicklung des Unternehmens nach, er stellt auch dar, wie die
242 Rezensionen und Anzeigen 245 Unternehmensleitung auf politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen reagierte und wie davon zentrale betriebliche Handlungsfelder betroffen waren. Der Autor nimmt auch die betriebliche Sozialpolitik in den Blick, die für das Binnenklima im Unternehmen und die Betriebsverbundenhdt der Voigtländer-Mitarbeiter bis zuletzt von großer Bedeutung war. Die Untersuchungsergebnisse verdanken sich neben der wissenschaftlichen Kompetenz des Autors auch der günstigen Quellenlage, da sich seit 1972 das Werksarchiv von Voigtländer & Sohn im Stadtarchiv Braunschweig befindet. Doch auch die für ein Braunschweiger Industrieunternehmen vergleichsweise vorteilhafte Überlieferungssituation konnte nicht verhindern, dass, wie Grabenhorst in seiner Einleitung einräumen musste, aufgrund mancher fehlender Unterlagen "nicht alle Fragen in der gewünschten Intensität oder für den gesamten Untersuchungszeitraum geklärt werden können" (S. 10i). Ungeachtet dieser im Bereich der Wirtschaftsgeschichte nicht ungewöhnlichen Einschränkung bietet die Untersuchung eine Fülle neuer, leserfreundlich vermittelter Einsichten in die Geschichte von Voigtländer & Sohn. Aufschlußreich sind zum Beispiel Grabenhorsts Ausführungen über die Beziehung von Peter Wilhelm Friedrich von Voigtländer ( ) zu seinem Stiefsohn Hans Sommer ( ). Voigtländer hatte durch die Übersiedlung nach Braunschweig die Weichen für eine erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens gestellt, doch als sein Stiefsohn in mühevoller Eigeninitiative zukunftsweisende Berechnungen für photographische Objektive erarbeitete, blockierte Voigtländer die Umsetzung, obwohl Sommer durch Urteile ausgewiesener Fachleute wie Helmholtz bestätigt wurde. Sommer scheiterte am technischen Konservatismus seines Stiefvaters, der ohnehin für die Nachfolge in der Leitung des Unternehmens seinen eigenen ältesten Sohn Friedrich Wilhelm ( ) vorgesehen hatte. Sommer jedoch, dessen anschauliche, nur abschriftlich überlieferte Lebenserinnerungen in wichtigen Passagen durch den Autor erstmals zugänglich gemacht wurden, gelang eine eigene Karriere als Professor für Mathematik und Direktor der Technischen Hochschule Braunschweig, bevor er sich seit 1883 ganz der Musik widmete. Carsten Grahenhorsts Untersuchung, die projektmäßig beim Museum für Photographie in Braunschweig angesiedelt war, stellt sich als gelungener erster Schritt zur Aufarbeitung der vielfältigen Geschichte der Fotoindustrie in Braunschweig dar. Es bleibt die Hoffnung auf das baldige Erscheinen des zweiten Teilbandes, der die Geschichte des Unternehmens abschließt. Norman-Mathias Pingel Birgit S chi e gel (Hg.), Industrie und Mensch in Südniedersachsen - vom 18. bis zum 20. Jahrhundert (Schriftenreihe der Arbeitsgemeinschaft südniedersächsischer Heimatfreunde 16). Duderstadt: Mecke 2003, 376 S., Abb., 17,90 Südniedersachsen - das ist zunächst eine Bezeichnung für eine schwer fassbare Region ohne deutliches Profil. Im vorliegenden Sammelband sind Beiträge vertreten, die sich auf die heutigen Landkreise Göttingen, Northeim, Osterode und Holzminden beziehen und damit bis auf Holzminden zum Regierungsbezirk Braunschweig gehören. Auch einige im Kreis Goslar gelegene Harzer Gebiete werden angesprochen. Bis zur Gründung des Landes Niedersachsen im November 1946 gehörten diese Gebiete teils zum Königreich bzw. zur preußischen Provinz Hannover, teils zum Herzogtum bzw. Freistaat Braunschweig (Landkreis Holzminden bis 1941 und der bis 1978 existierende Kreis Gandersheim). Die Wirtschaft war bis in das 19. Jahrhundert hinein vor allem land,virtschaftlich geprägt. Im Harz und im Hils haben u.a. Bergbau und Glasherstellung eine lange, bis in das Mittelalter
243 246 Rezensionen und Anzeigen hineinreichende Tradition. Für die hier dargestellte Region gilt insgesamt, dass die Dynamik der industriellen Entwicklung verspätet einsetzte und eher durch Klein- und Mittelbetriebe gekennzeichnet ist. Die niedersächsischen Industriezentren entstanden weiter nördlich in den Großräumen um Braunschweig und Hannover sowie im Westen um Osnabrück. Die im vorliegenden Band behandelte Thematik lässt sich unter den Stichworten,Industrialisierung der ländlichen Region' und,modernisierung der Dörfer' umschreiben. Die Geschichte von Gewerbe, Industrie und Menschen zwischen Weser und Harz hat einiges zu bieten. Mancher Leser wird mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen, dass in Grünenplan im 18. Jh. die erste planmäßige Arbeitersiedlung in Nordeuropa entstand, initiiert durch den braunschweigischen Forstmeister von Langen; - das heute vor allem durch eine Autobahnabfahrt bekannte Nörten zwischen 1880 und 1885 die größte Rübenverarbeitungsfabrik des Deutschen Reiches aufzuweisen hatte befand sich hier die größte hannoversche Zuckerfabrik; Walter Gropius vor dem Ersten Weltkrieg als eine seiner ersten Arbeiten nach dem Studium in Alfeld/ Leine das Firmengebäude für den Bau der Schuhleistenfabrik,Fagus Werke' baute und eine Werkssiedlung für das Eisenwerk in Delligsen entworfen hat; - der braunschweigische Minister für Volksbildung in den 1920er Jahren in Delligsen den modernsten Schul bau im Freistaat Braunschweig errichten ließ; in Alfeld/ Leine bis 1994 das größte Handelshaus der Welt für exotische Tiere bestand; die Firma Carstens als Hersteller von industrieller Keramik auf dem Tönnieshof in FredeIsloh / Solling bis 1977 Markführer in der Bundesrepublik war; - die Firma Dr. Demuth in Katlenburg auch heute noch der europaweit größte Anbieter für Fruchtweine ist. Im 18. Jahrhundert förderten die jeweiligen welfischen Herrscher in Wolfenbüttel und Hannover Gewerbe und Handwerk innerhalb ihrer Landesgrenzen. Wirtschaftliche Aktivitäten wurden unter dem alleinigen Blickwinkel des Staatshaushaltes gesehen. Die wirtschaftliche Struktur unmittelbar vor dem Beginn der Industrialisierung ist in Südniedersachsen wie auch anderswo gekennzeichnet durch Bergbau und Hüttenwesen, Verlagswesen und Manufakturen, die meist staatlich gefördert wurden (Albrecht Pfeiffer über die Strumpfwirkerei in Bad Sachsa und Gerald Strohmeier über die Saline in Sülbeck). Hier sei vor allem Karll. Herzog zu Braunschweig-(Wolfenbüttel) genannt, der die Spiegelglas fabrik in Grünenplan (heute Schott Desag AG / Deutsche Spiegelglas) und die Porzellanmanufaktur in Fürstenberg sowie die Carlshütte bei Delligsen gründete (Thomas Krueger über die Gewerbelandschaft Hils). Ausschlaggebend für die Ansiedlung der Betriebe waren die im Mittelgebirge des Hils vorhandenen Rohstoffe Wasser und Holz. Über die Weser konnten die Produkte gut verschifft werden. Die Arbeiter wurden deshalb von weither geholt und hier angesiedelt. Im 19. und 20. Jahrhundert entwickelte die Wirtschaft eine eigene, über die Landesgrenzen hinausgehende Dynamik. Als Pioniere in Südniedersachsen können die Fabrikanten Greve&Uhl in Osterode ab 1760 gelten (Michael Mende über Pioniere der Industrialisierung - Hannoversche Wollzeugfabrikanten im 18. Jahrhundert). Die Industrialisierung des Göttinger Raumes begann allmählich mit der Einrichtung von Textilfabriken seit der Mitte des 19. Jahrhunderts (Gerhard Ströhlein über die Spinnerei im Gartetal). In staatlicher Regie geführte Betriebe, wie die Spiegelglasfabrik in Grünenplan wurden nunmehr privatisiert und neue Betriebe von Unternehmern und Kaufleuten zum eigenen wirtschaftlichen Nutzen gegründet. Mit 130 Arbeitern zählte die Spiegelhütte 1830 neben der Carlshütte zu den größten Betrieben im Herzogtum Braunschweig.
244 Rezensionen und Anzeigen 247 Ab 1851 sorgte der Bau der hannoverschen Südbahn-Eisenbahn als erster Eisenbahnstrecke der Region, der Bau der braunschweigischen Südbahn (Braunschweig, Seesen, Bad Gandersheim, Kreiensen, Stadtoldendorf, Holzminden, Altenbeken) sowie zahlreicher anderer Strecken für die Chance, an die ökonomische Entwicklung anzuschließen. Gerd Busse beschreibt, wie die SoIlingbahn über Northeim, Hardegsen, Uslar, Bodenfelde und Ottbergen der als Armenhaus der Provinz Hannover geltenden Landschaft ab 1878 neue Möglichkeiten erschloss. Ein durchschlagender Effekt zur Förderung des ländlichen Raumes kam erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts u.a. infolge der wirtschaftspolitischen Impulse Preußens nach der Annexion des Königreichs Hannover zum Tragen (Gerd Busse über den Zusammenhang von Eisenbahnbau und Industrialisierung, Andreas Lilge über den Wandel der Hausformen am Beispiel Arholzen, Birgit Schlegel über Eisenbahn, Industrie- und Dorfentwicklung am Beispiel Katlenburgs). Die mit dem Niedergang des Leinengewerbes im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts verarmte Stadt Uslar entwickelte sich durch den Eisenbahnanschluss 1878 zu einem ländlichen prosperierenden "Industrierevier". In dem Dienstleistungszentrum für die Weser-Solling-Region entstanden mehrere Möbelbetriebe. Die 1890 gegründeten Ilse-Möbelwerke waren im 20. Jahrhundert der größte Arbeitgeber der Stadt (Wolfgang Schäfer). Mit der industriellen Verarbeitung landwirtschaftlicher und forstlicher Produkte begann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die eigentliche Industrialisierung des ländlichen Gebietes im Süden Niedersachsens. Zur Düngung der Landwirtschaft wurden Kalisalze benötigt (,Willst Du solchen Erntesegen, musst Du auch stets Kali geben!"). Mit der prosperierenden chemischen Industrie des Deutschen Reiches stieg die Nachfrage nach reinen, hochkonzentrierten Salzen. Das 1895 gegründete Kali- und Steinsalzbergwerk in Volpriehausen brachte für gut 40 Jahre Wohlstand in das Bauerndorf, das sich in kurzer Zeit zum Industriestandort entwickelte und dessen Einwohnerzahl sich allein zwischen 1895 und 1905 um mehr als das Doppelte auf 1040 erhöhte (Detlev Herbst). Die Handels- und Industriemühle in Northeim, gegr. 1865, sorgte für Weizenmehl (Werner Hesse). Große Zuckerfabriken entstanden in Nörten und Northeim (Gisela Murken), im Harz entwickelten sich u.a. in Gernrode, Lauterberg, St. Andreasberg, CIausthal und vor allem in Bennekkenstein Zündholzfabriken (Hans-Heinrich Hillcgeist). Eine organisierte Arbeiterbewegung entstand vor allem in der traditionsgemäß dichten Gewerbelandschaft Hils ab Hier hatte die Sozialdemokratie im Freistaat Braunschweig bis zu den Märzwahlen 1933 starken Rückhalt. Im 20. Jahrhundert setzte sich der Aufschwung zunächst fort. Erster Weltkrieg und Weltwirtschaftskrise brachten Erschütterungen. Kriegswichtige Betriebe wie die I1se-Möbel in Uslar und die Firma Dr. Demuth in Katlenburg, die u.a medizinische Getränke herstellte, profitierten von den staatlichen Aufträgen. Mit der Gründung der Flachsröste in Bad Gandersheim 1935 als typischer NS-Musterbetrieb wurden alte Produktionsverfahren wieder eingeführt, die nur vor dem Hintergrund der staatlichen Auftragswirtschaft lohnend waren. Vor dem Hintergrund einer schwachen Wirtschaft gehörte Gandersheim zu den frühen Bastionen der NSDAP im Freistaat Braunschweig. Auch in Südniedersachsen wurden mehr und mehr ausländische Zwangsarbciter eingesetzt, die von den im Zweiten Weltkrieg von der Wehrmacht besetzten europäischen Gebieten hierher verfrachtet wurden. Nach dem Krieg verdingten sich Flüchtlinge freiwillig für jedwede Arbeit. Die Firma Christi an Carstens Tönnieshof GmbH in Fredelsloh stellte als Flüchtlingsbetrieb industrielle Keramik her. Nach 1977 meldete sie 1987 zum zweiten und endgültigen Mal Konkurs an (GeraId Könecke). Mit dem Abebben des Nachkriegsbooms und der zunehmenden Liberalisierung der Teilmärkte mussten weitere Betriebe in den 1960er und 1970er Jahren schließen, die Flachsröste in Bad Gandersheim bereits 1957, die Spinnerei im Gartetal1967, die
245 248 Rezensionen undanzeigen Ilse-Werke und die Sollinger Hütte gerieten in den 1970er Jahren in Schwierigkeiten. Deutlich wird, dass sich hier Strukturprobleme auswirkten, die durch Kriegswirtschaft und Nachkriegsboom zunächst überdeckt worden sind, so u.a. die fehlende Modernisierung der Produktionsanlagen im Tönnieshof und bei der Spinnerei im Gartetal (Maschinenpark aus der Zeit um 1900). Die Situation ist seit 1980 gekennzeichnet durch eine hohe Arbeitslosigkeit infolge zahlreicher Entlassungen und Konkurse. Heutige Firmen benötigen für die Erhöhung der Produktion infolge weitreichender Automatisierung zunehmend weniger Arbeitskräfte. So beschäftigte die Zuckerfabrik in Nörten um 1900 in der Kampagne 600 Personen. In den 1990er Jahren wurden nur noch 100 Personen benötigt. Das vorliegende Buch erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für alle Aufsätze gilt das abschließende Resumee, mit dem Thomas Krueger seinen Aufsatz enden lässt: "Längst nicht alle Facetten... konnten vorgestellt werden. Viele Detailfragen... sind noch zu klären. Doch es lohnt sich, sie zu bearbeiten und diese Region mit anderen zu vergleichen und eingehender, als es hier möglich war, zu analysieren" (S. 60). Museumsfachleute, Wissenschaftler und erfahrene Heimatforscher haben für den Zeitraum der letzten drei Jahrhunderte zahlreiche regionalhistorische Fakten zusammengetragen, die als Grundlage für übergeordnete wirtschaftshistorische Forschungen dienen können. Gudrun Fiedler Frank Bei er, Die Geschichte der Stadt Wolfenbüttel 1933 bis Zeitzeugen - Fotos Dokumente (Beiträge zur Geschichte der Stadt Wolfenbüttel 11). Wolfenbüttel: Heckner 2003, 244 S., Abh., 14,90 Der katastrophale Verlauf der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert hat dazu geführt, dass die Epoche des Dritten Reiches geradezu Schlüsselfunktion für die Nationalgeschichte der Deutschen gewonnen hat. Umso größer ist seit etwa zwei Jahrzehnten das Interesse an der Frage, wie das Unmaß von Verblendung und verbrecherischer Barbarei weltgeschichtlichen Ausmaßes in den Jahren 1933 bis 1945 in die regionale bzw. lokale Sphäre hinabreichte oder sogar auch dort seine Wurzeln hatte. Seit etwa 1983 regte sich auch in Wolfenbüttel ein zunehmendes öffentliches Interesse an der Erforschung der NS-Ära in dieser Stadt, die besonders hier ein brisantes Thema war. Hier konnte man sozusagen an einem Testfall feststellen, was von der politischen Moral dieser Stadtbevölkerung zu halten war. Der von der Stadt i. J herausgegebene Vortragssammelband über" Wolfenbüttel unter dem Hakenkreuz" war eine erste wissenschaftliche Annäherung an diese Thematik. Im Vorwort stellte der Bürgermeister damals in Aussicht, dass demnächst ein "geeigneter Historiker" eine Gesamtdarstellung erarbeiten werde, die die auffallendc Lücke in der sonst für die Zeitspanne von 1871 bis 1986 bereits einigermaßen erforschten modernen Stadtgeschichte endlich ausfüllen solle. Dieser Band liegt nunmehr vor, ist jedoch eine große Enttäuschung, da der Verfasser dem schwierigen Thema nicht gewachsen war. Das ist ihm selbst wohl auch klar geworden, da er im Vorwort seine Ergebnisse einschränkend als "ersten Einstieg" bzw. als "Beitrag zur Geschichte" dieser Jahre bezeichnet. Im Buchtitel hätte das jedoch vernünftigerweise zwingend deutlich gemacht werden müssen, etwa derart: "Zur Geschichte der Stadt Wolfenbüttel 1933 bis 1945: Zeitzeugen... (etc.)". Abgesehen von diesem zu viel versprechenden und damit irreführenden Haupttitel verunzieren diesen Band zahlreiche Mängel. Die Fehler- und Mängelliste ist frustrierend lang und betrifft sehr viele Details, die hier nicht einzeln erörtert werden können, aber auch die ganze Konzeption und Durchführung dieses für Wolfenbüttel wichtigen Forschungsprojektes.
246 Rezensionen undanzeigen 249 Offenbar beherrscht B. als ausgebildeter Historiker erstaunlicherweise das Handwerkszeug der Geschichtsforschung nicht bzw. lässt deren Methodik außer Acht. Ein Blick in das Literaturverzeichnis belehrt jeden Kenner der stadtgeschichtiichen Materie, dass hier ein methodisch unbeholfener bzw. nachlässiger Historiker am Werk ist, der wichtigste Spezialliteratur zu seinem Thema nicht kennt (ich zähle mindestens etwa 17 fehlende, aber völlig unverziehtbare Arbeiten!) oder nicht nennt und in seinem Buch auch nicht verwertet, aber in wirrer Art ungefähr 30 völlig überflüssige allgemein gehaltene oder abseitige Literaturtitel (z. B. der im Buch überhaupt nicht vorkommende Oswald Spengler!) umständlich aufführt. Schon wegen dieser kaum begreiflichen Ignoranz ist sein auf schwammiger Grundlage ba<;ierendes Opus wissenschaftlich erheblich disqualifiziert. Da B. für seine Forschungsarbeit nur zwei Jahre zur Verfügung standen, entschied er sich angesichts der vorhandenen großen Quellenmassen (Archivalien, Zeitungen etc.) für umfangreiche Zeitzeugenbefragungen und die Suche nach Bildmaterial. Von den 108 Zeitzeugeninterviews, die "wohl auf Tonträgern gespeichert" sind (S. 16) [was bedeutet "wohl"?] hat er im vorliegenden Band nur 9 veröffentlicht. Aus weiteren vier bereits publizierten bzw. schriftlich fixierten Lebenserinnerungen zitiert er ausführlich wörtlich. Mit 121 Abbildungen (Fotos, Drucktexten usw.), 19 faksimilierten Dokumenten (Akten usw.) sowie Beiers eigenem Text mit verbindenden und übergreifenden Darstellungen der Geschehnisse ergibt sich eine umrisshafte grobe Skizze der nationalsozialistischen Ära in Wolfenbüttel. Ausgelassen sind aber wichtige Lebensgebiete wie die Bevölkerungsentwicklung, Verwaltung, Finanzen, Wirtschaft, Arbeitseinsatz und Zwangsarbeit. Es fehlt auch trotz der Fülle der genannten Namen eine gründlichere und systematische Darstellung des Führungspersonals in Stadt, Partei, Parteigliederungen usw. (sogar die Kreisleiter der NSDAP werden nicht vollzählig behandelt). Eine Vorstellung, wie die Stadtverwaltung und die NS-Parteiorganisation damals arbeitete und strukturiert war, erhält man nicht. Die Gleichschaltung der Vereine und sonstigen nichtkommunalen Institutionen wird nicht dargestellt. Das Großkapitel über HJ, BDM und die Schulen (d. h. eigentlich nur die Mittelschule) ist oberflächlich, da die einschlägige Literatur B. unbekannt blieb (u. a. Schultz über die HJ-Akademie in Braunsehweig 1978, die Jubiläumsschrift "Glaubenslehre, Bildung, Qualifikation" der Großen Schule 1993). Typisch für Beiers unkritische Arbeitsweise ist, dass er bei dem auf Seite 89 zusammenhanglos abgebildeten Aktendokument über Schülerwiderstand an der Großen Schule nicht auf die speziell einschlägigen Kapitel im o. g. Jubiläumsband dieses Gymnasiums (S !) verweist. Die Abschnitte über die Kirchen, die Neubaumaßnahmen (B. unterschlägt u. a. den geplanten Bahnhofsneubau), den Widerstandskämpfer Werner Schrader sowie das Strafgefängnis sind kläglich ausgefallen, weil wiederum die entsprechende Literaturkenntnis bzw. Schrifttumsauswertung fehlt. B. kennt nicht einmal Kuessners Biographie des Landesbischofs Johnsen und Knauers Dokumentation über das Strafgefängnis! Für das Kapitel über die Kriegsjahre nimmt er sich nicht die Mühe, den einschlägigen Aufsatz in "Wolfenbüttel unter dem Hakenkreuz" angemessen auszuwerten und sauber zu zitieren. Im Abschnitt "Wolfenbütteler Soldaten" findet der durch seine posthum publizierten Kriegsbriefe bekannt gewordene Peter Pfaff nicht einmal eine Erwähnung. Die z. T. umfangreichen Zeitzeugenberichte sind abgesehen von den drei interessanteren Stücken, nämlich den Aussagen der Kinder des Bürgermeisters Ramien, des NS-Kreisleiters Krebs und des Verlegers Kallmeyer weniger ergiebig, als man erwarten sollte. Sie bieten z. T. eine beschränkte, ganz individuelle und damit unbestimmbar repräsentative Sichtweise. B. will die Zeugen einfach "schildern" lassen, ohne deren Angaben kritisch zu kommentieren mit dem Ziel, eine "objektive Darstellung" zu erhalten (S. 19), was methodisch natürlich unsinnig ist. Da B. die Zeitzeugen nur mit ihren Namen, jedoch nicht mit biographischen Angaben zu ihrer Person zu Wort kommen lässt, weiß man nicht genau, um
247 250 Rezensionen undanzeigen welche Leute es sich eigentlich dabei handelt. Das ist besonders lästig im Fall eines von B. sozusagen als Kronzeugen behandelten Professors Dr. Dr. G. Wiemann, der auch ein ausführliches, aber umständliches Vorwort über die Methodik der "oral history" beisteuerte. An die darin angemahnten Grundsätze der kritischen Vorsicht hat sich B. jedoch selbst nicht gehalten. Die Oberflächlichkeit, die das Kennzeichen des ganzen Buches ist, zeigt sich nämlich auch insofern, dass von den Zeitzeugen einige naiv berichtete spektakuläre Vorgänge von B. überhaupt nicht kritisch hinterfragt werden: der angebliche Besuch von Hitlers Sekretär Martin Bormann beim Kreisleiter Krebs (S. 66) wäre eine so sensationelle Tatsache, dass eine Rückfrage beim Bundesarchiv nach dem Wahrheitsgehalt dieser Aussage zwingend geboten gewesen wäre. Schlimmer ist, dass der ganz vage, ungenaue Zeitzeugen bericht über einen Lynchmord an abgeschossenen amerikanischen Fliegern in Halchter (S. 171) wegen mangelnder Kenntnis der Ortschronik von Halchter (Rusteberg 1988, S. 170) von B. nicht richtiggestellt worden ist. An unverzeihliche Fahrlässigkeit grenzt es endlich, dass er im dürftigen Kapitel über das Kriegsende 1945 die einschlägige vorzügliche Dokumentation von Endewardl Mauss (WolfenbüUcl nach '45, 1986) nicht zitiert, aber aus dem darin abgedruckten Tagebuch von Wulfstich Partien (übrigens verkürzt!) abdruckt (S. 217 ff.) mit der Quellenangabe "Privatnachlass", der wiederum in seinem QuellenverLeichnis nicht erscheint. Die Frage drängt sich auf, woraus er in diesem Fall eigentlich zitiert hat. Ein Nebel der Ungenauigkeit umgibt auch die Schlüsselnotiz von Ramien über den Einmarsch der Amerikaner 1945 auf Seite 217, die sich gar nicht in der von B. zitierten Archivakte findet. Unkommentiert bleibt ein totaler Widerspruch: der angeblich in Theresienstadt ermordete Jude Max Cohn kam in Wahrheit im Juni 1946 nach Wolfenbüttel zurück (S. 205, 188). Die Mängelliste ließe sich für dieses Buch leicht fortsetzen. Viele Setzfehler, ein teilweise banaler, versimpelter Sprachstil (u. a. einfältig eingesetzte Anführungszeichen), Lücken in der Stoffdarbietung (Rüstungsindustrie und Zwangsarbeit fehlen u. a.) vervollständigen das Bild, dass dieses Buch eher dem Niveau einer laienhaften heimatkundlichen Zusammenstellung von bescheidenster Qualität als der von der Stadtverwaltung und dem Verfasser angestrebten "wissenschaftlichen Aufarbeitung" (S. 19) entspricht. Im Kontext der insgesamt hochstehenden wissenschaftlichen Forschung zur NS-Zeit im Lande Braunschweig ist Beiers Arbeit eine peinliche Entgleisung. Eine wissenschaftlich einwandfreie Behandlung des Themas bleibt deshalb in Wolfenbüttel weiterhin eine Forderung an die Zukunft. Dennoch ist diese BuchveröffentIichung trotz aller Mängel nicht ganz ohne Nutzen. Man erfährt mancherlei Neues und auch viel Bekanntes, aber isoliert Veröffentlichtes, erstmals zusammengefasst. Die Großkapitel "Machtergreifung" sowie "Verfolgung und Widerstand" ergeben wenigstens eine erste wenngleich lückenhafte Zusammenfassung dieser Geschehnisse: hier hat B. auch Archivquellen benutzt und viele Personen (Täter, Opfer usw.) eruiert, auf die ein Zugriff wegen des bedauerlicherweise fehlenden Personenregisters aber nur umständlich möglich ist. Auch nicht wenige Fotos und Dokumente und manche Zeugenberichte sind durchaus interessant und informativ. Für an schlichterem, aber ohne vertieften Horizont anregendem Lektürestoff interessierte Leser ist der vorliegende Band letztendlich gerade eben noch annehmbar. Dieter Lent
248 Rezensionen undanzeigen 251 Gudrun F i e die r u. Hans-Ulrich Lud e w i g (Hg.), Zwangsarbeit und Kriegswirtschaft im Lande Braunschweig (Quellen und Forschungen zur braunschweigischen Landesgeschichte 39). Braunschweig: Appe!hans-Ver!ag 2003, 512 S., Abb., 22 (für Mitglieder des Braunschweigischen Geschichtsvereins 14,30 ) Jahrzehntelang ignorierten Öffentlichkeit und Geschichtswissenschaft in Deutschland weitgehend die Tatsache, daß der nationalsozialistische Eroberungs- und Ausrottungskrieg nur geführt werden konnte, weil die als Soldaten an die Front geschickten Deutschen im heimischen Produktionsprozeß durch Heere ausländischer Männern und Frauen ersetzt wurden, die das NS-Regime zur Zwangsarbeit preßte. Ende 1944 belief sich ihre Zahl auf nahezu neun Millionen, unter ihnen zwei Millionen Kriegs- und über siebenhunderttausend KZ-Gefangene. In der hiesigen Region setzten die Untersuchungen zur Zwangsarbeit Anfang der 80er Jahre ein. Nach 1996 werden sie dann zahlreicher. Nun liegt die erste Gesamtdarstellung zu diesem Thema für das Land Braunschweig vor. Sie ist als Sammelband konzipiert und besteht aus Beiträgen von Gudrun Fiedler, Joanna und Kar! Liedke, Hans-Ulrich Ludewig, Heike Petry, Anke Menzel-Rathert, Ewa und Joachim Schmid sowie Norman-Mathias Pinge!, dessen Beiträge über 40% des Buches ausmachen. Das Autorenteam berücksichtigt nicht nur die gesamte bisher bundesweit und regional erschienene Spezialliteratur, sondern erschließt zahlreiche neue Quellen, so u.a. die AOK-Mcldekartci für ausländische Zivil arbeiter. Die Veröffentlichung besticht durch die souveräne Beherrschung der ihr zu Grunde liegenden Materialfülle, die übersichtlich in fünf, dann noch weiter untergliederten Abschnitten dargeboten wird. Von ihnen befassen sich die Abschnitte 1, 2 und 4 mit der Darstellung der hiesigen Rüstungswirtschaft und ihren wichtigsten Betrieben. Zur Sprache kommen Produktionsverlauf sowie die Integration dieser Firmen in das Zwangsarbeiter- und KZ System. Im Sommer 1944 hatten die vier Arbeitsamtsbezirke des Landes über ausländische Arbeitskräfte registriert, davon (35,5%) aus der Sowjetunion (sog. "Ostarbeiter"). Im Rüstungssektor lag der Zwangsarbeiteranteil bei 50% gegenüber 11 % Ende Die Verhältnisse in der Landwirtschaft werden ebenfalls gebührend berücksichtigt. Breiten Raum nimmt die Schilderung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Zwangsarbeiter, aber auch der Deutschen ein. Enthalten ist außerdem ein Beitrag über die wichtige Funktion der Arbeitsämter in diesem System. Dem jüngeren Publikum dürften die hier offen gelegten dunklen Seiten in der Geschichte der Arbeitsverwaltung weitgehend unhekannt sein. Besonders tief berühren die Ausführungen des vierten Abschnittes, in denen es um die Kriegs- und KZ-Gefangenen sowie um das Wüten der NS-Justiz geht. Auf großes Interesse, zumal der Fachwelt, wird auch der dritte Abschnitt stoßen: Die Auswertung der AOK-Meldekartei. Aus den rund Karteikarten der AOK Braunschweig wurden 2.461, also eine Zufallsstichprobe von 5%, gezogen. Sie erlaubt erstmals fundierte Aussagen über Gesundheitszustand, Herkunft, Beschäftigung, Geschlechts- und Altersstruktur der Zwangsarbeiter. Der fünfte Abschnitt macht ein Viertel des gesamten Textes aus. In ihm kommen noch lebende Zeitzeugen zu Wort, ehemalige Zwangsarbeiter aus Polen und der Sowjetunion und einstige Gefangene des KZ-Außenlagers SchilIstraße in Braunschweig, das für die Büssing-Werke eingerichtet worden war. Den Kontrast dazu bilden die Eindrücke, die befragten Deutschen zu diesem Thema noch vor Augen stehen, von Anke Menzel-Rathert übrigens glänzend analysiert ("Mythos vom Brotzustecken"). Hinsichtlich der Situation der Zwangsarbeiter ist festzustellen, daß die Autoren deren oft alptraumartigen Lebens- und Arbeitsbedingungen stets nüchtern schildern: Die Menschenjagden von SS und Wehrmacht in Polen und der Sowjetunion, die Massendeportatio-
249 252 Rezensionen undanzeigen nen, die deutschen Arbeitslager mit ihren Holzbaracken primitivster Bauart und katastrophalen sanitären Anlagen, den ständigen Hunger, die schmutzigen, harten, oft schwer gesundheitsschädigenden Arbeiten. Die Autoren registrieren Niederträchtigkeiten seitens der deutschen Betriebsangehörigen ebenso wie die raren humanen Gesten. Sie moralisieren nicht, ihre Erklärungen sind stets sachlich, differenziert und überzeugend. Eindringlich beschreiben sie, weiche Folgen die NS-Rassenideologie für jene hatte, die in der Hierarchie der Verachtung an unterster Stelle standen, zum einen die russischen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen, zum anderen - noch unter ihnen rangierend - die zu Arbeitssklaven herabgewürdigten Gefangenen aus den Konzentrationslagern. Für beide Gruppen galt das von den jeweiligen FirmenIeitungen akzeptierte und durchgesetzte ungeheuerliche NS Prinzip der" Vernichtung durch Arbeit" - mit erschütternden Resultaten. Kein Aspekt des Zwangsarbeitersystems bleibt ungenannt, nicht die Folgen des Verbots für diese Menschen, sich bei Bombenangriffen in die Luftschutzräume zu flüchten, nicht das Schicksal der Kranken, nicht das der schwangeren Frauen und ihrer Neugeborenen, nicht das berüchtigte Straflager 21, nicht die Terrorurteile furchtbarer Juristen, die nach dem Krieg ihre Karriere bruchlos fort~etzten. Die Autorengemeinschaft hat ein wichtiges, ein notwendiges Buch vorgelegt. Jeder der Beiträge zeichnet sich durch profunde Sachkenntnis aus. Die klare Diktion ihrer faktenund gedankenreichen Ausführungen prägt sich ein. Bei aller gebotenen Sachlichkeit mangelt es den Autorinnen und Autoren jedoch nicht an der unabdingbaren Empathie für die Opfer des von ihnen so kompetent dargestellten Zwangsarbeitersystems. Der Sammelband erweitert den Wissenshorizont zu diesem Thema außerordentlich. Ohne Zweifel kommt ihm der Rang eines regionalen Standardwerkes zu. Ein Rang, der eventuell eine noch stärkere Akzentuierung erfahren hätte, wenn nicht die Forschungsergebnisse zu Salzgitter (Reichswerke ) und Wolfsburg (VW) aus nachvollziehbaren Gründen unberücksichtigt geblieben wären. Zahlreiche Abbildungen sowie aufschlußreiche Grafiken und Tabellen, darunter eine vierseitige Aufstellung der Rüstungsbetriebe des Landes samt aufgeschlüsselter Beschäftigungszahlen, vor allem aber das im Anhang aufgeführte 66 Seiten umfassende, auf intensivem Quellenstudium beruhende, exzellente Verzeichnis sämtlicher 800 Arbeitslager des Landes, ferner ein detailliertes Register von 22 Seiten, verleihen dem Werk zudem den Charakter eines Handbuches. Diese Gesamtdarstellung ist ein Gewinn. Hans Christian Mempel Werner So h n, Im Spiegel der Nachkriegsprozesse: Die Errichtung der NS-Herrschaft im Freistaat Braunschweig (hg. vom Arbeitskreis Andere Geschichte e.v.). Braunschweig: Appelhans 2003, 224 S., Abb., 12,80 Dem selbstgerechten Staatsanwalt, der sich nach 1945 trotz seiner problematischen Vergangenheit als Kriegsrichter ohne Unrechtsbewusstsein im Kreis der städtischen Honoratioren bewegt, hat Wolfgang Staudte in der Person des Dr. Schramm 1959 mit dem Film "Rosen für den Staatsanwalt" ein gleichwohl ironisch überzeichnetes Denkmal gesetzt. Dennoch: die von Martin Held gespielte Figur des Dr. Schramm hat bis heute unser Bild vom Zustand der Justiz der frühen Bundesrepublik stärker geprägt als die Geschichtsforschung, die hier durchaus zu Differenzierungen neigt. Danach schienen die meisten Richter und Staatsanwälte unbeeindruckt von zwölf Jahren terroristischer Nazi-Diktatur in gewohnt positivistischer Manier (" Was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein.") Anklageschriften verfasst und Urteile gefällt und damit die "rechtliche" Denkungsweise des Nazi-Regimes fortgesetzt zu haben.
250 Rezensionen und Anzeigen 253 Zu einem ähnlichen Urteil gelangt Verf. in Bezug auf die Braunschweiger Justiz, sofern sie zwischen 1947 und 1953 (S. 14) mit der Aburteilung von "nazistischen Straftaten im Jahr 1933" (S. 12) befasst war. Neben einer geringen Zahl von "republikanisch eingestellten" Personen "stand die überwältigende Mehrheit der Braunschweiger Richter und Staatsanwälte, deren Rechtsverständnis obrigkeitsstaatlich geprägt war. In deren Rechtsdenken kam den Menschenrechten nur ein geringer Stellenwert zu, ein hoher dagegen der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung und der Bewahrung der Staatsraison. Für die Richter und Staatsanwälte, die in der Regel bereits im "Dritten Reich' in der Justiz gearbeitet hatten und Mitglied der NSDAP gewesen waren, war das NS-Regime eine legitime Diktatur gewesen." (S. 212 f.) Dieses Ergebnis ist zwar nicht neu und vor allem nicht überraschend, aber es gelingt Verf. in überzeugender Weise, aus der bislang weitgehend unbearbeiteten, geradezu uferlosen Materialgrundlage (807 Akteneinheiten über 117 Verfahren, S. 12) acht repräsentative Prozesse herauszuheben und nachvollziehbar zu dokumentieren. Der Leser wird in den Kapiteln 6 bis 13 (S ), die etwa zwei Drittel der Studie ausmachen, ausführlich über die Prozesse informiert, die vor dem Braunschweiger Landgericht gegen Nazi-Straftäter geführt wurden (u.a. Rieseberg-Prozess und das Verfahren gegen Dietrich Klagges). Revisions- und Parallel prozesse werden berücksichtigt, so dass ein facettenreiches Bild davon entsteht, was mit den Angeklagten von der Anklageerhebung bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens geschehen ist. Im diesem Zusammenhang werden die Hauptangeklagten biographisch beschrieben, die sich vor Gericht häufig mit durchsichtigen Schutzbehauptungen als jämmerliche Feiglinge zeigten. Den beteiligten Richtern und Staatsanwälten, die sich dadurch durchaus beeindrucken ließen, ist hingegen ein eigenes Kapitel gewidmet (S ). Die Ergebnisse der Prozesse bezeichnet Verf. im Ganzcn als unbefriedigend. Gemessen zum Beispiel an der entsetzlichen Grausamkeit gegenüber dem Uhrmachermeister Paasche (S ), der wegen des Verdachts, Kommunist zu sein, von SA-Leuten totgeprügclt wurde, und den unangemessenen Strafen, welche die Nazi-Täter (S ) dafür erhielten, muss man dem ohne Weiteres zustimmen. Verf. führt dies einerseits auf die veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen (Kap. 3) zurück, die immer mehr die gesellschaftliche Integration der Nazi-Täter in den Vordergrund stellten. Andererseits weist er an mehreren Stellen auf das Grundproblem der Rechtsprechung hin: Nur wenige Richter und Staatsanwälte konnten die Möglichkeit denken, dass das "Dritte Reich" seine Herrschaft per se auf illegale Grundlagen und Methoden gründete. Zum Beispiel wurde das bedenkenswerte Argument des Vorsitzenden des Schwurgerichts, Fritz Bauer, aus dem Jahr 1949, die Reichstagsbrandverordnung müsse, selbst wenn sie rechtmäßig zustande gekommen sei, bei Eingriffen in die Rechtssphäre des Einzelnen dafür sorgen, dass diese Eingriffe sich entgegen dem tatsächlichen Wortlaut der Verordnung in rechtsstaatlichen Grenzen bewegen (S. 86), vom Bundesgerichtshof 1952 mit der merkwürdigen Behauptung entkräftet, dass man der Person des Reichspräsidenten Hindenburg eine unredliche Absicht nicht zutrauen könne (S. 90). In dieser unreflektierten Verehrung des greisen Reichspräsidenten zeigt sich die biographische Dimension der uns befremdlich scheinenden Unfähigkeit vieler Richter, "gerechte" Urteile zu fällen. Gleichzeitig wird damit eine Schwäche der ansonsten verdienstvollen Studie deutlich. Verf. ordnet seine Ergebnisse nicht in größere Zusammenhänge ein. Er verzichtet einerseits konsequent auf die Berücksichtigung der rechtshistorischen Forschung (z. B. Diestelkamp, Stolleis), weiche die angedeutete rechtsdogmatische Problematik längst aufgezeigt hat, und anderseits versucht er nicht, das Verhalten der Richter und Staatsanwälte in seinen sozialen Bedingungen darzustellen. Daher kann er die wichtige Frage nach
251 254 Rezensionen und Anzeigen den Gründen für dieses Verhalten nur ganz allgemein mit der sattsam bekannten konservativen und obrigkeitsstaatlichen "Gesinnung" (z. B. Angermund, 1. Müller) beantworten. Die Gründe für die unterschiedlichen Rechtsauffassungen der Braunschweiger Juristen liegen auch in der 1918 begonnenen polarisierenden Personalpolitik der wechselnden Regierungskoalitionen. So sind noch beim Justizpersonal nach 1945 mehrere Gruppen zu erkennen, deren biographisch bedingte Rechtsauffassungen miteinander in Konflikt lagen: die Gruppe der im wesentlichen bürgerlich-konservativen alten Braunschweiger Landeskinder um Wilhelm Mansfeld, die Gruppe der auf Betreiben der SPD in die Justiz gekommenen, zumeist jüngeren und häufig landesfremden "NaturrechtIer" um Curt Staff und die Gruppe der politisch und fachlich amorphen, aber ebenfalls jüngeren Juristen, die während des "Dritten Reichs" ihre "Karriere" gemacht hatten (z. B. Hermann Hübschmann). Der Ausgang eines Prozesses hing demnach auch davon ab, aus weicher Gruppe die beteiligten Richter stammten. Markus Bernhardt Heidrun E dei man n, Heinz Nordhoff und Volkswagen. Ein deutscher Unternehmer im amerikanischen Jahrhundert. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht 2003, 363 S., Abb., 24,90 Volkswagen und Heinrich Nordhoff, das war 20 Jahre lang, von 1948 bis 1968, fast ein Synonym. Unter seiner Leitung entwickelte sich das Unternehmen in Wolfsburg vom Automobilwerk in der britischen Zone zum Konzern mit Weltgeltung. Mit der vorliegenden Veröffentlichung hat Heidrun Edelmann eine Geschichte des Volkswagenwerkes in der Ära Nordhoff geschrieben. Der 1899 in Hildesheim geborene Heinrich Nordhoff trat seine Stelle als Generaldirektor im Wolfsburger Werk im Januar 1948 nicht gerade enthusiastisch an. Ihn zwangen vielmehr die Umstände. Der ehemalige Leiter des Brandenburger Werkes der General-Motors-Tochter Opel konnte im Rüsselsheimer Stammwerk in der amerikanisch besetzten Zone nicht arbeiten, weil er von der US-Militärregierung als ehemaliger" Wehrwirtschaftsführer" wie viele andere keine leitende Tätigkeit ausüben durfte. Die in starken finanziellen Nöten steckenden Briten sahen in ihm vor allem die effiziente Führungskraft, die das angeschlagene Werk in Wolfsburg auf Erfolgskurs bringen konnte. Nordhoff selbst stand der Volkswagen-Limousine, dem zu diesem Zeitpunkt einzigen Produkt des Unternehmens, zunächst skeptisch gegenüber. Er bezeichnete den "Käfer" als "billiges, kleines Ding". Der Maschinenbau-Ingenieur mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt erwies sich als der Mann mit dem richtigen Blick für die Steigerung des Absatzes. Dank seiner bei Opel bereits vor dem zweiten Weltkrieg im Kundendienst und in der Verkaufsabteilung in leitenden Stellungen erprobten Weitläufigkeit und seiner Kenntnisse des amerikanischen Marktes konnte er die Chancen der sich liberalisierenden Weltwirtschaft in der Nachkriegszeit nutzen. Bereits früh setzte er konsequent auf den Export. Schon in den 1950er Jahren gab es überall auf der Welt Kundendienst- und Vertriebsniederlassungen. Vor allem die USA garantierten bis Mitte der 1960er Jahre hohe Absatzzahlen. Die Menschen in der Bundesrepublik erlebten automobile Freiheit zuerst mit "ihrem Käfer". Seine Zähigkeit, seine Robusthcit und seine Anspruchslosigkeit waren wichtige Verkaufsargumente in einer Zeit, in der es darauf ankam, das erworbene Auto möglichst lange als fahrbaren Untersatz nutzen zu können. Heidrun Edelmann zeigt vor allem anhand von Presseverlautbarungen und Vorstandsprotokollen, wie "König" Nordhoff selbstbewusst bis zu seinem Tod 1968 das Unterneh-
252 Rezensionen undanzeigen 255 men steuerte. Auch die Privatisierung 1961 tat dem keinen großen Abbruch. Warum Heidrun Edelmann im Untertitel das 20. Jahrhundert als amerikanisches Jahrhundert kennzeichnet, bleibt dabei offen. Hier hätten möglicherweise einige einführende Sätze zur Fragestellung des Buches weiter geholfen. Edelmann beschreibt Nordhoff nicht nur als Wirtschafts1cnker. Er habe sich auch als verantwortlich für die soziale Lage der "Belegschaft" des Volkswagenwerkes verstanden, die er noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg als homogene "Gefolgschaft" gesehen habe. Aus heutiger Sicht kann sein Unternehmerbild eher als patriarchalisch beschrieben werden. In der Frühphase der Bundesrepublik erschien dieses Modcll dennoch unerhört modern. Die Verfasserin zeigt ihn bei Ansprachen in der Betriebsversammlung, in denen er die Identität der Interessen von Unternehmern und Arbeitern beschwor. Sie zitiert die,motor-rundschau" aus dem Jahre 1949, die Nordhoff ein Portrait widmete und darin schrieb, dass an die Stelle des "Kapitalisten der überlieferten Form" der "angestellte und bezahlte Manager" getreten und damit "das Streben nach Stetigkeit und Sicherheit für Betrieb und Gefolgschaft" (S. 107) getreten sei. Die Verfasserin schildert das Leben Nordhoffs vor allem in seincr zweitcn Hälftc als erfolgreicher VW-Manager, die in seinem 50ten Lebensjahr begann. Diese Zeit umfasst zwei Drittel dcs Buches. Nordhoff kommt ausgiebig zu Wort. Viele Details aus der Firmengeschichte werden zur Erläuterung seiner offiziellen Sicht ergänzend eingestreut. Wer sich darüber hinaus zur eigentlichen Firmengeschichte informieren möchte, der sei u.a. auf die Veröffentlichungen von Bettina Gundler zur TH Braunschweig in den 1920er Jahren mit einem wichtigen Exkurs zur damaligen Ingenieursausbildung, von Volker Wellhöner zum westdeutschen Fordismus am Beispiel von VW (ausgestattet mit zahlreichen Statistiken) sowie von Markus Lupa und Ralf Richter im Rahmen der wissenschaftlich fundierten Schriftenrcihe des Unternehmensarchivs der Volkswagen AG in Wolfsburg verwiesen. 3 Der Mensch Heinrich Nordhoff bleibt hinter den Verlautbarungen allerdings ein wenig blass. Er lugt kaum hinter dcm erfolgreichen Manager als öffentlicher Person hervor. Die frühen Prägungen im Elternhaus und während des Studiums an der TH Charlottenburg auf der einen und die Aktivitäten des Managers eines Weltkonzerns auf der anderen Seite stehen eher unverhunden neheneinander. Edelmann hält sich an das in der offiziellen Darstellung geschaffene Bild des erfolgreichen und überlegen agierenden Unternehmers. Dennoch: Auch Heinrich Nordhoff hatte Grenzen, die ihm trotz aller Talente gesetzt waren. So ist ihm sicher wegen der auf ihn zugeschnittenen Entscheidungsstrukturen des Volkswagenwerkes ein hoher Anteil an der existenzbedrohenden Krise des Unternehmens zwischen 1966 und 1973 zuzuschreiben. Nordhoff entwickelte in den 1960er Jahren kaum mehr Gespür für die neuartigen technischen Entwicklungen und die nach Ende der" Wirtschaftswunderphase" schwieriger werdende Marktsituation. VW verpasste beinahe den Anschluss an eine neue Autogeneration. Die für den Fortbestand des Unternehmens nicht unwichtige Nachfolgefrage im Vorstand wurde wegen der übermächtig gewordenen Person Nordhoff nicht genügend diskutiert. Dies geht deutlich aus dem Buch hervor, wird aber von der Autorin nicht thematisiert. 3 Bettina Gundler, Technische Bildung, Hochschule, Staat und Wirtschaft: Entwicklungslinien des Technischen Hochschulwesens Das Beispiel der TH Braunschweig. liildesheim Volker Wellhöner, "Wirtschaftswunder" - Weltmarkt - Westdeutscher Fordismus. Münster 1996; Volkswagen Chronik, Text: Markus Lupa (Historische Notate, Heft 7, Schriftenreihe des Unternehmensarchivs der Volkswagen AG, Wolfsburg) Wolfsburg 2002; Markus Lupa, Das Werk der Briten. Volkswagenwerk und Besatzungsmacht (Historische Notate, Heft 2) Wolfsburg 1999; Ralf Richter, Ivan Hirs!. Britischer Offizier und Manager des Volkswagenaufbaus (Historische Notate, Heft 8), Wolfsburg 2003.
253 256 Rezensionen undanzeigen Der biographische Ansatz bietet sicher eine gute Möglichkeit, dem Leser das mitunter spröde Terrain der Unternehmens- und Wirtschaftsgeschichtsschreibung im 20. Jahrhundert nahe zu bringen. Nordhoff kam mit wichtigen Persönlichkeiten des politischen und wirtschaftlichen Lebens in den ersten zwei Dritteln des 20. Jahrhunderts zusammen. Er war ehrgeizig und sah sich vor und nach dem Zweiten Weltkrieg mit wichtigen Aufgaben konfrontiert, die mitten hineinführten in wirtschaftliche und gesellschaftliche Brennpunkte. Nordhoff wusste im Interesse der jeweiligen Firma die richtigen Kontakte auch zu den Größen des Dritten Reiches zu knüpfen, wirkungsvolle Presseauftritte zu inszenieren und effizient den Betriebsablauf zu kontrollieren. All das gibt viel Stoff für eine spannungsreiche Biographie ab. Da Heidrun Edelmann hauptsächlich aus Quellen schöpft, die ursprünglich für eine bewusst inszenierte Darstellung in der Öffentlichkeit angefertigt wurden, erscheint Nordhoff allerdings ein wenig zu glatt, zu perfekt und zu allmächtig. Die Rezensentin hätte sich gerade bei einem derart herausgehobenen Manager eine intensivere Auseinandersetzung mit seiner Rolle im Dritten Reich gewünscht, die allein von seiner schwierigen Position als Verbindungsmann Opcls her nicht eindeutig sein gewesen kann habe er, so beschreibt Heidrun Edelmann ihn, "die einzigartige Chance [genutzt - d. Verf.], die sich ihm 1948 in Wolfsburg bot, um Deutschlands Rückstand auf dem Gebiet der Produktion und der Verbreitung von Personenkraftwagen zu überwinden" (310). Das hieße, ihm in einer unübersichtlichen Zeit eine fast übermenschliche Voraussicht zuzuschreiben und ihn gar als einzigen Motor der automobilen Entwicklung in Deutschland zu sehen. Insgesamt bietet Heidrun Edelmanns Buch, dem leider ein Register fehlt, gut erzählten Lesestoff zum Einstieg und viele interessante Fakten in ein wichtiges Kapitel bundesrepublikanischer Wirtschaftsgeschichte. Gudrun Fiedler Volker D 0 w i d a t, Polizei im Rückspiegel. Die Geschichte der Polizeidirektion Braunschweig. Braunschweig: Döring 2003, 288 Seiten, Abb., 21,90. In der angezeigten Arbeit hat ein Insider (Polizeioberkommissar) den gelungenen Versuch gemacht, aus der Fülle des in den öffentlichen Archiven sowie in privaten Sammlungen erhaltenen Materials zur Polizeigeschichte Braunschweigs eine chronologische Darstellung zu formen, die schlaglichtartig die Tätigkeit einer Schnittstelle der staatlichen Verwaltung zu den Mitgliedern des Gemeinwesens auf dem Feld der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für den Zeitraum ab etwa Anfang des 19. Jahrhunderts spiegelt. Vorangestellt sind eine einführende Erklärung des Polizeibegriffs und eine kurze Skizzierung "Die Polizei im alten Braunschweig". Danach gliedert sich die Veröffentlichung in die Kapitel "Polizei - Münzstraße", "Braunschweig zwischen links und rechts", "Braunschweigs Polizei im NS-Staat" sowie "Braunschweigs Polizei 1945 bis zur Gegenwart". Organisatorischer Aufbau, Uni formierung, technische und Gebäudeausstattung sowie personelle Zusammensetzung des Führungskörpers der Polizei werden jeweils im Kontext der Zeitumstände unter Verwendung von vorzüglichem Bildmaterial (233 Abbildungen und Fotos, davon 14 in Farbe) äußerst detailliert und anschaulich mitgeteilt. Schwerpunkte bilden dabei der Zeitraum vom Ende der Monarchie bis zur nationalsozialistischen Machtergreifung, die Zeit des Nationalsozialismus bis zum Zusammenbruch sowie die unmittelbare Nachkriegszeit bis zum Bezug der neuen Dienstgebäude in der Friedrich-Voigtländer-Stra Be im Jahre Durch die bekannte Sonderentwicklung des Freistaates Braunschweig innerhalb des Deutschen Reiches (Beispiel: die frühe nationalsozialistische Beteiligung an einer Länderregierung bereits im Jahre 1930) gewinnt die Arbeit geradezu exemplarischen
254 Rezensionen undanzeigen 257 Charakter. Bei alier QuelIentreue - die zahlreich im Wortlaut zitierten Quellen sind durchweg genauestens in Fußnoten belegt - kommt die Darstellung jedoch über die lokale Perspektive oftmals nicht hinaus. Dazu hätte es vielleicht eines anderen Ansatzes bedurft, wie er für ein Parallelvorhaben in unserer benachbarten Landeshauptstadt Hannover verfolgt wurde. Dort hat man nämlich für die Festschrift zum 100. Gebäudejubiläum des Polizeipräsidiums Hannover sowohl Autoren gewonnen, die als Angehörige der Polizei die Binnenperspektive einbringen, als auch sachverständige Historiker, die die Polizei unter geschichtswissenschaftlichen Fragestellungen betrachten. 4 Auffallend ist außerdem, dass die Aufgabenschwerpunkte der Polizei und deren bis heute andauernder Wandel seit Mitte der 60er Jahre - abgesehen von Organisations-, Ausstattungs-, Bau- und Personalfragen - kaum behandelt werden. Diese FeststelIungen schmälern allerdings nicht den Wert der hier angezeigten Arbeit von Volker Dowidat für die Regionalgeschichte Braunschweigs. Einige ausgewählte Themen machen nachfolgend deutlich, welch ungeheure Materialfülle der Verfasser verarbeitet hat: Der Bogen spannt sieh über die Bekanntmachung des Verbots des Tabakrauchens auf allen öffentlichen Straßen und Plätzen aus dem Jahre 1824, die verschiedenen Dienstgebäude und Unterkünfte von den klassizistischen Torhäusern bis zum Bezug des Präsidiums in der Münzstraße, die Ereignisse beim Zusammenbruch der Monarchie, die Besetzung der Stadt durch Truppen des Freikorps Maercker, die sogenannte "Stahlhelm"-Affäre, die politischen Gegensätze 1924 bis 1930, die Übernahme der Polizeigewalt durch die Nationalsozialisten, die Säuberungs maßnahmen durch das NS-Regime, den Übergang der Polizeihoheit von den Ländern auf das Reich, die Entwicklung der politischen Polizei zur Gestapo, die Militarisierung der Polizei und die Teilnahme einer Braunschweiger Polizeieinheit bei der Besetzung des Sudetenlandes, die Kriegszeit mit den Auswirkungen der Luftangriffe bis zum Zusammenbruch, den Neubeginn 1945 und die Entnazifizierung, die Halbstarkentumulte Mitte der 50er Jahre bis zum Ausblick "Braunschweigs Polizei heute". Biographische Angaben zu den Polizeipräsidenten, eine chronologische Zusammenstellung der Daten und Fakten von 1814 bis 2002 sowie ein Verzeichnis der benutzten Quellen und Literatur erhöhen den Gebrauchswert für den lokal historisch interessierten Leser. Lediglich das Fehlen eines Personenindex kann man als kleinen Mangel betrachten. Die buchmäßige Ausstattung und das gut lesbare Layout lassen nichts zu wünschen übrig. Hans-Martin Arnoldt 4 Hans-Joachim Heuer, Hans-Dieter Klosa, Burkhard Lange, Hans-Dieter Schmid (Hg.): Von der Polizei der Obrigkeit zum Dienstleister für öffentliche Sicherheit. Festschrift zum 100. GebäUlkjubiläum des Polizeipräsidiums Hannover Verlag Deutsche Polizeiliteratur, Hilden 2003.
255 Chronik des Braunschweigischen Geschichtsvereins 1. Allgemeines vom Oktober 2003 bis Oktober 2004 (Johannes Angel) Die Mitgliederversammlung am 22. April 2004 im Städtischen Museum Braunschweig wurde von 100 Mitgliedern und Gästen besucht. Der Vorsitzende stellte die Beschlussfähigkeit fest und gedachte der seit der letzten Jahreshauptversammlung verstorbenen Mitglieder. Er informierte über die seit der letzten Mitgliederversammlung erschienenen Veröffentlichungen, aus der die Dokumentation "Zwangsarbeit und Kriegswirtschaft im Lande Braunschweig " herausragt. Das Vorstandsmitglied Frau Dr. Fiedler berichtete über die Vortragsserie des Winterhalbjahres , die nach der Mitgliederversammlung abgeschlossen wurde. Mit insgesamt fast 600 Besuchern war die Resonanz erfreulich und ein Widerhall für die interessante Bandbreite der Themen. Frau Dr. Fiedler informierte dann über die geplanten Studienfahrten des Sommerhalbjahres Kurz nach Versendung der Einladungen waren drei Exkursionen bereits völlig überbucht. Der Schatzmeister Herr Köckeritz legte den Abschluss per 31. Dezember 2003 vor und erläuterte die Einnahmen und Ausgaben. Der Kassenbestand betrug am Jahresende 8.575,33 Euro. Herr Köckeritz warb in Bezug auf den Jahresbeitrag bei den Mitgliedern um Abgabe von Einzugsermächtigungen. Frau Dr. Strauß berichtete dann über die Rechnungsprüfung durch sie und Herrn Mcdefind. Die Unterlagen seien vorzüglich geordnet gewesen und die Kasse habe gestimmt. Auf Antrag aus der Mitte der Mitglieder wurde dem Vorstand einstimmig bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder Entlastung erteilt. Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes berichteten der Vorsitzende über die laufenden Projekte des Vereins, das sind die Erarbeitung von Publikationen über mittelalterliche Siegel in den Beständen des Staats archivs Wolfenbüttel und die Erarbeitung eines vom 8. Jahrhundert bis 1800 reichenden Braunschweigischen Biographischen Lexikons, sowie Frau Dr. Fiedler über die neue Homepage des Vereins. Der Gesamtvorstand trat am 20. April 2004 und am 09. September 2004 zu Sitzungen zusammen. Die Mitgliederzahl betrug im Oktober 2004 insgesamt 618 Personen und Institutionen.
256 Veröffentlichungen Braunschweigisches Jahrbuch für Landesgeschichte Band 84,2003. Besonders interessant sind die Edition des Briefwechsels zwischen dem Kolonisator Hermann Blumenau und dem Erfurter Apotheker und Chemikalienfabrikanten Hermann Trommsdorff aus den Jahren von Irene R. Lauterbach sowie der Bericht von Uwe Ohainski über Arnold von Dorstadt. Dokumentation "Zwangsarbeit und Kriegswirtschaft im Lande Braunschweig " herausgegeben von Gudrun Fiedler und Hans-Ulrich Ludewig, Braunschweig 2003 (Quellen und Forschungen zur Braunschweigischen Landesgeschichte Band 39). Diese Dokumentation wurde mit generöser Unterstützung durch die Stiftung Nord/ LB-Öffentliche und die Arbeitsverwaltung seit 1997 erarbeitet. Mitglieder des Vereinsvorstandes steuerten Arbeitsleistungen in einem für die Vereinsgeschichte bisher einmaligem Umfang bei. Wissenschaftlicher Sammelband "Auf dem Wege zur herzoglichen Residenz. Wolfenbüttel im Mittelalter", herausgegeben von Ulrich Schwarz, Braunschweig 2003 (Quellen und Forschungen zur Braunschweigischen Landesgeschichte Band 40). Die erste Auflage dieser Publikation ist bereits vergriffen. Tagungsband "Braunschweig-Wolfenbüttel in der Frühen Neuzeit. Neue historische Forschungen", herausgegeben von Christian Lippelt und Gerhard Schildt, Braunschweig 2003 (Quellen und Forschungen zur Braunschweigischen Landesgeschichte Band 41). Gabriele Strathmann: "Das ehemalige Herzogtum Braunschweig unter dem Aspekt der Auswanderung - bei besonderer Berücksichtigung der westlichen Landkreise Holzminden und Gandersheim - von 1750 bis Motive, Verlauf und Folgen der Auswanderungsbewegung", Braunschweig 2003 (Beihefte zum Braunschweigischen Jahrbuch Band 17). 3. Vorträge a) im Städtischen Museum Braunschweig Donnerstag, 9. Oktober 2003: Herr Joachim F. Tornau, Göttingen/ Kassel: Gegenrevolution von unten. - Bürgerliche Sammlungsbewegungen in Braunschweig, Hannover und Göttingen. Donnerstag, 27. November 2003: Herr Dr. Hans-Ulrich Ludewig, Historisches Seminar der TU Braunschweig: Zwangsarbeit in der Kriegswirtschaft im Lande Braunschweig 1939 bis Donnerstag, 15. Januar 2004: Herr Dr. Michael Geschwinde/ Herr Martin Oppermann, Institut für Denkmalpflege Braunschweig: Der Wurmberg bei Braunlage - Einem archäologischen Mythos auf der Spur. Donnerstag, 11. März 2004: Herr Prof. Dr. Wolfgang Milde, Wolfenbüttel: Frauenbilder im Mittelalter - in Braunschweig und anderswo.
Veröffentlichungen des Instituts für Historische Landesforschung der Universität Göttingen
 Veröffentlichungen des Instituts für Historische Landesforschung der Universität Göttingen Band 2,13: Gerhard Streich (Hg.) Blatt Höxter 1996. ISBN 978-3-89534-187-8. Pb. 21 x 15 cm. 124 S. 27 sw. Abb.
Veröffentlichungen des Instituts für Historische Landesforschung der Universität Göttingen Band 2,13: Gerhard Streich (Hg.) Blatt Höxter 1996. ISBN 978-3-89534-187-8. Pb. 21 x 15 cm. 124 S. 27 sw. Abb.
Zum Archivale der Vormonate bitte scrollen!
 Archivale des Monats Juni 2013 Wohnungsvermietung vor 700 Jahren Dechant und Domkapitel zu Köln vermieten dem Goswin gen. von Limburch gen. Noyge auf Lebenszeit ihr Haus, das zwei Wohnungen unter seinem
Archivale des Monats Juni 2013 Wohnungsvermietung vor 700 Jahren Dechant und Domkapitel zu Köln vermieten dem Goswin gen. von Limburch gen. Noyge auf Lebenszeit ihr Haus, das zwei Wohnungen unter seinem
angereichert wurde. Alemannien war damit, wie kurz zuvor schon das Herzogtum Würzburg, von der fränkischen Herrschaftsorganisation erfasst, die sich
 angereichert wurde. Alemannien war damit, wie kurz zuvor schon das Herzogtum Würzburg, von der fränkischen Herrschaftsorganisation erfasst, die sich nun nach den aus den Hausmeiern hervorgegangenen Königen
angereichert wurde. Alemannien war damit, wie kurz zuvor schon das Herzogtum Würzburg, von der fränkischen Herrschaftsorganisation erfasst, die sich nun nach den aus den Hausmeiern hervorgegangenen Königen
Die Ausgrabungen auf der Ortenburg
 Die Ausgrabungen auf der Ortenburg www.archsax.sachsen.de Die Ausgrabungen auf der Ortenburg Im Januar 2002 wurden die 1999 begonnenen Grabungen auf der Ortenburg planmässig abgeschlossen. Die Untersuchungen
Die Ausgrabungen auf der Ortenburg www.archsax.sachsen.de Die Ausgrabungen auf der Ortenburg Im Januar 2002 wurden die 1999 begonnenen Grabungen auf der Ortenburg planmässig abgeschlossen. Die Untersuchungen
Der Anspruch auf die Königswahl Heinrichs II.
 Geschichte Alexander Begerl Der Anspruch auf die Königswahl Heinrichs II. Das neue Verständnis der Herzogtümer Studienarbeit Der Anspruch auf die Königswahl Heinrichs II. Das neue Verständnis der Herzogtümer
Geschichte Alexander Begerl Der Anspruch auf die Königswahl Heinrichs II. Das neue Verständnis der Herzogtümer Studienarbeit Der Anspruch auf die Königswahl Heinrichs II. Das neue Verständnis der Herzogtümer
Mittelalterliche Burgen um Futterkamp, Kreis Plön
 INGOLF ERICSSON Mittelalterliche Burgen um Futterkamp, Kreis Plön Die wohl schon im 7. Jahrhundert beginnende slawische Einwanderung in Ostholstein, die im 12. Jahrhundert folgende deutsche Kolonisation
INGOLF ERICSSON Mittelalterliche Burgen um Futterkamp, Kreis Plön Die wohl schon im 7. Jahrhundert beginnende slawische Einwanderung in Ostholstein, die im 12. Jahrhundert folgende deutsche Kolonisation
Impressionen aus Alt-Freusburg im Siegtal
 Impressionen aus Alt-Freusburg im Siegtal 1. Zur Geschichte der Burg und Siedlung Freusburg Im Früh- und Hochmittelalter gehörten die Wälder entweder dem König oder den hohen weltlichen und geistlichen
Impressionen aus Alt-Freusburg im Siegtal 1. Zur Geschichte der Burg und Siedlung Freusburg Im Früh- und Hochmittelalter gehörten die Wälder entweder dem König oder den hohen weltlichen und geistlichen
Das Frühmittelalter und seine Fundarmut als chronologisches Problem
 Ringvorlesung Querdenker Das Frühmittelalter und seine Fundarmut als chronologisches Problem Heribert Illig mantisillig@gmx.de 1 Übersicht 1: Chronologiekritik und Niemitz 2: Thesen zum erfundenen Mittelalter
Ringvorlesung Querdenker Das Frühmittelalter und seine Fundarmut als chronologisches Problem Heribert Illig mantisillig@gmx.de 1 Übersicht 1: Chronologiekritik und Niemitz 2: Thesen zum erfundenen Mittelalter
QUELLEN UND ABHANDLUNGEN ZUR MITTELRHEINISCHEN K I RCHENGESCH I CHTE IM AUFTRAGE DER GESELLSCHAFT FÜR MITTELRHEINISCHE KIRCHENGESCHICHTE
 QUELLEN UND ABHANDLUNGEN ZUR MITTELRHEINISCHEN K I RCHENGESCH I CHTE IM AUFTRAGE DER GESELLSCHAFT FÜR MITTELRHEINISCHE KIRCHENGESCHICHTE HERAUSGEGEBEN VON FRANZ RUDOLF REICHERT BAND 17 BEITRÄGE ZUR MAINZER
QUELLEN UND ABHANDLUNGEN ZUR MITTELRHEINISCHEN K I RCHENGESCH I CHTE IM AUFTRAGE DER GESELLSCHAFT FÜR MITTELRHEINISCHE KIRCHENGESCHICHTE HERAUSGEGEBEN VON FRANZ RUDOLF REICHERT BAND 17 BEITRÄGE ZUR MAINZER
Thomas Dahms. Die Hagen von Salzgitter-Gebhardshagen, Braunschweig, Gandersheim und des Klützer Ortes
 Thomas Dahms Die Hagen von Salzgitter-Gebhardshagen, Braunschweig, Gandersheim und des Klützer Ortes Eine regionale Vergleichsstudie zur mittelalterlichen Wald- und Siedlungsgeschichte in Niedersachsen
Thomas Dahms Die Hagen von Salzgitter-Gebhardshagen, Braunschweig, Gandersheim und des Klützer Ortes Eine regionale Vergleichsstudie zur mittelalterlichen Wald- und Siedlungsgeschichte in Niedersachsen
Ur- und Frühgeschichtsforscher
 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Wilhelm Ur- und Frühgeschichtsforscher Berlin 2002 Bibliothek
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Wilhelm Ur- und Frühgeschichtsforscher Berlin 2002 Bibliothek
Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen
 Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen Thematisches Kartenwerk, welches sich im Raum erstreckende historische Tatsachen, Ereignisse und Entwicklungen des Freistaates Sachsen in seinen Grenzen
Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen Thematisches Kartenwerk, welches sich im Raum erstreckende historische Tatsachen, Ereignisse und Entwicklungen des Freistaates Sachsen in seinen Grenzen
Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Löwenburg- Ruine hoch über dem Siebengebirge von Frank Buchali
 Burgen und Schlösser in Nordrhein-Westfalen Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Königswinter-Ittenbach Löwenburg- Ruine hoch über dem Siebengebirge von Frank Buchali Südlich von
Burgen und Schlösser in Nordrhein-Westfalen Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Königswinter-Ittenbach Löwenburg- Ruine hoch über dem Siebengebirge von Frank Buchali Südlich von
4. vorchristlichen Jahrhunderts stammen. Die Funde geben überraschende Hinweise auf eine eisenzeitliche Besiedlung im Tal der mittleren Wupper, deren
 4. vorchristlichen Jahrhunderts stammen. Die Funde geben überraschende Hinweise auf eine eisenzeitliche Besiedlung im Tal der mittleren Wupper, deren Bewohner von Ackerbau und Viehzucht lebten. Vermutlich
4. vorchristlichen Jahrhunderts stammen. Die Funde geben überraschende Hinweise auf eine eisenzeitliche Besiedlung im Tal der mittleren Wupper, deren Bewohner von Ackerbau und Viehzucht lebten. Vermutlich
Das Wappen der Marktgemeinde Timelkam
 1 Das Wappen der Marktgemeinde Timelkam Die Entstehung des Wappens Die Entstehung des Wappens der Marktgemeinde Timelkam dürfte auf den Nachfolger der Grafen von Polheim, dem Grafen Tobias Nütz von Goisernburg,
1 Das Wappen der Marktgemeinde Timelkam Die Entstehung des Wappens Die Entstehung des Wappens der Marktgemeinde Timelkam dürfte auf den Nachfolger der Grafen von Polheim, dem Grafen Tobias Nütz von Goisernburg,
Herzogtum Braunschweig
 Herzogtum Braunschweig Alte Firmen und Institutionen Einige alte Firmen und Institutionen existieren bis in die heutige Zeit. Hin und wieder hat man das Glück und kommt in den Besitz eines Briefes, der
Herzogtum Braunschweig Alte Firmen und Institutionen Einige alte Firmen und Institutionen existieren bis in die heutige Zeit. Hin und wieder hat man das Glück und kommt in den Besitz eines Briefes, der
Erstellen Sie Verbreitungskarten
 Möchten Sie wissen, woher ihre Ahnen stammen? Oft gibt der Familienname wertvolle Hinweise über die Herkunft und Verbreitung ihrer Vorfahren. Im folgenden erklären wir Ihnen, wie sie bei der Analyse des
Möchten Sie wissen, woher ihre Ahnen stammen? Oft gibt der Familienname wertvolle Hinweise über die Herkunft und Verbreitung ihrer Vorfahren. Im folgenden erklären wir Ihnen, wie sie bei der Analyse des
Hamburg Stadtteile Erlaubnis & Register Telefon Internet
 Hamburg Stadtteile Erlaubnis & Register Telefon Internet Bezirk Altona http://www.hamburg.de/stadtteile/altona/ Handelskammer Hamburg 040 36138138 http://www.hk24.de Bezirk Bergedorf http://www.hamburg.de/stadtteile/bergedorf/
Hamburg Stadtteile Erlaubnis & Register Telefon Internet Bezirk Altona http://www.hamburg.de/stadtteile/altona/ Handelskammer Hamburg 040 36138138 http://www.hk24.de Bezirk Bergedorf http://www.hamburg.de/stadtteile/bergedorf/
ANHALT(en) im NATURPARK HARZ Vor der Burgruine Anhalt
 ANHALT(en) im NATURPARK HARZ Vor der Ehemalige Dorfkirche Etwa 00 m in Richtung Harzgerode befand sich das ehemalige Dorf Anhalt. Nachdem die Burg im. Jh. nicht mehr genutzt wurde, verlor auch die Siedlung
ANHALT(en) im NATURPARK HARZ Vor der Ehemalige Dorfkirche Etwa 00 m in Richtung Harzgerode befand sich das ehemalige Dorf Anhalt. Nachdem die Burg im. Jh. nicht mehr genutzt wurde, verlor auch die Siedlung
Pfalzatlas (Kartenband 1):
 Pfalzatlas (Kartenband 1): Karte 1: Geographische Orientierungskarte mit den Grenzen des Regierungsbezirks Pfalz vom 1.1.1964 Karte 2: Leser, Hartmut: Höhenschichtenkarte Karte 3: Atzbach, Otto: Geologische
Pfalzatlas (Kartenband 1): Karte 1: Geographische Orientierungskarte mit den Grenzen des Regierungsbezirks Pfalz vom 1.1.1964 Karte 2: Leser, Hartmut: Höhenschichtenkarte Karte 3: Atzbach, Otto: Geologische
Das Wappen Freisewinkel
 Das Wappen Freisewinkel gestiftet von Stephan Freisewinkel im Jahr 2008 Familienforschung-Freisewinkel 2013 Autor: Christian F. Seidler Inhaltsverzeichnis Kapitel Seite Inhaltsverzeichnis 2 Einleitung
Das Wappen Freisewinkel gestiftet von Stephan Freisewinkel im Jahr 2008 Familienforschung-Freisewinkel 2013 Autor: Christian F. Seidler Inhaltsverzeichnis Kapitel Seite Inhaltsverzeichnis 2 Einleitung
LANDKREIS GOSLAR Nr. 21. Lfd. Nr. INHALT Seite(n) Bekanntmachungen
 für den LANDKREIS GOSLAR Im 2. Halbjahr 2006 erscheinen die Amtsblätter jeweils am: 27.07., 31.08., 28.09., 26.10., 30.11. und 28.12. Das Amtsblatt kann auch im Internet des Landkreises Goslar unter: www.landkreis-goslar.de
für den LANDKREIS GOSLAR Im 2. Halbjahr 2006 erscheinen die Amtsblätter jeweils am: 27.07., 31.08., 28.09., 26.10., 30.11. und 28.12. Das Amtsblatt kann auch im Internet des Landkreises Goslar unter: www.landkreis-goslar.de
2.1 Anzahl der Schulen nach Schulform
 2. Schule 40 II Ausgewählte Daten zur Lebenssituation von jungen Menschen in Niedersachsen 2.1 Anzahl der Schulen nach Schulform Die folgenden drei Karten weisen die Anzahl der Schulen nach Schulformen
2. Schule 40 II Ausgewählte Daten zur Lebenssituation von jungen Menschen in Niedersachsen 2.1 Anzahl der Schulen nach Schulform Die folgenden drei Karten weisen die Anzahl der Schulen nach Schulformen
Bildübersicht. Mythos Hammaburg Archäologische Entdeckungen zu den Anfängen Hamburgs. Missionar Ansgar: Tafelbild aus Hauptkirche St.
 Bildübersicht Mythos Hammaburg Archäologische Entdeckungen zu den Anfängen Hamburgs Abbildung 1: Missionar Ansgar: Tafelbild aus Hauptkirche St. Petri, Hamburg Das Bild von Hans Bornemann (1457) aus dem
Bildübersicht Mythos Hammaburg Archäologische Entdeckungen zu den Anfängen Hamburgs Abbildung 1: Missionar Ansgar: Tafelbild aus Hauptkirche St. Petri, Hamburg Das Bild von Hans Bornemann (1457) aus dem
265 Jahre Universitätsbibliothek Braunschweig 65 Jahre Dietmar Brandes
 265 Jahre Universitätsbibliothek Braunschweig 65 Jahre Dietmar Brandes Herausgegeben von Beate Nagel Braunschweig 2013 Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Braunschweig - Hrsg. von Dietmar Brandes
265 Jahre Universitätsbibliothek Braunschweig 65 Jahre Dietmar Brandes Herausgegeben von Beate Nagel Braunschweig 2013 Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Braunschweig - Hrsg. von Dietmar Brandes
Kaiserin und oberste Hofeunuch
 Geschichte Ulrike Wanderer Kaiserin und oberste Hofeunuch Gegenspieler im Kampf um Gunst und Einflussnahme am spätantiken römischen Kaiserhof und ihre Darstellung in Ammianus Marcellinus Res gestae Studienarbeit
Geschichte Ulrike Wanderer Kaiserin und oberste Hofeunuch Gegenspieler im Kampf um Gunst und Einflussnahme am spätantiken römischen Kaiserhof und ihre Darstellung in Ammianus Marcellinus Res gestae Studienarbeit
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek
 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Wilhelm Kunsthistoriker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Wilhelm Kunsthistoriker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Vorwort. Brief I An Claudine. Brief II Die Idylle und die Zäsur. Brief III Ein Hurenhaus in Wien. Brief IV Wiener Kreise
 Vorwort 8 Brief I An Claudine 11 Brief II Die Idylle und die Zäsur 16 Brief III Ein Hurenhaus in Wien 24 Brief IV Wiener Kreise 29 Brief V Monolog der Madame Chantal 36 Brief VI Julius Andrassy und Graf
Vorwort 8 Brief I An Claudine 11 Brief II Die Idylle und die Zäsur 16 Brief III Ein Hurenhaus in Wien 24 Brief IV Wiener Kreise 29 Brief V Monolog der Madame Chantal 36 Brief VI Julius Andrassy und Graf
Archäologische Untersuchungen auf Burg Wölpe bei Erichshagen
 Archäologische Untersuchungen auf Burg Wölpe bei Erichshagen Wissenschaftliche Leitung: Dr. Tobias Gärtner Kooperationspartner: Museum Nienburg (Dr. des. Kristina Nowak-Klimscha), Kommunalarchäologie Schaumburger
Archäologische Untersuchungen auf Burg Wölpe bei Erichshagen Wissenschaftliche Leitung: Dr. Tobias Gärtner Kooperationspartner: Museum Nienburg (Dr. des. Kristina Nowak-Klimscha), Kommunalarchäologie Schaumburger
Handwerk in Braunschweig
 Handwerk in Braunschweig Entstehung und Entwicklung vom Mittelalter bis zur Gegenwart Herausgegeben von Prof. Dr. Martin Kintzinger appelhans^ Verlag Inhalt 5 Inhaltsverzeichnis Geleitwort 9 Mittelalter
Handwerk in Braunschweig Entstehung und Entwicklung vom Mittelalter bis zur Gegenwart Herausgegeben von Prof. Dr. Martin Kintzinger appelhans^ Verlag Inhalt 5 Inhaltsverzeichnis Geleitwort 9 Mittelalter
Städtischer Konflikt im Mittelalter - Der Knochenhaueraufstand 1380 in Lübeck
 Geschichte Daniela Martens Städtischer Konflikt im Mittelalter - Der Knochenhaueraufstand 1380 in Lübeck Studienarbeit Inhaltsverzeichnis: 1. Einleitung...1 2. Die Entwicklung der Zünfte...4 2.1 Die Ämter
Geschichte Daniela Martens Städtischer Konflikt im Mittelalter - Der Knochenhaueraufstand 1380 in Lübeck Studienarbeit Inhaltsverzeichnis: 1. Einleitung...1 2. Die Entwicklung der Zünfte...4 2.1 Die Ämter
S a t z u n g. Evangelisch-lutherisches Predigerministerium Vereinigung zur Pflege der Frankfurter Kirchengeschichte. Präambel
 S a t z u n g Evangelisch-lutherisches Predigerministerium Vereinigung zur Pflege der Frankfurter Kirchengeschichte Präambel Seit der Reformationszeit trug die Gesamtheit der lutherischen Pfarrer in Frankfurt
S a t z u n g Evangelisch-lutherisches Predigerministerium Vereinigung zur Pflege der Frankfurter Kirchengeschichte Präambel Seit der Reformationszeit trug die Gesamtheit der lutherischen Pfarrer in Frankfurt
Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht"
 Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Bankverbindungen AOK Niedersachsen
 Alfeld Nord/LB Braunschweig NOLADE2HXXX DE64250500000000815100 Aurich Nord/LB Hannover NOLADE2HXXX DE33250500000101477214 Borkum Nord/LB Hannover NOLADE2HXXX DE33250500000101477214 Brake Nord/LB Hannover
Alfeld Nord/LB Braunschweig NOLADE2HXXX DE64250500000000815100 Aurich Nord/LB Hannover NOLADE2HXXX DE33250500000101477214 Borkum Nord/LB Hannover NOLADE2HXXX DE33250500000101477214 Brake Nord/LB Hannover
Exposé. Bauplatz an der Marienburger Straße. Gemeinde Diekholzen (PLZ 31199) im Landkreis Hildesheim
 Exposé Bauplatz an der Marienburger Straße Gemeinde Diekholzen (PLZ 31199) im Landkreis Hildesheim - 2 - Die Niedersächsischen Landesforsten bieten ein in der Ortsmitte der Gemeinde Diekholzen gelegenes
Exposé Bauplatz an der Marienburger Straße Gemeinde Diekholzen (PLZ 31199) im Landkreis Hildesheim - 2 - Die Niedersächsischen Landesforsten bieten ein in der Ortsmitte der Gemeinde Diekholzen gelegenes
Zur Bedeutung des Namens und des Wappens Backhausen
 Manfred Backhausen Zur Bedeutung des Namens und des Wappens Backhausen Woher stammt der Name BACKHAUSEN bzw. seine unterschiedlichen Schreibformen? Die Zentralstelle für Deutsche Personen und Familiengeschichte
Manfred Backhausen Zur Bedeutung des Namens und des Wappens Backhausen Woher stammt der Name BACKHAUSEN bzw. seine unterschiedlichen Schreibformen? Die Zentralstelle für Deutsche Personen und Familiengeschichte
Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg
 Statistik aktuell 01 2012 Stadtentwicklung - Stadtforschung - Statistik - Wahlen 15.08.2012 Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg Struktur und Entwicklung Statistischer Informationsdienst...
Statistik aktuell 01 2012 Stadtentwicklung - Stadtforschung - Statistik - Wahlen 15.08.2012 Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg Struktur und Entwicklung Statistischer Informationsdienst...
Tagung der Feuerwehrführungskräfte im Haus Berlin in Hohegeiß
 Tagung der Feuerwehrführungskräfte im Haus Berlin in Hohegeiß Kreis Hildesheim/ Hohegeiß. Kreisbrandmeister Josef Franke hatte in Zusammenarbeit mit Kreisausbildungsleiter Jürgen Spormann einen interessanten
Tagung der Feuerwehrführungskräfte im Haus Berlin in Hohegeiß Kreis Hildesheim/ Hohegeiß. Kreisbrandmeister Josef Franke hatte in Zusammenarbeit mit Kreisausbildungsleiter Jürgen Spormann einen interessanten
Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Burg Sulzburg Schildmauer schützte die Anlage von Frank Buchali
 Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Lenningen (Schwäbische Alb) Burg Sulzburg Schildmauer schützte die Anlage von Frank Buchali Südlich
Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Lenningen (Schwäbische Alb) Burg Sulzburg Schildmauer schützte die Anlage von Frank Buchali Südlich
Schlusswort Einen wissenschaftlichen Text kann man schließen
 Schlusswort Einen wissenschaftlichen Text kann man schließen: mit einem Fazit (nach jedem größeren Kapitel des Hauptteils oder nur nach dem ganzen Hauptteil); mit Schlussfolgerungen; mit einem Fazit und
Schlusswort Einen wissenschaftlichen Text kann man schließen: mit einem Fazit (nach jedem größeren Kapitel des Hauptteils oder nur nach dem ganzen Hauptteil); mit Schlussfolgerungen; mit einem Fazit und
Regensburger Fernhandel im Mittelalter
 Unterrichtsmaterialien in Themenpaketen Regensburger Fernhandel im Mittelalter Folien: Einstiegsfolie: Was könnte das sein? Silber in Barrenform und aus einem Münzschatz, der in Barbing bei Regensburg
Unterrichtsmaterialien in Themenpaketen Regensburger Fernhandel im Mittelalter Folien: Einstiegsfolie: Was könnte das sein? Silber in Barrenform und aus einem Münzschatz, der in Barbing bei Regensburg
Neues zur Archäologie und Geschichte von St. Quirin
 Tanja Potthoff Neues zur Archäologie und Geschichte von St. Quirin Bericht über das Kolloquium»St. Quirinus in Neuss Aktuelle Forschungen«Am 15. und 16. Juli 2011 trafen sich im Clemens-Sels-Museum Neuss
Tanja Potthoff Neues zur Archäologie und Geschichte von St. Quirin Bericht über das Kolloquium»St. Quirinus in Neuss Aktuelle Forschungen«Am 15. und 16. Juli 2011 trafen sich im Clemens-Sels-Museum Neuss
Wie wählte Rinteln? Thomas Gräfe. Reichstagswahlen im Wahlkreis Kassel I, im Kreis Rinteln und in der Stadt Rinteln
 Geschichte Thomas Gräfe Wie wählte Rinteln? Reichstagswahlen im Wahlkreis Kassel I, im Kreis Rinteln und in der Stadt Rinteln 1867-1912 Wissenschaftlicher Aufsatz Thomas Gräfe Wie wählte Rinteln? Reichstagswahlen
Geschichte Thomas Gräfe Wie wählte Rinteln? Reichstagswahlen im Wahlkreis Kassel I, im Kreis Rinteln und in der Stadt Rinteln 1867-1912 Wissenschaftlicher Aufsatz Thomas Gräfe Wie wählte Rinteln? Reichstagswahlen
BUNDESVERWALTUNGSGERICHT
 BUNDESVERWALTUNGSGERICHT bundesweit örtliche Zuständigkeit Adresse, Telefon- und Faxnummer Bundesverwaltungsgericht Simsonplatz 1 04107 Leipzig Telefon (0341) 2007-0 Telefax (0341) 2007-1000 OBERVERWALTUNGSGERICHTE
BUNDESVERWALTUNGSGERICHT bundesweit örtliche Zuständigkeit Adresse, Telefon- und Faxnummer Bundesverwaltungsgericht Simsonplatz 1 04107 Leipzig Telefon (0341) 2007-0 Telefax (0341) 2007-1000 OBERVERWALTUNGSGERICHTE
Inhaltsverzeichnis. Geschichte und Gegenwart 10. Unseren Vorfahren auf der Spur 28. Die ersten Spuren der Menschheit 32
 Inhaltsverzeichnis Geschichte und Gegenwart 10 Ein neues Fach auf dem Stundenplan Geschichte 12 Geschichte und ihre Epochen Eine Reise auf der Zeitleiste 14 Meine Geschichte, deine Geschichte, unsere Geschichte
Inhaltsverzeichnis Geschichte und Gegenwart 10 Ein neues Fach auf dem Stundenplan Geschichte 12 Geschichte und ihre Epochen Eine Reise auf der Zeitleiste 14 Meine Geschichte, deine Geschichte, unsere Geschichte
Karl Prantl Kreuzweg. 14 Platten je 140 x 140 x 14 cm im Abstand von 70 cm aus Bentheimer Sandstein Länge 33 m 14 Linden
 Karl Prantl Kreuzweg 14 Platten je 140 x 140 x 14 cm im Abstand von 70 cm aus Bentheimer Sandstein Länge 33 m 14 Linden 1979 2011 1 Karte Kloster Frenswegen vermessen im Jahr 1823 weiß markiert: Vechte
Karl Prantl Kreuzweg 14 Platten je 140 x 140 x 14 cm im Abstand von 70 cm aus Bentheimer Sandstein Länge 33 m 14 Linden 1979 2011 1 Karte Kloster Frenswegen vermessen im Jahr 1823 weiß markiert: Vechte
Aus der Geschichte der Steiermark 1
 Aus der Geschichte der Steiermark 1 Unsere Zeitrechnung beginnt mit Christi Geburt. Viele Funde zeigen aber, dass in unserem Land auch schon früher Menschen gelebt haben. Schon in der Steinzeit und in
Aus der Geschichte der Steiermark 1 Unsere Zeitrechnung beginnt mit Christi Geburt. Viele Funde zeigen aber, dass in unserem Land auch schon früher Menschen gelebt haben. Schon in der Steinzeit und in
der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei
 der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei einer um am sind noch wie einem über einen so zum war haben nur oder
der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei einer um am sind noch wie einem über einen so zum war haben nur oder
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Die 16 Bundesländer. Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de DOWNLOAD Jens Eggert Downloadauszug aus dem Originaltitel: Name: Datum: 21
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de DOWNLOAD Jens Eggert Downloadauszug aus dem Originaltitel: Name: Datum: 21
ACHTUNG FALLE Das Mittelalter (Alltagsleben damals), Tessloff
 Medienpaket: Mittelalter 1 Achtung Falle ACHTUNG FALLE Das Mittelalter (Alltagsleben damals), Tessloff In den folgenden Sachtexten haben sich Fehler eingeschlichen. Mit Hilfe des Sachbuches Alltagsleben
Medienpaket: Mittelalter 1 Achtung Falle ACHTUNG FALLE Das Mittelalter (Alltagsleben damals), Tessloff In den folgenden Sachtexten haben sich Fehler eingeschlichen. Mit Hilfe des Sachbuches Alltagsleben
Siegelabgußsammlung im Stadtarchiv Rheinbach
 Siegelabgußsammlung im Stadtarchiv Rheinbach Überarbeitet: Juli 2000 Ergänzt: Juli 2000 a) Ritter von Rheinbach, Stadt- und Schöffensiegel im Bereich der heutigen Stadt Rheinbach 1 Lambert I. (1256-1276,
Siegelabgußsammlung im Stadtarchiv Rheinbach Überarbeitet: Juli 2000 Ergänzt: Juli 2000 a) Ritter von Rheinbach, Stadt- und Schöffensiegel im Bereich der heutigen Stadt Rheinbach 1 Lambert I. (1256-1276,
Gewährte Fördermittel in Euro der GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe Nie
 Gewährte Fördermittel in Euro der GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe Nie Selbsthilfekontaktstelle Aurich Barnstorf Brake Braunschweig Celle Cloppenburg Cuxhaven Delmenhorst Edewecht Emden Gifhorn Göttingen
Gewährte Fördermittel in Euro der GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe Nie Selbsthilfekontaktstelle Aurich Barnstorf Brake Braunschweig Celle Cloppenburg Cuxhaven Delmenhorst Edewecht Emden Gifhorn Göttingen
Denkmalpflege in der DDR
 Denkmalpflege in der DDR Rückblicke Beiträge zur Denkmalpflege in Berlin, Band 41 Herausgegeben vom Landesdenkmalamt Berlin Inhalt 9 Jörg Haspel!Hubert Staroste Editorial 11 Ludwig Deiters!Ernst Wipprecht
Denkmalpflege in der DDR Rückblicke Beiträge zur Denkmalpflege in Berlin, Band 41 Herausgegeben vom Landesdenkmalamt Berlin Inhalt 9 Jörg Haspel!Hubert Staroste Editorial 11 Ludwig Deiters!Ernst Wipprecht
Landesweite Zuordnung Polizeiinspektionen zu den Polizeidirektionen
 Landesweite Zuordnung Polizeiinspektionen zu den Polizeidirektionen PD Braunschweig PD Hannover PD Lüneburg PD Göttingen PD Osnabrück PD Oldenburg Polizeiinspektion Braunschweig Polizeiinspektion Gifhorn
Landesweite Zuordnung Polizeiinspektionen zu den Polizeidirektionen PD Braunschweig PD Hannover PD Lüneburg PD Göttingen PD Osnabrück PD Oldenburg Polizeiinspektion Braunschweig Polizeiinspektion Gifhorn
Restaurierung des Wandbildes 1. Obergeschoss Nordflügel
 Ob ich mich an ein Wandbild in der Schule erinnern kann? Natürlich! Da war diese Frau mit dem Kind auf dem Arm und daneben ein Mann, der irgendein Handwerk ausgeübt hat... Frau Kohlhoff ist die einzige
Ob ich mich an ein Wandbild in der Schule erinnern kann? Natürlich! Da war diese Frau mit dem Kind auf dem Arm und daneben ein Mann, der irgendein Handwerk ausgeübt hat... Frau Kohlhoff ist die einzige
Topographie der Erinnerung
 Topographie der Erinnerung Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus im Gebiet der Braunschweigischen Landschaft Herausgegeben im Auftrag der Braunschweigischen Landschaft e. V., Arbeitsgruppe
Topographie der Erinnerung Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus im Gebiet der Braunschweigischen Landschaft Herausgegeben im Auftrag der Braunschweigischen Landschaft e. V., Arbeitsgruppe
Voransicht. Karl der Große Vater Europas? Das Wichtigste auf einen Blick. Stefanie Schwinger, Bühl
 Mittelalter Beitrag 6 Karl der Große (Klasse 6) 1 von 18 Karl der Große Vater Europas? Stefanie Schwinger, Bühl arl der Große ist die wohl bekannteste KHerrscherpersönlichkeit des Mittelalters. Wer war
Mittelalter Beitrag 6 Karl der Große (Klasse 6) 1 von 18 Karl der Große Vater Europas? Stefanie Schwinger, Bühl arl der Große ist die wohl bekannteste KHerrscherpersönlichkeit des Mittelalters. Wer war
Regierungsbezirk Mittelfranken Neustadt a.d.aisch-bad Windsheim Illesheim
 D-5-75-133-16 D-5-75-133-14 D-5-75-133-13 D-5-75-133-4 D-5-75-133-20 D-5-75-133-15 D-5-75-133-17 D-5-75-133-2 D-5-75-133-3 D-5-75-133-1 Baudenkmäler Aisch. Brücke über die Aisch, einbogige Sandsteinbrücke
D-5-75-133-16 D-5-75-133-14 D-5-75-133-13 D-5-75-133-4 D-5-75-133-20 D-5-75-133-15 D-5-75-133-17 D-5-75-133-2 D-5-75-133-3 D-5-75-133-1 Baudenkmäler Aisch. Brücke über die Aisch, einbogige Sandsteinbrücke
Die Chronik des Johannes Malalas Historisch-philologischer Kommentar
 HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN FORSCHUNGSSTELLE HISTORISCH-PHILOLOGISCHER KOMMENTAR ZUR CHRONIK DES JOHANNES MALALAS LEITER DER FORSCHUNGSSTELLE Prof. Dr. Mischa Meier Die Chronik des Johannes
HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN FORSCHUNGSSTELLE HISTORISCH-PHILOLOGISCHER KOMMENTAR ZUR CHRONIK DES JOHANNES MALALAS LEITER DER FORSCHUNGSSTELLE Prof. Dr. Mischa Meier Die Chronik des Johannes
mittelhochdeutsch warte, althochdeutsch warta: (gehoben) hoch gelegener Platz, von dem aus die Umgebung gut zu überblicken ist
 In Barth doch besser ohne Bart? Eine Betrachtung April 2012 von Axel Brätz Wenn das B aber nun ein W ist? mittelhochdeutsch warte, althochdeutsch warta: (gehoben) hoch gelegener Platz, von dem aus die
In Barth doch besser ohne Bart? Eine Betrachtung April 2012 von Axel Brätz Wenn das B aber nun ein W ist? mittelhochdeutsch warte, althochdeutsch warta: (gehoben) hoch gelegener Platz, von dem aus die
Österreichische Geschichte von den Anfängen bis ca Peter Rauscher Sommersemester 2015
 Österreichische Geschichte von den Anfängen bis ca. 1815 Peter Rauscher Sommersemester 2015 4. Länder und Landesherrschaft im Hoch und Spätmittelalter Was ist ein Land? Otto Brunner: Rechts und Friedensgemeinschaft
Österreichische Geschichte von den Anfängen bis ca. 1815 Peter Rauscher Sommersemester 2015 4. Länder und Landesherrschaft im Hoch und Spätmittelalter Was ist ein Land? Otto Brunner: Rechts und Friedensgemeinschaft
Orientierung Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/7 Arbeitsauftrag Windrose gestalten und mit den entsprechenden Himmelsrichtungen beschriften Kompass basteln mit der Sonne Ziel Die SuS können räumliche spunkte verorten und für die
Lehrerinformation 1/7 Arbeitsauftrag Windrose gestalten und mit den entsprechenden Himmelsrichtungen beschriften Kompass basteln mit der Sonne Ziel Die SuS können räumliche spunkte verorten und für die
Einführung in die Logik
 Einführung in die Logik Prof. Dr. Ansgar Beckermann Wintersemester 2001/2 Allgemeines vorab Wie es abläuft Vorlesung (Grundlage: Ansgar Beckermann. Einführung in die Logik. (Sammlung Göschen Bd. 2243)
Einführung in die Logik Prof. Dr. Ansgar Beckermann Wintersemester 2001/2 Allgemeines vorab Wie es abläuft Vorlesung (Grundlage: Ansgar Beckermann. Einführung in die Logik. (Sammlung Göschen Bd. 2243)
Das Analytische als Schreibweise bei Friedrich Schiller
 Germanistik Klaudia Spellerberg Das Analytische als Schreibweise bei Friedrich Schiller Magisterarbeit Das Analytische als Schreibweise bei Friedrich Schiller Schriftliche Hausarbeit für die Magisterprüfung
Germanistik Klaudia Spellerberg Das Analytische als Schreibweise bei Friedrich Schiller Magisterarbeit Das Analytische als Schreibweise bei Friedrich Schiller Schriftliche Hausarbeit für die Magisterprüfung
Kurt Raos auf dem Jakobsweg (Caminho Portugues)
 Kurt Raos auf dem Jakobsweg (Caminho Portugues) Nachdem ich von 30. Mai bis 06. Juni des portugiesischen Jakobsweg und dann noch weiter bis Finisterre (Ende der Welt) gegangen bin, möchte ich euch ein
Kurt Raos auf dem Jakobsweg (Caminho Portugues) Nachdem ich von 30. Mai bis 06. Juni des portugiesischen Jakobsweg und dann noch weiter bis Finisterre (Ende der Welt) gegangen bin, möchte ich euch ein
Haus der kleinen Forscher in Niedersachsen Zahlen und Fakten (Stand 31. Dezember 2015)
 Haus der kleinen Forscher in Niedersachsen Zahlen und Fakten (Stand 31. Dezember 2015) Die Stiftung Haus der kleinen Forscher kooperiert in Niedersachsen mit insgesamt 32 Institutionen, die als sogenannte
Haus der kleinen Forscher in Niedersachsen Zahlen und Fakten (Stand 31. Dezember 2015) Die Stiftung Haus der kleinen Forscher kooperiert in Niedersachsen mit insgesamt 32 Institutionen, die als sogenannte
Urbane Wälder in Leipzig
 LUKAS DENZLER IDEEN RECHERCHEN GESCHICHTEN Urbane Wälder in Leipzig Fotos: Lukas Denzler / Februar 2016 Die drei Modellflächen in Leipzig: Die ehemalige Stadtgärtnerei (ganz oben links), der ehemalige
LUKAS DENZLER IDEEN RECHERCHEN GESCHICHTEN Urbane Wälder in Leipzig Fotos: Lukas Denzler / Februar 2016 Die drei Modellflächen in Leipzig: Die ehemalige Stadtgärtnerei (ganz oben links), der ehemalige
vitamin de DaF Arbeitsblatt - Landeskunde
 1. Was könnte die Straße der Romanik sein? a) die bekannteste Straße in Rom b) eine Straße in Magdeburg, in der die meisten Bauwerke aus der romanischen Zeit konzentriert sind c) eine Reiseroute durch
1. Was könnte die Straße der Romanik sein? a) die bekannteste Straße in Rom b) eine Straße in Magdeburg, in der die meisten Bauwerke aus der romanischen Zeit konzentriert sind c) eine Reiseroute durch
Ausstellungen der Universitätsbibliothek
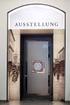 der Universitätsbibliothek 16.01.2001-23.02.2001 [113] Thomas Mann, Dr. Faustus : das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt von einem Freunde Professor Dr. Ruprecht Wimmer: Thomas Manns
der Universitätsbibliothek 16.01.2001-23.02.2001 [113] Thomas Mann, Dr. Faustus : das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt von einem Freunde Professor Dr. Ruprecht Wimmer: Thomas Manns
Wie alt ist Uster? - Über Gründung und Ersterwähnung eines Ortes
 Wie alt ist Uster? - Über Gründung und Ersterwähnung eines Ortes Fabrice Burlet Die Ersterwähnung von Uster: 775 erfolgten in Uster drei Schenkungen an das Kloster St. Gallen. Davon ist nur noch die oben
Wie alt ist Uster? - Über Gründung und Ersterwähnung eines Ortes Fabrice Burlet Die Ersterwähnung von Uster: 775 erfolgten in Uster drei Schenkungen an das Kloster St. Gallen. Davon ist nur noch die oben
Ehren-Worte. Porträts im Umfeld des ZDF. Dieter Stolte
 Ehren-Worte Porträts im Umfeld des ZDF Dieter Stolte Inhalt Vorwort I. Wegbereiter und Mitstreiter Rede bei der Trauerfeier für Walther Schmieding (1980) 13 Reden zur Verabschiedung von Peter Gerlach als
Ehren-Worte Porträts im Umfeld des ZDF Dieter Stolte Inhalt Vorwort I. Wegbereiter und Mitstreiter Rede bei der Trauerfeier für Walther Schmieding (1980) 13 Reden zur Verabschiedung von Peter Gerlach als
Deutsche Biographie Onlinefassung
 Deutsche Biographie Onlinefassung NDB-Artikel Pfirt (französisch: Ferrette) Grafen von Leben Die im Oberelsaß gelegene Grafschaft, hervorgegangen aus einer Erbteilung des Gf. Dietrich v. Mömpelgard/Montbéliard
Deutsche Biographie Onlinefassung NDB-Artikel Pfirt (französisch: Ferrette) Grafen von Leben Die im Oberelsaß gelegene Grafschaft, hervorgegangen aus einer Erbteilung des Gf. Dietrich v. Mömpelgard/Montbéliard
Familie Wagenknecht. Herzlich Willkommen. bei der nun folgenden Präsentation
 Familie Wagenknecht www.wagenknecht.de Herzlich Willkommen bei der nun folgenden Präsentation unserer ( Bauherrengemeinschaft Wünscher / Wagenknecht) Mietobjekte in Umpferstedt und Reisdorf. Folie 1 Familie
Familie Wagenknecht www.wagenknecht.de Herzlich Willkommen bei der nun folgenden Präsentation unserer ( Bauherrengemeinschaft Wünscher / Wagenknecht) Mietobjekte in Umpferstedt und Reisdorf. Folie 1 Familie
Bundesrat Drucksache 341/13 (Beschluss) Beschluss des Bundesrates
 Bundesrat Drucksache 341/13 (Beschluss) 07.06.13 Beschluss des Bundesrates Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Freizügigkeit von Bürgern und Unternehmen
Bundesrat Drucksache 341/13 (Beschluss) 07.06.13 Beschluss des Bundesrates Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Freizügigkeit von Bürgern und Unternehmen
Pressemeldung. Beschäftigungsprognose 2011 Niedersachsen
 Pressemeldung Beschäftigungsprognose 2011 Niedersachsen 61.000 Arbeitsplätze entstehen bis 2011 in Niedersachsen. Über 90% davon im Bereich der unternehmensnahen Dienstleistungen und dem Gesundheitswesen.
Pressemeldung Beschäftigungsprognose 2011 Niedersachsen 61.000 Arbeitsplätze entstehen bis 2011 in Niedersachsen. Über 90% davon im Bereich der unternehmensnahen Dienstleistungen und dem Gesundheitswesen.
Zitation nach Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft - Überarbeitung Selbstständige Publikationen
 Zitation nach Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft - Überarbeitung Selbstständige Publikationen Monographien Name [Komma] Vorname [Komma] Titel [Punkt] Untertitel [Komma] Ort(e; mehrere Orte mit /
Zitation nach Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft - Überarbeitung Selbstständige Publikationen Monographien Name [Komma] Vorname [Komma] Titel [Punkt] Untertitel [Komma] Ort(e; mehrere Orte mit /
Drehorte. Hollywood in. Besuchen Sie die Originalschauplätze von
 Drehorte Hollywood in Sachsen-Anhalt Besuchen Sie die Originalschauplätze von Monuments Men! Foto: Mathias Kasuptke IHR TOR ZUM HARZ Eine halbe Stunde Aufenthalt genügte George Clooney, um sich für die
Drehorte Hollywood in Sachsen-Anhalt Besuchen Sie die Originalschauplätze von Monuments Men! Foto: Mathias Kasuptke IHR TOR ZUM HARZ Eine halbe Stunde Aufenthalt genügte George Clooney, um sich für die
Jura Online - Fall: Das gefundene Geld - Lösung
 Jura Online - Fall: Das gefundene Geld - Lösung 1. Teil: Ansprüche R gegen F A. Anspruch R gegen F auf Herausgabe der Geldscheine gemäß 985 BGB R könnte gegen F zunächst einen Anspruch auf Herausgabe der
Jura Online - Fall: Das gefundene Geld - Lösung 1. Teil: Ansprüche R gegen F A. Anspruch R gegen F auf Herausgabe der Geldscheine gemäß 985 BGB R könnte gegen F zunächst einen Anspruch auf Herausgabe der
Königliche Hoheiten aus England zu Gast in der Pfalz
 Karl Erhard Schuhmacher Königliche Hoheiten aus England zu Gast in der Pfalz Lebensbilder aus dem Hochmittelalter verlag regionalkultur Inhaltsverzeichnis Einleitung... 6 Mathilde von England: Kaiserin
Karl Erhard Schuhmacher Königliche Hoheiten aus England zu Gast in der Pfalz Lebensbilder aus dem Hochmittelalter verlag regionalkultur Inhaltsverzeichnis Einleitung... 6 Mathilde von England: Kaiserin
Schriftenreihe der Stadt Bräunlingen Band 1 (2005): Beiträge zur Geschichte der Stadt Bräunlingen ( 10,-)
 Schriftenreihe der Stadt Bräunlingen Band 1 (2005): Beiträge zur Geschichte der Stadt Bräunlingen ( 10,-) Mit folgenden Aufsätzen (Nachdrucke): G. Tumbült (1897): Zur Geschichte der deutschen Stadtverfassung.
Schriftenreihe der Stadt Bräunlingen Band 1 (2005): Beiträge zur Geschichte der Stadt Bräunlingen ( 10,-) Mit folgenden Aufsätzen (Nachdrucke): G. Tumbült (1897): Zur Geschichte der deutschen Stadtverfassung.
3. Einzugsbereiche der sächsischen Hochschulen
 3. Einzugsbereiche der sächsischen Hochschulen Weiterhin ist das Wanderungsverhalten der zukünftigen Studienanfänger/innen von besonderer Bedeutung für die zu erwartende Studiennachfrage in einem Bundesland.
3. Einzugsbereiche der sächsischen Hochschulen Weiterhin ist das Wanderungsverhalten der zukünftigen Studienanfänger/innen von besonderer Bedeutung für die zu erwartende Studiennachfrage in einem Bundesland.
Feldforschung in Hasankeyf am Tigris Andreas Fink, M.A. (Heidelberg)
 Feldforschung in Hasankeyf am Tigris Andreas Fink, M.A. (Heidelberg) Hasankeyf ist eine kleine Kreisstadt mit rund 3500 Einwohnern im Osten der Türkei. Der Ort begeistert jedes Jahr zahlreiche Besucher
Feldforschung in Hasankeyf am Tigris Andreas Fink, M.A. (Heidelberg) Hasankeyf ist eine kleine Kreisstadt mit rund 3500 Einwohnern im Osten der Türkei. Der Ort begeistert jedes Jahr zahlreiche Besucher
Förderverein Dorfkirche Wegendorf e.v.
 Satzung des Fördervereins Dorfkirche Wegendorf e.v. 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 1. Der Verein führt den Namen "Förderverein Dorfkirche Wegendorf" und ist seit dem 29.06.2009 unter dem Aktenzeichen VR 5562
Satzung des Fördervereins Dorfkirche Wegendorf e.v. 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 1. Der Verein führt den Namen "Förderverein Dorfkirche Wegendorf" und ist seit dem 29.06.2009 unter dem Aktenzeichen VR 5562
Archiv für Geographie. Findbuch. Georg Jensch ( )
 Archiv für Geographie Findbuch (1908 1978) , Georg Paul Erich (1908 1978) * 17.6.1908 Steinbach, Kr. Züllichau 11.8.1978 Hochschul-Professor für Geographie und Kartographie K 444 Reifeprüfung an der Oberrealschule
Archiv für Geographie Findbuch (1908 1978) , Georg Paul Erich (1908 1978) * 17.6.1908 Steinbach, Kr. Züllichau 11.8.1978 Hochschul-Professor für Geographie und Kartographie K 444 Reifeprüfung an der Oberrealschule
Ernst Klett Schulbuchverlag Leipzig
 Asmut Brückmann Rolf Brütting Peter Gautschi Edith Hambach Uwe Horst Georg Langen Peter Offergeid Michael Sauer Volker Scherer Franz-Josef Wallmeier Ernst Klett Schulbuchverlag Leipzig Leipzig Stuttgart
Asmut Brückmann Rolf Brütting Peter Gautschi Edith Hambach Uwe Horst Georg Langen Peter Offergeid Michael Sauer Volker Scherer Franz-Josef Wallmeier Ernst Klett Schulbuchverlag Leipzig Leipzig Stuttgart
Literaturangaben in den Fußnoten können nach zwei unterschiedlichen Methoden gemacht werden:
 LEITFADEN: Nachweise, Zitate / Literaturverzeichnis Grundsätzliches zur Zitation in Hausarbeiten: > Sämtliche Textpassagen, die wörtlich aus anderen Texten in die eigene Hausarbeit übernommen werden, gehören
LEITFADEN: Nachweise, Zitate / Literaturverzeichnis Grundsätzliches zur Zitation in Hausarbeiten: > Sämtliche Textpassagen, die wörtlich aus anderen Texten in die eigene Hausarbeit übernommen werden, gehören
Herausgeber: Historischer Verein Säuling e.v.
 Herausgeber: Historischer Verein Säuling e.v. 2015 Historische Jahresschrift Jahrgang 04, Füssen 2015 Die älteste geometrisch exakt vermessene Karte der Stadt Füssen von 1818 mit den 2 Brücken: Notbrücke
Herausgeber: Historischer Verein Säuling e.v. 2015 Historische Jahresschrift Jahrgang 04, Füssen 2015 Die älteste geometrisch exakt vermessene Karte der Stadt Füssen von 1818 mit den 2 Brücken: Notbrücke
Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen
 Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen Thematisches Kartenwerk, welches sich im Raum erstreckende historische Tatsachen, Ereignisse und Entwicklungen des Freistaates Sachsen in seinen Grenzen
Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen Thematisches Kartenwerk, welches sich im Raum erstreckende historische Tatsachen, Ereignisse und Entwicklungen des Freistaates Sachsen in seinen Grenzen
Weihnachtsmusical von Monika Graf. Gottes Plan erfüllt sich. Lieder Sprechtexte Tipps
 Weihnachtsmusical von Monika Graf Gottes Plan erfüllt sich Lieder Sprechtexte Tipps Josef und Maria Gottes Plan erfüllt sich Regie- und Liederheft 52 55851 Ebenfalls von dieser Produktion erhältlich:
Weihnachtsmusical von Monika Graf Gottes Plan erfüllt sich Lieder Sprechtexte Tipps Josef und Maria Gottes Plan erfüllt sich Regie- und Liederheft 52 55851 Ebenfalls von dieser Produktion erhältlich:
...tes Landesgesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes Rheinland-Pfalz
 Mainz, 08.10.2014 G e s e t z e n t w u r f der Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen...tes Landesgesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes Rheinland-Pfalz A. Problem und Regelungsbedürfnis In
Mainz, 08.10.2014 G e s e t z e n t w u r f der Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen...tes Landesgesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes Rheinland-Pfalz A. Problem und Regelungsbedürfnis In
Handel, Belagerung und Bebauung-die bewegte Geschichte des ehemaligen Bollwerks im Spiegel der archäologischen Begleitung der Baumaßnahme
 Handel, Belagerung und Bebauung-die bewegte Geschichte des ehemaligen Bollwerks im Spiegel der archäologischen Begleitung der Baumaßnahme Seit dem Beginn der Sanierung- und Umgestaltungsarbeiten im Bereich
Handel, Belagerung und Bebauung-die bewegte Geschichte des ehemaligen Bollwerks im Spiegel der archäologischen Begleitung der Baumaßnahme Seit dem Beginn der Sanierung- und Umgestaltungsarbeiten im Bereich
Der bedeutendste Fund aus Mauer aber stammt aus dem Jahr Es handelt sich dabei um den sog. Jupiter Dolichenus Fund.
 AUS DER GESCHICHTE VON MAUER-ÖHLING Unsere Heimat in der Römerzeit Zur Zeit der Römerherrschaft gehörte unsere Heimat zur Provinz Noricum. Innerhalb des heutigen Bezirkes Amstetten gab es eine Grenzbefestigung,
AUS DER GESCHICHTE VON MAUER-ÖHLING Unsere Heimat in der Römerzeit Zur Zeit der Römerherrschaft gehörte unsere Heimat zur Provinz Noricum. Innerhalb des heutigen Bezirkes Amstetten gab es eine Grenzbefestigung,
Zu dieser Vortragsreihe sind drei handgeschriebene Klartextnachschriften
 Zu dieser Aus gabe Zu dieser Vortragsreihe sind drei handgeschriebene Klartextnachschriften erhalten: 1. Nachschrift von Fritz Mitscher (in Sütterlin) 2. Nachschrift von Mathilde Scholl (handgeschrieben)
Zu dieser Aus gabe Zu dieser Vortragsreihe sind drei handgeschriebene Klartextnachschriften erhalten: 1. Nachschrift von Fritz Mitscher (in Sütterlin) 2. Nachschrift von Mathilde Scholl (handgeschrieben)
Hinweisinventar Büttenhardt. Einleitung zur Inventarisierung. Datum : 30. Juni 2012 Version : 1.0 Verfasser : vestigia GmbH
 Hinweisinventar Büttenhardt Einleitung zur Inventarisierung Datum : 30. Juni 2012 Version : 1.0 Verfasser : vestigia GmbH 1 Inventarisierung und Geschichte Inventarisierung Im Auftrag der Denkmalpflege
Hinweisinventar Büttenhardt Einleitung zur Inventarisierung Datum : 30. Juni 2012 Version : 1.0 Verfasser : vestigia GmbH 1 Inventarisierung und Geschichte Inventarisierung Im Auftrag der Denkmalpflege
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Mittelalter. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Mittelalter Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Lernwerkstatt: Mittelalter Bestellnummer:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Mittelalter Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Lernwerkstatt: Mittelalter Bestellnummer:
Der Pakt zwischen dem Herrn und Mephisto in Goethes 'Faust' im Vergleich mit der Hiobswette aus der Bibel
 Germanistik Anonym Der Pakt zwischen dem Herrn und Mephisto in Goethes 'Faust' im Vergleich mit der Hiobswette aus der Bibel Studienarbeit Der Pakt zwischen dem Herrn und Mephisto in Goethes Faust im
Germanistik Anonym Der Pakt zwischen dem Herrn und Mephisto in Goethes 'Faust' im Vergleich mit der Hiobswette aus der Bibel Studienarbeit Der Pakt zwischen dem Herrn und Mephisto in Goethes Faust im
Die Soziologie und das Soziale
 Geisteswissenschaft Holger Michaelis Die Soziologie und das Soziale Eine Erklärung der bislang vergeblichen Versuche einer adäquaten Bestimmung des Gegenstandes der Soziologie Dr. Holger Michaelis Die
Geisteswissenschaft Holger Michaelis Die Soziologie und das Soziale Eine Erklärung der bislang vergeblichen Versuche einer adäquaten Bestimmung des Gegenstandes der Soziologie Dr. Holger Michaelis Die
Arbeitsblatt Jüdischer Friedhof - Grabsteine
 BASISINFORMATION Ein Grabstein dient der Erinnerung an die bestattete Person. Diese ist auf jüdischen Friedhöfen so bestattet, dass sie am Jüngsten Tag nach Osten auferstehen kann. Die Inschriften der
BASISINFORMATION Ein Grabstein dient der Erinnerung an die bestattete Person. Diese ist auf jüdischen Friedhöfen so bestattet, dass sie am Jüngsten Tag nach Osten auferstehen kann. Die Inschriften der
Bibliografie, Zitate und Fussnoten
 Bibliografie, Zitate und Fussnoten Inhaltsübersicht A. Zitate und Fussnoten B. Bibliografie A. Zitate und Fussnoten In den Fussnoten werden Kurztitel verwendet und der Vorname des Autors/der Autoren weggelassen.
Bibliografie, Zitate und Fussnoten Inhaltsübersicht A. Zitate und Fussnoten B. Bibliografie A. Zitate und Fussnoten In den Fussnoten werden Kurztitel verwendet und der Vorname des Autors/der Autoren weggelassen.
