Maare - biotische und Sedimentationsentwicklung an Fallbeispielen
|
|
|
- Erwin Gerstle
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Maare - biotische und Sedimentationsentwicklung an Fallbeispielen (BÜCHEL, G. & LORENZ, V.; aus: ZOLITSCHKA, B. & NEGENDANK, J.F.W., 1993) von Kerstin Fohlert
2 2 1. Einleitung Der aus der Eifel stammende Begriff Maar wird heute in der gesamten internationalen Literatur für einen besonderen Vulkantyp verwendet. Ursprünglich bezeichnete man in der Eifel seit Jahrhunderten kleine Weiher und feuchte Stellen mit diesem Wort. In der Westeifel, 50km südwestlich Koblenz zwischen den Orten Ormont und Bad Bertrich, sind ungefähr ein Viertel der Vulkanbauten Maare. Zwischen der Eifel und dem Egertalgraben (Zentraleuropäischer Vulkangürtel) kennt man heute ca. 30 Vorkommen paläogener Schwarzpelite, von denen einige als Maarseesedimente gedeutet werden. Bei vielen dieser Vorkommen ist jedoch die Genese umstritten. So zieht man unter anderem folgende Becken in Betracht: syn- oder postsedimentäre Gräben, vulkanotktonische Becken, Subrosionssenken, Dolinen oder Impaktstrukturen. Die erste Beschreibung von Maarstrukturen in Sachsen stammt von SUHR & GOTH, Bei Regionalvermessungen in den sechziger Jahren wurde im Gebiet von Kleinsaubernitz/ Lausitz eine auffällige Schwereanomalie festgestellt. Zunächst wurde diese als kleiner variszischer Stockgranit im Untergrund gedeutet. Später teufte man in diesem Gebiet Bohrungen ab und fand eine bis dahin unbekannte Sedimentfolge ( Kleinsaubernitzer Schichten ). SUHR & GOTH (1996) schreiben das der erbohrte Ölschiefer in vielen Merkmalen den anstehenden Gesteinen der Grube Messel entsprechen. Über einer zweiten, in diesem Gebiet (Baruth bei Bautzen) bekannten Schwereanomalie teufte man 1998 Bohrungen ab. Geophysikalische Voruntersuchungen zeigten einen schüsselförmigen Gebilde mit einem Durchmesser von 900m und einer Tiefe von 250m an. Die erbohrten Sedimente werden zur Zeit bearbeitet. Abb. 1: Maare in der Westeifel (aus: NEGENDANK & ZOLITSCHKA, 1997) Im folgenden wird vor allem das Mitteleozäne Eckfelder Maar bei Manderscheid (Abb. 1) in der Westeifel betrachtet. Seine seit dem letzten Jahrhundert bekannten fossilführenden Sedimente sind mit
3 3 dem Ölschiefer der Grube Messel bei Darmstadt vergleichbar. Wie in Messel werden auch hier jährlich wissenschaftliche Grabungen durchgeführt. Seltene Funde, wie die älteste bekannte Honigbiene (mit Pollenfracht!) und ein trächtiges Urpferdchen Palaeotherium, wurden hier gemacht. 2. Entstehung und Morphologie der Maare Maare sind in den Untergrund eingetiefte Vulkankrater. Sie entstehen durch heftige phreatomagmatische Explosionen, die durch den Kontakt von aufsteigendem Magma mit Grund- oder Oberflächenwasser hervorgerufen werden. Durch Explosionen in einigen 100m Tiefe entstehen Hohlräume in die das darüber liegende Material einsinkt. Maarkessel sind demnach häufig sowohl Explosions- als auch Einbruchstrukturen. (MURAWSKI, 1998) Der Durchmesser dieser Krater kann von einigen 10m bis zu 2km betragen. Der Maarkessel besitzt eine trichter- bis schüsselförmige Gestalt. Er ist häufig von einem Tuffwall umgeben (Abb. 2). An den steilen Kraterwänden treten Rutschungen auf, die den Krater bald verschütten können. Abb. 2: Schematische Skizze eines Maares (aus: NEGENDANK & ZOLITSCHKA, 1993) 3. Entwicklungsstadien eines Maares
4 4 Die posteruptive Entwicklung des Maares ist in Abb. 3 dargestellt. Bild A zeigt den gerade entstandenen Maarkessel mit seinem niedrigen Tuffring, der zu einem großen Teil aus Nebengesteinsfragmenten besteht. Da der Krater den Grundwasserspiegel unterschneidet, füllt sich das Maar mit Wasser (Abb. 3 B). Es entsteht ein Maarsee, der aufgrund von Massenbewegungen und Schlammströmen (Rutschungen der steilen Kraterwände), Deltaablagerungen einfließender Bäche, Eintrag atmosphärischer Last (Regen, Asche nahegelegener Vulkane, windtransportierte Sedimente) Produktion organischer Substanz im Maarsee und deren Sedimentation, immer mehr verfüllt wird. Maßgebend für die Geschwindigkeit der Verlandung des Sees (Abb. 3C) sind die Reliefenergie, die Vegetationsbedeckung und die Größe des Einzugsgebietes sowie die Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse. Abb. 3: Darstellung der posteruptiven Entwicklung eines Maares (aus: NEGENDANK & ZOLITSCHKA, 1993) Die abseits größerer Täler entstandenen Seen verlanden aufgrund der geringen Fläche ihrer Einzugsgebiete meist langsam. Typische Beispiele sind in Deutschland einige Maare der Eifel, die
5 5 trotz ihres spättertiären oder pleistozänen Alters und ihrer geringen Größe bis heute überdauert haben. (BOHLE, 1995). Nicht nur durch natürliche Verlandung und Moorbildung kann das Stadium des Maarsees beendet werden. Beispielsweise beschreibt KÖHLER (1998) das sehr plötzlich Ende des Sees Enspel im Westerwald folgend: Mit dem Einfließen des bis zu 100m mächtigen Olivin-Basaltes aus einem bisher noch unbekannten Eruptionsort ist das Seestadium abrupt beendet worden.. Aber auch durch menschliche Tätigkeit kann ein See zeitweilig oder gänzlich trockengelegt werden. Nach Cipa war das Trautzberger Maar früher mit Wasser gefüllt und diente als Fischteich. In den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde es durch einen Graben nach E trockengelegt. (MEYER, 1994). Der mit Sedimenten verfüllte Krater zeigt sich nur noch als eine leichte Depression an der Oberfläche, dabei ist der Tuffring zum größten Teil erodiert worden (Abb. 3 C). Unter günstigen Bedingungen kann die Erosion teilweise so effektiv sein, daß es zu einer Reliefumkehr kommt. Dabei werden die gesamte Sedimentfüllung des Kraters und der Tuffring vollständig erodiert bis das Diatremgestein freigelegt wird (Abb. 3 D und E). Nach NEGENDANK & ZOLITSCHKA (1993) erreichten einige sehr alte Maare der Westeifel dieses Stadium (Seiderath Maar, Wolfbeuel E Maar). 4. Der Maarsee 4.1. Die Schichtung des Wasserkörpers Seen werden nach unterschiedlichsten Merkmalen klassifiziert. Nach ihrer Entstehung unterteilt man sie beispielsweise in Stau von Seen durch Kalksinterbildung (Band-i-Amir Seen), Bergsturzseen (Hintersee, Berchtesgarden), Gletscherstauseen (Märjelensee, Schweiz), tektonisch entstandene Seen (Tanganjikasee, Ostafrika) Kraterseen (Laguna Quilotoa, Ecuador) usw. Eine andere Einteilung erfolgt nach der Art und Häufigkeit der Zirkulationen im See. So tritt in amiktischen Seen keine und in monomiktischen eine Zirkulation im Jahr auf. Dimiktische, oligomiktische und polymiktische Seen werden zweimal, mehrmals oder ständig durchmischt. Weiterhin wird bei einem holomiktischen See der gesamte Wasserkörper in die Zirkulation einbezogen. Dagegen greift in einem meromiktischen See (Abb. 4) die windinduzierte, vertikale Wasserzirkulation nicht bis zum Grund. Es bilden sich eine durchmischte obere (Mixolimnion) und eine nicht durchmischte untere Schicht (Monimolimnion) heraus. Im Monimolimnion herrschen permanent anoxische Bedingungen. Zweiwertiges Eisen, Hydrogenkarbonationen und hohe Konzentrationen von H 2 S und NH 4 + treten hier auf. Diese Verhältnisse reduzieren benthische Aktivitäten auf ein Minimum. Die zwischen Monimo- und Mixolimnion auftretende Sprungschicht nennt man Chemokline. Abb. 4: Schichtung des Wassers in einem meromiktischen See 4.2. Sedimentation im Maarsee
6 6 Die Sedimentationsvorgänge im Maarsee hängen maßgeblich von der Morphologie (Reliefenergie), dem Klima, der Art und Anzahl der Zuflüsse bzw. deren Liefergebiete, sowie von der Art des Maarsees (holo- oder meromiktisch) ab. Für die jüngeren Maare kommt der anthropogene Einfluß hinzu. In Maarseen vorkommende (Haupt-) Sedimenttypen sind vulkanische Brekzien (Diatrembrekzie), grobe Rutschmassen vom Kraterrand (debris flows), Trübe- bzw. Suspensionsströme (Turbidite), laminierte Feinklastika sowie pyroklastische Lagen benachbarter Vulkane. Diese Sedimenttypen zeigen eine charakteristische horizontale und vertikale Verbreitung. Im randlichen Bereich (Litoral) treten vor allen grobe Rutschungsmassen (debris flows) auf, zum Beckeninneren (Profundal) gehen diese über in Trübe- bzw. Suspensionsströme bis hin zur Ablagerung feiner klastischer Sedimente. Dabei tritt im Profundal die klastische Sedimentation gegenüber der biogenen Sedimentation und der chemischen Ausfällung zurück. Eine typische zeitliche Sedimentabfolge zeigt beispielsweise das mitteleozäne Eckfelder Maar. Es entwickelte sich von einem initialen grobklastischen Stadium (Diatrembrekzie und debris flows) über vorwiegend biogene Sedimentation (laminierte Schwarzpelite mit eingeschalteten Tubiditen) bis zu einem klastischen Endstadium (NEGENDANK & ZOLITSCHKA, 1993). Abb. 5: Laminierte Sedimente aus dem Holzmaar (aus: NEGENDANK & ZOLITSCHKA, 1993) Das Eckfelder Maar
7 7 Das Eckfelder Maar befindet sich nördlich des Ortes Manderscheid im Vulkangebiet der Westeifel. (Abb. 1). Es liegt auf einer NNE-SSW streichenden Hauptstörung und ist in unterdevonische Sandsteine eingetieft. Die ursprüngliche Größe des Maarkraters wird auf 900m im Durchmesser und ca. 150m Tiefe geschätzt. Für die im Krater abgelagerten Seesedimente, die seit dem letzten Jahrhundert bekannt sind, nimmt man heute nach palynologischen und Säugetierstratigraphischen Untersuchungen ein Mitteleozänes Alter (49 Ma) an wurden mehrere Bohrungen im Beckeninneren und in randlichen Bereichen abgeteuft. Eine Bohrung im Beckenzentrum mit einer Endteufe von 123m erreichte im Liegenden eine aus unterdevonischen Gesteinen bestehende Brekzie. Nach FISCHER et al. handelt es sich hierbei um eine Kollapsbrekzie. Darüber lagern Schuttstromsedimente und sandig-kiesige Turbidite. Diese Ablagerungen eines initialen Maares resultieren aus Rutschungen an den steilen und instabilen Hängen des Kraters. Eine wenige Meter mächtige Übergangszone aus feinkörnigen Sedimenten deutet auf die Stabilisation der Kraterwände hin und leitet in die Hauptphase der lakustrinen Ablagerungen über. Das Hangende besteht vorwiegend aus laminierten Tonsteinen mit einem hohen Anteil organischer Substanz. Sie werden häufig als Ölschiefer bezeichnet. Die Tonsteine bestehen aus den Tonmineralen Illit, Montmorillonit und Kaolinit, außerdem enthalten sie Quarz, mineralischen Detritus, Reste terrestrischer Pflanzen und Lagen von Grünalgen (Tetraedron und Botryococcus) und Siderit. Abb. 6: Diatomeen aus dem Polierschiefer. Bohrung Rott II (aus: MÖRS, 1995) (die Länge des Maßstabs beträgt 10µm) Neben den Ölschiefern treten auch bituminöse Schluffsteine, gradierte Schichten (Turbidite) und diatomitische Lamenite auf. Die Diatomite bestehen aus z.t. mm-dicken Lagen der Diatomee Melosira. Die beschriebene Abfolge der Sedimente wird als Füllung eines Maarkraters gedeutet, wobei die Verlandungssedimente und der obere Teil der bituminösen Laminite abgetragen wurden und somit nicht erhalten geblieben sind. Die Herausbildung der laminierten Sedimente, die hauptsächlich ungestört vorliegen, deuten auf einen ruhigen Ablagerungsraum hin. Nur gelegentlich wurden sie durch Rutschungsereignisse zerrüttet. Dabei entstanden slumping-strukturen und Abrißmarken im Sediment. Der hohe Gehalt an organischem Kohlenstoff, das Auftreten von Siderit im Sediment und das Fehlen bioturbaten Gefüges deuten auf ein anoxisches Milieu und damit einen meromiktischen See hin. Nach MINGRAM (1997) war das Eckfelder Maar, mit seiner charakteristischen Morphologie eines kleinen Maar- oder Kratersees eine ideale Sedimentfalle und ein günstiger Ort zu Ausbildung von Warven. Jedoch gibt es noch keinen endgültigen Beweis für die jahreszeitliche Schichtung der Sedimente. ZOLITSCHKA (1990) definiert Warven als laminierte Sedimente stehender Wasserkörper, die im jahreszeitlichen Rhythmus aus dünnen, horizontalen Lagen wechselnder Zusammensetzung aufgebaut sind. Dabei können 3 verschiedene Typen unterschieden werden:
8 8 Die klastischen oder physikalischen Warven werden im wesentlichen durch unterschiedlich starken Zuflüsse gebildet. Während in der regenreichen Jahreszeit (z.b. im Frühjahr durch die Schneeschmelze) die Transportkraft des Zuflusses erhöht ist, kann eine dementsprechende größere Menge an klastischem Material transportiert werden. Dagegen wird in der regenarmen Zeit (z.b. Wintermonaten) vergleichsweise weniger und feineres Material eingetragen. Es entsteht wie in Abb. 6 schematisch dargestellt eine Laminierung der Sedimente. Die organischen oder biologischen Warven werden hauptsächlich in Seen mit hohem Nährstoffgehalt und geringen klastischen Eintrag gebildet. Es treten hier im Frühling und Sommer lagenbildende Algenblüten (Diatomeen) auf, die eine oder mehrere helle Sublamina bilden. Die kontrastierende dunkle Sublamina wird aus amorpher autochthoner organischer Substanz bzw. aus allochthonen Teilen höherer Pflanzen aufgebaut, die im Herbst im See absterben oder aus dem Litoral durch Umlagerungsprozesse in das zentrale Becken verfrachtet werden. (ZOLITSCHKA, 1998). Die chemischen oder evaporitischen Warven entstehen durch rhythmische Ausfällung von Aragonit, Kalzit, Gips und Halit. Die drei verschiedenen Warventypen treten selten in Reinform auf. Meistens handelt es sich um Misch- oder Übergangstypen. (ZOLITSCHKA, 1998) Abb. 7: Warven Modelle (aus: NEGENDANK & ZOLITSCHKA (EDS.), 1997) Pyroklastische Einschaltungen benachbarter Vulkane sind im Eckfelder Maar nicht beschrieben. Jedoch treten sie in den Sedimenten anderer Maare häufig auf. So kann man in den Sedimenten des Holzmaars zwei markante Tephralagen aushalten. Die mm mächtige Laacher See Tephra und die 1,5mm mächtige Ulmener Maar Tephra sind im Holzmaar-Profil enthalten. Sie dienen unter anderem als Markerhorizonte und sind bei der Überprüfung der Warvenchronologie behilflich Biota Die Freiwasserzone (Pelagial) und die Bodenzone (Benthal) sind die zwei grundsätzlichen Lebensräume eines Sees. Beide Bereiche lassen sich vertikal weiter untergliedern. Das Pelagial wird in eine photische und eine aphotische Zone (ohne photosynthetische Primärproduktion) unterteilt. Parallel dazu gliedert man das Benthal in einen flachen Uferbereich (Litoral) und den aphotischen Tiefenbereich (Profundal). Aufgrund der steilen Morphologie ist ein eigentlicher Litoralbereich bei Maarseen oft nicht ausgebildet oder nur sehr schmal.
9 9 Wie aus Ablagerungen fossiler Maarseesedimente bekannt ist, fehlen benthische Organismen fast vollständig. Mit Ausnahme einiger chemoautothropher Organismen ist der Bereich unterhalb der Chemokline unbelebt. Damit sind die Bodenlebewesen auf die schmalen, gut durchlüfteten Randbereiche des Sees beschränkt. Die steilen und rutschungsgefährdeten Hänge aber stellen einen ungünstigen Lebensraum für die meisten Benthoner dar. Die Einwanderung der aquatischen Organismen in den See erfolgt hauptsächlich über das Gewässernetz. Eine andere Möglichkeit ist die Windverdriftung, die aber nur kleine und leichte Organismen nutzen können. Die wichtigsten Primärproduzenten in einem Maarsee sind Algen. In den Seesedimenten treten z.t. massenhaft Diatomeen (Kieselalgen) (Abb. 7), Chrysophyceencysten (Goldalgen) und die Grünalgen Tetraedron und Botryococcus auf. Die Ursache für diese Häufungen sind die saisonalen Algenblüten. Sie entstehen wenn nährstoffreiche und sauerstoffarme Wässer aus dem Monimolimnion in die oberen Schichten gelangen. Dies setzt eine verstärkte und auf die unteren Wassermassen ausgedehnte Vertikalzirkulation voraus, wie sie beispielsweise im Frühjahr und Herbst auftreten. Zusammen mit den feinen Sedimentlagen, die während der Sommer- und Winterstagnation entstehen, bilden diese Algenablagerungen die feinlaminierten organischen Warven. Zu den Konsumenten in einem See zählen vor allem die Fische, aquatisch lebende Schnecken und Frösche. Nach dem Tod sinken sie auf den Grund des Sees. Gelangen sie rasch unter Sauerstoffabschluß, können sie wenig zersetzt in das Sediment eingebettet werden. Das sauerstofffreie Monimolimnion ist deshalb eine ausgezeichnete Voraussetzung für die Konservierung von organischen Resten. Die Laminite und Turbidite im Beckenzentrum des Eckfelder Maares sind sehr fossilreich. Bis heute wurden mehr als Fossilien aufgenommen. Es wurden bakterielle Matten, Pilze, Algen, Moose, Farne und verschiedene Reste höherer Pflanzen, wie Pollen, Blätter, Früchte Samen und sogar Blüten gefunden (Abb. 8). Abb. 8: Blütenklech aus dem Eckfelder Maar, (die Länge des Maßstabs beträgt 1mm) (aus: NEGENDANK & ZOLITSCHKA, 1993) Die Invertebraten umfassen Süßwasserschwämme, Bryozoen, Gastropoden, Bivalven, Ostrakoden, Spinnen und Insekten. Die Insekten werden hauptsächlich von Käfern dominiert (ungefähr 90%), seltener ist die Riesenameise Formicium. Unter den Vertebraten finden sich vor allem Fische, wenige Vögel und Amphibien, Reptilien (Schildkröten und Krokodile) und Säugetiere, wie das Urpferdchen Propalaeotherium. Die Fossilien sind außergewöhnlich gut erhalten. So erkennt man bei Blättern noch die Kutikula und feine Haare, Blüten enthalten ihren Pollen, Insekten zeigen farbliche Pigmentierungen und einige Säugetiere findet
10 10 man noch mit Mageninhalt. Außerdem sind Weichteile in Form von Hautschatten erhalten. Es sind dichte Bakterienmatten die den Kadaver bedeckten und später durch Siderit oder Apatit fossilisiert wurden. 5. Zusammenfassung Maare sind vulkanisch entstandene Krater. Sie werden bald nach ihrer Entstehung mit Wasser gefüllt. In tiefen Maarseen bildet sich eine anoxische nicht in die Wasserzirkulation eingebundene Zone, das Monimolimniom aus, in der nur wenige Organismen leben können. Die Sedimentation ist in diesem Milieu sehr ruhig. Es bilden sich fein laminierte, bituminöse Tonsteine, die sogenannten Ölschiefer (Schwarzpelite), in denen Tier- und Pflanzenreste besonders gut erhalten sind. In den Gesteinen des Eckfelder Maares und des Messeler Sees sind sehr gut erhaltene Blätter, Früchte, Pollen, Insekten (Käfer, Bienen), Gastropoden, Schwämme, Frösche, Fische, Schildkröten, Krokodile, Haie, Vögel und Säugetiere (Fledermäuse, das Urpferdchen Propaleotherium), z.t. mit Erhaltung der Weichteile zu finden. Selbst zarteste Organismenreste wie Blütenkelche sind von der Überlieferung nicht ausgeschlossen (Abb. 8). Über die jahreszeitlich laminierten Sedimente ist es möglich eine hochauflösende Klimaforschung zu betreiben. Es werden u.a. Aussagen über Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse getroffen, außerdem ist es durch den Reichtum an Fossilien möglich Pflanzen- und Tiergemeinschaften des Einzugsgebietes und des Sees zu rekonstruieren. 6. Literatur BOHLE, H. W. (1995): Limnische Systeme S., Berlin; Heidelberg; New York: Springer- Verlag. FELDER, M., HARMS, F.-J. & WUTTKE, M. (1998): Faziesvergleich dreier Paläogener SeesystemeMitteleuropas anhand lithologischer Bohrprofile.- In: Geowissenschaften in Ökonomie und Ökologie-Das System Erde-Programm und Zusammenfassungen der Tagungsbeiträge: Geo-Berlin 98, Terra Nostra 98/3, Köln: Selbstverlag der Alfred-egener- Stiftung. FISCHER, C., PIRRUNG, M. & GAUPP, R. (1998): Lithofazies im Eckfelder Maar.- In: Geowissenschaften in Ökonomie und Ökologie-Das System Erde-Programm und Zusammenfassungen der Tagungsbeiträge: Geo-Berlin 98, Terra Nostra 98/3, Köln: Selbstverlag der Alfred-Wegener-Stiftung. GOTH, K. & SUHR, P. (1994): Oligozäne Maarsedimente von Kleinsaubernitz (Lausitz).- In: Niedermeyer, R.-O. et al.: Sediment 94: 9. Sedimentologen-Treffen vom 25. bis 27. Mai in Greifswald.- Greifswalder Geowissenschaftliche Beiträge, Reihe A, Bd.2, Seite 59. GOTH, K. & SUHR, P. (1998): Forschungsbohrung Baruth (Ostsachsen): Erste Ergebnisse.- In: Geowissenschaften in Ökonomie und Ökologie-Das System Erde-Programm und Zusammenfassungen der Tagungsbeiträge: Geo-Berlin 98, Terra Nostra 98/3, Köln: Selbstverlag der Alfred-Wegener-Stiftung. HARMS, F.-J. (1998): Die Eozän-Vorkommen des Sprendlinger Horstes.- In: Geowissenschaften in Ökonomie und Ökologie-Das System Erde-Programm und Zusammenfassungen der Tagungsbeiträge: Geo-Berlin 98, Terra Nostra 98/3, Köln: Selbstverlag der Alfred- Wegener-Stiftung. KÖHLER, J. (1998): Die Fossillagerstätte Enspel: Vegetation, Vegetationsdynamik und Klima im Oberoligozän S., Dissertation. KOENIGSWALD, W. v.(1982): Die erste Beutelratte aus dem mitteleozänen Ölschiefer von Messel bei Darmstadt.- In: Natur und Museum, 112 (2), KOENIGSWALD, W. v. [Hrsg.] (1996): Fossillagerstätte Rott bei Hennef im Siebengebirge. Das Leben an einem subtropischen See vor 25 Millionen Jahren S., Siegburg: Rheinlandia- Verlag (2. erweiterte Auflage).
11 11 LORENZ, V. (1988): Maare und Schlackenkegel der Westeifel, In: Vulkane: Naturgewalt, Klimafaktor und kosmische Formkraft S., Heidelberg: Spektrum der Wissenschaft (2. Auflage). MARTIN, T. (1999): Fossile Lebensräume aus Vulkankatastrophen.- In: Fossilien, Heft 5, MEYER, W.(1994):Geologie der Eifel S., Stuttgart: E. Schweizerbart sche Verlagsbuchhandlung, Nägele u. Obermiller (3. Auflage). MÖRS, T. (1995): Die Sedimentationsgeschichte der Fossillagerstätte Rott und ihre Alterseinstufung anhand neuer Säugetierfunde (Oberoligozän, Rheinland) S., Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 187, Frankfurt am Main. MURAWSKI, H.; MEYER, W. (1998):Geologisches Wörterbuch S., Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag (10. Auflage). NEGENDANK, J.F.W.; ZOLITSCHKA, B. (EDS.) (1993): Paleolimnology of European Maar Lakes S., Heidelberg: Springer-Verlag. NEGENDANK, J.F.W.; ZOLITSCHKA, B. (EDS.) (1997): 7th International Symposium on Paleolimnology, Excursion Guide.- Köln: Selbstverlag der Alfred-Wegener-Stiftung. NEUFFER, O. (1998): Das Eckfelder Maar - Ein Überblick.- In: Geowissenschaften in Ökonomie und Ökologie-Das System Erde-Programm und Zusammenfassungen der Tagungsbeiträge: Geo-Berlin 98, Terra Nostra 98/3, Köln: Selbstverlag der Alfred- Wegener-Stiftung. PIRRUNG, M. & BÜCHEL, G. (1998): Isolierte Paläogenvorkommen und Maarvulkane.- In: Geowissenschaften in Ökonomie und Ökologie-Das System Erde-Programm und Zusammenfassungen der Tagungsbeiträge: Geo-Berlin 98, Terra Nostra 98/3, Köln: Selbstverlag der Alfred-Wegener-Stiftung. SCHAAL, S. & ZIEGLER, W. (EDS.) (1988): Messel - Ein Schaufester in die Geschichte der Erde und des Lebens.-315 S., Senckenberg-Buch, 64, Frankfurt am Main: Waldemar KramerVerlag (2. unveränderte Auflage). SCHWOERBEL, J. (1999): Einführung in die Limnologie S., Stuttgart, Jena, Lübeck, Ulm: Gustav Fischer (8. Auflage). SUHR, P. & GOTH, K. (1996): Erster Nachweis tertiärer Maare in Sachsen.- In: Zbl. Geol. Paläont. Teil I, Jhg. 1995, Heft 1/2, , Stuttgart. WILDE, V. & FRANKENHÄUSER, H. (1998): Eckfeld und Messel, ein Fenster in die zonale Vegetation des zentraleuropäischen Mitteleozän.- In: Geowissenschaften in Ökonomie und Ökologie-Das System Erde-Programm und Zusammenfassungen der Tagungsbeiträge: Geo- Berlin 98, Terra Nostra 98/3, Köln: Selbstverlag der Alfred-Wegener-Stiftung. ZOLITSCHKA, B. (1993): siehe NEGENDANK, J.F.W.; ZOLITSCHKA, B. (EDS.) (1993). ZOLITSCHKA, B. (1998): Relief Boden Paläoklima, Bd. 13: Paläoklimatische Bedeutung laminierter Sedimente S., Berlin, Stuttgart: Gebrüder Borntraeger. ZOLITSCHKA, B. (1990): Jahreszeitlich geschichtete Seesedimente ausgewählter Eifelmaare.- Documenta naturae, 60:
12 12 Maare - biotische und Sedimentationsentwicklung an Fallbeispielen von Kerstin Fohlert Inhalt
13 1. Einleitung Entstehung und Morphologie der Maare 3. Entwicklungsstadien eines Maares 4. Der Maarsee 4.1. Die Schichtung des Wasserkörpers 4.2. Sedimentation im Maarsee 4.3. Biota 5. Zusammenfassung 6. Literatur
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Biologie Arbeitsblätter mit Lösungen - Ökologie
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Biologie Arbeitsblätter mit Lösungen - Ökologie Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de ÖKOLOGIE: Ökosystem
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Biologie Arbeitsblätter mit Lösungen - Ökologie Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de ÖKOLOGIE: Ökosystem
Aquatische Ökosysteme
 Vortrag am: 26.03.2009 Fach: Geografie Aquatische Ökosysteme Ein Vortrag von Katrin Riemann, Josephin Rodenstein, Florian Sachs und Philipp Sachweh Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg Gliederung 1 Das
Vortrag am: 26.03.2009 Fach: Geografie Aquatische Ökosysteme Ein Vortrag von Katrin Riemann, Josephin Rodenstein, Florian Sachs und Philipp Sachweh Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg Gliederung 1 Das
Kristallhöhle Kobelwald
 Kristallhöhle Kobelwald Entdeckt im Jahre 1682. 1702 von Johann Jakob Scheuchzer erstmals in der Literatur erwähnt. Gesamtlänge der Höhle beträgt 665 m, davon sind 128 Meter ausgebaut und touristisch zugänglich
Kristallhöhle Kobelwald Entdeckt im Jahre 1682. 1702 von Johann Jakob Scheuchzer erstmals in der Literatur erwähnt. Gesamtlänge der Höhle beträgt 665 m, davon sind 128 Meter ausgebaut und touristisch zugänglich
DOPSOL Development of a Phosphate-Elimination System of Lakes (Entwicklung eines Systems zur Entfernung von Phosphat aus Seen)
 DOPSOL Development of a Phosphate-Elimination System of Lakes (Entwicklung eines Systems zur Entfernung von Phosphat aus Seen) Die natürliche Ressource Wasser ist weltweit durch die verschiedensten Kontaminationen
DOPSOL Development of a Phosphate-Elimination System of Lakes (Entwicklung eines Systems zur Entfernung von Phosphat aus Seen) Die natürliche Ressource Wasser ist weltweit durch die verschiedensten Kontaminationen
PAS I. Inhalt 3. Sitzung. Physik Aquatischer Systeme I. 3. Dichteschichtung ( ) ( ) Salzgehalt und Dichte
 PAS I Physik Aquatischer Systeme I 3. Dichteschichtung Inhalt 3. Sitzung Kap. 1. Physikalische Eigenschaften des Wassers 1.6 Gelöste Stoffe, Dichte, und elektrische Leitfähigkeit Dichte als Funktion des
PAS I Physik Aquatischer Systeme I 3. Dichteschichtung Inhalt 3. Sitzung Kap. 1. Physikalische Eigenschaften des Wassers 1.6 Gelöste Stoffe, Dichte, und elektrische Leitfähigkeit Dichte als Funktion des
Ruppach-Goldhausen Maria für Pal.Ges.-Homepage/Grabungen
 Ruppach-Goldhausen Maria für Pal.Ges.-Homepage/Grabungen Ein pliozäner Kratersee mit fossilreichen Laminiten im südlichen Westerwald Thomas Schindler, Michael Wuttke, Martin Hottenrott, Mark Herrmann &
Ruppach-Goldhausen Maria für Pal.Ges.-Homepage/Grabungen Ein pliozäner Kratersee mit fossilreichen Laminiten im südlichen Westerwald Thomas Schindler, Michael Wuttke, Martin Hottenrott, Mark Herrmann &
S Primärproduktion >> Watt für Fortgeschrittene Naturschule Wattenmeer
 Wie funktioniert Primärproduktion im Meer? Aufgabe 1: Beschäftigen Sie sich mit den Steuerungsfaktoren der marinen Primärproduktion. Es gibt fünf Stationen, die Sie in beliebiger Reihenfolge durchlaufen
Wie funktioniert Primärproduktion im Meer? Aufgabe 1: Beschäftigen Sie sich mit den Steuerungsfaktoren der marinen Primärproduktion. Es gibt fünf Stationen, die Sie in beliebiger Reihenfolge durchlaufen
Station 10 Fränkische Ammoniten in Frankfurt
 Station 10 Fränkische Ammoniten in Frankfurt Ein Aktionsheft für Kinder von Nina Mühl Inhaltsverzeichnis Vorwort der Autorin Warum eine Mauer?...2 Wie benutzt Du dieses Aktionsheft?...3 Ein erster Blick!...4
Station 10 Fränkische Ammoniten in Frankfurt Ein Aktionsheft für Kinder von Nina Mühl Inhaltsverzeichnis Vorwort der Autorin Warum eine Mauer?...2 Wie benutzt Du dieses Aktionsheft?...3 Ein erster Blick!...4
b) Warum kann man von Konstanz aus Bregenz nicht sehen?
 Der Bodensee ein Arbeitsblatt für Schüler der 5. und 6. Klasse Der Bodensee ist mit einer Gesamtfläche von 571,5 km 2 der zweitgrößte See im Alpenvorland. Er besteht eigentlich aus zwei Seeteilen, dem
Der Bodensee ein Arbeitsblatt für Schüler der 5. und 6. Klasse Der Bodensee ist mit einer Gesamtfläche von 571,5 km 2 der zweitgrößte See im Alpenvorland. Er besteht eigentlich aus zwei Seeteilen, dem
Vulkane kennt doch jeder, das sind doch die qualmenden Berge mit der Lava? Stimmt, aber es steckt noch viel mehr dahinter!
 Vulkane kennt doch jeder, das sind doch die qualmenden Berge mit der Lava? Stimmt, aber es steckt noch viel mehr dahinter! Fangen wir erst mal mit der Entstehung von Vulkanen an. Warum gibt es irgendwo
Vulkane kennt doch jeder, das sind doch die qualmenden Berge mit der Lava? Stimmt, aber es steckt noch viel mehr dahinter! Fangen wir erst mal mit der Entstehung von Vulkanen an. Warum gibt es irgendwo
B E R I C H T E D E R N A T U R F O R S C H E N D E N G E S E L L S C H A F T D E R O B E R L A U S I T Z
 B E R I C H T E D E R N A T U R F O R S C H E N D E N G E S E L L S C H A F T D E R O B E R L A U S I T Z Band 10 Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz 10: 27-35 (2002) Manuskriptannahme am 15. 10. 2001 Erschienen
B E R I C H T E D E R N A T U R F O R S C H E N D E N G E S E L L S C H A F T D E R O B E R L A U S I T Z Band 10 Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz 10: 27-35 (2002) Manuskriptannahme am 15. 10. 2001 Erschienen
K-Feldspat + Wasser + Kohlensäure Kaolinit + gelöstes Hydrogencarbonat + gelöstes Kalium + gelöste Kieselsäure
 Hydrolyse 20 K-Feldspat + Wasser + Kohlensäure Kaolinit + gelöstes Hydrogencarbonat + gelöstes Kalium + gelöste Kieselsäure 2KAlSi 3 O 8 + H 2 O + 2H 2 CO 3 Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 + 2HCO 3 - + 2K + + 4SiO
Hydrolyse 20 K-Feldspat + Wasser + Kohlensäure Kaolinit + gelöstes Hydrogencarbonat + gelöstes Kalium + gelöste Kieselsäure 2KAlSi 3 O 8 + H 2 O + 2H 2 CO 3 Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 + 2HCO 3 - + 2K + + 4SiO
Baruths heisse Vergangenheit. Vulkane in der Lausitz von Kurt Goth & Peter Suhr
 Baruths heisse Vergangenheit Vulkane in der Lausitz von Kurt Goth & Peter Suhr Baruth Kurt Goth, Peter Suhr Baruths heiße Vergangenheit Vulkane in der Lausitz Vorwort Seit 1872 ist die systematische Bestandsaufnahme
Baruths heisse Vergangenheit Vulkane in der Lausitz von Kurt Goth & Peter Suhr Baruth Kurt Goth, Peter Suhr Baruths heiße Vergangenheit Vulkane in der Lausitz Vorwort Seit 1872 ist die systematische Bestandsaufnahme
Arbeitsblatt Rundgang Tropengarten Klasse 7/8
 1 Arbeitsblatt Rundgang Tropengarten Klasse 7/8 Datum: Herzlich willkommen in der Biosphäre Potsdam! Schön, dass du da bist! Auf dem Weg durch die Biosphäre kannst du verschiedene Aufgaben lösen: 1.) Zu
1 Arbeitsblatt Rundgang Tropengarten Klasse 7/8 Datum: Herzlich willkommen in der Biosphäre Potsdam! Schön, dass du da bist! Auf dem Weg durch die Biosphäre kannst du verschiedene Aufgaben lösen: 1.) Zu
 Der Kreislauf des Wassers 1/24 2/24 Fließende und stehende Gewässer Zu den fließenden Gewässern zählen der Bach, der Fluss und der Strom. Das größte, durch Österreich fließende Gewässer ist die Donau (der
Der Kreislauf des Wassers 1/24 2/24 Fließende und stehende Gewässer Zu den fließenden Gewässern zählen der Bach, der Fluss und der Strom. Das größte, durch Österreich fließende Gewässer ist die Donau (der
Taphonomie. Prof. H. U. Pfretzschner. Institut für Geowissenschaften, Tübingen. Prof. H. U. Pfretzschner
 Taphonomie Institut für Geowissenschaften, Tübingen Die Taphonomie befasst sich mit allen Prozessen, die vom Tod eines Organismus bis zum fertigen Fossil ablaufen. http://www.geology.wisc.edu/homepages/g100s2/public_html/geologic_time/l10_devonia
Taphonomie Institut für Geowissenschaften, Tübingen Die Taphonomie befasst sich mit allen Prozessen, die vom Tod eines Organismus bis zum fertigen Fossil ablaufen. http://www.geology.wisc.edu/homepages/g100s2/public_html/geologic_time/l10_devonia
Entwicklung der Litho- und Biosphäre (Geologie)
 Entwicklung der Litho- und Biosphäre (Geologie) Teil 8 Vorlesung 4.11 22.11. 2004 Mo - Do 9.15 10.00 Sedimentation Sedimentationsbereiche See Wüste Gletscher Fluß Strand Schelf Schelf Watt Kontinentalhang
Entwicklung der Litho- und Biosphäre (Geologie) Teil 8 Vorlesung 4.11 22.11. 2004 Mo - Do 9.15 10.00 Sedimentation Sedimentationsbereiche See Wüste Gletscher Fluß Strand Schelf Schelf Watt Kontinentalhang
Die Grabungssaison in Messel
 Die Grabungssaison in Messel Die Grabungsaktivitäten des Forschungsinstituts Senckenberg in der Grube Messel liefern jedes Jahr aufsehenerregende Fossilfunde. Die Grube Messel ist seit 1995 als Welterbestätte
Die Grabungssaison in Messel Die Grabungsaktivitäten des Forschungsinstituts Senckenberg in der Grube Messel liefern jedes Jahr aufsehenerregende Fossilfunde. Die Grube Messel ist seit 1995 als Welterbestätte
Wolken und Gewitter. Perlmutterwolken und leuchtende Nachtwolken
 Wolken und Gewitter Besonders auffällig sind auf den Bildern von der Erde aus dem Weltraum die vielfältigen Bewölkungsmuster (in Form von Bändern, Wirbeln, Zellen usw.). Ungefähr die Hälfte der Erdoberfläche
Wolken und Gewitter Besonders auffällig sind auf den Bildern von der Erde aus dem Weltraum die vielfältigen Bewölkungsmuster (in Form von Bändern, Wirbeln, Zellen usw.). Ungefähr die Hälfte der Erdoberfläche
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Stationenlernen: Naturgewalten: Vulkane - Feuerspeiende Berge
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Stationenlernen: Naturgewalten: Vulkane - Feuerspeiende Berge Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Stationenlernen:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Stationenlernen: Naturgewalten: Vulkane - Feuerspeiende Berge Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Stationenlernen:
Einführung in die Marinen Umweltwissenschaften
 Einführung in die Marinen Umweltwissenschaften www.icbm.de/pmbio Mikrobiologische Grundlagen - Rolle der Mikroorganismen in der Natur - Beispiel Meer - Biogeochemie, Mikrobielle Ökologie, Umweltmikrobiologie
Einführung in die Marinen Umweltwissenschaften www.icbm.de/pmbio Mikrobiologische Grundlagen - Rolle der Mikroorganismen in der Natur - Beispiel Meer - Biogeochemie, Mikrobielle Ökologie, Umweltmikrobiologie
Das Sonnensystem. Teil 6. Peter Hauschildt 6. Dezember Hamburger Sternwarte Gojenbergsweg Hamburg
 Das Sonnensystem Teil 6 Peter Hauschildt yeti@hs.uni-hamburg.de Hamburger Sternwarte Gojenbergsweg 112 21029 Hamburg 6. Dezember 2016 1 / 37 Übersicht Teil 6 Venus Orbit & Rotation Atmosphäre Oberfläche
Das Sonnensystem Teil 6 Peter Hauschildt yeti@hs.uni-hamburg.de Hamburger Sternwarte Gojenbergsweg 112 21029 Hamburg 6. Dezember 2016 1 / 37 Übersicht Teil 6 Venus Orbit & Rotation Atmosphäre Oberfläche
4. Teil: Die Eifel nach einer kosmischen Katastrophe
 4. Teil: Die Eifel nach einer kosmischen Katastrophe In drei kleinen Aufsätzen habe ich schon die Geschehnisse angesprochen, die vermutlich die Maarbildung in der Eifel ausgelöst haben. In einem dieser
4. Teil: Die Eifel nach einer kosmischen Katastrophe In drei kleinen Aufsätzen habe ich schon die Geschehnisse angesprochen, die vermutlich die Maarbildung in der Eifel ausgelöst haben. In einem dieser
Besondere Erhaltungsformen
 Besondere Erhaltungsformen Institut für Geowissenschaften, Tübingen http://www.lwl.org/pressemitteilungen/daten/bilder/22011.jpg Mammutfunde im Dauerfrostboden Das Beresowka-Mammut (1901) http://hanskrause.de/images/hkhpe12/image015.jpg
Besondere Erhaltungsformen Institut für Geowissenschaften, Tübingen http://www.lwl.org/pressemitteilungen/daten/bilder/22011.jpg Mammutfunde im Dauerfrostboden Das Beresowka-Mammut (1901) http://hanskrause.de/images/hkhpe12/image015.jpg
Allgemeine Geologie. Teil 16 SS 2005 Mo, Di, Mi
 Allgemeine Geologie Teil 16 SS 2005 Mo, Di, Mi 8.15 9.00 Evaporite Evaporite sind Eindampfungs-Gesteine, deren Komponenten bei hoher Verdunstung aus Randmeeren oder abflußlosen Seen auskristallisieren.
Allgemeine Geologie Teil 16 SS 2005 Mo, Di, Mi 8.15 9.00 Evaporite Evaporite sind Eindampfungs-Gesteine, deren Komponenten bei hoher Verdunstung aus Randmeeren oder abflußlosen Seen auskristallisieren.
3.Ätna. Ätna heißt eigentlich die Eigenschaft zu brennen. Der Vulkan formte sich vor Jahren. Der Ätna bricht selten aus
 Name: Klasse: Datum: 3.Ätna Auftrag f Richtig oder falsch? (Einzelarbeit) Die Aussagen auf diesem Arbeitsblatt sind teilweise richtig, teilweise falsch. Entscheide mit Hilfe des Textes über den Ätna 3,
Name: Klasse: Datum: 3.Ätna Auftrag f Richtig oder falsch? (Einzelarbeit) Die Aussagen auf diesem Arbeitsblatt sind teilweise richtig, teilweise falsch. Entscheide mit Hilfe des Textes über den Ätna 3,
ALLGEMEINE GEOWISSENSCHAFTLICHE LITERATUR ÜBER RHEINLANDPFALZ
 ALLGEMEINE GEOWISSENSCHAFTLICHE LITERATUR ÜBER RHEINLANDPFALZ Beiträge zur Geologie der Pfalz / Hrsg.: Jost Haneke et al. Speyer: Pfälz. Ges. zur Förderung d. Wiss., 2013. - 108 S. ISBN 978-3-932155-35-2
ALLGEMEINE GEOWISSENSCHAFTLICHE LITERATUR ÜBER RHEINLANDPFALZ Beiträge zur Geologie der Pfalz / Hrsg.: Jost Haneke et al. Speyer: Pfälz. Ges. zur Förderung d. Wiss., 2013. - 108 S. ISBN 978-3-932155-35-2
Natürliche ökologische Energie- und Stoffkreisläufe
 Informationsmaterialien über den ökologischen Landbau für den Unterricht an allgemein bildenden Schulen. Initiiert durch das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen
Informationsmaterialien über den ökologischen Landbau für den Unterricht an allgemein bildenden Schulen. Initiiert durch das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen
Einführung in die Geographie. Klimageographie
 Einführung in die Geographie Klimageographie Klimaelemente Gliederung der Vorlesung 1. Physische Geographie 2. Geologie 3. Klima, Vegetation und Wasser 4. Pedologie / Bodengeographie 5. Geomorphologie
Einführung in die Geographie Klimageographie Klimaelemente Gliederung der Vorlesung 1. Physische Geographie 2. Geologie 3. Klima, Vegetation und Wasser 4. Pedologie / Bodengeographie 5. Geomorphologie
Übungen zur Allgemeinen Geologie, Nebenfach
 zur Allgemeinen Geologie, Nebenfach Erta Ale, Afrika Übungstermine und Themen Termine Einführungsstunde Übung 26.10.2010 Einführung + Mineral- Eigenschaften Gruppeneinteilung 02.11. 2010 Minerale 1 Eigenschaften
zur Allgemeinen Geologie, Nebenfach Erta Ale, Afrika Übungstermine und Themen Termine Einführungsstunde Übung 26.10.2010 Einführung + Mineral- Eigenschaften Gruppeneinteilung 02.11. 2010 Minerale 1 Eigenschaften
Helmut Kokemoor, EM-Fachberatung Landwirtschaft, EM-RAKO, Rahden. Vortrag: Welchen Beitrag kann die EM-Technologie zur Sanierung des Dümmers leisten?
 Helmut Kokemoor, EM-Fachberatung Landwirtschaft, EM-RAKO, Rahden Vortrag: Welchen Beitrag kann die EM-Technologie zur Sanierung des Dümmers leisten? 1 x 1 der Mikrobiologie Was ist EM-Technologie EM-Wirkung
Helmut Kokemoor, EM-Fachberatung Landwirtschaft, EM-RAKO, Rahden Vortrag: Welchen Beitrag kann die EM-Technologie zur Sanierung des Dümmers leisten? 1 x 1 der Mikrobiologie Was ist EM-Technologie EM-Wirkung
Vulkane oder Die Erde spuckt Feuer
 Vor langer Zeit war unser Planet Erde ein glühender Feuerball. Er kühlte sich allmählich ab, weil es im Weltall kalt ist. Im Innern ist die Erde aber immer noch heiß. Diese Hitze bringt das innere Gestein
Vor langer Zeit war unser Planet Erde ein glühender Feuerball. Er kühlte sich allmählich ab, weil es im Weltall kalt ist. Im Innern ist die Erde aber immer noch heiß. Diese Hitze bringt das innere Gestein
Ökoregionen & Makroökologie
 Ökoregionen & Makroökologie 2. Meere und Brackgewässer 2.1 Grundlagen Einige Kenngrößen Fläche: 361,1 Mio. km², entspr. 70,8 % der Erdoberfläche Volumen: 1375 Mrd. km², entspr. 90 % der Biosphäre gesamte
Ökoregionen & Makroökologie 2. Meere und Brackgewässer 2.1 Grundlagen Einige Kenngrößen Fläche: 361,1 Mio. km², entspr. 70,8 % der Erdoberfläche Volumen: 1375 Mrd. km², entspr. 90 % der Biosphäre gesamte
Die Eifel Natur unter Vertrag
 Der Natur- und Kulturraum Eifel ist am westlichen Rand Deutschlands gelegen. Informiere dich über die Eifel. Nutze deinen Atlas zur Beantwortung der Fragen, manchmal brauchst du noch weitere Informationsquellen
Der Natur- und Kulturraum Eifel ist am westlichen Rand Deutschlands gelegen. Informiere dich über die Eifel. Nutze deinen Atlas zur Beantwortung der Fragen, manchmal brauchst du noch weitere Informationsquellen
Plinianischer Ausbruch Peleanischer Ausbruch
 Plinianischer Ausbruch Peleanischer Ausbruch Plinianische Ausbrüche sind hochexplosiv. Das Magma ist sehr kieselsäurereich und zähflüssig. Es verstopft oft den Schlot. Der steigende Gasdruck sprengt dann
Plinianischer Ausbruch Peleanischer Ausbruch Plinianische Ausbrüche sind hochexplosiv. Das Magma ist sehr kieselsäurereich und zähflüssig. Es verstopft oft den Schlot. Der steigende Gasdruck sprengt dann
Warum gibt es überhaupt Gebirge?
 Gebirge Es gibt heute viele hohe Gebirge auf der ganzen Welt. Die bekanntesten sind die Alpen in Europa, die Rocky Mountains in Nordamerika und der Himalaya in Asien. Wie sind diese Gebirge entstanden
Gebirge Es gibt heute viele hohe Gebirge auf der ganzen Welt. Die bekanntesten sind die Alpen in Europa, die Rocky Mountains in Nordamerika und der Himalaya in Asien. Wie sind diese Gebirge entstanden
Dynamik der Biosphäre. Endogene Dynamik II
 Dynamik der Biosphäre Endogene Dynamik II Wintersemester 2004/2005 Wolfgang Cramer Lehrstuhl "Globale Ökologie" http://www.pik-potsdam.de/~cramer -> "Teaching" Heute... Bodenprozesse mit globaler Bedeutung
Dynamik der Biosphäre Endogene Dynamik II Wintersemester 2004/2005 Wolfgang Cramer Lehrstuhl "Globale Ökologie" http://www.pik-potsdam.de/~cramer -> "Teaching" Heute... Bodenprozesse mit globaler Bedeutung
der Bach viele Bäche der Berg viele Berge die Bewölkung der Blitz viele Blitze der Donner Durch das Feld fließt ein kleiner Bach. Der Berg ist hoch.
 der Bach viele Bäche Durch das Feld fließt ein kleiner Bach. der Berg viele Berge Der Berg ist hoch. die Bewölkung Die Bewölkung am Himmel wurde immer dichter. der Blitz viele Blitze In dem Baum hat ein
der Bach viele Bäche Durch das Feld fließt ein kleiner Bach. der Berg viele Berge Der Berg ist hoch. die Bewölkung Die Bewölkung am Himmel wurde immer dichter. der Blitz viele Blitze In dem Baum hat ein
Kohlenstoff aus dem Erdinneren: eine Quelle für den Kohlenstoffkreislauf der Erde
 4.786 Zeichen Abdruck honorarfrei Beleg wird erbeten Prof. Dr. Dan Frost, Dr. Catherine McCammon und der Bayreuther Masterstudent Dickson O. Ojwang im Hochdrucklabor des Bayerischen Geoinstituts (BGI)
4.786 Zeichen Abdruck honorarfrei Beleg wird erbeten Prof. Dr. Dan Frost, Dr. Catherine McCammon und der Bayreuther Masterstudent Dickson O. Ojwang im Hochdrucklabor des Bayerischen Geoinstituts (BGI)
Vulkanpark Informationszentrum Plaidt/Saffig. Schülerorientierte Materialien
 1 Vulkanpark Informationszentrum Plaidt/Saffig Schülerorientierte Materialien zur Entstehung der Vulkane im Laacher See-Gebiet zu Gesteinen und Ausbruchsarten von Vulkanen in der Osteifel zum Abbau der
1 Vulkanpark Informationszentrum Plaidt/Saffig Schülerorientierte Materialien zur Entstehung der Vulkane im Laacher See-Gebiet zu Gesteinen und Ausbruchsarten von Vulkanen in der Osteifel zum Abbau der
Uran in hessischen Grund- und Rohwässern. Sachstand des laufenden Projektes. Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie
 Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie Wasser und Boden GmbH, Boppard-Buchholz Uran in hessischen Grund- und Rohwässern F. LUDWIG & G. BERTHOLD Sachstand des laufenden Projektes Urangehalte in hessischen
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie Wasser und Boden GmbH, Boppard-Buchholz Uran in hessischen Grund- und Rohwässern F. LUDWIG & G. BERTHOLD Sachstand des laufenden Projektes Urangehalte in hessischen
Ökologie. basics. 103 Abbildungen 52 Tabellen. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart
 Ökologie 103 Abbildungen 52 Tabellen basics Verlag Eugen Ulmer Stuttgart Inhaltsverzeichnis 100* «HS- S>J.S(;HC LAN'f.:tS- UND \ Vorwort 8 1 Was ist Ökologie? 10 1.1 Teilgebiete der Ökologie 10 1.2 Geschichte
Ökologie 103 Abbildungen 52 Tabellen basics Verlag Eugen Ulmer Stuttgart Inhaltsverzeichnis 100* «HS- S>J.S(;HC LAN'f.:tS- UND \ Vorwort 8 1 Was ist Ökologie? 10 1.1 Teilgebiete der Ökologie 10 1.2 Geschichte
Geplanter Verlauf. Einführung Beurteilung nach abiotischen Faktoren Pause Beurteilung nach biotischen Faktoren Auswertung und Diskussion
 Ökosystem See Geplanter Verlauf Einführung Beurteilung nach abiotischen Faktoren Pause Beurteilung nach biotischen Faktoren Auswertung und Diskussion Schulbiologiezentrum Hannover - Ökologie stehender
Ökosystem See Geplanter Verlauf Einführung Beurteilung nach abiotischen Faktoren Pause Beurteilung nach biotischen Faktoren Auswertung und Diskussion Schulbiologiezentrum Hannover - Ökologie stehender
3.3 Populationswachstum des Menschen
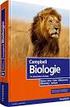 3.3 Populationswachstum des Menschen Die Art Homo sapiens zeigt ein superexponentielles Wachstum: Die Verdopplung der Individuenzahl erfolgt nicht in gleichen, sondern in immer kürzen Abständen. Gründe:
3.3 Populationswachstum des Menschen Die Art Homo sapiens zeigt ein superexponentielles Wachstum: Die Verdopplung der Individuenzahl erfolgt nicht in gleichen, sondern in immer kürzen Abständen. Gründe:
Entstehung der Gesteine
 Entstehung der Gesteine Entstehung der Gesteine In der Natur unterliegen die Gesteine verschiedenen, in enger Beziehung zueinander stehenden geologischen Prozessen wie Kristallisation, Hebung, Verwitterung,
Entstehung der Gesteine Entstehung der Gesteine In der Natur unterliegen die Gesteine verschiedenen, in enger Beziehung zueinander stehenden geologischen Prozessen wie Kristallisation, Hebung, Verwitterung,
Klimasystem. Das Klima der Erde und wie es entsteht: Definition Klima
 Das Klima der Erde und wie es entsteht: Definition Klima Unter dem Begriff Klima verstehen wir die Gesamtheit der typischen Witterungsabläufe an einem bestimmten Ort oder in einer bestimmten Region über
Das Klima der Erde und wie es entsteht: Definition Klima Unter dem Begriff Klima verstehen wir die Gesamtheit der typischen Witterungsabläufe an einem bestimmten Ort oder in einer bestimmten Region über
Urzeiten. Urgewalten. Vulkane. Geh auf Entdeckungsreise in die Vergangenheit unserer Erde! Los geht s!
 RÄTSEL-RALLYE DURCH DAS VULKANPARK INFOZENTRUM FÜR DIE KLASSE 8-10 Urzeiten. Urgewalten. Vulkane. Geh auf Entdeckungsreise in die Vergangenheit unserer Erde! Mal sehen, ob du nach eurem Besuch mehr über
RÄTSEL-RALLYE DURCH DAS VULKANPARK INFOZENTRUM FÜR DIE KLASSE 8-10 Urzeiten. Urgewalten. Vulkane. Geh auf Entdeckungsreise in die Vergangenheit unserer Erde! Mal sehen, ob du nach eurem Besuch mehr über
25) Die Eifel nach einer kosmischen Katastrophe (Trennung von Maar- und Vulkaneifel und der Mürmes )
 25) Die Eifel nach einer kosmischen Katastrophe (Trennung von Maar- und Vulkaneifel und der Mürmes ) Viele Fragen ergeben sich, wenn man in seiner Lieblingslandschaft weilt. Die Eifel strahlt einen großen
25) Die Eifel nach einer kosmischen Katastrophe (Trennung von Maar- und Vulkaneifel und der Mürmes ) Viele Fragen ergeben sich, wenn man in seiner Lieblingslandschaft weilt. Die Eifel strahlt einen großen
Feuchte Mittelbreiten. Landschaftsnutzung im Wandel
 Feuchte Mittelbreiten Landschaftsnutzung im Wandel Auswirkungen auf die Umwelt Dozent: Dr. Holger Schulz Referent: Benjamin Schreiber Gliederung Einleitung Relevanz für die Feuchten Mittelbreiten Perioden
Feuchte Mittelbreiten Landschaftsnutzung im Wandel Auswirkungen auf die Umwelt Dozent: Dr. Holger Schulz Referent: Benjamin Schreiber Gliederung Einleitung Relevanz für die Feuchten Mittelbreiten Perioden
Ökosystem Flusslandschaft
 Naturwissenschaft Philipp Schönberg Ökosystem Flusslandschaft Studienarbeit Das Ökosystem Flusslandschaft Ökologie Informationen zum Ökosystem Flusslandschaft Philipp Schönberg Abgabetermin: 20. Juni
Naturwissenschaft Philipp Schönberg Ökosystem Flusslandschaft Studienarbeit Das Ökosystem Flusslandschaft Ökologie Informationen zum Ökosystem Flusslandschaft Philipp Schönberg Abgabetermin: 20. Juni
Waldboden. Sucht unter einem Laubbaum Blätter in unterschiedlichem Zersetzungsgrad und klebt sie nacheinander auf ein großes Blatt Papier!
 1 Sucht unter einem Laubbaum Blätter in unterschiedlichem Zersetzungsgrad und klebt sie nacheinander auf ein großes Blatt Papier! Findet heraus, welche Tiere dies bewirken! Schaut euch im Gelände um: Zersetzen
1 Sucht unter einem Laubbaum Blätter in unterschiedlichem Zersetzungsgrad und klebt sie nacheinander auf ein großes Blatt Papier! Findet heraus, welche Tiere dies bewirken! Schaut euch im Gelände um: Zersetzen
Japanischer Staudenknöterich
 Blätter und Blüte Japanischer Staudenknöterich Blatt Japanischer Staudenknöterich Wissenschaftlicher Name: Fallopia japonica Beschreibung: Der japanische Staudenknöterich ist eine schnell wachsende, krautige
Blätter und Blüte Japanischer Staudenknöterich Blatt Japanischer Staudenknöterich Wissenschaftlicher Name: Fallopia japonica Beschreibung: Der japanische Staudenknöterich ist eine schnell wachsende, krautige
Wie hoch ist der Kalkgehalt?
 Wie hoch ist der Kalkgehalt? Kurzinformation Um was geht es? Kalk ist sowohl ein Pflanzen- als auch ein Bodendünger. Kalk versorgt die Pflanzen mit dem Nährstoff Calcium. Gleichzeitig verbessert er die
Wie hoch ist der Kalkgehalt? Kurzinformation Um was geht es? Kalk ist sowohl ein Pflanzen- als auch ein Bodendünger. Kalk versorgt die Pflanzen mit dem Nährstoff Calcium. Gleichzeitig verbessert er die
Geologische Rahmenbedingungen & Potenziale in Hessen
 Geologische Rahmenbedingungen & Potenziale in Hessen 1. Tiefengeothermie-Forum Forum,, 08. Nov. 2006, TU Darmstadt Gliederung 1. Geologischer Überblick 2. Hydrogeologische Übersicht 3. Flache Geothermie
Geologische Rahmenbedingungen & Potenziale in Hessen 1. Tiefengeothermie-Forum Forum,, 08. Nov. 2006, TU Darmstadt Gliederung 1. Geologischer Überblick 2. Hydrogeologische Übersicht 3. Flache Geothermie
Gemessene Schwankungsbreiten von Wärmeleitfähigkeiten innerhalb verschiedener Gesteinsgruppen Analyse der Ursachen und Auswirkungen
 Gemessene Schwankungsbreiten von Wärmeleitfähigkeiten innerhalb verschiedener Gesteinsgruppen Analyse der Ursachen und Auswirkungen Dipl.-Geologe Marcus Richter HGC Hydro-Geo-Consult GmbH Gliederung 1.
Gemessene Schwankungsbreiten von Wärmeleitfähigkeiten innerhalb verschiedener Gesteinsgruppen Analyse der Ursachen und Auswirkungen Dipl.-Geologe Marcus Richter HGC Hydro-Geo-Consult GmbH Gliederung 1.
Die kosmische Evolution - Lösung
 Die kosmische Evolution - Lösung Nr. Aussage Der Urknall muss sehr laut gewesen sein. 2 Vor dem Urknall gab es nichts. Am Anfang war es sehr, sehr heiß. 4 Der Urknall ereignete sich vor ca.,77 Millionen
Die kosmische Evolution - Lösung Nr. Aussage Der Urknall muss sehr laut gewesen sein. 2 Vor dem Urknall gab es nichts. Am Anfang war es sehr, sehr heiß. 4 Der Urknall ereignete sich vor ca.,77 Millionen
Geochemische Untersuchungen an Schwarzpeliten des Eozänen Eckfelder Maares zur Rekonstruktion der Paläoumweltbedingungen
 1 Geochemische Untersuchungen an Schwarzpeliten des Eozänen Eckfelder Maares zur Rekonstruktion der Paläoumweltbedingungen Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades (Dr. rer. nat.) der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
1 Geochemische Untersuchungen an Schwarzpeliten des Eozänen Eckfelder Maares zur Rekonstruktion der Paläoumweltbedingungen Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades (Dr. rer. nat.) der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Sommerstagnation (Ökosystem See)
 Thema: Sommerstagnation (Ökosystem See) Klasse: 09/10 Umfang: < 1 Stunde Differenzierungsform (Wonach?) ZIEL methodische Kompetenzen Lerntempo soziale Kompetenz Leistungsfähigkeit Interesse Fähigkeit z.
Thema: Sommerstagnation (Ökosystem See) Klasse: 09/10 Umfang: < 1 Stunde Differenzierungsform (Wonach?) ZIEL methodische Kompetenzen Lerntempo soziale Kompetenz Leistungsfähigkeit Interesse Fähigkeit z.
Ökologie. Die Lehre vom Haus
 Ökologie Die Lehre vom Haus Übersicht Ökologie 1. Welche Voraussetzungen braucht es für Leben: a. Abiotische Faktoren (Wo findet Leben statt?) b. Biotische Faktoren (Wie beeinflussen sich Lebewesen gegenseitig;
Ökologie Die Lehre vom Haus Übersicht Ökologie 1. Welche Voraussetzungen braucht es für Leben: a. Abiotische Faktoren (Wo findet Leben statt?) b. Biotische Faktoren (Wie beeinflussen sich Lebewesen gegenseitig;
Biodiversität Posten 1, Erdgeschoss 3 Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/6 Arbeitsauftrag Die SuS erleben am Ausstellungs-Beispiel die Vielfalt in der Natur. Sie erkunden die Ausstellung. Ziel Die SuS kennen Beispiele von und welch wichtige Bedeutung ein
Lehrerinformation 1/6 Arbeitsauftrag Die SuS erleben am Ausstellungs-Beispiel die Vielfalt in der Natur. Sie erkunden die Ausstellung. Ziel Die SuS kennen Beispiele von und welch wichtige Bedeutung ein
Aggregatzustände (Niveau 1)
 Aggregatzustände (Niveau 1) 1. Wasser kann verschiedene Zustandsformen haben, die sogenannten Aggregatzustände. Im Frühjahr kannst du die verschiedenen Aggregatzustände beobachten. Ergänze im Text die
Aggregatzustände (Niveau 1) 1. Wasser kann verschiedene Zustandsformen haben, die sogenannten Aggregatzustände. Im Frühjahr kannst du die verschiedenen Aggregatzustände beobachten. Ergänze im Text die
einer Exkursion und der Herausgabe einer allgemeinverständlichen Kurzbroschüre.
 Was ist eigentlich ein Geotop? Als Geotope werden Bildungen der unbelebten Natur bezeichnet, die als Fenster in die Erdgeschichte Aufschluss über die Entwicklung unserer Erde und des Lebens geben können.
Was ist eigentlich ein Geotop? Als Geotope werden Bildungen der unbelebten Natur bezeichnet, die als Fenster in die Erdgeschichte Aufschluss über die Entwicklung unserer Erde und des Lebens geben können.
Allgemeine Geologie. Teil 13 Vorlesung SS 2005 Mo, Di, Mi
 Allgemeine Geologie Teil 13 Vorlesung SS 2005 Mo, Di, Mi 8.15 9.00 Transport durch fließendes Wasser a) in Lösung b) in festem Zustand laminares und turbulentes Fließen laminares Fließen Stromlinien kreuzen
Allgemeine Geologie Teil 13 Vorlesung SS 2005 Mo, Di, Mi 8.15 9.00 Transport durch fließendes Wasser a) in Lösung b) in festem Zustand laminares und turbulentes Fließen laminares Fließen Stromlinien kreuzen
. Die quartären Eifelvulkanfelder
 20 Die quartären Eifelvulkanfelder. Die quartären Eifelvulkanfelder»In Coblenz hielt ich mich nicht länger als einen halben Tag auf. Als ich die Straßen dieser Stadt betrachtete, schien es mir, als wenn
20 Die quartären Eifelvulkanfelder. Die quartären Eifelvulkanfelder»In Coblenz hielt ich mich nicht länger als einen halben Tag auf. Als ich die Straßen dieser Stadt betrachtete, schien es mir, als wenn
Stationenlernen am Ostufer des Laacher Sees - Lösungen. Station 2: Erste scharfe Linkskurve nach 2 Gehminuten
 Stationenlernen am Ostufer des Laacher Sees - Lösungen Auf diesem Lösungsblatt findest du die Antworten auf die meisten dir gestellten Fragen. Was du nicht beantworten kannst, solltet ihr anschließend
Stationenlernen am Ostufer des Laacher Sees - Lösungen Auf diesem Lösungsblatt findest du die Antworten auf die meisten dir gestellten Fragen. Was du nicht beantworten kannst, solltet ihr anschließend
Protokoll der Exkursion am 24.5.2001
 Eberhard-Karls-Universität Tübingen Geographisches Institut Proseminar Geomorphologie Sommersemester 2001 Dozent: PD Dr. H. Borger Tobias Spaltenberger 9.6.2001 Protokoll der Exkursion am 24.5.2001 Standort
Eberhard-Karls-Universität Tübingen Geographisches Institut Proseminar Geomorphologie Sommersemester 2001 Dozent: PD Dr. H. Borger Tobias Spaltenberger 9.6.2001 Protokoll der Exkursion am 24.5.2001 Standort
7. Artikel: Die Eifel nach einer kosmischen Katastrophe
 7. Artikel: Die Eifel nach einer kosmischen Katastrophe Nach den sechs Schriften, die aus der Betrachtung der Eifel und ihrer wahrscheinlichen Mitgestaltung durch Einschläge von Teilen eines um 10000 Jahre
7. Artikel: Die Eifel nach einer kosmischen Katastrophe Nach den sechs Schriften, die aus der Betrachtung der Eifel und ihrer wahrscheinlichen Mitgestaltung durch Einschläge von Teilen eines um 10000 Jahre
BARUTHS HEISSE VERGANGENHEIT VULKANE VOR DER HAUSTÜR
 VULKANE VOR DER HAUSTÜR 1 Wartha Guttau Kleinsaubernitz Buchwalde www.knopek-clauss.de Die fünf Vulkane in der Umgebung von Baruth. Ocker: die Maare von Kleinsaubernitz, Buchwalde und Baruth; Braun: die
VULKANE VOR DER HAUSTÜR 1 Wartha Guttau Kleinsaubernitz Buchwalde www.knopek-clauss.de Die fünf Vulkane in der Umgebung von Baruth. Ocker: die Maare von Kleinsaubernitz, Buchwalde und Baruth; Braun: die
die eisbären und der klimawandel
 die eisbären und der klimawandel Hintergrundinformationen für Erwachsene Der Eisbär ist an die harten Umweltbedingungen der Arktis angepasst. Die schnellen Veränderungen der Arktis durch den Klimawandel
die eisbären und der klimawandel Hintergrundinformationen für Erwachsene Der Eisbär ist an die harten Umweltbedingungen der Arktis angepasst. Die schnellen Veränderungen der Arktis durch den Klimawandel
Professur Radiochemie Sommersemester 2009
 Professur Radiochemie Sommersemester 2009 Vorlesung: Umweltchemie Gliederung: 0 Einleitung 0.1 Vorbemerkungen 0.2 Definition Umweltchemie 1 Entstehung der Umwelt 1.1 Bildung der Elemente 1.2 Aufbau der
Professur Radiochemie Sommersemester 2009 Vorlesung: Umweltchemie Gliederung: 0 Einleitung 0.1 Vorbemerkungen 0.2 Definition Umweltchemie 1 Entstehung der Umwelt 1.1 Bildung der Elemente 1.2 Aufbau der
Biologische Meereskunde
 Ulrich Sommer Biologische Meereskunde 2. iiberarbeitete Auflage Mit 138 Abbildungen 4y Springer Inhaltsverzeichnis 1 Einfuhrung ^^/^^^^^^^^i^^g^^gg/^^^^g^^^g^^ggg^ 1.1 Biologische Meereskunde - Meeresokologie
Ulrich Sommer Biologische Meereskunde 2. iiberarbeitete Auflage Mit 138 Abbildungen 4y Springer Inhaltsverzeichnis 1 Einfuhrung ^^/^^^^^^^^i^^g^^gg/^^^^g^^^g^^ggg^ 1.1 Biologische Meereskunde - Meeresokologie
Grundwassermodell. 4.2 Wasserkreislauf. Einführung: Wir alle kennen den Wasserkreislauf:
 4.2 Wasserkreislauf Einführung: Wir alle kennen den Wasserkreislauf: Regen fällt zu Boden... und landet irgendwann irgendwie wieder in einer Wolke, die einen schon nach ein paar Stunden, die anderen erst
4.2 Wasserkreislauf Einführung: Wir alle kennen den Wasserkreislauf: Regen fällt zu Boden... und landet irgendwann irgendwie wieder in einer Wolke, die einen schon nach ein paar Stunden, die anderen erst
6. LEBENS- UND WIRTSCHAFTS- RÄUME DER ERDE
 6. LEBENS- UND WIRTSCHAFTS- RÄUME DER ERDE. Ein Planet für über 6 Milliarden Wie viele Menschen leben auf der Erde und wo leben sie? Es gibt bereits über 6 Milliarden Menschen auf der Erde. Mehr als die
6. LEBENS- UND WIRTSCHAFTS- RÄUME DER ERDE. Ein Planet für über 6 Milliarden Wie viele Menschen leben auf der Erde und wo leben sie? Es gibt bereits über 6 Milliarden Menschen auf der Erde. Mehr als die
weisst du die lösung... körperteile des baumes...
 weisst du die lösung... körperteile des baumes... Welche Körperteile des Baumes kennst Du? Mit welchen menschlichen Körperteilen sind sie vergleichbar? Verbinde die zusammengehörenden Felder mit einem
weisst du die lösung... körperteile des baumes... Welche Körperteile des Baumes kennst Du? Mit welchen menschlichen Körperteilen sind sie vergleichbar? Verbinde die zusammengehörenden Felder mit einem
3, 2, 1 los! Säugetiere starten durch!
 1 3, 2, 1 los! Säugetiere starten durch! Die Vielfalt an Säugetieren ist unglaublich groß. Sie besiedeln fast alle Teile der Erde und fühlen sich in Wüsten, Wasser, Wald und sogar in der Luft wohl. Aber
1 3, 2, 1 los! Säugetiere starten durch! Die Vielfalt an Säugetieren ist unglaublich groß. Sie besiedeln fast alle Teile der Erde und fühlen sich in Wüsten, Wasser, Wald und sogar in der Luft wohl. Aber
Eisbohrkerne - Archive der Klimaforschung
 Universität Leipzig Fakultät für Physik und Geowissenschaften Bereich Didaktik der Physik und Institut für Geophysik und Geologie Eisbohrkerne - Archive der Klimaforschung Masterarbeit im Studiengang Master
Universität Leipzig Fakultät für Physik und Geowissenschaften Bereich Didaktik der Physik und Institut für Geophysik und Geologie Eisbohrkerne - Archive der Klimaforschung Masterarbeit im Studiengang Master
Aspekte der Angewandten Geologie
 Aspekte der Angewandten Geologie Geohydromodellierung Institut für Geowissenschaften Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 2-1 Wo ist das Grundwasser? 2-2 Hier 2-3 d 2-4 Das unterirdische Wasser befindet
Aspekte der Angewandten Geologie Geohydromodellierung Institut für Geowissenschaften Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 2-1 Wo ist das Grundwasser? 2-2 Hier 2-3 d 2-4 Das unterirdische Wasser befindet
Geografie, D. Langhamer. Klimarisiken. Beschreibung des Klimas eines bestimmten Ortes. Räumliche Voraussetzungen erklären Klimaverlauf.
 Klimarisiken Klimaelemente Klimafaktoren Beschreibung des Klimas eines bestimmten Ortes Räumliche Voraussetzungen erklären Klimaverlauf Definitionen Wetter Witterung Klima 1 Abb. 1 Temperaturprofil der
Klimarisiken Klimaelemente Klimafaktoren Beschreibung des Klimas eines bestimmten Ortes Räumliche Voraussetzungen erklären Klimaverlauf Definitionen Wetter Witterung Klima 1 Abb. 1 Temperaturprofil der
Pflanzen. 1.)Unterschied: Monokotyle und Dikotyle
 Pflanzen 1.)Unterschied: Monokotyle und Dikotyle Monokotyle: heißen auch noch Einkeimblättrige. Bei diesen Pflanzen sind die Leitbündel zerstreut angeordnet, das nennt man Anaktostelen. Die Blüte hat die
Pflanzen 1.)Unterschied: Monokotyle und Dikotyle Monokotyle: heißen auch noch Einkeimblättrige. Bei diesen Pflanzen sind die Leitbündel zerstreut angeordnet, das nennt man Anaktostelen. Die Blüte hat die
DOWNLOAD. Vertretungsstunde Biologie 9. 7./8. Klasse: Wechselbeziehungen von Pflanzen und Tieren. Corinna Grün/Cathrin Spellner
 DOWNLOAD Corinna Grün/Cathrin Spellner Vertretungsstunde Biologie 9 7./8. Klasse: Wechselbeziehungen von Pflanzen und Tieren auszug aus dem Originaltitel: Die Pflanzen Lebensgrundlage aller Organismen
DOWNLOAD Corinna Grün/Cathrin Spellner Vertretungsstunde Biologie 9 7./8. Klasse: Wechselbeziehungen von Pflanzen und Tieren auszug aus dem Originaltitel: Die Pflanzen Lebensgrundlage aller Organismen
Die Klimazonen der Erde
 Die Klimazonen der Erde Während wir in Deutschland sehnsüchtig den Frühling erwarten (oder den nächsten Schnee), schwitzen die Australier in der Sonne. Wieder andere Menschen, die in der Nähe des Äquators
Die Klimazonen der Erde Während wir in Deutschland sehnsüchtig den Frühling erwarten (oder den nächsten Schnee), schwitzen die Australier in der Sonne. Wieder andere Menschen, die in der Nähe des Äquators
Vertikutieren richtig gemacht
 Vertikutieren richtig gemacht Hat sich über den Winter Moos und Rasenfilz im Garten breit gemacht? Wenn ja, sollte beides unbedingt entfernt werden, um den Rasen im Frühling wieder ordentlich zum Wachsen
Vertikutieren richtig gemacht Hat sich über den Winter Moos und Rasenfilz im Garten breit gemacht? Wenn ja, sollte beides unbedingt entfernt werden, um den Rasen im Frühling wieder ordentlich zum Wachsen
Ein Stein 100 Fossilien: Erfassung einer paläontologischen Sammlung in digicult
 Ein Stein 100 Fossilien: Erfassung einer paläontologischen Sammlung in digicult Ulrich Kotthoff Universität Hamburg Centrum für Naturkunde Geologisch-Paläontologisches Museum ulrich.kotthoff@uni-hamburg.de
Ein Stein 100 Fossilien: Erfassung einer paläontologischen Sammlung in digicult Ulrich Kotthoff Universität Hamburg Centrum für Naturkunde Geologisch-Paläontologisches Museum ulrich.kotthoff@uni-hamburg.de
Absolute Datierungsmethoden. Dr. Gnoyke, Bi-GK 13.1 Methoden zur Altersbestimmung von Fossilfunden
 Absolute Datierungsmethoden Dr. Gnoyke, Bi-GK 13.1 Methoden zur Altersbestimmung von Fossilfunden Datierungsmethoden Datierungsmethoden relative Datierungsmethoden Absolute Datierungsmethoden z. B. Stratigrafie
Absolute Datierungsmethoden Dr. Gnoyke, Bi-GK 13.1 Methoden zur Altersbestimmung von Fossilfunden Datierungsmethoden Datierungsmethoden relative Datierungsmethoden Absolute Datierungsmethoden z. B. Stratigrafie
Wiese in Leichter Sprache
 Wiese in Leichter Sprache 1 Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern die Natur. Zum Beispiel: Wir bauen Wege und Plätze aus Stein. Wo Stein ist, können Pflanzen nicht wachsen. Tiere
Wiese in Leichter Sprache 1 Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern die Natur. Zum Beispiel: Wir bauen Wege und Plätze aus Stein. Wo Stein ist, können Pflanzen nicht wachsen. Tiere
10. Arbeitstreffen der Amtssachverständigen aus dem Bereich der Grundwasserwirtschaft. 22. und 23. Mai 2013
 Vortragsreihe Hydrogeologie von Wien Wissen für Wien 10. Arbeitstreffen der Amtssachverständigen aus dem Bereich der Grundwasserwirtschaft 22. und 23. Mai 2013 Vortrag Sabine Grupe (WGM): Hydrogeologie
Vortragsreihe Hydrogeologie von Wien Wissen für Wien 10. Arbeitstreffen der Amtssachverständigen aus dem Bereich der Grundwasserwirtschaft 22. und 23. Mai 2013 Vortrag Sabine Grupe (WGM): Hydrogeologie
Mineralogische, geochemische und farbmetrische Untersuchungen an den Bankkalken des Malm 5 im Treuchtlinger Revier
 Erlanger Beitr.Petr. Min. 2 15-34 9 Abb., 5 Tab. Erlangen 1992 Mineralogische, geochemische und farbmetrische Untersuchungen an den Bankkalken des Malm 5 im Treuchtlinger Revier Von Frank Engelbrecht *)
Erlanger Beitr.Petr. Min. 2 15-34 9 Abb., 5 Tab. Erlangen 1992 Mineralogische, geochemische und farbmetrische Untersuchungen an den Bankkalken des Malm 5 im Treuchtlinger Revier Von Frank Engelbrecht *)
Subtropische Wälder. Eine Studie zur Streuproduktion und Zersetzung in subtropischen, montanen Araukarienwäldern
 Subtropische Wälder Eine Studie zur Streuproduktion und Zersetzung in subtropischen, montanen Araukarienwäldern 17.12.2009 Ökoregionen und Makroökologie im Wintersemster 2009/10 Dr. Holger Schulz Inhaltliche
Subtropische Wälder Eine Studie zur Streuproduktion und Zersetzung in subtropischen, montanen Araukarienwäldern 17.12.2009 Ökoregionen und Makroökologie im Wintersemster 2009/10 Dr. Holger Schulz Inhaltliche
Kontinentaldrift Abb. 1
 Kontinentaldrift Ausgehend von der Beobachtung, dass die Formen der Kontinentalränder Afrikas und Südamerikas fast perfekt zusammenpassen, entwickelte Alfred Wegener zu Beginn des 20. Jahrhunderts die
Kontinentaldrift Ausgehend von der Beobachtung, dass die Formen der Kontinentalränder Afrikas und Südamerikas fast perfekt zusammenpassen, entwickelte Alfred Wegener zu Beginn des 20. Jahrhunderts die
Biodiversität im Siedlungsraum: Zustand und Potenziale
 Biodiversität im Siedlungsraum: Zustand und Potenziale Manuela Di Giulio Natur Umwelt Wissen GmbH Siedlungen: Himmel oder Hölle? Wirkungsmechanismen unklar, Aussagen teilweise widersprüchlich Methodische
Biodiversität im Siedlungsraum: Zustand und Potenziale Manuela Di Giulio Natur Umwelt Wissen GmbH Siedlungen: Himmel oder Hölle? Wirkungsmechanismen unklar, Aussagen teilweise widersprüchlich Methodische
Einführung in die Geologie
 Einführung in die Geologie Teil 4: Minerale - Baustoffe der Gesteine Prof. Dr. Rolf Bracke International Geothermal Centre Lennershofstraße 140 44801 Bochum Übersicht Definition der Minerale Minerale und
Einführung in die Geologie Teil 4: Minerale - Baustoffe der Gesteine Prof. Dr. Rolf Bracke International Geothermal Centre Lennershofstraße 140 44801 Bochum Übersicht Definition der Minerale Minerale und
Das sind vielleicht Zustände!
 1 Das sind vielleicht Zustände! Wasser ist der einzige Stoff auf unserem Planeten, der in drei verschiedenen Formen, sogenannten Aggregatszuständen, vorkommt: fest, flüssig und gasförmig. Das heißt, Wasser
1 Das sind vielleicht Zustände! Wasser ist der einzige Stoff auf unserem Planeten, der in drei verschiedenen Formen, sogenannten Aggregatszuständen, vorkommt: fest, flüssig und gasförmig. Das heißt, Wasser
Einführung in die Geologie
 Einführung in die Geologie Teil 9: Sedimente und Sedimentgesteine Prof. Dr. Rolf Bracke Hochschule Bochum International Geothermal Centre Lennershofstraße 140 44801 Bochum Übersicht Sedimente und Sedimentgesteine
Einführung in die Geologie Teil 9: Sedimente und Sedimentgesteine Prof. Dr. Rolf Bracke Hochschule Bochum International Geothermal Centre Lennershofstraße 140 44801 Bochum Übersicht Sedimente und Sedimentgesteine
Seminar: Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft oder der Wille zum Sozialen
 Herbstsemester 2014 Peter-Ulrich Merz-Benz Seminar: Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft oder der Wille zum Sozialen Mi 10:15-12:00 Programm 17. September 2014: Einführung/Vorstellung des Programms
Herbstsemester 2014 Peter-Ulrich Merz-Benz Seminar: Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft oder der Wille zum Sozialen Mi 10:15-12:00 Programm 17. September 2014: Einführung/Vorstellung des Programms
Die Masse der Milchstraße [28. März] Die Milchstraße [1] besteht ganz grob aus drei Bereichen (Abb. 1):
![Die Masse der Milchstraße [28. März] Die Milchstraße [1] besteht ganz grob aus drei Bereichen (Abb. 1): Die Masse der Milchstraße [28. März] Die Milchstraße [1] besteht ganz grob aus drei Bereichen (Abb. 1):](/thumbs/55/37824085.jpg) Die Masse der Milchstraße [28. März] Die Milchstraße [1] besteht ganz grob aus drei Bereichen (Abb. 1): (a) dem Halo [1], der die Galaxis [1] wie eine Hülle umgibt; er besteht vorwiegend aus alten Sternen,
Die Masse der Milchstraße [28. März] Die Milchstraße [1] besteht ganz grob aus drei Bereichen (Abb. 1): (a) dem Halo [1], der die Galaxis [1] wie eine Hülle umgibt; er besteht vorwiegend aus alten Sternen,
Unterscheidung von Bodentypen Bodenprofil. Grundversuch 45 min S
 Bodentypen bestimmen Kurzinformation Um was geht es? Durch das Zusammenwirken von Niederschlag, Grundwasser und Temperatur und Ausgangsgestein sind Böden mit übereinstimmenden oder ähnlichen Merkmalen
Bodentypen bestimmen Kurzinformation Um was geht es? Durch das Zusammenwirken von Niederschlag, Grundwasser und Temperatur und Ausgangsgestein sind Böden mit übereinstimmenden oder ähnlichen Merkmalen
Pflanzenschutzdienst Hessen.
 Regierungspräsidium Gießen Pflanzenschutzdienst Hessen www.pflanzenschutzdienst.rp-giessen.de Erläuterungen zu Abstandsauflagen NW 605, 606, 607, 609 Regierungspräsidium Giessen, Dez. 51.4 -Pflanzenschutzdiensteberhard.cramer@rpgi.hessen.de
Regierungspräsidium Gießen Pflanzenschutzdienst Hessen www.pflanzenschutzdienst.rp-giessen.de Erläuterungen zu Abstandsauflagen NW 605, 606, 607, 609 Regierungspräsidium Giessen, Dez. 51.4 -Pflanzenschutzdiensteberhard.cramer@rpgi.hessen.de
SEDIMENTE UND SEDIMENTGESTEINE
 SEDIMENTE UND SEDIMENTGESTEINE Praktische Bedeutung Sedimente stellen die wichtigsten Reservoire für fossile Energieträger (Kohlenwasserstoffe, Kohle) und Wasser dar. Wichtige Erzlagerstätten metallischer
SEDIMENTE UND SEDIMENTGESTEINE Praktische Bedeutung Sedimente stellen die wichtigsten Reservoire für fossile Energieträger (Kohlenwasserstoffe, Kohle) und Wasser dar. Wichtige Erzlagerstätten metallischer
Geotop Lange Wand bei Ilfeld
 Geotop bei Ilfeld n zum Vorschlag zur Aufnahme in die Liste der bedeutendsten Geotope Deutschlands 1. Geotop bei Ilfeld Am Grunde des Zechsteinmeeres: Beschreibung des Geotops Aufschluß 2. Kurzbeschreibung
Geotop bei Ilfeld n zum Vorschlag zur Aufnahme in die Liste der bedeutendsten Geotope Deutschlands 1. Geotop bei Ilfeld Am Grunde des Zechsteinmeeres: Beschreibung des Geotops Aufschluß 2. Kurzbeschreibung
