Einfluss des Sulfat- und Bindemittelgehalts auf das Ettringittreiben in Zusammenhang mit Bodenbehandlungen
|
|
|
- Carl Kristian Brandt
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Einfluss des Sulfat- und Bindemittelgehalts auf das Ettringittreiben in Zusammenhang mit Bodenbehandlungen J. Knopp, Universität Stuttgart, Institut für Geotechnik Bei der Behandlung sulfathaltiger Böden mit calciumbasierten Bindemitteln ist es weltweit im Erd- und Straßenbau wiederholt zu Schadensfällen durch Ettringittreiben gekommen. Durch die Bindemittelbehandlung wird im Boden der ph-wert erhöht, wodurch Silikate und Aluminate aus der Tonfraktion freigesetzt werden. Die vorhandenen Sulfate im Porenwasser reagieren mit den freigesetzten Aluminaten und dem freien Calcium aus dem Bindemittel und es kommt zur Bildung von Mineralen aus der Gruppe der Ettringite, die einen hohen Kristallwasseranteil haben, sehr voluminös und leicht sind und somit zu schädigenden Quellhebungen führen können. Für die Reaktion des Sulfattreibens im Boden sind zwar Einflussfaktoren bekannt, quantitative Prüfmethoden und standardisierte Strategien zur Gefahrenabwehr liegen derzeit allerdings noch nicht vor. In dem hier vorgestellten Forschungsvorhaben wurden kritische Einflussgrößen für die Ettringitbildung mit dem Ziel untersucht, Grundlagen für die Entwicklung einer praxistauglichen Prüfvorschrift zu erarbeiten. Im bodenmechanischen Labor des Instituts für Geotechnik der Universität Stuttgart wurden an Proben aus verschiedenen Boden-Bindemittelgemischen und mit definierten Sulfatgehalten Quellhebungsversuche durchgeführt. Im Ergebnis wurde ein Zusammenhang zwischen dem Sulfatgehalt im Boden und den eingetretenen Quellhebungen festgestellt. Des Weiteren wurde ermittelt, dass eine Bodenbehandlung mit Weißfeinkalk mit größeren Quellhebungen verbunden ist als eine Behandlung mit Zement. Auch der Einfluss des Bindemittelgehalts wurde näher untersucht. 1. Einleitung Im Straßenbau kommt es durch die Behandlung sulfathaltiger Böden mit calciumbasierten Bindemitteln immer wieder zu Schadensfällen durch Sulfattreiben. Durch die Bindemittelbehandlung wird im Boden der ph-wert erhöht, wodurch Silikate und Aluminate aus den Tonmineralen und z.t. aus dem Bindemittel selbst freigesetzt werden. Die aus dem Boden gelösten Sulfate im Porenwasser können mit den freigesetzten Aluminaten und dem freien Calcium aus dem Bindemittel reagieren, so dass es zur Bildung von Mineralen aus der Gruppe der Ettringite kommt. Durch den hohen Kristallwasseranteil von etwa 46 M.-% ist Ettringit sehr voluminös und leicht und kann bei Neubildung im Boden somit zu schädigenden Quellhebungen führen. Ein Beispiel für einen Schadensfall infolge von Ettringittreiben ist der im Jahre 1995 hergestellte Autobahnzubringer K1077 der Bundesautobahn A81 bei Gärtringen, Herrenberg. Im ersten von zwei Bauabschnitten traten bereits im Jahr nach der Fertigstellung Schäden auf. Es handelte sich um Hebungen des Baugrunds um bis zu 30 cm und Längsrisse in der Asphaltdecke von einer Länge bis zu 6 m bei einer Breite von ca. 2 cm (Keller et al., 2002). Ein aktuelleres Beispiel ist die Bundesautobahn A71 (nördlich B85 AS Sömmerda-Ost). Nach dem Winter 2013/2014 traten an den im Herbst 2013 verbesserten Planien und Dammböschungen Schäden auf. Die Dämme waren im Sommer und Herbst 2013 fast vollständig aus dem Abtrag geschüttet worden. Die Böden sind aus dem Bereich des Mittleren und Unteren Gipskeupers. In der Planung der Baumaßnahme wurden umfangreiche experimentelle Untersuchungen durchgeführt, da bereits bei früheren Teilabschnitten Schäden aufgetreten waren (Hecht & Krings, 2009), (Hecht, 2010). Die experimentellen Untersuchungen ließen mit dem eingesetzten Bindemittel nur ein geringes Quellpotential vermuten. Die äußere Zone der Dammböschungen und das Planum wurden daraufhin im Herbst 2013 mit einem Hochofenzement mit hohem Sulfatwiderstand behandelt. Das Planum wurde mit einer 15
2 16 Schutzlage aus Frostschutzmaterial überschüttet. Im Frühjahr 2014 wurde an fertiggestellten und überschütteten Planien eine Aufl ockerung mit einem Verlust der Festigkeit und der Tragfähigkeit festgestellt (DEGES, 2014). Für die Reaktion des Sulfattreibens im Boden sind die Einfl ussfaktoren zwar bekannt, allerdings steht der Baupraxis kein standardisiertes Prüfverfahren mit eindeutig defi nierten Kenngrößen zur Verfügung. Das Ziel der im Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) ausgeführten Forschungsvorhabens Kenngrößen zur Risikoabschätzung des Ettringittreibens war die Entwicklung eines praxistauglichen Prüfverfahrens als Grundlage für eine hieraus abzuleitende Prüfvorschrift (Moormann et al., 2014). Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurde vorwiegend der Einfl uss des Sulfatgehalts und der Bindemittelart untersucht. Im Anschluss an das zuvor genannte Forschungsvorhaben werden am Institut für Geotechnik, der Universität Stuttgart weiterführende Untersuchungen u. a. zum Einfl uss des Bindemittelgehalts durchgeführt. 2. Einflüsse auf die Ettringitbildung Aus der Literatur sind unterschiedliche, für eine Ettringitneubildung in bindemittelverbesserten Böden maßgebende Einfl ussfaktoren bekannt: Tonmineralbestand: Die Verfügbarkeit bestimmter Minerale beeinfl usst, ob und in welchem Umfang die Treibreaktion stattfi nden kann. Hierbei ist der für Sulfattreiben bei einer Bodenbehandlung mit calciumbasierten Bindemitteln als kritisch zu bezeichnenden Sulfatgehalt stets vom Anteil, der Art und der Verteilung der im Boden vorhandenen Tonmineralen abhängig. Bindemittel führen im Boden zu einer Erhöhung des ph-werts. Dadurch erhöht sich die Löslichkeit von Silikaten und Aluminaten in der Tonfraktion. Silikatund Aluminiumionen werden freigesetzt und stehen zur Ettringitbildung zur Verfügung. Tendenziell sinkt der kritische Sulfatgehalt eines Bodens mit zunehmendem Tonanteil und kaolinitische (nicht quellfähige) bindige Böden haben gegenüber smectitischen (quellfähige) Böden einen größeren Bestand an Aluminaten und somit unter ansonsten gleichen Bedingungen ein höheres Potential für schädigenden Ettringitaufwuchs (Witt, 2012). Sulfatgehalt: Der deutschsprachigen Literatur (Witt, 2012) ist zu entnehmen, dass Sulfatgehalte im Boden ab ppm potentiell schädigungsrelevant sind. Eine hohe Gefährdung ist aber erst ab einem Sulfatgehalt von größer ppm anzunehmen. Diese Grenzwerte werden auch in der Technischen Vorschrift des Texas Department of Transportation (2005) und in der UNI EN angegeben. Little et al. (2010) und Petry & Little (1992) geben an, dass bereits ein Sulfatgehalt von ppm potentiell schädigungsrelevant ist. Wasserangebot: Voraussetzung für die Treibreaktion ist, dass vorhandene Sulfate in Lösung gehen. Hierfür und für den weiteren Transport des Sulfats muss ausreichend Wasser verfügbar sein (Witt, 2012). Zudem hat Ettringit einen sehr hohen Kristallwasseranteil von etwa 46 M. %. Für die Bildung des Minerals muss ausreichend Wasser vorhanden sein. Chemisches Milieu/Alkalität: Sulfattreiben fi ndet nur in einem alkalischen Milieu statt. Die Bindemittelzugabe hat im Boden eine starke Erhöhung der Alkalität zur Folge. Bei einem ph-wert > 10,5 werden Aluminat- und Silikationen aus den Tonmineralen des Bodens freigesetzt und stehen für die Treibreaktion zur Verfügung (Witt, 2012). Durch die Bodenbehandlung mit calciumbasierten Bindemitteln ist das für das Sulfattreiben erforderliche alkalische Milieu im Allgemeinen immer realisiert. Temperatur: In der Literatur wird vermutet, dass die Bodentemperatur einen starken Einfl uss auf den Reaktionsmechanismus hat. Zur Ettringitbildung ist nach Witt (2012) eine Temperatur kleiner 20 C notwendig.
3 Vor allem Bodentemperaturen zwischen 10 C und 20 C werden von Witt (2012) als günstig für die Ettringitbildung genannt. Porenstruktur des Bodens: Ein zusammenhängendes Porensystem begünstigt den konvektiven Transport sulfathaltiger Lösungen durch das Bodengerüst. Da die schädigende Volumenzunahme infolge Ettringitaufwuchs aber in den Bodenporen stattfi ndet, kann eine gute Verdichtung des Bodens und damit eine Reduzierung der Porengröße die Quellgefährdung erhöhen (Witt, 2012). Bindemittel: Besonders kritisch erscheint nach Keller et al. (2002) die Bodenbehandlung mit Weißfeinkalk von verwitterten, gipshaltigen Böden. Wird stattdessen Zement als Bindemittel verwendet, verringert sich das Schadensrisiko. Die Phasenneubildung erfolgt bei einer Behandlung mit Zement zwar schneller, da im Gegensatz zu einer Behandlung mit Kalk die notwendigen Aluminate aus den reaktiven Calciumaluminaten aus dem Zement sofort zu Verfügung stehen, allerdings entwickeln sich deutlich geringere Ettringitgehalte als bei Weißfeinkalk. Überlagerungsdruck: Bei einer behinderten Volumendehnung entstehen beim Ettringittreiben sehr hohe Quelldrücke (bis ca. 5 MPa). Bei im Straßenbau üblichen Überlagerungsdrücken können daher die Quellhebungen nicht überdrückt werden (Keller et al., 2002). 3. Quellhebungsversuche Am Institut für Geotechnik der Universität Stuttgart wurde das Quellverhalten in Abhängigkeit vom Sulfatgehalt mit Pulverquellversuchen nach Thuro (1993) in Oedometerversuchsständen untersucht. Insgesamt wurden für die Versuchsreihe, sowohl im Rahmen des durch die BASt geförderten Forschungsvorhabens (Moormann et al., 2014), als auch für die weiterführenden Versuche, zwei natürlich sulfathaltige und zwei sulfatfreie Böden verwendet. Als Versuchsböden wurden geeignete Böden und Halbfestgesteine ausgewählt, die in Süddeutschland häufi g angetroffen bzw. bei Straßenbaumaßnahmen eingesetzt werden. Im Folgenden wird exemplarisch auf zwei Probenmaterialien eingegangen. Das Probenmaterial WTF3 ist ein Gestein aus dem Wagenburgtunnel in Stuttgart. Es wurde in einem geologischen Fenster oberhalb des Gipshorizontes gewonnen und ist ausgelaugt, enthält also weder Gips noch Anhydrit. Das Material besteht zum Großteil aus Illit (44 %), quellfähigen Tonmineralen (23 %) und Dolomit (18 %). Außerdem wurde Calcit (6 %), Quarz (6 %) und Kaolinit (1 %) festgestellt. Das Probenmaterial GBET ist ein gipshaltiger, gemischtkörniger Verwitterungsboden der Bodengruppe SU (nach DIN 18196) aus einem Steinbruch bei Epfendorf-Trichtingen. Das Material hat einen natürlichen Sulfatgehalt; es wurden ca. 8 % Gips nachgewiesen. Zudem enthält das Material vor allem Dolomit (54 %) und Illit (25 %). Daneben wurden Anteile quellfähiger Tonminerale (2 %), Kaolinit (2 %), Quarz (4 %) und Calcite (2 %) festgestellt. Zur Untersuchung des Einfl uss des Sulfatgehalts wurde den beiden Probenmaterialien ohne natürlichen Sulfatgehalt Sulfat in vier Stufen zwischen 0 und ppm hinzugegeben und die Bindemittelzugabemenge mit 4 M.-% konstant gehalten. Bei den beiden Probenmaterialien mit natürlichem Sulfatgehalt wurden Versuche mit 4 M.-% Bindemittel und ohne Bindemittelzugabe als Referenzversuche durchgeführt (Moormann et al., 2014). Zur Untersuchung des Einfl usses des Bindemittelgehalts wurden Untersuchungen mit einer variierten Bindemittelzugabe zwischen 2 und 8 M.-% bei gleichzeitig variierten Sulfatgehalt am natürlich sulfatfreien Probenmaterial und natürlichem Sulfatgehalt am natürlich sulfathaltigen Probenmaterial durchgeführt. Durchgeführt wurden Pulverquellhebungsversuche, da es so zum einen möglich war, das Bodenmaterial mit den Zugabestoffen homogenisiert einzubauen und zum anderen die Versuchszeit bei Pulverquellversuchen aufgrund der hohen spezifi schen Oberfl ächen deutlich geringer ist. Die Versuchsböden wurden dafür schonend bei 60 C im Ofen 17
4 18 getrocknet und anschließend zu einem Pulver mit einer Korngröße < 0,5 mm aufbereitet. Das pulverisierte Versuchsmaterial wurde dann homogen mit Bindemittel und bei den Versuchsböden ohne geogenen Sulfatgehalt zusätzlich mit Calciumsulfat- Dihydrat vermengt. Anschließend wurde die Mischung mittels einer hydraulischen Presse in einen Oedometerring gepresst. Die Probe wurde dann in den Versuchsstand eingebaut und durch Zugabe von demineralisiertem Wasser der Quellprozess eingeleitet (Moormann et al., 2014). Während der Versuche wurde die Temperatur im Labor konstant auf +18 C gehalten. Verdunstetes Wasser wurde ausgeglichen. Sobald die Prüfkörper mit dem Wasser in Berührung kommen, setzen bei Pulverquellhebungsversuchen starke Volumendehnungen ein, die auf eine Wasseranlagerung an Ionen bzw. Körnern zurückzuführen sind (Thuro, 1993), (Rauh & Thuro, 2007) Diese in der Literatur als Hydratationseffekte bezeichneten Volumendehnungen überlagern anfangs die Quellvorgänge infolge von Mineralreaktionen. Nachdem dieser initiale Hebungsprozess abgeschlossen ist, tritt bei den Versuchen mit Bindemittel- bzw. Sulfatzugabe nach einer Stagnation von einigen Stunden eine weitere Volumenzunahme ein, die auf die Kristallisation von Ettringitmineralien zurückgeführt werden kann. Bei den Referenzproben sind diese sekundären Volumendehnungen nicht aufgetreten. Für die weiteren Auswertungen wurde anhand von Kurvenanpassungen an die Messwerte der einzelnen Versuche die Voluemndehnung infolge der Ettringitbildung ermittelt. Hierfür wurde sowohl der Hydratationseffekt als auch die Ettringitbildung durch eine exponentielle Annäherung wie folgt beschrieben Gl. 1 vol,hyd entspricht hierbei dem Betrag der Quelldehnung infolge Hydratation, vol,ett dem Betrag der Quelldehnung infolge Ettringitneubildung für t. Der Zeitparameter gibt allgemein den Zeitraum an, den ein exponentiell ansteigender Prozess benötigt, um auf 63,2 % seines Endwertes anzusteigen (Moormann et al., 2014). Eine typische zeitabhängige Entwicklung der Volumendehnungen mit Kurvenanpassung an die Messwerte ist in Bild 1 dargestellt. Bild 1. Zeitabhängige Entwicklung der Volumendeh-nungen am Beispiel einer Probe aus Probenmaterial WTF3 mit 4 % Weißfeinkalk und ppm Sulfat. Kurvenanpassung an Gleichung 1 (Moormann et al., 2014). 4. Versuchsergebnisse 4.1. Einfl uss des Sulfatgehalts Unabhängig von der Bodenart wurde sowohl bei den Materialien mit natürlichem Sulfatgehalt als auch bei den Materialien mit künstlich hinzugegeben Sulfatgehalt ein Zusammenhang zwischen dem Sulfatgehalt und der Volumendehnung infolge Ettringitbildung festgestellt. Umso höher die Sulfatgehalte waren, desto größere Volumendehnungen wurden gemessen (Bild 2) (Moormann et al., 2014). Zunächst wurde vermutet, dass die Dehnungen linear vom Sulfatgehalt abhängen. In Anschluss an das BASt-Forschungsvorhaben wurden Versuche mit geringen Sulfatgehalten von und ppm durchgeführt, um den vermuteten linearen Zusammenhang näher zu untersuchen. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass sich die Abhängigkeit der Dehnungen vom Sulfatgehalt nicht durch ein lineares Wachstum beschreiben lässt (Bild 3) (Knopp & Moormann, 2016).
5 4.3. Einfl uss der Bindemittelgehalts Nach Abschluss des BASt-Forschungsvorhabens wurde am Institut für Geotechnik, der Universität Stuttgart (IGS) ergänzend der Einfl uss des Bindemittelgehalts am Beispiel des natürlich sulfatfreien Materials WTF3 mit Zugabe eines Portlandzements CEM I 32,5 R in Mengen von 4 M.-%, 6 M.-% und 8 M.-% untersucht. Zugegeben wurden Sulfatgehalte von 0 bis ppm. Die Ergebnisse sind in Bild 4 dargestellt. Bild 2. Material WTF3. Dehnungen infolge Ettringitbildung in Abhängigkeit des Sulfatgehalts. (WFK: Weißfeinkalk) (Moormann et al., 2014). Bild 4. Probenmaterial WTF3, Zugabe CEM I 32,5 R. Volumendehnungen infolge Ettringitneubildung in Abhängigkeit vom Bindemittelgehalt (Moormann et al., 2016). Bild 3. Probenmaterial WTF3, zementbehandelt (4 % CEM I 32,5 R). Dehnungen infolge Ettringitbildung in Abhängigkeit vom Sulfatgehalt (Knopp & Moormann, 2016) Einfl uss der Bindemittelart Für alle Probenmaterialien konnten im Rahmen des BASt-Forschungsprojektes (Moormann et al., 2014) die Beobachtung von Keller et al. (2002) bestätigt werden, wonach die Behandlung von verwitterten, gipshaltigen Böden mit Weißfeinkalk kritischer als diejenige mit Zement ist, da größere Volumendehnungsbeträge gemessen wurden (Bild 2). Für einen Sulfatgehalt von ppm wurden bei Verwendung von Portlandzement Volumendehnungen bis maximal 2 % (Bild 2) festgestellt. Bei einer Stabilisierung mit Weißfeinkalk zeigten sich hingegen bereits bei einem Sulfatgehalt von ppm Volumendehnungen infolge Ettringittreibens von 5 % bis 7 % (Bild 2). Im Bereich kleiner Sulfatgehalte (bis ppm) ist kein Einfl uss des Bindemittelgehalts erkennbar. Vermutlich wird hier das zur Verfügung stehende Sulfat bereits bei 4 % Zementzugabe aufgebraucht, so dass größere Zementmengen nicht zu mehr Volumendehnungen führen können. Erst ab einem Sulfatgehalt von > ppm wurden Unterschiede festgestellt. Die größten Volumendehnungen werden bei Verwendung von 6 % Zement erreicht, die geringsten bei 4 %. Die Ergebnisse mit 8 % liegen dazwischen. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass bei 6 % Zement bereits alles für eine Reaktion zur Verfügung stehende Sulfat aufgebraucht wird und höhere Zementzugaben aufgrund einer stabilisierenden Wirkung zu weniger Volumendehnungen führen. Hier müssen aber weitere Versuche mit höheren Sulfatgehalten und weiteren Bindemittelgehalten durchgeführt werden (Moormann et al., 2016). 19
6 20 5. Grundlagen für eine Prüfvorschrift Ziel der Forschungsarbeit ist die Entwicklung eines praxistauglichen Prüfverfahrens als Grundlage für eine hieraus abzuleitende Prüfvorschrift. Untersucht wurde bislang neben dem Einfl uss des Sulfatgehalts, der Einfl uss des Bindemittelgehalts und der Bindemittelart Kritische Einfl ussgrößen Es konnte die Beobachtung von Keller et al. (2002) bestätigt werden, dass eine Bodenbehandlung mit Weißfeinkalk mit größeren Volumendehnungen verbunden ist als eine Behandlung mit Zement und eine Verwendung von Zement daher das Schadensrisiko verringern kann. Es ist daher zu empfehlen, in Böden mit einem kritischen Sulfatgehalt auf eine Bindemittelbehandlung mit Weißfeinkalk generell zu verzichten. Aus den Ergebnissen der Versuche an den beiden natürlich sulfatfreien Materialien wurden für eine erste Abschätzung der infolge Ettringitbildung zu erwartenden Dehnungen in Abhängigkeit des Sulfatgehalts des behandelten Bodens die in den Bildern 5 und 6 angegebenen Bandbreiten ermittelt. Bild 6. gemittelte Volumendehnungen in Abhängigkeit des Sulfatgehalts zur Risikobewertung für kalkbehandelte Böden (4 % Weißfeinkalk) (Moormann et al., 2014). Zur Ermittlung der Bandbreiten wurden die in den Versuchen gemessenen Volumendehnungen für die untersuchten Materialien in Abhängigkeit der Bindemittelart gemittelt. Zu beachten ist, dass der kritische Sulfatgehalt stark materialabhängig ist, wodurch die teilweise recht hohen Bandbreiten in den Bildern 5 und 6 entstehen. Ob ein geringes, mittleres oder hohes Risiko besteht, muss in Abhängigkeit der Anwendung jeweils entschieden werden. Die hier angegebenen Grenzen wurden als Vorschlag angegeben, für den Fall, dass ab 5 % Volumendehnungen ein mittleres bis hohes Risiko für Schäden an Bauwerken besteht Prüfverfahren zur Risikoabschätzung Bild 5. gemittelte Volumendehnungen in Abhängigkeit des Sulfatgehalts zur Risikobewertung für zementbehandelte Böden (4 % CEM I 32,5 R) (Moormann et al., 2014). Zur Abschätzung des Schadensrisikos wurde ein Ablaufplan (Bild 7) ermittelt. Für eine erste grobe Abschätzung der Quellgefährdung kann mittels Feldversuchen qualitativ bestimmt werden, ob ein Boden sulfathaltig ist. Eine Zusammenfassung möglicher Feldversuche fi ndet sich in einer Studie aus den USA (Harris, 2002). Vorgeschlagen wird hier u. a., die elektrische Leitfähigkeit des Bodensättigungsextraktes zu messen, einen Aceton- oder Bariumchlorid-Test durchzuführen oder den Sulfi dgehalt zu bestimmen. Zudem geben die stratigraphische Einordnung der jeweiligen Baugrundschichten und die geotechnische Erkundung bereits deutliche
7 Hinweise auf einen möglichen Sulfatgehalt. Die Versuche wurden im Rahmen des beschriebenen Forschungsvorhabens nicht untersucht und können daher nicht bewertet werden. Mittels mineralogischer Untersuchungen (z. B. röntgendiffraktometrische Messung) ist es möglich, den Sulfatträger und den Mengenanteil im Boden zu bestimmen. Für Reihenuntersuchungen von Baugrundproben sind mineralogische Verfahren allerdings nicht geeignet, da sie sehr aufwändig sind. Hier empfehlen sich chemische Analysen. Anhand der Bilder 5 und 6 kann in Abhängigkeit der Anwendung eine erste Risikobeurteilung durchgeführt werden. Muss von einer mittleren bis hohen Gefährdung ausgegangen werden, so empfehlen sich für eine fundierte Prognose Pulverquellhebungsversuche an Proben des Boden-Bindemittelgemischs. Bild 7. Ablaufplan zur Abschätzung des Schadensrisikos (Moormann et al., 2014). 6. Zusammenfassung Es wurden Einfl ussgrößen für die Ettringitbildung mit dem Ziel untersucht, Grundlagen für die Entwicklung einer praxistauglichen Prüfvorschrift zu erarbeiten. Als Einfl ussfaktoren die eine Ettringitneubildung begünstigen sind insbesondere der Mineralbestand, das Wasserangebot, das chemische Milieu, die Temperatur, die Porenstruktur, die Bindemittelart und der Überlagerungsdruck als wesentliche Einfl ussfaktoren aus der Literatur bekannt. Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde das Quellverhalten an Materialien mit natürlichem Sulfatgehalt (hier beispielhaft das Probenmaterial GBET) und ohne einen natürlichen Sulfatgehalt (hier beispielhaft das Probenmaterial WTF3) untersucht. Es wurde festgestellt, dass ein Zusammenhang zwischen dem Sulfatgehalt und der Dehnung infolge Ettringitbildung besteht. Für eine Abschätzung der in Abhängigkeit vom Sulfatgehalt und eingesetzten Bindemittel zu erwartenden Hebungen wurden die in den Bildern 5 und 6 dargestellten Kenngrößen als Richtwerte abgeleitet. Der kritische Sulfatgehalt ist zum einen stark materialabhängig und wird zum anderen durch die Wahl des Bindemittels beeinfl usst. Es konnte validiert werden, dass eine Bindemittelbehandlung mit Weißfeinkalk ungünstiger ist als eine Behandlung mit Portlandzement, da sowohl bei den natürlich sulfatfreien, als auch bei den natürlich sulfathaltigen Materialien bei Verwendung von Weißfeinkalk größere Volumendehnung eintraten. Im Bereich geringer Sulfatgehalte (3.000 und ppm) wurde kein Einfl uss des Bindemittelgehalts festgestellt. Erst ab Sulfatgehalten > ppm konnten Unterschiede festgestellt werden. Als Prüfverfahren zur Ermittlung des Quellpotentials und zur Abschätzung des Schadensrisikos wurde ein Ablaufplan (Bild 7) vorgeschlagen. Im Rahmen des vorgestellten Forschungsvorhabens konnten bisher nur einige wesentliche der vielen Randbedingungen, die die Kristallisation von Ettringitmineralen begünstigen, untersucht werden. Hinsichtlich des Einfl usses bestimmender Faktoren wie z. B. der Porenstruktur, des Verdichtungsgrades, der Umgebungstemperatur, des Bindemittelgehalts, des Dolomit-Gehalts, des Einfl usses von Frost-Tau-Wechseln und auch hinsichtlich der Anwendbarkeit der Indexversuche zur qualitativen Sulfatbestimmung im Feld, besteht weiterer Forschungsbedarf. 21
8 22 7. Literatur DEGES (2014). A71 AS Sömmerda Ost, provisorische Anbindung B85, Verformung und Risse im Erdkörper. Präsentation der DEGES bei der Pressekonferenz zur A71 im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft. Guidelines for Treatment of Sulfate Rich Soils and Bases in pavement Structures (2005). Harris, P. (2002). Laboratory and fi eld procedures for measuring the sulfate content of texas soil. Develop guidelines an procedures for stabilisation of sulfate soils. Texas Ttransportation Institut. Hecht, T. (2010). Fahrbahnanhebungen infolge von Treibmineralbildungen in bindemittelverbesserten Böden. 41. Erfahrungsaustausch über Erdarbeiten im Straßenbau. Hecht, T. & Krings, M. (2009). Besondere Erfahrungen beim Erdbau mit treibmineralbildenden Böden. 16. Brandenburgischer Bauingenieurtag, Cottbus. Keller, P., Mosthof, A., Laptev, V. & Gilde, S. (2002). Gipskeuper: Baugrundrisiken durch die Bildung von Ettringit/Thaumsait. 3. Kolloquium Bauen in Boden und Fels, S Esslingen. Knopp, J. & Moormann, C. (2016). Einfl ussfaktoren auf die Ettringitbildung bei Bodenbehandlungen. Zur Veröffentlichung in der Zeitschrift Geotechnik eingereicht. Little, D., Nair, S. & Herbert, B. (2010). Addressing Sulfate-Induced Heave in Lime Treated Soils. J. Geotech. Geoenviron. Eng., S Moormann, C., Zweschper, B. & Knopp, J. (2014). Kenngrößen zur Risikoabschätzung des Ettringittreibens von sulfathaltigen Böden. Bisher unveröffentlichter Forschungsbericht. Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), vertreten durch die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt). Petry, T. M. & Little, D. N. (1992). Update on sulfate-induced heave in treated clays: Problematic sulfate levels. Transportation Research Record, 1362(51-55). Rauh, F. & Thuro, K. (2007). Rasche und optimierte Vorhersage von Quelleigenschaften bei Tonen mithilfe des Pulverquellversuchs. 16. Tagung für Ingenieurgeologie und Forum "Junge Ingenieurgeologen", Bochum. Thuro, K. (1993). Der Pulver-Quellversuch ein neuer Quellhebungsversuch. Geotechnik (16), S Witt, K. (2012). Wirkungsmechanismen und Effekte bei der Bodenstabilisierung mit Bindemitteln. 8. Erdbaufachtagung. Danksagung Die diesem Bericht zum Teil zugrundeliegenden Forschungsarbeiten wurden im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, vertreten durch die Bundesanstalt für Straßenwesen, unter FE Nr /2012/BGB sowie KLAP Nr durchgeführt. Die Verantwortung für den Inhalt liegt allein bei den Autoren. Unser besonderer Dank gilt der fachlichen Unterstützung der Betreuergruppe, i.e. den Herren Dr. Kuhl, Dr. Schade und Prof. Witt. Moormann, C., Knopp, J. & Krysta, M. (2016). Treiberscheinungen bei bindemittelbehandelten, sulfathaltigen Böden. Erd- und Grundbautagung, Worms.
Dosis-Effekt-Beziehung bei der Bodenbehandlung mit Mischbindemitteln
 GBB und Marketing 8. Fachtagung Bodenbehandlung mit Bindemittel 23. 1. 2013 Kongress- und Tagungs-Center Magdeburg Dosis-Effekt-Beziehung bei der Bodenbehandlung mit Mischbindemitteln Prof. Dr.-Ing. K.
GBB und Marketing 8. Fachtagung Bodenbehandlung mit Bindemittel 23. 1. 2013 Kongress- und Tagungs-Center Magdeburg Dosis-Effekt-Beziehung bei der Bodenbehandlung mit Mischbindemitteln Prof. Dr.-Ing. K.
FESTIGKEITSENTWICKLUNG BINDEMITTELN VON BODENBEHANDLUNGEN MIT INHALT. M.Eng. Aline Kenzler. 1. Begriffsbestimmungen. 2.
 FESTIGKEITSENTWICKLUNG VON BODENBEHANDLUNGEN MIT BINDEMITTELN M.Eng. Aline Kenzler Ingenieurbüro Küchler GmbH Ferdinandstr. 25 18055 Rostock INHALT 1. Begriffsbestimmungen 2. Bindemittel 3. Festigkeitsentwicklungen
FESTIGKEITSENTWICKLUNG VON BODENBEHANDLUNGEN MIT BINDEMITTELN M.Eng. Aline Kenzler Ingenieurbüro Küchler GmbH Ferdinandstr. 25 18055 Rostock INHALT 1. Begriffsbestimmungen 2. Bindemittel 3. Festigkeitsentwicklungen
Flugasche und Sulfatwiderstand
 47. Aachener Baustofftag, 9. April 214 Flugasche und Sulfatwiderstand Johannes Haufe Institut für Bauforschung der RWTH Aachen University (ibac) Gliederung Sulfatbeanspruchung von Beton Schadensmechanismen
47. Aachener Baustofftag, 9. April 214 Flugasche und Sulfatwiderstand Johannes Haufe Institut für Bauforschung der RWTH Aachen University (ibac) Gliederung Sulfatbeanspruchung von Beton Schadensmechanismen
Bodenverbesserung mit hydraulischen Bindemitteln
 Bodenverbesserung mit hydraulischen Bindemitteln Mögliche Schäden und ihre Vermeidung 1 Einleitung Offensichtlich als Folge der Wiedervereinigung hat seit 1989 der Umfang an Bodenverbesserungsmaßnahmen
Bodenverbesserung mit hydraulischen Bindemitteln Mögliche Schäden und ihre Vermeidung 1 Einleitung Offensichtlich als Folge der Wiedervereinigung hat seit 1989 der Umfang an Bodenverbesserungsmaßnahmen
5. Fachtagung. Zementstabilisierte Böden. Chemnitz, 27. Januar 2010
 5. Fachtagung Zementstabilisierte Böden Chemnitz, 27. Januar 2010 Erwünschte und unerwünschte Reaktionsmechanismen bei der Bodenstabilisierung mit Bindemitteln Prof. Dr.-Ing. Karl Josef Witt Kontakt: Bauhaus
5. Fachtagung Zementstabilisierte Böden Chemnitz, 27. Januar 2010 Erwünschte und unerwünschte Reaktionsmechanismen bei der Bodenstabilisierung mit Bindemitteln Prof. Dr.-Ing. Karl Josef Witt Kontakt: Bauhaus
Laboruntersuchungen zur Bodenverbesserung mittels Zugabe von Kalk-Zement-Mischungen
 Laboruntersuchungen zur Bodenverbesserung mittels Zugabe von Kalk-Zement-Mischungen Dr.-Ing. Andreas Becker Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Christos Vrettos Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau, Technische
Laboruntersuchungen zur Bodenverbesserung mittels Zugabe von Kalk-Zement-Mischungen Dr.-Ing. Andreas Becker Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Christos Vrettos Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau, Technische
Mit 29 Farb- und 192 sw-abbildungen und 42 Tabellen
 Herausgegeben vom F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar Mit 29 Farb- und 192 sw-abbildungen und 42 Tabellen VII Inhaltsverzeichnis Einführung 1 1 Kenngrößen und Einflussfaktoren
Herausgegeben vom F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar Mit 29 Farb- und 192 sw-abbildungen und 42 Tabellen VII Inhaltsverzeichnis Einführung 1 1 Kenngrößen und Einflussfaktoren
K-Feldspat + Wasser + Kohlensäure Kaolinit + gelöstes Hydrogencarbonat + gelöstes Kalium + gelöste Kieselsäure
 Hydrolyse 20 K-Feldspat + Wasser + Kohlensäure Kaolinit + gelöstes Hydrogencarbonat + gelöstes Kalium + gelöste Kieselsäure 2KAlSi 3 O 8 + H 2 O + 2H 2 CO 3 Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 + 2HCO 3 - + 2K + + 4SiO
Hydrolyse 20 K-Feldspat + Wasser + Kohlensäure Kaolinit + gelöstes Hydrogencarbonat + gelöstes Kalium + gelöste Kieselsäure 2KAlSi 3 O 8 + H 2 O + 2H 2 CO 3 Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 + 2HCO 3 - + 2K + + 4SiO
1 Einsatzgrenzen von ZM-Auskleidungen für den Trinkwassertransport
 1 Einsatzgrenzen von ZM-Auskleidungen für den Trinkwassertransport Der Einsatzbereich von ZM-Auskleidungen als Korrosionsschutz ist sehr weitreichend. Derartig ausgekleidete Rohre sind geeignet zum Transport
1 Einsatzgrenzen von ZM-Auskleidungen für den Trinkwassertransport Der Einsatzbereich von ZM-Auskleidungen als Korrosionsschutz ist sehr weitreichend. Derartig ausgekleidete Rohre sind geeignet zum Transport
Einfluss von K 2 SO 4 auf das rheologische Verhalten von Zementleimen mit Fließmitteln
 Einfluss von K 2 auf das rheologische Verhalten von Zementleimen mit Fließmitteln Hana Kučerová Institut für Baustofftechnologie und Bauteile Technische Universität in Brno (CZ) Christiane Rößler F.A.
Einfluss von K 2 auf das rheologische Verhalten von Zementleimen mit Fließmitteln Hana Kučerová Institut für Baustofftechnologie und Bauteile Technische Universität in Brno (CZ) Christiane Rößler F.A.
Jochen Stark Bernd Wicht Dauerhaftigkeit von Beton Der Baustoff als Werkstoff
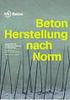 Jochen Stark Bernd Wicht Dauerhaftigkeit von Beton Der Baustoff als Werkstoff Herausgegeben vom F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar Mit 29 Färb- und 192 sw-abbildungen
Jochen Stark Bernd Wicht Dauerhaftigkeit von Beton Der Baustoff als Werkstoff Herausgegeben vom F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar Mit 29 Färb- und 192 sw-abbildungen
Untersuchung zur Beschleunigung von Prüfungen der. physikalischen Dauergebrauchseigenschaften von Schuhen. und Schuhkomponenten.
 Untersuchung zur Beschleunigung von Prüfungen der physikalischen Dauergebrauchseigenschaften von Schuhen und Schuhkomponenten. (Veröffentlichung) Firma AIF-Forschungsprojekt 13804 N Das Projekt wurde aus
Untersuchung zur Beschleunigung von Prüfungen der physikalischen Dauergebrauchseigenschaften von Schuhen und Schuhkomponenten. (Veröffentlichung) Firma AIF-Forschungsprojekt 13804 N Das Projekt wurde aus
Zement nach DIN EN 197-1:
 Zement nach DIN EN 197-1:2004-08 Holcim (Süddeutschland) GmbH D-72359 Dotternhausen Telefon +49 (0) 7427 79-300 Telefax +49 (0) 7427 79-248 info-sueddeutschland@holcim.com www.holcim.de/sued Zement Zement
Zement nach DIN EN 197-1:2004-08 Holcim (Süddeutschland) GmbH D-72359 Dotternhausen Telefon +49 (0) 7427 79-300 Telefax +49 (0) 7427 79-248 info-sueddeutschland@holcim.com www.holcim.de/sued Zement Zement
by kiknet.ch 04 Gips / Radioaktivität / Arbeitsblatt
 1/7 Gips und seine Eigenschaften. Wir erstellen in der Klasse aus den Erkenntnissen aus drei Stationen ein Portrait des Baustoffes! SCENE GIPS Bautechnisch 2/7 Station 1 Bautechnisch Gips als Bindemittel
1/7 Gips und seine Eigenschaften. Wir erstellen in der Klasse aus den Erkenntnissen aus drei Stationen ein Portrait des Baustoffes! SCENE GIPS Bautechnisch 2/7 Station 1 Bautechnisch Gips als Bindemittel
Sichern Prüfverfahren Eigenschaften von Mischbindemitteln? SCHWENK Spezialbaustoffe GmbH & Co. KG Dr. Klaus Raiber
 Sichern Prüfverfahren Eigenschaften von Mischbindemitteln? SCHWENK Spezialbaustoffe GmbH & Co. KG Dr. Klaus Raiber Sichern Prüfverfahren Eigenschaften von Mischbindemitteln? Mischbindemittel für Bodenverbesserung
Sichern Prüfverfahren Eigenschaften von Mischbindemitteln? SCHWENK Spezialbaustoffe GmbH & Co. KG Dr. Klaus Raiber Sichern Prüfverfahren Eigenschaften von Mischbindemitteln? Mischbindemittel für Bodenverbesserung
Diskussion der Ergebnisse
 5 Diskussion der Ergebnisse Die Auswertung der Basiseigenschaften der Gläser beider Versuchsreihen lieferte folgende Ergebnisse: Die optische Einteilung der hergestellten Gläser konnte in zwei Gruppen
5 Diskussion der Ergebnisse Die Auswertung der Basiseigenschaften der Gläser beider Versuchsreihen lieferte folgende Ergebnisse: Die optische Einteilung der hergestellten Gläser konnte in zwei Gruppen
Florian Rauh & Kurosch Thuro 1. Schlüsselworte: Pulverquellversuch, quellfähige Tone, Quelldruck, Quellhebung, Tunnelbau
 Rasche und optimierte Vorhersage von Quelleigenschaften bei Tonen mithilfe des Pulverquellversuchs Investigations on the swelling behaviour of clays with the Powder Swelling Test Florian Rauh & Kurosch
Rasche und optimierte Vorhersage von Quelleigenschaften bei Tonen mithilfe des Pulverquellversuchs Investigations on the swelling behaviour of clays with the Powder Swelling Test Florian Rauh & Kurosch
Geologische Untersuchungen von Baugrundhebungen im nördlichen Stadtgebiet von Böblingen (Hebungsgebiet Nord )
 - Präsentation LANDESAMT FÜR GEOLOGIE, ROHSTOFFE UND BERGBAU Geologische Untersuchungen von Baugrundhebungen im nördlichen Stadtgebiet von Böblingen (Hebungsgebiet Nord ) Dr. Rupert Prestel, Dr. Clemens
- Präsentation LANDESAMT FÜR GEOLOGIE, ROHSTOFFE UND BERGBAU Geologische Untersuchungen von Baugrundhebungen im nördlichen Stadtgebiet von Böblingen (Hebungsgebiet Nord ) Dr. Rupert Prestel, Dr. Clemens
Bauchemische Grundlagen. Chemie der anorganischen Verbindungen. Thomas A. BIER
 Chemie der anorganischen Verbindungen Thomas A. BIER Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik, Leipziger Straße 28, 09596 Freiberg, Gliederung Allgemeine Grundlagen chemischer Reaktionen Messmethoden
Chemie der anorganischen Verbindungen Thomas A. BIER Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik, Leipziger Straße 28, 09596 Freiberg, Gliederung Allgemeine Grundlagen chemischer Reaktionen Messmethoden
von Fußböden (Systemböden)
 Messverfahren zur Messung des Ableitwiderstandes von Fußböden (Systemböden) GIT ReinRaumTechnik 02/2005, S. 50 55, GIT VERLAG GmbH & Co. KG, Darmstadt, www.gitverlag.com/go/reinraumtechnik In Reinräumen
Messverfahren zur Messung des Ableitwiderstandes von Fußböden (Systemböden) GIT ReinRaumTechnik 02/2005, S. 50 55, GIT VERLAG GmbH & Co. KG, Darmstadt, www.gitverlag.com/go/reinraumtechnik In Reinräumen
Bodenverbesserung mit Kalk - Grundlagen und Praxisbeispiel
 Fachtagung Gütegemeinschaft Bodenverbesserung/ Bodenverfestigung Bodenverbesserung mit Kalk - Grundlagen und Praxisbeispiel Nabil Peix Fels- Werke GmbH 22.01.2013 Bodenverbesserung mit Kalk Grundlagen
Fachtagung Gütegemeinschaft Bodenverbesserung/ Bodenverfestigung Bodenverbesserung mit Kalk - Grundlagen und Praxisbeispiel Nabil Peix Fels- Werke GmbH 22.01.2013 Bodenverbesserung mit Kalk Grundlagen
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend
 Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
Bestimmung der feuchte- und temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen
 Bestimmung der feuchte- und temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen F. Ochs 1), H. Stumpp 1), D. Mangold 2), W. Heidemann 1) 1) 2) 3), H. Müller-Steinhagen 1) Universität Stuttgart, Institut
Bestimmung der feuchte- und temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen F. Ochs 1), H. Stumpp 1), D. Mangold 2), W. Heidemann 1) 1) 2) 3), H. Müller-Steinhagen 1) Universität Stuttgart, Institut
Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen (EF)
 Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen (EF)... interpretieren den zeitlichen Ablauf chemischer Reaktionen in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (u.a. Oberfläche, Konzentration, Temperatur)
Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen (EF)... interpretieren den zeitlichen Ablauf chemischer Reaktionen in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (u.a. Oberfläche, Konzentration, Temperatur)
FließestrichForum 2016
 FließestrichForum 2016 Belegreife von beheizten Calciumsulfatestrichen? 0,5 CM-%! Andres Seifert Gips, ein Mineral Ca Kalzium 1x 1x S Schwefel Kochsalz O Sauerstoff 4x schimmelt nicht Gips (Calciumsulfat)
FließestrichForum 2016 Belegreife von beheizten Calciumsulfatestrichen? 0,5 CM-%! Andres Seifert Gips, ein Mineral Ca Kalzium 1x 1x S Schwefel Kochsalz O Sauerstoff 4x schimmelt nicht Gips (Calciumsulfat)
Schlickergießen von Silicatkeramik-Tiegeln mittels statistischer Versuchsplanung
 Schlickergießen von Silicatkeramik-Tiegeln mittels statistischer Versuchsplanung von Tanja Einhellinger in der Fakultät Werkstofftechnik der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaft - Fachhochschule
Schlickergießen von Silicatkeramik-Tiegeln mittels statistischer Versuchsplanung von Tanja Einhellinger in der Fakultät Werkstofftechnik der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaft - Fachhochschule
Angriffspotenzial saurer und sulfatreicher Grundwässer auf Betonbauwerke
 Beitrag zum 2. TASK Symposium,, 30.6. 01.07. 2010 Angriffspotenzial saurer und sulfatreicher Grundwässer auf Betonbauwerke Rolf Breitenbücher, Björn Siebert Abstract In Regionen mit eisendisulfidhaltigen
Beitrag zum 2. TASK Symposium,, 30.6. 01.07. 2010 Angriffspotenzial saurer und sulfatreicher Grundwässer auf Betonbauwerke Rolf Breitenbücher, Björn Siebert Abstract In Regionen mit eisendisulfidhaltigen
Tipp 14/02. 0,25 Klasse S CEM 32,5 N 0,38
 Tipp 14/02 Ermittlung der zeitabhängigen, charakteristischen Betondruckfestigkeit fck(t) nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 [1] in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01 [2] Die Ermittlung der zeitabhängigen,
Tipp 14/02 Ermittlung der zeitabhängigen, charakteristischen Betondruckfestigkeit fck(t) nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 [1] in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01 [2] Die Ermittlung der zeitabhängigen,
Unterrichtsmaterial. Die Unterrichtssequenz enthält drei verschiedene Teile/ Experimente:
 Unterrichtsmaterial Die Unterrichtssequenz enthält drei verschiedene Teile/ Experimente: I. Mit dem Abkühlungsprozess vertraut werden Idee: Gegebenes Experiment / Beobachtung des Abkühlungsprozesses von
Unterrichtsmaterial Die Unterrichtssequenz enthält drei verschiedene Teile/ Experimente: I. Mit dem Abkühlungsprozess vertraut werden Idee: Gegebenes Experiment / Beobachtung des Abkühlungsprozesses von
Straßenbau II. Technische Universität Kaiserslautern Fachgebiet Verkehrswesen. Aufgaben AUFGABE 1: Bemessungsaufgabe
 AUFGABE 1: Bemessungsaufgabe Auf einer Kreisstraße im Landkreis Kusel ist die Verkehrsbelastung stark angestiegen. Bei der Eröffnung der Straße 1981 lag der DTV noch bei 750 Fz/24h und der LKW-Anteil bei
AUFGABE 1: Bemessungsaufgabe Auf einer Kreisstraße im Landkreis Kusel ist die Verkehrsbelastung stark angestiegen. Bei der Eröffnung der Straße 1981 lag der DTV noch bei 750 Fz/24h und der LKW-Anteil bei
10.0 Ergebnis der dynamischen Brennversuche im Drehrohrofen
 b) winit ebenfalls ein Speichermineral ist, c) enit mit Wasser und Rest-Anhydrit zur Bildung von Ettringit beiträgt. 2) Bei Abmischung P30 ist der ganze enit mit dem Calciumsulfat und Wasser zu Ettringit
b) winit ebenfalls ein Speichermineral ist, c) enit mit Wasser und Rest-Anhydrit zur Bildung von Ettringit beiträgt. 2) Bei Abmischung P30 ist der ganze enit mit dem Calciumsulfat und Wasser zu Ettringit
Neuer Nationaler Anhang: Gesteinskörnungen für Beton. IMP Bautest AG, Bereichsleiter Mineralstoffe / Erdbau Geologe (MSc)
 Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie Neuer Nationaler Anhang: Gesteinskörnungen für Beton SN 670102b-NA / EN 12620 : 2002 / A1 : 2008 Vortrag: Sandro Coray IMP Bautest AG, Bereichsleiter
Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie Neuer Nationaler Anhang: Gesteinskörnungen für Beton SN 670102b-NA / EN 12620 : 2002 / A1 : 2008 Vortrag: Sandro Coray IMP Bautest AG, Bereichsleiter
F Rolf Breitenbücher, Björn Siebert
 F 2769 Rolf Breitenbücher, Björn Siebert Verbreitung und Schadenspotenzial saurer und sulfatreicher Grundwässer in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung des Wiederanstiegs des Grundwassers Teil
F 2769 Rolf Breitenbücher, Björn Siebert Verbreitung und Schadenspotenzial saurer und sulfatreicher Grundwässer in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung des Wiederanstiegs des Grundwassers Teil
Glasschaumgranulat Dämmmaterial unter lastabtragenden Bauteilen
 Titel der Arbeitsgruppe, wird vom PHI eingefügt. ARBEITSGRUPPE XX Glasschaumgranulat Dämmmaterial unter lastabtragenden Bauteilen Universität Innsbruck / Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften
Titel der Arbeitsgruppe, wird vom PHI eingefügt. ARBEITSGRUPPE XX Glasschaumgranulat Dämmmaterial unter lastabtragenden Bauteilen Universität Innsbruck / Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften
Reines Wasser ist Lebensqualität
 Reines Wasser ist Lebensqualität Der menschliche Körper besteht zu rund zwei Dritteln aus Wasser. Es ist offensichtlich, dass das Wasser eines der wichtigsten Elemente auf der Erde und für unseren Körper
Reines Wasser ist Lebensqualität Der menschliche Körper besteht zu rund zwei Dritteln aus Wasser. Es ist offensichtlich, dass das Wasser eines der wichtigsten Elemente auf der Erde und für unseren Körper
42. Erfahrungsaustausch des Bundes und der Länder über Erdarbeiten im Straßenbau
 42. Erfahrungsaustausch des Bundes und der Länder über Erdarbeiten im Straßenbau Normung Earthworks im CEN/TC 396 Mi., 5. Mai 2010 Roderich Hillmann Referat Erdbau, Mineralstoffe Bundesanstalt für Straßenwesen
42. Erfahrungsaustausch des Bundes und der Länder über Erdarbeiten im Straßenbau Normung Earthworks im CEN/TC 396 Mi., 5. Mai 2010 Roderich Hillmann Referat Erdbau, Mineralstoffe Bundesanstalt für Straßenwesen
Nachweis- (NG) und Bestimmungsgrenzen (BG)
 1 Freiheitsgrade Nachweis- (NG) und Bestimmungsgrenzen (BG) - Die Anzahl von Freiheitsgraden hängt vor allem von der Anzahl der verfügbaren Informationen ab (A). (A) f = n-v-m f: Freiheitsgrade n: Anzahl
1 Freiheitsgrade Nachweis- (NG) und Bestimmungsgrenzen (BG) - Die Anzahl von Freiheitsgraden hängt vor allem von der Anzahl der verfügbaren Informationen ab (A). (A) f = n-v-m f: Freiheitsgrade n: Anzahl
Artesisches Grundwasser, Anhydrit und Karsterscheinungen im Konflikt mit Erdwärmesonden: Überlegungen zur Schadensursache im Fall Staufen im Breisgau
 Institut für Angewandte Geowissenschaften Fachgebiet Angewandte Geothermie Artesisches Grundwasser, Anhydrit und Karsterscheinungen im Konflikt mit Erdwärmesonden: Überlegungen zur Schadensursache im Fall
Institut für Angewandte Geowissenschaften Fachgebiet Angewandte Geothermie Artesisches Grundwasser, Anhydrit und Karsterscheinungen im Konflikt mit Erdwärmesonden: Überlegungen zur Schadensursache im Fall
Gips als nachwachsender Rohstoff? Verfahren zur Hydratisierung von Anhydrit
 Gips als nachwachsender Rohstoff? Verfahren zur Hydratisierung von Anhydrit Dr. Gerald Dehne Geotekt GbR Matthias Schwotzer Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Vergipsung von Anhydrit -Das Ziel -Die Reaktion
Gips als nachwachsender Rohstoff? Verfahren zur Hydratisierung von Anhydrit Dr. Gerald Dehne Geotekt GbR Matthias Schwotzer Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Vergipsung von Anhydrit -Das Ziel -Die Reaktion
Schriftenreihe der Zement- und Betonindustrie. Zementstabilisierte Böden. Anwendung, Planung, Ausführung
 Schriftenreihe der Zement- und Betonindustrie Zementstabilisierte Böden Anwendung, Planung, Ausführung Zementstabilisierte Böden Anwendung, Planung, Ausführung Dipl.-Ing. Otmar Hersel Beton Marketing
Schriftenreihe der Zement- und Betonindustrie Zementstabilisierte Böden Anwendung, Planung, Ausführung Zementstabilisierte Böden Anwendung, Planung, Ausführung Dipl.-Ing. Otmar Hersel Beton Marketing
Boden Versauerung Dynamik-Gefährdung
 Rochuspark I Erdbergstraße 10/33 I 1020 Wien T (+43 1) 236 10 30 33 I M (+43 0) 676 364 10 30 E office@bodenoekologie.com I www.bodenoekologie.com Boden Versauerung Dynamik-Gefährdung Univ. Lek. DI Hans
Rochuspark I Erdbergstraße 10/33 I 1020 Wien T (+43 1) 236 10 30 33 I M (+43 0) 676 364 10 30 E office@bodenoekologie.com I www.bodenoekologie.com Boden Versauerung Dynamik-Gefährdung Univ. Lek. DI Hans
Lärmarmes Betonsteinpflaster
 Lärmarmes Betonsteinpflaster 13. Münchener Baustoffseminar am 15. März 2016 Jens Skarabis, Christoph Gehlen, Dirk Lowke, Francisco Durán 1 Foto: Müller-BBM 2 1 Nationales Innovationsprogramm Straße Förderschwerpunkt
Lärmarmes Betonsteinpflaster 13. Münchener Baustoffseminar am 15. März 2016 Jens Skarabis, Christoph Gehlen, Dirk Lowke, Francisco Durán 1 Foto: Müller-BBM 2 1 Nationales Innovationsprogramm Straße Förderschwerpunkt
Einfluss unterschiedlicher Dachdeckungen auf die Schalldämmung von Steildächern
 Seite 1 von 6 ift Rosenheim Einfluss unterschiedlicher Dachdeckungen auf die Schalldämmung von Steildächern 1 Einleitung In der Baupraxis wird von Bauexperten immer wieder ein Einfluss auf die Schalldämmung
Seite 1 von 6 ift Rosenheim Einfluss unterschiedlicher Dachdeckungen auf die Schalldämmung von Steildächern 1 Einleitung In der Baupraxis wird von Bauexperten immer wieder ein Einfluss auf die Schalldämmung
Ausgangssituation: Prüfprozess: Bei der Kolbenherstellung ist im Rahmen der Maschineneinstellung
 Fallbeispiel VDA5 (Beispiel 1) 1/15 Ziel: Umsetzung der Studien zur Prüfprozesseignung und Messunsicherheit in qs-stat nach der Vorlage VDA Band 5 Anhang 6 Beispiel 1. Es soll die Eignung eines Prüfprozesses
Fallbeispiel VDA5 (Beispiel 1) 1/15 Ziel: Umsetzung der Studien zur Prüfprozesseignung und Messunsicherheit in qs-stat nach der Vorlage VDA Band 5 Anhang 6 Beispiel 1. Es soll die Eignung eines Prüfprozesses
E 3-1 Eignungsprüfung mineralischer Oberflächen- und Basisabdichtungen. 2 Untersuchungen zur bodenphysikalischen Klassifizierung
 E 3-1 1 E 3-1 Eignungsprüfung mineralischer Oberflächen- und Basisabdichtungen April 2010 1 Allgemeines Für alle Baustoffe, die planmäßig bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen an Deponien und Altlasten zum
E 3-1 1 E 3-1 Eignungsprüfung mineralischer Oberflächen- und Basisabdichtungen April 2010 1 Allgemeines Für alle Baustoffe, die planmäßig bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen an Deponien und Altlasten zum
Reduktion von Bauschäden durch den Einsatz von hochdiffusionsoffenen Unterspannbahnen
 Reduktion von Bauschäden durch den Einsatz von hochdiffusionsoffenen Unterspannbahnen Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Leimer 1 Einleitung In letzter Zeit werden infolge eines fortschreitenden Bauablaufes unter
Reduktion von Bauschäden durch den Einsatz von hochdiffusionsoffenen Unterspannbahnen Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Leimer 1 Einleitung In letzter Zeit werden infolge eines fortschreitenden Bauablaufes unter
Praktische Erfahrungen mit den neuen Betonnormen
 Strength. Performance. Passion. Praktische Erfahrungen mit den neuen Betonnormen Dr. Peter Lunk Holcim (Schweiz) AG Inhalt Einleitung Betonsorten Expositionsklasse und schweizerische Dauerhaftigkeitsprüfungen
Strength. Performance. Passion. Praktische Erfahrungen mit den neuen Betonnormen Dr. Peter Lunk Holcim (Schweiz) AG Inhalt Einleitung Betonsorten Expositionsklasse und schweizerische Dauerhaftigkeitsprüfungen
Hochofenzement CEM III/A 52,5 N-HS
 Hochofenzement CEM III/A 52,5 N-HS Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten SCHWENK Mischmeisterschulung 2015 Wolfgang Hemrich SCHWENK Zement KG hemrich.wolfgang@schwenk.de Entwicklung des Zementes Projekt
Hochofenzement CEM III/A 52,5 N-HS Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten SCHWENK Mischmeisterschulung 2015 Wolfgang Hemrich SCHWENK Zement KG hemrich.wolfgang@schwenk.de Entwicklung des Zementes Projekt
11. DASt-Forschungskolloquium Stahlbau
 Stahlbau Tragverhalten von Verbindungen des Leichtbaus Im Stahlleichtbau werden heutzutage sehr häufig Stahltrapezprofile zum Verkleiden von Fassaden oder auch zur Dacheindeckung verwendet. Als Verbindungsmittel
Stahlbau Tragverhalten von Verbindungen des Leichtbaus Im Stahlleichtbau werden heutzutage sehr häufig Stahltrapezprofile zum Verkleiden von Fassaden oder auch zur Dacheindeckung verwendet. Als Verbindungsmittel
Geotechnische Eigenschaften von Permafrostböden
 SLF Davos, 1. Oktober 2009 Geotechnische Eigenschaften von Permafrostböden Lukas Arenson, Dr. Sc. Techn. ETH larenson@bgcengineering.ca +1.604.684.5900 ext. 116 Übersicht Einführung Gefrorene Böden Klassifikation
SLF Davos, 1. Oktober 2009 Geotechnische Eigenschaften von Permafrostböden Lukas Arenson, Dr. Sc. Techn. ETH larenson@bgcengineering.ca +1.604.684.5900 ext. 116 Übersicht Einführung Gefrorene Böden Klassifikation
Wärmesee Untersuchung zur Nutzung des Erdreichs unter einer Sporthalle als Wärmespeicher
 329 Wärmesee Untersuchung zur Nutzung des Erdreichs unter einer Sporthalle als Wärmespeicher Manfred Mevenkamp 1 & Wilfried Zapke 2 1 Hochschule Bremen, Institut für Informatik und Automation 2 Fachhochschule
329 Wärmesee Untersuchung zur Nutzung des Erdreichs unter einer Sporthalle als Wärmespeicher Manfred Mevenkamp 1 & Wilfried Zapke 2 1 Hochschule Bremen, Institut für Informatik und Automation 2 Fachhochschule
Sulfate in Bauschutt
 Sulfate in Bauschutt - Herkunft und Auswirkungen - Dipl.-Ing Jan Matyschik, Dr.-Ing. Karin Weimann BAM Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung Fachgruppe IV.3 Abfallbehandlung und Altlastensanierung
Sulfate in Bauschutt - Herkunft und Auswirkungen - Dipl.-Ing Jan Matyschik, Dr.-Ing. Karin Weimann BAM Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung Fachgruppe IV.3 Abfallbehandlung und Altlastensanierung
Beitrag zum Tragverhalten von Mikropfählen unter axial zyklischer Belastung in bindigen Böden
 Tragverhalten von Mikropfählen unter axial zyklischer Belastung in bindigen Böden Seite 1 Beitrag zum Tragverhalten von Mikropfählen unter axial zyklischer Belastung in bindigen Böden Kurzfassung für Bewerbung
Tragverhalten von Mikropfählen unter axial zyklischer Belastung in bindigen Böden Seite 1 Beitrag zum Tragverhalten von Mikropfählen unter axial zyklischer Belastung in bindigen Böden Kurzfassung für Bewerbung
Bemessung. Zu beachten ist jedoch, dass die Anforderungen an die Baustoffe und Baustoffgemische nicht in den RStO geregelt sind!
 Bemessung Raum für Notizen Die Bemessung von Straßen nach den Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen, Ausgabe 2001 (RStO 01), unterscheidet sich nicht wesentlich von den
Bemessung Raum für Notizen Die Bemessung von Straßen nach den Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen, Ausgabe 2001 (RStO 01), unterscheidet sich nicht wesentlich von den
Performance von Asphalt Verformungswiderstand. Dr.-Ing. Manfred Hase. analytisch konzeptionell innovativ
 Performance von Asphalt Verformungswiderstand Dr.-Ing. Manfred Hase analytisch konzeptionell innovativ 2 Verformungsverhalten des Asphalts Was beeinflusst das Verformungsverhalten des Asphalts? Asphalte
Performance von Asphalt Verformungswiderstand Dr.-Ing. Manfred Hase analytisch konzeptionell innovativ 2 Verformungsverhalten des Asphalts Was beeinflusst das Verformungsverhalten des Asphalts? Asphalte
Untersuche den Kalkgehalt von Gartenerde, Sand und weiteren Bodenproben.
 Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 3 Von unserer Umwelt und ihrer Gefährdung (P80200) 3.2 Der Kalkgehalt des Bodens Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.0.203 5:35:09 intertess (Version
Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 3 Von unserer Umwelt und ihrer Gefährdung (P80200) 3.2 Der Kalkgehalt des Bodens Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.0.203 5:35:09 intertess (Version
Zugversuch - Versuchsprotokoll
 Gruppe 13: René Laquai Jan Morasch Rudolf Seiler 16.1.28 Praktikum Materialwissenschaften II Zugversuch - Versuchsprotokoll Betreuer: Heinz Lehmann 1. Einleitung Der im Praktikum durchgeführte Zugversuch
Gruppe 13: René Laquai Jan Morasch Rudolf Seiler 16.1.28 Praktikum Materialwissenschaften II Zugversuch - Versuchsprotokoll Betreuer: Heinz Lehmann 1. Einleitung Der im Praktikum durchgeführte Zugversuch
NUTZUNG LOKALER EFFEKTE VON SCHWEIßNÄHTEN BEI LASERBASIERTEN FÜGEKONZEPTEN FÜR HOCHFESTE LASTÜBERTRAGENDE STRUKTURMODULE
 NUTZUNG LOKALER EFFEKTE VON SCHWEIßNÄHTEN BEI LASERBASIERTEN FÜGEKONZEPTEN FÜR HOCHFESTE LASTÜBERTRAGENDE STRUKTURMODULE Dipl.-Ing. M. Schimek*, Dr. rer. nat. D. Kracht, Prof. Dr-Ing. V. Wesling Laser
NUTZUNG LOKALER EFFEKTE VON SCHWEIßNÄHTEN BEI LASERBASIERTEN FÜGEKONZEPTEN FÜR HOCHFESTE LASTÜBERTRAGENDE STRUKTURMODULE Dipl.-Ing. M. Schimek*, Dr. rer. nat. D. Kracht, Prof. Dr-Ing. V. Wesling Laser
Wasserbeständigkeit von auf REA-Gips basierten Multi- Komponenten-Bindemittelsystemen
 Y. Wang, L. Urbonas, D. Heinz Wasserbeständigkeit von auf REA-Gips basierten Multi- Komponenten-Bindemittelsystemen Einleitung Die durch Feuchtigkeitsaufnahme verursachte Festigkeitsabnahme beschränkt
Y. Wang, L. Urbonas, D. Heinz Wasserbeständigkeit von auf REA-Gips basierten Multi- Komponenten-Bindemittelsystemen Einleitung Die durch Feuchtigkeitsaufnahme verursachte Festigkeitsabnahme beschränkt
Elektroofenschlacke (EOS) als Gesteinskörnung für Asphalte
 für Straßen- und Eisenbahnwesen für Straßenund Eisenbahnwesen Elektroofenschlacke (EOS) als Gesteinskörnung für Asphalte Dipl.-Ing. Leyla Chakar - Unser 1 für Straßenund Eisenbahnwesen Entstehung von EOS
für Straßen- und Eisenbahnwesen für Straßenund Eisenbahnwesen Elektroofenschlacke (EOS) als Gesteinskörnung für Asphalte Dipl.-Ing. Leyla Chakar - Unser 1 für Straßenund Eisenbahnwesen Entstehung von EOS
Normative Neuigkeiten und Interpretationen aus dem Bereich Betontechnologie
 Normative Neuigkeiten und Interpretationen aus dem Bereich Betontechnologie Hinweis Viele der in dieser Präsentation gemachten Angaben basieren auf einem vorläufigen Wissenstand. Insbesondere sind die
Normative Neuigkeiten und Interpretationen aus dem Bereich Betontechnologie Hinweis Viele der in dieser Präsentation gemachten Angaben basieren auf einem vorläufigen Wissenstand. Insbesondere sind die
Entwicklung von Anwendungsregeln für Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff
 47. Aachener Baustofftag, 09. April 2014 Entwicklung von Anwendungsregeln für Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff Teil 2: k-wert Konzept und Equivalent Concrete Performance Concept (ECPC) Christina Nobis
47. Aachener Baustofftag, 09. April 2014 Entwicklung von Anwendungsregeln für Hüttensandmehl als Betonzusatzstoff Teil 2: k-wert Konzept und Equivalent Concrete Performance Concept (ECPC) Christina Nobis
Berücksichtigung von Wärmebrücken im Energieeinsparnachweis
 Flankendämmung Dieser Newsletter soll auf die Thematik der Flankendämmung in Kellergeschossen und Tiefgaragen zu beheizten Bereichen hinweisen. Hierfür wird erst einmal grundsätzlich die Wärmebrücke an
Flankendämmung Dieser Newsletter soll auf die Thematik der Flankendämmung in Kellergeschossen und Tiefgaragen zu beheizten Bereichen hinweisen. Hierfür wird erst einmal grundsätzlich die Wärmebrücke an
EnzymeLab.
 Das Enzyme Lab ist ein virtuelles Labor in dem enzymatische Reaktionen getestet werden können. Dem Benutzer sollen hier in einfacher Form Prinzipien der Enzymkinetik und die experimentelle Laborarbeit
Das Enzyme Lab ist ein virtuelles Labor in dem enzymatische Reaktionen getestet werden können. Dem Benutzer sollen hier in einfacher Form Prinzipien der Enzymkinetik und die experimentelle Laborarbeit
(51) Int Cl.: C07J 71/00 ( )
 (19) Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets (12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG (11) EP 1 700 862 A1 (43) Veröffentlichungstag: 13.09.2006 Patentblatt 2006/37 (51) Int Cl.:
(19) Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets (12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG (11) EP 1 700 862 A1 (43) Veröffentlichungstag: 13.09.2006 Patentblatt 2006/37 (51) Int Cl.:
Harnstoffspaltung durch Urease
 Martin Raiber Chemie Protokoll Nr.5 Harnstoffspaltung durch Urease Versuch 1: Materialien: Reagenzglasgestell, Reagenzgläser, Saugpipetten, 100 ml-becherglas mit Eiswasser, 100 ml-becherglas mit Wasser
Martin Raiber Chemie Protokoll Nr.5 Harnstoffspaltung durch Urease Versuch 1: Materialien: Reagenzglasgestell, Reagenzgläser, Saugpipetten, 100 ml-becherglas mit Eiswasser, 100 ml-becherglas mit Wasser
EMPA: Abteilung Bautechnologien Bericht-Nr. 443 015-1 Auftraggeber: Toggenburger AG, Schlossackerstrasse 20, CH-8404 Winterthur Seite 2 / 7
 Auftraggeber: Toggenburger AG, Schlossackerstrasse 20, CH-8404 Winterthur Seite 2 / 7 1 Auftrag Die Firma Toggenburger AG, Schlossackerstrasse 20, CH-8404 Winterthur, erteilte der EMPA Abt. Bautechnologien
Auftraggeber: Toggenburger AG, Schlossackerstrasse 20, CH-8404 Winterthur Seite 2 / 7 1 Auftrag Die Firma Toggenburger AG, Schlossackerstrasse 20, CH-8404 Winterthur, erteilte der EMPA Abt. Bautechnologien
Gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit (GERN) ist ein Projekt im Rahmen von
 1 Gesunde, bedarfsdeckende Ernährung und Nachhaltigkeit in der landwirtschaftlichen Produktion T. Haider, M.M. Mayr, K.H. Wagner Gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit (GERN) ist ein Projekt im Rahmen von
1 Gesunde, bedarfsdeckende Ernährung und Nachhaltigkeit in der landwirtschaftlichen Produktion T. Haider, M.M. Mayr, K.H. Wagner Gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit (GERN) ist ein Projekt im Rahmen von
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D PL
 Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH Anlage zur Akkreditierungsurkunde D PL 11025 01 00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Gültigkeitsdauer: 19.01.2016 bis 18.01.2021 Ausstellungsdatum: 19.01.2016 Urkundeninhaber:
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH Anlage zur Akkreditierungsurkunde D PL 11025 01 00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Gültigkeitsdauer: 19.01.2016 bis 18.01.2021 Ausstellungsdatum: 19.01.2016 Urkundeninhaber:
Einsatz von Olexobit SMA Beurteilung nach 10 jähriger Liegezeit. Maßnahme: B 41 St. Wendel
 Einsatz von Olexobit SMA Beurteilung nach 10 jähriger Liegezeit Maßnahme: B 41 St. Wendel BP Bitumen Rolf Reiter November 2003 Olexobit SMA Einsatz von Olexobit SMA - B 41 St. Wendel Beurteilung nach 10
Einsatz von Olexobit SMA Beurteilung nach 10 jähriger Liegezeit Maßnahme: B 41 St. Wendel BP Bitumen Rolf Reiter November 2003 Olexobit SMA Einsatz von Olexobit SMA - B 41 St. Wendel Beurteilung nach 10
Computerübung 5. Empirische Wirtschaftsforschung. Willi Mutschler. Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik Uni Münster. 26.
 Computerübung 5 Empirische Wirtschaftsforschung Willi Mutschler Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik Uni Münster 26. November 2010 Willi Mutschler (Uni Münster) Computerübung 5 26. November 2010 1 / 11
Computerübung 5 Empirische Wirtschaftsforschung Willi Mutschler Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik Uni Münster 26. November 2010 Willi Mutschler (Uni Münster) Computerübung 5 26. November 2010 1 / 11
SS 98 / Platz 1. Versuchsprotokoll. (Elektronik-Praktikum) zu Versuch 4. Differenzverstärker
 Dienstag, 19.5.1998 SS 98 / Platz 1 Dennis S. Weiß & Christian Niederhöfer Versuchsprotokoll (Elektronik-Praktikum) zu Versuch 4 Differenzverstärker 1 Inhaltsverzeichnis 1 Problemstellung 3 2 Physikalische
Dienstag, 19.5.1998 SS 98 / Platz 1 Dennis S. Weiß & Christian Niederhöfer Versuchsprotokoll (Elektronik-Praktikum) zu Versuch 4 Differenzverstärker 1 Inhaltsverzeichnis 1 Problemstellung 3 2 Physikalische
Protokoll Grundpraktikum I: T6 Thermoelement und newtonsches Abkühlungsgesetz
 Protokoll Grundpraktikum I: T6 Thermoelement und newtonsches Abkühlungsgesetz Sebastian Pfitzner 5. Juni 03 Durchführung: Sebastian Pfitzner (553983), Anna Andrle (55077) Arbeitsplatz: Platz 3 Betreuer:
Protokoll Grundpraktikum I: T6 Thermoelement und newtonsches Abkühlungsgesetz Sebastian Pfitzner 5. Juni 03 Durchführung: Sebastian Pfitzner (553983), Anna Andrle (55077) Arbeitsplatz: Platz 3 Betreuer:
Veränderungen der Hydrodynamik in der westliche Ostsee
 Veränderungen der Hydrodynamik in der westliche Ostsee Christian Schlamkow, Universität Rostock Norman Dreier, Universität Rostock Prof. Peter Fröhle, Technische Universität Hamburg-Harburg 1 Inhalt: Wasserstandsszenarien
Veränderungen der Hydrodynamik in der westliche Ostsee Christian Schlamkow, Universität Rostock Norman Dreier, Universität Rostock Prof. Peter Fröhle, Technische Universität Hamburg-Harburg 1 Inhalt: Wasserstandsszenarien
Baustofftechnologie Eine Einführung
 Baustofftechnologie Eine Einführung Thomas A. BIER Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik, Leipziger Straße 28, 09596 Freiberg, Baustofflehre 2010 Literatur Friedrich W. Locher, Zement Grundlagen
Baustofftechnologie Eine Einführung Thomas A. BIER Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik, Leipziger Straße 28, 09596 Freiberg, Baustofflehre 2010 Literatur Friedrich W. Locher, Zement Grundlagen
Bestimmung der Geschwindigkeitskonstanten einer Esterverseifung
 Versuchsprotokoll: Bestimmung der Geschwindigkeitskonstanten einer Esterverseifung Gruppe 10 29.06.2013 Patrik Wolfram TId:20 Alina Heidbüchel TId:19 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 3 2 Theorie...
Versuchsprotokoll: Bestimmung der Geschwindigkeitskonstanten einer Esterverseifung Gruppe 10 29.06.2013 Patrik Wolfram TId:20 Alina Heidbüchel TId:19 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 3 2 Theorie...
6 Zusammenfassung und Ausblick
 6. Zusammenfassung und Ausblick 117 6 Zusammenfassung und Ausblick Der Schwerpunkt dieser Arbeit lag in stationären und instationären Untersuchungen zur Methanolsynthese. Ein Ziel war, den Einfluss der
6. Zusammenfassung und Ausblick 117 6 Zusammenfassung und Ausblick Der Schwerpunkt dieser Arbeit lag in stationären und instationären Untersuchungen zur Methanolsynthese. Ein Ziel war, den Einfluss der
12 Zusammenfassung. Zusammenfassung 207
 Zusammenfassung 207 12 Zusammenfassung Die Arbeit liefert einen Beitrag zur Ermittlung der hydraulischen Verluste von Stirnradverzahnungen. Insbesondere wurde der Einfluss des Flanken- und des Kopfspieles
Zusammenfassung 207 12 Zusammenfassung Die Arbeit liefert einen Beitrag zur Ermittlung der hydraulischen Verluste von Stirnradverzahnungen. Insbesondere wurde der Einfluss des Flanken- und des Kopfspieles
Foto: Fritsch. Übung 3: Bestimmung der gesättigten hydraulischen Leitfähigkeit (k f -Wert) - Ermittlung aus der Kornverteilungskurve -
 Übung 3 Hydrogeologie I: Bestimmung der gesättigten hydraulischen Leitfähigkeit Dipl.-Geoökol. M. Schipek TU Bergakademie Freiberg, Institut für Geologie Lehrstuhl für Hydrogeologie Foto: Fritsch Kenngrößen
Übung 3 Hydrogeologie I: Bestimmung der gesättigten hydraulischen Leitfähigkeit Dipl.-Geoökol. M. Schipek TU Bergakademie Freiberg, Institut für Geologie Lehrstuhl für Hydrogeologie Foto: Fritsch Kenngrößen
Gesundheitsgefahren durch Mobilfunk? Alexander Lerchl Jacobs-University Bremen
 Gesundheitsgefahren durch Mobilfunk? Alexander Lerchl Jacobs-University Bremen Hintergrund Die Besorgnis der Bevölkerung ist relativ konstant bei ca. 30%. Eine Beeinträchtigung der eigenen Gesundheit wird
Gesundheitsgefahren durch Mobilfunk? Alexander Lerchl Jacobs-University Bremen Hintergrund Die Besorgnis der Bevölkerung ist relativ konstant bei ca. 30%. Eine Beeinträchtigung der eigenen Gesundheit wird
Systematische Optimierungsverfahren verbessern mit geringem Aufwand Prozesse und Produkte
 Systematische Optimierungsverfahren verbessern mit geringem Aufwand Prozesse und Produkte - Eine phänomenologische Darstellung der statistischen Versuchsplanung - Sie kennen das Problem: Ihr komplexer
Systematische Optimierungsverfahren verbessern mit geringem Aufwand Prozesse und Produkte - Eine phänomenologische Darstellung der statistischen Versuchsplanung - Sie kennen das Problem: Ihr komplexer
Enseignement secondaire technique
 Enseignement secondaire technique Régime de la formation de technicien Division génie civil Chimie appliquée Classe de T3GC Nombre de leçons: 0 Nombre minimal de devoirs: 2 Langue véhiculaire: Allemand
Enseignement secondaire technique Régime de la formation de technicien Division génie civil Chimie appliquée Classe de T3GC Nombre de leçons: 0 Nombre minimal de devoirs: 2 Langue véhiculaire: Allemand
[ PROTOKOLL: TAGESPERIODIK DES MEERFELDER MAARES VOM ]
![[ PROTOKOLL: TAGESPERIODIK DES MEERFELDER MAARES VOM ] [ PROTOKOLL: TAGESPERIODIK DES MEERFELDER MAARES VOM ]](/thumbs/54/33253451.jpg) 2012 Hannah Klingener, Natalja Böhm Otto-Hahn-Gymnasium und Katharina Schwander [ PROTOKOLL: TAGESPERIODIK DES MEERFELDER MAARES VOM 16.08.2012] Biologie, LK MSS 13, Herr Kohlhepp S e i t e 1 Inhaltsverzeichnis
2012 Hannah Klingener, Natalja Böhm Otto-Hahn-Gymnasium und Katharina Schwander [ PROTOKOLL: TAGESPERIODIK DES MEERFELDER MAARES VOM 16.08.2012] Biologie, LK MSS 13, Herr Kohlhepp S e i t e 1 Inhaltsverzeichnis
Organische Haftverbesserer
 Organische Haftverbesserer Wirkung Dosierung Umgang und Lagerung Dr. Alfred Nehrings Julius Hoesch Das Thema Haftung XVII. Deutsche Asphalttage Berchtesgaden alt und doch sehr aktuell! Inhaltsangabe 1.
Organische Haftverbesserer Wirkung Dosierung Umgang und Lagerung Dr. Alfred Nehrings Julius Hoesch Das Thema Haftung XVII. Deutsche Asphalttage Berchtesgaden alt und doch sehr aktuell! Inhaltsangabe 1.
Schülerexperiment: Messen elektrischer Größen und Erstellen von Kennlinien
 Schülerexperiment: Messen elektrischer Größen und Erstellen von Kennlinien Stand: 26.08.2015 Jahrgangsstufen 7 Fach/Fächer Natur und Technik/ Schwerpunkt Physik Benötigtes Material Volt- und Amperemeter;
Schülerexperiment: Messen elektrischer Größen und Erstellen von Kennlinien Stand: 26.08.2015 Jahrgangsstufen 7 Fach/Fächer Natur und Technik/ Schwerpunkt Physik Benötigtes Material Volt- und Amperemeter;
Flüssigboden. Waiblinger Betonforum Krieger Beton-Technologiezentrum. Ralf Lieber
 Flüssigboden Ralf Lieber Gliederung Einführung Flüssigboden Flüssigboden bei Krieger Flüssigboden aus Erdboden Aktuelle Baumaßnahme Ausblick Was ist Flüssigboden? zeitweise fließfähiges selbstverdichtendes
Flüssigboden Ralf Lieber Gliederung Einführung Flüssigboden Flüssigboden bei Krieger Flüssigboden aus Erdboden Aktuelle Baumaßnahme Ausblick Was ist Flüssigboden? zeitweise fließfähiges selbstverdichtendes
W. Meinhold, BAW Karlsruhe / Max Spannaus, Universität Karlsruhe Klassifizierung stahlwasserbaulicher Kerbdetails
 W. Meinhold, BAW Karlsruhe / Max Spannaus, Universität Karlsruhe Klassifizierung stahlwasserbaulicher Kerbdetails 1 Problemstellung und Ziel Wegen aufgetretener Rissschäden haben in den zurückliegenden
W. Meinhold, BAW Karlsruhe / Max Spannaus, Universität Karlsruhe Klassifizierung stahlwasserbaulicher Kerbdetails 1 Problemstellung und Ziel Wegen aufgetretener Rissschäden haben in den zurückliegenden
Entwicklung spezieller Lösungen für die Messtechnik. Schallgeschwindigkeits-, Viskositäts- und Leitfähigkeitsmessungen an Polymer - Dispersionen
 Mess - und Analysentechnik Dr. Dinger Entwicklung spezieller Lösungen für die Messtechnik Applikationsberatung und technische Untersuchungen MAT Dr. Dinger Ludwig-Erhard-Strasse 12 34131 Kassel Vertrieb
Mess - und Analysentechnik Dr. Dinger Entwicklung spezieller Lösungen für die Messtechnik Applikationsberatung und technische Untersuchungen MAT Dr. Dinger Ludwig-Erhard-Strasse 12 34131 Kassel Vertrieb
Mineralogische, geochemische und farbmetrische Untersuchungen an den Bankkalken des Malm 5 im Treuchtlinger Revier
 Erlanger Beitr.Petr. Min. 2 15-34 9 Abb., 5 Tab. Erlangen 1992 Mineralogische, geochemische und farbmetrische Untersuchungen an den Bankkalken des Malm 5 im Treuchtlinger Revier Von Frank Engelbrecht *)
Erlanger Beitr.Petr. Min. 2 15-34 9 Abb., 5 Tab. Erlangen 1992 Mineralogische, geochemische und farbmetrische Untersuchungen an den Bankkalken des Malm 5 im Treuchtlinger Revier Von Frank Engelbrecht *)
Messung der Abtragung von Partikeln aus Staubschichten im elektrischen Feld mit überlagerter Korona
 Anzahl der Partikel / l Zeit [s] Messung der Abtragung von Partikeln aus Staubschichten im elektrischen Feld mit überlagerter Korona D. Pieloth, H. Wiggers, P. Walzel PiKo Workshop Dialog Experiment Modell
Anzahl der Partikel / l Zeit [s] Messung der Abtragung von Partikeln aus Staubschichten im elektrischen Feld mit überlagerter Korona D. Pieloth, H. Wiggers, P. Walzel PiKo Workshop Dialog Experiment Modell
Max-Buchner-Forschungsstiftung Forschungsprojekt 2506. Bericht für den Förderzeitraum vom 01.07.2004 bis 30.06.2005
 Max-Buchner-Forschungsstiftung Forschungsprojekt 2506 Bericht für den Förderzeitraum vom 01.07.2004 bis 30.06.2005 Produktformulierung mittels Sprühtrocknung mit überlagerter Absorption und Reaktion Dipl.-Ing.
Max-Buchner-Forschungsstiftung Forschungsprojekt 2506 Bericht für den Förderzeitraum vom 01.07.2004 bis 30.06.2005 Produktformulierung mittels Sprühtrocknung mit überlagerter Absorption und Reaktion Dipl.-Ing.
Versuch Q1. Äußerer Photoeffekt. Sommersemester Daniel Scholz
 Demonstrationspraktikum für Lehramtskandidaten Versuch Q1 Äußerer Photoeffekt Sommersemester 2006 Name: Daniel Scholz Mitarbeiter: Steffen Ravekes EMail: daniel@mehr-davon.de Gruppe: 4 Durchgeführt am:
Demonstrationspraktikum für Lehramtskandidaten Versuch Q1 Äußerer Photoeffekt Sommersemester 2006 Name: Daniel Scholz Mitarbeiter: Steffen Ravekes EMail: daniel@mehr-davon.de Gruppe: 4 Durchgeführt am:
Dipl.-Geol. Martin Sauder
 Anorganische Bindemittel Kreislauf des Kalks Kalk als Bindemittel: Kreislauf des Kalks Antike Form des Kalkbrennofens Brennen von Kalk Brenntemperatur: 900 1.200 C CaCO 3 CaO + CO 2 Calciumcarbonat Calcit,
Anorganische Bindemittel Kreislauf des Kalks Kalk als Bindemittel: Kreislauf des Kalks Antike Form des Kalkbrennofens Brennen von Kalk Brenntemperatur: 900 1.200 C CaCO 3 CaO + CO 2 Calciumcarbonat Calcit,
H 2 S-Freisetzung im Mastschweinestall mit Slalomsystem während des Gülleaufrührens
 AKAL 2.3.16 Dr. Monika Krause 1 H 2 S-Freisetzung im Mastschweinestall mit Slalomsystem während des Gülleaufrührens Dr. Monika Krause, Michael Ihrig und Werner Geißler AKAL 2.3.16 Dr. Monika Krause 2 Gliederung
AKAL 2.3.16 Dr. Monika Krause 1 H 2 S-Freisetzung im Mastschweinestall mit Slalomsystem während des Gülleaufrührens Dr. Monika Krause, Michael Ihrig und Werner Geißler AKAL 2.3.16 Dr. Monika Krause 2 Gliederung
Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern
 Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern Worum geht es in diesem Modul? Schätzer als Zufallsvariablen Vorbereitung einer Simulation Verteilung von P-Dach Empirische Lage- und Streuungsparameter zur
Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern Worum geht es in diesem Modul? Schätzer als Zufallsvariablen Vorbereitung einer Simulation Verteilung von P-Dach Empirische Lage- und Streuungsparameter zur
INGENIEURBÜRO SCHNEIDER Dipl.- Ing. Frank Schneider
 Wärmebrückennachweis und Nachweis der Schimmelbildung in der Wohneinheit. (DG),.Straße. in.. Gliederung 1. Grundlage und Auftrag zur Nachweisführung 2. Wärmebrückennachweis und Nachweis der Schimmelbildung
Wärmebrückennachweis und Nachweis der Schimmelbildung in der Wohneinheit. (DG),.Straße. in.. Gliederung 1. Grundlage und Auftrag zur Nachweisführung 2. Wärmebrückennachweis und Nachweis der Schimmelbildung
Biologisches Gutachten
 Biologisches Gutachten Institut Hagalis AG International tätiges Labor für Qualitätsanalysen von Lebensmitteln, Wasser und Gegenständen des täglichen Gebrauchs. VitaJuwel Inhalt: Seite 1: Grundlagen der
Biologisches Gutachten Institut Hagalis AG International tätiges Labor für Qualitätsanalysen von Lebensmitteln, Wasser und Gegenständen des täglichen Gebrauchs. VitaJuwel Inhalt: Seite 1: Grundlagen der
Qualitätssicherung klebemassenbasierter Verbindungstechnik für die Ausbildung der Luftdichtheitsschichten. Abschlussbericht
 Bau- und Wohnforschung 2559 Qualitätssicherung klebemassenbasierter Verbindungstechnik für die Ausbildung der Luftdichtheitsschichten. Abschlussbericht Bearbeitet von A Maas, Rolf Gross 1. Auflage 2010.
Bau- und Wohnforschung 2559 Qualitätssicherung klebemassenbasierter Verbindungstechnik für die Ausbildung der Luftdichtheitsschichten. Abschlussbericht Bearbeitet von A Maas, Rolf Gross 1. Auflage 2010.
PRODUKTDATENBLATT STÜCKKALK / BAUKALK
 STÜCKKALK / BAUKALK Der Dachstein-Kalk vom Ofenauerberg zeichnet sich durch besondere Reinheit und einen hohen Carbonat-Gehalt aus. Das LEUBE Kalkwerk erzeugt daraus Kalkprodukte höchster Qualität. Kalksteine
STÜCKKALK / BAUKALK Der Dachstein-Kalk vom Ofenauerberg zeichnet sich durch besondere Reinheit und einen hohen Carbonat-Gehalt aus. Das LEUBE Kalkwerk erzeugt daraus Kalkprodukte höchster Qualität. Kalksteine
Zement - Kalk - Stabilisierung von Böden Karl Josef Witt
 - 1 - Zement - Kalk - Stabilisierung von Böden Karl Josef Witt 1 Einführung Den Boden in seinen Eigenschaften gezielt zu verbessern, das war schon vor 5.000 Jahren ein Ziel der damaligen Baumeister. Wir
- 1 - Zement - Kalk - Stabilisierung von Böden Karl Josef Witt 1 Einführung Den Boden in seinen Eigenschaften gezielt zu verbessern, das war schon vor 5.000 Jahren ein Ziel der damaligen Baumeister. Wir
