Forschungsergebnisse für die Praxis
|
|
|
- Lukas Victor Boer
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Forschungsergebnisse für die Praxis Gefördert durch Mittel der
2 Impressum Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Berend Denkena Redaktion: Dipl.-Ing. M.A. Gerold Kuiper Tobias Mörke Titelfoto: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch das des Nachdruckes, der Wiedergabe, der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen und der Übersetzung des vollständigen Werkes oder von Teilen davon, sind vorbehalten. TEWISS-Technik und Wissen GmbH, 2015 An der Universität Garbsen Tel: Fax: info@pzh-verlag.de ISBN PZH Verlag Herstellung: druckteam, Hannover Printed in Germany
3 SFB 653 Vorwort Vorwort Gentelligente Bauteile im Lebenszyklus - Nutzung vererbbarer, bauteilinhärenter Informationen in der Produktionstechnik heißt der Sonderforschungsbereich 653 (SFB 653) der Leibniz Universität Hannover. Seit 2005 werden in diesem Rahmen gentelligente Bauteile und Systeme erforscht und entwickelt. Mit diesen Forschungen schafft der Sonderforschungsbereich wesentliche Grundlagen für die vernetzte Produktion einer Industrie 4.0: kommunikationsfähige Bauteile, Sensoren und Maschinen sowie zu deren Vernetzung die entsprechenden Prozesse und Strukturen. In 17 Teilprojekten arbeiten 40 Wissenschaftler interdisziplinär an der Realisierung der Produktion von morgen. Mit den zehn beteiligten Instituten der Leibniz Universität Hannover bildet der SFB 653 die gesamte Wertschöpfungskette der Produktion ab. Neben Instituten der Fakultät für Maschinenbau und der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik ist auch das Laser Zentrum Hannover e. V. am Sonderforschungsbereich beteiligt. Die vorliegende Broschüre versammelt ausgewählte Beiträge der Teilprojekte und ihre Ergebnisse der vergangenen zehn Jahre. Prof. Dr.-Ing. Berend Denkena Sprecher des SFB 653 und Leiter des Instituts für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen Viel Spaß beim Lesen, I
4
5 SFB 653 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Einleitung Genetik und Intelligenz Grundlagen für Industrie Prozessoptimierung und Qualitätssicherung Prozessinformationen zur Optimierung von Fertigungsprozessen erschließen... 5 Einzeltechnolgien Erfassung von Prozesskräften in hochsteifen Strukturen... 6 Online-Prozessbewertung durch lernende Prozessmodelle... 7 Direktabscheidung ultradünner Sensorik auf Bauteile beliebiger Größe... 8 Industriegerechte Fertigung: Optimierung folienbasierter Magnetfeldsensoren... 9 Laserstrukturierung von Dünnschicht-Dehnungssensoren auf Oberflächen Sensorisches Spannsystem zur Überwachung des System- und Prozesszustands Integration von Temperierkanälen zur Erfassung von Temperaturen im Schmiedeprozess Bauteilinhärente Energieübertragung und optische Signalkopplung Opto-elektronische Integration eines Hochfrequenz-Kommunikationssystems Potenziale für die Arbeits- und Prozessplanung nutzen Einzeltechnolgien Fertigungsinformationen für die adaptive Fertigungsplanung und steuerung Anlernfreie Prozessüberwachung für die Einzelteilfertigung Ausgewählte Veröffentlichungen Datenspeicherung und Plagiatsschutz Informationen im Bauteil speichern und zweifelsfrei wiedererkennen Einzeltechnolgien Markierungsfreie Bauteilidentifikation Topografiegestaltung im Fräsprozess Datenspeicherung durch Fremdpulver im Sinterprozess Informationsspeicherung und Erfassung von Bauteilbelastungen im Randzonengefüge Magnetische Datenspeicherung im Bauteilvolumen Ausgewählte Veröffentlichungen Instandhaltung und Produktoptimierung Informationen aus dem Lebenszyklus für die Instandhaltungsplanung und Gestaltoptimierung nutzen Einzeltechnolgien Belastungserfassung mittels magnetischer Magnesiumlegierungen Gestaltoptimierung auf Basis von Informationen aus dem Lebenszyklus Zustandsorientierte Instandhaltung auf Basis von Belastungsdaten Ausgewählte Veröffentlichungen Entwickelte Technologien verstetigen Production Innovations Network Rahmeninformationen Übersicht der geförderten Projekte Übersicht der beteiligten Institute III
6
7 SFB 653 Genetik und Intelligenz Grundlagen für Industrie 4.0 Genetik und Intelligenz Grundlagen für Industrie 4.0 Warum die Welt cyberphysisch wird - und wie gentelligente Systeme dazu beitragen Die denkende Fabrik und smarte Produkte: Eine Welt, in der Bauteile und Werkzeuge fühlen und ihre Zustände kommunizieren können. Diese Vision beschäftigt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Sonderforschungsbereichs Gentelligente Bauteile im Lebenszyklus. Ihre Realisierung wird die Produktion von morgen nachhaltig beeinflussen. Der Sonderforschungsbereich (SFB) 653 Gentelligente Bauteile im Lebenszyklus - Nutzung vererbbarer, bauteilinhärenter Informationen in der Produktionstechnik greift die Ideen der fühlenden und kommunizierenden Produkte auf und entwickelt sie weiter zeigte der SFB 653 erstmals die Vision auf, Bauteil und Information inhärent miteinander zu verknüpfen: Bauteile ihren Zustand eigenständig überwachen zu lassen, ihre Restlebensdauer zu bestimmen und bei Bedarf selbstständig eine Inspektion zu veranlassen. Unfälle aufgrund verfrühter Ermüdungsbrüche und teure Rückrufaktionen beispielsweise in der Automobilindustrie könnten vermieden werden. In den Folgejahren hat der SFB Prototypen mit erweiterten Fähigkeiten wie Belastungserfassung und Informationsvererbung entwickelt, die neue Produktionstechnologien erforderten und neue Instandhaltungsprozesse ermöglichten. In der Vergangenheit wurden so Maßstäbe gesetzt, die sich auch in neuesten Forschungsansätzen widerspiegeln: So hat mit der 2012 gemeinsam vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Bundeswirtschaftsministerium gestarteten Forschungsinitiative Industrie 4.0 die zunehmende Integration digitaler Information und zugehöriger physischer Komponenten unter dem Begriff cyberphysische Systeme Einzug in Forschung und Industrie gehalten. Bis 2020 soll sich Deutschland zum Leitanbieter für cyberphysische Systeme entwickeln. Viele Ansätze der neuen Forschungsinitiativen fokussieren den Einsatz von RFID-Technologien (RFID: Radio Frequency Identification). Die Forschung im Sonderforschungsbereich 653 geht einen Schritt weiter, indem die physikalische Trennung von Bauteil und dazugehöriger Information vollständig aufgehoben wird. Heute bilden Bauteil und zugehörige Information nur in der Entwicklungsphase, also der ersten Produktentstehungsphase, in Form eines virtuellen Bauteils eine Einheit. Im weiteren Lebenszyklus (Herstellung, Nutzung, Wiederverwertung) kommt es im Allgemeinen zur physischen Trennung des Bauteils von den zugehörigen Informationen. Das Produktionsdatum und die Produktionshistorie, Qualitätsinformationen, Werkstoff, Änderungsstand, Produktmodelle und andere Informationen sind nicht mehr direkt verfügbar. Um auf die Informationen eines individuellen Bauteils zugreifen zu können, muss im Regelfall die Seriennummer des Bauteils sofern eine eindeutige existiert ausgelesen und anschließend auf eine örtlich getrennte Datenbank zugegriffen werden. Im Vordergrund des SFB 653 steht deshalb die Erforschung und Entwicklung neuer Produktionstechniken, die Bauteile befähigen, inhärent Informationen über sich und ihren Lebenszyklus aufzunehmen und inhärent zu speichern. Die Integration von sensorischen Komponenten in komplexen Maschinen schafft eine völlig neue Dimension der Zustands- und Prozessbewertung. Im Zusammenschluss zum System entstehen so neue Möglichkeiten einer sich kontinuierlich im Prozess anpassenden Fertigungsplanung und -steuerung. In 17 interdisziplinären Teilprojekten werden im SFB 653 unterschiedliche Technologie- und Anwendungsbereiche untersucht, zusammengeführt und Ergebnisse in die industrielle Anwendung überführt. Neben der Fakultät für Maschinenbau und der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik der Leibniz Universität Hannover ist auch das Laser Zentrum Hannover e.v. beteiligt. Was sind gentelligente Bauteile? Der Begriff gentelligent setzt sich aus genetisch und intelligent zusammen und beschreibt in Anlehnung an die Biologie Bauteile mit genetischen und intelligenten Eigenschaften. Bauteile werden befähigt, Informationen in ihrem Lebenszyklus zu sammeln, zu speichern und zu kommunizieren. Damit wird die Grundlage zur Übertragung von Prinzipien der Biologie im Sinne des Vererbens von Informationen an nachfolgende Bauteilgenerationen und des lebenslangen Lernens geschaffen. Die Nutzung von realen Produkterfahrungen im Lebenszyklus für die Produktund Produktionsevolution bezeichnet der SFB 653 als technische Vererbung. Als genetische Informationen eines Bauteils werden grundlegende Informationen, die zur Identifikation oder Reproduktion erforderlich sind, wie geometrische Beschreibungen oder Materialinformationen, interpretiert. Diese Informationen sind als statische, unveränderbare Daten im Bauteil gespeichert und können von einer älteren Bauteilgeneration vererbt worden sein. Daneben enthält das Bauteil Informationen zu seiner Herstellung, die beispielsweise durch Qualitätsinformationen erweitert werden können. Die Intelligenz des gentelligenten Bauteils entsteht durch seine technische Fähigkeit, Informationen in der Nutzungsphase, wie einwirkende Kräfte und Temperaturen, selbstständig inhärent erfassen, verarbeiten und speichern zu können. Dies erfolgt durch geeignete 1
8 Genetik und Intelligenz Grundlagen für Industrie 4.0 SFB 653 Materialien und Sensorik, die in das Bauteil integriert sind. Die in dem Bauteil gespeicherte Gesamtheit an Informationen kann bei Bedarf entweder direkt an den Nutzer des Bauteils kommuniziert oder bei Ausbau oder Austausch des Bauteils ausgelesen werden. Diese Gesamtheit an Informationen ist inhärent mit dem gentelligenten Bauteil verbunden und jederzeit abrufbar. Ein gentelligentes Bauteil ist somit durch inhärente sensorische Eigenschaften und die Fähigkeit zur bauteilinhärenten Datenspeicherung und -kommunikation gekennzeichnet (Bild 1). Bauteile / technische Systeme der Zukunft nutzen Prinzipien der Biologie Lebenslanges Lernen während Herstellung und Nutzung Intelligenz Vererben von Informationen an nachfolgende Generationen Genetik Das gentelligente Bauteil / System - wissend, fühlend, kommunikationsfähig, anpassungsfähig - Bild 1: Gentelligente Bauteile folgen Prinzipien der Biologie Was leisten gentelligente Bauteile? Die inhärenten Fähigkeiten, Wissen zu speichern, Erfahrungen zu erlangen und zu kommunizieren, ermöglichen sowohl während der Produktion als auch im Lebenszyklus und bei der Weiterentwicklung eines Bauteils beispielsweise: die eindeutige Produktidentifizierung und ihre Anwendung als Plagiatsschutz, die gezielte Fertigungs- und Montageplanung bzw. Fertigungssteuerung, die Ermittlung von Ausfallursachen, Ausfallwahrscheinlichkeiten und Restlebensdauer sowie die Ermittlung dynamischer Wartungsintervalle, die Auslegung neuer Bauteile mit Hilfe realer Belastungsprofile, die während der Nutzungsphase von Vorgängerbauteilen ermittelt wurden. Der Transfer der Ergebnisse aus dem Sonderforschungsbereich in die Anwendung wird mit dem aus dem SFB 653 hervorgegangenen Production Innovations Network (PIN) maßgeblich vorangetrieben. Weitere Ausführungen zum PIN sind ab Seite 41 dargestellt. In der Fabrik der Zukunft werden Bauteile und Maschinen miteinander kommunizieren und eigenständig Entscheidungen treffen. Mit der Entwicklung gentelligenter Bauteile, Werkzeuge und Systeme werden die Grundlagen für eine vernetzte Produktion einer Industrie 4.0 geschaffen. 2
9 SFB 653 Prozessoptimierung und Qualitätssicherung Prozessoptimierung und Qualitätssicherung Prozessinformationen zur Optimierung von Fertigungsprozessen erschließen... 5 Potenziale für die Arbeits- und Prozessplanung nutzen Ausgewählte Veröffentlichungen
10
11 SFB 653 Prozessinformationen zur Optimierung von Fertigungsprozessen erschließen Prozessinformationen zur Optimierung von Fertigungsprozessen erschließen Fühlende Maschinen als Schlüssel für optimierte Fertigungsprozesse? Produktionsmaschinen und Werkstücke werden zunehmend mit integrierten Sensoren und Kommunikationssystemen ausgestattet, die vergleichbar den menschlichen Nerven und Nervenbahnen in der Maschine verteilt sind. Wie ein Mensch, der beispielsweise in der einen Hand eine Feile und in der anderen ein Werkstück hält und führt, erfühlt die Maschine Prozess-, Werkstück- und Werkzeugzustände. Diese Informationen können zurückgeführt werden und ermöglichen es der Produktion, selbstständig auf Ereignisse zu reagieren, indem Prozess- und Arbeitsabläufe individuell umgeplant und angepasst werden. Ein enormes Potenzial, um die Sicherheit und Qualität von Produktionsprozessen bei einer gleichzeitigen Steigerung der Produktivität zu erhöhen, ist hierin verborgen. Die folgenden Beispiele zeigen, dass die Anwendung dieser Systeme nicht mehr fern der Realität ist, sondern bereits umgesetzt werden kann. Die im Sonderforschungsbereich Gentelligente Bauteile im Lebenszyklus entwickelten fühlenden Maschinen liefern detaillierte Informationen über den Maschinen- und Prozesszustand. Sie ermöglichen damit eine selbstständige Anpassung der Fertigungsparameter. Aufgrund der besonderen Anforderungen bei der Datenerfassung wurden neuartige Sensoren und Sensorfertigungstechnologien erforscht und entwickelt. Jene erlauben zum Beispiel eine höhere Sensitivität der Sensoren für die Verwendung in steifen Strukturen von Werkzeugmaschinen. Neue Ansätze, die es weiter zu erforschen gilt, ermöglichen darüber hinaus u.a. eine reduzierte Bauhöhe von Sensorsystemen durch eine Direktabscheidung und Direktstrukturierung auf technischen Oberflächen. Der Datenaustausch zwischen der Maschine, dem Werkzeug und dem Werkstück wird durch speziell entwickelte Kommunikationstechnologien ermöglicht. Die aus dem Fertigungsprozess gewonnen Informationen der fühlenden Maschine werden direkt verarbeitet und die Oberflächenqualität sowie die Abdrängung des Fräswerkzeugs berechnet. Diese Daten fließen in ein selbstlernendes Regressionsmodell ein. Nähert sich die Bauteilqualität dem zulässigen Grenzwert, erfolgt eine automatische Anpassung der Bearbeitungsparameter des folgenden Bauteils. Das Resultat: Minimierung der Ausschussrate bei stets maximaler Produktivität. Einzeltechnologien Erfassung von Prozesskräften in hochsteifen Strukturen Online-Prozessbewertung durch lernende Prozessmodelle Direktabscheidung ultradünner Sensorik auf Bauteile beliebiger Größe Industriegerechte Fertigung: Optimierung folienbasierter Magnetfeldsensoren Laserstrukturierung von Dünnschicht-Dehnungssensoren auf Oberflächen Sensorisches Spannsystem zur Überwachung des System- und Prozesszustands Integration von Temperierkanälen zur Erfassung von Temperaturen im Schmiedeprozess Bauteilinhärente Energieübertragung und optische Signalkopplung Opto-elektronische Integration eines Hochfrequenz-Kommunikationssystems 5
12 Erfassung von Prozesskräften in hochsteifen Strukturen SFB 653 Erfassung von Prozesskräften in hochsteifen Strukturen Die größte Herausforderung bei der Integration von Dehnungssensorik in Werkzeugmaschinen ist, dass diese prinzipbedingt hochsteif sind und nur geringste Amplituden in den Sensoren auftreten. Eine Möglichkeit zur Steigerung der Signalamplituden, ohne dabei das Rauschen zu verstärken, bietet die lokale Bündelung des Kraftflusses. Diese führt zu einer lokalen Erhöhung der mechanischen Spannung bzw. Dehnung und kann durch den Einsatz von kleinen Kerben in die Struktur erreicht werden. An ausgewählten Stellen des Spindelschlittens eines Fräsbearbeitungszentrums wurden daher gezielt Kerben eingebracht, mit denen rein mechanisch eine zusätzliche Steigerung der Sensitivität ermöglicht wurde. Die Gesamtsteifigkeit des Spindelschlittens wird aufgrund der sehr kleinen Kerbendimensionen und da es sich bei Kerbwirkung im Gegensatz zur Steifigkeit um einen lokalen Effekt handelt, lediglich in einem sehr geringen und daher zu vernachlässigenden Maße verringert (Bild 1). Zur Erfassung der Dehnung wurden miniaturisierte Dehnungssensoren in den engen Kerbengrund appliziert. Im SFB 653 wurden hierfür zwei verschiedene Arten von Mikro-Dehnungsmessstreifen entwickelt und eingesetzt: Zum einen laserstrukturierte Dehnungsmessstreifen (L-DMS) durch das Laser Zentrum Hannover, die auf beliebige dreidimensionale Strukturen gesputtert und anschließend durch einen Laser-Strahl strukturiert werden. Zum anderen wurden substratlose Mikrodehnungsmessstreifen (µ-dms) durch das Institut für Mikroproduktionstechnik der Leibniz Universität Hannover entwickelt (Bild 2). Die Sensitivitäten der in den Spindelschlitten integrierten Dehnungsmessstreifen, wurden basierend auf einer statischen Kraftbelastung am TCP in den Richtungen x, y und z ermittelt. In Kerben applizierten Mikro- Dehnungsmessstreifen zeigen nachweislich eine deutliche Empfindlichkeitserhöhung gegenüber konventionellen Dehnungsrosetten, die sehr dicht an den Kerben angeordnet, jedoch nicht in die Kerben integriert sind. Auf Basis der zur Verfügung stehenden Vielzahl an Sensorsignalen, wurden mit Hilfe von Methoden zur Sensor-Daten-Fusion und nach entsprechender Kalibrierung mit externer Kraftsensorik die am Werkzeug wirkenden Kräfte rekonstruiert (Bild 3). Dadurch können für die Werkzeugmaschine weitere Nutzenpotenziale wie eine anlernfreie oder eine Online laufende Prozessüberwachung erschlossen werden. Beispielsweise lassen sich anhand der gemessenen Prozesskräfte Informationen über die Werkzeug- und Maschinensteifigkeit ableiten. Hierfür lässt sich durch Antasten des Werkstücks mit dem Werkzeug und durch anschließendes Verspannen aus dem Verhältnis von Verspannungsweg (aus der Steuerung) und Verspannkraft (aus dem sensorischen Schlitten) die Steifigkeit bestimmen und zur späteren Bewertung der Bearbeitungsqualität heranziehen. Teilprojekt N1: Gentelligente Maschinenkomponenten für Werkzeugmaschinen Prof. B. Denkena (IFW) denkena@ifw.uni-hannover.de Dipl.-Ing. H. Boujnah (IFW) boujnah@ifw.uni-hannover.de Bild 1: Einfluss von Kerben auf die Steifigkeit des Spindelschlittens Bild 2: Prototypischer Spindelschlitten mit integrierten Dehnungssensoren Bild 3: Kraftmessung mit dem sensorischen Spindelschlitten 6
13 SFB 653 Online-Prozessbewertung durch lernende Prozessmodelle Online-Prozessbewertung durch lernende Prozessmodelle Die Generierung umfassender Daten während der Fertigung, etwa durch den sensorischen Spindelhalter (N2), ermöglicht neue Einblicke in Fertigungsprozesse und eröffnet damit auch neue Möglichkeiten der Prozessbewertung und -planung. Die Herausforderung besteht in der sinvollen Interpretation der gewonnenen Daten und deren anschließender Berücksichtung in der Planung und Prozessführung. Bevor die Fertigungsdaten, etwa Prozesskräfte oder Qualitätsinformationen, ausgewertet und genutzt werden können, müssen sie zunächst in einen geeigneten Kontext gebracht werden. Dafür nutzt der sogenannte Virtuelle Planer (siehe Bild 1) analytische Vorhersagemodelle und Simulationen, die auf Basis der Rohdaten Prognosen zur Bauteilqualität ermöglichen (siehe Bild 2). Durch die Nutzung von Data-Mining-Techniken erfolgt eine empirische Modellbildung, die kausale Zusammenhänge und Korrelationen ermittelt. Die gewonnen Zusammenhänge ermöglichen eine Entscheidungsfindung für die Prozessauslegung, mit dem Ziel, passende Prozessparameter auszuwählen. Wenn neue Informationen vorliegen, werden die Paramater für das folgende Bauteil angepasst. Bei Bedarf kann der Virtuelle Planer auch in laufende Prozesse eingreifen und die Prozessparameter anpassen. Modelle und Simulationen werden darüberhinaus genutzt, um die Rohdaten mit weiteren relevanten Informationen anzureichern. Eine Abtragssimulation (Bild 3) wird verwendet, um die Eingriffsbedingungen der ablaufenden Prozesse zu erfassen. Darauf aufbauend werden weitere relevante Informationen für das Entscheidungsmodell generiert und das System befähigt, die Prozesse geometrisch nachzuvollziehen. Damit können die auftretenen Prozesskräfte ortsaufgelöst dem Werkzeugeingriff zugeordnet werden. Um einen kompletten Regelkreis zu erhalten, werden zusätzlich Qualitätsinformationen erfasst, die eine Prozessbewertung ermöglichen. Auf diese Weise können die erfassten Daten in Hinblick auf das erzielte Ergebnis interpretiert werden. Durch diese Rückführung der Fertigungsergebnisse erhält die gentelligente Fertigungskette eine zunehmend fundiertere Datenbasis, die eine immer zuverlässigere Fertigungsplanung ermöglicht. Diese Datenrückführung führt zu einem sich selbst kalibrierenden System. Ein Baustein für die adaptive Prozessauslegung ist die Kommunikation mit der Maschinensteuerung. Dafür existierte bisher keine Möglichkeit, weshalb im Rahmen des Projekts ein NC-Programm entwickelt wurde, das mit dem Virtuellen Planer kommuniziert. Damit ist es möglich, Prozessparameter und die Zustellung des Werkzeugs während der Bearbeitung zu beeinflussen. Der Virtuelle Planer hat zudem die Möglichkeit, eine Messung während des Prozesses anzufordern, wenn die Informationsbasis dies erforderlich macht. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein neuer Werkstoff oder ein neues Werkzeug verwendet wird, zu dem noch nicht ausreichend Daten vorhanden sind. Bild 1: Aufbau des Virtuellen Planers Bild 2: Datenanreicherung durch Vorhersagemodell Bild 3: Verwendung einer Abtragssimulation zu Ermittlung der Eingriffsbedingungen Teilprojekt K2: Planung und Überwachung spanender Fertigungsprozesse auf Basis von Werkstück- und Fertigungsinformationen Prof. B. Denkena (IFW) Dipl.-Ing. F. Uhlich
14 500 µm 15 µm < 10 µm Direktabscheidung ultradünner Sensorik auf Bauteile beliebiger Größe SFB 653 Direktabscheidung ultradünner Sensorik auf Bauteile beliebiger Größe In Zukunft sollen Bauteile in der Lage sein, Informationen sowohl während des Fertigungsprozesses, als auch während des Produktlebenszyklus zu sammeln. Somit sind sie in der Lage, den eigenen Zustand autonom zu überwachen, bei Bedarf selbstständig Maßnahmen wie eine Inspektion zu veranlassen sowie fertigungsrelevante Informationen zur Optimierung nachfolgender Produktgenerationen zur Verfügung zu stellen. Zur Erreichung dieser Ziele ist Sensorik erforderlich, welche die Bauteile befähigt, eine Vielzahl unterschiedlicher Messgrößen zu detektieren. Im Rahmen des Teilprojekts S1 wurde an der bedarfsgerechten Entwicklung einer modularen, mehrfunktionalen Mikrosensorik gearbeitet, die das Sammeln relevanter Daten während des gesamten Lebenszyklus erlaubt. Die im ersten Förderzeitraum entwickelte Sensorfamilie besteht unter anderem aus Temperatur-, Dehnungs- sowie Magnetfeldsensoren. Die Prozessierung dieser Sensoren erfolgte dabei zunächst auf starrem Silizium. Zur Steigerung der Systemintegration sowie Flexibilität wurden im zweiten Förderzeitraum Polymerfolien als Trägersubstrate verwendet (vgl. Bild 1) und die bestehende Sensorik optimiert. Die Dicke des Sensorsystems inklusive des Trägersubstrates und der erforderlichen Klebstoffschicht ließ sich somit von 500 μm auf ca. 15 μm reduzieren (Bild 2). Im dritten Förderzeitraum liegt der Fokus auf der Abscheidung und Strukturierung von Sensorik direkt auf technischen Oberflächen. Eine Optimierung und Anpassung der polymerbasierten Magnetfeldsensoren an eine industriegerechte Fertigung erfolgt im Rahmen des Transferprojektes T05 (vgl. Seite 9). Im Vergleich zu silizium- und polymerbasierten Sensoren entfallen bei der Direktstrukturierung das Trägersubstrat sowie die Klebstoffschicht, wodurch die daraus resultierenden Messwertverfälschungen vermieden werden. Die Sensorsystemdicke beträgt dabei je nach Rauheit der Oberfläche und erforderlicher elektrischer Isolationsschichtdicke wenige Mikrometer. Somit ergeben sich neue Einsatzmöglichkeiten an Positionen in Anlagen, Maschinen und Geräten, an denen zum Beispiel eine besonders niedrige Bauhöhe erforderlich ist. Im Rahmen der Forschungstätigkeiten werden zunächst Anforderungen und Herausforderungen für die Direktabscheidung identifiziert. Um optimale Isolations- und Funktionsschichteigenschaften zu erreichen, sind für die Abscheidung der Schichtmaterialien zunächst werkstoff- und anlagenspezifische Prozessparameter zu ermitteln. Insbesondere die hohe gemittelte Rauhtiefe technischer Oberflächen von einigen Mikrometern stellt hohe Anforderungen an einen Prozess zur Abscheidung elektrischer Isolationsschichten und gestaltet die Abdichtung des Prozesses zur Umgebung anspruchsvoll. Darüber hinaus ist die Strukturierung der Sensoren mittels Schattenmasken zu erforschen. Hierbei stehen die Untersuchungen der reproduzierbaren Positionierbarkeit und der Strukturauflösung im Mittelpunkt. Neue Anlagentechnik zur simultanen Abscheidung und Strukturierung von Sensorik befindet sich in der Entwicklung (vgl. Bild 3). Jene ermöglicht die Applikation von Sensoren auf Bauteile beliebiger Größe und kann auch außerhalb eines Reinraums zum Einsatz kommen. Bild 1: Lichtmikroskopische Aufnahme eines auf Polymerfolie gefertigten Magnetfeldsensors Silizium Klebstoffschicht Sensor Isolator Polymer Oberfläche Bild 2: Reduktion des Sensor-Bauteil- Abstandes. V.l.n.r.: Silizium- und polymerbasierte sowie direktabgeschiedene Sensorik Sputterkammer Kathode Sputtertarget Vakuumdichter Schieber Andockkammer Fixierung für Schattenmaske Bauteiloberfläche Bild 3: Schematische Darstellung der Anlage für die Sensordirektabscheidung Teilprojekt S1: Modulare, mehrfunktionale Mikrosensorik Dr.-Ing. M. C. Wurz (IMPT) Dipl.-Ing. D. Klaas (IMPT)
15 SFB 653 Industriegerechte Fertigung: Optimierung folienbasierter Magnetfeldsensoren Industriegerechte Fertigung: Optimierung folienbasierter Magnetfeldsensoren Das Transferprojekt dient der Überführung der bisher im Teilprojekt S1 entwickelten Technologie zur Herstellung von modularen Sensoren auf flexibler Polyimidfolie in eine fertigungsorientierte Umgebung. Dadurch werden die bisherigen Ergebnisse aus der Grundlagenforschung in eine industrielle Applikation überführt und deren Eignung evaluiert. Damit verbunden ist die Entwicklung einer neuartigen Aufbau- und Verbindungstechnik, um die Sensoren an die gestellten Anforderungen zu adaptieren. In diesem konkreten Projekt wird das Design von Magnetfeldsensoren sowohl hinsichtlich der Anforderungen für die industrielle Verarbeitung als auch in Bezug auf die Funktionalität und Dauerstabilität weiterentwickelt. Der Herstellungsprozess, der im Teilprojekt S1 entwickelt wurde, wird auch in diesem Teilprojekt angewandt. Dieser Prozess sieht vor, dass zuerst auf einem Siliziumwafer ein Polymer aufgebracht wird. Auf diesem Polymer werden die Sensoren bestehend aus einer mäanderförmigen Funktionsschicht, Zuleitungen und Kontaktpads aufgebracht. Zum Schutz und zur Isolation der Sensoren werden diese wiederum in Polymer eingebettet. Zur Vereinzelung jedes Sensors wird der Siliziumträger rückseitig trocken geätzt, sodass ein Siliziumgitter entsteht, das die einzelnen Mikrosysteme freilegt und ihnen gleichzeitig Stabilität gibt, bis die Vereinzelung stattfindet. Der Vereinzelungsprozess beziehungsweise die dafür notwendige Maschine wird in Kooperation mit dem Industriepartner ETO Magnetic GmbH entwickelt und gefertigt. Die Vereinzelung wird über einen Stanzprozess realisiert, bei dem ein planarer Stahlstempel und ein ebenfalls planarer Gegenhalter das Mikrosystem klemmen. Durch gleichzeitiges Verfahren von Stempel und Gegenhalter kann ein schadensfreies Heraustrennen der Sensoren gewährleistet werden. Die vereinzelten Sensorelemente sind sehr filigran. Jedes System ist unter 15 µm dick und besitzt eine Gesamtfläche von 5 x 1 mm². Für die Handhabung des Sensors nach der Vereinzelung ist deshalb ein Vakuumkanal in den Gegenhalter integriert, der den Transport des Sensors zum finalen Applikationsort gewährleistet, wo der Sensor platziert und mit einem geeigneten Kleber fixiert wird. Die auf diese Weise hergestellten flexiblen und sehr dünnen Sensoren bieten für die Anwender die Möglichkeit, Messwerte an bisher unzugänglichen Bereichen zu erfassen. So können diese Sensoren beispielsweise in schmale Luftspalte eingebaut oder auf unebenen Flächen plaziert werden. Durch diese Erschließung neuer Bauräume und die dadurch einhergehende Erschließung weiterer Messdaten kann die Grundlage geschaffen werden, Prozesse besser zu verstehen und die Produktion folgender Produktgenerationen zu verbessern. µm Bild 1: Messung der Belastung durch einen Stanzprozess -4,97-2,00-1,00-4,00-7,06 Bild 2: Simulation der Deformation und Kräfte, die durch das Ausstanzen auf den Sensor wirken Teilprojekt T05: Verfahren und Werkzeugmaschine zur Applikation und Integration substratloser modularer Mikrosensoren Dr.-Ing. M. C. Wurz (IMPT) wurz@impt.uni-hannover.de M.Sc. L. Jogschies (IMPT) jogschies@impt.uni-hannover.de Bild 3: Designoptimierung des flexiblen Magnetfeldsensors 9
16 Laserstrukturierung von Dünnschicht-Dehnungssensoren auf Oberflächen SFB 653 Laserstrukturierung von Dünnschicht-Dehnungssensoren auf Oberflächen Dünnschicht-Dehnungssensoren integriert in technische Oberflächen erlauben die Erfassung von statischen und dynamischen Kräften und Momenten, die auf das Bauteil wirken. Das Funktionsprinzip basiert auf dem piezoresistiven Effekt: Eine Verformung des Bauteils führt zu einer proportionalen Änderung des elektrischen Widerstands eines Messgitters, welches auf der Bauteiloberfläche aufgebracht ist. Während dieses Messprinzip bereits lange bekannt und beispielsweise als aufgeklebte Foliensensoren eingesetzt wird, besteht die besondere Herausforderung in der technischen Umsetzung zur Herstellung von integrierten Sensoren auf Serienbauteilen, bei denen lange Lebensdauer, geringe Langzeitdrift und hohe Robustheit gegenüber äußeren Einflüssen erforderlich sind. Das in diesem Projekt untersuchte Herstellungsverfahren basiert auf Dünnschichttechnologien, wobei die Sensorstruktur direkt auf dem Bauteil aufgebaut und somit integraler Bestandteil der Oberfläche wird (Bild 1). Hierdurch entsteht ein sehr kompakter Aufbau mit nur wenigen Mikrometern Gesamtschichtdicke. Probleme, die durch den Einsatz von Polymeren bei herkömmlich geklebten Foliensensoren auftreten können (Drift durch Temperatur- oder Feuchtigkeitseinflüsse), werden umgangen. Zusammen mit dem Industriepartner Schaeffler Technologies AG & Co. KG wird die Verfahrenskombination, bestehend aus einer vollflächigen Beschichtung der Bauteiloberfläche und einer anschließenden selektiven Laserstrukturierung zur Erzeugung der Messgitter, untersucht. Dieser Ansatz erlaubt die Herstellung von Dünnschichtsensoren auf gekrümmten Oberflächen und ermöglicht vielfältige Einsatzszenarien, etwa in Taschen und Kerben oder auf Wellen und komplexeren Bauteiloberflächen. Die Strukturierung der Sensoren erfolgt durch direkten Laserabtrag mittels ultrakurzer Laserpulse in Kombination mit hochdynamischen Laser- Scannern. Hierdurch werden hohe Bearbeitungsauflösungen im Mikrometerbereich, geringe Prozesszeiten von typischerweise wenigen Sekunden und eine hohe Bearbeitungsflexibilität etwa beim Abgleichen von Messbrücken erreicht. Bild 2 zeigt den prinzipiellen Aufbau einer Laser- Strukturierungsanlage, die eine Bearbeitung von gekrümmten Bauteiloberflächen zulässt. Die im Rahmen dieses Transferprojektes hergestellten Sensoren finden Anwendung in der gentelligenten Werkzeugmaschine (Bild 3), um Prozesskräfte zu erfassen und somit Rückschlüsse auf den Zerspanungsprozess ziehen zu können. Weiterhin werden die wesentlichen Projektziele zur Prozesszeit, Sensorqualität und Ausschussrate anhand eines Bauteils aus einem Radlager überprüft, um letztlich Aussagen zur Wirtschaftlichkeit in der industriellen Anwendung treffen zu können. Messgitter auf diesem Demonstrator-Bauteil sind in Bild 4 dargestellt. Bild 1: Schichtaufbau eines Dünnschicht-Dehnungssensors Bild 2: Wesentliche Komponenten zur 3D-Oberflächenbearbeitung Bild 3: Laserstrukturierte Sensorik verbaut in der Werkzeugmaschine Teilprojekt T03: 3D-Laserstrukturierung von sensorischen Schichtsystemen - Entwicklung eines industriellen Demonstrators Prof. L. Overmeyer (ITA) ludger.overmeyer@ita.unihannover.de Dr.-Ing. O. Suttmann (LZH) o.suttmann@lzh.de Bild 4: Mäanderstrukturen auf Radlagerring. Die Strukturierungsdauer beträgt < 10 s je Messgitter 10
17 SFB 653 Sensorisches Spannsystem zur Überwachung des System- und Prozesszustands Sensorisches Spannsystem zur Überwachung des System- und Prozesszustands Die Entwicklung und Erforschung eines sensorischen Spannsystems für die industrielle Praxis ist Ziel des Transferprojektes T02. Hierzu werden prototypische Elemente für ein hydraulisches Spannsystem entwickelt, welche typischerweise in der Serienfertigung eingesetzt werden. In enger Zusammenarbeit mit den Firmen Römheld GmbH und ReiKam GmbH wird vor dem Hintergrund realer Anwendungsszenarien ein sensorisches Spannsystem erarbeitet, prototypisch realisiert und analysiert. Über die sensorische Erfassung von Prozesszuständen hinaus wird der Zustand des Spannsystems selbst überwacht. Fehlerzustände wie Verschleiß, Überlast, und Fehlspannung werden durch das System eigenständig erkannt. Neben der Sensorintegration stellen eine hohe Systemrobustheit, die Energieund Datenübertragung auf rotierende Systeme und die Berücksichtigung von Kostenaspekten besondere Anforderungen an das System. Ein geeignetes Anwendungsszenario stellt eine Spannvorrichtung aus dem Portfolio der Firma ReiKam dar (Bild 1). Zur Fixierung des Bauteils im Arbeitsraum dienen drei hydraulische Schwenkspanner und ein hydraulischer Abstützer der Fa. Römheld, die jeweils sensorisch ausgestattet werden. Dazu sind Dehnungsmessstreifen und Temperatursensoren für die Integration in die Spannelemente ausgewählt worden. Die analogen Signalwege werden hierbei möglichst kurz gehalten, um Störeinflüsse auf die Signale zu reduzieren. Zu diesem Zweck wird jedes sensorische Spannelement mit einer Messelektronik in unmittelbarer Nähe verbunden, die der Digitalisierung und Signalvorverarbeitung dient. Des Weiteren verfügt die Messelektronik über eine CANBus-Schnittstelle, sodass eine flexible Erweiterung des Spannsystems um weitere sensorische Spannelemente erfolgen kann. Zur Versorgung des Systems mit elektrischer und hydraulischer Energie wird eine hybride Schnittstelle für rotierende Systeme entwickelt. Die elektrische Energieübertragung wird kontaktlos über eine induktive Kopplung realisiert. Die Integration der Induktionsspulen und der notwendigen elektrischen Schaltungen in eine hydraulische Drehdurchführung erfolgt in enger Kooperation mit dem Industriepartner Römheld, der langjährige Erfahrung mit der Herstellung hydraulischer Drehdurchführungen hat. Basierend auf FEM-Analysen sind Spannelemente (Bild 2) mit Dehnungssensoren ausgestattet worden. Diese fühlenden Schwenkspanner sind in der Lage den hydraulischen Druck und extern angreifende Kräfte zu messen und die Kolbenposition im gespannten Zustand zu erfassen und ebnen damit den Weg in die digitalisierte Fertigung im Sinne der Industrie 4.0. Die Validierung des Gesamtsystems erfolgt mit mehreren sensorischen Spannelementen in praktischen Zerspanversuchen unter industrienahen Einsatzbedingungen. Bild 1: Anwendungsszenario Bild 2: FEM-basierte Sensorintegration am Schwenkspanner Teilprojekt T02: Sensorisches Spannsystem zur Überwachung des System- und Prozesszustandes Prof. B. Denkena (IFW) Dipl.-Ing. J. Kiesner (IFW)
18 Integration von Temperierkanälen zur Erfassung von Temperaturen im Schmiedeprozess SFB 653 Integration von Temperierkanälen zur Erfassung von Temperaturen im Schmiedeprozess Eine geregelte Temperierung von Werkzeugen (Gesenke) in der Warmmassivumformung ermöglicht eine effektive Vermeidung von Ausschuss sowie die Verkürzung von Prozessunterbrechungen durch die Einstellung eines stabilen Temperaturniveaus (Bild 1). Weiterhin führt die Reduzierung von thermisch bedingtem Verschleiß zu einer Verringerung der Werkzeugkosten. Insbesondere bei der Fertigung von Bauteilen mit höchster Genauigkeit, wie sie etwa beim Präzisionschmieden gefordert wird, kann sich der Mehraufwand einer Gesenktemperierung rechnen. Die Herstellung von Kühlkanälen erfolgt mittels bewährter Prozesstechnik aus der Pulvermetallurgie (Kaltpressen, Sintern, Nachverdichten). Durch die Einbringung eines niedrig schmelzenden Fremdelementes, wie z.b. Kupfer in einer Stahlpulvermatrix, können schnell und kostengünstig Kavitäten innerhalb dieser erzeugt werden. Hierbei macht man sich Kapillarkräfte zu Nutze, die dafür sorgen, dass das schmelzflüssige Kupfer während des Sinterprozesses in die umgebende poröse Stahlmatrix fließt (Bild 2). In der Herstellungsphase kann durch die Anwendung der FEM die Lage des Fremdelementes in der Pulvermatrix nach dem Pressen sowie Sintern numerisch genau vorhergesagt werden. Weiterhin sorgt die Simulation der Temperaturverteilung während der Nutzungsphase für eine optimierte Auslegung der Temperierkanäle, unter Berücksichtigung aller Randbedingungen (Bild 3). Die Temperierung des Gesenks erfolgt über ein handelsübliches Temperiergerät (Temperiermedium: Öl) und erlaubt eine Aufheizung des Gesenkkerns (Grundtemperatur) auf bis zu 250 C. Die automatisierte Regelung der Gesenktemperatur erfolgt wahlweise durch die Überwachung des Zu- und Abflusses, oder über einen externen Temperaturfühler (Bild 4). Für die Analyse der Kühleffizienz der eingebrachten Temperierkanäle wird mit einem faseroptischen Messsystem die Temperaturverteilung aufgezeichnet. Das verwendete System detektiert dabei das je Laserscan entstehende Raleigh-Rückstreusignal aufgrund der lokalen Brechzahlschwankungen längs des verwendeten Glasfasersensors. Durch die hochaufgelöste Messung der Temperatur entlang der Glasfaser (alle 1,25 mm ein Messwert), kann die sich einstellende Temperaturverteilung im Werkzeug exakt aufgenommen werden. Das System zeichnet sich weiterhin durch eine hohe Messempfindlichkeit aus (Temperaturänderungen von 0,1 C werden erfasst), weiterhin ist die parallele Abfrage aller Sensoren bis zu einer Rate von 24 Hz möglich. Die in der Praxis gesammelten Messwerte werden dem Gestaltungsansatz zur Designoptimierung wieder zugeführt. Teilprojekt E3: Herstellung gentelligenter Sinterbauteile aus Metallpulver Prof. B.-A. Behrens (IFUM) behrens@ifum.uni-hannover.de M.Sc. I. Malik (IFUM) malik@ifum.uni-hannover.de Dipl.-Ing. M. Bonhage (IFUM) bonhage@ifum.uni-hannover.de Bild 1: CAD Modell eines Schmiedegesenks mit integrierten Temperierkanälen Bild 2: Kavitäten hergestellt durch Flüssigphasensintern mit Kupfer Bild 3: Simulierte Temperaturverteilung im Schmiedegesenk mit Temperierkanälen Bild 4: Realisierte Anbindung des Schmiedegesenks (Prototyp) an eine externe Temperierung 12
19 SFB 653 Bauteilinhärente Energieübertragung und optische Signalkopplung Bauteilinhärente Energieübertragung und optische Signalkopplung Im Rahmen des Teilprojekts werden Microfasers in die Bauteilrandzone integriert. Die Fasern dienen einer bauteilinhärenten optischen Signalkopplung. Dadurch ist eine Datenkommunikation möglich, die unempflindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen ist und eine hohe Bandbreite anbietet. Weiterhin können die sensorischen Eigenschaften der integrierten Fasern benutzt werden, um ortsaufgelöst physikalische Änderungen, wie Temperaturdifferenzen oder Dehnungen, entlang der Faser zu messen. Die Fasern werden direkt, oder in einer Nute auf die Oberfläche integriert (Bild 1). Der Kern der eingesetzten Fasern wird in einer Kombination aus einem Extrudier- und einem Ziehverfahren hergestellt. Dabei kann der Kerndurchmesser zwischen 10 und 50 µm variert werden. Für die Verbindung mit Bauteiloberfläche wird ein UV-aushärtender Kleber eingesetzt. Neben der inhärenten Verbindung zur Substratoberfläche dient das Polymer ebenfalls als Mantelmaterial. Somit entsteht eine Totalreflexion an der Grenzfläche zwischen Faserkern und Mantel, wodurch die optische Signalleitung gewährleistet wird. Für die Applikation des Polymers wird ein Mikrodispensierverfahren eingesetzt (Bild 2). Im ersten Schritt wird die untere Mantellage dispensiert. Danach wird der Faserkern darauf platziert. Anschließend wird die obere Mantellage dispensiert und mit UV-Strahlung ausgehärtet. Für die Vervollständigung der Kommunikationsstrecke müssen die Lichtwellenleiter mit einem Strahlensender bzw. Empfänger gekoppelt werden. Dafür werden die Stirnflächen mit einem Mikroschleifverfahren bearbeitet. Die realisierten oberflächen-inhärenten Lichtwellenleiter werden in den sensorischen Schlitten des Teilprojeks N1 integriert und ermöglichen die Kommunikation mit der im Teilprojekt S1 erforschten Mikrosensorik. Für die automatisierte Integration der Lichtwellenleiter in die Bauteiloberfläche wird ein Portalrobotersystem erforscht. In diesem System werden die notwendigen Arbeitsschritte, wie Positionierung, Mikrodispensieren, Aushärtung und Stirnflächenbearbeitung durchgeführt. Die Konzeption des Systems erfordert die Berücksichtigung der Fehlerund Toleranzbereiche der eingesetzten Prozesse. Darüber hinaus sind die notwendigen Positioniergenauigkeiten für eine effiziente Signalkopplung zu ermitteln. Hierfür werden optische Simulation und experimentelle Versuchsplannung eingesetzt. Mit dem automatisierten System wird es möglich, in einer einzigen Maschine funktionsfähige und oberflächenintegrierte Lichtwellenleiter herzustellen. Bild 1: Bauteilinhärente Lichtwellenleiter Bild 2: Mikrodispensierprozess Teilprojekt K1: Dispensierte Fasern zur bauteilinhärenten Energieübertragung und optischen Signalkopplung Prof. L. Overmeyer (ITA) Dipl.-Ing. B. Hachicha (ITA) Bild 3: Beispiel Bauteilinhärenter Lichtwellenleiter (O. Variante 1, U. Variante 2) 13
20 4 mm Opto-elektronische Integration eines Hochfrequenz-Kommunikationssystems SFB 653 Opto-elektronische Integration eines Hochfrequenz-Kommunikationssystems Eine Vision von Industrie 4.0 besteht darin, dass sich der Fertigungsablauf eines Bauteils flexibel an geänderte Rahmenbedingungen in der Produktion anpasst und die Fertigungsbedingungen kontinuierlich verbessert werden. Dies setzt voraus, dass die Bauteile eindeutig identifizierbar und ortbar sind. Weiterhin ist es von Vorteil, Fertigungsdaten sowie Bauteilbelastungen direkt auf dem Bauteil zu speichern und diese Daten drahtlos an eine äußere Infrastruktur zu übermitteln. Am Institut für Hochfrequenztechnik und Funksysteme (HFT) werden gemeinsam mit dem Intitut für Transport- und Automatisierungstechnik (ITA) Konzepte für bauteilintegrierte Kommunikationssysteme erforscht (Bild 1). Vordergründiges Ziel ist es, ein metallisches Bauteil zu befähigen, bauteilrelevante Daten und Informationen während des gesamten Lebenszyklus zu speichern, zu verarbeiten und mit seiner Umgebung auszutauschen. Die Datenübertragung zwischen Bauteil und Lese-/Schreibgerät erfolgt drahtlos durch elektromagnetische Wellen. Als Betriebsfrequenz wird das weltweit zugelassene ISM-Band bei 24 GHz genutzt. Die Energieversorgung erfolgt allein über Solarzellen. Gegenüber konventionellen funkbasierten Systemen hat dies den Vorteil, dass das Kommunikationsmodul batterielos arbeitet. Bei ausreichendem Umgebungslicht kann das System ohne externe Lichtquelle betrieben werden. Um eine kontinuierliche Prozessüberwachung von Belastungsgrößen wie Temperatur oder Dehnung zu ermöglichen, kann dieses Modul durch Sensorik zu einem autarken Sensorknoten ergänzt werden. Die Aufgabe der Datenverarbeitung, speicherung sowie Kommunikation mit der Umgebung übernimmt ein Ultra-Low-Power Mikrocontroller. Bisher konnte eine bidirektionale Datenübertragung mit einer Datenrate von 80 kbit/s bei einer Übertragungsreichweite von bis zu 0,5 Metern erzielt werden. Um das Anwendungsspektrum zu erweitern, wird in der aktuellen Förderperiode ein neues Aufbaukonzept untersucht (Bild 2). Antenne und HF- Schaltung werden auf einen 200 µm dünnen Glasträger strukturiert und direkt mit der darunterliegenden Solarzelle fusioniert. Die Antenne und die HF-Schaltung sollten idealerweise eine hohe optische Transparenz aufweisen, um den Schattenwurf auf die Solarzelle zu minimieren. Weiterhin sind die einzelnen Schichten elektrisch zu kontaktieren. Diese Verbindungstechnik kann direkt in das Gehäuse integriert werden, da dieses als dreidimensionaler Schaltungsträger (3D-MID) ausgeführt wird und gleichzeitig als Träger der Digitalschaltung fungiert. Eine Gegenüberstellung der beiden Konzepte macht deutlich, dass das Einbauvolumen mit dem neuen Aufbau deutlich reduziert werden kann (Bild 3). Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass sich die Kommunikationsreichweite und die Datenrate noch weiter vergrößern lassen. Metallisches Bauteil Kommunikationsmodul Bild 1: Funktionsweise des Kommunikationssystems MID-Träger mit Digitalschaltung Lese-/ Schreibgerät Lichtquelle Solarzelle Antenne + HF- Schaltung Schutzschicht Signalführung zw. Schichten Bild 2: Optisch versorgtes Kommunikationsmodul mit elektro-optischer Fusion; oben: Explosionsansicht; unten: 3D-Ansicht Teilprojekt L2: Opto-elektronische Integration eines HF- Kommunikationssystems für gentelligente Bauteile Dr.-Ing. B. Geck (HFT) geck@hft.uni-hannover.de Dipl.-Ing. Q. H. Dao (HFT) dao@hft.uni-hannover.de Prof. L. Overmeyer (ITA) ita@ita.uni-hannover.de M.Sc. A. Skubacz-Feucht (ITA) alexandra.skubacz@ita.unihannover.de Bild 3: Intelligente Schrauben als Demonstratoren; links: neues Aufbaukonzept; rechts: alter Aufbau 14
21 SFB 653 Potenziale für die Arbeits- und Prozessplanung nutzen Potenziale für die Arbeits- und Prozessplanung nutzen Die effiziente Planung und Steuerung von Fertigungsprozessen erfordern mit zunehmendem Schwerpunkt auf Wirtschaftlichkeit mehr Informationen über den Fertigungszustand. Gerade in der Einzelteilfertigung ist die Planung von Fertigungsprozessen bedingt durch das stetig wechselnde Produktportfolio aufwendig und datenhungrig. Um diesen Datenhunger zu stillen, werden im SFB zunächst diejenigen Daten verarbeitet, die im Unternehmen ohnehin anfallen, jedoch bisher nicht genutzt werden. Beispielsweise können Daten der Steuerung einer modernen Werkzeugmaschine verwendet werden, um BDE-Terminals überflüssig zu machen. Der aktuelle Auftragszustand kann über die Kombination von NC- Programmname und Programmfortschritt sekundengenau erfasst und in die Planung überführt werden. Auch Prozessszustände können beispielsweise über die Leistungen der Antriebe überwacht werden. Wo die verfügbaren Daten nicht ausreichen, können durch die Einbringung zusätzlicher Sensoren Informationslücken geschlossen werden (vgl. Prozessinformationen zur Optimierung von Fertigungsprozessen erschließen, S. 5). Der Anteil neu einzubringender Sensoren wird dadurch auf ein wirtschaftliches Minimum reduziert. Das Potenzial der vorhandenen Daten erschließen jedoch erst die Verarbeitungsalgorithmen. Beispielsweise wird die Qualität der Prozessplanung und der Fertigungssteuerung signifikant gesteigert, indem Daten vergangener Arbeitsvorgänge sekundengenau erfasst und aufbereitet werden. Hohe Produktivität und Produktqualität sind wesentlich, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Eine Herausforderung an die Unternehmen dabei ist die zunehmende Individualisierung der Fertigung. Sie führt in der Einzelteil- und Kleinserienfertigung zu einer hohen Variantenvielfalt und zu einer Vielzahl möglicher Prozesse und Prozessketten. Die Rückführung aktueller Zustandsinformationen aus der Werkzeugmaschine in die Prozessüberwachung ermöglicht zum Beispiel eine anlernfreie Prozessüberwachung bei der Einzelteilfertigung. Einzeltechnologien Fertigungsinformationen für die adaptive Fertigungplanung und steuerung Anlernfreie Prozessüberwachung für die Einzelteilfertigung 15
22 Fertigungsinformationen für die adaptive Fertigungsplanung und steuerung SFB 653 Fertigungsinformationen für die adaptive Fertigungsplanung und steuerung Das Ziel des Teilprojektes K2 ist die Kombination von bauteilinhärenten Werkstück- und Fertigungsinformationen für die Planung und Überwachung der Fertigung von cyberphysische gentelligenten Bauteilen entsprechend der Vision Industrie 4.0. Dabei verfolgt das Teilprojekt K2 die Vision einer gentelligenten Fertigungskette als Gesamtkonzept zur Einbindung von bauteilinhärenten Werkstückinformationen sowie Informationen aus gentelligenten Systemkomponenten. Die gentelligente Fertigungskette (Bild 1) basiert auf einer physischen Fertigungskette und einer prozessübergreifenden Informationskette im Sinne des Internet der Dinge. Sie ermöglicht das Weiterleiten, Verbinden und Verwerten von gentelligenten Informationen in Form von Werkstückund Systeminformationen über den gesamten Produktentstehungsprozess. Bereits in der Prozessplanungsphase, mit der entwickelten Adaptiven Prozessplanung (APP) (Bild 1/1), werden bauteileigene Informationen genutzt, um Prozesspläne für nachfolgende Fertigungsprozesse zu erstellen. Mit den in der Prozessplanungsphase festgelegten Prozessstellgrößen werden mit einer Prozesssimulation systematische Einflussfaktoren auf die geometrische Bauteilqualität prognostiziert (Bild 1/2). Dieses Vorgehen ermöglicht die Virtualisierung konventioneller Einfahrprozesse. In einem virtuellen Fertigungsprozess werden relevante Zielgrößen des Fertigungsprozesses, wie bspw. Prozesskräfte und Oberflächengüten, prognostiziert. Die Prozesssimulation ermöglicht weiterhin die Definition von Grenzwerten für eine Überwachung des Fertigungsprozesses (Bild 1/3). Dort werden Prozessgrößen von gentelligenten Komponenten in der Werkzeugmaschine erfasst und kritische Prozesszustände identifiziert (Bild 2). Prozessstörungen werden so wirkstellennah erkannt und durch eine integrierte Logik ausgewertet (Bild 1/4). Durch die Verfügbarkeit von Fertigungsinformationen (bspw. Prozessstörungen) in der Adaptiven Prozessplanung (Bild 1/1) werden Umplanungen auf Basis alternativer Prozessketten vorgenommen und damit störungsbedingte Engpässe vermieden (Bild 3). Alternative Fertigungsrouten werden dabei auf dem Bauteilspeicher abgelegt und kontinuierlich auf den aktuellen Stand gebracht. Durchläuft das gentelligente Bauteil die Fertigung, so wird seine Informationsbasis kontinuierlich erweitert. Verlässt das Bauteil die Fertigung, trägt es sämtliche bauteilspezifischen Fertigungsdaten inhärent in sich. Ein Zugriff auf diese Daten ermöglicht nicht nur die Nachverfolgung des Fertigungsprozesses, sondern hilft auch bei der Ursachenforschung von Langzeitschäden. Die Aktuellen Forschungsschwerpunkte im Teilprojekt sind die Implementierung und Validierung der Adaptiven Prozessplanung auf Teilarbeitsvorgangsebene sowie die Rückführung von Fertigungsinformationen in die Prozessplanung. Weiterhin wird an einem geometrischen Prozessmodell geforscht, um in einem virtuellen Einfahrprozess detaillierte Bauteilqualitäten prognostizieren zu können. Zudem wird eine modellbasierte Prozessüberwachung zur Interpretation und Rückführung von Prozessfehlern in die Prozessplanung entwickelt. Bild 1: Prinzip der Gentelligenten Fertigungskette Bild 2: Prozessüberwachung durch gentelligente Maschinenkomponenten Bild 3: Umfahrung von Engpässen durch alternative Prozesspläne auf dem gentelligenten Bauteil Teilprojekt K2: Planung und Überwachung spanender Fertigungsprozesse auf Basis von Werkstück- und Fertigungsinformationen Prof. B. Denkena (IFW) Dipl.-Ing. K. Doreth
23 SFB 653 Anlernfreie Prozessüberwachung für die Einzelteilfertigung Anlernfreie Prozessüberwachung für die Einzelteilfertigung In der Serienfertigung kommen vielfach Prozessüberwachungsverfahren zum Einsatz, die eine hohe Prozesssicherheit und somit Verfügbarkeit der Produktionsanlage sicherstellen. Diese Überwachungsverfahren müssen an den zu überwachenden Bearbeitungsprozess angelernt werden. Wenn jedoch nur ein einzelnes Teil hergestellt wird, ist ein solches Vorgehen nicht möglich, da entsprechende Lernschritte am Fertigungsprozess nicht durchgeführt werden können. Das Hauptziel dieses Forschungsprojektes war die Erhöhung der Prozesssicherheit von Produktionsanlagen in der Einzelteilfertigung. Dafür wurde ein anlernfreies Prozessüberwachungsverfahren entwickelt, welches eine robuste und zuverlässige Überwachung schon für das erste gefertigte Werkstück ermöglicht. Um die Anlernphase zu ersetzen, wird die Grundlage zur Parametrierung von Überwachungsgrenzen während der Arbeitsvorbereitungsphase durch eine Simulation vorgenommen (siehe Bild 1). Für die simulationsgestützte Parametrierung von Überwachungsgrenzen werden die für die Parametrierung relevanten Informationen aus der Arbeitsvorbereitung (CAD/CAM, NC-Simulation) genutzt. Das konventionelle Anlernen durch zahlreiche Referenzprozesse wird durch eine virtuelle Parametrierung innerhalb der Arbeitsvorbereitungsphase ersetzt. Folglich dient NC-Simulation in der Arbeitsvorbereitungsphase nicht nur zur Validierung und Optimierung des geplanten Fertigungsprozesses, wie sie üblicherweise eingesetzt wird, sondern liefert darüber hinaus die Prozessgrößen, die eine Parametrierung der Überwachungsgrenzen ermöglichen. Der Zugriff auf bestehende Lösungen zur maschinenbasierten Simulation der NC-basierten Achsbewegungen einer Werkzeugmaschine ermöglicht eine wegbasierte Materialabtragssimulation mit dem vom IFW entwickelten Simulationswerkzeug CutS (siehe Bild 2 ). Dazu wird auf Achspositionsdaten aus der Virtuellen Maschine des Projektpartners INDEX-Werke zurückgegriffen. Mit diesen Daten lässt sich die wegbasierte Synchronisation zwischen simulierten Referenzdaten und den aus einem Überwachungssystem des Projektpartners ARTIS erfassten Signalen zur Prozessüberwachung durchführen. Über ein statistisches Verfahren können prozessparallel Alarmgrenzen für die Überwachungsgröße, basierend auf Mess- und Simulationsdaten, generiert werden. Schwerpunkt des Projekts war neben der Entwicklung der Überwachungsmethodik der Transfer der Ergebnisse aus dem SFB 653 in die industrielle Anwendung. Dazu wurde die gesamte Überwachungskette, von der Simulation bis hin zur Überwachung, industrienah abgebildet. Ein Überwachungssystem des Projektpartners Artis GmbH wurde mit der entwickelten Methode parametriert und für die Prozessüberwachung verwendet, wodurch das Gesamtsystem verifiziert werden konnte. Bild 1: Konzept der anlernfreien Prozessüberwachung Teilprojekt T01: Anlernfreie Prozessüberwachung für die Einzelteilfertigung Prof. B. Denkena (IFW) denkena@ifw.uni-hannover.de Dipl.-Phys. T. Neff (IFW) neff@ifw.uni-hannover.de Bild 2: Verknüpfung von NC- und Prozesssimulation 17
24
25 SFB 653 Ausgewählte Veröffentlichungen Ausgewählte Veröffentlichungen Erfassung von Prozesskräften in hochsteifen Strukturen Denkena, B., Litwinski, K., Boujnah, H.: Process Monitoring with a Force Sensitive Axis-Slide for Machine Tools, 2 nd International Conference on System-Integrated Intelligence, Procedia Technology, 2014, 8 Seiten Denkena, B., Litwinski, K.M., Brouwer, D., Boujnah, H.: Design and analysis of a prototypical sensory Z-slide for machine tools, Production Engineering Research and Development, 2012, 6 Seiten Denkena, B., Litwinski, K.M., Brouwer, D., Boujnah, H.: Sensory Z-Slide for Machine Tools, 1 st Joint International Symposium on System-Integrated Intelligence, 2012, 10 Seiten Online-Prozessbewertung durch lernende Feinplanung Krüger, M., Denkena, B.: A model-based approach for monitoring of shape deviations in peripheral milling, International Journal of Advanced Manufacturing Technologies, Vol. 67 (9-12), 2013, S Denkena, B., Schmidt, J., Krüger, M.: Data mining approach for knowledge-based process planning, 2 nd International Conference on System-Integrated Intelligence, Procedia Technology, Vol. 15, 2014, S Krüger, M.: Modellbasierte Online-Bewertung von Fräsprozessen, Dr.-Ing. Dissertation, Leibniz Universität Hannover, 2014 Direktabscheidung ultradünner Sensorik auf Bauteile beliebiger Größe Klaas, D., Rittinger, J., Taptimthong, P., Duesing, J., Wurz, M. C., Rissing, L.: Verwendung von Schattenmasken zur Direktstrukturierung individuell adaptierbarer Sensorik auf technischen Oberflächen, In Proceedings of MikroSystemTechnik Kongress 2015, Karlsruhe, Germany, Oktober 2015 Klaas, D., Taptimthong, P., Jogschies, L., Rissing, L.: Component Integrated Sensors: Deposition of Thin Insulation Layers on Functional Surfaces, Procedia Technology, 2014, 15, S Rittinger, J., Klaas, D., Wurz, M. C., Rissing, L.: Hybrider Fertigungsprozess zur Integration von Drucksensoren auf die Oberfläche von Tellerfedern, In Proceedings of MikroSystemTechnik Kongress 2015, Karlsruhe, Germany, Oktober 2015 Industriegerechte Fertigung: Optimierung folienbasierter Magnetfeldsensoren Jogschies, L., Heitmann, J., Klaas, D., Rissing, L.: Investigations on Strain Behaviour on a Polymer Substrate during a Separation Process, Procedia Technology, 2014, 15, S Rittinger, J., Taptimthong, P., Jogschies, L., Rissing, L.: Impact of different polyimide-based substrates on the soft magnetic properties of NiFe thin films, Smart Sensors, Actuators and MEMS VII, 2015 Laserstrukturierung von Dünnschicht-Dehnungssensoren auf Oberflächen Behrens, B-A., Bouguecha, A., Bouguecha, S. M., Klassen, A., Bonhage, M.: Conception of a hot forging die out of metal powder equipped with inner cooling channels, Powder Metallurgy, Vol. 58 (3), 2015, S Behrens, B.-A., Bonhage, M., Kammler, M., Klassen, A., Vahed, N.: Development of a Powder Metallurgical Self Cooling Forging Die with Inner Cavities, Conference Proceedings of the 2 th International Conference on System- Integrated Intelligence, 2014 Sensorisches Spannsystem zur Überwachung des System- und Prozesszustands Denkena, B. et al.: Industrie 4.0 in der Zerspanung, ZWF, Jahrg. 109, Heft 7-8, 2014, S Denkena, B., Dahlmann, D., Kiesner, J.: Sensor Integration for a Hydraulic Clamping System, SysInt, Procedia Technology, Vol. 15, 2014, S Denkena, B.; Kiesner, J.: Strain gauge based sensing hydraulic fixtures, Mechatronics, 2015, 8 Seiten 19
26 Ausgewählte Veröffentlichungen SFB 653 Integration von Temperierkanälen zur Erfassung von Temperaturen im Schmiedeprozess Behrens, B-A., Bouguecha, A., Bouguecha, S. M., Klassen, A., Bonhage, M.: Conception of a hot forging die out of metal powder equipped with inner cooling channels, Powder Metallurgy, Vol. 58 (3), 2015, S Behrens, B.-A., Bonhage, M., Kammler, M., Klassen, A., Vahed, N.: Development of a Powder Metallurgical Self Cooling Forging Die with Inner Cavities, Conference Proceedings of the 2th International Conference on System- Integrated Intelligence, 2014 Bauteilinhärente Energieübertragung und optische Signalkopplung Hachicha, B., Kuklik, J., Overmeyer, L.: Simulation of Coupling Efficiency for Surface Integration of Optical Waveguides, 6 th International Conference on Modeling, Simulation, and Applied Optimization, 2015, S.1-7 Hachicha, B., Overmeyer, L.: In-Line Production, Optronic Assembly and Packaging of POFs, 2 nd International Conference on System-Integrated Intelligence, 2014, S Wang, Y., Hachicha, B., Overmeyer, L.: Surface Integration of Optoelectronic Components and Polymer Optical Waveguides in Planar Optronic Systems, 2015 Opto-elektronische Integration eines Hochfrequenz-Kommunikationssystems Dao, Q. H., Braun, R., Geck, B.: Design and Investigation of Meshed Patch Antennas for Applications at 24 GHz, European Microwave Conference, 2015 Meyer, J., Dao, Q. H., Geck, B.: 24 GHz RFID Communication System for Product Lifecycle Applications, 2 nd International Conference on System-Integrated Intelligence, 2014 Meyer, J., Dao, Q. H., Geck, B.: Design of a 24 GHz Analog Frontend for an Optically Powered RFID Transponder for the Integration into Metallic Components, European Microwave Conference, 2013 Fertigungsinformationen für die adaptive Fertigungsplanung und steuerung Krüger, M., Denkena, B.: A model-based approach for monitoring of shape deviations in peripheral milling, International Journal of Advanced Manufacturing Technologies, Vol. 67 (9-12), 2013, S Denkena, B., Schmidt, J., Krüger, M.: Data mining approach for knowledge-based process planning. In: Conference Proceedings of the 2 nd International Conference on System-Integrated Intelligence, Procedia Technology, Vol. 15, 2014, S Krüger, M.: Modellbasierte Online-Bewertung von Fräsprozessen. Dr.-Ing. Dissertation, Leibniz Universität Hannover, 2014 Anlernfreie Prozessüberwachung für die Einzelteilfertigung Denkena, B., Fischer, R., Euhus, D., Neff, T.: Simulation based Process Monitoring for Single Item Production without Machine External Sensors, 2 nd International Conference on System-Integrated Intelligence, Procedia Technology, 2014, 8 S. 20
27 SFB 653 Datenspeicherung und Plagiatsschutz Datenspeicherung und Plagiatsschutz Informationen im Bauteil speichern und zweifelsfrei wiedererkennen Ausgewählte Veröffentlichungen
28
29 SFB 653 Informationen im Bauteil speichern und zweifelsfrei wiedererkennen Informationen im Bauteil speichern und zweifelsfrei wiedererkennen Neben der direkten Verarbeitung der im Fertigungsprozess gewonnenen Daten zur Optimierung von Prozessen, ist die Speicherung relevanter Informationen für folgende Prozessschritte oder die anschließende Nutzungsphase des Bauteils unabdingbar. Neben einer zentralen Datenablage auf Serversystemen wird im SFB 653 die dezentrale Datenspeicherung auf dem Bauteil selbst angestrebt. Die physikalische Trennung von Bauteil und zugehöriger Daten wird aufgehoben. Dies ermöglicht es Bauteilen, sich individuell auszuweisen. Ein Bauteil identifiziert sich beispielsweise im Rahmen einer routinemäßigen Wartung und gibt Auskunft über besondere Vorkommnisse während der letzten Nutzungsphase. Bei allen im Folgenden vorgestellten Technologien werden die bauteilbezogenen Daten auf der Bauteiloberfläche bzw. im Bauteilinneren hinterlegt. Sollen gezielt Daten auf dem Bauteil abgelegt werden, kommen aktuierte Fräswerkzeuge zum Einsatz, die durch hochfrequente, axiale Zustellung die Gravur codierter Daten bzw. komplexer Graphiken ermöglichen. Die Informationseinbringung in das Bauteilvolumen im Sinterprozess, die Speicherung von Informationen durch lokale Wärmebehandlung und die magnetische Datenspeicherung sind im SFB entwickelte technische Verfahren, die für die Bauteilidentifizierung genutzt werden: Gefüge werden stellenweise magnetisiert und so eine Codierung von Informationen im Binärsystem vorgenommen. Beim Sintern werden im Urformprozess Identifikationsmerkmale durch Fremdpulver eingebracht und durch lokale Wärmebehandlung werden dreidimensionale Data-Matrix-Codes in die Bauteiloberfläche eingebracht. Ein weiterer Vorteil von untrennbar mit dem Bauteil verbundenen Informationen liegt in der Anwendung als Plagiatsschutz. Allein für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau beläuft sich der Umsatzverlust durch Plagiate jährlich auf etwa acht Milliarden Euro. Ein sicherer Plagiatsschutz ist seit mehr als zehn Jahren ein Forschungsthema im SFB. Das Besondere: Der vorgestellte Plagiatsschutz bei spanend hergestellten Bauteilen kommt ohne zusätzliche Bearbeitungsschritte aus. Spanend gefertigte Bauteile liefern einen sicheren Plagiatsschutz, da ihre Oberfläche einzigartig ist wie ein Fingerabdruck. Zur eindeutigen Identifizierung wird die Oberfläche mit einer Industriekamera gescannt und alle relevanten stochastischen Anteile der Oberfläche werden in einer Datenbank gespeichert. Einzeltechnologien Markierungsfreie Bauteilidentifikation Topografiegestaltung beim Fräsen Datenspeicherung durch Fremdpulver im Sinterprozess Informationsspeicherung und Erfassung von Bauteilbelastungen im Randzonengefüge Magnetische Datenspeicherung im Bauteilvolumen 23
30 Markierungsfreie Bauteilidentifikation SFB 653 Markierungsfreie Bauteilidentifikation Das Teilprojekt E1 hebt die Trennung zwischen Bauteil und zugehörigem Informationsträger auf. Hierzu werden zum einen Randzoneninformationen genutzt, um auf die Belastungshistorie eines Bauteils zu schließen. Zum anderen werden die stochastischen und damit einzigartigen Anteile einer allgemein spanend bearbeiteten Bauteiloberfläche zum Plagiatsschutz verwendet. Ein am TNT verfolgter Forschungsschwerpunkt ist der passive Plagiatsschutz von Bauteilen mit allgemein spanend gefertigter Oberfläche. Durch die mathematische Echtzeitverarbeitung optisch erfasster Oberflächen können Bauteilen, die den gleichen Herstellungsprozess durchlaufen haben, unterschieden werden. Im Schleifprozess beispielsweise kommt es durch Kornverschleiß und -ausbruch zu einer sich ständig ändernden Werkzeuggestalt, die folglich individuelle Bauteiloberflächen erzeugt. Bei der Zerspanung mit geometrisch bestimmter Schneide kommt es durch Werkzeugverschleiß und teilweise ungünstige Spanbildung zu stochastischen Oberflächeneffekten, die ebenfalls zur Identifikation genutzt werden können. Bilder und Abtastungen der Bauteiloberfläche werden über eine kontinuierliche Wavelet Transformation verarbeitet, die um eine Detektion individueller Merkmale erweitert wurde (Bild 2). Die Identifikationsmerkmale sind hier als Kreuze dargestellt. Anzahl sowie Konstellation der Kreuze ergeben einen individuellen Fingerabdruck für jedes einzelne Bauteil. Der Fingerabdruck wird in einer Datenbank mit relevanten Bauteilinformationen abgespeichert und kann jederzeit zum Plagiatsabgleich herangezogen werden (Falsch-Positiv-Rate < ). Die Belastungen eines Bauteils werden üblicherweise über aufwendige Sensorik während der Nutzungsphase erfasst. Am IFW wurde eine Methodik entwickelt, mit der während der Wartung Rückschlüsse auf die ertragenen Lasten der Komponente gezogen werden können. Dafür wird die Veränderung der oberflächennahen Eigenspannungen durch die Belastung verwendet. Der Eigenspannungsgrundzustand wird im Zerspanungsprozess gezielt eingebracht und anschließend für das Bauteil in einer Datenbank hinterlegt. Bei Werkstoffen mit geringer Zugfestigkeit (<1500 MPa) bauen sich die Eigenspannungen je nach Belastungsniveau und Anzahl der Lastwechsel unterschiedlich ab und lassen Rückschlüsse auf die Belastungshistorie zu. Bild 1 zeigt den Weg eines Bauteils von der Herstellung in die Nutzungsphase. In der Nutzungsphase existieren Wartungsintervalle, die dazu genutzt werden können, auf die ertragenen Lasten zurückzuschließen. Ergebnis der Rechnung sind mögliche Belastungsfälle, die sich aus Belastungshöhe und -häufigkeit zusammensetzen. Es ist also möglich, durch die Nutzung inhärenter Werkstoffeigenschaften auf Belastungsinformationen zu schließen und in einem weiteren Schritt die Restlebensdauer des Bauteils abzuschätzen. Bild 1: Bauteillebenszyklus von der Fertigung in die Nutzungsphase Teilprojekt E1: Bauteiloberflächen und randzonen mit gentelligenten Eigenschaften Einzeltechnologien Prof. J. Ostermann (TNT) ostermann@tnt.uni-hannover.de Dipl.-Ing. B. Spitschan (TNT) spitschan@tnt.uni-hannover.de Dr. habil. B. Breidenstein (IFW) breidenstein@ifw.uni-hannover.de M.Sc. R. Hockauf (IFW) hockauf@ifw.uni-hannover.de Bild 2: Individueller Fingerabdruck zur Bauteilidentifikation 24
31 SFB 653 Topografiegestaltung beim Fräsen Topografiegestaltung beim Fräsen Durch die axiale Werkzeuganregung eregeben sich neue Möglichkeiten Zerspanprozesse hinsichtlicher der Werkstücktopogrphie als auch der Produktivitätssteigerung gezielt zu beeinflussen. Kernstück dieses Projektes ist daher ein mit dem Projektpartner SAUER GmbH weiterentwickelter aktorischer Werkzeughalter (Bild 1) der auf einem patentierten Werkzeuprinzip beruht, welches im Teilprojekt E1 erarbeitet wurde. Dieser Werkzeughalter ist mit einem piezoaktor ausgestattet der gezielt angesteuert werden kann. Dadurch wird es möglich unterschiedlicheste im Halter eingespannte Bohr- und Fräswerkzeuge während der konventionellen Drehbewegung zusätlich hochdynamisch entlang der Rotaionsachse um einige Mikrometer auszulenken. Durch eine echtzeitgesteuerte Ansteuerung des Aktors, ermöglicht dieser technische Aufbau die axiale Bewegung innerhalb der Systemgrenzen ( Hz Frequenz und 0 20 µm Amplitude) nahezu frei zu steuern. Dadurch lassen sich Fräs- und Bohrprozesse um drei weitere Parameter wie Auslenkungsform, -frequenz und amplitude erweitern. Werkzeuglösungen die benutzerdefinierte Auslenkungen in diesem Bereich erlauben, existieren bisher noch nicht am Markt. Mittels einer gezielt angeregten einzahnigen Planfräsbearbeitung von Bauteiloberflächen lassen sich so ortsabhänige Variationen der Schnittiefe durchführen. Daraus resultrieren Strukturen von wenigen µm Tiefe auf der Oberfläche. Ähnlich einer CD lassen sich so Binärinformationen einbringen (Bild 2). Dadruch eröffnet sich die Möglichkeit Bauteile innerhalb der Fräsmaschine mit inherenten Informationen bis zu einer Speicherdichte von 200 bit/cm² zu versehen. Die flexible Steuerung des Werkzeuges erlaubt es zudem auch zusammenhängende Strukturen zu erzeugen und so definierte Werstücktopographiegestalltungen durch Muster oder Bilder durchzuführen (Bild 3). Ein weiterer Schwerpunkt bei der Anwendung dieses Werkzeughalters liegt in der Produktivitätssteigerung von Bohrbearbeitungen. Bei langspanenden Metallen kann durch die sich dynamisch verändernden Kontaktbedingungen während der axialen Werkzeuganregung ein vorzeitiger Spanbruch herbeigeführt werden und so die Prozesskräfte gesenkt und infolge auch die Werkzeugstandzeit gesteigert werden. Bei kunstfaserverstärkten Werkstoffen liegt der Fokus auf der sich verändernden Durchtrennungsrichtung der Fasern beim Eintritt und Austritt während der Bohrbearbeitung. Daraus können Bohrlöcher mit weniger Delamination resultieren (Bild 4). Aber auch während der Planfräsbearbeitung kann die axiale Bewegung der Schneiden zur Beeinflussung der resultierenden Eigenspannungszustände in der Bauteiloberfläche und so letztendlich auch der Bauteillebensdauer genutzt werden. Bild 1: Aktorischer Werkzeughalter Bild 2: Informationstragende Mikrostrukturen Bild 3: Individuelle Werkstücktopographiegestalltung Teilprojekt T04: Gentelligente Werkstücktopografiegestaltung und Produktivitätssteigerung geometrisch bestimmter Zerspanprozesse durch axiale Werkzeuganregungen Prof. B. Denkena (IFW) denkena@ifw.uni-hannover.de Dipl.-Ing. A. Seibel (IFW) seibel@ifw.uni-hannover.de Bild 4: Verringerung von Delamination bei der Bohrbearbeitung von CFK 25
32 Datenspeicherung durch Fremdpulver im Sinterprozess SFB 653 Datenspeicherung durch Fremdpulver im Sinterprozess Das Fälschen von Produkten verursacht für die Industrie einen erheblichen finanziellen Schaden. Im Falle minderwertiger Imitate sicherheitsrelevanter Bauteile birgt sie sogar eine Gesundheitsgefährdung. Hieraus resultiert die Nachfrage nach effizienten Möglichkeiten, eigene Bauteile vor Nachahmung zu schützen. Des Weiteren strebt die Industrie nach innovativen Bauteilen, die einen immer größer werdenden Funktionsumfang bieten. Eine wichtige Anforderung stellt etwa die Bauteilüberwachung dar. Sinterbauteile bergen das Potenzial in sich diese Anforderungen zu erfüllen. Das Ziel dieses Teilprojekts ist deshalb die Herstellung gentelligenter (GI) Sinterbauteile. Diese bieten zum einen die Möglichkeit in ihrem Inneren Informationen zu speichern und zum anderen ihren Belastungszustand im Sinne einer Bauteilüberwachung zu erfassen. Im Rahmen der bisherigen Untersuchungen wurden erfolgreich Sinterbauteile mit einer binären Kodierung im Bauteilinneren hergestellt. Die Datenspeicherung erfolgte über die Einbringung von Fremdpartikeln in das Grundpulver (Bild 1). Die Verwendung von Fremdpulver bietet eine große Flexibilität bei der Datenspeicherung. Beispielsweise sind Buchstaben, Ziffern, Symbole oder Barcodes realisierbar (Bild 2). Da sich das Fremdpulver innerhalb des Bauteils befindet, ist die Markierung von außen nicht sichtbar und nachträglich nicht manipulierbar. Das Auslesen der Daten erfolgt zerstörungsfrei und berührungslos, z.b. mit einem Röntgengerät. Fremdpulver und umgebendes Pulver streuen bzw. absorbieren die Röntgenstrahlen unterschiedlich, so dass die Information eindeutig zu rekonstruieren ist (Bild 3). Die Überwachung des Bauteilbelastungszustandes soll über die Integration von geeigneten Fremdelementen (magneto-elastische Schichten) verwirklicht werden. Diese Schichten sind auf eine dünne Trägerschicht aufgebracht und werden im Innern des Bauteils mit dem Pulver verpresst. Bei einer äußeren Belastung werden die Schichten im Innern ausgedehnt, wodurch eine messbare Änderung des Magnetfeldes auftritt. Die Messung der Magnetfeldänderung unter äußerer Belastung erfolgt zerstörungsfrei während des Betriebs mittels geeigneter Wirbelstromsensoren. Nach der Umsetzung der Verfahren sind die Prozessoptimierung und eine Erhöhung der erreichbaren Speicherkapazität sowie die Anwendung auf industriell relevante Bauteile vorgesehen. Bild 1: Applikation der Pulvermarkierung Bild 2: Beispiel für mögliche Kennzeichnungen Teilprojekt E3: Herstellung gentelligenter Sinterbauteile aus Metallpulver Prof. B.-A. Behrens (IFUM) M.Sc. I. Malik (IFUM) Dipl.-Ing. M. Bonhage (IFUM) Bild 3: CT-Aufnahme eines zylindrischen Probekörpers mit Fremdpulver- Markierung 26
33 SFB 653 Informationsspeicherung und Erfassung von Bauteilbelastungen im Randzonengefüge Informationsspeicherung und Erfassung von Bauteilbelastungen im Randzonengefüge Die Motivation für das Teilprojekt S3 leitet sich aus aktuellen Problemstellungen in den Bereichen der Bauteilidentifikation und der Integritätsbewertung insbesondere bei hoch belasteten Bauteilen ab. Fehlende Bauteilkennzeichungen können zu Zuordnungsproblemen und Verzögerungen in Betriebsabläufen sowie unvorhergesehenes Bauteilversagen trotz regelmäßiger Wartung zu Ausfällen von Maschinen und Anlagen führen. Hier bieten moderne Verfahren zur inhärenten Markierung und zum schnellen zerstörungsfreien Auslesen der Belastungshistorie eine Perspektive zur sicheren Identifikation und Zustandsbewertung von Bauteilen und damit zur Reduzierung von Ausfallkosten. Ausgerichtet auf ein breites Anwendungsfeld der Kennzeichnung und Datenspeicherung in Bauteilen aus Stahl- und Leichtmetallwerkstoffen wurde eine Lasertechnik zur lokalen Wärmebehandlung entwickelt, mit der gezielt über Anlassen, Härten und Dispergieren punktuell definiert Gefügezustände in der Bauteilrandzone eingestellt werden können, Bild 1. Mittels hochauflösender Wirbelstrom-Array Technologie, der Harmonischen Analyse von Wirbelstrom Signalen oder der Induktions- Thermografie können diese, durch eine mehrstufige Gefügeänderung eingebrachten, dreidimensionalen Bauteilmarkierungen ausgelesen werden. Mit diesem neuartigen Verfahren markierte Bauteile verfügen über eine gegen äußere Einflüsse robuste Kennzeichnung und einen inhärenten Plagiatsschutz. Hinsichtlich der frühzeitigen Erfassung und Bewertung hoher Bauteilbelastungen und Belastungsfälle wurde ein Sensorkonzepten entwickelt, welches deutlich über den Integrationsgrad bekannter Überwachungstechniken hinausgeht. Dieses Konzept basiert auf der globalen Kaltverfestigung metastabiler austenitischer Werkstoffe und der lokalen Wärmebehandlung des gebildeten Martensits zur Einstellung anwendungsfallspezifischer Dehngrenzwerte in begrenzten Werkstoffbereichen. Hierdurch kann eine hohe Beanspruchung frühzeitig erkannt, inhärent gespeichert und ein Bauteilversagen infolge Überbeanspruchung vermieden werden. Zur Erfassung und Bewertung der vom Bauteil unter mehrachsiger Belastung in Abhängigkeit der Beanspruchung und Lastwechselzahl ertragenen Belastungshistorie wurde eine Wirbelstrom-Sensorarray und Analysetechnik zur Bewertung richtungsempfindlicher Dehngrenzwertsensoren entwickelt (Bild 2). Entsprechend der Ausrichtung des SFB 653 in der 3. Antragsphase ist die Qualifizierung der entwickelten Techniken zur bauteilinhärenten Informationsspeicherung, Belastungssensorik und Analysetechnik zur Erfassung und Charakterisierung der lokalen Randzoneninformation sowie deren Integration in gentelligenten Bauteilen von Demonstratorsystemen beabsichtigt. Teilprojekt S3: Gentelligente Bauteilidentifikation und Integritätsbewertung Prof. H. J. Maier (IW) Dipl.-Ing. S. Barton (IW) Dr.-Ing. W. Reimche (IW) Breite [mm] WS-Signal [SKT] Wirbelstrom-Scan Gefüge-Stufe Länge [mm] W Messlinie Leistung 85 W 105 W Referenz Gefüge-Stufen- Matrix Gefüge- Markierung WS-Matrix Bild 1: Mehrdimensionale Informationsspeicherung Einstellbare Dehngrenzwerte WS-Scan - Belastungssensoren in Kreisform 15 Belastung: 0 MPa Breite [mm] 0 0 Breite [mm] WS-Signal [SKT] WS-Signal [SKT] W R p=950mpa 120 W 130 W Laser-Leistung Länge [mm] 60 R p=900mpa Belastung: 1000 MPa Quer R p=800mpa Anlassstufen Längs W 120 W 130 W Laser-Leistung 0 Länge [mm] R p=950mpa R p=900mpa R p=800mpa Anlassstufen Bild 2: Lokale richtungsempfindliche Dehngrenzwertsensoren zur Belastungserfassung 27
34 Magnetische Datenspeicherung im Bauteilvolumen SFB 653 Magnetische Datenspeicherung im Bauteilvolumen Das Teilprojekt L3 beschäftigt sich mit der Entwicklung einer Methode, Hersteller- und Anwenderdaten magnetisch auf die Oberfläche gentelligenter Komponenten zu speichern (Bild 1). Individuelle und kritische Produktinformationen können somit untrennbar mit der Komponente verknüpft werden. Demzufolge hilft dies dem Hersteller ebenso wie dem Anwender, Nutzerdaten mit einer Komponente zu vereinen. Während der Nutzungsphase können die Lebenserwartung einer Komponente, ihr derzeitiger Zustand und ihre Beanspruchungshistorie abgerufen und somit ihre Wartung effezient geplant werden. Am Ende ihres Lebenszyklus helfen gespeicherte Sicherheitsrichtlinien bei der Entsorgung. In vorigen Bewilligungszeiträumen wurden starre Schreibköpfe aus MnZn Ferritkernen mit 100 µm langem Luftspalt für das induktive Schreiben entwickelt. Während die erste Generation noch eine Breite von 700 µm besaß, konnte diese bei der zweiten auf bis zu 350 µm reduziert werden. In enger Zusammenarbeit mit Teilprojekt E2 und E3 wurden diverse Magnetspeichemedien entwickelt. Zu diesen zählen zum Beispiel gesintertes Mg mit hartmagnetischen γ-fe 2O 3 Partikeln und MgCo 4 Legierungen. Komponenten können diese Medien enthalten oder aus ihnen hergestellt sein. Das Auslesen der gespeicherten Informationen geschieht durch einen GMR-Sensor als Leseelement und einem speziell für Medien mit inhomogener Partikelverteilung entwickelten Algorithmus zur Datenerkennung. Die erreichbare Datendichte, begrenzt durch den zurzeit verwendeten GMR Sensor, beträgt 100 bit/cm 2. In einem typischen Anwendungsbeispiel sind Flughöhen im zweistelligen µm Bereich sowie eine vibrationsarme Umgebung entscheidende Parameter. In der aktuellen Bewilligungsphase liegt der Fokus auf der Systemintegration und Nutzbarkeit. So wird die Datendichte durch Integration des Lesekopfes in den Schreibkopf erhöht. Um Beschädigungen bei hoher Vibration entgegenzuwirken, ist es nötig, den Kopf flexibel und somit immun gegen Stöße zu gestalten. Als flexible Substrate zum Aufbau der funktionellen Einheiten bieten sich Polymere an. Zur Herstellung eines Lese- /Schreibkopfes sind Dünnschichtprozesse entwickelt worden (Bild 2). Aufgrund der hervorragenden Materialeigenschaften und der Kompatibilität mit diesen Prozessen wurde eine Kapton Polyimid Folie als Substrat ausgewählt. Es wurden Vorbehandlungen der Folie sowie Bonding- und Ablöseverfahren bei der Herstellung entwickelt. Der flexible Lese-/Schreibkopf besitzt einen 50 µm langen Luftspalt mit einer Breite von 100 µm. Um die Datenzuverlässigkeit bei erhöhten Temperaturen und magnetischen Störfeldern zu steigern, ist der Gebrauch von Materialien mit höherer Koerzivität nötig. Dieses erfordert wiederum eine höhere Schreibenergie. Ein vielversprechender Ansatz ist die Nutzung wärmeunterstützter Magnetaufzeichnung, bei der durch das Einbringen thermischer Energie die zum Schreiben notwendige magnetische Feldstärke reduziert wird. Dieser Ansatz wird aktuell vom Teilprojekt L3 verfolgt (Bild 3). Teilprojekt L3: Lesen und Schreiben magnetisch gespeicherter Daten im Bauteilvolumen Dr.-Ing. M. C. Wurz (IMPT) wurz@impt.uni-hannover.de M.Sc. M.Eng. P. Taptimthong (IMPT) taptimthong@impt.uni-hannover.de Lesekopf Medium Bild 1: Magnetische Speicherung auf der Oberfläche gentelligenter Komponente Schreibkopfkern Schreibkopf Datenspur Bild 2: Funktionelle Einheiten des Lese- /Schreibkopfes auf einem Kapton Film Lese-/Schreibeinheit Spule Spalt 500 µm Lesekopf Strahlengang Bild 3: Ein Modellkonzept zum wärmeunterstützten Magnetschreiben für gentelligente Komponenten. 28
35 SFB 653 Ausgewählte Veröffentlichungen Ausgewählte Veröffentlichungen Markierungsfreie Bauteilidentifikation Dragon, R., Mörke, T., Rosenhahn, B., Ostermann, J.: Fingerprints for Machines - Characterization and Optical Identification of Grinding Imprints, DAGM Conference, 2011, 10 Seiten Topografiegestaltung beim Fräsen Köhler, J., Seibel, A.: FTS-based face milling of micro structures, 3 rd CIRP Global Web Conference, Procedia CIRP 28, 2015, S Denkena, B., Köhler, J., Seibel. A.: Experimental Analysis of Cutting Forces in actuated Face Milling of Micro Patterns, SYSINT nd International Conference on System-Integrated Intelligence, 2014, S Datenspeicherung durch Fremdpulver im Sinterprozess Behrens, B.-A., Vahed, N., Kammler, M.: Functional Sintered Parts with Adapted Structures, Proceedings, Materials Science & Technology, 2013 Behrens, B.-A., Vahed, N., Kammler. M.: Manufacturing of Functional Sintered Parts with Inherently Stored Information and Integrated Status Monitoring, Euro PM2012 Congress, 2012 Behrens, B.-A., Vahed, N., Gastan, E., Lange, F.: Experimental and Numerical Investigation on Manufacturing Methods of PM Components with Integrated Information Storage, Journal of Advanced Manufacturing Systems, 10 (1), 2011, S Informationsspeicherung und Erfassung von Bauteilbelastungen im Randzonengefüge Mroz, G.: Entwicklung von Techniken zur bauteilinhärenten Informationsspeicherung und Erfassung von Bauteilbelastungen, Dr.-Ing. Dissertation, Leibniz Universität Hannover, 2013 Mroz, G., Reimche, W., Bach, Fr.-W.: The use of component s edge region as inherent information carriers and loading indicators, Proc. 1 st Joint International Symposium on System-integrated Intelligence, 2012 Mroz, G., Reimche, W., Bach, Fr.-W.: Frühzeitige Erfassung erhöhter Bauteilbeanspruchung mit lokalen Dehngrenzwertsensoren, DGZfP-Jahrestagung, 2011 Magnetische Datenspeicherung im Bauteilvolumen Taptimthong, P., Rittinger, J., Wurz, M. C., Rissing, L.: Flexible Magnetic Writing / Reading System: Polyimide Film as Flexible Substrate. Procedia Technology, 2014, 15, S Demminger, C., Klose, C., Taptimthong, P., Maier H. J.: Material-inherent data storage using magnetic magnesiumcobalt alloys. Procedia Technology, 2014, 15, S Rittinger J., Taptimthong P., Jogschies L., Wurz M. C., Rissing L.: Impact of different polyimide-based substrates on the soft magnetic properties of NiFe thin films In: Proc. Of Smart Sensors, Actuators, and MEMS VII, and Cyber Physical Systems, 95171R,
36
37 SFB 653 Instandhaltung und Produktoptimierung Instandhaltung und Produktoptimierung Informationen aus dem Lebenszyklus für die Instandhaltungsplanung und Gestaltoptimierung nutzen Ausgewählte Veröffentlichungen
38
39 SFB 653 Informationen aus dem Lebenszyklus für die Instandhaltungsplanung und Gestaltoptimierung nutzen Informationen aus dem Lebenszyklus für die Instandhaltungsplanung und Gestaltoptimierung nutzen Bauteile mit sensitiven Eigenschaften, die Informationen während ihrer Nutzung speichern können, bieten ein enormes Potenzial. Reale Daten aus der Nutzungsphase eines Bauteils lösen Modelle und Simulationen ab: Herstellungskosten können minimiert, eine Bauteiloptimierung, eine Instandhaltungsplanung und eine Lebensdauerprognose auf der Grundlage tatsächlicher Belastungen durchgeführt werden. Gegenüber konventionellen Bauteilen sind die im Sonderforschungsbereich 653 Gentelligente Bauteile im Lebenszyklus (SFB) entwickelten Bauteile mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet. Sie erfassen und speichern u. a. Belastungen während ihres Betriebs. Ein im SFB entwickelter Radträger ist beispielsweise durch seine spezielle magnetische Magnesiumlegierung belastungssensitiv. Er erfasst Lastspannungen und speichert die Informationen im Material selbst. Zusätzliche Mess- und Speichertechnik ist nicht notwendig. Die Integration eines Wirbelstromsensors ermöglicht darüber hinaus eine dynamische Erfassung der Belastungen. Die gewonnenen Daten sind damit für nachfolgende Analyseroutinen verfügbar. Sie werden beispielsweise für eine zustandsorientierte Instandhaltung genutzt: Es können optimale Instandhaltungszeitpunkte für Bauteile ermittelt werden, die einerseits eine hohe Ausnutzung des Restnutzungspotenzials und andererseits eine Minimierung des Ausfallsrisikos ermöglichen. Kostenintensive Spontanausfälle werden somit verhindert. Darüber hinaus werden die Belastungsinformationen bei der Gestaltung nachfolgender Bauteilgenerationen genutzt. Mit einem genetischen Algorithmus werden sie für eine optimale Anpassung der Bauteilgestalt ausgewertet, entsprechend ihrer real erfahrenen Belastungen angepasst und unter Berücksichtigung unterschiedlicher Zielkriterien wie Leichtbau oder Steifigkeit entwickelt. Einzeltechnologien Belastungserfassung mittels magnetischer Magnesiumlegierungen Gestaltoptimierung auf Basis von Informationen aus dem Lebenszyklus Zustandsorientierte Instandhaltung auf Basis von Belastungsdaten 33
40 Belastungserfassung mittels magnetischer Magnesiumlegierungen SFB 653 Belastungserfassung mittels magnetischer Magnesiumlegierungen Das Ziel des Teilprojekts E2 ist die Entwicklung und Herstellung von magnetischen Magnesiumlegierungen mit sensorischen Eigenschaften. Diese Werkstoffe können als belastungsempfindliche Sensormaterialien genutzt werden, weil sie die Erfassung relevanter Informationen über die Betriebsbedingungen, insbesondere die anliegenden, dynamischen mechanischen Lasten, werkstoffinhärent über die Änderung ihrer magnetischen Eigenschaften ermöglichen. Diese Änderung, die auf dem Effekt der inversen Magnetostriktion (Villari-Effekt) beruht, kann mit Hilfe moderner Methoden zur zerstörungsfreien Bauteilprüfung und Materialcharakterisierung, etwa der hochauflösenden Wirbelstromtechnik unter Anwendung der Harmonischen-Analyse, im laufenden Betrieb ausgelesen und verarbeitet werden. Mit Hilfe solcher Messdaten der Belastungshistorie kann die zu erwartende Lebensdauer von Bauteilen abgeleitet werden, so dass Wartungsintervalle geplant und nachfolgende Bauteilgenerationen optimiert werden können. Magnesiumlegierungen verfügen aufgrund hoher spezifischer Festigkeiten bei geringer Dichte über großes Leichtbau-Potenzial. Da Magnesium selbst und gebräuchliche Mg-Legierungen nicht über ferromagnetische Eigenschaften verfügen, wurden im TP E2 neue Legierungen auf Basis von Magnesium und Kobalt entwickelt, deren Gefüge Phasen mit deutlich messbaren ferromagnetischen Eigenschaften enthält. Die magnetischen Eigenschaften der Legierungen unter zyklischer Beanspruchung werden in Kooperation mit dem TP S3 mittels der Harmonischen-Analyse von Wirbelstromsignalen bestimmt. Die Messwerte der Harmonischen liefern Aussagen über den momentanen Werkstoffzustand und die Gitterverspannungen infolge der auf die Mg-Proben einwirkenden Kräfte. Hierbei zeigen verschiedene Varianten der Legierungen für die Online-Belastungsmessung geeignetes, sensorisches Verhalten (Bild 1). Diese Methode kann eingesetzt werden, um die mechanischen Lasten an bspw. einer Schubstrebe aus stranggepresstem MgCo4Zn1RE zu überwachen (Bild 2). Darüber hinaus ermöglichen die magnetischen Mg-Legierungen eine werkstoffinhärente Datenspeicherung. In Bild 3 sind vergleichend zwei gemessene Hysteresekurven der gießtechnisch hergestellten Legierungen gezeigt. Das Ziel in der dritten Förderperiode ist die werkstoffinhärente Vererbung von Information über lokale Überbelastungen im Bauteil, die während der Nutzungsphase auftreten. Dazu werden die verbleibenden Änderungen der Harmonischen Messsignale nach mechanischer Überbeanspruchung der betroffenen Bauteilbereiche untersucht und Konzepte zur Nutzung dieser Informationen durch die Messung der belastungsabhängigen magnetischen Eigenschaften erarbeitet. Bild 1: Korrelation von mechanischer Last und Messwerten der 3. Harmonischen des Wirbelstromsignals Bild 2: Gentelligenter Pushrod eines Formula Student Fahrzeugs mit Wirbelstromsonde zur Messung der magnetischen Eigenschaften Teilprojekt E2: Magnetische Magnesiumlegierungen Prof. H. J. Maier (IW) maier@iw.uni-hannover.de Dipl.-Ing. C. Demminger (IW) demminger@iw.uni-hannover.de Dr.-Ing. C. Klose (IW) klose@iw.uni-hannover.de Bild 3: Vergleich der magnetischen Hysterese der Legierungen MgCo4 und MgCo4Zn2 34
41 SFB 653 Gestaltoptimierung auf Basis von Informationen aus dem Lebenzyklus Gestaltoptimierung auf Basis von Informationen aus dem Lebenzyklus Der Fokus in den Untersuchungen liegt in der Erforschung, Erarbeitung und Adaption von Methoden, Werkzeugen, Hilfsmitteln sowie Prozessen für die Unterstützung einer ganzheitlichen Produktentwicklung. Darunter fallen Betrachtungen hinsichtlich performanter und effizienter Prozessabläufe zur Erzeugung eines hohen Automatisierungsgrades. Dies beinhaltet ebenso die Integration von Wissen, wie beispielsweise neuartiger KBE- Methoden, als auch eine erhöhte Flexibilität innerhalb der Prozesskette. Mit den Enablern aus dem SFB kann die Produktentwicklung unterstützt werden, indem eine generationsübergreifende Prozessbetrachtung durchgeführt wird. Dieser Prozess wird als technische Vererbung bezeichnet und ist definiert als: Überführung gesammelter und verifizierter Informationen aus der Produktion und Nutzung zur nächstfolgenden Anpassung. In allen Phasen des Produktlebenszykluses entsteht eine Vielzahl von Daten, welche durch die Aufbereitung zu Informationen für die Entwicklung der nachfolgenden Generation verwendet werden können. Durch eine Weiterentwicklung von Spezifikations- und Modellierungstechniken kann der Lebenszyklus für diverse technische Systeme sehr genau hinsichtlich der Informationsflüsse abgebildet werden. Darüber hinaus ermöglicht eine nachfolgende Analyse die Identifikation entwicklungsrelevanter Informationen. Durch die Berücksichtigung physikalischer, menschbezogener und ökonomischer Aspekte sowie technologischer Trends, können Hypothesen zum eigenen Produkt aufgestellt werden. Um diese Fragestellungen über den Lebenszyklus zu beantworten, kann einerseits auf eine bestehende Messtechnik zurückgegriffen werden. Andererseits können gentelligente Enabler aus einem Konstruktionskatalog ausgewählt und ins technische System integriert werden, um die Monitoringstrategie zu realisieren. Damit einhergehend werden Data Mining Methoden direkt in die Phasen der Produktentwicklung integriert, sodass die Datenmenge auf ein Minimum reduziert wird, indem die Messdaten typischen Situationen des technischen Systems im Lebenszyklus zugeordnet werden können. Durch die Prozesse der technischen Vererbung können somit Informationen produktspezifisch erzeugt werden, welche auf diese Weise einen großen Vorteil für die Entwicklung der Nachfolgegeneration generieren. Weiterhin werden im Rahmen des TPs virtuelle Produktmodelle entwickelt, die eine Integration von Nutzungsinformationen unterstützen. Mit Hilfe dieser Modelle wird eine automatische Anpassung von Produkten an veränderte Nutzungsbedingungen ermöglicht. Mit dem Fokus auf mechanische Komponenten wird ein generativer parametrischer Modellierungsansatz, siehe Bild 1, entwickelt. Über die Kopplung von generativen parametrischen Modellen mit Simulationsumgebungen wird mittels genetischen Optimierungsalgorithmen sowohl konzeptionell, als auch geometrisch eine Bauteilgestalt erzeugt, die optimal an die jeweiligen Nutzungsinformationen angepasst ist, siehe Bild 2. Bild 1: Generative Design Approach Bild 2: Optimierte Radträger Teilprojekt N4: Gestaltevolution durch algorithmisierte Informationsrückführung aus dem Produktlebenszyklus Prof. R. Lachmayer (IPeG) Dr. I. Mozgova (IPeG)
42 Zustandsorientierte Instandhaltung auf Basis von Belastungsdaten SFB 653 Zustandsorientierte Instandhaltung auf Basis von Belastungsdaten Im Kontext der Industrie 4.0 wird der Instandhaltung im Allgemeinen ein Kosteneinsparpotenzial von bis zu 30% zugesprochen. Dieses Potenzial kann beispielsweise durch eine effizientere Ersatzteillogistik, eine dynamische Priorisierung von Instandhaltungszeitpunkten und -maßnahmen oder eine zustandsorientierte Instandhaltung erschlossen werden. Gegenwärtig wird das Ausfallverhalten von Bauteilen für die Ermittlung präventiver Instandhaltungszeitpunkte auf Basis von Zuverlässigkeitsmodellen beschrieben. Aktuelle Daten hinsichtlich eines möglichen Ausfalls in der Zukunft, können jedoch häufig nicht aufwandsarm und kontinuierlich aufgenommen werden und sind meist nicht eindeutig interpretierbar. Des Weiteren zielt ein Großteil aktueller Überwachungen nur auf die Abnutzungsart Verschleiß, aber nicht auf die Werkstoffermüdung ab. In diesem Zusammenhang bietet die zustandsorientierte Instandhaltung insbesondere hinsichtlich der Vermeidung von Spontanausfällen ermüdungsgefährdeter Bauteile ein hohes Potenzial. Ermüdungserscheinungen von Bauteilen sind äußerlich am Betriebsverhalten nicht erkennbar und die Überwachung ist zudem im laufenden Betrieb derzeit nur schwer möglich. Im Teilprojekt N3 wird daher eine Methodik zur bauteilstatus-getriebenen Instandhaltung gentelligenter Bauteile (Bild 1) entwickelt, welche auf Basis von Erfahrungsdaten den Ermüdungszustand ableiten und somit teure Spontanausfälle sicherheitsrelevanter Bauteile vermeiden soll. Diese bezieht Belastungsdaten aus der Bauteilfertigung ebenso wie aus der Nutzungsphase mit ein und ermöglicht so eine Prognose der Restlebensdauer der Bauteile, wodurch zustandsorientierte Instandhaltungszeitpunkte geplant werden können (Bild 2). Zur Realisierung dieses Vorhabens bestehen innerhalb des Sonderforschungsbereichs verschiedene Kooperationen. Um neben den Daten aus der Nutzungsphase auch Informationen aus der Bauteilfertigung berücksichtigen zu können, werden für ausgewählte Demonstrationsszenarien die erforderlichen Daten, wie beispielsweise Fertigungsparameter und Prozesskräfte durch die Teilprojekte K2 und N1 bereitgestellt. Diese nutzen zur Detektion der auftretenden Kräfte unter anderem die im Teilprojekt S1 entwickelten Mikrosensoren. Geplant sind im Teilprojekt N3 darüber hinaus die Erweiterung der beschriebenen Methodik hinsichtlich der Ermittlung von Systemzuständen sowie ein intelligenter Auswahlalgorithmus zur Identifikation optimaler Instandhaltungsmaßnahmen. Hierdurch können das Nutzungspotenzial von Bauteilen zunehmend ausgeschöpft und die Instandhaltungskosten minimiert werden. Bild 1: Instandhaltungsstrategien Teilprojekt N3: Bauteilstatus-getriebene Instandhaltung Prof. P. Nyhuis (IFA) Dipl.-Ing. M. Quirico (IFA) Dipl.-Ing. M. Winkens (IFA) Bild 2: Zustandsorientierte Instandhaltung gentelligenter Bauteile 36
43 SFB 653 Ausgewählte Veröffentlichungen Ausgewählte Veröffentlichungen Belastungserfassung mittels magnetischer Magnesiumlegierungen Klose, C., Demminger, C., Mroz, G., Reimche, W., Bach, Fr.-W., Maier, H. J., Kerber K.: Influence of Cobalt on the Properties of Load-Sensitive Magnesium Alloys, In: Sensors 13, 2013, S Demminger, C., Klose, C., Taptimthong, P., Maier, H. J.: Material-inherent data storage using magnetic magnesiumcobalt alloys, Procedia Technology 5, 2nd International Conference of System-Integrated Intelligence, 2014, S Klose, C., Demminger, C., Maier, H. J.: Microstructure and Properties of Cobalt- and Zinc-Containing Magnetic Magnesium Alloys Processed by High-Pressure Die Casting, Magnesium technology. Proceedings of a symposium sponsored by Magnesium Committee of the Light Metals Division of the Minerals, 2015, S Gestaltoptimierung auf Basis von Informationen aus dem Lebenszyklus Lachmayer, R., Gottwald, P.: An Approach to Integrate Data Mining into the Development Process. In: Modelling and management of engineering processes, 2015 (1), S Lachmayer, R., Gottwald, P.: Integrated Development by the consideration of product experiences. In: Proceedings of the 10 th International Workshop on Integrated Design Engineering, 2015, S Sauthoff, B., Lachmayer, R.: Generative Design Approach for Modelling of Large Design Spaces. In: Proceedings of the 7 th World Conference on Mass Customization, Personalization, and Co-Creation (MCPC 2014), 2014, S Zustandsorientierte Instandhaltung auf Basis von Belastungsdaten Winkens, M., Schmidt, M., Nyhuis, P.: Zustandsorientierte Instandhaltung - Potentiale bei der Lebensdauerprognose von Bauteilen im Sonderforschungsbereich 653, Werkstatttechnik online 105 (3), 2015, S Winkens, M., Goerke, M., Nyhuis, P.: Use of Life Cycle Data for Condition-Oriented Maintenance, In: International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering 9 (4), 2015, S Denkena, B., Mörke, T., Krüger, M., Schmidt, J., Boujnah, H., Meyer, J., Gottwald, P., Spitschan, B., Winkens, M.: Development and first applications of gentelligent components over their lifecycle, CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology 7 (2), 2014, S
44
45 SFB 653 Verstetigung der entwickelten Technologien Entwickelte Technologien verstetigen Production Innovations Network
46
47 SFB 653 Production Innovations Network Production Innovations Network Das Production Innovations Network (PIN) wurde Anfang 2015 aus dem Sonderforschungsbereich Gentelligente Bauteile im Lebenszyklus heraus gegründet. Mit dem PIN werden die im SFB geschaffenen Grundlagen für die vernetzte Produktion einer Industrie 4.0 in die Anwendung gebracht. Ziel des Netzwerkes ist es, den Dialog von Entwicklern, Herstellern, Anwendern und Forschern zu fördern und gemeinsame Projekte von Industrieunternehmen untereinander und mit der Wissenschaft zu initiieren. Was ist der industrielle Bedarf? Was kann die Forschung schon liefern? Welche Lücken von der Forschung zur Praxis müssen wir schließen? Dies sind Fragen, die im PIN behandelt werden vor dem Hintergrund, die Digitalisierung und Vernetzung der Produktion in konkrete anwendungsbezogene und bedarfsgerechte Projekte umzusetzen. Wesentliches Anliegen des Production Innovations Network ist es, aus einzelnen Industrie-4.0-Anwendungen durchdachte Strategien abzuleiten, und es durch die Zusammenarbeit im Neztwerk auch kleinen und mittelständischen Unternehmen zu erlauben, im Sinne von Industrie 4.0 zukunftsfähig zu werden. Zur Geschichte: Mehr als 70 Unternehmen waren am 15. Januar 2015 der Einladung ins Produktionstechnische Zentrum der Leibniz Universität Hannover gefolgt. Sie konnten in den Versuchsfeldern live sehen, was mit Industrie-4.0-Anwendungen aus der Grundlagenforschung bereits möglich ist, und sie diskutierten, wie man den massiven Veränderungen, die auf die Unternehmen zukommen, gemeinsam erfolgreich begegnen kann. Neben elf Forschungsinstituten hat das PIN derzeit zwölf Firmenmitglieder und die IHK Hannover als Fördermitglied. Der Startschuss: Beim ersten Arbeitstreffen am stellten die Forschungsinstitute des PIN ihre Expertisen zu Industrie 4.0 und die Firmen ihre Bedarfe, Kompetenzen und Ressourcen zum Thema vor. Zwei Arbeitsgruppen - zur Produktion und Instandhaltung erarbeiteten sechs Leitthemen: 1. Sensorik / (dezentrale) Vorverarbeitung Das Erfassen von Informationen ist die Grundlage für Industrie 4.0, für eine Digitalisierung der Wirtschaft. Sensoren, die die Ermittlung neuer Informationen ermöglichen, sind dafür ein wesentlicher Bestandteil gerade im Produktionsbereich. Im PIN entwickeln und nutzen wir Sensoren, die direkt auf die Bauteiloberfläche strukturiert werden oder auf Folien basieren, die nur wenige Mikrometer stark sind. Diese Verfahren steigern die Sensitivität um den Faktor 15. Durch ihre geringe Größe und ihr Herstellungsverfahren werden darüber hinaus völlig neue Positionierungen der Sensoren ermöglicht beispielsweise in Kerben oder auf stark gekrümmten Oberflächen. 2. Kommunikation / Energieversorgung Speziell bei beweglichen Komponenten ist eine verlässliche drahtlose Datenübertragung unabdingbar. Komponenten müssen unterbrechungsfrei mit Energie versorgt werden. Wie können Lichtleitfasern im Werkzeugmaschinenumfeld ideal integriert werden? Welches Potenzial und welche Einsatzmöglichkeiten bietet die Hochfrequenz-Funkkommunikation mit energieautarken Funkzellen im 24 GHz Bereich in metallischen Strukturen? An Lösungen wird im PIN gearbeitet. 3. Auswertung der Informationen (Big Data / Maschinenlernen) Daten haben nur dann einen wirtschaftlichen Wert, wenn sie korrekt genutzt werden. Das PIN entwickelt bedarfsgerechte Auswertungsverfahren für unterschiedliche Anwendungsfälle. Die Expertise der Mitglieder bietet in Kombination mit dem Know-how von elf Forschungsinstituten Expertenwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Produktionstechnik. Diese Wissensbasis in Kombination mit realen Anforderungen der Industrie ermöglicht es dem PIN, Maschinen- und Produktionsdaten in Wissen umzuwandeln und Nutzen für eine selbstständige Prozessoptimierung und -planung zu schaffen. 4. Intelligente Datenkombinationen Wissen, das aus Daten gewonnen wird, muss genutzt werden, um Entscheidungen herbeizuführen. Assistenz und Autonomie sind dabei die Schlüsselbegriffe für eine intelligente Kombination von Daten, um neue Informationen für Entscheidungen zu gewinnen. Beide Aspekte, Assistenz und Autonomie, werden im Rahmen des PIN behandelt. 5. Standardisierung / Sicherheit Wo Komponenten miteinander agieren, sind Standards erforderlich, um eine flexible Integration zu ermöglichen. Darüber hinaus muss eine Digitalisierung eine hohe Verlässlichkeit aufweisen. Der Schutz vor Sabotage oder Spionage und der Schutz der Per- 41
48 Production Innovations Network SFB 653 sönlichkeitsrechte sind Schwerpunkte, die im PIN bearbeitet werden. 6. Mitarbeiterschulungen, Arbeitswelten, rechtliche Aspekte Auch in der Fabrik der Zukunft wird der Mensch eine zentrale, wenn auch veränderte Rolle spielen. Das PIN beschäftigt sich mit den neuen Anforderungen an die Arbeit und die Menschen sowie mit den Möglichkeiten ihrer optimalen Unterstützung. Aktuelle Projekte Drei Projekte sind 2015 im PIN direkt gestartet. Zentrale Fragestellungen dabei sind: Welche Daten werden von den Endanwendern benötigt? Welche Schnittstellen sind an den Maschinen der Mitglieder vorhanden? Industrie-4.0-Check-Ups: Um die Bedarfe, Expertisen und Potenziale zu Industrie 4.0 zu ermitteln, führt das PIN Industrie-Check-Ups bei den PIN-Partnern durch. Aus den Ergebnissen der Check-Ups werden Projekte entwickelt. Unterschieden wird dabei in Implementierungs- und Entwicklungsprojekte. Die Implementierungsprojekte sollen mit den Expertisen und Potenzialen der Partner realisiert werden. Im Idealfall entsteht kein zusätzlicher Forschungsbedarf. Falls Lücken sichtbar werden, die nur mit zusätzlichem Forschungsaufwand zu schließen sind, werden dafür langfristige Projekte (Entwicklungsprojekte) initiiert, die über Fördermittel finanziert werden sollen (ZIM-Projekte, DFG-Projekte etc.). Datenerhebung: Das Projekt zur Datenerhebung im realen Produktionsprozess wird bei einem Endanwender oder am Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen umgesetzt. Das Projekt beinhaltet die Zusammenführung von Daten aus einer Produktionsmaschine sowie korrespondierender Daten aus der Qualitätssicherung. Ziel ist die Bildung eines Datenpools zur Korrelation von Prozess- und Qualitätsdaten. Nach Zusammenführung der Daten erfolgen eine Kosten-Nutzen-Abschätzung sowie die Bestimmung vorhandener Lücken der konventionellen Technologien. Die Daten werden innerhalb des PIN für die Analyse und Visualisierung zur Verfügung gestellt. Interaktive Instandhaltung: Die mobile Lösung zur interaktiven Instandhaltung ermöglicht es, interaktive Informationen zur korrekten Durchführung von IH- Maßnahmen an Fertigungsanlagen zur Verfügung zu stellen. Dazu werden im Projekt QR-Tags auf Anlagenkomponenten zur Lokalisierung und Identifikation visuell erfasst und mittels Beamer oder Laser visuelle Markierungen zur Unterstützung der jeweiligen Arbeitsschritte projiziert. Eine Tonausgabe der Handlungsanweisungen unterstützt die Nutzerführung. Diese kann personenindividuell gestaltet werden und dient somit auch der Schulung unerfahrener Mitarbeiter. Ziel ist es, dadurch die Flexibilität des Mitarbeitereinsatzes zu erhöhen. Unerfahrene erhalten viel Assistenz über das System. Die Assistenz wird über den Lernprozess dann immer weiter verringert, um routinierte Arbeitsabläufe nicht zu verlangsamen. Das Einbinden von Fertigungsdaten zur zustandsbasierten Instandhaltung als Predictive Maintenance ist grundsätzlich möglich. Weitere Themen für längerfristige Entwicklungsprojekte: - Hochflexible sensorische Spannmittel für Schweißund Zerspanprozesse - Direktstrukturierung von Sensoren auf Funktionskomponenten - Hochgeschwindigkeits-Funkkommunikation im Maschinenumfeld - Efficient Quality - Matchingplanung Teilprojekt Ö: Zielgruppenspezifische Netzwerkarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit Prof. B. Denkena (IFW) denkena@ifw.uni-hannover.de M.A. G. Kuiper (IFW) kuiper@ifw.uni-hannover.de Weitere Infos zum Production Innovations Network: 42
49 SFB 653 Rahmeninformationen zum Sonderforschungsbereich 653 Rahmeninformationen zum Sonderforschungsbereich 653 Übersicht der geförderten Projekte Übersicht der beteiligten Institute
50
51 SFB 653 Übersicht der geförderten Projekte Übersicht der geförderten Projekte E Informationen einbringen E1 Bauteiloberflächen und randzonen mit gentelligenten Eigenschaften Prof. B. Denkena Dr. habil. B. Breidenstein Prof. J. Ostermann E2 Magnetische Magnesiumlegierungen Prof. H. J. Maier IW E3 Herstellung gentelligenter Sinterbauteile aus Metallpulver Prof. B.-A. Behrens IFUM E4 S Magnetische Konditionierung und Mikrostrukturierung von Bauteiloberflächen mittels Laserstrahlung Informationen sammeln Prof. L. Overmeyer S1 Modulare, mehrfunktionale Mikrosensorik Dr.-Ing. M. C. Wurz IMPT S2 Umformtechnische Herstellung mechanischer Belastungssensoren durch Einbringen lokaler Dehnungen Prof. B.-A. Behrens S3 Gentelligente Bauteilidentifikation und Integritätsbewertung Prof. H. J. Maier Dr.-Ing. W. Reimche IFW IFW TNT ITA IFUM IW IW K Informationen kombinieren K1 Dispensierte Wellenleiter zur bauteilihärenten Energieübertragung und optischen Signalkopplung Prof. L. Overmeyer ITA K2 Planung und Überwachung spanender Fertigungsprozesse auf Basis von Werkstück- und Fertigungsinformationen Prof. B. Denkena IFW K3 Echtzeitfähige Planung und Steuerung der Montage auf Basis bauteilinhärenter Informationen Prof. P. Nyhuis IFA L L2 Informationen ein-/auslesen Opto-elektronische Integration eines HF-Kommunikationssystems für gentelligente Bauteile Prof. L. Overmeyer Dr.-Ing. B. Geck L3 Lesen und Schreiben magnetisch gespeicherter Daten Dr.-Ing. M. C. Wurz IMPT N Informationen nutzen N1 Gentelligente Maschinenkomponenten für Werkzeugmaschinen Prof. B. Denkena IFW N3 Bauteilstatus-getriebene Instandhaltung Prof. P. Nyhuis IFA N4 Gestaltevolution durch algorithmisierte Informationsrückführung aus dem Produktlebenszyklus Prof. R. Lachmayer Dr.-Ing. I. Mozgova ITA HFT IPeG IPeG Ö Öffentlichkeitsarbeit Zielgruppenspezifische Netzwerkarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit Prof. B. Denkena IFW 45
52 Übersicht der geförderten Projekte SFB 653 T Transferprojekt T01 Anlernfreie Prozessüberwachung für die Einzelteilfertigung Prof. B. Denkena IFW T02 T03 T04 T05 Sensorisches Spannsystem zur Überwachung des System- und Prozesszustandes 3D-Laserstrukturierung von sensorischen Schichtsystemen - Entwicklung eines industriellen Demonstrators Gentelligente Werkstücktopografiegestaltung und Produktivitätssteigerung geometrisch bestimmter Zerspanprozesse durch axiale Werkzeuganregungen Verfahren und Werkzeugsystem zur Applikation und Integration von substratlosen modularen Mikrosensoren Prof. B. Denkena Prof. L. Overmeyer Prof. B. Denkena Dr.-Ing. M. C. Wurz IFW ITA IFW IMPT 46
53 SFB 653 Übersicht der geförderten Institute Übersicht der geförderten Institute Institut für Fabrikanlagen und Logistik Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Nyhuis Produktionstechnisches Zentrum Hannover An der Universität Garbsen Tel. +49 (0) Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen Prof. Dr.-Ing. Berend Denkena Produktionstechnisches Zentrum Hannover An der Universität Garbsen Tel. +49 (0) Institut für Hochfrequenztechnik und Funksysteme Dr.-Ing. Bernd Geck Appelstr. 9 a Hannover Tel. +49 (0) Institut für Informationsverarbeitung Prof. Dr.-Ing. Jörn Ostermann Appelstr. 9 a Hannover Tel. +49 (0) Institut für Mikroproduktionstechnik Prof. Dr.-Ing. Lutz Rissing* Produktionstechnisches Zentrum Hannover An der Universität Garbsen Tel. +49 (0) Institut für Produktentwicklung und Gerätebau Prof. Dr.-Ing. Roland Lachmayer Leibniz Universität Hannover Welfengarten 1A Hannover Tel. +49 (0) * zur Zeit beurlaubt, kommissarische Leitung durch Prof. Dr.-Ing. H. J. Maier 47
54 Übersicht der geförderten Institute SFB 653 Institut für Transport- und Automatisierungstechnik Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer Produktionstechnisches Zentrum Hannover An der Universität Garbsen Tel. +49 (0) Institut für Umformtechnik und Umformmaschinen Prof. Dr.-Ing. Bernd-Arno Behrens Produktionstechnisches Zentrum Hannover An der Universität Garbsen Tel. +49 (0) Institut für Werkstoffkunde Prof. Dr.-Ing. Hans Jürgen Maier Produktionstechnisches Zentrum Hannover An der Universität Garbsen Tel. +49 (0) Laser Zentrum Hannover e.v. Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer Hollerithallee Hannover Tel. +49 (0)
Prozessinformationen für die Fertigung
 Sonderforschungsbereich 653 Leibniz Universität Hannover Prozessinformationen für die Fertigung Garbsen, 15. Januar 2015 Prof. Dr.-Ing. L. Rissing Leibniz Universität Hannover Rückführung von Zustandsinformationen
Sonderforschungsbereich 653 Leibniz Universität Hannover Prozessinformationen für die Fertigung Garbsen, 15. Januar 2015 Prof. Dr.-Ing. L. Rissing Leibniz Universität Hannover Rückführung von Zustandsinformationen
Industrie 4.0. Integrative Produktion. Aachener Perspektiven. Aachener Perspektiven. Industrie 4.0. Zu diesem Buch
 Zu diesem Buch»Industrie 4.0«zählt zu den Zukunftsprojekten der Hightech-Strategie der Bundesregierung. Sie umfasst nicht nur neue Formen intelligenter Produktions- und Automatisierungstechnik, sondern
Zu diesem Buch»Industrie 4.0«zählt zu den Zukunftsprojekten der Hightech-Strategie der Bundesregierung. Sie umfasst nicht nur neue Formen intelligenter Produktions- und Automatisierungstechnik, sondern
Fenster- und Türtechnologie. Roto Lean Die Beratung für effiziente Fensterfertigung
 Fenster- und Türtechnologie Roto Lean Die Beratung für effiziente Fensterfertigung Fertigungs- Optimierungs- Team Roto Lean Arbeitsplatzgestaltung Fertigung im Fluss Lager- und Logistikorganisation Mitarbeiter-Organisation
Fenster- und Türtechnologie Roto Lean Die Beratung für effiziente Fensterfertigung Fertigungs- Optimierungs- Team Roto Lean Arbeitsplatzgestaltung Fertigung im Fluss Lager- und Logistikorganisation Mitarbeiter-Organisation
Intelligente Vernetzung für die Produktionstechnik von morgen
 Intelligente Vernetzung für die Produktionstechnik von morgen Roland Bent Geschäftsführung Phoenix Contact GmbH & Co.KG PHOENIX CONTACT Kurzportrait Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Blomberg Marktführer
Intelligente Vernetzung für die Produktionstechnik von morgen Roland Bent Geschäftsführung Phoenix Contact GmbH & Co.KG PHOENIX CONTACT Kurzportrait Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Blomberg Marktführer
Hylight Innovative Hybrid-Leichtbautechnologie für die Automobilindustrie
 Hylight Innovative Hybrid-Leichtbautechnologie für die Automobilindustrie Hochschule trifft Mittelstand 13. Juli 2011 IKV, Campus Melaten, Aachen Dipl.-Ing. Klaus Küsters Gliederung Anwendung von Hybridbauteilen
Hylight Innovative Hybrid-Leichtbautechnologie für die Automobilindustrie Hochschule trifft Mittelstand 13. Juli 2011 IKV, Campus Melaten, Aachen Dipl.-Ing. Klaus Küsters Gliederung Anwendung von Hybridbauteilen
Neues Verfahren zur Roboterzielführung ohne Kalibrierung
 Lernende Roboterführung Roboteraugen werden autonomer, leistungsfähiger und genauer Neues Verfahren zur Roboterzielführung ohne Kalibrierung Unter dem Namen AURA (Adaptive Uncalibrated Robot Automation)
Lernende Roboterführung Roboteraugen werden autonomer, leistungsfähiger und genauer Neues Verfahren zur Roboterzielführung ohne Kalibrierung Unter dem Namen AURA (Adaptive Uncalibrated Robot Automation)
Makrem Kadachi. Kriterien für eine simulationskonforme Abbildung von Materialflusssystemen. Herbert Utz Verlag München
 Makrem Kadachi Kriterien für eine simulationskonforme Abbildung von Materialflusssystemen Herbert Utz Verlag München Zugl.: München, Techn. Univ., Diss., 2003 Bibliografische Information Der Deutschen
Makrem Kadachi Kriterien für eine simulationskonforme Abbildung von Materialflusssystemen Herbert Utz Verlag München Zugl.: München, Techn. Univ., Diss., 2003 Bibliografische Information Der Deutschen
Hydrauliksysteme für CNC-Abkantpressen....sicher, präzise, dynamisch
 Hydrauliksysteme für CNC-Abkantpressen...sicher, präzise, dynamisch 1 Umformprozesse moderner CNC- Abkantpressen unterliegen hohen Anforderungen an Präzision und Produktivität bei absoluter Bediensicherheit.
Hydrauliksysteme für CNC-Abkantpressen...sicher, präzise, dynamisch 1 Umformprozesse moderner CNC- Abkantpressen unterliegen hohen Anforderungen an Präzision und Produktivität bei absoluter Bediensicherheit.
Integrierte Informationen und Werkzeuge für Simulationsprojekte
 Pressemitteilung der MAGMA GmbH MAGMA GmbH Kackertstraße 11 D-52072 Aachen Telefon +49 241 8 89 01-0 Fax +49 241 8 89 01-60 info@magmasoft.de www.magmasoft.de MAGMA 5, die neue Software-Generation für
Pressemitteilung der MAGMA GmbH MAGMA GmbH Kackertstraße 11 D-52072 Aachen Telefon +49 241 8 89 01-0 Fax +49 241 8 89 01-60 info@magmasoft.de www.magmasoft.de MAGMA 5, die neue Software-Generation für
WESTO Hydraulik GmbH August-Euler-Straße 5 D-50259 Pulheim T +49 2238 3022-0 info@westo.de www.westo.de
 NACHWEIS VON WASSER IN ÖLEN Der Sensor NP330-F eignet sich zur OnlineMessung des absoluten Wassergehaltes in Mineral- und Esterölen. Er hat sich seit Jahren u.a. zur Erkennung von Wassereinbrüchen an Ölkühlern
NACHWEIS VON WASSER IN ÖLEN Der Sensor NP330-F eignet sich zur OnlineMessung des absoluten Wassergehaltes in Mineral- und Esterölen. Er hat sich seit Jahren u.a. zur Erkennung von Wassereinbrüchen an Ölkühlern
Anwendungsbeispiel: Reverse Engineering. Luft-/Raumfahrt: Nachrüsten von BLACK HAWK Helikoptern
 Anwendungsbeispiel: Reverse Engineering Luft-/Raumfahrt: Nachrüsten von BLACK HAWK Helikoptern Messsysteme: ATOS, TRITOP Keywords: Rumpf-Außenhaut, Flächenrückführung, CAD-Daten Um die elektronischen Systeme
Anwendungsbeispiel: Reverse Engineering Luft-/Raumfahrt: Nachrüsten von BLACK HAWK Helikoptern Messsysteme: ATOS, TRITOP Keywords: Rumpf-Außenhaut, Flächenrückführung, CAD-Daten Um die elektronischen Systeme
Virtuelle und physische Welt kombinieren
 Virtuelle und physische Welt kombinieren Innovationen bei Siemens Presse- und Analysten-Event 8. Dezember 2015 Norbert Gaus, Corporate Technology siemens.com/innovationen Siemens-Lösungen verbinden Digitalisierung
Virtuelle und physische Welt kombinieren Innovationen bei Siemens Presse- und Analysten-Event 8. Dezember 2015 Norbert Gaus, Corporate Technology siemens.com/innovationen Siemens-Lösungen verbinden Digitalisierung
AKKREDITIERTES MESSLABOR COMPUTERTOMOGRAFIE GEOMETRISCHE VORHALTUNG REVERSE ENGINEERING VERZUGSANALYSE PROZESSOPTIMIERUNG WERKZEUG KORREKTUR
 AKKREDITIERTES MESSLABOR COMPUTERTOMOGRAFIE GEOMETRISCHE VORHALTUNG REVERSE ENGINEERING VERZUGSANALYSE PROZESSOPTIMIERUNG WERKZEUG KORREKTUR Unsere Vision Wir sind ein innovativer und kompetenter Dienstleistungs-
AKKREDITIERTES MESSLABOR COMPUTERTOMOGRAFIE GEOMETRISCHE VORHALTUNG REVERSE ENGINEERING VERZUGSANALYSE PROZESSOPTIMIERUNG WERKZEUG KORREKTUR Unsere Vision Wir sind ein innovativer und kompetenter Dienstleistungs-
STETS IN GUTEN HÄNDEN. Ihre Technik. unsere Stärke.
 STETS IN GUTEN HÄNDEN Ihre Technik. Mit Sicherheit unsere Stärke. UNTERNEHMEN ERFAHRUNG, FLEXIBILITÄT UND QUALITÄT. UNSERE ERFOLGSFAKTOREN. Kompetent, flexibel und herstellerunabhängig sorgen wir für den
STETS IN GUTEN HÄNDEN Ihre Technik. Mit Sicherheit unsere Stärke. UNTERNEHMEN ERFAHRUNG, FLEXIBILITÄT UND QUALITÄT. UNSERE ERFOLGSFAKTOREN. Kompetent, flexibel und herstellerunabhängig sorgen wir für den
FOREnergy die energieflexible Fabrik
 FOREnergy die energieflexible Fabrik 4. A³ Wissenschaftsdialog Energie "Virtuelle Kraftwerke - Intelligente Netze - Energiespeicherung" 23. November 2012, Universität Augsburg Peter Tzscheutschler Technische
FOREnergy die energieflexible Fabrik 4. A³ Wissenschaftsdialog Energie "Virtuelle Kraftwerke - Intelligente Netze - Energiespeicherung" 23. November 2012, Universität Augsburg Peter Tzscheutschler Technische
ELHA-MASCHINENBAU Liemke KG
 ELHA-MASCHINENBAU Liemke KG DAS UNTERNEHMEN ELHA-MASCHINENBAU Liemke KG Familiengeführter Betrieb in der dritten Generation Ihr Partner für anspruchsvolle Zerspanungssaufgaben 240 Mitarbeiter entwickeln,
ELHA-MASCHINENBAU Liemke KG DAS UNTERNEHMEN ELHA-MASCHINENBAU Liemke KG Familiengeführter Betrieb in der dritten Generation Ihr Partner für anspruchsvolle Zerspanungssaufgaben 240 Mitarbeiter entwickeln,
Das Büro im Wandel der Zeit.
 Das Büro im Wandel der Zeit. Büroräume und deren Einrichtung haben sich grundlegend verändert und werden sich auch weiterhin im Wandel befinden. Wo es einmal eine klare Unterscheidungen zwischen Arbeitsbereichen,
Das Büro im Wandel der Zeit. Büroräume und deren Einrichtung haben sich grundlegend verändert und werden sich auch weiterhin im Wandel befinden. Wo es einmal eine klare Unterscheidungen zwischen Arbeitsbereichen,
Entscheidungshilfe zur Auswahl Schlanker Produktionssysteme für die Montage von Werkzeugmaschinen
 Schriftenreihe des PTW: "Innovation Fertigungstechnik" Guido Rumpel Entscheidungshilfe zur Auswahl Schlanker Produktionssysteme für die Montage von Werkzeugmaschinen D 17 (Diss. TU Darmstadt) Shaker Verlag
Schriftenreihe des PTW: "Innovation Fertigungstechnik" Guido Rumpel Entscheidungshilfe zur Auswahl Schlanker Produktionssysteme für die Montage von Werkzeugmaschinen D 17 (Diss. TU Darmstadt) Shaker Verlag
Informationen aus der Nutzungsphase
 Sonderforschungsbereich 653 Leibniz Universität Hannover Informationen aus der Nutzungsphase Garbsen, 15. Januar 2015 Prof. Dr.-Ing. R. Lachmayer Leibniz Universität Hannover Vision Gentelligente Bauteile
Sonderforschungsbereich 653 Leibniz Universität Hannover Informationen aus der Nutzungsphase Garbsen, 15. Januar 2015 Prof. Dr.-Ing. R. Lachmayer Leibniz Universität Hannover Vision Gentelligente Bauteile
Industrie 4.0. Geschäftsmodelle 26.02.2016. Ihr Technologie- Dienstleister. Karl-Heinz Flamm Produktmanagement Industrietechnik
 Industrie 4.0 Geschäftsmodelle Ihr Technologie- Dienstleister Karl-Heinz Flamm Produktmanagement Industrietechnik Alexander Bürkle GmbH & Co. KG Technischer Dienstleister [ Konstruktion [ Applikationen
Industrie 4.0 Geschäftsmodelle Ihr Technologie- Dienstleister Karl-Heinz Flamm Produktmanagement Industrietechnik Alexander Bürkle GmbH & Co. KG Technischer Dienstleister [ Konstruktion [ Applikationen
Automation für wandlungsfähige Produktionstechnik auf dem Weg hin zu Industrie 4.0. Johannes Kalhoff
 Automation für wandlungsfähige Produktionstechnik auf dem Weg hin zu Industrie 4.0 Johannes Kalhoff Automation für wandlungsfähige Produktionstechnik auf dem Weg hin zu Industrie 4.0 Warum ist Wandlungsfähige
Automation für wandlungsfähige Produktionstechnik auf dem Weg hin zu Industrie 4.0 Johannes Kalhoff Automation für wandlungsfähige Produktionstechnik auf dem Weg hin zu Industrie 4.0 Warum ist Wandlungsfähige
ENTWICKLUNG UND CHARAKTERISIERUNG STRUKTURIERENDER LASERVERFAHREN FÜR DIE HERSTELLUNG KRISTALLINER SILIZIUM - SOLARZELLEN
 ENTWICKLUNG UND CHARAKTERISIERUNG STRUKTURIERENDER LASERVERFAHREN FÜR DIE HERSTELLUNG KRISTALLINER SILIZIUM - SOLARZELLEN DISSERTATION ZUR ERLANGUNG DES AKADEMISCHEN GRADS EINES DOKTORS DER NATURWISSENSCHAFTEN
ENTWICKLUNG UND CHARAKTERISIERUNG STRUKTURIERENDER LASERVERFAHREN FÜR DIE HERSTELLUNG KRISTALLINER SILIZIUM - SOLARZELLEN DISSERTATION ZUR ERLANGUNG DES AKADEMISCHEN GRADS EINES DOKTORS DER NATURWISSENSCHAFTEN
Presse-Information Seite: 1 / 5
 Seite: 1 / 5 Weidmüller gibt Antworten zu Industrie 4.0 während der Hannover Messe auf seinem Messestand in Halle 11, Stand B 60 vom 08.04.2013 bis 12.04.2013. Weidmüller Industrie 4.0 Weiterdenken für
Seite: 1 / 5 Weidmüller gibt Antworten zu Industrie 4.0 während der Hannover Messe auf seinem Messestand in Halle 11, Stand B 60 vom 08.04.2013 bis 12.04.2013. Weidmüller Industrie 4.0 Weiterdenken für
PRESSEINFORMATION. Adapt Pro EMG Prothesensteuerung: Aktive Arm-Orthese mit intelligentem Mensch-Maschine-Interface
 Adapt Pro EMG Prothesensteuerung: Aktive Arm-Orthese mit intelligentem Mensch-Maschine-Interface Seite 1 2 Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA forscht an Sensorik zur
Adapt Pro EMG Prothesensteuerung: Aktive Arm-Orthese mit intelligentem Mensch-Maschine-Interface Seite 1 2 Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA forscht an Sensorik zur
PRESSE MITTEILUNG. Kostengünstiges RFIDZeitnahmesystem für den. Motorsport. Vom Einkaufswagen zum Motorsport: Juli 2010
 PRESSE MITTEILUNG Juli 2010 Vom Einkaufswagen zum Motorsport: Kostengünstiges RFIDZeitnahmesystem für den Motorsport TU Braunschweig und KartCity nehmen neues System in Betrieb Intelligente Preisschilder
PRESSE MITTEILUNG Juli 2010 Vom Einkaufswagen zum Motorsport: Kostengünstiges RFIDZeitnahmesystem für den Motorsport TU Braunschweig und KartCity nehmen neues System in Betrieb Intelligente Preisschilder
bitte eintreten Karten für Zugangskontrolle und Zeiterfassung
 2 Karten für Zugangskontrolle und Zeiterfassung bitte eintreten Moderne Identifikationssysteme erfordern ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Benutzerkomfort. Ob bei der Erfassung von personenbezogenen
2 Karten für Zugangskontrolle und Zeiterfassung bitte eintreten Moderne Identifikationssysteme erfordern ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Benutzerkomfort. Ob bei der Erfassung von personenbezogenen
Unternehmensbefragung Lebensmittel 4.0
 Einleitung Im Rahmen des Projekts, das vom Land NRW gefördert wird, führen wir aktuell eine Umfrage zum digitalen Wandel und ihrer Auswirkungen auf die Lebensmittelwirtschaft durch. Das Vorhaben wird gemeinsam
Einleitung Im Rahmen des Projekts, das vom Land NRW gefördert wird, führen wir aktuell eine Umfrage zum digitalen Wandel und ihrer Auswirkungen auf die Lebensmittelwirtschaft durch. Das Vorhaben wird gemeinsam
Das Forschungsprojekt KoSiF
 : computer-automation.de http://www.computer-automation.de/feldebene/sensoren/artikel/106525/ Sensoren benötigen in aller Regel eine über Kabel angeschlossene Signalverarbeitung sowie Energieversorgung
: computer-automation.de http://www.computer-automation.de/feldebene/sensoren/artikel/106525/ Sensoren benötigen in aller Regel eine über Kabel angeschlossene Signalverarbeitung sowie Energieversorgung
Exposé zur Safari-Studie 2002: Der Mensch in IT-Projekten Tools und Methoden für den Projekterfolg durch Nutzerakzeptanz
 Exposé zur Safari-Studie 2002: Der Mensch in IT-Projekten Tools und Methoden für den Projekterfolg durch Nutzerakzeptanz Inhalt: Viele IT-Projekte scheitern nicht aus technisch bedingten Gründen, sondern
Exposé zur Safari-Studie 2002: Der Mensch in IT-Projekten Tools und Methoden für den Projekterfolg durch Nutzerakzeptanz Inhalt: Viele IT-Projekte scheitern nicht aus technisch bedingten Gründen, sondern
NI-TDM-Datenformat. Komfortables Arbeiten mit TDM-Dateien in LabVIEW
 NI-TDM-Dateiformat NI-TDM-Datenformat Im Verlauf des gesamten Entwicklungsprozesses für ein neues Produkt werden große Mengen technischer Daten erzeugt sei es bei der Simulation bestimmter Vorgänge oder
NI-TDM-Dateiformat NI-TDM-Datenformat Im Verlauf des gesamten Entwicklungsprozesses für ein neues Produkt werden große Mengen technischer Daten erzeugt sei es bei der Simulation bestimmter Vorgänge oder
Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik
 Geisteswissenschaft Sandra Mette Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik Rolle und Aufgabe der Sozialen Arbeit Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Geisteswissenschaft Sandra Mette Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik Rolle und Aufgabe der Sozialen Arbeit Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
LEAN MANAGEMENT UND KOSTENSENKUNG
 REIS ENGINEERING & CONSULTING IHR PARTNER FÜR LEAN MANAGEMENT UND KOSTENSENKUNG Fabrikplanung, Werkentwicklung Industriebauplanung Produktionsprozessoptimierung Materialflussplanung Anlagenprojektierung
REIS ENGINEERING & CONSULTING IHR PARTNER FÜR LEAN MANAGEMENT UND KOSTENSENKUNG Fabrikplanung, Werkentwicklung Industriebauplanung Produktionsprozessoptimierung Materialflussplanung Anlagenprojektierung
Modular zur wirtschaftlichen Produktion Kunststoffschweißen mit der LPKF PowerWeld 2000
 Modular zur wirtschaftlichen Produktion Kunststoffschweißen mit der LPKF PowerWeld 2000 Mit den Aufgaben wachsen Das Laser-Kunststoffschweißen sorgt für exakte Schweißnähte mit beliebigem Verlauf, ohne
Modular zur wirtschaftlichen Produktion Kunststoffschweißen mit der LPKF PowerWeld 2000 Mit den Aufgaben wachsen Das Laser-Kunststoffschweißen sorgt für exakte Schweißnähte mit beliebigem Verlauf, ohne
Effiziente Instandhaltung: Überwachung der Infrastruktur mit Regelzügen
 Effiziente Instandhaltung: Überwachung der Infrastruktur mit Regelzügen für Fahrweg und Fahrzeuge kontinuierliches Zustandsmonitoring zuverlässige Prognose höhere Betriebsqualität DB Systemtechnik Unsere
Effiziente Instandhaltung: Überwachung der Infrastruktur mit Regelzügen für Fahrweg und Fahrzeuge kontinuierliches Zustandsmonitoring zuverlässige Prognose höhere Betriebsqualität DB Systemtechnik Unsere
Faseroptische Erweiterung des geodätischen Messlabors der TU Graz
 Faseroptische Erweiterung des geodätischen Messlabors der TU Graz Helmut Woschitz Institut für Ingenieurgeodäsie und Messsysteme TU Graz [20120509_FO_Labor_OGT12_Velden.ppt] 1 Geodätisches Messlabor Messlabor
Faseroptische Erweiterung des geodätischen Messlabors der TU Graz Helmut Woschitz Institut für Ingenieurgeodäsie und Messsysteme TU Graz [20120509_FO_Labor_OGT12_Velden.ppt] 1 Geodätisches Messlabor Messlabor
Demonstrations-Planar-Triode
 Demonstrations-Planar-Triode 1. Anode 2. Gitter 3. Halter mit 4-mm-Steckerstift zum Anschluss des Gitters 4. Heizwendel 5. Katodenplatte 6. Verbindung der Heizfadenzuführung mit der inneren Beschichtung
Demonstrations-Planar-Triode 1. Anode 2. Gitter 3. Halter mit 4-mm-Steckerstift zum Anschluss des Gitters 4. Heizwendel 5. Katodenplatte 6. Verbindung der Heizfadenzuführung mit der inneren Beschichtung
Bosch Klima-Kälte-Prüfstand Ein Messsystem für den Fahrversuch und den Einsatz am Prüfstand
 Bosch Klima-Kälte-Prüfstand Ein Messsystem für den Fahrversuch und den Einsatz am Prüfstand von Kamil Pogorzelski Anwendungsbericht Automobil- & Fahrzeugindustrie Prüfstand Einleitung Die Firma Bosch führt
Bosch Klima-Kälte-Prüfstand Ein Messsystem für den Fahrversuch und den Einsatz am Prüfstand von Kamil Pogorzelski Anwendungsbericht Automobil- & Fahrzeugindustrie Prüfstand Einleitung Die Firma Bosch führt
EFQM Excellence Model Fragen und Antworten zum Selbststudium
 QUALITY-APPS Applikationen für das Qualitätsmanagement EFQM Excellence Model 2013 200 Fragen und Antworten zum Selbststudium Autor: Prof. Dr. Jürgen P. Bläsing Um erfolgreich zu sein, benötigen alle Organisationen
QUALITY-APPS Applikationen für das Qualitätsmanagement EFQM Excellence Model 2013 200 Fragen und Antworten zum Selbststudium Autor: Prof. Dr. Jürgen P. Bläsing Um erfolgreich zu sein, benötigen alle Organisationen
glaesum group Synergie in der globalen Industrie
 glaesum group Synergie in der globalen Industrie Glaesum Group Synergie in der globalen Industrie Mit Wärme- und Metalltechnik als Schwerpunkte bietet die Glaesum Group dem professionellen, industriellen
glaesum group Synergie in der globalen Industrie Glaesum Group Synergie in der globalen Industrie Mit Wärme- und Metalltechnik als Schwerpunkte bietet die Glaesum Group dem professionellen, industriellen
Industrie 4.0 erfolgreich anwenden mit Sicherheit. Dr. Reinhard Ploss Dresden, 23. März 2016
 Industrie 4.0 erfolgreich anwenden mit Sicherheit Dr. Reinhard Ploss Dresden, 23. März 2016 Ziel von Industrie 4.0: Flexible, individuelle Fertigung bei hoher Produktivität wie in der Massenproduktion
Industrie 4.0 erfolgreich anwenden mit Sicherheit Dr. Reinhard Ploss Dresden, 23. März 2016 Ziel von Industrie 4.0: Flexible, individuelle Fertigung bei hoher Produktivität wie in der Massenproduktion
Sexueller Missbrauch im Kindheitsalter und die traumatischen Folgen
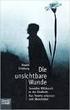 Geisteswissenschaft Sarah Proske Sexueller Missbrauch im Kindheitsalter und die traumatischen Folgen Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek
Geisteswissenschaft Sarah Proske Sexueller Missbrauch im Kindheitsalter und die traumatischen Folgen Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek
Überleitung eines Wachkomapatienten aus der Rehaklinik in die häusliche Umgebung durch Case Management
 Medizin Birgit zum Felde Überleitung eines Wachkomapatienten aus der Rehaklinik in die häusliche Umgebung durch Case Management Projekt-Arbeit zum Abschluss der CM-Weiterbildung Projektarbeit Birgit zum
Medizin Birgit zum Felde Überleitung eines Wachkomapatienten aus der Rehaklinik in die häusliche Umgebung durch Case Management Projekt-Arbeit zum Abschluss der CM-Weiterbildung Projektarbeit Birgit zum
Microsoft ISA Server 2004
 Microsoft ISA Server 2004 Marcel Zehner Leitfaden für Installation, Einrichtung und Wartung ISBN 3-446-40597-6 Leseprobe Weitere Informationen oder Bestellungen unter http://www.hanser.de/3-446-40597-6
Microsoft ISA Server 2004 Marcel Zehner Leitfaden für Installation, Einrichtung und Wartung ISBN 3-446-40597-6 Leseprobe Weitere Informationen oder Bestellungen unter http://www.hanser.de/3-446-40597-6
Mikro Bestückung Mikro + Nano Dosieren Mikro Laserlöten. Möglichkeiten der Aufbau- und Verbindungstechnik für 3D-MID
 Mikro Bestückung Mikro + Nano Dosieren Mikro Laserlöten Möglichkeiten der Aufbau- und Verbindungstechnik für 3D-MID Agenda Anforderungen im Wandel Herausforderungen der räumlichen Aufbau- und Verbindungstechnik
Mikro Bestückung Mikro + Nano Dosieren Mikro Laserlöten Möglichkeiten der Aufbau- und Verbindungstechnik für 3D-MID Agenda Anforderungen im Wandel Herausforderungen der räumlichen Aufbau- und Verbindungstechnik
Druckluft- und Gasnetze
 Druckluft- und Gasnetze Sichere Auslegung von Gasnetzen Minimierung der Betriebs- und Instandhaltungskosten Vergleichmäßigung des Betriebsdruckes Simulation und Berechnung von Gasströmungen in Rohrleitungsnetzen
Druckluft- und Gasnetze Sichere Auslegung von Gasnetzen Minimierung der Betriebs- und Instandhaltungskosten Vergleichmäßigung des Betriebsdruckes Simulation und Berechnung von Gasströmungen in Rohrleitungsnetzen
Industrie 4.0 Ist der Einkauf gerüstet?
 Industrie 4.0 Ist der Einkauf gerüstet? Das Thema Industrie 4.0 und damit auch Einkauf 4.0 ist derzeit in aller Munde. Aber was genau verbirgt sich dahinter? Was sind die Anforderungen an die Unternehmen
Industrie 4.0 Ist der Einkauf gerüstet? Das Thema Industrie 4.0 und damit auch Einkauf 4.0 ist derzeit in aller Munde. Aber was genau verbirgt sich dahinter? Was sind die Anforderungen an die Unternehmen
Produktidentifikation, Intralogistik und Plagiatschutz RFID-Integration in Gussbauteile
 Produktidentifikation, Intralogistik und Plagiatschutz RFID-Integration in Gussbauteile Die CAST TRONICS -Technologie ermöglicht das direkte Eingießen von RFID-Transpondern zur Gussteilkennzeichnung im
Produktidentifikation, Intralogistik und Plagiatschutz RFID-Integration in Gussbauteile Die CAST TRONICS -Technologie ermöglicht das direkte Eingießen von RFID-Transpondern zur Gussteilkennzeichnung im
Produktbaukästen entwickeln. Unsere Roadmap zum Erfolg
 Produktbaukästen entwickeln Unsere Roadmap zum Erfolg Welche Varianten / Optionen sollen entwickelt werden? Die Fähigkeit, kundenindividuelle Lösungen zu marktfähigen Preisen anzubieten, wird in Zeiten
Produktbaukästen entwickeln Unsere Roadmap zum Erfolg Welche Varianten / Optionen sollen entwickelt werden? Die Fähigkeit, kundenindividuelle Lösungen zu marktfähigen Preisen anzubieten, wird in Zeiten
2. Niedersächsische Jahresfachtagung Industrie 4.0
 2. Niedersächsische Jahresfachtagung Industrie 4.0 Fachforum: Intelligente Prüftechnik für Produktion und Instandhaltung Volker Pape Vorstand Viscom AG Unternehmensprofil Inhalt: Viscom im Überblick Vernetzte
2. Niedersächsische Jahresfachtagung Industrie 4.0 Fachforum: Intelligente Prüftechnik für Produktion und Instandhaltung Volker Pape Vorstand Viscom AG Unternehmensprofil Inhalt: Viscom im Überblick Vernetzte
Formgedächtnislegierungen Eigenschaften, Stand der Forschung, Kompetenzen und Ausblick
 hyprofga Entwicklung und Produktion hybrider Produkte mit Formgedächtnisaktorik Formgedächtnislegierungen Eigenschaften, Stand der Forschung, Kompetenzen und Ausblick Agenda I Was sind Formgedächtnislegierungen
hyprofga Entwicklung und Produktion hybrider Produkte mit Formgedächtnisaktorik Formgedächtnislegierungen Eigenschaften, Stand der Forschung, Kompetenzen und Ausblick Agenda I Was sind Formgedächtnislegierungen
Anlagen und Systeme zum lunkerfreien Löten mit Vakuum
 Anlagen und Systeme zum lunkerfreien Löten mit Vakuum Löttechnik PINK GmbH Thermosysteme Ein Unternehmen mit Kompetenz in der Vakuumtechnik Anforderungen der internationalen Kunden im Fokus Die PINK GmbH
Anlagen und Systeme zum lunkerfreien Löten mit Vakuum Löttechnik PINK GmbH Thermosysteme Ein Unternehmen mit Kompetenz in der Vakuumtechnik Anforderungen der internationalen Kunden im Fokus Die PINK GmbH
Energie Energie Punkt
 www.klauke.com Schneiden Stanzen Fügen Energie Energie Punkt auf den Punkt den auf Prägen Formen Pressen Für höchste Anforderungen weltweit: Qualität, Kompetenz und Innovation. Klauke die Verbindungsexperten
www.klauke.com Schneiden Stanzen Fügen Energie Energie Punkt auf den Punkt den auf Prägen Formen Pressen Für höchste Anforderungen weltweit: Qualität, Kompetenz und Innovation. Klauke die Verbindungsexperten
ENTWICKLUNG UND FERTIGUNG MEDIZINTECHNISCHER PRODUKTE
 ENTWICKLUNG UND FERTIGUNG MEDIZINTECHNISCHER PRODUKTE Entwicklung und Fertigung DAS IST MECHATRONIC Wir entwickeln und produzieren medizintechnische Geräte zur Diagnose und Therapie sowie Teillösungen
ENTWICKLUNG UND FERTIGUNG MEDIZINTECHNISCHER PRODUKTE Entwicklung und Fertigung DAS IST MECHATRONIC Wir entwickeln und produzieren medizintechnische Geräte zur Diagnose und Therapie sowie Teillösungen
Uwe Fritsch Freiburg, 08. September 2015
 Uwe Fritsch Freiburg, 08. September 2015 Von der ersten zur vierten industriellen Revolution Quelle: Abschlussbericht des Arbeitskreises Industrie 4.0 (2013: 17) Seite 2 Braunschweiger Zeitung, 07.10.2014
Uwe Fritsch Freiburg, 08. September 2015 Von der ersten zur vierten industriellen Revolution Quelle: Abschlussbericht des Arbeitskreises Industrie 4.0 (2013: 17) Seite 2 Braunschweiger Zeitung, 07.10.2014
M E S S T E C H N I K
 M E S S T E C H N I K Service / Dienstleistung Die Springer GmbH ist Ihr Dienstleister in dem Bereich der industriellen Messtechnik. Mit stetig wachsendem Leistungsumfang sowie einem motivierten und qualifizierten
M E S S T E C H N I K Service / Dienstleistung Die Springer GmbH ist Ihr Dienstleister in dem Bereich der industriellen Messtechnik. Mit stetig wachsendem Leistungsumfang sowie einem motivierten und qualifizierten
Hinter unserer Messtechnik steht der Mensch.
 Auf uns ist Verlass. Hinter unserer Messtechnik steht der Mensch. Systematisches Denken. Gezieltes Beobachten. Präzises Wahrnehmen. Sicheres Kommunizieren. Unsere Verlässlichkeit nach Aussen. Marktbedürfnis.
Auf uns ist Verlass. Hinter unserer Messtechnik steht der Mensch. Systematisches Denken. Gezieltes Beobachten. Präzises Wahrnehmen. Sicheres Kommunizieren. Unsere Verlässlichkeit nach Aussen. Marktbedürfnis.
Themenvorschlä ge fü r stüdentische Arbeiten äm Lehrstühl Integrierte Aütomätion
 Themenvorschlä ge fü r stüdentische Arbeiten äm Lehrstühl Integrierte Aütomätion Die folgenden Themenvorschläge dienen als Grundlage für studentische Arbeiten. Je nach Art der Arbeit können die Themen
Themenvorschlä ge fü r stüdentische Arbeiten äm Lehrstühl Integrierte Aütomätion Die folgenden Themenvorschläge dienen als Grundlage für studentische Arbeiten. Je nach Art der Arbeit können die Themen
White Paper. Mikromesszellen. für die Qualitätssicherung in Steckverbindern. Hochauflösende Messungen bis in den Sub-Millimeter-Bereich
 White Paper Mikromesszellen für die Qualitätssicherung in Steckverbindern Hochauflösende Messungen bis in den Sub-Millimeter-Bereich Zusammenfassung: Eine mangelhafte Kontaktierung von Steckverbindern
White Paper Mikromesszellen für die Qualitätssicherung in Steckverbindern Hochauflösende Messungen bis in den Sub-Millimeter-Bereich Zusammenfassung: Eine mangelhafte Kontaktierung von Steckverbindern
Was ist falsch an diesem Bild
 Crossmedia Crossmedia Crossmedia Crossmedia Was ist falsch an diesem Bild Was ist falsch an diesem Bild Warum funktioniert das Geschäftsmodell nicht mehr? heute Worum geht es also? Alte Welt vs. neue
Crossmedia Crossmedia Crossmedia Crossmedia Was ist falsch an diesem Bild Was ist falsch an diesem Bild Warum funktioniert das Geschäftsmodell nicht mehr? heute Worum geht es also? Alte Welt vs. neue
Ein Konzept zur Verbesserung der Gesprächsführung in bayerischen integrierten Leitstellen von Feuerwehr und Rettungsdienst
 Geisteswissenschaft Holger Sieber Ein Konzept zur Verbesserung der Gesprächsführung in bayerischen integrierten Leitstellen von Feuerwehr und Rettungsdienst Bachelorarbeit Bibliografische Information
Geisteswissenschaft Holger Sieber Ein Konzept zur Verbesserung der Gesprächsführung in bayerischen integrierten Leitstellen von Feuerwehr und Rettungsdienst Bachelorarbeit Bibliografische Information
Kapitel 2, Führungskräftetraining, Kompetenzentwicklung und Coaching:
 Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Markus Andre Eisen Optimierte Parameterfindung und prozessorientiertes Qualitätsmanagement für das Selective Laser Melting Verfahren
 Berichte aus der Fertigungstechnik Markus Andre Eisen Optimierte Parameterfindung und prozessorientiertes Qualitätsmanagement für das Selective Laser Melting Verfahren Shaker Verlag Aachen 2010 Bibliografische
Berichte aus der Fertigungstechnik Markus Andre Eisen Optimierte Parameterfindung und prozessorientiertes Qualitätsmanagement für das Selective Laser Melting Verfahren Shaker Verlag Aachen 2010 Bibliografische
INTEGRIERTE ANSCHLUSSTECHNIK IN-SERIE
 INTEGRIERTE ANSCHLUSSTECHNIK IN-SERIE INTEGRIERTE ANSCHLUSSTECHNIK Überwinden Sie die Grenzen konventioneller Leiterplattenanschlusstechnik: Mit der integrierten Anschlusstechnik von PTR lassen sich elektrische
INTEGRIERTE ANSCHLUSSTECHNIK IN-SERIE INTEGRIERTE ANSCHLUSSTECHNIK Überwinden Sie die Grenzen konventioneller Leiterplattenanschlusstechnik: Mit der integrierten Anschlusstechnik von PTR lassen sich elektrische
Einsatz von Simulationen in der Softwareentwicklung
 Einsatz von Simulationen in der Softwareentwicklung Dr. rer. nat. Olaf Maibaum Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.v. Simulations- und Softwaretechnik, Braunschweig Dr. Olaf Maibaum. DLR, Simulations-
Einsatz von Simulationen in der Softwareentwicklung Dr. rer. nat. Olaf Maibaum Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.v. Simulations- und Softwaretechnik, Braunschweig Dr. Olaf Maibaum. DLR, Simulations-
Entwicklung einer netzbasierten Methodik zur Modellierung von Prozessen der Verdunstungskühlung
 Institut für Energietechnik - Professur für Technische Thermodynamik Entwicklung einer netzbasierten Methodik zur Modellierung von Prozessen der Verdunstungskühlung Tobias Schulze 13.11.2012, DBFZ Leipzig
Institut für Energietechnik - Professur für Technische Thermodynamik Entwicklung einer netzbasierten Methodik zur Modellierung von Prozessen der Verdunstungskühlung Tobias Schulze 13.11.2012, DBFZ Leipzig
Transformation bestehender Geschäftsmodelle und -prozesse für eine erfolgreiche Digitalisierung
 Transformation bestehender Geschäftsmodelle und -prozesse für eine erfolgreiche Digitalisierung VPP-Tagung, TU Chemnitz Smarte Fabrik & smarte Arbeit Industrie 4.0 gewinnt Kontur Session 4.0 im Mittelstand
Transformation bestehender Geschäftsmodelle und -prozesse für eine erfolgreiche Digitalisierung VPP-Tagung, TU Chemnitz Smarte Fabrik & smarte Arbeit Industrie 4.0 gewinnt Kontur Session 4.0 im Mittelstand
Multimediales Modell des Zerspanprozesses 1
 Multimediales Modell des Zerspanprozesses 1 Dipl.-Ing. Jens Hoffmann Einleitung Entsprechend der Ausrichtung der Arbeitsgruppe PAZAT bildet die Lehre zu den spanenden Fertigungsverfahren einen wesentlichen
Multimediales Modell des Zerspanprozesses 1 Dipl.-Ing. Jens Hoffmann Einleitung Entsprechend der Ausrichtung der Arbeitsgruppe PAZAT bildet die Lehre zu den spanenden Fertigungsverfahren einen wesentlichen
Sonstige Marktregeln Strom
 Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 11 Datenformat zur Übermittlung von Verbrauchsdaten intelligenter Messgeräte vom Netzbetreiber an den Lieferanten gemäß 2 DAVID-VO Version 1.0 Dokumentenhistorie Version
Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 11 Datenformat zur Übermittlung von Verbrauchsdaten intelligenter Messgeräte vom Netzbetreiber an den Lieferanten gemäß 2 DAVID-VO Version 1.0 Dokumentenhistorie Version
Waschvlies BöttcherTex Optima BöttcherTex Primera BöttcherTex Impress
 Waschvlies BöttcherTex Optima BöttcherTex Primera BöttcherTex Impress Neue Waschanlagenkonzepte zur Reduzierung der Waschzeiten erfordern optimierte Waschvliese In den letzten Jahren wurde der Druckmaschinenbau
Waschvlies BöttcherTex Optima BöttcherTex Primera BöttcherTex Impress Neue Waschanlagenkonzepte zur Reduzierung der Waschzeiten erfordern optimierte Waschvliese In den letzten Jahren wurde der Druckmaschinenbau
BEDIENEN NEU DEFINIERT Das HMI-Konzept von SMS Siemag
 BEDIENEN NEU DEFINIERT Das HMI-Konzept von SMS Siemag INNOVATIVES HMI verständlich und intuitiv DER NEUE BLICK des Bedieners auf den Produktionsprozess Metallurgische Produkte werden in hochkomplexen Produktionsprozessen
BEDIENEN NEU DEFINIERT Das HMI-Konzept von SMS Siemag INNOVATIVES HMI verständlich und intuitiv DER NEUE BLICK des Bedieners auf den Produktionsprozess Metallurgische Produkte werden in hochkomplexen Produktionsprozessen
CIMOTEC CNC-Flachpoliersysteme Anlagensicherheit modularen Aufbau Unterschiedliche Werkstückzuführsysteme wirtschaftliches Arbeiten
 1.10 Das CIMOTEC CNC-Flachpoliersysteme wurde in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden als kostengünstige Antwort auf die immer weiter steigenden Anforderungen beim Polieren oder Bürsten von liegenden
1.10 Das CIMOTEC CNC-Flachpoliersysteme wurde in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden als kostengünstige Antwort auf die immer weiter steigenden Anforderungen beim Polieren oder Bürsten von liegenden
 und Spannelemente GmbH Mubea weltweit Mehr als 40 Jahre Erfahrung in Entwicklung und Produktion von Qualitätstellerfedern Große Anwendungsvielfalt von Tellerfedern in unterschiedlichsten Industriebereichen
und Spannelemente GmbH Mubea weltweit Mehr als 40 Jahre Erfahrung in Entwicklung und Produktion von Qualitätstellerfedern Große Anwendungsvielfalt von Tellerfedern in unterschiedlichsten Industriebereichen
Beitrag zur Untersuchung von passiven planaren Hochgeschwindigkeitsmagnetlagern für die Anwendung in der Mikrosystemtechnik
 Beitrag zur Untersuchung von passiven planaren Hochgeschwindigkeitsmagnetlagern für die Anwendung in der Mikrosystemtechnik Markus Klöpzig Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor-Ingenieur
Beitrag zur Untersuchung von passiven planaren Hochgeschwindigkeitsmagnetlagern für die Anwendung in der Mikrosystemtechnik Markus Klöpzig Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor-Ingenieur
Der Einfluss von Geschützten Werten und Emotionen auf Reaktionen im Ultimatum Spiel
 Geisteswissenschaft Andrea Steiger / Kathrin Derungs Der Einfluss von Geschützten Werten und Emotionen auf Reaktionen im Ultimatum Spiel Lizentiatsarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Geisteswissenschaft Andrea Steiger / Kathrin Derungs Der Einfluss von Geschützten Werten und Emotionen auf Reaktionen im Ultimatum Spiel Lizentiatsarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Simulation führt zu effizienter E-Mobilität
 (Quelle: istockphoto, Henrik Jonsson) Simulation führt zu effizienter E-Mobilität Gerhard Friederici, CADFEM GmbH, Grafing b. München Der Trend hin zur E-Mobilität stellt die traditionellen Automobilhersteller
(Quelle: istockphoto, Henrik Jonsson) Simulation führt zu effizienter E-Mobilität Gerhard Friederici, CADFEM GmbH, Grafing b. München Der Trend hin zur E-Mobilität stellt die traditionellen Automobilhersteller
DDM9000 : Kurz und bündig
 LTE Consulting GmbH Ihr Partner für InformationsLogistik DDM9000 : Kurz und bündig Kennen Sie das? Langes Suchen nach Unterlagen, aktuellen Dokumenten und anderen Informationen Wo sind wichtige, aktuelle
LTE Consulting GmbH Ihr Partner für InformationsLogistik DDM9000 : Kurz und bündig Kennen Sie das? Langes Suchen nach Unterlagen, aktuellen Dokumenten und anderen Informationen Wo sind wichtige, aktuelle
Ü Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Jahrgangstufe 10. Jahrgangsstufe 10 (2-stündig im ganzen Schuljahr)
 Ü Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Jahrgangstufe 10 Jahrgangsstufe 10 (2-stündig im ganzen Schuljahr) Unterrichtsvorhaben I: Thema: Erprobung und technische Umsetzung von elektrischen und elektronischen
Ü Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Jahrgangstufe 10 Jahrgangsstufe 10 (2-stündig im ganzen Schuljahr) Unterrichtsvorhaben I: Thema: Erprobung und technische Umsetzung von elektrischen und elektronischen
WAHRNEHMUNG UND NACHWEIS NIEDRIGER ELEKTRISCHER LEISTUNG. FernUniversität Universitätsstrasse 1 D Hagen, GERMANY. 1.
 WAHRNEHMUNG UND NACHWEIS NIEDRIGER ELEKTRISCHER LEISTUNG Eugen Grycko 1, Werner Kirsch 2, Tobias Mühlenbruch 3 1,2,3 Fakultät für Mathematik und Informatik FernUniversität Universitätsstrasse 1 D-58084
WAHRNEHMUNG UND NACHWEIS NIEDRIGER ELEKTRISCHER LEISTUNG Eugen Grycko 1, Werner Kirsch 2, Tobias Mühlenbruch 3 1,2,3 Fakultät für Mathematik und Informatik FernUniversität Universitätsstrasse 1 D-58084
Genauigkeit moderner Kraftmessdosen- Stand der Technik und Anwendungen
 Genauigkeit moderner Kraftmessdosen- Stand der Technik und Anwendungen Thomas Kleckers Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH Product Marketing Im Tiefen See 45 64293 Darmstadt Thomas.kleckers@hbm.com 0. Einführung
Genauigkeit moderner Kraftmessdosen- Stand der Technik und Anwendungen Thomas Kleckers Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH Product Marketing Im Tiefen See 45 64293 Darmstadt Thomas.kleckers@hbm.com 0. Einführung
Analyse des Betriebszustandes der ZKS-Abfall. Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb
 Analyse des Betriebszustandes der ZKS-Abfall Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb Stand: 21. März 2011 Neutrale Prüfung der ZKS-Abfall Nachdem die ZKS-Abfall ab 1. April 2010, dem Inkrafttreten der
Analyse des Betriebszustandes der ZKS-Abfall Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb Stand: 21. März 2011 Neutrale Prüfung der ZKS-Abfall Nachdem die ZKS-Abfall ab 1. April 2010, dem Inkrafttreten der
Photovoltaik-Anlage Ihr eigenes Kraftwerk.
 Photovoltaik-Anlage Ihr eigenes Kraftwerk. www.naturenergie.de/my-e-nergy Ihre eigene Energie aus der Kraft der Sonne. Strom, Wärme, Mobilität: Produzieren Sie Ihren Strom selbst mit einer auf Ihre Bedürfnisse
Photovoltaik-Anlage Ihr eigenes Kraftwerk. www.naturenergie.de/my-e-nergy Ihre eigene Energie aus der Kraft der Sonne. Strom, Wärme, Mobilität: Produzieren Sie Ihren Strom selbst mit einer auf Ihre Bedürfnisse
DEFIS Design und flexible Integration von Sensoren aus Nanodispersionen zur Strukturüberwachung
 Mikro-Nano-Integration als Schlüsseltechnologie für die nächste Generation von Sensoren und Aktoren (MNI-mst) DEFIS Design und flexible Integration von Sensoren aus Nanodispersionen zur Strukturüberwachung
Mikro-Nano-Integration als Schlüsseltechnologie für die nächste Generation von Sensoren und Aktoren (MNI-mst) DEFIS Design und flexible Integration von Sensoren aus Nanodispersionen zur Strukturüberwachung
Züchtung von neuartigen Kristallen für die Halbleitertechnik
 Züchtung von neuartigen Kristallen für die Halbleitertechnik Dr.-Ing. Matthias Bickermann 1. Was haben Kristalle mit Halbleitertechnik zu tun? 2. Anforderungen an ein Substrat 3. Halbleitertechnik, das
Züchtung von neuartigen Kristallen für die Halbleitertechnik Dr.-Ing. Matthias Bickermann 1. Was haben Kristalle mit Halbleitertechnik zu tun? 2. Anforderungen an ein Substrat 3. Halbleitertechnik, das
Ecofys Pressemappe. Ecofys Experts in Energy. Allgemeines
 Ecofys Pressemappe Ecofys Experts in Energy Allgemeines Ecofys ist als internationales Beratungsunternehmen für Energie und Klima und seit 25 Jahren Vorreiter in Energie- und Klimafragen. Ecofys will eine
Ecofys Pressemappe Ecofys Experts in Energy Allgemeines Ecofys ist als internationales Beratungsunternehmen für Energie und Klima und seit 25 Jahren Vorreiter in Energie- und Klimafragen. Ecofys will eine
TOYOTA I_SITE Mehr als Flottenmanagement
 KOMPETENZ FÜR IHR UNTERNEHMEN KOMPETENZ FÜR IHR UNTERNEHMEN TOYOTA I_SITE Mehr als Flottenmanagement LÖSUNGEN FÜR GEBRAUCHTSTAPLER Kaufen Sie mit Vertrauen www.toyota-forklifts.at www.toyota-forklifts.de
KOMPETENZ FÜR IHR UNTERNEHMEN KOMPETENZ FÜR IHR UNTERNEHMEN TOYOTA I_SITE Mehr als Flottenmanagement LÖSUNGEN FÜR GEBRAUCHTSTAPLER Kaufen Sie mit Vertrauen www.toyota-forklifts.at www.toyota-forklifts.de
Industrie 4.0 Quick Scan Tool. HTZ-Praxiszirkelt Industrie 4.0, , Brugg
 Industrie.0 Quick Scan Tool HTZ-Praxiszirkelt Industrie.0,.0.06, Brugg Ausgangslage Resultate der Literaturrecherche zum Thema I.0 8 identifizierte Studien & Fragebogen zum Thema I.0 Deutschland dominiert
Industrie.0 Quick Scan Tool HTZ-Praxiszirkelt Industrie.0,.0.06, Brugg Ausgangslage Resultate der Literaturrecherche zum Thema I.0 8 identifizierte Studien & Fragebogen zum Thema I.0 Deutschland dominiert
Lean Development Von Ruedi Graf, Senior Consultant und Partner der Wertfabrik AG
 Fachartikel Lean Development Von Ruedi Graf, Senior Consultant und Partner der Wertfabrik AG In der Entstehung neuer Produkte verfehlen eine Vielzahl von Projekten die definierten Qualitäts-, Termin- und
Fachartikel Lean Development Von Ruedi Graf, Senior Consultant und Partner der Wertfabrik AG In der Entstehung neuer Produkte verfehlen eine Vielzahl von Projekten die definierten Qualitäts-, Termin- und
Ein Integriertes Berichtswesen als Führungshilfe
 Ein Integriertes Berichtswesen als Führungshilfe Begleitung eines kennzahlgestützten Berichtswesens zur Zielerreichung Tilia Umwelt GmbH Agenda 1. Was bedeutet Führung? 2. Was bedeutet Führung mit Hilfe
Ein Integriertes Berichtswesen als Führungshilfe Begleitung eines kennzahlgestützten Berichtswesens zur Zielerreichung Tilia Umwelt GmbH Agenda 1. Was bedeutet Führung? 2. Was bedeutet Führung mit Hilfe
Schulungsunterlagen für Energieberaterseminare. KWK-Leitfaden für Energieberater. www.asue.de 1
 Schulungsunterlagen für Energieberaterseminare KWK-Leitfaden für Energieberater www.asue.de 1 Vorwort Auf dem Weg zu einer neuen, emissionsarmen Energieversorgung werden die konventionellen Energieträger
Schulungsunterlagen für Energieberaterseminare KWK-Leitfaden für Energieberater www.asue.de 1 Vorwort Auf dem Weg zu einer neuen, emissionsarmen Energieversorgung werden die konventionellen Energieträger
Case-Study WI-Master Prof. Dr.-Ing. K. Schuchard
 Einsatz von HMDs im Produktenstehungsprozess Ein Head-Mounted Display (HMD, Helmdisplay oder VR-Helm) ist ein auf dem Kopf getragenes visuelles Ausgabegerät, das an einem Computer erzeugte, dreidimensionale
Einsatz von HMDs im Produktenstehungsprozess Ein Head-Mounted Display (HMD, Helmdisplay oder VR-Helm) ist ein auf dem Kopf getragenes visuelles Ausgabegerät, das an einem Computer erzeugte, dreidimensionale
Teilrealisierung der intelligenten Brücke auf dem durabast-areal
 Teilrealisierung der intelligenten Brücke auf dem durabast-areal Konzeption und aktueller Stand Abdalla Fakhouri, M.Sc. Abteilung Brücken- und Ing.-bau Referat Betonbau Bundesanstalt für Straßenwesen Gliederung
Teilrealisierung der intelligenten Brücke auf dem durabast-areal Konzeption und aktueller Stand Abdalla Fakhouri, M.Sc. Abteilung Brücken- und Ing.-bau Referat Betonbau Bundesanstalt für Straßenwesen Gliederung
Abschluss- und Studienarbeiten. Entwicklung. Konstruktion
 Entwicklung Konstruktion Ihr Ansprechpartner: ANDREAS STIHL AG & Co. KG Personalmarketing Andreas-Stihl-Str. 4 71336 Waiblingen Tel.: 07151-26-2489 oder über: www.stihl.de www.facebook.com/stihlkarriere
Entwicklung Konstruktion Ihr Ansprechpartner: ANDREAS STIHL AG & Co. KG Personalmarketing Andreas-Stihl-Str. 4 71336 Waiblingen Tel.: 07151-26-2489 oder über: www.stihl.de www.facebook.com/stihlkarriere
PharmaResearch. Analyse des Pressvorgangs. Mehr als Forschung und Entwicklung
 PharmaResearch Analyse des Pressvorgangs Mehr als Forschung und Entwicklung Unterstützung für die Entwicklung PharmaResearch erfasst und wertet sämtliche Prozessdaten von instrumentierten Tablettenpressen
PharmaResearch Analyse des Pressvorgangs Mehr als Forschung und Entwicklung Unterstützung für die Entwicklung PharmaResearch erfasst und wertet sämtliche Prozessdaten von instrumentierten Tablettenpressen
AutoCAD, dynamischer Block Gert Domsch, CAD-Dienstleistung
 AutoCAD, 2010-2014 dynamischer Block Gert Domsch, CAD-Dienstleistung 30.05.2014 Inhalt: Ziel... 2 Ausgangssituation... 2 Blockeditor... 3 Dynamische Blockfunktionen... 5 Parameter... 5 Aktion... 6 Feste
AutoCAD, 2010-2014 dynamischer Block Gert Domsch, CAD-Dienstleistung 30.05.2014 Inhalt: Ziel... 2 Ausgangssituation... 2 Blockeditor... 3 Dynamische Blockfunktionen... 5 Parameter... 5 Aktion... 6 Feste
Einführung. Rechnerarchitekturen Entwicklung und Ausführung von Programmen Betriebssysteme
 Teil I Einführung Überblick 1 2 Geschichte der Informatik 3 Technische Grundlagen der Informatik Rechnerarchitekturen Entwicklung und Ausführung von Programmen Betriebssysteme 4 Daten, Informationen, Kodierung
Teil I Einführung Überblick 1 2 Geschichte der Informatik 3 Technische Grundlagen der Informatik Rechnerarchitekturen Entwicklung und Ausführung von Programmen Betriebssysteme 4 Daten, Informationen, Kodierung
Konzept-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität
 Konzept-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität PD Dr. Rainer Strobl Universität Hildesheim Institut für Sozialwissenschaften & proval Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Analyse, Beratung und
Konzept-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität PD Dr. Rainer Strobl Universität Hildesheim Institut für Sozialwissenschaften & proval Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Analyse, Beratung und
MetraSCAN-R: ROBOTERGEFÜHRTE OPTISCHE CMM-3D-SCANNER FÜR DIE AUTOMATISCHE INSPEKTION
 MetraSCAN-R: ROBOTERGEFÜHRTE OPTISCHE CMM-3D-SCANNER FÜR DIE AUTOMATISCHE INSPEKTION TRAGBARE 3D-MESSTECHNIK-LÖSUNGEN Die MetraSCAN 3D TM -Produktreihe von Creaform umfasst die robotergeführten optischen
MetraSCAN-R: ROBOTERGEFÜHRTE OPTISCHE CMM-3D-SCANNER FÜR DIE AUTOMATISCHE INSPEKTION TRAGBARE 3D-MESSTECHNIK-LÖSUNGEN Die MetraSCAN 3D TM -Produktreihe von Creaform umfasst die robotergeführten optischen
CAMELOT Management Consultants AG
 CAMELOT Management Consultants AG Referenzbeispiele im Umfeld Operations und Kurzportrait Köln, November 2016 Referenzbeispiel Automobilzulieferer Globaler Automobilzulieferer: Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit
CAMELOT Management Consultants AG Referenzbeispiele im Umfeld Operations und Kurzportrait Köln, November 2016 Referenzbeispiel Automobilzulieferer Globaler Automobilzulieferer: Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit
