Nachrichten. Mitgliederversammlung 2010 des BGV Abteilung
|
|
|
- Marcus Ziegler
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Nachrichten Mitgliederversammlung 2010 des BGV Abteilung Wuppertal Am 4. März 2010 fand in der Zentralbibliothek die diesjährige Mitgliederversammlung des BGV Abteilung Wuppertal statt. Es waren etwa 80 Damen und Herren anwesend. Vor dem offiziellen Beginn gedachten die Anwesenden der verstorbenen Mitglieder: Fritz Dupont, Detlev Frielinghaus, Helmut Hohagen, Karl Jakob Krebs, Karl Putsch, Karl Tirre, Ursula von Wussow, Ingeborg Rebensburg-Real, Willi Walkenhorst, Werner Zanner und unser langjähriger Kassenprüfer Dr. Fritz Paetzold. Für langjährige Mitgliedschaft konnten zahlreiche Jubilare geehrt werden: 50 Jahre Mitgliedschaft Ilse Decker, 40 Jahre Hans- Jürgen Ebers, Aloys Löwe, Prof. Dr. Ferdinand Meinzen, Renate Metschies, Brigitte Müller, 25 Jahre Christian Bitzhenner, Dr. Jürgen Brand, Peter Christians, Hanna Clever, Dr. Hermann Eberlein, Hans-Otto Gorsboth, Paul Happ, Hans-Walter Henschke, Ilse Immeke, Hilde Kehlenbach, Hildegard Liebig, Dr. H.D. Miss, Detlef Schmitz, Peter Ulrich, Werner Wicke. Vorstand und Beirat haben sich im letzten Jahr sechsmal getroffen. Als neues Beiratsmitglied konnten wir Frau Prof. Dr. Ute Planert begrüßen, Professorin für neuere Geschichte und Didaktik an der Bergischen Universität. Eingeladen wurde zu Vorträgen von Prof. Dr. Klaus Goebel über Gerhard Tersteegens Briefe in das Wuppertal, Rainer Hendricks über Persönlichkeiten und ihre Häuser an der Diekerstraße in Wichlinghausen. Gut besucht war auch der Vortrag von Jörg Himmelreich über Franz Krause, dem Architekten der Villa Herberts. Weitere Themen waren Jacob Engelbert Teschemacher, ein pietistischer Orgelbauer von Prof. Hans-Joachim Oehm, das Thema von Prof. Dr. Volkmar Wittmütz zum Jubiläum der Barmer Theologischen Erklärung Die lutherische Kirche hat geschlafen und die reformierte Kirche hat gewacht und unser neues Mitglied im Beirat Prof. Dr. Ute Planert referierte über Kriege und Krisen. Alltag im Zeitalter Napoleons. Im Engels-Haus fanden zwei Vorträge statt: Eine Vorschau auf die Biedermeierausstellung im Herbst war der Vortrag von Prof. Dr. Joseph Kruse: Wo lag Krähwinkel? Prof. Dr. Helga Grebing referierte über Willy Brandt. Der andere Deutsche. Ein historischer Verein pflegt Traditionen. Als festes Angebot unseres Exkursionsprogramms bieten wir jährlich eine Stadtwanderung an; diesmal trafen wir uns in Beyenburg. Die alljährliche Besichtigung von Gottesdienststätten fand in der Synagoge und in der Gemarker Kirche statt. Elke Brychta und Dr. Arno Mersmann führten wieder eine Überraschungsfahrt durch und die Krippenfahrt ging nach Münster. Die Bonner Museen sind immer eine Reise wert besuchten wir die Ausstellung: Die Langobarden. Auf den Spuren der Preußen waren wir in Hamm und haben selbstverständlich das Jahrhundertereignis wahrgenommen, indem die drei Ausstellungen zur Varusschlacht besucht wurden. Jedes Jahr finanziert unsere Abteilung die eigene Publikation Geschichte im Wuppertal. Statt einer Weihnachtsgabe erhielten diesmal alle Mitglieder das Heft Geschichte im Wuppertal 2009 als Katalog zu der Ausstellung Von Tugend und Glück. Erstmals in Wuppertal haben vier Institutionen (Historisches Zentrum, von der Heydt-Museum, Völkerkundemuseum und CityKirche) ein Thema, die Zeit des Biedermeier, in unterschiedlichen Aspekten bearbeitet. Der BGV Abt. Wuppertal war verantwortlich für den Ausstellungsteil Gemeinde Gesellschaft Gebet in der CityKirche. Mit dem Katalog, der zum Ende der Ausstellung vergriffen war, wurden offensichtlich viele Menschen auf den BGV auf- 133
2 merksam. Im letzten Jahr konnten wir 67 neue Mitglieder in unsere Liste eintragen. Die letzten Informationen gelten der Geschichtswerkstatt: Die Flyer mit dem Angebot für die geführten Rundgänge liegen vor. Außerdem sind inzwischen 2 Broschüren von den dreizehn Routen erschienen, einige Manuskripte sind in Vorbereitung. In dem Kassenbericht erläuterte Dr. Florian Speer die gesunde Finanzlage unseres Vereins. Mit 67 Neuaufnahmen, 11 Verstorbenen und 16 Austritten konnte die Mitgliederstatistik per Saldo eine positive Bilanz aufweisen. Am zählte unsere Abteilung 838 Mitglieder. Christel Weidenbach bescheinigte dem Schatzmeister nach Prüfung der Kasse eine sorgfältige Kassenführung und beantragte die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig mit Enthaltung der Betroffenen erteilt wurde. Beide Kassenprüfer erklärten sich bereit, auch 2010 diese Funktion wieder auszuüben. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung hielt Dr. Uwe Eckardt einen Vortrag mit dem Thema: 400 Jahre Stadt Elberfeld. Sigrid Lekebusch Studienfahrt zur Weserrenaissance nach Lemgo, Detmold und Höxter vom 3. bis 5. Juni 2010 Bei strahlendem Sommerwetter startete der Bus mit Dr. Christoph Heuter als Fahrtenleiter und 37 Damen und Herren am 3. Juni 2010 an die Weser. Das erste Ziel, Schloss Brake mit dem Weserrenaissancemuseum, wurde pünktlich erreicht. Nach einer ersten theoretischen Einstimmung im Bus durch Dr. Heuter folgte die Einführung in die Baugeschichte des Schlosses vor Ort. Die Führungen durch das Museum verdeutlichten darüber hinaus die Geschichte der Weserrenaissance anhand ausgesuchter Exponate. Der europäische Baustil der Renaissance hat im 16. bis 17. Jahrhundert im Weserraum eine besondere Ausprägung erfahren. Kaum irgendwo sonst in Mitteleuropa wurden in dieser Zeit so viele Renaissance-Bauten errichtet wie im Weserraum. Eine Voraussetzung für die rege Bautätigkeit zwischen 1520 und 1620 war die wirtschaftliche Blüte dieser Zeit. Westlich und östlich der Weser wurden vom Adel und den Landesherren viele Schlösser neu erbaut oder alte durchgreifend umgestaltet. Dazu gehört auch Schloss Brake, das ab 1587 als Residenz der Grafen zur Lippe im Stil der Renaissance ausgebaut wurde. Es ist von einem Wassergraben umgeben und steht auf den Grundmauern einer der größten mittelalterlichen Burgen Norddeutschlands. Der markante Turm macht es zum weithin sichtbaren Wahrzeichen der alten Hansestadt Lemgo. Die Gebäude im näheren Umfeld des Schlosses vermitteln noch heute ein eindrucksvolles Bild einer frühneuzeitlichen Residenz. Am Schloss und im Museum sind die auffallenden baulichen Gestaltungsmittel der Weserrenaissance nachvollziehbar. Dazu gehören die welschen Giebel (geschwungene Giebel nach italienischem Vorbild), Kerbschnitt-Bossensteine (Quader mit gleichförmigen, kerbenartigen Ornamenten), besonderes Beschlagwerk (als Ornament, besonders an Giebelkanten und Portalen), Streifenputz (Putz in rautenförmiger Schraffur), Fächerrosetten (Halbkreise mit Fächerornamenten), die Utlucht (niederdeutsch für Auslug, Ausblick, vom Erdboden ausgehender, erkerartiger Vorbau). Die Bautätigkeit im Weserraum zur Zeit der Weserrenaissance zog Bauhandwerker und bedeutende Baumeister aus anderen deutschen Landen an. Mehr als zwanzig Baumeister der Renaissancearchitektur im Weserraum sind mit Namen und Herkunft bekannt, so auch Jörg Unkair aus Lustnau bei Tübingen, Cord Tönnies aus Hameln, die uns in Detmold wieder begegnen werden. Derartig vorbereitet bot die ehemalige Hansestadt Lemgo mit den prachtvollen Häusern 134
3 ein permanentes Wiedererkennen der unterschiedlichen Merkmale der Weserrenaissance, die auch bei der anschließenden Besichtigung des Hexenbürgermeisterhauses deutlich wurden. Der außergewöhnliche Name des im 16. Jahrhundert erbauten imposanten Hauses geht auf den Bürgermeister Hermann Cothmann ( ) zurück, in dessen Amtszeit die letzte Welle der Hexenverfolgung fiel. Zwischen 1583 und 1681 wurden nach derzeitigem Forschungsstand 254 Personen verurteilt und hingerichtet, darunter 38 Männer. Die lange Dauer der Verfolgung und die große Zahl der Opfer waren besondere Kennzeichen der Hexenverfolgung in Lemgo. Der Vormittag des nächsten Tages blieb der Residenzstadt Detmold vorbehalten. Nach Zerstörung der Detmolder Burg und Wiederaufbau als Schloss diente das Gebäude den lippischen Landesherren als Residenz wurde es unter Jörg Unkair, der sich bereits mit einer beachtlichen Zahl von Renaissancebauten im Weserraum einen Namen gemacht hatte, zu einem stattlichen Renaissanceschloss umgebaut. Zwei Giebel an der rechten Seite der Vorderfront des Schlosses und die beiden vorderen Treppentürme tragen noch seine unverkennbare Handschrift. Nach dem Tod Unkairs im Jahre 1554 fügte der flämische Steinschneider Johann Robin im Schlosshof die berühmte Renaissancegalerie zwischen den beiden Treppentürmen ein und Baumeister Kord Tönnies vollendete den Neubau des Schlosses. Erst im 18. Jahrhundert wurde das Schloss teilweise barockisiert. Das nächste Ziel, die Hämelschenburg, ist wohl das bekannteste Schloss der Weserrenaissance und präsentiert sich in aller Pracht schon von weiten. Nach einem Brand, der die ältere Burg vernichtete, ließ Ludwig Klencke die Dreiflügelanlage mit zwei achteckigen Treppentürmen erbauen. Die Führung durch die Innenräume sowie die Besichtigung der normalerweise verschlossenen Schlosskapelle waren der nächste Programmpunkt. Bei Kaffee und Kuchen im Schlosshof unter Sonnenschirmen erholte sich die Gruppe von den zahlreichen Eindrücken. Ausklang des Tages war eine geruhsame Fahrt an der Weser entlang mit Besichtigung einer Barockkirche am Wegesrand, der Jürgen Rottmann mit einem Trompetensolo die passende Atmosphäre verlieh. Für den letzten Tag war der Besuch in Höxter und das Kloster Corvey geplant. In dem ehemaligen Adelshof in Höxter erhielt die Gruppe einen intensiven Einblick in die Arbeit des Denkmalschutzes. Während der vordere Teil des Hauses zu einem Museum umgebaut worden ist, ist der rückwärtige Teil unter Berücksichtigung der denkmalgeschützten Substanz in Wohnungen umgebaut worden, die modern, individuell gestaltet sind und dennoch den Flair des alten Hauses bewahrt haben. In dem Büro der leitenden Architektin konnten die Wandbemalungen und der Fußbodenbelag aus den letzten Jahrhunderten freigelegt werden. Bei dem anschließenden Rundgang, der Besichtigung des Rathauses und einer Fülle an Bürgerhäusern, die die stilistischen Merkmale der Weserrenaissance aufweisen, ist besonders das Adam-und-Eva-Haus von 1571 erwähnenswert, das neben Adam und Eva die Darstellung einer Kreuzigungsgruppe, die einzige im Oberweserraum, aufweist. Abschluss der Fahrt bildete der Besuch von Corvey, der ehemaligen Reichsabtei, die 822 gegründet und mit den Reliquien des hl. Stephanus und 836 mit denen des hl. Vitus versehen wurde, so dass das Kloster mit der ehem. Abteikirche St. Stephanus und Vitus zu dem kirchlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Mittelpunkt aufblühte säkularisiert und 1820 zum Schloss umgestaltet, ist es heute ein Museum mit der umfangreichen Bibliothek von mehr als Bänden, die Hoffmann von Fallersleben als Schlossbibliothekar betreute. Bis heute prägen das Westwerk und die Abteikirche das Bild von Corvey. Während das zweigeschossige Westwerk mit restaurierter Raumausmalung beeindruckt, kontrastiert 135
4 dazu das 1667 erbaute Langhaus mit der reichen Ausstattung des üppigen Paderborner Barocks. Nach dem Besuch dieser bedeutenden und zum Weltkulturerbe nominierten Anlage treten wir die Heimreise an. Sigrid Lekebusch Wolfgang Hütt zum 85. Geburtstag Wolfgang Hütt Foto: Fliegenkopf Verlag, Halle Der Kunsthistoriker und Schriftsteller Wolfgang Erich Hütt wurde am 18. August 1925 als Sohn des Handlungsgehilfen Abraham Erich Hütt und seiner Frau Helene, geb. Stahl, in der Oberdörner Straße 12 in Barmen geboren. 1 Nach der Volksschule erlernte er den Maurerberuf. Ab Herbst 1942 besuchte er die Staatsbauschule in der Unterbarmer Pauluskirchstraße, eine Fachschule für Bauingenieure. Wolfgang Hütt wurde jedoch schon Anfang 1943 zuerst zum Arbeitsdienst und dann zum Militärdienst eingezogen. In den letzten Kriegstagen versteckte er sich bei seinen Eltern, die nach dem schweren alliierten Luftangriff auf Barmen am 29./30. Mai 1943 in die Nähe von Leipzig gezogen waren. Nach Kriegsende unternahm Wolfgang Hütt seine ersten journalistischen Gehversuche in Halle (Saale) als Mitarbeiter der Volkszeitung. Organ der Kommunistischen Partei für die Provinz Sachsen und beim Landessender. Zeitweise hatte er eine Stelle im Kulturamt der Stadt Eilenburg. Nach Ablegung einer Sonderprüfung studierte er von 1946 bis 1948 an der Universität Halle zuerst Germanistik und Geschichte, wechselte dann aber zur Kunstgeschichte und Archäologie heiratete er. Er unterbrach sein Studium und verdiente den Lebensunterhalt für seine Familie als Maurer und dann als Funktionär der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF). 2 Von 1951 bis 1953 setzte er das unterbrochene Studium fort promovierte er in Halle mit der Untersuchung Die Düsseldorfer Kunst und die demokratische Bewegung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die wissenschaftliche Karriere zuerst als wissenschaftlicher Aspirant, dann seit 1959 als wissenschaftlicher Oberassistent an der Karl-Marx-Universität Leipzig endete abrupt Aus den Akten des Bestandes SAMPO des Bundesarchivs und der Gauck-Behörde, 3 die in Auszügen im Stadtarchiv Wuppertal vorhanden sind, 4 geht hervor, dass Wolfgang Hütt seit ca regelmäßig überwacht und bespitzelt worden ist. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe beziehen sich u. a. auf seine Weigerung einzusehen,, dass Klassenkampf auf dem Gebiet der Kunst stattfindet und dass Hütt in den letzten Jahren faktisch gegen die Entwicklung einer sozialistischen Kunst gearbeitet hat. Spitzel überwachen nicht nur seine Vorlesungen und Vorträge, sondern sind auch über den Inhalt der von ihm geplanten Publikationen informiert. Sie stellen dabei immer wieder negative Tendenzen fest und beschuldigen Wolfgang Hütt der Aufweichungs- und 136
5 Zersetzungstätigkeit innerhalb der Universität. Die in der DDR besonders schwer wiegenden Vorwürfe, eine revisionistische Haltung zu vertreten, die Inhalte westdeutscher Publikationen kritiklos zu übernehmen oder die Idee eines menschlichen Sozialismus zu unterstützen, tauchen in den Berichten immer häufiger auf. Nach dem Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 wurde Wolfgang Hütt von dem Ministerium für Staatssicherheit im Zentralvorgang Slawist erfasst und wegen ideologischer Diversion und Verbreitung revisionistischer Auffassungen auf dem Gebiet der Kunstgeschichte bearbeitet. Der Informant Leopold berichtet am 9. September 1961, dass sich nach seiner Einschätzung am Kunsthistorischen Institut eine parteifeindliche Gruppierung entwickelt hat, als deren Kopf Hütt anzusehen ist. Noch 1961 wurde Wolfgang Hütt aus der SED ausgeschlossen, was gleichzeitig mit dem Verlust seiner Assistentenstelle verbunden war. Der engagierte Kunsthistoriker blieb in der DDR und arbeitete als freier Buchautor. Von 1969 bis 1971 leitete er die Staatliche Galerie Moritzburg in Halle. Er wurde weiterhin von Informellen Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit bespitzelt und u. a. wegen seiner Westkontakte im Zusammenhang mit einer von ihm geplanten Ausstellung über Künstler und Kunst in Halle nach dem Zweiten Weltkrieg sowie seines Einsatzes für Künstler, die für ihre künstlerische Freiheit und Unabhängigkeit von Funktionären eintraten, denunziert und unter Druck gesetzt. Wolfgang Hütt sah sich gezwungen, auch diese Stelle aufzugeben. Das Ministerium für Staatsicherheit ließ ihn bis in die 1980er Jahre beobachten. Trotz dieser für uns in Westdeutschland eigentlich nicht vorstellbar schwierigen Umstände hat Wolfgang Hütt eine kaum noch überschaubare Zahl wissenschaftlicher und populärwissenschaftlicher Arbeiten vor allem zur Kunst der Revolutionszeit (1848/49) und der Kunstentwicklung in der DDR, darunter zahlreiche Monographien, vorgelegt. Nicht nur seine Veröffentlichungen über die Düsseldorfer Malerschule, Adolf Menzel oder Willi Sitte sind längst wichtige Standardwerke geworden. Auch die Übersetzungen in zahlreiche andere Sprachen belegen seine Fachkompetenz. Hierfür spricht auch die in der DDR übliche Praxis der Vergabe von Buchlizenzen an westdeutsche oder österreichische Verlage. Hinzu kommen viele Kunstbücher für Kinder. Die hier vorgelegte Auswahl gibt nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Gesamtwerk wieder. Die Beiträge in Ausstellungskatalogen, in Kunstzeitschriften sowie in Wochen- und Tageszeitungen bleiben völlig unberücksichtigt. 5 Vor allem aus familiären Gründen hat Wolfgang Hütt trotz aller Hindernisse und Schwierigkeiten die Verbindung zu seiner Geburtsstadt und dem Bergischen Land nie abreißen lassen. Die 1982 erschienenen Erinnerungen Heimfahrt in die Gegenwart zählen zu den wichtigsten autobiographischen Zeugnisse über die Verhältnisse in Wuppertal während der Zeit des Nationalsozialismus. Im Zusammenhang mit der von dem Stadtarchiv Wuppertal 1984 gezeigten Ausstellung Wuppertal in der Zeit des Nationalsozialismus bin ich Wolfgang Hütt zum ersten Mal persönlich begegnet. Er hatte sich auf meine Bitte hin sofort bereit erklärt, im Rahmenprogramm der Ausstellung über seine Erlebnisse während seiner Kindheit und Jugend zu berichten. Die mit ihm im Stadtarchiv geführten Gespräche gehören zu den besonders beeindruckenden Erlebnissen während meiner Dienstzeit.1986 drehte das Medienzentrum unter Leitung von Hans-Werner Robke den Film Heimfahrt in die Gegenwart. Wolfgang Hütt hat neben anderen Zeitzeugen wesentlich zum Gelingen dieser Dokumentation, die im Anschluss vielfach zu Unterrichtszwecken in Schulen eingesetzt worden ist, beigetragen. Freunde und Wegbegleiter widmeten Wolfgang Hütt 1990 zu seinem 65. Geburtstag die von Ulrike Krenzlin herausgegebene, im Berliner Henschelverlag erschienene Festschrift Lebenswelt und Kunsterfahrung. Beiträ- 137
6 ge zur neueren Kunstgeschichte mit einem ausführlichen Verzeichnis seiner Veröffentlichungen. In der Festschrift findet sich unter anderem auch der Beitrag von Udo Mammen: Kinderbücher von einem Kunsthistoriker. Vielen Mitgliedern und Freunden des Schlossbauvereins Burg an der Wupper und des Bergischen Geschichtsvereins ist Wolfgang Hütt als Festredner zur Eröffnung der Johann Peter Hasenclever-Ausstellung am 3. April 2003 auf Schloss Burg und als Mitarbeiter an dem die Ausstellung begleitenden Katalog in guter Erinnerung. 6 Wegen seiner zahlreichen Beiträge nicht nur zur Erforschung der Kunstgeschichte des Bergischen Landes und des Rheinlandes hat die Abteilung Wuppertal durch ihren damaligen Vorsitzenden Professor Dr. Volkmar Wittmütz im Jahr 2001 dem für die Verleihung des Von der Heydt-Preises der Stadt Wuppertal zuständigen Kuratorium Wolfgang Hütt als Preisträger vorgeschlagen. Leider fand dieser Vorschlag keine Berücksichtigung. Vielleicht irritierte die Kuratoriumsmitglieder, falls sie sich überhaupt mit den von dem Bergischen Geschichtsverein eingereichten Unterlagen beschäftigt haben, der im Lexikon Schriftsteller der DDR (Leipzig, 1975) erschienene Artikel. Danach sind Wolfgang Hütts vom marxistischen Standpunkt geschriebene Darstellungen zur bildenden Kunst, die zumeist Text und Bild kombinieren, von dem Bemühen charakterisiert, die revolutionären und progressiven Impulse und Traditionen der Kunstgeschichte aufzuspüren. 7 Dadurch ist leider versäumt worden, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, unter welchen Voraussetzungen Wolfgang Hütts kunstgeschichtlichen Arbeiten, seine Vorträge und Zeitungsartikel entstanden sind und welche Bedeutung sie für das Kunstverständnis weiter Bevölkerungskreise, aber auch für die Kunstszene in der DDR gehabt haben. Zehn Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer veröffentlichte Wolfgang Hütt die Fortsetzung seiner Erinnerungen unter dem Titel Schattenlicht. Ein Leben im geteilten Deutschland. 8 Als Ergebnis seiner Recherchen in den Unterlagen des Bundesarchivs und der Gauck-Behörde legte er 2004 die Untersuchung Gefördert. Überwacht. Reformdruck bildender Künstler der DDR. Das Beispiel Halle vor. Im vergangenen Jahr trat der Kunstwissenschaftler als Romanautor an die Öffentlichkeit. Das Manuskript für den Roman Es gibt kein Arkadien, der das Ringen um die Freiheit der Kunst in der DDR trotz aller Einschüchterungsversuche von Seiten des Staates schildert, war schon vor der Wende abgeschlossen. Im Mittelpunkt des Romans Zinnoberrot und Schweinfurter Grün steht der Rahmenmacher Johannes Hackländer, aus dessen Sicht der Autor die Revolution 1848 in Düsseldorf und die Rolle, die die bekannten Künstler der Düsseldorfer Malerschule dabei spielen, in der Art eines weit ausladenden Gemäldes beschreibt Die Abteilung Wuppertal des Bergischen Geschichtsvereins gratuliert Wolfgang Hütt nachträglich sehr herzlich zu seinem 85. Geburtstag. Auswahlbibliographie Das Genrebild, Dresden Der Einfluß des preußischen Staates auf Inhalt und Form der bildenden Kunst im 19. Jahrhundert (= Studienmaterial für die künstlerischen Lehranstalten 1), Dresden Wir und die Kunst. Eine Einführung in Kunstbetrachtung und Kunstgeschichte, Berlin 1959, 1. [= 8.] überarbeitete und erweiterte Auflage Landschaftsfotografie. Ein Beitrag zu ihrer Geschichte und Thematik, Halle Otto Nagel, Berlin Die Düsseldorfer Malerschule , Leipzig 1964, 1. [= 3.] neugestaltete Aufl
7 Junge bildende Künstler der DDR. Skizzen zur Situation der Kunst in unserer Zeit, Leipzig Adolph Menzel, Leipzig 1965, 1. [= 4.] überarb. und aktualisierte Aufl (Lizenzausgaben der 1. und 2. Aufl.). Mathis-Gothard-Neithardt, genannt Grünewald. Leben und Werk im Spiegel der Forschung, Leipzig Deutsche Malerei und Grafik im 20. Jahrhundert, Berlin Lea Grundig (Veröffentlichungen der Deutschen Akademie der Künste zu Berlin), Dresden 1969, 2. Aufl Willi Sitte, Dresden Deutsche Malerei und Grafik der frühbürgerlichen Revolution, Leipzig 1973 (Übersetzung ins Polnische 1985). Vom Umgang mit der Kunst. Kleine Einführung in Architektur, Plastik, Malerei und Grafik, Berlin 1974, 3. Aufl (Übersetzung ins Slowakische). Wolfgang Mattheuer (= Maler und Werk ), Dresden Otto Nagel (= Welt der Kunst ), Berlin 1976, 4. Aufl Künstler in Halle, Berlin Grafik in der DDR, Dresden Heimfahrt in die Gegenwart. Ein Bericht, Berlin 1982 (Neuauflage unter dem Titel: Heimfahrt. Erinnerungen an Kindheit und Jugendzeit in Wuppertal, Wuppertal, 1997). Hasenclever (= Maler und Werk ), Dresden Deutsche Malerei und Graphik , Berlin Hintergrund. Mit den Unzüchtigkeits- und Gotteslästerungsparagraphen des Strafgesetzbuches gegen Kunst und Künstler , Berlin Schattenlicht. Ein Leben im geteilten Deutschland, Halle Gefördert-überwacht. Reformdruck bildender Künstler der DDR. Das Beispiel Halle, Dößel Es gibt kein Arkadien (Roman), Halle Zinnoberrot und Schweinfurter Grün (Roman), Halle Kunstbücher für Kinder Was Bilder erzählen. Eine Einführung in die Malerei und Grafik und in die Kunst. Bilder zu betrachten, Berlin 1969, 2. Aufl Kleine bunte Welt. Ein Kunstbuch für Kinder, Leipzig 1973 (Lizenzausgabe und Übersetzungen ins Englische, Spanische und Ungarische). Wir gehen in ein Haus mit vielen Bildern, Berlin 1975, 3. Aufl Schwinge, Propeller, Raketenmotor. Ein Kunstbuch für Kinder. Ein Kinderbuch über Kunst, Leipzig 1977 (Lizenzausgabe und Übersetzungen ins Spanische und Ungarische). Was Städte und Häuser erzählen. Eine Einführung in Architektur, Plastik und in die Kunst, die Umwelt zu betrachten, Berlin Holt Euch das Licht der Sonne. Deutsche Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts im Klassenkampf, Berlin 1978, 2. Aufl
8 Der Drachentöter im Paradiesgärtlein. Über den Sinn der Zeichen und Symbole in der bildenden Kunst, Berlin 1984, 2. Aufl Anmerkungen: 1 Die folgenden Ausführungen stützen sich auf die Unterlagen des Wuppertaler Standesamts und auf Wolfgang Hütts autobiographische Aufzeichnungen Heimatfahrt in die Gegenwart (Berlin, 1982). 2 Vgl. auch Gabriele Baumgartner/Dieter Hebig: Biographisches Handbuch der SBZ/DDR , Bd. 1, S SAMPO = Stiftung der Parteien und Massenorganisationen der DDR. 4 Vgl. Stadtarchiv Wuppertal (StAW): Zeitgeschichtliche Sammlung (ZS): Personen: Wolfgang Hütt. 5 Eine umfassendere Zusammenstellung seiner Veröffentlichungen auf dem Stand des J ahres 2000, einschließlich der Rezensionen seiner Veröffentlichungen und der biographischen Artikel über ihn, hat Wolfgang Hütt in der in Anm. 4 aufgeführten Mappe im Stadtarchiv Wuppertal deponiert. 6 Vgl. Wolfgang Hütt: Ansprache zur Eröffnung der Ausstellung mit Werken von Johann Peter Hasenclever am 3. April 2003 auf Schloss Burg an der Wupper, in: Romerike Berge 53, 2003, H. 2, S und Wolfgang Hütt: Hasenclever Ein Maler im Vormärz. Geschichte und Gegenstände eines neuen Entdeckens, in: Stefan Geppert/Dirk Soechting (Hg.): Johann Peter Hasenclever ( ). Ein Malerleben zwischen Biedermeier und Revolution, Mainz 2003, S Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf Wolfgang Hütts Aufsatz: Israel, das Buch der Bücher und der Messias. Der bergische Maler El Shalom Wieberneit, in: Romerike Berge 53, 2003, H. 3, S Günter Albrecht u.a.: Schriftsteller der DDR, Leipzig 1975, S Vgl. auch die Besprechung von Wolfgang Seitz in der Wuppertaler Rundschau v Bei grundlegenden Überarbeitungen sind die Auflagenzahlen neu gezählt worden. * * * 11. Deutscher evangelischer Kirchentag in Barmen, 1860 Die evangelische Kirchengeschichtsschreibung kennt in der Geschichte des Evangelischen Kirchentages drei deutlich voneinander zu unterscheidende Abschnitte. Die ersten Kirchentage zwischen 1848 und 1872 waren als Reaktion auf die Revolution von 1848/49 von dem Bedürfnis nach nationaler und kirchlicher Einheit und gleichzeitig zunehmender monarchistischer Grundhaltung bestimmt. Nach einer Unterbrechung von 50 Jahren fanden zwischen 1922 und 1930 kirchenamtliche Zusammenkünfte als Repräsentation des Deutschen Evangelischen Kirchenbundes statt, die von einem zunehmenden Nationalismus geprägt waren. Der Kirchentag in seiner heutigen Gestalt geht auf eine Evangelische Woche 1949 in Hannover zurück, deren Teilnehmer unter dem Eindruck des Kirchenkampfes, des Zweiten Weltkriegs und der Kriegsgefangenschaft nach neuen Wegen suchten. Er versteht sich seitdem als Laienbewegung und Einrichtung in Permanenz. Auch wenn er seit 1949 starken Wandlungen unterworfen gewesen ist, ist an den Grundgedanken, wonach der Kirchentag eine Zusammenkunft für den gesamten deutschen Protestantismus und ein Forum für kirchenreformerische Auseinandersetzungen sein soll, gleichzeitig aber auch den ökumenischen Gedanken erfahrbar zu machen versucht, stets festgehalten worden. 1 Vor 150 Jahren fand vom 11. bis zum 14. September 1860 in Barmen der 11. Deutsche evangelische Kirchentag in der damals üblichen Verbindung mit dem Kongress für die Innere Mission statt. Bereits 1851 war Elberfeld Tagungsort des 4. Kirchentages gewesen. Diese ersten Kirchentage waren 1848 in Wittenberg mit dem Ziel ins Leben gerufen worden, die untereinander zerstrittenen Gruppierungen des deutschen Protestantismus zu vereinigen und so besser den sozialen Herausforderungen des 19. Jahrhunderts zu begegnen. Die angestrebte Vereinigung kam auch ansatzweise nicht zustande, da die strengen Lutheraner von Anfang an den Kirchentagen fern blieben. 140
9 Von bleibender Bedeutung war jedoch die von Johann Hinrich Wichern ( ) in Wittenberg gehaltene Rede über die Tat der Liebe als kirchenbauende Macht, 2 in deren Folge der Zentral-Ausschuss für die Innere Mission gegründet wurde. Das Barmer Bürgerblatt veröffentlichte in seiner Sonntagsausgabe vom 9. September 1860 als ganzseitige Beilage das komplette Kirchentagsprogramm. Danach hielt am Dienstag, den 11. September, der Berliner Hofprediger Karl Snethlage, 3 der von 1822 bis 1842 als Pfarrer gemeinsam mit dem lutherischen Pfarrer Johann Wilhelm Leipoldt in der neu gegründeten unierten Gemeinde in Unterbarmen gewirkt hatte, die Predigt des Eröffnungsgottesdienstes in der Unterbarmer Hauptkirche. Den Rechenschaftsbericht über die Geschäftsführung erstattete der stellvertretende Vorsitzende Dr. Heinrich von Mühler ( ). 4 Die Begrüßung der Abgeordneten der verschiedenen Kirchengemeinschaften, Vereine und Anstalten, die aus ihrer Arbeit berichteten, wurde zweimal wiederholt. An drei Abenden versammelten sich die Kirchentagsteilnehmer zu Gottesdiensten in den reformierten und lutherischen Kirchen Elberfelds und Barmens. In den Hauptversammlungen stellten unter der Leitung des engeren und weiteren Ausschusses ausgewählte Redner ihre Thesen zu den Themen Die Bedeutung des Alten Testaments für die christliche Erkenntnis und Bildung und Die Stellung unserer weltlichen Literatur zum Christentume und ihr Einfluss auf unsere Gesellschaft zur Diskussion. In Spezial-Konferenzen wurden die Themen Über die Pflege und Erziehung blödsinniger Kinder, Über Erziehungs-Vereine und Rettungsanstalten und deren Verhältnis zueinander, Über die Aufgaben der Schriftenvereine und Bücher-Colportage, Über die Aufgabe der Gefängnisgesellschaften, Über christliche Kunst, insbesondere über den protestantischen Kirchenbau, Über die Asyle für gefallene Mädchen und den Kampf wider die Sünde der Unzucht, Über Jünglings- und Gesellen-Vereine nebst Herbergswesen, Über die Aufgabe protestantischer Vereine wider Rom, Über die Sache der Enthaltsamkeitsvereine und Über die Mission zur Verbreitung des Evangeliums unter den Juden behandelt. Die Berichte aus den Spezial-Konferenzen gehörten in den Hauptversammlungen zu den festen Programmpunkten. Der mit dem Kirchentag verbundene Kongress für Innere Mission, auf dem die Themen Die Sammlung und Pflege der lebendigen Glieder der Gemeinde in ihrer Bedeutung für das Werk der Inneren Mission und Die Erziehung und Bewahrung des weiblichen Geschlechts in den arbeitenden Ständen, mit besonderer Rücksicht auf die desfallsigen sittlichen Aufgaben zur Beratung anstanden, wurde am 13. September durch Johann Heinrich Wichern eröffnet. Ein von dem Kirchentag beauftragtes Komitee rief am 13. September 1860 zu einer Sammlung zugunsten der kurz zuvor von libanesischen Drusen in Damaskus verfolgten und ermordeten syrischen Christen auf. Das Barmer Bürgerblatt veröffentlichte am 18. September 1860 den umfangreichen Aufruf. Dem für die Verwendung der gesammelten Spenden verantwortlichen Ausschuss unter dem Vorsitz des Hofpredigers Karl Snethlage gehörte auch der Barmer Oberbürgermeister Wilhelm August Bredt an. Der Aufruf endete mit der an die geehrten Bürger Barmens gerichteten Bitte, recht zahlreiche Beiträge zu spenden. In den Tageszeitungen spielten in dieser Zeit Lokalnachrichten nur eine untergeordnete Rolle. Umso bemerkenswerter ist der ausführliche Bericht über den von dem Bonner Professor Dr. Johann Peter Lange gehaltenen Vortrag über die Stellung der weltlichen Literatur zum Christentum und die sich daran anschließende Diskussion, 5 den das Barmer Bürgerblatt am 14. September 1860 veröffentlicht. Der Berichterstatter fasste nicht nur die Thesen des Referenten zusammen, sondern gab auch den Verlauf der Diskussion ausführlich wieder. Danach sprach sich der Elberfelder Pfarrer 141
10 Karl Krafft, der drei Jahre später zu den Mitbegründern des Bergischen Geschichtsvereins gehörte, entschieden gegen die Möglichkeit einer Vermittlung zwischen Christentum und Humanismus aus und schilderte der Elberfelder Lehrer Georg Rödel in beweglichen Worten, wie er in Schiller, Göthe, Shakspeare nur Träber gefunden und endlich in Christo Jesu Heil und Ruhe gewonnen habe. Bemerkenswert ist auch, mit welchem Aufwand die Buch- und Kunsthandlung Wilhelm Langewiesche, die ihren Sitz im Barmer Werth hatte, unter den Kirchentagsteilnehmern in dem Barmer Bürgerblatt gezielt für zahlreiche Veröffentlichungen der unterschiedlichsten Verlage warb. Darüber hinaus zeigte sie in den Räumen der Pfarrschule der Unterbarmer Gemeinde, in der mehrere Veranstaltungen stattfanden, eine Ausstellung mit großformatigen, für die Ausschmückung von Kirchen, Schulen und Vereinslokalen geeigneten Öldruck- und Holzschnittbildern. Letztere stammten aus dem Rauhen Haus in (Hamburg-) Horn. Ich denke, es lohnt sich, unter Einbeziehung aller erreichbarer Quellen, sich mit der Geschichte der Kirchentage in Elberfeld (1851) und Barmen näher zu beschäftigen. Dabei sind interessante Ergebnisse nicht nur für die Kirchen-, sondern auch für die Kultur- und Gesellschaftsgeschichte des Wuppertals in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu erwarten. Uwe Eckardt Anmerkungen: 1 Zur Geschichte und Einordnung der Deutschen Evangelischen Kirchentage vgl. die entsprechenden Artikel in: Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, 3. Aufl. bearb. von Albert Hauck, Bd. 10, 1896, Nachdruck 1970, S Evangelisches Kirchenlexikon. Internationale theologische Enzyklopädie, Bd. 1, 1986, Sp. 842 ff Religion in Geschichte und Gegenwart, 4. völlig neu bearb. Aufl., Bd. 4, 2001, Sp ff. 2 Johann Hinrich Wichern (* Hamburg Hamburg) studierte evangelische Theologie in Göttingen und Berlin. Er beschäftigte sich vor allem mit dem Problem des Pauperismus gründete er in Hamburg-Horn das Rauhe Haus für sozial entwurzelte Jugendliche. Die oben erwähnte Rede auf dem ersten Kirchentag in Wittenberg 1848 führte zur Gründung des Zentral- Ausschusses der Inneren Mission. Darüber hinaus bemühte er sich als Referent im preußischen Ministerium des Innern um die Reform des Gefängniswesens. Sein Wirken hat zur Herausbildung des Systems der sozialen Sicherung wesentlich beigetragen; vgl. Deutsche Biographische Enzyklopädie (DBE), Bd. 10, 1999, S. 470 (Jochen- Christoph Kaiser). 3 Vgl. Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), Bd. 34, 1892, S (Ferdinand Sander) und Peter Herkenrath: 140 Jahre Geschichte der Vereinigt-evangelischen Gemeinde Unterbarmen , Wuppertal 1963, S Heinrich von Mühler (* Brieg Potsdam) wurde nach dem Jurastudium und Promotion 1841 in das preußische Kultusministerium nach Berlin berufen, wo er für kirchliche Fragen zuständig war. Von 1682 bis 1872 amtierte er als Minister für geistliche, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten. Er veröffentlichte auch Balladen und Gedichte; vgl. Neue Deutsche Biographie (NDB) 18, 1997, S. 287 f. (Helmut Neubach). 5 Zu Johann Peter Lange, der am 10. April 1802 in Wuppertal-Sonnborn als Sohn eines Bauern und Fuhrmanns geboren wurde, als Pfarrer in Solingen-Wald, Langenberg und Duisburg wirkte, bevor er als Professor zuerst nach Zürich und dann nach Bonn berufen wurde, wo er am 8. Juli 1884 starb, vgl. August Lomberg: Johann Peter Lange, der Professor der Theologie, in: Ders.: Bergische Männer. Ein Beitrag zur Geschichte der Heimat, Elberfeld 1921, S sowie Realencyklopädie (wie Anm. 1), Bd. 11, 1902, S (Karl Krafft) und ADB 51, 1906, S (Otto Zöckler). Jürgen Abeler ( ) Am 24. Juli 2010 starb nach langer Krankheit der Elberfelder Uhrmachermeister und Goldschmied Jürgen Abeler. Zahlreiche Wuppertaler erwiesen ihm bei der Trauerfeier in der St. Laurentiuskirche am 3. August 2010 die letzte Ehre. 142
11 Jürgen Abeler wurde am 24. November 1933 in Elberfeld geboren. Er setzte in 5. Generation das Werk seiner Vorfahren, die 1840 nach Elberfeld gekommen waren und hier ein Uhrengeschäft gegründet hatten, fort. Gemeinsam mit seinem Vater Georg Abeler ( ) gründete er bereits 1958 in den Räumen des nach den Kriegszerstörungen wieder aufgebauten Geschäftshauses in der Elberfelder Poststraße 11 ein Historisches Uhrenmuseum, das sehr schnell einen wichtigen Platz innerhalb der kulturellen Einrichtungen der Stadt Wuppertal einnahm. Die wissenschaftliche Erforschung der Geschichte der Uhren und der Uhrmacher spielte seitdem in Jürgen Abelers Leben eine wichtige Rolle. Weitere Sammel- und Forschungsgebiete waren Kronen und Insignien sowie Ringe, Edelsteine, Speisekarten und Weinetiketten. Einen Großteil seiner Sammlungen machte er in viel beachteten Ausstellungen, zu deren Begleitung zumeist auch eine informativer und gut bebilderter Katalog erschien, einer großen Öffentlichkeit zugänglich. Jürgen Abeler engagierte sich in verschiedenen städtischen Gremien und zahlreichen Vereinen. Mit großer Kreativität initiierte er zahlreiche Veranstaltungen in der Stadt. Er wirkte aber auch im Verborgenen. Seine Initiative trug zum Beispiel maßgeblich zur würdigen Neugestaltung des Ehrengrabes des Lehrers Carl Fuhlrott, der 1846 den Neandertaler entdeckt hatte, auf dem Katholischen Friedhof an der Hochstraße bei. Für sein großes ehrenamtlichen Engagement erhielt er 1998 das Verdienstkreuz Erster Klasse und 2002 den Ehrenring der Stadt Wuppertal. Jürgen Abelers großer, leider nicht mehr verwirklichter Traum war die Etablierung eines historischen Schauspiels mit Wuppertaler Bezügen nach dem Vorbild etwa der Fürstenhochzeit in Landshut, des Fischerstechens in Ulm oder der Wallensteintage in Stralsund. Er versprach sich davon nicht nur eine Werbewirkung für seine Vaterstadt, sondern eine identitätsstiftende Wirkung für alle Wuppertaler. Als ersten Schritt in diese Richtung betrachtete er das am 1. Juni 2001 durch die Wuppertaler Bühnen uraufgeführte Stück Das Privileg des Wuppertaler Schriftstellers Karl Otto Mühl, das die Verleihung des Garnnahrungsprivilegs an die Elberfelder und Barmer Bleicher durch Herzog Johann III. von Berg im Jahr 1527 behandelt. Der Abteilung Wuppertal des Bergischen Geschichtsvereins trat Jürgen Abeler am 1. Januar 1967 bei. Zuvor hatte er bereits in der Nummer 9/1965 des BGV-Mitteilungsblattes Unsere bergische Heimat zur Erforschung der Geschichte der Uhrmacherkunst im Bergischen Land aufgerufen. Dieses Thema stand, wie die nachfolgende Auswahlbibliographie zeigt, am Beginn seiner umfangreichen Forschertätigkeit, in der auch die Geschichte seiner Familie einen breiten Raum einnahm. Selbstständige Veröffentlichungen Alt-Bergische Uhren und die Uhrmacherfamilien im Bergischen Land, Wuppertal 1968, 2. erw. Aufl Jahre Zeitmessung. Dargestellt im Wuppertaler Uhrenmuseum an der Privatsammlung der Uhrmacher- und Goldschmiedefamilie Abeler, Wuppertal 1968, 2. erw. Aufl Das Wuppertaler Uhrenmuseum (= Kulturgeschichtliche Museen in Deutschland, Bd. 12), Berlin/New York Kronen. Herrschaftszeichen der Welt, Düsseldorf 1972, 6. stark erw. Aufl., Wuppertal [Anlässlich der Kronen-Ausstellung in Maney/Frankreich erschien 1978 eine französische Übersetzung des Katalogs]. Ullstein-Uhrenbuch. Eine Kulturgeschichte der Zeitmessung, Berlin/Frankfurt/Wien 1975, 3. Aufl., Frankfurt/Berlin Meister der Uhrmacherkunst. Über Uhrmacher aus dem deutschen Sprachgebiet 143
12 mit Lebens- und Wirkungsdaten und dem Verzeichnis ihrer Werke, Wuppertal 1977, 2. stark erweiterte Aufl Vom Siegelring zum Liebesring. Geschichte und Symbolik des Ringes aus 4 Jahrtausenden, dargestellt an der Wanderausstellung Jürgen und Gudrun Abeler [Sonderdruck als Katalog], In Sachen Peter Henlein, Wuppertal Das Wuppertaler Uhrenmuseum (= Schnell Kunstführer 1411), München/Zürich Zeit-Zeichen. Die tragbare Uhr von Henlein bis heute (= Die bibliophilen Taschenbücher 362), Dortmund 1983, 3. Aufl Die Longitudo zur See. Zeitmessung und Ortsbestimmung auf hoher See, Wuppertal 1983 Kronen-Zepter-Reichsäpfel. Herrschaftszeichen der Welt, Wuppertal 2008 [= 7. erweiterte und völlig überarbeitete Auflage der 1972 erschienenen Veröffentlichung Kronen, Herrschaftszeichen der Welt ]. Zeitschriftenbeiträge Meine schönsten alten Uhren, in: Westermanns Monatshefte 102, 1961, Heft 9, S Die Gebrüder Johannes, Augustinerpatres und Uhrmacher, in: Mainzer Zeitschrift 69, 1974, S Uhren und Uhrmacher aus dem Wuppertal, in: Mitteilungen des Stadtarchivs, des Historischen Zentrums und des Bergischen Geschichtsvereins Abteilung, Wuppertal 8, 1983, Heft 3. (Mit Ursula Schmidt-Goertz) Das Wuppertaler Uhrenmuseum. Zur Geschichte der Zeitmessung Uhrmacher im Bergischen Land, in: Rheinisch-Bergischer Kalender 55, 1985, S Genauigkeit der Zeitmessung, in: Praxis der Naturwissenschaften Physik in der Schule 51, 2002, Heft 6, S Familienforschung Die Uhrmacher- und Goldschmiedefamilie Abeler und ihre Vorfahren. 125 Jahre im Dienste des Handwerks, Wuppertal Die Ahnen der Uhrmacher- und Goldschmiede-Familie Abeler, Wuppertal Ein Wuppertaler und sein Werk. Georg Abeler 70 Jahre, Wuppertal Spitzenahnen der Uhrmacher- und Goldschmiedefamilie Abeler in Nordrhein- Westfalen, Nordbrabant und Rheinland-Pfalz, Wuppertal Die Uhrmacher- und Goldschmiedefamilie Abeler. Ihre Vorfahren und Verwandten; Lebensläufe, Daten und Fakten, Bd. 1 3, Sprockhövel, Uwe Eckardt Bundeswettbewerb des Verbandes Wohneigentum 2009 Im Juni 2009 fand der 24. Bundeswettbewerb des Verbandes Wohneigentum (früher: Deutscher Siedlerbund) unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung statt. Der nur jedes vierte Jahr durchgeführte Wettbewerb war unter dem Titel Wohneigentum heute und morgen. Energieeffizienz Klimaschutz- bürgerschaftliches Engagement ausgeschrieben worden. Der sechsköpfigen Bewertungskommission, die 20 Landessieger-Siedlungen in 16 Bundesländern zu bewerten hatte, gehörte auch Siegfried Wirtz, langjähriger Vorsitzender des Wuppertaler Stadtjugendringes und Mitglied der Abteilung Wuppertal des Bergischen Geschichtsvereins, an. Den geteilten 1. Preis überreichte am 17. November 2009 im 144
13 Rahmen eines Festaktes in Berlin Bundesminister Peter Ramsauer an die Siedlungsgemeinschaft Aueblick (Lübeck) und an die Siedlergemeinschaft Perl-Besch im Saarland. U. E. In eigener Sache Liebe Mitglieder und Freunde des Bergischen Geschichtsvereins Abt. Wuppertal, kurz ein paar Worte in eigener Sache zu den Themen Adressänderungen, Mitgliedsbeiträge, Spendenbescheinigungen, Fristen Haben Sie vielleicht schon einmal keine Post mehr von uns erhalten? Oder sind von Ihnen Beiträge nachgefordert wurden? Auch wenn Ihre BGV-Mitgliedschaft sicherlich eines der letzten Probleme ist, wenn Sie einmal umziehen: Bitte denken Sie dennoch daran, uns rechtzeitig zu informieren, sollte sich Ihre Adresse ändern oder wenn Sie die Hausbank wechseln. Vergessen Sie eine solche Mitteilung, dann können Sie auch keine weiteren Zusendungen mehr erreichen. Während unsere Schrift Geschichte im Wuppertal mit dem Postvermerk Empfänger unbekannt an uns zurückkehrt, so ist es jedoch besonders ärgerlich beim Versand der Zeitschrift Romerike Berge. Diese Vierteljahrsschrift, die an alle Mitglieder unseres Vereins sowie an die Mitglieder des Schloßbauvereins geht, wird über die günstigere Versandform als Postzeitungsgut verschickt. Hierbei werden jedoch die Hefte, sollte der Empfänger nicht erreichbar sein, vernichtet. Dumm für uns: Wir erfahren nicht, daß Ihre Anschrift nicht mehr besteht. Dumm für Sie: Diese Hefte können wir, da sie wie erwähnt bei Unzustellbarkeit von der Post vernichtet werden, auch nicht mehr nachliefern. Ein weiteres: Haben Sie uns die (für beide Seiten bequeme) Möglichkeit eingeräumt, Jahresbeiträge im Lastschriftverfahren zu erheben, müssen Sie uns unbedingt über einen Kontenwechsel informieren. Wird das unterlassen, dann stornieren die Banken den Abbuchungsversuch kostenpflichtig. Der zuvor gut-gebuchte Jahresbeitrag wird nach wenigen Tagen wieder von unserem Vereinskonto abgebucht mit Bemerkungen wie: Kontonummer falsch, Konto erloschen oder auch, in Ausnahmefällen: nicht bezahlt. Neben der Rückbuchung erfolgt zu Lasten des BGV eine ärgerliche Gebührenerhebung. Bestand Ihr früheres Konto bei unserer Hausbank, sind das 3,00 EUR, bestand Ihr Konto jedoch bei einem anderen Institut, so betragen diese Gebühren bereits 9,50 EUR. Da solchen Fällen in der Regel Versäumnisse Einzelner zu Grund liegen, bitten wir natürlich die betreffenden Mitglieder anschließend um Erstattung. Zum Thema Beitragszahlungen sind noch ein paar Punkte zu ergänzen: Der Bergische Geschichtsverein ist ein freiwilliger Zusammenschluß von Menschen, die ein Interesse an der Geschichte des Bergischen Landes miteinander verbindet. Viele einzelne Projekte in diesem Bereich werden gefördert und unterstützt, teils eben durch finanzielle Beiträge, teils durch eigenes Mittun. Die Ergebnisse diese Arbeit fließen dann in unsere Publikationen und Zeitschriften ein, die der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Soweit erst einmal ganz grob formuliert. Deutlich wird damit: Der BGV ist kein Buchclub, der gegen Jahreszahlungen Bücher verschickt, sondern ein gemeinnütziger Verein, der von vielen getragen wird und letzlich aber auch nur durch viel ehrenamtliche Tätigkeit bestehen kann. Daß dabei die Mitgliedsbeiträge freiwillig und unaufgefordert im 1. Quartal des Jahres gezahlt werden, so wie es in der Satzung formuliert ist, sollte selbstverständlich sein. Rechnungen, nach denen gelegentlich gefragt wird, kann der BGV (bei über 800 Mitgliedern der Wuppertaler Abteilung) nicht schreiben. Wer Mitglied wird, sollte auch bereit sein, seinen Verpflichtungen unaufgefordert nachzukommen oder aber sich dieser Aufgabe über seine Bank zu entledi- 145
14 gen: entweder per Dauerauftrag oder per Lastschriftverfahren. Für einen kleineren Teil unserer Mitglieder müssen gelegentlich Erinnerungsschreiben verschickt werden. Darum hatte bereits die Mitgliederversammlung vom 6. März 2003(!) festgelegt, daß in diesem Falle eine Gebühr in Höhe von 3,00 EUR erhoben wird. Daß alle Mitglieder an diesen Beschluß (solange er nicht wieder aufgehoben wird) gebunden sind, sollte natürlich selbstverständlich sein. Ein Vereinsbeitrag für einen gemeinnützigen Verein kann man in der Regel nicht steuerlich geltend machen, Spenden hingegen sehr wohl. Grundsätzlich gehört der BGV aber zu jener Art von Vereinen, bei denen es möglich ist, nach einer Einzelprüfung eine Genehmigung zu erhalten, auch Beiträge steuerlich geltend zu machen. Im Zuge der neueren Steuergesetze wird diese Möglichkeit jedoch von Verein zu Verein individuell untersucht und nach der Situation des jeweiligen Vereines entsprechend beschieden. Unser normaler Beitrag ist auf 25 EUR im Jahr festgelegt, was auf den Monat gerechnet etwas mehr als 2 Euro beträgt. Dafür gibt es neben kostenlosen Vorträgen, der Möglichkeit, an Fahrten (i.d. Regel mit sachkundiger Führung) teilzunehmen, kostenlosen Schriften auch noch den unentgeltlichen Zugang zur Stadtbibliothek Wuppertal. Das ist sehr viel Leistung für recht wenig Geld. Das meinte das für uns zuständige Finanzamt auch und hat entschieden, daß im Falle des Bergischen Geschichtsvereins nur reguläre Spenden also keine Beiträge bei Steuererklärung zur Geltung gebracht werden dürfen. Natürlich hat der Vorstand mehrere Versuche unternommen, hier zu einer anderen Lösung zu gelangen, leider vergeblich. Bitte denken Sie also daran: Wenn Sie Ihre Steuer einreichen, können Sie Überweisungsträger mit Ihrem Jahresbeitrag in Höhe von 25 EUR nicht geltend machen. Wortungetüme wie Spende/Beitrag, Beitragsspende, o. ä. werden vom Finanzamt nicht anerkannt und könnten Ihnen Ärger bereiten. Vollkommen unberührt davon bleiben natürlich echte Spenden, für die wir immer dankbar sind und die Sie auch weiterhin steuerlich geltend machen können. Nebenbei: Seit sind Spenden bis 200 EUR (bis dahin waren es 100 EUR) auch einfach nachweisbar, d.h. durch den Überweisungsträger; aber in unserem Falle eben nur reine Spenden. Es gibt neben dem allgemeinen Beitrag in Höhe von 25 EUR auch noch einen ermäßigten Beitrag in Höhe von 15 EUR, der dazu gedacht ist, junge Menschen, insbesondere Schüler und Studenten, durch ein besonders günstiges Angebot an den Verein heranzuführen. Dieser ermäßigte Beitrag ist nicht kostendeckend und wird letztlich von allen Mitgliedern mitbezahlt. Daher kann und sollte eine Mitgliedschaft mit ermäßigtem Beitrag nur ein vorübergehender Zustand sein. Wir erwarten, daß Schüler oder studentische Mitglieder das Ende ihrer Ausbildungszeit mitteilen. Gelegentlich stellen wir aber fest, daß Mitglieder trotz Arbeitsstelle und eigenem Einkommen einen ermäßigten Beitragssatz weiter in Anspruch nehmen, weil sie diese Mitteilung schlichtweg vergessen. Wir bitten freundlichst darum, uns das Ende Ihrer Ausbildungzeit mitzuteilen! Unangenehm ist es jedoch, wenn jemand mit Berufseinkünften auf einem ermäßigten Beitragssatz besteht, weil er oder sie sich nach dem Studium z.b. für die Promotion oder aber neben dem Beruf als Student/Studentin der Fernuniversität eingetragen hat; de jure mag das wohl richtig sein, aber es hinterläßt doch einen schalen Beigeschmack! Florian Speer 146
15 Buchbesprechungen Wolfgang Hütt: Zinnoberrot und Schweinfurter Grün, Halle: Projekte-Verlag Cornelius, 2009, 456 S., 24,80, ISBN: Der Verfasser, 1925 in Wuppertal-Barmen geboren, ist einer der besten Kenner der Geschichte des Düsseldorfer Malerschule in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Mit diesem Roman erfüllt er sich vermutlich einen seit langer Zeit gehegten Wunsch. Im Mittelpunkt der Handlung, die in den Jahren 1847 bis 1849 spielt, steht der Düsseldorfer Tischlermeister Hannes Hackländer, der sich als Rahmenmacher bei den Künstlern der Stadt einen guten Namen gemacht hat. Durch seinen Freund Theodor Mintrop, den Sohn eines Bauern aus der Grafschaft Mark, ein ländlicher Raffael, der dank eines Stipendiums an die Akademie gekommen ist, lernt er Agnes Althaus, die Tochter ein Ölmüllers, kennen und lieben. Das glückliche Paar heiratet, kurz vor Ende des Jahres 1848 kommt der erste Sohn zur Welt. Wolfgang Hütt erzählt diese Geschichte mit bemerkenswert großer Liebe zum Detail vor dem Hintergrund der revolutionären Unruhen in der Stadt, in die der Tischlermeister als Mitglied der Bürgerwehr, aber auch als Geschäftspartner und guter Freund vieler Künstler mit hineingezogen wird. Dazu zählen in erster Linie die Maler Carl Friedrich Lessing und seine Frau Ida, Johann Peter Hasenclever und seine Frau Caroline, Karl Wilhelm Hübner, Johann Wilhelm Schirmer und Gustav Adolf Koettgen sowie der Arzt und Schriftsteller Wolfgang Müller, genannt Müller von Königswinter, und der Musiker Ferdinand Hiller. In dem aus vielen Episoden zusammen gesetzten Gesamtbild treten auch Ferdinand Freiligrath, dem wegen seines Liedes Die Toten an die Lebenden die reaktionären Kräfte den Prozess machen, Carl Schurz und Ferdinand Lassalle auf. Selbstverständlich fehlt auch nicht der Abschnitt, in dem Johann Peter Hasenclever zu seinem Bild Arbeiter vor dem Magistrat, das zu den wichtigsten künstlerischen Dokumenten der Revolution von 1848 zählt, Stellung nimmt Der Leser erfährt von der Eskalation der politischen Ereignisse, beginnend mit der demokratischen Aufbruchstimmung im März 1848 über das Einheitsfest am 6. August 1848 und die Gründung des Künstlervereins Malkasten bis hin zur Verhöhnung des Königs Friedrich Wilhelm IV. und den ersten Zusammenstößen zwischen den aufgebrachten Massen, darunter zahlreiche Arbeitslose, und dem preußischen Militär, indirekt über Hannes Hackländer aus den Unterhaltungen und Diskussionen der Künstler bzw. aus den Schilderungen des Schreinergesellen Bernhard Brinkmann, der sich dem Volksklub angeschlossen hat und im Gegensatz zu seinem Meister immer radikalere Ansichten vertritt. Es ist auffallend, dass sich Hannes Hackländer, nicht nur weil er als Ehemann und Vater Verantwortung trägt, sich immer mehr in das Private zurückzieht. In der Sprache der Künstler heißt dies, dass er sich für das Schweinfurter Grün, die Farbe der konservativen, von dem Akademiedirektor Friedrich Wilhelm von Schadow angeführten Madonnenmalern, und gegen das Zinnoberrot der Revolution entscheidet. Als ihm auf seine Frage nach dem Sinn der revolutionären Kämpfe im Mai 1859 im Zuge der Reichsverfassungskampagne Bernhard Brinkmann antwortet, dass es um Freiheit und die Einheit Deutschlands geht, stellt er resignierend fest: Freiheit! Was ist Freiheit? Wir haben unsere Arbeit, ein Auskommen. Ob er sich doch noch eines anderen besinnt, als seine ihm zu Hilfe eilende Frau durch das Bajonett eines angetrunkenen Soldaten schwer verletzt wird, bleibt offen. U. E. 147
16 Wilhelm Dörpfeld: Daten meines Lebens. Hg. von Klaus Goebel und Chara Giannopoulou, Patros 2010, 318 S., 31 Abb., ISBN , 18,00. Im Jahr 2008 fand auf der griechischen Insel Lefkas ein internationaler Dörpfeld-Kongress statt, in dessen Rahmen Klaus Goebel die Edition der Tagebuchaufzeichnungen des 1853 in Wuppertal-Barmen geborenen und 1940 auf Lefkas gestorbenen Archäologen anregte. Wilhelm Dörpfeld, der Begründer der modernen Grabungsmethoden, der unter Heinrich Schliemann in Troja gegraben und danach wichtige Ausgrabungen u.a. in Olympia, Tiryns, Pergamon, Athen und Lefkas verantwortlich geleitet und wissenschaftlich ausgewertet hat, beginnt mit seinen fortlaufenden Aufzeichnungen 1916, stellt diesen jedoch die wichtigsten Daten seit seiner Geburt aus der Rückschau voran. Nach seiner weitgehenden Erblindung setzt seine Nichte Gertrud von Rohden die Aufzeichnungen fort. Die Eintragungen sind sehr knapp, auf das Faktische beschränkt, ohne persönliche Kommentare. Sie betreffen in der Hauptsache Grabungen, Veröffentlichungen, Vorträge, Teilnahme an Konferenzen, Reisen (Ziele und Begleiter), Besuche und Besucher sowie Auszeichnungen und Ehrungen. Die Grabungsorte, die selbständigen Veröffentlichungen und die Zeitschriftenaufsätze sowie die ihm gewidmeten Bücher wobei es sich wohl vielfach um handschriftliche und nicht um gedruckte Widmungen handelt sind akribisch aufgelistet. Demjenigen, der sich wissenschaftlich mit dem Leben und Werk des bedeutenden Archäologen beschäftigt, stehen mit diesen Daten, die über weite Abschnitte den Charakter eines Itinerars haben, eine wichtige Quelle zur Verfügung. Bereits Peter Goessler hat dieses Datengerüst für seine nicht immer sehr kritische, aber umfassende Biographie (Wilhelm Dörpfeld: Ein Leben im Dienste der Antike, Stuttgart 1951) zur Grundlage gemacht. Dank der Übersetzung von Dörpfelds Aufzeichnungen in das Griechische durch die Mitherausgeberin Chara Giannopoulou steht mit diesem reich bebilderten Band ein wichtiges Hilfsmittel zur Verfügung, um die bisher so erfolgreiche deutsch-griechische Zusammenarbeit bei der Pflege des großen Erbes, das der Grieche aus Barmen der Nachwelt hinterlassen hat, erfolgreich fortzuführen. U. E. Hans Joachim de Bruyn-Ouboter: 1200 Jahre Barmen. Die Stadtgeschichte (Edition Köndgen), Wuppertal 2009, 288 S., zahlr. Abb., ISBN , 29,95. Es ist gut, dass rund 100 Jahren nach der von Adolf Werth veröffentlichten Festschrift zur Jahrhundert-Feier 1908 wieder eine Geschichte Barmens vorliegt. Der Verfasser, durch zahlreiche Beiträge zu den verschiedensten Aspekten der Wuppertaler Geschichte ausgewiesen, holt weit aus, beginnt mit der Vorgeschichte Barmens vor 400 Millionen Jahren und berücksichtigt selbst die erst 2003 entdeckte Abfallgrube im Deweerthschen Garten in Elberfeld, deren Scherben eine Datierung der Ansiedlung in die Zeit des 6. bis 4. Jahrhunderts v. Ch. erlauben. Hier und in der Darstellung der Zeit bis zur Ersterwähnung Barmens 1070 und darüber hinaus bis zur endgültigen Zugehörigkeit zu Berg im 13. Jahrhundert haben viele Aussagen aus naheliegenden Gründen hypothetischen Charakter. Häufig basieren sie auf Analogieschlüssen oder auf den nicht immer unbestrittenen Aussagen der Ortsnamensforschung. Wichtige gesicherte Einzelergebnisse sind in den letzten Jahren den Untersuchungen von Gerd Helbeck zu verdanken. Die Quellenlage wird mit dem 14. Jahrhundert merklich besser. Mit der Verleihung des Garnnahrungsprivilegs von 1527 setzt auch in Barmen der wirtschaftliche Aufstieg ein, unterbrochen von Konfessionsstreit und Kriegsgräuel. Die Darstellung der allgemeine Entwicklung ist gut recherchiert und anschaulich geschildert. Es ist sicherlich eine kluge Entscheidung des Verfassers gewesen, immer 148
17 wieder Abschnitte mit plakativen Überschriften zu speziellen Themen (z.b. Türkischrot, Gründung der verschiedenen Kirchengemeinden) einzuschieben. In der Franzosenzeit erlangte Barmen 1808 Stadtstatus. Die Entwicklung zu einer der reichsten und wichtigsten Fabrikstädten Europas - so die Auffassung des Lokalpatrioten H. J. de Bruyn-Ouboter - vollzog sich nach und nach. Im Jahr 1883 wurde mit Einwohnern die Grenze zur Großstadt überschritten. Verbesserungen der Infrastruktur ( Wasserleitung), Theater, bürgerliche Organisierung (Verschönerungsverein) und Schulwesen sind Stichworte, die in diesem Zusammenhang, vielfach in ausführlichen Bildunterschriften, Erwähnung finden. Die goldenen Jahre Barmens mit Ruhmeshalle, Kaiserbesuch, Bergbahn, Schwebebahn und Hundertjahrfeier reichen von 1883 bis Es gibt gute Gründe dafür, dass mehr als ein Drittel des Bandes den Barmer Katastrophenjahren ( ) und der Metamorphose der Stadt nach 1945 gewidmet ist. Hier ist es richtig und notwendig gewesen, nicht mehr zwischen der Geschichte des Stadtteils Barmen und der der 1929 gebildeten Gesamtstadt Wuppertal zu unterscheiden. Das gilt für den nationalsozialistischen Alltag, die Vertreibung und Ermordung der jüdischen Mitbürger, den Widerstand (auch wenn der Barmer Bekenntnissynode eine weit über die Stadt Wuppertal hinausgehende Bedeutung zukommt) und die alliierten Luftangriffe am 29./30. Mai auf Barmen und 24./25. Juni 1943 auf Elberfeld mit ihren katastrophalen Folgen. Nicht nur im Abschnitt über den Wiederaufbau stellt der Verfasser seine Fachkompetenz auf den Gebieten des Siedlungsbaus, der Stadtplanung und des Denkmalschutzes unter Beweis. Den Abschluss bildet eine Wuppertaler Bilderbogen, für den Herbert Günther, der in den letzten Jahren zahlreiche Bildbände zur Wuppertaler Geschichte vorgelegt hat, die Fotos liefert. Auch in den vorangehenden Abschnitten stammen die aktuellen Fotos zum größten Teil von ihm. Das Personenregister erlaubt das gezielte Suchen nach den Frauen und Männern, die im Laufe der Geschichte Barmens besonders hervorgetreten sind. Das tief gegliederte Inhaltsverzeichnis ersetzt das Sachregister. In den Anmerkungen des fortlaufenden Textes finden sich Hinweise auf weiterführende Literatur. Ich gestehe, zu der offenbar aussterbenden Spezies Mensch zu gehören, für die auch im Zeitalter der Internetrecherche ein umfassendes Literaturverzeichnis immer noch wichtig, weil hilfreich ist. H. J. de Bryun-Ouboters Barmer Geschichte ist Lese- und Bilderbuch zugleich. In einigen Passagen hätte ich mir mehr Text und weniger Bilder gewünscht, auch wenn es sich zum Teil um bisher weitgehend unbekannte Fotos handelt. Allein die Stilllegung bzw. die letzte Fahrt der Bergbahn 1959, unter dem Aspekt von Jahren Stadtgeschichte nicht unbedingt das wichtigste Ereignis, ist mit sechs Fotos dokumentiert. Gemessen an der Zahl der Abbildungen hat sich das kulturelle Leben des Stadtteils Barmen nach 1945 offenbar nur im Opernhaus und in der Galerie Palette abgespielt. Es ist fraglos richtig, dass es vor den alliierten Luftangriffen auf Barmen und Elberfeld in der Geschichte Wuppertals nie einen derart abrupten Bruch in der Kontinuität, eine derart fundamentale Katastrophe gegeben hat (S. 193). Dies rechtfertigt ohne Frage auch die ausführliche Dokumentation, einschließlich der Zeitzeugenberichte, dieses unfassbar schrecklichen Ereignisses. Unter anderem erfährt der Leser, dass die sechskantigen Stabbrandbomben bei 54 cm Länge etwas 4,5 cm Durchmesser und 1,7 kg Gewicht hatten und weshalb die gelben Leuchtbomben am geographischen Punkt Nord, Ost als Markierung abgeworfen wurden. Es fehlt mir allerdings der Satz, der erklärt, weshalb die britischen Bomber ihre Angriffe auf deutsche Städte überhaupt erst geflogen haben. 149
18 Diese Bemerkungen schmälern nicht das Verdienst des Autors, eine gründlich recherchierte, gut lesbare Darstellung der Geschichte Barmens vorgelegt zu haben, die dank ihrer opulenten Bebilderung auch, aber nicht nur jüngere Leser ansprechen und so für die wechselvolle und immer spannende Geschichte der bis 1929 selbständigen Stadt interessieren wird ein im besten Sinne des Wortes Hausbuch für alle Barmer und sonstigen Wuppertaler. Uwe Eckardt Armin Fuhrer/Heinz Schön: Erich Koch. Hitlers brauner Zar. Gauleiter von Ostpreußen und Reichskommissar der Ukraine, München: Olzog Verlag, 2010, 248 S.13 Abb., 24,90, ISBN: Erich Koch ( ), einer der führenden Nationalsozialisten, zunächst Gauleiter, seit 1933 Oberpräsident von Ostpreußen, der während des Zweiten Weltkriegs nach dem Überfall auf die Sowjetunion als Reichskommissar maßgeblich an der Unterdrückung der ukrainischen Bevölkerung sowie der Verfolgung und Ermordung der dortigen Juden beteiligt war, stammte aus Elberfeld. Die beiden Autoren schildern nah an den Quellen und unter Auswertung der Spezialliteratur den Aufstieg vom Reichsbahnbeamten zum König von Ostpreußen und Hitlers Zaren in der Ukraine, der mit großer Brutalität und Skrupellosigkeit seine Ziele verfolgte. Vor der endgültigen Eroberung Ostpreußens durch die Sowjetarmee floh Erich Koch in den Westen und versteckte sich mit gefälschten Papieren auf einem Bauernhof in Schleswig-Holstein. Dort wurde er erst 1949 von britischen Sicherheitsbeamten entdeckt und 1950 an Polen ausgeliefert. Das Warschauer Wojewodschaftsgericht (Landgericht) verurteilte ihn wegen Massenmordes zum Tode. Das Todesurteil wurde in eine lebenslängliche Haftstrafe umgewandelt. Erich Koch, der offenbar bis zuletzt von der nationalsozialistischen Ideologie überzeugt war, starb, von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, im Alter von 90 Jahren in der polnischen Haftanstalt Barczewo. Es hat immer wieder Spekulationen darüber gegeben, weshalb das Todesurteil nicht vollstreckt worden ist. Hierbei spielt der ungeklärte Verbleib des Bernsteinzimmers, das in den letzten Jahren bisher vergeblich auch in Wuppertal gesucht worden ist, eine Rolle. Möglicherweise hat man gehofft, doch noch Aufzeichnungen oder Tagebücher des ehemaligen Reichskommissars zu finden. Auch der Einsatz verschiedener Vertreter der evangelischen Kirche für den Gefangenen wirft viele Fragen auf. Die Autoren gehen diesen und anderen Fragen anhand der vorhandenen Quellen nach, ohne sich jedoch an unbegründbaren Spekulationen zu beteiligen. Nicht nur diese Zurückhaltung macht diese Biographie lesenswert, die zeigt, unter welchen Bedingungen Karrieren in der NS-Zeit möglich gewesen sind. U. E. Engels, Sylvia; Eberlein, Hermann-Peter (Hg.): Die tausendjährige Geschichte der Alten reformierten Kirche. Prisma der Stadt- und Kirchengeschichte Elberfelds. Kamen In einer eintägigen Vortragsreihe, die 2007 zur Geschichte der alten Laurentius- und späteren reformierten Gemeinde in Elberfeld stattfand, haben Historiker und Theologen die chronologisch große Spannweite von 1000 Jahren in der Alten reformierten Kirche, der heutigen CityKirche vorgetragen. Dass dabei nicht ein voluminöses Werk entstanden ist, liegt nicht nur an dem Vorhaben, die gehaltenen Vorträge abzudrucken, sondern auch für einige Bereiche an der begrenzten Quellenlage. Vor allem für die erste Phase, das Mittelalter, in dem die Geschichte des Ortes Elberfeld nahezu identisch mit der Kirchengeschichte ist, kann nur auf eine geringe Überlieferung zurückgegriffen werden. Der langjährige 150
19 Stadtarchivar, Uwe Eckardt, rekonstruiert die Abhängigkeiten und Verpfändungen des Erzbischofs von Köln bis zur endgültigen Übernahme durch den Grafen von Berg im Jahre 1430 sowie die lange Tradition des namensgebenden Schutzpatrons St. Laurentius der ersten Kirche, die im Wuppertaler Wappen als Rost fortbesteht. Die für Elberfeld prägende Epoche der Reformation, die die Laurentiuskirche zu einer reformierten Gemeinde werden ließ, wird von Hermann-Peter Eberlein beschrieben. Gleichzeitig stellt er das lang gehegte Diktum, Peter Lo habe den Heidelberger Katechismus in Elberfeld eingeführt, in Frage. Das 19. Jahrhundert als das Vereinsjahrhundert beschreibt Klaus Goebel, wobei sowohl bekannte Persönlichkeiten als auch das Spektrum der religiösen Vielfalt angesprochen werden. Eine Grundlage des christlichen Ethos war die Sorge um die Armen der Gemeinde. Dass die Kirchen im 19. Jahrhundert mit dem wachsenden Problem des Pauperismus schließlich an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stießen, ist ein immer wieder diskutiertes Problem. Mit den unterschiedlichen christlichen und bürgerlichen Lösungsversuchen im Laufe der Jahrhunderte setzt sich Volkmar Wittmütz auseinander. Mit mehreren zufällig anmutenden Kurzviten beschreibt Hans Helmich reformierte Theologen im 20. Jahrhundert. Ein kurzer Abriss zur Entwicklung der Gemeinde im 20. Jahrhundert von Eberlein schließt die chronologische Darstellung. Mit dem Streifzug durch die Jahrhunderte vermittelt dieses Heft komprimiert und lesenswert 1000 Jahre Geschichte. Doch so unterschiedlich wie die Zeitabschnitte differieren auch die Aufsätze. Bis auf einen, der mit Anmerkungen und Fußnoten versehen wurde, ist allen anderen der Vortragscharakter geblieben. Die matt-graue Qualität der Abbildungen ist allerdings enttäuschend, auch wenn es sich weitgehend um bekannte Bilder handelt. Sigrid Lekebusch Brausenwerth mit Kaiser-Wilhelm-Denkmal und Stadttheater, ca Foto: Privatbesitz. 151
Verzeichnis der Tabellen, Diagramme und Schaubilder. Abkürzungsverzeichnis. Vorbemerkungen 1. Prolog 3
 Inhaltsverzeichnis Verzeichnis der Tabellen, Diagramme und Schaubilder Abkürzungsverzeichnis XII XIV Vorbemerkungen 1 Prolog 3 A. Forschungsstand - Universitäten im Dritten Reich 3 B. Forschungsstand -
Inhaltsverzeichnis Verzeichnis der Tabellen, Diagramme und Schaubilder Abkürzungsverzeichnis XII XIV Vorbemerkungen 1 Prolog 3 A. Forschungsstand - Universitäten im Dritten Reich 3 B. Forschungsstand -
Verleihung der 4. Martin Warnke-Medaille an Prof. Dr. Michael Hagner 23. April 2014, 19:30, Warburg-Haus
 Seite 1 von 7 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wissenschaft und Forschung DIE SENATORIN Verleihung der 4. Martin Warnke-Medaille an Prof. Dr. Michael Hagner 23. April 2014, 19:30, Warburg-Haus
Seite 1 von 7 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wissenschaft und Forschung DIE SENATORIN Verleihung der 4. Martin Warnke-Medaille an Prof. Dr. Michael Hagner 23. April 2014, 19:30, Warburg-Haus
Satzung des Historischen Vereins Rosenheim e. V.
 Satzung des Historischen Vereins Rosenheim e. V. 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr Der Verein führt den Namen Historischer Verein Rosenheim e. V.. Er hat seinen Sitz in Rosenheim und ist in das Vereinsregister
Satzung des Historischen Vereins Rosenheim e. V. 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr Der Verein führt den Namen Historischer Verein Rosenheim e. V.. Er hat seinen Sitz in Rosenheim und ist in das Vereinsregister
150 Jahre CAHN - die Firmengeschichte von
 150 Jahre CAHN - die Firmengeschichte von 1863-2013 Vier Generationen von Numismatikern, Kunsthistorikern und Archäologen haben dazu beigetragen, «Cahn» zu einem der führenden Namen im Kunsthandel zu machen.
150 Jahre CAHN - die Firmengeschichte von 1863-2013 Vier Generationen von Numismatikern, Kunsthistorikern und Archäologen haben dazu beigetragen, «Cahn» zu einem der führenden Namen im Kunsthandel zu machen.
Name, Sitz und Zweck, Gemeinnützigkeit
 Name, Sitz und Zweck, Gemeinnützigkeit 1 Der "Verein" ist 1873 gegründet worden. Er hat Rechtspersönlichkeit kraft staatlicher Verleihung (Ministerial-Bekanntmachung vom 7.1.1892, Regierungsblatt vom 13.1.1892,
Name, Sitz und Zweck, Gemeinnützigkeit 1 Der "Verein" ist 1873 gegründet worden. Er hat Rechtspersönlichkeit kraft staatlicher Verleihung (Ministerial-Bekanntmachung vom 7.1.1892, Regierungsblatt vom 13.1.1892,
Satzung des Vereins Technikmuseum Kassel
 Satzung des Vereins Technikmuseum Kassel 02.09.2005 1 Name und Sitz (1) Der Verein führt den Namen Technikmuseum Kassel mit dem Zusatz e.v. nach Eintragung in das Vereinsregister. (2) Der Verein hat seinen
Satzung des Vereins Technikmuseum Kassel 02.09.2005 1 Name und Sitz (1) Der Verein führt den Namen Technikmuseum Kassel mit dem Zusatz e.v. nach Eintragung in das Vereinsregister. (2) Der Verein hat seinen
2. Reformation und Macht, Thron und Altar. Widerständigkeit und Selbstbehauptung
 1517 2017 Reformationsjubiläum in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 2. Reformation und Macht, Thron und Altar Widerständigkeit und Selbstbehauptung Widerständigkeit und
1517 2017 Reformationsjubiläum in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 2. Reformation und Macht, Thron und Altar Widerständigkeit und Selbstbehauptung Widerständigkeit und
Die Erforschung jüdischer Geschichte in Brandenburg
 Die Erforschung jüdischer Geschichte in Brandenburg 1 Bernhard Ludwig Bekmann (Hg.): Historische Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg Erster Teil, Berlin 1751 2 Balthasar König: Annalen der Juden
Die Erforschung jüdischer Geschichte in Brandenburg 1 Bernhard Ludwig Bekmann (Hg.): Historische Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg Erster Teil, Berlin 1751 2 Balthasar König: Annalen der Juden
Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Schleswig-Holstein
 ACK-Richtlinien SH ACKSHRL 1.304-503 Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Schleswig-Holstein Stand 29. April 1999 1 1 Red. Anm.: Der Text der Neufassung wurde von der Kirchenleitung
ACK-Richtlinien SH ACKSHRL 1.304-503 Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Schleswig-Holstein Stand 29. April 1999 1 1 Red. Anm.: Der Text der Neufassung wurde von der Kirchenleitung
Satzung der Fördergemeinschaft Rotary Darmstadt e.v.
 Satzung der Fördergemeinschaft Rotary Darmstadt e.v. 1 Name, Sitz (1) Der Verein führt den Namen Fördergemeinschaft Rotary Darmstadt e.v. (2) Sitz des Vereins ist Darmstadt. Er ist im Vereinsregister des
Satzung der Fördergemeinschaft Rotary Darmstadt e.v. 1 Name, Sitz (1) Der Verein führt den Namen Fördergemeinschaft Rotary Darmstadt e.v. (2) Sitz des Vereins ist Darmstadt. Er ist im Vereinsregister des
S a t z u n g. Evangelisch-lutherisches Predigerministerium Vereinigung zur Pflege der Frankfurter Kirchengeschichte. Präambel
 S a t z u n g Evangelisch-lutherisches Predigerministerium Vereinigung zur Pflege der Frankfurter Kirchengeschichte Präambel Seit der Reformationszeit trug die Gesamtheit der lutherischen Pfarrer in Frankfurt
S a t z u n g Evangelisch-lutherisches Predigerministerium Vereinigung zur Pflege der Frankfurter Kirchengeschichte Präambel Seit der Reformationszeit trug die Gesamtheit der lutherischen Pfarrer in Frankfurt
Behinderten-Politisches Maßnahmen-Paket für Brandenburg
 Behinderten-Politisches Maßnahmen-Paket für Brandenburg Das macht Brandenburg für die Rechte von Kindern und Erwachsenen mit Behinderungen Zusammen-Fassung in Leichter Sprache. 2 Achtung Im Text gibt es
Behinderten-Politisches Maßnahmen-Paket für Brandenburg Das macht Brandenburg für die Rechte von Kindern und Erwachsenen mit Behinderungen Zusammen-Fassung in Leichter Sprache. 2 Achtung Im Text gibt es
S A T Z U N G. 1 Name und Sitz. (1) Der am gegründete Verein trägt den Namen Förderkreis der Evangelischen Stiftung Alsterdorf.
 S A T Z U N G 1 Name und Sitz (1) Der am 22.10.1975 gegründete Verein trägt den Namen Förderkreis der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. (2) Der Verein wurde am 17.12.1975 unter der Nr. 69 VR 8385 in das
S A T Z U N G 1 Name und Sitz (1) Der am 22.10.1975 gegründete Verein trägt den Namen Förderkreis der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. (2) Der Verein wurde am 17.12.1975 unter der Nr. 69 VR 8385 in das
Analyse der Tagebücher der Anne Frank
 Germanistik Amely Braunger Analyse der Tagebücher der Anne Frank Unter Einbeziehung der Theorie 'Autobiografie als literarischer Akt' von Elisabeth W. Bruss Studienarbeit 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 1. EINLEITUNG
Germanistik Amely Braunger Analyse der Tagebücher der Anne Frank Unter Einbeziehung der Theorie 'Autobiografie als literarischer Akt' von Elisabeth W. Bruss Studienarbeit 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 1. EINLEITUNG
Erziehung - Kunst des Möglichen
 Wolfgang Brezinka Erziehung - Kunst des Möglichen Beiträge zur Praktischen Pädagogik 3., verbesserte und erweiterte Auflage Ernst Reinhardt Verlag München Basel WOLFGANG BREZINKA, geb. 9. 6. 1928 in Berlin.
Wolfgang Brezinka Erziehung - Kunst des Möglichen Beiträge zur Praktischen Pädagogik 3., verbesserte und erweiterte Auflage Ernst Reinhardt Verlag München Basel WOLFGANG BREZINKA, geb. 9. 6. 1928 in Berlin.
Worte von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer. anlässlich des Empfanges der. Theodor-Körner-Preisträger. am Montag, dem 24.
 - 1 - Worte von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer anlässlich des Empfanges der Theodor-Körner-Preisträger am Montag, dem 24. April 2006 Meine Damen und Herren! Tradition ist Schlamperei, meinte einst Gustav
- 1 - Worte von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer anlässlich des Empfanges der Theodor-Körner-Preisträger am Montag, dem 24. April 2006 Meine Damen und Herren! Tradition ist Schlamperei, meinte einst Gustav
PD Dr. Frank Almai Epochenschwellen im Vergleich: 1550, 1720, 1800, 1900
 Institut für Germanistik Professur für Neuere deutsche Literatur und Kulturgeschichte : 1550, 1720, 1800, 1900 9. Vorlesung: Block III: 1800: Klassik und Romantik III Gliederung 2.2 Romantik und Wissenschaft
Institut für Germanistik Professur für Neuere deutsche Literatur und Kulturgeschichte : 1550, 1720, 1800, 1900 9. Vorlesung: Block III: 1800: Klassik und Romantik III Gliederung 2.2 Romantik und Wissenschaft
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek
 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Karl Kirchenhistoriker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Karl Kirchenhistoriker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Thomas-Akademie Jüdische und christliche Leseweisen der Bibel im Dialog Kurt Kardinal Koch EINLADUNG
 Theologische Fakultät EINLADUNG Thomas-Akademie 2016 Jüdische und christliche Leseweisen der Bibel im Dialog Kurt Kardinal Koch MITTWOCH, 16. MÄRZ 2016, 18.15 UHR UNIVERSITÄT LUZERN, FROHBURGSTRASSE 3,
Theologische Fakultät EINLADUNG Thomas-Akademie 2016 Jüdische und christliche Leseweisen der Bibel im Dialog Kurt Kardinal Koch MITTWOCH, 16. MÄRZ 2016, 18.15 UHR UNIVERSITÄT LUZERN, FROHBURGSTRASSE 3,
Satzung. des Vereins der Förderer und Freunde des Gymnasiums Dresden-Cotta e.v. (Förderverein Gymnasium Dresden-Cotta)
 Satzung des Vereins der Förderer und Freunde des Gymnasiums Dresden-Cotta e.v. (Förderverein Gymnasium Dresden-Cotta) 1 Name und Sitz des Vereins Der Verein führt den Namen Verein der Förderer und Freunde
Satzung des Vereins der Förderer und Freunde des Gymnasiums Dresden-Cotta e.v. (Förderverein Gymnasium Dresden-Cotta) 1 Name und Sitz des Vereins Der Verein führt den Namen Verein der Förderer und Freunde
Satzung des Vereins Steffenshammer e. V. Förderverein für historische Schmiedetechnik
 Satzung des Vereins Steffenshammer e. V. Förderverein für historische Schmiedetechnik Name, Rechtsform und Sitz des Vereins 1 1. Der Verein führt den Namen: 2. Steffenshammer e. V. Förderverein für historische
Satzung des Vereins Steffenshammer e. V. Förderverein für historische Schmiedetechnik Name, Rechtsform und Sitz des Vereins 1 1. Der Verein führt den Namen: 2. Steffenshammer e. V. Förderverein für historische
SOZIALDEMOKRATISCHER BILDUNGSVEREIN MANNHEIM/LUDWIGSHAFEN e. V.
 VEREINSSATZUNG 1 Name Der Verein trägt den Namen SOZIALDEMOKRATISCHER BILDUNGSVEREIN Er ist ein eingetragener Verein und hat seinen Sitz in Mannheim. 2 Zweck des Vereines 1. Zweck des Vereines ist es,
VEREINSSATZUNG 1 Name Der Verein trägt den Namen SOZIALDEMOKRATISCHER BILDUNGSVEREIN Er ist ein eingetragener Verein und hat seinen Sitz in Mannheim. 2 Zweck des Vereines 1. Zweck des Vereines ist es,
Quelleninterpretation - Bericht eines Beteiligten über den Sturm auf die Bastille
 Geschichte Jacek Izdebski Quelleninterpretation - Bericht eines Beteiligten über den Sturm auf die Bastille In: Paschold Chris E., Gier Albert (Hrsg.): Die Französische Revolution. Ein Lesebuch mit zeitgenössischen
Geschichte Jacek Izdebski Quelleninterpretation - Bericht eines Beteiligten über den Sturm auf die Bastille In: Paschold Chris E., Gier Albert (Hrsg.): Die Französische Revolution. Ein Lesebuch mit zeitgenössischen
zu erhellen, sollen die folgenden Thesen in des ehrwürdigen Pater Martin Luther, Magister dort auch ordentlicher Professor der Theologie.
 Aus Liebe zur Wahrheit und im Verlangen, sie zu erhellen, sollen die folgenden Thesen in Wittenberg disputiert werden unter dem Vorsitz des ehrwürdigen Pater Martin Luther, Magister der freien Künste und
Aus Liebe zur Wahrheit und im Verlangen, sie zu erhellen, sollen die folgenden Thesen in Wittenberg disputiert werden unter dem Vorsitz des ehrwürdigen Pater Martin Luther, Magister der freien Künste und
Sehr geehrte Damen und Herren,
 Sehr geehrte Damen und Herren, ehe Sie sich dem Reisebericht zuwenden, möchte ich mich bei allen bedanken, die zum Erfolg dieses Ausfluges beigetragen haben. Allen voran natürlich bei Herrn Volker Siepmann,
Sehr geehrte Damen und Herren, ehe Sie sich dem Reisebericht zuwenden, möchte ich mich bei allen bedanken, die zum Erfolg dieses Ausfluges beigetragen haben. Allen voran natürlich bei Herrn Volker Siepmann,
Satzung des Vereins Internationale Schule Dresden (Dresden International School) Fassung vom
 Satzung des Vereins Internationale Schule Dresden (Dresden International School) Fassung vom 28.04.2016 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr (1) Der Verein führt den Namen Internationale Schule Dresden e.v. (Dresden
Satzung des Vereins Internationale Schule Dresden (Dresden International School) Fassung vom 28.04.2016 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr (1) Der Verein führt den Namen Internationale Schule Dresden e.v. (Dresden
65. Geburtstag der Vizepräsidentin der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, Frau Prof. Dr. Dorothee Wierling, , 19:00 Uhr, FZH
 Seite 1 von 6 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wissenschaft und Forschung DIE SENATORIN 65. Geburtstag der Vizepräsidentin der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, Frau Prof. Dr. Dorothee
Seite 1 von 6 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wissenschaft und Forschung DIE SENATORIN 65. Geburtstag der Vizepräsidentin der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, Frau Prof. Dr. Dorothee
PRAG EXKURSION. Universität Potsdam Institut für Religionswissenschaft Am Neuen Palais Potsdam
 Universität Potsdam Institut für Religionswissenschaft Am Neuen Palais 10 14469 Potsdam Vorlesung: Dozent: Jüdische Kunst überblicken Dr.phil. Michael M.Heinzmann MA Wi/Se 2012/13 Veranstaltung: Prag-Exkursion
Universität Potsdam Institut für Religionswissenschaft Am Neuen Palais 10 14469 Potsdam Vorlesung: Dozent: Jüdische Kunst überblicken Dr.phil. Michael M.Heinzmann MA Wi/Se 2012/13 Veranstaltung: Prag-Exkursion
6DW]XQJGHV ) UGHUYHUHLQVGHU.L7D.XQWHUEXQW +RKHU:HJ )ULHGULFKVGRUI
![6DW]XQJGHV ) UGHUYHUHLQVGHU.L7D.XQWHUEXQW +RKHU:HJ )ULHGULFKVGRUI 6DW]XQJGHV ) UGHUYHUHLQVGHU.L7D.XQWHUEXQW +RKHU:HJ )ULHGULFKVGRUI](/thumbs/39/18913701.jpg) 6DW]XQJGHV ) UGHUYHUHLQVGHU.L7D.XQWHUEXQW +RKHU:HJ )ULHGULFKVGRUI In nachfolgendem Dokument wird der Einfachheit halber nur die männliche Anrede verwendet selbstverständlich richtet sich die Satzung auch
6DW]XQJGHV ) UGHUYHUHLQVGHU.L7D.XQWHUEXQW +RKHU:HJ )ULHGULFKVGRUI In nachfolgendem Dokument wird der Einfachheit halber nur die männliche Anrede verwendet selbstverständlich richtet sich die Satzung auch
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek
 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Wilhelm von Kunsthistoriker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Wilhelm von Kunsthistoriker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
NACHBEMERKUNGEN: Die Fluchtroute von Wally Reinhardt stellt sich auf einer Karte des ehemaligen Deutschen Reiches wie folgt dar:
 NACHBEMERKUNGEN: Die Fluchtroute von Wally Reinhardt stellt sich auf einer Karte des ehemaligen Deutschen Reiches wie folgt dar: 1 Heiligenbeil 2 Pillau 3 Swinemünde 4 Rostock 5 Lauenbrück 6 Hamburg 7
NACHBEMERKUNGEN: Die Fluchtroute von Wally Reinhardt stellt sich auf einer Karte des ehemaligen Deutschen Reiches wie folgt dar: 1 Heiligenbeil 2 Pillau 3 Swinemünde 4 Rostock 5 Lauenbrück 6 Hamburg 7
2017 weiter-sehen Initiativen zum Reformationsgedächtnis 2017 in der Erzdiözese München und Freising DR. F. SCHUPPE 1
 2017 weiter-sehen Initiativen zum Reformationsgedächtnis 2017 in der Erzdiözese München und Freising DR. F. SCHUPPE 1 Es stimmt hoffnungsvoll, dass mit dem 500. Jahrestag der Reformation erstmals ein Reformationsgedenken
2017 weiter-sehen Initiativen zum Reformationsgedächtnis 2017 in der Erzdiözese München und Freising DR. F. SCHUPPE 1 Es stimmt hoffnungsvoll, dass mit dem 500. Jahrestag der Reformation erstmals ein Reformationsgedenken
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek
 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Wilhelm Kunsthistoriker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Wilhelm Kunsthistoriker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Tennisclub Sinzheim e.v.
 Tennisclub Sinzheim e.v. Satzung vom 14. März 1975 in der Fassung vom 22. November 2002 - I - I N H A L T S V E R Z E I C H N I S =========================== Seite 1 Name und Sitz 1 2 Zweck 1 3 Geschäftsjahr
Tennisclub Sinzheim e.v. Satzung vom 14. März 1975 in der Fassung vom 22. November 2002 - I - I N H A L T S V E R Z E I C H N I S =========================== Seite 1 Name und Sitz 1 2 Zweck 1 3 Geschäftsjahr
Weihbischof Wilhelm Zimmermann. Ansprache im Gottesdienst der Antiochenisch-Orthodoxen Gemeinde Hl. Josef von Damaskus
 Weihbischof Wilhelm Zimmermann Ansprache im Gottesdienst der Antiochenisch-Orthodoxen Gemeinde Hl. Josef von Damaskus in der Kirche St. Ludgerus, Essen-Rüttenscheid Sonntag, 19. Juni 2016 Sehr geehrter,
Weihbischof Wilhelm Zimmermann Ansprache im Gottesdienst der Antiochenisch-Orthodoxen Gemeinde Hl. Josef von Damaskus in der Kirche St. Ludgerus, Essen-Rüttenscheid Sonntag, 19. Juni 2016 Sehr geehrter,
INHALT. Hans-Gert Roloff Manfred Lemmer zum Gedenken...11
 INHALT Geleitwort... 7 Hans-Gert Roloff Manfred Lemmer zum Gedenken...11 Irene Roch-Lemmer Zur Übergabe des Silberbechers an die Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle am 27. November 2009... 31 Irene
INHALT Geleitwort... 7 Hans-Gert Roloff Manfred Lemmer zum Gedenken...11 Irene Roch-Lemmer Zur Übergabe des Silberbechers an die Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle am 27. November 2009... 31 Irene
Satzung LUDWIG - ERHARD - STIFTUNG BONN
 Satzung LUDWIG - ERHARD - STIFTUNG BONN 1 Name, Rechtsform und Sitz Der Verein führt den Namen Ludwig-Erhard-Stiftung e.v. Er hat die Rechtsform eines eingetragenen Vereins und ist in das Vereinsregister
Satzung LUDWIG - ERHARD - STIFTUNG BONN 1 Name, Rechtsform und Sitz Der Verein führt den Namen Ludwig-Erhard-Stiftung e.v. Er hat die Rechtsform eines eingetragenen Vereins und ist in das Vereinsregister
Gedenkworte zur Pogromnacht 9. November 2016, Uhr, Plenarsaal des Rathauses Es gilt das gesprochene Wort
 Gedenkworte zur Pogromnacht 9. November 2016, 11.00 Uhr, Plenarsaal des Rathauses Es gilt das gesprochene Wort Herr Oberbürgermeister, Herr Minister, lieber Herr Dr. Horowitz, verehrter Herr Professor
Gedenkworte zur Pogromnacht 9. November 2016, 11.00 Uhr, Plenarsaal des Rathauses Es gilt das gesprochene Wort Herr Oberbürgermeister, Herr Minister, lieber Herr Dr. Horowitz, verehrter Herr Professor
Paderborn. Stadtrundgang
 Stadtrundgang Ein erstes Kennenlernen Paderborn hält eine Fülle von Sehenswertem für Sie bereit: Vom mittelalterlichen Turm der Stadtmauer vorbei an liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern, bedeutenden
Stadtrundgang Ein erstes Kennenlernen Paderborn hält eine Fülle von Sehenswertem für Sie bereit: Vom mittelalterlichen Turm der Stadtmauer vorbei an liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern, bedeutenden
Es erfüllt mich mit Stolz und mit Freude, Ihnen aus Anlass des
 Grußwort des Präsidenten des Sächsischen Landtags, Dr. Matthias Rößler, zum Festakt anlässlich des 10. Jahrestages der Weihe in der Neuen Synagoge Dresden am 13. November 2011 Sehr geehrte Frau Dr. Goldenbogen,
Grußwort des Präsidenten des Sächsischen Landtags, Dr. Matthias Rößler, zum Festakt anlässlich des 10. Jahrestages der Weihe in der Neuen Synagoge Dresden am 13. November 2011 Sehr geehrte Frau Dr. Goldenbogen,
S A T Z U N G (Beschlossen in der Mitgliederversammlung am 30.11.2012 in Düsseldorf)
 Forschungsinstitut des Bundesverbandes Deutscher Volks- und Betriebswirte e.v. (Forschungsinstitut des bdvb) S A T Z U N G (Beschlossen in der Mitgliederversammlung am 30.11.2012 in Düsseldorf) 1 Name,
Forschungsinstitut des Bundesverbandes Deutscher Volks- und Betriebswirte e.v. (Forschungsinstitut des bdvb) S A T Z U N G (Beschlossen in der Mitgliederversammlung am 30.11.2012 in Düsseldorf) 1 Name,
Satzung Freundeskreis der Kolping Stiftung Litauen
 Satzung Freundeskreis der Kolping Stiftung Litauen 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr Der Verein führt den Namen Freundeskreis der Kolping Stiftung Litauen. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden.
Satzung Freundeskreis der Kolping Stiftung Litauen 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr Der Verein führt den Namen Freundeskreis der Kolping Stiftung Litauen. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden.
Protokoll der Mitgliederversammlung des Förder- und Freundeskreises der Friedrich-List-Schule
 Protokoll der Mitgliederversammlung des Förder- und Freundeskreises der Friedrich-List-Schule Datum: Dauer: 18.06.2015 in der FLS, Raum U8 18:10 bis 19:30 Uhr, anschließend Begehung des grünen Klassenzimmers
Protokoll der Mitgliederversammlung des Förder- und Freundeskreises der Friedrich-List-Schule Datum: Dauer: 18.06.2015 in der FLS, Raum U8 18:10 bis 19:30 Uhr, anschließend Begehung des grünen Klassenzimmers
Letzte Bücher aus der DDR Premieren & Bestseller 1989/90
 I: 1989 Revolution im Leseland Wenige Monate vor ihrem politischen Ende durch den Mut vieler Bürgerinnen und Bürger in der Friedlichen Revolution 1989/90 präsentierte sich die DDR in der Bundesrepublik
I: 1989 Revolution im Leseland Wenige Monate vor ihrem politischen Ende durch den Mut vieler Bürgerinnen und Bürger in der Friedlichen Revolution 1989/90 präsentierte sich die DDR in der Bundesrepublik
Das kurze Leben von Anna Lehnkering
 Das kurze Leben von Anna Lehnkering Tafel 1 Anna als Kind Anna wurde 1915 geboren. Anna besuchte für 5 Jahre eine Sonder-Schule. Lesen, Schreiben und Rechnen findet Anna schwer. Anna ist lieb und fleißig.
Das kurze Leben von Anna Lehnkering Tafel 1 Anna als Kind Anna wurde 1915 geboren. Anna besuchte für 5 Jahre eine Sonder-Schule. Lesen, Schreiben und Rechnen findet Anna schwer. Anna ist lieb und fleißig.
vitamin de DaF Arbeitsblatt - zum Geschichte
 1. Die folgenden Fotos spiegeln einen Teil der deutschen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg wider. a) Schauen Sie sich die beiden Fotos an. Tauschen Sie sich zu folgenden Fragen aus: - Was ist auf den
1. Die folgenden Fotos spiegeln einen Teil der deutschen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg wider. a) Schauen Sie sich die beiden Fotos an. Tauschen Sie sich zu folgenden Fragen aus: - Was ist auf den
Junge Theologen im >Dritten Reich<
 Wolfgang Scherffig Junge Theologen im >Dritten Reich< Dokumente, Briefe, Erfahrungen Band 1 Es begann mit einem Nein! 1933-1935 Mit einem Geleitwort von Helmut GoUwitzer Neukirchener Inhalt Helmut GoUwitzer,
Wolfgang Scherffig Junge Theologen im >Dritten Reich< Dokumente, Briefe, Erfahrungen Band 1 Es begann mit einem Nein! 1933-1935 Mit einem Geleitwort von Helmut GoUwitzer Neukirchener Inhalt Helmut GoUwitzer,
Leseprobe Verlag Ludwig Freytag, Harms, Schilling Gesprächskultur des Barock
 Freytag, Harms, Schilling Gesprächskultur des Barock Hartmut Freytag, Wolfgang Harms, Michael Schilling GESPRÄCHSKULTUR DES BAROCK Die Embleme der Bunten Kammer im Herrenhaus Ludwigsburg bei Eckernförde
Freytag, Harms, Schilling Gesprächskultur des Barock Hartmut Freytag, Wolfgang Harms, Michael Schilling GESPRÄCHSKULTUR DES BAROCK Die Embleme der Bunten Kammer im Herrenhaus Ludwigsburg bei Eckernförde
Satzung Schießklub Einigkeit" Tanneberg e.v.
 Satzung Schießklub Einigkeit" Tanneberg e.v. 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 1. Der Verein führt den Namen Schießklub Einigkeit Tanneberg e.v. und wurde in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Meißen unter
Satzung Schießklub Einigkeit" Tanneberg e.v. 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 1. Der Verein führt den Namen Schießklub Einigkeit Tanneberg e.v. und wurde in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Meißen unter
Satzung des Fördervereins Städtische KiTa Rhade e.v. Am Stuvenberg 40, Dorsten-Rhade
 Satzung des Fördervereins Städtische KiTa Rhade e.v. Am Stuvenberg 40, 46286 Dorsten-Rhade 1 Name und Sitz des Vereins 1. Der Verein führt den Namen Förderverein Städtische KiTa Rhade e.v.". 2. Er wurde
Satzung des Fördervereins Städtische KiTa Rhade e.v. Am Stuvenberg 40, 46286 Dorsten-Rhade 1 Name und Sitz des Vereins 1. Der Verein führt den Namen Förderverein Städtische KiTa Rhade e.v.". 2. Er wurde
Gütersloher Verlagshaus. Dem Leben vertrauen
 GÜTERSLOHER VERLAGSHAUS Gütersloher Verlagshaus. Dem Leben vertrauen Moritz Stetter, geboren 1983, ist freiberuflicher Trickfilmzeichner und Illustrator. Er hat an der Akademie für Kommunikation und an
GÜTERSLOHER VERLAGSHAUS Gütersloher Verlagshaus. Dem Leben vertrauen Moritz Stetter, geboren 1983, ist freiberuflicher Trickfilmzeichner und Illustrator. Er hat an der Akademie für Kommunikation und an
S A T Z U N G des Verbandes für Handel, Handwerk, Industrie und Freie Berufe Saarlouis e.v.
 S A T Z U N G des Verbandes für Handel, Handwerk, Industrie und Freie Berufe Saarlouis e.v. 1 Name und Sitz des Vereins Die Handel- und Gewerbetreibenden von Saarlouis schließen sich zu einem Verein zusammen.
S A T Z U N G des Verbandes für Handel, Handwerk, Industrie und Freie Berufe Saarlouis e.v. 1 Name und Sitz des Vereins Die Handel- und Gewerbetreibenden von Saarlouis schließen sich zu einem Verein zusammen.
Förderverein Dorfkirche Wegendorf e.v.
 Satzung des Fördervereins Dorfkirche Wegendorf e.v. 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 1. Der Verein führt den Namen "Förderverein Dorfkirche Wegendorf" und ist seit dem 29.06.2009 unter dem Aktenzeichen VR 5562
Satzung des Fördervereins Dorfkirche Wegendorf e.v. 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 1. Der Verein führt den Namen "Förderverein Dorfkirche Wegendorf" und ist seit dem 29.06.2009 unter dem Aktenzeichen VR 5562
Landeszentrale vor Ort: Lorenz S. Beckhardt liest aus seinem Buch. Der Jude mit dem Hakenkreuz Meine deutsche Familie.
 Landeszentrale vor Ort: Lorenz S. Beckhardt liest aus seinem Buch Der Jude mit dem Hakenkreuz Meine deutsche Familie www.politische-bildung.nrw.de demokratie leben Landeszentrale vor Ort: Es liest Zu den
Landeszentrale vor Ort: Lorenz S. Beckhardt liest aus seinem Buch Der Jude mit dem Hakenkreuz Meine deutsche Familie www.politische-bildung.nrw.de demokratie leben Landeszentrale vor Ort: Es liest Zu den
Begrüßungsworte des Herrn Bundespräsidenten anlässlich. 50.Jahre Österreichische Superiorenkonferenz. am 23. November 2009 im Spiegelsaal
 Begrüßungsworte des Herrn Bundespräsidenten anlässlich 50.Jahre Österreichische Superiorenkonferenz am 23. November 2009 im Spiegelsaal Exzellenz! Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Verehrte Ordensobere!
Begrüßungsworte des Herrn Bundespräsidenten anlässlich 50.Jahre Österreichische Superiorenkonferenz am 23. November 2009 im Spiegelsaal Exzellenz! Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Verehrte Ordensobere!
Konrad-Adenauer-Stiftung in Eichholz Villa Hammerschmidt
 Es sind nun 3 Monate vergangen, seitdem ich mit meinem Praktikum im Deutschen Bundestag begonnen habe. Die letzten vier Wochen wurden durch den Besuch der politischen Stiftungen geprägt. Der erste Besuch
Es sind nun 3 Monate vergangen, seitdem ich mit meinem Praktikum im Deutschen Bundestag begonnen habe. Die letzten vier Wochen wurden durch den Besuch der politischen Stiftungen geprägt. Der erste Besuch
Sächsische Landeszentrale für politische Bildung
 14 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung Die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung ist eine Einrichtung des Freistaates Sachsen, die politische Bildungsarbeit auf überparteilicher
14 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung Die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung ist eine Einrichtung des Freistaates Sachsen, die politische Bildungsarbeit auf überparteilicher
Begriff der Klassik. classicus = röm. Bürger höherer Steuerklasse. scriptor classicus = Schriftsteller 1. Ranges
 Klassik (1786-1805) Inhaltsverzeichnis Begriff der Klassik Zeitraum Geschichtlicher Hintergrund Idealvorstellungen Menschenbild Dichtung Bedeutende Vertreter Musik Baukunst Malerei Stadt Weimar Quellen
Klassik (1786-1805) Inhaltsverzeichnis Begriff der Klassik Zeitraum Geschichtlicher Hintergrund Idealvorstellungen Menschenbild Dichtung Bedeutende Vertreter Musik Baukunst Malerei Stadt Weimar Quellen
Satzung der Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung. der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
 Satzung der Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in der EKHN 332 Satzung der Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau Vom 14. Dezember 2006 (ABl.
Satzung der Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in der EKHN 332 Satzung der Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau Vom 14. Dezember 2006 (ABl.
Eugène Delacroix: Die Freiheit führt das Volk ( 1830 )
 1815-1850 Eugène Delacroix: Die Freiheit führt das Volk ( 1830 ) Die politischen Verhältnisse könnten mich rasend machen. Das arme Volk schleppt den Karren, worauf die Fürsten und Liberalen ihre Affenkomödie
1815-1850 Eugène Delacroix: Die Freiheit führt das Volk ( 1830 ) Die politischen Verhältnisse könnten mich rasend machen. Das arme Volk schleppt den Karren, worauf die Fürsten und Liberalen ihre Affenkomödie
Sonderpostwertzeichen 2018
 Jahresprogramme..06 Briefmarken und Sammlermünzen Sonderpostwertzeichen 08 Nummer 0 Das Sonderpostwertzeichenprogramm für 08 ist beschlossen. Bundesfinanzminister DR. Wolfgang Schäuble hat den rund 50
Jahresprogramme..06 Briefmarken und Sammlermünzen Sonderpostwertzeichen 08 Nummer 0 Das Sonderpostwertzeichenprogramm für 08 ist beschlossen. Bundesfinanzminister DR. Wolfgang Schäuble hat den rund 50
Schule im Kaiserreich
 Schule im Kaiserreich 1. Kapitel: Der Kaiser lebte hoch! Hoch! Hoch! Vor 100 Jahren regierte ein Kaiser in Deutschland. Das ist sehr lange her! Drehen wir die Zeit zurück! Das war, als die Mama, die Oma,
Schule im Kaiserreich 1. Kapitel: Der Kaiser lebte hoch! Hoch! Hoch! Vor 100 Jahren regierte ein Kaiser in Deutschland. Das ist sehr lange her! Drehen wir die Zeit zurück! Das war, als die Mama, die Oma,
Ausstellungen der Universitätsbibliothek
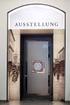 der Universitätsbibliothek 16.01.2001-23.02.2001 [113] Thomas Mann, Dr. Faustus : das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt von einem Freunde Professor Dr. Ruprecht Wimmer: Thomas Manns
der Universitätsbibliothek 16.01.2001-23.02.2001 [113] Thomas Mann, Dr. Faustus : das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt von einem Freunde Professor Dr. Ruprecht Wimmer: Thomas Manns
Satzung des Mukoviszidose Fördervereins Halle (Saale) e.v. vom
 Satzung des Mukoviszidose Fördervereins Halle (Saale) e.v. vom 06.10.2009 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr (1) Der Verein trägt den Namen Mukoviszidose Förderverein Halle (Saale) e.v. (2) Der Verein hat seinen
Satzung des Mukoviszidose Fördervereins Halle (Saale) e.v. vom 06.10.2009 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr (1) Der Verein trägt den Namen Mukoviszidose Förderverein Halle (Saale) e.v. (2) Der Verein hat seinen
Satzung. b) durch Wahrnehmung der sozialen Belange der Mitglieder, insbesondere der Mitglieder der Einsatzabteilung,
 Satzung 1 - Name und Sitz Der Verein führt den Namen: Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hamm/Sieg. Eine Eintragung ins Vereinsregister wird angestrebt. Nach erfolgter Eintragung erhält der Verein
Satzung 1 - Name und Sitz Der Verein führt den Namen: Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hamm/Sieg. Eine Eintragung ins Vereinsregister wird angestrebt. Nach erfolgter Eintragung erhält der Verein
Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz. Reclam Lektüreschlüssel
 Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz Reclam Lektüreschlüssel Lektüreschlüssel für Schüler Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz Von Helmut Bernsmeier Philipp Reclam jun. Stuttgart Alle Rechte vorbehalten
Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz Reclam Lektüreschlüssel Lektüreschlüssel für Schüler Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz Von Helmut Bernsmeier Philipp Reclam jun. Stuttgart Alle Rechte vorbehalten
E.T.A. Hoffmann-Jahrbuch
 E.T.A. Hoffmann-Jahrbuch Mitteilungen der E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft Herausgegeben von Hartmut Steinecke und Detlef Kremer Wissenschaftlicher Beirat: Gerhard Allroggen (Hamburg), Patrizio Collini (Florenz),
E.T.A. Hoffmann-Jahrbuch Mitteilungen der E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft Herausgegeben von Hartmut Steinecke und Detlef Kremer Wissenschaftlicher Beirat: Gerhard Allroggen (Hamburg), Patrizio Collini (Florenz),
Bewahrt die Hamburger Hauptkirchen!
 Bewahrt die Hamburger Hauptkirchen! Ob von der Alster oder vom Hafen aus, das Ensemble der fünf Hauptkirchen verleiht Hamburg aus jeder Perspektive einen unverwechselbaren Charakter. Ihre Türme prägen
Bewahrt die Hamburger Hauptkirchen! Ob von der Alster oder vom Hafen aus, das Ensemble der fünf Hauptkirchen verleiht Hamburg aus jeder Perspektive einen unverwechselbaren Charakter. Ihre Türme prägen
Kirche in der City von Darmstadt e.v. - Satzung -
 Kirche in der City von Darmstadt e.v. - Satzung / 1 Kirche in der City von Darmstadt e.v. - Satzung - 2 / Satzung - Kirche in der City von Darmstadt e.v. 1 Name, Sitz, Rechtsperson, Geschäftsjahr 1. Der
Kirche in der City von Darmstadt e.v. - Satzung / 1 Kirche in der City von Darmstadt e.v. - Satzung - 2 / Satzung - Kirche in der City von Darmstadt e.v. 1 Name, Sitz, Rechtsperson, Geschäftsjahr 1. Der
Die Donnerstagsfrauen kämpfen um ihr Schwimmbad
 Die Donnerstagsfrauen kämpfen um ihr Schwimmbad Frau Walter erzählt: Aufgezeichnet R. Trunzler Hedi Walter Jede Woche am Donnerstag trafen sich im Hallenbad in Siersdorf viele Frauen zum Schwimmen. An
Die Donnerstagsfrauen kämpfen um ihr Schwimmbad Frau Walter erzählt: Aufgezeichnet R. Trunzler Hedi Walter Jede Woche am Donnerstag trafen sich im Hallenbad in Siersdorf viele Frauen zum Schwimmen. An
c/o. Caritasverband Herten e.v. Hospitalstraße Herten Telefon: Fax: "Hermann-Schäfers-Stiftung" Satzung
 c/o. Caritasverband Herten e.v. Hospitalstraße 13 45699 Herten Telefon: 0 23 66-304 0 Fax: 0 23 66 304-400 "" Satzung Satzung 2 1 Name Rechtsform Sitz der Stiftung 1.) Die Stiftung führt den Namen "" 2.)
c/o. Caritasverband Herten e.v. Hospitalstraße 13 45699 Herten Telefon: 0 23 66-304 0 Fax: 0 23 66 304-400 "" Satzung Satzung 2 1 Name Rechtsform Sitz der Stiftung 1.) Die Stiftung führt den Namen "" 2.)
Zum 250. Band der Zeitschrift Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen
 Zum 250. Band der Zeitschrift Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen Die 1846 von Ludwig Herrig und Heinrich Viehoff ins Leben gerufene Zeit - schrift Archiv für das Studium der neueren
Zum 250. Band der Zeitschrift Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen Die 1846 von Ludwig Herrig und Heinrich Viehoff ins Leben gerufene Zeit - schrift Archiv für das Studium der neueren
Satzung des Vereins Förderkreis zur Erhaltung der Burgruine Loch e.v.
 Satzung des Vereins Förderkreis zur Erhaltung der Burgruine Loch e.v. (Stand:Januar 2011) 1 Name und Sitz des Vereins I. Der Verein führt den Namen Förderkreis zur Erhaltung der Burgruine Loch e.v. und
Satzung des Vereins Förderkreis zur Erhaltung der Burgruine Loch e.v. (Stand:Januar 2011) 1 Name und Sitz des Vereins I. Der Verein führt den Namen Förderkreis zur Erhaltung der Burgruine Loch e.v. und
Satzung des Vereins. Fassung It. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 30. November 2013
 Satzung des Vereins Fassung It. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 30. November 2013 1 Name und Sitz Der Verein führt den Namen Verein der Freunde und Förderer des Michaelsberges in Siegburg". Er
Satzung des Vereins Fassung It. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 30. November 2013 1 Name und Sitz Der Verein führt den Namen Verein der Freunde und Förderer des Michaelsberges in Siegburg". Er
SATZUNG. des Vereins "Kriminologische Initiative Hamburg. Name und Sitz. Aufgaben
 SATZUNG des Vereins "Kriminologische Initiative Hamburg 1 Name und Sitz Der Verein hat den Namen "Kriminologische Initiative Hamburg - Verein zur Förderung kriminologischer Aus- und Weiterbildung - ".
SATZUNG des Vereins "Kriminologische Initiative Hamburg 1 Name und Sitz Der Verein hat den Namen "Kriminologische Initiative Hamburg - Verein zur Förderung kriminologischer Aus- und Weiterbildung - ".
Geschichte der Diakonie in Deutschland
 Geschichte der Diakonie in Deutschland Bearbeitet von Dr. Georg-Hinrich Hammer 1. Auflage 2013. Taschenbuch. 384 S. Paperback ISBN 978 3 17 022999 0 Format (B x L): 15,5 x 23,2 cm Gewicht: 563 g Weitere
Geschichte der Diakonie in Deutschland Bearbeitet von Dr. Georg-Hinrich Hammer 1. Auflage 2013. Taschenbuch. 384 S. Paperback ISBN 978 3 17 022999 0 Format (B x L): 15,5 x 23,2 cm Gewicht: 563 g Weitere
(aus dem Vorwort für Kinder, in: AB HEUTE BIN ICH STARK- VORLESEGESCHICHTEN, DIE SELBSTBEWUSST MACHEN, ISBN )
 Interview für Kinder 1 Liebe Kinder, vorgelesen zu bekommen ist eine tolle Sache! Die Erwachsenen müssen sich ganz auf Euch einlassen, sich ganz für Euch Zeit nehmen. Wenn sie es richtig machen wollen,
Interview für Kinder 1 Liebe Kinder, vorgelesen zu bekommen ist eine tolle Sache! Die Erwachsenen müssen sich ganz auf Euch einlassen, sich ganz für Euch Zeit nehmen. Wenn sie es richtig machen wollen,
Friedrich II.: Mit dem roi philosophe zum aufgeklärten Staat?
 Geschichte Annegret Jahn Friedrich II.: Mit dem roi philosophe zum aufgeklärten Staat? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 2 2 Die europäische Aufklärung im 18. Jahrhundert... 3 2.1 Christian
Geschichte Annegret Jahn Friedrich II.: Mit dem roi philosophe zum aufgeklärten Staat? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 2 2 Die europäische Aufklärung im 18. Jahrhundert... 3 2.1 Christian
Hospizdienst Gomaringen e.v. VEREINSSATZUNG HOSPIZDIENST GOMARINGEN E.V. 1 Name und Sitz. 2 Zweck
 1 Hospizdienst Gomaringen e.v. Begleitung Schwerkranker, Sterbender und ihrer Angehörigen VEREINSSATZUNG HOSPIZDIENST GOMARINGEN E.V. 1 Name und Sitz 1. Der Verein führt den Namen Hospizdienst Gomaringen
1 Hospizdienst Gomaringen e.v. Begleitung Schwerkranker, Sterbender und ihrer Angehörigen VEREINSSATZUNG HOSPIZDIENST GOMARINGEN E.V. 1 Name und Sitz 1. Der Verein führt den Namen Hospizdienst Gomaringen
S a t z u n g. der Wirtschaftsjunioren Annaberg - Erzgebirge
 S a t z u n g der Wirtschaftsjunioren Annaberg - Erzgebirge bei der Industrie- und Handelskammer Südwestsachsen Chemnitz Plauen Zwickau e. V vom 06.11.2008 1 1 Name, Sitz, Verhältnis zur Kammer 1. Der
S a t z u n g der Wirtschaftsjunioren Annaberg - Erzgebirge bei der Industrie- und Handelskammer Südwestsachsen Chemnitz Plauen Zwickau e. V vom 06.11.2008 1 1 Name, Sitz, Verhältnis zur Kammer 1. Der
Satzung vom 13. November 2007 für die Stiftung Evangelische Stiftung. Regenbogen in Hagenow
 Satzung vom 13. November 2007 für die Stiftung Evangelische Stiftung 4.506-524 M Satzung vom 13. November 2007 für die Stiftung Evangelische Stiftung (KABl 2008 S. 5) 13.10.2014 Nordkirche 1 4.506-524
Satzung vom 13. November 2007 für die Stiftung Evangelische Stiftung 4.506-524 M Satzung vom 13. November 2007 für die Stiftung Evangelische Stiftung (KABl 2008 S. 5) 13.10.2014 Nordkirche 1 4.506-524
(1) Der Verein führt den Namen Flüchtlingshilfe Kaarst. Er soll ins Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz e.v.
 Satzung 1 (1) Der Verein führt den Namen Flüchtlingshilfe Kaarst. Er soll ins Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz e.v. (2) Der Sitz des Vereins ist Kaarst. (3) Das Geschäftsjahr
Satzung 1 (1) Der Verein führt den Namen Flüchtlingshilfe Kaarst. Er soll ins Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz e.v. (2) Der Sitz des Vereins ist Kaarst. (3) Das Geschäftsjahr
H21 ev: Förderverein der Grundschule an der Herrnstrasse 21 80539 München. Satzung
 H21 ev: Förderverein der Grundschule an der Herrnstrasse 21 80539 München Satzung 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 1. Der Verein hat den Namen H21 Förderverein der Grundschule an der Herrnstrasse 21 e. V.
H21 ev: Förderverein der Grundschule an der Herrnstrasse 21 80539 München Satzung 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 1. Der Verein hat den Namen H21 Förderverein der Grundschule an der Herrnstrasse 21 e. V.
2 Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit, Auflösung und Vermögen.
 Satzung Freifunk Rheinland e.v. Gründungssatzung vom 21.03.2011 in der geänderten Fassung vom 20.04.2016 ( 3 Absatz 1 und 9, 4 Absatz 6 Ziffer 1) 1 Name und Sitz des Vereins 1. Der Verein führt den Namen
Satzung Freifunk Rheinland e.v. Gründungssatzung vom 21.03.2011 in der geänderten Fassung vom 20.04.2016 ( 3 Absatz 1 und 9, 4 Absatz 6 Ziffer 1) 1 Name und Sitz des Vereins 1. Der Verein führt den Namen
Die Heilig-Blut-Legende
 Die Heilig-Blut-Legende Der kostbarste Schatz der Basilika ist das Heilige Blut. Es wird in einem prachtvollen Gefäß aufbewahrt. Schon vor Hunderten von Jahren fragten sich die Menschen und die Mönche
Die Heilig-Blut-Legende Der kostbarste Schatz der Basilika ist das Heilige Blut. Es wird in einem prachtvollen Gefäß aufbewahrt. Schon vor Hunderten von Jahren fragten sich die Menschen und die Mönche
Verein der europäischen Bürgerwissenschaften e.v. (ECSA) (European Citizen Science Association) Satzung
 Verein der europäischen Bürgerwissenschaften e.v. (ECSA) (European Citizen Science Association) Satzung Fassung 26.11.2014 (1) Der Verein führt den Namen Verein der europäischen Bürgerwissenschaften (ECSA)
Verein der europäischen Bürgerwissenschaften e.v. (ECSA) (European Citizen Science Association) Satzung Fassung 26.11.2014 (1) Der Verein führt den Namen Verein der europäischen Bürgerwissenschaften (ECSA)
Vorankündigung: Leben in Siebenbürgen Bildergeschichten aus Zendersch im 20. Jahrhundert
 Vorankündigung: Leben in Siebenbürgen Bildergeschichten aus Zendersch im 20. Jahrhundert Dietlinde Lutsch, Renate Weber, Georg Weber ( ) Schiller Verlag, Hermannstadt/Sibiu, ca. 400 Seiten Der Bildband
Vorankündigung: Leben in Siebenbürgen Bildergeschichten aus Zendersch im 20. Jahrhundert Dietlinde Lutsch, Renate Weber, Georg Weber ( ) Schiller Verlag, Hermannstadt/Sibiu, ca. 400 Seiten Der Bildband
Förderverein. Wendepunkt e.v. Satzung
 Förderverein Wendepunkt e.v. Satzung HERAUSGEBER: Förderverein Wendepunkt e.v. Postfach 1524 59755 Arnsberg Stand: November 2014 1 Name und Sitz Der Verein führt den Namen Förderverein Wendepunkt e.v.
Förderverein Wendepunkt e.v. Satzung HERAUSGEBER: Förderverein Wendepunkt e.v. Postfach 1524 59755 Arnsberg Stand: November 2014 1 Name und Sitz Der Verein führt den Namen Förderverein Wendepunkt e.v.
FC Potsdam Sanssouci e.v. Satzung. Inhalt : 1. Name,Sitz,Geschäftsjahr. 2.Zweck, Aufgaben und Grundsätze der Tätigkeit
 FC Potsdam Sanssouci e.v. Satzung Inhalt : 1. Name,Sitz,Geschäftsjahr 2. Zweck, Aufgaben und Grundsätze der Tätigkeit 3. Mitgliedschaft 4. Rechte und Pflichten 5. Organe 6. Mitgliederversammlung 7. Wählbarkeit
FC Potsdam Sanssouci e.v. Satzung Inhalt : 1. Name,Sitz,Geschäftsjahr 2. Zweck, Aufgaben und Grundsätze der Tätigkeit 3. Mitgliedschaft 4. Rechte und Pflichten 5. Organe 6. Mitgliederversammlung 7. Wählbarkeit
Satzung. 1 Sitz und Name. (1) Der Verein führt den Namen Förderverein der Grundschule Altrahlstedt e.v. und hat seinen Sitz in Hamburg.
 Satzung 1 Sitz und Name (1) Der Verein führt den Namen Förderverein der Grundschule Altrahlstedt e.v. und hat seinen Sitz in Hamburg. 2 Zweck und Aufgabe (1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar
Satzung 1 Sitz und Name (1) Der Verein führt den Namen Förderverein der Grundschule Altrahlstedt e.v. und hat seinen Sitz in Hamburg. 2 Zweck und Aufgabe (1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar
Begleitprogramm zur Ausstellung in Hamburg vom 6. November bis zum 7. Dezember 2016 in der Hauptkirche St. Katharinen
 Vernichtungsort Malyj Trostenez Geschichte und Erinnerung Begleitprogramm zur Ausstellung in Hamburg vom 6. November bis zum 7. Dezember 2016 in der Hauptkirche St. Katharinen Zur Erinnerung an die Deportation
Vernichtungsort Malyj Trostenez Geschichte und Erinnerung Begleitprogramm zur Ausstellung in Hamburg vom 6. November bis zum 7. Dezember 2016 in der Hauptkirche St. Katharinen Zur Erinnerung an die Deportation
Verband der Mitarbeiter an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg S A T Z U N G
 Verband der Mitarbeiter an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg S A T Z U N G des Verbandes der Mitarbeiter an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg I. NAME, SITZ UND ZWECK DES VERBANDES 1 NAME, SITZ,
Verband der Mitarbeiter an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg S A T Z U N G des Verbandes der Mitarbeiter an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg I. NAME, SITZ UND ZWECK DES VERBANDES 1 NAME, SITZ,
Angebote Sonderveranstaltungen. Grundschulen Schuljahr 2010/11 1. Klasse
 Angebote Sonderveranstaltungen Grundschulen Schuljahr 2010/11 1. Klasse Sehr geehrte Lehrerinnen, sehr geehrte Lehrer, nachfolgend finden Sie die Angebote für die Sonderveranstaltungen im Rahmen des Projektes
Angebote Sonderveranstaltungen Grundschulen Schuljahr 2010/11 1. Klasse Sehr geehrte Lehrerinnen, sehr geehrte Lehrer, nachfolgend finden Sie die Angebote für die Sonderveranstaltungen im Rahmen des Projektes
Österreich. Hauptstadt: Wien. Einwohner: 8,47 Millionen. Nationalflagge: Rot-Weiß-Rot. Die Lage: Im südlichen Mitteleuropa
 Österreich Hauptstadt: Wien Einwohner: 8,47 Millionen Nationalflagge: Rot-Weiß-Rot Die Lage: Im südlichen Mitteleuropa Die Nachbarstaaten: Die Tschechische Republik im Norden, die Slowakische Republik
Österreich Hauptstadt: Wien Einwohner: 8,47 Millionen Nationalflagge: Rot-Weiß-Rot Die Lage: Im südlichen Mitteleuropa Die Nachbarstaaten: Die Tschechische Republik im Norden, die Slowakische Republik
Satzung des Vereins LaKiTa - Lachende Kinder Tanzania (gemeinnütziger Verein)
 Satzung des Vereins LaKiTa - Lachende Kinder Tanzania (gemeinnütziger Verein) 1 Name und Sitz 1. Der Verein führt den Namen LaKiTa - Lachende Kinder Tanzania. 2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen
Satzung des Vereins LaKiTa - Lachende Kinder Tanzania (gemeinnütziger Verein) 1 Name und Sitz 1. Der Verein führt den Namen LaKiTa - Lachende Kinder Tanzania. 2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen
Mut zur Inklusion machen!
 Heft 4 - Dezember 2015 Mut zur Inklusion machen! Die Geschichte... von dem Verein Mensch zuerst Was bedeutet People First? People First ist ein englischer Name für eine Gruppe. Man spricht es so: Piepel
Heft 4 - Dezember 2015 Mut zur Inklusion machen! Die Geschichte... von dem Verein Mensch zuerst Was bedeutet People First? People First ist ein englischer Name für eine Gruppe. Man spricht es so: Piepel
Rede von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer anlässlich der Festveranstaltung zum 100. Geburtstag Herbert von Karajans am 5. April 2008 in Salzburg
 Rede von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer anlässlich der Festveranstaltung zum 100. Geburtstag Herbert von Karajans am 5. April 2008 in Salzburg Sehr geehrte Frau Landeshauptfrau! Sehr geehrte Frau von
Rede von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer anlässlich der Festveranstaltung zum 100. Geburtstag Herbert von Karajans am 5. April 2008 in Salzburg Sehr geehrte Frau Landeshauptfrau! Sehr geehrte Frau von
Satzung. Förderer und Freunde der Gesamtschule Obere Aar e.v. 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
 FV IGS Förderer und Freunde der Gesamtschule Obere Aar e.v. Satzung 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 1. Der Verein führt den Namen "Förderer und Freunde der Gesamtschule Obere Aar", Taunusstein-Hahn. Mit der
FV IGS Förderer und Freunde der Gesamtschule Obere Aar e.v. Satzung 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 1. Der Verein führt den Namen "Förderer und Freunde der Gesamtschule Obere Aar", Taunusstein-Hahn. Mit der
DEUTSCH- TÜRKISCHE WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG E.V.
 DEUTSCH- TÜRKISCHE WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG E.V. 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 1. Der Verein führt den Namen Deutsch-Türkische Wirtschaftsvereinigung e. V. im folgenden Verein genannt. 2. Der Sitz des Vereins
DEUTSCH- TÜRKISCHE WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG E.V. 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 1. Der Verein führt den Namen Deutsch-Türkische Wirtschaftsvereinigung e. V. im folgenden Verein genannt. 2. Der Sitz des Vereins
Die Evangelische Kirche im Rheinland
 Die Evangelische Kirche im Rheinland Eine kurzer Überblick 54. ordentliche Landessynode Bad Neuenahr 09. bis 14. Januar 2005 Dr. Matthias Schreiber Die rheinische Kirche ist eine von 23 Gliedkirchen der
Die Evangelische Kirche im Rheinland Eine kurzer Überblick 54. ordentliche Landessynode Bad Neuenahr 09. bis 14. Januar 2005 Dr. Matthias Schreiber Die rheinische Kirche ist eine von 23 Gliedkirchen der
