Die Mineralien der Gruben Wohlfahrt und Schwalenbach
|
|
|
- Lars Fiedler
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Die Mineralien der Gruben Wohlfahrt und Schwalenbach GEOMONTANUS Die Erzvorkommen bei Rescheid sind bekannt geworden durch den viele jahrhundertelang dauernde Abbau von hochwertigen Bleierzen, der sich auf die Gewinnung eines einzigen Minerales beschränkte, die von Bleiglanz (PbS). Dass es außer Bleiglanz eine ganze Anzahl weiterer Mineralien in diesen Vorkommen gibt, ist hingegen nur den Sammlern und Mineralienfreunden bekannt. In der wissenschaftlichen Literatur ist bislang nie in ausführlicher Weise die Gesamtparagenese, d. h. die gesamte Gemeinschaft der hier zusammen auftretenden Mineralien, beschrieben und näher untersucht worden. Dieser Beitrag soll den aktuellen Kenntnisstand zusammenfassen und eine Übersicht über die bislang im Bereich des Bergbaureviers der Grube Wohlfahrt gemachten Funde geben. Hierzu zählen die pauschal mit "Rescheid" oder "Grube Wohlfahrt" benannten Lokalitäten bei den Ortsteilen Aufbereitung, Grube Wohlfahrt, Schnorrenberg und Schwalenbach. Geologisch-lagerstättenkundlicher Hintergrund Die Rescheider Mineralien sind insgesamt an gangförmige Erzvorkommen gebunden, die in den gefalteten Tonschiefern und Grauwacken des Unterdevons als Gangzug auftreten und sich im Bereich von Rescheid scharen. Wegen der Vorherrschaft des Bleis und der besonderen Silberarmut des Bleiglanzes gehören diese einem besonderen Gangtyp an, der als Typus der Glasurerzgänge lagerstättenkundlich eingestuft wird. Genetisch stehen sie in direktem Zusammenhang mit den Vorkommen, die parallel zum Gebirgsstreichen von Nord-Luxemburg im Südwesten, über Bleialf und Rescheid bis Mechernich im Nordosten reichen. Dies ist als Bleialf-Rescheider Gangzug bekannt (VOIGT, 1952). Die Erzvorkommen dieses Gangzuges, die mit der nicht gangförmigen Mechernicher Bleierzlagerstätte durch gleiche Abkunft verknüpft sind, sind auch insoweit bemerkenswert, als sie durch die besondere Qualität dieser Glasurerze durch mehrere Jahrhunderte eine in wirtschaftlicher Hinsicht besondere Bedeutung aufweisen. BORNHARDT (1912/13) hebt diesen Typus wie folgt hervor: "Er unterscheidet sich dadurch, dass sein Mineralinhalt vorwiegend drusig entwickelt ist, wogegen Drusen in den (anderen) Typen nur höchst selten vorkommen. Außerdem fehlt bei ihm der Spateisenstein als Gangart und weist statt dessen Bitterspat (Ankerit) nebst Kalkspat auf". Dies bedeutet natürlich auch, dass solche Lagerstätten für Sammler und Liebhaber eine besondere Attraktivität besitzen, da sie schönste Stufen mit großen Kristallen zu liefern imstande sind. Gerade die Grube Wohlfahrt war früher sehr bekannt für ihre besonders großen, würfelförmigen Bleiglanzkristalle, die bis zu einem halben Meter Kantenlänge erreichen konnten. Leider sind viele entsprechende historische Sammlerstufen verlorengegangen, so dass gute Mineralstufen aus Rescheid heute eher zu den Raritäten auf dem Mineralienmarkt gehören. An frisches Untertage-Material kommt man jedenfalls nicht mehr heran und die Fundmöglichkeiten von Haldenmaterial sind auch heutzutage mehr als bescheiden geworden.
2 Typischerweise ist die Erzfüllung der Glasurerzgänge ziemlich grobspätig ausgebildet; grobspätig bedeutet, der Bleiglanz zeigt in seinem Bruch recht grobe Korngrößen, was sich in spiegelnden Spaltflächen von Millimeter- bis Zentimetergröße äußert. Bildung der Erze (Genese) Die Erze von Rescheid wie auch die weiteren Vorkommen der Glasurerzgänge bildeten sich durch Vorgänge im Erdinnern. Voraussetzung waren Störungssysteme im Gebirge, welche mehrere Kilometer tief in die Erdkruste hinabreichten und während der Vorgänge der variskischen Gebirgsbildung vor ca Millionen Jahren angelegt wurden. Diese Störungen dienten als Wegsamkeiten bzw. Aufstiegswege für hydrothermale Erzlösungen, hochsalinare, mineralreiche Wässer mit Temperaturen von C. In geeigneten Zonen konnten sich Erze und andere Mineralien durch Kristallisation innerhalb von Gesteinsspalten ausscheiden und bildeten so die langgestreckten, relativ unregelmäßig ausgebildeten Erzgänge. Aufgrund der tektonischen Vorgaben sprich der durch die Gebirgsbildung verursachten Spannungen im Erdinnern kam es zur Ausbildung bevorzugter Raumrichtungen der Erzgänge, die um Rescheid annähernd Nord-Süd-Erstreckung aufweisen. Früher nahm man einen genetischen Zusammenhang mit einem erzbringenden Magmakörper oder einem Pluton unter der Eifel an; bis heute konnte aber kein entsprechender nachgewiesen werden. Ein bereits zur Unteren Devonzeit unter dem Vennkern aufgestiegener Magmenkörper, der u.a. den Hilltal-Tonalit formte, wäre viel zu alt. Das basaltische Magma, welches den Vulkanismus in der Eifel verursachte, ist viel zu jung und kommt auch aus anderen Gründen nicht als Lieferant für die Schwermetalle in den Eifeler Erzen in Frage. Die heute allgemein vertretene Auffassung einer Mobilisation dieser Metalle aus paläozoischen Sedimentgesteinen im tieferen Untergrund wird erstmals in bezug auf die Eifeler Erzvorkommen durch KRAHN (1988) in einem genetischen Modell vorgestellt, gestützt durch Blei-Isotopen-Analysen verschiedener Erze und Gesteine. Auch Rescheider Material lag diesen Untersuchungen zu Grunde. Weitere Forschungen über die physikochemischen Vorgänge bei der Erzbildung legen eine wichtige Rolle durch Kohlenwasserstoffe bei der Fällung von Sulfiden zugrunde (FRIEDRICH, GERMANN, JOCHUM 1993). In Frage kommende Kohlenwasserstoffe wurden auch in Untersuchungen an Gesteinsmaterial aus dem Bereich der Rescheider Erzvorkommen festgestellt. Bezüglich des Bildungsalters der Erze von Bleialf-Rescheid-Mechernich können erst seit wenigen Jahren genauere Aussagen gemacht werden. Bislang war klar, dass diese Vorkommen gleichaltrig und jünger als Keuper-zeitlich abgesetzt worden sein müssen. Durch Altersdatierungen mit der Rb-Sr-Methode finden SCHNEIDER et al. (1999) Bildungsalter von 170 +/- 4 Mill. Jahren in Zinkblende-Proben aus diesen Vorkommen. So lässt sich das Bildungsalter auf die Mittlere Jura-Zeit festlegen.
3 Paragenese der primären Erze GEOMONTANUS Unter primärem Erz verstehen wir die unterhalb des Grundwasserspiegels liegenden Teile eines Erzganges, der eine ursprüngliche, nicht durch Oxydation oder Umlagerungsvorgänge veränderte Mineralgesellschaft (Paragenese) aufweist. Es handelt sich vornehmlich um sulfidische Erzminerale wie Bleiglanz. In Rescheid waren diese durch untertägigen Abbau zugänglich, während im alten, oberflächennahen Abbau sekundäre, durch Oxydationsvorgänge veränderte Erze (Weißbleierz) gewonnen worden sind. Neben Bleiglanz und den häufigen Gangartmineralen (nichtmetallische, nicht verwertbare Minerale) Ankerit und Quarz treten in den Rescheider Gängen untergeordnet bis selten die folgenden Minerale auf: Kupferkies (Chalkopyrit) Markasit Pyrit Fahlerz (hier Tetraedrit) Voltzin Schalenblende Schwerspat Kalzit Harmotom Nachfolgend soll eine noch aus der Betriebszeit stammende, aufschlussreiche Beschreibung der Grube Wohlfahrt und deren Mineralien wiedergegeben werden (W. BORNHARDT, 1912, S. 56): " Ich habe selbst ein ausgezeichnetes Vorkommen dieser Bleierze auf Grube Wohlfahrt bei Rescheid in der Eifel kennen gelernt. Dort werden unterdevonische Grauwackensandsteine, denen untergeordnet Schiefer eingeschaltet sind, von einer Anzahl parallel verlaufender, in Stunde streichender und steil nach Osten einfallender Gänge durchsetzt. An den Salbändern der Gänge und an den in die Gangspalten eingebrochenen Sandsteinbrocken haben sich Krystallkrusten von Bleiglanz, Bitterspat und Quarz, meist in dieser Altersfolge, zuweilen aber auch davon abweichend, abgesetzt. Die Spaltenräume sind stellenweise völlig zugewachsen; in den meisten Gangteilen sind aber noch Drusenräume offen geblieben, in denen vielfach Bleiglanzkrystalle von 5-10 cm Kantenlänge und darüber zu beobachten sind. Spateisenstein und Zinkblende fehlen; Schwefelkies kommt nur in geringen Mengen vor. Schwerspat, der in der oberen Teufe häufig gewesen ist, ist in den tieferen Bausohlen nur selten mehr anzutreffen. Vereinzelt finden sich in den Drusenräumen noch Krystalle von Kupferkies und Fahlerz und, als große Seltenheit, von Bournonit. Der Silbergehalt des stets grobglanzig ausgebildeten Bleiglanzes beträgt 7-8 g auf 100 kg Erz bei einem Bleigehalt von %. Die ersten bauwürdigen Erze haben sich in dem A-Gange, der heute allein in Abbau steht, in 50 m Teufe gefunden. Höher hinauf hat sich der Gang infolge des in dem bergigen Gelände besonders wirksam gewesenen Einflusses der Tageswässer als fast erzleer erwiesen. Zwischen 120 und 200 m Teufe sind die Erze in besonders reichen Mengen eingebrochen. Der Gang ist aber auch in der jetzigen tiefsten Sohle, der 320 m-sohle, noch gut bauwürdig. Eine wesentliche Veränderung des Gangcharakters ist bis jetzt nicht erkennbar, und es erscheint danach die Hoffnung wohl berechtigt, dass der Erzreichtum auch noch auf größeren Teufen anhalten wird. Die bauwürdigen Mittel endigen im Streichen jedes Mal da, wo schiefrige, wasserundurchlässige Gesteinsmassen in die Gangspalte hineingerutscht sind."
4 Bemerkenswert ist in BORNHARDT s Ausführungen die Erwähnung des Bleiminerals Bournonit (CuPbSbS 3). Dieser ist bislang in der Rescheider Paragenese nicht aus Sammlungen oder aus anderen Literaturvermerken bekannt und wurde auch vom Verfasser bisher nicht beobachtet. Bleiglanz (PbS) Das Mineral Bleiglanz wird in der Mineralogie auch Galenit genannt, dieser Name ist von lat. galena = Blei abzuleiten. Es enthält theoretisch 86,6% Blei und 13,4% Schwefel. Es kann aber auch zahlreiche Spurenelemente (Ag, Cu, Fe, Sb, Zn, As, Se, Bi u.a.) enthalten, von denen vor allem das Silber (Ag) hervorzuheben ist. Der Gehalt an Silber beträgt meist 0,005% - 0,4%, gelegentlich auch mehr. So war Bleiglanz von jeher auch ein wichtiger Rohstoff zur Silbergewinnung, Blei fiel oft nur als Nebenprodukt an. Bereits in der Antike führte der Silbergehalt zu einer großen wirtschaftlichen Bedeutung der Bleierze. Als Beispiel seien die Lagerstätten von Lavrion in Griechenland, Linares und Rio Tinto in Spanien und Bleiberg in Kärnten erwähnt. Silberarmer Bleiglanz wie der aus Rescheid, Bleialf und Mechernich hatte als Glasurerz besondere Bedeutung (konnte unbehandelt zur Herstellung von Glasurschlichen für Keramik verwendet werden) oder wurde zur Herstellung von Bleigläsern (Kristallglas) gebraucht. Seit dem späten 15. Jahrhundert kam ihm weitere Bedeutung durch das Saigerverfahren zu, wo durch Zusatz von silberarmen Bleiglanz beim Schmelzprozess dem Kupfer das Silber entzogen wird. Bleiglanz besitzt eine perfekte Spaltbarkeit nach allen drei Raumrichtungen. Das führt aufgrund der Kristallstruktur zu einer Absonderung in rechtwinklig begrenzte Körper wie Quader und Würfel. Die gute Spaltbarkeit bedingt auch die leichte Brüchigkeit von reinen Bleierzen, was für die Erzaufbereitung Konsequenzen hat. ca. 30 cm große Bleiglanzstufe vom Schwalenbacher Gangzug
5 Bleiglanz kristallisiert im kubischen System, d.h. die Bleiglanzkristalle entwickeln sich in allen 3 Raumrichtungen gleichmäßig, es entstehen entweder Würfel wie beim Steinsalz oder Oktaeder oder Kombinationen aus beiden (Kubooktaeder). Die Rescheider Erzstufen zeigen meist Würfelform, häufig finden sich auch Kubooktaeder. Größere Kristalle sind oft leicht verzerrt und weisen Parkettierungen infolge von Gitterbaufehlern auf. Quarz (SiO ) 2 Quarz ist in den Rescheider Erzgängen neben Ankerit die häufigste Gangart. Besonders in den Erzen der Schwalenbacher Gänge ist er ständig anzutreffen. Meist ist er leicht trüb, durch oxydierte Eisenverbindungen gelblich oder bräunlich angefärbt, häufig auch milchig weiß. Manchmal treten auch wasserklare Kristalle auf (Bergkristall). Vereinzelt finden sich auch rauchig braun gefärbte Kristallstufen (Rauchquarz). Oft bildeten Quarze in Drusenhohlräumen hübsche Kristallrasen oder seltener Stufen mit bis zu mehreren Zentimeter großen Quarzkristallen. Diese sind dann als späte Ausscheidung auf den früher gebildeten Bleierzen und auf Ankerit aufgewachsen. 6 cm großer Quarzkristall als Anhänger gefasst Im Schwalenbacher Bereich sind häufig Gangbrekzien ausgebildet, in denen Quarz neben eingesprengtem Bleiglanz, Kupferkies und Fahlerz die Gesteinsbruchstücke miteinander fest verkittet. Auch das Nebengestein ist hier vielfach verquarzt und ergibt so ein besonders hartes und splittriges, quarzitisches Material, welches in der Vergangenheit gerne zum Wegebau benutzt wurde. Ankerit (CaFe(CO ) ) 3 2 Ankerit, von Bergleuten auch Braunspat genannt, ist eine häufige Gangart der Rescheider Erzgänge. Vor allem in den östlich gelegenen Gängen ist er vorherrschend und bildet dort stellenweise die alleinige Gangmasse. So schreibt von DECHEN: "Auf der Eisenen Thür ist die vorherrschende Gangart: Braunspath, der in vielen großen und kleinen Klüften und Drusen in nieren- und traubenförmigen Gestalten auftritt, daneben findet sich Quarz nur stellenweise und in den Drusenräumen krystallisiert. Dagegen ist dieser letztere auf dem Bärwurzel-Gange und auch auf dem After-Gange vorherrschend, während der Braunspath auf diesem zurück tritt, er findet sich derb und krystallisiert. In Drusenräumen ist Quarz und Bleiglanz mit dem Braunspath verwachsen und mit kleinen Braunspathkrystallen überzogen."
6 An der Oberfläche derartiger nieriger und traubiger Massen erscheinen schuppige, normalerweise kleine rhomboedrische Kristalle. Größere Individuen weisen leichte Krümmung der Kristallflächen auf. In frischem Zustand ist Ankerit gelblichweiß, die meisten Stufen sind jedoch durch Oxydation des Eisenanteils tief braun gefärbt. Kupferkies (Chalkopyrit) CuFeS 2 Kupferkies ist in den Rescheider Erzen nicht selten im Bleiglanz eingesprengt, aber nie in größeren Nestern zu finden. Durch seine goldgelbe Farbe und evtl. bunte Anlauffarben ist er leicht zu erkennen. In Rescheider Mineralstufen bildet er häufig Kristallrasen und Überzüge aus winzigen idiomorphen Kriställchen (Tetraeder und Kombinationen mit tetraedrischem Habitus) auf größeren Quarz- oder Bleiglanzkristallen. Besonders typisch für Rescheid (Schwalenbacher Bereich) sind dünne Kupferkies-Ummantelungen von Tetraedrit-Kristallen. Markasit (FeS ) 2 Markasit wird wie auch der Pyrit Schwefelkies genannt. Beide sind durch messinggelbe Farbe und metallischen Glanz gekennzeichnet. Der rhombische Markasit tritt in den Rescheider Gängen wesentlich häufiger in Erscheinung als der kubische Pyrit. In der älteren Literatur ist nur pauschal von Schwefelkies die Rede, vermutlich handelt es sich dann meistens um Markasit. So schreibt von DECHEN (1866, S. 244): "Auf dem Bärwurzel-Gange sind die Erze weniger mit Schwefelkies gemengt, als auf der Eisernen Thür." Gerade dort, auf dem Eiserne Thür-Gang sind v. DECHEN zufolge stellenweise größere Mengen dieses Eisenminerals aufgetreten: "...Bleiglanz, der sehr mit Schwefelkies gemengt ist." Von Schwalenbach sind ansehnlich große Markasitstufen überkommen (Sammlung im Grubenhaus), die in nieriger Form und in bizarren Kristallaggregaten ausgebildet sind. Das Auftreten in größeren, monomineralischen Massen scheint in diesem Vorkommen häufiger gewesen zu sein. Pyrit (FeS ) 2 Pyrit wird wie auch der Markasit Schwefelkies genannt. Pyrit ist in dem heute zugänglichen Rescheider Sammlungsmaterial lediglich in Form kleiner Kristalle (Würfel, Pentagondodekaeder) in Millimetergröße auf Quarz oder Bleiglanz bekannt. Pyrit vom Schwalenbacher Gangzug
7 Voltzin (ZnS) Diese Cadmium- und Arsenhaltige Variante der Zinkblende kommt in Form millimeterkleiner, dunkelbrauner Kügelchen auf einigen Erzstufen aus dem Schwalenbacher Bereich als Rarität vor. Einige Proben wurden vom Verfasser für die Altersbestimmungen an der Uni Gießen (SCHNEIDER et al., 1999) zur Verfügung gestellt. Wurtzit/Schalenblende (ZnS) Bislang ist nur ein einzelnes Belegstück einer Schalenblende bekannt, welches mit Sicherheit dem Schwalenbacher Fundbereich zugeordnet werden kann. Schalenblende vom Schwalenbacher Gangzug Schwerspat (BaSO ) 4 Baryt kommt heute nur in wenigen Sammlungsexemplaren von den Rescheider Erzgängen vor. Darin sind die weißlichen Kristalle immer recht stark zersetzt. Oft beobachtet man nur noch die kammartigen Abdrücke ehemaliger Barytkristalle im Quarz. Vermutlich ist der Baryt während der Lagerzeit auf den Halden stark durch saure Wässer angegriffen worden. Hingegen konnten vor wenigen Jahren unzersetzte, grobspätige Massen auf eigenen Schwerspatgängen unterhalb von Schnorrenberg, in der Flur Metzigeroder und bei Wittscheid gefunden werden. Kalzit (CaCO ) 3 Kalzit ist nur in wenigen Belegproben in wenig ansehnlichen, weiß-durchscheinenden Kristallen auf Quarz im Schwalenbacher Haldenmaterial vom Verfasser gefunden worden. Das Fehlen von Kalzit bzw. Kalkspat als ansonsten häufige Gangart ist charakteristisch für den Typ der Glasurerzgänge. Harmotom (Ba(Al Si O )*6H O) Dieses typisch hydrothermal gebildete Bariummineral gehört ebenfalls zu den seltenen Mineralien der primären Rescheider Mineralparagenese. Es findet sich vereinzelt auf Erzstufen, meist auf Quarz oder Ankerit in hell-gelblichen Kriställchen von unter 1 mm Größe, die in besonderer Weise das Licht reflektieren. Unter der Lupe sind idiomorphe, längliche Kristalle, die charakteristisch verzwillingt sind (Durchkreuzungszwillinge) sichtbar.
8 Harmotom vom Schwalenbacher Gangzug Die Beschreibung der sekundäre Mineralparagenese folgt. Literatur: BORNHARDT, W. (1912): Über die Gangverhältnisse des Siegerlandes und seiner Umgebung. Teil II. Kgl. Preuss. Geol. Landesanstalt, Berlin BORNHARDT, W. (1912/13): Die Erzvorkommen des rheinischen Schiefergebirges. In: Metall und Erz, X., H 1 von DECHEN, H. (1866): Orographisch-Geognostische Übersicht des Regierungsbezirkes Aachen. Verlag von Benrath & Vogelsang, Aachen, 292 S. FRIEDRICH, G., GERMANN, A. & JOCHUM, J. (1993): Schichtgebundene Pb-Zn- Vorkommen in klastischen Gesteinen vom Typ Maubach-Mechernich Lagerstättenbildung durch intraformationale Prozesse. In: Mitt. Österr. Miner. Ges., Vol. 138, S KRAHN, L. (1988): Buntmetall-Vererzung und Blei-Isotopie im linksrheinischen Schiefergebirge und in angrenzenden Gebieten. Diss. RWTH Aachen 1988 SCHNEIDER, J.C.; HAACK, U.; HEIN, U.F.; GERMANN, A. (1999): Direct Rb-Sr dating of sandstone-hosted sphalerites from stratabound Pb-Zn deposits in the northern Eifel, NW Rhenish Massif, Germany. Mineral Deposits: In: Processes to Processing, Stanley et al. (eds.), Rotterdam, VOIGT, A. (1952): Die Metallerzprovinz um das Hohe Venn. In: ERZMETALL, Bd. V, S
Übungen zur Allgemeinen Geologie, Nebenfach. Erta Ale, Afrika
 Übungen zur Allgemeinen Geologie, Nebenfach Erta Ale, Afrika Minerale anorganisch, (natürlich) Festkörper definierte chemische Zusammensetzung homogen definiert durch chemische Formel kristallin Physikalische
Übungen zur Allgemeinen Geologie, Nebenfach Erta Ale, Afrika Minerale anorganisch, (natürlich) Festkörper definierte chemische Zusammensetzung homogen definiert durch chemische Formel kristallin Physikalische
Neue Wismutmineralfunde und ein neuer Goldfund aus der Steiermark
 Neue Wismutmineralfunde und ein neuer Goldfund aus der Steiermark WERNER TUFAR (Geologisches Institut der Universität Aarhus, Dänemark) Von einer Reihe von Erzlagerstätten und Vorkommen des Semmering-
Neue Wismutmineralfunde und ein neuer Goldfund aus der Steiermark WERNER TUFAR (Geologisches Institut der Universität Aarhus, Dänemark) Von einer Reihe von Erzlagerstätten und Vorkommen des Semmering-
Einführung in die Geologie
 Einführung in die Geologie Teil 4: Minerale - Baustoffe der Gesteine Prof. Dr. Rolf Bracke International Geothermal Centre Lennershofstraße 140 44801 Bochum Übersicht Definition der Minerale Minerale und
Einführung in die Geologie Teil 4: Minerale - Baustoffe der Gesteine Prof. Dr. Rolf Bracke International Geothermal Centre Lennershofstraße 140 44801 Bochum Übersicht Definition der Minerale Minerale und
Gesteinskunde. Bestimmung magmatischer Minerale. Christopher Giehl, Uni Tübingen 20.10.2011
 Gesteinskunde Bestimmung magmatischer Minerale Christopher Giehl, Uni Tübingen 20.10.2011 Christopher Giehl (Universität Tübingen) 20.10.2011 1 / 18 1 Wiederholung 2 Klassifikation magmatischer Gesteine
Gesteinskunde Bestimmung magmatischer Minerale Christopher Giehl, Uni Tübingen 20.10.2011 Christopher Giehl (Universität Tübingen) 20.10.2011 1 / 18 1 Wiederholung 2 Klassifikation magmatischer Gesteine
Gesteinskunde Einführung
 Gesteinskunde Einführung Christopher Giehl, Uni Tübingen 13.10.2011 Christopher Giehl (Universität Tübingen) 13.10.2011 1 / 23 1 Organisatorisches 2 Kursinhalte und -ziele 3 Grundbegriffe und Definitionen
Gesteinskunde Einführung Christopher Giehl, Uni Tübingen 13.10.2011 Christopher Giehl (Universität Tübingen) 13.10.2011 1 / 23 1 Organisatorisches 2 Kursinhalte und -ziele 3 Grundbegriffe und Definitionen
Unterrichtsmaterial zum Modul Symmetrie
 Unterrichtsmaterial zum Modul Symmetrie Inhalt (je 4x) Alkalifeldspat (Prisma - monoklin) Kalkspat/Calcit (Rhomboeder - trigonal) Apatit (Prisma & Pyramide - hexagonal) Quarz (Prisma & Pyramide - trigonal)
Unterrichtsmaterial zum Modul Symmetrie Inhalt (je 4x) Alkalifeldspat (Prisma - monoklin) Kalkspat/Calcit (Rhomboeder - trigonal) Apatit (Prisma & Pyramide - hexagonal) Quarz (Prisma & Pyramide - trigonal)
GOLD IN ÖSTERREICH. Von Gerhard NIEDERMAYR und Robert SEEMANN
 GOLD IN ÖSTERREICH Von Gerhard NIEDERMAYR und Robert SEEMANN Entstehung und Verbreitung der Goldlagerstätten Gold findet sich in der Natur hauptsächlich in gediegenem Zustand. Sehr selten geht es Verbindungen
GOLD IN ÖSTERREICH Von Gerhard NIEDERMAYR und Robert SEEMANN Entstehung und Verbreitung der Goldlagerstätten Gold findet sich in der Natur hauptsächlich in gediegenem Zustand. Sehr selten geht es Verbindungen
Beispielklausur Geochemie I Mineralogie (Anteil Schertl)
 Beispielklausur Geochemie I Mineralogie (Anteil Schertl) 1. Wichtig zum Verständnis der Kristallchemie von Mineralen sind Wertigkeiten und Ionenradien von Elementen. a. Geben Sie die Wertigkeiten folgender
Beispielklausur Geochemie I Mineralogie (Anteil Schertl) 1. Wichtig zum Verständnis der Kristallchemie von Mineralen sind Wertigkeiten und Ionenradien von Elementen. a. Geben Sie die Wertigkeiten folgender
BULLETIN SOCIETE IMPERIALE MOSCOU. .M m. DE LA TOIIE.XXXV. IIIPRUlBIUB DB L'UNIVERSlTi IIIPERIALR. (Katkoff & co.) 1862.
 BULLETIN DE LA SOCIETE IMPERIALE TOIIE.XXXV.M m. MOSCOU. IIIPRUlBIUB DB L'UNIVERSlTi IIIPERIALR. (Katkoff & co.) 1862. UNTERSUCHUNGEN EINIGER NEUER RUSSISCHER MINERALIEN. VO:-l R. Bermann. 1. UEBER PLANERIT,
BULLETIN DE LA SOCIETE IMPERIALE TOIIE.XXXV.M m. MOSCOU. IIIPRUlBIUB DB L'UNIVERSlTi IIIPERIALR. (Katkoff & co.) 1862. UNTERSUCHUNGEN EINIGER NEUER RUSSISCHER MINERALIEN. VO:-l R. Bermann. 1. UEBER PLANERIT,
Typische Eigenschaften von Metallen
 Typische Eigenschaften von Metallen hohe elektrische Leitfähigkeit (nimmt mit steigender Temperatur ab) hohe Wärmeleitfähigkeit leichte Verformbarkeit metallischer Glanz Elektronengas-Modell eines Metalls
Typische Eigenschaften von Metallen hohe elektrische Leitfähigkeit (nimmt mit steigender Temperatur ab) hohe Wärmeleitfähigkeit leichte Verformbarkeit metallischer Glanz Elektronengas-Modell eines Metalls
Exkursion Erzlagerstätte Schauinsland A. Danilewsky, J. Richter
 Exkursion Erzlagerstätte Schauinsland 05.04.2014 A. Danilewsky, J. Richter 1. Geologische Übersicht und Entstehung der Erzgänge 1.1 Geologische Übersicht des Schwarzwaldes 1.2 Grundgebirge des Bereichs
Exkursion Erzlagerstätte Schauinsland 05.04.2014 A. Danilewsky, J. Richter 1. Geologische Übersicht und Entstehung der Erzgänge 1.1 Geologische Übersicht des Schwarzwaldes 1.2 Grundgebirge des Bereichs
BERGBAU PSL! INVENTAR! BLATT St. Johann! PUNKT ! AUSGABE 1! DATUM SEITE 1!
 A. B. D. BERGBAU PSL INVENTAR BLATT St. Johann PUNKT 6708.001 AUSGABE 1 DATUM 2015-04-03 SEITE 1 Bohrloch "Stuhlsatzenhaus". Heute im Bebauungsbereich der Universität R 25 76 130 H 54 58 240 Höhe 247 m
A. B. D. BERGBAU PSL INVENTAR BLATT St. Johann PUNKT 6708.001 AUSGABE 1 DATUM 2015-04-03 SEITE 1 Bohrloch "Stuhlsatzenhaus". Heute im Bebauungsbereich der Universität R 25 76 130 H 54 58 240 Höhe 247 m
Gewinnung und Reinigung der Übergangsmetalle. Von Sebastian Kreft
 Übergangsmetalle Von Sebastian Kreft Übersicht Gewinnung und Raffination von: 1. Scandium 2. Titan 3. Vanadium 4. Chrom 5. Mangan 6. Eisen 7. Cobalt 8. Nickel 9. Kupfer 10. Zink Übergangsmetalle 2 1. Scandium
Übergangsmetalle Von Sebastian Kreft Übersicht Gewinnung und Raffination von: 1. Scandium 2. Titan 3. Vanadium 4. Chrom 5. Mangan 6. Eisen 7. Cobalt 8. Nickel 9. Kupfer 10. Zink Übergangsmetalle 2 1. Scandium
Übungen zur Allgemeinen Geologie, Nebenfach
 zur Allgemeinen Geologie, Nebenfach Erta Ale, Afrika Übungstermine und Themen Termine Einführungsstunde Übung 26.10.2010 Einführung + Mineral- Eigenschaften Gruppeneinteilung 02.11. 2010 Minerale 1 Eigenschaften
zur Allgemeinen Geologie, Nebenfach Erta Ale, Afrika Übungstermine und Themen Termine Einführungsstunde Übung 26.10.2010 Einführung + Mineral- Eigenschaften Gruppeneinteilung 02.11. 2010 Minerale 1 Eigenschaften
Glas und seine Rohstoffe
 Glas und seine Rohstoffe Version 1.8, Nov. 2001 Was ist Glas? Definition: Glas ist ein anorganisches Schmelzprodukt, welches aus verschiedenen Rohstoffen erschmolzen wird und beim Abkühlen nicht kristallisiert
Glas und seine Rohstoffe Version 1.8, Nov. 2001 Was ist Glas? Definition: Glas ist ein anorganisches Schmelzprodukt, welches aus verschiedenen Rohstoffen erschmolzen wird und beim Abkühlen nicht kristallisiert
Magische Kristalle Prof. Dr. R. Glaum
 Magische Kristalle Prof. Dr. R. Glaum Institut für Anorganische Chemie Universität Bonn http://www.glaum.chemie.uni-bonn.de email: rglaum@uni-bonn.de Dank Herr Michael Kortmann Herr Andreas Valder Deutsche
Magische Kristalle Prof. Dr. R. Glaum Institut für Anorganische Chemie Universität Bonn http://www.glaum.chemie.uni-bonn.de email: rglaum@uni-bonn.de Dank Herr Michael Kortmann Herr Andreas Valder Deutsche
Geotop Lange Wand bei Ilfeld
 Geotop bei Ilfeld n zum Vorschlag zur Aufnahme in die Liste der bedeutendsten Geotope Deutschlands 1. Geotop bei Ilfeld Am Grunde des Zechsteinmeeres: Beschreibung des Geotops Aufschluß 2. Kurzbeschreibung
Geotop bei Ilfeld n zum Vorschlag zur Aufnahme in die Liste der bedeutendsten Geotope Deutschlands 1. Geotop bei Ilfeld Am Grunde des Zechsteinmeeres: Beschreibung des Geotops Aufschluß 2. Kurzbeschreibung
7. Woche. Gesamtanalyse (Vollanalyse) einfacher Salze. Qualitative Analyse anorganischer Verbindungen
 7. Woche Gesamtanalyse (Vollanalyse) einfacher Salze Qualitative Analyse anorganischer Verbindungen Die qualitative Analyse ist ein Teil der analytischen Chemie, der sich mit der qualitativen Zusammensetzung
7. Woche Gesamtanalyse (Vollanalyse) einfacher Salze Qualitative Analyse anorganischer Verbindungen Die qualitative Analyse ist ein Teil der analytischen Chemie, der sich mit der qualitativen Zusammensetzung
Philipps Universität Marburg Fachbereich 15: Chemie Experimentalvortrag Dozenten: Dr. Philipp Reiß Prof. Dr. Bernhard Neumüller
 Philipps Universität Marburg Fachbereich 15: Chemie Experimentalvortrag Dozenten: Dr. Philipp Reiß Prof. Dr. Bernhard Neumüller Referent: Martin Stolze Inhaltsverzeichnis 1. Zustandsformen 2. Vorkommen
Philipps Universität Marburg Fachbereich 15: Chemie Experimentalvortrag Dozenten: Dr. Philipp Reiß Prof. Dr. Bernhard Neumüller Referent: Martin Stolze Inhaltsverzeichnis 1. Zustandsformen 2. Vorkommen
Die 22. Fichtelgebirgs-Mineralienbörse in Marktleuthen
 Die 22. Fichtelgebirgs-Mineralienbörse in Marktleuthen Die große Börse im kleinen Fichtelgebirge hat es geschafft die zweite Schnapszahl 22 prangte auf dem ansprechend gestalteten Börsenplakat. Enttäuscht
Die 22. Fichtelgebirgs-Mineralienbörse in Marktleuthen Die große Börse im kleinen Fichtelgebirge hat es geschafft die zweite Schnapszahl 22 prangte auf dem ansprechend gestalteten Börsenplakat. Enttäuscht
Zur Entstehung der Erz- und Mineralgänge im Exkursionsgebiet
 Zur im Exkursionsgebiet Im Grundgebirge und den überlagernden Schichten des Schwarzwalds gibt es mehrere tausend Erzund Mineralgänge, wovon etwa 400-500 dieser Gänge zumindest zeitweise wirtschaftliche
Zur im Exkursionsgebiet Im Grundgebirge und den überlagernden Schichten des Schwarzwalds gibt es mehrere tausend Erzund Mineralgänge, wovon etwa 400-500 dieser Gänge zumindest zeitweise wirtschaftliche
Untersuchung der Absorption von Schwermetallen und Ammonium durch MAC
 Wolferner Analytik GmbH Untersuchung der Absorption von Schwermetallen und Ammonium durch MAC 1 Veröffentlichung 15.12.2004, Studie Zusammenfassung: Im Auftrag der ASTRA GmbH, einer Vorgesellschaft der
Wolferner Analytik GmbH Untersuchung der Absorption von Schwermetallen und Ammonium durch MAC 1 Veröffentlichung 15.12.2004, Studie Zusammenfassung: Im Auftrag der ASTRA GmbH, einer Vorgesellschaft der
Datierung mittels Ungleichgewichten der Uran-Zerfallsreihe Isotopengeochemie und Geochronologie
 Datierung mittels Ungleichgewichten der Uran-Zerfallsreihe Datierung mittels Ungleichgewichten der Uran-Zerfallsreihe Ionium Datierung von Eis 2 Möglichkeiten von Ungleichgewichten in den U-Zerfallsreihen:
Datierung mittels Ungleichgewichten der Uran-Zerfallsreihe Datierung mittels Ungleichgewichten der Uran-Zerfallsreihe Ionium Datierung von Eis 2 Möglichkeiten von Ungleichgewichten in den U-Zerfallsreihen:
Kristallhöhle Kobelwald
 Kristallhöhle Kobelwald Entdeckt im Jahre 1682. 1702 von Johann Jakob Scheuchzer erstmals in der Literatur erwähnt. Gesamtlänge der Höhle beträgt 665 m, davon sind 128 Meter ausgebaut und touristisch zugänglich
Kristallhöhle Kobelwald Entdeckt im Jahre 1682. 1702 von Johann Jakob Scheuchzer erstmals in der Literatur erwähnt. Gesamtlänge der Höhle beträgt 665 m, davon sind 128 Meter ausgebaut und touristisch zugänglich
Einführung in die Geowissenschaften I
 Einführung in die Geowissenschaften I Mineralogie Prof. Dr. K. Mengel und Dr. K.W. Strauß Fachgebiet Mineralogie, Geochemie, Salzlagerstätten Gliederung Seite Vorwort 2 1. Mineralogie nach äußeren Kennzeichen
Einführung in die Geowissenschaften I Mineralogie Prof. Dr. K. Mengel und Dr. K.W. Strauß Fachgebiet Mineralogie, Geochemie, Salzlagerstätten Gliederung Seite Vorwort 2 1. Mineralogie nach äußeren Kennzeichen
Über Lichtätzung des Silberglanzes
 Über Lichtätzung des Silberglanzes Autor(en): Objekttyp: Petrulian, Nikolaus Article Zeitschrift: Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilungen = Bulletin suisse de minéralogie et pétrographie
Über Lichtätzung des Silberglanzes Autor(en): Objekttyp: Petrulian, Nikolaus Article Zeitschrift: Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilungen = Bulletin suisse de minéralogie et pétrographie
Hagalis AG Kristallanalysen - Qualitätsprüfung Qualitätsberatung - Medizinische Diagnosen
 Hagalis AG Kristallanalysen - Qualitätsprüfung Qualitätsberatung - Medizinische Diagnosen Eulogiusstr. 8 88634 Herdwangen-Schönach Hagalis AG * Eulogiusstr. 8 * 88634 Herdwangen-Schönach Fläming Quellen
Hagalis AG Kristallanalysen - Qualitätsprüfung Qualitätsberatung - Medizinische Diagnosen Eulogiusstr. 8 88634 Herdwangen-Schönach Hagalis AG * Eulogiusstr. 8 * 88634 Herdwangen-Schönach Fläming Quellen
Vom Atombau zum Königreich der Elemente
 Vom Atombau zum Königreich der Elemente Wiederholung: Elektronenwellenfunktionen (Orbitale) Jedes Orbital kann durch einen Satz von Quantenzahlen n, l, m charakterisiert werden Jedes Orbital kann maximal
Vom Atombau zum Königreich der Elemente Wiederholung: Elektronenwellenfunktionen (Orbitale) Jedes Orbital kann durch einen Satz von Quantenzahlen n, l, m charakterisiert werden Jedes Orbital kann maximal
Anwendungsbeispiel Strahlensatz
 Anwendungsbeispiel Strahlensatz L5 Das berühmteste Beispiel der Proportionalität ist der Strahlensatz aus der Geometrie (siehe dazu auch Geometrie). Hier noch einmal die Hauptsätze des Strahlensatzes:
Anwendungsbeispiel Strahlensatz L5 Das berühmteste Beispiel der Proportionalität ist der Strahlensatz aus der Geometrie (siehe dazu auch Geometrie). Hier noch einmal die Hauptsätze des Strahlensatzes:
1. Einleitung. 2. Zielsetzung und Arbeitsmethoden
 Geo.Alp, Vol. 11 2014 85-102 Woher stammen die Kupfererze vom Fennhals (Kurtatsch, Südtirol)? Ein chemischer und mineralogischer Vergleich der Kupferschlacken mit ausgewählten Cu-führenden Erzvorkommen
Geo.Alp, Vol. 11 2014 85-102 Woher stammen die Kupfererze vom Fennhals (Kurtatsch, Südtirol)? Ein chemischer und mineralogischer Vergleich der Kupferschlacken mit ausgewählten Cu-führenden Erzvorkommen
Jungalpidische Erzmineralisationen in der Phyllitgneiszone des Arlberggebietes (Tirol/Vorarlberg)
 Mitt, österr. geol. Ges. 84 (1991) S. 39-64 5 Abb., Tab., 4 Taf. Wien, Juni 199 Jungalpidische Erzmineralisationen in der Phyllitgneiszone des Arlberggebietes (Tirol/Vorarlberg) Von J. G. HADITSCH und
Mitt, österr. geol. Ges. 84 (1991) S. 39-64 5 Abb., Tab., 4 Taf. Wien, Juni 199 Jungalpidische Erzmineralisationen in der Phyllitgneiszone des Arlberggebietes (Tirol/Vorarlberg) Von J. G. HADITSCH und
Innovative Gewinnung von Wertmetallen aus Halden des Mansfelder Kupferschiefers
 Projekt 11 A F Innovative Gewinnung von Wertmetallen aus Halden des Mansfelder Kupferschiefers Von einer vergessenen Ressource zur innovativen, nachhaltigen Nutzung deponierter Armerze Heterogene Erze
Projekt 11 A F Innovative Gewinnung von Wertmetallen aus Halden des Mansfelder Kupferschiefers Von einer vergessenen Ressource zur innovativen, nachhaltigen Nutzung deponierter Armerze Heterogene Erze
Kurzportraits wichtiger Metalle
 Kurzportraits wichtiger Metalle Edelmetalle - Gold - Silber - Platin Basismetalle - Aluminium - Kupfer - Blei - Zinn - Zink - Eisenerz Edelmetalle Die Notierung von Edelmetallen erfolgt in USD je Feinunze
Kurzportraits wichtiger Metalle Edelmetalle - Gold - Silber - Platin Basismetalle - Aluminium - Kupfer - Blei - Zinn - Zink - Eisenerz Edelmetalle Die Notierung von Edelmetallen erfolgt in USD je Feinunze
Grundlagen der Chemie Metalle
 Metalle Prof. Annie Powell KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Metalle 75% aller chemischen Elemente sind Metalle. Typische
Metalle Prof. Annie Powell KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Metalle 75% aller chemischen Elemente sind Metalle. Typische
Sachstandsinformation Gold in Sachsen
 Sachstandsinformation Gold in Sachsen Stand 06/2009 Gold in Sachsen weiter verbreitet, als man denkt! In der Natur tritt Gold nahezu ausschließlich in elementarer Form auf. Dies trifft auch für Sachsen
Sachstandsinformation Gold in Sachsen Stand 06/2009 Gold in Sachsen weiter verbreitet, als man denkt! In der Natur tritt Gold nahezu ausschließlich in elementarer Form auf. Dies trifft auch für Sachsen
Die 6. Hauptgruppe des Periodensystems der chemischen Elemente
 Die 6. Hauptgruppe des Periodensystems der chemischen Elemente Die 6. Hauptgruppe des Periodensystems umfaßt die Chalkogene (Erzbildner) Sauerstoff, Schwefel, Selen, Tellur und Polonium. Dieser Name leitet
Die 6. Hauptgruppe des Periodensystems der chemischen Elemente Die 6. Hauptgruppe des Periodensystems umfaßt die Chalkogene (Erzbildner) Sauerstoff, Schwefel, Selen, Tellur und Polonium. Dieser Name leitet
Vom Erz zum Stahl. Von Andre Hähnel & Tobias Bomkamp
 Vom Erz zum Stahl Von Andre Hähnel & Tobias Bomkamp Inhaltsverzeichnis Das Element Eisen Was ist eigentlich Erz? Herstellung von Roheisen Hochofenprozess Herstellung von Stahl Veredelung zum Stahl Eigenschaften
Vom Erz zum Stahl Von Andre Hähnel & Tobias Bomkamp Inhaltsverzeichnis Das Element Eisen Was ist eigentlich Erz? Herstellung von Roheisen Hochofenprozess Herstellung von Stahl Veredelung zum Stahl Eigenschaften
Baustofftechnologie Eine Einführung
 Baustofftechnologie Eine Einführung Thomas A. BIER Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik, Leipziger Straße 28, 09596 Freiberg, Baustofflehre 2010 Literatur Friedrich W. Locher, Zement Grundlagen
Baustofftechnologie Eine Einführung Thomas A. BIER Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik, Leipziger Straße 28, 09596 Freiberg, Baustofflehre 2010 Literatur Friedrich W. Locher, Zement Grundlagen
Thema: Chemische Bindungen Wasserstoffbrückenbindungen
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Thema: Chemische Bindungen Wasserstoffbrückenbindungen Wasserstoffbrückenbindungen, polare H-X-Bindungen, Wasser, Eigenschaften des Wassers, andere Vbg. mit H-Brücken
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Thema: Chemische Bindungen Wasserstoffbrückenbindungen Wasserstoffbrückenbindungen, polare H-X-Bindungen, Wasser, Eigenschaften des Wassers, andere Vbg. mit H-Brücken
1.11 Welcher Stoff ist es?
 L *** 1.11 Welcher Stoff ist es? Didaktisch-methodische Hinweise Im Arbeitsblatt wird der Versuch des Lösens von vier verschiedenen Salzen in Wasser in einem Labor beschrieben. Aus Zahlenangaben müssen
L *** 1.11 Welcher Stoff ist es? Didaktisch-methodische Hinweise Im Arbeitsblatt wird der Versuch des Lösens von vier verschiedenen Salzen in Wasser in einem Labor beschrieben. Aus Zahlenangaben müssen
Schwefelsäureherstellung
 Frederike Wolfering Anne Warrink Wolfering/Warrink 1 Inhalt Allgemeines Geschichte Herstellungsverfahren Großtechnische Herstellung Zusammenfassung Wolfering/Warrink 2 Allgemeines zur Schwefelsäure nach
Frederike Wolfering Anne Warrink Wolfering/Warrink 1 Inhalt Allgemeines Geschichte Herstellungsverfahren Großtechnische Herstellung Zusammenfassung Wolfering/Warrink 2 Allgemeines zur Schwefelsäure nach
Geotechnik 10 2 Gebirgseigenschaften
 10 2 Gebirgseigenschaften Felsmechanik 2.1 Entstehung der Gesteine 11 Bild 2.4: Benennen und Beschreiben der Gesteine (DIN 4022 Teil 1, Tab. 5) 12 2 Gebirgseigenschaften 2.2 Korngefüge Neben dem Mineralbestand
10 2 Gebirgseigenschaften Felsmechanik 2.1 Entstehung der Gesteine 11 Bild 2.4: Benennen und Beschreiben der Gesteine (DIN 4022 Teil 1, Tab. 5) 12 2 Gebirgseigenschaften 2.2 Korngefüge Neben dem Mineralbestand
Talk Apatit Feldspat Topas. Granat Halit Magnetit Turmalin Härte (Mohs): Härte (Mohs):
 Talk Apatit Feldspat Topas mittlere Volumen Lichtbrechung: Elementarzelle:.-. Talk ist das weichste Mineral, man kann es sogar mit dem Fingernagel ritzen. Zähne und Knochen des Körpers bestehen zu einem
Talk Apatit Feldspat Topas mittlere Volumen Lichtbrechung: Elementarzelle:.-. Talk ist das weichste Mineral, man kann es sogar mit dem Fingernagel ritzen. Zähne und Knochen des Körpers bestehen zu einem
Kunststoff Sortierung. Papier Sortierung. Glas Sortierung. Ihr Partner in den Bereichen: Sensorgestützte Sortiertechnik
 www.redwave.at Ihr Partner in den Bereichen: Kunststoff Sensorgestützte Sortiertechnik Papier REDWAVE ist ein Markenprodukt der BT-Wolfgang Binder GmbH, welches im Bereich der sensorgestützten Sortiertechnik
www.redwave.at Ihr Partner in den Bereichen: Kunststoff Sensorgestützte Sortiertechnik Papier REDWAVE ist ein Markenprodukt der BT-Wolfgang Binder GmbH, welches im Bereich der sensorgestützten Sortiertechnik
Die Standard Reduktions-Halbzellenpotentiale. Die Standard Reduktions. Wird die Halbzellenreaktion Zn 2+ /Zn gegen die Standard-Wassersoffelektrode
 Die Standard Reduktions Die Standard Reduktions-Halbzellenpotentiale Wird die Halbzellenreaktion Zn 2+ /Zn gegen die Standard-Wassersoffelektrode in einer galvanischen Zelle geschaltet, ergibt sich eine
Die Standard Reduktions Die Standard Reduktions-Halbzellenpotentiale Wird die Halbzellenreaktion Zn 2+ /Zn gegen die Standard-Wassersoffelektrode in einer galvanischen Zelle geschaltet, ergibt sich eine
Kontinentaldrift Abb. 1
 Kontinentaldrift Ausgehend von der Beobachtung, dass die Formen der Kontinentalränder Afrikas und Südamerikas fast perfekt zusammenpassen, entwickelte Alfred Wegener zu Beginn des 20. Jahrhunderts die
Kontinentaldrift Ausgehend von der Beobachtung, dass die Formen der Kontinentalränder Afrikas und Südamerikas fast perfekt zusammenpassen, entwickelte Alfred Wegener zu Beginn des 20. Jahrhunderts die
Neue Glaskeramiken mit negativer thermischer Ausdehnung im System BaO-Al 2 O 3 -B 2 O 3
 Neue Glaskeramiken mit negativer thermischer Ausdehnung im System BaO-Al 2 O 3 -B 2 O 3 Christian Rüssel Ralf Keding Diana Tauch Otto-Schott-Institut Universität Jena Glaskeramiken System BaO-Al 2 O 3
Neue Glaskeramiken mit negativer thermischer Ausdehnung im System BaO-Al 2 O 3 -B 2 O 3 Christian Rüssel Ralf Keding Diana Tauch Otto-Schott-Institut Universität Jena Glaskeramiken System BaO-Al 2 O 3
Gebrauchsanweisung für Lehrkräfte
 Materialien entwickelt und zusammengestellt von Claudia Holtermann, Geographielehrerin am Friedrich-Dessauer- Gymnasium in Aschaffenburg Gebrauchsanweisung für Lehrkräfte 1. Vor der Untersuchung der Gesteine
Materialien entwickelt und zusammengestellt von Claudia Holtermann, Geographielehrerin am Friedrich-Dessauer- Gymnasium in Aschaffenburg Gebrauchsanweisung für Lehrkräfte 1. Vor der Untersuchung der Gesteine
Ionenbindungen, Ionenradien, Gitterenergie, Born-Haber-Kreisprozess, Madelung-Konstante
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Ionenbindungen, Ionenradien, Gitterenergie, Born-Haber-Kreisprozess, Madelung-Konstante Thema heute: 1) Kovalente Gitter, 2) Metalle 280 Kovalente und molekulare
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Ionenbindungen, Ionenradien, Gitterenergie, Born-Haber-Kreisprozess, Madelung-Konstante Thema heute: 1) Kovalente Gitter, 2) Metalle 280 Kovalente und molekulare
Klausurarbeit Feste Mineralische Rohstoffe - Lagerstättenbildende Prozesse und Montangeologie Datum:
 Klausurarbeit Feste Mineralische Rohstoffe - Lagerstättenbildende Prozesse und Montangeologie Datum: Name:... Vorname:... Fachrichtung:... Matrikel-Nr.... Alle Angaben ohne Gewähr 1. Nennen Sie die beiden
Klausurarbeit Feste Mineralische Rohstoffe - Lagerstättenbildende Prozesse und Montangeologie Datum: Name:... Vorname:... Fachrichtung:... Matrikel-Nr.... Alle Angaben ohne Gewähr 1. Nennen Sie die beiden
Grundwassermodell. 4.2 Wasserkreislauf. Einführung: Wir alle kennen den Wasserkreislauf:
 4.2 Wasserkreislauf Einführung: Wir alle kennen den Wasserkreislauf: Regen fällt zu Boden... und landet irgendwann irgendwie wieder in einer Wolke, die einen schon nach ein paar Stunden, die anderen erst
4.2 Wasserkreislauf Einführung: Wir alle kennen den Wasserkreislauf: Regen fällt zu Boden... und landet irgendwann irgendwie wieder in einer Wolke, die einen schon nach ein paar Stunden, die anderen erst
ABFALLWIRTSCHAFT UND ABFALLENTSORGUNG
 ABFALLWIRTSCHAFT UND ABFALLENTSORGUNG Peter Lechner & Marion Huber-Humer MVA-Schlacke LVA-Nr. 813.100 & 101 Studienjahr 2011/2012 Studienjahr 2011/12 LVA 813.100 & 101 2 Stoffströme einer MVA Restabfall
ABFALLWIRTSCHAFT UND ABFALLENTSORGUNG Peter Lechner & Marion Huber-Humer MVA-Schlacke LVA-Nr. 813.100 & 101 Studienjahr 2011/2012 Studienjahr 2011/12 LVA 813.100 & 101 2 Stoffströme einer MVA Restabfall
Entsäuern und Entgiften mit Body Detox neueste wissenschaftliche Erkenntnisse
 Entsäuern und Entgiften mit Body Detox neueste wissenschaftliche Erkenntnisse Dr.Dr.med. Rainer Zierer Diplom Bio-Chemiker, Betriebsarzt und praktischer Arzt, München Physiko-chemische Schwermetallprovokation
Entsäuern und Entgiften mit Body Detox neueste wissenschaftliche Erkenntnisse Dr.Dr.med. Rainer Zierer Diplom Bio-Chemiker, Betriebsarzt und praktischer Arzt, München Physiko-chemische Schwermetallprovokation
Grenzwerte für die Annahme von Abfällen
 BGBl. II - Ausgegeben am 30. Jänner 2008 - Nr. 39 1 von 11 Allgemeines e für die Annahme von Abfällen Anhang 1 Für die Untersuchung und Beurteilung, ob die e gegebenenfalls nach Maßgabe des 8 eingehalten
BGBl. II - Ausgegeben am 30. Jänner 2008 - Nr. 39 1 von 11 Allgemeines e für die Annahme von Abfällen Anhang 1 Für die Untersuchung und Beurteilung, ob die e gegebenenfalls nach Maßgabe des 8 eingehalten
Mineralogische, geochemische und farbmetrische Untersuchungen an den Bankkalken des Malm 5 im Treuchtlinger Revier
 Erlanger Beitr.Petr. Min. 2 15-34 9 Abb., 5 Tab. Erlangen 1992 Mineralogische, geochemische und farbmetrische Untersuchungen an den Bankkalken des Malm 5 im Treuchtlinger Revier Von Frank Engelbrecht *)
Erlanger Beitr.Petr. Min. 2 15-34 9 Abb., 5 Tab. Erlangen 1992 Mineralogische, geochemische und farbmetrische Untersuchungen an den Bankkalken des Malm 5 im Treuchtlinger Revier Von Frank Engelbrecht *)
Einführung in die Kristallographie
 Einführung in die Kristallographie Gerhard Heide Institut für Mineralogie Professur für Allgemeine und Angewandte Mineralogie Brennhausgasse 14 03731-39-2665 oder -2628 gerhard.heide@mineral.tu-freiberg.de
Einführung in die Kristallographie Gerhard Heide Institut für Mineralogie Professur für Allgemeine und Angewandte Mineralogie Brennhausgasse 14 03731-39-2665 oder -2628 gerhard.heide@mineral.tu-freiberg.de
Bes e ucher he ber be gwe w r e k Gr ube ube Bend e i nd s i ber be g in i St. t Jo J st 16. März
 Besucherbergwerk Grube Bendisberg in St. Jost 16. März 2009 1 Themen Begrüßung Historie Geschichte Abbau Arbeiter Idee zur Eröffnung Begehung im Juni 2000 Eröffnung Cafe Bendisberg Ausbau zum Besucherbergwerk
Besucherbergwerk Grube Bendisberg in St. Jost 16. März 2009 1 Themen Begrüßung Historie Geschichte Abbau Arbeiter Idee zur Eröffnung Begehung im Juni 2000 Eröffnung Cafe Bendisberg Ausbau zum Besucherbergwerk
Leben mit KPU - Kryptopyrrolurie
 Leben mit KPU - Kryptopyrrolurie Ein Ratgeber für Patienten von Dr. Joachim Strienz 1. Auflage Leben mit KPU - Kryptopyrrolurie Strienz schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG
Leben mit KPU - Kryptopyrrolurie Ein Ratgeber für Patienten von Dr. Joachim Strienz 1. Auflage Leben mit KPU - Kryptopyrrolurie Strienz schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG
3.6 Phosphate der Strukturfamilie M 2 O(PO 4 ) 93
 3.6 Phosphate der Strukturfamilie M 2 O(PO 4 ) 93 Abbildung 3.29 Ti 5 O 4 (PO 4 ). ORTEP-Darstellung eines Ausschnitts der "Ketten" aus flächenverknüpften [TiO 6 ]-Oktaedern einschließlich der in der Idealstruktur
3.6 Phosphate der Strukturfamilie M 2 O(PO 4 ) 93 Abbildung 3.29 Ti 5 O 4 (PO 4 ). ORTEP-Darstellung eines Ausschnitts der "Ketten" aus flächenverknüpften [TiO 6 ]-Oktaedern einschließlich der in der Idealstruktur
Das Hyperdodekaeder. Einleitung
 geometricdesign Einleitung Die fünf Platonischen Körper können nach ihren Proportionen in zwei Gruppen eingeteilt werden: 1. Die Vertreter der mineralischen Natur sind Würfel, Oktaeder und Tetraeder. An
geometricdesign Einleitung Die fünf Platonischen Körper können nach ihren Proportionen in zwei Gruppen eingeteilt werden: 1. Die Vertreter der mineralischen Natur sind Würfel, Oktaeder und Tetraeder. An
Vom Quarz zum hochreinen Silicium
 Vom Quarz zum hochreinen Silicium Inhalt I. Vorkommen von Silicium II. Industrielle Verwendung III. Isolierung und Reinigung 1. Technische Darstellung 2. Reinstdarstellung 3. Einkristallzucht IV. Zusammenfassung
Vom Quarz zum hochreinen Silicium Inhalt I. Vorkommen von Silicium II. Industrielle Verwendung III. Isolierung und Reinigung 1. Technische Darstellung 2. Reinstdarstellung 3. Einkristallzucht IV. Zusammenfassung
Wie hoch ist der Kalkgehalt?
 Wie hoch ist der Kalkgehalt? Kurzinformation Um was geht es? Kalk ist sowohl ein Pflanzen- als auch ein Bodendünger. Kalk versorgt die Pflanzen mit dem Nährstoff Calcium. Gleichzeitig verbessert er die
Wie hoch ist der Kalkgehalt? Kurzinformation Um was geht es? Kalk ist sowohl ein Pflanzen- als auch ein Bodendünger. Kalk versorgt die Pflanzen mit dem Nährstoff Calcium. Gleichzeitig verbessert er die
Chemie für Geowissenschaftler. SSem Wiederholungsklausur. Datum
 Chemie für Geowissenschaftler SSem 2009 Wiederholungsklausur Datum 15.10.2009 Name: Vorname: Matr.-Nr.: Erreichte Punktzahl: 1. Am Ozeanboden wird Methangas durch sulfat-reduzierende Bakterien in Hydrogen-carbonat
Chemie für Geowissenschaftler SSem 2009 Wiederholungsklausur Datum 15.10.2009 Name: Vorname: Matr.-Nr.: Erreichte Punktzahl: 1. Am Ozeanboden wird Methangas durch sulfat-reduzierende Bakterien in Hydrogen-carbonat
a) 15 % von 300 ml = ml b) von 28 g = g c) 2 von 25 sind % Aufgabe 4: Terme berechnen (Rechenweg) a) (4 + 5)² b) 11² c) 23 + ( 4) = = =
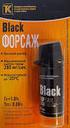 a) 6,3 kg = g b) 45 min = h c) 0,95 km = m d) 10,5 mm = cm a) 15 % von 300 ml = ml b) von 28 g = g c) 2 von 25 sind % a) (4 + 5)² + 6 7 b) 11² 2 + 11 c) 23 + ( 4) Aufgabe 5: Körper (Rechenweg) a) Berechne
a) 6,3 kg = g b) 45 min = h c) 0,95 km = m d) 10,5 mm = cm a) 15 % von 300 ml = ml b) von 28 g = g c) 2 von 25 sind % a) (4 + 5)² + 6 7 b) 11² 2 + 11 c) 23 + ( 4) Aufgabe 5: Körper (Rechenweg) a) Berechne
Periodensystem. Physik und Chemie. Sprachkompendium und einfache Regeln
 Periodensystem Physik und Chemie Sprachkompendium und einfache Regeln 1 Begriffe Das (neutrale) Wasserstoffatom kann völlig durchgerechnet werden. Alle anderen Atome nicht; ein dermaßen komplexes System
Periodensystem Physik und Chemie Sprachkompendium und einfache Regeln 1 Begriffe Das (neutrale) Wasserstoffatom kann völlig durchgerechnet werden. Alle anderen Atome nicht; ein dermaßen komplexes System
High-Tech in der Gemmologie
 High-Tech in der Gemmologie Schmucktechnologische Institut Februar 2014 Die klassischen gemmologischen Untersuchungsmethoden für Edelsteine sind: Lupe Polariskop Refraktometer Dichroskop Hydrostatische
High-Tech in der Gemmologie Schmucktechnologische Institut Februar 2014 Die klassischen gemmologischen Untersuchungsmethoden für Edelsteine sind: Lupe Polariskop Refraktometer Dichroskop Hydrostatische
EP A2 (19) (11) EP A2 (12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG. (43) Veröffentlichungstag: Patentblatt 2008/52
 (19) (12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG (11) EP 2 006 8 A2 (43) Veröffentlichungstag: 24.12.08 Patentblatt 08/2 (1) Int Cl.: B41F 33/00 (06.01) (21) Anmeldenummer: 08011226.1 (22) Anmeldetag:.06.08 (84)
(19) (12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG (11) EP 2 006 8 A2 (43) Veröffentlichungstag: 24.12.08 Patentblatt 08/2 (1) Int Cl.: B41F 33/00 (06.01) (21) Anmeldenummer: 08011226.1 (22) Anmeldetag:.06.08 (84)
Ausführung potentiometrischer Analysen
 Ausführung potentiometrischer Analysen nebst vollständigen Analysenvorschriften für technische Produkte Von Dr. Werner Hiltner Breslau Einleitung 1 Allgemeiner Teil. A. Grundlagen der potentiometrischen
Ausführung potentiometrischer Analysen nebst vollständigen Analysenvorschriften für technische Produkte Von Dr. Werner Hiltner Breslau Einleitung 1 Allgemeiner Teil. A. Grundlagen der potentiometrischen
Allgemeine Pathologie. Störungen im Kupfer- Stoffwechsel
 Allgemeine Pathologie Störungen im Kupfer- Stoffwechsel Physiologie (1): - das Übergangsmetall Kupfer ist als essentielles Spurenelement Bestandteil einer Reihe wichtiger Enzyme: - Ferro-oxidase I (Coeruloplasmin),
Allgemeine Pathologie Störungen im Kupfer- Stoffwechsel Physiologie (1): - das Übergangsmetall Kupfer ist als essentielles Spurenelement Bestandteil einer Reihe wichtiger Enzyme: - Ferro-oxidase I (Coeruloplasmin),
Grundlagen der Festkörperchemie
 Grundlagen der Festkörpercheie 1. Der feste Aggregatzustand Aggregatzustand Beständigkeit Ordnung Voluen For gas (g) - - - flüssig (l) + - Teilordnung fest (s) + + + akroskopisch subikrokopisch - ideales
Grundlagen der Festkörpercheie 1. Der feste Aggregatzustand Aggregatzustand Beständigkeit Ordnung Voluen For gas (g) - - - flüssig (l) + - Teilordnung fest (s) + + + akroskopisch subikrokopisch - ideales
WESTKALK Vereinigte Warsteiner Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG Kreisstr Warstein-Suttrop
 Institut für Kalk- und Mörtelforschung e.v. Annastrasse 67-71 50968 Köln D CLJ ~RSCHUNG Telefon: +49 (0) 22 1 / 93 46 74-72 Telefax: +49 (0) 22 1/9346 74-14 Datum: 08.06.2016- Ho/AB Prüfbericht: 37111200416114
Institut für Kalk- und Mörtelforschung e.v. Annastrasse 67-71 50968 Köln D CLJ ~RSCHUNG Telefon: +49 (0) 22 1 / 93 46 74-72 Telefax: +49 (0) 22 1/9346 74-14 Datum: 08.06.2016- Ho/AB Prüfbericht: 37111200416114
Metalle. Dieses Skript gehört
 Metalle Metalle prägen unseren Alltag. Doch wo kommen sie eigentlich her und wofür werden sie verwendet? Metalle werden aus Erzen gewonnen. Das sind Mineralien, die in der Erdkruste enthalten sind. Die
Metalle Metalle prägen unseren Alltag. Doch wo kommen sie eigentlich her und wofür werden sie verwendet? Metalle werden aus Erzen gewonnen. Das sind Mineralien, die in der Erdkruste enthalten sind. Die
2.4 Metallische Bindung und Metallkristalle. Unterteilung in Metalle, Halbmetalle, Nicht metalle. Li Be B C N O F. Na Mg Al Si P S Cl
 2.4 Metallische Bindung und Metallkristalle Li Be B C N O F Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ga Ge As Se Br Rb Sr In Sn Sb Te I Cs Ba Tl Pb Bi Po At Unterteilung in Metalle, Halbmetalle, Nicht metalle Metalle etwa
2.4 Metallische Bindung und Metallkristalle Li Be B C N O F Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ga Ge As Se Br Rb Sr In Sn Sb Te I Cs Ba Tl Pb Bi Po At Unterteilung in Metalle, Halbmetalle, Nicht metalle Metalle etwa
Tabelle spezifischer Gewichte der gebräuchlichsten Gold- Silber-Kupfer-Legierungen Silber-Kupfer-Legierungen und Weißgoldlegierungen
 Tabelle spezifischer Gewichte der gebräuchlichsten Gold- Silber-Kupfer-Legierungen Silber-Kupfer-Legierungen und Weißgoldlegierungen Durch Untersuchung festgestellt von Dipl.-Ing. F. Michel Direktor der
Tabelle spezifischer Gewichte der gebräuchlichsten Gold- Silber-Kupfer-Legierungen Silber-Kupfer-Legierungen und Weißgoldlegierungen Durch Untersuchung festgestellt von Dipl.-Ing. F. Michel Direktor der
Mentoring zu Wie schreibe ich ein Exkursionsprotokoll? Kathrin Schneider geow-mentorat@uni-bonn.de
 Mentoring zu Wie schreibe ich ein Exkursionsprotokoll? Kathrin Schneider geow-mentorat@uni-bonn.de Gliederung Titelseite Inhaltsverzeichnis Ggf. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis Regionalgeologischer
Mentoring zu Wie schreibe ich ein Exkursionsprotokoll? Kathrin Schneider geow-mentorat@uni-bonn.de Gliederung Titelseite Inhaltsverzeichnis Ggf. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis Regionalgeologischer
Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Sehschädigung an Regelschulen. Didaktikpool
 Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Sehschädigung an Regelschulen Didaktikpool Periodensystem der Elemente für blinde und hochgradig sehgeschädigte Laptop-Benutzer Reinhard Apelt 2008 Technische
Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Sehschädigung an Regelschulen Didaktikpool Periodensystem der Elemente für blinde und hochgradig sehgeschädigte Laptop-Benutzer Reinhard Apelt 2008 Technische
GDOES-Treffen Berlin 2008. Sputterprozess und Kristallorientierung
 GDOES-Treffen Berlin 2008 Sputterprozess und Kristallorientierung Die folgenden drei Folien zeigen, daß bei polykristallinen Materialien kein mehr oder weniger gleichmäßiger Sputterangriff beobachtet werden
GDOES-Treffen Berlin 2008 Sputterprozess und Kristallorientierung Die folgenden drei Folien zeigen, daß bei polykristallinen Materialien kein mehr oder weniger gleichmäßiger Sputterangriff beobachtet werden
Text Anhang 1. Grenzwerte für die Annahme von Abfällen
 Kurztitel Deponieverordnung 2008 Kundmachungsorgan BGBl. II Nr. 39/2008 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 104/2014 /Artikel/Anlage Anl. 1 Inkrafttretensdatum 01.06.2014 Text Anhang 1 Allgemeines e für
Kurztitel Deponieverordnung 2008 Kundmachungsorgan BGBl. II Nr. 39/2008 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 104/2014 /Artikel/Anlage Anl. 1 Inkrafttretensdatum 01.06.2014 Text Anhang 1 Allgemeines e für
Einführung in die Geowissenschaften I
 Einführung in die Geowissenschaften I Mineralogie Prof. Dr. K. Mengel und Dr. K.W. Strauß Fachgebiet Mineralogie, Geochemie, Salzlagerstätten Gliederung Seite Vorwort 2 1. Mineralogie nach äußeren Kennzeichen
Einführung in die Geowissenschaften I Mineralogie Prof. Dr. K. Mengel und Dr. K.W. Strauß Fachgebiet Mineralogie, Geochemie, Salzlagerstätten Gliederung Seite Vorwort 2 1. Mineralogie nach äußeren Kennzeichen
Mit dem Helikopter in die Römerzeit Luftbildprospektion in Augusta Raurica
 Mit dem Helikopter in die Römerzeit Luftbildprospektion in Augusta Raurica Der heisse Sommer 2015 mit seiner langanhaltenden Trockenheit hinterliess auch auf den Wiesen und Ackerflächen in und um Augusta
Mit dem Helikopter in die Römerzeit Luftbildprospektion in Augusta Raurica Der heisse Sommer 2015 mit seiner langanhaltenden Trockenheit hinterliess auch auf den Wiesen und Ackerflächen in und um Augusta
Wie kommen Metalle vor? CaO, MgO, Al 2 O 3, CaCO 3, CaSO 4 vs. Cu 2 S, HgS, PbS. Welche Kombinationen führen zu hohen Oxidationsstufen?
 HSAB-Prinzip Wie kommen Metalle vor? CaO, MgO, Al 2 O 3, CaCO 3, CaSO 4 vs. Cu 2 S, HgS, PbS Welche Kombinationen führen zu hohen Oxidationsstufen? XeO 6 4, ClO 4, MnO 4, MnS 4, ClS 4 Warum entsteht der
HSAB-Prinzip Wie kommen Metalle vor? CaO, MgO, Al 2 O 3, CaCO 3, CaSO 4 vs. Cu 2 S, HgS, PbS Welche Kombinationen führen zu hohen Oxidationsstufen? XeO 6 4, ClO 4, MnO 4, MnS 4, ClS 4 Warum entsteht der
Helmut Schrecke Karl-Ludwig Weiner. Mineralogie. Ein Lehrbuch auf systematischer Grundlage W DE. Walter de Gruyter Berlin New York 1981
 Helmut Schrecke Karl-Ludwig Weiner Mineralogie Ein Lehrbuch auf systematischer Grundlage W DE G Walter de Gruyter Berlin New York 1981 Inhalt Einführung 1. Mineral, Kristall, Gestein 1 2. Einige Bemerkungen
Helmut Schrecke Karl-Ludwig Weiner Mineralogie Ein Lehrbuch auf systematischer Grundlage W DE G Walter de Gruyter Berlin New York 1981 Inhalt Einführung 1. Mineral, Kristall, Gestein 1 2. Einige Bemerkungen
LV Mikroskopie I Kurs 7 1/7. Calcische-Amphibole (Ca >Na): Tremolit-Ferroaktinolit-Reihe, Hornblende, Kärsutit etc.
 LV 620.108 Mikroskopie I Kurs 7 1/7 Amphibole Inosilikate (Bandsilikate; abgeleitet von der [Si 4 O 11 -Doppelkette]. Es lassen sich zahlreiche Mischungsreihen unterscheiden. Allgemeine Formel der Amphibole
LV 620.108 Mikroskopie I Kurs 7 1/7 Amphibole Inosilikate (Bandsilikate; abgeleitet von der [Si 4 O 11 -Doppelkette]. Es lassen sich zahlreiche Mischungsreihen unterscheiden. Allgemeine Formel der Amphibole
4. Teil: Die Eifel nach einer kosmischen Katastrophe
 4. Teil: Die Eifel nach einer kosmischen Katastrophe In drei kleinen Aufsätzen habe ich schon die Geschehnisse angesprochen, die vermutlich die Maarbildung in der Eifel ausgelöst haben. In einem dieser
4. Teil: Die Eifel nach einer kosmischen Katastrophe In drei kleinen Aufsätzen habe ich schon die Geschehnisse angesprochen, die vermutlich die Maarbildung in der Eifel ausgelöst haben. In einem dieser
Untersuchung von Alterungseffekten bei monokristallinen PV-Modulen mit mehr als 15 Betriebsjahren durch Elektrolumineszenz- und Leistungsmessungen
 Untersuchung von Alterungseffekten bei monokristallinen PV-Modulen mit mehr als 15 Betriebsjahren durch Elektrolumineszenz- und Leistungsmessungen Katharina Schulze*, Manfred Groh*, Monika Nieß*, Christian
Untersuchung von Alterungseffekten bei monokristallinen PV-Modulen mit mehr als 15 Betriebsjahren durch Elektrolumineszenz- und Leistungsmessungen Katharina Schulze*, Manfred Groh*, Monika Nieß*, Christian
Praktikum Materialwissenschaft II. Wärmeleitung
 Praktikum Materialwissenschaft II Wärmeleitung Gruppe 8 André Schwöbel 1328037 Jörg Schließer 1401598 Maximilian Fries 1407149 e-mail: a.schwoebel@gmail.com Betreuer: Markus König 21.11.2007 Inhaltsverzeichnis
Praktikum Materialwissenschaft II Wärmeleitung Gruppe 8 André Schwöbel 1328037 Jörg Schließer 1401598 Maximilian Fries 1407149 e-mail: a.schwoebel@gmail.com Betreuer: Markus König 21.11.2007 Inhaltsverzeichnis
Thema heute: Grundlegende Ionenstrukturen
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde Einfache Metallstrukturen, Dichtestpackung von "Atomkugeln", N Oktaeder-, 2N Tetraederlücken, Hexagonal-dichte Packung, Schichtfolge ABAB, hexagonale Elementarzelle,
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde Einfache Metallstrukturen, Dichtestpackung von "Atomkugeln", N Oktaeder-, 2N Tetraederlücken, Hexagonal-dichte Packung, Schichtfolge ABAB, hexagonale Elementarzelle,
GOLDVORKOMMEN IN DER SCHWEIZ
 Goldvorkommen in der Schweiz 7 GOLDVORKOMMEN IN DER SCHWEIZ Peter Pfander Die Goldvorkommen in der Schweiz Goldfunde sind in der Schweiz an sehr vielen Orten möglich (Abbildung 1). Manchmal sind es nur
Goldvorkommen in der Schweiz 7 GOLDVORKOMMEN IN DER SCHWEIZ Peter Pfander Die Goldvorkommen in der Schweiz Goldfunde sind in der Schweiz an sehr vielen Orten möglich (Abbildung 1). Manchmal sind es nur
Forschungsaufträge «BodenSchätzeWerte Unser Umgang mit Rohstoffen»
 Forschungsaufträge «BodenSchätzeWerte Unser Umgang mit Rohstoffen» Altersstufe Geeignet für 9- bis 14-Jährige. Konzept Die Forschungsaufträge laden ein, die Sonderausstellung von focusterra im Detail selbständig
Forschungsaufträge «BodenSchätzeWerte Unser Umgang mit Rohstoffen» Altersstufe Geeignet für 9- bis 14-Jährige. Konzept Die Forschungsaufträge laden ein, die Sonderausstellung von focusterra im Detail selbständig
Eigenschaften der Elemente der 16. Gruppe
 Eigenschaften der Elemente der 16. Gruppe Vorkommen: S_Schwefel elementar Sulfate CaSO 4, BaSO 4, Sulfide Kiese (z.b. FeS 2 ) Glanze (z.b. PbS) Blenden (z.b. ZnS) in Erdöl, Erdgas; in Steinkohle Kokereigas
Eigenschaften der Elemente der 16. Gruppe Vorkommen: S_Schwefel elementar Sulfate CaSO 4, BaSO 4, Sulfide Kiese (z.b. FeS 2 ) Glanze (z.b. PbS) Blenden (z.b. ZnS) in Erdöl, Erdgas; in Steinkohle Kokereigas
Stand der Untersuchungen
 Stand der Untersuchungen Durchgeführte Arbeiten Erhebung des Ist-Zustandes / Aktualisierung 2004 Variantenvergleich Derzeit in Bearbeitung Auswirkungsanalyse Maßnahmenvorschläge Ist Zustand Wald Hochwertige
Stand der Untersuchungen Durchgeführte Arbeiten Erhebung des Ist-Zustandes / Aktualisierung 2004 Variantenvergleich Derzeit in Bearbeitung Auswirkungsanalyse Maßnahmenvorschläge Ist Zustand Wald Hochwertige
Die Lösungen findest du an den jeweiligen Stationen.
 Außerschulische Lernorte in Thüringen Im Grottoneum findest du 22 Mitmach- und Wissensstationen. Diese sind alle durch eine kleine Fledermaus namens Fledi gekennzeichnet. Folge Fledi durch das Grottoneum
Außerschulische Lernorte in Thüringen Im Grottoneum findest du 22 Mitmach- und Wissensstationen. Diese sind alle durch eine kleine Fledermaus namens Fledi gekennzeichnet. Folge Fledi durch das Grottoneum
Zur Veröffentlichung am 3.3. in der Oberurseler Woche Oberursel, den 21. Februar 2016 ===========================================
 Zur Veröffentlichung am 3.3. in der Oberurseler Woche Oberursel, den 21. Februar 2016 =========================================== Antwort von Horst Siegemund zur Goldgrube im Taunus Preisfrage: Wer hatte
Zur Veröffentlichung am 3.3. in der Oberurseler Woche Oberursel, den 21. Februar 2016 =========================================== Antwort von Horst Siegemund zur Goldgrube im Taunus Preisfrage: Wer hatte
Unsere Planeten. Kein Planet gleicht einem anderen Planeten. Kein Mond gleicht genau dem eines anderen Planeten.
 Unsere Planeten Um unsere Sonne kreisen 9 Planeten und um manche von diesen kreisen Monde, so wie unser Mond um den Planeten Erde kreist. Außerdem kreisen noch Asteroide und Kometen um die Sonne. Fünf
Unsere Planeten Um unsere Sonne kreisen 9 Planeten und um manche von diesen kreisen Monde, so wie unser Mond um den Planeten Erde kreist. Außerdem kreisen noch Asteroide und Kometen um die Sonne. Fünf
aktuelle Aktivitäten zu Ihrer Nutzung Bernhard Cramer Sächsisches Oberbergamt, Freiberg
 Metalle und Spate in Sachsen aktuelle Aktivitäten zu Ihrer Nutzung Bernhard Cramer Sächsisches Oberbergamt, Freiberg Bergbauland Sachsen Gewinnungsbetriebe unter Bergaufsicht Bergbauland Sachsen Förderung
Metalle und Spate in Sachsen aktuelle Aktivitäten zu Ihrer Nutzung Bernhard Cramer Sächsisches Oberbergamt, Freiberg Bergbauland Sachsen Gewinnungsbetriebe unter Bergaufsicht Bergbauland Sachsen Förderung
Polarisationsapparat
 1 Polarisationsapparat Licht ist eine transversale elektromagnetische Welle, d.h. es verändert die Länge der Vektoren des elektrischen und magnetischen Feldes. Das elektrische und magnetische Feld ist
1 Polarisationsapparat Licht ist eine transversale elektromagnetische Welle, d.h. es verändert die Länge der Vektoren des elektrischen und magnetischen Feldes. Das elektrische und magnetische Feld ist
Aus welchem Material besteht der Turiner Lagerstättenpapyrus? a. Stoff b. Stein c. Papier d. Papyrus
 Der Turiner Lagerstättenpapyrus Fragen für Einsteiger Aus welchem Material besteht der Turiner Lagerstättenpapyrus? a. Stoff b. Stein c. Papier d. Papyrus Was ist auf dem Turiner Lagerstättenpapyrus abgebildet?
Der Turiner Lagerstättenpapyrus Fragen für Einsteiger Aus welchem Material besteht der Turiner Lagerstättenpapyrus? a. Stoff b. Stein c. Papier d. Papyrus Was ist auf dem Turiner Lagerstättenpapyrus abgebildet?
Erkunder-Simulation. Realitätsnahe Übungen mit dem ABC-Erkunder. Beispiele für die Einstellung von Ausbreitungen
 Erkunder-Simulation Realitätsnahe Übungen mit dem ABC-Erkunder Beispiele für die Einstellung von Ausbreitungen Inhalt Einfache Ausbreitungsfahne...5 Ablenkung einer Ausbreitungsfahne...5 Durchzug einer
Erkunder-Simulation Realitätsnahe Übungen mit dem ABC-Erkunder Beispiele für die Einstellung von Ausbreitungen Inhalt Einfache Ausbreitungsfahne...5 Ablenkung einer Ausbreitungsfahne...5 Durchzug einer
Einführung in die Labormethoden (Mineralogie u. Petrologie)
 Einführung in die Labormethoden (Mineralogie u. Petrologie) Kurt Krenn 14. Dezember 2010 Einführung in die Labormethoden 1 Struktur der LV: 2 bis 3 Einheiten zur theoretischen Vorbildung Teil I: Schliffherstellung
Einführung in die Labormethoden (Mineralogie u. Petrologie) Kurt Krenn 14. Dezember 2010 Einführung in die Labormethoden 1 Struktur der LV: 2 bis 3 Einheiten zur theoretischen Vorbildung Teil I: Schliffherstellung
