Geschichte der Philosophie II Mittelalter und frühe Neuzeit XII
|
|
|
- Eike Krüger
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Geschichte der Philosophie II Mittelalter und frühe Neuzeit XII
2 Mittelalter XII 02
3 Mittelalter XII 02
4 Verurteilungen des Aristotelismus Seit 1210 (Pariser Synode) mehrfach erneuerte Verbote, die Naturphilosophie des Aristoteles an der Artistenfakultät zu lehren. Dennoch werden 1255 an der Pariser Artistenfakultät die Schriften des Aristoteles (Logik, Metaphysik, Ethik, De anima, Physik) als Lehrbücher eingeführt. Der Streit um Aristoteles wird zu einem Streit um die Autonomie der Artistenfakultät und Philosophie von der Theologischen Fakultät, den Étienne Tempier, von 1268 bis zu seinem Tod 1279 Bischof von Paris, zugunsten des kirchlichen Lehramts zu entscheiden sucht, indem er 1210 die folgenden 13 Thesen bei Strafe der Exkommunikation verurteilt: 1. Daß der Intellekt aller Menschen ein und derselbe ist an Zahl. [im Jahr 1277 verurteilte These: 32] 2. Daß Folgendes falsch oder uneigentlich (gesagt) ist: Ein Mensch versteht. [14 Daß man vom Menschen in demselben Sinne sagt, er denke, wie man vom Himmel sagt, er denke oder lebe oder bewege sich, d.h. daß der Urheber dieser Tätigkeiten mit ihm wie der Beweger mit dem Bewegten vereint ist, aber nicht wesenhaft (quia agens istas actiones est ei unitum ut motor mobili, et non substantialiter)] 3. Daß der Wille des Menschen aus Zwang will oder wählt. [133, 162, 194] 4. Daß alles, was hier auf Erden geschieht, dem Zwang von Himmelskörpern unterliegt. [133, 162, 195, 206, 207] 5. Daß die Welt ewig ist. [87, 89, 90, 98, 107, 202, 203] 6. Daß es niemals einen ersten Menschen gegeben hat. [9] 7. Daß die Seele vergehe, wenn der Körper vergeht. [17, 18, 116] 8. Daß die nach dem Tode abgetrennte Seele nicht unter körperlichem Feuer leidet. [19] 9. Daß der freie Wille ein passives, nicht aktives Vermögen ist und daß er durch Zwang von dem, was er erstrebt, bewegt wird. [134, 135, 136, 164, 194] 10. Daß Gott nicht Einzeldinge erkennt. [56] 11. Daß Gott nicht von sich anderes erkennt. [3] 12. Daß menschliche Handlungen nicht durch göttliche Vorsehung geleitet werden. [195] 13. Daß Gott nicht Unsterblichkeit oder Unvergänglichkeit einer sterblichen oder vergänglichen Sache geben kann. [25] (zit. nach A. Läpple, Kirchengeschichte in Dokumenten, Düsseldorf 1967, 124) Mittelalter XII 03
5 Verurteilungen von 1277 Kurt Walter Zeidler Philosophie des Mittelalters 1277 wird Tempier von Papst Johannes XXI. [Petrus Hispanus] beauftragt, den Berichten über Irrlehren an der Universität Paris nachzugehen. Nach Einsetzung einer Theologenkommission veröffentlicht Tempier am 7. März 1277 ein Dekret mit 219 Meinungen (opiniones) des Siger von Brabant, Boetius von Dacien und anderer, von denen sie die Formulierung findet sich bereits in der Verurteilung von 1270 behaupteten, diese Irrlehren seien wahr gemäß der Philosophie, aber nicht gemäß dem katholischen Glauben, gleichsam als gebe es zwei entgegengesetzte Wahrheiten (esse vera secundum philosophiam, sed non secundum fidem catholicam, quasi sint duae contrariae veritates) und als sei im Widerspruch zur Wahrheit der Hl. Schriften Wahrheit in den Sätzen verdammter Heiden Einige provokante Thesen: 152. Daß die Reden der Theologen in Fabeln gründen (Quod sermones theologi fundati sunt in fabulis) Daß die Weisen der Welt nur die Philosophen sind (Quod sapientes mundi sunt philosophi tantum) Daß die völlige geschlechtliche Enthaltsamkeit die Tugend und die [menschliche] Art korrumpiert (Quod perfecta abstinentia ab actu carnis corrumpit virtutem et speciem) Daß das christliche Gesetz den Fortschritt des Wissens behindert (Quod lex christiana impedit addiscere) Daß die Glückseligkeit in diesem Leben, nicht in einem anderen besessen wird (Quod felicitas habetur in ista vita, et non in alia). Von der Verurteilung betroffen ist aber auch die Individuationslehre des Thomas von Aquin: 191. Quod formae non recipiunt divisionem, nisi per materiam. (vgl. Thesen 81, 96) Weitere thomistische Lehren, vor allem die Lehre von der Einheit der Lebensform im Menschen: die einzige substantiale Form im Menschen ist allein die Geistseele (anima intellectiva), denn wie sie in ihrer Kraft die sensitive und die vegetative Seele enthält, enthält sie auch alle niedrigeren Formen; und sie allein wirkt alles, was die unvollkommeneren Formen in anderen Seienden wirken. (STh I 76, 4), sind von dem Lehrverbot von 30 Thesen betroffen, das der Erzbischof von Canterbury, Robert Kilwardby, am 18. März 1277 erteilt: (4); item quod intellectiva introducta corrumpitur sensitiva et vegetativa (7); item quod vegetativa, sensitiva et intellectiva sint una forma simplex Mittelalter XII 04
6 Radikaler Aristotelismus (»Averroismus«) Sigerus de Brabantia/Siger von Brabant (ca. 1235/1240 ca. 1280) Quaestio 9. Ob Ein Geist in Allen sei (Utrum sit unus intellectus in omnibus)? 2. Es scheint, daß es nur einen Geist in allen [Menschen] gibt (Quod sit unus intellectus in omnibus videtur). Keine immaterielle Form, die der Art nach eine ist, wird der Zahl nach vervielfältigt. Der Geist ist aber eine imaterielle Form und der Art nach einer. Also ist er nicht der Zahl nach mehrere. 19. [ ] der Geist ist der Beweger des Menschen erst nach der Aufnahme der vorgestellten Intentionen, nicht aber seiner Substanz nach. 20. Ebenso dazu: soweit er Beweger ist, ist er nicht Einer, sondern vervielfältigt; somit ist der spekulative Geist in einem bestimmten Menschen vergänglich, er selbst jedoch ist einfach und ewig, wie Averroes sagt (Item adhuc: eo modo quo est motor, eo modo non est unus, sed multiplicatus; unde intellectus speculativus in hoc homine est corruptibilis, est tamen secundum se et simpliciter aeternus, ut dicit Averroes). (Siger von Brabant, Quaestiones in Tertium de Anima 9) Thomas Aquinas, De unitate intellectus contra Averroistas (1270) Auch ist offenkundig, daß dieser einzelne Mensch denkt (Manifestum est enim quod hic homo singularis intelligit): niemals würden wir nämlich nach dem Geist (intellectus) fragen, wenn wir nicht dächten (nisi intelligeremus); wie wir auch mit Bezug auf den Geist nach keinem anderen Prinzip fragen, als nach dem, durch das wir denken. (nr. 216) Mittelalter XII 05
7 Raimundus Lullus/Ramon Llull Raimundus Lullus ( ) «Doctor illuminatus» Geb. in Palma de Mallorca 1265 aufgrund einer Vision Eintritt in den 3. Orden der Franziskaner 3 Missionsreisen nach Nordafrika Gest in Palma Werke Ars compendiosa inveniendi Ars generalis ultima (Ars Magna) Ars brevis (1308) Raimundus Lullus Fig. 1 der Ars Magna Wir verwenden in dieser Ars ein Alphabet, um mit seine Hilfe Figuren zu bilden und Prinzipien und Regeln zu verknüpfen, mit dem Ziel die Wahrheit zu erforschen. (Ars brevis (lat.-dt.), übers. und hg. von A. Fidora, Hamburg 1999, 5) Mittelalter XII 06
8 Johannes Duns Scotus ( ) «Doctor subtilis» Geb. in Duns/Schottland um 1280 Eintritt in den Franziskanerorden 1291 Priesterweihe, Studium in Oxford Lehrt in Oxford und Cambridge ab 1302 in Paris und ab 1307 in Köln Gest in Köln Werke Opera Omnia, ed. L. Wadding, 12 Bde. Lyon 1639 u.ö. Opera Omnia, dzt. 16 Bde., Vatican 1950ff. Die Univozität des Seienden. Texte zur Metaphysik, Hg. T. Hoffmann, Göttingen Duns Scotus Justus van Gent (15. Jhd.) streng verstandene Wissenschaft erfüllt vier Bedingungen (scientia stricte sumpta quattuor includit), nämlich: daß sie sichere Erkenntnis sei, ohne Täuschung und Zweifel (quod sit cognitio certa, absque deceptione et dubitatione); zweitens, daß sie Erkenntnis von Notwendigem sei (quod sit de cognitio necessario); drittens, daß sie verursacht sei durch eine dem Geist evidente Ursache (quod sit causata a causa evidente intellectui); viertens, daß sie dem Wissen vermittelt sei durch den Syllogismus oder schlußfolgernden Diskurs (quod sit applicata ad cognitum per syllogismum vel discursum syllogisticum). (Ordinatio: prologus p. 4 q. 1-2 n. 208) Mittelalter XII 07
9 Johannes Duns Scotus ( ) «Doctor subtilis» Ordinatio I (Ordinatio=Commentaria Oxoniensia ad IV. libros Magistri Sententiarum) Distinctio Tertia Pars prima: De cognoscibilitate Dei q. 3: Utrum Deus sit primum obiectum naturale adaequatum respectu intellectus viatoris Was ist das erste Objekt des Geistes (primum obiectum intellectus)? Bezüglich dieser Frage gibt es eine Meinung [Thomas von Aquin], die besagt, das erste Objekt unseres Geistes sei die Wesenheit eines materiellen Dinges (In ista quaestione est una opinio quae dicit quod primum obiectum intellectus nostri est quiditas rei materialis). (Ordinatio I, dist. 3, p. 1, q. 3, n. 110; vgl. 124) Contra: dieses ist für den Theologen nicht haltbar, weil der Geist, der in seinem Bestehen natürlicherweise über ein und dasselbe Vermögen verfügt, durch eigene Kraft die Wesenheit der immateriellen Substanzen erkennt, wie das offenkundig dem Glauben zufolge für die glückselige Seele gilt (Contra: istud non potest sustineri a theologo, quia intellectus, exsistens eadem potentia naturaliter, cognoscet per se quiditatem substantiae immaterialis, sicut patet secundum fidem de anima beata). Ein Vermögen aber das ein und dasselbe bleibt, kann nicht aktual etwas erkennen, das nicht unter seinem ersten Objekt enthalten ist (Potentia autem manens eadem non potest habere actum circa aliquid quod non continetur sub suo primo obiecto). (ebd. n. 113) der Geist erkennt jegliches unter einem umfassenderen Aspekt als dem des Vorstellbaren, weil er jegliches unter dem Aspekt des Seienden im allgemeinen erkennt, andernfalls die Metaphysik gar keine Wissenschaft für unseren Geist wäre (intellectus cognoscit aliquid sub ratione communiore quam sit ratio imaginabilis, quia cognoscit aliquid sub ratione entis in communi, alioquin metaphysica nulla esset scientia intellectui nostro) (ebd. n. 117) Mittelalter XII 08
10 Johannes Duns Scotus ( ) «Doctor subtilis» Der Gegenstand der Metaphysik: die transzendierenden Bestimmungen (transcendentia) Das zuerst am ehesten Wißbare sind die gemeinsamsten (Bestimmungen), wie das Seiende als Seiendes (maxime scibilia primo modo sunt communissima, ut ens in quantum ens), und damit zusammenhängende (Bestimmungen). Es sagt nämlich Avicenna in Met. I 5 [Folie X 13] daß ens und res in die Seele durch einen ersten Eindruck eingeprägt werden, der nicht aus anderen bekannteren erworben wird. Diese gemeinsamsten (Bestimmungen) gehören auch nach Aristoteles am Beginn seines IV. Buches zur Metaphysik: Es gibt eine Wissenschaft, die das Seiende als Seiendes untersucht und das demselben an sich Zukommende [1003a 21] etc. Deren Notwendigkeit kann man so aufzeigen: weil die gemeinsamsten (Bestimmungen) zuerst erkannt werden, wie durch Avicenna bewiesen wurde, folgt, daß Speziellere nicht erkannt werden können, bevor nicht jene gemeinsamen (Bestimmungen) erkannt wurden (Cuius necessitas ostendi potest sic: ex quo communissima primo intelliguntur ut probatum est per Auicennam, sequitur quod alia specialiora non possunt cognosci nisi illa communia prius cognoscantur). Man kann aber die Erkenntnis dieser gemeinsamen (Bestimmungen) nicht in irgendeiner speziellen Wissenschaft behandeln (Et non potest istorum communium cognitio tradi in aliqua scientia particulari), [ ] weshalb es notwendig eine universale Wissenschaft geben muß, die als solche jene Transzendentalien [transzendierenden Bestimmungen] untersucht (igitur necesse est esse aliquam scientiam uniuersalem, quae per se consideret illa transcendentia). Eben diese Wissenschaft nennen wir Metaphysik, die so genannt wird nach meta, d.i. trans, und ycos scientia, gewissermaßen die transzendierende Wissenschaft, die von den Transzendentalien handelt (Et hanc scientiam uocamus metaphysicam, quae dicitur a "meta", quod est "trans", et "ycos" "scientia", quasi transcendens scientia, quia est de transcendentibus). (Quaest. subt. in Metaph., prologus, n. 5; vgl. Ordinatio I, dist. 3, p. 1, q. 3, n. 117f.) Mittelalter XII 09
11 Johannes Duns Scotus ( ) «Doctor subtilis» Transzendentia: passiones entis convertibiles passiones entis disiunctae perfectiones simpliciter Seiendes hat nicht nur einfache konvertible Bestimmungen wie Eines, Wahres und Gutes sondern hat weitere Bestimmungen bei denen Gegensätze gegeneinander unterschieden werden, wie Notwendigsein oder Möglichsein, Akt oder Potenz, und dergleichen (ens non tantum habet passiones simplices convertibiles, sicut unum, verum et bonum sed habet aliquas passiones ubi opposita distinguuntur contra se, sicut necesse esse vel possibile, actus vel potentia, et huiusmodi). Da nämlich die konvertiblen Bestimmungen Transzendentalien sind, die dem Seienden zukommen insoweit es nicht gattungsmäßig bestimmt ist, sind diese disjunktiven Bestimmungen Transzendentalien (Sicut autem passiones convertibiles sunt transcendentes quia consequuntur ens in quantum non determinatur ad aliquod genus, ita passiones disiunctae sunt transcendentes), [ ]. Somit kann auch die Weisheit ein Transzendentale sein, und anderes dergleichen [sc. die perfectiones simpliciter dictae de Deo formaliter (Ord. I 8,1,3, n. 78)], das Gott und dem Geschöpf gemeinsam ist (Ita etiam potest sapientia esse transcendens, et quodcumque aliud, quod est commune Deo et creaturae), es steht frei etwas derartiges allein von Gott zu sagen, etwas auch von Gott und irgendeinem Geschöpf (licet aliquod tale dicatur de solo Deo, aliquod autem de Deo et aliqua creatura). (Ordinatio I, dist. 8, p. 1, q. 3, n. 115) Distinctio formalis: um die perfectiones simpliciter dictae de Deo, wie Weisheit, Güte usw. mit Bezug auf Gott unterscheiden (und zugleich die Einheit Gottes aufrecht erhalten) zu können, muß ihnen durch ihre je eigene ratio formalis eine Washeit zukommen, die sie von jeder anderen reinen Vollkommenheit unterscheidet. Mittelalter XII 10
12 Johannes Duns Scotus ( ) «Doctor subtilis» Principium individuationis Thomas von Aquin: die Materie ist das Individuationsprinzip (individuationis principium materia est) [ ], aber nur die bezeichnete Materie [ ], die unter bestimmten Dimensionen betrachtet wird (sed solum materia signata [ ], quae sub determinatis dimensionibus consideratur). Diese Materie wird aber in der Definition, die zum Menschen gehört, insoweit er Mensch ist, nicht angeführt, jedoch würde sie in der Definition des Sokrates angeführt, wenn Sokrates eine Definition hätte. In der Definition des Menschen wird aber die nicht bezeichnete Materie angeführt: in der Definition des Menschen wird nämlich nicht dieser Knochen und dieses Fleisch angeführt (non enim in diffinitione hominis ponitur hoc os et haec caro), sondern Knochen und Fleisch im allgemeinen, die die nicht bezeichnete Materie des Menschen sind (sed os et caro absolute, quae sunt materia hominis non signata). (De ente et essentia II) Duns Scotus: haecceitas intelligo per individuationem sive unitatem numeralem sive singularitatem [ ] unitatem signatam (ut 'hanc'), [ ] et quaeritur causa non singularitatis in communi sed 'huius' singularitatis in speciali, signatae, scilicet ut est 'haec' determinate. (Ordinatio II, dist. 3, p. 1, q. 4, n. 76) quod necesse est per aliquid positivum intrinsecum huic lapidi, tamquam per rationem propriam, repugnare sibi dividi in partes subiectivas; et illud positivum erit illud quod dicetur esse per se causa individuationis, quia per individuationem intelligo illam indivisibilitatem sive repugnantiam ad divisibilitatem. (Ordinatio II, dist. 3, p. 1, q. 2, n. 57) Ergo praeter naturam in hoc et in illo, sunt aliqua primo diversa, quibus hoc et illud differunt (hoc in isto et illud in illo): et non possunt esse negationes, ex secunda quaestione, - nec accidentia, ex quarta quaestione; igitur erunt aliquae entitates positivae, per se determinantes naturam. (Ordinatio II, dist. 3, p. 1, q. 6, n. 170) Mittelalter XII 11
13 Johannes Duns Scotus ( ) «Doctor subtilis» Principium individuationis ( Haecceitas ) [187] Und wenn du mich fragst, was diese individuelle Entität ist, von der die individuelle Unterscheidung abhängt, wenn sie weder Materie, noch Form, noch Kompositum ist, - so antworte ich (Et si quaeras a me quae est ista 'entitas individualis' a qua sumitur differentia individualis, estne materia vel forma vel compositum, - respondeo): Jede wesenheitliche Entität [ ] ist als wesenheitliche Entität indifferent gegenüber dieser oder jener Entität (Omnis entitas quiditativa [ ] est de se indifferens 'ut entitas quiditativa' ad hanc entitatem et illam) [ ]. [188] Daher ist diese Entität weder Materie, noch Form, noch Kompositum, insoweit jedes dieser ein Wesen ist, - sondern sie ist die äußerste Wirklichkeit des Seienden, das Materie oder Form oder Kompositum ist (Non est igitur 'ista entitas' materia vel forma vel compositum, in quantum quodlibet istorum est 'natura', - sed est ultima realitas entis quod est materia vel quod est forma vel quod est compositum); und zwar so, daß man jedwedes Gemeinsame und somit Bestimmbare insoweit unterscheiden kann (wann immer es ein Ding ist) in mehrere formaliter getrennte Realitäten, bei denen diese formaliter nicht jene ist (ita quod quodcumque commune, et tamen determinabile, adhuc potest distingui (quantumcumque sit una res) in plures realitates formaliter distinctas, quarum haec formaliter non est illa): und so ist dieses formaliter die Entität des Singulären und jenes formaliter die Entität des Wesens (et haec est formaliter entitas singularitatis, et illa est entitas naturae formaliter). Aber diese zwei Realitäten können nicht zwei Dinge sein, [ ] sondern [ ] sind Realitäten ein und desselben Dinges, die formaliter getrennt sind (Nec possunt istae duae realitates esse res et res, [ ] sed [ ] sunt realitates eiusdem rei, formaliter distinctae). (Ordinatio II, dist. 3, p. 1, q. 6, n. 187f.) Mittelalter XII 12
14 Voluntarismus actus intellectus est in potestate voluntatis Johannes Duns Scotus ( ) «Doctor subtilis» secundum Augustinum [De duabus animabus 10.12]: Peccatum nusquam est, nisi in voluntate. [...] Causa prima peccandi est voluntas. Nihil enim est peccatum, nisi quod est in potestate facientis, et nihil est in potestate facientis, nisi quod est in potestate voluntatis ejus, quia nihil praeter hoc est imputabile [ ]. omnis causa activa in universo praeter voluntatem est naturaliter activa; ergo nulla praeter voluntatem est vituperabilis propter suam actionem. [ ] voluntas est motor in toto regno animae, et omnia obediunt sibi; [ ] quod oportet actum intellectus esse in potestate voluntatis, ita quod possit intellectum avertere ab uno intelligibili ad aliud intelligibile convertendo, alias intellectus staret semper in cognitione objecti perfectissimi habitualiter sibi noti [ ]; igitur minus perfectum intelligibile, praesente magis perfecto intelligibili movente, nunquam moveret, neque averteretur intellectus ab illo magis perfecto et efficacissimo intelligibili. (Ordinatio I, dist. 42, q. 4) Voluntas tamen est causa principalior, et 'natura cognoscens' minus principalis, quia voluntas libere movet, ad cuius motionem movet aliud (unde determinat aliud ad agendum); sed natura 'cognoscens obiectum' est naturale agens, quod, quantum est ex parte sui, agit semper: numquam tamen potest esse sufficiens ad actum eliciendum, nisi concurrente voluntate, et ideo voluntas est causa principalior. [ ] [74] Ex hoc patet quomodo est libertas in voluntate. Nam ego dicor 'libere videre', quia libere possum uti potentia visiva ad videndum; sic in proposito, quantumcumque aliqua causa sit naturalis et semper uniformiter agens (quantum est ex parte sui), quia tamen non determinat nec necessitat voluntatem ad volendum, sed voluntas ex libertate sua potest concurrere cum ea ad volendum vel non volendum et sic libere potest uti ea, ideo dicitur 'libere velle et nolle' esse in potestate nostra. (Lectura II, d. 25, n. 73f.) Mittelalter XII 13
15 Voluntarismus: potentia ordinata Dei est eius potentia absoluta Johannes Duns Scotus ( ) «Doctor subtilis» zurecht so genannte allgemeine Gesetze sind vom göttlichen Willen vorgeschrieben und nicht etwa vom göttlichen Verstand, der dem göttlichen Willensakt vorangeht [ ]; denn wenn der Verstand dem göttlichen Willen solch ein Gesetz vorlegt, [ ] ist es, sofern es seinem Willen der frei ist gefällt, ein richtiges Gesetz, und so verhält es sich mit den anderen Gesetzen (leges aliquae generales, recte dictantes, praefixae sunt a voluntate divina et non quidem ab intellectu divino ut praecedit actum voluntatis divinae [ ]; sed quando intellectus offert voluntati divinae talem legem, [ ] si placet voluntati suae - quae libera est - est recta lex, et ita est de aliis legibus). (Ordinatio I, dist. 44, n. 6; Vat. VI, 365) Daher wird von Gott, wenn er jenen von ihm vorgeschriebenen richtigen Gesetzen gemäß handelt, gesagt, er handle gemäß der potentia ordinata (dicitur agere secundum potentiam ordinatam); da er aber auch vieles zu tun vermag, das nicht jenen bereits vorgeschriebenen Gesetzen unterliegt, spricht man von seiner potentia absoluta: denn Gott vermag Beliebiges zu tun, sofern es keinen Widerspruch einschließt (ut autem potest multa agere quae non sunt secundum illas leges iam praefixas, sed praeter illas, dicitur eius potentia absoluta: quia enim Deus quodlibet potest agere quod non includit contradictionem) [...]. (Ordinatio I, dist. 44, n. 7; Vat. VI, 365f.) Kein Gesetz ist richtig, sofern es nicht mit Zustimmung des göttlichen Willens festgelegt wurde; mithin erstreckt sich seine potentia absoluta auf nichts anderes als jenes, das er geordnet vollbrächte, falls er es vollbrächte (nulla lex est recta nisi quatenus a voluntate divina acceptante est statuta; et tunc potentia eius absoluta ad aliquid, non se extendit ad aliud quam ad illud quod ordinate fieret, si fieret): er vollbrächte es zwar nicht dieser Ordnung gemäß geordnet, vollbrächte es aber einer anderen Ordnung gemäß geordnet, einer Ordnung, die der göttliche Wille ebenso festlegen könnte, wie er zu handeln vermag (non quidem fieret ordinate secundum istum ordinem, sed fieret ordinate secundum alium ordinem, quem ordinem ita posset voluntas divina statuere sicut potest agere). (Ord. I, dist. 44,n.8; Vat. VI, 366) Mittelalter XII 14
16 Theodoricus Teutonicus de Vriberg Dietrich von Freiberg (ca /20) Geb. in Freiberg in Sachsen um 1260 Eintritt in den Dominikanerorden Studien in Köln und Paris Provinzial der deutschen Ordensprovinz zudem Generalvikar der Dominikaner 1296/97 Magister der Theologie in Paris Werke Opera omnia, 4 Bde., Hamburg Verschränkt in seiner Intellekttheorie das Augustinische abditum mentis und den Aristotelischen intellectus agens Dietrich von Freiberg De Iride (Ms. 14. Jhd.) Nû sprichet sant Augustînus unde der niuwe meister[dietrich von Freiberg], daz hier inne lige einerhande geziugnisse unde verstentnisse unde wille, unt disiu driu enhânt niht unterscheides, daz ist, daz verborgen bilde daz antwürtet dem götlichen wesenne unde daz götlich wesen schînet in daz bilde âne mitel unde daz bilde schînet in daz götliche wesen âne mitel. Daz got in uns kome unde wir in in unde wir mit ime vereinet werden, des helf uns got. Anonymus, in: Fr. Pfeiffer (Hg.), Deutsche Mystiker des XIV. Jhdts., 2. Bd., Leipzig 1857, 251; vgl. 622f.) Mittelalter XII 15
17 Eckhardus Teutonicus Meister Eckhart (ca ) Geb. in Hochheim bei Gotha (Thüringen) um 1275 Eintritt in den Dominikanerorden Studien in Köln und Paris (?) 1302 Magister der Theologie in Paris Provinzial der Ordensprovinz Saxonia Lehrtätigkeit in Paris, Straßburg und Köln ab 1326 Anklage und Prozesse in Köln und Avignon Gest in Avignon (?) 1329 Bulle In agro dominico Verurteilung von 28 Sätzen Werke Die deutschen und lateinischen Werke, 11 Bde., Stuttgart 1958ff. Meister Eckhart, Fr. Pfeiffer (Hg.), Deutsche Mystiker des XIV. Jhdts., 2. Bd., Leipzig 1857 Meister-Eckhart-Portal Predigerkirche in Erfurt Got ist namlos, wan von ime kan niemant nit gesprechen noch verstan. Har vmb spricht ein heidens meister [Liber de causis, prop. 5 u. 21]: Swas wir verstant oder sprechent von der ersten sachen, das sin wir me selber, dan es die erste sache si, wan si ist vber allis sprechen und verstan. [ ] Sprich ich och: Got ist ein wesen es ist nit war: Er ist ein vber swebende wesen vnd ein vber wesende nitheit. (Pr. 83, DW III, 441f.; Pf. XCIX, 318) Mittelalter XII 16
18 Eckhardus Teutonicus Meister Eckhart (ca ) Swenne ich predige, sô pflige ich ze sprechenne von abegescheidenheit und daz der mensche ledic werde sîn selbes und aller dinge. Ze dem andern mâle, daz man wider îngebildet werde in daz einvaltige guot, daz got ist. Ze dem dritten mâle, daz man gedenke der grôzen edelkeit, die got an die sele hât geleget, daz der mensche dâ mite kome in ein wunder ze gote. Ze dem vierden mâle von götlîcher natûre lûterkeit waz klârheit an götlicher natûre sî, daz ist unsprechelich. Got ist ein wort, ein ungesprochen wort. (Pr. 53, DW II, 528f.; Pf. XXII, 91) Alle crêatûren sint ein lûter niht. [ ] Swaz niht wesens enhât, daz enist niht. Alle crêatûren hânt kein wesen, wan ir wesen swebet an der gegenwerticheit gotes. Kêrte sich got ab allen crêatûren einen ougenblik, sô würden sie ze nihte. (Pr. 4, DW I, 69; Pf. XL, 136) daz etwaz in der sêle ist, daz gote alsô sippe ist, daz ez ein ist unde niht vereinet. Ez ist ein, ez enhât mit nihte niht gemeine noch enist dem nihtes niht allez daz gemeine, daz geschaffen ist. Allez daz geschaffen ist, daz ist niht. Nu ist diz aller geschaffenheit verre unde vremde. Waere der mensche aller also, er were alzemâle ungeschaffen und ungeschepfelich; [ ]. Vünde ich mich einen ougenblik in disem wesene, ich ahtete als wênic ûf mich selben als eines mistwürmelîns. (Pr. 12, DW I, 197f.; Pf. XCVI, 311) Mittelalter XII 17
19 Ioannes Tauler/Johannes Tauler (ca ) Dominikaner in Straßburg. Seine Predigten sind Ausdruck spätma. Volksfrömmigkeit und von kaum zu überschätzender Bedeutung für die Reformation (Luther gibt 1516/18 Eyn deutsch Theologia (der Franckforter ) heraus, eine Schrift des 14. Jhds., die er für eine Zusammenfassung der Lehren Taulers hält). Und herumb ist gros underscheit enzwúschent den die der geschrift lebent, und in den die alleine sú lesent. Die sú lesent, die wellent gegro sset und geeret sin und versmohent die die ir do lebent [ ]. Und die ir do lebent, die hant sich selber fúr súnder und erbarment sich úber die andern. (Die Predigten Taulers, Berlin 1910, Pr. 19, 78) Suso/Heinrich Seuse (ca ) Schüler Eckharts in Köln. Bedeutendster Vertreter der Deutschen Mystik neben Eckhart und Tauler. Ioannes Ruusbroec/Jan van Ruysbroeck ( ) Ioannes Gerson/Jean Gerson ( ) Considerationes de mystica theologia speculativa et practica Thomas a Kempis/Thomas von Kempen (ca ) De imitatione Christi (1418): Das meistgelesene Dokument der Devotio moderna Nicolaus de Cusa/Nikolaus von Kues ( ) In seiner Apologia doctae ignorantiae (1448) tritt der Cusaner gegen den Heidelberger Theologen Johannes Wenck offen für Eckhart ein, dessen Schriften für den Pöbel zwar nicht geeignet seien (vulgus non est aptus ad ea), in denen aber per intelligentes multa subtilia et utilia reperiantur, und spricht von der coincidentia oppositorum als dem intium ascensus in mysticam Theologiam. Mittelalter XII 18
20 Guilelmus Ockham Wilhelm von Ockham (ca /49) «Venerabilis inceptor/doctor invincibilis» Geb. in Ockham/Surrey Studien in London und Oxford seit 1324 zur Verteidigung seiner Lehren in Avignon Zeitgleich spitzt sich der Armutsstreit zwischen den Franziskanern und dem Papst (Johannes XXII.) zu 1328 gemeinsam mit dem Ordensgeneral (Michael von Cesena) Flucht an den Hof Ludwigs d. Bayern Gest. 1347/49 in München Werke Opera theologica, 11 Bde., St. Bonaventure (N.Y.) Opera philosophica, 7 Bde., St. Bonaventure (N.Y.) Opera politica, 3 Bde., Manchester Wilhelm von Ockham Franziskanerkirche in Krakau Daß Gleichheit, Ähnlichkeit und andere Relationen zwischen den Geschöpfen bezeichnende Namen sind für distinkte absolute Sachen (sunt nomina significantia res distinctas absolutas) und von Seiten der Sache nichts weiter vorstellbar ist als das Absolute, obwohl Namen oder [mentale] Konzepte verschieden sind. Dies ist gefährlich, weil es alle Relationen zwischen den Geschöpfen aufhebt, alle Abhängigkeiten und Verbindungen der Sachen untereinander und die Ordnung, die ohne Relationen nicht sein können. (Ioannes Lutterell, Libellus contra doctrinam G. Occam 50) Mittelalter XII 19
21 Guilelmus Ockham Wilhelm von Ockham (ca /49) «Venerabilis inceptor/doctor invincibilis» Summa Logicae II Cap. 2. Was zur Wahrheit einer singulären assertorischen Aussage erforderlich ist (Quid requiretur ad veritatem propositionis quae est singularis et de inesse) 3. Ebenso wird auch durch die Aussagen (propositiones) Sokrates ist ein Mensch, Sokrates ist ein Tier nicht ausgedrückt, daß Sokrates die Menschheit oder Tierheit habe (non denotatur quod Sortes habeat humanitatem vel animalitatem), auch wird nicht ausgedrückt, daß die Menschheit oder Tierheit in Sokrates sei, noch daß der Mensch oder das Tier in Sokrates sei, noch daß Mensch oder Tier zum Wesen oder zur Washeit des Sokrates gehörten oder zum washeitlichen Begriff des Sokrates (nec quod homo vel animal sit de essentia vel de quidditate Sortis vel de intellectu quidditativo Sorti), vielmehr wird ausgedrückt, daß Sokrates wahrhaft Mensch und wahrhaft Tier ist (sed denotatur quod Sortes vere est homo et vere est animal). Nicht als ob Sokrates das Prädikat Mensch oder das Prädikat Tier wäre, vielmehr wird ausgedrückt, daß er irgendeine Sache ist, für die dieses Prädikat Mensch oder das Prädikat Tier steht oder supponiert (sed denotatur quod est aliqua res pro qua stat vel supponit hoc praedicatum 'homo' et hoc praedicatum 'animal ), denn jedes dieser beiden Prädikate steht für Sokrates. 4. Daraus erhellt, daß bei genauer Sprechweise all die [Aussagen] falsch sind (Ex istis patet, quod omnes tales de virtute sermonis sunt falsae): Mensch gehört zur Washeit des Sokrates (homo est de quidditate Sortis), Mensch gehört zum Wesen des Sokrates (homo est de essentia Sortis), Die Menschheit ist in Sokrates (humanitas est in Sorte), Sokrates besitzt Mensch[lic]h[k]eit (Sortes habet humanitatem), Sokrates ist Mensch durch die Menschheit (Sortes est homo humanitate), sowie viele solche Aussagen, die beinahe von allen zugestanden werden (et multae tales propositiones quae quasi ab omnibus conceduntur). Mittelalter XII 20
22 Marsilius Patavinus Marsilius von Padua (ca. 1275/ /43) Defensor Pacis (1324) II 9, 13. Es [das Evangelium] ist nämlich gegeben, damit wir dadurch unmittelbar [ ] eine Anleitung erhalten, was den Menschen dazu dient, die ewige Seligkeit zu gewinnen und der ewigen Pein zu entgehen, und darin ist es völlig ausreichend und vollkommen. Es ist aber nicht gegeben worden oder dazu da, um bürgerliche Streitsachen zu schlichten für den Zweck, die die Menschen, und zwar erlaubterweise, im irdischen Dasein wünschen. II 9, 7. In Wahrheit also und nach der klar ausgesprochenen Meinung des Apostels und der Heiligen [ ] besteht das Gebot, niemand dürfe in dieser Welt durch Strafe oder Pein zur Befolgung der Gebote des evangelischen Gesetzes gezwungen werden, besonders nicht durch den Priester, nicht nur ein Gläubiger, sondern auch nicht einmal ein Ungläubiger; [ ] denn in dieser Welt darf ein solches Gericht nach dem göttlichen Gesetz nicht gehalten oder ein solches Urteil vollstreckt werden, sondern nur in der künftigen. II, 18, 1,5. Der römische Bischof oder jeder andere handelt in blinder Unvernunft, ohne jedes sittliche Recht und ohne Rücksicht auf den Sinn der göttlichen Schriften und der menschlichen Beweise, ja in vollem Gegensatz dazu, wenn er sich über Herrscher, Gemeinschaften und Einzelpersonen die Fülle der Gewalt zuschreibt; diese sich beizulegen, müssen die menschlichen Gesetzgeber oder kraft Ermächtigung durch sie die Herrscher diesen Bischof und jeden anderen mit aller Macht gänzlich hindern durch Verwarnung und nötigenfalls sogar durch zwingende Gewalt. III, II 6. Gesetzgeber in menschlichen Angelegenheiten sei allein die Gemeinschaft der Bürger oder deren mächtigerer Teil (Legislatorem humanum solam civium universitatem esse aut valenciorem illius partem). Mittelalter XII 21
23 Mittelalter XII 22
Was ist ein Gedanke?
 Lieferung 8 Hilfsgerüst zum Thema: Was ist ein Gedanke? Thomas: Es bleibt zu fragen, was der Gedanke selbst [ipsum intellectum] ist. 1 intellectus, -us: Vernunft, Wahrnehmungskraft usw. intellectum, -i:
Lieferung 8 Hilfsgerüst zum Thema: Was ist ein Gedanke? Thomas: Es bleibt zu fragen, was der Gedanke selbst [ipsum intellectum] ist. 1 intellectus, -us: Vernunft, Wahrnehmungskraft usw. intellectum, -i:
Hilfsgerüst zum Thema:
 Lieferung 11 Hilfsgerüst zum Thema: Das Böse 1. Die Lehre des Averroes Alles Gute geht auf Gott zurück; Böses geht auf die Materie zurück. Die erste Vorsehung ist die Vorsehung Gottes. Er ist die Ursache,
Lieferung 11 Hilfsgerüst zum Thema: Das Böse 1. Die Lehre des Averroes Alles Gute geht auf Gott zurück; Böses geht auf die Materie zurück. Die erste Vorsehung ist die Vorsehung Gottes. Er ist die Ursache,
Der Begriff der Wirklichkeit
 Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Der Begriff der Wirklichkeit Die letzte Vorlesung in diesem Semester findet am 18. Juli 2014 statt. Die erste Vorlesung im Wintersemester 2014/2015 findet am 10. Oktober
Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Der Begriff der Wirklichkeit Die letzte Vorlesung in diesem Semester findet am 18. Juli 2014 statt. Die erste Vorlesung im Wintersemester 2014/2015 findet am 10. Oktober
Wilhelm von Ockham. Lieferung 15 (1288/ ) [Das Ersterkannte ist das Einzelne, nicht das Allgemeine]
![Wilhelm von Ockham. Lieferung 15 (1288/ ) [Das Ersterkannte ist das Einzelne, nicht das Allgemeine] Wilhelm von Ockham. Lieferung 15 (1288/ ) [Das Ersterkannte ist das Einzelne, nicht das Allgemeine]](/thumbs/54/35271140.jpg) Lieferung Wilhelm von Ockham (1288/ 1349) [Das Ersterkannte ist das Einzelne, nicht das Allgemeine] 2 Meine Antwort auf die Frage [ob das Ersterkannte der Vernunft, bezüglich der Erstheit des Entstehens,
Lieferung Wilhelm von Ockham (1288/ 1349) [Das Ersterkannte ist das Einzelne, nicht das Allgemeine] 2 Meine Antwort auf die Frage [ob das Ersterkannte der Vernunft, bezüglich der Erstheit des Entstehens,
Richard Heinzmann. Philosophie des Mittelalters. Grundkurs Philosophie 7. Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln
 Richard Heinzmann Philosophie des Mittelalters Grundkurs Philosophie 7 Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln Inhalt Vorwort 13 A. Griechische Philosophie und christliches Glaubenswissen 15 1. Zeitliche
Richard Heinzmann Philosophie des Mittelalters Grundkurs Philosophie 7 Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln Inhalt Vorwort 13 A. Griechische Philosophie und christliches Glaubenswissen 15 1. Zeitliche
Gott als die Wahrheit selbst
 Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Gott als die Wahrheit selbst 1. Gott ist die Wahrheit Augustinus Papst Leo I. (447): Kein Mensch ist die Wahrheit [... ]; aber viele sind Teilnehmer an der Wahrheit.
Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Gott als die Wahrheit selbst 1. Gott ist die Wahrheit Augustinus Papst Leo I. (447): Kein Mensch ist die Wahrheit [... ]; aber viele sind Teilnehmer an der Wahrheit.
Wer denkt meine Gedanken?
 Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Wer denkt meine Gedanken? FORTSETZUNG 1. Andere islamische Aristoteliker lehren, daß der Geist sich mit dem Leib wie der Beweger mit dem Bewegten verbindet Anders als
Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Wer denkt meine Gedanken? FORTSETZUNG 1. Andere islamische Aristoteliker lehren, daß der Geist sich mit dem Leib wie der Beweger mit dem Bewegten verbindet Anders als
Harald Berger, Denken über Glück im Mittelalter Erwartungsgemäßes und Überraschendes, Vortrag Graz, KFUG, HS 06.01, 16. Dezember 2014, 19 Uhr
 Harald Berger, Denken über Glück im Mittelalter Erwartungsgemäßes und Überraschendes, Vortrag Graz, KFUG, HS 06.01, 16. Dezember 2014, 19 Uhr Antike Klassik: Objektivismus Hellenismus: Subjektivismus Lit.
Harald Berger, Denken über Glück im Mittelalter Erwartungsgemäßes und Überraschendes, Vortrag Graz, KFUG, HS 06.01, 16. Dezember 2014, 19 Uhr Antike Klassik: Objektivismus Hellenismus: Subjektivismus Lit.
[Erste Intention: eine Intention, die nicht für eine Intention steht]
![[Erste Intention: eine Intention, die nicht für eine Intention steht] [Erste Intention: eine Intention, die nicht für eine Intention steht]](/thumbs/54/35269604.jpg) Aus der summa logicae des William von Ockham (ca. 1286 - ca. 1350) Übersetzung: Ruedi Imbach, nach Wilhelm von Ockham, Texte zur Theorie der Erkenntnis und der Wissenschaft, lat./dt., hg., übersetzt und
Aus der summa logicae des William von Ockham (ca. 1286 - ca. 1350) Übersetzung: Ruedi Imbach, nach Wilhelm von Ockham, Texte zur Theorie der Erkenntnis und der Wissenschaft, lat./dt., hg., übersetzt und
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über die Bedeutung der Wahrheit nach Thomas von Aquin.
 Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über die Bedeutung der Wahrheit nach Thomas von Aquin Zweite Lieferung Zum Thema: Die Klugheit als das Wesen der Moralität [1] Inwiefern
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über die Bedeutung der Wahrheit nach Thomas von Aquin Zweite Lieferung Zum Thema: Die Klugheit als das Wesen der Moralität [1] Inwiefern
SCIENTIA MYSTICA SIVE THEOLOGIA
 SCIENTIA MYSTICA SIVE THEOLOGIA Abendländische Mystik im Mittelalter. Symposion Kloster Engelberg 1984 Mystik als Aussage. Erfahrungs-, Denk- und Redeformen christlicher Mystik theologia mystica Horologium
SCIENTIA MYSTICA SIVE THEOLOGIA Abendländische Mystik im Mittelalter. Symposion Kloster Engelberg 1984 Mystik als Aussage. Erfahrungs-, Denk- und Redeformen christlicher Mystik theologia mystica Horologium
Glück als der Sinn des Lebens
 Lieferung 17 Hilfsgerüst zum Thema: Glück als der Sinn des Lebens 1. Kann man menschliches Leben zusammenfassen? Kann man von einem Sinn des Lebens sprechen? Universalität ist eine Vorbedingung für Glück.
Lieferung 17 Hilfsgerüst zum Thema: Glück als der Sinn des Lebens 1. Kann man menschliches Leben zusammenfassen? Kann man von einem Sinn des Lebens sprechen? Universalität ist eine Vorbedingung für Glück.
I. Der Idealismus in der Philosophie des 13./14. Jahrhunderts: Heinrich von Gent, Dietrich von Freiberg und Meister Eckhart... 51
 Inhaltsverzeichnis Einleitung... 19 A. Quod demonstrandum est... 21 1. Was ist Idealismus?... 21 2. Alberts des Großen Metaphysik als Idealismus-Kritik... 24 a. Die streng aristotelische averroistische
Inhaltsverzeichnis Einleitung... 19 A. Quod demonstrandum est... 21 1. Was ist Idealismus?... 21 2. Alberts des Großen Metaphysik als Idealismus-Kritik... 24 a. Die streng aristotelische averroistische
Gibt es Gott? Die fünf Wege des hl. Thomas von Aquin
 Gibt es Gott? Die fünf Wege des hl. Thomas von Aquin Thomas von Aquin geb. 1225 in Roccasecca als Graf von Aquino gegen der Willen der Eltern wird er Dominikaner Schüler Alberts des Großen (Paris und Köln)
Gibt es Gott? Die fünf Wege des hl. Thomas von Aquin Thomas von Aquin geb. 1225 in Roccasecca als Graf von Aquino gegen der Willen der Eltern wird er Dominikaner Schüler Alberts des Großen (Paris und Köln)
Hilfsgerüst zum Thema: Gottesbeweise
 Lieferung 3 Hilfsgerüst zum Thema: Gottesbeweise 1. Wie Richard Dawkins Gott versteht Dawkins: Ich möchte die Gotteshypothese, damit sie besser zu verteidigen ist, wie folgt definieren: Es gibt eine übermenschliche,
Lieferung 3 Hilfsgerüst zum Thema: Gottesbeweise 1. Wie Richard Dawkins Gott versteht Dawkins: Ich möchte die Gotteshypothese, damit sie besser zu verteidigen ist, wie folgt definieren: Es gibt eine übermenschliche,
Anselm von Canterburys Ontologischer Gottesbeweis
 Lieferung 8 Hilfsgerüst zum Thema: Anselm von Canterburys Ontologischer Gottesbeweis Der christliche Glaube wird vorausgesetzt. Der Beweis findet innerhalb eines intimen Gebets statt. Frömmigkeit und Rationalität
Lieferung 8 Hilfsgerüst zum Thema: Anselm von Canterburys Ontologischer Gottesbeweis Der christliche Glaube wird vorausgesetzt. Der Beweis findet innerhalb eines intimen Gebets statt. Frömmigkeit und Rationalität
Descartes, Dritte Meditation
 Descartes, Dritte Meditation 1. Gewissheiten: Ich bin ein denkendes Wesen; ich habe gewisse Bewusstseinsinhalte (Empfindungen, Einbildungen); diesen Bewusstseinsinhalten muss nichts außerhalb meines Geistes
Descartes, Dritte Meditation 1. Gewissheiten: Ich bin ein denkendes Wesen; ich habe gewisse Bewusstseinsinhalte (Empfindungen, Einbildungen); diesen Bewusstseinsinhalten muss nichts außerhalb meines Geistes
Politischer Humanismus und europäische Renaissance. Prof. Dr. Alexander Thumfart
 Politischer Humanismus und europäische Renaissance Prof. Dr. Alexander Thumfart Geboren: 24. Februar 1464; Mirandola (Po-Ebene) Gestorben: 17. November 1494; Florenz Ausbildung: Philosophie in Padua Leben:
Politischer Humanismus und europäische Renaissance Prof. Dr. Alexander Thumfart Geboren: 24. Februar 1464; Mirandola (Po-Ebene) Gestorben: 17. November 1494; Florenz Ausbildung: Philosophie in Padua Leben:
Gott ist Liebe. Meister Eckhart, Lehrer der Unmittelbarkeit
 Gott ist Liebe. Meister Eckhart, Lehrer der Unmittelbarkeit 1 Vortrag Gespräch - Meditation Katholisch soziales Institut, Bad Honnef Tagung: Kunst und Religion Gegenwart des Absoluten Mystik 4. bis 7.
Gott ist Liebe. Meister Eckhart, Lehrer der Unmittelbarkeit 1 Vortrag Gespräch - Meditation Katholisch soziales Institut, Bad Honnef Tagung: Kunst und Religion Gegenwart des Absoluten Mystik 4. bis 7.
Thomas von Aquin. In diesem Leben kann ein Mensch nicht restlos glücklich sein. Summe gegen die Heiden [Summa contra gentiles], Buch III, Kapitel 48
![Thomas von Aquin. In diesem Leben kann ein Mensch nicht restlos glücklich sein. Summe gegen die Heiden [Summa contra gentiles], Buch III, Kapitel 48 Thomas von Aquin. In diesem Leben kann ein Mensch nicht restlos glücklich sein. Summe gegen die Heiden [Summa contra gentiles], Buch III, Kapitel 48](/thumbs/61/45371744.jpg) Lieferung 16 Thomas von Aquin In diesem Leben kann ein Mensch nicht restlos glücklich sein Summe gegen die Heiden [Summa contra gentiles], Buch III, Kapitel 48 48. Kapitel DIE LETZTE GLÜCKSELIGKEIT DES
Lieferung 16 Thomas von Aquin In diesem Leben kann ein Mensch nicht restlos glücklich sein Summe gegen die Heiden [Summa contra gentiles], Buch III, Kapitel 48 48. Kapitel DIE LETZTE GLÜCKSELIGKEIT DES
Was im Allgemeinen mit dem Wort Wesenheit und Seiendes bezeichnet wir
 - 1 - De ente et essentia, cap. 1 & 2 Was im Allgemeinen mit dem Wort Wesenheit und Seiendes bezeichnet wir 3 Seiend (ens) wird (nach Ar.) hat zwei Bedeutungen: (1) verteilt auf 10 Kategorien (genera),
- 1 - De ente et essentia, cap. 1 & 2 Was im Allgemeinen mit dem Wort Wesenheit und Seiendes bezeichnet wir 3 Seiend (ens) wird (nach Ar.) hat zwei Bedeutungen: (1) verteilt auf 10 Kategorien (genera),
Thomas von Aquin: Kein vollendetes Glück in diesem Leben. Summe gegen die Heiden [Summa contra gentiles], Buch III
![Thomas von Aquin: Kein vollendetes Glück in diesem Leben. Summe gegen die Heiden [Summa contra gentiles], Buch III Thomas von Aquin: Kein vollendetes Glück in diesem Leben. Summe gegen die Heiden [Summa contra gentiles], Buch III](/thumbs/61/45371770.jpg) Lieferung Thomas von Aquin: Kein vollendetes Glück in diesem Leben Summe gegen die Heiden [Summa contra gentiles], Buch III 48. Kapitel DIE LETZTE GLÜCKSELIGKEIT DES MENSCHEN FINDET SICH NICHT IN DIESEM
Lieferung Thomas von Aquin: Kein vollendetes Glück in diesem Leben Summe gegen die Heiden [Summa contra gentiles], Buch III 48. Kapitel DIE LETZTE GLÜCKSELIGKEIT DES MENSCHEN FINDET SICH NICHT IN DIESEM
1. Person 2. Person. ich. wir unser von uns uns uns durch uns. is, ea, id: 6.3 d)
 6 Die Pronomina 6.1 Personalpronomina Nom. 1) Nom. 1) 2) egō meī mihi mē a mē nōs nostri nostrum nōbis nōs a nōbis 1. Person 2. Person ich tū du meiner tui deiner mir tibi dir mich tē dich durch mich a
6 Die Pronomina 6.1 Personalpronomina Nom. 1) Nom. 1) 2) egō meī mihi mē a mē nōs nostri nostrum nōbis nōs a nōbis 1. Person 2. Person ich tū du meiner tui deiner mir tibi dir mich tē dich durch mich a
ZWEI TEXTE VON JOHANNES DUNS SCOTUS ZUR PHILOSOPHY OF MIND
 SBORNlK PRACf FILOZOFICKE FAKULTY BRNENSKE UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS B 40, 1993 Vladimir Richter (Innsbruck) ZWEI TEXTE VON JOHANNES DUNS SCOTUS ZUR PHILOSOPHY
SBORNlK PRACf FILOZOFICKE FAKULTY BRNENSKE UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS B 40, 1993 Vladimir Richter (Innsbruck) ZWEI TEXTE VON JOHANNES DUNS SCOTUS ZUR PHILOSOPHY
Ist das Universum irgendwann entstanden?
 Lieferung 12 Hilfsgerüst zum Thema: Ist das Universum irgendwann entstanden? Die Frage nach der Ewigkeit der Welt 1. Die von dem Bischof von Paris 1277 verurteilte Lehren These 87: Die Welt ist ewig in
Lieferung 12 Hilfsgerüst zum Thema: Ist das Universum irgendwann entstanden? Die Frage nach der Ewigkeit der Welt 1. Die von dem Bischof von Paris 1277 verurteilte Lehren These 87: Die Welt ist ewig in
Immanuel Kant. *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg
 Immanuel Kant *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg ab 1770 ordentlicher Professor für Metaphysik und Logik an der Universität Königsberg Neben Hegel wohl der bedeutendste deutsche
Immanuel Kant *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg ab 1770 ordentlicher Professor für Metaphysik und Logik an der Universität Königsberg Neben Hegel wohl der bedeutendste deutsche
Zeit der Engel: Das Aevum (aevitas; aeviternitas)
 Lieferung 5 Hilfsgerüst zum Thema: Die Zeit der Engel: Das Aevum (aevitas; aeviternitas) Am 17. November findet anstelle der Vorlesung ein Gastvortrag von Leo O Donovan, S.J. zum Thema: Zur Möglichkeit
Lieferung 5 Hilfsgerüst zum Thema: Die Zeit der Engel: Das Aevum (aevitas; aeviternitas) Am 17. November findet anstelle der Vorlesung ein Gastvortrag von Leo O Donovan, S.J. zum Thema: Zur Möglichkeit
2. Seinsweise, die in der Angleichung von Ding und Verstand besteht. 3. Unmittelbare Wirkung dieser Angleichung: die Erkenntnis.
 THOMAS VON AQUIN - De veritate (Quaestio I) - Zusammenfassung Erster Artikel: Was ist Wahrheit?! Ziel ist die Erschließung des Wortes Wahrheit und der mit diesem Begriff verwandten Wörter.! 1. Grundlage
THOMAS VON AQUIN - De veritate (Quaestio I) - Zusammenfassung Erster Artikel: Was ist Wahrheit?! Ziel ist die Erschließung des Wortes Wahrheit und der mit diesem Begriff verwandten Wörter.! 1. Grundlage
Die Existenz Gottes nach Thomas von Aquin
 Lieferung 6 Hilfsgerüst zum Thema: Die Existenz Gottes nach Thomas von Aquin Die fünf Wege stammen nicht original von Thomas selbst, sondern werden von ihm in eigener Fassung dargestellt. Aristoteles ist
Lieferung 6 Hilfsgerüst zum Thema: Die Existenz Gottes nach Thomas von Aquin Die fünf Wege stammen nicht original von Thomas selbst, sondern werden von ihm in eigener Fassung dargestellt. Aristoteles ist
...den Schöpfer des Himmels und der Erde. Credo IV BnP
 ...den Schöpfer des Himmels und der Erde Credo IV BnP 18.6.2107 Gen 1,1: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde Großes Credo: der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare
...den Schöpfer des Himmels und der Erde Credo IV BnP 18.6.2107 Gen 1,1: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde Großes Credo: der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare
Definition des Glaubens
 Lieferung 2 Hilfsgerüst zum Thema: Definition des Glaubens Mehrdeutigkeit der rettende Glaube Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen (Hebräerbrief11, 6). 1. Der Glaube ist das Feststehen im Erhofften,
Lieferung 2 Hilfsgerüst zum Thema: Definition des Glaubens Mehrdeutigkeit der rettende Glaube Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen (Hebräerbrief11, 6). 1. Der Glaube ist das Feststehen im Erhofften,
Philosophische Auseinandersetzung mit dem Kraftbegriff Newton vs. Leibniz
 Philosophische Auseinandersetzung mit dem Kraftbegriff Newton vs. Leibniz Eren Simsek Mag. Dr. Nikolinka Fertala 3. März 010 Theoretische Physik für das Lehramt L1 Sommersemester 010 Gliederung Historischer
Philosophische Auseinandersetzung mit dem Kraftbegriff Newton vs. Leibniz Eren Simsek Mag. Dr. Nikolinka Fertala 3. März 010 Theoretische Physik für das Lehramt L1 Sommersemester 010 Gliederung Historischer
DAS NATÜRLICHE GESETZ UND DAS KONKRETE PRAKTISCHE URTEIL NACH DER LEHRE DES JOHANNES DUNS SCOTUS
 DAS NATÜRLICHE GESETZ UND DAS KONKRETE PRAKTISCHE URTEIL NACH DER LEHRE DES JOHANNES DUNS SCOTUS Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität
DAS NATÜRLICHE GESETZ UND DAS KONKRETE PRAKTISCHE URTEIL NACH DER LEHRE DES JOHANNES DUNS SCOTUS Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität
Toleranz und Intoleranz in der christlichen Geschichte. Teil VI: Raymundus Lullus
 Lieferung 12 Hilfsgerüst zum Thema: Hilfsgerüst zum Thema: Toleranz und Intoleranz in der christlichen Geschichte Teil VI: Raymundus Lullus (Ramon Lull oder Llull) geb. um 1235 in Palma auf Mallorca gest.
Lieferung 12 Hilfsgerüst zum Thema: Hilfsgerüst zum Thema: Toleranz und Intoleranz in der christlichen Geschichte Teil VI: Raymundus Lullus (Ramon Lull oder Llull) geb. um 1235 in Palma auf Mallorca gest.
KREATÜRLICHKEIT: GEHEIMNIS DES GLAUBENS IM LICHT DER VERNUNFT. THOMAS VON AQUIN ÜBER SCHÖPFUNGSLAUBEN UND SEINSVERSTÄNDNIS
 1 KREATÜRLICHKEIT: GEHEIMNIS DES GLAUBENS IM LICHT DER VERNUNFT. THOMAS VON AQUIN ÜBER SCHÖPFUNGSLAUBEN UND SEINSVERSTÄNDNIS von Dr. Axel Schmidt Daß die Welt von Gott geschaffen ist, hält nicht allein
1 KREATÜRLICHKEIT: GEHEIMNIS DES GLAUBENS IM LICHT DER VERNUNFT. THOMAS VON AQUIN ÜBER SCHÖPFUNGSLAUBEN UND SEINSVERSTÄNDNIS von Dr. Axel Schmidt Daß die Welt von Gott geschaffen ist, hält nicht allein
Die Eigenschaften Gottes
 Die Eigenschaften Gottes 1 Jesus Christus: wahrer Mensch und wahrer Gott 2 und wahrer Gott 1. Beide Wahrheiten (Mensch geworden zu sein / Gott zu sein) sind und waren Gegenstand von Irrlehren in 2000 Jahren
Die Eigenschaften Gottes 1 Jesus Christus: wahrer Mensch und wahrer Gott 2 und wahrer Gott 1. Beide Wahrheiten (Mensch geworden zu sein / Gott zu sein) sind und waren Gegenstand von Irrlehren in 2000 Jahren
Die Zeit und Veränderung nach Aristoteles
 Lieferung 4 Hilfsgerüst zum Thema: Die Zeit und Veränderung nach Aristoteles 1. Anfang der Untersuchung: Anzweiflung Aristoteles: Es reiht sich an das bisher Versprochene, über die Zeit zu handeln. Zuerst
Lieferung 4 Hilfsgerüst zum Thema: Die Zeit und Veränderung nach Aristoteles 1. Anfang der Untersuchung: Anzweiflung Aristoteles: Es reiht sich an das bisher Versprochene, über die Zeit zu handeln. Zuerst
Katholiken und Evangelikale. Gemeinsamkeiten und Unterschiede Teil 2
 Katholiken und Evangelikale Gemeinsamkeiten und Unterschiede Teil 2 Katholiken und Evangelikale Gemeinsamkeiten und Unterschiede 1. Einführung a. Ziele und Methode der Vortragsreihe b. Quellen c. Was sind
Katholiken und Evangelikale Gemeinsamkeiten und Unterschiede Teil 2 Katholiken und Evangelikale Gemeinsamkeiten und Unterschiede 1. Einführung a. Ziele und Methode der Vortragsreihe b. Quellen c. Was sind
Die Klugheit als das Wesen der Moralität
 Lieferung 4 Hilfsgerüst zum Thema: Die Klugheit als das Wesen der Moralität 1. Der Name prudentia; nicht: im Sinne von Schläue, Gerissenheit nicht: der gewiegte Taktiker nicht: die Fähigkeit, für sich
Lieferung 4 Hilfsgerüst zum Thema: Die Klugheit als das Wesen der Moralität 1. Der Name prudentia; nicht: im Sinne von Schläue, Gerissenheit nicht: der gewiegte Taktiker nicht: die Fähigkeit, für sich
Die Frage nach der Existenz Gottes
 Lieferung 12 Hilfsgerüst zum Thema: Die Frage nach der Existenz Gottes Die letzte Vorlesung des Semesters findet am 19. Juli 2013 statt. 1. Vorbemerkungen An sich ist die Existenz Gottes selbstevident
Lieferung 12 Hilfsgerüst zum Thema: Die Frage nach der Existenz Gottes Die letzte Vorlesung des Semesters findet am 19. Juli 2013 statt. 1. Vorbemerkungen An sich ist die Existenz Gottes selbstevident
Nikolaus von Kues. Mathematische Betrachtungen in De docta ignorantia
 UNIVERSITÄTS- BIBLIOTHEK HEIDELBERG Heidelberger Texte zur Mathematikgeschichte Nikolaus von Kues Mathematische Betrachtungen in De docta ignorantia Deutsche Übersetzung von Franz Anton Scharff Quelle:
UNIVERSITÄTS- BIBLIOTHEK HEIDELBERG Heidelberger Texte zur Mathematikgeschichte Nikolaus von Kues Mathematische Betrachtungen in De docta ignorantia Deutsche Übersetzung von Franz Anton Scharff Quelle:
Erste Lieferung. Zum Thema: Wahrheit und die Autoritäten Die theologsiche Hermeneutik der mittelalterlichen Scholastik
 Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung: Theologien im europäischen Mittelalter Die Vielfalt des Denkens in der Blütezeit der Theologie Erste Lieferung Zum Thema: Wahrheit und die
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung: Theologien im europäischen Mittelalter Die Vielfalt des Denkens in der Blütezeit der Theologie Erste Lieferung Zum Thema: Wahrheit und die
Sapientia Romanorum Weisheiten aus dem alten Rom
 Sapientia Romanorum Weisheiten aus dem alten Rom Lateinisch/Deutsch Ausgewählt, übersetzt und herausgegeben von Fritz Fajen Philipp Reclam jun. Stuttgart RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK Nr. 18558 Alle Rechte
Sapientia Romanorum Weisheiten aus dem alten Rom Lateinisch/Deutsch Ausgewählt, übersetzt und herausgegeben von Fritz Fajen Philipp Reclam jun. Stuttgart RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK Nr. 18558 Alle Rechte
Joachim Stiller. Was ist Gott? Eine theologische Frage. Alle Rechte vorbehalten
 Joachim Stiller Was ist Gott? Eine theologische Frage Alle Rechte vorbehalten Was ist Gott? In diesem Aufsatz soll es einmal um die Frage gehen, was Gott ist... Was können, dürfen und sollen wir uns unter
Joachim Stiller Was ist Gott? Eine theologische Frage Alle Rechte vorbehalten Was ist Gott? In diesem Aufsatz soll es einmal um die Frage gehen, was Gott ist... Was können, dürfen und sollen wir uns unter
Anselm von Canterbury
 Anselm von Canterbury *1034 in Aosta/Piemont Ab 1060 Novize, dann Mönch der Benediktinerabtei Bec ab 1078: Abt des Klosters von Bec 1093: Erzbischof von Canterbury *1109 in Canterbury 1076 Monologion (
Anselm von Canterbury *1034 in Aosta/Piemont Ab 1060 Novize, dann Mönch der Benediktinerabtei Bec ab 1078: Abt des Klosters von Bec 1093: Erzbischof von Canterbury *1109 in Canterbury 1076 Monologion (
EINFÜHRUNG IN DIE PHILOSOPHIE DES MITTELALTERS
 KURT FLASCH EINFÜHRUNG IN DIE PHILOSOPHIE DES MITTELALTERS WISSENSCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT DARMSTADT INHALTSVERZEICHNIS Vorwort XI I. Zitat und Einsetzung - Karolingischer Neubeginn. 1 1. Untergang
KURT FLASCH EINFÜHRUNG IN DIE PHILOSOPHIE DES MITTELALTERS WISSENSCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT DARMSTADT INHALTSVERZEICHNIS Vorwort XI I. Zitat und Einsetzung - Karolingischer Neubeginn. 1 1. Untergang
Das Seiende und das Wesen
 Thomas von Aquin Das Seiende und das Wesen (De ente et essentia) 2 Einleitung Weil ein kleiner Irrtum am Anfang am Ende ein großer ist nach dem Philosophen im 1. Buch von»der Himmel und die Erde«, Seiendes
Thomas von Aquin Das Seiende und das Wesen (De ente et essentia) 2 Einleitung Weil ein kleiner Irrtum am Anfang am Ende ein großer ist nach dem Philosophen im 1. Buch von»der Himmel und die Erde«, Seiendes
Geschichte der Rechts- und Staatsphilosophie
 Ernst-Wolfgang Böckenförde Geschichte der Rechts- und Staatsphilosophie Antike und Mittelalter Mohr Siebeck Inhaltsverzeichnis Vorwort VII 1 Einleitung 1 I. An wen wendet sich und was will das Buch? (1)
Ernst-Wolfgang Böckenförde Geschichte der Rechts- und Staatsphilosophie Antike und Mittelalter Mohr Siebeck Inhaltsverzeichnis Vorwort VII 1 Einleitung 1 I. An wen wendet sich und was will das Buch? (1)
Realität Virtualität Wirklichkeit
 Virtualität 2. Vorlesung (24.4.12): und Christoph Hubig (1)/Scholastik: Duns Scotus, Antonius Trombetta res realitas (actualis) was eine res als res konstituiert/ ausmacht (rationes) quidditas / Washeit
Virtualität 2. Vorlesung (24.4.12): und Christoph Hubig (1)/Scholastik: Duns Scotus, Antonius Trombetta res realitas (actualis) was eine res als res konstituiert/ ausmacht (rationes) quidditas / Washeit
Die Lehre von der Schöpfung Thomas Noack
 Die Lehre von der Schöpfung Thomas Noack Die Lehre von der Schöpfung 1 Mit der kirchlichen Lehre stimmen Swedenborg und Lorber in wenigstens zwei grundsätzlichen Anschauungen überein: 1.) Das vorfindliche
Die Lehre von der Schöpfung Thomas Noack Die Lehre von der Schöpfung 1 Mit der kirchlichen Lehre stimmen Swedenborg und Lorber in wenigstens zwei grundsätzlichen Anschauungen überein: 1.) Das vorfindliche
Die Wunder Jesu. Eigentlich braucht der Glaube nicht mehr als die Auferstehung.
 Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Die Wunder Jesu 1. Unsere Skepsis heute Eigentlich braucht der Glaube nicht mehr als die Auferstehung. 2. Wunder definiert als Durchbrechung eines Naturgesetzes Historisches
Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Die Wunder Jesu 1. Unsere Skepsis heute Eigentlich braucht der Glaube nicht mehr als die Auferstehung. 2. Wunder definiert als Durchbrechung eines Naturgesetzes Historisches
Vorlesung Teil III. Kants transzendentalphilosophische Philosophie
 Vorlesung Teil III Kants transzendentalphilosophische Philosophie Aufklärung: Säkularisierung III. Kant l âge de la raison Zeitalter der Vernunft le siécles des lumières Age of Enlightenment Aufklärung:
Vorlesung Teil III Kants transzendentalphilosophische Philosophie Aufklärung: Säkularisierung III. Kant l âge de la raison Zeitalter der Vernunft le siécles des lumières Age of Enlightenment Aufklärung:
Glück als Schauen [Theoria] nach Aristoteles ( vor Chr.)
![Glück als Schauen [Theoria] nach Aristoteles ( vor Chr.) Glück als Schauen [Theoria] nach Aristoteles ( vor Chr.)](/thumbs/63/50098748.jpg) Lieferung 12 Hilfsgerüst zum Thema: Glück als Schauen [Theoria] nach Aristoteles (384 322 vor Chr.) 1. Was will der Mensch letzten Endes? Alle Menschen wollen glücklich sein. Das Endziel aller Ziele des
Lieferung 12 Hilfsgerüst zum Thema: Glück als Schauen [Theoria] nach Aristoteles (384 322 vor Chr.) 1. Was will der Mensch letzten Endes? Alle Menschen wollen glücklich sein. Das Endziel aller Ziele des
Die Wahrheit der hl. Schrift
 Lieferung 6 Hilfsgerüst zum Thema: Die Wahrheit der hl. Schrift Thomas von Aquin, Quaestiones quodlibetales, IV, q. 9, a. 3c:»Wenn der Lehrer mit nackten Autoritäten eine Frage entscheidet, dann wird der
Lieferung 6 Hilfsgerüst zum Thema: Die Wahrheit der hl. Schrift Thomas von Aquin, Quaestiones quodlibetales, IV, q. 9, a. 3c:»Wenn der Lehrer mit nackten Autoritäten eine Frage entscheidet, dann wird der
Die Eigenschaften Gottes
 Die Eigenschaften Gottes 1 Jesus Christus: wahrer Mensch und wahrer Gott 2 1. Beide Wahrheiten (Mensch geworden zu sein / Gott zu sein) sind und waren Gegenstand von Irrlehren in 2000 Jahren Kirchengeschichte
Die Eigenschaften Gottes 1 Jesus Christus: wahrer Mensch und wahrer Gott 2 1. Beide Wahrheiten (Mensch geworden zu sein / Gott zu sein) sind und waren Gegenstand von Irrlehren in 2000 Jahren Kirchengeschichte
Jesus Christus als der absolute Heilbringer
 Lieferung 2 Hilfsgerüst zum Thema: Jesus Christus als der absolute Heilbringer 1. Die Lehre der christlichen Kirchen Karl Rahner: In einer phänomenologischen Deskription des gemeinchristlichen Verhältnisses
Lieferung 2 Hilfsgerüst zum Thema: Jesus Christus als der absolute Heilbringer 1. Die Lehre der christlichen Kirchen Karl Rahner: In einer phänomenologischen Deskription des gemeinchristlichen Verhältnisses
Boethius von Dakien, De summo bono. von Dr. Andreas Kamp
 Boethius von Dakien, De summo bono von Dr. Andreas Kamp Die bislang einzige www-fassung von "De summo bono" stammt von S. Kawazoe (www.bun.kyoto-u.ac.jp). Sie basiert auf der Print-Edition von Green-Pedersen,
Boethius von Dakien, De summo bono von Dr. Andreas Kamp Die bislang einzige www-fassung von "De summo bono" stammt von S. Kawazoe (www.bun.kyoto-u.ac.jp). Sie basiert auf der Print-Edition von Green-Pedersen,
Ermenegildo Bidese. (University of Trento, Via Tommaso Gar 14, ITA Trento)
 Das Naturgesetz als dialogische Emergenz des Ethischen. Zum Verhältnis zwischen lex aeterna, lex naturalis und motus rationalis creaturae im De-lege-Traktat der Summa Theologiae Thomas von Aquins Ermenegildo
Das Naturgesetz als dialogische Emergenz des Ethischen. Zum Verhältnis zwischen lex aeterna, lex naturalis und motus rationalis creaturae im De-lege-Traktat der Summa Theologiae Thomas von Aquins Ermenegildo
Eine allgemeine Rede Hermetis Trismegisti an Asclepium
 Das sechste Buch Eine allgemeine Rede Hermetis Trismegisti an Asclepium Freilich. ermes Lieber Asciepi, alles, was bewegt wird, wird das nicht in etwas und von etwas bewegt? Muss nun nicht notwendig dasjenige,
Das sechste Buch Eine allgemeine Rede Hermetis Trismegisti an Asclepium Freilich. ermes Lieber Asciepi, alles, was bewegt wird, wird das nicht in etwas und von etwas bewegt? Muss nun nicht notwendig dasjenige,
Thomas von Aquin. De regimine principum ad regem Cypri - Über die Herrschaft des Fürsten, dem König von Zypern gewidmet ( )
 Thomas von Aquin De regimine principum ad regem Cypri - Über die Herrschaft des Fürsten, dem König von Zypern gewidmet (1265-1267) "Triumph of St. Thomas Aquinas over Averroes" by Benozzo Gozzoli (1420
Thomas von Aquin De regimine principum ad regem Cypri - Über die Herrschaft des Fürsten, dem König von Zypern gewidmet (1265-1267) "Triumph of St. Thomas Aquinas over Averroes" by Benozzo Gozzoli (1420
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über das. Dritte und letzte Lieferung. Zum Thema: Ist Gott das Glück?
 Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über das Glück Dritte und letzte Lieferung Zum Thema: Ist Gott das Glück? 1. Wer war Boethius? 2. Wie lautet die Glücksdefinition des Boethius?
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über das Glück Dritte und letzte Lieferung Zum Thema: Ist Gott das Glück? 1. Wer war Boethius? 2. Wie lautet die Glücksdefinition des Boethius?
THEOLOGIE AN DER SCHNITTSTELLE
 THEOLOGIE AN DER SCHNITTSTELLE EXEGESE IN DER UNIVERSITAS THOMAS SÖDING LEHRSTUHL NEUES TESTAMENT KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM 26. 10. 2015 1. Die neutestamentliche Exegese
THEOLOGIE AN DER SCHNITTSTELLE EXEGESE IN DER UNIVERSITAS THOMAS SÖDING LEHRSTUHL NEUES TESTAMENT KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM 26. 10. 2015 1. Die neutestamentliche Exegese
Glück als Begründung und Sinn der Moral
 Lieferung 4 Hilfsgerüst zum Thema: Glück als Begründung und Sinn der Moral 1. Glück ist das erste Thema der thomasischen Ethik Der Aufbau der Ethik: (1) Glück und (2) das, was dahin führt bzw. davon ablenkt
Lieferung 4 Hilfsgerüst zum Thema: Glück als Begründung und Sinn der Moral 1. Glück ist das erste Thema der thomasischen Ethik Der Aufbau der Ethik: (1) Glück und (2) das, was dahin führt bzw. davon ablenkt
Gott als das Gute. Hilfsgerüst zum Thema: 1. In der Dimension des Guten ist Gott das Gute selbst, bzw. die Gutheit alles Guten.
 Lieferung 9 Hilfsgerüst zum Thema: Gott als das Gute Die Religion richtet den Menschen auf Gott aus, nicht wie auf ihr Objekt, sondern wie auf ihr Ziel. Thomas von Aquin, Summa theologiae, I II, q. 81,
Lieferung 9 Hilfsgerüst zum Thema: Gott als das Gute Die Religion richtet den Menschen auf Gott aus, nicht wie auf ihr Objekt, sondern wie auf ihr Ziel. Thomas von Aquin, Summa theologiae, I II, q. 81,
Geschichte der Philosophie II Mittelalter und frühe Neuzeit XI
 Geschichte der Philosophie II Mittelalter und frühe Neuzeit XI Mittelalter XI 02 Mittelalter XI 02 Aristotelesrezeption Gerardus Cremonensis/Gerhard von Cremona (1114 1187) Kanoniker in Toledo, Übersetzer
Geschichte der Philosophie II Mittelalter und frühe Neuzeit XI Mittelalter XI 02 Mittelalter XI 02 Aristotelesrezeption Gerardus Cremonensis/Gerhard von Cremona (1114 1187) Kanoniker in Toledo, Übersetzer
Informationszentrum für Touristen oder Gäste
 11. 01. 2016 09:36:28 Allgemeines Titel der Umfrage Informationszentrum für Touristen oder Gäste Autor Richard Žižka Sprache der Umfrage Deutsch Öffentliche Web-Adresse der Umfrage (URL) http://www.survio.com/survey/d/x2d7w9l8e4f8u4i5j
11. 01. 2016 09:36:28 Allgemeines Titel der Umfrage Informationszentrum für Touristen oder Gäste Autor Richard Žižka Sprache der Umfrage Deutsch Öffentliche Web-Adresse der Umfrage (URL) http://www.survio.com/survey/d/x2d7w9l8e4f8u4i5j
2. Lernjahr Aufgabenheft 4
 Datum: Klasse: Name: Selbsttest zum Unterrichtsertrag Latein 2. Lernjahr Aufgabenheft 4 BIFIE I Department Standardisierte kompetenzorientierte Reife- und Diplomprüfung Stella-Klein-Löw-Weg 15 / Rund Vier
Datum: Klasse: Name: Selbsttest zum Unterrichtsertrag Latein 2. Lernjahr Aufgabenheft 4 BIFIE I Department Standardisierte kompetenzorientierte Reife- und Diplomprüfung Stella-Klein-Löw-Weg 15 / Rund Vier
Incipit liber de divisione philosophiae in partes suas et partium in partes suas secundum philosophos
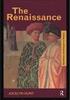 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. y trad. alemana Alexander Fidora y Dorothée Werner, colección Herders Bibliothek der Philosophie des Mittelalters, Freiburg, Herder. NB: Los números
Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. y trad. alemana Alexander Fidora y Dorothée Werner, colección Herders Bibliothek der Philosophie des Mittelalters, Freiburg, Herder. NB: Los números
Thomas von Aquin. Fragen über Glückseligkeit. Summe gegen die Heiden [Summa contra gentiles], Buch III, Kapitel (Auszüge)
![Thomas von Aquin. Fragen über Glückseligkeit. Summe gegen die Heiden [Summa contra gentiles], Buch III, Kapitel (Auszüge) Thomas von Aquin. Fragen über Glückseligkeit. Summe gegen die Heiden [Summa contra gentiles], Buch III, Kapitel (Auszüge)](/thumbs/70/62311392.jpg) Thomas von Aquin Fragen über Glückseligkeit Summe gegen die Heiden [Summa contra gentiles], Buch III, Kapitel 2 48 (Auszüge) 2. Kapitel GOTT ERKENNEN IST DAS ZIEL JEDER 1 2 3 GEISTIGEN [intellectualis]
Thomas von Aquin Fragen über Glückseligkeit Summe gegen die Heiden [Summa contra gentiles], Buch III, Kapitel 2 48 (Auszüge) 2. Kapitel GOTT ERKENNEN IST DAS ZIEL JEDER 1 2 3 GEISTIGEN [intellectualis]
Cicero, de re publica (1,1)
 Cicero, de re publica (1,1) 1 2 1 3 4 5 6 M. vero Catoni, homini ignoto et novo, 7 8 quo omnes, 9 10 11 12 qui isdem rebus studemus, 2. Relativsatz 13 14 15 16 17 18 quasi exemplari ad industriam virtutem/que
Cicero, de re publica (1,1) 1 2 1 3 4 5 6 M. vero Catoni, homini ignoto et novo, 7 8 quo omnes, 9 10 11 12 qui isdem rebus studemus, 2. Relativsatz 13 14 15 16 17 18 quasi exemplari ad industriam virtutem/que
Ein Satz wird auch dunkel werden wo solch ein Begriff einfliest; Klar: Ist Erkenntnis wenn man die dargestellte Sache wieder erkennen kann.
 Lebenslauf: Gottfried Wilhelm Leibniz: 1.Juli 1646(Leipzig) - 14. November 1716 (Hannover) mit 15 Besuchte er Uni Leipzig; mit 18 Mag; wegen seines geringen Alters (kaum 20) nicht zum Doktorat zugelassen;
Lebenslauf: Gottfried Wilhelm Leibniz: 1.Juli 1646(Leipzig) - 14. November 1716 (Hannover) mit 15 Besuchte er Uni Leipzig; mit 18 Mag; wegen seines geringen Alters (kaum 20) nicht zum Doktorat zugelassen;
Joachim Stiller. Platon: Menon. Eine Besprechung des Menon. Alle Rechte vorbehalten
 Joachim Stiller Platon: Menon Eine Besprechung des Menon Alle Rechte vorbehalten Inhaltliche Gliederung A: Einleitung Platon: Menon 1. Frage des Menon nach der Lehrbarkeit der Tugend 2. Problem des Sokrates:
Joachim Stiller Platon: Menon Eine Besprechung des Menon Alle Rechte vorbehalten Inhaltliche Gliederung A: Einleitung Platon: Menon 1. Frage des Menon nach der Lehrbarkeit der Tugend 2. Problem des Sokrates:
Von der Besinnung und dem Verstand
 Das elfte Buch Hermetis Trismegisti Rede an Asclepium Von der Besinnung und dem Verstand estern, lieber Asclepi! habe ich eine vollkommene Rede geführt, jetzt halte ich nötig, solches zu verfolgen und
Das elfte Buch Hermetis Trismegisti Rede an Asclepium Von der Besinnung und dem Verstand estern, lieber Asclepi! habe ich eine vollkommene Rede geführt, jetzt halte ich nötig, solches zu verfolgen und
Predigt zu allein die Schrift und allein aus Gnade am Reformationstag 2017
 Predigt zu allein die Schrift und allein aus Gnade am Reformationstag 2017 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit Euch allen. Amen
Predigt zu allein die Schrift und allein aus Gnade am Reformationstag 2017 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit Euch allen. Amen
Das Gewissen als Konvergenzpunkt der Wahrheit
 Lieferung 3 Hilfsgerüst zum Thema: Das Gewissen als Konvergenzpunkt der Wahrheit wo Wahrheiten und die Wahrheit konvergieren, so daß ihre Differenz deutlich wird Wahrheit und Wahrhaftigkeit Grundgesetz
Lieferung 3 Hilfsgerüst zum Thema: Das Gewissen als Konvergenzpunkt der Wahrheit wo Wahrheiten und die Wahrheit konvergieren, so daß ihre Differenz deutlich wird Wahrheit und Wahrhaftigkeit Grundgesetz
Anhang. LV Gang nach Canossa
 Anhang LV Gang nach Canossa Nachdem Heinrich IV. mit dem Kirchenbann belegt wurde und die deutschen Fürsten ihm das Ultimatum stellten, ihn nicht mehr anzuerkennen, sollte es dem König nicht gelingen den
Anhang LV Gang nach Canossa Nachdem Heinrich IV. mit dem Kirchenbann belegt wurde und die deutschen Fürsten ihm das Ultimatum stellten, ihn nicht mehr anzuerkennen, sollte es dem König nicht gelingen den
Ist Gott das Glück? Hilfsgerüst zum Thema: 1. Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius ( ) Lieferung 9
 Lieferung 9 Hilfsgerüst zum Thema: Ist Gott das Glück? 1. Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius (480 524) Philosoph, Christ (Laientheologe) und Staatsmann Senator in Rom Sein Vater war Konsul. Er
Lieferung 9 Hilfsgerüst zum Thema: Ist Gott das Glück? 1. Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius (480 524) Philosoph, Christ (Laientheologe) und Staatsmann Senator in Rom Sein Vater war Konsul. Er
Das Vernunftrecht. Prof. Dr. Thomas Rüfner. Materialien im Internet:
 Privatrechtgeschichte der Neuzeit Vorlesung am 28.05.2008 Das Vernunftrecht Prof. Dr. Thomas Rüfner Materialien im Internet: http://ius-romanum.uni-trier.de/index.php?id=20787 Naturrecht und Völkerrecht
Privatrechtgeschichte der Neuzeit Vorlesung am 28.05.2008 Das Vernunftrecht Prof. Dr. Thomas Rüfner Materialien im Internet: http://ius-romanum.uni-trier.de/index.php?id=20787 Naturrecht und Völkerrecht
A,4 Persönliches sich Mitteilen in der Gegenwart des Herrn (Schritt 4 und 5)
 A: Bibel teilen A,4 Persönliches sich Mitteilen in der Gegenwart des Herrn (Schritt 4 und 5) Zur Vorbereitung: - Bibeln für alle Teilnehmer - Für alle Teilnehmer Karten mit den 7 Schritten - Geschmückter
A: Bibel teilen A,4 Persönliches sich Mitteilen in der Gegenwart des Herrn (Schritt 4 und 5) Zur Vorbereitung: - Bibeln für alle Teilnehmer - Für alle Teilnehmer Karten mit den 7 Schritten - Geschmückter
Konditionalsatz (Fortsetzung) Relativsatz (Fortsetzung)
 L. Annaeus Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, ep. 35 Satz/Struktur 1 2 3 4 5 Cum te tam valde rogo, Temporalsatz 6 7 ut studeas, 8 9 10 meum negotium ago: Wunschsatz 1)Temporalsatz ( cum iterativum
L. Annaeus Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, ep. 35 Satz/Struktur 1 2 3 4 5 Cum te tam valde rogo, Temporalsatz 6 7 ut studeas, 8 9 10 meum negotium ago: Wunschsatz 1)Temporalsatz ( cum iterativum
t h e o l o g i a germanica
 t h e o l o g i a germanica Diesmal ist das Buch ohn Titel und Namen funden, schreibt Luther seiner ersten Ausgabe vor. In der Handschrift hat es einen Titel: es handle, heißt es dort, vom vollkommenen
t h e o l o g i a germanica Diesmal ist das Buch ohn Titel und Namen funden, schreibt Luther seiner ersten Ausgabe vor. In der Handschrift hat es einen Titel: es handle, heißt es dort, vom vollkommenen
Der Grund für die Notwendigkeit des Glaubens nach Thomas von Aquin
 Der Grund für die Notwendigkeit des Glaubens nach Thomas von Aquin William J. Hoye Erschienen in: Theologie und Philosophie, 70 (1995), 374 382. Der Ansatz In seiner Summa theologiae führt Thomas von Aquin
Der Grund für die Notwendigkeit des Glaubens nach Thomas von Aquin William J. Hoye Erschienen in: Theologie und Philosophie, 70 (1995), 374 382. Der Ansatz In seiner Summa theologiae führt Thomas von Aquin
WESEN UND WIRKEN DES HEILIGEN GEISTES
 WESEN UND WIRKEN DES HEILIGEN GEISTES 1 Einleitung Der christliche Glaube bekennt sich zum Heiligen Geist als die dritte Person der Gottheit, nämlich»gott-heiliger Geist«. Der Heilige Geist ist wesensgleich
WESEN UND WIRKEN DES HEILIGEN GEISTES 1 Einleitung Der christliche Glaube bekennt sich zum Heiligen Geist als die dritte Person der Gottheit, nämlich»gott-heiliger Geist«. Der Heilige Geist ist wesensgleich
B Gelübde C Nonne D Augustiner-Orden. A Mönch C Nonne D Augustiner-Orden
 1 A Kloster: Mönch Wie nennt man einen männlichen Bewohner eines Klosters? 1 B Kloster: Gelübde Wie nennt man das Versprechen, das jemand beim Eintritt in ein Kloster gibt? B Gelübde C Nonne D Augustiner-Orden
1 A Kloster: Mönch Wie nennt man einen männlichen Bewohner eines Klosters? 1 B Kloster: Gelübde Wie nennt man das Versprechen, das jemand beim Eintritt in ein Kloster gibt? B Gelübde C Nonne D Augustiner-Orden
1 B Kloster: Gelübde. 1 A Kloster: Mönch. Wie nennt man einen männlichen Bewohner eines Klosters?
 1 A Kloster: Mönch Wie nennt man einen männlichen Bewohner eines Klosters? 1 B Kloster: Gelübde Wie nennt man das Versprechen, das jemand beim Eintritt in ein Kloster gibt? 1 C Kloster: Nonne Wie nennt
1 A Kloster: Mönch Wie nennt man einen männlichen Bewohner eines Klosters? 1 B Kloster: Gelübde Wie nennt man das Versprechen, das jemand beim Eintritt in ein Kloster gibt? 1 C Kloster: Nonne Wie nennt
Philosophie des Glücks
 Geisteswissenschaft Veronika Gaitzenauer Philosophie des Glücks Glückslehren von der Antike bis zur Gegenwart Essay Philosophie des Glücks Glückslehren von der Antike bis zur Gegenwart 1. Definition von
Geisteswissenschaft Veronika Gaitzenauer Philosophie des Glücks Glückslehren von der Antike bis zur Gegenwart Essay Philosophie des Glücks Glückslehren von der Antike bis zur Gegenwart 1. Definition von
4. Anhang: Übersicht über die lateinischen Nebensatzarten
 4. Anhang: Übersicht über die lateinischen Nebensatzarten 4.1 Klassifikation der Nebensätze nach der Art der Pronomina oder Konjunktionen 4.1.1 Konjunktionalsätze Konjunktionalsätze werden eingeleitet
4. Anhang: Übersicht über die lateinischen Nebensatzarten 4.1 Klassifikation der Nebensätze nach der Art der Pronomina oder Konjunktionen 4.1.1 Konjunktionalsätze Konjunktionalsätze werden eingeleitet
Lateinische Stilübungen 3 / Exercitia latina. Text 7. (Cic. leg. 2, 27-28)
 Lateinische Stilübungen 3 / Exercitia latina Text 7 (Cic. leg. 2, 27-28) Dadurch dass das Gesetz aber befiehlt, zu Gottheiten erhobene Menschen (consecrari ex) wie Hercules und andere zu verehren, dann
Lateinische Stilübungen 3 / Exercitia latina Text 7 (Cic. leg. 2, 27-28) Dadurch dass das Gesetz aber befiehlt, zu Gottheiten erhobene Menschen (consecrari ex) wie Hercules und andere zu verehren, dann
"DER ERLÖSER IN DIR": Aus: ad.php?t=5342
 "DER ERLÖSER IN DIR": Aus: http://www.foren4all.de/showthre ad.php?t=5342 Es gibt seit langer Zeit eine Prophezeihung auf dieser Ebene, die von der "Wiederkunft Christi" spricht. Nun, diese Prophezeihung
"DER ERLÖSER IN DIR": Aus: http://www.foren4all.de/showthre ad.php?t=5342 Es gibt seit langer Zeit eine Prophezeihung auf dieser Ebene, die von der "Wiederkunft Christi" spricht. Nun, diese Prophezeihung
11. Gottes Vermögen bzw. Macht
 11. Gottes Vermögen bzw. Macht 11.1 Einleitung Gottes Recht und Gerechtigkeit sind für Voetius, wie wir gesehen haben, Dispositionen oder Tugenden des göttlichen Willens. Nicht Gottes Wissen, sondern sein
11. Gottes Vermögen bzw. Macht 11.1 Einleitung Gottes Recht und Gerechtigkeit sind für Voetius, wie wir gesehen haben, Dispositionen oder Tugenden des göttlichen Willens. Nicht Gottes Wissen, sondern sein
Glaube kann man nicht erklären!
 Glaube kann man nicht erklären! Es gab mal einen Mann, der sehr eifrig im Lernen war. Er hatte von einem anderen Mann gehört, der viele Wunderzeichen wirkte. Darüber wollte er mehr wissen, so suchte er
Glaube kann man nicht erklären! Es gab mal einen Mann, der sehr eifrig im Lernen war. Er hatte von einem anderen Mann gehört, der viele Wunderzeichen wirkte. Darüber wollte er mehr wissen, so suchte er
Wissen und Werte (Philosophie-Vorlesung für BA)
 Vorlesung Wissen und Werte (Philosophie-Vorlesung für BA) Zeit: Fr, 10-12 Uhr Raum: GA 03/142 Beginn: 15.04.2016 Anmeldefrist: BA: Modul V MEd nach alter Ordnung: - - - VSPL-Nr.: 020002 MA: - - - MEd nach
Vorlesung Wissen und Werte (Philosophie-Vorlesung für BA) Zeit: Fr, 10-12 Uhr Raum: GA 03/142 Beginn: 15.04.2016 Anmeldefrist: BA: Modul V MEd nach alter Ordnung: - - - VSPL-Nr.: 020002 MA: - - - MEd nach
Das Böse als die Ermangelung eines gesollten Guten
 Lieferung 2 Hilfsgerüst zum Thema: Das Böse als die Ermangelung eines gesollten Guten 1. Zur Einleitung: Pointierungen Hannah Arendt über die Banalität des Bösen : Ich bin in der Tat heute der Meinung,
Lieferung 2 Hilfsgerüst zum Thema: Das Böse als die Ermangelung eines gesollten Guten 1. Zur Einleitung: Pointierungen Hannah Arendt über die Banalität des Bösen : Ich bin in der Tat heute der Meinung,
Zwischen Naturalismus und Voluntarismus.
 2 Zwischen Naturalismus und Voluntarismus. Was uns die Philosophie und Theologie des Johannes Duns Scotus zu denken gibt 1 Dr. Axel Schmidt Papst Benedikt hat schon vor 50 Jahren bei seiner Antrittsvorlesung
2 Zwischen Naturalismus und Voluntarismus. Was uns die Philosophie und Theologie des Johannes Duns Scotus zu denken gibt 1 Dr. Axel Schmidt Papst Benedikt hat schon vor 50 Jahren bei seiner Antrittsvorlesung
Das Phänomen Wahrheit
 Lieferung 6 u. 7 Hilfsgerüst zum Thema: Das Phänomen Wahrheit 1. Die Bedeutung von Wahrheit Naturwissenschaft sucht und findet Wahrheiten. Wissenschaft ist... die Suche nach Wahrheit 1. Antonio R. Damasio
Lieferung 6 u. 7 Hilfsgerüst zum Thema: Das Phänomen Wahrheit 1. Die Bedeutung von Wahrheit Naturwissenschaft sucht und findet Wahrheiten. Wissenschaft ist... die Suche nach Wahrheit 1. Antonio R. Damasio
Gedanken zur eigenen (Un)Endlichkeit - ein nachdenklicher Pfarrer
 Gedanken zur eigenen (Un)Endlichkeit - ein nachdenklicher Pfarrer Was erwartet Sie heute nachmittag? Alltag und Unendlichkeit Alltag und Unendlichkeit Alltag und Unendlichkeit Die Zahl Pi Cornwall
Gedanken zur eigenen (Un)Endlichkeit - ein nachdenklicher Pfarrer Was erwartet Sie heute nachmittag? Alltag und Unendlichkeit Alltag und Unendlichkeit Alltag und Unendlichkeit Die Zahl Pi Cornwall
Die Existenz und Eigenschaften Gottes (I, 10 26)
 Lieferung 3 Hilfsgerüst zum Thema: Die Existenz und Eigenschaften Gottes (I, 10 26) 1. Thomas bekannte Einwände von Muslimen gegen den christlichen Glauben»Die Sarazenen spotten nämlich darüber, wie du
Lieferung 3 Hilfsgerüst zum Thema: Die Existenz und Eigenschaften Gottes (I, 10 26) 1. Thomas bekannte Einwände von Muslimen gegen den christlichen Glauben»Die Sarazenen spotten nämlich darüber, wie du
Referenten: Tim Dwinger, Sven Knoke und Leon Mischlich
 Kurs: GK Philosophie 12.2 Kurslehrer: Herr Westensee Referatsthema: Wahrheit vs. Logik Referenten: Tim Dwinger, Sven Knoke und Leon Mischlich Gliederung 1. Einleitung 2. Wahrheit 2.1.Thomas v. Aquin 2.1.1.
Kurs: GK Philosophie 12.2 Kurslehrer: Herr Westensee Referatsthema: Wahrheit vs. Logik Referenten: Tim Dwinger, Sven Knoke und Leon Mischlich Gliederung 1. Einleitung 2. Wahrheit 2.1.Thomas v. Aquin 2.1.1.
