INKLUSIV BILINGUAL MEHRSTUFIG: Das Wiener Schulmodell
|
|
|
- Hannelore Blau
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 ERZIEHUNG INKLUSIV BILINGUAL MEHRSTUFIG: Das Wiener Schulmodell VON SILV IA KRAMREITER 1. Modellbeschreibung Was bedeutet nun inklusiv, bilingual und mehrstufig? Zunächst werden diese drei pädagogischen Schwerpunkte im Einzelnen beschrieben und zusammengefasst, anschließend wird dokumentiert, wie sie in der Unterrichtspraxis ineinandergreifen Inklusiv 2 DZ Im Schuljahr 2012/13 wurde in Wien ein neues bilinguales Schulprojekt im Sekundarstufenbereich I mit zwei gehörlosen 1 und 15 hörenden Schüler/innen eröffnet. Ab dem Schuljahr 2014/15 umfasst dieses Schulmodell drei Klassen mit insgesamt 11 hörbeeinträchtigten Schüler/innen und um die 60 hörenden Schüler/innen im Rahmen einer achtstufigen Schulgemeinschaft von 6- bis 15-jährigen Schüler/innen. Das Schulkonzept beschreibt drei grundsätzliche Schwerpunkte: Der Unterricht wird inklusiv, bilingual und mehrstufig durchgeführt, wobei reformpädagogische Methodenansätze das gesamte Projekt zusätzlich mitgestalten und kreativ in den Schulalltag inkludiert werden. Die hörbeeinträchtigten Schüler/innen werden nach dem Regelschullehrplan unterrichtet in Deutsch gibt es hierbei die Möglichkeit einer Lehrplanänderung. Strukturelle, organisatorische und pädagogische Ressourcen sind grundsätzlich an das österreichische Integrationsgesetz angepasst. Durch den Expositurstatus 2 können jedoch zusätzliche Ressourcen freigespielt werden. Alle Unterrichtsstunden sind zumindest doppelt- bis dreifachbesetzt (höhere Lehrer/innenbesetzung durch die Mehrstufigkeit und durch den Lehrplan der Neuen Mittelschule). Ein Team von Regelschullehrer/inne/n unterrichtet abwechselnd mit hörenden Gebärdensprachpädagoginnen und gehörlosen Pädagoginnen. Die Schulgemeinschaft definiert sich wiederum anhand der zielgleichen Integration/Inklusion : Alle Schüler/innen werden nach den gleichen Rahmenrichtlinien unterrichtet. 3 Konkret bedeutet dies, dass Schüler/innen mit Hörbeeinträchtigung zielgleich (mit den nichtbehinderten Schüler/inne/n) nach dem Regelschullehrplan und unter Verwendung gleicher Unterrichtsmittel (Schulbücher) unterrichtet werden. Der Nachteilsausgleich wird durch konkret definierte methodisch-didaktische Lehrstrukturen sichergestellt. Dies implementiert eine bilinguale Unterrichtsführung, spezielle gehörlosenpädagogische Unterrichtsmethoden sowie gezielte Zeitressourcen für die gehörlosen Schüler/innen. Förderstunden zur Festigung des Lernstoffs, Hörübungen, Artikulationsstunden, Gebärdensprachstunden und therapeutisch-funktionelle Übungen werden zusätzlich angeboten. Österreich kann seit über 20 Jahren auf Erfahrungen im integrativen Unterricht zurückgreifen. Bilingual geführte Klassen gibt es seit den Anfängen der Integration. Wissenschaftlich begleitete bilinguale Integrationsklassen wurden ausführlich von Krausneker (2004) und Kramreiter (2011) dokumentiert. Um von einem inklusiven Schulalltag sprechen zu können, müssen ganz konkrete Rahmenbedingungen erfüllt sein. Da die Schüler/innen hörend und gehörlos sind, wird der Unterricht in ÖGS und Deutsch abgehalten und zwar möglichst zeitgleich. Weiters wird die Identifikation mit Sprache, Kultur und Gemein- 1 Nachfolgend ist abwechselnd von gehörlosen und hörbeeinträchtigten Kindern bzw. Schüler/innen die Rede, womit alle inklusiv geführten Schüler/innen gemeint sind. Grundsätzlich handelt es sich um eine heterogene Sprachgruppe (von mittelgradig schwerhörigen bis zu gehörlosen Schüler/inne/n). Die Gemeinsamkeit dieser heterogenen Sprachgruppe zeigt sich in der Gebärdensprachkompetenz (Österreichische Gebärdensprache (ÖGS)). 2 Die hörbeeinträchtigten Schüler/innen und die Integrationspädagog/inn/en in der Regelschule werden der Sonderinstitution administrativ zugeordnet. 3 Auch das Modell Waldschule (Kramreiter 2012) hatte sich an diesen Prinzipien orientiert.
2 BILDUNG DZ Abb. 1: Wiener Modell: Klassenraum mit Smartboard, runden bunten Tischen, bunten Wänden und Vorhängen schaft gehörloser Menschen über und durch gehörlose Pädagoginnen direkt in die Klasse und in die Schule hineingetragen Bilingual Bilinguales Teamteaching (Zwei- Lehrer/innen-System in allen Unterrichtsstunden) zeigt sich in der Anwesenheit zweier Pädagog/inn/en, welche in beiden Sprachen (ÖGS und Deutsch) im Unterricht in allen Unterrichtstunden Bildungsinhalte erarbeiten, erklären, wiederholen und festigen. Abwechselnd übernimmt eine gehörlose Pädagogin und eine hörende gebärdensprachkompetente Integrationslehrkraft den Unterricht als Zweitlehrerin. Die Unterrichtsstunden der gehörlosen bzw. hörenden Integrationspädagogin sind möglichst gleich von der Anzahl aufgeteilt. Natürlich wird auf Fachqualifikationen Rücksicht genommen. Das bedeutet u. a., dass die gehörlosen Lehrkräfte ihre studierten Fächer z. B. Mathematik und Sport vorrangig abdecken. ÖGS-Unterricht jeweils für hörende und gehörlose Schüler/innen, allerdings nicht als Schulfach (s. u.) wird ebenfalls von den gehörlosen Kolleginnen geplant und gehalten. Der Zugang zur Gehörlosengemeinschaft und Kultur wird über die gehörlosen Lehrkräfte mit in den Unterricht getragen. Außerschulische Veranstaltungen und spezifische Schulveranstaltungen (z. B. Talking Gloves Gehörlosentheater 2013/14) werden durch Workshops und Projekte in den Schulalltag inkludiert und gestalten das Schulumfeld sehr intensiv mit. Die hörenden Mitschüler/innen und die hörenden Teamlehrer/innen erleben die gehörlosen Pädagoginnen und die gehörlosen Schüler/innen ausschließlich als anderssprachig. Ein Defizit wird eher in der mangelhaften ÖGS-Kompetenz der hörenden
3 ERZIEHUNG NMS 4 DZ Lehrer/innen und einiger hörender Schüler/innen gesehen hier wird ggf. auf konstruktive kommunikative Ersatzstrategien (z. B. Aufschreiben, Darstellen, Fingeralphabet) zurückgegriffen. Zusätzlich erleben die gehörlosen Schüler/innen ihre gehörlose Lehrerin im Schulumfeld als kompetent, gleichwertig und voll anerkannt. Dies wirkt sich positiv auf deren eigenes Selbstwertgefühl und Identitätsentwicklung aus. Sie sind stolz auf ihre innovativen jungen gehörlosen Lehrerinnen und sie nehmen sie als erstrebenswerte Vorbilder wahr. Dies wird auch häufig bei Gesprächen über Berufswünsche geäußert. Ein weiterer Aspekt, welcher bisher selten zur Sprache kam, ist die Tatsache, dass die gehörlosen Kolleginnen Informationsträgerinnen für das hörende Lehrer/innenteam darstellen. Bei Unsicherheiten im Umgang mit den hörbeeinträchtigten Schüler/innen werden sie um Rat gefragt ggf. auch hinsichtlich ihrer Erfahrungen zu unterschiedlichen Situationen im Schulalltag. Dies ist für das gesamte Team sehr bereichernd, da Problematiken auch von der Seite der Betroffenen dargestellt werden können. Somit werden Missverständnisse verringert und konstruktive Lösungsvorschläge schneller gefunden. Wie schon kurz erwähnt, lernen auch die hörenden Mitschüler/innen ÖGS. Im österreichischen Lehrplan ist ein solcher Unterricht zwar nicht als Fach verankert, aber autonome Unterrichtsgestaltungsmöglichkeiten erlauben dieses Angebot. Hierfür wird einmal in der Woche eine Unterrichtseinheit freigespielt. Auch für die hörenden Teamlehrer/innen wurde über die Pädagogische Hochschule ein ÖGS-Kursangebot, welches von einer gehörlosen Pädagogin gehalten wurde, zur Verfügung gestellt. Im Rahmen einer unverbindlichen Übung einmal pro Woche bekommen auch die gehörlosen Schüler/innen von der gehörlosen Lehrkraft Unterricht bezüglich Aufbau und Grammatik der ÖGS. Dies ist momentan die einzige Möglichkeit für gehörlose Schüler/innen, ÖGS- Unterricht zu erhalten. Die Implementierung eines eigenen Unterrichtsfachs ist trotz oftmaliger Interventionen in Österreich bis heute nicht gelungen. Zusammengefasst ist bilingualer Unterricht durch konkrete Komponenten abgesichert: Doppelbesetzung in allen Stunden d. h. zweisprachiger Unterricht in allen Unterrichtsstunden; gehörlose Lehrkräfte gleichwertig im Team und Schulalltag; hohe Gebärdensprachkompetenz durch Native Signerinnen, regelmäßige gehörlosenspezifische außerschulische und schulische Veranstaltungen; ÖGS-Unterricht für hörende und gehörlose Schüler/innen; ÖGS-Kurse für hörende Teamlehrer/innen. Bis auf die Implementierung eines Unterrichtsfachs ÖGS haben wir alle unsere Forderungen durchsetzen können und mit unserem engagierten Team haben wir ein inklusives Beschulungsmodell geschaffen, welches uns allen, Schüler/innen und Pädagog/inn/en, großen Spaß bereitet. Eine Schule, die Spaß macht, und ein innovatives Unterrichtskonzept waren unser Ziel und dieses Ziel haben wir erreicht. 1 VS Mehrstufig Eine mehrstufige Klasse zeigt sich in altersheterogenen Schüler/innen und gliedert sich in unterschiedliche Jahrgangsgruppen (Stammklassen). Unsere Schulgemeinschaft umfasst drei Stammklassen (s. Abb. 2): Die Stammklasse 1 (dunkelgrau) besteht aus den ersten drei Schulstufen inklusive der Vorschulstufe, die Stammklasse 2 (mittelgrau) aus der vierten bis sechsten Schulstufe und die Stammklasse 3 (hellgrau) aus der siebenten und achten Schulstufe Raumkonzept und Sitzordnung Die drei Klassen sind durch ein eigenes Raumkonzept miteinander ver- 5 Abb
4 BILDUNG Stammklasse Stammklasse Stammklasse 3 Abb. 3 DZ bunden. Sie sind im Schulgebäude in einem eigenen halb abgeschlossenen Trakt untergebracht, wo sie durch einen Gang und über Verbindungstüren zwischen den einzelnen Klassenräumen zueinander Zugang haben. So findet in den Pausen und auch manchmal während der Unterrichtsstunden ein reger Kontakt zwischen den acht Schulstufen statt. Auch ein zusätzlicher Ausweichraum steht für die Klassen zur Verfügung. Das Raumkonzept beeinflusst die soziale Dynamik und den sprachlichen Kontakt unter den jüngeren und älteren gehörlosen Schüler/inne/n positiv. Letztere können einerseits mit ihren hörenden Mitschüler/inne/n oder andererseits mit ihrer Sprachgruppe, den gehörlosen Schüler/inne/n, interagieren. Sehr interessant zu beobachten ist der Austausch unter den Altersgruppen in der Pause. In den letzten beiden Jahren wurden die Pausen mit allen Schüler/inne/n von 6 bis 15 Jahren gleichzeitig abgehalten und das Pausenklima ist geprägt von Rücksichtnahme, Umsorge (z. B. ältere Schüler/innen helfen jüngeren Schüler/inne/n) und gemeinsamen Spielen (Fußball, Karten, Geschicklichkeitsspiel usw.). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die 8-stufige Schulgemeinschaft durch ein durchdachtes Raumkonzept (s. Abb. 3) zusätzlich positiv unterstützt wird. Die Sitzordnung in der Klasse ist ausgerichtet auf das Arbeiten mit Wochenplänen im Rahmen eines offenen Unterrichts. Die Schüler/innen sitzen an bunten runden Tischen, welche man teilweise in zwei Hälften teilen kann, um von Gruppenarbeiten in Partner- oder Einzelarbeiten übergehen zu können (s. auch Abb. 1) Methodisch- didaktisches Konzept Nahtloser Übergang von der 1. bis zur 8. Schulstufe Die Beseitigung der Nahtstelle zwischen Grundstufe und Sekundarstufe soll den fließenden Übergang von Stufe 4 auf Stufe 5 ermöglichen. Gemeinsame regelmäßige Projekte (z. B. Tanzprojekt, Zirkusprojekt, Signdance) und Workshops werden organisiert und gestaltet. Bei bestimmten Unterrichtsveranstaltungen arbeitet die gesamte Grundstufe mit der Sekundarstufe zusammen. Fördern und Fordern durch Wochenpläne Um den Schüler/innen Handlungskompetenzen vermitteln zu können, werden Lehr- und Unterrichtsmethoden verwendet, die die aktive Kooperation der Schüler/innen ermöglichen. Offener Unterricht und das Arbeiten mit Wochenplänen bestimmen den Schulalltag. Aktives und selbst gesteuertes Lernen wird dadurch forciert. Die Schüler/innen werden ermutigt, selbstständig und aktiv zu handeln und eigene Lösungsstrategien anzuwenden. Das Einteilen der eigenen Zeitressourcen und das Auswählen der Reihenfolge der zu machenden Aufgaben ermöglichen den Schüler/innen ein selbstverantwortliches Lernen nach eigenen Bedürfnissen. Durch Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit werden Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung
5 ERZIEHUNG 6 DZ reflexiv gegenübergestellt und das Arbeiten im Team geübt. Auch hier kann beobachtet werden, dass das mehrstufige Modell sich auch als hervorragendes Stützsystem für die Schüler/innen eignet. So erklären und wiederholen schneller arbeitende Schüler/innen langsamer arbeitenden Schüler/inne/n Aufgaben kindgerecht und oft mit ausdauernder Geduld und festigen hierdurch gleichzeitig die erlernten Bildungsinhalte. Das Miteinander-Lernen und -Erarbeiten von Lerninhalten ist für alle Schüler/innen motivierend und bereitet Freude am Lösen von Aufgaben. Die Sitzordnung an den runden Tischen unterstützt das gemeinsame Arbeiten. Individuelle Förderung und Zeitressourcen durch Wochenpläne Das didaktische Konzept der Wochenpläne spielt flexible Zeitressourcen für die Lehrer/innen frei. Dies bedeutet: Sind Schüler/innen mit ihren Wochenplänen beschäftigt und bei einzelnen Schüler/inne/n tauchen Fragen auf, haben Lehrer/innen genügend Zeit, sich individuell dem/der Schüler/in zuzuwenden und Fragen zu klären oder Bildungsinhalte nochmals zu erklären. Dies kann so aussehen, dass die Lehrkräfte auf die Schüler/innen zugehen, während sie in der Klasse herumgehen, oder aber die Schüler/innen wenden sich an die am Lehrertisch sitzenden Lehrkräfte. Beide Möglichkeiten werden wiederum sehr gezielt eingesetzt, wobei das Herumgehen der Pädagog/inn/en in der Klasse vor allem dann zu beobachten ist, wenn Bildungsinhalte gerade erst neu erarbeitet wurden. In solchen Situationen rechnen die Lehrkräfte mit einem erhöhten Fragebedarf und können so schnell von Schü - ler/inne/n zu Schüler/inne/n wechseln. Besteht weniger Fragebedarf, können Schüler/innen vereinzelt auch direkt zum Lehrertisch kommen und Informationen einholen. Diese Form würde jedoch bei einem hohen Fragebedarf eine ansteigende Unruhe in die Klassen bringen, da viele Schüler/innen in Bewegung wären. Diszipliniertes und ruhiges Arbeiten mit Wochenplänen Wochenpläne ermöglichen den Schüler/inne/n, ein individuelles Tempo, eigenständiges Auswählen der zu erledigenden Aufgaben, Selbstkontrolle und Kompetenzen zur selbstständigen Entscheidungsund Lösungsfindung zu entwickeln. Durch die Mehrstufigkeit orientieren sich die jüngeren Schüler/innen an den älteren Schüler/inne/n. Sie beobachten die eingearbeiteten Schüler/innen beim konzentrierten Arbeiten und erkennen sehr schnell, wie und mit welchen Strategien die gestellten Aufgaben effektiv erfüllt werden können. Der Anreiz, dass diejenigen Schüler/in - nen, die in der Schule effizient gearbeitet haben, zu Hause wenig bis nichts mehr erledigen müssen, ist für alle Schüler/innen hoch. Da alle Schüler/innen das Ziel haben, wenig bis keine Hausaufgaben mit nach Hause zu nehmen, ist die Selbstregulierung der Klasse innerhalb der Schüler/innengemeinschaft durch konkrete Strategien geregelt. So geben die älteren Schüler/innen acht, dass in der Klasse ruhig gearbeitet wird. Weiter hat sich eine Art Co-Lehrer/innensystem entwickelt, indem sich die Schüler/innen untereinander helfen, um schneller mit den Aufgaben fertig zu werden. Hierbei wird genau darauf geachtet, dass das Geben und Nehmen ausgeglichen bleibt. Meint z. B. ein/e Schüler/in, er/sie könne nur abschreiben oder Hilfe in Anspruch nehmen, dann wird ein solches Verhalten von der Klassengemeinschaft nicht toleriert. Lernzielkontrollen und Schularbeiten Regelmäßig werden in allen Fächern größere und kleinere Lernzielkontrollen durchgeführt. Meistens werden sie vorab im Semesterplan welchen die Schüler/innen am Anfang des Schuljahrs bekommen eingetragen, sodass sich die Schüler/innen rechtzeitig vorbereiten können. Kurz vor der Lernzielkontrolle werden noch Übungsphasen angeboten, in denen der Lernstoff gemeinsam nochmals grob durchgearbeitet wird. Schularbeiten werden genauso angeboten, wie sie im Lehrplan vorgesehen sind. Die Deutschschularbeiten werden in mehrere Teilkompetenzen gegliedert Grammatik-, Rechtschreib- und Aufsatzteil. Anwendung von unterschiedlichen Lehrplänen Es besteht auch die Möglichkeit, gehörlose Schüler/innen nach dem Lehrplan der Sekundarstufe I für Gehörlose zu beurteilen. Meistens wird dies bei den Deutschschularbeiten angeboten und birgt mehrere Vorteile: Einerseits haben die Schüler/innen mehr Zeit, die Bildungsinhalte zu festigen, und andererseits kann die Gebär-
6 BILDUNG densprachpädagogin jederzeit die gehörlosen Schüler/innen in den Regelschullehrplan umstufen. Dies wird immer mit den gehörlosen Schüler/inne/n besprochen und durch eine Doppelausfolgung der Noten transparent dokumentiert. Doppelausfolgung der Noten in unterschiedlichen Lehrplänen Was bedeutet eine Doppelausfolgung der Noten? Ein solcher Benotungsmodus wird nur bei den Schularbeiten in Deutsch (eventuell auch in Englisch) angeboten und funktioniert folgendermaßen: Der/die Regelschullehrer/in benotet die Schularbeit des/der gehörlosen Schülers/Schülerin mit Prozenten nach dem Regelschullehrplan und die Gebärdensprachpädagogin benotet die Schularbeit ein zweites Mal mit Prozenten, dieses Mal aber nach dem Gehörlosenlehrplan. Das Ergebnis sähe bspw. folgendermaßen aus: 72 % RL / 85 % GL (RL = Regelschullehrplan / GL = Gehörlosenlehrplan). Somit weiß der/die Schüler/in, nach dem Lehrplan der Regelschule würde die Schularbeit mit der Note 3 und nach dem Gehörlosenlehrplan mit der Note 2 benotet werden. Im vorliegenden Fall würde natürlich relativ schnell in den Regelschullehrplan umgestuft, da der/die gehörlose Schüler/in auch im Regelschullehrplan eine positiv gut abgesicherte Note erreichen würde. Die Schüler/innen schätzen diese Doppelausfolgung der Noten, da sie sich selbst auf diese Weise in Bezug auf beide Lehrpläne gut einschätzen können und auch selbst spüren, wann der Zeitpunkt für eine Umstufung gekommen ist. Benotungsschlüssel Die gesamten Prüfungsmodalitäten werden in Prozente berechnet, wobei die Schüler/innen wissen, welcher Prozentrahmen welche Note ergibt. Dies hat den Vorteil, die Leistungen der Schüler/innen sehr genau bestimmen zu können. 2. Schul- und Klassenprofil 2.1. Expositurklassen in der Regelschule Alle drei Stammklassen werden organisatorisch und administrativ am Bundesinstitut für Gehörlosenbildung in Wien im 13. Bezirk geführt. Das Bundesinstitut ist die Stammschule und somit für die gehörlosen Schüler/innen, die Gebärdensprachpädagoginnen und für die Ausstattung in den Klassenräumen verantwortlich. Der Klassenstandort ist an der Volksschule und Neuen Mittelschule im 8. Bezirk. Es ist sozusagen eine Klasse in einer Klasse. Die Gebärdensprachpädagoginnen sind auch Klassenvorstände der gehörlosen Kinder und somit hauptverantwortlich für diese. Alle Unterrichtsstunden werden an der Regelschule gehalten, zudem werden den gehörlosen Kindern mehrere Zusatzstunden pro Woche (ÖGS-Übungsstunden, Artikulationsstunden, CI-Stunden und Therapiestunden) angeboten. Die gehörlosen Volksschulkinder werden am Nachmittag auch am Standort im 8. Bezirk im Hort mitbetreut. Da es für die Mittelschulschüler/innen keine Nachmittagsbetreuung gibt, werden einige gehörlose Schüler/innen mit einem Busdienst mittags in den Hort des Bundesinstituts gebracht Volksschulklasse 1. bis 4. Stufe plus Vorschulklasse Die inklusive Volksschulklasse wurde erst im laufenden Schuljahr 2014/15 eröffnet. In der Volksschulklasse befinden sich insgesamt 27 Kinder. Drei Schüler/innen sind hörbeeinträchtigt. Alle Unterrichtsstunden sind dreifach besetzt: zwei Regelschullehrer/innen und abwechselnd eine hörende Gebärdensprachpädagogin und eine gehörlose Pädagogin unterrichten in der Klasse. Die Dreifachbesetzung ergibt sich aus der Mehrstufigkeit von der 1. bis zur 4. Schulstufe und der jeweiligen Präsenz einer Pädagogin für die gehörlosen Schüler/innen. In der Regel wird in Österreich in Integrationsklassen die Höchstanzahl von 20 Schüler/innen nicht überschritten. Da es sich jedoch um eine mehrstufige Integrationsklasse/Inklusionsklasse handelt, die mit einer Dreifachbesetzung ausgestattet ist, umfasst die Schüler/innenanzahl 27 Kinder. Eine Regelschulpädagogin besitzt Grundkenntnisse der ÖGS. Alle Lehrer/innen haben Teamerfahrung, jedoch ist die inklusive Beschulung von gehörlosen Schüler/innen für beide Regelschulpädagog/inn/en neu. Sie konnten jedoch zwei Jahre lang Erfahrungen und Beobachtungen in der Nebenklasse (Neue Mittelschule) mit gehörlosen Schüler/innen sammeln Neue Mittelschulklasse 5./6. Stufe Diese Klasse wurde vor zwei Jahren im Schuljahr 2012/13 eröffnet. Das Modellprojekt begann mit 15 hörenden Schüler/inne/n und zwei gehörlosen Schüler/inne/n in der 5. Schulstufe. Im Schuljahr 2013/14 kam ein DZ
7 ERZIEHUNG 8 DZ schwerhöriger Schüler in die 5. Schulstufe und ein neuer gehörloser Schüler in die 6. Schulstufe dazu. Insgesamt waren es nun 4 hörbeeinträchtigte Schüler/innen (in der 5. Stufe ein schwerhöriger Schüler und in der 6. Stufe drei gehörlose Schüler/innen). 2014/15 wechselten die drei gehörlosen Schüler/innen der 6. Stufe in die 7. Stufe und somit in die Nebenklasse (s. Abb. 3). Im Schuljahr 2014/15 begannen drei neue gehörlose Schüler/innen und 13 hörende Schüler/innen in der 5. Stufe. Die Mittelschulklassen sind in allen Unterrichtsstunden doppelt besetzt. Eine Regelschullehrerin und abwechselnd eine hörende Gebärdensprachpädagogin und eine gehörlose Pädagogin arbeiten im Team. Der Klassenvorstand der gehörlosen Schüler/innen wurde von einer hörenden Gebärdensprachpädagogin übernommen Neue Mittelschulklasse 7./8. Stufe Die Schüler/innen der 6. Stufe wechselten wie gesagt im Schuljahr 2014/15 in die 7. Stufe und somit in die Nebenklasse. Ein weiterer gehörloser Schüler aus einem anderen Bundesland kam dazu. Nun sind es vier gehörlose Schüler/innen in der Stufe 7. Die Doppelbesetzung der Pädagoginnen ist ähnlich wie in der 5./6. Stufe. Nur stellt hier eine gehörlose Pädagogin den Klassenvorstand der hörbeeinträchtigten Schüler/innen. Das Mehrstufenmodell ermöglicht, dass hörbeeinträchtigte Schüler/innen jedes Jahr in allen Stufen dazustoßen können. Für das Schuljahr 2015/16 sind wir voll belegt und mussten leider auch Schüler/innen aus einem anderen Bundesland ablehnen. Im kommenden Schuljahr sollen insgesamt 7 neue hörbeeinträchtigte Schüler/innen in allen drei Stammklassen in unterschiedlichen Schulstufen dazukommen. 3. Unterrichtspraxis 3.1. Schulische Inklusion gehörloser Schüler/innen Da die schulische Integration in Österreich seit 1992 positiv im Pflichtschulsystem verankert wird, wurde das integrative/inklusive, bilinguale Unterrichtssetting in die regulären Integrationsstrukturen eingebettet. Seit 2000 wurden unterschiedliche Schulmodelle wissenschaftlich begleitet (zu den bilingualen Schulprojekten vgl. Krausneker 2004 und Kramreiter 2011). Zusammengefasst zeigen sich folgende organisatorische und pädagogische Strukturen im Unterricht: Teamteaching (Zwei-Lehrer/innen- System in allen Unterrichtsstunden): Für beide Sprachen sind Pädagog/inn/en für die Schüler/innen im Unterricht anwesend. Abwechselnd sollte ein/e gehörlose/r Pädagoge/Pädagogin oder Unterrichtsassistent/in und eine hörende gebärdensprachkompetente Integrationslehrkraft den Unterricht als Zweitlehrer/in übernehmen. Regelschulstandort mit Expositurstatus: Gemischte Klassen (mit hörenden und gehörlosen Schüler/innen) befinden sich meist an einer Regelschule, wobei die organisatorischen Belange im Verantwortungsbereich der Sonderinstitution (Stammschule) bleiben. Dies birgt insofern Vorteile, als die Sonderinstitution die technische Ausstattung übernimmt, die gebärdensprachkompetenten Pädagog/inn/en zur Verfügung stellt und somit die gesamte Unterrichtsstundenanzahl durch eine/n Sonderpädagogen/-pädagogin absichert. Das Zeugnis wird von der Regelschule ausgestellt, wobei Lehrplanzuordnungen konkret gekennzeichnet werden. Die inklusive Beschulung kann somit zielgerichtet, d. h. sowohl nach dem Regelschullehrplan als auch in einzelnen Gegenständen nach dem Lehrplan für Gehörlose erfolgen. Spezifische bilinguale Unterrichtskriterien: Die Unterrichtssprachen sind ÖGS und Deutsch, wobei beide Sprachen eine gleichberechtigte Stellung im Unterricht einnehmen; vorrangiges Ziel ist es, die Gebärdensprachkompetenzen der gehörlosen Schüler/innen zu erweitern und eine lautsprachliche Lese- und Schreibkompetenz aufzubauen; wenn die gehörlosen Schüler/innen es wünschen, wird die Lautsprache Deutsch sprechtechnisch geübt und verfeinert; Gebärdensprachunterricht soll zumindest in einer unverbindlichen Übung (UÜ) von einem/einer Native Signer/in unterrichtet werden (getrennt für hörende und gehörlose Schüler/innen); die Gebärdensprache wird zur Vermittlung von Bildungsinhalten und als Unterrichts- und Alltagskommunikation eingesetzt; Deutsch wird einerseits mit spezifischen didaktisch-methodischen Unterrichtspraktiken und andererseits auch mithilfe der Regelschuldidaktik vermittelt und gelernt;
8 BILDUNG in Inklusiven Klassen soll Gebärdensprache für hörende Schüler/innen im Rahmen einer UÜ durch eine/n Native Signer/in angeboten werden; Sensibilisierung der hörenden Schüler/innen und der Regelschulpädagog/inn/en durch Bildungsinhalte über Gehörlosenkultur und Gebärdensprache soll mit in den allgemeinen Unterricht eingebettet werden Gebärdensprache und Deutsch als Unterrichtssprachen In den Klassen verwenden die Regelschullehrer/innen ausschließlich die Lautsprache in gesprochener und geschriebener Form, da sie die Gebärdensprache nur in Grundzügen beherrschen. Der Part der hörenden Gebärdensprachlehrerin umfasst ÖGS und lautsprachbegleitendes Gebärden (LBG). Die gehörlose Pädagogin kommuniziert in ÖGS und in schriftlichem Deutsch. Die Gebärdensprache wird durch die hörende gebärdensprachkompetente Pädagogin und durch die gehörlose Pädagogin in das lautsprachliche Bildungsumfeld mitinkludiert. Teilweise werden Anweisungen und Inhalte der Regelschulpädago - g/inn/en in ÖGS zeitgleich übersetzt und während der Wochenplanarbeiten werden Bildungsinhalte, welche mehr Zeit oder eine intensivere Erklärung benötigen, nochmals und nach gehörlosendidaktischen Methoden (z. B. beim Erarbeiten von umfangreichen Textpassagen) bearbeitet und gefestigt. LBG wird ausschließlich im Lese- und Schreibprozess verwendet. Bei den Übungsphasen vor den Lernzielkontrollen wird nach gehörlosenspezifischen Unterrichtsmethoden gearbeitet. Konkrete Strukturierungen, Zusatzerklärungen und Zwischenschritte werden gefestigt. Anfangs wurden solche Übungsphasen mit den gehörlosen Schüler/inne/n alleine durchgearbeitet. Hier entwickelte sich ein sehr interessantes Phänomen: Langsam gesellten sich auch hörende Schüler/innen zu uns, da sie diese zusätzlichen Erklärungen gerne in Anspruch nahmen, um ebenfalls besser zu verstehen. Mittlerweile ist es Brauch, dass die gesamte Klasse zusammenkommt, sobald die Gebärdensprachpädagogin beginnt, Lernstoff zu festigen. Die Gebärdensprachpädagogin wird nun auch gebeten, vor bestimmten Lernzielkontrollen solche Übungsphasen mit der Klasse durchzuarbeiten. Besonders für Kinder mit nicht deutscher Muttersprache sind die gehörlosenspezifischen Unterrichtsmethoden von Vorteil. Es wird akribisch darauf geachtet, dass alle Schüler/innen alle Bildungsinhalte verstehen. Die Schüler/innen sehen alle Lehrer/innen als gleichwertig an. Bei Fragen, Aufgaben, Erklärungen, Verbesserungen usw. wenden sich hörende Kinder auch an die gehörlose Pädagogin/hörende Gebärdensprachpädagogin bzw. gehörlose Kinder an die Regelschulpädagog/inn/en. Obwohl die Regelschulpädagog/inn/en nur in der Lautsprache kommunizieren, wird der Kontakt zu ihnen von den gehörlosen Schüler/inne/n im gleichen Maße gepflegt, wie zu den gebärdensprachkompetenten Lehrerinnen. Sie verwenden bei der Kontaktaufnahme mit den Regelschullehrkräften vorrangig die Lautsprache. Ein zusätzlich wichtiger Aspekt ist die Visualisierung des Unterrichts. Neue Ausdrücke werden sofort an die Tafel oder auf das Smartboard geschrieben. Das Smartboard wird entweder parallel zur Tafel für Zwischenschritte verwendet oder als Speicherplatz für neue Ausdrücke gebraucht ÖGS als Unterrichtsfach Der gesamte Unterricht wird zwar in beiden Sprachen abgehalten (ÖGS und Deutsch), doch der Unterrichtsgegenstand ÖGS ist wie oben bereits ausgeführt bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Lehrplan für gehörlose Schüler/innen nicht verankert. Es gibt lediglich eine unverbindliche Übung, zu der sich die Schüler/innen zu Beginn des Schuljahrs anmelden können. Manchmal wird auch das Pflichtfach Therapeutisch funktionelle Übungen, welches zwei Stunden in der Woche zusätzlich angeboten wird, für einen kontrastiven Grammatikunterricht verwendet. Hier muss aber wiederum darauf hingewiesen werden, dass diese eine konkrete Gebärdensprachstunde viel zu wenig ist, um auch eine Förderung in der Gebärdensprachgrammatik abdecken zu können. Es wäre wünschenswert, wenn das Unterrichtsfach Gebärdensprache endlich im offiziellen Lehrplan verankert wäre dort könnten auch die Geschichte der Gehörlosen und die Gehörlosenkultur ihren Platz finden. Dieses Fach würde für gehörlose wie auch hörende Schüler/innen eine interessante Bereicherung darstellen. In Österreich gibt es zwei Schulen, die ÖGS autonom von der Schule ausgehend als Schularbeitsfach oder auch schon als Maturafach anbieten. Seit 2014 können hörbeeinträchtigte Schüler/innen in einer DZ
9 ERZIEHUNG 10 DZ Schule in Wien in ÖGS maturieren, sprich ihr Abitur ablegen Bilinguales Teamteaching Da die Schulgemeinschaft aus 8 Stufen besteht, sehen wir uns als ein einheitliches Team, welches aus 2 Volksschullehrer/innen, 5 Mittelschullehrer/innen und 7 Gebärdensprachpädagoginnen besteht. Es wird darauf geachtet, dass beide Sprachen gleichberechtigt eingesetzt und für alle Schüler/innen die Unterrichtsinhalte in gleicher Qualität vermittelt werden. Für Gespräche und Planungen ist jede Woche eine Teamsitzung im Stundenplan vorgesehen. Wir mussten ein Jahr ohne Teamsitzungen arbeiten, da diese bei der Planung der Unterrichtsstunden nicht berücksichtigt worden waren. In dem betreffenden Jahr gab es im Vergleich zu den anderen Jahren wesentlich mehr Spannungen und Missverständnisse. Dieses Schuljahr haben wir wiederum eine regelmäßige Teamsitzung eingefordert, die dann auch gewährt wurde. Die Regelschullehrer/innen sowie die Gebärdensprachpädagoginnen fühlen sich für alle Bildungs- und Erziehungsthemen bei allen Schüler/innen gleichermaßen zuständig. Seit dem Schuljahr 2014/15 arbeiten zwei gehörlose Pädagoginnen an der Schule. Für das Team ist dies eine neue Herausforderung, da nun auf eine sehr strukturierte Kommunikationskultur geachtet werden muss. Durcheinanderreden kann nicht mehr toleriert werden, da die hörenden Gebärdensprachpädagoginnen für die gehörlosen Pädagoginnen die Gesprächsinhalte in Gebärdensprache übersetzen müssen. Da leider kein/e Gebärdensprachdolmetscher/in für Teamsitzungen bezahlt wird, übernehmen die gebärdensprachkompetenten Lehrerinnen abwechselnd die Dolmetschung. Es ist äußerst wichtig, dass konkrete Vorbereitungen und Planungsprozesse vorab überlegt und besprochen werden, denn über das Team manifestiert sich das Gelingen des schulischen Inklusionsprozesses. Ist das Team offen, flexibel und interessiert an Sprache, Kultur und spezifischen Lerngewohnheiten der gehörlosen Schüler/innen (z. B. Lerntempo, schriftsprachliche gehörlosenspezifische Besonderheiten usw.), dann wird die schulische Inklusion gehörloser Schüler/innen gelingen. Im Team sollten folgende notwendige Reflexions- und Planungsprozesse bedacht werden: Sensibilisierungsseminare für das gesamte Lehrer/innenteam vor Beginn des geplanten inklusiven Settings. Fragen zur Gehörlosigkeit der Schüler/innen, zur Gebärdensprache, zum Unterrichtsablauf in zwei Sprachen usw. sollen abgeklärt und diskutiert werden. Klare Strukturen bezüglich Teamsitzungen, Supervisionen und dem Besprechungsmodus sollen vorab geklärt werden. Im Vorfeld sollen Kompetenzzuordnungen und Kompetenzgrenzen zwischen den Regelschulpädagog/inn/en und Integrationspädagog/inn/en besprochen werden: Wer ist wofür verantwortlich? Hinweis auf gegenseitige Wertschätzung bezüglich unterschiedlicher pädagogischer Kompetenzen. Anspruch von hoher Flexibilität, um sich auf unvorhergesehene Situationen positiv einstellen zu können ohne sich sofort gestört zu fühlen (z. B. beim Einsatz von visualisierenden Medien, Smartboard/Flipchart). Inklusion bedeutet keine Anpassung von Seiten der gehörlosen Schüler/innen an die Regelschulklassen, sondern setzt eine gleichberechtigte Teilhabe im Schulsystem voraus. Gleichberechtigung im Rahmen einer manchmal erforderlichen individuellen Unterrichtsgestaltung (z. B. Zwischenschritte und Zusatzerklärungen) und des Einsatzes von unterstützenden Maßnahmen (z. B. Visualisierung) Zeitfaktor berücksichtigen (Kramreiter 2014) Identitätsbildung und Gehörlosenkultur im Unterricht Beide gehörlosen Kolleginnen bereichern das Schul- und Klassenumfeld durch ihr selbstbewusstes, engagiertes Auftreten. Die gehörlosen Schüler/innen sind auf ihre gehörlosen Lehrerinnen stolz und erfahren eine positive Identifikation sowie ein positives Selbstwertgefühl, da sie spüren, dass Gehörlosigkeit keine Barriere darstellen muss, sondern dass sich gehörlose Menschen nur durch ihre Sprache von hörenden Menschen unterscheiden. Alle Schüler/innen hörende wie gehörlose sowie alle Lehrer/innen sehen gehörlose Menschen als anderssprachig an. Dies wirkt sehr positiv auf das gesamte Inklusionssetting, da auch den gehörlosen Schüler/inne/n automatisch Respekt und Wertschätzung bezüglich ihrer Sprache und Kultur entgegengebracht werden. Durch sehr gezielte Veranstaltungen wird die Gehörlosenkultur direkt in die Schule und in die Klasse transferiert. Eine sehr aufwendige Tanzund Theaterproduktion, an der auch
10 BILDUNG eine gehörlose Schülerin mitwirkte, wurde im Schuljahr 2012/13 ganzjährig erarbeitet. 2013/14 wurde ein weiterer Theaterworkshop mit dem Gründer von ARBOS, Herbert Gantschacher, zum Thema Talking Gloves mit der ganzen Klasse veranstaltet. Die Theaterproduktion wurde in Lienz und in Wien im Schauspielhaus aufgeführt fährt die Klasse nach Rügen und Trelleborg, um dort das Theaterstück ebenfalls zu zeigen. Mit zwei professionellen Tänzer/inne/n wird gegenwärtig eine unverbindliche Übung zu Signdance veranstaltet. Gebärdensprache, Tanz und Theater bestimmen momentan das Kulturangebot der Schule. Weiters ist im Schuljahr 2014/15 gemeinsam mit der Technischen Universität Wien ein Sparkling Science- Projekt zum Thema Hands on! Gestenbasiertes Planen in vielfältigen Stadtgesellschaften geplant. Wir bekommen häufig Anfragen von Universitäten und Institutionen zu unterschiedlichen Themen im Zusammenhang mit Gebärdensprache. Leider müssen wir oft genug ablehnen, da der Schulbetrieb natürlich aufrechterhalten werden muss. Für die Schüler/innen sind solche außerschulischen Kooperationen jedoch sehr interessant, da sie unterschiedliche Arbeitsweisen und Institutionen kennenlernen. 4. Rahmenbedingungen des inklusiven, bilingualen Mehrstufenmodells 4.1. Voraussetzungen der gehörlosen und schwerhörigen Schüler/innen Die hörbeeinträchtigten Schüler/innen müssen lediglich eine Voraussetzung mit in den Unterricht bringen: Sie sollten die Gebärdensprache so beherrschen, dass ihnen eine Alltagskommunikation in ÖGS möglich ist und sie die Vermittlung von Bildungsinhalten in ÖGS verstehen. Tatsächlich ist aber auch eine sehr unterschiedliche Sprachkompetenz zu beobachten: Hörbeeinträchtigte Schüler/innen von hörbeeinträchtigten Eltern weisen oft eine sehr hohe Gebärdensprachkompetenz auf. Schüler/innen der bilingualen Volksschulklassen (es gibt momentan zwei solcher Klassen in Wien) zeigen ebenfalls meist eine sehr gute ÖGS-Kompetenz, während Schüler/innen z. B. aus den Bundesländern Niederösterreich oder Burgenland großteils eine noch sehr geringe ÖGS-Sprachkompetenz haben. Bei diesen Schüler/inne/n wird der Wortschatz in ÖGS durch zusätzliche Übungen aufgebaut. Grundsätzlich werden alle Schüler/innen aufgenommen, deren Eltern sich für dieses Schulmodell entscheiden. Der Hörstatus der Schüler/innen spielt überhaupt keine Rolle. Es befinden sich mittelgradig/hochgradig schwerhörige Kinder, CI-Kinder und auch gehörlose Schüler/innen in den Klassen Qualifikationsprofile der Pädagog/inn/en Grundsätzlich sollten Pädagog/inn/en, die im inklusiven, bilingualen Schulsetting mitarbeiten möchten, mehrere Voraussetzungen mitbringen: die Bereitschaft, dauernd in einem Team zu arbeiten; Teilnahme an regelmäßigen Teamsitzungen oder Planungsarbeiten zusätzlich zum Schulalltag; gute Gebärdensprachkompetenz; Flexibilität; Offenheit und Humor; Akzeptanz gegenüber Forschungsarbeiten, die in in den Klassen regelmäßig durchgeführt werden Zusätzliche Fördermaßnahmen Den hörbeeinträchtigten Schüler/innen werden zusätzliche Fördermaßnahmen pro Unterrichtswoche angeboten: Therapeutische-funktionelle Übungen (2 UE/Woche): Diese Stunden werden zum Nacharbeiten, zum Wiederholen und zum Festigen des Wochenlernstoffs genutzt; unverbindliche Übung ÖGS für hörbeeinträchtigte Schüler/innen (1 UE/Woche): Die gehörlosen Pädagoginnen erweitern den Wortschatz und kontrastieren die Grammatik von Deutsch und ÖGS; Artikulationsübungen (nur in der Volksschule): Den Volksschüler/innen wird pro Woche eine Artikulationseinheit von 25 Min. angeboten. Hörübungen für CI-Kinder (25 Min./ Woche): Cochleaimplantierte Schüler/innen haben Anspruch auf diese Unterrichtseinheit. Die zusätzlichen Fördermaßnahmen werden über die Stammschule (das Bundesinstitut) angeboten und ermöglichen eine spezifische Förderung im Rahmen des Regelschulbereichs Kooperation der Schulpartner/innen Unter Schulpartner/innen werden Schüler/innen, Lehrer/innen, Direktor/innen und Eltern verstanden. DZ
11 ERZIEHUNG 12 DZ Da die Organisation zwei Schulen mit deren Schulpartner/innen und unterschiedlicher Schulamtsbereiche (Bund und Land) umfasst, ergeben sich teilweise sehr komplizierte Situationen, welche manchmal für alle Schulpartner/innen eine Herausforderung darstellen. Die Problemfelder reichen von Schüler/innenzuordnungen, Zeugniserstellung (Regelschulzeugniskopf oder Sonderinstitutionszeugniskopf) bis hin zu Bewilligungen von Bustransfers, Hortbewilligungen und Schulmaterialgeldern. Im Bereich der Pädagogik gibt es wenig Hürden, jedoch wird der administrative-organisatorische Bereich durch den Expositurstatus der Klasse in der Klasse sehr gefordert. Da alle Schulpartner/innen konstruktiv miteinander kooperieren, werden die Hürden der Administration meist schnell genommen Forschungsfeld Ab 2015 wird das inklusive, bilinguale, mehrstufige Schulmodell in den unterschiedlichsten Bereichen beforscht werden. Die Universität Wien wird im Rahmen von Masterarbeiten und spätestens im Schuljahr 2015/16 im Bereich eines umfangreichen Forschungsvorhabens zu den sozialen Prozessen in den Klassen, im Teamteaching und dem Leistungsbereich der hörbeeinträchtigten Schüler/innen usw. tätig werden. Das Forschungsfeld Schule ist ein sehr sensibler Bereich. Team, Schüler/innen und Eltern müssen gut darauf vorbereitet und unterschiedliche Genehmigungen müssen eingeholt werden. Auch das Ansuchen bei der Schulbehörde bedarf eines stringent strukturierten durchgeplanten Konzepts und einer relevanten Forschungsbegründung. Dadurch, dass die Autorin des Artikels Lektorin an der Universität Wien ist und gleichzeitig als Pädagogin im Modell arbeitet, wird die Forschungsakzeptanz und Forschungsdurchführung auf alle Fälle wesentlich erleichtert. 5. Zusammenfassung und momentaner Status 5.1. Team Am Anfang des Schuljahrs 2014/15 herrschte ein belastendes Chaos für das gesamte Team. Eine Gebärdensprachpädagogin fiel mit Beginn des Schuljahrs für fünf Wochen aufgrund einer Erkrankung aus. Die Pädagogin war noch dazu die Klassenvorständin einer Klasse. Im November hat sich die Lage etwas beruhigt und der Schulalltag läuft seither entspannt. Wir Gebärdensprachpädagoginnen konnten die neue Schulsituation mit sechs weiteren Kolleginnen auch erst im November so richtig wahrnehmen und erstmals spürten wir die Vorteile eines größeren Inklusionsteams in der Regelschule. Mitte November wurde die erste Gebärdensprachlehrerinnen-Teamsitzung abgehalten und beschlossen, dass wir zusätzlich zu unserer zweiwöchigen Großteamsitzung mit den Regelschullehrkräften einen gemütlichen Gebärdensprachlehrerinnen-Stammtisch einmal im Monat abends in einem Gasthof eröffnen werden. Diese Psychohygiene mit den Kolleg/inn/en ist von äußerster Wichtigkeit, da Spannungen, Missverständnisse und Problembereiche gleich an der Basis abgefangen werden. Zusätzlich wird über Unterrichtsmethoden und -didaktiken im inklusiven Schulsetting diskutiert und Vorschläge werden ausgetauscht Schüler/innen Alle Schüler/innen haben sich gut eingelebt und fühlen sich wohl in der Klasse. Der Austausch der hörbeeinträchtigen Schüler/innen von der ersten bis zur achten Klasse funktioniert sehr angeregt. Die neuen hörenden Schüler/innen bekommen ÖGS-Unterricht und können mit den hörbeeinträchtigten Schüler/innen in einfachen Alltagsgesprächen kommunizieren. Das soziale inklusive Miteinander funktioniert hervorragend und belebt den gesamten Schulalltag. 6. Perspektiven und Visionen Das Schulmodell erweckt reges Interesse im In- und Ausland. Im Juni 2015 besucht das Bayerische Fernsehen die Klassen. Hospitant/inn/en aus unterschiedlichen sozialen Bereichen (Lehrer/innen, Sozialpädagog/inn/en, Psycholog/inn/en usw.) der Bundesländer informieren sich regelmäßig über Rahmenbedingungen, administrative Strukturen sowie Didaktik und Methodik. Für das Schuljahr 2015/16 sind alle Klassen voll belegt und es können keine hörbeeinträchtigten Schüler/innen mehr aufgenommen werden. Für 2015 sind mehrere Vorträge in unterschiedlichen Bundesländern Österreichs über die didaktisch-methodische Praxis im bilingualen inklusiven Unterricht geplant. Es ist nun spürbar, dass das Interesse an bilingualen Klassen stetig steigt. Großes Lob und Zufriedenheit wird von Seiten der Gebärdensprachgemeinschaft und der gehörlosen und hörenden Eltern unserer Schüler/in-
12 BILDUNG nen signalisiert. Insbesondere unsere gehörlosen Eltern empfehlen uns über die Bundesländergrenzen hinweg weiter. Eine Vision wäre, dass in mehreren Bundesländern in Österreich ähnliche Modelle eröffnet würden. Zur Verwirklichung dieser Vision müssten jedoch qualitativ hochwertige Gebärdensprachausbildungen für Pädagog/inn/en angeboten werden. In Österreich herrscht ein massiver Mangel an wirklich ÖGSkompetenten Lehrer/inne/n. Weiters bräuchte das bilinguale Unterrichtsmodell gehörlose Lehrer/innen. Da aber in Österreich der Zugang zu Pädagogischen Hochschulen für gehörlose Menschen erst seit Oktober 2013 geöffnet ist, sind gehörlose Lehrer/innen noch an einer Hand abzählbar. Schulbehörde und Schulämter zeigen sich sehr offen für einen bilingualen Unterricht in Gebärdensprache und Deutsch. Leider fehlen uns noch die zuständigen Gesetze im Bildungsbereich. Das Recht auf Gebärdensprache als Unterrichtssprache wurde im Dezember 2014 von der gehörlosen Nationalratsabgeordneten Helene Jarmer als Antrag in den Nationalrat eingebracht. Literatur Krausneker, Verena ( 2004): Viele Blumen schreibt man Blümer. Soziolinguistische Aspekte des bilingualen Wiener Grundschul-Modells mit Österreichischer Gebärdensprache und Deutsch. Hamburg: Signum. Kramreiter, Silvia ( 2011): Integration gehörloser SchülerInnen in der Regelschule mit Gebärdensprache und Lautsprache in Österreich. Universität Wien (Phil. Diss., unveröff.). Kramreiter, Silvia (2012): Sprachintegration Integrative Beschulung gehörloser und hörender SchülerInnen in Österreich. Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung einer Integrationsklasse in Wien. In: Das Zeichen 90, Kramreiter, Silvia (2014): Inklusive (integrative) bilinguale Schulmodelle in Österreich. In: DFGS-forum Jahresschrift des deutschen Fachverbandes für Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik. 22. Jahrgang, Dr.in Silvia Kramreiter ist Pädagogin am Bundesinstitut für Gehörlosenbildung in Wien und seit 10 Jahren im integrativen/inklusiven Bereich tätig. Sie ist Gründerin und Projektleiterin der Plattform Integration & Gebärdensprache in Österreich. Weiters ist sie Lehrbeauftragte an der Universität Wien, Universität Klagenfurt, Humboldt Universität zu Berlin sowie an den Pädagogischen Hochschulen Klagenfurt und Krems. silvia.kramreiter@plig. at DZ
forum dfgs 20 Jahre DFGS 20 Jahre bilinguale Pädagogik 20. Jahrestagung des DFGS in Berlin Ausgabe 2014 / 22. Jahrgang
 Ausgabe 2014 / 22. Jahrgang dfgs forum Jahresschrift des deutschen Fachverbandes für Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik 20 Jahre DFGS 20 Jahre bilinguale Pädagogik 20. Jahrestagung des DFGS in Berlin
Ausgabe 2014 / 22. Jahrgang dfgs forum Jahresschrift des deutschen Fachverbandes für Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik 20 Jahre DFGS 20 Jahre bilinguale Pädagogik 20. Jahrestagung des DFGS in Berlin
Integrative bilinguale Bildung im Gymnasium in Österreich
 Integrative bilinguale Bildung im Gymnasium in Österreich Verfasserin: Dipl.Päd. Mag.a Silvia Kramreiter Publikation: Zeitschrift "hörgeschädigter Kinder" 2010 VORGESCHICHTE Seit 2009 gibt es in Österreich
Integrative bilinguale Bildung im Gymnasium in Österreich Verfasserin: Dipl.Päd. Mag.a Silvia Kramreiter Publikation: Zeitschrift "hörgeschädigter Kinder" 2010 VORGESCHICHTE Seit 2009 gibt es in Österreich
Schulische Integration gehörloser Kinder mit Gebärdensprache und Lautsprache in der Regelschule Wiener Modell "Waldschule"
 Schulische Integration gehörloser Kinder mit Gebärdensprache und Lautsprache in der Regelschule Wiener Modell "Waldschule" Verfasserin: Mag. Silvia Kramreiter Publikation: Zeitschrift "hörgeschädigter
Schulische Integration gehörloser Kinder mit Gebärdensprache und Lautsprache in der Regelschule Wiener Modell "Waldschule" Verfasserin: Mag. Silvia Kramreiter Publikation: Zeitschrift "hörgeschädigter
1.1 Kurzer persönlicher Exkurs
 1 1.1 Kurzer persönlicher Exkurs 1992 absolvierte ich mein Praktikum noch während meiner Studienzeit am Bundesinstitut für Gehörlosenbildung (BIG) in Wien. Ich erlebte eine rein oralistisch orientierte
1 1.1 Kurzer persönlicher Exkurs 1992 absolvierte ich mein Praktikum noch während meiner Studienzeit am Bundesinstitut für Gehörlosenbildung (BIG) in Wien. Ich erlebte eine rein oralistisch orientierte
Schriftsprachkompetenz gehörloser SchülerInnen eine österreichische Untersuchung in einer bilingualen Klasse
 Schriftsprachkompetenz gehörloser SchülerInnen eine österreichische Untersuchung in einer bilingualen Klasse Johannes Hennies & Anna Litschauer (2012) Einleitung Historisch haben sich drei (potentiell
Schriftsprachkompetenz gehörloser SchülerInnen eine österreichische Untersuchung in einer bilingualen Klasse Johannes Hennies & Anna Litschauer (2012) Einleitung Historisch haben sich drei (potentiell
Vorträge in Wien 2013 o Freitag, 15. Februar 2013
 Vorträge in Wien 2013 o Freitag, 15. Februar 2013 Thema: Die Augenbrauen kommen spät - Was wir über den kindlichen Erwerb von Gebärdensprachen wissen: Ergebnisse der weltweiten Forschung Vortragende: Mag
Vorträge in Wien 2013 o Freitag, 15. Februar 2013 Thema: Die Augenbrauen kommen spät - Was wir über den kindlichen Erwerb von Gebärdensprachen wissen: Ergebnisse der weltweiten Forschung Vortragende: Mag
Sprachintegration. 1. Entstehung der Integrationsklasse mit Gebärdensprache und Lautsprache 76 DZ 90 12
 Ausland Sprachintegration Integrative Beschulung gehörloser und hörender SchülerInnen in Österreich Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung einer Integrationsklasse in Wien Von silvia kramreiter 1.
Ausland Sprachintegration Integrative Beschulung gehörloser und hörender SchülerInnen in Österreich Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung einer Integrationsklasse in Wien Von silvia kramreiter 1.
Privat-Volksschule Zwettl SCHULPROFIL
 Privat-Volksschule Zwettl SCHULPROFIL Wir führen eine ganztägige Schulform in getrennter Abfolge. Dies bedeutet, dass Unterricht und Lernbetreuung bis 13:20 Uhr (kostenlos) stattfinden, Nachmittags- und
Privat-Volksschule Zwettl SCHULPROFIL Wir führen eine ganztägige Schulform in getrennter Abfolge. Dies bedeutet, dass Unterricht und Lernbetreuung bis 13:20 Uhr (kostenlos) stattfinden, Nachmittags- und
Gemeinsames Lernen an der Sternenschule
 Gemeinsames Lernen an der Sternenschule Im Schuljahr 2011 / 2012 hat sich das Kollegium der Sternenschule gemeinsam auf den Weg zur inklusiven Schulentwicklung gemacht. Seitdem nehmen auch Kinder mit festgestelltem
Gemeinsames Lernen an der Sternenschule Im Schuljahr 2011 / 2012 hat sich das Kollegium der Sternenschule gemeinsam auf den Weg zur inklusiven Schulentwicklung gemacht. Seitdem nehmen auch Kinder mit festgestelltem
DEUTSCHE GEBÄRDENSPRACHE
 STAATSINSTITUT FÜR SCHULPÄDAGOGIK UND BILDUNGSFORSCHUNG Dr. Renate Köhler-Krauß Arabellastr. 1, 81925 München E-Mail: r.koehler-krauss@isb.bayern.de DEUTSCHE GEBÄRDENSPRACHE AN BAYERISCHEN SCHULEN FÜR
STAATSINSTITUT FÜR SCHULPÄDAGOGIK UND BILDUNGSFORSCHUNG Dr. Renate Köhler-Krauß Arabellastr. 1, 81925 München E-Mail: r.koehler-krauss@isb.bayern.de DEUTSCHE GEBÄRDENSPRACHE AN BAYERISCHEN SCHULEN FÜR
Privat-Volksschule Zwettl SCHULPROFIL
 Privat-Volksschule Zwettl SCHULPROFIL Wir führen eine ganztägige Schulform in getrennter Abfolge. Dies bedeutet, dass Unterricht und Lernbetreuung bis 13:20 Uhr (kostenlos) stattfinden, Nachmittags- und
Privat-Volksschule Zwettl SCHULPROFIL Wir führen eine ganztägige Schulform in getrennter Abfolge. Dies bedeutet, dass Unterricht und Lernbetreuung bis 13:20 Uhr (kostenlos) stattfinden, Nachmittags- und
Die Bedeutung der lautsprachbegleitenden Gebärden (LBG) und der Deutschen Gebärdensprache (DGS) für Frühschwerhörige.
 Fragebogen zum Thema: Die Bedeutung der lautsprachbegleitenden Gebärden (LBG) und der Deutschen Gebärdensprache (DGS) für Frühschwerhörige. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 15 Minuten. Alle Angaben
Fragebogen zum Thema: Die Bedeutung der lautsprachbegleitenden Gebärden (LBG) und der Deutschen Gebärdensprache (DGS) für Frühschwerhörige. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 15 Minuten. Alle Angaben
Fragebögen für die Jahrgänge 5/6/7
 Fragebögen für die Jahrgänge 5/6/7 Unterrichtsgestaltung 1. Im Unterricht gibt es verschiedene Arbeitsweisen. Schätze ein, wie dein Lernerfolg bei den einzelnen Arbeitsformen ist. Arbeitsweise sehr gut
Fragebögen für die Jahrgänge 5/6/7 Unterrichtsgestaltung 1. Im Unterricht gibt es verschiedene Arbeitsweisen. Schätze ein, wie dein Lernerfolg bei den einzelnen Arbeitsformen ist. Arbeitsweise sehr gut
Volksschulen Änderungen Im Lehrplan 1
 Volksschulen Änderungen Im Lehrplan 1 Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ab September 2003 ergeben sich durch die Verordnung des BM:BWK wichtige Änderungen im Lehrplan der Volksschule, daher erlaube
Volksschulen Änderungen Im Lehrplan 1 Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ab September 2003 ergeben sich durch die Verordnung des BM:BWK wichtige Änderungen im Lehrplan der Volksschule, daher erlaube
Privat-Volksschule Zwettl SCHULPROFIL
 Privat-Volksschule Zwettl SCHULPROFIL Wir führen eine ganztägige Schulform in getrennter Abfolge. Dies bedeutet, dass Unterricht und Lernbetreuung bis 13:20 Uhr (kostenlos) stattfinden, Nachmittags- und
Privat-Volksschule Zwettl SCHULPROFIL Wir führen eine ganztägige Schulform in getrennter Abfolge. Dies bedeutet, dass Unterricht und Lernbetreuung bis 13:20 Uhr (kostenlos) stattfinden, Nachmittags- und
Bilinguale Inklusive Gemeinschaftsschule
 Bilinguale Inklusive Gemeinschaftsschule Kinder mit Hörschädigung in der Inklusion - BILING: Ein deutschlandweites Pilotprojet - 10.04.2016 Elterninformation Aktueller Stand des Projektes Kristin Hofmann
Bilinguale Inklusive Gemeinschaftsschule Kinder mit Hörschädigung in der Inklusion - BILING: Ein deutschlandweites Pilotprojet - 10.04.2016 Elterninformation Aktueller Stand des Projektes Kristin Hofmann
Aufbau von Schriftsprachkompetenz gehörloser Kinder bei schulischer Integration Wiener Waldschule
 Aufbau von Schriftsprachkompetenz gehörloser Kinder bei schulischer Integration Wiener Waldschule Zeitschrift: Schulheft 146/2012 Verfasserin: Dr in Silvia Kramreiter Wie funktioniert der Unterricht in
Aufbau von Schriftsprachkompetenz gehörloser Kinder bei schulischer Integration Wiener Waldschule Zeitschrift: Schulheft 146/2012 Verfasserin: Dr in Silvia Kramreiter Wie funktioniert der Unterricht in
Schule Willicher Heide Städtische Gemeinschaftsgrundschule Jahrgangsübergreifende Unterrichtsorganisation Offene Ganztagsschule
 Konzept im Rahmen der Offenen Ganztagsschule der Schule Willicher Heide 1. Leitgedanken Jedes Kind soll in der OGS individuell so unterstützt werden, dass es seine möglichst eigenverantwortlich, selbstständig,
Konzept im Rahmen der Offenen Ganztagsschule der Schule Willicher Heide 1. Leitgedanken Jedes Kind soll in der OGS individuell so unterstützt werden, dass es seine möglichst eigenverantwortlich, selbstständig,
Schule kann gelingen, wenn....schülerinnen, LehrerInnen und Eltern zufrieden sind. Jenaplanpädagogik - Präsentation Gabriele Weber
 Schule kann gelingen, wenn....schülerinnen, LehrerInnen und Eltern zufrieden sind. Schüler sind zufrieden, wenn ihr Interesse für ein Thema geweckt wird. für ihre Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit
Schule kann gelingen, wenn....schülerinnen, LehrerInnen und Eltern zufrieden sind. Schüler sind zufrieden, wenn ihr Interesse für ein Thema geweckt wird. für ihre Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit
1. Die Verwaltung bzw. das das Sekretariat steht mir bei Fragen zur Verfügung.
 Schülerfragebogen Qualitätsbereich I Voraussetzungen und Bedingungen Fragen 1.1 1.8 im elektronischen Fragebogen 1. Modellprojektschule Selbstverantwortung + 2. Politische und rechtliche Vorgaben 3. Personal
Schülerfragebogen Qualitätsbereich I Voraussetzungen und Bedingungen Fragen 1.1 1.8 im elektronischen Fragebogen 1. Modellprojektschule Selbstverantwortung + 2. Politische und rechtliche Vorgaben 3. Personal
Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Schule, Eltern und Integrationsassistenz Wie kann das gelingen? Vorurteile. Befürchtungen. Ansprüche.
 Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Schule, Eltern und Integrationsassistenz Wie kann das gelingen? Schule Erfolgreiche Zusammenarbeit braucht: Akzeptanz Wertschätzung Eltern Integrationsassistenz (IA)
Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Schule, Eltern und Integrationsassistenz Wie kann das gelingen? Schule Erfolgreiche Zusammenarbeit braucht: Akzeptanz Wertschätzung Eltern Integrationsassistenz (IA)
Fachtagung Schulische Inklusion, Köln, 7./ Inklusion in der Praxis einer Grundschule Wie geht das? Vom Modellversuch 1989 zum Schulalltag
 Fachtagung Schulische Inklusion, Köln, 7./8.2.2014 Inklusion in der Praxis einer Grundschule Wie geht das? Vom Modellversuch 1989 zum Schulalltag 2014 Fallbeispiel Axel Klasse 1 frisch eingeschult Das
Fachtagung Schulische Inklusion, Köln, 7./8.2.2014 Inklusion in der Praxis einer Grundschule Wie geht das? Vom Modellversuch 1989 zum Schulalltag 2014 Fallbeispiel Axel Klasse 1 frisch eingeschult Das
Privat-Volksschule Zwettl SCHULPROFIL
 Privat-Volksschule Zwettl SCHULPROFIL Wir führen eine ganztägige Schulform in getrennter Abfolge. Dies bedeutet, dass Unterricht und Lernbetreuung bis 13:20 Uhr (kostenlos) stattfinden, Nachmittags- und
Privat-Volksschule Zwettl SCHULPROFIL Wir führen eine ganztägige Schulform in getrennter Abfolge. Dies bedeutet, dass Unterricht und Lernbetreuung bis 13:20 Uhr (kostenlos) stattfinden, Nachmittags- und
Vorträge in Wien 2012 o Freitag, 17. Februar 2012
 Vorträge in Wien 2012 o Freitag, 17. Februar 2012 Thema: Bilinguale Förderung an der Samuel-Heinicke Realschule Anwendungen und Informationen zum Fachlehrplan DGS (Deutsche Gebärdensprache) Vortragende:
Vorträge in Wien 2012 o Freitag, 17. Februar 2012 Thema: Bilinguale Förderung an der Samuel-Heinicke Realschule Anwendungen und Informationen zum Fachlehrplan DGS (Deutsche Gebärdensprache) Vortragende:
Leiterin: Gesamtschuldirektorin Gertrud Korf, Tel. 02581/2743. Vielfalt Chancengleichheit Gemeinschaft Leistung
 A. Bildungswege der Gesamtschule 1. Städtische Gesamtschule Warendorf Leiterin: Gesamtschuldirektorin Gertrud Korf, Tel. 02581/2743 E-Mail: gesamtschule@warendorf.de Homepage: www.gesamtschule-warendorf.de
A. Bildungswege der Gesamtschule 1. Städtische Gesamtschule Warendorf Leiterin: Gesamtschuldirektorin Gertrud Korf, Tel. 02581/2743 E-Mail: gesamtschule@warendorf.de Homepage: www.gesamtschule-warendorf.de
Das Konzept Inklusive Modellregionen in Österreich. Franz Wolfmayr Präsident EASPD
 Das Konzept Inklusive Modellregionen in Österreich Franz Wolfmayr Präsident EASPD Was sind Inklusive Modellregionen? Im Jahre 2012 wurde in Österreich ein Nationaler Aktionsplan Behinderung 2012-2020 beschlossen.
Das Konzept Inklusive Modellregionen in Österreich Franz Wolfmayr Präsident EASPD Was sind Inklusive Modellregionen? Im Jahre 2012 wurde in Österreich ein Nationaler Aktionsplan Behinderung 2012-2020 beschlossen.
Überblick über bilinguale Bildungsmodelle in Österreich. Sabine Zeller Plattform Integration und Gebärdensprache - PLIG
 Überblick über bilinguale Bildungsmodelle in Österreich Sabine Zeller Plattform Integration und Gebärdensprache - PLIG Sabine Zeller 2 Was wir wollen Jedes hörbehinderte Kind soll ungehindert Zugang zu
Überblick über bilinguale Bildungsmodelle in Österreich Sabine Zeller Plattform Integration und Gebärdensprache - PLIG Sabine Zeller 2 Was wir wollen Jedes hörbehinderte Kind soll ungehindert Zugang zu
Gut vorbereitet in die Zukunft
 Kanton Zürich Bildungsdirektion Volksschulamt Gut vorbereitet in die Zukunft Der Lehrplan 21 im Kanton Zürich 6 Gut vorbereitet in die Zukunft Informationen für Eltern Der Zürcher Lehrplan 21 bildet aktuelle
Kanton Zürich Bildungsdirektion Volksschulamt Gut vorbereitet in die Zukunft Der Lehrplan 21 im Kanton Zürich 6 Gut vorbereitet in die Zukunft Informationen für Eltern Der Zürcher Lehrplan 21 bildet aktuelle
Inhalte, Ziele, Verbindlichkeiten. in der Vorschule
 Inhalte, Ziele, Verbindlichkeiten in der Vorschule Richtlinie für Vorschulklassen - Umsetzung am Beispiel der VSK an der Grundschule Bramfeld Rechtlich organisatorischer Rahmen Vorschulklassen können an
Inhalte, Ziele, Verbindlichkeiten in der Vorschule Richtlinie für Vorschulklassen - Umsetzung am Beispiel der VSK an der Grundschule Bramfeld Rechtlich organisatorischer Rahmen Vorschulklassen können an
Leitbild der OS Plaffeien
 Leitbild der OS Plaffeien Schritte ins neue Jahrtausend Unsere Schule ist Bestandteil einer sich rasch entwickelnden Gesellschaft. Dadurch ist sie laufenden Veränderungs- und Entwicklungsprozessen unterworfen.
Leitbild der OS Plaffeien Schritte ins neue Jahrtausend Unsere Schule ist Bestandteil einer sich rasch entwickelnden Gesellschaft. Dadurch ist sie laufenden Veränderungs- und Entwicklungsprozessen unterworfen.
GEBÄRDENSPRACHE Ein Leitfaden
 BDÜ Infoservice GEBÄRDENSPRACHE Ein Leitfaden Was ist Gebärdensprache und wie funktioniert sie? Was genau macht ein Gebärdensprachdolmetscher? Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer Spricht für Sie.
BDÜ Infoservice GEBÄRDENSPRACHE Ein Leitfaden Was ist Gebärdensprache und wie funktioniert sie? Was genau macht ein Gebärdensprachdolmetscher? Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer Spricht für Sie.
Willkommen in der österreichischen. Deutsch
 Willkommen in der österreichischen Schule! Deutsch Liebe Eltern! Liebe Erziehungsberechtigte! Sie sind erst seit kurzer Zeit in Österreich. Vieles ist neu für Sie auch das österreichische Schulsystem.
Willkommen in der österreichischen Schule! Deutsch Liebe Eltern! Liebe Erziehungsberechtigte! Sie sind erst seit kurzer Zeit in Österreich. Vieles ist neu für Sie auch das österreichische Schulsystem.
Hörgeschädigten pädagogik Josef-Rehrl Schule. Mag.(FH) Kerschbaumsteiner Alex
 Hörgeschädigten pädagogik Josef-Rehrl Schule Mag.(FH) Kerschbaumsteiner Alex alexandra_kerschbaumsteiner@hotmail.com Ablauf: Josef Rehrl Schule Lehrpläne Unterricht Hörgeschädigte SchülerInnen Besonderheiten
Hörgeschädigten pädagogik Josef-Rehrl Schule Mag.(FH) Kerschbaumsteiner Alex alexandra_kerschbaumsteiner@hotmail.com Ablauf: Josef Rehrl Schule Lehrpläne Unterricht Hörgeschädigte SchülerInnen Besonderheiten
MatheBuch. Was zeichnet MatheBuch aus? Leitfaden. Übersichtlicher Aufbau. Schülergerechte Sprache. Innere Differenzierung. Zeitgemäße Arbeitsformen
 Was zeichnet MatheBuch aus? Übersichtlicher Aufbau Jedes Kapitel besteht aus einem Basis- und einem Übungsteil. Im Basisteil wird die Theorie an Hand von durchgerechneten Beispielen entwickelt. Die Theorie
Was zeichnet MatheBuch aus? Übersichtlicher Aufbau Jedes Kapitel besteht aus einem Basis- und einem Übungsteil. Im Basisteil wird die Theorie an Hand von durchgerechneten Beispielen entwickelt. Die Theorie
Hospitationsbegleiter
 für das in Evangelischer Religionslehre 1. Die Schule 2. Das Klassenzimmer 3. Die Schülerinnen und Schüler 4. Der/die slehrer/in 5. Der Unterricht 6. Weitere Eindrücke 7. Erfahrungen mit eigenen Unterrichtsversuchen
für das in Evangelischer Religionslehre 1. Die Schule 2. Das Klassenzimmer 3. Die Schülerinnen und Schüler 4. Der/die slehrer/in 5. Der Unterricht 6. Weitere Eindrücke 7. Erfahrungen mit eigenen Unterrichtsversuchen
Arbeit und Bildung für Menschen mit Behinderung
 in Niedersachsen Arbeit und Bildung für Menschen mit Behinderung Diakonie für Menschen Die Position des Fachverbandes Diakonisches Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.v. Fachverband Diakonische
in Niedersachsen Arbeit und Bildung für Menschen mit Behinderung Diakonie für Menschen Die Position des Fachverbandes Diakonisches Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.v. Fachverband Diakonische
Die SchülerInnen sollen den Weltliteratur- Klassiker Romeo und Julia kennenlernen.
 Unterrichtsskizze Unterrichtsverlauf 1. Einheit Die SchülerInnen dürfen ihre Einführung in die Vorkenntnisse über die Geschichte Geschichte Romeo und Julia, in einer Romeo u Julia Gesprächsrunde, erzählen.
Unterrichtsskizze Unterrichtsverlauf 1. Einheit Die SchülerInnen dürfen ihre Einführung in die Vorkenntnisse über die Geschichte Geschichte Romeo und Julia, in einer Romeo u Julia Gesprächsrunde, erzählen.
Gemeinsam lernen. Einrichtung einer Kooperationsklasse der Heinrich- Hehrmann-Schule an der Bergwinkelgrundschule im Schuljahr 2012/2013
 Gemeinsam lernen Einrichtung einer Kooperationsklasse der Heinrich- Hehrmann-Schule an der Bergwinkelgrundschule im Schuljahr 2012/2013 1.Pädagogische Zielsetzung Inklusion durch Kooperation mit der allgemeinen
Gemeinsam lernen Einrichtung einer Kooperationsklasse der Heinrich- Hehrmann-Schule an der Bergwinkelgrundschule im Schuljahr 2012/2013 1.Pädagogische Zielsetzung Inklusion durch Kooperation mit der allgemeinen
Umsetzung der Ausbildungsgespräche nach GPO II, 12 Absatz 4
 Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (GS) Pforzheim Umsetzung der Ausbildungsgespräche nach GPO II, 12 Absatz 4 Vorbemerkungen Die hier vorliegende Konzeption für das Seminar Pforzheim möchte
Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (GS) Pforzheim Umsetzung der Ausbildungsgespräche nach GPO II, 12 Absatz 4 Vorbemerkungen Die hier vorliegende Konzeption für das Seminar Pforzheim möchte
GGS Schönforst Schwalbenweg Aachen
 GGS Schönforst Schwalbenweg 4 52078 Aachen Telefon: 0241 / 57 18 19 Mail: ggs.schoenforst@mail.aachen.de Die Gemeinschaftsgrundschule Schönforst stellt sich vor: Die GGS Schönforst ist schon seit vielen
GGS Schönforst Schwalbenweg 4 52078 Aachen Telefon: 0241 / 57 18 19 Mail: ggs.schoenforst@mail.aachen.de Die Gemeinschaftsgrundschule Schönforst stellt sich vor: Die GGS Schönforst ist schon seit vielen
Vor- und Nachteile verschiedener Kurssettings
 Vor- und verschiedener Kurssettings Schulungen für SeniorInnen werden in ganz unterschiedlichen Settings durchgeführt. Jedes davon hat seine Vor- und. Im Folgenden werden die verschiedenen Möglichkeiten
Vor- und verschiedener Kurssettings Schulungen für SeniorInnen werden in ganz unterschiedlichen Settings durchgeführt. Jedes davon hat seine Vor- und. Im Folgenden werden die verschiedenen Möglichkeiten
1. Schuleingangsphase
 Selbständiges Lernen in der Schuleingangsphase und in den 3./4. Klassen 1. Schuleingangsphase Wochenplanarbeit Laut Lehrplan ist es Aufgabe der Lehrkräfte, in der Schuleingangsphase (1./2.) alle Kinder
Selbständiges Lernen in der Schuleingangsphase und in den 3./4. Klassen 1. Schuleingangsphase Wochenplanarbeit Laut Lehrplan ist es Aufgabe der Lehrkräfte, in der Schuleingangsphase (1./2.) alle Kinder
Längst sind die Ergebnisse und Erkenntnisse, die aus diesem Modellversuch erwachsen sind, eingegangen in die Bildungspläne des Jahres 2004.
 Jahrgangsmischung Unsere Schule hat seit dem Schuljahr 1998/99 am damaligen Modellversuch Modell A1 Schulanfang auf neuen Wegen des Landes Baden-Württemberg teilgenommen. Anfänglich haben wir nur zwei
Jahrgangsmischung Unsere Schule hat seit dem Schuljahr 1998/99 am damaligen Modellversuch Modell A1 Schulanfang auf neuen Wegen des Landes Baden-Württemberg teilgenommen. Anfänglich haben wir nur zwei
Overbergschule Witten Städtische Gemeinschaftshauptschule Sekundarstufe I
 Overbergschule Witten Städtische Gemeinschaftshauptschule Sekundarstufe I gültig ab 2014/15 Sprachförderung als Prinzip der Kommunikation in der Schule 1. Unterricht und außerunterrichtliche Kommunikation
Overbergschule Witten Städtische Gemeinschaftshauptschule Sekundarstufe I gültig ab 2014/15 Sprachförderung als Prinzip der Kommunikation in der Schule 1. Unterricht und außerunterrichtliche Kommunikation
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Stationenlernen: Die Sage der Europa - Kinder entdecken die griechische Sagenwelt Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Stationenlernen: Die Sage der Europa - Kinder entdecken die griechische Sagenwelt Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Konzept der schulpädagogischen Ausrichtung. der Grundschule Gries
 Grundschule Gries Konzept der schulpädagogischen Ausrichtung der Grundschule Gries Durch die großen gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen unserer Zeit entstehen immer neue Anforderungen an das
Grundschule Gries Konzept der schulpädagogischen Ausrichtung der Grundschule Gries Durch die großen gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen unserer Zeit entstehen immer neue Anforderungen an das
GÜTESIEGEL GESUNDE SCHULE TIROL
 GÜTESIEGEL GESUNDE SCHULE TIROL KRITERIENKATALOG SEKUNDARSTUFE 1 & 2 2016/2017 Das ist eine Fußzeile Struktur Ansprechperson und Steuerung Kriterium Nachhaltigkeit 1. Es gibt eine/n definierte/n Gesundheitsreferenten/in
GÜTESIEGEL GESUNDE SCHULE TIROL KRITERIENKATALOG SEKUNDARSTUFE 1 & 2 2016/2017 Das ist eine Fußzeile Struktur Ansprechperson und Steuerung Kriterium Nachhaltigkeit 1. Es gibt eine/n definierte/n Gesundheitsreferenten/in
Fragebogen zum Orientierungsrahmen Schulqualität in Niedersachsen Schülerinnen und Schüler, Sekundarstufe. Stimme gar nicht zu. Stimme gar nicht zu
 Markierung: Korrektur: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder einen starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst. Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die
Markierung: Korrektur: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder einen starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst. Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die
Fragebogen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I / II
 Fragebogen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I / II Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen über deine Schule zu? 1 Ich fühle mich in unserer Schule wohl. 2 An unserer Schule gibt es klare
Fragebogen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I / II Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen über deine Schule zu? 1 Ich fühle mich in unserer Schule wohl. 2 An unserer Schule gibt es klare
SOMMERSCHULE 2012 AN DER BILDUNGSAKADEMIE DER HANDWERKSKAMMER KARLSRUHE
 SOMMERSCHULE 2012 AN DER BILDUNGSAKADEMIE DER HANDWERKSKAMMER KARLSRUHE 1 Inhaltsverzeichnis 1. Zielsetzung 3 2. Projektverlauf 4 3. Beschreibung der Projektinhalte 5 4. Arbeiten in den Ausbildungswerkstätten
SOMMERSCHULE 2012 AN DER BILDUNGSAKADEMIE DER HANDWERKSKAMMER KARLSRUHE 1 Inhaltsverzeichnis 1. Zielsetzung 3 2. Projektverlauf 4 3. Beschreibung der Projektinhalte 5 4. Arbeiten in den Ausbildungswerkstätten
Hausaufgaben in der Ganztagesgrundschule
 Pädagogische Hochschule Freiburg Institut für Erziehungswissenschaft Seminar: Schultheoretische Aspekte der Ganztagspädagogik Dozent: Prof. Dr. Alfred Holzbrecher Wintersemester 2007/2008 Hausaufgaben
Pädagogische Hochschule Freiburg Institut für Erziehungswissenschaft Seminar: Schultheoretische Aspekte der Ganztagspädagogik Dozent: Prof. Dr. Alfred Holzbrecher Wintersemester 2007/2008 Hausaufgaben
1. Oberstufen Praktikum
 Fachschule für Sozialpädagogik BEURTEILUNGSBOGEN zur Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung von individuellen pädagogisch relevanten Kompetenzen im 1. Oberstufen Praktikum Studierende/r:...................................................................
Fachschule für Sozialpädagogik BEURTEILUNGSBOGEN zur Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung von individuellen pädagogisch relevanten Kompetenzen im 1. Oberstufen Praktikum Studierende/r:...................................................................
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017)
 Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Entwicklungsplan VS Gutenberg
 Entwicklungsplan VS Gutenberg Volksschule Gutenberg 2016/17 Teil A (für die einzelnen Themen): Thema 1 Individualisierung und Kompezenzenerwerb im Allgemeinen Zielbilder Im Sinne der Inklusion wollen wir
Entwicklungsplan VS Gutenberg Volksschule Gutenberg 2016/17 Teil A (für die einzelnen Themen): Thema 1 Individualisierung und Kompezenzenerwerb im Allgemeinen Zielbilder Im Sinne der Inklusion wollen wir
Konzept Fördern. Wir fördern und fordern unsere Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung ihrer individuellen Lernvoraussetzungen
 Caspar-Heinrich-Schule Konzept Fördern Wir fördern und fordern unsere Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung ihrer individuellen Lernvoraussetzungen Stand 2010 1. Die Förderung von Schülerinnen
Caspar-Heinrich-Schule Konzept Fördern Wir fördern und fordern unsere Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung ihrer individuellen Lernvoraussetzungen Stand 2010 1. Die Förderung von Schülerinnen
Neue Mittelschule - Steiermark. Elisabeth Meixner
 Neue Mittelschule Begutachtungsentwurf Stand Nov 2011 Neue Mittelschule - Steiermark Zusammenfassung: Elisabeth Meixner Vizepräsidentin des LSR Stmk. Aufgrund vieler Anfragen übermittle ich folgende Zusammenfassung
Neue Mittelschule Begutachtungsentwurf Stand Nov 2011 Neue Mittelschule - Steiermark Zusammenfassung: Elisabeth Meixner Vizepräsidentin des LSR Stmk. Aufgrund vieler Anfragen übermittle ich folgende Zusammenfassung
3.04 Gemeinsamer Unterricht für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf
 3.04 Gemeinsamer Unterricht für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf Konzept der Johannesschule Sundern Gemeinsamer Unterricht ist Schulalltag. Gemeinsamer Unterricht findet in allen Unterrichtsstunden
3.04 Gemeinsamer Unterricht für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf Konzept der Johannesschule Sundern Gemeinsamer Unterricht ist Schulalltag. Gemeinsamer Unterricht findet in allen Unterrichtsstunden
25 JAHRE ÖCIG SYMPOSIUM SALZBURG, AM 21. OKTOBER 2017 INKLUSION UND SCHULE. Mag. Katharina Strohmayer BiG- Schulzentrum
 25 JAHRE ÖCIG SYMPOSIUM SALZBURG, AM 21. OKTOBER 2017 INKLUSION UND SCHULE Mag. Katharina Strohmayer BiG- Schulzentrum www.big-kids.at Weichenstellung durch Regierung Ratifizierung der UN Behindertenrechtskonvention
25 JAHRE ÖCIG SYMPOSIUM SALZBURG, AM 21. OKTOBER 2017 INKLUSION UND SCHULE Mag. Katharina Strohmayer BiG- Schulzentrum www.big-kids.at Weichenstellung durch Regierung Ratifizierung der UN Behindertenrechtskonvention
Eßkamp Oldenburg LEITBILD
 Eßkamp 126 26127 Oldenburg LEITBILD Wir schaffen ein respektvolles Lernklima im Lebe nsraum Schule. Unser Lehren und Lerne n berücksichtigt die individuelle Situation aller Schülerinnen und Schüler. Unsere
Eßkamp 126 26127 Oldenburg LEITBILD Wir schaffen ein respektvolles Lernklima im Lebe nsraum Schule. Unser Lehren und Lerne n berücksichtigt die individuelle Situation aller Schülerinnen und Schüler. Unsere
ANHANG 2 UMFRAGEANTWORTEN
 ANHANG 2 UMFRAGEANTWORTEN ANTWORTEN VON PERSON 1 Nein in welcher Form und in welchem Umfang tun Sie das für welche Programme? (z.b. Campuslizenzen, Ja, in meiner Einrichtung ist eine Campuslizenz für ein
ANHANG 2 UMFRAGEANTWORTEN ANTWORTEN VON PERSON 1 Nein in welcher Form und in welchem Umfang tun Sie das für welche Programme? (z.b. Campuslizenzen, Ja, in meiner Einrichtung ist eine Campuslizenz für ein
Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes INKLUSIVES MARTINSVIERTEL
 Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes INKLUSIVES MARTINSVIERTEL 15.05.2012 14.05.2014 Prof. Dr. Manfred Gerspach Ulrike Schaab, Dipl.-Sozialpädagogin, M.A. Hochschule Darmstadt
Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes INKLUSIVES MARTINSVIERTEL 15.05.2012 14.05.2014 Prof. Dr. Manfred Gerspach Ulrike Schaab, Dipl.-Sozialpädagogin, M.A. Hochschule Darmstadt
Gehörlosigkeit in der Gesellschaft. Ein geschichtlicher Abriss
 Ein geschichtlicher Abriss Zahlen und Fakten Taube Menschen gab es vermutlich schon so lange, wie die Menschheit existiert 0,01% der Bevölkerung ist gehörlos Das sind in Deutschland ca. 80.000 gehörlose
Ein geschichtlicher Abriss Zahlen und Fakten Taube Menschen gab es vermutlich schon so lange, wie die Menschheit existiert 0,01% der Bevölkerung ist gehörlos Das sind in Deutschland ca. 80.000 gehörlose
Es gilt das gesprochene Wort.
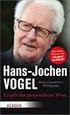 Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Festakt zur Einweihung des neuen Schulgebäudes der Michaeli Schule Köln Freie Waldorfschule mit inklusivem
Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Festakt zur Einweihung des neuen Schulgebäudes der Michaeli Schule Köln Freie Waldorfschule mit inklusivem
Grundschule Fleestedt
 Evaluationsbericht der Grundschule Fleestedt, Seevetal Juni 2015 - Seite 1 Evaluationsbericht Juni 2015: LÜNEBURGER FRAGEBOGEN Grundschule Fleestedt Befragte Anzahl Rückläufer Rücklaufquote Aussagekraft
Evaluationsbericht der Grundschule Fleestedt, Seevetal Juni 2015 - Seite 1 Evaluationsbericht Juni 2015: LÜNEBURGER FRAGEBOGEN Grundschule Fleestedt Befragte Anzahl Rückläufer Rücklaufquote Aussagekraft
Zusammenlegung. Eiderlandschule Hennstedt. FHS Wesselburen. Ideen zur Umsetzung Chancen Hürden Lösungsansätze
 Zusammenlegung FHS Wesselburen + Eiderlandschule Hennstedt Ideen zur Umsetzung Chancen Hürden Lösungsansätze Persönliches Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt Vorab: Kein fertiges Konzept Dies ist
Zusammenlegung FHS Wesselburen + Eiderlandschule Hennstedt Ideen zur Umsetzung Chancen Hürden Lösungsansätze Persönliches Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt Vorab: Kein fertiges Konzept Dies ist
Pädagogisches Konzept Tagesstruktur
 Pädagogisches Konzept Tagesstruktur Kerzers 1. Grundlage Grundlagen für das pädagogische Konzept bilden das Reglement Tagesstruktur und die Rahmenbedingungen der Gemeinde Kerzers. 2. Leitgedanken und Ziele
Pädagogisches Konzept Tagesstruktur Kerzers 1. Grundlage Grundlagen für das pädagogische Konzept bilden das Reglement Tagesstruktur und die Rahmenbedingungen der Gemeinde Kerzers. 2. Leitgedanken und Ziele
Schule für Kinder mit besonderem Förderbedarf
 Schule für Kinder mit besonderem Förderbedarf In der Schule für Kinder mit besonderem Förderbedarf (SfKmbF) in Alsterdorf werden Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1-10 in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen
Schule für Kinder mit besonderem Förderbedarf In der Schule für Kinder mit besonderem Förderbedarf (SfKmbF) in Alsterdorf werden Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1-10 in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen
Coaching-Portfolio 1. Warum bin ich hier? (Kärtchen mit verschiedenen sprachlichen Bereichen) 2. Wie lerne ich?/meine Ressourcen
 Coaching Portfolio Coaching-Portfolio Hier finden Sie eine kleine Sammlung von Arbeitsblättern, die Teilnehmenden bei er Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernen, insbesondere seinem Sprachenlernen unterstützen
Coaching Portfolio Coaching-Portfolio Hier finden Sie eine kleine Sammlung von Arbeitsblättern, die Teilnehmenden bei er Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernen, insbesondere seinem Sprachenlernen unterstützen
Expert/innengruppe Manual- und Gebärdensysteme und Gebärdensprache. Vorstellung der Handreichungen
 Expert/innengruppe Manual- und Gebärdensysteme und Gebärdensprache Vorstellung der Handreichungen Unsere Gruppe 24.2.2010 Unsere Gruppe wurde 2009 von BMUKK unter der Leitung von Frau MRin Mag.a Lucie
Expert/innengruppe Manual- und Gebärdensysteme und Gebärdensprache Vorstellung der Handreichungen Unsere Gruppe 24.2.2010 Unsere Gruppe wurde 2009 von BMUKK unter der Leitung von Frau MRin Mag.a Lucie
Ganztägige Schulformen. Beste Bildung und Freizeit für unsere Kinder
 Ganztägige Schulformen Beste Bildung und Freizeit für unsere Kinder Sehr geehrte Damen und Herren! Ganztägige Schulformen garantieren die optimale Förderung der Schülerinnen und Schüler in ihrer gesamten
Ganztägige Schulformen Beste Bildung und Freizeit für unsere Kinder Sehr geehrte Damen und Herren! Ganztägige Schulformen garantieren die optimale Förderung der Schülerinnen und Schüler in ihrer gesamten
Arbeitsgruppe: Kooperative Lernformen
 Arbeitsgruppe: Kooperative Lernformen Hilf mir es selbst zu tun! - Lernen mit Kopf, Hand und Herz! Was versteckt sich hinter: Kooperative Lernformen/ Methodenwerkstatt Formen des offenen Unterricht wie
Arbeitsgruppe: Kooperative Lernformen Hilf mir es selbst zu tun! - Lernen mit Kopf, Hand und Herz! Was versteckt sich hinter: Kooperative Lernformen/ Methodenwerkstatt Formen des offenen Unterricht wie
Aufgabenbeispiele für Klassen der Flexiblen Grundschule
 Aufgabenbeispiele für Klassen der Flexiblen Grundschule Zentrales Kernelement der Flexiblen Grundschule ist es, die vorhandene Heterogenität der Schülerinnen und Schüler in der Klasse als Chance zu sehen
Aufgabenbeispiele für Klassen der Flexiblen Grundschule Zentrales Kernelement der Flexiblen Grundschule ist es, die vorhandene Heterogenität der Schülerinnen und Schüler in der Klasse als Chance zu sehen
Sind wir auch verschieden, keiner wird gemieden, keiner bleibt allein.
 1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 29.03.2012, 10.00 Uhr - Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Urkundenverleihung an Schulen
1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 29.03.2012, 10.00 Uhr - Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Urkundenverleihung an Schulen
Schulprogramm der Hermann-Hesse-Schule
 Unterricht Bildung Die Hermann-Hesse-Schule ist ein Ort, an dem Schülerinnen und Schüler unterschiedlichster Bildungskarrieren und Leistungsstärken individuell und dennoch gemeinsam lernen können. Sie
Unterricht Bildung Die Hermann-Hesse-Schule ist ein Ort, an dem Schülerinnen und Schüler unterschiedlichster Bildungskarrieren und Leistungsstärken individuell und dennoch gemeinsam lernen können. Sie
Qualitäts-Leitbild der Kreisschule Lotten (eingesetzt am 13. Februar 2006; überarbeitet Februar 2015)
 SCHULLEITUNG Qualitäts-Leitbild der Kreisschule Lotten (eingesetzt am 13. Februar 2006; überarbeitet Februar 2015) Inhaltsverzeichnis 1. Gemeinsame pädagogische Haltung 2. Identifikation mit der Schule
SCHULLEITUNG Qualitäts-Leitbild der Kreisschule Lotten (eingesetzt am 13. Februar 2006; überarbeitet Februar 2015) Inhaltsverzeichnis 1. Gemeinsame pädagogische Haltung 2. Identifikation mit der Schule
Pädagogische Hochschule Heidelberg Akademisches Auslandsamt
 Pädagogische Hochschule Heidelberg Akademisches Auslandsamt Erfahrungsbericht über mein Praktikum an der German American International School in Menlo Park/ Kalifornien Name: Kathrin Ploch Studiengang:
Pädagogische Hochschule Heidelberg Akademisches Auslandsamt Erfahrungsbericht über mein Praktikum an der German American International School in Menlo Park/ Kalifornien Name: Kathrin Ploch Studiengang:
Kocherburgschule Unterkochen. anders. gemeinsam. besser. lernen. lernen. lernen
 Kocherburgschule Unterkochen Gemeinschaftsschule anders gemeinsam besser Neue Ziele Neue Wege Neues Profil Was lerne ich? Wie lerne ich? Wer oder was hilft mir beim Lernen? länger gemeinsam fundierte individuelle
Kocherburgschule Unterkochen Gemeinschaftsschule anders gemeinsam besser Neue Ziele Neue Wege Neues Profil Was lerne ich? Wie lerne ich? Wer oder was hilft mir beim Lernen? länger gemeinsam fundierte individuelle
SCHULINSPEKTION. infiiii. Offene Volksschule 1020 Wien, Wittelsbachstr. 6. Inspektionsteam: LSI Mag. Dr. Wolfgang Gröpel BSI Manfred Zolles
 SCHULINSPEKTION 2. Inspektionsbezirk infiiii Offene Volksschule 1020 Wien, Wittelsbachstr. 6 Inspektionsteam: LSI Mag. Dr. Wolfgang Gröpel BSI Manfred Zolles Thema der Inspektion Individualisieren und
SCHULINSPEKTION 2. Inspektionsbezirk infiiii Offene Volksschule 1020 Wien, Wittelsbachstr. 6 Inspektionsteam: LSI Mag. Dr. Wolfgang Gröpel BSI Manfred Zolles Thema der Inspektion Individualisieren und
Berufsbild GebärdensprachlehrerInnen in Österreich
 Berufsbild GebärdensprachlehrerInnen in Österreich Verfasst von Traude Binder E-Mail: traudeaf@a1.net ilona.seifert@chello.at Das Berufsbild wurde aufbauend auf einer Fassung aus 2006 von Jürgen Brunner,
Berufsbild GebärdensprachlehrerInnen in Österreich Verfasst von Traude Binder E-Mail: traudeaf@a1.net ilona.seifert@chello.at Das Berufsbild wurde aufbauend auf einer Fassung aus 2006 von Jürgen Brunner,
LEITFADEN ELTERNABENDE
 LEITFADEN ELTERNABENDE AM GEORG BÜCHNER GYMNASIUM SEELZE Eine Anregung für ElternvertreterInnen zur Gestaltung Die Arbeitsgruppe Kommunikation und Lobkultur, eine Arbeitsgruppe an der Schüler_innen, Lehrer_innen
LEITFADEN ELTERNABENDE AM GEORG BÜCHNER GYMNASIUM SEELZE Eine Anregung für ElternvertreterInnen zur Gestaltung Die Arbeitsgruppe Kommunikation und Lobkultur, eine Arbeitsgruppe an der Schüler_innen, Lehrer_innen
1. Rechtliche Grundlagen & Begriffe
 Lehren und Lernen im Kontext von Beeinträchtigungen des Modul Inhalte 1 1. Rechtliche Grundlagen & Begriffe rechtliche Grundlagen (UN-BRK; Kinderrechtskonvention; Schul-, Sozial-, Behindertenrecht) KMK-Empfehlungen
Lehren und Lernen im Kontext von Beeinträchtigungen des Modul Inhalte 1 1. Rechtliche Grundlagen & Begriffe rechtliche Grundlagen (UN-BRK; Kinderrechtskonvention; Schul-, Sozial-, Behindertenrecht) KMK-Empfehlungen
Die Stadtteilschule. Stadtteilschule 1
 Die Stadtteilschule Stadtteilschule 1 Die Stadtteilschule. In der Stadtteilschule lernen alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam, um die bestmöglichen Leistungen und den höchstmöglichen Schulabschluss
Die Stadtteilschule Stadtteilschule 1 Die Stadtteilschule. In der Stadtteilschule lernen alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam, um die bestmöglichen Leistungen und den höchstmöglichen Schulabschluss
Ist Schulsport vor allem für die Kinder wichtig, die außerhalb der Schule keinen Sport treiben?
 Professor Dr. Claus Buhren, Leiter des Institutes für Schulsport und Schulentwicklung an der Hochschule für Sport in Köln, über Schulsport in Deutschland Was macht den Sportunterricht an Schulen in Deutschland
Professor Dr. Claus Buhren, Leiter des Institutes für Schulsport und Schulentwicklung an der Hochschule für Sport in Köln, über Schulsport in Deutschland Was macht den Sportunterricht an Schulen in Deutschland
Konzept. zur Inklusion an der Gesamtschule Oelde. (Hubbe - Cartoon)
 Konzept zur Inklusion an der Gesamtschule Oelde (Hubbe - Cartoon) Die Gesamtschule Oelde möchte sich mit ihrem Konzept zur Inklusion nicht auf eine Achterbahn begeben. Uns ist es wichtig, zu verdeutlichen,
Konzept zur Inklusion an der Gesamtschule Oelde (Hubbe - Cartoon) Die Gesamtschule Oelde möchte sich mit ihrem Konzept zur Inklusion nicht auf eine Achterbahn begeben. Uns ist es wichtig, zu verdeutlichen,
Unser Bild vom Menschen
 Das pädagogische Konzept t des ELKI Naturns: Unser Bild vom Menschen Wir sehen den Menschen als ein einzigartiges, freies und eigenständiges Wesen mit besonderen physischen, emotionalen, psychischen und
Das pädagogische Konzept t des ELKI Naturns: Unser Bild vom Menschen Wir sehen den Menschen als ein einzigartiges, freies und eigenständiges Wesen mit besonderen physischen, emotionalen, psychischen und
Bausteine zu Selbstbeurteilungen von Schülerinnen und Schülern an der Bernischen Volksschule ---
 Übersicht über die Bausteine (Module) für stufengemässe Selbstbeurteilungen von Schülerinnen und Schülern an der Bernischen Volksschule 1. (SEMESTER-) SELBSTBEURTEILUNG ( 1. / 2. Klasse) 2. (SEMESTER-)
Übersicht über die Bausteine (Module) für stufengemässe Selbstbeurteilungen von Schülerinnen und Schülern an der Bernischen Volksschule 1. (SEMESTER-) SELBSTBEURTEILUNG ( 1. / 2. Klasse) 2. (SEMESTER-)
Leitbild GEMEINDESCHULE FREIENBACH
 Leitbild GEMEINDESCHULE FREIENBACH GEMEINDESCHULE FREIENBACH Vorwort Das Leitbild der Schule Freienbach zeigt Grundwerte auf, an denen sich unser Denken und Handeln orientiert. Es dient als Richtschnur
Leitbild GEMEINDESCHULE FREIENBACH GEMEINDESCHULE FREIENBACH Vorwort Das Leitbild der Schule Freienbach zeigt Grundwerte auf, an denen sich unser Denken und Handeln orientiert. Es dient als Richtschnur
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Das Telefongespräch als wichtiges Kommunikationsmittel - Gruppenarbeit
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das Telefongespräch als wichtiges Kommunikationsmittel - Gruppenarbeit Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das Telefongespräch als wichtiges Kommunikationsmittel - Gruppenarbeit Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Jedes Kind hat ein Talent In wenigen Tagen findet an der Schule Forsmannstraße der jährliche Vorlesetag statt ein Highlight für alle Beteiligten.
 Jedes Kind hat ein Talent In wenigen Tagen findet an der Schule Forsmannstraße der jährliche Vorlesetag statt ein Highlight für alle Beteiligten. Auf dem Gang vor dem Schulbüro ist großer Andrang. Hier
Jedes Kind hat ein Talent In wenigen Tagen findet an der Schule Forsmannstraße der jährliche Vorlesetag statt ein Highlight für alle Beteiligten. Auf dem Gang vor dem Schulbüro ist großer Andrang. Hier
Ausgewählte Ergebnisse aus der Befragung der Lehrkräfte und Eltern im Schulversuch ERINA im Schuljahr 2012/2013
 Erziehungswissenschaftliche Fakultät WB ERINA Prof. Dr. Katrin Liebers, Christin Seifert (M. Ed.) Ausgewählte Ergebnisse aus der Befragung der Lehrkräfte und Eltern im Schulversuch ERINA im Schuljahr 2012/2013
Erziehungswissenschaftliche Fakultät WB ERINA Prof. Dr. Katrin Liebers, Christin Seifert (M. Ed.) Ausgewählte Ergebnisse aus der Befragung der Lehrkräfte und Eltern im Schulversuch ERINA im Schuljahr 2012/2013
Schule für visuelle und alternative Kommunikation
 Schule für visuelle und alternative Kommunikation Was ist vis.com? vis.com Schule für visuelle und alternative Kommunikation Ausbildung für gehörlose und hörbeeinträchtigte Jugendliche und Erwachsene im
Schule für visuelle und alternative Kommunikation Was ist vis.com? vis.com Schule für visuelle und alternative Kommunikation Ausbildung für gehörlose und hörbeeinträchtigte Jugendliche und Erwachsene im
Albert-Schweitzer-Schule Sonderpädagogisches Förderzentrum Sonthofen. Leitbild
 Albert-Schweitzer-Schule Sonderpädagogisches Förderzentrum Sonthofen Leitbild "Die Zukunft liegt nicht darin, dass man an sie glaubt oder nicht an sie glaubt, sondern darin, dass man sie vorbereitet."
Albert-Schweitzer-Schule Sonderpädagogisches Förderzentrum Sonthofen Leitbild "Die Zukunft liegt nicht darin, dass man an sie glaubt oder nicht an sie glaubt, sondern darin, dass man sie vorbereitet."
Hausaufgabenkonzept. Schule und Hort ElisabethenHeim. Stand Juli ElisabethenHeim l Bohnesmühlgasse 16 l Würzburg l
 Schule und Hort ElisabethenHeim Stand Juli 2014 1. VORWORT... 1 2. ZIELE UND GRUNDSÄTZE... 1 3. STRUKTUR... 2 4. FESTLEGUNG DER AUFGABEN DER BETEILIGTEN... 2 4.1 Schulkind... 2 4.2 Lehrkraft... 3 4.3 Hort...
Schule und Hort ElisabethenHeim Stand Juli 2014 1. VORWORT... 1 2. ZIELE UND GRUNDSÄTZE... 1 3. STRUKTUR... 2 4. FESTLEGUNG DER AUFGABEN DER BETEILIGTEN... 2 4.1 Schulkind... 2 4.2 Lehrkraft... 3 4.3 Hort...
Fairteilung von Bildungschancen!
 Fairteilung von Bildungschancen! Mittelzuteilung auf Basis des Chancen-Index: Ein Modell für eine gerechte, transparente und bedarfsorientierte Schulfinanzierung. Wir wollen dass alle Kinder die Bildungsziele
Fairteilung von Bildungschancen! Mittelzuteilung auf Basis des Chancen-Index: Ein Modell für eine gerechte, transparente und bedarfsorientierte Schulfinanzierung. Wir wollen dass alle Kinder die Bildungsziele
Gesamtschule der Stadt Ahaus
 Gesamtschule der Stadt Ahaus Eine Schule für alle Was leistet die Gesamtschule Ahaus? Für welche Kinder ist sie geeignet? Wie wird an der Gesamtschule Ahaus gelernt? Welche Abschlüsse sind möglich? Welche
Gesamtschule der Stadt Ahaus Eine Schule für alle Was leistet die Gesamtschule Ahaus? Für welche Kinder ist sie geeignet? Wie wird an der Gesamtschule Ahaus gelernt? Welche Abschlüsse sind möglich? Welche
SCHWERPUNKTSCHULE RS+ Hachenburg. RS+ Hachenburg SJ 12/13
 SCHWERPUNKTSCHULE RS+ Hachenburg Realschule Plus Hachenburg ca. 900 Schüler insgesamt über 70 Lehrpersonen In Bezug auf Schwerpunktschule: Schwerpunktschule aufgrund der Fusion seit Schuljahr 2012/2013
SCHWERPUNKTSCHULE RS+ Hachenburg Realschule Plus Hachenburg ca. 900 Schüler insgesamt über 70 Lehrpersonen In Bezug auf Schwerpunktschule: Schwerpunktschule aufgrund der Fusion seit Schuljahr 2012/2013
Die flexible Eingangsstufe an der Grundschule Bubenreuth
 Was? Warum? Die flexible Eingangsstufe an der Grundschule Bubenreuth Wie? Wer? Was? Flexible Grundschule Die Eingangsstufe umfasst die 1. und 2. Jgst. der bisherigen Grundschule. 1. Jahr: Eintritt in die
Was? Warum? Die flexible Eingangsstufe an der Grundschule Bubenreuth Wie? Wer? Was? Flexible Grundschule Die Eingangsstufe umfasst die 1. und 2. Jgst. der bisherigen Grundschule. 1. Jahr: Eintritt in die
Ausführlicher Bericht zu einer ersten schulpraktischen Übung mit Hospitation und Planung und Reflexion der ersten Unterrichtserfahrungen
 Pädagogik Anika Weller Ausführlicher Bericht zu einer ersten schulpraktischen Übung mit Hospitation und Planung und Reflexion der ersten Unterrichtserfahrungen Unterrichtsentwurf Inhalt 1 Die Schule...
Pädagogik Anika Weller Ausführlicher Bericht zu einer ersten schulpraktischen Übung mit Hospitation und Planung und Reflexion der ersten Unterrichtserfahrungen Unterrichtsentwurf Inhalt 1 Die Schule...
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Kreative Unterrichtseinstiege (mit zahlreichen Beispielen)
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Kreative Unterrichtseinstiege (mit zahlreichen Beispielen) Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Kreative
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Kreative Unterrichtseinstiege (mit zahlreichen Beispielen) Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Kreative
Individuelle Förderung
 Individuelle Förderung Diagnose Fördern und Fordern L.-C. Verhees G. Troles Jedes Kind ist anders... An der Johannesschule wird die Individualität des Kindes besonders geschätzt und unterstützt. Individuelle
Individuelle Förderung Diagnose Fördern und Fordern L.-C. Verhees G. Troles Jedes Kind ist anders... An der Johannesschule wird die Individualität des Kindes besonders geschätzt und unterstützt. Individuelle
