Der Struppige Tintling Coprinus cinereus (Schaeffer: Fries) S.F. Gray
|
|
|
- Barbara Raske
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Der Struppige Tintling Coprinus cinereus (Schaeffer: Fries) S.F. Gray Dietmar Winterstein, Römer-Apotheke, Bahnhofstr. 40, Bad Münstereifel 2. Teil: Biographie (Ontogenese) Coprinus cinereus - Stirps: Lagopus (Hasenpfote) - gilt in weiten Teilen Europas als sehr verbreitet. Bestimmungen müssen jedoch grundsätzlich auch mikroskopisch abgesichert werden. Der Pilz wurde unter verschiedenen Namen isoliert: C. cinereus, C. delicatulus, C. fimentarius, C. lagopus, C. macrorhizus f. microsporus und C. radiatus CLEMENÇON (1997), KRIEGLSTEINER ET AL. (1982), KÜES (2000), s. a. MONTAG (1996). Coprinus cinereus ist ein ideales Versuchobjekt, um Entwicklungsprozesse in Basidiomyceten zu studieren. Erstens kann der Pilz auf künstlichem Nährboden gezüchtet werden und zweitens hat er einen relativ kurzen Lebenszyklus, der unter Laborbedingungen innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen ist. Einen weiteren Vorteil hat der schnellwüchsige und rasch vergehende Tintling, dass nämlich die Basidien fast synchron reifen und die Teilungsphasen der Sporen direkt bestimmbar sind. Nach 48 Stunden sind der Teilungszyklus und die Sporenreife abgeschlossen. Die meisten Hymenomyceten zeigen dagegen Lamellen mit Basidien in allen Entwicklungsstadien. Mit der Autolyse zerstört sich der Pilz selbst. Der Pilz hat Vorzüge gegenüber Pflanzen bei dem Studium von Meiose, Einfluss von Licht und Schwerkraft und Übermittlung von Signalen KÜES (2000). Lectine in Pilzen Erkennungs- und Abwehrreaktionen gehören zu den Merkmalen, die das Leben charakterisieren. Das Erkennen von Selbst oder Nicht-Selbst ist ein archaisches, biologisches Grundprinzip. Die Kommunikation auf zellulärer Ebene erfolgt mittels chemischer Signale, wobei beide Partner mit einander reagieren. Pilz-Lectine sind beteiligt an lebenswichtigen Mechanismen wie, Angriff und Verteidigung, Chemotaxis, Erkennung von Symbionten, Auffinden von Nahrungsquellen, Erschließen derselben und Fruchtkörper-Bildung.
2 Lectine sind Proteine und Glycoproteine, die befähigt sind, Kohlenhydrate - auch in Lipid- oder Protein-gebundener Form - mit hoher Affinität zu erkennen, auszulesen und zu binden. Aktivitäten von Lectinen werden durch die Zucker charakterisiert, an denen sie binden. Analog beschreiben wir menschliche Tätigkeiten durch ihre Berufsbezeichnungen: Gärtner, Köhler, Fischer, Jäger, Schmied... Das Wissen um die Lectine steht in engem Zusammenhang mit der Erforschung der Glycoproteine. Zuckermoleküle, an eine lange Polypeptidkette (Eiweißkörper) montiert, sind Antennen, die biologische Informationen signalisieren. Sie sind Schlüssel an einem Schlüsselbund, die in die unterschiedlichsten Schlösser passen. Lectine heften sich an die Oligosaccharide derartiger Antennen; durch diese Interaktion wird das Signal in die Zelle weitergeleitet und die gespeicherten Informationen in biologische Prozesse umgesetzt. Von C. cinereus wissen wir, dass seine Galectine spezifisch an b-galactoside binden. Diese Kriterien unterscheiden die Galectine von allen anderen Lectinen. Bei Tieren sind Galectine in viele zelluläre Prozesse involviert, die Zelldifferenzierungen betreffen, wie Entwicklung von Muskelgeweben, Ausbildung von Riechorganen, embryonale Einnistung, Metastase, Apoptose und mrna-splicing. Die Isolierung von Galectinen aus C. cinereus zeigt, dass es sich um eine uralte Genfamilie handelt. Die Coprinus-Galectine sind die ersten Galectine, die zuerst außerhalb des Tierreiches nachgewiesen wurden. Die Pilze trennten sich schätzungsweise vor 1 Milliarde Jahren vom Tierreich. Das Coprinus-cinereus-Galectin (Cgl-2) zeigt besonders Affinität zum Blutgruppen-A-Tetrasaccharid. Im Menschen und in den verschiedensten Tierstämmen finden wir Galectine, die sich in der Aminosäurensequenz und im spezifischen Binden an b-galactoside gleichen RABI- NOVICH ET AL. (1999). Ihre Affinität für Oligosaccharide, die sich an Glycokonjugaten auf Zelloberflächen befinden, lassen vermuten, dass Galectine überwiegend extrazytoplasmatische und extrazelluläre Wirkungen haben. Die Coprinus-Galectine üben keine katalytischen oder signalisierenden Wirkungen aus, sondern eher strukturelle, in dem sie Veränderungen in der Entwicklung der Fruchtköper regulieren COOPER ET AL (1997). Die Entscheidung, ob differenzierte Strukturen ausgebildet werden, seien es Sklerotien, dickwandige Chlamydosporen oder reproduktive Organe, wird auf der Basis von Umwelteinflüssen getroffen wie Licht, Temperatur, Feuchtigkeit und Nahrungsangebot KÜES (2000). Es ist bemerkenswert, dass Galactose-bindende Lectine (Galectine) nicht im Myzel, sondern im Fruchtkörper in großer Menge synthetisiert werden zu einer Zeit (Idiophase), wo der Organismus verhungert und Fruchtkörper ausbildet. Die Metamorphose des Pilzes ist offensichtlich: Aus einem vegetativen Myzel wird ein komplexes Gewebe geflochten, nämlich das Plektenchym, das den Phänotyp des Pilzes darstellt COOPER ET AL. (1997), KÜES (2000). Hyphenfusionen Zwei sich begegnende Hyphen können sich unterschiedlich verhalten. Sie können die Anwesenheit der anderen ignorieren und ungestört weiter wachsen, wie dies während der exponentiellen Wachstumsphase oder in der Randzone eines sich ausbreitenden Myzels der Fall ist. Es ist jedoch auch möglich, dass sich zwei Hyphen berühren und deren Hyphen verschmelzen. Die Hyphenfusion kann sich zwischen verträglichen und auch unverträglichen und auch artfremden Hyphen vollziehen. Im letzteren Fall erkennen sich die Myzelien als fremd. Fusionen zwischen inkompatiblen Hyphen führen zum Tod oder zum Wachstumsstillstand der betreffenden Zellen CLEMENÇON (1997). Die vegetative Selbst/Nichtselbst -Erkennung von Dikaryons zeigt sich durch pigmentierte Zonen, spärlichen Hyphen und manchmal auch zusammen geknitterten Hyphen KÜES (2000). Selbst und Nicht-Selbst werden erst nach der Hyphenfusion beim Kontakt der zwei Zytoplasmen wirksam. Liegen plasmatisch kompatible Fusionen vor, können Kerne und Mitochondrien von einem Myzel in das andere übergehen CLE- MENÇON (1997). Dikaryon Eine der bemerkenswertesten Aspekte im Lebenszyklus der meisten Basidiomyceten ist die zeitliche und räumliche Trennung der Zellfusion von der Kernfusion. Die Karyogamie geschieht in den Basidien. Ihr folgt sofort die Meiose (Reduktionsteilung), wobei die Diplophase auf eine einzige Kerngeneration beschränkt bleibt CLE- MENÇON (1997). Der Tintling 5 (2001) Seite 24
3 Weil Syngamie (Plasmogamie) und Karyogamie räumlich und zeitlich getrennt sind, ist der Nucleus in der Lage, neue Partnerschaften einzugehen. Dieser fortlaufende Aufschub der Kern- Fusion verleiht dem Nucleus einen einzigartigen Status: der Nucleus kann sich wie ein Individuum verhalten. Er ist selbstsüchtig, weil er seine Identität nicht aufgibt. Diese Partnerschaft ist nicht gleichwertig und zeigt auch Aspekte von Parasitismus KÜES (2000). Bei Hyphenfusionen werden Mitochondrien zwischen den Myzelien nicht ausgetauscht. Der wandernde Nucleus verlässt seine ursprünglichen Mitochondrien. Innerhalb der Myzel-Gemeinschaft müssen also Konflikte zwischen egoistischen Nuclei und selbstsüchtigen Mitochondrien bestehen KÜES (2000). Diese Vermutung wird durch die ungewöhnliche Beobachtung unterstützt, dass Mitochondrien die vegetative Inkompatibilität in C. cinereus determinieren können MAY (1988) in KÜES (2000). Sexuelle Fusionen finden zwischen zwei genetisch verschiedenen, aber kompatiblen Myzelien derselben Art statt ( mon-mon-mating ). Aus Basidiosporen entwickeln sich zuerst einmal monokaryotische Myzelien. Begegnen sich zwei monokaryotische Myzelien, so können sie fusionieren. Vermutlich werden alle Zellen beider monokaryotischer Hyphen dikaryotisiert: die übergetretenen Kerne wandern in den Empfänger-Myzelien durch teilweise abgebaute Querwände von Zelle zu Zelle CLEMENÇON (1997). Sexualität von Coprinus cinereus Bei Pilzen gibt es im Unterschied zuhöheren Organismen keine Geschlechtschromosomen. Vielmehr sind die für das jeweilige Geschlecht verantwortlichen Gene auf verschiedenen Gen-Loci verteilt. Sexuell differenzierte Pilzstämme werden durch den Paarungstyp - mating type - gekennzeichnet. Das sexuelle Paarungsverhalten bei C. cinereus wird durch zwei Gruppen von Inkompatibilitätsfaktoren beeinflusst (tetrapolare Heterothallie). Die Unverträglichkeit wird durch vier Allele (einander entsprechende Erbanlagen) zweier nicht gekoppelter Genorte - A- und B-mating-loci - kontrolliert. Dabei sind die Allele von A und B zwar ungleich, aber kompatibel. x und y repräsentieren die beiden verschiedenen Paarungstypen. Nur Hyphen mit den nicht identischen A- und B-Faktoren sind in der Lage, das Dikaryon zu bilden. Mögliche Paarungen sind: AxBx, AxBy, AyBx, AyBy SCHWANTES (1996), KÜES (2000). (Unmöglich ist z.b. eine Paarung AAxy) STRAS- BURGER (1998). Die Gene des A-Paarungstyp-Locus kontrollieren die Paarung der zwei elterlichen Nuclei innerhalb des Dikaryons und induzieren die Bildung von Schnallen KÜES (2000). B-Gene initiieren die Fusion der Schnallenzelle mit der subapikularen Zelle und bewirken, dass der gefangene Nucleus wieder freigelassen wird KÜES (2000), BOULIANNE ET AL. (2000). Außer Umweltfaktoren bestimmt auch die genetische Disposition des Myzels die Induktion von Differenzierungsprozessen, die besonders der A-Paarungstyp-Locus kontrolliert KÜES (1998). Der A-Paarungstyp-Locus ist auch in die Regulierung der Expression der Gene cgl-1 und cgl-2 involviert. Diese beiden Gene kodieren zwei Galectine (Lectine) BOULIANNE ET AL. (2000). A-Gene kontrollieren Entwicklungsprozesse (Zell-Differenzierungen), B-Gene kontrollieren die Nucleus-Migration KÜES (2000). Kolonien verschiedener A-Spezifitäten und derselben B-Spezifität, also fremde Myzelien, zeigen gegenseitige Aversionen. Dies zeigt sich in Sperren, also Zonen spärlichen Wachstums KÜES (2000). Mit der Isolierung der Galectine in C. cinereus, deren Expression durch kompatible Produkte von A-Paarungstypen induziert wird, sind die ersten Zielgene verfügbar, die zeigen, dass die Pro- Der Tintling 5 (2001) Seite 25
4 Regulatoren agieren BOULIANNE ET AL. (2000). Das Ausbleiben von Interaktionen zwischen Proteinen, die derselbe A-Lokus kodiert hat, bestimmen die Paarungs-Spezifität. Zwischen unverträglichen Proteinen besteht also Aversion. G Aversionen und Attraktionen werden auf molekularer Ebene durch Proteine befohlen Obgleich A und B-Gene verschiedene Zellfunktionen befehlen, kontrollieren sie gemeinsam im Dikaryon gewisse Funktionen wie die Bildung von camp, die camp-abhängige Proteinkinase-Aktivität und die Initiierung der Fruchtkörper-Bildung. Auffallend ist, dass all diese Funktionen durch Licht reguliert oder stimuliert werden KÜES (2000). Morphogenese der Hyphen - Die Pilze kennen das Recycling! Die Zellwände der Pilze müssen wie die Wände der Pflanzen und Algen ausreichend stabil sein, dem Zellturgor und äußeren Einflüssen Widerstand leisten, aber das Zellwachstum erlauben. Bei Pilzen ist die Zellwandausdehnung auf die Hyphen-Spitze beschränkt. Verästelungen entwickeln sich durch Umwandlungen reifer Seitenwände der Hyphen. Das apikale Wachstum der Pilzzzelle vollzieht sich in der Scheitelregion und wird von dem Spitzenkörper koordiniert CLEMENÇON (1997). Der Spitzenkörper ist als kleine, dichte Zone im Hyphenscheitel im Mikroskop sichtbar, reagiert aber äußerst sensibel auf Strörungen und verschwindet vorübergehend bei Deckglasauflage oder bei intensiver Beleuchtung CLE- MENÇON (1997). Polysaccharide in der Zellwand werden recycelt. Bei der Wanderung der Zellkerne in neue Zellen, sind entweder die Septen über Porenkanäle für sie passierbar, oder es müssen Schnallen als Kernschleusen DÖRFELT (1989) gebaut werden. Dafür müssen Löcher oder Breschen in die Zellwände gestemmt und wieder verschlossen werden. Auch bei der Ausbildung von Fruchtkörpern werden Polysaccharide degradiert und wieder verwertet WESSELS (1999). Die gebündelten Aktivitäten von Wandsynthese und Proteinsekretion, unterstützt Der Tintling 5 (2001) Seite 26
5 durch die enorme Penetrationskraft, die durch den Turgordruck erzeugt wird, machen die Pilzhyphen zu Tunnel-bohrenden Geräten, die ideal ausgestattet sind, um in tote und lebende Substrate einzudringen. An der äußersten Hyphen- Spitze werden plastische Wandkomponenten an der Plasmamembran aufgebaut, in die dehnbare Spitzenwand gedrückt und allmählich kreuzvernetzt. Die Zelle wächst weiter, reift, und die Hyphenwand verfestigt sich. Apikale Vesikel, die mit der Plasmamembran an der Hyphenspitze fusionieren, enthalten Proteine, die für den Export ins Medium bestimmt sind. In dem Maße wie neues Wandmaterial beständig an die Innenseite der Zellwand gebracht wird, wird älteres Material wieder abgetragen und ständig der Außenseite zugeführt. Man vermutet, dass Proteine an die Innenseite der Wand gespült werden, wo die maximale Wandsynthese herrscht, und durch die wachsende Wand ausgeschleust werden. In dem Strom der naszierenden Wandglycane werden die Proteine wie ein Holzfloß in einem Fluss mitgeschwemmt (bulk-flow) und gelangen an die Außenregion der Zellwand WES- SELS (1999). Bei den meisten Pilzen sind die Mikrofibrillen aus Chitin zusammengesetzt, Homopolymere aus b-verknüpften N-Acetylglucosamin-Einheiten. Bei den Arthropoden bilden Chitin-Moleküle langvernetzte Ketten, die in der Kutikula der Tiere wie Sperrholz geschichtet sind und jene erstaunlichen physikalischen und statischen Eigenschaften zeigen. Morphogenetische Strukturen bei Coprinus cinereus Zwei unterschiedliche Haupttypen des Myzels können unterschieden werden: nämlich das infertile Monokaryon und das fertile Dikaryon. Eine bemerkenswerte Flexibilität zeichnet C. cinereus aus, um auf unterschiedliche Umweltbedingungen zu reagieren. So finden wir eine Vielfalt morphogenetischer Strukturen bei C. cinereus: 1. Das Monokaryon, das Dikaryon, die Noduli (Hyphenknoten) als Vorstufe zu den Primordien, Fruchtkörper und die reproduktiven Basidien; 2. monokaryotische Differenzierungen zu Oidiophoren und Oidien, sowie monokaryotisches Myzel, Chlamydosporen und Sklerotien. In vegetativen monokaryotischen Hyphen von Coprinus cinereus werden zwei Hydrophobine (COH-1 und COH-2) exprimiert; in asexuellen Oidien und in den Fruchtkörpern kommen sie nicht vor, im dikaryotischen Myzel nur in geringen Mengen ASGEIRSDOTTIR ET AL. (1997). Die Fruchtkörperbildung ist ein überaus komplizierter Prozess, in dem dramatische Veränderungen stattfinden. Aus einem dreidimensionalem, lockerem Maschenwerk gleicher Hyphen entwickelt sich ein kompaktes, plektenchymatisches Gebilde aus differenzierten Zellen CLEMENÇ- ON (1994, 1997), KÜES (2000), BOULIANNE ET AL. (2000). Die innere Uhr des Tintlings: der Tag/Nacht-Rhythmus steuert Veränderungen im Myzel 1. Nodulus Bei vielen Hymenomyceten entsteht aus dem Myzel nicht direkt eine Fruchtkörperanlage, sondern ein kisssenförmiges bis kugeliges Knötchen. CLEMENÇON hat dafür den Begriff Nodulus eingeführt. Vor und während der Fühentwicklung des Nodulus bilden sich im Myzel blasenförmige, Glycogen-haltige Zellen. Das Glycogen - ein Energie-Lieferant bei Pilzen - wird später in den Nodulus, dann in den Stiel und schließlich in den Hut des Basidioms verlagert. Die Fruchtkörper-Entwicklung bei C. cinereus ist monozentrisch. Die Frühentwicklung des Nodulus beginnt damit, dass von vegetativen Hyphen Lufthyphen emporwachsen. Im Normalfall stammen Hyphenknoten von mehr als einer generativen Hyphe ab. Äste von benachbarten Lufthyphen wachsen auf einander zu, lagern sich längsseits und verschmelzen durch Anastomosen an den lateralen Hyphenwänden und formen so ein verwickeltes und leicht zu erkennendes Gitter KÜES (2000). Dieser Prozess findet nur im Dunkeln statt, Licht unterbindet ihn. Die Expression eines Galectins Cgl-2 korreliert mit der Formierung zum Nodulus und wird ebenfalls durch Licht gestoppt, wohingegen die Expression von des Galectins Cgl-1 durch Licht begünstigt wird KÜES (2000). Die weitere Entwicklung zu Basidiomata ist nun abhängig vom Licht. Die neue Phase beinhaltet eine Weichenstellung von einem sich verzweigenden zu einem verwobenem Hyphen-Wachstum. Die Galectine sind in die Hyphen-Hyphen- Der Tintling 5 (2001) Seite 27
6 Struppiger Tintling Coprinus cinereus (Schaeffer 1774; Fries 1821) S.F. Gray 1821 Sektion: Coprinus - Lanatuli Fries Stirps: Lagopus Krieglsteiner et al. Datum: Mitte Oktober bis Mitte Dezember Fundort: Euskirchen MTB , Kalkarer Moor, Glatthaferwiese, Grauweidengebüsch. Ökologie: modrige, nasse Streu, Humus, kein Mist, nitrophil - Wachstum-Minimum: 8 C! Hut grau, dünn, 3-4 (5) cm breit, 1-1,5 cm hoch, mit Velum. Lamellen jung weiß, grauschwarz, dünn Stiel weiß, sparrig-faserig-flockig bedeckt, hohl, dünn, zerbrechlich, wurzelnd! oft büschelig, mit einer Zentralwurzel Mikromerkmale: Breithyphiges Velum, Sporen (-13) x 7-8 µm, Q= 1,6-1,8, dunkelbraun, breit-elliptisch mit mittigem Keimporus, Cheilozystiden und Pleurozystiden bauchigkeulig (1998), COOPER ET AL. (1997). Sie sind nicht essentiell für die Nodulus-Bildung, in Übereinstimmung mit der Beobachtung, dass die Hyphen-Aggregation für die Ausbildung eines Nodulus nicht notwendig ist KÜES (2000). Nicht nur durch das Licht, sondern auch durch andere Umweltfaktoren wird die Fruchtkörperbildung unseres Tintlings kontrolliert: Hungert nämlich der Pilz, so wird dieser Differenzierungsprozess vorangetrieben! Kulturen, die in vollständiger Dunkelheit wachsen, Hyphenknoten und Sklerotien bilden, stellen diese Differenzierungen ein, sobald das Angebot an Kohlenstoff (Glucose) und Stickstoff (Asparagin) erhöht wird BOULIANNE ET AL. (2000). Die Steigerung der Glucose-Konzentration im Nährboden ist wirksamer als die Erhöhung der Stickstoffmenge. Die Mengen von Cgl-2 in den Kulturen korrelieren mit der Anzahl an Sklerotien: hohe Glucose- oder Asparaginwerte unterdrücken die Cgl-2-Expression BOULIANNE ET AL. (2000). 2. Initialen Die kugeliege Hyphenaggregation der Initiale, die aus dem Nodulus hervorgeht, die primordiale Knospe - primordial bud - ist die erste Struktur, die eine klare histologische Differenzierung zeigt. Die dicht gepackten Zellen im Kern sind reich an Glycogen, und zwischen den Zellen sind große Mengen an schleimigem Material. Anastomose und Austausch von Zytoplasma erfolgt vermutlich zwischen an einander liegenden Zellen KUES (2000). Vom Nodulus wächst eine Matrix mit dichterem Kern und lockerer Hülle aus. Früh richten sich die Hyphen des Kerns parallel aus und werden kurzzellig turgeszent. So entsteht die Stielanlage. 7 (7,5) µm, also bei gleicher Breite deutlich kürzere Sporen zeigt). C. lagopides Karst. ist dagegen sehr wohl eine eigenständige Sippe mit Anspruch auf Artrang. Kuehner & Romagnesi (1953) bezeichnen den relativ stattlichen Pilz wohl zu Recht als souvant lignicole ou carbonicole, mais parfois aussi terrestre. Es wurden uns Funde sowohl von Brandstellen als an morschen Baumstümpfen, an am Boden liegenden Holz, an totem liegenden Laub in Buchenwäldern, wie direkt auf Erde wachsend gemeldet. Struppiger Tintling Coprinus cinereus Die Typusart der Sektion ist C. lagopus Fr., die Hasenpfote. Die nah verwandte Art ist in Mitteleuropa zweifellos weit verbreitete und häufige Sippe. Sie fruktifiziert von Juli bis Oktober vorwiegend in Laubwäldern auf Erde einzeln oder zu wenigen Exemplaren. Zuweilen kommt sie auch außerhalb der Wälder in Gärten, auf Feldern, sogar auf Schuttplätzen vor. C. lagopus ist vermutlich eine Kollektiv-Art. So beschreibt Romagnesi (1945) eine forma macrospermus, die 12,5-16 x 6,5-7,5 µm große Sporen aufweist (während C. lagopus f typica Sporen zwischen (10)11-12,5 (13,5) x 6- Der Tintling 5 (2001) Seite 28
7 Oben geht der Stiel in eine kleine knopfförmige pseudo-parenchymatische Hutanlage über. Die Hutanlage hebt die Matrixhülle etwas von der Stielanlage ab, wodurch eine prähymeniale Ringhöhle entsteht. In diesem Stadium fehlt bei vielen Tintlingen eine Hutdeckschicht. Über der der Fruchtkörperanlage wächst die Matrix zu einem kräftigen Lemmablem ( Velum universale ) heran CLEMENÇON (1997). Wenn die Pilzkulturen 5 Tage lang bei 37 0 C in der Dunkelheit wachsen, produzieren sie keine Galectine und entwickeln sich auch nicht weiter. Werden jedoch diese Kulturen bei 25 0 C einem Tag/Nacht-Zyklus von 24 Stunden, also 12 Stunden Helligkeit ausgesetzt, dann erscheinen am nächsten Tag Noduli, in denen das Galectin Struppiger Tintling Coprinus cinereus Cgl-2 auffindbar ist. Noduli entwickeln sich, falls sie einer stimulierende Lichtperiode ausgesetzt werden, über Initialen und Primordien nach 3 Tagen zu Fruchtkörpern. Dagegen bilden sich Hyphenknoten, wenn sie einem ständig wechselnden Tag/Nacht-Rhythmus ausgesetzt werden, über den gesamten Nährboden und entwickeln sich fast ausschließlich am Rand der Petrischale zu Initialen. Dies macht es möglich, das Myzel in innere nichtfruchtendende und äußere fruchtenden Zonen zu trennen. Wenn Galectine von der inneren nicht-fruchtenden Zone extrahiert wurden, wurde nur Cgl-2 detektiert, wohingegen in der äußeren fruchtenden Zone in den Initialen und Pri- Zur Cinereus-Gruppe gehören: C. cinereus, C. radiatus, C. pseudoradiatus, C. macrocephalus C.cinereus (Schaeffer ex Fr.) 5. F. Gray 1821 gilt in weiten Teilen Europas als sehr verbreitet. Bestimmungen müssen jedoch grundsätzlich auch mikroskopisch abgesichert werden, da der,,struppige Tintling mit recht ähnlichen Arten, wie C. radiatus (Bolt. ex Fr.) 5. F. Gray 1821, der ebenso weit verbreitet scheint, oder wie C. pseudoradiatus Kuehner & Josserand ex Watling 1976, der in der BRD noch nicht sicher nachgewiesen ist, und auch mit C. macrocephalus Berkeley 1860 verwechselt werden kann. Letzterer kann nämlich, im Gegensatz zu den Angaben bei Moser (1978: 225) durchaus auch auf Mist wachsen. Enderle fand die Art von Juli bis Oktober 1981 an zwei älteren Kuhmisthaufen. Die Exemplare sahen Hasenpfote Coprinus lagopus Der Tintling 5 (2001) Seite 29
8 mordien nur Cgl-1 detektiert wird. Diese Daten zeigen, dass die zwei Galectine unterschiedlich gebildet werden: Cgl-2-Expression korreliert mit der Formierung von Hyphenknoten, Cgl-1 wird ausschließlich im fruchtenden Myzel, also in hohen Konzentration im Gewebe der Fruchtkörper gefunden BOULIANNE ET AL.(2000). Die Expression von Cgl-2 korreliert mit der Bildung von Noduli und ist die Antwort auf Umweltbedingungen wie Entzug von Nahrung, während die Expression von Cgl-1 besonders in den Primordien und den Fruchtkörpern stattfindet BOULIANNE ET AL.(2000). 3. Primordien Die Architektur der Basidiome zeigt eine überraschende Vielfalt verschiedener Typen. Die Carpogenese, also die Entstehung und Entfaltung der Basidiome, wird in den Primordien vorgezeichnet. Schon sehr früh werden in der Fruchtkörper-Ontogenese die Weichen gestellt. Der negative Geotropismus spielt bei der Gestaltung der Fruchtkörper eine Rolle und stellt einen phylogenetischen Fortschritt dar, wenn der Pilz gegen die Schwerkraft in die Höhe wächst CLE- MENÇON (1997). Die Größenzunahme des jungen Fruchtkörpers beruht vor Beginn der Meiose der Basidien vor kleineren oder eleganteren Exemplaren des häufigen C. cinereus (Schaeff. ex Fr.) S. F. Gray äußerst ähnlich, die auf denselben Misthaufen in großer Zahl fruktifizierten. Es war immer wieder notwendig zumindest die Sporen zu untersuchen: C. cinereus besitzt deutlich kleinere Sporen x 6-7 µm. Um eine Trennung vornehmen zu können und erst nach zahlreichen Aufsammlungen hatte sich das Auge so weit geübt, daß auch makroskopische Trennungen möglich waren: C. cinereus ist im allgemeinen robuster und besitzt einen meist wurzelnden Stiel. Eine weitere Verwechslungsgefahr besteht mit dem meist kleineren C. radiatus (Bolt.) Fr., der ebenfalls am selben Substrat vorkommt und von Hutfärbung und Habitus her makroskopisch leicht für C. macrocephalus gehalten werden kann, wenn die Fruchtkörper einmal etwas größer werden. Keine der beiden Arten erreicht aber die Sporengröße von C. macrocephalus, die im Mittel 13-13,5 x 7-8 (-9) ~m beträgt. Die nun folgende Beschreibung durch Enderle gründet sich nicht nur auf eigene Aufsammlung. Die Nachbestimmung zweier Kollektionen besorgten die Herren Dr. G. Moreno (Madrid) und Dr. R. Watling (Edinburgh).,,Hüte zunächst zylindrisch bis länglich bis länglich ellipsoid, x 4-12 mm, nach dem Aufschirmen im Durchmesser mm, aufgeschirmte Hüte fast flach. Wie bei den meisten schnell vergänglichen Arten biegen sich die Hut-ränder schon bald nach oben, rollen ein und zerfließen innerhalb weniger Stunden; zuvor bilden sich bei C. macrocephalus öfters gezackte Ränder. Hutfarbe typisch grau, ähnlich C. cinereus, nur in der Mitte ocker bis senffarben (wegen des durchscheinenden Stielansatzes); Hutriefung bis zu dieser zentralen, rundlichen Aufhellung, etwas feiner und meist enger als bei C. cinereus. Gesamter Hut bei noch geschlossenen Fruchtkörpern mit deutlichen, weißlichen oder schmutzig weißlichen Velumfasern dicht abstehend bis anliegend besetzt, (im Hutzentrum ist das Velum manchmal bräunlich verfärbt), dieser Rundsporiger Kohlen-Tintling Coprinus lagopides Foto: Fredi Kasparek Der Tintling 5 (2001) Seite 30
9 allem auf Zellvermehrung, nachher auf Zellstreckung CLEMENÇON (1997). G Die Expression der cgl-2-gene, die Cgl-2- Galectine kodieren, ist initiiert durch Signale wie Entzug von Nahrung und ist erforderlich für die Zell-Aggregation. G Die Expression der cgl-1-gene, die Cgl-2- Galectine kodieren, ist verantwortlich für die weitere Zelldifferenzierung. G Mit den beiden Galectinen ist es möglich, auf molekularer Ebene die verschiedenen Pfade der Basidiom-Entwicklung zu deuten BOULI- ANNE ET AL. (2000). G Wenn C. cinereus Fruchtkörper ausbildet, werden große Mengen von Galectinen in diesen gefunden. Die Fruchtkörperbildung korreliert mit externen Signalen und ist perfekt synchronisiert mit dem Tag/Nacht-Zyklus von Hell und Dunkel BOULIANNE ET AL. (2000), KÜES (2000) Großhütiger Mist-Tintling Coprinus macrocephalus 4. Basidiom (Fruchtörper) Werden Myzelkulturen dem Wechsel von Dunkelheit und Licht in einem Tageszyklus von jeweils 12 Stunden Dunkelheit und Helligkeit ausgesetzt, so beginnt das Myzel in der darauf folgenden Nacht mit der Formation von Noduli. Auf Licht-Induktion hin, können diese sich nun zu Initialen entwickeln. Innerhalb der Initialen beginnt nach einem weiteren Tag/Nacht-Zyklus die Zelldifferenzierung. Ein weiteres Lichtsignal ist notwendig, damit der Nodulus zum Primordium anwächst, wo all die Gewebe vorgebildet sind, die den Pilz zusammensetzen. Aber dieses letzte Lichtsignal ist notwendig, ansonsten findet Bleichwuchs statt, mit langen bleichen Stielen ( etiolated stipes ) und unfertigen Hüten. Nach einer weiteren Dunkelperiode wird Licht benötigt, um Karyogamie und Meiose in den Probasidien zu vollenden. Dann reift nach 48 Besatz verliert sich aber bei aufgeschirmten Exemplaren sehr bald und ist nur noch partiell oder gar nicht mehr vorhanden. Die Velumfasern können leicht abgestreift werden. Lamellen im Primordialstadium weißlich, beim Aufschirmen grau, bald schwarz, schmal, gedrängt, mit heller Schneide. Stiel x 2,6 mm, gegen die Basis erweitert, Basis selbst wenig verdickt Stielfarbe weiß. Die Stiele sind innen hohl und außen lange mit auffälligen, abstehenden Flocken bzw. Fasern besetzt, die später verschwinden. Geruch unauffällig. Sporenpulver in Masse dunkelst schwarzbraun bis schwarz, mit schwachem Violettstich. Hutvelum aus + zylindrischen bis etwas aufgeblasenen Hyphen, die an den Septen deutlich eingeschnürt sind (- 70) µm breit, Endzellen gelegentlich konisch auslaufend. Cheilozystiden rundlich bis sackoder tropfenförmig, selten schlauchartig länglich, µm breit. Basidien 4sporig, teils etwas eingeschnürt, ca. 28 x 8,5 µm. Sporen 12,5-14,5 (-15,5) x 7-8 (-9) µm, fast schwarz, bis ganz schwarz, zylindrisch ellipsoid, walzenförmig bis flach eiförmig; Keimporus + zentral bis schwach exzentrisch. Standort: Einzeln oder gesellig, manchmal fast büschelig, meist auf älteren Misthaufen, besonders an deren Rand. Die Art ist nur in den ersten Morgenstunden in voller Entfaltung zu finden, und schon gegen Uhr sind die meisten Fruchtkörper zur Unkenntlichkeit eingerollt, zusammengesackt. Pleurocystiden wurden in dem Enderle vorliegenden Material nicht festgestellt. Orton & Watling konnten ebenfalls keine finden, doch stellte Bender gelegentlich welche fest. Nach Moser (1978) wachsen diese Tintlinge nicht auf Mist, sondern,,auf modrigen Pflanzenresten". Bender fand sie auch auf verfaulenden Strohballen. Literatur.: MONTAG K (1996): Pilze auf Pferdemist. Der Tintling 4: 9-16 Der graue Tintling ist durch seine intensiv graue Hutfarbe, seine reichlichen weißen Velumflocken und seinen struppigen, weißen + wurzelnden Stiel gut erkennbar. Der Tintling 5 (2001) Seite 31
10 Stunden der voll entwickelte Fruchtkörper heran und löst sich schließlich auf (Autolyse). Synchron haben sich die Basidien entwickelt und im Gleichtakt haben sich die meiotischen Teilungen des diploiden Zellkerns vollzogen, die sich dann paarweise in den vier reifen Basidiosporen wiederfinden CLEMENÇON (1997), BOULIANNE ET AL. (2000), KÜES (2000). Auf der Hutoberfläche des Pilzes findet sich ein flauschiger Schleier, das Velum. Darunter ist die rigide Cortex des Hutes, die das Lamellengewebe stützt, welches die Trama, das Subhymenium und das Hymenium enthält CLEMENÇON (1997). Sowohl Cgl-1 und Cgl-2 werden in den verschiedenen Geweben in relativ gleichen Anteilen gefunden. Die höchsten Anteile finden sich im Velum, in den äußersten Schichten des Stieles, dem Lipsanoblem CLEMENÇON (1997), die niedrigsten Mengen in den Lamellen selbst und in den Basidien überhaupt nicht BOULIAN- NE ET AL. (2000). 5. Physalohyphen Eine vegetative Hyphenzelle kann durch Vergrößerung der Vakuole beträchtlich anschwellen. Durch den steigenden Turgor, infolge einer gewaltigen Wasseraufnahme, dehnt sich die Zelle wie ein Ballon aus. Bei den aufgeschirmten Hymenomyceten besteht das Plektenchym des Fruchtkörpers aus solchen turgeszenten Zellen. Der physiologische Sinn der Physalohyphen der Fruchtkörpertrama liegt in der raschen Entfaltung vorgebildeter Geflechte und Organe. Diese werden während der Primordialentwicklung aus generativen Hyphen angelegt. Das Aufschirmen eines Blätterpilzes wird vorwiegend durch dieses Aufpumpen mit Wasser bewerkstelligt. G Die Physalohyphen erlauben eine rasche Vergrößerung des Volumens und der Oberfläche bei einer konstanten oder nur noch geringfügig erhöhten Biomasse CLEMENÇON (1997). 6. Basidien Die Basidien von C. cinereus sind die einzigen Zellen, die sich übereinstimmend entwickeln. Probasidien können in ihrer Entwicklung gestoppt werden. Ist die Meiose aber erst einmal eingeleitet, dann reifen die Basidien konsequent autonom und endotropisch heran. Die Basidie erhebt sich gewöhnlich als endständige Zelle von einem Hyphenast und ist von der darunter liegenden Zelle durch ein Septum mit einem Doliporus abgetrennt. Das Zytoplasma in der Probasidie ist noch relativ einfach mit zahlreichen freien Ribosomen, wenigen Vakuolen, Mitochondrien und limitiertem endoplasmatischem Retikulum. Zur Zeit der Kernfusion findet sich Glycogen an der Basis der Basidie. Wenn die Basidiosporen sich ausbilden, zeigt sich wiederum an der Basis eine Vakuole, die sich allmählich ausbreitet und schließlich die gesamte Zelle füllt. Die Bildung der Basidiosporen beginnt mit der Entwicklung der Sterigmen. Diese beginnen als breite Beulen und verlängern sich vergleichbar dem Spitzenwachstum einer Hyphe. Die Zellwand der Sterigmen ist dreilagig wie die Basidien-Wand, nur dünner. Es ist nicht klar, ob die Sterigmenwand eine Fortsetzung der Basidien-Wand ist. Die Sporenwand jedenfalls ist vielschichtig und verändert sich ständig während des Entwicklungsprozesses. Während der Sporenbildung orientieren sich zahlreiche Mikrotubuli longitudinal in den Sterigmen, und Golgi-Vesikel bringen Kohlenhydrate heran, damit sich Sporen und Sporenwand entwickeln können. Die meisten Hymenomyceten schließen den beiden meiotischen Teilungen eine dritte Kernteilung an. Die dritte Kernteilung findet oft gerade unter den Sterigmen oder sogar in ihnen statt. Verschiedene Möglichkeiten beschreibt CLEMENÇON (1997): manche Sporen enthalten zwei Kerne, vielfach verkümmern aber vier von acht haploiden Kernen. Ethymologie: dolium = großer Krug Doli pores Septum legere = auswählen alloioz, alloios = verschieden Allel dinh, dine = Strudel, Wirbel Dinophyten genea, genea = Geschlecht, Stamm genoz, genos = Sprößling Genetik karpoz, karpos = Frucht; joroz, phoros = tragend, Abgabe Karpophor = Fruchtträger karuon, karuon = Nußkern lemma, lemma = Eierschale; blhma, blema = Wurf mit Würfeln Lemma blem, Velum universale meiow, meioo = verkleinert werden Meiose onjwz, onthos = wirklich, wahrhaft, absolut plektoz, plektos = geflochten; encew, enchyo= eingießen, füllen Plektenchym julon, phylon = Geschlecht, Familie jragma, phragma = Zaun, Mauer Phragmo Basidiomycceten - Epiphragma der Schnecken jusa, physa = Blase Nachtschattengewächs Der Tintling 5 (2001) Seite 32
11 Physalis alkekengi L. (Wilde Blasenkirsche) juton, phyton = Gewächs, Pflanze Æ Präfix: Phyto compartiment (franz.) = abgeteiltes Feld, Zugabteil Literatur: ARNOLD GRW (1993): Das System der Pilze - in Weber: Allgemeine Mykologie. G. Fischer ASGEIRSDOTTIR SA, HALSALL JR, CASSELTON LA (1997): Expression of two closely linked hydrophobin genes of Coprinus cinereus in monokaryon-specific and down-regulated by the oid- 1 mutation. Fungal genet Biol 22 (1): BARTNICKI-GARCIA S (1999): Glucans, Walls, and Morphogenesis: On the contributions of J.G.H. Wessels to the golden decades of fungal physiology and beyond. Fungal Genetics and Biology 27: Academic Press BOULIANNE RP, LIU Y, AEBI M, LU BC, KUES U (2000): Fruiting body development in Coprinus cinereus: regulated expression of two galectins secreted by a non-classical pathway. Microbiology 146 (Pt 8): BRESINSKY A, KREISEL H & PRIMAS A (1995): Mykologische Standortkunde. Regensburger Mykologische Schriften, Band 5 BRESINSKY A (1996): Abstammung, Phylogenie und Verwandtschaft im Pilzreich. Z. Mykol 62/2: CLEMENÇON H (1994): Der Nodulus und Organogenese während der Frühen Fruchtkörperentwicklung von Psilocybe cyanescens. Z. Mykol. 60 (1): CLEMENÇON H (1997): Anatomie der Hymenomyceten. Eine Einführung in die Cytologie und Plectologie der Hymenomycetes. F. Flück- Wirth, CH Teufen COOPER DNW, BOULIANNE RP, CHARLTON S, FARRELL EM, SUCHER A, LU BC (1997): Fungal Galectins, Sequence and Specifity of two Isolectins from Coprinus cinereus. J Biol Chem 272 (3): COOPER DNW & BARONDES SH (1999): God must love galectins; He made so many of them. Oxford University Press, Glycobiology DÖRFELT H (1989): Lexikon der Mykologie.Fischer HERDER (1984): Lexikon der Biologie ILLIES J (1983): Der Jahrhundert-Irrtum, Würdigung und Kritik des Darwinismus. Umschau Verlag HOEK CHR VAN DEN, JAHNS HM & MANN DG (1993): Algen, 3. Auflage, Thieme KRIEGLSTEINER GJ, BENDER H & ENDERLE M (1982): Studien zur Gattung Coprinus. Z Mykol 48(1): KREISEL H (1969): Grundzüge eines natürlichen Systems der Pilze KUES U, GRANADO JD, HERMANN R, BOULI- ANNE RP, KERTESZ-CHALOUPKOVA K, AEBI RP (1998): The A mating type and blue light regulate all known differentiation porecesses in the basidiomycete Coprinus cinereus. Mol Gen Genet 260 (1): KUES U (2000): Life history and development processes in the basidiomycete Coprinus cinereus: Microbiology and Molecular Biology Reviews 64 (2): KUES U & LIU Y (2000): Fruiting body production in basidiomycetes. Appl Microbiol Biotechnol 54 (2): MHK- MICHAEL E, HENNIG B & KREISEL H (1983): Handbuch für Pilzfreunde. G. Fischer MONTAG K (1996): Pilze auf Pferdemist. Der Tintling 4: 9-20 MÜLLER E & LOEFFLER W (1992): Mykologie. G. Thieme Verlag RABINOVICH GA, RIERA CM, LANDA CA, SO- TOMAYOR CE (1999): Galectins: a key intersection between glycobiology and immunology. Braz J Med Biol 32 (4): SCHERRER S, DE VRIES OM, DUDLER R, WES- SELS JG, HONEGGER R (2000): Interfacial selfassembly of fungal hydrophobins of the lichenforming ascomycetes Xanthoria parietina and X. ectaneoides. Fungal Genet Biol 30 (10): SCHWANTES HO (1995): Biologie der Pilze. Verlag E. Ulmer SMITH G (1969): An Introduction to Industrial mycology. 6th edition. E Arnold Publishers STRASBURGER (1998): LEHRBUCH DER BO- TANIK. G. Fischer Verlag WEBER H, Herausgeber (1993): Allgemeine Mykologie. G. Fischer Verlag WESSELS JGH & SIETSMA JH (1981): Cell wall synthesis and hyphal morphogenesis. A new model for apical growth. In Cell Walls 1981 (DG Robinson and JH Quader, Eds.), pp WESSELS JGH (1986): Cell wall synthesis in apical hypal growth. Int. Rev. Cytol. 104: WESSELS JGH (1999): Fungi in their own right. Fungal Genetics and Biology 27: WIRTH V (1995): Flechtenflora, 2. Auflage, Verlag E. Ulmer Der Tintling 5 (2001) Seite 33
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Genetik & Vererbung. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: : Genetik & Vererbung Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Inhalt Vorwort Seite 4 Einleitung Seite
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: : Genetik & Vererbung Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Inhalt Vorwort Seite 4 Einleitung Seite
Von der Eizelle zum Welpen
 Manuela Walter Landstr. 34, CH-5322 Koblenz / Switzerland Tel./Fax P: +41(0)56 246 00 38 Natel: +41(0)79 344 30 09 e-mail: olenjok@hotmail.com website: www.olenjok-husky.ch Von der Eizelle zum Welpen Ein
Manuela Walter Landstr. 34, CH-5322 Koblenz / Switzerland Tel./Fax P: +41(0)56 246 00 38 Natel: +41(0)79 344 30 09 e-mail: olenjok@hotmail.com website: www.olenjok-husky.ch Von der Eizelle zum Welpen Ein
1 Was ist Leben? Kennzeichen der Lebewesen
 1 In diesem Kapitel versuche ich, ein großes Geheimnis zu lüften. Ob es mir gelingt? Wir werden sehen! Leben scheint so selbstverständlich zu sein, so einfach. Du wirst die wichtigsten Kennzeichen der
1 In diesem Kapitel versuche ich, ein großes Geheimnis zu lüften. Ob es mir gelingt? Wir werden sehen! Leben scheint so selbstverständlich zu sein, so einfach. Du wirst die wichtigsten Kennzeichen der
Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten
 Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Differentielle Genexpression Positive Genregulation Negative Genregulation cis-/trans-regulation 1. Auf welchen Ebenen kann Genregulation stattfinden? Definition
Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Differentielle Genexpression Positive Genregulation Negative Genregulation cis-/trans-regulation 1. Auf welchen Ebenen kann Genregulation stattfinden? Definition
Wie Zellmembranen Lipide austauschen
 Prof. Dr. Benedikt Westermann (re.) und Till Klecker, M.Sc. im Labor für Elektronenmikroskopie der Universität Bayreuth. Wie Zellmembranen Lipide austauschen Bayreuther Zellbiologen veröffentlichen in
Prof. Dr. Benedikt Westermann (re.) und Till Klecker, M.Sc. im Labor für Elektronenmikroskopie der Universität Bayreuth. Wie Zellmembranen Lipide austauschen Bayreuther Zellbiologen veröffentlichen in
Anhang zu Kapitel 06.02: Die Zelle
 Anhang zu Kapitel 06.02: Die Zelle Inhalt Anhang Kapitel 06.02: Die Zelle... 1 Inhalt... 2 Zellorganellen im EM: die Zellmembran... 3 Zellkern einer Leberzelle... 4 Zellkern... 4 Poren der Kernmembran...
Anhang zu Kapitel 06.02: Die Zelle Inhalt Anhang Kapitel 06.02: Die Zelle... 1 Inhalt... 2 Zellorganellen im EM: die Zellmembran... 3 Zellkern einer Leberzelle... 4 Zellkern... 4 Poren der Kernmembran...
Merkmale des Lebens. - Aufbau aus Zellen - Wachstum - Vermehrung - Reaktion auf Reize - Bewegung aus eigener Kraft - Stoffwechsel
 Merkmale des Lebens - Aufbau aus Zellen - Wachstum - Vermehrung - Reaktion auf Reize - Bewegung aus eigener Kraft - Stoffwechsel Alle Lebewesen bestehen aus Zellen Fragen zum Text: - Was sah Hooke genau?
Merkmale des Lebens - Aufbau aus Zellen - Wachstum - Vermehrung - Reaktion auf Reize - Bewegung aus eigener Kraft - Stoffwechsel Alle Lebewesen bestehen aus Zellen Fragen zum Text: - Was sah Hooke genau?
Bei Einbeziehung von neun Allelen in den Vergleich ergibt sich eine Mutation in 38 Generationen (350:9); das entspricht ca. 770 Jahren.
 336 DNA Genealogie Das Muster genetischer Variationen im Erbgut einer Person - zu gleichen Teilen von Mutter und Vater ererbt - definiert seine genetische Identität unveränderlich. Neben seiner Identität
336 DNA Genealogie Das Muster genetischer Variationen im Erbgut einer Person - zu gleichen Teilen von Mutter und Vater ererbt - definiert seine genetische Identität unveränderlich. Neben seiner Identität
Lerntext Pflanzen 1. Was sind Pflanzen?
 Was sind Pflanzen? Lerntext Pflanzen 1 Pleurotus_ostreatus Ausschnitt eines Photos von Tobi Kellner, das er unter der Lizenz CC BY-SA 3.0 zur Verfügung stellte Der Körper eines Pilzes ist ein Fadengeflecht
Was sind Pflanzen? Lerntext Pflanzen 1 Pleurotus_ostreatus Ausschnitt eines Photos von Tobi Kellner, das er unter der Lizenz CC BY-SA 3.0 zur Verfügung stellte Der Körper eines Pilzes ist ein Fadengeflecht
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Die klassische Genetik: T.H. Morgan und seine Experimente mit Drosophila melanogaster Das komplette Material finden Sie hier: Download
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Die klassische Genetik: T.H. Morgan und seine Experimente mit Drosophila melanogaster Das komplette Material finden Sie hier: Download
Zelluläre Reproduktion: Zellzyklus. Regulation des Zellzyklus - Proliferation
 Zelluläre Reproduktion: Zellzyklus Regulation des Zellzyklus - Proliferation Alle Zellen entstehen durch Zellteilung Der Zellzyklus kann in vier Haupt-Phasen eingeteilt werden Interphase Zellwachstum;
Zelluläre Reproduktion: Zellzyklus Regulation des Zellzyklus - Proliferation Alle Zellen entstehen durch Zellteilung Der Zellzyklus kann in vier Haupt-Phasen eingeteilt werden Interphase Zellwachstum;
Das Paper von heute. Samuel Grimm & Jan Kemna
 Das Paper von heute Samuel Grimm & Jan Kemna Bisheriges Modell Was bereits bekannt war - TIR1 ist an Auxinantwort (Zellteilung, Elongation, Differenzierung) beteiligt, im selben Signalweg wie AXR1 - TIR1
Das Paper von heute Samuel Grimm & Jan Kemna Bisheriges Modell Was bereits bekannt war - TIR1 ist an Auxinantwort (Zellteilung, Elongation, Differenzierung) beteiligt, im selben Signalweg wie AXR1 - TIR1
Übung 8. 1. Zellkommunikation. Vorlesung Bio-Engineering Sommersemester 2008. Kapitel 4. 4
 Bitte schreiben Sie Ihre Antworten direkt auf das Übungsblatt. Falls Sie mehr Platz brauchen verweisen Sie auf Zusatzblätter. Vergessen Sie Ihren Namen nicht! Abgabe der Übung bis spätestens 05. 05. 08
Bitte schreiben Sie Ihre Antworten direkt auf das Übungsblatt. Falls Sie mehr Platz brauchen verweisen Sie auf Zusatzblätter. Vergessen Sie Ihren Namen nicht! Abgabe der Übung bis spätestens 05. 05. 08
If you can't study function, study structure. Vom Molekül in der Ursuppe bis zur ersten Zelle war es ein langer Weg:
 Kapitel 4: ANATOMIE EINER EUKARYOTENZELLE Inhalt: EINLEITUNG... 53 BESTANDTEILE EINER EUKARYOTENZELLE... 55 MEMBRANVERBINDUNGEN... 57 GEWEBE UND ORGANE... 57 LITERATUR...57 LINKS... 57 Einleitung If you
Kapitel 4: ANATOMIE EINER EUKARYOTENZELLE Inhalt: EINLEITUNG... 53 BESTANDTEILE EINER EUKARYOTENZELLE... 55 MEMBRANVERBINDUNGEN... 57 GEWEBE UND ORGANE... 57 LITERATUR...57 LINKS... 57 Einleitung If you
In der Jahrgangsstufe 8 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
 In der Jahrgangsstufe 8 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen: Sie kennen die Bedeutung der Bakterien und grundlegende Unterschiede zwischen Pro- und Eucyte. Sie können einfache Objekte mikroskopisch
In der Jahrgangsstufe 8 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen: Sie kennen die Bedeutung der Bakterien und grundlegende Unterschiede zwischen Pro- und Eucyte. Sie können einfache Objekte mikroskopisch
Fette und ihre Funktionen. Müssen Fette sein?
 Fette und ihre Funktionen Müssen Fette sein? Ja! Fette sind: Wichtiger Bestandteil unserer täglichen Nahrung Energieträger Nummer 1 Quelle für essentielle n Vehikel für die Aufnahme fettlöslicher Vitamine
Fette und ihre Funktionen Müssen Fette sein? Ja! Fette sind: Wichtiger Bestandteil unserer täglichen Nahrung Energieträger Nummer 1 Quelle für essentielle n Vehikel für die Aufnahme fettlöslicher Vitamine
Trennungsverfahren Techniken (in der Biologie)
 Trennungsverfahren Techniken (in der Biologie)? Biomoleküle können getrennt werden aufgrund ihrer - chemischen Eigenschaften: Ladung, Löslichkeit, Wechselwirkung mit spezifischen Reagenzen, Molmasse -
Trennungsverfahren Techniken (in der Biologie)? Biomoleküle können getrennt werden aufgrund ihrer - chemischen Eigenschaften: Ladung, Löslichkeit, Wechselwirkung mit spezifischen Reagenzen, Molmasse -
27 Funktionelle Genomanalysen Sachverzeichnis
 Inhaltsverzeichnis 27 Funktionelle Genomanalysen... 543 27.1 Einleitung... 543 27.2 RNA-Interferenz: sirna/shrna-screens 543 Gunter Meister 27.3 Knock-out-Technologie: homologe Rekombination im Genom der
Inhaltsverzeichnis 27 Funktionelle Genomanalysen... 543 27.1 Einleitung... 543 27.2 RNA-Interferenz: sirna/shrna-screens 543 Gunter Meister 27.3 Knock-out-Technologie: homologe Rekombination im Genom der
Allotrope Kohlenstoffmodifikationen. Ein Vortrag von Patrick Knicknie. Datum: 04.05.06 Raum:112
 Allotrope Kohlenstoffmodifikationen Ein Vortrag von Patrick Knicknie Datum: 04.05.06 Raum:112 Themen: 1. Was ist Allotrop? 2. Unterschiedliche Kohlenstoffmodifikationen 3. Der Graphit 4. Der Diamant 5.
Allotrope Kohlenstoffmodifikationen Ein Vortrag von Patrick Knicknie Datum: 04.05.06 Raum:112 Themen: 1. Was ist Allotrop? 2. Unterschiedliche Kohlenstoffmodifikationen 3. Der Graphit 4. Der Diamant 5.
Stand von letzter Woche
 RUB ECR1 AXR1 Stand von letzter Woche E2 U? E1-like AXR1 Repressor ARF1 Proteasom AuxRE Repressor wird sehr schnell abgebaut notwendig für Auxinantwort evtl. Substrat für SCF Identifikation des SCF-Ubiquitin
RUB ECR1 AXR1 Stand von letzter Woche E2 U? E1-like AXR1 Repressor ARF1 Proteasom AuxRE Repressor wird sehr schnell abgebaut notwendig für Auxinantwort evtl. Substrat für SCF Identifikation des SCF-Ubiquitin
β2-microglobulin deficient mice lack CD4-8+cytolytic T cells
 β2-microglobulin deficient mice lack CD4-8+cytolytic T cells Mäuse mit einem Knock-out bezüglich ß-Microglobulin sind nicht in der Lage CD4-8+ cytotoxische T-Zellen zu bilden Nature,Vol 344, 19. April
β2-microglobulin deficient mice lack CD4-8+cytolytic T cells Mäuse mit einem Knock-out bezüglich ß-Microglobulin sind nicht in der Lage CD4-8+ cytotoxische T-Zellen zu bilden Nature,Vol 344, 19. April
Der Versuch im Bild. März 2008
 Der Versuch im Bild März 2008 Zaun aufstellen Ein Zaun stellt sicher, dass keine gentechnisch veränderten Pflanzen von Menschen oder Tieren verschleppt werden. Zudem wird der Versuch, welcher nur von eingewiesenen
Der Versuch im Bild März 2008 Zaun aufstellen Ein Zaun stellt sicher, dass keine gentechnisch veränderten Pflanzen von Menschen oder Tieren verschleppt werden. Zudem wird der Versuch, welcher nur von eingewiesenen
Was ist Wirkstoffdesign?
 Was ist Wirkstoffdesign? Eine Einführung für Nicht-Fachleute Arzneimittel hat vermutlich schon jeder von uns eingenommen. Vielleicht hat sich der eine oder andere dabei gefragt, was passiert eigentlich
Was ist Wirkstoffdesign? Eine Einführung für Nicht-Fachleute Arzneimittel hat vermutlich schon jeder von uns eingenommen. Vielleicht hat sich der eine oder andere dabei gefragt, was passiert eigentlich
Die Chromosomen sind im Zellkern immer paarweise vorhanden. In der menschlichen Zelle befinden sich 23 Chromosomenpaare. Diese bilden den diploiden
 Die Chromosomen Die Chromosomen sind Träger der Erbinformation. Unter dem Mikroskop erscheinen sie in verschiedenen Formen. Einmal als gekrümmte oder gedrungene Stäbchen, in deren Mitte sich eine Ein-schnürung
Die Chromosomen Die Chromosomen sind Träger der Erbinformation. Unter dem Mikroskop erscheinen sie in verschiedenen Formen. Einmal als gekrümmte oder gedrungene Stäbchen, in deren Mitte sich eine Ein-schnürung
Eine Exkursion in das Reich der deutschen Bäume. Acer platanoides. Diplomarbeit von Jennifer Burghoff. Fachbereich Gestaltung. Kommunikationsdesign
 Eine Exkursion in das Reich der deutschen Bäume SPITZ AHORN Acer platanoides Diplomarbeit von Jennifer Burghoff WS 06/07 Hochschule Darmstadt Fachbereich Gestaltung Kommunikationsdesign Eine Exkursion
Eine Exkursion in das Reich der deutschen Bäume SPITZ AHORN Acer platanoides Diplomarbeit von Jennifer Burghoff WS 06/07 Hochschule Darmstadt Fachbereich Gestaltung Kommunikationsdesign Eine Exkursion
Unterschied Tiere, Pflanzen, Bakterien u. Pilze und die Zellorganellen
 Unterschied Tiere, Pflanzen, Bakterien u. Pilze und die Zellorganellen Die Organellen der Zelle sind sozusagen die Organe die verschiedene Funktionen in der Zelle ausführen. Wir unterscheiden Tierische
Unterschied Tiere, Pflanzen, Bakterien u. Pilze und die Zellorganellen Die Organellen der Zelle sind sozusagen die Organe die verschiedene Funktionen in der Zelle ausführen. Wir unterscheiden Tierische
APP-GFP/Fluoreszenzmikroskop. Aufnahmen neuronaler Zellen, mit freund. Genehmigung von Prof. Stefan Kins, TU Kaiserslautern
 Über die Herkunft von Aβ42 und Amyloid-Plaques Heute ist sicher belegt, dass sich die amyloiden Plaques aus einer Vielzahl an Abbaufragmenten des Amyloid-Vorläufer-Proteins (amyloid-precursor-protein,
Über die Herkunft von Aβ42 und Amyloid-Plaques Heute ist sicher belegt, dass sich die amyloiden Plaques aus einer Vielzahl an Abbaufragmenten des Amyloid-Vorläufer-Proteins (amyloid-precursor-protein,
EINFLUSS DER ZELLMEMBRAN UND EINIGER ZELLAKTOREN AUF DEN ALTERUNGSPROZESS
 EINFLUSS DER ZELLMEMBRAN UND EINIGER ZELLAKTOREN AUF DEN ALTERUNGSPROZESS Der Kern steuert die Proteinsynthese durch Synthese der Boten-RNA (mrna) gemäß den von der DNA gelieferten Informationen Die mrna
EINFLUSS DER ZELLMEMBRAN UND EINIGER ZELLAKTOREN AUF DEN ALTERUNGSPROZESS Der Kern steuert die Proteinsynthese durch Synthese der Boten-RNA (mrna) gemäß den von der DNA gelieferten Informationen Die mrna
Von der DNA zum Eiweißmolekül Die Proteinbiosynthese. Ribosom
 Von der DNA zum Eiweißmolekül Die Proteinbiosynthese Ribosom Wiederholung: DNA-Replikation und Chromosomenkondensation / Mitose Jede Zelle macht von Teilung zu Teilung einen Zellzyklus durch, der aus einer
Von der DNA zum Eiweißmolekül Die Proteinbiosynthese Ribosom Wiederholung: DNA-Replikation und Chromosomenkondensation / Mitose Jede Zelle macht von Teilung zu Teilung einen Zellzyklus durch, der aus einer
Was versteht man unter AURA?
 1 Eugen J. Winkler Die Aura Was versteht man unter AURA? Jede Form des Lebens besitzt eine AURA, sie ist aber je nach Art, unterschiedlich zusammengesetzt und unterschiedlich ausgeprägt. Das Naturreich
1 Eugen J. Winkler Die Aura Was versteht man unter AURA? Jede Form des Lebens besitzt eine AURA, sie ist aber je nach Art, unterschiedlich zusammengesetzt und unterschiedlich ausgeprägt. Das Naturreich
Grundwissenkarten Gymnasium Vilsbisburg. 10. Klasse. Biologie
 Grundwissenkarten Gymnasium Vilsbisburg 10. Klasse Biologie Es sind insgesamt 12 Karten für die 10. Klasse erarbeitet. Karten ausschneiden : Es ist auf der linken Blattseite die Vorderseite mit Frage/Aufgabe,
Grundwissenkarten Gymnasium Vilsbisburg 10. Klasse Biologie Es sind insgesamt 12 Karten für die 10. Klasse erarbeitet. Karten ausschneiden : Es ist auf der linken Blattseite die Vorderseite mit Frage/Aufgabe,
Vom pubertären Nachtschwärmer zum senilen Bettflüchter
 Biologische Uhr ändert sich Vom pubertären Nachtschwärmer zum senilen Bettflüchter Basel, Schweiz (17. Mai 2011) - Die meisten Menschen kommen aufgrund ihrer Biochronologie entweder als Lerche (Frühaufsteher)
Biologische Uhr ändert sich Vom pubertären Nachtschwärmer zum senilen Bettflüchter Basel, Schweiz (17. Mai 2011) - Die meisten Menschen kommen aufgrund ihrer Biochronologie entweder als Lerche (Frühaufsteher)
Stammzellenmanipulation. Stammzellen können in Zellkultur manipuliert werden
 Stammzellenmanipulation Hämatopoietische Stammzellen können gebraucht werden um kranke Zellen mit gesunden zu ersetzen (siehe experiment bestrahlte Maus) Epidermale Stammzellpopulationen können in Kultur
Stammzellenmanipulation Hämatopoietische Stammzellen können gebraucht werden um kranke Zellen mit gesunden zu ersetzen (siehe experiment bestrahlte Maus) Epidermale Stammzellpopulationen können in Kultur
Zellenlehre (Cytologie)
 Zellenlehre (Cytologie) 1 Geschichte der Cytologie 1590 Erfindung des Lichtmikroskops durch holländische Brillenmacher Johannes und Zacharias Janssen 1665 Robert Hooke entdeckt zellulären Aufbau von Pflanzen
Zellenlehre (Cytologie) 1 Geschichte der Cytologie 1590 Erfindung des Lichtmikroskops durch holländische Brillenmacher Johannes und Zacharias Janssen 1665 Robert Hooke entdeckt zellulären Aufbau von Pflanzen
Alien Invasion I. Univ.-Prof. Dr. Albert Duschl
 Alien Invasion I Univ.-Prof. Dr. Albert Duschl Bakterien und wir Bakterien sind ein normaler und notwendiger Teil unserer Umwelt. Unser Körper enthält 10 14 Bakterien, aber nur 10 13 Eukaryontenzellen.
Alien Invasion I Univ.-Prof. Dr. Albert Duschl Bakterien und wir Bakterien sind ein normaler und notwendiger Teil unserer Umwelt. Unser Körper enthält 10 14 Bakterien, aber nur 10 13 Eukaryontenzellen.
mentor Grundwissen: Biologie bis zur 10. Klasse
 mentor Grundwissen mentor Grundwissen: Biologie bis zur 10. Klasse Alle wichtigen Themen von Franz X Stratil, Wolfgang Ruppert, Reiner Kleinert 1. Auflage mentor Grundwissen: Biologie bis zur 10. Klasse
mentor Grundwissen mentor Grundwissen: Biologie bis zur 10. Klasse Alle wichtigen Themen von Franz X Stratil, Wolfgang Ruppert, Reiner Kleinert 1. Auflage mentor Grundwissen: Biologie bis zur 10. Klasse
Autotrophe Ernährung. Heterotrophe Ernährung. Ernährungsweise von grünen Pflanzen und manchen Bakterien
 2 2 Autotrophe Ernährung Ernährungsweise von grünen Pflanzen und manchen Bakterien Sie stellen energiereiche organische Verbindungen (z.b. Zucker) zum Aufbau körpereigener Stoffe selbst her. Die Energie
2 2 Autotrophe Ernährung Ernährungsweise von grünen Pflanzen und manchen Bakterien Sie stellen energiereiche organische Verbindungen (z.b. Zucker) zum Aufbau körpereigener Stoffe selbst her. Die Energie
"Chromosomen Didac 2" Einzelsatz Best.- Nr / Paket von 6 Sätzen
 "Chromosomen Didac 2" Einzelsatz Best.- Nr. 2013336 / 2013337 Paket von 6 Sätzen Zusammensetzung Der Einzelsatz besteht aus: 2 blauen Sätzen mit 3 Chromosomen + 1 Geschlechtschromosom + 1 Stück von einem
"Chromosomen Didac 2" Einzelsatz Best.- Nr. 2013336 / 2013337 Paket von 6 Sätzen Zusammensetzung Der Einzelsatz besteht aus: 2 blauen Sätzen mit 3 Chromosomen + 1 Geschlechtschromosom + 1 Stück von einem
Zoologische Staatssammlung München;download: http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at SPIXIANA
 SPIXIANA Abb. 1: Strombus k. kleckhamae Cernohorsky, 1971, dorsal und ventral 320 Abb. 2: Strombus k. boholensis n. subsp., Typus, dorsal und ventral Gehäusefärbung: Die ersten 3-^ "Windungen sind bräunlich
SPIXIANA Abb. 1: Strombus k. kleckhamae Cernohorsky, 1971, dorsal und ventral 320 Abb. 2: Strombus k. boholensis n. subsp., Typus, dorsal und ventral Gehäusefärbung: Die ersten 3-^ "Windungen sind bräunlich
Proseminarvortrag. Markov-Ketten in der Biologie (Anwendungen)
 Proseminarvortrag Markov-Ketten in der Biologie (Anwendungen) von Peter Drössler 20.01.2010 2 Markov-Ketten in der Biologie (Peter Drössler, KIT 2010) Inhalt 1. Das Wright-Fisher Modell... 3 1.1. Notwendige
Proseminarvortrag Markov-Ketten in der Biologie (Anwendungen) von Peter Drössler 20.01.2010 2 Markov-Ketten in der Biologie (Peter Drössler, KIT 2010) Inhalt 1. Das Wright-Fisher Modell... 3 1.1. Notwendige
Grundwissenkarten Hans-Carossa-Gymnasium. 8. Klasse. Biologie
 Grundwissenkarten Hans-Carossa-Gymnasium 8. Klasse Biologie Es sind insgesamt 12 Karten für die 8. Klasse erarbeitet. davon : Karten ausschneiden : Es ist auf der linken Blattseite die Vorderseite mit
Grundwissenkarten Hans-Carossa-Gymnasium 8. Klasse Biologie Es sind insgesamt 12 Karten für die 8. Klasse erarbeitet. davon : Karten ausschneiden : Es ist auf der linken Blattseite die Vorderseite mit
Medizinische Universitäts-Kinderklinik Marfan-Syndrom Wie kommt es dazu? Vererbung Was macht das Gen?
 Medizinische Universitäts-Kinderklinik Prof. Dr. med. Primus E. Mullis Abteilungsleiter Pädiatrische Endokrinologie / Diabetologie & Stoffwechsel CH 3010 Bern Marfan-Syndrom Wie kommt es dazu? In jeder
Medizinische Universitäts-Kinderklinik Prof. Dr. med. Primus E. Mullis Abteilungsleiter Pädiatrische Endokrinologie / Diabetologie & Stoffwechsel CH 3010 Bern Marfan-Syndrom Wie kommt es dazu? In jeder
Set einer tierischen / pflanzlichen Zelle BAD_ DOC
 Set einer tierischen / pflanzlichen Zelle Alle Lebewesen setzen sich aus Zellen zusammen. Zellen können vereinzelt vorkommen, sich zu Kolonien gruppieren oder die Gewebe größerer Organismen bilden. Sie
Set einer tierischen / pflanzlichen Zelle Alle Lebewesen setzen sich aus Zellen zusammen. Zellen können vereinzelt vorkommen, sich zu Kolonien gruppieren oder die Gewebe größerer Organismen bilden. Sie
Dip-Pen Nanolithography. Ramona Augustin Einführung in die Biophysik SoSe 2013
 Ramona Augustin Einführung in die Biophysik SoSe 2013 Gliederung Was ist DPN und wie funktioniert es? Welche Versuche wurden mit DPN durchgeführt? Wofür kann man DPN einsetzen? Was zeichnet DPN gegenüber
Ramona Augustin Einführung in die Biophysik SoSe 2013 Gliederung Was ist DPN und wie funktioniert es? Welche Versuche wurden mit DPN durchgeführt? Wofür kann man DPN einsetzen? Was zeichnet DPN gegenüber
Das magnetische Feld. Kapitel Lernziele zum Kapitel 7
 Kapitel 7 Das magnetische Feld 7.1 Lernziele zum Kapitel 7 Ich kann das theoretische Konzept des Magnetfeldes an einem einfachen Beispiel erläutern (z.b. Ausrichtung von Kompassnadeln in der Nähe eines
Kapitel 7 Das magnetische Feld 7.1 Lernziele zum Kapitel 7 Ich kann das theoretische Konzept des Magnetfeldes an einem einfachen Beispiel erläutern (z.b. Ausrichtung von Kompassnadeln in der Nähe eines
Angewandte Zellbiologie
 Angewandte Zellbiologie Bt-BZ01: Pflanzenzellen als Bioreaktoren 8 CP (VL + Pr) MENDEL (VL) HÄNSCH (Pr) Bt-BZ02: Zellbiologie der Tiere I 8 CP (VL + Pr) BUCHBERGER WINTER (VL) VAUTI (Pr) Bt-BZ03: Zellbiologie
Angewandte Zellbiologie Bt-BZ01: Pflanzenzellen als Bioreaktoren 8 CP (VL + Pr) MENDEL (VL) HÄNSCH (Pr) Bt-BZ02: Zellbiologie der Tiere I 8 CP (VL + Pr) BUCHBERGER WINTER (VL) VAUTI (Pr) Bt-BZ03: Zellbiologie
Zellen brauchen Sauerstoff Information
 Zellen brauchen Sauerstoff Information Tauchregel: Suche mit deiner schweren Tauchausrüstung einen direkten Weg zum Einstieg ins Wasser. Tauchen ist wie jede andere Sportart geprägt von körperlicher Anstrengung.
Zellen brauchen Sauerstoff Information Tauchregel: Suche mit deiner schweren Tauchausrüstung einen direkten Weg zum Einstieg ins Wasser. Tauchen ist wie jede andere Sportart geprägt von körperlicher Anstrengung.
Welche Organelle und Zellbestandteile konntest Du in Zellen der Ligusterbeere im Lichtmikroskop erkennen? Wie gross ist ein Grippe Virus ungefähr?
 Welche Organelle und Zellbestandteile konntest Du in Zellen der Ligusterbeere im Lichtmikroskop erkennen? Wie gross ist ein Grippe Virus ungefähr? 1 2 Wie gross ist das Auflösungsvermögen des menschlichen
Welche Organelle und Zellbestandteile konntest Du in Zellen der Ligusterbeere im Lichtmikroskop erkennen? Wie gross ist ein Grippe Virus ungefähr? 1 2 Wie gross ist das Auflösungsvermögen des menschlichen
Gentherapie. Grüne Gentechnologie
 Gentherapie Grüne Gentechnologie Definition Mit Gentherapie bezeichnet man das Einfügen von Genen in Zellen eines Individuums zur Behandlung von Erbkrankheiten bzw. Gendefekten Durch die Einführung soll
Gentherapie Grüne Gentechnologie Definition Mit Gentherapie bezeichnet man das Einfügen von Genen in Zellen eines Individuums zur Behandlung von Erbkrankheiten bzw. Gendefekten Durch die Einführung soll
Alter/Grösse Anatomie Heimat Terrarium Fütterung Häutung Paarung Tragzeit Arten Meine Erlebnisse
 Alter/Grösse Anatomie Heimat Terrarium Fütterung Häutung Paarung Tragzeit Arten Meine Erlebnisse Lynn Fehr, 15. Mai 2009 www.pjf.ch/schlangen/ Seite 1 von 7 Alter/Grösse: Die Kornnatter kann 120cm-150cm
Alter/Grösse Anatomie Heimat Terrarium Fütterung Häutung Paarung Tragzeit Arten Meine Erlebnisse Lynn Fehr, 15. Mai 2009 www.pjf.ch/schlangen/ Seite 1 von 7 Alter/Grösse: Die Kornnatter kann 120cm-150cm
Vertiefendes Seminar zur Vorlesung Biochemie
 Vertiefendes Seminar zur Vorlesung Biochemie 31.10.2014 Proteine: Struktur Gerhild van Echten-Deckert Fon. +49-228-732703 Homepage: http://www.limes-institut-bonn.de/forschung/arbeitsgruppen/unit-3/abteilung-van-echten-deckert/abt-van-echten-deckert-startseite/
Vertiefendes Seminar zur Vorlesung Biochemie 31.10.2014 Proteine: Struktur Gerhild van Echten-Deckert Fon. +49-228-732703 Homepage: http://www.limes-institut-bonn.de/forschung/arbeitsgruppen/unit-3/abteilung-van-echten-deckert/abt-van-echten-deckert-startseite/
1. Tag. Spermien erreichen die Eileiter, in denen sich reife Eizellen befinden. 2. Tag. Befruchtung der Eizellen in der Eileiterampulle. 3.
 1. Tag Erster Decktag. Spermien wandern außerhalb der Gebärmutterschleimhaut. Die Spermien wandern zu den Eileitern. Bei gesunden Rüden ist das Sperma bis zu sechs Tage im weiblichen Genital befruchtungsfähig.
1. Tag Erster Decktag. Spermien wandern außerhalb der Gebärmutterschleimhaut. Die Spermien wandern zu den Eileitern. Bei gesunden Rüden ist das Sperma bis zu sechs Tage im weiblichen Genital befruchtungsfähig.
Grundlagen der Vererbung beim Hund
 Grundlagen der Vererbung beim Hund Züchterstammtisch: 10. August 2013 Referentin: Diana Ringpfeil Tätigkeit: Tierärztin Mail: Ringpfeil@arcor.de Referent: Kay Rostalski Diana Ringpfeil, Tierärztin, Kay
Grundlagen der Vererbung beim Hund Züchterstammtisch: 10. August 2013 Referentin: Diana Ringpfeil Tätigkeit: Tierärztin Mail: Ringpfeil@arcor.de Referent: Kay Rostalski Diana Ringpfeil, Tierärztin, Kay
Neue Fakten zur Lohnentwicklung
 DR. WOLFGANG KÜHN LW.Kuehn@t-online.de Neue Fakten zur Lohnentwicklung Die seit Jahren konstant große Lücke in der Entlohnung zwischen den neuen Bundesländern und dem früheren Bundesgebiet bleibt auch
DR. WOLFGANG KÜHN LW.Kuehn@t-online.de Neue Fakten zur Lohnentwicklung Die seit Jahren konstant große Lücke in der Entlohnung zwischen den neuen Bundesländern und dem früheren Bundesgebiet bleibt auch
Station 1. Analyse von strahleninduzierten DNA-Schäden durch Gel-Elektrophorese
 Station 1 Analyse von strahleninduzierten DNA-Schäden durch Gel-Elektrophorese 1 I. Vorinformationen An der GSI wurde eine weltweit neuartige Krebstherapie mit Ionenstrahlen entwickelt. Dazu werden in
Station 1 Analyse von strahleninduzierten DNA-Schäden durch Gel-Elektrophorese 1 I. Vorinformationen An der GSI wurde eine weltweit neuartige Krebstherapie mit Ionenstrahlen entwickelt. Dazu werden in
6. Ein Betrag von 840 soll im Verhältnis 3:4 auf zwei Personen aufgeteilt werden. Wie groß ist der kleinere Betrag?
 Lehranstalt für Pharmazeutisch-technische technische Assistenten Name, Vorname: Muster! Muster! Eingangstest Aufgabe 1. Wie viel mg sind 0,056 g? 2. Wie viel mm sind 803, 2 cm? 3. Wie viel Minuten sind
Lehranstalt für Pharmazeutisch-technische technische Assistenten Name, Vorname: Muster! Muster! Eingangstest Aufgabe 1. Wie viel mg sind 0,056 g? 2. Wie viel mm sind 803, 2 cm? 3. Wie viel Minuten sind
GRUNDEINHEITEN DES LEBENS
 Cytologie:Zellen Organismen Vorssa09/10/CK 1. DieZelle 1.1.VielfaltderZellen Alle Lebewesen sind aus Zellen aufgebaut. Zellen sind die kleinsten, selbständig lebensfähigen Einheiten, die sogenanntengrundeinheitendeslebens.
Cytologie:Zellen Organismen Vorssa09/10/CK 1. DieZelle 1.1.VielfaltderZellen Alle Lebewesen sind aus Zellen aufgebaut. Zellen sind die kleinsten, selbständig lebensfähigen Einheiten, die sogenanntengrundeinheitendeslebens.
Musterlösung - Übung 5 Vorlesung Bio-Engineering Sommersemester 2008
 Aufgabe 1: Prinzipieller Ablauf der Proteinbiosynthese a) Erklären Sie folgende Begriffe möglichst in Ihren eigenen Worten (1 kurzer Satz): Gen Nukleotid RNA-Polymerase Promotor Codon Anti-Codon Stop-Codon
Aufgabe 1: Prinzipieller Ablauf der Proteinbiosynthese a) Erklären Sie folgende Begriffe möglichst in Ihren eigenen Worten (1 kurzer Satz): Gen Nukleotid RNA-Polymerase Promotor Codon Anti-Codon Stop-Codon
3. Elektrische Felder
 3. Elektrische Felder Das dem Menschen wohl am längsten bekannte elektrische Phänomen ist der Blitz. Aufgrund der Urgewalt von Blitzen wurden diese in der Antike Gottheiten wie dem Donnergott Thor zugeschrieben.
3. Elektrische Felder Das dem Menschen wohl am längsten bekannte elektrische Phänomen ist der Blitz. Aufgrund der Urgewalt von Blitzen wurden diese in der Antike Gottheiten wie dem Donnergott Thor zugeschrieben.
Anatomie - Histologie. Bindegewebe
 Bindegewebe 1 Binde- und Stützgewebe Lockeres Bindegew., Fettgewebe, Knorpel, Knochen 2 Binde- und Stützgewebe Zusammengesetzt aus Bindegewebszellen und größerer Mengen geformter, bzw. ungeformter Interzellularsubstanzen
Bindegewebe 1 Binde- und Stützgewebe Lockeres Bindegew., Fettgewebe, Knorpel, Knochen 2 Binde- und Stützgewebe Zusammengesetzt aus Bindegewebszellen und größerer Mengen geformter, bzw. ungeformter Interzellularsubstanzen
Evolution, Genetik und Erfahrung
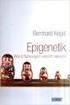 Chromosomen, Fortpflanzung und Genkopplung Entscheidende Entdeckung: Gene sind auf Chromosomen lokalisiert! 1 CHROMOSOM fadenförmige Strukturen im Kern der Zellen (wikipedia) Chromosomen in Körperzellen
Chromosomen, Fortpflanzung und Genkopplung Entscheidende Entdeckung: Gene sind auf Chromosomen lokalisiert! 1 CHROMOSOM fadenförmige Strukturen im Kern der Zellen (wikipedia) Chromosomen in Körperzellen
Grüne Gentechnologie Beispiel: Kartoffel
 Grüne Gentechnologie Beispiel: Kartoffel Inhalt 1. Gentechnisch veränderte (transgene) Pflanzen und drei Methoden der Herstellung transgener Pflanzen 2. Bedeutung von Antibiotika-Selektionsmarkern bei
Grüne Gentechnologie Beispiel: Kartoffel Inhalt 1. Gentechnisch veränderte (transgene) Pflanzen und drei Methoden der Herstellung transgener Pflanzen 2. Bedeutung von Antibiotika-Selektionsmarkern bei
KULTIVIERUNG VON MIKROORGANISMEN
 KULTIVIERUNG VON MIKROORGANISMEN KULTIVIERUNG VON MIKROORGANISMEN Verfahren, das Bakterien außerhalb des natürlichen Standortes zur Vermehrung bringt (unbelebte Substrate oder Zellkulturen) 1 Voraussetzungen
KULTIVIERUNG VON MIKROORGANISMEN KULTIVIERUNG VON MIKROORGANISMEN Verfahren, das Bakterien außerhalb des natürlichen Standortes zur Vermehrung bringt (unbelebte Substrate oder Zellkulturen) 1 Voraussetzungen
Meisterwurz. Imperatoriae Radix. Radix Imperatoriae
 ÖAB xxxx/xxx Meisterwurz Imperatoriae Radix Radix Imperatoriae Definition Das ganze oder geschnittene, getrocknete Rhizom und die Wurzel von Peucedanum ostruthium (L.) KCH. Gehalt: mindestens 0,40 Prozent
ÖAB xxxx/xxx Meisterwurz Imperatoriae Radix Radix Imperatoriae Definition Das ganze oder geschnittene, getrocknete Rhizom und die Wurzel von Peucedanum ostruthium (L.) KCH. Gehalt: mindestens 0,40 Prozent
Zelldifferenzierung und Morphogenese
 Zelldifferenzierung und Morphogenese Fragestellung: Wie ist es möglich, daß sich aus einer einzigen Zelle ein hochkomplexes Lebewesen mit hohem Differenzierungsgrad entwickeln kann? weniger gut verstanden
Zelldifferenzierung und Morphogenese Fragestellung: Wie ist es möglich, daß sich aus einer einzigen Zelle ein hochkomplexes Lebewesen mit hohem Differenzierungsgrad entwickeln kann? weniger gut verstanden
Pflanzen. Blüte, Knospe, Blatt, Stängel, Hauptwurzel, Seitenwurzel, Frucht, Keimblatt
 Pflanzen 1. Welche Teile einer Pflanze kennst du? Ordne die folgenden Begriffe der Skizze zu! Schreibe dazu die folgenden Begriffe zu den richtigen Zahlen in die Tabelle! Blüte, Knospe, Blatt, Stängel,
Pflanzen 1. Welche Teile einer Pflanze kennst du? Ordne die folgenden Begriffe der Skizze zu! Schreibe dazu die folgenden Begriffe zu den richtigen Zahlen in die Tabelle! Blüte, Knospe, Blatt, Stängel,
Fossile Rohstoffe. Kohle
 Kohle Kohle ist ein Gemisch aus Kohlenstoffverbindungen, die Schwefel, Sauerstoff und Wasserstoff enthalten können. Entstehung Kohle ist größtenteils pflanzlichen Ursprungs. Im feuchtwarmen Klima des Karbon
Kohle Kohle ist ein Gemisch aus Kohlenstoffverbindungen, die Schwefel, Sauerstoff und Wasserstoff enthalten können. Entstehung Kohle ist größtenteils pflanzlichen Ursprungs. Im feuchtwarmen Klima des Karbon
Inhalte unseres Vortrages
 Inhalte unseres Vortrages Vorstellung der beiden paper: Germ line transmission of a disrupted ß2 mirkroglobulin gene produced by homologous recombination in embryonic stem cells ß2 Mikroglobulin deficient
Inhalte unseres Vortrages Vorstellung der beiden paper: Germ line transmission of a disrupted ß2 mirkroglobulin gene produced by homologous recombination in embryonic stem cells ß2 Mikroglobulin deficient
Primärstoffwechsel. Prof. Dr. Albert Duschl
 Primärstoffwechsel Prof. Dr. Albert Duschl Aufgaben Der Primärstoffwechsel sorgt für Aufbau (Anabolismus) und Abbau (Katabolismus) biologischer Moleküle, wie Aminosäuren, Lipide, Kohlenhydrate und Nukleinsäuren.
Primärstoffwechsel Prof. Dr. Albert Duschl Aufgaben Der Primärstoffwechsel sorgt für Aufbau (Anabolismus) und Abbau (Katabolismus) biologischer Moleküle, wie Aminosäuren, Lipide, Kohlenhydrate und Nukleinsäuren.
Wald und Weidetieren. Landschaftsentwicklung durch Beweidung und die Ko-Evolution von Pflanzen und Pflanzenfresser
 Wald und Weidetieren Landschaftsentwicklung durch Beweidung und die Ko-Evolution von Pflanzen und Pflanzenfresser Leo Linnartz, september 2015 Inhalt Wald und Weidetieren Landschaftsentwicklung durch Beweidung
Wald und Weidetieren Landschaftsentwicklung durch Beweidung und die Ko-Evolution von Pflanzen und Pflanzenfresser Leo Linnartz, september 2015 Inhalt Wald und Weidetieren Landschaftsentwicklung durch Beweidung
Glia- sowie Nervenzellen (= Neuronen) sind die Bausteine des Nervensystems. Beide Zellarten unterscheiden sich vorwiegend in ihren Aufgaben.
 (C) 2014 - SchulLV 1 von 5 Einleitung Du stehst auf dem Fußballfeld und dein Mitspieler spielt dir den Ball zu. Du beginnst loszurennen, denn du möchtest diesen Ball auf keinen Fall verpassen. Dann triffst
(C) 2014 - SchulLV 1 von 5 Einleitung Du stehst auf dem Fußballfeld und dein Mitspieler spielt dir den Ball zu. Du beginnst loszurennen, denn du möchtest diesen Ball auf keinen Fall verpassen. Dann triffst
Grundschraffur Metalle feste Stoffe Gase. Kunststoffe Naturstoffe Flüssigkeiten
 Anleitung für Schraffuren beim Zeichnen Die Bezeichnung Schraffur leitet sich von dem italienischen Verb sgraffiare ab, was übersetzt etwa soviel bedeutet wie kratzen und eine Vielzahl feiner, paralleler
Anleitung für Schraffuren beim Zeichnen Die Bezeichnung Schraffur leitet sich von dem italienischen Verb sgraffiare ab, was übersetzt etwa soviel bedeutet wie kratzen und eine Vielzahl feiner, paralleler
Wie vermehren sich Pilze?
 Wie vermehren sich Pilze? 31. Woche Pilze sind geheimnisvoll. Manche schaffen es, über Nacht zu wachsen Sie vermehren sich durch Sporen. Sporen sieht man nur ganz selten, aber du kannst sie sichtbar machen.
Wie vermehren sich Pilze? 31. Woche Pilze sind geheimnisvoll. Manche schaffen es, über Nacht zu wachsen Sie vermehren sich durch Sporen. Sporen sieht man nur ganz selten, aber du kannst sie sichtbar machen.
Bäume pflanzen in 6 Schritten
 Schritt-für-Schritt- 1 Einleitung Ob Ahorn, Buche, Kastanie, Obstbäume oder exotische Sorten wie Olivenbäume und die Japanische Blütenkirsche lesen Sie in unserem Ratgeber, wie Sie am besten vorgehen,
Schritt-für-Schritt- 1 Einleitung Ob Ahorn, Buche, Kastanie, Obstbäume oder exotische Sorten wie Olivenbäume und die Japanische Blütenkirsche lesen Sie in unserem Ratgeber, wie Sie am besten vorgehen,
5.7 Blütenentwicklung als Beispiel für kombinatorische Genfunktion
 160 Entwicklung Infloreszenzmeristem: Sprossmeristem nach Blühinduktion. Bildet an den Flanken statt Blatt-Blütenprimordien. TERMINAL FLOWER (TFL): Gen, welches nötig ist für die Identität des Infloreszenzmeristems,
160 Entwicklung Infloreszenzmeristem: Sprossmeristem nach Blühinduktion. Bildet an den Flanken statt Blatt-Blütenprimordien. TERMINAL FLOWER (TFL): Gen, welches nötig ist für die Identität des Infloreszenzmeristems,
Verbesserte Basenpaarung bei DNA-Analysen
 Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/verbesserte-basenpaarungbei-dna-analysen/ Verbesserte Basenpaarung bei DNA-Analysen Ein Team aus der Organischen
Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/verbesserte-basenpaarungbei-dna-analysen/ Verbesserte Basenpaarung bei DNA-Analysen Ein Team aus der Organischen
IAG Futtermitteluntersuchung Sektion Futtermittelmikroskopie FUTTERMITTELUNTERSUCHUNG Mutterkorn 30.2 BESTIMMUNG VON MUTTERKORN IN FUTTERMITTELN
 BESTIMMUNG VON MUTTERKORN IN FUTTERMITTELN 1 Zweck und Anwendungsbereich Die Methode dient der qualitativen und quantitativen Bestimmung von Mutterkorn in Futtermitteln. Die Methode eignet sich für eine
BESTIMMUNG VON MUTTERKORN IN FUTTERMITTELN 1 Zweck und Anwendungsbereich Die Methode dient der qualitativen und quantitativen Bestimmung von Mutterkorn in Futtermitteln. Die Methode eignet sich für eine
Klebe die gepressten Blätter auf ein Blatt Papier und mach dieses Blatt in eine Klarsichtfolie. Hefte diese Folie nun in deinem Baumbuch ab.
 September Suche eine Eiche in deiner Umgebung und merke dir gut wo sie steht. Du wirst ihren Lebensweg nun eine Weile begleiten. Sammle Blätter deiner Eiche und presse sie, damit du sie lange aufbewahren
September Suche eine Eiche in deiner Umgebung und merke dir gut wo sie steht. Du wirst ihren Lebensweg nun eine Weile begleiten. Sammle Blätter deiner Eiche und presse sie, damit du sie lange aufbewahren
Chemische Evolution. Biologie-GLF von Christian Neukirchen Februar 2007
 Chemische Evolution Biologie-GLF von Christian Neukirchen Februar 2007 Aristoteles lehrte, aus Schlamm entstünden Würmer, und aus Würmern Aale. Omne vivum ex vivo. (Alles Leben entsteht aus Leben.) Pasteur
Chemische Evolution Biologie-GLF von Christian Neukirchen Februar 2007 Aristoteles lehrte, aus Schlamm entstünden Würmer, und aus Würmern Aale. Omne vivum ex vivo. (Alles Leben entsteht aus Leben.) Pasteur
Exkurs: Circadiane Rhythmik. Physiologie der Zeitumstellung
 Exkurs: Circadiane Rhythmik Physiologie der Zeitumstellung Chronobiologie Die biologische Uhr circadiane Rhythmik Biologische Uhren sind Anpassungen des Organismus an zyklische Veränderungen der Umwelt
Exkurs: Circadiane Rhythmik Physiologie der Zeitumstellung Chronobiologie Die biologische Uhr circadiane Rhythmik Biologische Uhren sind Anpassungen des Organismus an zyklische Veränderungen der Umwelt
Alterungsvorgänge bei PKW-Reifen
 Untersuchung des Alterungsverhaltens von PKW-Reifen Alterungsvorgänge bei PKW-Reifen 1 Inhalt Inhalt Definition von Alterung Ziel der Studie Chemische Vorgänge Physikalische Vorgänge Bewertung der Alterungsvorgänge
Untersuchung des Alterungsverhaltens von PKW-Reifen Alterungsvorgänge bei PKW-Reifen 1 Inhalt Inhalt Definition von Alterung Ziel der Studie Chemische Vorgänge Physikalische Vorgänge Bewertung der Alterungsvorgänge
Verhaltensbiologie. 26. Juni 2007
 Verhaltensbiologie 26. Juni 2007 Geschichte der Verhaltensbiologie in Münster Konrad Lorenz (1903-1989) Nobelpreis 1973 Foto: H. Kacher Geschichte der Verhaltensbiologie in Münster Bernhard Rensch (1900-1990)
Verhaltensbiologie 26. Juni 2007 Geschichte der Verhaltensbiologie in Münster Konrad Lorenz (1903-1989) Nobelpreis 1973 Foto: H. Kacher Geschichte der Verhaltensbiologie in Münster Bernhard Rensch (1900-1990)
Hexagonales Wasser: Erkenntnisse und Fakten
 Hexagonales Wasser: Erkenntnisse und Fakten Helmut Theuretzbacher Beispiel: Optimaler hexagonaler Wasserkristall Nur gesundes Wasser bildet schöne sechseckige, den Schneeflocken ähnliche Kristalle. Quellwasser,
Hexagonales Wasser: Erkenntnisse und Fakten Helmut Theuretzbacher Beispiel: Optimaler hexagonaler Wasserkristall Nur gesundes Wasser bildet schöne sechseckige, den Schneeflocken ähnliche Kristalle. Quellwasser,
Spuren/Trittsiegel erkennen
 Spuren/Trittsiegel erkennen Einleitung Die Zehen Ihre Länge ist verschieden. Wie bei des Menschen Hand, der 3 Zeh ist der längste, dann der 4, 2, 5 Zehballen und zum Schluss der Innenzehe (Daumen) Die
Spuren/Trittsiegel erkennen Einleitung Die Zehen Ihre Länge ist verschieden. Wie bei des Menschen Hand, der 3 Zeh ist der längste, dann der 4, 2, 5 Zehballen und zum Schluss der Innenzehe (Daumen) Die
24 Volumen und Oberfläche eines Quaders
 52 24 Volumen und Oberfläche eines Quaders Das Volumen (V) eines Quaders berechnet man, indem man Länge (a), Breite (b) und Höhe (c) miteinander multipliziert, also: V = a b c. Die Oberfläche (O) eines
52 24 Volumen und Oberfläche eines Quaders Das Volumen (V) eines Quaders berechnet man, indem man Länge (a), Breite (b) und Höhe (c) miteinander multipliziert, also: V = a b c. Die Oberfläche (O) eines
Lösung Station 1. Teile des Baumes (a)
 Lösung Station 1 Teile des Baumes (a) Jeder Baum hat einen Stamm mit einer harten Rinde, die ihn schützt. Am Stamm wachsen die dicken Äste, an denen wiederum die dünnen Zweige wachsen. Im Frühjahr sprießen
Lösung Station 1 Teile des Baumes (a) Jeder Baum hat einen Stamm mit einer harten Rinde, die ihn schützt. Am Stamm wachsen die dicken Äste, an denen wiederum die dünnen Zweige wachsen. Im Frühjahr sprießen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Pilze: Lernwerkstatt mit Texten und Aufgaben
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Pilze: Lernwerkstatt mit Texten und Aufgaben Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 1. Auflage 2001 Alle Rechte vorbehalten
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Pilze: Lernwerkstatt mit Texten und Aufgaben Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 1. Auflage 2001 Alle Rechte vorbehalten
IV. Übungsaufgaben für die Jahrgangstufe 9 & 10
 IV. Übungsaufgaben für die Jahrgangstufe 9 & 10 Von der Erbanlage zum Erbmerkmal: 34) Welche Aufgaben haben Chromosomen? 35) Zeichne und benenne die Teile eines Chromosoms, wie sie im Lichtmikroskop während
IV. Übungsaufgaben für die Jahrgangstufe 9 & 10 Von der Erbanlage zum Erbmerkmal: 34) Welche Aufgaben haben Chromosomen? 35) Zeichne und benenne die Teile eines Chromosoms, wie sie im Lichtmikroskop während
Zucker und Polysaccharide (Voet Kapitel 10)
 Zucker und Polysaccharide (Voet Kapitel 10) 1. Monosaccharide 2. Polysaccharide 3. Glycoproteine 2. Polysaccharide Polysaccharide = Glycane, bestehen aus glycosidisch miteinander verbundenen Monosacchariden
Zucker und Polysaccharide (Voet Kapitel 10) 1. Monosaccharide 2. Polysaccharide 3. Glycoproteine 2. Polysaccharide Polysaccharide = Glycane, bestehen aus glycosidisch miteinander verbundenen Monosacchariden
Soziologie. Bildungsverlag EINS a Wolters Kluwer business. Sylvia Betscher-Ott, Wilfried Gotthardt, Hermann Hobmair, Wilhelm Ott, Rosemarie Pöll
 Sylvia Betscher-Ott, Wilfried Gotthardt, Hermann Hobmair, Wilhelm Ott, Rosemarie Pöll Herausgeber: Hermann Hobmair Soziologie 1. Auflage Bestellnummer 05006 Bildungsverlag EINS a Wolters Kluwer business
Sylvia Betscher-Ott, Wilfried Gotthardt, Hermann Hobmair, Wilhelm Ott, Rosemarie Pöll Herausgeber: Hermann Hobmair Soziologie 1. Auflage Bestellnummer 05006 Bildungsverlag EINS a Wolters Kluwer business
Sind MADS-Box-Gene ein Schlüssel zum Verständnis der Entwicklung und Evolution der Gametophyten-Generation von Landpflanzen?
 P flanzenforschung Sind MADS-Box-Gene ein Schlüssel zum Verständnis der Entwicklung und Evolution der Gametophyten-Generation von Landpflanzen? Verelst, Wim; Münster, Thomas; Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung,
P flanzenforschung Sind MADS-Box-Gene ein Schlüssel zum Verständnis der Entwicklung und Evolution der Gametophyten-Generation von Landpflanzen? Verelst, Wim; Münster, Thomas; Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung,
BIORACING Ergänzungsfuttermittel
 BIORACING Ergänzungsfuttermittel...für Pferde Der natürlich Weg zur optimaler Gesundheit und Leistungsfähigkeit Einführung Was ist BIORACING? Die einzigartige Nahrungsergänzung enthält die Grundbausteine
BIORACING Ergänzungsfuttermittel...für Pferde Der natürlich Weg zur optimaler Gesundheit und Leistungsfähigkeit Einführung Was ist BIORACING? Die einzigartige Nahrungsergänzung enthält die Grundbausteine
Baumtagebuch Japanische Zierkirsche
 Baumtagebuch Japanische Zierkirsche Klasse 9d Juni 2016 Die Japanische Zierkirsche habe ich mir für das Baumtagebuch ausgesucht. Ich habe mich für diesen Baum entschieden, weil er in meiner Straße sehr
Baumtagebuch Japanische Zierkirsche Klasse 9d Juni 2016 Die Japanische Zierkirsche habe ich mir für das Baumtagebuch ausgesucht. Ich habe mich für diesen Baum entschieden, weil er in meiner Straße sehr
Proteinstrukturklassen α-helikale Proteine
 Proteinstrukturklassen α-helikale Proteine Wintersemester 2011/12 Peter Güntert Domäne Modul Faltung Domäne (domain): Polypeptidkette (oder Teil davon), die unabhängig in eine stabile, kompakte Tertiärstruktur
Proteinstrukturklassen α-helikale Proteine Wintersemester 2011/12 Peter Güntert Domäne Modul Faltung Domäne (domain): Polypeptidkette (oder Teil davon), die unabhängig in eine stabile, kompakte Tertiärstruktur
Basale Aufgabe eines Immunsystems
 Komponenten und Aufbau des Immunsystems Initiation von Immunantworten lymphatische Organe Erkennungsmechanismen Lymphozytenentwicklung Entstehung und Verlauf adaptiver Immunantworten 1 Basale Aufgabe eines
Komponenten und Aufbau des Immunsystems Initiation von Immunantworten lymphatische Organe Erkennungsmechanismen Lymphozytenentwicklung Entstehung und Verlauf adaptiver Immunantworten 1 Basale Aufgabe eines
FOS: Radioaktivität und Strahlenschutz. Chemische Elemente und ihre kleinsten Teilchen
 R. Brinkmann http://brinkmann-du.de Seite 5..03 Chemische Elemente FOS: Radioaktivität und Strahlenschutz Chemische Elemente und ihre kleinsten Teilchen Der Planet Erde besteht aus 9 natürlich vorkommenden
R. Brinkmann http://brinkmann-du.de Seite 5..03 Chemische Elemente FOS: Radioaktivität und Strahlenschutz Chemische Elemente und ihre kleinsten Teilchen Der Planet Erde besteht aus 9 natürlich vorkommenden
Das Kind und ich eine Bindung, die stärkt
 Das Kind und ich eine Bindung, die stärkt P Ä D A G O G I S C H E W E R K T A G U N G 1 3. 1 5. J U L I 2 0 1 0 S A L Z B U R G Ich darf Sie durch diesen Workshop begleiten: Klinische- u. Gesundheitspsychologin
Das Kind und ich eine Bindung, die stärkt P Ä D A G O G I S C H E W E R K T A G U N G 1 3. 1 5. J U L I 2 0 1 0 S A L Z B U R G Ich darf Sie durch diesen Workshop begleiten: Klinische- u. Gesundheitspsychologin
Die Zukunft der ökologischen Pflanzenzüchtung auf dem Feld oder im Labor?
 Die Zukunft der ökologischen Pflanzenzüchtung auf dem Feld oder im Labor? Klaus-Peter Wilbois Fulda, 15.11.2014 Schwindende Agro- Biodiversität Trends & Zahlen zur Agro-Biodiversität Seit Anfang des 20ten
Die Zukunft der ökologischen Pflanzenzüchtung auf dem Feld oder im Labor? Klaus-Peter Wilbois Fulda, 15.11.2014 Schwindende Agro- Biodiversität Trends & Zahlen zur Agro-Biodiversität Seit Anfang des 20ten
