Über die Eigenfluoreszenz lebender, absterbender und toter Florideenzellen
|
|
|
- Ralph Weber
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter Über die Eigenfluoreszenz lebender, absterbender und toter Florideenzellen Von Christian Wimmer lind Karl Höfler. Mit 3 Textabbildungen (Vorgelegt in der Sitzung am 17. Dezember 1953) Im Rahmen umfangreicher Untersuchungen über Eigenfluoreszenz an lebenden Pflanzen wurden 1933 auch lebende Florideen untersucht, die H ö f 1 e r kurz vorher aus Griechenland mitgebracht hatte1. Die damals geprüften Rotalgen gehörten drei Familien der Ordnung der Ceramiales an: es waren folgende Gattungen und Arten: Delesseriaceae: Nitophyllum punctatum (Stackh.) Gr ev. Rhodomelaceae: Polysiphonia sertidarioide-s (Grat.) J. Äg., Polysiphonia sp., Heterosiphonia Mont. sp. Ceramiaceae: Griffithsia Schousboei Mont., Griffithsia Ag., zwei sp., Callithamnion Lyngb., zwei sp., Antithamnion cruciatwn (Ag.) Naeg. Die an diesem Material gemachten Beobachtungen ließen den Wunsch entstehen, noch weitere Fluoreszenzstudien an frischen Algen durchzuführen. Zu solchen ist es aber vor dem Kriege nicht mehr gekommen. Erst im März 1953 erhielten wir durch die Post aus Neapel Material von Antithamnion cruciatwn, das im UV-Licht untersucht werden konnte. Die alten Protokolle wurden hervorgeholt, und so entstand diese kleine Arbeit. Zu Ende August 1953 sammelte dann noch H ö f 1 e r in Helgoland einige Arten, die frisch 1 Die Algen waren von Höfler auf der Reise der Wiener Universität gesammelt worden: Am 17. April 1933 bei Nauplia an der Ostküste des Peloponnes (Hafenstadt vor Mykene) am Felsenufer südlich vom Hafen. Am 18. April 1933 in Santorin (Vulkaninsel zwischen dem Peloponnes und Kreta), Felsenufer und Grotte nördlich vom Hafen. Am 20. April 1933 bei Katakolon an der Westseite des Peloponnes, Innenseite der Hafenmauer. Die Algen wurden in großen Standgläsern auf dem Verdeck des Schiffes schattig gehalten, regelmäßig mit neuem Seewasser versorgt und am 25./26. April 1933 von Split in einem offenem Wagen des direkten Zuges bei kühler Witterung, vor jeder Erwärmung geschützt, nach Wien gebracht und weiter im Pflanzenphysiologischen Institut sorgsam gehalten. Sitzungsberichte d. mathem.-naturw. Kl., Abt. I, 162. Bd., 7. und 8. Heft. 41
2 626 Christian Akademie d. Wissenschaften Wimmer Wien; download und unter Karl H ö f 1e r, im Hamburger Institut für Allgemeine Botanik geprüft wurden (vgl. H ö f 1e r u. D ti v e ). Unsere Beobachtungen wurden 1933 mit dem Reichertschen Fluoreszenzmikroskop Kam F nach H. H a i t i n g e r (vgl. 1938, S. 15), 1953 mit der modernen Reichertschen Lux-UV-Apparatur vorgenommen, welche raschesten Wechsel zwischen Beobachtung im weißen Licht und im ultravioletten Licht bei jeder Vergrößerung zuläßt. In keinem Fall wurden fluorochromierte Präparate untersucht, sondern ausschließlich nur die Eigen-(Primär-) fluoreszenz beobachtet. I. Beobachtungen. N i t o p h y 11 u m punctatum: Zart rosa gefärbte Thalluslappen wurden untersucht. Die lebenden Zellen waren, entsprechend dem schwachen Farbton, im UV-Licht schwach aufleuchtend matt ziegelrot, d i e toten Zellen aber grell helle h romgelb. Bei starkem Abblenden erschienen die lebenden Zellen ganz dunkel, fast schwarz, während die toten noch immer hellgelb leuchteten. Um die Veränderungen der Primärfluoreszenz während des Absterbens von Nitophyllum-Zellen beobachten zu können, wurde ein zart rosa gefärbter Thalluslappen zunächst in Meerwasser untersucht. Er zeigte zwischen matt ziegelroten, lebenden Zellen einige wenige tote, grell hellchromgelb aufleuchtende Zellen. Nun wurde der Thalluslappen rasch mit destilliertem Wasser abgespült und in destilliertem Wasser weiter untersucht. Bereits nach 24 Sekunden zeigten sich viele gelbe Zellen, Nun wurde im ultravioletten Licht eine große Gruppe matt ziegelrot fluoreszierender, also noch lebender Zellen durch 26 Minuten dauernd beobachtet, bis alle Zellen gelb fluoreszierten, also tot waren. Nach 2' 20": Die Zellen blassen aus, die Farbe ändert sich rasch. Die Zellen der Thallusspitze sind noch unverändert (größere Resistenz der jungen Zellen). Die bereits bei Versuchsbeginn gelben Zellen, die absterbenden Zellen und die lebenden Zellen sind noch scharf unterschieden. Nach weiteren 1' 50": Die Zellen sind noch blasser geworden, jetzt hellbräunlich, die ursprünglich gelben leuchten noch immer heraus. Im weißen Licht ist kein Unterschied zu sehen. Nach weiteren 3'40": Jetzt sind die beobachteten Zellen nur mehr lichtbraun. Nach weiteren 50": Das Ausbleichen erfolgt nun rascher. An einer Stelle sind schon stetige Abstufungen zwischenhellbraun und Gelb zu erkennen. Die Zellen nahe der Thallusspitze sehen noch immer fast wie lebende aus. Nach weiteren 2' 20": Viele Zellen sind schon recht blaß aber noch bräunlich statt gelb. Der Unterschied im Farbton zwischen den absterbenden Zellen und den noch lebenden Zellen ist jetzt sehr groß.
3 Über Akademie die d. Eigenfluoreszenz Wissenschaften Wien; download von unter Florideenzellen Nach weiteren 2' 50": Der Farbenunterschied ist noch immer vorhanden. Bei starker Vergrößerung erkennt man in den absterbenden Zellen noch immer die Rhodoplasten. Nach weiteren 2' 10": Bei schwacher Vergrößerung scheinen die absterbenden Zellen jetzt auch schon gelb, gegen die Thallusspitzen hin dunkelgelb. Einige überlebende Zellen sehen noch wie ursprünglich aus, erst bei starker Vergrößerung erkennt man Veränderungen, kleine gelbleuchtende Tropfen. Nach weiteren 9'40": Nun sind alle Zellen gelb, also tot. In den während der Beobachtung abgestorbenen Zellen sind die Rhodoplasten noch als leichte Schattierungen zu erkennen, zum Unterschied von den schon bei Versuchsbeginn toten, gelbleuchtenden Zellen. Der gelbe Farbton ist aber jetzt bei beiden Zellen gleich. Einige Zellen sind aber noch immer dunkel nach mehr als 26 Minuten. Die grell hellchromgelbe Primärfluoreszenz der toten Zellen ist bei dieser Rotalge besonders gut von der matt ziegelroten Fluoreszenz der lebenden Zellen zu unterscheiden. Dort ist die Fluoreszenz so stark, daß sie auch im auffallenden Tageslicht erkennbar ist, M o 1i s c h (1897, S. 39) hat bei seinen Gefrierversuchen die Verfärbung von Nitophyllum als ein sicheres Zeichen des Todes benützt. Fror die Alge bei 5 C ein, so wurde sie orangerot, woraus folgt, daß der Tod schon im gefrorenen Zustand und nicht erst beim Auftauen erfolgt. Höfler (1931) sagt von ihr: Die Alge ist im Leben rot bis bräunlichrot, wird beim Tode matt ziegelrot und beginnt zu fluoreszieren, später bleichen die Thalli langsam aus. Die Verfärbung im Tode beruht bekanntlich darauf, daß der rote Farbstoff aus den Chromatophoren in den Zellsaft Übertritt. Im Leben ist der Phykoerythrinfarbstoff auf die Chromatophoren lokalisiert, und die Alge erscheint makroskopisch klar durchscheinend rot. Nach dem Tode tritt er in den Zellsaft, die wässerige Lösung fluoresziert«und die Algen erscheinen trüb orange oder ziegelrot. Unsere Beobachtungen im Fluoreszenzmikroskop haben diese Befunde bestätigt. In den lebenden Zellen von Nitophyllum sind die matt ziegelrot fluoreszierenden Rhodoplasten auf optisch leerem Grund bei starker Abblendung nur noch schwach wahrzunehmen, in den toten Zellen entsteht zunächst diffus eine grell hellchromgelbe Primärfluoreszenz, die auch bei starker Abblendung sehr deutlich bleibt. Antith a m nion er u c i at um: Das Material 1933 enthielt einige Blasenzellen, das Material 1953 viele Blasenzellen und zahlreiche Tetrasporangien in allen Entwicklungsstadien. Abb. 1 zeigt einen Zweig des Algenräschens, der einige Blasenzellen und ein Tetrasporangium trägt, Abb. 2 Blasenzellen und Tetrasporangien verschiedenen Alters. Blasen- 41*
4 628 Christian Akademie d. Wissenschaften Wimmer Wien; download und unter Karl Höfler, zellen wurden erstmals von N a e g e 1 i (1861) bei Antithamnion als abortierte Sporangien besprochen. Ausführlich behandelt sind sie in einer Arbeit B i e b 1 s (1939, S. 455) und weiter bei Schiffner und B i e b 1 (1944, S. 99). Die Blasenzellen enthalten vorwiegend eiweißartige Stoffe, wie von Nestler bereits 1900 erwähnt. Sie zeigen nach B i e b 1 starke Empfindlichkeit gegen Hypotonie (sogar Platzen in Süß wasser), aber hohe Hypertonieresistenz. Erwähnenswert ist, daß von einigen Autoren Jod- bzw. Bromanreicherung in den Blasenzellen angegeben wird. Die Tetrasporangien der Gattung Antithamnion können tetraedrisch, kreuzförmig oder zonenförmig geteilt sein. Nach unseren Protokollen von 1933 erscheinen im UV-Licht die Rhodoplasten in den lebenden Zellen mennigrot; an toten Zellen leuchtet der gesamte Inhalt hellch romgelb. Die Blasenzellen sind optisch leer, ihre Membran leuchtet zart himmelblau. Am 1953 untersuchten Neapeler Material wurden die Rasen sorgfältig zerteilt und die verzweigten Einzelzellen untersucht. An
5 Über Akademie die d. Wissenschaften Eigenfluoreszenz Wien; download von unter Florideenzellen ihrem Grund lagen oft Anhäufungen von Tetrasporangien und an den opponiert oder einseitig gefiederten Ästchen häufig die arttypischen Blasenzellen. Beide waren fast in allen Entwicklungsstufen vorhanden. Der Zellinhalt zeigte anfangs nur in einigen Hauptfadenzellen Degenerationserscheinungen, nach einigen Tagen verbreiteten sich diese vom Hauptfaden in die Ästchen und distal fortschreitend in diesen weiter, bis endlich nur mehr wenige Zellen der Spitzen der Endfiederchen unverändert aussahen. Erfahrungsgemäß zeigen ja bei Rotalgen oft die jüngsten Zellen die höchste Resistenz gegen verschiedene schädliche Einflüsse (Child 1916, Abb. 2. Oben Blasenzellen verschiedenen Alters, unten Tetrasporangien verschiedenen Alters. K y 1 i n 1927, B i e b a, 1939 b). Noch resistenter waren aber die Tetrasporen in den reifen Tetrasporangien, die manchmal noch völlig unverändert aussaheh, wenn sogar die jüngsten Zellen am gleichen Ästchen bereits Anzeichen von Degeneration zeigten. Hingegen degenerierten die Blasenzellen rascher. Im weißen Licht erschienen bei schwacher Vergrößerung anfangs die Inhalte aller Zellen rosa, später orangebraun, endlich olivgrün, am dunkelsten die reifen Tetrasporen. Nur die Blasenzellen waren anfangs körnig und farblos, voll entwickelte waren klar, sehr stark lichtbrechend und farblos, gelblich oder auch grünlich. Die Zellwände aller Zellen waren ungefärbt oder etwas gelblich. Bei
6 630 Christian Akademie d. Wissenschaften Wimmer Wien; download und unter Karl H ö f 1e r, starker Vergrößerung' erkannte man, daß die Rhodoplasten anfangs allein rosa gefärbt waren, daß aber mit fortschreitender Degeneration der Farbstoff andere Zellinhalte färbt, daß ferner die Zellwände der Tetrasporangien, auch jüngerer und älterer Hauptfadenzellen, zweischichtig sind. Im UV-Licht zeigten schon bei der ersten Untersuchung des noch ziemlich frischen Materials die im Tageslicht einheitlich rosa erscheinenden Zellen ein ungemein farbenprächtiges Bild: Die intakt aussehenden Zellen ließen auf optisch fast leerem Grund die mennigroten Rhodoplasten erkennen. Die Inhalte anderer Zellen leuchteten zur Gänze graugelb bis grell hellchromgelb mit Abb. 3. Zerfallserscheinungen im Zellinhalt eines erwachsenen Tetrasporang'iums und alter Fadenzellen. verblassenden Schatten der Rhodoplasten. In ganz vereinzelten Zellen leuchteten die Inhalte schwach tintenblau oder waren optisch leer. Der Inhalt junger Tetrasporen war menniggelb, heranreifender orangerot und ausgereifter grell feuerrot (Resistenzunterschied!). Der Inhalt junger Blasenzellen erschien gelblichgrau, älterer optisch leer oder tintenblau. Ebensolche Farbe zeigten auch Zellen einiger Hauptfäden. (Die Chromatophoren einiger lebender Diatomeen leuchteten blutrot.) Die Zellwände waren meist optisch leer, nur die Wände abgestorbener Zellen ohne Inhalt zart kornblumenblau. Interessant waren die Zellwände reifer Tetrasporangien und ganz alter Hauptfadenzellen: d i e innere Zellwand 1amelle leuchtete mehr oder weniger stark graug e 1b, die äußere war dunkel. Beim Absterben wurde das Leuchten der Innenlamelle stärker, und auch die Außenlamelle
7 Über Akademie die d. Wissenschaften Eigenfluoreszenz Wien; download von unter Florideenzellen begann in gleicher, Farbe aber schwächer zu leuchten. Kylin (1937) sagt: In den Zellwänden der Rhodophyceen (s. 1. Bangiales und Florideae) sind im allgemeinen zwei verschiedene Schichten gut erkennbar, von denen die innere aus Zellulose, die äußere aus Pektinverbindungen besteht. 2 Nach B ünning (1935) hebt sich bei Callithamnion roseum innerhalb der Zellwand deutlich eine innere Lamelle ab, deren Dicke etwa ein Viertel bis ein Drittel der gesamten Wanddicke beträgt, und diese Lamelle zeichnet sich durch intensive Färbbarkeit mit Methylenblau (0,01 % ige Lösung) aus, während der übrige Teil der Zellwand fast ungefärbt bleibt. Dies spricht wohl für erhöhten Pektingehalt der inneren Zellwandlamelle. B ti n n i n g beobachtete auch, daß kurze Zeit nach dem Zelltod, wenn der Farbstoff aus den Chromatophoren austritt, auch die äußere, sonst nicht färbbare Lamelle mit Methylenblau färbbar wird. Ob bei Antithamnion eine gelbe zarte äußere Begrenzung dieser Zellen nur auf Reflexwirkung der grell hellgelb leuchtenden Zellinhalte toter Zellen beruhte oder auf dem Selbstleuchten einer sehr zarten äußeren Membranschicht (Kutikula), konnte nicht entschieden werden. Mit fortschreitendem Absterben nahm die Zahl der Zellen mit leuchtendem Inhalt stark zu. Endlich strahlten die Inhalte fast aller Zellen in grellem Hellgelb; nur die reifen Tetrasporen leuchteten noch immer grell feuerrot, die jungen jetzt auch hellgelb. Zuletzt verblaßte das Leuchten, d. h. es leuchteten in den Fadenzellen nicht mehr die ganzen Inhalte, sondern nur noch eigentümlich geformte Reste; vielleicht handelt es sich um die Inhalte geschrumpfter Vakuolen (Abb. 3). Auch das Feuerrot der Tetrasporen wich einem leuchtendem Hellgelb, worin zuerst noch feuerrote W ölkungen zu erkennen waren, die aber immer mehr verschwanden. Von den 1933 geprüften Florideen aus Griechenland seien noch folgende genannt: Polysiphonia sertularioides: In den lebenden Zellen erscheinen im Fluoreszenzmikroskop die Chromatophoren mennigrot auf dunklem, optisch leerem Grund. Polysiphonia sp.: Die lebenden Zellen fluoreszieren mennigrot, die toten hell Chromgelb. 1 Bei Furcellciria fastigiata sind nach Kylin (1943) die Zellwände aus Zellulose und einem mit Agar-Agar nahe verwandten Membranschleim aufgebaut. Beide Substanzen sind miteinander gemischt, Zellulose jedoch hauptsächlich in den inneren, der Membranschleim hauptsächlich in den äußeren Teilen der Zellwände.
8 Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter Christian Wimmer und Karl H ö f 1e r, Heterosiphonia sp. (aus Nauplia): Die Plastiden sind in intakten Zellen mennigrot, alles andere ist farblos. Bei verletzten Fäden ist der Zellinhalt blau, auch wenn die mennigroten Chromatophoren noch erhalten sind; anscheinend ist das Blau auf die Vakuolen beschränkt. Die Erscheinung bleibt an frischem, reicherem Material zu untersuchen. Griffithsia Schousboei und zwei weitere Griffithsia sp.: Die lebenden Zellen sind im UV-Licht matt orangerot (etwa wie tote Zellen im W eißlicht), die toten Zellen grell hellgelb. Der Unterschied ist hier besonders auffällig. Callithamnion sp. (aus Katakolon): Bei schwacher Vergrößerung erscheinen lebende Zellen mattrot, tote Zellen gelb, in leeren ist die Zellwandung himmelblau. Bei mittlerer Vergrößerung erkennt man in den lebenden, mattroten Zellen die bläulich grauen Kerne, bei starker erkennt man die mennigroten Chromatophoren. In den grell hellchromgelb aufleuchtenden toten Zellen sieht man im Inneren einen helleren Sack (den geschrumpften Protoplasten oder den Tonoplasten mit seinem Inhalt?). Bei der Braunalge Ectocarpus olympiacus aus Katakolon (det. Professor Y. Schiffner) leuchten im Fluoreszenzlicht die Chromatophoren wie bei anderen Phaeophyten alle dunkelblutrot, also ganz so wie bei Diatomeen oder bei Grünalgen. Ein kleiner Rotalgenkeimling, der am Ectocarpus aufsaß, war abgestorben und leuchtete hell Chromgelb. Aus der Klasse der Bangiales fand sich in einem Material ein einzelner Faden von Bangia ceramicola (Lyngb.) Chauv. mit sternförmigen Chromatophoren. Er zeigt im UV-Licht ebenfalls mennigrote Fluoreszenz der lebenden und grell hellchromgelbe Fluoreszenz der toten Zellen. Im Sommer 1953 ergab sich die Gelegenheit, frisches Helgoländer Rotalgenmaterial im Hamburger Institut für Allgemeine Botanik fluoreszenzmikroskopisch zu untersuchen. Die Befunde werden im einzelnen an anderen Orten beschrieben (H ö f 1e r u. Düvel 1954). Unsere Grundbeobachtung konnte an 5 weiteren Arten den Florideen Delesseria alata (Huds.) Lamour (= M e m - branoptera alata Kylin), Delesseria sanguinea Lamour ( = Hydrolapathum sanguineum [L.] Stackh.), Ceramium rubrum (Huds.) Ag. und den Bangieen Bangia atropurpurea und Porphyra umbilicalis (L.) Kiitz. f. laciniata (Lighlf.) J. Ag. bestätigt werden. Zellen mit lebenden Rhodoplasten fluoreszieren matt mennigrot, tote Zellen grellgelb. Bei vielen Arten hat sich also gezeigt, daß lebende und tote Zellen im weißen Licht schwer zu unterscheiden sind, absterbende wohl überhaupt nicht zu erkennen sind, daß aber die Eigenfluores
9 Über Akademie die d. Wissenschaften Eigenfluoreszenz Wien; download von unter Florideenzellen zenz außerordentlich verschieden ist. Es läßt sich daher an den untersuchten Arten im U V - L i c h t a u f einen Blick erkennen, ob ihre Zellen lebend sind, ob sie abzusterben beginnen, ob sie tot sind. II. Besprechung. a) Z u r L i t e r a t u r. Seit langer Zeit ist bekannt, daß die wäßrigen Lösungen von Phykoerythrin und Phykocyan im auffallenden kurzwelligen bzw. UV-Licht lebhaft fluoreszieren. Nach Kylin erscheint reine Phykoerythrinlösung im durchfallenden Licht bei geringer Konzentration karminrot mit leicht violettem Ton, bei höherer spielt die Farbe nach Orange. Die Lösung von Florideen-Phykocyan (aus Cerdmium rubrum) zeigt eine stark dunkel karminrote Fluoreszenz und ist im durchfallenden Licht indigoblau, bei starker Konzentration violett bis rotviolett. Die Plastiden der Rhodophyten enthalten bekanntlich sowie die der grünen Pflanzen die alkohollöslichen Farbstoffe Chlorophyll a (vielleicht auch Chlorophyll d), Karotin und Xanthophyll und dazu die wasserlöslichen Farbstoffe Phykoerythrin und Phykocyan. Die Eiweißnatur dieser beiden hat M o 1 i s c h (1894, 1895) nachgewiesen; er hat auch beide zum Kristallisieren gebracht. Reine Lösungen beider Pigmente wurden zuerst von Kylin (1910) hergestellt, der uns auch in seiner Anatomie der Rhodophyceen (1937) die beste zusammenfassende Darstellung unter Berücksichtigung der gesamten Literatur bis 1935 gegeben hat. Er hat die beiden chemisch verwandten Farbstoffe als Phykochromoproteide zusammengefaßt. Seit Lember g (1929) zu dem Ergebnis kam, daß die prosthetischen Gruppen den Gallenfarbstoffen nahestehen, sind die Chromoproteide auch als Phvkoerythrobilin und Phykocyanobilin und beide zusammen als Phykobiline bezeichnet worden. Auf Kylin s Anregung hat sich T h e Svedberg (1928 bis 1932) eingehend mit der Bestimmung des Molekulargewichtes beider Proteide beschäftigt. Er hat im Upsalienser Laboratorium seine Methoden der Ultrazentrifugierung (Sedimentationsgleichgewicht und Sedimentationsgeschwindigkeit) zur Anwendung gebracht. Er erhält für das Phykoerythrin der Florideen als wahrscheinlichen Wert ein Molekulargewicht von Die Angaben beziehen sich auf wäßrige Lösungen von Phykoerythrin, das mit Ammoniumsulfat gereinigt worden war. Svedberg glaubt annehmen zu dürfen, daß das natürliche Phykoerythrin in
10 634 Christian Akademie d. Wissenschaften Wimmer Wien; download und unter Karl Höfler, bezug* auf das Molekulargewicht wahrscheinlich mit dem gereinigten Produkt übereinstimmt. An einem Originalpräparat Kylin s, welches 17 Jahre lang in kristallisierter Form unter gesättigter Lösung von (NH4) 2S 04 aufbewahrt worden war, zeigten 67% der Moleküle noch das Molekulargewicht , 33% ein kleineres (wahrscheinlich ein Sechstel oder ein Achtel). Bei Ceramium rubrum war das Molekulargewicht von Phykoerythrin zu , das des gleichzeitig anwesenden Phykocyans zunächst zu bestimmt worden. Nach späterer Bestimmung (1932) wäre aber auch das Molekulargewicht des Phykocyans bei mittlerem ph-bereich, während die Moleküle bei extremerem ph zerfallen und im Übergangsbereich das halbe Molekulargewicht vom normalen zeigen. Von Mittelmeeralgen hat Svedberg in Neapel Bornetia secundiflorci (J. Ag.) Thur., Griffithsia furcellata J. Ag. und Sebdenia monardinia (Mont.) Berth. untersucht, welche trotz ihrer wesentlich anderen Lichtabsorption (G a e t a n o 1926) doch bei UV-Bestrahlung Licht von gleicher Wellenlänge zeigten: es dürfte sich bloß um Intensitäts-, nicht um qualitative Unterschiede gegenüber den Chromoproteiden von Ceramium handeln. Der IEP liegt nach T i s e 1i u s Bestimmungen für Phykoerythrin bei ph4,3, für Phykocyan bei pit4,5. Dem Gedanken Svedbergs, daß die Phykochromoproteide im wesentlichen Polymere des Ei-Albumins vom Molekulargewicht darstellen, hätte wohl auch zur Zeit der Svedberg sehen Arbeiten kein Botaniker zugestimmt; auch bleibt die wesentliche Eigenschaft der Strahlenabsorption bei dieser Vorstellung unberücksichtigt. Lembergs Ergebnis, wonach die prosthetischen Gruppen der Phykochromoproteide den Gallenfarbstoffen, und zwar dem Biliverdin, nahestehen, hat in der Literatur recht allgemein Eingang gefunden. Es ist dies eine Tetrapyrrolverbindung mit offenem Ring, die sich vom Hämoglobin nur durch den Mangel des Eisenatoms sowie dadurch unterscheidet, daß die a-ch-brücke zwischen den Pyrrolringen I und II fehlt. Die Pyrrolringe bilden daher nicht wie beim Chlorophyll einen Ring, sondern nur eine Kette. Nach E g 1e (1953) erbrachten die Strukturaufklärung des Mesobiliviolins und Mesobilierythrins, der prosthetischen Gruppen des Phykocyans und Phykoerythrins, durch Lemberg und Mitarbeiter sowie die Ergebnisse von W. S i e d e 1 (1944) den Beweis, daß diese Verbindungen dem Protoporphyrin 9 in struktureller Beziehung sehr nahestehen, so daß sie sich wahrscheinlich auch in ihrer Genese von diesem ableiten lassen. Die Verteilung der Absorptionsbänder im Spektrum der wäßrigen Lösung der Phykobiline ist von zahlreichen For
11 Über Akademie die d. Wissenschaften Eigenfluoreszenz Wien; download von unter Florideenzellen schern studiert worden. Man stellt die Lösung1 aus den Meeresalgen so her, daß man frisches Material mit destilliertem H^O übergießt und bei Zimmertemperatur oder C stehen läßt, bis sich der Farbstoff aus der abgestorbenen Algenmasse herauslöst. K y 1 i n setzt nach einem Tag etwas Toluol zu, um Fäulnis zu vermeiden. Nach einigen Tagen wird der Extrakt abfiltriert, mit kristallisiertem Ammoniumsulfat (10 12 g auf 100 cm3) versetzt und über Nacht stehengelassen. Der entstehende Niederschlag besteht hauptsächlich aus Phykoerythrinkristallen. Nach einigem Umkristallisieren mit (NH4)2S 04 erhält man reines Phykoerythrin. Wird der übrigbleibende Extrakt neuerlich mit Ammonsulfat versetzt, so fallen beide Proteide aus. Nach fraktioniertem Umkristallisieren wird auch reines Florideen-Phykocyan gewonnen. Die Absorptionsspektra zeigen für das Phykoerythrin aus Ceranium rubrum drei Bänder im Grün und Blau mit Maxima bei A /.t/t und A uy. Bei Polysiphonia und Rhodomela gibt es eine Modifikation, die schwächer fluoresziert, aber ähnliche Absorptionsbänder zeigt. Doch werden die Rhodomelaceen, wenn sie in Süßwasser absterben, makroskopisch gesehen, nicht orangegelb wie die übrigen Florideen. Andere Modifikationen mit nur zwei Absorptionsbändern (Band 3 und 1 entsprechend) finden sich bei Neapler Material von Sebdenia monardinia. Daß die wäßrigen Auszüge aus verschiedenen Neapler Rotalgen am Tageslicht ganz verschiedene Färbung haben, hat schon Gaetano gezeigt; doch sollen sie, wie erwähnt, ein Fluoreszenzlicht von etwa gleicher Wellenlänge geben. Die roten (Meeres-) Cyanophyceen enthalten nach Boresch (1921) eine besondere Phykoerythrinmodifikation, die nur ein Band im Grün mit dem Maximum um A 550 f.tu zeigt, Daß die Chromoproteide bei der Absorption d e r p h o t o- synthetisch wirksamen Strahlen die wichtigste Rolle spielen, steht heute wohl außer Zweifel (M o n t f o r t, S e y b o 1 d, S e y b o 1d u. E g 1 e, S e y b o 1d u. W e i s s w e i 1e r). K y 1 i n hielt noch 1937 für wahrscheinlich, daß das Phykoerythrin nur einen optischen Sensibilator darstellt, und er glaubte die Möglichkeit, daß es in derselben Weise wie Chlorophyll assimilierend wirkt, ausschließen zu können. Dagegen gelangen H a x o und Blinks (1950), denen wir die eingehendste und methodisch exakteste Untersuchung über Absorption und Assimilation von Meeresalgen im sichtbaren Spektrum verdanken, zu dem Ergebnis, daß der Gehalt an wasserlöslichen Phykoproteiden die photosynthetische Leistung bestimmt. Für Rotalgen, die nur Phykoerythrin, kein Phykocyan enthalten (Delesseria, Scliizymenia,
12 636 Christian Akademie d. Wissenschaften Wimmer Wien; download und unter Karl Höfler, Porphyrelia) fällt die Kurve der Assimilation und Lichtabsorption im mittleren Teil des sichtbaren Spektrums zusammen, und beide Kurven zeigen übereinstimmende Gipfelpunkte bei 495, 540, 565 jlijli. Vgl. die Diagramme bei Haxo und Blinks S Das Chlorophyll das ja in den Rotalgenplastiden oft recht reichlich vorhanden ist (S e y b o 1d u. E g 1 e 1938) wird dagegen überraschenderweise für die O-Produktion nur wenig ausgentitzt. Die photosynthetische Leistung der genannten Rotalgen bleibt bei 440 jlijli und bei 675 minimal, wo doch das Chlorophyll am stärksten absorbiert und daher die Absorptionskurve der intakten Thalli relative Maxima zeigt. Haxo und Blinks berühren die Frage, ob die Strahlenabsorption von Extrakten der Absorption im intakten Algenthallus entsprechen müsse. It must be admitted, in the case of the fatsoluble pigments, that the relative absorption by Chlorophylls and Carotinoids found in extracts may bear little relation to that obtaining in the cell: thus, this uncertainty prevails in appraising the role of Carotinoids in photosynthesis. Fortunately, the absorption characteristic of the phycobilins are much the some in aqueous extracts and in the living thallus and a more direct comparison seems permissible. On the other hand, quantitative extraction and estimation of the water-soluble pigments are not as feasible. b) Diskussion. Hier müssen nun unsere Befunde eintreten. Die Fluoreszenz des Phykoerythrins bzw. der Rhodoplasten innerhalb der Zelle war wohl vor unseren Versuchen von 1933 noch nicht beobachtet worden. Denn Kylin, Lemberg und Svedberg haben nicht mit dem Fluoreszenzmikroskop gearbeitet. Auch aus neuerer Zeit sind uns mikroskopische Befunde zur Frage nicht bekannt. Das Überraschende an unserer ersten Beobachtung war ja nicht so sehr die Tatsache, daß der beim Zelltode in den Zellsaft austretende Phykoerithrinfarbstoff imuv-mikroskop dieselbe grellgelbe Fluoreszenz aufweist, die makroskopisch von wäßrigen Auszügen so wohlbekannt ist, als vielmehr die Tatsache, daß d e r Farbstoff innerhalb der lebenden, intakten Plastiden der R o t a 1 g e n, mikroskopisch betrachtet, noch nicht gelb fluoresziert. Man könnte an verschiedene Ursachen denken. Das gleichzeitig vorhandene Chlorophyll könnte die Eigenfluoreszenz des Phykoerythrins überstrahlen. Gegen diesen einfachen Erklärungsversuch spricht aber schon, daß das Algenrot, wenn es in den Zell
13 Akademie Über die d. Wissenschaften Eigenfluoreszenz Wien; download vou unter Florideenzellen. 637 saft Übertritt und dabei noch vielfach verdünnt wird, doch so intensiv in chromgelber Farbe leuchtet, daß es die Rotfluoreszenz der chlorophyllhaltigen, im Weißlicht grünen Plastidenreste weit überstrahlt. Es ließe sich ferner an Fluoreszenzlöschung durch hohe Konzentration denken, aber für eine solche Annahme spricht wohl nichts. Am wahrscheinlichsten ist, daß d e r P h y k o e r y t h r i n- f a r b s t o f f erst in dem Moment seine gelbe Fluoreszenz annimmt, wo er in wäßrige Lösung tritt. Dafür sprechen auch neue Beobachtungen an Helgoländer Rotalgen vom Sommer In Süßwasser gebracht, sterben die Thalli von Delesseria sanguinea, D. alata und Bangia atropurpurea dank ihrer geringeren Hypotonieempfindlichkeit (Biebl 1937) viel langsamer ab als z. B. Nitophyllum punctatum., dessen Nekroseablauf in H20 im Tageslichtmikroskop schon früher in Neapel ausführlich studiert wurde (H ö f l e r 1931). Bei den Delesserien und bei Bangia schwellen im Süßwasser die roten Plastiden erst stark auf und bleiben dabei noch rot im UY-Licht. Im Verlauf der Nekrose tritt dann die gelbe Fluoreszenz zuerst i n den Plastiden auf (vgl. Höfler und Düvel 1954). Der Wechsel der Fluoreszenzfarbe erfolgt also schon innerhalb der Plastiden und vollzieht sich wohl in dem Augenblick, wo hier bei der Nekrose durch Entmischung wäßrige Phase frei wird. Wenn dann die Plastiden platzen, teilt sich die grellgelbe Fluoreszenz dem ganzen, von wäßriger Lösung erfüllten Zellsaftraum mit. Der in den intakten Plastiden enthaltene Farbstoff zeigt die gelbe Fluoreszenz noch nicht. Daraus folgt aber wohl, daß er in physikalisch-chemischer Hinsicht anders beschaffen ist als der ausgetretene bzw. extrahierte Farbstoff. Nur auf diesen beziehen sich aber alle bisherigen chemischen Untersuchungen. Wir wissen heute nicht, wie das Phykoerythrin natürlicherweise im Stroma der Rotalgenplastiden gebunden ist. Die Beobachtungen vieler Forscher haben (Kylin 1937, S. 14) zur Auffassung geleitet, daß sich die Chromatophoren der Florideen fast im flüssigen Aggregatzustand befinden (Küster 1904, 1951, S. 363 f., Liebald 1913, Höfler 1931, 1937, Biebl 1936 f.). Der an Antithamnion cruciatum geführte Nachweis vital reversibler osmotischer Volumsschwankungen der Plastiden (Höfler 1931, S. 61) könnte zur Vorstellung Anlaß geben, daß wäßrige Phase schon in den intakten Plastiden vorhanden wäre und daß in ihr die wasserlöslichen Pigmente gelöst wären. Die beschriebenen Beobachtungen widerlegen eine solche Vorstellung, denn
14 638 Christian Akademie d. Wissenschaften Wimmer Wien; download und unter Karl Höfler, beim Übergang von der natürlichen Bindung im Plastidenstroma zum wassergelösten Zustand tritt ja die Gelbfluoreszenz erst auf. Welcher Art die mit diesem Übergang verbundenen physikochemischen Veränderungen des Phykoerythrinfarbstoffes sind, bleibt aufzuklären. Unsere Auffassung wird gestützt durch jüngste orientierende Versuche vom Dezember Delesseria alatci aus Helgoland stand im Wiener Institut noch in gutem Zustand zur Verfügung. Lebende, intakte Zellen waren im UV-Licht mennigrot, im Süßwasser stellte sich, wie am frisch gesammelten Material, von der Schnittfläche fortschreitend, grellgelbe Fluoreszenz ein. Wurden solche Thallusstücke in konzentrierten Methylalkohol übertragen, so ging mit der Nekrose eine rasche Welle von Gelbfärbung durch die Thalli. Gleich nachher kehrte die rote Farbe zurück. In abgeschnittenen bandförmigen Thalluslappen nahm der gelbe, nach innen fortschreitende, einige Zellen breite Streifen die Form einer steilen Hyperbel an. Nachher löst sich das Chlorophyll rasch mit leuchtend blutroter Fluoreszenz im umgebenden Alkohol. Die Farbe kontrastiert gegen die matt mennigrote Farbe des Thallus, in welchem das Phykoerythrin zurückgeblieben ist. Bringt man die Thalluslappen direkt in konzentriertes Methanol, so bleiben die Zellen mennigrot, wenn das Chlorophyll blutrot herausgelöst worden ist. Das Phykoerythrin, in Alkohol unlöslich, bleibt also auch in toten Zellen rot, wo es nicht ins wäßrige Medium Übertritt. Werden in Alkohol getötete Thallusteile nachträglich in Wasser überführt, so färben sie sich nicht mehr gelb. Vermutlich ist das Phykoerythrin als Proteid durch die Alkoholwirkung denaturiert worden und so nicht mehr zur Umwandlung in den wasserlöslich gelb fluoreszierenden Zustand fähig. Es ist also die Gelbverfärbung im UV-Licht eine Todesreaktion, verbleibende Rotfärbung der Thalli aber keine allgemein gültige Lebensreaktion. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang endlich die Feststellung B i e b 1s (1952) über die Absorption Arerschiedener Meeresalgen im ultravioletten Strahlenbereich. B i e b 1 fand, daß die Absorptionskurven der beiden von ihm untersuchten Florideen Phycodris und Polyneura im weichen Ultraviolett, d. i. im W ellenlängenbereich von jiijii, ein breites Absorptionsminimum zeigen, während Grün- und Braunalgen (und ebenso Porphyra) im gleichen Bereich sogar verstärkt absorbieren. Es wäre zu untersuchen, ob sich nicht intakte Thalli und wäßrige Lösung verschieden verhalten, d. h. ob das wassergelöste, gelb fluoreszierende
15 Über Akademie die d. Wissenschaften Eigenfluoreszenz Wien; download von unter Florideenzellen Phykoerythrin nicht stärker absorbiert als das native. Im kurzwelligen, harten UV ( juju) verlaufen nach Biebl die Absorptionskurven der Grün- und Rotalgen flach und annähernd parallel ohne spezifische Unterschiede. A n merkung bei de r K o r r e k t u r : Aus einer Arbeit von R. W. van Norma n, C. S. F r e n c h and Fergus D. H. MacDowall (1948), die uns erst jetzt zugänglich wurde, geht hervor, daß die Fluoreszenzspektra von intakten Rotalgen und ihren Extrakten sehr verschieden sind. Während die Fluoreszenz des Phycoerythrinextraktes ein Maximum um 575 m,a (und die des Chlorophyllextraktes eines um 707 m^) hat, ist dieses Phycoerythrinmaximum bei intakten Rotalgen nur schwach ausgebildet. It must therefore be concluded that the fluorescence spectrum of the phycoerythrin and of the Chlorophyll is widely different in the intact algae from its shape in extracts, or that other pigments not present in either the water or the methyl alcohol extracts are causing some of the fluorescence of the intact material. Unsere mikroskopischen Befunde sprechen bezüglich des Phycoerythrins für die erstere Alternative. Literaturverzeichnis. Biebl, R : Untersuchungen an Rotalgen-Plastiden. Protoplasma 26, a: Zur protoplasmatischen Anatomie der Rotalgen. Protoplasma 28, b: Ökologische und zellphysiologische Studien an Rotalgen der englischen Südkiiste. Beih. Bot. Centralbl. Abt. A '57, a: Zellphysiologische Studien an Antithamnium plumula (EU.) Thuret. Protoplasma 32, b: Über die Temperaturresistenz von Meeresalgen verschiedener Klimazonen und verschieden tiefer Standorte. Jahrb. f. wiss. Bot. 8 8, : Ultraviolettabsorption der Meeresalgen. Ber. d. D. Bot. Ges. 65, : Lichttransmissionsänderungen an Meeresalgen, im besonderen an Porphyra umbilicalis f. laciniata. Österr. Bot. Zeitschr. 100, 179. Bore sch, K., 1921: Die wasserlöslichen Farbstoffe der Schizophyceen. Biochem. Zeitschr. 119, 167. B ü n n i n g, B., 1934: Zellphysiologische Studien an Meeresalgen. Protoplasma 22, 444. Child, C. M., 1916: Axial susceptibility gradients in Algae. Bot. Gaz. 62, 89. Egle, K., 1953: Die Biosynthese der Chlorophyllfarbstoffe. Die Naturwissenschaften 49, H. 22, 569. Funk, G., 1927: Die Algenvegetation des Golfs von Neapel. Pubbl. Staz. Zool. Napoli 7, Supplemento. R. Friedländer, Berlin. G a e t a n o, K., 1926: Pubbl. Staz. Zool. Napoli 7, 77 (zit. nach Svedberg u. Eriksson 1932, S. 4C05). H a i t i n g e r, M., 1938: Fluoreszenzmikroskopie. Akad. Verlagsges. Leipzig. Haxo, F. T. and Blinks, L. R., 1950: Photosynthetic action spectra of marine algae. Journ. Gen. Physiol. 33, 389. Höfler, K., 1931: Hypotonietod und osmotische Resistenz einiger Rotalgen. österr. Bot. Zeitschr. 80, : Vertragen Rotalgen das Zentrifugieren? Protoplasma 26, 377.
16 640 Christian Akademie d. Wissenschaften Wimmer Wien; download und unter Karl Höfler, Höfler, K. und Dtivel, D., 1954: Helgoländer Algen im Fluoreszenzmikroskop. Ber. d. D. Bot. Ges. 67, 2. Küster, E., 1904: Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Pflanzenzelle. Zeitschr. f. allgem. Physiologie 4, : Die Pflanzenzelle, 2. Aufl. G. Fischer, Jena. Kylin, H., 1910: Über Phykoerythrin und Phykocyan bei Ceramium rubrum (Huds.) Ag. Zeitschr. physiol. Chemie 69, : Über die roten und blauen Farbstoffe der Algen. Ebenda 76, a: Über den Einfluß der Wasserstoffionenkonzentration auf einige Meeresalgen. Botaniska Notiser Lund b: Über die Blasenzellen der Florideen. Ebenda : Einige Bemerkungen über Phykoerythrin und Phykocyan. Zeitschr. physiol. Chemie 197, : Anatomie der Rhodophyceen. Handb. d. Pflanzenanatomie, Bd. VI/2, Borntraeger, Berlin. 1943: Zur Biochemie der Rhodophyceen. Kungl. fysiografiska sällskapets i Lund förhandlingar, 13, Nr. 6. Lemberg, R., 1928: Die Chromoproteide der Rotalgen I. Liebigs Annalen d. Chemie 461, : Chromoproteide der Rotalgen II. Spaltung mit Pepsin und Säuren. Isolierung eines Pyrrolfarbstoffs. Ebenda 477, : Die Lichtextinktionen der Algen-Chromoproteide. Biochem. Zeitschrift 219. Liebaldt, E., 1913: Über die Wirkung wäßriger Lösungen oberflächenaktiver Substanzen auf die Chlorophyllkörner. Zeitschr. f. Bot. 5, 65. M o 1 i s c h, H., 1894: Das Phykoerythrin, seine Kristallisierbarkeit und chemische Natur. Botan. Ztg. 52, : Das Phykocyan, ein kristallisierbarer Eiweißkörper. Ebenda 53, Mikrochemie der Pflanze. 1. Aufl. Jena. M o n t f o r t, C., 1934: Farbe und Stoffgewinn im Meer. Untersuchungen zur Theorie der komplementären Farbenanpassung nordischer Meeresalgen. Jahrb. f. wiss. Bot. 79, 493. Naegeli, C., 1861: Beitrag zur Morphologie und Systematik der Ceramiaceae. Sitzungsber. Bayrisch. Akad. Wiss. 1. München. Nestler, A., 1900: Die Blasenzellen von Antithamnion plumula (Ellis) Thur, und Antithamnion cruciatum (Ag.) Näg. Wissensch. Meeresunters. Neue Folge 3, Abt. Helgoland, 1. van Norman, R. W., French, C. S. and M a c D o w a 11, F. D., 1948: The absorption and fluorescence spectra of two red marine algae. Plant Physiol. 23, 455. S c h i f f n e r, Y. und B i e b 1, R., 1944: Über die Blasenzellen der Gattung Antithamnion. Hedwigia 82, 99. S e y b o 1d, A., 1934: Über die Lichtenergiebilanz submerser Wasserpflanzen, vornehmlich der Meeresalgen. Jahrb. wiss. Bot. 79, : Über den Lichtfaktor photophysiologischer Prozesse. Ebenda 82, 741. Seybold, A. und Egle, K., 1938a: Quantitative Untersuchungen über Chlorophyll und Karotinoide der Meeresalgen. Ebenda 8 6, b: Lichtfeld und Blattfarbstoffe II. Planta 28, : Zur Kenntnis des Protochlorophylls II. Planta 29, 119. Seybold, A. und W e i s s w e i 1 e r, A., 1942: Weitere spektro-photometrische Messungen an Laubblättern und an Chlorophyll-Lösungen sowie an Meeresalgen. Botan. Archiv 44, 102.
17 Über Akademie die d. Wissenschaften Eigenfluoreszenz Wien; download von unter Florideenzellen Siedel, W., 1944: Chemie und Physiologie des Blutfarbstoff-Abbaues. Ber. d. Dtsch. Chem. Ges. 77, 21. Svedbe r g, T. and N i c h o 1s, I. B., 1927: The application oil turbine type of ultracentrifuge to the study of the stability region of carbon monoxide-hemoglobin. Journ. Amer. Chem. Soc. 49, Svedberg, T. and Lewis, N. B., 1928: The molecular weights of Phycoerythrin and of Phycocyan. Ibidem 50, Svedberg, T. and Katsurai, T., 1929: The molecular weights of Phycocyan and of Phycoerythrin from Porphyra tenera and of Phycocyan from Aphanizomenon flos aquae. Ibidem 51, Svedberg, T. and Eriksson, I. B., 1932: The molecular weights of phycocyan and of phycoerythrin III. Ibidem 54, T i s e 1i u s, 1930: Nova Acta Reg. Soc. Sc. Upsaliensis, (4), 7, Nr. 4 (zit. nach Svedberg u. Eriksson 1932). S itzungsberichte d. m athem.-naturw. K l.. A bt. I, 162. Bd.. und 8. H eft. 42
Material: Rotkohlblätter, Eiklar, Essigsäurelösung (w=10%), Speiseöl, Spülmittel farblos verdünnt mit Wasser 1:1, Wasser, 9 Reagenzgläser, Messer.
 Bau der Biomembran Experiment mit Rotkohl: Indirekter Nachweis von Membranbestandteilen verändert nach Feldermann, D. (2004). Schwerpunktmaterialien Linder Biologie Band 1. Hannover, Schroedel Fragestellung:
Bau der Biomembran Experiment mit Rotkohl: Indirekter Nachweis von Membranbestandteilen verändert nach Feldermann, D. (2004). Schwerpunktmaterialien Linder Biologie Band 1. Hannover, Schroedel Fragestellung:
Isolierung von Pflanzenfarbstoffen und Untersuchung auf ihre Verwendung als Säure- Base-Indikatoren
 Bodensee-Gymnasium Lindau Januar 2009 Isolierung von Pflanzenfarbstoffen und Untersuchung auf ihre Verwendung als Säure- Base-Indikatoren von Marc Bradenbrink und Florian Gerner Betreuungslehrkraft: StR
Bodensee-Gymnasium Lindau Januar 2009 Isolierung von Pflanzenfarbstoffen und Untersuchung auf ihre Verwendung als Säure- Base-Indikatoren von Marc Bradenbrink und Florian Gerner Betreuungslehrkraft: StR
Spektroskopie im sichtbaren und UV-Bereich
 Spektroskopie im sichtbaren und UV-Bereich Theoretische Grundlagen Manche Verbindungen (z.b. Chlorophyll oder Indigo) sind farbig. Dies bedeutet, dass ihre Moleküle sichtbares Licht absorbieren. Durch
Spektroskopie im sichtbaren und UV-Bereich Theoretische Grundlagen Manche Verbindungen (z.b. Chlorophyll oder Indigo) sind farbig. Dies bedeutet, dass ihre Moleküle sichtbares Licht absorbieren. Durch
SCHWEIZER JUGEND FORSCHT. Chemie und Materialwissenschaften
 SCHWEIZER JUGEND FORSCHT Chemie und Materialwissenschaften Studie einer ultraschnellen Fotochemischen Reaktion mit Laserspektroskopie Gianluca Schmoll Widmer Betreuer: Dr. Sandra Mosquera Vazquez, Dr.
SCHWEIZER JUGEND FORSCHT Chemie und Materialwissenschaften Studie einer ultraschnellen Fotochemischen Reaktion mit Laserspektroskopie Gianluca Schmoll Widmer Betreuer: Dr. Sandra Mosquera Vazquez, Dr.
Lichtabsorption. Handout zum Vortrag am REFERAT BIOLOGIE LEISTUNGSKURS. 11 Februar 2007 Verfasst von: Daniela Luxem
 Lichtabsorption Handout zum Vortrag am 13.02.2007 REFERAT BIOLOGIE LEISTUNGSKURS 11 Februar 2007 Verfasst von: Daniela Luxem Lichtabsorption Handout zum Vortrag am 13.02.2007 Ziel dieser Arbeit ist, den
Lichtabsorption Handout zum Vortrag am 13.02.2007 REFERAT BIOLOGIE LEISTUNGSKURS 11 Februar 2007 Verfasst von: Daniela Luxem Lichtabsorption Handout zum Vortrag am 13.02.2007 Ziel dieser Arbeit ist, den
Verschlucktes Licht Wenn Farben verschwinden
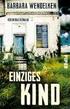 Verschlucktes Licht Wenn Farben verschwinden Scheint nach einem Regenschauer die Sonne, so kann ein Regenbogen entstehen. Dieser besteht aus vielen bunten Farben. Alle diese Farben sind im Sonnenlicht
Verschlucktes Licht Wenn Farben verschwinden Scheint nach einem Regenschauer die Sonne, so kann ein Regenbogen entstehen. Dieser besteht aus vielen bunten Farben. Alle diese Farben sind im Sonnenlicht
7. Woche. Gesamtanalyse (Vollanalyse) einfacher Salze. Qualitative Analyse anorganischer Verbindungen
 7. Woche Gesamtanalyse (Vollanalyse) einfacher Salze Qualitative Analyse anorganischer Verbindungen Die qualitative Analyse ist ein Teil der analytischen Chemie, der sich mit der qualitativen Zusammensetzung
7. Woche Gesamtanalyse (Vollanalyse) einfacher Salze Qualitative Analyse anorganischer Verbindungen Die qualitative Analyse ist ein Teil der analytischen Chemie, der sich mit der qualitativen Zusammensetzung
Seminar: Photometrie
 Seminar: Photometrie G. Reibnegger und W. Windischhofer (Teil II zum Thema Hauptgruppenelemente) Ziel des Seminars: Theoretische Basis der Photometrie Lambert-Beer sches Gesetz Rechenbeispiele Literatur:
Seminar: Photometrie G. Reibnegger und W. Windischhofer (Teil II zum Thema Hauptgruppenelemente) Ziel des Seminars: Theoretische Basis der Photometrie Lambert-Beer sches Gesetz Rechenbeispiele Literatur:
UV/VIS-Spektroskopie
 UV/VIS-Spektroskopie Version 2, Gruppe M 14 Jorge Ferreiro, Studiengang Chemieingenieur, 4. Semester, fjorge@student.ethz.ch Natalja Früh, Studiengang Interdisziplinäre Naturwissenschaften, 4. Semester
UV/VIS-Spektroskopie Version 2, Gruppe M 14 Jorge Ferreiro, Studiengang Chemieingenieur, 4. Semester, fjorge@student.ethz.ch Natalja Früh, Studiengang Interdisziplinäre Naturwissenschaften, 4. Semester
Fluoreszenz von Silberclustern
 Fluoreszenz von Silberclustern Unter Fluoreszenz versteht man die Emission von Licht durch Hüllenelektronen, wenn diese aus einem angeregten Zustand (energetisch höher liegend) in einen energetisch niedrigeren
Fluoreszenz von Silberclustern Unter Fluoreszenz versteht man die Emission von Licht durch Hüllenelektronen, wenn diese aus einem angeregten Zustand (energetisch höher liegend) in einen energetisch niedrigeren
Kombinierte Übungen zur Spektroskopie Beispiele für die Bearbeitung
 Im folgenden soll gezeigt werden, daß es großen Spaß macht, spektroskopische Probleme zu lösen. Es gibt kein automatisches Lösungsschema, sondern höchstens Strategien, wie beim "Puzzle Lösen"; häufig hilft
Im folgenden soll gezeigt werden, daß es großen Spaß macht, spektroskopische Probleme zu lösen. Es gibt kein automatisches Lösungsschema, sondern höchstens Strategien, wie beim "Puzzle Lösen"; häufig hilft
Von Nadine Ufermann und Marcus Oldekamp
 Von Nadine Ufermann und Marcus Oldekamp Photosynthese: Allgemein und Lichtreaktion Photosysteme: PSI und PSII, Entdeckung und Funktion Mangan und Manganenzyme: Speziell sauerstoffentwickelnder Mn Cluster
Von Nadine Ufermann und Marcus Oldekamp Photosynthese: Allgemein und Lichtreaktion Photosysteme: PSI und PSII, Entdeckung und Funktion Mangan und Manganenzyme: Speziell sauerstoffentwickelnder Mn Cluster
Grundschraffur Metalle feste Stoffe Gase. Kunststoffe Naturstoffe Flüssigkeiten
 Anleitung für Schraffuren beim Zeichnen Die Bezeichnung Schraffur leitet sich von dem italienischen Verb sgraffiare ab, was übersetzt etwa soviel bedeutet wie kratzen und eine Vielzahl feiner, paralleler
Anleitung für Schraffuren beim Zeichnen Die Bezeichnung Schraffur leitet sich von dem italienischen Verb sgraffiare ab, was übersetzt etwa soviel bedeutet wie kratzen und eine Vielzahl feiner, paralleler
Welche Strahlen werden durch die Erdatmosphäre abgeschirmt? Welche Moleküle beeinflussen wesentlich die Strahlendurchlässigkeit der Atmosphäre?
 Spektren 1 Welche Strahlen werden durch die Erdatmosphäre abgeschirmt? Welche Moleküle beeinflussen wesentlich die Strahlendurchlässigkeit der Atmosphäre? Der UV- und höherenergetische Anteil wird fast
Spektren 1 Welche Strahlen werden durch die Erdatmosphäre abgeschirmt? Welche Moleküle beeinflussen wesentlich die Strahlendurchlässigkeit der Atmosphäre? Der UV- und höherenergetische Anteil wird fast
Beeinflussung des Pflanzenwachstums durch verschieden farbiges Licht
 Beeinflussung des Pflanzenwachstums durch verschieden farbiges Licht Diese Arbeit wurde angefertigt von: Sonia Olaechea Sofia Zaballa Alba Calabozo Betreuung: Axel Stöcker 2 Inhalt 1. Kurzfassung der Arbeit...4
Beeinflussung des Pflanzenwachstums durch verschieden farbiges Licht Diese Arbeit wurde angefertigt von: Sonia Olaechea Sofia Zaballa Alba Calabozo Betreuung: Axel Stöcker 2 Inhalt 1. Kurzfassung der Arbeit...4
1. Qualitativer Nachweis von Anionen und Sodaauszug
 Anionennachweis 1 1. Qualitativer Nachweis von Anionen und Sodaauszug Die moderne Analytische Chemie unterscheidet zwischen den Bereichen der qualitativen und quantitativen Analyse sowie der Strukturanalyse.
Anionennachweis 1 1. Qualitativer Nachweis von Anionen und Sodaauszug Die moderne Analytische Chemie unterscheidet zwischen den Bereichen der qualitativen und quantitativen Analyse sowie der Strukturanalyse.
Protokoll. Farben und Spektren. Thomas Altendorfer 9956153
 Protokoll Farben und Spektren Thomas Altendorfer 9956153 1 Inhaltsverzeichnis Einleitung Ziele, Vorwissen 3 Theoretische Grundlagen 3-6 Versuche 1.) 3 D Würfel 7 2.) Additive Farbmischung 8 3.) Haus 9
Protokoll Farben und Spektren Thomas Altendorfer 9956153 1 Inhaltsverzeichnis Einleitung Ziele, Vorwissen 3 Theoretische Grundlagen 3-6 Versuche 1.) 3 D Würfel 7 2.) Additive Farbmischung 8 3.) Haus 9
Die chemische Natur der Pigmente aus photosynthetischen Reaktionszentren von Rhodospirillum ruhrum G-9+
 Diss. ETHNr.6106 Die chemische Natur der Pigmente aus hotosynthetischen Reaktionszentren von Rhodosirillum ruhrum G-9+ ABHANDLUNG zur Erlangung destitelseinesdoktorsder Naturwissenschaften der Eidgenössischen
Diss. ETHNr.6106 Die chemische Natur der Pigmente aus hotosynthetischen Reaktionszentren von Rhodosirillum ruhrum G-9+ ABHANDLUNG zur Erlangung destitelseinesdoktorsder Naturwissenschaften der Eidgenössischen
Mikroskopische Wasseruntersuchungen - Berthold Heusel M.A. - Wasserstudio Bodensee
 Mikroskopische Wasseruntersuchungen - Berthold Heusel M.A. - Wasserstudio Bodensee Untersuchung des Wasseraktivators Max Gross Überlingen, 28.3.2013 Untersucht wurde ein Wasseraktivator der Fa. Max Gross
Mikroskopische Wasseruntersuchungen - Berthold Heusel M.A. - Wasserstudio Bodensee Untersuchung des Wasseraktivators Max Gross Überlingen, 28.3.2013 Untersucht wurde ein Wasseraktivator der Fa. Max Gross
Visuelle Wahrnehmung I
 Visuelle Wahrnehmung I Licht: physikalische Grundlagen Licht = elektromagnetische Strahlung Nur ein kleiner Teil des gesamten Spektrums Sichtbares Licht: 400700 nm Licht erst sichtbar, wenn es gebrochen
Visuelle Wahrnehmung I Licht: physikalische Grundlagen Licht = elektromagnetische Strahlung Nur ein kleiner Teil des gesamten Spektrums Sichtbares Licht: 400700 nm Licht erst sichtbar, wenn es gebrochen
1. Ein Dreieck entsteht aus den drei Grundfarben: Gelb, Rot, Blau; durch Mischen ergaben sich drei weitere Farben: Grün, Orange, Violett.
 Das Malen der Kinder Vom 8. Oktober bis zum 2. Dezember 2001 führte der Künstler Guram Nemsadze (ein Kurzportrait siehe Seite 5) einen Malkurs für Kinder und Jugendliche durch. Die ersten drei Übungen,
Das Malen der Kinder Vom 8. Oktober bis zum 2. Dezember 2001 führte der Künstler Guram Nemsadze (ein Kurzportrait siehe Seite 5) einen Malkurs für Kinder und Jugendliche durch. Die ersten drei Übungen,
Aspirin und Paracetamol im chemischen Vergleich
 Aspirin und Paracetamol im chemischen Vergleich Achtung Aspirin und Paracetamol sind geschützte Namen und dürfen nicht ohne weiteres verwendet werden. Strukturformeln Aus den Strukturformeln leiten wir
Aspirin und Paracetamol im chemischen Vergleich Achtung Aspirin und Paracetamol sind geschützte Namen und dürfen nicht ohne weiteres verwendet werden. Strukturformeln Aus den Strukturformeln leiten wir
Oberstufe (11, 12, 13)
 Department Mathematik Tag der Mathematik 1. Oktober 009 Oberstufe (11, 1, 1) Aufgabe 1 (8+7 Punkte). (a) Die dänische Flagge besteht aus einem weißen Kreuz auf rotem Untergrund, vgl. die (nicht maßstabsgerechte)
Department Mathematik Tag der Mathematik 1. Oktober 009 Oberstufe (11, 1, 1) Aufgabe 1 (8+7 Punkte). (a) Die dänische Flagge besteht aus einem weißen Kreuz auf rotem Untergrund, vgl. die (nicht maßstabsgerechte)
Versuchsprotokoll Kapitel 6
 Versuchsprotokoll Kapitel 6 Felix, Sebastian, Tobias, Raphael, Joel 1. Semester 21 Inhaltsverzeichnis Einleitung...3 Versuch 6.1...3 Einwaagen und Herstellung der Verdünnungen...3 Photospektrometrisches
Versuchsprotokoll Kapitel 6 Felix, Sebastian, Tobias, Raphael, Joel 1. Semester 21 Inhaltsverzeichnis Einleitung...3 Versuch 6.1...3 Einwaagen und Herstellung der Verdünnungen...3 Photospektrometrisches
PROTOKOLL ZUM VERSUCH ABBÉSCHE THEORIE. Inhaltsverzeichnis
 PROTOKOLL ZUM VERSUCH ABBÉSCHE THEORIE CHRIS BÜNGER Betreuer: Dr. Enenkel Inhaltsverzeichnis 1. Versuchsbeschreibung 1 1.1. Ziel 1 1.2. Aufgaben 2 1.3. Amplituden- und Phasenobjekte 2 1.3.1. Amplitudenobjekte
PROTOKOLL ZUM VERSUCH ABBÉSCHE THEORIE CHRIS BÜNGER Betreuer: Dr. Enenkel Inhaltsverzeichnis 1. Versuchsbeschreibung 1 1.1. Ziel 1 1.2. Aufgaben 2 1.3. Amplituden- und Phasenobjekte 2 1.3.1. Amplitudenobjekte
5.1. Wellenoptik d 2 E/dx 2 = m 0 e 0 d 2 E/dt 2 Die Welle hat eine Geschwindigkeit von 1/(m 0 e 0 ) 1/2 = 3*10 8 m/s Das ist die
 5. Optik 5.1. Wellenoptik d 2 E/dx 2 = m 0 e 0 d 2 E/dt 2 Die Welle hat eine Geschwindigkeit von 1/(m 0 e 0 ) 1/2 = 3*10 8 m/s Das ist die Lichtgeschwindigkeit! In Materie ergibt sich eine andere Geschwindikeit
5. Optik 5.1. Wellenoptik d 2 E/dx 2 = m 0 e 0 d 2 E/dt 2 Die Welle hat eine Geschwindigkeit von 1/(m 0 e 0 ) 1/2 = 3*10 8 m/s Das ist die Lichtgeschwindigkeit! In Materie ergibt sich eine andere Geschwindikeit
Analytische Chemie. B. Sc. Chemieingenieurwesen. 14. März Prof. Dr. T. Jüstel. Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum:
 Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 14. März 2007 Prof. Dr. T. Jüstel Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges und der Endergebnisse. Versehen
Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 14. März 2007 Prof. Dr. T. Jüstel Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges und der Endergebnisse. Versehen
Spektroskopie. im IR- und UV/VIS-Bereich. Raman-Spektroskopie. http://www.analytik.ethz.ch
 Spektroskopie im IR- und UV/VIS-Bereich Raman-Spektroskopie Dr. Thomas Schmid HCI D323 schmid@org.chem.ethz.ch http://www.analytik.ethz.ch Raman-Spektroskopie Chandrasekhara Venkata Raman Entdeckung des
Spektroskopie im IR- und UV/VIS-Bereich Raman-Spektroskopie Dr. Thomas Schmid HCI D323 schmid@org.chem.ethz.ch http://www.analytik.ethz.ch Raman-Spektroskopie Chandrasekhara Venkata Raman Entdeckung des
Extraktion. Arbeitstechnik der Extraktion
 1 Extraktion Die heute vielfach angewandte Trennung durch Extraktion basiert auf der unterschiedlichen Löslichkeit bestimmter Verbindungen in zwei nicht (od. begrenzt) mischbaren Lösungsmittel. (Das Lösungsmittesystem
1 Extraktion Die heute vielfach angewandte Trennung durch Extraktion basiert auf der unterschiedlichen Löslichkeit bestimmter Verbindungen in zwei nicht (od. begrenzt) mischbaren Lösungsmittel. (Das Lösungsmittesystem
Wasser Kaffeefilter ein Streifen Filterpapier als Docht Schere Tasse
 Trennen von Farben Was Du brauchst: schwarzfarbige Filzstifte Wasser Kaffeefilter ein Streifen Filterpapier als Docht Schere Tasse Wie Du vorgehst: Schneide einen Kreis aus dem Kaffeefilter. Steche mit
Trennen von Farben Was Du brauchst: schwarzfarbige Filzstifte Wasser Kaffeefilter ein Streifen Filterpapier als Docht Schere Tasse Wie Du vorgehst: Schneide einen Kreis aus dem Kaffeefilter. Steche mit
Polarisationsapparat
 1 Polarisationsapparat Licht ist eine transversale elektromagnetische Welle, d.h. es verändert die Länge der Vektoren des elektrischen und magnetischen Feldes. Das elektrische und magnetische Feld ist
1 Polarisationsapparat Licht ist eine transversale elektromagnetische Welle, d.h. es verändert die Länge der Vektoren des elektrischen und magnetischen Feldes. Das elektrische und magnetische Feld ist
Licht und Farbe - Dank Chemie!
 Licht und Farbe - Dank Chemie! Folie 1 Was verstehen wir eigentlich unter Licht? Licht nehmen wir mit unseren Augen wahr Helligkeit: Farbe: Schwarz - Grau - Weiß Blau - Grün - Rot UV-Strahlung Blau Türkis
Licht und Farbe - Dank Chemie! Folie 1 Was verstehen wir eigentlich unter Licht? Licht nehmen wir mit unseren Augen wahr Helligkeit: Farbe: Schwarz - Grau - Weiß Blau - Grün - Rot UV-Strahlung Blau Türkis
4.2 Kokulturen Epithelzellen und Makrophagen
 Ergebnisse 4.2 Kokulturen Epithelzellen und Makrophagen Nach der eingehenden Untersuchung der einzelnen Zelllinien wurden die Versuche auf Kokulturen aus den A549-Epithelzellen und den Makrophagenzelllinien
Ergebnisse 4.2 Kokulturen Epithelzellen und Makrophagen Nach der eingehenden Untersuchung der einzelnen Zelllinien wurden die Versuche auf Kokulturen aus den A549-Epithelzellen und den Makrophagenzelllinien
Lösungen zum Niedersachsen Physik Abitur 2012-Grundlegendes Anforderungsniveau Aufgabe II Experimente mit Elektronen
 1 Lösungen zum Niedersachsen Physik Abitur 2012-Grundlegendes Anforderungsniveau Aufgabe II xperimente mit lektronen 1 1.1 U dient zum rwärmen der Glühkathode in der Vakuumröhre. Durch den glühelektrischen
1 Lösungen zum Niedersachsen Physik Abitur 2012-Grundlegendes Anforderungsniveau Aufgabe II xperimente mit lektronen 1 1.1 U dient zum rwärmen der Glühkathode in der Vakuumröhre. Durch den glühelektrischen
In den grünen Pflanzenteilen, genauer gesagt in bestimmten Organellen der Pflanzenzellen, den
 A 7 Fotosynthese Stellen sie die Wort- und die Symbolgleichung für den Vorgang der Fotosynthese in grünen Pflanzen auf. Wortgleichung: Symbolgleichung: Vervollständigen Sie den Text. In den grünen Pflanzenteilen,
A 7 Fotosynthese Stellen sie die Wort- und die Symbolgleichung für den Vorgang der Fotosynthese in grünen Pflanzen auf. Wortgleichung: Symbolgleichung: Vervollständigen Sie den Text. In den grünen Pflanzenteilen,
Protokoll Versuch 1 d Bestimmung der photochemischen Aktivität isolierter Chloroplasten mit der Sauerstoffelektrode
 Protokoll Versuch 1 d Bestimmung der photochemischen Aktivität isolierter Chloroplasten mit der Sauerstoffelektrode Chloroplasten verlieren bei ihrer Isolation die umhüllende Doppelmembran, die in der
Protokoll Versuch 1 d Bestimmung der photochemischen Aktivität isolierter Chloroplasten mit der Sauerstoffelektrode Chloroplasten verlieren bei ihrer Isolation die umhüllende Doppelmembran, die in der
Auswirkung verschiedener Umweltbedingungen auf Photosystem II, nachgewiesen durch Messung der Chlorophyll-Fluoreszenz
 Kurs 63032, -36, -26 Pflanzenphyiologische und ökologische Übungen Auswirkung verschiedener Umweltbedingungen auf Photosystem II, nachgewiesen durch Messung der Chlorophyll-Fluoreszenz Georg-August- Universität
Kurs 63032, -36, -26 Pflanzenphyiologische und ökologische Übungen Auswirkung verschiedener Umweltbedingungen auf Photosystem II, nachgewiesen durch Messung der Chlorophyll-Fluoreszenz Georg-August- Universität
Bienen, Licht & Farbe: Es ist nicht alles so, wie wir es sehen
 Bienen, Licht & Farbe: Es ist nicht alles so, wie wir es sehen Bienen sehen die Welt anders als wir und finden sich ganz anders zurecht. Welche Möglichkeiten gibt es in der Schule in diese andere Welt
Bienen, Licht & Farbe: Es ist nicht alles so, wie wir es sehen Bienen sehen die Welt anders als wir und finden sich ganz anders zurecht. Welche Möglichkeiten gibt es in der Schule in diese andere Welt
Physikalisches Praktikum II Bachelor Physikalische Technik: Lasertechnik Prof. Dr. H.-Ch. Mertins, MSc. M. Gilbert
 Physikalisches Praktikum II Bachelor Physikalische Technik: Lasertechnik Prof. Dr. H.-Ch. Mertins, MSc. M. Gilbert O07 Michelson-Interferometer (Pr_PhII_O07_Michelson_7, 5.10.015) 1.. Name Matr. Nr. Gruppe
Physikalisches Praktikum II Bachelor Physikalische Technik: Lasertechnik Prof. Dr. H.-Ch. Mertins, MSc. M. Gilbert O07 Michelson-Interferometer (Pr_PhII_O07_Michelson_7, 5.10.015) 1.. Name Matr. Nr. Gruppe
Einführung in die Biophysik - Übungsblatt 8
 Einführung in die Biophysik - Übungsblatt 8 July 2, 2015 Allgemeine Informationen: Die Übung ndet immer montags in Raum H030, Schellingstr. 4, direkt im Anschluss an die Vorlesung statt. Falls Sie Fragen
Einführung in die Biophysik - Übungsblatt 8 July 2, 2015 Allgemeine Informationen: Die Übung ndet immer montags in Raum H030, Schellingstr. 4, direkt im Anschluss an die Vorlesung statt. Falls Sie Fragen
3-01. Triphenylmethan
 Triphenylmethan 3-01 Triphenylmethan ist ein farbloser Feststoff. Die Verbindung kann aus Benzol und Trichlormethan durch FRIEDL-CRAFTS-Alkylierung (elektrophile Substitution) hergestellt werden. Die H-Atome
Triphenylmethan 3-01 Triphenylmethan ist ein farbloser Feststoff. Die Verbindung kann aus Benzol und Trichlormethan durch FRIEDL-CRAFTS-Alkylierung (elektrophile Substitution) hergestellt werden. Die H-Atome
Die gängigen Verfahren
 Die gängigen Verfahren Das hier in diesem Buch vorgestellte Verfahren ist die Unterätzung. Im englischen Sprachraum auch als CBX benannt. Normalerweise ist die Unterätzung ein unerwünschter Fehler beim
Die gängigen Verfahren Das hier in diesem Buch vorgestellte Verfahren ist die Unterätzung. Im englischen Sprachraum auch als CBX benannt. Normalerweise ist die Unterätzung ein unerwünschter Fehler beim
Proteinbestimmung. Diese Lerneinheit befasst sich mit der Beschreibung von verschiedenen Methoden der Proteinbestimmung mit den folgenden Lehrzielen:
 Diese Lerneinheit befasst sich mit der Beschreibung von verschiedenen Methoden der mit den folgenden Lehrzielen: Verständnis der Prinzipien der sowie deren praktischer Durchführung Unterscheidung zwischen
Diese Lerneinheit befasst sich mit der Beschreibung von verschiedenen Methoden der mit den folgenden Lehrzielen: Verständnis der Prinzipien der sowie deren praktischer Durchführung Unterscheidung zwischen
Mikroskopisch-botanisches Praktikum
 Mikroskopisch-botanisches Praktikum Bearbeitet von Gerhard Wanner 2., überarb. erw. Aufl. 2010. Taschenbuch. 264 S. Paperback ISBN 978 3 13 149962 2 Format (B x L): 19,5 x 24 cm Weitere Fachgebiete > Chemie,
Mikroskopisch-botanisches Praktikum Bearbeitet von Gerhard Wanner 2., überarb. erw. Aufl. 2010. Taschenbuch. 264 S. Paperback ISBN 978 3 13 149962 2 Format (B x L): 19,5 x 24 cm Weitere Fachgebiete > Chemie,
QY Cas und EF Cnc - zwei besondere RRc-Sterne QY Cas and EF Cnc - two very spezial RRc stars
 QY Cas und EF Cnc - zwei besondere RRc-Sterne QY Cas and EF Cnc - two very spezial RRc stars Gisela Maintz Abstract : CCD observations of QY Cas (RA = 23:59:05.15, DE = +54:01:00.70) and EF Cnc (RA = 08:40:38.82,
QY Cas und EF Cnc - zwei besondere RRc-Sterne QY Cas and EF Cnc - two very spezial RRc stars Gisela Maintz Abstract : CCD observations of QY Cas (RA = 23:59:05.15, DE = +54:01:00.70) and EF Cnc (RA = 08:40:38.82,
Brechung des Lichts Arbeitsblatt
 Brechung des Lichts Arbeitsblatt Bei den dargestellten Strahlenverläufen sind einige so nicht möglich. Zur Erklärung kannst du deine Kenntnisse über Brechung sowie über optisch dichtere bzw. optisch dünnere
Brechung des Lichts Arbeitsblatt Bei den dargestellten Strahlenverläufen sind einige so nicht möglich. Zur Erklärung kannst du deine Kenntnisse über Brechung sowie über optisch dichtere bzw. optisch dünnere
Über den Einfluß von Substitution in den Komponenten binärer Lösungsgleichgewichte XLVIII. Mitteilung
 G e d r u c k t mit Unterstützung Akademie d. Wissenschaften aus dem Wien; Jerome download unter und www.biologiezentrum.at Margaret Stonborough-Fonds Über den Einfluß von Substitution in den Komponenten
G e d r u c k t mit Unterstützung Akademie d. Wissenschaften aus dem Wien; Jerome download unter und www.biologiezentrum.at Margaret Stonborough-Fonds Über den Einfluß von Substitution in den Komponenten
WAHRNEHMUNG UND NACHWEIS NIEDRIGER ELEKTRISCHER LEISTUNG. FernUniversität Universitätsstrasse 1 D Hagen, GERMANY. 1.
 WAHRNEHMUNG UND NACHWEIS NIEDRIGER ELEKTRISCHER LEISTUNG Eugen Grycko 1, Werner Kirsch 2, Tobias Mühlenbruch 3 1,2,3 Fakultät für Mathematik und Informatik FernUniversität Universitätsstrasse 1 D-58084
WAHRNEHMUNG UND NACHWEIS NIEDRIGER ELEKTRISCHER LEISTUNG Eugen Grycko 1, Werner Kirsch 2, Tobias Mühlenbruch 3 1,2,3 Fakultät für Mathematik und Informatik FernUniversität Universitätsstrasse 1 D-58084
Zusammenhang zwischen Farbe, Wellenlänge, Frequenz und Energie des sichtbaren Spektrums
 Zusammenhang zwischen Farbe, Wellenlänge, Frequenz und Energie des sichtbaren Spektrums Farbe, die das menschliche Auge empfindet Wellenlänge [10-9 m] Frequenz [10 14 Hz] Energie [kj/ 1 mol Photonen] Rot
Zusammenhang zwischen Farbe, Wellenlänge, Frequenz und Energie des sichtbaren Spektrums Farbe, die das menschliche Auge empfindet Wellenlänge [10-9 m] Frequenz [10 14 Hz] Energie [kj/ 1 mol Photonen] Rot
Was bin ich für ein Farbtyp?
 Was bin ich für ein? Um Deine Persönlichkeit optimal hervorzuheben, ist es wichtig zu wissen, was für ein Du bist. Egal, ob Erdtöne, knallige Farben oder Pastelltöne jeder von uns hat einen Farbton, der
Was bin ich für ein? Um Deine Persönlichkeit optimal hervorzuheben, ist es wichtig zu wissen, was für ein Du bist. Egal, ob Erdtöne, knallige Farben oder Pastelltöne jeder von uns hat einen Farbton, der
Basis Cordes RK ist eine wirkstofffreie Basissalbe für die Rezepturkonzentrate
 Prüfanweisung Nr. A00957-5 Seite 1 von 5 Basis Cordes RK ist eine wirkstofffreie Basissalbe für die Rezepturkonzentrate 1 Aussehen Fast weiß bis weiß 2 Geruch Praktisch geruchlos 3 Konsistenz Salbenartig
Prüfanweisung Nr. A00957-5 Seite 1 von 5 Basis Cordes RK ist eine wirkstofffreie Basissalbe für die Rezepturkonzentrate 1 Aussehen Fast weiß bis weiß 2 Geruch Praktisch geruchlos 3 Konsistenz Salbenartig
E2-1-2 Beispiel Experiment Biologie 1/6 Entwicklung von kompetenzorientiertem Unterricht am Beispiel eines Experiments
 E2-1-2 Beispiel Experiment Biologie 1/6 Entwicklung von kompetenzorientiertem Unterricht am Beispiel eines Experiments Nachweis von Stärke in Blättern: (aus Westermann; BIO 2 Rheinlandpfalz, Saarland;
E2-1-2 Beispiel Experiment Biologie 1/6 Entwicklung von kompetenzorientiertem Unterricht am Beispiel eines Experiments Nachweis von Stärke in Blättern: (aus Westermann; BIO 2 Rheinlandpfalz, Saarland;
Das CD-Spektroskop. 15 min
 50 Experimente- Physik / 9.-13. Schulstufe Das CD-Spektroskop 15 min Welche Beleuchtung eignet sich für Innenräume am besten? Seit die Glühlampe aus den Wohnungen verbannt wurde, wird in den Medien über
50 Experimente- Physik / 9.-13. Schulstufe Das CD-Spektroskop 15 min Welche Beleuchtung eignet sich für Innenräume am besten? Seit die Glühlampe aus den Wohnungen verbannt wurde, wird in den Medien über
Grundbausteine des Mikrokosmos (4) Die Entdeckung des Atomkerns...
 Grundbausteine des Mikrokosmos (4) Die Entdeckung des Atomkerns... Alles begann mit den Röntgenstrahlen... November 1895, Würzburg Wilhelm Conrad Röntgen untersuchte Kathodenstrahlen, wobei er eine Fluoreszenz
Grundbausteine des Mikrokosmos (4) Die Entdeckung des Atomkerns... Alles begann mit den Röntgenstrahlen... November 1895, Würzburg Wilhelm Conrad Röntgen untersuchte Kathodenstrahlen, wobei er eine Fluoreszenz
Untersuchung der Zusammenhänge zwischen der gebauten Struktur einer Stadt und der
 Ein agentenbasiertes t Simulationsmodell ll zur Untersuchung der Zusammenhänge zwischen der gebauten Struktur einer Stadt und der sozialen Organisation ihrer Bevölkerung Reinhard König, Informatik in der
Ein agentenbasiertes t Simulationsmodell ll zur Untersuchung der Zusammenhänge zwischen der gebauten Struktur einer Stadt und der sozialen Organisation ihrer Bevölkerung Reinhard König, Informatik in der
Farbchemie mit dem Smartphone 4.01 ; 217 2.73 ; 210 2.00 ; 202 200 1.34 ; 197
 Farbchemie mit dem Smartphone Daniel Bengtsson Lilla Jónás Miroslaw Los Marc Montangero Márta Gajdosné Szabó 21 1 Zusammenfassung Wenn Kupfer in Wasser gelöst wird, dann ergibt dies eine blaue Lösung.
Farbchemie mit dem Smartphone Daniel Bengtsson Lilla Jónás Miroslaw Los Marc Montangero Márta Gajdosné Szabó 21 1 Zusammenfassung Wenn Kupfer in Wasser gelöst wird, dann ergibt dies eine blaue Lösung.
Pflanzen-Zellbiologie und Photosynthese
 Pflanzen-Zellbiologie und Photosynthese Anatomischer Aufbau von Blättern Epidermis Mesophyll: Palisaden-Parenmchym Leitbündel Mesophyll: Schwamm-Parenmchym Epidermis Bilder: Blätter von Berkheya coddii
Pflanzen-Zellbiologie und Photosynthese Anatomischer Aufbau von Blättern Epidermis Mesophyll: Palisaden-Parenmchym Leitbündel Mesophyll: Schwamm-Parenmchym Epidermis Bilder: Blätter von Berkheya coddii
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt für die Klassen 7 bis 9: Strahlung
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt für die Klassen 7 bis 9: Strahlung Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de SCHOOL-SCOUT
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt für die Klassen 7 bis 9: Strahlung Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de SCHOOL-SCOUT
Spektroskopische Untersuchungen an Ostereier-Farbstoffen
 pektroskopische Untersuchungen an stereier-farbstoffen Diplomarbeit vorgelegt von Der Hase aus Berlin an der sterhasen-universität Berlin (UB) 10. April 2015 Inhaltsverzeichnis Einleitung und Aufgabenstellung
pektroskopische Untersuchungen an stereier-farbstoffen Diplomarbeit vorgelegt von Der Hase aus Berlin an der sterhasen-universität Berlin (UB) 10. April 2015 Inhaltsverzeichnis Einleitung und Aufgabenstellung
Licht als Welle: Teil I
 Licht als Welle: Teil I Name: Wir haben schon lange über Wellen gelernt. Du weißt jetzt zum Beispiel, was eine Querwelle ist und was eine Längswelle ist; du kennst auch den Unterschied zwischen Wellenberg
Licht als Welle: Teil I Name: Wir haben schon lange über Wellen gelernt. Du weißt jetzt zum Beispiel, was eine Querwelle ist und was eine Längswelle ist; du kennst auch den Unterschied zwischen Wellenberg
Meisterwurz. Imperatoriae Radix. Radix Imperatoriae
 ÖAB xxxx/xxx Meisterwurz Imperatoriae Radix Radix Imperatoriae Definition Das ganze oder geschnittene, getrocknete Rhizom und die Wurzel von Peucedanum ostruthium (L.) KCH. Gehalt: mindestens 0,40 Prozent
ÖAB xxxx/xxx Meisterwurz Imperatoriae Radix Radix Imperatoriae Definition Das ganze oder geschnittene, getrocknete Rhizom und die Wurzel von Peucedanum ostruthium (L.) KCH. Gehalt: mindestens 0,40 Prozent
Extraktion/Komplexbildung
 Extraktion/Komplexbildung Inhalte dieser Lerneinheit: Quantitativer Nachweis von Eisen mit o-phenanthrolin Quantitativer Nachweis von Kupfer mit Bichinolin Dabei werden Grundlagen der: Komplexbildung und
Extraktion/Komplexbildung Inhalte dieser Lerneinheit: Quantitativer Nachweis von Eisen mit o-phenanthrolin Quantitativer Nachweis von Kupfer mit Bichinolin Dabei werden Grundlagen der: Komplexbildung und
Lösungen Benjamin 2015, Känguru der Mathematik - Österreich
 Lösungen Benjamin 2015, Känguru der Mathematik - Österreich 1. In welcher Figur ist genau die Hälfte grau gefärbt? Lösung: In (A) ist 1/3 gefärbt, in (B) die Hälfte, in (C) ¾, in (D) ¼ und in (E) 2/5.
Lösungen Benjamin 2015, Känguru der Mathematik - Österreich 1. In welcher Figur ist genau die Hälfte grau gefärbt? Lösung: In (A) ist 1/3 gefärbt, in (B) die Hälfte, in (C) ¾, in (D) ¼ und in (E) 2/5.
Protokoll. Kombinierte Anwendung verschiedener Spektroskopischer Methoden
 Protokoll Kombinierte Anwendung verschiedener Spektroskopischer Methoden Zielstellung: Durch die Auswertung von IR-, Raman-, MR-, UV-VIS- und Massenspektren soll die Struktur einer unbekannten Substanz
Protokoll Kombinierte Anwendung verschiedener Spektroskopischer Methoden Zielstellung: Durch die Auswertung von IR-, Raman-, MR-, UV-VIS- und Massenspektren soll die Struktur einer unbekannten Substanz
Laborprotokoll. Trennung von Chlorophyll a und Chlorophyll b mittels Säulenchromatographie
 Laborprotokoll Trennung von Chlorophyll a und Chlorophyll b mittels Säulenchromatographie Cédric Birrer (E46) Michel Rickhaus (E45) Anna-Caterina Senn (E44) Juni 2007 Inhaltsverzeichnis 1 Versuchsziel...
Laborprotokoll Trennung von Chlorophyll a und Chlorophyll b mittels Säulenchromatographie Cédric Birrer (E46) Michel Rickhaus (E45) Anna-Caterina Senn (E44) Juni 2007 Inhaltsverzeichnis 1 Versuchsziel...
Haben Sie gewusst, dass Farben gar NICHT existieren? Die Nervenimpulse lösen im Gehirn Reaktionen aus, die unser Wohlbefinden beeinflussen.
 Haben Sie gewusst, dass Farben gar NICHT existieren? Farben sind schlicht und einfach ein Produkt unserer Sinneswahrnehmung, die unser Sehsinn aus der wahrgenommenen Schwingung und Energie des Lichts erzeugt.
Haben Sie gewusst, dass Farben gar NICHT existieren? Farben sind schlicht und einfach ein Produkt unserer Sinneswahrnehmung, die unser Sehsinn aus der wahrgenommenen Schwingung und Energie des Lichts erzeugt.
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Genetik & Vererbung. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: : Genetik & Vererbung Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Inhalt Vorwort Seite 4 Einleitung Seite
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: : Genetik & Vererbung Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Inhalt Vorwort Seite 4 Einleitung Seite
SCHÜEX RHEINLAND-PFALZ
 DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR ZERSTÖRUNGSFREIE PRÜFUNG E.V. ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Landeswettbewerb Jugend forscht SCHÜEX RHEINLAND-PFALZ Die Lebensmittelampel: Verdorben oder noch essbar? Florian
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR ZERSTÖRUNGSFREIE PRÜFUNG E.V. ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Landeswettbewerb Jugend forscht SCHÜEX RHEINLAND-PFALZ Die Lebensmittelampel: Verdorben oder noch essbar? Florian
Physikalisches Praktikum 3. Semester
 Torsten Leddig 11.Januar 2004 Mathias Arbeiter Betreuer: Dr.Hoppe Physikalisches Praktikum 3. Semester - Abbésche Theorie - 1 Ziel: Verständnis der Bildentstehung beim Mikroskop und dem Zusammenhang zwischen
Torsten Leddig 11.Januar 2004 Mathias Arbeiter Betreuer: Dr.Hoppe Physikalisches Praktikum 3. Semester - Abbésche Theorie - 1 Ziel: Verständnis der Bildentstehung beim Mikroskop und dem Zusammenhang zwischen
Elektronenspektren Organischer Verbindungen (Vollhardt, 3. Aufl., S. 650-654, 4. Aufl. S. 725-729; Hart, S. 453-455; Buddrus, S. 41-45, S.
 Vorlesung 25 Elektronenspektren Organischer Verbindungen (Vollhardt, 3. Aufl., S. 650-654, 4. Aufl. S. 725-729; Hart, S. 453-455; Buddrus, S. 41-45, S. 310-312) Warum sind manche Substanzen farbig, andere
Vorlesung 25 Elektronenspektren Organischer Verbindungen (Vollhardt, 3. Aufl., S. 650-654, 4. Aufl. S. 725-729; Hart, S. 453-455; Buddrus, S. 41-45, S. 310-312) Warum sind manche Substanzen farbig, andere
Raumfahrtmedizin. darauf hin, dass es auch einen Zusammenhang zwischen Knochenabbau, Bluthochdruck und Kochsalzzufuhr gibt. 64 DLR NACHRICHTEN 113
 Raumfahrtmedizin Gibt es einen Die geringe mechanische Belastung der unteren Extremitäten von Astronauten im All ist eine wesentliche Ursache für den Knochenabbau in Schwerelosigkeit. Gleichzeitig haben
Raumfahrtmedizin Gibt es einen Die geringe mechanische Belastung der unteren Extremitäten von Astronauten im All ist eine wesentliche Ursache für den Knochenabbau in Schwerelosigkeit. Gleichzeitig haben
Spektren und Farben. Schulversuchspraktikum WS 2002/2003. Jetzinger Anamaria Mat.Nr.:
 Spektren und Farben Schulversuchspraktikum WS 2002/2003 Jetzinger Anamaria Mat.Nr.: 9755276 Inhaltsverzeichnis 1. Vorwissen der Schüler 2. Lernziele 3. Theoretische Grundlagen 3.1 Farbwahrnehmung 3.2 Das
Spektren und Farben Schulversuchspraktikum WS 2002/2003 Jetzinger Anamaria Mat.Nr.: 9755276 Inhaltsverzeichnis 1. Vorwissen der Schüler 2. Lernziele 3. Theoretische Grundlagen 3.1 Farbwahrnehmung 3.2 Das
Baumtagebuch Japanische Zierkirsche
 Baumtagebuch Japanische Zierkirsche Klasse 9d Juni 2016 Die Japanische Zierkirsche habe ich mir für das Baumtagebuch ausgesucht. Ich habe mich für diesen Baum entschieden, weil er in meiner Straße sehr
Baumtagebuch Japanische Zierkirsche Klasse 9d Juni 2016 Die Japanische Zierkirsche habe ich mir für das Baumtagebuch ausgesucht. Ich habe mich für diesen Baum entschieden, weil er in meiner Straße sehr
Sto AG Innenfarben. Aktive Innenraumfarbe StoClimasan Color
 Sto AG Innenfarben Aktive Innenraumfarbe StoClimasan Color StoClimasan Color: wenn aus Licht frische Luft wird. StoClimasan Color die Innenraumfarbe, die laufend Schadstoffe abbaut und Gerüche reduziert.
Sto AG Innenfarben Aktive Innenraumfarbe StoClimasan Color StoClimasan Color: wenn aus Licht frische Luft wird. StoClimasan Color die Innenraumfarbe, die laufend Schadstoffe abbaut und Gerüche reduziert.
Das Sehen des menschlichen Auges
 Das Sehen des menschlichen Auges Der Lichteinfall auf die lichtempfindlichen Organe des Auges wird durch die Iris gesteuert, welche ihren Durchmesser vergrößern oder verkleinern kann. Diese auf der Netzhaut
Das Sehen des menschlichen Auges Der Lichteinfall auf die lichtempfindlichen Organe des Auges wird durch die Iris gesteuert, welche ihren Durchmesser vergrößern oder verkleinern kann. Diese auf der Netzhaut
7. Klausur am
 Name: Punkte: Note: Ø: Profilkurs Physik Abzüge für Darstellung: Rundung: 7. Klausur am 8.. 0 Achte auf die Darstellung und vergiss nicht Geg., Ges., Formeln, Einheiten, Rundung...! Angaben: h = 6,66 0-34
Name: Punkte: Note: Ø: Profilkurs Physik Abzüge für Darstellung: Rundung: 7. Klausur am 8.. 0 Achte auf die Darstellung und vergiss nicht Geg., Ges., Formeln, Einheiten, Rundung...! Angaben: h = 6,66 0-34
Protokoll zur Übung Ölanalyse
 Protokoll zur Übung Ölanalyse im Rahmen des Praktikums Betreuender Assistent Univ.Ass. Dipl.-Ing. Martin Schwentenwein Verfasser des Protokolls: Daniel Bomze 0726183 1 Theoretischer Hintergrund 1.1 Aufgabenstellung
Protokoll zur Übung Ölanalyse im Rahmen des Praktikums Betreuender Assistent Univ.Ass. Dipl.-Ing. Martin Schwentenwein Verfasser des Protokolls: Daniel Bomze 0726183 1 Theoretischer Hintergrund 1.1 Aufgabenstellung
Tatort Küche. Versuch 1: Rotkohl. Aufgabe: Geräte und Chemikalien: Versuchsdurchführung: Beobachtungen: Auswertung:
 Tatort Küche Aufgabe: Es muss anhand von chemischen Versuchen herausgefunden werden, welcher von drei sehr ähnlich aussehenden Feststoffen Zucker, welcher Kochsalz und welcher Zitronensäure ist. Das Kosten
Tatort Küche Aufgabe: Es muss anhand von chemischen Versuchen herausgefunden werden, welcher von drei sehr ähnlich aussehenden Feststoffen Zucker, welcher Kochsalz und welcher Zitronensäure ist. Das Kosten
1. Warum sehen wir Erdbeeren?
 Kinder-Universität Winterthur Prof. Christophe Huber huber.christophe@gmail.com 1. Warum sehen wir Erdbeeren? 1.1. Licht, Farbe und das menschliche Auge Farbe ist ein Aspekt von Licht. Das menschliche
Kinder-Universität Winterthur Prof. Christophe Huber huber.christophe@gmail.com 1. Warum sehen wir Erdbeeren? 1.1. Licht, Farbe und das menschliche Auge Farbe ist ein Aspekt von Licht. Das menschliche
PCD Europe, Krefeld, Jan 2007. Auswertung von Haemoccult
 Auswertung von Haemoccult Ist das positiv? Nein! Ja! Im deutschen Krebsfrüherkennungsprogramm haben nur etwa 1 % der Frauen und 1,5 % der Männer ein positives Haemoccult -Ergebnis, da dieser Test eine
Auswertung von Haemoccult Ist das positiv? Nein! Ja! Im deutschen Krebsfrüherkennungsprogramm haben nur etwa 1 % der Frauen und 1,5 % der Männer ein positives Haemoccult -Ergebnis, da dieser Test eine
1.5 Färbung und Farbstoffe
 1.5 Färbung und Farbstoffe Durch das Färben können bestimmte Zell- und Gewebestrukturen deutlich sichtbar gemacht und exakt und kontrastreich abgegrenzt werden. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Farbstoffe
1.5 Färbung und Farbstoffe Durch das Färben können bestimmte Zell- und Gewebestrukturen deutlich sichtbar gemacht und exakt und kontrastreich abgegrenzt werden. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Farbstoffe
Farbumfänge. Arbeiten mit Farbe
 Farbumfänge Beim Farbumfang bzw. Farbraum eines Farbsystems handelt es sich um den Farbbereich, der angezeigt oder gedruckt werden kann. Das vom menschlichen Auge wahrnehmbare Farbspektrum ist größer als
Farbumfänge Beim Farbumfang bzw. Farbraum eines Farbsystems handelt es sich um den Farbbereich, der angezeigt oder gedruckt werden kann. Das vom menschlichen Auge wahrnehmbare Farbspektrum ist größer als
3.6 Phosphate der Strukturfamilie M 2 O(PO 4 ) 93
 3.6 Phosphate der Strukturfamilie M 2 O(PO 4 ) 93 Abbildung 3.29 Ti 5 O 4 (PO 4 ). ORTEP-Darstellung eines Ausschnitts der "Ketten" aus flächenverknüpften [TiO 6 ]-Oktaedern einschließlich der in der Idealstruktur
3.6 Phosphate der Strukturfamilie M 2 O(PO 4 ) 93 Abbildung 3.29 Ti 5 O 4 (PO 4 ). ORTEP-Darstellung eines Ausschnitts der "Ketten" aus flächenverknüpften [TiO 6 ]-Oktaedern einschließlich der in der Idealstruktur
FARBE 1 6. InDesign cs6. Additive und subtraktive Farbmischung Additive Farbmischung = Das Mischen von farbigem Licht.
 1 6 Additive und subtraktive Farbmischung Additive Farbmischung = Das Mischen von farbigem Licht. Wenn zwei Taschenlampen auf ein und dieselbe Fläche gehalten werden, so wird diese Fläche heller beleuchtet,
1 6 Additive und subtraktive Farbmischung Additive Farbmischung = Das Mischen von farbigem Licht. Wenn zwei Taschenlampen auf ein und dieselbe Fläche gehalten werden, so wird diese Fläche heller beleuchtet,
18.Elektromagnetische Wellen 19.Geometrische Optik. Spektrum elektromagnetischer Wellen Licht. EPI WS 2006/7 Dünnweber/Faessler
 Spektrum elektromagnetischer Wellen Licht Ausbreitung von Licht Verschiedene Beschreibungen je nach Größe des leuchtenden (oder beleuchteten) Objekts relativ zur Wellenlänge a) Geometrische Optik: Querdimension
Spektrum elektromagnetischer Wellen Licht Ausbreitung von Licht Verschiedene Beschreibungen je nach Größe des leuchtenden (oder beleuchteten) Objekts relativ zur Wellenlänge a) Geometrische Optik: Querdimension
Probe und Probenmenge Wassermenge Auftragspuffermenge 5 µl Kaninchenmuskelextrakt 50 µl 100 µl
 Arbeitsgruppe D 6 Clara Dees Susanne Duncker Anja Hartmann Kristin Hofmann Kurs 3: Proteinanalysen Im heutigen Kurs extrahierten wir zum einen Proteine aus verschiedenen Geweben eines Kaninchens und führten
Arbeitsgruppe D 6 Clara Dees Susanne Duncker Anja Hartmann Kristin Hofmann Kurs 3: Proteinanalysen Im heutigen Kurs extrahierten wir zum einen Proteine aus verschiedenen Geweben eines Kaninchens und führten
Western Blot. Zuerst wird ein Proteingemisch mit Hilfe einer Gel-Elektrophorese aufgetrennt.
 Western Blot Der Western Blot ist eine analytische Methode zum Nachweis bestimmter Proteine in einer Probe. Der Nachweis erfolgt mit spezifischen Antikörpern, die das gesuchte Protein erkennen und daran
Western Blot Der Western Blot ist eine analytische Methode zum Nachweis bestimmter Proteine in einer Probe. Der Nachweis erfolgt mit spezifischen Antikörpern, die das gesuchte Protein erkennen und daran
Titration von Metallorganylen und Darstellung der dazu benötigten
 Kapitel 1 Titration von tallorganylen und Darstellung der dazu benötigten Indikatoren -(2-Tolyl)pivalinsäureamid, ein Indikator zur Konzentrationsbestimmung von -rganylen [1] Reaktionstyp: Syntheseleistung:
Kapitel 1 Titration von tallorganylen und Darstellung der dazu benötigten Indikatoren -(2-Tolyl)pivalinsäureamid, ein Indikator zur Konzentrationsbestimmung von -rganylen [1] Reaktionstyp: Syntheseleistung:
1 Was ist Leben? Kennzeichen der Lebewesen
 1 In diesem Kapitel versuche ich, ein großes Geheimnis zu lüften. Ob es mir gelingt? Wir werden sehen! Leben scheint so selbstverständlich zu sein, so einfach. Du wirst die wichtigsten Kennzeichen der
1 In diesem Kapitel versuche ich, ein großes Geheimnis zu lüften. Ob es mir gelingt? Wir werden sehen! Leben scheint so selbstverständlich zu sein, so einfach. Du wirst die wichtigsten Kennzeichen der
 www.sempervivumgarten.de Volkmar Schara Kreuzstr. 2 / OT Neunstetten 91567 Herrieden Fon 09825/4846 Fax 09825/923521 Delosperma Mittagsblume Sukkulente Gattung aus Süd-Afrika. Es gibt Arten die unserem
www.sempervivumgarten.de Volkmar Schara Kreuzstr. 2 / OT Neunstetten 91567 Herrieden Fon 09825/4846 Fax 09825/923521 Delosperma Mittagsblume Sukkulente Gattung aus Süd-Afrika. Es gibt Arten die unserem
Physikalisch-Chemisches Grundpraktikum
 Physikalisch-Cheisches Grundpraktiku Versuch Nuer G3: Bestiung der Oberflächen- spannung it der Blasenethode Gliederung: I. Aufgabenbeschreibung II. Theoretischer Hintergrund III. Versuchsanordnung IV.
Physikalisch-Cheisches Grundpraktiku Versuch Nuer G3: Bestiung der Oberflächen- spannung it der Blasenethode Gliederung: I. Aufgabenbeschreibung II. Theoretischer Hintergrund III. Versuchsanordnung IV.
2.15 Der grüne Blattfarbstoff. Aufgabe. Welche Bedeutung hat der grüne Blattfarbstoff?
 Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 2 Vom Keimen der Samen und Wachsen der Pflanzen (P80900) 2.5 Der grüne Blattfarbstoff Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.0.203 5:25:20 intertess (Version
Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 2 Vom Keimen der Samen und Wachsen der Pflanzen (P80900) 2.5 Der grüne Blattfarbstoff Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.0.203 5:25:20 intertess (Version
Waschmittel. 1. Inhaltsstoffe der Waschmittel. 1.1. Tenside
 Universität Regensburg 06.11.2009 Institut für Anorganische Chemie Lehrstuhl Prof. Dr. A. Pfitzner Wintersemester 2009/2010 Gruppenversuche in Anorganischer Chemie mit Demonstrationen Betreuung: Dr. M.
Universität Regensburg 06.11.2009 Institut für Anorganische Chemie Lehrstuhl Prof. Dr. A. Pfitzner Wintersemester 2009/2010 Gruppenversuche in Anorganischer Chemie mit Demonstrationen Betreuung: Dr. M.
2. Teilklausur zum Chemischen Grundpraktikum im WS 2015/16 vom
 2. Teilklausur zum Chemischen Grundpraktikum im WS 2015/16 vom 20.01.2016 A1 A2 A3 F4 R5 E6 Note 10 9 6 8 9 8 50 NAME/VORNAME:... Matrikelnummer:... Pseudonym für Ergebnisveröffentlichung Schreiben Sie
2. Teilklausur zum Chemischen Grundpraktikum im WS 2015/16 vom 20.01.2016 A1 A2 A3 F4 R5 E6 Note 10 9 6 8 9 8 50 NAME/VORNAME:... Matrikelnummer:... Pseudonym für Ergebnisveröffentlichung Schreiben Sie
22 Optische Spektroskopie; elektromagnetisches Spektrum
 22 Optische Spektroskopie; elektromagnetisches Spektrum Messung der Wellenlänge von Licht mithilfedes optischen Gitters Versuch: Um das Spektrum einer Lichtquelle, hier einer Kohlenbogenlampe, aufzunehmen
22 Optische Spektroskopie; elektromagnetisches Spektrum Messung der Wellenlänge von Licht mithilfedes optischen Gitters Versuch: Um das Spektrum einer Lichtquelle, hier einer Kohlenbogenlampe, aufzunehmen
Zoologische Staatssammlung München;download: http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at SPIXIANA
 SPIXIANA Abb. 1: Strombus k. kleckhamae Cernohorsky, 1971, dorsal und ventral 320 Abb. 2: Strombus k. boholensis n. subsp., Typus, dorsal und ventral Gehäusefärbung: Die ersten 3-^ "Windungen sind bräunlich
SPIXIANA Abb. 1: Strombus k. kleckhamae Cernohorsky, 1971, dorsal und ventral 320 Abb. 2: Strombus k. boholensis n. subsp., Typus, dorsal und ventral Gehäusefärbung: Die ersten 3-^ "Windungen sind bräunlich
Universität der Pharmazie
 Universität der Pharmazie Institut für Pharmazie Pharmazie-Straße 1 12345 Pharmastadt Identitäts-, Gehalts- und Reinheitsbestimmung von Substanzen in Anlehnung an Methoden des Europäischen Arzneibuchs
Universität der Pharmazie Institut für Pharmazie Pharmazie-Straße 1 12345 Pharmastadt Identitäts-, Gehalts- und Reinheitsbestimmung von Substanzen in Anlehnung an Methoden des Europäischen Arzneibuchs
Protokoll Physikalisch-Chemisches Praktikum für Fortgeschrittene
 K. B. Datum des Praktikumstags: 4.12.2007 Matthias Ernst Protokoll-Datum: 8.12.2007 Gruppe 11 Assistent: T. Bentz Testat: AK-Versuch: Modellierung von verbrennungsrelevanten Prozessen Aufgabenstellung
K. B. Datum des Praktikumstags: 4.12.2007 Matthias Ernst Protokoll-Datum: 8.12.2007 Gruppe 11 Assistent: T. Bentz Testat: AK-Versuch: Modellierung von verbrennungsrelevanten Prozessen Aufgabenstellung
Protokoll Nr.1: 01. Oktober 2009. Eiweiße. Thema: Julia Wiegel
 Protokoll Nr.1: 01. Oktober 2009 Thema: Eiweiße 1 Julia Wiegel 1 http://images.google.de/imghp?hl=de&tab=wi (Stichwort: Eiweiße) 1 11 BG 08 Lehrer: Herr Weber Fach: Technologie Abgabetermin: 29. Oktober
Protokoll Nr.1: 01. Oktober 2009 Thema: Eiweiße 1 Julia Wiegel 1 http://images.google.de/imghp?hl=de&tab=wi (Stichwort: Eiweiße) 1 11 BG 08 Lehrer: Herr Weber Fach: Technologie Abgabetermin: 29. Oktober
AnC I Protokoll: 7.1 Synthese und Charakterisierung von Tetraamminkupfer(II)-sulfat! SS Analytische Chemie I.
 Analytische Chemie I Versuchsprotokoll 7.1 Synthese und Charakterisierung der Komplexverbindung Tetraamminkupfer(II)-sulfat 1.! Theoretischer Hintergrund Aus Kupfer(II)-sulfat und Ammoniak wird zunächst
Analytische Chemie I Versuchsprotokoll 7.1 Synthese und Charakterisierung der Komplexverbindung Tetraamminkupfer(II)-sulfat 1.! Theoretischer Hintergrund Aus Kupfer(II)-sulfat und Ammoniak wird zunächst
