WASSERVERSORGUNGSKONZEPT GEMÄß 38 LWG NW
|
|
|
- Viktor Diefenbach
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 WASSERVERSORGUNGSKONZEPT GEMÄß 38 LWG NW Titel: Wasserversorgungskonzept gemäß 38 Landeswassergesetz NRW für die Stadt Solingen Datum: 26. September 2017 Auftraggeber: Auftrag vom: Stadt Solingen/Eigenbetrieb Wasserversorgung Solingen Ansprechpartner: Herr Dipl.-Biol. Martin Wegner Herr Dipl.-Ing. Manfred Müller Auftragnehmer: Herr Dipl.-Ing. Norbert Feldmann Auftragnehmer: AHU Aachen (Hydrologische/Wasserrechtliche Daten) Frau Dipl.-Geol. Nadine Coenen Herr Dipl.-Geol. Christoph Sailer Aktenzeichen: Ausfertigung Nr.:, Beethovenstraße 210, Solingen Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Norbert Feldmann, Tel.:
2 I N H A L T 1 GEMEINDEGEBIET 6 2 BESCHREIBUNG DES WASSERVERSORGUNGSSYSTEMS Übersicht Wasserwerke Organisation der Wasserversorgung Rechtliche/Vertragliche Rahmenbedingungen Qualifikationsnachweise/Zertifizierung Absicherung der Versorgung Besonderheiten 28 3 AKTUELLE WASSERABGABE UND WASSERBEDARF Wasserabgabe (Historie) Prognose Wasserbedarf 30 4 MENGENMÄßIGES WASSERDARGEBOT FÜR DIE BEDARFS-DECKUNG (WASSERBILANZ) SOWIE MÖGLICHE ZUKÜNFTIGE VERÄNDERUNGEN Wasserressourcenbeschreibung Genutzte Ressourcen Ungenutzte Ressourcen Wasserbilanz Entwicklungsprognose des quantitativen Wasserdargebots unter Berücksichtigung möglicher Auswirkungen des Klimawandels 39 5 ROHWASSERÜBERWACHUNG / TRINKWASSERUNTERSUCHUNG UND BESCHAFFENHEIT ROHWASSER / TRINKWASSER Überwachungskonzept Rohwasser und Probenahmeplan Trinkwasser Beschaffenheit von Rohwasser und Trinkwasser Trinkwasser Rohwasser WG Baumberg Rohwasser WG Hilden-Karnap Rohwasser Sengbachtalsperre Eigenversorgungsanlagen 54 6 WASSERTRANSPORT 55 7 WASSERVERTEILUNG Plan des Wasserverteilnetzes Auslegung des Verteilnetzes
3 7.3 Technische Ausstattung, Materialien, Durchschnittsalter, Dichtigkeit, Schadensfälle, Substanzerhalt Wasserbehälter, Druckerhöhungs- /Druckminderungsanlagen 61 8 GEFÄHRDUNGSANALYSE Identifizierung möglicher Gefährdungen Entwicklungsprognose Gefährdungen 65 9 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND ERFORDERLICHE MAßNAHMEN ZUR LANGFRISTIGEN SICHERSTELLUNG DER ÖFFENTLICHEN WASSERVERSORGUNG Schlussfolgerungen Risiken für die Versorgungssicherheit Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung 68 ABBILDUNGEN: Abb: 1.1: Topografische Karte mit Hydrologie und Gemeindegrenzen aus 6 Abb. 1.2: Flächennutzungsplan der Stadt Solingen... 8 Abb : Grafik Bevölkerungsentwicklung mit Prognose (Stadt Solingen)... 9 Abb : Bevölkerungsentwicklung nach IT.NRW, Düsseldorf, Dieses Werk ist lizensiert unter der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version Abb. 1.4: Gebietsentwicklungsplan Gemeindegebiet Solingen ( nderung.html) Abb. 2.1: Schematische Übersicht Wasserversorgungssystem der Stadt Solingen) Abb. 2.2: Übersichtsplan Wasserversorgungssystem der Stadtwerke Solingen Abb. 2.3: Übersichtsplan Wasserverteilnetz mit den unterschiedlichen Druckzonen im Stadtgebiet von Solingen Abb. 2.4: Übersichtsplan Wasserversorgungssystem mit Einspeisungen in das Wasserverteilnetz Abb. 2.5: Fließschema Wasseraufbereitung Wasserwerk Glüder der Abb. 2.6: Fließschema Wasseraufbereitung Wasserwerk Baumberg der WW Baumberg GmbH Abb. 2.7: Übersichtsplan private Trinkwasserversorger / Eigenversorger. 19 Abb. 2.8: Fließschema Wasseraufbereitung Wasserwerk Dabringhausen Bremen der BTV GmbH (Quelle: Abb. 2.9: Fließschema Wasseraufbereitung Wasserwerk Schürholz des WVV (Quelle: 22 Abb. 2.10: Organisation der Trinkwasserversorgung in Solingen
4 Abb. 2.11: Schematische Übersicht Wasserversorgung im Versorgungsgebiet der SW Solingen Abb. 2.12: TSM Bestätigung gemäß DVGW Arbeitsblatt W Abb. 3.1: Grafik Wasserabgabe (Historie). Durch den linearen Tarif für alle Kunden, gibt es keine Differenzierung nach Kundengruppen Abb. 3.2: Eigenförderung und Bezugsmengen der SW Solingen GmbH Abb. 3.3: Grafik Prognose Wasserbedarf Solingen der nächsten Jahre Abb. 4.1: Übersichtskarte Wasserschutzgebiet Sengbachtalsperre Abb. 4.2: Übersichtskarte Wasserschutzgebiet Baumberg Abb. 4.3: Geplantes Wasserschutzgebiet Hilden-Karnap (Stand: Oktober 2016) Abb. 4.4: Aktuelle Einzugsgebiete WG Baumberg und WG Hilden-Karnap (April 2016) Abb. 4.5: Übersichtskarte Wasserschutzgebiet Große Dhünn Talsperre Abb. 4.6: Gegenüberstellung Wasserbedarf und Versorgungsszenarien für die SW Solingen GmbH und die WW Baumberg GmbH Abb. 5.1: Untersuchungshäufigkeiten Trinkwasser (Auszug) Abb. 5.2: Plan Trinkwasser Netzprobenahmestellen Abb. 5.3: Einzugsgebiet WG Baumberg und WG Hilden-Karnap(alt).45 Abb. 5.5: Probenahmestellen Einzugsgebiet Sengbachtalsperre Abb. 5.6: Auszug aus der TW-Analyse Abb. 5.7: Nitratkonzentration in den Zuflüssen der Sengbachtalsperre...53 Abb. 5.8: Tabelle Grenzwertüberschreitungen Eigenversorgungsanlagen.54 Abb. 7.1: Verteilnetzplan mit den Druckzonen..55 Abb. 7.2: Netzberechnung für Spitzenlastfall mit farblicher Darstellung der Fließgeschwindigkeiten.56 Abb. 7.3: Werkstoffe Verteilnetz nach Dimensionen 58 Abb. 7.4: Dimensionsübersicht Verteilnetz 58 Abb. 7.5: Altersverteilung Verteilnetz.. 59 Abb 7.6: Schäden am Wasserverteilnetz Abb. 7.7: Schematische Darstellung der Behälteranlagen..61 Abb. 8.1: Schema der Prozessbestandteile Wassersicherstellungskonzept WW Baumberg GmbH TABELLEN: Tab. 1: Flächennutzungen im Stadtgebiet Solingen 7 Tab. 2: Brunnen/Pumpwerke und Wasserwerke 16 Tab. 3: Übersicht private Trinkwasserversorger / Eigenversorger 20 Tab. 4: Wasserrechte für die öffentliche Trinkwasserversorgung Solingen 24 Tab.5: Lieferverträge der bzw. WW Baumberg GmbH mit anderen Wasserversorgungsunternehmen (WVU) 25 Tab. 6: Absicherungen der Trinkwasserversorgung Solingens 27 Tab. 7: Berechnung erwarteter Spitzenbedarf in 20 Jahren 30 Tab. 8: Wasserbilanz im Einzugsgebiet der WG Baumberg 37 Tab. 9: Wasserbilanz im Einzugsgebiet der WG Hilden-Karnap (Niedrigwasser) 38 Tab. 10: Übersicht Rohwasserbeschaffenheit WG Baumberg 488 Tab. 11: Übersicht Rohwasserbeschaffenheit WG Hilden-Karnap
5 Tab. 12: Beispiele für mögliche Gefährdungen im Wassergewinnungsgebiet und Maßnahmen zum Management (Quantität wie Qualität) 65 ANLAGEN: siehe Abbildungen, z.t. groß als Anlagen Anl. 1 : Anl. 2 : Anl. 5 : Anl. 5.6: Anl. 5.7: Anl. 5.8: Anl. 5.9: Anl. 5.10: Anl. 6.1: Anl. 6.2: Anl. 6.4: Anl. 7.0: Anl. 7.1: Anl. 7.2: Anl. 7.3: Topografische Karte mit Hydrologie und Gemeindegrenzen aus Flächennutzungsplan der Stadt Solingen Gebietsentwicklungsplan Gemeindegebiet Solingen Langjährige Entwicklung der Rohwasserbeschaffenheit WG Baumberg für die Parameter Leitfähigkeit, Gesamthärte, Chlorid, Sulfat und Nitrat Langjährige Entwicklung der GW-Beschaffenheit im Einzugsgebiet Baumberg Langjährige Entwicklung der Rohwasserbeschaffenheit WG Hilden-Karnap für die Parameter Leitfähigkeit, Gesamthärte, Chlorid, Sulfat, Nitrat, Eisen, Mangan und Nickel Langjährige Entwicklung der GW-Beschaffenheit im Einzugsgebiet Hilden-Karnap Tabelle Grenzwertüberschreitungen Eigenversorgungsanlagen Schematische Übersicht Wasserversorgungssystem der Stadt Solingen Übersichtsplan Wasserversorgungssystem der Stadtwerke Solingen GmbH Übersichtsplan Wasserversorgungssystem mit Einspeisungen in das Wasserverteilnetz Fließschema Wasseraufbereitung Wasserwerk Glüder der Übersichtsplan Wasserverteilnetz mit den unterschiedlichen Druckzonen im Stadtgebiet von Solingen Fließschema Wasseraufbereitung Wasserwerk Baumberg der WW Baumberg GmbH Übersichtsplan private Trinkwasserversorger / Eigenversorger - 4 -
6 Anl. 7.4: Anl. 7.5: Anl. 7.6: Anl. 11: Fließschema Wasseraufbereitung Wasserwerk Dabringhausen Bremen der BTV GmbH Fließschema Wasseraufbereitung Wasserwerk Schürholz des WVV Netzberechnung für Spitzenlastfall mit farblicher Darstellung der Fließgeschwindigkeiten Schematische Übersicht Wasserversorgung im Versorgungsgebiet der SW Solingen GmbH Anl. 13: TSM Bestätigung gemäß DVGW Arbeitsblatt W 1000 Anl. 19.1: Anl. 19.2: Anl. 19.3: Anl. 19.4: Anl. 19.5: Anl. 24: Anl. 26: Übersichtskarte Wasserschutzgebiet Sengbachtalsperre Übersichtskarte Wasserschutzgebiet Baumberg Geplantes Wasserschutzgebiet Hilden-Karnap (Stand: Oktober 2016) Aktuelle Einzugsgebiete WG Baumberg und beantragtes WG Hilden-Karnap (April 2016) Übersichtskarte Wasserschutzgebiet Große Dhünn Talsperre (Quelle: Wupperverband, FluGGS) Plan Trinkwasser Netzprobenahmestellen Probenahmestellen Einzugsgebiet Sengbachtalsperre Anl. 27: Auszug aus der TW-Analyse 2016 Anl. 30: Anl. 32 : Werkstoffe Verteilnetz nach Dimensionen Altersverteilung Verteilnetz Anl. 33: Schäden am Wasserverteilnetz Anl. 34: Schematische Darstellung der Behälteranlagen - 5 -
7 1 GEMEINDEGEBIET Überblick Die Stadt Solingen liegt zwischen Wuppertal, Remscheid, Wermelskirchen, Leichlingen, Langenfeld, Hilden und Haan. Die Stadt liegt im Bergischen Land und es leben ca Einwohner in Solingen. Durchquert man Solingen von West nach Ost, so steigt das Gelände stetig an (von 53 mnn auf 276 mnn). Dieser Höhenunterschied sorgt für eine komplexe Trinkwasserversorgung in Solingen. In der Abbildung 1.1 ist das Gemeindegebiet der Stadt Solingen mit den Begrenzungen und dem Gewässersystem dargestellt. Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von ca. 90 km². Im Osten und Süden verläuft die Stadtgrenze entlang der Wupper. Abb: 1.1: Topografische Karte mit Hydrologie und Gemeindegrenzen aus (Anlage 1) - 6 -
8 Nutzungsstruktur im Stadt Gebiet Solingen Abbildung 1.2 zeigt den Flächennutzungsplan für Solingen. In Tabelle 1 sind die zusammengefassten Nutzungskategorien mit der Flächengröße und dem prozentualen Flächenanteil am Stadtgebiet angegeben. Tab. 1: Flächennutzungen im Stadtgebiet Solingen Fläche Nutzung km² % Siedlungsfläche inkl. Sport und Freizeitflächen 36,88 41,2 Industrie- und Gewerbefläche 6,29 7,0 Verkehrsflächen inkl. Bahn 0,31 0,3 Gewässer 0,70 0,8 Landwirtschaft 19,76 22,1 Forstwirtschaft inkl. Gehölz 25,51 28,5 Sonstiges 0,06 0,1 Summe 89, Bezogen auf das Stadtgebiet Solingen (vgl. Tab. 1) sind folgende Nutzungen relevant: Siedlungsnutzungen haben mit rd. 41,2 % den größten Flächenanteil Forstflächen machen etwa 28,5 % der Flächen aus. Das Stadtgebiet ist entlang der Wupper und der Nebengewässer, im Südosten, sowie im Westen (Stadtwald) von forstwirtschaftlichen Nutzungen geprägt. Landwirtschaftliche Nutzungen erstrecken sich auf rd. 22,1 % der Stadtfläche, dabei überwiegen die Grünlandflächen. Gewerbe und Industrieflächen sind auf rd. 7 % der Stadtfläche vorhanden. Verkehrsflächen mit Straßen und Bahnlinien sind in der flächenhaften Auswertung nur anteilig enthalten. Im Stadtgebiet von Solingen liegen die Autobahn BAB A1 (ganz im Süden), die BAB A3 (ganz im Westen) und mehrere Bahnlinien, die das Stadtgebiet in Nord-Süd bzw. Ost- West-Richtung queren. Im Südosten des Stadtgebiets Solingen liegt auch die Sengbachtalsperre, eine der Rohwasserressourcen für die Sicherstellung der Öffentlichen Trinkwasserversorgung der Stadt Solingen
9 In Ergänzung zum Kartenausdruck aus Tim-Online (vgl. Abb. 1.1) ist in der Abbildung 1.2 der Flächennutzungsplan für die Stadt Solingen dargestellt. Abb. 1.2: Flächennutzungsplan der Stadt Solingen (Anlage 2) - 8 -
10 Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Solingen Abbildung zeigt die Prognose der Bevölkerungsentwicklung für die Stadt Solingen (Quelle: Bevölkerungsprognose der Stadt Solingen 2015); demnach ist mit einem Bevölkerungszuwachs für Solingen bis zum Jahr 2020 von etwa Einwohnern zu rechnen. Die Auswertungen auf IT NRW (Abb ) ergeben bis zum Jahr 2040 einen leichten Bevölkerungsanstieg um rd Einwohner (Zahlen IT NRW liegen aber knapp unter EW). Abb : Grafik Bevölkerungsentwicklung mit Prognose (Stadt Solingen) - 9 -
11 Abb : Bevölkerungsentwicklung nach IT.NRW, Düsseldorf, Dieses Werk ist lizensiert unter der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0. Gebietsentwicklungsplanung Abbildung 1.4 zeigt den Gebietsentwicklungsplan für Solingen. Abb. 1.4: Gebietsentwicklungsplan Gemeindegebiet Solingen (Anlage 5) ( b.pdf)
12 Der Regionalrat beschloss am 9. Oktober 2002, das Verfahren zur Erarbeitung der 16. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) im Gebiet der Stadt Solingen einzuleiten (vgl. Vorlage 6/6 PA bzw. 6/7 RR). Anlass dafür ist die Aufstellung des neuen Flächennutzungsplans der Stadt Solingen, die zu Änderungen des GEP 99 in zwölf Teilbereichen führt. Ein Teil der bisher dargestellten Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) soll in Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) bzw. Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich mit überlagernden Darstellungen geändert werden. Die Flächen für Bahnanlagen des ehemaligen Bahnhofs Solingen Wald sollen in den GIB einbezogen und die nicht mehr genutzten Bahnflächen südlich des Hauptbahnhofes sollen als ASB dargestellt werden. Am hat der Regionalrat den Aufstellungsbeschluss zu v.g. Verfahren gefasst. Mit Bekanntmachung der Genehmigung vom durch die Landesplanungsbehörde im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW ist die 16. GEP-Änderung am ein Ziel der Raumordnung geworden. ( ung.html)
13 2 BESCHREIBUNG DES WASSERVERSORGUNGSSYSTEMS 2.1 Übersicht In Abbildung 2.1 ist das Wasserversorgungssystem für die Stadt Solingen schematisch dargestellt. Abb. 2.1: Schematische Übersicht Wasserversorgungssystem der Stadt Solingen (Anlage 6.1) Die SW Solingen GmbH betreibt zur Versorgung der Stadt Solingen das WW Glüder an der Sengbachtalsperre. Das Rohwasser aus der Sengbachtalsperre wird im WW Glüder zu Trinkwasser aufbereitet und in das Trinkwassernetz der SW Solingen GmbH eingespeist. An der Sengbachtalsperre verfügt die SW Solingen GmbH über eine wasserrechtliche Bewilligung zur Rohwasserentnahme von bis zu 12,5 Mio. m³/a. Über das vorhandene Ringleitungssystem wird ganz Solingen außer Burg/Höhrath mit Trinkwasser versorgt. Die SW- Solingen GmbH bezieht Trinkwasser für die Ortsteile Burg und Höhrath vom Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper (WVV). Dieses wird dann von der SW Solingen GmbH in Burg /Höhrath verteilt
14 Die SW Solingen GmbH bezieht zur Versorgung der Stadt Solingen zusätzlich Trinkwasser von der Bergischen Trinkwasserverbund GmbH (BTV). Aus dem WW Dabringhausen welches sein Rohwasser aus der Großen Dhünn- Talsperre (Betreiber der Talsperre ist der Wupperverband) bezieht, wird Trinkwasser über den Hochbehälter Lützowstraße in das Trinkwassernetz der SW Solingen GmbH eingespeist. Der SW Solingen GmbH steht vertraglich eine Trinkwassermenge von bis zu 6,3 Mio. m³/a von der BTV zur Verfügung. Die Ausschöpfung dieser Bereitstellungsmenge von 6,3 Mio. m³/a wird im Regelbetrieb seitens der SW Solingen GmbH angestrebt. Die WW Baumberg GmbH beliefert die SW Solingen GmbH darüber hinaus bedarfsgesteuert mit Trinkwasser aus dem Wasserwerk Baumberg. Für den Notversorgungsfall bestehen Vereinbarungen, dass auch aus dem Wasserwerk Baumberg eine Rohwasserlieferung ins Versorgungsgebiet der SW Solingen GmbH möglich ist. Nachfolgend ist ein schematischer Übersichtplan über die wesentlichen Bestandteile des Wasserversorgungssystems (Gewinnungsgebiete, Gewinnungsanlagen, Aufbereitungsanlagen, Speicheranlagen, Verteilnetz, Wasserübergabestellen und Notverbundstellen) dargestellt. Abb. 2.2: Übersichtsplan Wasserversorgungssystem der Stadtwerke Solingen (Anlage 6.2)
15 Abb. 2.3: Übersichtsplan Wasserverteilnetz mit den unterschiedlichen Druckzonen im Stadtgebiet von Solingen (Anlage 7.1) Abb. 2.4: Übersichtsplan Wasserversorgungssystem mit Einspeisungen in das Wasserverteilnetz (Anlage 6.4)
16 In Solingen wird fast ausschließlich aufbereitetes Oberflächenwasser an die Endverbraucher geliefert. Nur ein kleiner Bereich im Bereich der Langhansstraße und Bonner Straße in Solingen Ohligs wird mit Trinkwasser aus dem Wasserwerk Baumberg (Grundwasser 70% und Uferfiltrat 30%) versorgt (siehe auch Kapitel 2.6). In Solingen werden ca. 7,5 Mio m³ pro Jahr an Trinkwasser verbraucht. Lieferant ist hier der Eigenbetrieb Wasser Solingen (EBW). Die Nachbarstädte Haan und Langenfeld werden von den Stadtwerken Solingen (SW SG) beliefert. Zusammen bekommen die Städte ca. 3,5 Mio m³ Trinkwasser pro Jahr. Daraus resultiert, dass die Stadtwerke Solingen insgesamt rd. 11,0 Mio m³ Trinkwasser pro Jahr aufbereiten oder fremdbeziehen. Ungefähr 6,0 Mio m³/a Trinkwasser werden fremdbezogen; und zwar von der BTV (Bergische Trinkwasserverbund GmbH). Die BTV betreibt das Wasserwerk Bremen (Dabringhausen) mit Rohwasser aus der Großen Dhünn- Talsperre. Durch einen Leitungsverbund wird aus diesem Werk Wuppertal, Remscheid, Solingen und Leverkusen beliefert. Die Übergabestelle für das BTV-Wasser ist in Solingen an der Lützowstraße (Solingen Gräfrath). Dort befindet sich eine Behälteranlage, die an einen großen Transportleitungsring angeschlossen ist. Die verbleibenden 5,0 Mio m³/a werden im Wasserwerk Glüder (Solingen) aus dem Rohwasser der Sengbachtalsperre aufbereitet. Eine große Trinkwassertransportleitung führt vom WW Glüder zur Krahenhöhe. Dort befindet sich ebenfalls eine Behälteranlage (neben der Hauptschule Krahenhöhe), aus der weite Teile der Innenstadt versorgt werden. Die Behälteranlage ist ebenfalls mit dem oben erwähnten Transportring verbunden, so dass die beiden Behälteranlagen miteinander kommunizieren können. In der Nähe der Stadtwerke, auf der Martinstraße (Behälteranlage Olgastraße), befindet sich eine dritte Behälteranlage, die ebenfalls mit dem Transportring verbunden ist. Da sie jedoch geodätisch etliche Meter tiefer liegt als die beiden anderen Anlagen, kann Sie im Regelversorgungsfall nur vom Transportring aufgefüllt werden. Durch die Vorhaltung einer Pumpenanlage ist es allerdings im Störfall möglich, dass die Behälteranlage auch in den Transportring einspeisen kann. Aus dieser Behälteranlage werden die tiefer liegenden Ortsteile von Solingen (Ohligs und Merscheid) versorgt. Diese Ortsteile wurden bis 2003 mit aufbereitetem Grundwasser aus dem ehemaligen Wasserwerk Karnap (heute Wasserwerk Baumberg) versorgt. Die zurückgegangenen Wasserverbräuche in den letzten 15 Jahren machten die Umstellung der Trinkwasserversorgung aus Oberflächenwasser möglich. Das Wasserwerk Karnap ist Anfang der 1970er Jahre gebaut worden. Im Wasserwerk Karnap wird Grundwasser aus der Nachbarschaft des Werkes aufbereitet. Zur gleichen Zeit wurde nur einen Steinwurf entfernt ein zweites Wasserwerk errichtet das Wasserwerk Baumberg (WWB). Der Name rührt daher, da im Wasserwerk Baumberg Uferfiltrat (Rohwasser aus den Grundwasserleitern in der Nähe des Rheins) aufbereitet wurde. Die Planungsgrundlagen und Prognosen in den 70er Jahren gingen von einer Bevölkerungsverdopplung und auch von einem spezifischen Wasserverbrauch aus, der um 50 % höher lag, als sich tatsächlich bis heute eingestellt hat. Aus diesem Grund
17 wurde 2008 das alte Wasserwerk Baumberg stillgelegt, das Wasserwerk Karnap wurde auf neuen technischen Stand gebracht und anschließend wurde das alte Wasserwerk Baumberg abgerissen. Das umgebaute Wasserwerk Karnap nennt sich nun Wasserwerk Baumberg (hängt mit der Gesellschafterstruktur der Wasserwerk Baumberg GmbH zusammen) und dort werden beide Rohwässer (Uferfiltrat und Grundwasser) verschnitten und dann zu Trinkwasser aufbereitet. Vom Wasserwerk Baumberg (WWB) wird die Stadt Hilden und ein Teil von Langenfeld mit Trinkwasser versorgt. Die Betriebsführung des Werkes wird von SW SG-Mitarbeitern wahrgenommen. Wie wird Solingen Burg versorgt? Oberburg und Unterburg werden ebenfalls im Auftrag des EBW durch die SW SG versorgt. Das Trinkwasser wird aber nicht selber aufbereitet sondern in Oberburg in einer Schachtanlage vom Wasserversorgungsverband Rhein Wupper (WVV) übernommen. Die Herkunft des Wassers ist auch die Große Dhünntalsperre allerdings aus dem WW-Schürholz, das vom WVV betrieben wird. 2.2 Wasserwerke Das in Solingen verteilte Trinkwasser stammt aus vier Gewinnungsanlagen und vier Aufbereitungsanlagen; siehe Übersicht in Tabelle 2. Dabei liegt nur die Sengbachtalsperre sowie die Aufbereitungsanlage im WW Glüder auf Solinger Stadtgebiet. Die Einzugsgebiete der Sengbachtalsperre und der WG Hilden-Karnap liegen anteilig auf Solinger Stadtgebiet. Tab. 2: Brunnen/Pumpwerke und Wasserwerke Wassergewinnung Rechtsinhaber rechtlich / vertraglich gesicherte Wassermengen [m³/a] Brunnen Mengen je Brunnen Wasserwerk Art des geförderten Wassers WG Baumberg WW Baumberg GmbH (Notwassermenge) m³/h m³/d 7,0 Mio. m³/a Baumberg 2 Horizontalfilterbrunnen Grundwasser, 1 Stockwerk u. Uferfiltration WG Hilden-Karnap WW Baumberg GmbH 250 m³/h m³/d m³/a Baumberg Vertikalfilterbrunnen Grundwasser, 1 Stockwerk Sengbachtalsperre SW Solingen GmbH * - - Glüder Talsperre Große Dhünn- Talsperre BTV (Zielabnahmemenge) Dabringhausen Talsperre Große Dhünn- Talsperre WVV (Mittelwert) rund (bedarfsgesteuert) - - Schürholz * Das Wasserrecht an der Sengbachtalsperre steht in dieser Höhe nur in niederschlagsreichen Jahren bei gleichzeitiger Überleitung von bis zu 2,5 Mio. m³/a Rohwasser aus der Vorsperre Große Dhünn zur Verfügung. Im langjährigen Mittel steht klimatisch bedingt lediglich ein nutzbares Dargebot in einer Größenordnung von 6,5 bis 8,5 Mio. m³/a zur Verfügung. Talsperre
18 Das Wasserwerk Glüder bereitet das Rohwasser aus der Sengbachtalsperre zu Trinkwasser auf. Die Aufbereitung besteht aus drei Filterstufen. Die erste Filterstufe (Vorfiltration) reinigt das Rohwasser von Algen und Schwebstoffen. Anschließend wird ins Rohwasser ein Flockungsmittel (Polyaluminiumchlorid) dosiert, welches die Bildung von Partikelflocken fördert. In diesen Flocken werden die mikrobiologischen Bestandteile des Rohwassers gebunden und anschließend über die Filterstufe I ausfiltriert. In der Filterstufe II wird das weiche Wasser durch die Passage von Jurakalk aufgehärtet. Am Ende der Aufbereitung wird dem Trinkwasser noch Chlordioxid zu dosiert als Schutz vor Wiederverkeimung im Rohrnetz. Bei Bedarf steht eine Pulveraktivkohleanlage zur Verfügung. Diese kommt dann zum Einsatz, wenn Toxine oder Kohlenwasserstoffe ins Rohwasser gelangt sind. Sollte es zu starker Manganbildung im Rohwasser kommen, kommt die Kaliumpermanganatanlage zum Einsatz (seit 2013 war kein Einsatz notwendig). Die Aufbereitungsschemata der von den SW Solingen betriebenen Aufbereitungsanalgen im WW Glüder (maximal m³/tag) und im WW Baumberg (maximal m³/tag) sind in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt. Abb. 2.5: Fließschema Wasseraufbereitung Wasserwerk Glüder der Stadtwerke Solingen GmbH (Anlage 7.0)
19 Abb. 2.6: Fließschema Wasseraufbereitung Wasserwerk Baumberg der WW Baumberg GmbH (Anlage 7.2)
20 Eigenversorger / private Trinkwasserversorgung Die innerhalb der Stadt Solingen vorhandenen privaten Brunnen sind in der Abbildung 2.7 dargestellt und in Tabelle 3 aufgeführt. Insgesamt werden aktuell 62 private Brunnenanlagen, vor allem im Rand und Außenbereich der Siedlungen, für Trinkwasser betrieben. Die Überwachung der Eigenversorger obliegt den zuständigen Behörden bei der Stadt Solingen. Abb. 2.7: Übersichtsplan private Trinkwasserversorger / Eigenversorger (Anlage 7.3)
21 Tab. 3: Übersicht private Trinkwasserversorger / Eigenversorger (Auszug)
22 Trinkwasserbezug aus dem Wasserwerk Darbringhausen-Bremen (BTV) und Wasserwerk Schürholz (WVV) Das Wasserwerk Fernwasserversorgung Große Dhünn-Talsperre (Wasserwerk Dabringhausen-Bremen) wird von der Wuppertaler Stadtwerke (WSW) im Namen des Wupperverbands betrieben. Das Rohwasser kommt von der Trinkwassertalsperre Große Dhünn-Talsperre welche dem Wupperverband gehört. Das Wasserwerk Dabringhausen-Bremen hat eine stündliche Aufbereitungskapazität von max m³ (notfalls max m³). Von dort beziehen die Stadtwerke Solingen jährlich 6,3 Mio. m³ Trinkwasser. Das Aufbereitungsschema des WW-Dabringhausen Bremen ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Abb. 2.8: Fließschema Wasseraufbereitung Wasserwerk Dabringhausen Bremen der BTV GmbH (Anlage 7.4) (Quelle: Beschreibung Aufbereitung WW Schürholz vom WVV Das Aufbereitungsschema vom WW Schürholz des WVV ist in der folgenden Abbildung 2.9 dargestellt (Quelle: In Anpassung an die Rohwasserqualität aus der Großen Dhünn - Talsperre und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Qualitätsanforderungen an das Trinkwasser wurde die Aufbereitungsanlage in den Jahren 1985 bis 1990 auf eine dem Stand der Technik erforderliche Trinkwasseraufbereitungsanlage einschließlich einer Filterrückspülwasser - Reinigungsanlage erweitert. Die Inbetriebnahme erfolgte im Juli Zur Aufbereitung des Rohwassers verfügt das WW Schürholz über eine Kapazität von 500 bis 2000 m³ pro Stunde. Die Stadtwerke Solingen beziehen vom WW Schürholz bedarfsgesteuert im Mittel etwa m³/a
23 Die bei der Trinkwasseraufbereitung anfallenden Filterrückspülwässer werden in einer gesonderten Reinigungsanlage aufbereitet. Unter ständiger Kontrolle wird das entstandene Klarwasser in den Vorfluter (Eifgenbach) eingeleitet. Der anfallende Dünnschlamm wird kontrolliert landwirtschaftlich verwertet bzw. kann in den Kanal eingeleitet werden. Abb. 2.9: Fließschema Wasseraufbereitung Wasserwerk Schürholz des WVV (Anlage 7.5) (Quelle:
24 2.3 Organisation der Wasserversorgung Der Wasserversorger der Stadt Solingen ist der Eigenbetrieb Wasserversorgung Solingen (EBW). Er hat das ausschließliche Recht zur unmittelbaren Wasserversorgung auf dem Gebiet der Stadt Solingen. Der EBW hat das Trinkwassernetz (Transport und Verteilung inkl. Hausanschlüsse) gepachtet. Das aufbereitete Trinkwasser bezieht er von den Stadtwerken Solingen GmbH (SW SG). Die SW SG ist vom EBW mit der Erweiterung, der Instandhaltung und der Betriebsführung des Trinkwassernetzes beauftragt. Abb. 2.10: Organisation der Trinkwasserversorgung in Solingen 2.4 Rechtliche/Vertragliche Rahmenbedingungen In Tabelle 4 sind die vorliegenden wasserrechtlichen Zulassungen für die Entnahme von Grundwasser/Oberflächenwasser zu Zwecken der öffentlichen Trinkwasserversorgung in Solingen und die wesentlichen Inhalte (Befristung, Begünstigte, zulässige Entnahmemenge, wesentliche Auflagen und Nebenbestimmungen) aufgeführt
25 Tab. 4: Wasserrechte für die öffentliche Trinkwasserversorgung Solingen Wassergewinnung Rechtsinhaber Aktenzeichen Wasserrechte rechtlich und vertraglich zur Verfügung stehende Wassermengen [m³/a] Befristung Wesentliche Auflagen WG Baumberg WW Baumberg GmbH (Notwassermenge) 2027 Monitoring WG Hilden-Karnap WW Baumberg GmbH /99 u ME - 06/ Monitoring Sengbachtalsperre Große Dhünn- Talsperre SW Solingen GmbH BTV (Zielabnahmemenge) / * 2028 Liefervertrag Große Dhünn- Talsperre WVV (Mittelwert) Liefervertrag rund (bedarfsgesteuert) * Das Wasserrecht an der Sengbachtalsperre steht in dieser Höhe nur in niederschlagsreichen Jahren bei gleichzeitiger Überleitung von bis zu 2,5 Mio. m³/a Rohwasser aus der Vorsperre Große Dhünn zur Verfügung. Im langjährigen Mittel steht klimatisch bedingt lediglich ein nutzbares Dargebot in einer Größenordnung von 6,5 bis 8,5 Mio. m³/a zur Verfügung. Abbildung 2.11 zeigt die aktuelle Versorgungssituation schematisch. Abb. 2.11: Schematische Übersicht Wasserversorgung im Versorgungsgebiet der SW Solingen GmbH (Anlage 11)
26 Die bestehenden Lieferverträge der SW Solingen GmbH bzw. der Wasserwerk Baumberg GmbH an andere Wasserversorger außerhalb des Stadtgebiets Solingen - sind in Tabelle 5 zusammengestellt. Tab.5: Lieferverträge der bzw. WW Baumberg GmbH mit anderen Wasserversorgungsunternehmen (WVU) Vertragspartner SW Solingen GmbH SW Haan GmbH SW Solingen GmbH VWW Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG WW Baumberg GmbH SW Hilden GmbH Vertragliche Trinkwassermenge Bemerkung 2,5 Mio. m³/a Talsperrenwasser 1,0 Mio. m³/a Grundwasser, mind. 50 % WG Hilden-Karnap, Zielwert: 70 % WG Hilden-Karnap 5,0 Mio. m³/a Grundwasser
27 2.5 Qualifikationsnachweise/Zertifizierung Abb. 2.12: TSM Bestätigung gemäß DVGW Arbeitsblatt W 1000 (Anlage 13)
28 2.6 Absicherung der Versorgung In Kapitel 2.1 wurde bereits erwähnt, dass fast ganz Solingen mit Trinkwasser aus Oberflächenwasser versorgt wird. Dies ist der Situation geschuldet, dass das Wasserwerk Baumberg eine kleine Menge (ca. 0,1 0,2 Mio. m³ pro Jahr) in Ohligs einspeist. Der Grund dafür ist in der Versorgungssicherheit zu finden. Sollte eine Talsperre länger nicht zur Verfügung stehen, so kann über eine Transportleitung (vom Wasserwerk Baumberg nach Solingen) ca. 1/3 von Solingen mit Trinkwasser aus Grund-/Uferfiltratwasser versorgt werden. Da eine Transportleitung ständig in Betrieb sein muss - sonst besteht Verkeimungsgefahr -, fließt eine kleine Menge stetig in den Ohligser Westen (Bereich Langhansstraße / Bonner Str.). Ebenso ist es möglich, dass Langenfeld oder Hilden bei Bedarf Trinkwasser aus Oberflächenwasser erhalten kann. Darüber hinaus können sich die beiden Haupteinspeisungen (BTV-Bezug und WW-Glüder) gegenseitig (bis zu 3 Monate) kompensieren. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass keine weiteren Beeinträchtigungen in den Aufbereitungssystemen bestehen. Tab. 6: Absicherungen der Trinkwasserversorgung Solingens Art der Absicherung Erhöhung Einspeisung aus dem WW Baumberg Erhöhung Bezug BTV Erhöhung Rohwassermenge WW Glüder Ersatz für Ausfall Sengbachtalsperre / WW Glüder bis zu 3 Monate Ausfall Sengbachtalsperre / WW Glüder Ausfall Trinkwasser-Bezug vom BTV: Überleitung von Rohwasser aus der Vorsperre Große Dhünn in das Einzugsgebiet der Sengbachtalsperre bei Ausfall der Großen Dhünn oder der Trinkwasseraufbereitung im WW Dabringhausen Was passiert, wenn die Sengbachtalsperre einmal zu leer ist? Auch für den Fall ist Vorsorge getroffen worden. Durch eine Vertragsbeziehung mit dem WVV und einem Leitungsverbund bis zur Kleinen Dhünntalsperre (Vorsperre der Großen Dhünntalsperre), kann bei Bedarf Rohwasser in die Sengbachtalsperre übergeleitet werden. Pro Jahr können so bis zu 2,5 Mio m³ Rohwasser übergeleitet und im Wasserwerk Glüder zu Trinkwasser aufbereitet werden
29 2.7 Besonderheiten Siehe Aktuelle Wasserabgabe und Wasserbedarf 3.1 Wasserabgabe (Historie) Die Darstellung der Entwicklung der Wasserabgabe der vergangenen Jahre ist für Solingen in der Abbildung 3.1 enthalten. Abb. 3.1: Grafik Wasserabgabe (Historie). Durch den linearen Tarif für alle Kunden, gibt es keine Differenzierung nach Kundengruppen
30 Förder-/Bezugsmenge [m³/a] Wasserversorgungskonzept Stadt Solingen In Abbildung 3.2 sind die Eigenfördermengen (Sengbachtalsperre) und die Bezugsmengen (BTV und WVV) der SW Solingen GmbH dargestellt. Maximal wurden insgesamt rund 12,0 Mio. m³/a Wasser im Zeitraum 2003 bis 2013 gefördert bzw. über Fremdbezug bereitgestellt. Die Differenz zu der Wasserabgabe (Abb. 3.1) erklärt sich durch die Abgabe an die SW Haan (bis zu 2,5 Mio. m³/a) und die Wasserverluste sowie den Eigenbedarf der SW Solingen Sengbachtalsperrer BTV WVV Abb. 3.2: Eigenförderung und Bezugsmengen der SW Solingen GmbH
31 3.2 Prognose Wasserbedarf Für die Stadt Solingen ergibt sich die in Abbildung 3.3 dargestellte Prognose des Trinkwasserbedarfs. Dieser Prognose liegt die Bevölkerungsprognose bis 2040 für die Stadt Solingen zu Grunde. Der Wasserbedarf für die SW Solingen liegt deutlich darüber und berücksichtigt zusätzlich folgende Bedarfs- und Liefermengen: Trinkwasserlieferung an die SW Haan gem. Liefervertrag Eigenbedarf und Wasserverluste in der gleichen Größenordnung wie 2003 bis In Tabelle 7 sind die einzelnen der Bedarfsprognose zu Grunde liegenden Posten aufgeführt. Abb. 3.3: Grafik Prognose Wasserbedarf Solingen der nächsten Jahre Tab. 7: Berechnung erwarteter Spitzenbedarf in 20 Jahren Bedarfsposten Prognose 2025 /2026 [m³/a] Prognose 2035/2036 [m³/a] Wasserabgabe Stadt Solingen Gleichbleibende Tendenz Lieferung an die SW Haan Vertragsabhängig Wasserverluste ca. 8-9% Gleichbleibende Tendenz Eigenbedarf Löschwasserbereitstellung In Wasserabgabe Stadt SG enthalten In Wasserverlusten enthalten. Summe
32 4 MENGENMÄßIGES WASSERDARGEBOT FÜR DIE BEDARFS- DECKUNG (WASSERBILANZ) SOWIE MÖGLICHE ZUKÜNFTIGE VERÄNDERUNGEN 4.1 Wasserressourcenbeschreibung Auf folgende Wasserressourcen kann in Solingen zurückgegriffen werden (vgl. auch Abschn. 2.1 bis 2.6): Oberflächenwasser der Wassergewinnung Sengbachtalsperre. Darüber hinaus bestehen Wasserrechtskontingente an der Großen (GDT)- und Kleinen (KDT) Dhünntalsperre. Aus der GDT dürfen 6,3 Mio m³ pro Jahr und aus der KDT dürfen 2,5 Mio m³ pro Jahr entnommen werden. In Hilden wird durch die das Wasserwerk Baumberg (WWB) mit den Wassergewinnungen Baumberg (Grundwasser und Uferfiltrat) und Hilden-Karnap (Grundwasser) betrieben. Das Wasserwerk Baumberg beliefert die Stadt Hilden mit Trinkwasser. Darüber hinaus erhält Langenfeld eine Teilmenge ihrer benötigten Wassermengen aus dem WWB. Bei Versorgungsengpässen aus der Sengbachtalsperre oder der GDT kann auch Solingen Trinkwasser aus dem WWB beziehen. Das WWB bereitet Uferfiltrat und Grundwasser auf Genutzte Ressourcen In den Abbildungen 4.1 bis 4.3 sind die Wasserschutzgebiete der von den Stadtwerken Solingen betriebenen Wassergewinnungen dargestellt. Im Wasserwerk Glüder wird Rohwasser aus der Sengbachtalsperre aufbereitet. Das Einzugsgebiet der Talsperre hat ein Wasserdargebot/Wasserrecht von 12,5 Mio m³ pro Jahr darin sind die 2,5 Mio m³ enthalten, die aus der KDT übergeleitet werden dürfen. In 2016 ist durch die Bezirksregierung Köln eine Neuausweisung des Wasserschutzgebietes (Abb. 4.1) erfolgt. Die Geltungsdauer der Ausweisung ist unbefristet
33 Abb. 4.1: Übersichtskarte Wasserschutzgebiet Sengbachtalsperre (Anlage 19.1) Die Wasseraufbereitungsanlage WW-Baumberg, bezieht aus zwei verschiedenen Brunnenanlagen - WG Baumberg und WG Hilden-Karnap - ihr Rohwasser. Die eine Rohwassergewinnungsanlage liegt direkt am Rhein und fördert über zwei Horizontalfilterbrunnen Grundwasser aus dem ersten Stockwerk sowie Rheinuferfiltrat (Monheim Baumberg). Im Jahr 2000 ist eine Wasserschutzzone für dieses Gewinnungsgebiet durch die zuständige Bezirksregierung Düsseldorf festgesetzt worden (Abb. 4.2)
34 Abb. 4.2: Übersichtskarte Wasserschutzgebiet Baumberg (Anlage 19.2) Die Brunnenanlage im Bereich Hilden Karnap erschließt über fünf Vertikalfilterbrunnen das erste, lokal durch eine Tonschicht (Interglazial) geschützte, Grundwasserstockwerk und hatte bis zum ebenfalls ein festgesetztes Wasserschutzgebiet. Zur Zeit läuft das neue Festsetzungssverfahren bei der Bezirksregierung Düsseldorf, so dass momentan kein besonderer Schutz des Grundwassers für diese Trinkwassergewinnung besteht. In Abbildung 4.3 ist das geplante Wasserschutzgebiet dargestellt
35 Abb. 4.3: Geplantes Wasserschutzgebiet Hilden-Karnap (Stand: Oktober 2016), (Anlage 19.3) In Abbildung 4.4 sind die aktuellen Einzugsgebiete (Stichtag April 2016) der WG Baumberg und der WG Hilden-Karnap mit den bestehenden bzw. geplanten Wasserschutzgebieten dargestellt. Daraus wird deutlich, dass das Wasserrecht für die WG Baumberg nur anteilig ausgenutzt wird. Dies ist zum einen in der wasserrechtlich abgesicherten Notwassermenge von 2,7 Mio. m³/a begründet. Zum anderen in dem angestrebten Mischungsverhältnis von 30 zu 70 % mit dem Grundwasser der WG Hilden-Karnap
36 Abb. 4.4: Aktuelle Einzugsgebiete WG Baumberg und beantragtes WG Hilden-Karnap (April 2016), Anlage 19.4 Wasserschutzgebiet Große-Dhünn-Talsperre In Abbildung 4.5 ist das festgesetzte Wasserschutzgebiet für die Große Dhünn Talsperre dargestellt. Das Einzugsgebiet der Große Dhünn Talsperre umfasst rund 60 km² (Wasserschutzzone). Ihr Speichervermögen liegt bei 81 Mio. m³, die nutzbare Rohwassermenge pro Jahr bei insgesamt 42 Mio. Davon beziehen neben der Stadtwerke Solingen (bis zu 6,3 Mio. m³ Trinkwasser pro Jahr) auch die Wuppertaler Stadtwerke (WSW), die EWR GmbH (Remscheid) und die Energieversorgung Leverkusen (EVL) sowie der Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper Trink- und Rohwasser für ihre Versorgungsgebiete. Die Geltungsdauer der Wasserschutzgebietsverordnung für die Große Dhünn Talsperre ist unbefristet gemäß 35 Absatz 1 Satz 2 i.v.m. 125 Absatz 4 Satz 2 des Landeswassergesetzes LWG in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926/SGV. NRW. 77), neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S.559 ff.)
37 Abb. 4.5: Übersichtskarte Wasserschutzgebiet Große Dhünn Talsperre (Quelle: Wupperverband, FluGGS) (Anlage 19.5) Ungenutzte Ressourcen Alternative Grundwasserstockwerke, die aus quantitativer Sicht für eine Rohwassergewinnung zur öffentlichen Trinkwasserversorgung geeignet wären, stehen im Bereich der WG Baumberg und WG Hilden-Karnap nicht zur Verfügung. Da unterhalb der genutzten quartären Terrassensedimente bereits die geringer durchlässigen tertiären Schichten (sog. Grafenberg Schichten) mit einer von Osten nach Westen zunehmenden Mächtigkeit über dem devonischen Grundgebirge folgen. Jedoch ist an der WG Baumberg im Wasserrecht und bei der Schutzgebietsausweisung die Notversorgung mit einer Menge von 2,7 Mio. m³/a bilanziell berücksichtigt worden. Weitere ungenutzte Rohwasserressourcen sind im Gemeindegebiet Solingen nicht vorhanden, aufgrund der geologischen Verhältnisse, überwiegend devonisches Grundgebirge mit geringmächtigen Lockergesteinsüberdeckungen, sind hier keine für die öffentliche Trinkwassergewinnung geeigneten Grundwasservorkommen vorhanden
38 4.2 Wasserbilanz Nachfolgend sind die Wasserbilanzen für die drei von den SW Solingen betriebenen Gewinnungsgebiete WG Baumberg, WG Hilden-Karnap und Sengbachtalsperre tabellarisch aufgeführt. Dabei wurden die Dargebotsermittlungen aus den jeweiligen Wasserrechtsanträgen zugrunde gelegt und soweit erforderlich aktualisiert. Die Komponenten und Bilanzgrößen des Grundwasserdargebots in den Einzugsgebieten der WG Hilden-Karnap und der WG Baumberg sind die flächenhafte Grundwasserneubildung durch Versickerung von Niederschlägen, die Infiltration von Oberflächenwasser aus Bächen in den Grundwasserleiter und für die WG Baumberg das Uferfiltrat des Rheins Neben den zugelassenen und tatsächlichen Entnahmemengen wurden auch die Entnahmen Dritter bei der Bilanzierung berücksichtigt. Betrachtet wurden bei der Bilanzierung die maximalen wasserrechtlichen Einzugsgebiete, die den in Abschnitt 4.1 dargestellten Wasserschutzgebieten entsprechen. Außerdem wurden ungünstige hydrologische Verhältnisse angesetzt (Niedrigwasser) bzw. für die Sengbachtalsperre unterschiedliche hydrologische Situationen dargestellt. WG Baumberg Das maximale wasserrechtliche Einzugsgebiet der WG Baumberg ist rd. 7 km² groß. Innerhalb dieses Einzugsgebietes ergibt sich die in Tabelle 8 zusammengefasste Wasserbilanz. Tab. 8: Wasserbilanz im Einzugsgebiet der WG Baumberg Dargebotskomponente flächenhafte Grundwasserneubildung aus Niederschlagsversickerung Wassermenge [m³/a] Dargebot durch Infiltration aus Oberflächengewässern Summe Grundwasserneubildung Uferfiltrat Rhein abzüglich Entnahmen Dritter < gesamtes Dargebot genehmigtes Wasserrecht Bilanzüberschuss (rechnerisch) ausgeglichen Bei mittleren und niedrigen Grundwasserverhältnissen und wasserrechtlicher Entnahme liegt der Ufer- bzw. Sohlfiltratanteil zwischen 60 und 70 %
39 Da der Uferfiltratanteil an dem an der WG Baumberg geförderten Rohwasser abhängig vom Rheinwasserstand, Grundwasserstand und der tatsächlichen Fördermenge variiert, ist der Zusammenhang zwischen Anteil Jahresfördermenge und der genehmigten Fördermenge im Vergleich mit dem Flächenanteil des jeweils aktuellen Einzugsgebietes mit dem maximalen wasserrechtlichen Einzugsgebiet variabel (vgl. auch Abbildung 4.4). Entscheidend für die Bilanzbetrachtung im Wasserschutzgebiet Baumberg ist jedoch, dass die Wasserbilanz auch unter Berücksichtigung der genehmigten Notwasserentnahmen für das Versorgungsgebiet der SW Solingen ausgeglichen ist (vgl. Tab. 8). WG Hilden-Karnap Das maximale wasserrechtliche Einzugsgebiet der WG Hilden-Karnap ist rd. 13,7 km² groß. Innerhalb dieses Einzugsgebietes ergibt sich die in Tabelle 9 zusammengefasste Wasserbilanz. Tab. 9: Wasserbilanz im Einzugsgebiet der WG Hilden-Karnap (Niedrigwasser) Dargebotskomponente flächenhafte Grundwasserneubildung aus Niederschlagsversickerung Wassermenge [m³/a] Dargebot durch Infiltration aus Oberflächengewässern Summe Grundwasserneubildung abzüglich Entnahmen Dritter gesamtes Dargebot genehmigtes Wasserrecht Bilanzüberschuss (rechnerisch) Mit der Förderung im Normalbetrieb wird das Wasserrecht für die WG Hilden Karnap zu ca. 65 % ausgenutzt. Dies zeigt sich auch beim Vergleich der Abgrenzung der aktuellen Einzugsgebiete (Stichtagsmessung) in den Monitoringberichten mit dem maximalen wasserrechtlichen Einzugsgebiet (s. Abb. 4.4). Die aktuellen Einzugsgebiete liegen immer innerhalb des maximalen wasserrechtlichen Einzugsgebietes und umfassen i.d.r. eine dem Förderanteil entsprechende Fläche. Die Wasserbilanz für das geplante Wasserschutzgebiet ist auch unter Berücksichtigung niedriger Grundwasserstände und Ausnutzung der maximal zugelassenen Jahresentnahme ausgeglichen. Sengbachtalsperre Das oberirdische Einzugsgebiet der Sengbachtalsperre ist rd. 11,8 km² groß. Das zur Verfügung stehende Wasserdargebot der Sengbachtalsperre ist von der Niederschlagsentwicklung unmittelbar abhängig. Aufgrund der geologischen Verhältnisse spielt der unterirdische Abfluss und Grundwasserneubildung nur eine untergeordnete Rolle für das Dargebot der Sengbachtalsperre
40 Aus der Auswertung der Niederschlagsdaten, der Zuflüsse zur Sengbachtalsperre und der Rohwasserförderung können die minimalen und maximalen Dargebotsmengen abgeleitet werden. Zusammenfassend ist das Wasserdargebot im Einzugsgebiet der Sengbachtalsperre wie folgt zu beschreiben: Für das langjährige mittlere Wasserdargebot aus den natürlichen Zuflüssen zur Sengbachtalsperre kann eine Größenordnung von etwa 6,0 bis 8,5 Mio. m³/a in Normaljahren angegeben werden. Unter Berücksichtigung extremer klimatischer Verhältnisse ergibt sich für Trockenjahre im Einzugsgebiet bislang ein minimales natürliches Wasserdargebot aus den Zuflüssen zur Sengbachtalsperre von etwa 4,5 Mio. m³/a. Für Jahre mit überdurchschnittlichen Niederschlägen erhöht sich das natürliche Wasserdargebot im Einzugsgebiet der Sengbachtalsperre auf etwa 9,0 bis 10,0 Mio. m³/a. Durch die vertraglich abgesicherte Möglichkeit zur Überleitung von Rohwasser aus der Vorsperre Große Dhünn kann das natürliche Wasserdargebot an der Sengbachtalsperre / WW Glüder um 2,5 Mio. m³/a erhöht werden. Damit steht an der Sengbachtalsperre ein maximal nutzbares Rohwasserdargebot von bis zu 12,5 Mio. m³/a, unter Berücksichtigung der Überleitung aus der Vorsperre Große Dhünn zur Verfügung. 4.3 Entwicklungsprognose des quantitativen Wasserdargebots unter Berücksichtigung möglicher Auswirkungen des Klimawandels Die Oberflächenwasserressourcen sind stärker von der klimatischen Entwicklung und der Niederschlagsverteilung abhängig. In den letzten Jahren waren insbesondere eine Häufung von Trockenjahren sowie die Verschiebung der Winterniederschläge und damit zusammenhängend eine ausbleibende bzw. geringe Grundwasserneubildung und fehlende Wiederauffüllung der Talsperren zu beobachten. Im Rahmen der Aktualisierung des gemeinsamen Bedarfsnachweises für die Wasserwerk Baumberg GmbH und die im Jahr 2014 sind diese Auswirkungen mit dem schwankenden Dargebot der Trinkwassertalsperren Sengbachtalsperre und Große Dhünn bzw. der Ausfall einer oder beider Talsperren über einen Zeitraum von bis zu 3 Monaten berücksichtigt und als Versorgungsszenarien betrachtet worden. Dass der Ausfall z.b. der Sengbachtalsperre ein realistisches Szenario ist, hat sich z.b. im Jahr 2013 gezeigt. In diesem Jahr ist in der Sengbachtalsperre eine Blüte der Burgunderblutalge aufgetreten. Diese bildet das Toxin
41 Microcystin, welches die Verwendung des Rohwassers für Trinkwasser vorübergehend unmöglich machte. Daher konnte die Sengbachtalsperre für den Zeitraum der Algenblüte nicht für die Trinkwasserversorgung genutzt werden. Szenario 1: klimatisches Normaljahr In mittleren, klimatisch normalen Jahren (Szenario 1) steht an der Sengbachtalsperre ein nutzbares Wasserdargebot von rund 8,5 Mio. m³/a zur Verfügung. Szenario 2: klimatisches Trockenjahr Im Szenario 2 wird von einem sehr trockenen Jahr ausgegangen, in dem an der Sengbachtalsperre wie beispielsweise im Wasserwirtschaftsjahr 1995/1996 als nutzbares Wasserdargebot nur etwa 4,5 Mio. m³ zur Verfügung stehen. Szenario 3: Ausfall der Sengbachtalsperre über 3 Monate im klimatischen Normaljahr Der Ausfall der Sengbachtalsperre für einen Zeitraum von 3 Monaten pro Jahr wird in Szenario 3 betrachtet. Dazu wird ein Viertel des Dargebots eines klimatischen Normaljahres vom langjährigen mittleren Gesamtdargebot von rund 8,5 Mio. m³/a abgezogen. Szenario 4: Ausfalls der Wasserlieferung vom BTV über 3 Monate im klimatischen Normaljahr Für den Ausfall der Wasserlieferung vom BTV wird bei Szenario 4 ein Viertel der jährlichen Liefermenge des angestrebten Gesamtbezugs vom BTV von rund 6,3 Mio. m³/a abgezogen. Szenario 5: Gleichzeitiger Ausfall beider Talsperren über 3 Monate im klimatischen Normaljahr Für den Ausfall beider Talsperren über einen Zeitraum von 3 Monaten wird beim Szenario 5 ein Viertel des mittleren, langjährigen Dargebots eines klimatischen Normaljahres vom Gesamtdargebot von rund 8,5 Mio. m³/a der Sengbachtalsperre und ein Viertel der Bezugsmenge des angestrebten Gesamtbezugs vom BTV von rund 6,3 Mio. m³/a abgezogen. Szenario 6: Ausfall der Wasserlieferung vom BTV über 3 Monate im klimatischen Trockenjahr Im Szenario 6 wird ein Viertel der Liefermenge des angestrebten Gesamtbezugs vom BTV von rund 6,3 Mio. m³/a abgezogen und das nutzbare Wasserdargebot an der Sengbachtalsperre für Trockenjahre von 4,5 Mio. m³/a angesetzt
42 Wasserdargebot [m³/a] Wasserversorgungskonzept Stadt Solingen Ergebnisse der Variantenbetrachtung Szenario 1 bis 6 In Abbildung 4.6 sind die für die sechs betrachteten Szenarien zur Verfügung stehenden Wassermengen graphisch dem Bedarf der SW Solingen GmbH und der WW Baumberg GmbH gegenübergestellt (vgl. Abschn. 3.2). Das Wasserrecht an der WG Baumberg wurde in die bewilligte Entnahmemenge von 4,3 Mio. m³/a und die zur Notversorgung zur Verfügung stehende Entnahmemenge von 2,7 Mio. m³/a aufgeteilt WR Baumberg Notversorgung Baumberg WR Hilden-Karnap Dargebot Sengbachtalsperre Lieferung BTV Lieferung WVV Gesamtwasserbedarf inklusive Lieferverträge: rd. 22 Mio. m³/a Fördermengen, Bezug inkl. 15 % Sicherheit (Basis Jahre ) Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Szenario 4 Szenario 5 Szenario 6 Abb. 4.6: Gegenüberstellung Wasserbedarf und Versorgungsszenarien für die SW Solingen GmbH und die WW Baumberg GmbH Abbildung 4.6 ist zu entnehmen, dass in einem Normaljahr (Szenario 1) ein deutlicher Bilanzüberschuss des Wasserdargebots im Vergleich zum Wasserbedarf von rechnerisch bis zu 5,0 Mio. m³/a vorliegt. In einem Trockenjahr fällt der rechnerische Überschuss im Vergleich zum Normaljahr deutlich geringer aus (Szenario 2). In einem Trockenjahr mit einem theoretischen dreimonatigen Ausfall der Trinkwasserlieferung durch den BTV kann der Gesamtbedarf rechnerisch nicht mehr (ganz) zu 100 % gedeckt werden. Innerhalb des BTV werden seit einigen Jahren Überlegungen geführt, wie die Versorgungssicherheit im Verbundgebiet erhöht werden kann. Anlass dafür ist u.a. die Füllstandsentwicklung der Großen-Dhünntalsperre in den Jahren 2013 / 2014 und Ende 2016 / 2017 sowie der temporäre Ausfall einzelner Talsperren z.b. durch Algenblüten (Burgunderblutalge) oder Havarien im Einzugsgebiet (z.b. Neyetalsperre). Eine Option dabei ist, die Eschbach- und die Neye
43 talsperre der Energie und Wasser für Remscheid (EWR) GmbH als Trinkwasserressourcen zu sichern und in einen Rohwasserverbund einzubinden. Durch den Wupperverband und den EWR (Energie und Wasser Remscheid GmbH) werden derzeit die Möglichkeiten und Anforderungen an Rohwasserüberleitungen aus der Neye- und Eschbach-Talsperre in das Einzugsgebiet der Großen Dhünn-Talsperre aus qualitativer und quantitativer Sicht geprüft. Mit der Einbindung weiterer Rohwasserressourcen in das Verbundsystem im Bereich der BTV und des WVV könnte zukünftig Engpässen in der quantitativen und auch qualitativen Bereitstellung von ausreichenden Trinkwasserressourcen im Bereich des Bergischen Landes früher entgegengesteuert und damit kritischen Versorgungssituationen (wie z.b. Reduzierung der Bezugsmengen der BTV-Partner) in Teilen des aus der Große Dhünn Talsperre belieferten Versorgungsverbundes besser beherrscht bzw. bereits in der Entstehung entgegengewirkt werden
44 5 ROHWASSERÜBERWACHUNG / TRINKWASSERUNTERSUCHUNG UND BESCHAFFENHEIT ROHWASSER / TRINKWASSER 5.1 Überwachungskonzept Rohwasser und Probenahmeplan Trinkwasser Trinkwasser Die Probenahmepläne und die Probenahmestellen im Netz für Trinkwasser sind in den Abbildungen 5.1 und 5.2 dargestellt. Die Probenahmehäufigkeit des Trinkwassers richtet sich nach den Vorgaben der Trinkwasserverordnung und sind mit dem Stadtdienst Gesundheit abgestimmt worden. Abb. 5.1: Untersuchungshäufigkeiten Trinkwasser (Auszug)
45 Abb. 5.2: Plan Trinkwasser Netzprobenahmestellen (Anlage 24)
46 Rohwasser Die Untersuchungen des Rohwassers in den Einzugsgebieten der WG Baumberg und WG Hilden-Karnap erfolgen gem. der Nebenbestimmungen der jeweiligen Bewilligungsbescheide in einem abgestimmten Untersuchungsumfang, der die Rohwasserüberwachungsrichtlinie nach 50 LWG, die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2011) sowie die Vor-Ort-Verhältnisse berücksichtigt. Im Grundwasser werden halbjährliche Beprobungskampagnen mit einem abgestuften Parameterumfang durchgeführt. In Dokumentation 2 sind der Parameterumfang und die Untersuchungshäufigkeit aufgeführt. In den Abbildungen 4.2 und 4.3 (siehe Kap ) sind die beprobten Grundwassermessstellen in den beiden Einzugsgebieten dargestellt. Abb. 5.3: Einzugsgebiete WG Baumberg und Karnap (alt) (Anlage 19.4)
47 Im Einzugsgebiet der Sengbachtalsperre werden die Vorfluter und die Vorsperre (s. Abb. 5.5) monatlich beprobt und untersucht. Das Rohwasser im Hauptbecken der Sengbachtalsperre wird wöchentlich tiefenspezifisch beprobt. Abb. 5.5: Probenahmestellen Einzugsgebiet Sengbachtalsperre (Anlage 26)
48 5.2 Beschaffenheit von Rohwasser und Trinkwasser Trinkwasser Hier ein Auszug aus der aktuellen Trinkwasseranalyse (2016) für Solingen: Abbildung 5.6: Auszug aus der TW-Analyse 2016 (Anlage 27) Rohwasser WG Baumberg Die Anlage 5.7 enthält die Ganglinien der Rohwasserbeschaffenheit für die Parameter Leitfähigkeit, Gesamthärte, Sulfat, Chlorid und Nitrat jeweils für den gesamten Beobachtungszeitraum (1988 bis 2016). Diese Parameter werden als Leitparameter für das Rohwasser der WG Baumberg betrachtet und dienen in den Monitoringberichten als Qualitätsindikatoren zur Beurteilung der Roh- und Grundwasserqualität bzw. deren Entwicklung. In Tabelle 10 sind statistische Auswertungen der o. g. Leitparameter für den gesamten Beobachtungszeitraum von 1982 bis 2016 sowie für das Wasserwirtschaftsjahr (WWJ) 2015/2016 dargestellt
49 Tab. 10: Übersicht Rohwasserbeschaffenheit WG Baumberg Parameter Einheit Statistische Werte Statistische Werte 2015/2016 n Min Max Mittelwert n Min Max Mittelwert Leitfähigkeit [µs/cm] , ,8 Härte (ges.) [ dh] ,1 23,3 17, ,8 19,6 17,2 Chlorid [mg/l] , , , ,3 Sulfat [mg/l] , ,6 60,1 54,2 Nitrat [mg/l] ,3 48,7 23, ,8 27,3 24,3 Die Parameter (Maximalwert) liegen im WWJ 2015/2016 alle deutlich unterhalb der hilfsweise für die Beurteilung herangezogenen Grenzwerte der TrinkwV. Zusammenfassend zeigt die Rohwasserbeschaffenheit an der WG Baumberg in 2016 keine wesentlichen Änderungen zu den Vorjahren. Es kann festgestellt werden, dass für die Parameter Leitfähigkeit, Chlorid und Sulfat der maximal gemessene Wert in 2016 unter dem langjährigen Mittel liegt (vgl. Tab. 10). Damit wird die leicht abnehmende Tendenz in der langjährigen Entwicklung für diese Parameter, wie sie in Anlage 5.6 zu erkennen ist, bestätigt. Für die Parameter Härte (ges.) und Nitrat liegen die Maximalwerte von 2016 dagegen über dem langjährigen Mittel. Die Ganglinie in Anlage 5.6 für den Parameter Nitrat zeigt auch eher stagnierende oder sogar leicht steigende Gehalte. PBSM Die im Herbst 2016 durchgeführten Analysen auf PBSM im Rohwasser zeigen keine Konzentrationen oberhalb der jeweiligen Bestimmungsgrenzen. Die Konzentration der Metaboliten des Pflanzenschutzmittels Chloridazon lag bezüglich Desphenylchloridazon bei 2,48 µg/l (Br. I) bzw. bei 3,16 µg/l (Br. II). Im Vergleich zum Vorjahr (Br. I: 2,7 µg/l und Br. II: 3,0 µg/l) ist die Konzentration im Brunnen I leicht zurückgegangen und im Brunnen II leicht angestiegen. Die Konzentration an Methyl-Desphenylchloridazon lag bei 0,66 µg/l (Br. I) bzw. bei 0,70 µg/l (Br. II). Im Vergleich zum Vorjahr (Br. I: 0,77 µg/l und Br. II: 0,74 µg/l) ist die Konzentration in beiden Brunnen leicht zurückgegangen. Zur Bewertung dieser Metaboliten wird der gesundheitliche Orientierungswert (GOW) von 3 µg/l aus der Empfehlung des Umweltbundesamtes herangezogen (entsprechend ahu-schwellenwert). Die Messwerte der Metaboliten des Pflanzenschutzmittels Chloridazon lagen für Brunnen I unterhalb des GOW von 3 µg/l. Das Rohwasser von Brunnen II hat für den Metaboliten Desphenylchloridazon den GOW leicht überschritten und für Methyl- Desphenylchloridazon deutlich unterschritten
50 Bakteriologische Beschaffenheit des Rohwassers Die Koloniezahlen bei Bebrütungstemperaturen von 22 C und 36 C lagen für das Rohwasser der WG Baumberg im WWJ 2015/2016 durchgehend deutlich unterhalb der Grenzwerte der TrinkwV (2003) von 100 KBE/ml (22 C) und 20 KBE/ml (36 C). In der neuen TrinkwV (2011) werden die allgemeinen mikrobiologischen Parameter (Koloniezahlen) nicht mehr mit Grenzwerten belegt, sondern nur darauf verwiesen, dass die Koloniezahlen keinen anormalen Veränderungen unterliegen dürfen. Der mikrobiologische Indikatorkeim Escherichia Coli ist im Rohwasser der WG Baumberg im WWJ 2015/2016 nicht nachgewiesen worden. Auch die mikrobiologischen Untersuchungen bezüglich Enterokokken, Coliforme Keime und Clostridium perfringens des Rohwassers der WG Baumberg im WWJ 2015/2016 führten zu keinem Nachweis. In der neuen TrinkwV (2011) sind nur noch die mikrobiologischen Parameter Escherichia Coli und Enterokokken mit Grenzwerten belegt (0 KBE/100 ml). Grundwasserbeschaffenheit WG Baumberg Die Bewertung der Grundwasserqualität im Einzugsgebiet der WG Baumberg wird im Folgenden anhand der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie mittels der von der ahu AG vorgeschlagenen Schwellenwerte (ahu 1990 und ahu 2002) durchgeführt. In Anlage 5.7 sind die Langzeitganglinien für ausgewählte Parameter enthalten. Die Messstellen östlich des Urdenbacher Altarms zeichnen sich durch deutlich erhöhte Gehalte an Eisen und Mangan aus, die z. T. erheblich über dem Grenzwert der TrinkwV liegen. Parallel dazu liegen hier geringe ph-werte vor, die unter dem in der TrinkwV angegebenen Bereich liegen. Die Messstellen westlich des Urdenbacher Altrheins dagegen zeigen bei den Parametern Eisen, Mangan und ph-wert nur sehr vereinzelte Grenzwertüberschreitungen. Die Nitratgehalte im Grundwasser im Bereich des Urdenbacher Altrheinarms bzw. westlich davon sind höher als im Grundwasser östlich des Urdenbacher Altrheinarms. Dies ist durch unterschiedliche Nutzungen in den beiden Bereichen und die reduzierenden Bedingungen im Grundwasser (s. o.) östlich des Urdenbacher Altrheinarms bedingt. Insgesamt ist hinsichtlich der Grundwasserbeschaffenheit im Einzugsgebiet der WG Baumberg festzuhalten, dass sich in 2016 keine wesentlichen Änderungen gegenüber den Vorjahren zeigen. Überschreitungen der Grenzwerte der TrinkwV weisen vor allem die Messstellen östlich des Urdenbacher Altrheins auf und zwar hinsichtlich der Parameter Eisen und Mangan. Einher damit gehen niedrige ph-werte. In den Messstellen westlich des Urdenbacher Altrheins dagegen treten nur vereinzelte Überschreitungen der TrinkwV- Grenzwerte bzw. des ahu-schwellenwerts auf. Auffällig sind hier vor allem die Analyseergebnisse hinsichtlich der bakteriologischen Beschaffenheit des Grundwassers, wo im Frühjahr vor allem Clostridium perfringens und in der Herbstbeprobung Coliforme Keime und Enterokokken erhöht waren
51 5.2.3 Rohwasser WG Hilden-Karnap In der Anlage 5.8 sind Ganglinien der Rohwasserbeschaffenheit für die Parameter Leitfähigkeit, Gesamthärte, Sulfat, Chlorid und Nitrat an der WG Hilden- Karnap jeweils für den gesamten Beobachtungszeitraum (seit 1993) dargestellt. Diese Parameter werden als Leitparameter für das Rohwasser der WG Hilden-Karnap betrachtet und in den Monitoringberichten als Qualitätsindikatoren zur Beurteilung der Roh- und Grundwasserqualität bzw. deren Entwicklungen herangezogen. Zusätzlich werden für die WG Hilden-Karnap die Parameter Eisen, Mangan und Nickel aufgrund der geogenen Bedingungen im Einzugsgebiet näher betrachtet. In Tabelle 11 ist eine Zusammenstellung der statistischen Werte der Rohwasseranalysen für die o. g. Leitparameter und weitere relevante Parameter bezogen auf das WWJ 2015/2016 sowie für den Zeitraum 1993 bis 2016 dargestellt. Tab. 11: Übersicht Rohwasserbeschaffenheit WG Hilden-Karnap Parameter Einheit Statistische Werte Statistische Werte 2015/2016 n Min Max Mittelwert n Min Max Mittelwert Leitfähigkeit [µs/cm] , ,7 Härte (ges.) [ dh] ,89 14,7 9,3 51 7,3 9,0 8,2 Chlorid [mg/l] , , ,9 26,9 24,8 Sulfat [mg/l] , , ,3 72,3 62,1 Nitrat [mg/l] ,7 38,6 15, ,2 16,6 15,3 Eisen [mg/l] ,01 0,5 51 0,0 1,7 0,2 Mangan [mg/l] ,01 0,5 0,2 51 0,1 0,2 0,1 Nickel [µg/l] ,1 4 7,0 10,0 8,3 Summe TRI und PER [µg/l] ,3 7,7 4 1,4 4,0 2,6 Die behelfsmäßig herangezogenen Grenzwerte der TrinkwV (2011) werden mit Ausnahme vom Parameter Eisen in 2015/2016 nicht überschritten (vgl. Tab. 11). Der maximale Eisengehalt im Mischrohwasser lag im WWJ 2015/2016 bei 1,7 mg/l und damit deutlich über dem TrinkwV-Grenzwert (2011) von 0,2 mg/l. Die Rohwasserbeschaffenheit (Rohmischwasser) zeigt im WWJ 2015/2016 keine bemerkenswerten Veränderungen zum Vorjahr. Tabelle 11 zeigt zudem, dass die Maximalwerte in 2015/2016 bei den meisten dargestellten Parametern unter dem langjährigen Mittel liegen. Ausnahmen stellen Nitrat, Eisen und Nickel dar. TRI und PER werden nur noch mit sehr geringen Gehalten nach
52 gewiesen und lagen im Mittel 2015/16 unterhalb des Grenzwertes der TrinkwV. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass für die Parameter Leitfähigkeit, Härte (ges.), Chlorid und Sulfat der maximal gemessene Wert in 2016 unter dem langjährigen Mittel liegt (vgl. Tab. 11). Damit wird die leicht abnehmende bzw. stagnierende Tendenz in der langjährigen Entwicklung für diese Parameter, wie sie in Anlage 5.8 zu erkennen ist, bestätigt. Für die Parameter Nitrat, Eisen und Nickel liegen die Maximalwerte von 2016 dagegen über dem langjährigen Mittel. Die Ganglinie in Anlage 5.8 für den Parameter Nitrat zeigt auch für die Brunnen VI und vor allem VII leicht steigende Gehalte. Auch die langjährige Entwicklung für den Parameter Eisen lässt steigende Gehalte für die letzten zwei Jahre vor allem für den Brunnen VIII erkennen, die deutlich über den Grenzwerten der TrinkwV liegen. Die Entwicklung der Nickel-Gehalte ist in allen vier Brunnen sehr unterschiedlich, mit leicht steigender Tendenz in den Brunnen VII und IX und stagnierender bzw. leicht fallender Tendenz in den Brunnen VI und VIII. Aufgrund der hohen Eisen- und Mangangehalte im Rohwasser des Brunnens VIII wird zur Sicherung der WG Hilden-Karnap im Frühjahr 2017 der Brunnen X im Bereich des ehem. Horizontalfilterbrunnens errichtet. Auswirkungen auf das Wasserrecht oder den maximalen Absenkbereich ergeben sich dadurch nicht. Der Brunnen VI wurde im Jahr 2016 regeneriert und anschließend gesichert, so dass er zunächst weiter als Sicherungsbrunnen gegenüber der DMS- Fahne im Grundwasser genutzt werden kann. Zur rechtlichen Absicherung der Einleitung des an Brunnen VI geförderten Rohwassers in den Karnaper Graben wurde nach Abstimmung der Zuständigkeit ein Einleitantrag im Februar 2015 bei der Bezirksregierung (BR) Düsseldorf vorgelegt. PBSM Bei den im Frühjahr und Herbst 2016 durchgeführten Analysen des Rohwassers der WG Hilden-Karnap auf PBSM lagen fast alle Einzelparameter gemäß den abgestimmten Untersuchungslisten unterhalb der jeweiligen Nachweisgrenzen. Eine Ausnahme stellt der Parameter DMS (N,N-Dimethylsulfamid) dar, der sowohl im Frühjahr als auch im Herbst 2016 im Brunnen VI mit 2,89 µg/l bzw. 3,54 µg/l oberhalb des gesundheitlichen Orientierungswerts (GOW) von 1 µg/l lag. Die Metaboliten Desphenylchloridazon und Methyl-Desphenylchloridazon des Pflanzenschutzmittels Chloridazon wurden zwar im Jahr 2016 im Rohwasser der Brunnen der WG Hilden-Karnap nachgewiesen, lagen aber mit einer Konzentration kleiner 0,6 µg/l konstant unter dem gesundheitlichen Orientierungswert (GOW) von 3 µg/l aus der Empfehlung des Umweltbundesamtes (entsprechend ahu-schwellenwert)
53 Mikrobiologische Beschaffenheit des Rohwassers Bezüglich der mikrobiologischen Beschaffenheit des Rohwassers der WG Hilden-Karnap (Koloniezahlen bei Bebrütungstemperaturen von 20 C und 36 C, Indikatorkeime Escherichia Coli, Coliforme Keime, Enterokokken und Clostridium perfringens) wurde im WWJ 2015/2016 keine Überschreitung der Grenzwerte festgestellt. Grundwasserbeschaffenheit WG Hilden-Karnap Die Grundwasserbeschaffenheit im Einzugsgebiet der WG Hilden-Karnap zeigt eine Differenzierung, die auf geogene und z. T. auf anthropogene Einflüsse zurückzuführen ist. In Anlage 5.9 sind die Langzeitganglinien für ausgewählte Parameter enthalten. Insgesamt ist hinsichtlich der Grundwasserbeschaffenheit im Einzugsgebiet der WG Hilden-Karnap festzuhalten, dass sich 2016 keine wesentlichen Änderungen gegenüber den Vorjahren zeigen. Überschreitungen der Grenzwerte der TrinkwV werden wie in den Vorjahren an Grundwassermessstellen vor allem für die Parameter Eisen und Mangen sowie Nitrat und Nickel beobachtet. Mit den erhöhten Eisen- und Mangangehalten einher geht häufig eine Unterschreitung des TrinkwV-Grenzwertes für den ph-wert (erhöhte Eisen- und Mangan-Gehalte durch niedrige ph-werte). Die Analyseergebnisse der Beprobungskampagne vom Frühjahr 2016 zeigen zudem an vereinzelten Messstellen Überschreitungen des ahu-schwellenwertes für Nickel, Kalium und Nitrit. Die Entwicklung der Parameter Nitrat und PBSM (hier insbesondere DMS) wird in einem gesonderten Projekt zur Evaluierung der Maßnahmen im kooperierenden Gewässerschutz eingehender untersucht
54 5.2.4 Rohwasser Sengbachtalsperre Ein Einflussfaktor für die Wasserbeschaffenheit in der Talsperre ist der Stickstoffgehalt in den Zuflüssen. In Abbildung 5.7 ist der Nitratgehalt in den Zuflüssen der Sengbachtalsperre dargestellt. Die Nitratkonzentration lag zu Messbeginn im Jahr 1998 für alle Zuflüsse im Bereich von 15 bis 35 mg/l. Dabei ist eine regionale Verteilung zu erkennen: Die höheren Nitratgehalte lagen in den Zuflüssen Neuenhoferbach, Sengbach Unten und Hölvescheider Bach vor, geringere Nitratgehalte wurden in den Zuflüssen Sengbach Mitte, Haiderbach und Ellinghauser Bach gemessen. Die Nitratgehalte blieben in den folgenden Jahren konstant. Seit dem Jahr 2007 ist eine geringfügige Abnahme zu verzeichnen, wobei die Spannbreite im Jahr 2014 bei 10 bis 25 mg/l lag. Abb. 5.7: Nitratkonzentration in den Zuflüssen der Sengbachtalsperre Die Nitratkonzentration, bestimmt als Mittelwert (1998 bis 2014), liegt im Bereich von 13,67 bis 25,20 mg/l. Diese Mittelwerte liegen deutlich unterhalb des Grenzwertes der TrinkwV (2011) und des Grenzwertes für die Qualitätsanforderungen von Oberflächenwasser für die Trinkwasseraufbereitung (RL75/440/EWG) von 50 mg/l Nitrat
55 5.2.5 Eigenversorgungsanlagen Nachfolgende Tabelle zeigt auszugsweise die Grenzwertüberschreitungen für 2016/17, die bei der Analyse von Trinkwasserproben im Rahmen der regulären Überwachung der Wasserversorgungsanlagen gem. 3., 2 b und c TrinkwV 2001 festgestellt wurden. Abbildung 5.8: Tabelle Grenzwertüberschreitungen Eigenversorgungsanlagen (Anlage 5.10)
56 6 WASSERTRANSPORT Das Wasserversorgungsgebiet Solingen ist direkt mit der Wasseraufbereitung Glüder (Sengbachtalsperre) verbunden. Siehe auch Punkt 7 Wasserverteilung. Das Transportleistungssystem der Großen Dhünn Aufbereitung, ist in der Betriebsverantwortung der BTV bzw. des WVV. 7 WASSERVERTEILUNG 7.1 Plan des Wasserverteilnetzes Das Solinger Verteilnetz umfasst ca. 575 km (ohne Hausanschlüsse). Die unterschiedlichen Farben, kennzeichnen die wesentlichen Druckzonen. Netzstrukturdaten Anzahl Druckzonen: 23 Anzahl Druckminderanlagen: 21 Druckbereich: von min.2,8 bar 14 bar Abb. 7.1: Netzplan mit den unterschiedlichen Druckzonen (Anlage 7.1)
57 7.2 Auslegung des Verteilnetzes Erläuterung zur Rohrnetzberechnung Wasser am Spitzentag Die geringen Geschwindigkeiten von in der Regel > 0,5 m/s in den Leitungsabschnitten resultieren zum einen aus dem Wasserversorgungskonzept, welches zu Beginn der 1970 er Jahre für das Gesamtgebiet Solingen erstellt wurde. Hier wurde eine kontinuierliche Steigerung der Einwohnerzahl auf rund Einwohnern im Jahr 2000 sowie einem täglichen Wasserbedarf von 220 l/einwohner und Tag prognostiziert. Da ein großer Teil des Netzes und der Anlagen in der anschließenden Dekade errichtet bzw. erneuert wurde, wurden diese Werte für die Auslegung des Netzes und der Anlagen angesetzt.diese Entwicklungsprognose bestätigte sich nicht. Seit Mitte der 1980 er Jahre wurde der tatsächlichen Einwohnerentwicklung sowie des täglichen Wasserbedarfes je Einwohner bei der kontinuierlichen Erneuerung Rechnung getragen und entsprechend angepasst. Ein weiterer Grund für die geringen Geschwindigkeiten ist die Bereitstellung des Grundschutzes nach W 405. Die hygienischen Belange werden dabei berücksichtigt und haben Priorität. Sollte eine Grundschutzbereitstellung in bestimmten Gebieten weit von den dort vorhandenen Trinkwasserabnahmen abweichen, erfolgt die Auslegung des Netzes nicht nach dem Grundschutzbedarf. Eine Information der Feuerwehr erfolgt entsprechend mit Änderung des Löschwasserbereitstellungsplanes. Abbildung 7.2 Netzberechnung für Spitzenlastfall mit farblicher Darstellung der Fließgeschwindigkeiten (Anlage 7.6)
58 Instandhaltungsstrategie Die Strategie zur Instandhaltung des Wasserversorgungsnetzes sieht eine jährliche Erneuerungsrate von 1,0 1,2 % vor. Entsprechende Investitionsmittel werden zur Realisierung dieser Quote bereitgestellt. Ziel ist die Vermeidung von erhöhten Schadensaufkommen sowie eine kontinuierliche Reduzierung der Wasserverlustquote. Löschwasserbereitstellung Die Löschwasserbereitstellung über das Wasserversorgungsnetz erfolgt gemäß DVGW Arbeitsblatt 405. Hierzu wurde in Abstimmung mit der Feuerwehr der Stadt Solingen ein Löschwasserplan erarbeitet. Dieser Plan enthält über das gesamte Stadtgebiet Cluster mit der abgestimmten Grundschutzbereitstellung. Der rechnerische Nachweis erfolgt durch entsprechende Netzberechnungen. Ein Abgleich der Berechnung mit den tatsächlich möglich Grundschutzmengen erfolgt durch Entnahmeversuche in ausgewählten Bereichen. Gebiete, in denen die Bereitstellung des geforderten Grundschutzes nicht möglich ist, sind in diesem Löschwasserplan gekennzeichnet und der Feuerwehr bekannt. Die hygienischen Belange sind berücksichtigt
59 7.3 Technische Ausstattung, Materialien, Durchschnittsalter, Dichtigkeit, Schadensfälle, Substanzerhalt Folgende Grafik zeigt die Materialaufteilung auf die unterschiedlichen Dimensionen. Abbildung 7.3 Werkstoffe Verteilnetz nach Dimensionen (Anlage 30) Das Trinkwasserverteilnetz in Solingen hat eine Gesamtlänge von ca. 575 km. Die Aufteilung auf die Nennweiten stellt sich wie folgt dar: Abbildung 7.4 Dimensionsübersicht Verteilnetz
60 Die Alterszusammensetzung des Verteilnetzes stellt folgende Grafik dar. Hier sind die Längen angegeben, die im jeweiligen Jahr gebaut worden sind. Abbildung 7.5: Altersverteilung Verteilnetz (Anlage 32) Wasserverlustrate 2016: In 2016 wurden 10,34 Mio m³ an Weiterverteiler abgegeben. Die Wasserverluste (inklusive der Spül- und Löschwassermengen) lagen bei 0,987 Mio m³. Dies entspricht einer Wasserverlustrate von 8,73 % in
61 Rohrschadensraten Abbildung 7.6: Schäden am Wasserverteilnetz (Anlage 33)
62 7.4 Wasserbehälter, Druckerhöhungs- /Druckminderungsanlagen Das Solinger Stadtgebiet wird von drei Doppelkammer Behälteranlagen versorgt. Siehe auch Kapitel 2.1. Behälteranlage Krahenhöhe: 2 Kammern je m³. Gesamtvolumen m³ Behälteranlage Lützowstrasse: 2 Kammern je m³. Gesamtvolumen m³ Behälteranlage Olgastrasse: 2 Kammern je m³. Gesamtvolumen m³ Abbildung 7.7: Schematische Darstellung der Behälteranlagen (Anlage 34) Geodätisch bedingt lassen sich von den m³ ca m³/tag nutzen. Dies entspricht ca. 0,8xSpitzenbedarf. Das heißt, dass bei Ausfall sämtlicher Aufbereitungsanlagen für Stunden am Spitzenverbrauchstag Trinkwasser aus den Behälteranlagen zur Verfügung steht. Dies ist in der Regel ausreichend, um Rohrbrüche zu beseitigen oder eine Notversorgung in Betrieb zu nehmen
63 8 GEFÄHRDUNGSANALYSE 8.1 Identifizierung möglicher Gefährdungen Eine Gefährdung ist jede mögliche biologische, chemische, physikalische oder radiologische Beeinträchtigung im Versorgungssystem. Gefährdungen in der Trinkwasserversorgung können eine Schädigung der Gesundheit des Verbrauchers oder der Verbraucherin verursachen, die sensorischen Eigenschaften des Trinkwassers (Farbe, Geruch und Geschmack) und damit die Appetitlichkeit des Trinkwassers für die Verbraucherin oder den Verbraucher beeinflussen und/oder die technische Versorgungssicherheit im Verteilungsnetz (Menge, Druck) beeinflussen. Gefährdende Ereignisse oder Auslöser sind Zwischenfälle oder Situationen, die zum konkreten Eintreten einer Gefährdung in der Trinkwasserversorgung führen. Gefährdungsanalysen können für das gesamte Versorgungssystem durch Auswertung von vorhandenen Unterlagen (Karten, Plan- und Bestandsunterlagen, Luftbilder), Befragung von Mitarbeitern und durch Begehungen der Örtlichkeiten durchgeführt werden. Wasserwerk Baumberg GmbH Für die WG Baumberg und WG Hilden-Karnap wurde im Jahr 2007 ein Wassersicherheitsstellungskonzept gem. Water-Safety-Plan Vorgehensweise erstellt. Dabei wurden die Einzugsgebiete, die Gewinnungsanlagen sowie die Aufbereitungsanlagen der Wasserwerk Baumberg GmbH betrachtet (s. Abbildung 8.1)
64 Abb. 8.1: Schema der Prozessbestandteile Wassersicherstellungskonzept WW Baumberg GmbH Das Wassersicherstellungskonzept lieferte zum einen die im Betrieb des WW Baumberg nutzbare, systematische Erfassung der Anlagenbestandteile und Kontrollpunkte. Darüber hinaus sind aus der Bearbeitung des Wassersicherstellungskonzeptes für die WW Baumberg GmbH folgende Punkte herauszustellen: Die positive Risikobewertung für den Teil Trinkwasseraufbereitung, Trinkwasserförderung und Elektrotechnik, mit einem überwiegend geringen Risiko, ist als Ergebnis der durchgeführten Bewertungen und deren Rückwirkung in die parallel durchgeführte Planung anzusehen. Die im Wassersicherstellungskonzept für die Einzugsgebiete identifizierten Risiken werden weitgehend im laufenden Einzugsgebietsmonitoring der WW Baumberg GmbH überwacht. Eine direkte Rückkopplung zwischen erkannten Risikopotenzialen und Monitoringvorschlägen wird durch die systematisch aufgezeigten Risikopotenziale vereinfacht und wurde in einen kontinuierlichen Prozess überführt. Damit liegt eine nachvollziehbare und dokumentierte Risikobewertung für alle Prozessteile der Trinkwassergewinnung und Trinkwasseraufbereitung der WW Baumberg GmbH vor. Insgesamt bündelt das Wassersicherstellungskonzept laufende und geplante Aktivitäten und Maßnahmen der WW Baumberg GmbH und stellt sie in den Kontext des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses gem. WSP-Konzept
Anmerkungen zum Wasserversorgungskonzept ( 38 Abs. 3 LWG E )
 Institut für Deutsches und Europäisches Wasserwirtschaftsrecht Universität Trier 32. Wasserwirtschaftsrechtlicher Gesprächskreis Schwerpunkte des neuen Landeswassergesetzes NRW 4. November 2015 Anmerkungen
Institut für Deutsches und Europäisches Wasserwirtschaftsrecht Universität Trier 32. Wasserwirtschaftsrechtlicher Gesprächskreis Schwerpunkte des neuen Landeswassergesetzes NRW 4. November 2015 Anmerkungen
Der Wasserkreislauf in der Region - Unsere Verantwortung für heutige und künftige Generationen. Jens Feddern Berliner Wasserbetriebe
 Der Wasserkreislauf in der Region - Unsere Verantwortung für heutige und künftige Generationen Jens Feddern Berliner Wasserbetriebe Die Abwasserbilanz 2012 Zentrum für Luft- und Raumfahrt III 10. Dezember
Der Wasserkreislauf in der Region - Unsere Verantwortung für heutige und künftige Generationen Jens Feddern Berliner Wasserbetriebe Die Abwasserbilanz 2012 Zentrum für Luft- und Raumfahrt III 10. Dezember
Eine klare Sache: unser neuer Trinkwassertarif.
 hildenwasser Eine klare Sache: unser neuer Trinkwassertarif. TRANSPARENT UND FAIR Unser Lebensmittel Nummer eins bleibt günstig, aber der Tarif braucht eine Auffrischung. Es kommt uns wie eine Selbstverständlichkeit
hildenwasser Eine klare Sache: unser neuer Trinkwassertarif. TRANSPARENT UND FAIR Unser Lebensmittel Nummer eins bleibt günstig, aber der Tarif braucht eine Auffrischung. Es kommt uns wie eine Selbstverständlichkeit
Die Trinkwasserversorgung der Landeshauptstadt Erfurt und der Umlandgemeinden
 Die Trinkwasserversorgung der Landeshauptstadt Erfurt und der Umlandgemeinden Uwe Gerstenhauer Revision/Gütesicherung ThüWa ThüringenWasser GmbH Seite 1 Inhalt Die Trinkwasserversorgung der ThüWa GmbH
Die Trinkwasserversorgung der Landeshauptstadt Erfurt und der Umlandgemeinden Uwe Gerstenhauer Revision/Gütesicherung ThüWa ThüringenWasser GmbH Seite 1 Inhalt Die Trinkwasserversorgung der ThüWa GmbH
Transparent und fair: unser neuer Trinkwasser-Tarif
 Transparent und fair: unser neuer Trinkwasser-Tarif www.swk.de 2 Ein ausgewogenes System, damit unser Lebensmittel Nr.1 für alle bezahlbar bleibt. Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und durch
Transparent und fair: unser neuer Trinkwasser-Tarif www.swk.de 2 Ein ausgewogenes System, damit unser Lebensmittel Nr.1 für alle bezahlbar bleibt. Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und durch
Erhebung und Bewertung der öffentlichen Wasserversorgung in Bayern - Versorgungssicherheit derzeit und künftig -
 Erhebung und Bewertung der öffentlichen Wasserversorgung in Bayern - Versorgungssicherheit derzeit und künftig - Dialog zur Klimaanpassung Grundwasser zwischen Nutzung und Klimawandel Berlin, 16.09.2014
Erhebung und Bewertung der öffentlichen Wasserversorgung in Bayern - Versorgungssicherheit derzeit und künftig - Dialog zur Klimaanpassung Grundwasser zwischen Nutzung und Klimawandel Berlin, 16.09.2014
Rechtliche und technische Grundlagen zur Wasserbeschaffung auf Golfanlagen Grundlagen und Wasserbedarf Wasserbeschaffung Bevorratung
 Rechtliche und technische Grundlagen zur Wasserbeschaffung auf Golfanlagen Große Kreyssig Dr. Schönert GbR Rellinghauser Straße 334 d 45 136 Essen Tel.: 0201-481884 Fax: 0201-481886 email: Info@PlanLand.net
Rechtliche und technische Grundlagen zur Wasserbeschaffung auf Golfanlagen Große Kreyssig Dr. Schönert GbR Rellinghauser Straße 334 d 45 136 Essen Tel.: 0201-481884 Fax: 0201-481886 email: Info@PlanLand.net
BUC Immobilien GmbH Areal Makartstraße Pforzheim. Regenwasserbeseitigungskonzept
 BUC Immobilien GmbH Regenwasserbeseitigungskonzept bei Einhaltung der Grundwasserneubildung ERLÄUTERUNGSBERICHT MIT BERECHNUNGEN Hügelsheim, Juli 2013 WALD + CORBE Infrastrukturplanung GmbH Vers V/13PF
BUC Immobilien GmbH Regenwasserbeseitigungskonzept bei Einhaltung der Grundwasserneubildung ERLÄUTERUNGSBERICHT MIT BERECHNUNGEN Hügelsheim, Juli 2013 WALD + CORBE Infrastrukturplanung GmbH Vers V/13PF
Wasserverschmutzung kostenfrei? Auswirkungen der Landwirtschaft auf das Gemeingut Wasser
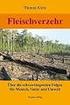 Wasserverschmutzung kostenfrei? Auswirkungen der Landwirtschaft auf das Gemeingut Wasser Berlin, den 22.1.2015 Martin Weyand BDEW-Hauptgeschäftsführer Wasser/ Abwasser www.bdew.de Entwicklung der Wasserförderung
Wasserverschmutzung kostenfrei? Auswirkungen der Landwirtschaft auf das Gemeingut Wasser Berlin, den 22.1.2015 Martin Weyand BDEW-Hauptgeschäftsführer Wasser/ Abwasser www.bdew.de Entwicklung der Wasserförderung
Talsperren als Trinkwasserressource. Welche Seen braucht das Land? Natur- und Umweltschutzakademie NRW, 22. März, Haltern am See
 Talsperren als Trinkwasserressource Welche Seen braucht das Land? Natur- und Umweltschutzakademie NRW, 22. März, Haltern am See Prof. Dr. Scheuer 1 Talsperren als Trinkwasserressource 2 Talsperren als
Talsperren als Trinkwasserressource Welche Seen braucht das Land? Natur- und Umweltschutzakademie NRW, 22. März, Haltern am See Prof. Dr. Scheuer 1 Talsperren als Trinkwasserressource 2 Talsperren als
Quantifizierung des Bedarfs an behandeltem Abwasser zur landwirtschaftlichen Bewässerung
 Quantifizierung des Bedarfs an behandeltem Abwasser zur landwirtschaftlichen Bewässerung Sebastian Maaßen (ZALF) Dagmar Balla (ZALF) Workshop Abwassernutzung in der Landwirtschaft 12. Februar 2015 Auftraggeber:
Quantifizierung des Bedarfs an behandeltem Abwasser zur landwirtschaftlichen Bewässerung Sebastian Maaßen (ZALF) Dagmar Balla (ZALF) Workshop Abwassernutzung in der Landwirtschaft 12. Februar 2015 Auftraggeber:
Wasserentnahme in der Nordheide
 Wieviel Wasser braucht Hamburg? UWG SG Salzhausen Mittwoch, den 2.05.2012, Gasthof Isernhagen, Gödenstorf Öffentliche Veranstaltung am 9. Mai 2012 im Alten Geidenhof in Hanstedt Beginn 19:30 Wasserförderung
Wieviel Wasser braucht Hamburg? UWG SG Salzhausen Mittwoch, den 2.05.2012, Gasthof Isernhagen, Gödenstorf Öffentliche Veranstaltung am 9. Mai 2012 im Alten Geidenhof in Hanstedt Beginn 19:30 Wasserförderung
45.02.0. Koordinierung Förderung/Haushalt
 Fonds: EFRE 1 Aktionsbogen 45.02.0. Aktion: 45.02.0. Bau von öffentlichen Trinkwasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Teil-Aktion 45.02.1 Bau von öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen
Fonds: EFRE 1 Aktionsbogen 45.02.0. Aktion: 45.02.0. Bau von öffentlichen Trinkwasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Teil-Aktion 45.02.1 Bau von öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen
Gemeinde Wettringen KREIS STEINFURT. Flächennutzungsplan Neubekanntmachung Erläuterungstext. gemäß 6 (6) BauGB
 Gemeinde Wettringen KREIS STEINFURT Flächennutzungsplan Neubekanntmachung 2016 gemäß 6 (6) BauGB Erläuterungstext Projektnummer: 214295 Datum: 2016-08-18 Gemeinde Wettringen Flächennutzungsplan Neubekanntmachung
Gemeinde Wettringen KREIS STEINFURT Flächennutzungsplan Neubekanntmachung 2016 gemäß 6 (6) BauGB Erläuterungstext Projektnummer: 214295 Datum: 2016-08-18 Gemeinde Wettringen Flächennutzungsplan Neubekanntmachung
Die Geschichte. des Wasserwerks Concordia. zum 100-jährigen Bestehen 1909-2009
 Die Geschichte des Wasserwerks Concordia zum 100-jährigen Bestehen 1909-2009 Die Trinkwasserversorgung in der Gemeinde Kreuzau Wasser gehört zu den unabdingbaren Voraussetzungen des Lebens; es gibt kein
Die Geschichte des Wasserwerks Concordia zum 100-jährigen Bestehen 1909-2009 Die Trinkwasserversorgung in der Gemeinde Kreuzau Wasser gehört zu den unabdingbaren Voraussetzungen des Lebens; es gibt kein
Kommunale. WasserWirtschaft. Fragen und Antworten WASSERPREISE. Hintergrundinformationen zur Wasserpreisbildung
 Kommunale WasserWirtschaft Fragen und Antworten WASSERPREISE Hintergrundinformationen zur Wasserpreisbildung 1. Wie viel gibt ein Bundesbürger durchschnittlich im Monat für die Trinkwasserbereitstellung
Kommunale WasserWirtschaft Fragen und Antworten WASSERPREISE Hintergrundinformationen zur Wasserpreisbildung 1. Wie viel gibt ein Bundesbürger durchschnittlich im Monat für die Trinkwasserbereitstellung
Thüringer Fernwasserversorgung
 Thüringer Fernwasserversorgung Inhalt Überblick zum Unternehmen Konzeption Fernwasserleitung Bad Langensalza/Eisenach Talsperre Ohra Trinkwasseraufbereitung Fernwasserverteilung Wasserkraftnutzung Fernwasserqualität
Thüringer Fernwasserversorgung Inhalt Überblick zum Unternehmen Konzeption Fernwasserleitung Bad Langensalza/Eisenach Talsperre Ohra Trinkwasseraufbereitung Fernwasserverteilung Wasserkraftnutzung Fernwasserqualität
Berliner Wasserbetriebe
 Berliner Wasserbetriebe Investitionen in die Zukunft Dr. Ulrich Bammert Technischer Vorstand Kennzahlen 2006 Trinkwasserversorgung Abwasserentsorgung 209,3 Mio. m³/a 230,7 Mio. m³/a (3,6 Mio. m³ Umland)
Berliner Wasserbetriebe Investitionen in die Zukunft Dr. Ulrich Bammert Technischer Vorstand Kennzahlen 2006 Trinkwasserversorgung Abwasserentsorgung 209,3 Mio. m³/a 230,7 Mio. m³/a (3,6 Mio. m³ Umland)
Netzentkoppelte Löschwasserbereitstellung
 Netzentkoppelte Löschwasserbereitstellung Christian Sorge, Dominik Nottarp-Heim, Kevin Krüger IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung gemeinnützige GmbH 18.04.2016 Netzentkoppelte Löschwasserbereitstellung
Netzentkoppelte Löschwasserbereitstellung Christian Sorge, Dominik Nottarp-Heim, Kevin Krüger IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung gemeinnützige GmbH 18.04.2016 Netzentkoppelte Löschwasserbereitstellung
11 DYNAMISCHES GRUNDWASSERMANAGEMENT- SYSTEM
 Kapitel 11: Dynamisches Grundwassermanagementsystem 227 11 DYNAMISCHES GRUNDWASSERMANAGEMENT- SYSTEM 11.1 Übersicht Das entwickelte Optimierungssystem für instationäre Verhältnisse lässt sich in der praktischen
Kapitel 11: Dynamisches Grundwassermanagementsystem 227 11 DYNAMISCHES GRUNDWASSERMANAGEMENT- SYSTEM 11.1 Übersicht Das entwickelte Optimierungssystem für instationäre Verhältnisse lässt sich in der praktischen
B e g r ü n d u n g. zum Bebauungsplan-Vorentwurf Nr. 05/003 - Westlich Leuchtenberger Kirchweg Vereinfachtes Verfahren gemäß 13 BauGB
 B e g r ü n d u n g zum Bebauungsplan-Vorentwurf Nr. 05/003 - Westlich Leuchtenberger Kirchweg Vereinfachtes Verfahren gemäß 13 BauGB Stadtbezirk 5 - Stadtteil Lohausen 1. Örtliche Verhältnisse Das etwa
B e g r ü n d u n g zum Bebauungsplan-Vorentwurf Nr. 05/003 - Westlich Leuchtenberger Kirchweg Vereinfachtes Verfahren gemäß 13 BauGB Stadtbezirk 5 - Stadtteil Lohausen 1. Örtliche Verhältnisse Das etwa
Versorgung mit Briefkästen und Paketshops in Deutschland
 Versorgung mit Briefkästen und Paketshops in Deutschland Ein Bericht aus dem Monitoring der Brief- und KEP-Märkte in Deutschland 2 VERSORGUNGSQUALITÄT Den Grad der Servicequalität von Brief- und Paketdienstleistern
Versorgung mit Briefkästen und Paketshops in Deutschland Ein Bericht aus dem Monitoring der Brief- und KEP-Märkte in Deutschland 2 VERSORGUNGSQUALITÄT Den Grad der Servicequalität von Brief- und Paketdienstleistern
Trinkwasser Versorgungsgebiet:
 Trinkwasser Versorgungsgebiet: ENTEGA AG Telefon: 065 708022 Telefax: 065 70409 in Zusammenarbeit mit Hessenwasser GmbH & Co. KG Darmstadt (alle Ortsteile), Riedstadt (alle Ortsteile), Weiterstadt (alle
Trinkwasser Versorgungsgebiet: ENTEGA AG Telefon: 065 708022 Telefax: 065 70409 in Zusammenarbeit mit Hessenwasser GmbH & Co. KG Darmstadt (alle Ortsteile), Riedstadt (alle Ortsteile), Weiterstadt (alle
Auszug aus Denkschrift zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes Baden-Württemberg
 Auszug aus Denkschrift 2015 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes Baden-Württemberg Beitrag Nr. 13 Zuwendungen für die Wasserversorgung in Seckach, Neckar-Odenwald-Kreis RECHNUNGSHOF Rechnungshof
Auszug aus Denkschrift 2015 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes Baden-Württemberg Beitrag Nr. 13 Zuwendungen für die Wasserversorgung in Seckach, Neckar-Odenwald-Kreis RECHNUNGSHOF Rechnungshof
Stellungnahme der Bürgerinitiative zum Schutz der Landschaft zwischen Moitzfeld und Herkenrath zum Entwurf des Landesentwicklungsplanes NRW
 BI Moitzfeld-Herkenrath Stellungnahme LEP v. 18.2.2014 Seite 1 von 9 Bürgerinitiative Moitzfeld-Herkenrath c/o Dr. David Bothe Neuenhaus 20a 51429 Bergisch Gladbach WWW: http://www.moitzfeldherkenrath.de
BI Moitzfeld-Herkenrath Stellungnahme LEP v. 18.2.2014 Seite 1 von 9 Bürgerinitiative Moitzfeld-Herkenrath c/o Dr. David Bothe Neuenhaus 20a 51429 Bergisch Gladbach WWW: http://www.moitzfeldherkenrath.de
Erläuterungsbericht. zu den wasserrechtlichen Unterlagen
 Unterlage 13.1 zu den wasserrechtlichen Unterlagen Planfeststellung Kreisstraße ED 18 St 2086 (Lappach) B 15 (St. Wolfgang) Ausbau nördlich Sankt Wolfgang ED 18 Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+577 ED 18_100_2,706
Unterlage 13.1 zu den wasserrechtlichen Unterlagen Planfeststellung Kreisstraße ED 18 St 2086 (Lappach) B 15 (St. Wolfgang) Ausbau nördlich Sankt Wolfgang ED 18 Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+577 ED 18_100_2,706
Trink- Wasser. aus der Fuelbecke Talsperre
 Trink- Wasser aus der Fuelbecke Talsperre Ohne die Stadtwerke wäre es einfach nur nass,...... das Quell- und Regenwasser aus der Fuelbecke Talsperre. Täglich setzen die Mitarbeiter alles daran, für die
Trink- Wasser aus der Fuelbecke Talsperre Ohne die Stadtwerke wäre es einfach nur nass,...... das Quell- und Regenwasser aus der Fuelbecke Talsperre. Täglich setzen die Mitarbeiter alles daran, für die
Wasserkraftanlagen. Leistungen aus unserem Serviceportfolio
 Wasserkraftanlagen Leistungen aus unserem Serviceportfolio Wasserkraft aus der Natur In Trinkwasserturbinen lässt sich effektiv elektrische Energie erzeugen. Die natürliche Kraft steckt in jedem Tropfen
Wasserkraftanlagen Leistungen aus unserem Serviceportfolio Wasserkraft aus der Natur In Trinkwasserturbinen lässt sich effektiv elektrische Energie erzeugen. Die natürliche Kraft steckt in jedem Tropfen
Das Wasserversorgungskonzept Berlin 2040 aus der Sicht der Naturschutzverbände
 Das Wasserversorgungskonzept Berlin 2040 aus der Sicht der Naturschutzverbände Dr. Andreas Meißner Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.v. WRRL Seminar der Grünen Liga, 28.11.2008 Gliederung 1. Einführung
Das Wasserversorgungskonzept Berlin 2040 aus der Sicht der Naturschutzverbände Dr. Andreas Meißner Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.v. WRRL Seminar der Grünen Liga, 28.11.2008 Gliederung 1. Einführung
IBF. Ingenieurbüro Finster. Erläuterung
 IBF Ingenieurbüro Finster Eichenweg 17-91460 Baudenbach - Tel. 09164/99 54 54 - E-mail: ibfinster@gmx.de Ingenieurbüro für kommunalen Tiefbau Auftraggeber: Markt Dachsbach Projekt: Antrag auf gehobene
IBF Ingenieurbüro Finster Eichenweg 17-91460 Baudenbach - Tel. 09164/99 54 54 - E-mail: ibfinster@gmx.de Ingenieurbüro für kommunalen Tiefbau Auftraggeber: Markt Dachsbach Projekt: Antrag auf gehobene
Wasserwirtschaft in Deutschland. Wasserversorgung Abwasserbeseitigung
 Wasserwirtschaft in Deutschland Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Öffentliche Abwasserbeseitigung in Zahlen (211) Abwasserbehandlungsanlagen: knapp 1. Behandelte Abwassermenge: 1,1 Mrd. m 3 (5,2 Mrd.
Wasserwirtschaft in Deutschland Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Öffentliche Abwasserbeseitigung in Zahlen (211) Abwasserbehandlungsanlagen: knapp 1. Behandelte Abwassermenge: 1,1 Mrd. m 3 (5,2 Mrd.
Entwicklung der EEG-Anlagen in München
 Entwicklung der EEG-Anlagen in München Impressum Herausgeberin: Referat für Gesunheit und Umwelt Landeshauptstadt München Bayerstraße 8 a 8335 München Sachgebiet Energie, Klimaschutz, Förderprogramm Energieeinsparung,
Entwicklung der EEG-Anlagen in München Impressum Herausgeberin: Referat für Gesunheit und Umwelt Landeshauptstadt München Bayerstraße 8 a 8335 München Sachgebiet Energie, Klimaschutz, Förderprogramm Energieeinsparung,
Aussehen, Trübung - Farbe - Sensorische Prüfung - Temperatur C 10,3-20,8 Calcitlösekapazität mg/l CaCO
 Telefon: 065 708022 Telefax: 065 70409 Trinkwasser Versorgungsgebiet: Biblis mit den Ortsteilen Nordheim und Wattenheim; GroßRohrheim Herkunft: Wasserwerk Jägersburg Technisch relevante Analysenwerte nach
Telefon: 065 708022 Telefax: 065 70409 Trinkwasser Versorgungsgebiet: Biblis mit den Ortsteilen Nordheim und Wattenheim; GroßRohrheim Herkunft: Wasserwerk Jägersburg Technisch relevante Analysenwerte nach
STROM WÄRME ERDGAS WASSER UND MEHR. Wasserwerk Dresden-Tolkewitz
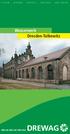 STROM WÄRME ERDGAS WASSER UND MEHR Wasserwerk Dresden-Tolkewitz Die Wasserversorgung der Stadt Dresden Kurzer historischer Abriss Die Wasserversorgung der Stadt Dresden wurde bis 1875 durch eine Vielzahl
STROM WÄRME ERDGAS WASSER UND MEHR Wasserwerk Dresden-Tolkewitz Die Wasserversorgung der Stadt Dresden Kurzer historischer Abriss Die Wasserversorgung der Stadt Dresden wurde bis 1875 durch eine Vielzahl
Der Regionale Wasserbedarfsnachweis der Hessenwasser GmbH & Co. KG
 Der Regionale Wasserbedarfsnachweis der Hessenwasser GmbH & Co. KG Werner Herber, Holger Wagner und Ulrich Roth Wasserversorgung, Wasserbedarfsnachweis, Wasserbedarf Der Wasserbedarfsnachweis ist notwendiger
Der Regionale Wasserbedarfsnachweis der Hessenwasser GmbH & Co. KG Werner Herber, Holger Wagner und Ulrich Roth Wasserversorgung, Wasserbedarfsnachweis, Wasserbedarf Der Wasserbedarfsnachweis ist notwendiger
Trinkwasserversorgung in Flensburg
 Trinkwasserversorgung in Flensburg Trinkwasserversorgung in Flensburg Basisdaten 2006 In Flensburg erfolgt die öffentliche Trinkwasserversorgung über zwei von der Stadtwerke Flensburg GmbH betriebene Was
Trinkwasserversorgung in Flensburg Trinkwasserversorgung in Flensburg Basisdaten 2006 In Flensburg erfolgt die öffentliche Trinkwasserversorgung über zwei von der Stadtwerke Flensburg GmbH betriebene Was
Wasser Ein kommunales Gut!
 Pressetext vom 31. März 2008 Tag des Wassers 2008: Wasser Ein kommunales Gut! diskutierte mit Aufgaben- und Hoheitsträgern aktuelle Fragen auf kommunaler Ebene Leipzig/Nauen. Die Leipzig und der Wasser-
Pressetext vom 31. März 2008 Tag des Wassers 2008: Wasser Ein kommunales Gut! diskutierte mit Aufgaben- und Hoheitsträgern aktuelle Fragen auf kommunaler Ebene Leipzig/Nauen. Die Leipzig und der Wasser-
Ökologische und ökonomische Bewertung der zentralen Enthärtung von Trinkwasser
 1 Ökologische und ökonomische Bewertung der zentralen Enthärtung von Trinkwasser Zusammenfassung Die Versorgung mit hartem Wasser, d.h. Wasser im Härtebereich 3 oder 4, kann für den Verbraucher deutliche
1 Ökologische und ökonomische Bewertung der zentralen Enthärtung von Trinkwasser Zusammenfassung Die Versorgung mit hartem Wasser, d.h. Wasser im Härtebereich 3 oder 4, kann für den Verbraucher deutliche
Wasser und Nahrung 1) Die globale Dimension 2) Positionierung der Schweiz 3) Schlussfolgerungen
 Wasser und Nahrung: Geht der Landwirtschaft das Wasser aus?, Prof. Dr. Geographisches Institut der Universität Bern Gruppe für Hydrologie Oeschger Centre for Climate Change Research rolf.weingartner@giub.unibe.ch
Wasser und Nahrung: Geht der Landwirtschaft das Wasser aus?, Prof. Dr. Geographisches Institut der Universität Bern Gruppe für Hydrologie Oeschger Centre for Climate Change Research rolf.weingartner@giub.unibe.ch
Wem gehört unser Wasser?
 Wem gehört unser Wasser? Dipl.-Ing. Johann Wiedner Trinkwasserversorgung in der Steiermark Wasserdargebot, Eigentums- und Nutzungsrechte, Qualität und Infrastruktur Wasserbilanz der Steiermark Mittlerer
Wem gehört unser Wasser? Dipl.-Ing. Johann Wiedner Trinkwasserversorgung in der Steiermark Wasserdargebot, Eigentums- und Nutzungsrechte, Qualität und Infrastruktur Wasserbilanz der Steiermark Mittlerer
AMTSBLATT DER STADT LEICHLINGEN
 AMTSBLATT DER STADT LEICHLINGEN Jahrgang 19 Amtliche Bekanntmachung der Stadt Leichlingen Inhaltsverzeichnis 39 Planaufstellung zur Maßnahme Betrieb der Wasserkraftanlage Auer Kotten in Solingen-Widdert
AMTSBLATT DER STADT LEICHLINGEN Jahrgang 19 Amtliche Bekanntmachung der Stadt Leichlingen Inhaltsverzeichnis 39 Planaufstellung zur Maßnahme Betrieb der Wasserkraftanlage Auer Kotten in Solingen-Widdert
Status Quo in der Umweltbranche in der Türkei. -Abfallwirtschaft -Wasserver-/Abwasserentsorgung -Luftreinhaltung
 Status Quo in der Umweltbranche in der Türkei -Abfallwirtschaft -Wasserver-/Abwasserentsorgung -Luftreinhaltung 1 Fakten über die Türkei Fläche: Bevölkerung: 780.000 km² (10 x Österreich) 73,7 Mio. (9
Status Quo in der Umweltbranche in der Türkei -Abfallwirtschaft -Wasserver-/Abwasserentsorgung -Luftreinhaltung 1 Fakten über die Türkei Fläche: Bevölkerung: 780.000 km² (10 x Österreich) 73,7 Mio. (9
11 Kostendeckende Wasserpreise
 173 11 Kostendeckende Wasserpreise Kläranlage Rheinhausen 11.1 Abwassergebühren in Nordrhein-Westfalen Die Kosten der Abwasserentsorgung werden in Form von Abwassergebühren auf die Bürgerinnen und Bürger
173 11 Kostendeckende Wasserpreise Kläranlage Rheinhausen 11.1 Abwassergebühren in Nordrhein-Westfalen Die Kosten der Abwasserentsorgung werden in Form von Abwassergebühren auf die Bürgerinnen und Bürger
BEGRÜNDUNG ZUR 5. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER GEMEINDE SCHÜLP BEI NORTORF KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE BESTEHEND AUS
 BEGRÜNDUNG ZUR 5. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER GEMEINDE SCHÜLP BEI NORTORF KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE BESTEHEND AUS TEIL I ZIELE, GRUNDLAGEN UND INHALTE TEIL II UMWELTBERICHT ZIELE, GRUNDLAGEN
BEGRÜNDUNG ZUR 5. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER GEMEINDE SCHÜLP BEI NORTORF KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE BESTEHEND AUS TEIL I ZIELE, GRUNDLAGEN UND INHALTE TEIL II UMWELTBERICHT ZIELE, GRUNDLAGEN
Anpassung ist notwendig: Konsequenzen aus Klimawandel und Hochwasserrisiko für f r die Elbe
 Anpassung ist notwendig: Konsequenzen aus Klimawandel und Hochwasserrisiko für f r die Elbe Dipl. Ing. Corinna Hornemann Umweltbundesamt Abteilung II Wasser und Boden Fachgebiet Übergreifende Angelegenheiten
Anpassung ist notwendig: Konsequenzen aus Klimawandel und Hochwasserrisiko für f r die Elbe Dipl. Ing. Corinna Hornemann Umweltbundesamt Abteilung II Wasser und Boden Fachgebiet Übergreifende Angelegenheiten
Die Abwassergebühren. Wie sie berechnet werden und warum sie sinnvoll sind. Für Mensch und Natur AIB
 Die Abwassergebühren Wie sie berechnet werden und warum sie sinnvoll sind Pro Tag und pro Person verbrauchen wir rund 150 Liter Trinkwasser. Jeder von uns produziert oder scheidet Schmutzstoffe aus (organische
Die Abwassergebühren Wie sie berechnet werden und warum sie sinnvoll sind Pro Tag und pro Person verbrauchen wir rund 150 Liter Trinkwasser. Jeder von uns produziert oder scheidet Schmutzstoffe aus (organische
15. Informationsveranstaltung Wissenswertes rund um Kanalnetz und Gewässer 20. Juni 2012
 15. Informationsveranstaltung Wissenswertes rund um Kanalnetz und Gewässer 20. Juni 2012 Analytik und Qualitätsüberwachung in der Trinkwasserversorgung Referent: Dipl.-Ing. Thomas Rießner DIN 2000: Leitsätze
15. Informationsveranstaltung Wissenswertes rund um Kanalnetz und Gewässer 20. Juni 2012 Analytik und Qualitätsüberwachung in der Trinkwasserversorgung Referent: Dipl.-Ing. Thomas Rießner DIN 2000: Leitsätze
TÜV SÜD Standard: Produkt GreenMethane GM. TÜV SÜD Industrie Service GmbH - Carbon Management Service - Westendstraße München
 TÜV SÜD Standard: Produkt GreenMethane GM TÜV SÜD Industrie Service GmbH - Carbon Management Service - Westendstraße 199 80686 München Zertifizierung von GreenMethane Endkundenprodukten Inhalt Zertifizierung
TÜV SÜD Standard: Produkt GreenMethane GM TÜV SÜD Industrie Service GmbH - Carbon Management Service - Westendstraße 199 80686 München Zertifizierung von GreenMethane Endkundenprodukten Inhalt Zertifizierung
Allgemeine Preise. für die Versorgung mit. Fernwärme
 STADTWERKE GmbH Allgemeine Preise für die Versorgung mit Fernwärme (Preisregelung CAL-Gas) der STADTWERKE ITZEHOE GmbH Gültig ab 01. Januar 2016 Anlage zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die
STADTWERKE GmbH Allgemeine Preise für die Versorgung mit Fernwärme (Preisregelung CAL-Gas) der STADTWERKE ITZEHOE GmbH Gültig ab 01. Januar 2016 Anlage zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die
Verordnung zum Gesetz über die Nutzung von öffentlichem Fluss- und Grundwasser (Wassernutzungsverordnung)
 Wassernutzungsverordnung 77.50 Verordnung zum Gesetz über die Nutzung von öffentlichem Fluss- und Grundwasser (Wassernutzungsverordnung) Vom. Juni 00 (Stand. Januar 009) Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt,
Wassernutzungsverordnung 77.50 Verordnung zum Gesetz über die Nutzung von öffentlichem Fluss- und Grundwasser (Wassernutzungsverordnung) Vom. Juni 00 (Stand. Januar 009) Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt,
Trinkwasser - Immer sauber und überall?
 Bürgermeisterkongress 2013 Trinkwasser - Immer sauber und überall? Dr. Ina Wienand Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Bonn Ref. II.5 Wasserversorgung, baulich-technischer Schutz kritischer
Bürgermeisterkongress 2013 Trinkwasser - Immer sauber und überall? Dr. Ina Wienand Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Bonn Ref. II.5 Wasserversorgung, baulich-technischer Schutz kritischer
Gemeinde Taufkirchen (Vils) 58. Änderung des Flächennutzungsplans
 Gemeinde Taufkirchen (Vils) Landkreis Erding 58. Änderung des Flächennutzungsplans "Änderung und Erweiterung der Campingplatzanlage Lain Bereich 3 a und 3 b" Begründung Max Bauer, Landschaftsarchitekt,
Gemeinde Taufkirchen (Vils) Landkreis Erding 58. Änderung des Flächennutzungsplans "Änderung und Erweiterung der Campingplatzanlage Lain Bereich 3 a und 3 b" Begründung Max Bauer, Landschaftsarchitekt,
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) der Gemeinde Steinhöring
 Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) der Gemeinde Steinhöring Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Steinhöring folgende Beitrags- und
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) der Gemeinde Steinhöring Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Steinhöring folgende Beitrags- und
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des Finanzausgleichsgesetzes
 Deutscher Bundestag Drucksache 16/3269 16. Wahlperiode 07.11.2006 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des Finanzausgleichsgesetzes
Deutscher Bundestag Drucksache 16/3269 16. Wahlperiode 07.11.2006 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des Finanzausgleichsgesetzes
Leitfaden für die Ausweisung von Grundwasserschutzzonen für die Trinkwassergewinnung. Teil 2: Risikoplan und Maßnahmenkatalog
 Leitfaden für die Ausweisung von Grundwasserschutzzonen für die Trinkwassergewinnung ahu Teil 2: Risikoplan und Maßnahmenkatalog Dipl.-Geol. C. Sailer (c.sailer@ahu.de) ahu, Aachen Workshop Präsentation
Leitfaden für die Ausweisung von Grundwasserschutzzonen für die Trinkwassergewinnung ahu Teil 2: Risikoplan und Maßnahmenkatalog Dipl.-Geol. C. Sailer (c.sailer@ahu.de) ahu, Aachen Workshop Präsentation
Antwort 31 Die Fließgeschwindigkeit des Abwassers wird vermindert. Frage 31 Wodurch erreicht man im Sandfang, dass sich der Sand absetzt?
 Frage 31 Wodurch erreicht man im Sandfang, dass sich der Sand absetzt? Antwort 31 Die Fließgeschwindigkeit des Abwassers wird vermindert. Frage 32 Welche Stoffe sind im Abwasser, die dort nicht hinein
Frage 31 Wodurch erreicht man im Sandfang, dass sich der Sand absetzt? Antwort 31 Die Fließgeschwindigkeit des Abwassers wird vermindert. Frage 32 Welche Stoffe sind im Abwasser, die dort nicht hinein
Wie viele OGS-Plätze an Grundschulen im Bereich der Bezirksregierung Detmold stehen nicht zur Verfügung, obwohl ein Bedarf der Eltern besteht?
 LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 16. Wahlperiode Drucksache 16/5866 14.05.2014 Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 2213 vom 14. April 2014 der Abgeordneten Kai Abruszat und Yvonne Gebauer FDP
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 16. Wahlperiode Drucksache 16/5866 14.05.2014 Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 2213 vom 14. April 2014 der Abgeordneten Kai Abruszat und Yvonne Gebauer FDP
Die Landeshauptstadt Potsdam verzeichnet
 Ressourcenmanagement in der Wasser - wirtschaft am Beispiel der Energie und Wasser Potsdam GmbH Durch den starken Bevölkerungszuwachs in Potsdam bis 2030 und durch den in Folge des Klimawandels zu erwartenden
Ressourcenmanagement in der Wasser - wirtschaft am Beispiel der Energie und Wasser Potsdam GmbH Durch den starken Bevölkerungszuwachs in Potsdam bis 2030 und durch den in Folge des Klimawandels zu erwartenden
Quelle: PI Mitterfellner GmbH. Berücksichtigung von öffentlichen Interessen bei der Planung von Klein(st)wasserkraftwerken
 Quelle: PI Mitterfellner GmbH Berücksichtigung von öffentlichen Interessen bei der Planung von Klein(st)wasserkraftwerken Waidhofen an der Ybbs 13. Oktober 2016 Agenda Begriffsdefinitionen Öffentliche
Quelle: PI Mitterfellner GmbH Berücksichtigung von öffentlichen Interessen bei der Planung von Klein(st)wasserkraftwerken Waidhofen an der Ybbs 13. Oktober 2016 Agenda Begriffsdefinitionen Öffentliche
Abwasserbeseitigungskonzepte Niederschlagswasser
 Gesetzliche Grundlagen Inhaltliche Gestaltung der Abwasserbeseitigungskonzepte Teil Niederschlagswasser Aufgabenträger Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung Bearbeitungsstand der Abwasserbeseitigungskonzepte
Gesetzliche Grundlagen Inhaltliche Gestaltung der Abwasserbeseitigungskonzepte Teil Niederschlagswasser Aufgabenträger Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung Bearbeitungsstand der Abwasserbeseitigungskonzepte
Präambel. 1 Gebührenerhebung
 Satzung der Stadt Cloppenburg über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Krippenplätzen vom 16.07.2007 in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 16.09.2013 Aufgrund der 6, 8, 40 und 83
Satzung der Stadt Cloppenburg über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Krippenplätzen vom 16.07.2007 in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 16.09.2013 Aufgrund der 6, 8, 40 und 83
Grundwassernutzung Trinkwasser und vieles mehr
 Grundwassernutzung Trinkwasser und vieles mehr 3 3. Grundwassernutzung Trinkwasser und vieles mehr 3.1 Trinkwassernutzung Zur Geschichte der zentralen Trinkwasserversorgung Berlins Vor 150 Jahren bestand
Grundwassernutzung Trinkwasser und vieles mehr 3 3. Grundwassernutzung Trinkwasser und vieles mehr 3.1 Trinkwassernutzung Zur Geschichte der zentralen Trinkwasserversorgung Berlins Vor 150 Jahren bestand
Gesetz zur Änderung von bau- und enteignungsrechtlichen Vorschriften sowie der Baumschutzverordnung
 BREMISCHE BÜRGERSCHAFT Drucksache 18/1355 Landtag 18. Wahlperiode 22.04.2014 Mitteilung des Senats vom 22. April 2014 Gesetz zur Änderung von bau- und enteignungsrechtlichen Vorschriften sowie der Baumschutzverordnung
BREMISCHE BÜRGERSCHAFT Drucksache 18/1355 Landtag 18. Wahlperiode 22.04.2014 Mitteilung des Senats vom 22. April 2014 Gesetz zur Änderung von bau- und enteignungsrechtlichen Vorschriften sowie der Baumschutzverordnung
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) Außenanlagen von Bundesliegenschaften
 Inhalt und Zielsetzungen Positive Wirkungsrichtung, Kommentar Die Verringerung potenzieller Risiken wie z. B. durch unsachgemäße Bauausführung oder Unternehmensinsolvenz kann durch die Beauftragung qualifizierter
Inhalt und Zielsetzungen Positive Wirkungsrichtung, Kommentar Die Verringerung potenzieller Risiken wie z. B. durch unsachgemäße Bauausführung oder Unternehmensinsolvenz kann durch die Beauftragung qualifizierter
Empfehlung zur Vermeidung von Kontaminationen des Trinkwassers mit Parasiten
 Bekanntmachung des Umweltbundesamtes Empfehlung zur Vermeidung von Kontaminationen des Trinkwassers mit Parasiten Empfehlung des Umweltbundesamtes nach Anhörung der Trinkwasserkommission des Umweltbundesamtes
Bekanntmachung des Umweltbundesamtes Empfehlung zur Vermeidung von Kontaminationen des Trinkwassers mit Parasiten Empfehlung des Umweltbundesamtes nach Anhörung der Trinkwasserkommission des Umweltbundesamtes
Wasser. Regionale Wasserversorgung St.Gallen AG
 Wasser Regionale Wasserversorgung St.Gallen AG INHALTSVERZEICHNIS LEBENSELIXIER WASSER 03 NATÜRLICHE WASSERRESSOURCEN 04 WASSERSPEICHER BODENSEE 07 RWSG DAS UNTERNEHMEN 08 RWSG DIE ANLAGEN 11 WASSERAUFBEREITUNG
Wasser Regionale Wasserversorgung St.Gallen AG INHALTSVERZEICHNIS LEBENSELIXIER WASSER 03 NATÜRLICHE WASSERRESSOURCEN 04 WASSERSPEICHER BODENSEE 07 RWSG DAS UNTERNEHMEN 08 RWSG DIE ANLAGEN 11 WASSERAUFBEREITUNG
die WASSER WERKSTATT Wasserversorgung
 die WASSER WERKSTATT Wasserversorgung Inhalt: Nach UNO-Angaben haben rund 660 Millionen Menschen das ist weltweit knapp einer von zehn keinen täglichen Zugang zu sauberem Wasser und 2,4 Milliarden haben
die WASSER WERKSTATT Wasserversorgung Inhalt: Nach UNO-Angaben haben rund 660 Millionen Menschen das ist weltweit knapp einer von zehn keinen täglichen Zugang zu sauberem Wasser und 2,4 Milliarden haben
Protokoll zum Unterseminar Geomorphologie vom 10.12.2001
 Unterseminar Geomorphologie Wintersemester 2001/2002 Dr. A. Daschkeit Protokollant: Helge Haacke Protokoll zum Unterseminar Geomorphologie vom 10.12.2001 Fluvialgeomophologie Fluvial ( lat. fluvius = Fluß
Unterseminar Geomorphologie Wintersemester 2001/2002 Dr. A. Daschkeit Protokollant: Helge Haacke Protokoll zum Unterseminar Geomorphologie vom 10.12.2001 Fluvialgeomophologie Fluvial ( lat. fluvius = Fluß
Anlage 14 Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis. U81/ 1. Bauabschnitt Freiligrathplatz - Flughafen Terminal U 81 / 1. BAUABSCHNITT
 Anlage 14 Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis U81/ 1. Bauabschnitt Freiligrathplatz - Flughafen Terminal Stand: 3. September 2015 Version 3.3 Ansprechpartner: IGV - Ingenieurgemeinschaft Grassl Vössing
Anlage 14 Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis U81/ 1. Bauabschnitt Freiligrathplatz - Flughafen Terminal Stand: 3. September 2015 Version 3.3 Ansprechpartner: IGV - Ingenieurgemeinschaft Grassl Vössing
LÖSCHWASSER. Löschwasser für Ihre Sicherheit
 Löschwasser für Ihre Sicherheit Wasser ist trotz immer moderner werdenden Löschmittel und Löschtechniken nach wie vor das durch die Feuerwehr zur Brandbekämpfung am meist eingesetzte Löschmittel. Bei der
Löschwasser für Ihre Sicherheit Wasser ist trotz immer moderner werdenden Löschmittel und Löschtechniken nach wie vor das durch die Feuerwehr zur Brandbekämpfung am meist eingesetzte Löschmittel. Bei der
Merkblatt Nr. 1.6/3 Stand: 29. Januar 2008 alte Nummer: 1.6/3
 Bayerisches Landesamt für Umwelt Merkblatt Nr. 1.6/3 Stand: 29. Januar 2008 alte Nummer: 1.6/3 Ansprechpartner: Referat 94 Dezentrale Enthärtung Inhalt 1 Allgemeines...2 2 Enthärtungsverfahren...3 3 Auswirkung
Bayerisches Landesamt für Umwelt Merkblatt Nr. 1.6/3 Stand: 29. Januar 2008 alte Nummer: 1.6/3 Ansprechpartner: Referat 94 Dezentrale Enthärtung Inhalt 1 Allgemeines...2 2 Enthärtungsverfahren...3 3 Auswirkung
4) Die an die Kunden der Stadtwerke Asperg abgegebene Wassermenge im Jahr 2009 wird auf 650.000 m 3 prognostiziert.
 Vorlage Nr.: GR 75 /2008 Az.: 815.30 zur Sitzung des Auszüge: II (3), GEMEINDERATS öffentlich am 18.11.2008 Sachbearbeiter: Manfred Linder, Armin Huttenlocher, Daniel Schreiber Festsetzung des Wasserzinses
Vorlage Nr.: GR 75 /2008 Az.: 815.30 zur Sitzung des Auszüge: II (3), GEMEINDERATS öffentlich am 18.11.2008 Sachbearbeiter: Manfred Linder, Armin Huttenlocher, Daniel Schreiber Festsetzung des Wasserzinses
Sicherstellung der Löschwasserversorgung
 1 2 SächsBRKG Brandschutz umfasst den vorbeugenden Brandschutz und die Brandbekämpfung als abwehrenden Brandschutz sowie die technische Hilfe. 2 3 Sächs. BRKG Aufgabenträger 1. sind die Gemeinden für den
1 2 SächsBRKG Brandschutz umfasst den vorbeugenden Brandschutz und die Brandbekämpfung als abwehrenden Brandschutz sowie die technische Hilfe. 2 3 Sächs. BRKG Aufgabenträger 1. sind die Gemeinden für den
S T A D T G E M E I N D E G Ä N S E R N D O R F =====================
 S T A D T G E M E I N D E G Ä N S E R N D O R F ===================== Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Gänserndorf hat in seiner Sitzung am 7. September 2011 folgende W A S S E R A B G A B E N O R D N
S T A D T G E M E I N D E G Ä N S E R N D O R F ===================== Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Gänserndorf hat in seiner Sitzung am 7. September 2011 folgende W A S S E R A B G A B E N O R D N
Ziele heute. Sie kennen verschiedene Rohwasser- Ressourcen Sie können die Eignung für die Trinkwasserherstellung einschätzen
 1 Ziele heute Sie kennen verschiedene Rohwasser- Ressourcen Sie können die Eignung für die Trinkwasserherstellung einschätzen Wasservorkommen für die Trinkwassernutzung Wasserversorgung Wasservorkommen
1 Ziele heute Sie kennen verschiedene Rohwasser- Ressourcen Sie können die Eignung für die Trinkwasserherstellung einschätzen Wasservorkommen für die Trinkwassernutzung Wasserversorgung Wasservorkommen
Notwasserkonzept Basel Stadt (VTN)
 SBV Weiterbildungskurs, Campus Sursee 2015 Notwasserkonzept Basel Stadt (VTN) Inhalt der Präsentation Vorstellung IWB als Wasserversorger Kanton BS Konzept zur Umsetzung der Vorgaben der Verordnung über
SBV Weiterbildungskurs, Campus Sursee 2015 Notwasserkonzept Basel Stadt (VTN) Inhalt der Präsentation Vorstellung IWB als Wasserversorger Kanton BS Konzept zur Umsetzung der Vorgaben der Verordnung über
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Buchhorn, sehr geehrte Damen und Herren des Rat der Stadt Leverkusen,
 Von: An: Cc: Kraneis Detlev 01@stadt.leverkusen.de; Reinhard Buchhorn (oberbuergermeister@stadt.leverkusen.de) Thema: NETG Erdgas-Parallelleitung Lev-Hitdorf - GL-Paffrath: Beschlussvorlage Rat 2014/0128,
Von: An: Cc: Kraneis Detlev 01@stadt.leverkusen.de; Reinhard Buchhorn (oberbuergermeister@stadt.leverkusen.de) Thema: NETG Erdgas-Parallelleitung Lev-Hitdorf - GL-Paffrath: Beschlussvorlage Rat 2014/0128,
Planfeststellungsverfahren. von Fachplanungsrecht für Straße, Schiene, Wasser etc. von 1-13 a BauGB
 Wege zur Schaffung von Baurecht Baugenehmigungsverfahren auf Basis von 34 BauGB (Innenbereich) oder 35 BauGB (Außenbereich) Bauleitplanverfahren auf Basis von 1-13 a BauGB Planfeststellungsverfahren auf
Wege zur Schaffung von Baurecht Baugenehmigungsverfahren auf Basis von 34 BauGB (Innenbereich) oder 35 BauGB (Außenbereich) Bauleitplanverfahren auf Basis von 1-13 a BauGB Planfeststellungsverfahren auf
Betriebssatzung der Gemeindewerke der Gemeinde Alfter
 Betriebssatzung der Gemeindewerke der Gemeinde Alfter vom 27.10.2005 Verzeichnis der Änderungen Satzung vom Geänderte Regelungen 16.04.2014 3 Absatz 2 Betriebssatzung der Gemeindewerke der Gemeinde Alfter
Betriebssatzung der Gemeindewerke der Gemeinde Alfter vom 27.10.2005 Verzeichnis der Änderungen Satzung vom Geänderte Regelungen 16.04.2014 3 Absatz 2 Betriebssatzung der Gemeindewerke der Gemeinde Alfter
Das Amtsblatt finden Sie auch im Internet unter www.velbert.de
 Nr.14/2012 vom 4. Juli 2012 20. Jahrgang Inhaltsverzeichnis: (Seite) Bekanntmachungen 2 Auslegung von Karten, Erläuterungsbericht und Text der geplanten Verordnung zur Festsetzung des Überschwemmungsgebietes
Nr.14/2012 vom 4. Juli 2012 20. Jahrgang Inhaltsverzeichnis: (Seite) Bekanntmachungen 2 Auslegung von Karten, Erläuterungsbericht und Text der geplanten Verordnung zur Festsetzung des Überschwemmungsgebietes
EG-Wasserrahmenrichtlinie in NRW
 EG-Wasserrahmenrichtlinie in NRW Bewirtschaftungsplanung im Einzugsgebiet der Erft Gebietsforum, 18. Februar 2010, Euskirchen Dr. Thomas Oswald: Durchgeführte und geplante Maßnahmen der RWE Power AG RWE
EG-Wasserrahmenrichtlinie in NRW Bewirtschaftungsplanung im Einzugsgebiet der Erft Gebietsforum, 18. Februar 2010, Euskirchen Dr. Thomas Oswald: Durchgeführte und geplante Maßnahmen der RWE Power AG RWE
Trinkwasser für das Versorgungsgebiet
 Telefon: 06151 7018022 Telefax: 06151 7014019 in Zusammenarbeit mit Hessenwasser GmbH & Co. KG Trinkwasser für das Versorgungsgebiet Darmstadt (alle Ortsteile), Riedstadt (alle Ortsteile), Weiterstadt
Telefon: 06151 7018022 Telefax: 06151 7014019 in Zusammenarbeit mit Hessenwasser GmbH & Co. KG Trinkwasser für das Versorgungsgebiet Darmstadt (alle Ortsteile), Riedstadt (alle Ortsteile), Weiterstadt
Gefahren für den Boden
 1 Seht euch die Schnellstraße an. Was fällt euch dabei zum Boden ein? Exkursionseinheit 7 / Seite S 1 Was bedeutet "Flächen verbrauchen"? Spontan denkt man: Flächen kann man doch gar nicht verbrauchen!
1 Seht euch die Schnellstraße an. Was fällt euch dabei zum Boden ein? Exkursionseinheit 7 / Seite S 1 Was bedeutet "Flächen verbrauchen"? Spontan denkt man: Flächen kann man doch gar nicht verbrauchen!
Wasserbedarf. Speicher Wasservorkommen und Gewinnung. Pumpen Bedarf. Aufbereitung. Rohrleitungen. Brunnen Netz
 Wasserbedarf Speicher Wasservorkommen und Gewinnung Pumpen Aufbereitung Rohrleitungen Brunnen Netz 1 Ziele heute Sie kennen verschiedene Verbrauchsarten und können eine Wasserbedarfsprognose erstellen.
Wasserbedarf Speicher Wasservorkommen und Gewinnung Pumpen Aufbereitung Rohrleitungen Brunnen Netz 1 Ziele heute Sie kennen verschiedene Verbrauchsarten und können eine Wasserbedarfsprognose erstellen.
Petition an den Landtag NRW zur Verbesserung des Lärmschutzes an der A 1 in Hagen - Vorhalle. - Eine Initiative Vorhaller Bürgerinnen und Bürger -
 Petition an den Landtag NRW zur Verbesserung des Lärmschutzes an der A 1 in Hagen - Vorhalle - Eine Initiative Vorhaller Bürgerinnen und Bürger - 1 Warum diese Petition? Auf nachträglichen Lärmschutz an
Petition an den Landtag NRW zur Verbesserung des Lärmschutzes an der A 1 in Hagen - Vorhalle - Eine Initiative Vorhaller Bürgerinnen und Bürger - 1 Warum diese Petition? Auf nachträglichen Lärmschutz an
Wie viele Erwerbspersonen hat Nordrhein-Westfalen 2040/2060? Modellrechnung zur Entwicklung der Erwerbspersonen. Statistik kompakt 03/2016
 Statistik kompakt 03/2016 Wie viele Erwerbspersonen hat Nordrhein-Westfalen 2040/2060? Modellrechnung zur Entwicklung der Erwerbspersonen www.it.nrw.de Impressum Herausgegeben von Information und Technik
Statistik kompakt 03/2016 Wie viele Erwerbspersonen hat Nordrhein-Westfalen 2040/2060? Modellrechnung zur Entwicklung der Erwerbspersonen www.it.nrw.de Impressum Herausgegeben von Information und Technik
F. Klingel, S. Greassidis, S. Jaschinski, C. Jolk, A. Borgmann, H. Stolpe
 GIS als Lösungsansatz für die Entwicklung eines Planungs- und Entscheidungsunterstützungssystems für das Integrierte Wasserressourcenmanagement in Vietnam F. Klingel, S. Greassidis, S. Jaschinski, C. Jolk,
GIS als Lösungsansatz für die Entwicklung eines Planungs- und Entscheidungsunterstützungssystems für das Integrierte Wasserressourcenmanagement in Vietnam F. Klingel, S. Greassidis, S. Jaschinski, C. Jolk,
Trinkwasserverordnung 2001
 2001 Gültig Seit dem 01.01.2003 Trinkwasser ist ein verderbliches Lebensmittel ohne aufgedrucktes Verfalldatum Somit sind wir in der Lebensmittel verarbeitenden Branche tätig. Zapfstellenverordnung Die.
2001 Gültig Seit dem 01.01.2003 Trinkwasser ist ein verderbliches Lebensmittel ohne aufgedrucktes Verfalldatum Somit sind wir in der Lebensmittel verarbeitenden Branche tätig. Zapfstellenverordnung Die.
Gesundheitsamt. Betriebshandbuch. (Mustervorlage für nichtkommunale Trinkwasserversorgungsunternehmen des Hochsauerlandkreises)
 Gesundheitsamt Betriebshandbuch (Mustervorlage für nichtkommunale Trinkwasserversorgungsunternehmen des Hochsauerlandkreises) gemäß DVGW W 1000/W 1010 Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation
Gesundheitsamt Betriebshandbuch (Mustervorlage für nichtkommunale Trinkwasserversorgungsunternehmen des Hochsauerlandkreises) gemäß DVGW W 1000/W 1010 Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation
Agrarumweltmaßnahmen zur Biodiversitätsförderung auf dem Acker Perspektiven für die Umsetzung im künftigen ELER-Programm
 Agrarumweltmaßnahmen zur Biodiversitätsförderung auf dem Acker Perspektiven für die Umsetzung im künftigen ELER-Programm Tagung Bienenweiden, Blühflächen und Agrarlandschaft 26. / 27. November 2013, Berlin
Agrarumweltmaßnahmen zur Biodiversitätsförderung auf dem Acker Perspektiven für die Umsetzung im künftigen ELER-Programm Tagung Bienenweiden, Blühflächen und Agrarlandschaft 26. / 27. November 2013, Berlin
Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung) vom 26. November 2002
 Gemeinde Wüstenrot Landkreis Heilbronn Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung) vom 26. November 2002 Auf Grund von 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
Gemeinde Wüstenrot Landkreis Heilbronn Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung) vom 26. November 2002 Auf Grund von 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
Willkommen zur. Frühen Öffentlichkeitsbeteiligung Umgestaltung der Itter im Mündungsbereich und Sanierung des Rhein-Rückstaudeichs
 Willkommen zur Frühen Öffentlichkeitsbeteiligung Umgestaltung der Itter im Mündungsbereich und Sanierung des Rhein-Rückstaudeichs 17. August 2016 Tagesordnung 1. Begrüßung und Moderation Dipl.-Ing. Kristin
Willkommen zur Frühen Öffentlichkeitsbeteiligung Umgestaltung der Itter im Mündungsbereich und Sanierung des Rhein-Rückstaudeichs 17. August 2016 Tagesordnung 1. Begrüßung und Moderation Dipl.-Ing. Kristin
Woher kommt unser Trinkwasser?
 Woher kommt unser Trinkwasser? Von Jörg Breitenfeld Jeder Rheinland-Pfälzer verbraucht im Durchschnitt etwa 120 Liter Wasser am Tag. Die öffentliche Versorgung mit Wasser wird in von gut 250 Wasserversorgungsunternehmen
Woher kommt unser Trinkwasser? Von Jörg Breitenfeld Jeder Rheinland-Pfälzer verbraucht im Durchschnitt etwa 120 Liter Wasser am Tag. Die öffentliche Versorgung mit Wasser wird in von gut 250 Wasserversorgungsunternehmen
München installiert Wasserspender zum kostenlosen Auffüllen von Wasserflaschen
 Telefon: 233-26181 Telefax: 233-21136 Elisabeth Tietjens Seite Referat 1 für Arbeit und Wirtschaft Beteiligungsmanagement Stadtwerke und MVV München installiert Wasserspender zum kostenlosen Auffüllen
Telefon: 233-26181 Telefax: 233-21136 Elisabeth Tietjens Seite Referat 1 für Arbeit und Wirtschaft Beteiligungsmanagement Stadtwerke und MVV München installiert Wasserspender zum kostenlosen Auffüllen
80,00 80,00 0,00 0,00 Erwerbseinkommen Zwischensumme
 Bedarfsgemeinschaft 98802//0000018 Anlage zum Bescheid vom 15.07.2016 Vertreter der Bedarfsgemeinschaft: Müller, Hans Berechnung der Leistungen für Juli 2016 bis Juni 2017: Höhe der monatlichen Bedarfe
Bedarfsgemeinschaft 98802//0000018 Anlage zum Bescheid vom 15.07.2016 Vertreter der Bedarfsgemeinschaft: Müller, Hans Berechnung der Leistungen für Juli 2016 bis Juni 2017: Höhe der monatlichen Bedarfe
Anleitung Investitionsrechnung
 1 Anleitung Investitionsrechnung (Version 2.13, 26. Mai 2010) Dr. Dirk Köwener LEEN GmbH Schönfeldstraße 8 76131 Karlsruhe Programm starten Um das Tool nutzen zu können müssen die dazugehörigen Makros
1 Anleitung Investitionsrechnung (Version 2.13, 26. Mai 2010) Dr. Dirk Köwener LEEN GmbH Schönfeldstraße 8 76131 Karlsruhe Programm starten Um das Tool nutzen zu können müssen die dazugehörigen Makros
Grundwasserdatenbank Wasserversorgung
 VfEW DVGW VKU Städtetag Gemeindetag TZW Grundwasserdatenbank Wasserversorgung Regionalbeitrag zum 23. Jahresbericht Neue Metaboliten - und kein Ende in Sicht! Vorkommen von S-Metolachlor-Metaboliten im
VfEW DVGW VKU Städtetag Gemeindetag TZW Grundwasserdatenbank Wasserversorgung Regionalbeitrag zum 23. Jahresbericht Neue Metaboliten - und kein Ende in Sicht! Vorkommen von S-Metolachlor-Metaboliten im
Bewässerungstag Landwirtschaft Erlaubnisverfahren im Wasserrecht für die Bewässerung
 Bewässerungstag Landwirtschaft 11.02.2014 Erlaubnisverfahren im Wasserrecht für die Bewässerung Amt für Umwelt und Arbeitsschutz Frau Käfer 11.2.2014 Entnahmen aus Grundwasser und Oberirdischen Gewässern
Bewässerungstag Landwirtschaft 11.02.2014 Erlaubnisverfahren im Wasserrecht für die Bewässerung Amt für Umwelt und Arbeitsschutz Frau Käfer 11.2.2014 Entnahmen aus Grundwasser und Oberirdischen Gewässern
I. Angaben zum Objekt, Bauvorhaben
 Hinweis: Musterformular, welches individuell vom jeweiligen Sachkundigen als Unternehmer nach Art. 52 BayBO angepasst werden kann Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen durch Sachkundige nach der
Hinweis: Musterformular, welches individuell vom jeweiligen Sachkundigen als Unternehmer nach Art. 52 BayBO angepasst werden kann Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen durch Sachkundige nach der
Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer der Stadt Datteln vom
 Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer der Stadt Datteln vom 2.10.2014 Aufgrund der 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung
Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer der Stadt Datteln vom 2.10.2014 Aufgrund der 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung
