Kommunales Energiekonzept. Stadt Bad Belzig
|
|
|
- Chantal Amsel
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Kommunales Energiekonzept Stadt Bad Belzig
2 RENPlus Förderung des Landes Brandenburg Herausgeber: Stadt Bad Belzig Wiesenburger Straße Bad Belzig Durchführung: B.&S.U. Beratungs- und GFE Gesellschaft für Service-Gesellschaft Umwelt mbh Energieeffizienz mbh Saarbrücker Str. 38A, Helmholtzstr Berlin Berlin Tel Tel Fax Fax Projektleitung: Bearbeiter/-innen: Marc Hoffmann (GFE mbh), Sebastian Scholz (B.&S.U. mbh), René Rudolf (GFE mbh) Manuel Kobelt (GFE mbh), Julia Mügel (GFE mbh), Tilman Müller (B.&S.U. mbh), Ludger Schrempf (B.&S.U. mbh), André Stech (B.&S.U. mbh) Berlin, Mai 2013
3 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1. Kommunaler Energiebericht Kurzfassung Einleitung Energie-, CO 2 - und Schadstoffbilanz Szenarien, Leitbild, Ziele Controlling und Öffentlichkeitsarbeit Energiekonzept öffentliche Gebäude Energie- und Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Nutzung erneuerbarer Energien Beschreibung des Untersuchungsraumes Untergliederung in Teilräume Energie- und CO 2 -Bilanz Bestehende Energiekonzepte Bestandsaufnahme Ergebnisse der Energiebilanz Ergebnisse der CO 2 - und Schadstoffbilanz Schadstoffbilanz Szenarien, Leitbild, Ziele Potenzialanalyse mit Szenarien Szenarien bis Szenarien bis Zusammenfassung der Ergebnisse der Szenarienanalyse Ziele im Bereich Energieeffizienz, -einsparung und Klimaschutz Ziele Bund und Brandenburg für die Stadt Bad Belzig Controlling und Öffentlichkeitsarbeit Akteursbeteiligung Controlling Öffentlichkeitsarbeit i
4 Inhaltsverzeichnis 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bauhof Hauptgebäude Turnhalle Karl-Liebknecht-Straße Feld-Sport- und Mehrzweckhalle Albert-Baur Feuerwehr Hauptgebäude Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule Hauptgebäude) Krause-Tschetschog-Oberschule (Ganztagsgebäude) Krause-Tschetschog-Oberschule (Hauptgebäude) Kindertagesstätte Tausendfüßler Freizeit- und Erlebnisbad Teilobjekt Eisbahn (Technikgebäude) Bürgerhaus Bad Belzig Rathausgebäude Bad Belzig Kindertagesstätte 1 (Hauptgebäude) Jugendfreizeitzentrum POGO Gemeindehaus Bergholz Kindertagesstätte Lütte (Hauptgebäude) Gemeindehaus Neschholz Sondermaßnahme Wärmeverbundnetz Schulgelände Zusammenfassung der Potenzialbetrachtung der öffentlichen Gebäude Energie- und Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung Bestandsaufnahme und Analyse Optimierungspotenziale Untersuchung der Ortsteile Aktuelle Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Straßenbeleuchtung Zusammenfassung Energie- und Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Untersuchung Referenzobjekt: Goethestraße Untersuchung Referenzobjekt: Erich-Weinert-Straße ii
5 Inhaltsverzeichnis 8.3. Untersuchung Referenzobjekt: Weitzgrunder Straße Untersuchung Referenzobjekt: Kurpark Darstellung Klinkengrund Energetischer Gebäudebestand Darstellung Kurparksiedlung Energetischer Gebäudebestand Untersuchung Referenzobjekt: Straße der Einheit 15 - Altstadt Fördermittel Zusammenfassung Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Nutzung von erneuerbaren Energien Bestandsaufnahme Potenziale zur Nutzung von erneuerbaren Energien Biomasse Geothermie Windenergie Fernwärme Erdgas-Fahrzeuge Speichermöglichkeiten von erneuerbaren Energien Energieautarker Ortsteil: Dippmannsdorf Finanzierungs- und Betreibermodelle Fördermittel Zusammenfassung Nutzung von erneuerbaren Energien Quellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Einheitenverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Anhangsverzeichnis Anhang 1 Partizipation Anhang 2 Zentrale Annahmen der in der Potenzialanalyse eingesetzten Szenarien iii
6 Inhaltsverzeichnis Anhang 3 Leitbild Bad Belzig Anhang 4 Workshop Anhang 5 Befragung iv
7 1. Kommunaler Energiebericht Kurzfassung 1. Kommunaler Energiebericht Kurzfassung 1.1. Einleitung Die Stadt Bad Belzig liegt etwa 90 Kilometer südwestlich von Berlin und nahe der sächsischanhaltinischen Landesgrenze in Brandenburg. Die Kreisstadt von Potsdam-Mittelmark ist seit 1995 staatlich anerkannter Luftkurort und seit 2009 Thermalsoleheilbad seit 2010 trägt sie den Beinamen Bad. In der Stadt Bad Belzig und den 14 dazugehörigen Ortsteilen leben Einwohner. Die Energieversorgung erfolgt innerhalb der Kernstadt mit Fernwärme (Kurparksiedlung und Klinkengrund) und durch Erdgas. Außerhalb der Kernstadt kommen zur Wärmeversorgung nichtleitungsgebundene Energieträger zum Einsatz. Die Stadt beabsichtigt die lokalen Potenziale zur Energieeinsparung und zur Minderung der CO 2 -Emissionen zu erschließen und den Anteil der erneuerbaren Energien zu erhöhen. Das vorliegende kommunale Energiekonzept für die Stadt Bad Belzig unterstützt die Stadt dabei und wurde im Rahmen des RENPlus Förderprogrammes des Landes Brandenburg erstellt. Ein erster Schritt bei der Erstellung eines Energiekonzeptes ist die Bestandsaufnahme. Dazu wurde in der Stadt Bad Belzig eine Energie- und CO 2 -Bilanz differenziert nach Teilräumen, Sektoren und Energieträgern erstellt und in Bezug zu den bereits in den Jahren 1992 und 2000 erstellten Bilanzen gebracht. Aus der Bilanz für das Jahr 2010 wurden Potenziale in Form von Szenarien abgeleitet, die eine Einschätzung liefern, wie sich die Stadt Bad Belzig in energetischer Hinsicht entwickeln wird. Die entwickelten Szenarien wurden verglichen mit Zieldimensionen auf Bundes- und Landesebene. Auf diese Weise wurden realistische Zielsetzungen mit Bezug zu den Rahmenbedingungen des Landes und des Bundes formuliert. Die Szenarien und auch die Ziele stellen in dieser Vorgehensweise eine Draufsicht da. Um die Potenziale zu unterfüttern mit konkreten Berechnungen wurden Potenziale in den öffentlichen Gebäuden, bei der Straßenbeleuchtung, im Wohngebäudebestand und zur Nutzung erneuerbarer Energien ermittelt. Mit Hilfe dieser in Einzelmaßnahmen aufgeschlüsselten Potenziale wird der Stadt Bad Belzig eine konkrete Handlungsanweisung zur Erreichung der gesteckten Ziele gegeben Energie-, CO 2 - und Schadstoffbilanz Energiebilanz Insgesamt wurden im Jahr 2010 knapp 38 GWh Strom und ca. 97 GWh Endenergie Wärme verbraucht. Davon entfallen rund 49 GWh auf den Energieträger Erdgas und knapp 17 GWh auf Fernwärme. Den größten Anteil der nichtleitungsgebundenen Energieträger am Endenergieverbrauch macht der Energieträger Heizöl mit ca. 24 GWh aus. In Tabelle 1 sind die Endenergieverbräuche 2010 gesamt und differenziert nach Sektoren dargestellt. 5
8 1. Kommunaler Energiebericht Kurzfassung Energieträger Gesamt Endenergieverbrauch 2010 Private Haushalte Gewerbe, Industrie öffentliche Gebäude Sonderverbraucher [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] Strom Heizöl Erdgas Fernwärme Holz Umweltwärme Heizstrom Sonnenkollektoren Biogas Flüssiggas Braunkohle Erdgas (Tankstelle) Gesamt (ohne Strom) Tabelle 1: Endenergieverbrauch in der Stadt Bad Belzig 2010 nach Energieträgern und Sektoren Zur Einordnung der Ergebnisse und für einen Vergleich mit den Ergebnissen der Energiekonzepte von 1992 und 2000 wurden die Ergebnisse witterungsbereinigt dargestellt. [MWh] Endenergieverbrauch gesamt 2010 (witterungsbereinigt) nach Teilräumen Erdgas (Tankstelle) Braunkohle Flüssiggas Biogas Sonnenkollektoren Heizstrom Umweltwärme Holz Fernwärme Erdgas Heizöl EL Strom Klinkengrund Kurparksiedlung Sanierungsgebiet Altstadt sonstiges Kernstadtgebiet Ortsteile Abbildung 1: Endenergieverbrauch 2010 nach Teilräumen Der größte Endenergieverbrauch erfolgt auf dem Gebiet der sonstigen Kernstadt, hier dominiert der Energieträger Erdgas mit knapp 36 GWh. Rund MWh Endenergie werden in diesem Teilraum durch Heizöl verbraucht. Auch der Stromverbrauch liegt mit knapp 19 GWh auf diesem Territorium am höchsten. Der zweithöchste Endenergieverbrauch erfolgt auf dem Gebiet der Ortsteile. Hier ist der dominante Energieträger zur 6
9 1. Kommunaler Energiebericht Kurzfassung Wärmebereitstellung Heizöl. Die weitere Wärmebereitstellung erfolgt vergleichsweise heterogen durch Flüssiggas, Biogas, Braunkohle, Holz, Umweltwärme und Sonnenkollektoren. In dem Sanierungsgebiet Altstadt wird ein beträchtlicher Anteil der Wärme durch Erdgas bereitgestellt, auch Heizöl hat eine relativ hohe Relevanz. Die übrigen Energieträger zur Wärmebereitstellung spielen eine untergeordnete Rolle. Der Endenergieverbrauch in den Gebieten Klinkengrund und Kurparksiedlung wird fast ausschließlich durch die Energieträger Strom und Fernwärme bereitgestellt. Die Energiebilanzen der Jahre 1992 und 2000 haben den Energieträger Strom nicht betrachtet und das Stadtgebiet hatte noch nicht die heutigen Ausmaße. Für einen Vergleich mit der Energiebilanz 2000 wurde lediglich der Energieverbrauch zur Wärmebereitstellung in der Kernstadt betrachtet. Der Endenergieverbrauch ist insgesamt um 7 % oder 5 GWh gesunken (witterungsbereinigt), außerdem hat ein Energieträgerwechsel stattgefunden: es wurde 2010 deutlich weniger Fernwärme, Heizstrom, Flüssiggas und Braunkohle eingesetzt. Starke Zuwächse haben die Energieträger Erdgas und Holz verbucht. Endenergieverbrauch (witterungsbereinigt) Veränderung ohne Ortsteile und ohne Strom Energieträger / Sektoren <> 2010 [MWh] [%] [MWh] [%] [MWh] [%] Heizöl ,6% ,1% ,2% Erdgas ,6% ,2% ,4% Fernwärme ,8% ,5% ,0% Holz 94 0,1% 237 0,4% ,9% Umweltwärme 0 0,0% 27 0,0% 27 - Heizstrom 230 0,3% 62 0,1% ,1% Sonnenkollektoren 0 0,0% 53 0,1% 53 - Biogas 0 0,0% 0 0,0% 0 - Flüssiggas 240 0,3% 0 0,0% ,0% Braunkohle ,2% 377 0,6% ,1% Erdgas (Tankstelle) 0 0,0% 759 1,2% Gesamt (ohne Strom) ,0% ,0% ,9% Private Haushalte ,3% ,4% ,7% Gewerbe, Industrie ,3% ,9% 276 2,4% öffentliche Gebäude ,2% ,7% ,5% Sonderverbraucher ,2% ,9% ,8% Tabelle 2: Vergleich Endenergieverbrauch 2000 und 2010 Auch sektoral haben Verschiebungen beim Endenergieverbrauch stattgefunden. Die privaten Haushalte verbrauchen im Jahr ,7 % (oder knapp 7 GWh) weniger Endenergie als noch Auch in den öffentlichen Gebäuden wurde im Jahr ,5 % weniger Endenergie verbraucht. Ein Zuwachs ist bei den Sonderverbrauchern zu verzeichnen. Teil dessen ist die Erdgastankstelle, die im Jahr 2000 noch nicht installiert war, hier sind auch weitere nicht allokalisierte Erdgasverbräuche verbucht. 7
10 1. Kommunaler Energiebericht Kurzfassung [MWh] Endenergieverbrauch (witterungsbereinigt) ohne Ortsteile und ohne Strom Erdgas (Tankstelle) Braunkohle Flüssiggas Biogas Sonnenkollektoren Heizstrom Umweltwärme Holz Fernwärme Erdgas Heizöl Private Haushalte Gewerbe, Industrie öffentliche Gebäude Sonderverbraucher Abbildung 2: Vergleich der Endenergieverbräuche 1992, 2000 und 2010 In Abbildung 2 sind die Endenergieverbräuche sektoral und nach Energieträgern differenziert für die Jahre 1992, 2000 und 2010 dargestellt. Generell ist ersichtlich, dass der wesentliche Energieträgerwechsel von der Braunkohle zu anderen Energieträgern bereits zwischen den Jahren 1992 und 2000 stattgefunden hat. Ebenfalls hat sich der Endenergieverbrauch im Sektor der privaten Haushalte bereits zwischen 1992 und 2000 deutlich verringert. Dieser Trend setzt sich auch zwischen 2000 und 2010 fort, jedoch deutlich abgeschwächt. In den anderen Sektoren sind keine vergleichbaren Entwicklungen ablesbar CO 2 - und Schadstoffbilanz Aus den Ergebnissen der Energiebilanz wurde mit Hilfe von Emissionsfaktoren eine CO 2 - und Schadstoffbilanz berechnet. Dabei wird der verbrauchten Energiemenge je Energieträger ein Emissionswert zugeteilt. Insgesamt wurden auf dem Stadtgebiet Bad Belzig im Jahr 2010 ca t CO 2 emittiert, davon entfallen knapp t auf den Stromverbrauch. Durch den Erdgasverbrauch auf dem Stadtgebiet wurden über t CO 2 emittiert. Der Verbrauch von Heizöl ist für Emissionen von rund t CO 2 verantwortlich. Die Nutzung des Energieträgers Fernwärme verursacht Emissionen in Höhe von knapp t CO 2. 8
11 1. Kommunaler Energiebericht Kurzfassung [t CO 2 /a] CO 2 -Emissionen 2010 (witterungsbereinigt) nach Sektoren Erdgas (Tankstelle) Braunkohle Flüssiggas Biogas Sonnenkollektoren Heizstrom Umweltwärme Holz Fernwärme Erdgas Heizöl EL Strom Private Haushalte Gewerbe, Industrie öffentliche Gebäude Sonderverbraucher Abbildung 3: CO 2-Emissionen nach Sektoren Die mit Abstand meisten Emissionen werden in der Stadt Bad Belzig durch die privaten Haushalte verursacht. Es folgt der Sektor Gewerbe und Industrie. In diesem Sektor liegen die höchsten Emissionen durch Stromnutzungen vor, Emissionen durch die Nutzung von Wärmeenergie sind in diesem Sektor deutlich geringer als im Sektor der privaten Haushalte. Durch den Endenergieverbrauch in den öffentlichen Gebäuden werden Emissionen von rund t CO 2 verursacht. In diesem Sektor spielt der Stromverbrauch bei den Emissionen eine sehr untergeordnete Rolle, die wesentlichen Beiträge an den Gesamtemissionen in diesem Sektor werden durch den Gas- und Fernwärmeverbrauch verursacht (vgl. Abbildung 3). Die meisten Emissionen entfallen mit insgesamt rund t CO 2 auf das Gebiet der sonstigen Kernstadt und hier werden die meisten Emissionen durch den Verbrauch von Strom (knapp t CO 2 ), Erdgas (ca t CO 2 ) und Heizöl (ca t CO 2 ) verursacht. Auf dem Gebiet der Ortsteile werden insgesamt über t CO 2 emittiert und davon wurden mehr als die Hälfte der Emissionen durch Stromverbrauch verursacht (rund t CO 2 ). Weiterhin ist auf diesem Gebiet der Energieträger Heizöl für knapp t CO 2 verantwortlich und schließlich haben hier die nichtleitungsgebundenen Energieträger Flüssiggas (mit 621 t CO 2 ) und Braunkohle mit 338 t CO 2 einen vergleichsweisen hohen Anteil an den CO 2 -Emissionen. 9
12 1. Kommunaler Energiebericht Kurzfassung Energieträger CO 2 -Emissionen 2010 (witterungsbereinigt) Gesamt Klinkengrund Kurparksiedlung Sanierungsgebiet Altstadt sonstiges Kernstadtgebiet Ortsteile [t CO 2 /a] [t CO 2 /a] [t CO 2 /a] [t CO 2 /a] [t CO 2 /a] [t CO 2 /a] Strom Heizöl Erdgas Fernwärme Holz Umweltwärme Heizstrom Sonnenkollektoren Biogas Flüssiggas Braunkohle Erdgas (Tankstelle) Gesamt (ohne Strom) Tabelle 3: CO 2-Emissionen nach Teilräumen Die Schadstoffemissionen haben insgesamt sehr deutlich zwischen den Jahren 1992 und 2000, aber auch zwischen 2000 und 2010, abgenommen, vor allem der starke Rückgang der Braunkohlenutzung hat zu massiven Emissionsminderungen geführt. Die Gesamtergebnisse der Schadstoffbilanz sind in Tabelle 3 im Vergleich mit den Emissionen 1992 und 2000 dargestellt. Sonstige Schadstoffemissionen SO 2 NO X CO Staub [kg/a] [kg/a] [kg/a] [kg/a] Tabelle 4: Sonstige Schadstoffemissionen gesamt 1992, 2000 und Szenarien, Leitbild, Ziele Szenarien Durch Auswertung von Studien und Übertragen der Ergebnisse auf die Situation in Bad Belzig wurde die Entwicklung des Endenergieverbrauchs dargestellt. Ausgangsjahr für die Entwicklung der Szenarien für Bad Belzig sind die Werte für den Endenergieverbrauch des Jahres 2010 (witterungsbereinigt). Erstellt wurden zwei Szenarien, das Referenzszenario stellt die wahrscheinliche Entwicklung dar, im Klimaszenario sind weitere Energiespar- und -effizienzmaßnahmen angenommen. Die Szenarien wurden bis zum Jahr 2030 entwickelt, für abzuleitende Maßnahmen ist aber der Zeithorizont bis 2020 praktikabler, so das in 10
13 1. Kommunaler Energiebericht Kurzfassung Tabelle 23 die witterungsbereinigten Endenergieverbräuche für das Startjahr 2010 und die prognostizierten Verbräuche 2020 für das Referenz- und Klimaszenario dargestellt sind. Startjahr Referenzszenario Klimaszenario Energieträger 2010 [MWh] Absolut 2020 [MWh] 2010 << 2020 [%] Absolut 2020 [MWh] 2010 << 2020 [%] Umweltwärme ,6% ,3% Strom ,9% ,7% Sonnenkollektoren ,4% ,2% Holz ,4% 667 8,3% Heizöl ,1% ,7% Flüssiggas ,7% ,9% Fernwärme ,7% ,3% Erdgas ,3% ,3% Braunkohle ,0% ,8% Biogase ,3% ,3% Summe ,3% ,8% Tabelle 5: Szenarien Endenergieverbrauch bis 2020 nach Energieträgern Im Jahr 2020 wird nach dem Referenzszenario ein Rückgang des Gesamtendenergieverbrauchs von 19,3 % prognostiziert. Die relativen Veränderungen sind besonders groß bei den Energieträgern Braunkohle, Flüssiggas und Heizöl, hier ist eine relative Abnahme von jeweils über 30 % prognostiziert. Die Energieträger zur Wärmebereitstellung Erdgas (-19,3 %) und Fernwärme (-16,7 %) nehmen ebenfalls deutlich ab. Auch der Stromverbrauch wird bis 2020 um knapp 15 % abnehmen. Dagegen ist für die erneuerbaren Energieträger Umweltwärme, Sonnenkollektoren Holz und Biogase ein Zuwachs vorhergesagt. Nach dem Klimaszenario ergibt sich ein ähnliches Bild. Insgesamt wird erwartet, dass der Endenergieverbrauch um knapp 24 % abnimmt. Die zusätzliche prognostizierte Minderung des Strom- und Wärmeverbrauchs führt zu einer noch größeren Minderung der fossilen Energieträger und Strom. Ein wesentlicher Treiber der Energieverbrauchsminderung ist die prognostizierte abnehmende Einwohnerzahl der Stadt Bad Belzig, denn verkürzt betrachtet verbrauchen weniger Einwohner auch weniger Energie. Für eine Entwicklung von Zielen wurde daher folgend mit einwohnerbezogenen Energieverbrauchswerten gearbeitet Leitbild und Ziele Von 2010 bis 2011 wurde in der Stadt Bad Belzig ein Leitbild für 2030 entworfen. Neben einer Präambel sind insgesamt zehn Oberziele unter anderem die Umsetzung der Agenda 21 zur nachhaltigen Entwicklung und 19 Ziele für insgesamt sechs Handlungsfelder definiert. Zusätzlich wurde ein weiteres Handlungsfeld Innovative Projekte und Ideen mit konkreten Maßnahmenvorschlägen und einer Priorisierung erarbeitet. Als langfristige Projekte wurden in diesem Handlungsfeld die Energieautarke Region PM mit der Kurstadt Bad Belzig und Atomstromfreies Bad Belzig benannt. Auf Ebene des Landkreises Potsdam-Mittelmark existiert ebenfalls ein Leitbild. In diesem wird unter anderem benannt, 11
14 MWh/Jahr 1. Kommunaler Energiebericht Kurzfassung dass sich Potsdam-Mittelmark als Träger der Energiewende versteht. Konkrete Ziele sind auf Bundes- und Landesebene formuliert. Die höchstrangigsten Ziele wurden zur Entwicklung eines Zielpfades genutzt: 1) Endenergieverbrauch -23 % (Basis 2007) oder -1,1 % jährlich (Brandenburgziel), 2) 50 % des Endenergieverbrauch durch erneuerbare Energien (Brandenburgziel), 3) Primärenergieverbrauch bis % (Basis 2008), bis % (Bundesziel). Bezogen auf den Pro-Kopf-Endenergieverbrauch in Bad Belzig ergeben sich die in Abbildung Entwicklung des Energieverbrauchs 2010 und Ziele Bund und Brandenburg (witterungsbereinigt) Zielpfad Bund und Brandenburg 10 Referenzszenario 9 8 Klimaszenario 7 6 Abbildung 4: Ziele Bund und Brandenburg und Referenz- und Klimaszenario bezogen auf die Bevölkerungsentwicklung in Bad Belzig 4 dargestellten Potenziale und der Zielpfad Bund und Brandenburg. Ohne wesentliche zusätzliche Anstrengungen sind gemäß dem Referenzszenario bis zum Jahr 2020 Einsparungen beim Pro-Kopf-Endenergieverbrauch von rund 9,2 % auf ca. 9,7 MWh zu erwarten, bis 2030 nimmt der Pro-Kopf-Endenergieverbrauch um 17,5 % auf 8,8 MWh ab. Zur Erreichung der Ziele des Landes und des Bundes müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden. Entwickelt sich die Stadt dem Klimaszenario folgend, resultiert bis 2020 eine Minderung um rund 14,3 % auf ca. 9,1 MWh; bis 2030 nimmt in diesem Szenario der Pro-Kopf- Endenergieverbrauch um knapp 30 % auf ca. 7,6 MWh ab die Ziele des Landes und des Bundes wären in diesem Szenario erfüllt Controlling und Öffentlichkeitsarbeit Projektbegleitend wurden Akteure in einer Steuerungsgruppe eingebunden um so die Vorgehensweise zu legitimieren, Zwischenergebnisse zu präsentieren und das Konzept schon während der Entstehungsphase vor Ort zu erden. Zusätzlich wurde ein Kreativworkshop durchgeführt und gemeinsam mit wichtigen Akteuren Maßnahmen 12
15 1. Kommunaler Energiebericht Kurzfassung entwickelt. Zur Einbindung der breiten Öffentlichkeit wurde zu Beginn des Projektes eine Befragung durchgeführt. Die Einrichtung eines Controlling-Systems Bad Belzig ist entscheidend für voranschreitende Energieeffizienz und stetigen Klimaschutz. Es dient der Erfolgskontrolle der gesteckten Ziele sowie der Überprüfung der Effizienz der geplanten bzw. durchgeführten Maßnahmen. Dazu müssen personelle Voraussetzungen geschaffen werden und es bedarf einer organisatorischen Verankerung des Prozesses. Mittels einer gezielten Kommunikation ist es möglich Energieeffizienz, -einsparungen und den Klimaschutz in der Stadt Bad Belzig stärker in das öffentliche Bewusstsein zu rücken, handlungsleitende Informationen zu vermitteln, die unterschiedlichen Zielgruppen zu Verhaltensänderungen und einer aktiven Beteiligung zu motivieren und darüber hinaus zum Leitbild der Stadt Bad Belzig der nachhaltigen Entwicklung beizutragen Energiekonzept öffentliche Gebäude Im Rahmen der durchgeführten Potenzialanalyse der zu untersuchenden kommunalen Liegenschaften wird deutlich, dass sich rein quantitativ noch erhebliche Energieeinspareffekte bei der Gebäudesubstanz erzielen lassen. Für den Erhalt der Gebäudesubstanz und zur Förderung einer energieeffizienten Bewirtschaftung gilt es, für zukünftige Sanierungsvorhaben die Potenziale eines jeden Gebäudes weiterführend zu untersuchen und darauf abgestimmte Maßnahmen zu definieren. Die wesentlichen Maßnahmen umfassen: Dämmmaßnahmen der Gebäudehülle (Fassade, Dach, Kellerdecken), Austausch von Fenstern und Außentüren, Ertüchtigung bzw. Neuausrichtung der Anlagentechnik eines Gebäudes. Auch wenn der Anteil des Energiebedarfs der kommunalen Liegenschaften bezogen auf den städtischen Gesamtenergiebedarf vergleichsweise gering ist, sollte die Stadt Bad Belzig seiner Vorbildwirkung für Ressourceneffizienz und Klimaschutz nachkommen. Darüber hinaus stehen die Anstrengungen auch im finanziellen Interesse der Kommune, da monetäre Einsparungen im Unterhalt der Gebäude der Stadt zu Gute kommen und die Gebäudesubstanz langfristig gesichert wird. Die folgende Tabelle 6 bietet einen zusammenfassenden Überblick der untersuchten Objekte mit den entsprechenden Maßnahmenempfehlungen und den daraus resultierenden Einspareffekten. Zudem stellt die Reihenfolge der angeführten Liegenschaften eine Priorisierung, gemessen an der Höhe der zu erwartenden Minderung des Energieverbrauches durch die Umsetzung der beschrieben Maßnahmenempfehlungen, dar. 13
16 1. Kommunaler Energiebericht Kurzfassung Gebäude Krause-Tschetschog- Oberschule Kindertagesstätte Tausendfüssler 3-Feld-Sport-Halle Albert-Baur Rathausgebäude Bad Belzig Bauhof Hauptgebäude Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule Hauptgebäude) Kindertagesstätte 1 (Hauptgebäude) Geschwister-Scholl-Schule (Oberschule Ganztagsgebäude) Jugendfreizeitzentrum POGO Turnhalle Karl-Liebknecht- Straße Gemeindehaus Bergholz Kindertagesstätte Lütte (Hauptgebäude) Gemeindehaus Neschholz Feuerwehr Hauptgebäude Maßnahmenempfehlung Sanierung der thermischen Hüllflächen Einbau Lüftungsanalage Austausch Beleuchtung Einzelraumregelung Reduzierung Kesselleistung/ Optimierung Hydraulik Sanierung der thermischen Hüllflächen Austausch Kesselanlage/ Optimierung Hydraulik Sanierung der thermischen Hüllflächen Optimierung Lüftung Optimierung Heizungshydraulik Sanierung der thermischen Hüllflächen Austausch Kesselanlage/ Optimierung Hydraulik Sanierung der thermischen Hüllflächen Zusammenschluss der Heizkreise Austausch Beleuchtung Sanierung der thermischen Hüllflächen Einzelraumregelung Austausch Beleuchtung Sanierung der thermischen Hüllflächen Austausch Kesselanlage/ Optimierung Hydraulik Sanierung der Fassadenflächen mit WDVS-System Einzelraumregelung Austausch Beleuchtung Sanierung der thermischen Hüllflächen Austausch Beleuchtung Optimierung Lüftungsanalage Austausch Beleuchtung Sanierung der thermischen Hüllflächen Austausch Beleuchtung Einzelraumregelung Rückbau Nachtspeicheröfen Sanierung der thermischen Hüllflächen Austausch Beleuchtung Energie- Einsparung ca. 296 MWh/a ca. 228 MWh/a ca. 105,5 MWh/a ca. 84,4 MWh/a ca. 67,9 MWh/a ca. 65,5 MWh/a ca. 33,5 MWh/a ca. 27,5 MWh/a ca. 21 MWh/a ca. 12 MWh/a Tabelle 6: Übersicht Einsparungen öffentliche Gebäude 14
17 1. Kommunaler Energiebericht Kurzfassung 1.6. Energie- und Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung Die Bestandsaufnahme hat verdeutlicht, dass im Bereich der Straßenbeleuchtung bereits viele Optimierungsmaßnahmen durchgeführt worden sind. So wurde bereits ein Großteil der veralteten Quecksilberdampflampen (HQL) gegen Natriumdampfhochdrucklampen (NAV) ausgetauscht, welche dem Stand der Technik entsprechen. Da jedoch noch ein Teil der HQL-Lampen vorhanden ist, wird empfohlen, diese gegen effizientere Natriumdampflampen, Halogenmetalldampflampen oder LED-Technik zu ersetzen. Weitere Einsparpotenziale liegen in der Optimierung der Lichtverteilung der Leuchten sowie der Reduktion der Vollbetriebsstunden durch eine bedarfsgerechte Steuerung Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Auf Basis vorhandener Unterlagen wurden insgesamt fünf Referenzobjekte stellvertretend für die Wohngebiete Klinkengrund, Kurparksiedlung sowie die Altstadt untersucht. Die Bestandsaufnahme zeigte, dass die untersuchten Gebäude im Klinkengrund und in der Kurparksiedlung zwischen 1992 und 2004 bereits saniert bzw. neu erbaut worden sind. Eine Sanierung der thermischen Hülle wird daher im ersten Schritt nicht empfohlen. Im Bereich der Anlagentechnik konnten jedoch direkte Optimierungsmaßnahmen ausfindig gemacht werden. Wenn eine Sanierung zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet, wird eine Unterschreitung der aktuellen Grenzwerte unter Einsatz von ökologischen Dämmstoffen empfohlen. In der historischen Altstadt können durch die verschiedenen Gebäudetypen, welche sich hinsichtlich Gebäudestruktur, Denkmalschutz, Baujahr u. a. zum Teil deutlich unterscheiden, keine Aussagen für das ganze Stadtgebiet getroffen werden. Für das Referenzgebäude konnten jedoch unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes Einsparpotenziale im Bereich der thermischen Hülle definiert werden Nutzung erneuerbarer Energien In diesem Kapitel wurden verschiedene erneuerbare Energien hinsichtlich Nutzungs- und Anwendungsmöglichkeiten in Bad Belzig untersucht. Dabei werden unter Berücksichtigung der regionalen Gegeben- bzw. Besonderheiten Aussagen, unter anderem zur Nutzung von Sonnen- und Windenergie und zu den Einsatzmöglichkeiten von Kraft-Wärme-Kopplungsund Geothermieanlagen getätigt bis hin zur Darstellung des Umsetzungsschemas einer Anlagenkonzeption zur bilanziellen Eigenversorgung des Ortsteils Dippmannsdorf. Der Einsatz von PV-Anlagen kann auf Gebäudedächern oder auf dafür nutzbaren Freiflächen in Betracht gezogen werden. Für die großflächige Nutzung von Aufdachanlagen ist das Wohngebiet Klinkengrund gut geeignet. In diesem Gebiet sind viele große Flach- und Schrägdächer mit Südausrichtung vorhanden (vgl. Tabelle 7). 15
18 1. Kommunaler Energiebericht Kurzfassung Dachtyp Dachfläche Leistung PV Ertrag CO 2 - Einsparung Erwartete Investitionskosten [m²] [kw p ] [kwh/a] [t/a] 1 [Mio. EUR] Flachdächer ca ca ca. 1,3 Schrägdächer ca ca ca. 0,6 Tabelle 7: Potenziale PV Bad Belzig Mit der erzeugbaren Strommenge könnten rein rechnerisch ca. 190 Haushalte (bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch eines 4-Personen-Haushaltes von kwh/a) versorgt werden. Ebenfalls wurden im Bereich der Biomassenutzung und folglich Biogaserzeugung durch die Restholzverwertung, die Nutzung von Grünschnitt, Gülle sowie Silagen Nutzungspotenziale ermittelt. Diese Potenziale stehen jedoch nicht in vollem Umfang zur Verfügung, da diese bereits in den bestehenden Verwertungsanlagen (Werbig, Schwanebeck) zur Energieerzeugung genutzt werden. Daher wird eine Zusammenarbeit mit anderen Kommunen bzw. die Intensivierung der Kooperation im Bereich der Klärgasnutzung für sinnvoll erachtet. Ähnliche Überlegungen können auch bezüglich der Nutzung von Windenergie in Betrachtung gezogen werden. Da aufgrund der ausgedehnten Naturschutzgebiete innerhalb der Kommune Bad Belzig keine Vorranggebiete für Windparkanlagen ausgewiesen sind, kann auch hier eine interkommunale Zusammenarbeit, beispielhaft mit der Gemeinde Treuenbrietzen angestrebt werden. In einem weiteren Untersuchungsabschnitt wurden die Anreize zur Nutzung erdgasbetriebener Fahrzeuge im Stadtgebiet Bad Belzig im Hinblick auf gesteigerte Auslastung der vorhandenen Erdgastankstelle betrachtet. Hier werden die Potenziale vorrangig in der Eigeninitiative und folglich der Vorbildwirkung der Stadt Bad Belzig gesehen, die mit der Umrüstung bzw. der Umstellungen der kommunalen Fahrzeugflotte auf Erdgasbetrieb mit gutem Beispiel vorangehen. Darüber hinaus ist auch die Nutzung von gasbetriebenen Linienbussen im öffentlichen Nahverkehr denkbar. Mit eigenen Erfahrungswerten der Mitarbeiter und öffentlicher Aufklärung steht die Stadt auch interessierten Bürgern für Fragen zu dieser Thematik zur Verfügung und kann die Verbreitung gasbetriebener Fahrzeuge aktiv unterstützen. In einer exemplarischen Betrachtung zur bilanziellen Eigenversorgung des Ortsteils Dippmannsdorf wurde ein theoretisches Versorgungskonzept erstellt, in dem die vorangegangen Betrachtungen und regionalen Potenziale der erneuerbaren Energien zusammenfließen. Bei der Betrachtung des energieautarken Ortsteils spielt die Nutzung von Biogas über BHKW und virtuelle Kraftwerke eine bedeutende Rolle. Eine Ergänzung der 1 Angesetzter Faktor für CO 2-Emissionen: 475 g/kwh Strom 16
19 1. Kommunaler Energiebericht Kurzfassung Energiebereitstellung erfolgt über Photovoltaik- und Solarthermieanlagen, oberflächennahe Geothermie sowie entsprechende Speichertechnologien. Im Zusammenspiel der abgestimmten Anlagenkomponenten wird deutlich, dass sich die Eigenversorgung nicht als energieautarker Ortsteil umsetzen lässt, da sich aufgrund der regionalen Gegebenheiten die vorhandenen Potenziale nur eingeschränkt nutzen lassen. Daher sollte die Begrifflichkeit der Energieautarkie in diesem Zusammenhang vermieden werden. 17
20 2. Beschreibung des Untersuchungsraumes 2. Beschreibung des Untersuchungsraumes Die Stadt Bad Belzig liegt im Land Brandenburg und ist die Kreisstadt des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Die Stadt liegt etwa 90 Kilometer südwestlich von Berlin nahe der sächsisch-anhaltinischen Landesgrenze. Sie ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg und mit dem Ortsteil Fredersdorf Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Historische Dorfkerne im Land Brandenburg. Etwa 85 % des Stadtgebiets Bad Belzigs liegen innerhalb des Naturparks Hoher Fläming 2. Die Stadt war seit 1995 staatlich anerkannter Luftkurort und ist seit 2009 Thermalsoleheilbad seit März 2010 trägt die Stadt Belzig den Städtebeinamen Bad. Abbildung 5: Die Lage Bad Belzigs im Landkreis Potsdam-Mittelmark und im Land Brandenburg 3 Zum hatten Einwohner 4 ihren Hauptwohnsitz in der Stadt Bad Belzig mit den 14 Ortsteilen gemeldet. Davon leben etwa 67% 5 innerhalb der Kernstadt mit den Stadtteilen: Altstadt, Kurparksiedlung und Klinkengrund. 2 IDAS Planungsgesellschaft mbh: Flächennutzungsplan Begründung Entwurf. März Online abrufbar: Angaben der Bauverwaltung der Stadt Bad Belzig. 5 Stadt Bad Belzig: Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Bad Belzig, Bad Belzig (2012) 18
21 2. Beschreibung des Untersuchungsraumes Neben der Kernstadt gehören zu Bad Belzig die folgenden Ortsteile: Bergholz, Borne, Dippmannsdorf, Fredersdorf, Groß Briesen mit dem Gemeindeteil Klein Briesen, Hagelberg mit dem Gemeindeteil Klein Glien, Kuhlowitz mit dem Gemeindeteil Preußnitz, Lübnitz, Lüsse, Lütte, Neschholz, Ragösen, Schwanebeck und Werbig mit den Gemeindeteilen Egelinde, Hohenspringe und Verlorenwasser. In Abbildung 6 ist eine Karte der Stadt Bad Belzig abgebildet mit Abgrenzung der einzelnen Ortsteile und den Einwohnern zum Stichtag
22 2. Beschreibung des Untersuchungsraumes Abbildung 6: Karte der Stadt Bad Belzig mit Ortsteilen und Einwohnerzahlen In der folgenden Untergliederung werden die wesentlichen und in Hinblick auf das Energiekonzept relevanten Rahmenbedingungen und Strukturdaten der Stadt Bad Belzig dargestellt. Flächennutzung Bad Belzig hat eine Fläche von 234,8 km² und eine Bevölkerungsdichte von 48 Einwohnern pro Quadratkilometer und hat damit eine Bevölkerungsdichte weit unterhalb des Kreisdurchschnitts (79 EW/km²). 7 Die geringe Einwohnerdichte ist typisch für die Struktur des ländlichen Raumes Bad Belzig. Im nördlichen Teil des Stadtgebiets überwiegen die 6 Quelle: 7 LBV Landesamt für Bauen und Verkehr: Mittelbereichsprofil Bad Belzig Online abrufbar: 20
23 Einwohner 2. Beschreibung des Untersuchungsraumes Waldflächen, das südliche Stadtgebiet ist geprägt von etwa gleichen Anteilen Landwirtschafts- und Waldflächen. 8 Bevölkerungsentwicklung In den vergangenen Jahren ist die Stadt Bad Belzig geschrumpft. Zwischen 1992 und 2008 hat die Bevölkerungszahl um 3,1 % abgenommen 9 und Prognosen zufolge soll dieser Trend anhalten. Bis zum Jahr 2030 soll die Einwohnerzahl um insgesamt knapp 22 % bezogen auf das Jahr 2008 abnehmen. Daraus würde eine Bevölkerung von insgesamt ca Einwohnern resultieren. 10 In Abbildung 7 ist die Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2008 als Linie dargestellt. Die gestrichelte Linie stellt die Prognose des statistischen Landesamts Berlin-Brandenburg dar. Die eingezeichneten Punkte markieren die tatsächlichen Einwohnerzahlen in den Jahren 2010 und Die tatsächliche Bevölkerungsabnahme verlief bis 2011 deutlich langsamer als von der Prognose vorhergesagt Einwohnerzahl bis 2008 Prognose Einwohnerzahl 2010 / Jahr Abbildung 7 Bevölkerungsentwicklung in Bad Belzig von 2000 bis 2008 und Prognose bis Die Bertelsmann Stiftung klassifiziert Bad Belzig als schrumpfende und alternde Stadt mit hoher Abwanderung. 12 Charakteristisch für diesen Demografietyp ist die rückläufige und deutlich älter werdende Bevölkerung. Das Durchschnittsalter lag im Jahr 2009 bei 45,8 Jahren und soll bis 2030 auf 51,4 Jahren ansteigen. 13 Zum Vergleich: im Landkreis Potsdam- Mittelmark lag das Durchschnittsalter 2008 bei 44,0 Jahren; im Land Brandenburg bei 8 IDAS Planungsgesellschaft mbh: Flächennutzungsplan Begründung Entwurf. März Online abrufbar: 9 Landkreis Potsdam-Mittelmark: Demografiebericht Nr. 1. Oktober Ebd. 11 Darstellung eigen. Daten nach Landkreis Potsdam-Mittelmark: Demografiebericht Nr. 1. Oktober 2010 nach Amt für Statistik Berlin-Brandenburg und Landesamt für Bauen und Verkehr. 12 Bertelsmannstiftung: Demografiebericht Bad Belzig Ebd. 21
24 2. Beschreibung des Untersuchungsraumes 44,9 Jahren. 14 Im Jahr 2008 lag die Zahl der gestorbenen Bad Belziger um 39 höher als die Zahl der geborenen. 15 Wohnungsbestand Im Jahr 2006 hatte die Stadt Bad Belzig einen Bestand von insgesamt 5517 Wohnungen. 16 Die durchschnittliche Wohnfläche pro Person beträgt 39,0 m² und der Anteil der Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern liegt bei 53,1 %. 17 Nur 34,3 % der Haushalte sind Singlehaushalte. Schwerpunkte der Ein- und Zweifamilienhausbebauung sind die Ränder der Kernstadt und die Ortsteile. Die wesentlichen Mehrfamilienhaussiedlungen liegen mit den Stadtteilen Klinkengrund und Kurparksiedlung im Hauptort. Gewerbestruktur und Wirtschaft Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg definiert die Stadt Bad Belzig als Mittelzentrum mit der Funktion der gehobenen Daseinsvorsorge mit regionaler Bedeutung. Dazu gehören insbesondere: Wirtschafts- und Siedlungsfunktionen, Einzelhandelsfunktionen, Kultur- und Freizeitfunktionen, Verwaltungsfunktionen, Bildungs-, Gesundheits-, soziale Versorgungsfunktionen sowie überregionale Verkehrsknotenfunktionen. 18 Handwerk und mittelständische Betriebe prägen die Wirtschaftsstruktur des Stadtgebiets. Die Einzelhandelsfunktionen sind, bis auf wenige Ausnahmen, in der Stadt Bad Belzig konzentriert. Dort prägt kleinteiliger Einzelhandel die historische Altstadt. An den Ausfallstraßen finden sich Super- und Discountmärkte und ähnliche Geschäfte. Ein wichtiger Arbeitgeber in der Stadt ist das Johanniter-Krankenhaus im Fläming Bad Belzig. Im Osten der Stadt Bad Belzig befindet sich der 22,5 ha große Gewerbepark Seedoche. In der Stadt Bad Belzig befindet sich die Kreisverwaltung des Landkreises Potsdam- Mittelmark. In der traditionellen Kreisstadt ist die Verwaltung ein wichtiger Arbeitgeber. Tourismus und Gastronomie spielen eine zunehmende Rolle für die Wirtschaft der Stadt. Mit der Burg Eisenhardt, dem Heimatmuseum, der SteinTherme, dem Kurpark, dem Freizeitzentrum und der Reha-Klinik verfügt die Stadt über die entsprechende Infrastruktur, die über die städtische Touristeninformation beworben wird. Die städtische Kur- und Freizeit GmbH betreibt die SteinTherme. Im Jahr 2012 war Bad Belzig der zentrale Austragungsort des 112. Deutschen Wandertags. 14 Landkreis Potsdam-Mittelmark: Demografiebericht Nr. 1. Oktober Landkreis Potsdam-Mittelmark: Demografiebericht Nr. 1. Oktober IDAS Planungsgesellschaft mbh: Flächennutzungsplan Begründung Entwurf. März Online abrufbar: 17 Bertelsmannstiftung: Demografiebericht Bad Belzig Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin Brandenburg: Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B). März
25 2. Beschreibung des Untersuchungsraumes Kommunale und öffentliche Gebäude Neben der Stadtverwaltung beherbergt Bad Belzig als Kreisstadt Landratsämter mit Standorten in der Niemöllerstraße, dem Papendorfer Weg, der Steinstraße und der Ernst- Thälmann-Straße. Weitere Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung sind die Agentur für Arbeit in der Brücker Landstraße, die Straßenmeisterei in der Niemegker Straße und der Bauhof des Landkreises im Gewerbepark Seedoche. Die örtliche Polizeiwache liegt in der Schloßstraße 2, die freiwillige Feuerwehr verfügt über Standorte in der Kernstadt und allen Ortsteilen mit Ausnahme des Ortsteils Borne. Auf dem Stadtgebiet Bad Belzigs befinden sich Bildungseinrichtungen der Primar- und Sekundarstufe. Im Hauptort befinden sich Grundschule, Oberschule, das Fläming- Gymnasium, eine Förderschule für geistig Behinderte, die freie Schule Fläming und eine Kreismusik- und Volkshochschule. Im Ortsteil Dippmannsdorf befindet sich eine weitere Grundschule. 19 Auf dem Stadtgebiet wurden 2010 insgesamt 7 Kindertagesstätten und Horte durch die Stadt oder freien Trägern betrieben. Mit den Turnhallen Puschkin, Karl- Liebknecht und Albert Baur befinden sich drei gedeckte Sportstätten in der Kernstadt. Im Ortsteil Dippmannsdorf befindet sich eine weitere Turnhalle. Darüber hinaus befinden sich in Bad Belzig mit einer Kegelbahn, der SteinTherme und einem Fitnesscenter weitere Sportund Freizeiteinrichtungen. 20 Verkehr Das Stadtgebiet liegt zwischen der in Ost-West-Richtung verlaufenden Autobahn A2 und der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Autobahn A9. Die nächsten Anschlussstellen sind in Brandenburg (BAB 2, 25 km) und Niemegk (BAB 9, 10 km). Die Bundesstraßen B 102 (Brandenburg an der Havel Luckau) und B 246 (Magdeburg - Eisenhüttenstadt) kreuzen sich in Bad Belzig. Darüber hinaus liegt Bad Belzig an der Regionalbahnstrecke RE 7 zwischen Berlin und Dessau. Die Verkehrsgesellschaft Belzig mbh des Landkreises betreiben ein dichtes Busliniennetz aus insgesamt 27 Linien im Landkreis Potsdam-Mittelmark, 13 davon bedienen Haltestellen auf dem Stadtgebiet Bad Belzigs. Durch Bad Belzig verläuft der Europäische Fernwanderweg E11 zwischen den Niederlanden und Masuren, die Deutsche Alleenstraße und der Europaradweg Euroroute R1 zwischen Calais und Sankt Petersburg. Außerdem gibt es südlich des Ortsteils Lüsse den Segelflugplatz Lüsse. 19 IDAS Planungsgesellschaft mbh: Flächennutzungsplan Begründung Entwurf. März Online abrufbar: 20 Ebd. 23
26 2. Beschreibung des Untersuchungsraumes Energieversorgung und -erzeugung Die Grundversorgung mit Strom erfolgt auf dem Stadtgebiet durch die E.ON edis Vertriebs GmbH Netzbetreiber ist die E.ON edis AG. Die Stadtwerke Bad Belzig GmbH sind Betreiber des Gasnetzes, das sich im Wesentlichen auf das Gebiet der Kernstadt erstreckt. Außerdem betreiben die Stadtwerke zwei Fernwärmenetze in den Gebieten Kurparksiedlung und Klinkengrund. Das Wohngebiet Klinkengrund wird wärmeversorgt durch ein Heizwerk, in dem zu 95 % Erdgas und zu ca. 5 % Heizöl eingesetzt werden. Die Kurparksiedlung wird durch ein erdgasbetriebenes BHKW in der SteinTherme sowie einem Spitzenlastkessel wärmeversorgt. Die Wärmeversorgung außerhalb der Gas- und Fernwärmenetze erfolgt über nichtleitungsgebundene Energieträger. Eine vertiefte Analyse der Energieversorgung erfolgt in Kapitel 3.2. In Abbildung 8 ist eine Übersicht des Gasnetzes in Bad Belzig dargestellt. Abbildung 8: Übersichtsplan der Gasversorgung in Bad Belzig 21 24
27 2. Beschreibung des Untersuchungsraumes 2.1. Untergliederung in Teilräume In der nachfolgenden Bearbeitung des kommunalen Energiekonzeptes erfolgt eine untergliederte Betrachtung nach Teilräumen. Gesondert betrachtet werden: Sanierungsgebiet historische Altstadt, Klinkengrund, Kurparksiedlung, übriges Kernstadtgebiet und Gebiet der Ortsteile. Die Differenzierung des Gebietes der Ortsteile erfolgt über die Grenzen (siehe auch Abbildung 6), die vier Teilräume innerhalb des Gebietes der Kernstadt untergliedern sich nach den Fernwärmeversorgungsgebieten Klinkengrund und Kurparksiedlung sowie nach der Grenzlinie des Sanierungsgebietes Historische Altstadt. Dieses Gebiet ist über den Stadtverordnetenbeschluss Nr /29 über die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes der historischen Altstadt Belzig von November 1992 definiert. 22 Abbildung 9 enthält eine grobe Kartierung der Gas- und Fernwärmenetze in der Stadt mit Eingrenzungen der Teilräume. Das Sanierungsgebiet historische Altstadt hat 790 Einwohner. Die Gesamtfläche beträgt 34,2 ha, von denen etwa 13 % Straßenfläche sind. Im Teilraum befinden sich 391 Gebäude mit insgesamt 523 Wohnungen, 149 Gebäude sind mit Gewerbenutzung belegt Quelle: Übergabe des Übersichtsplans durch die Stadtwerke Bad Belzig. Erstellt durch die Netzgesellschaft Berlin Brandenburg, Quelle: 23 Sattler, Herbert: Gutachten zur Ermittlung der Zonenanfangswerte für das Sanierungsgebiet Historische Altstadt Belzig Belzig
28 2. Beschreibung des Untersuchungsraumes Abbildung 9: Kernstadt mit den Teilräumen und Kartierung der leitungsgebundenen Energieträger Im Teilraum Klinkengrund leben Menschen. Dieser Stadtteil ist relativ kompakt, es handelt sich größtenteils um typische DDR-Plattenbauten der Baureihe Q & bzw. WBS Deutlich weniger Einwohner hat die Kurparksiedlung mit 623 Einwohnern, das Gebiet der übrigen Kernstadt hat Einwohner. Auf dem Gebiet der Ortsteile leben Menschen (alle Angaben aus dem Jahr 2012). 24 BEWOG: Wettbewerb Energetische Sanierung von Großwohnsiedlungen Wohngebiet Klinkengrund
29 3. Energie- und CO2-Bilanz 3. Energie- und CO 2 -Bilanz Im Rahmen der Erstellung der Energie- und CO 2 -Bilanz für die Stadt Bad Belzig wurden in einem ersten Schritt die vorliegenden Daten gesichtet. Für die Stadt Bad Belzig liegen u.a. Energiebilanzen und Energiekonzepte für die Jahre 1992 und 2000 vor. In Abschnitt 3.1 werden überblicksartig die Ergebnisse dieser Konzepte zusammengefasst um in den folgenden Abschnitten einen Anschluss für die vorliegende Energiebilanz zu schaffen Bestehende Energiekonzepte Energiekonzept 1992 Für die Bestandsaufnahme im Energiekonzept von 1992 standen Daten der Volkszählung aus dem Jahre 1981 zur Verfügung, weitere Daten wurden erhoben. Die Zahl der Einwohner wird mit bei insgesamt Wohnungen benannt. 25 Ziel des Energiekonzeptes war die Analyse der Wärmebedarfs- und Versorgungsstrukturen. Der Wärmebedarf wurde durch den Wärmeleistungsbedarf und den Wärmeverbrauchsatlas dargestellt, differenziert nach den Verbrauchsbereichen private Haushalte, Industrie und Sonderverbraucher und Energieträger (Nahwärme, Strom zu Heizzwecken, Braunkohle und sonstige wie Flüssiggas, Holz etc.). Weiterhin wurden die ermittelten Daten nach Innenstadt, Klinkengrund, dem Industriebetrieb EWB und Zwischen- und Randgebieten differenziert dargestellt. Der Wärmeleistungsbedarf wurde an Hand von Gebäudekennwerten für die Bausubstanz ermittelt und daraus der Wärmebedarf und die Wärmedichten abgeleitet. Die Versorgungsstruktur mit Fernwärme, Erdgas und Elektroenergie wurde kurz textlich dargestellt. Nach dem Brennstoffeinsatz für Bad Belzig (nach VDI 2067) wurden konkrete örtliche Schadstoffemissionen ermittelt. Energiekonzept 2000 Die Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Stadt Bad Belzig wurde für das Jahr 2000 auf benannt. Methodisch wurden 50 % der Einwohner mit Nebenwohnsitz in Bad Belzig (356) der Zahl der Einwohner zugerechnet, so dass insgesamt mit einer Einwohnerzahl von gerechnet wurde. Die Anzahl der Wohneinheiten im Jahr 2000 wurde über die Gebäude- und Wohnungszählung aus dem Jahr 1995 sowie den erteilten Baugenehmigungen im Zeitraum zwischen 1995 und 1999 ermittelt und beläuft sich so für das Jahr 2000 auf insgesamt Zur Struktur der Wärmeversorgung auf dem Stadtgebiet im Jahr 2000 wurden die Versorgungsgebiete der Gas- und Fernwärmenetze dargestellt. Die Stadtwerke Belzig haben für die Energieträger Fernwärme und Erdgas Kundenabrechnungsdaten zur Verfügung gestellt. Der Einsatz nichtleitungsgebundener Energieträger (Heizöl, Flüssiggas, Kohle, Holz) wurde durch die Stadtwerke Belzig über die Anzahl der beheizten Wohneinheiten je Gebäude geschätzt. 25 Es ist anzumerken, dass zum Zeitpunkt der Erstellung des ersten Energiekonzepte das Stadtgebiet noch nicht seine heutige Fläche hatte. 27
30 3. Energie- und CO2-Bilanz Als Bilanzgrenze wurde das Gebiet der Stadt definiert ( city gate ). Innerhalb dieser Bilanzgrenze wurden alle lokalen Emissionen betrachtet, die bei der Umwandlung von Endenergie in Nutzenergie oder bei der Umwandlung von Endenergieträgern in andere Endenergieformen entstehen. Zur Ermittlung der Emissionen wurden Emissionsfaktoren aus GEMIS 4.0 benutzt. Die Verbrauchsdaten wurden einer klimatischen Bereinigung unterzogen, so wurde die Vergleichbarkeit zu den Daten von 1992 gewährleistet. Das Energiekonzept von 2000 differenziert den Endenergieverbrauch nach den Energieträgern: Fernwärme Erdgas, Fernwärme Heizöl, Erdgas, Heizöl, Heizstrom, Holzhackschnitzel, Flüssiggas, Braunkohlebrikett. Es werden die folgenden Luftschadstoffe bilanziert: SO 2, NO X, CO, CO 2, Staub. Unterschiede dieser Studie zu den bestehenden Energiekonzepten 1992 und 2000 Die Strukturdaten haben sich seit 1992 bzw verändert: es ist neben der natürlichen Entwicklung und Veränderung Bad Belzigs innerhalb von zehn Jahren zu berücksichtigen, dass sich durch Eingemeindungen die Fläche des Stadtgebiets und die Einwohnerzahl verändert haben. Weiterhin erfolgte in den Energiekonzepten 1992 und 2000 lediglich eine Differenzierung der Daten für das Stadtgebiet und den Teilraum Klinkengrund. In der vorliegenden Studie werden neben dem Teilraum Klinkengrund auch die Teilräume Kurparksiedlung, historische Altstadt, übriges Stadtgebiet und Gebiet der Ortsteile differenziert betrachtet. In Abgrenzung zum Energiekonzept von 1992 erfolgt 2013 keine Bedarfsbilanz, sondern eine Verbrauchsbilanz. Im Gegensatz zu den alten Energiekonzepten wird in dieser Studie auch der Stromverbrauch (nicht nur zum Heizen) bilanziert. Die Daten zum Stromverbrauch auf dem Stadtgebiet wurden von der E.ON edis als Netzbetreiber in Bad Belzig zur Verfügung gestellt. Der Anteil des Stroms, der von E.ON edis an private Haushalte auf dem Stadtgebiet geliefert wird, 28
31 3. Energie- und CO2-Bilanz beläuft sich nach Angaben des Versorgers auf 68 %. 26 Für diesen Anteil des Stromes kann auf Basis der Angaben der E.ON edis zum Strom-Mix ein spezifischer Emissionsfaktor errechnet werden. Das angewandte Bilanzierungsprinzip der Territorialbilanz definiert als Bilanzgrenze die Stadtgrenze (oder city gate wie in bisherigen Konzepten). Zusätzlich werden Emissionen, die durch auf dem Stadtgebiet verbrauchten (oder genutzten) Strom verursacht werden, dem Stadtgebiet zugeschrieben, weshalb diese etablierte Form der Energie-, CO 2 - und Schadstoffbilanz auch endenergiebasierte und verursacherorientierte Territorialbilanz genannt wird. 27 Die eingesetzten Emissionsfaktoren basieren auf Daten nach GEMIS Um eine Vergleichbarkeit der Daten dieser Studie mit den Daten der Energiekonzepte 1992/2000 herzustellen, wurden Werte witterungsbereinigt aufbereitet. Darüber hinaus werden Strom und Wärme (der Anteil des Heizstroms kann aufgrund der Tarifstruktur differenziert werden) separat dargestellt, und durch die Aggregierung der Teilräume Klinkengrund, Kurparksiedlung, historische Altstadt und sonstige Kernstadt und Differenzierung zu den übrigen Ortsteilen ist eine räumliche Vergleichbarkeit gewährleistet Bestandsaufnahme Darstellung der Energieerzeugungsanlagen Unter dem Kernstadtgebiet der Stadt Bad Belzig liegt für weite Teile ein Erdgasnetz. Für die beiden Teilräume Klinkengrund und Kurparksiedlung liegt eine Fernwärmeversorgung vor. Auf dem Stadtgebiet gibt es neben den Heizwerken Klinkengrund und Kurparksiedlung zur Fernwärmebereitstellung weitere Heizanlagen, die in der folgenden Abbildung 10 beispielhaft zusammengestellt und grob kartiert sind Quelle: Laut Angaben H.Nimpsch E.ON edis Vertriebs AG. 27 In dieser Form wird die Bilanzierung beispielsweise vom Klimabündnis empfohlen. 28 Vergleiche Abschnitt Quelle: Angaben der Stadtwerke Bad Belzig 29
32 3. Energie- und CO2-Bilanz 30
33 3. Energie- und CO2-Bilanz Darstellung erneuerbarer Energien Auf dem Gebiet der Stadt Bad Belzig werden Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien erzeugt und genutzt. Die Stromproduktion durch erneuerbare Energien ist größtenteils gut und umfassend dokumentiert: der Übertragungsnetzbetreiber, der verpflichtet ist, Strom aus erneuerbaren Energien abzunehmen, muss die Daten im Internet öffentlich zugänglich machen. Auf dem Stadtgebiet waren bis 2010 insgesamt 107 Anlagen registriert, die Strom aus erneuerbaren Energien produzieren. Dabei handelt es sich um 105 Photovoltaik-Anlagen unterschiedlichster Größe und zwei Biomasse-Anlagen, die im Ortsteil Werbig verzeichnet sind. Anzahl, installierte Leistung und nach dem EEG vergüteter Strom sind in Tabelle 8 dargestellt. Anlagentyp Anzahl Installierte Leistung [kw] EEG-Strom [kwh] Photovoltaik , Biomasse 2 502, Gesamt , Tabelle 8: Übersicht der nach EEG vergüteten erneuerbare Energien 30 Die Nutzung von Wärme aus erneuerbaren Energien, z.b. durch solar- oder geothermische Anlagen, aber auch durch die Verbrennung von Hölzern und der thermischen Nutzung von Biogasen, ist im Abschnitt als Teil der Bilanz weiter ausgeführt Ergebnisse der Energiebilanz Datengrundlagen Im Folgenden wird dargestellt, welche Daten für die Berechnung der Energie- und CO 2 - Bilanz erhoben und verwendet wurden, um die Transparenz der Bilanz zu gewährleisten. Bei den verwendeten Daten zur Berechnung der Energie- und CO 2 -Bilanz handelt es sich zunächst um allgemeine statistische Daten (Einwohner und Wohnflächen) und um lokale Energieverbrauchsdaten der leitungsgebundenen Energieträger wie Strom-, Gas- oder Fernwärmeverbrauch, sowie der nichtleitungsgebundenen Energieträger wie z.b. Heizöl, Kohle, Holz und Flüssiggas. In der nachfolgenden Übersicht (Tabelle 9) sind die erhobenen Daten, die entsprechenden Quellen und die Datenqualität aufgeführt. 30 Datenquelle: EEG Jahresabrechnung 50 Hertz. E57679D3. 31
34 3. Energie- und CO2-Bilanz Parameter Quelle Datenqualität Anzahl der Einwohner und Wohneinheiten Wohnflächen Stromverbrauch Heizölverbrauch Erdgasverbrauch Fernwärmeverbrauch Kohle- und Holzverbrauch Umweltwärme (Geothermie) Heizstrom Sonnenkollektoren (Solarthermie) Biogasverbrauch Flüssiggasverbrauch Stadt Bad Belzig und statistisches Landesamt Berlin- Brandenburg Stadt Bad Belzig und statistisches Landesamt Berlin- Brandenburg E.ON edis Bezirksschornsteinfeger (BSF) Stadtwerke Bad Belzig GmbH, Bezirksschornsteinfeger (BSF) Stadtwerke Bad Belzig GmbH Bezirksschornsteinfeger (BSF) Untere Wasserbehörde, Kreis Potsdam Mittelmark E.ON edis Solarkataster EEG-Anlagenstammdaten Bezirksschornsteinfeger (BSF) Harte Daten für alle Teilräume Harte Daten für das Gesamtgebiet, Aufteilung auf die Teilräume anhand durchschnittlicher Wohnflächen je Wohneinheit Harte Daten straßengenau im gesamten Stadtgebiet, Teilräume über Straßenzuordnung aggregiert, sektorale Abschätzung anhand der Tarifzuordnung Angaben zur Anzahl der mit Heizöl versorgten Gebäude und Anlagen je Teilraum, eigene Abschätzung und Hochrechnung über Annahmen zur mittleren Anlagenleistung und Auslastung sowie Vergleich mit Wärmebedarfsabschätzungen, Übernahme der sektoralen Anteile aus dem Jahr 2000 Harte Daten für die Gesamtverbräuche der Privat-, Industrie- und Sondervertragskunden, eigene Abschätzung der kommunalen Verbräuche, Teilraumzuordnung über Hochrechnung der BSF- Daten sowie eigener Wärmebedarfsabschätzungen Harte Daten für die Gesamtverbräuche sowie die sektorale und teilräumliche Aufteilung Angaben zur Anzahl der mit festen Brennstoffen versorgten Gebäude und Anlagen je Teilraum, eigene Abschätzung und Hochrechnung über Annahmen zur mittleren Anlagenleistung und Auslastung sowie Vergleich mit Wärmebedarfsabschätzungen, eigene Annahmen zu den Anteilen von Holz und Kohle, eigene Annahmen zur sektoralen Aufteilung Hochrechnung des Gesamtverbrauchs über Anzahl der Wärmepumpenanlagen, eigene Annahmen zur sektoralen und teilräumlichen Aufteilung Abschätzung anhand der Tarifzuordnung Schwachlastkunden, harte Daten straßengenau im gesamten Stadtgebiet, Teilräume über Straßenzuordnung aggregiert Abschätzung anhand der insgesamt installierten Anlagenleistung, eigene Annahmen zur sektoralen und teilräumlichen Aufteilung Eigene Abschätzung anhand der harten Daten zur elektrischen Leistung und der eingespeisten Strommenge Angaben zur Anzahl der Flüssiggas versorgten Gebäude und Anlagen je Teilraum, eigene Abschätzung und Hochrechnung über Annahmen zur mittleren Anlagenleistung und Auslastung sowie Vergleich mit Wärmebedarfsabschätzungen, eigene Annahmen zur sektoralen Aufteilung Erdgas (Tankstelle) Stadtwerke Bad Belzig GmbH Harte Daten für den Gesamtverbrauch Tabelle 9: Datenquellen und -qualität Energiebilanz Bad Belzig 32
35 3. Energie- und CO2-Bilanz Statistische Daten und Annahmen In der folgenden Tabelle 10 sind die der Bilanz zu Grunde liegenden Einwohnerzahlen und Anzahl der Wohneinheiten zusammengestellt. Ferner ist die vorliegende Wohnfläche je Teilraum aufgeführt und der angenommene spezifische Energiebedarf je m². Teilraum Einwohner Wohneinheiten Wohnfläche Spezi. Energiebedarf Einwohner/ Wohneinheit [-] [-] m² [ kwh/m²*a] [-] Kurparksiedlung ,85 Klinkengrund ,76 Sanierungsgebiet historische 1, Altstadt sonstiges Stadtgebiet ,91 Ortsteile ,44 Gesamt ,00 Tabelle 10: Statistische Daten und Annahmen zur Energiebilanz Leitungsgebundene Energieträger Die von der E.ON edis übermittelten Daten zum Stromverbrauch lagen differenziert für Tarifkunden, Schwachlastabsatz, Sondervertragskunden und nichtkonzessionsabgabepflichtiger Absatz straßengenau für das gesamte Stadtgebiet vor. In Absprache mit der Stadtverwaltung Bad Belzig wurden Annahmen zur sektoralen Verteilung der Stromverbräuche je Teilraum erarbeitet. Es wurde angenommen, dass der Schwachlastabsatz Heizstrom entspricht. Der Erdgasverbrauch auf dem Stadtgebiet Bad Belzig wurde von den Stadtwerken Bad Belzig zur Verfügung gestellt. Die vorliegenden Daten stellen den Erdgasverbrauch differenziert für das Sanierungsgebiet Altstadt und das sonstige Kernstadtgebiet und nach Sektoren private Haushalte und Industrie und Gewerbe dar. Ebenfalls separat erfasst sind der Erdgasverbrauch durch die Erdgastankstelle auf dem Stadtgebiet sowie Sonderverbraucher. Der Energieverbrauch des Energieträgers Fernwärme wurde ebenfalls von den Stadtwerken bereitgestellt. Für die Gebiete Klinkengrund und Kurparksiedlung liegen Verbrauchsdaten nach Sektoren unterschieden vor. Nichtleitungsgebundene Energieträger Die nichtleitungsgebundenen Energieträger Heizöl, Flüssiggas und feste Brennstoffe wurden mit Hilfe von Angaben der zuständigen Bezirksschornsteinfeger über die Anzahl der jeweiligen Feuerungsstätten abgeschätzt. Gemeinsam mit den Stadtwerken Bad Belzig, der Stadtverwaltung und unter Berücksichtigung der Energiekonzepte der Stadt von 1992 und 2000, der Anzahl der Feuerungsstätten je Energieträger, der durchschnittlichen Wärmebedarfe (Wärme und Warmwasser), der thermischen Nutzungsgrade, der mittleren 31 Die Wohnfläche je Teilraum lag nur für den Teilraum Klinkengrund vor, die übrigen Werte wurden anhand des statistischen Berichts Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes im Land Brandenburg am mit der mittleren Wohnfläche je Einwohner erarbeitet sie stellen also nur eine Rechengröße dar. Für eine Fortschreibung des Berichts ist zu überprüfen, ob weitere definierte Daten zur Wohnfläche je Teilraum ermittelt oder erhoben werden können. 33
36 3. Energie- und CO2-Bilanz Anlagenleistung und der angenommenen Volllaststunden pro Jahr wurde ein Endenergieverbrauch je Energieträger erarbeitet, dabei wurden die Festbrennstoffe weiter ausdifferenziert nach Holz und Braunkohle. Auf dem Stadtgebiet befinden sich zwei Biogasanlagen, die EEG-Strom ins Netz einspeisen. Die thermische Nutzung des Biogases wurde über die Anlagengröße in Abstimmung mit den Stadtwerken und der Stadtverwaltung Bad Belzig abgeschätzt. Anhand der Anzahl der installierten solar- und geothermischen (oberflächennahe Geothermie) Anlagen 32 wurde die bereitgestellte Wärmemenge ermittelt. Über Annahmen erfolgte eine sektorale und geografische Aufteilung des Endenergieverbrauchs für Sonnenkollektoren und Umweltwärme Endenergieverbrauch 2010 Insgesamt wurden im Jahr 2010 knapp 38 GWh Strom und ca. 97 GWh Endenergie Wärme verbraucht. Davon entfallen rund 49 GWh auf den Energieträger Erdgas und knapp 17 GWh auf Fernwärme. Den größten Anteil der nichtleitungsgebundenen Energieträger am Endenergieverbrauch macht der Energieträger Heizöl mit ca. 24 GWh aus. In Tabelle 11 sind die Endenergieverbräuche 2010 gesamt und differenziert nach Sektoren dargestellt. Energieträger Gesamt Endenergieverbrauch 2010 Private Haushalte Gewerbe, Industrie öffentliche Gebäude Sonderverbraucher [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] Strom Heizöl Erdgas Fernwärme Holz Umweltwärme Heizstrom Sonnenkollektoren Biogas Flüssiggas Braunkohle Erdgas (Tankstelle) Gesamt (ohne Strom) Tabelle 11: Endenergieverbrauch in der Stadt Bad Belzig 2010 nach Energieträgern und Sektoren Im Jahr 2010 wurde mit rund 50 GWh mit Abstand am meisten Endenergie zur Wärmebereitstellung im Sektor Private Haushalte verbraucht. In diesem Sektor dominieren zur Wärmebereitstellung die Energieträger Erdgas, Heizöl und Fernwärme. Im Sektor Gewerbe und Industrie wurden im Jahr 2010 ca. 22 GWh Endenergie zur Wärmebereitstellung verbraucht, die wesentlichen Energieträger in diesem Sektor sind Heizöl und Erdgas. Fernwärme spielt hier eine untergeordnete Rolle. Der Stromverbrauch im Sektor Gewerbe und Industrie ist mit knapp 20 GWh noch etwas höher als bei den privaten Haushalten in Bad Belzig. Die öffentlichen Gebäude hatten im Jahr 2010 einen 32 Solarthermische Anlagen: Daten aus dem Solarkataster. Umweltwärme: Angaben der unteren Wasserbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark. 34
37 3. Energie- und CO2-Bilanz Endenergieverbrauch von 13 GWh zur Wärmebereitstellung und einen Stromverbrauch von 733 MWh. Unter der Kategorie Sonderverbraucher wird der Erdgasverbrauch der Erdgastankstelle gefasst sowie (laut Angaben der Stadtwerke Bad Belzig) die Erdgasabnahmen durch öffentliche Gebäude und der Therme für Wärme-Direkt-Service-Leistungen (WDS), der Reha-Klinik und dem ZEGG sowie ein nicht zuordbarer Rest. Die erhobenen Daten wurden, wie beschrieben, nicht nur sektoral differenziert aufbereitet, sondern auch nach Teilräumen dargestellt (vgl. Tabelle 12). Energieträger Gesamt Endenergieverbrauch 2010 Klinkengrund Kurparksiedlung Sanierungs -gebiet Altstadt sonstiges Kernstadtgebiet Ortsteile [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] Strom Heizöl Erdgas Fernwärme Holz Umweltwärme Heizstrom Sonnenkollektoren Biogas Flüssiggas Braunkohle Erdgas (Tankstelle) Gesamt (ohne Strom) Tabelle 12: Endenergieverbrauch in der Stadt Bad Belzig 2010 differenziert nach Energieträgern und Teilräumen Auf dem sonstigen Kernstadtgebiet erfolgt der größte Endenergieverbrauch, hier wurden 2010 knapp 19 GWh Strom und rund 51 GWh Wärme verbraucht. Der dominierende Energieträger zur Wärmebereitstellung auf diesem Gebiet ist Erdgas. Auf dem Gebiet der Ortsteile erfolgt der zweithöchste Endenergieverbrauch mit ca. 11 GWh Strom und ca. 20 GWh Wärme. Zur Wärmebereitstellung werden knapp 15 GWh durch den Energieträger Heizöl verbraucht. Weiterhin werden auf dem Gebiet der Ortsteile die Energieträger Flüssiggas (2,8 GWh), Biogas (1,2 GWh) und Braunkohle (1 GWh) zu nennenswerten Anteilen eingesetzt. Holz (447 MWh), Heizstrom (124 MWh), Umweltwärme (51 MWh) und Sonnenkollektoren (21 MWh) spielen eine untergeordnete Rolle als Energieträger zur Wärmebereitstellung. Die Gebiete Klinkengrund und Kurparksiedlung werden jeweils fast vollständig durch Fernwärme versorgt, im Sanierungsgebiet Altstadt dominiert der Energieträger Erdgas zur Wärmeversorgung. Um die Endenergieverbräuche je Teilraum 33 in Beziehung zu einander zu setzen, sind in Tabelle 13 und Abbildung 11 die Einwohnerzahlen je Teilraum dargestellt; daraufhin wurden die Pro-Kopf-Verbräuche je Teilraum ausgewertet. 33 Der Teilraum beschreibt das Territorium und nicht nur die Wohnfläche auf dem Territorium. 35
38 3. Energie- und CO2-Bilanz Gesamt Pro-Kopf-Endenergieverbrauch 2010 Klinkengrund Kurparksiedlung Sanierungsgebiet Altstadt sonstiges Kernstadtgebiet Ortsteile Einwohner Pro-Kopf-Verbrauch Strom [kwh/ew] Pro-Kopf-Verbrauch Wärme [kwh/ew] Pro-Kopf-Verbrauch gesamt [kwh/ew] Tabelle 13: Pro-Kopf-Endenergieverbrauch differenziert nach Teilräumen Der spezifische Wärmeverbrauch ist in der Kurparksiedlung am geringsten, ebenfalls sehr gering sind die Verbräuche je Einwohner im Klinkengrund. In diesen beiden Teilräumen bestimmen die privaten Haushalte die wesentlichen Verbräuche. Gleiches gilt auf dem Gebiet der Ortsteile. Hier ist der Wärmeverbrauch mit 5,6 MWh pro Person etwas unter dem spezifischen Wärmeverbrauch im Klinkengrund mit 5,9 MWh pro Person, dafür ist der Pro- Kopf-Stromverbrauch in diesem Gebiet mehr als doppelt so hoch. Im Sanierungsgebiet Altstadt und dem sonstigen Kernstadtgebiet befinden sich die maßgeblichen Verbraucher der Sektoren Gewerbe und Industrie und öffentliche Gebäude (auch die Sonderverbraucher sind größtenteils in diesen Gebieten lokalisiert), so dass auf [kwh/ew] Pro-Kopf-Endenergieverbrauch 2010 nach Teilräumen Pro-Kopf-Verbrauch Strom [kwh/ew] Pro-Kopf-Verbrauch Wärme [kwh/ew] 0 Klinkengrund Kurparksiedlung Sanierungsgebiet Altstadt sonstiges Kernstadtgebiet Ortsteile Abbildung 11: Pro-Kopf-Endenergieverbrauch Strom und Wärme nach Teilräumen für das Jahr 2010 dem Gebiet dieser Teilräume die Pro-Kopf-Verbräuche deutlich höher liegen. Um eine Vergleichsmöglichkeit der Endenergieverbräuche einzuführen, werden im folgenden Abschnitt alle Werte witterungsbereinigt dargestellt. Alle Endenergieverbräuche von 36
39 3. Energie- und CO2-Bilanz Energieträgern zur Wärmebereitstellung wurden mit dem Klimafaktor 0, multipliziert, um eine Vergleichbarkeit des besonders kalten Jahres 2010 mit den durchschnittlichen Endenergieverbräuchen zu gewährleisten. Um einen Vergleich mit den bisherigen Energiekonzepten darstellen zu können, wird in der folgenden Betrachtung das Gebiet der Ortsteile nicht berücksichtigt bzw. separat dargestellt. Der Stromverbrauch, der in den bisherigen Energiekonzepten nicht berücksichtigt wurde, wird wie in den bisherigen Darstellungen gesondert ausgewiesen Endenergieverbrauch 2010 witterungsbereinigt und ohne Ortsteile In der folgenden Tabelle 14 ist der erhobene Endenergieverbrauch nach Sektoren witterungsbereinigt und ohne Ortsteile zusammengestellt. Insgesamt wurden im Jahr 2010 rund 92 GWh Endenergie verbraucht. Der mit Abstand größte Verbrauchssektor wird durch die privaten Haushalte gebildet. In diesem Sektor deckt etwa ein Viertel des Endenergieverbrauchs der Energieträger Strom. Drei Viertel des Endenergieverbrauchs wird durch Wärmeverbrauch verursacht. Die dominanten Energieträger zur Wärmebereitstellung sind Erdgas, Heizöl und Fernwärme im Sektor der privaten Haushalte. Energieträger Gesamt Endenergieverbrauch 2010 (witterungsbereinigt) ohne Ortsteile Private Haushalte Gewerbe, Industrie öffentliche Gebäude Sonderverbraucher [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] Strom Heizöl Erdgas Fernwärme Holz Umweltwärme Heizstrom Sonnenkollektoren Biogas Flüssiggas Braunkohle Erdgas (Tankstelle) Gesamt (ohne Strom) Tabelle 14: Endenergieverbrauch nach Verbrauchssektoren Im Sektor Gewerbe und Industrie liegt der Stromverbrauch deutlich höher, rund 15 GWh wurden im Jahr 2010 verbraucht. Der Wärmeverbrauch summierte sich auf insgesamt knapp 12 GWh, rund 8 GWh davon werden durch Erdgas bereitgestellt und rund 3,4 GWh durch Heizöl. Fernwärme spielt in diesem Sektor eine untergeordnete Rolle. Die öffentlichen Gebäude haben im Jahr 2010 einen Endenergieverbrauch von ca MWh. Davon hat der Stromverbrauch mit 622 MWh einen vergleichsweise geringen Anteil; zur 34 Laut Angaben der Stadtwerke Bad Belzig der Klimafaktor nach EnEV für die Stadt Bad Belzig im Jahr Das entspricht einem Verhältnis der Gradtagszahl G20/ zum langjährigen Mittel von 1, Die Witterungsbereinigung verfälscht den realen Energieverbrauch. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Energiekonzepts keine vollständigen Angaben über den Charakter der Sonderverbraucher vorlagen, wurde dieser Verbrauchswert gleich allen anderen vorliegenden Werten behandelt. 37
40 3. Energie- und CO2-Bilanz Wärmebereitstellung wurden vorrangig Erdgas (6,3 GWh) und Fernwärme (4,5 GWh) eingesetzt. Analog zu den bisherigen Energiekonzepten wird ein Bereich Sonderverbraucher ausgewiesen. Dazu gehören der Erdgasabsatz der Erdgastankstelle sowie ein nicht näher zuordbarer Erdgasverbrauch von 9 GWh. In Abbildung 12 ist der sektorale Endenergieverbrauch im Jahr 2010 differenziert nach Energieträgern dargestellt. [MWh] Endenergieverbrauch 2010 (witterungsbereinigt ohne Ortsteile) nach Sektoren Erdgas (Tankstelle) Braunkohle Flüssiggas Biogas Sonnenkollektoren Heizstrom Umweltwärme Holz Fernwärme Erdgas Heizöl EL Strom 0 Private Haushalte Gewerbe, Industrie öffentliche Gebäude Sonderverbraucher Abbildung 12: Endenergieverbrauch 2010 nach Sektoren Folgend werden die Endenergieverbräuche witterungsbereinigt je Energieträger nach den definierten Teilräumen abgebildet (Tabelle 15 und Abbildung 13), die Ortsteile werden hier als ein Teilraum separat dargestellt. 38
41 3. Energie- und CO2-Bilanz Energieträger Gesamt Endenergieverbrauch 2010 (witterungsbereinigt) Klinkengrund Kurparksiedlung Sanierungsgebiet Altstadt sonstiges Kernstadtgebiet Ortsteile [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] Strom Heizöl Erdgas Fernwärme Holz Umweltwärme Heizstrom Sonnenkollektoren Biogas Flüssiggas Braunkohle Erdgas (Tankstelle) Gesamt (ohne Strom) Tabelle 15: Endenergieverbrauch 2010 nach Teilräumen differenziert Insgesamt erfolgt der größte Endenergieverbrauch auf dem Gebiet der sonstigen Kernstadt, hier dominiert der Energieträger Erdgas mit knapp 36 GWh 36. Rund 6,4 GWh Endenergie werden in diesem Teilraum durch Heizöl verbraucht. Auch der Stromverbrauch liegt mit knapp 19 GWh auf diesem Territorium am höchsten. Der zweithöchste Endenergieverbrauch erfolgt auf dem Gebiet der Ortsteile. Hier ist der dominante Energieträger zur Wärmebereitstellung Heizöl. Die weitere Wärmebereitstellung erfolgt vergleichsweise heterogen durch Flüssiggas, Biogas, Braunkohle, Holz, Umweltwärme und Sonnenkollektoren. In dem Sanierungsgebiet Altstadt wird ein beträchtlicher Anteil der Wärme durch Erdgas bereitgestellt, auch Heizöl hat eine relativ hohe Relevanz. Die übrigen Energieträger zur Wärmebereitstellung spielen eine untergeordnete Rolle. Der Endenergieverbrauch in den Gebieten Klinkengrund und Kurparksiedlung wird fast ausschließlich durch die Energieträger Strom und Fernwärme bereitgestellt. 36 Es ist anzumerken, dass hier auch der Sonderverbrauch, siehe Abschnitt 3.3.3, bilanziert ist. 39
42 3. Energie- und CO2-Bilanz [MWh] Endenergieverbrauch gesamt 2010 (witterungsbereinigt) nach Teilräumen Erdgas (Tankstelle) Braunkohle Flüssiggas Biogas Sonnenkollektoren Heizstrom Umweltwärme Holz Fernwärme Erdgas Heizöl EL Strom Klinkengrund Kurparksiedlung Sanierungsgebiet Altstadt sonstiges Kernstadtgebiet Ortsteile Abbildung 13: Endenergieverbauch 2010 nach Teilräumen Zur Einordnung der Ergebnisse und Bewertung des Endenergieverbrauchs ist in Abbildung 14 ein Bezug des Endenergieverbrauchs auf die Einwohner je Teilraum hergestellt. Der Pro- Kopf-Endenergieverbrauch ist auf dem Gebiet der Kurparksiedlung am geringsten, insbesondere der Wärmeverbrauch ist hier sehr niedrig, was vorrangig durch die Gebäudestruktur determiniert wird. Im Vergleich zu den Ortsteilen, dem Sanierungsgebiet Altstadt und dem sonstigen [kwh/ew] Pro-Kopf-Endenergieverbrauch 2010 (witterungsbereinigt) nach Teilräumen Pro-Kopf-Verbrauch Strom [kwh/ew] Pro-Kopf-Verbrauch Wärme [kwh/ew] 0 Klinkengrund Kurparksiedlung Sanierungsgebiet Altstadt sonstiges Kernstadtgebiet Ortsteile Abbildung 14: Pro-Kopf-Endenergieverbrauch 2010 nach Teilräumen Kernstadtgebiet ist der Pro-Kopf-Endenergieverbrauch im Klinkengrund sehr niedrig. 40
43 3. Energie- und CO2-Bilanz Bei einem solchen Vergleich bleibt anzumerken, dass sich die Struktur der Teilräume hinsichtlich ihrer Nutzung teilweise stark unterscheiden Vergleich mit dem Energiekonzept 2000 Zur Einordnung der Ergebnisse und zur Darstellung der Entwicklungen der vergangenen Jahre erfolgt in Tabelle 16 ein Vergleich der Endenergieverbräuche in Bad Belzig der Jahre 2000 und Zur besseren Vergleichbarkeit der Energiekonzepte wurden die Ortsteile und der Energieträger Strom (außer Heizstrom) nicht berücksichtigt. Der Endenergieverbrauch ist insgesamt um rund 7 % oder 5 GWh gesunken (witterungsbereinigt). Außerdem hat ein Energieträgerwechsel stattgefunden: es wurde deutlich weniger Fernwärme, Heizstrom, Flüssiggas und Braunkohle eingesetzt. Der hohe Rückgang im Fernwärmeabsatz ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass das Krankenhaus die Wäscherei eingestellt hat und die Zentralsterilisation von Hochdruck-Dampf auf Strom umgestellt hat. Starke Zuwächse haben die Energieträger Erdgas und Holz verbucht. Endenergieverbrauch (witterungsbereinigt) Veränderung ohne Ortsteile und ohne Strom Energieträger / Sektoren <> 2010 [MWh] [%] [MWh] [%] [MWh] [%] Heizöl ,6% ,1% ,2% Erdgas ,6% ,2% ,4% Fernwärme ,8% ,5% ,0% Holz 94 0,1% 237 0,4% ,9% Umweltwärme 0 0,0% 27 0,0% 27 - Heizstrom 230 0,3% 62 0,1% ,1% Sonnenkollektoren 0 0,0% 53 0,1% 53 - Biogas 0 0,0% 0 0,0% 0 - Flüssiggas 240 0,3% 0 0,0% ,0% Braunkohle ,2% 377 0,6% ,1% Erdgas (Tankstelle) 0 0,0% 759 1,2% Gesamt (ohne Strom) ,0% ,0% ,9% Private Haushalte ,3% ,4% ,7% Gewerbe, Industrie ,3% ,9% 276 2,4% öffentliche Gebäude ,2% ,7% ,5% Sonderverbraucher ,2% ,9% ,8% Tabelle 16: Vergleich Endenergieverbrauch 2000 und 2010 Auch sektoral haben Verschiebungen beim Endenergieverbrauch stattgefunden. Die privaten Haushalte verbrauchen im Jahr ,7 % (oder 6,6 GWh) weniger Endenergie als noch Auch in den öffentlichen Gebäuden wurde im Jahr ,5 % weniger Endenergie verbraucht. Ein massiver Zuwachs ist bei den Sonderverbrauchern zu verzeichnen. Teil dessen ist die Erdgastankstelle, die im Jahr 2000 noch nicht installiert war, hier sind aber auch nicht allokalisierte Erdgasverbräuche verbucht. 41
44 3. Energie- und CO2-Bilanz [MWh] Endenergieverbrauch (witterungsbereinigt) ohne Ortsteile und ohne Strom Erdgas (Tankstelle) Braunkohle Flüssiggas Biogas Sonnenkollektoren Heizstrom Umweltwärme Holz Fernwärme Erdgas Heizöl Private Haushalte Gewerbe, Industrie öffentliche Gebäude Sonderverbraucher Abbildung 15: Vergleich der Endenergieverbräuche 1992, 2000 und 2010 In Abbildung 15 sind die Endenergieverbräuche sektoral und nach Energieträgern differenziert für die Jahre 1992, 2000 und 2010 dargestellt. Generell ist ersichtlich, dass der wesentliche Energieträgerwechsel von der Braunkohle zu anderen Energieträgern bereits zwischen den Jahren 1992 und 2000 stattgefunden hat. Ebenfalls hat sich der Endenergieverbrauch im Sektor der privaten Haushalte bereits zwischen 1992 und 2000 deutlich verringert. Dieser Trend setzt sich auch zwischen 2000 und 2010 fort, jedoch deutlich abgeschwächt. In den anderen Sektoren sind keine vergleichbaren Entwicklungen ablesbar. Mit Ausnahme der öffentlichen Gebäude hat in allen Sektoren der Anteil des Erdgases am Endenergieverbrauch zugenommen. Im Bereich der öffentlichen Gebäude hat der Energieträger Fernwärme zwischen 2000 und 2010 deutlich an Relevanz gewonnen. 42
45 3. Energie- und CO2-Bilanz 3.4. Ergebnisse der CO 2 - und Schadstoffbilanz Aus den Ergebnissen der Energiebilanz kann mit Hilfe von Emissionsfaktoren eine CO 2 - und Schadstoffbilanz berechnet werden. Dabei wird der verbrauchten Energiemenge je Energieträger ein Emissionswert in g/mwh zugeteilt Emissionsfaktoren Die Emissionsfaktoren, die zur Ermittlung der CO 2 - und Schadstoffemissionen eingesetzt wurden, basieren auf Daten aus GEMIS 4.6 (siehe Tabelle 17). Energieträger globale Emissionen [g/mwh] SO 2 NO X CO CO 2 Staub Strom / Heizstrom Heizöl Erdgas Fernwärme Heizöl Fernwärme Erdgas Holz-Hackschnitzel-Heizung Flüssiggas Braunkohle Umweltwärme Sonnenkollektoren Biogas Tabelle 17: Emissionsfaktoren nach GEMIS 4.6 und Angaben der E.ON edis sowie der Stadtwerke Bad Belzig 37 Den ermittelten Endenergieverbräuchen werden mit Hilfe der dargestellten Emissionsfaktoren CO 2 - und Schadstoffemissionen zugewiesen. Folgend werden zunächst die CO 2 -Emissionen ausführlich dargestellt und die weiteren Schadstoffemissionen analog zu den bisherigen Konzepten aufgezeigt. 37 Die Emissionsfaktoren für Strom wurden mit Hilfe von GEMIS ermittelt, hierbei wurden die GEMIS-Werte für den Strom-Mix Deutschland 2010 mit den von der E.ON edis veröffentlichten Werten skaliert. Die Emissionsfaktoren für FW Erdgas und Heizöl wurden entsprechend der von den Stadtwerken genannten ein- und abgesetzten Energiemengen mit GEMIS 4.6 errechnet. Die Emissionsfaktoren enthalten Werte der Vorkette, so dass auch erneuerbaren Energieträgern ein Emissionswert zugeordnet wird. 43
46 3. Energie- und CO2-Bilanz CO 2 -Bilanz nach Sektoren Entsprechend der Endenergiebilanz und der Emissionsfaktoren ergibt sich die in Tabelle 18 und Abbildung 16 dargestellte CO 2 -Bilanz nach Sektoren. Energieträger Gesamt CO 2 -Emissionen 2010 (witterungsbereinigt) Private Haushalte Gewerbe, Industrie öffentliche Gebäude Sonderverbraucher [t CO 2 /a] [t CO 2 /a] [t CO 2 /a] [t CO 2 /a] [t CO 2 /a] Strom Heizöl Erdgas Fernwärme Holz Umweltwärme Heizstrom Sonnenkollektoren Biogas Flüssiggas Braunkohle Erdgas (Tankstelle) Gesamt (ohne Strom) Tabelle 18: CO 2-Bilanz nach Sektoren Im Wesentlichen zeigt sich bei der CO 2 -Bilanz ein ähnliches Bild wie bei der in Abschnitt dargestellten Endenergiebilanz, jedoch verschieben sich die Anteile der Energieträger je nach Emissionsfaktoren: Strom und Braunkohle haben zum Beispiel einen vergleichsweise hohen Emissionsfaktor, die Emissionsfaktoren erneuerbarer Energieträger wie Umweltwärme, Holz, Solarthermie haben einen sehr geringen Emissionsfaktor und fallen dadurch in der CO 2 -Bilanz (noch) weniger ins Gewicht. Insgesamt wurden auf dem Stadtgebiet Bad Belzig im Jahr 2010 ca t CO 2 emittiert, davon entfallen knapp t auf den Stromverbrauch. Durch den Erdgasverbrauch auf dem Stadtgebiet werden über t CO 2 emittiert. Der Verbrauch von Heizöl ist für Emissionen von rund t CO 2 verantwortlich. Die Nutzung des Energieträgers Fernwärme verursacht Emissionen in Höhe von knapp t CO Perspektivisch kann davon ausgegangen werden, dass der Emissionsfaktor der Fernwärme durch Substitution der eingesetzten Energieträger und KWK deutlich sinken wird, so dass auch der Emissionsanteil deutlich weniger ins Gewicht fallen wird. 44
47 3. Energie- und CO2-Bilanz [t CO 2 /a] CO 2 -Emissionen 2010 (witterungsbereinigt) nach Sektoren Erdgas (Tankstelle) Braunkohle Flüssiggas Biogas Sonnenkollektoren Heizstrom Umweltwärme Holz Fernwärme Erdgas Heizöl EL Strom Private Haushalte Gewerbe, Industrie öffentliche Gebäude Sonderverbraucher Abbildung 16: CO 2-Emissionen nach Sektoren Die mit Abstand meisten Emissionen werden in der Stadt Bad Belzig durch die privaten Haushalte verursacht. Es folgt der Sektor Gewerbe und Industrie. In diesem Sektor liegen die höchsten Emissionen durch Stromnutzungen vor, Emissionen durch die Nutzung von Wärmeenergie sind in diesem Sektor aber deutlich geringer als im Sektor der privaten Haushalte. Durch den Endenergieverbrauch in den öffentlichen Gebäuden werden Emissionen von rund t CO 2 verursacht. In diesem Sektor spielt der Stromverbrauch bei den Emissionen eine sehr untergeordnete Rolle, die wesentlichen Beiträge an den Gesamtemissionen in diesem Sektor werden durch den Gas- und Fernwärmeverbrauch verursacht (vgl. Abbildung 16) CO 2 -Bilanz nach Teilräumen In Tabelle 19 und Abbildung 17 sind die Emissionen differenziert nach Teilräumen dargestellt. Auch hier ergibt sich ein analoges Bild zur Endenergiebilanz: die meisten Emissionen entfallen mit insgesamt rund t CO 2 auf das Gebiet der sonstigen Kernstadt und hier werden die meisten Emissionen durch den Verbrauch von Strom (knapp t CO 2 ), Erdgas (ca t CO 2 ) und Heizöl (ca t CO 2 ) verursacht. Auf dem Gebiet der Ortsteile werden insgesamt über t CO 2 emittiert und davon wurden mehr als die Hälfte der Emissionen durch Stromverbrauch verursacht (rund t CO 2 ). Weiterhin ist auf diesem Gebiet der Energieträger Heizöl für knapp t CO 2 verantwortlich und schließlich haben hier die nichtleitungsgebundenen Energieträger Flüssiggas (mit 621 t CO 2 ) und Braunkohle mit 338 t CO 2 einen vergleichsweisen hohen Anteil an den CO 2 -Emissionen. 45
48 3. Energie- und CO2-Bilanz Energieträger CO 2 -Emissionen 2010 (witterungsbereinigt) Gesamt Klinkengrund Kurparksiedlung Sanierungsgebiet Altstadt sonstiges Kernstadtgebiet Ortsteile [t CO 2 /a] [t CO 2 /a] [t CO 2 /a] [t CO 2 /a] [t CO 2 /a] [t CO 2 /a] Strom Heizöl Erdgas Fernwärme Holz Umweltwärme Heizstrom Sonnenkollektoren Biogas Flüssiggas Braunkohle Erdgas (Tankstelle) Gesamt (ohne Strom) Tabelle 19: CO 2-Emissionen nach Teilräumen [t CO 2 /a] CO 2 -Emissionen 2010 (witterungsbereinigt) nach Teilräumen Erdgas (Tankstelle) Braunkohle Flüssiggas Biogas Sonnenkollektoren Heizstrom Umweltwärme Holz Fernwärme Erdgas Heizöl EL Strom Klinkengrund Kurparksiedlung Sanierungsgebiet Altstadt sonstiges Kernstadtgebiet Ortsteile Abbildung 17: CO 2-Emissionen nach Teilräumen 46
49 3. Energie- und CO2-Bilanz Vergleich mit dem Energiekonzept 2000 Zur Einordnung der Ergebnisse der vorliegenden CO 2 -Bilanz erfolgt ein Vergleich mit den Ergebnissen der CO 2 -Bilanz von 2000 in Tabelle 20, dazu sind die Emissionen ohne Ortsteile und ohne Strom dargestellt. 39 Energieträger / Sektoren CO 2 -Emissionen (witterungsbereinigt) ohne Ortsteile und ohne Strom Veränderung <> 2010 [t CO 2 /a] [%] [t CO 2 /a] [%] [t CO 2 /a] [%] Heizöl ,8% ,3% ,4% Erdgas ,7% ,6% ,5% Fernwärme ,7% ,9% ,6% Holz 3 0,0% 5 0,0% 2 54,9% Umweltwärme 0 0,0% 4 0,0% 4 - Heizstrom 196 1,1% 29 0,2% ,0% Sonnenkollektoren 0 0,0% 1 0,0% 1 - Biogas 0 0,0% 0 0,0% 0 - Flüssiggas 66 0,4% 0 0,0% ,0% Braunkohle ,2% 144 0,9% ,8% Erdgas (Tankstelle) 0 0,0% 171 1,1% Gesamt (ohne Strom) ,0% ,0% ,1% Private Haushalte ,3% ,4% ,5% Gewerbe, Industrie ,3% ,2% ,0% öffentliche Gebäude ,9% ,8% ,9% Sonderverbraucher ,6% ,6% ,9% Tabelle 20: Vergleich der CO 2-Emissionen 2000 und 2010 Insgesamt sind die jährlichen CO 2 -Emissionen zwischen 2000 und 2010 um 9,1 % zurückgegangen. Die absolut größten Emissionsminderungen sind bei dem Energieträger Heizöl auszumachen ( t CO 2 ). Auch Emissionen durch Fernwärme (ca t CO 2 ) und Braunkohle (ca t CO 2 ) sind deutlich zurückgegangen. Ein deutlicher Zuwachs ist bei den Emissionen durch Erdgas (ca. plus t CO 2 ) zu beobachten. Auch sektoral hat es Verschiebungen bei den Emissionen gegeben. Durch die privaten Haushalte wurden im Jahr ,5 % (oder rund t) weniger CO 2 emittiert als noch In den öffentlichen Gebäuden gab es zwischen 2000 und 2010 ebenfalls Emissionsminderungen von ca. 10 % oder rund 300 t CO 2. Der Sektor Gewerbe und Industrie emittiert geringfügig weniger als noch 2000 (-123 t CO 2 oder -4,0 %) und der Sektor Sonderverbraucher ist deutlich größer geworden (+45 %). In Abbildung 18 sind die CO 2 -Emissionen nach Sektoren und je Energieträger der Energiekonzepte von 1992, 2000 und 2010 dargestellt. Aus dieser Darstellung wird ersichtlich, dass insgesamt, aber vor allem im Bereich der privaten Haushalte, erhebliche Emissionsminderungen seit 1992 erreicht wurden. Ebenfalls ist in dieser Abbildung sehr gut der Energieträgerwechsel ersichtlich. Der Anteil des Energieträgers Braunkohle an den Gesamtemissionen ist stark gesunken: im Jahr 1992 war Braunkohle noch verantwortlich für die meisten Emissionen, schon im Jahr 2000 spielt dieser Energieträger in der CO 2 -Bilanz 39 Die CO 2-Bilanz bezieht sich auf die witterungsbereinigte Energiebilanz. 47
50 3. Energie- und CO2-Bilanz eine deutlich geringere Rolle, im Jahr 2010 sind die Emissionen durch Nutzung von [t CO 2 /a] CO 2 -Emissionen (witterungsbereinigt) ohne Ortsteile und ohne Strom Erdgas (Tankstelle) Braunkohle Flüssiggas Biogas Sonnenkollektoren Heizstrom Umweltwärme Holz Fernwärme Erdgas Heizöl Private Haushalte Gewerbe, Industrie öffentliche Gebäude Sonderverbraucher Abbildung 18: Vergleich der CO 2-Emissionen 1992, 2000 und 2010 Braunkohle marginal Schadstoffbilanz Zur Anschlussfähigkeit dieses Energiekonzeptes an die bestehenden Energiekonzepte wurde mit Hilfe der in Abschnitt eingeführten Emissionsfaktoren eine Bilanz der weiteren Schadstoffe SO 2, NO X, CO und Staub ermittelt. Die Gesamtergebnisse der Schadstoffbilanz sind in Tabelle 21 im Vergleich mit den Emissionen 1992 und 2000 dargestellt. Sonstige Schadstoffemissionen SO 2 NO X CO Staub [kg/a] [kg/a] [kg/a] [kg/a] Tabelle 21: Sonstige Schadstoffemissionen gesamt 1992, 2000 und 2010 Die Schadstoffemissionen haben insgesamt sehr deutlich zwischen den Jahren 1992 und 2000, aber auch zwischen 2000 und 2010, abgenommen. In Tabelle 22 sind die sonstigen Emissionen nach Energieträgern aufgeschlüsselt dargestellt. Es wird ersichtlich, dass vor allem der starke Rückgang der Braunkohlenutzung zu massiven Emissionsminderungen geführt hat. 48
51 3. Energie- und CO2-Bilanz Sonstige Schadstoffemissionen [kg] globale Emissionen In [kg] SO 2 NO X CO Staub Heizöl Erdgas Fernwärme Holz Umweltwärme Heizstrom Sonnenkollektoren Biogas Flüssiggas Braunkohle Erdgas (Tankstelle) Gesamt Tabelle 22: Sonstige Schadstoffemissionen nach Energieträgern 1992, 2000 und
52 4. Szenarien, Leitbild, Ziele 4. Szenarien, Leitbild, Ziele In diesem Abschnitt erfolgt eine Fortschreibung der Energie- und CO 2 -Bilanz mit dem Ziel die wesentlichen Handlungsansätze zu identifizieren. Folgend werden die vorliegenden Ziele auf Bundes- und Landesebene sowie Ziele der Stadt Bad Belzig identifiziert und zusammengestellt. Die energetischen und klimarelevanten Ziele werden in Bezug zu den entworfenen Szenarien gestellt, um eine Einordnung der Ziele vorzunehmen Potenzialanalyse mit Szenarien Grundlage der Szenarienentwicklung sind bundesweit anerkannte Studien, die sich mit dem zukünftigen Energiekonsum und der Energieversorgung in Deutschland befassen und verschiedene Szenarien entwerfen. Durch Auswertung der Studien und Skalierung (d.h. Übertragen auf die Situation in Bad Belzig) wird die Entwicklung des Endenergieverbrauchs dargestellt. Zur Einordnung der Entwicklungen werden die Ergebnisse der Szenarien mit der Bilanz der vergangenen Jahre gekoppelt und so in die Zukunft fortgeschrieben. Ausgangsjahr für die Entwicklung der Szenarien für Bad Belzig sind die Werte für den Endenergieverbrauch des Jahres 2010 (witterungsbereinigt). Entsprechend der zugrunde liegenden Studien und den entsprechenden Annahmen wird für jeden Energieträger in jedem Sektor eine jährliche prozentuale Entwicklung errechnet. Auf diese Weise können künftige Energieverbräuche differenziert nach Energieträger und Sektor dargestellt werden. Es werden ein Referenz- und ein Klimaszenario entwickelt. Die Szenarien stellen eine Analyse der Potenziale im Jahr 2020 und 2030 dar Annahmen der zugrunde liegenden Studien Dem Referenzszenario liegen die Annahmen der Studie Energieszenarien für ein Energiekonzept der Bundesregierung 40 zugrunde. Diese sind u.a. folgende: Private Haushalte: Insgesamt nimmt der Energieverbrauch der Haushalte ab. Am größten ist die Einsparung im Bereich der Raumwärme, am kleinsten bei der Warmwasserbereitstellung. Die Reduktion im Bereich der Raumwärme ist vor allem auf energetische Sanierungen zurückzuführen. Von etwas geringerer Bedeutung sind effiziente Heizanlagen. Die spezifische Wohnfläche pro Person erhöht sich weiter, effizienzbedingte Einsparungen werden dadurch teilweise kompensiert. Eine Ausweitung des Bestands von elektrischen Geräten wirkt den durch technische Maßnahmen erzielten Effizienzsteigerungen entgegen. Wirtschaft: Weniger energieintensive Branchen weisen ein deutlich stärkeres Produktionswachstum auf als energieintensive Branchen. Hochwertige und 40 EWI, GWS, Prognos für das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Hrsg.): Energieszenarien für ein Energiekonzept der Bundesregierung. Basel/Köln/Osnabrück
53 4. Szenarien, Leitbild, Ziele wissensintensive Produkte und Produktionsweisen bilden den Kern der industriellen Wertschöpfung. Es erfolgt ein verstärkter Einsatz effizienter Technologien (IuK, Beleuchtung, Motoren, Pumpen etc.) Zur Bereitstellung von Prozesswärme und mechanischer Energie werden effiziente Prozesse genutzt. Abwärme wird konsequent genutzt. Aufbauend auf dem Referenzszenario wird ein Klimaszenario gemäß der Studie Energieeffizienz: Potenziale, volkswirtschaftliche Effekte und innovative Handlungs- und Förderfelder für die Nationale Klimaschutzinitiative 41 entwickelt. Hierbei werden konkret definierte Energieeffizienz- und Energieeinsparmaßnahmen über die Referenz hinaus untersucht. Eine vollständige Liste der untersuchen Maßnahmen, die in das Klimaszenario einfließen, ist im Anhang 2 zusammengestellt. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Referenzszenario eine wahrscheinlich eintretende Entwicklung darstellt, während das Klimaszenario eine engagierte Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen einer nachhaltigen Energie- und Klimapolitik in Bad Belzig erfordert Annahmen zur Entwicklung in Bad Belzig Der künftige absolute Endenergieverbrauch und die daraus resultierenden Emissionen der Stadt Bad Belzig hängen zu einem großen Teil von der Bevölkerungsentwicklung ab. In Abschnitt 1 wurde bereits dargestellt, dass die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung zwischen 2008 und 2010 recht deutlich von der tatsächlichen Entwicklung abweicht. Trotz der festgestellten Abweichungen wird für die Potenzialanalyse mit Szenarien auf die prognostizierte Bevölkerung zurückgegriffen. Für das Bilanzjahr 2010 wird eine Bevölkerung von Einwohnern angenommen. 42 Für die Entwicklung bis 2030 wird der Prognose des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg gefolgt. 43 Hier liegen Werte in Fünfjahresschritten vor. Die Zwischenwerte wurden interpoliert. Abbildung 19 stellt die Werte für die Entwicklung der Bevölkerung in Bad Belzig dar. Näherungsweise wird angenommen, dass die Entwicklung der Bevölkerung auf alle Sektoren gleich auswirkt. Der Bereich der kommunalen Verwaltung wird bei der Ermittlung der Szenarien wie der Dienstleistungssektor im Bereich Wirtschaft behandelt. Die Sonderverbräuche der Bilanz werden dem Sektor Wirtschaft zugeschlagen. Heizstrom wird in der folgenden Darstellung nicht gesondert betrachtet, sondern die Entwicklungen werden für Strom insgesamt berechnet. Der Emissionsfaktor für Fernwärme wird als Mittel der beiden eingesetzten Energieträger Heizöl und Erdgas verwendet. 41 IFEU, Fraunhofer ISI, GWS, Prognos AG (Hg.): Energieeffizienz: Potenziale, volkswirtschaftliche Effekte und innovative Handlungs- und Förderfelder für die Nationale Klimaschutzinitiative. Heidelberg, Karlsruhe, Berlin, Osnabrück, Freiburg Integriertes Stadtentwicklungskonzept Bad Belzig Demografiebericht 1 Landkreis Potsdam-Mittelmark 2010 nach: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 51
54 4. Szenarien, Leitbild, Ziele Einwohner Bad Belzig Abbildung 19: Bevölkerungsentwicklung Bad Belzig 2010 bis Szenarien bis Szenarien bis 2020 Endenergie Folgend sind die Entwicklungen der Endenergieverbräuche bis zum Jahr 2020 dargestellt. In Tabelle 23 sind die witterungsbereinigten Endenergieverbräuche für das Startjahr 2010 und die prognostizierten Verbräuche 2020 für das Referenz- und Klimaszenario dargestellt. Startjahr Referenzszenario Klimaszenario Energieträger 2010 [MWh] Absolut 2020 [MWh] 2010 << 2020 [%] Absolut 2020 [MWh] 2010 << 2020 [%] Umweltwärme ,6% ,3% Strom ,9% ,7% Sonnenkollektoren ,4% ,2% Holz ,4% 667 8,3% Heizöl ,1% ,7% Flüssiggas ,7% ,9% Fernwärme ,7% ,3% Erdgas ,3% ,3% Braunkohle ,0% ,8% Biogase ,3% ,3% Summe ,3% ,8% Tabelle 23: Szenarien Endenergieverbrauch bis 2020 nach Energieträgern Im Jahr 2020 wird schon nach dem Referenzszenario ein Rückgang des Gesamtendenergieverbrauchs von 19,3 % prognostiziert. Die relativen Veränderungen sind besonders groß bei den Energieträgern Braunkohle, Flüssiggas und Heizöl, hier ist eine 44 Demografiebericht 1 Landkreis Potsdam-Mittelmark 2010 nach: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg und Integriertes Stadtentwicklungskonzept Bad Belzig
55 GWh/a 4. Szenarien, Leitbild, Ziele relative Abnahme von jeweils über 30 % prognostiziert. Die Energieträger zur Wärmebereitstellung Erdgas (-19,3 %) und Fernwärme (-16,7 %) nehmen ebenfalls deutlich ab. Auch der Stromverbrauch wird bis 2020 um knapp 15 % abnehmen. Dagegen ist für die erneuerbaren Energieträger Umweltwärme, Sonnenkollektoren Holz und Biogase ein Zuwachs vorhergesagt. Nach dem Klimaszenario ergibt sich ein ähnliches Bild. Insgesamt wird erwartet, dass der Endenergieverbrauch um knapp 24 % abnimmt. Die zusätzliche prognostizierte Minderung des Strom- und Wärmeverbrauchs führt zu einer noch größeren Minderung der fossilen Energieträger und Strom. In Abbildung 20 erfolgt eine sektorale Darstellung der Entwicklungen gemäß Referenz- und Klimaszenario bis zum Jahr Hier wird deutlich, in welchen Sektoren quantitativ große Einsparpotenziale zu erwarten sind Zusammenfassende Darstellung des Endenergieverbrauchs nach Sektoren und Energieträgern für die Stadt Bad Belzig Haushalte Wirtschaf t/ Erdgastank- Kommunale Sonderbraucher stelle Verwaltung Biogase Braunkohle Erdgas Fernwärme Flüssiggas Heizöl EL Holz Sonnenkollektoren Strom Umweltwärme Abbildung 20: Vergleich Endenergieverbrauch 2010 und Szenarien 2020 nach Sektoren Besonders große Einsparungen sind in den Sektoren Haushalte und Wirtschaft (inkl. Sonderverbraucher) zu erwarten. Große Rückgänge werden hier beim Strom und Wärmeverbrauch erwartet. Der Gasverbrauch der Erdgastankstelle wird steigen im Referenzszenario mehr (207 %) als im Klimaszenario (169 %) (im Klimaszenario werden weitere Maßnahmen, den Energieverbrauch des Verkehrssektors betreffend, angenommen). 53
56 4. Szenarien, Leitbild, Ziele Die prognostizierten Gesamtverbräuche je Sektor sind in Tabelle 24 dargestellt. Die absolut größten Einsparungen sind sowohl im Referenz- als auch im Klimaszenario bei den privaten Haushalten zu erwarten Referenzszenario 2020 Klimaszenario Sektoren Verbrauch [MWh] Verbrauch [MWh] Minderung [%] Verbrauch [MWh] Minderung [%] Haushalte ,6% ,8% Wirtschaft / Sonderverbraucher ,9% ,4% Erdgastankstelle ,4% ,1% Kommunale Verwaltung ,4% ,6% Summe ,3% ,8% Tabelle 24: Szenarien Endenergieverbrauch bis 2020 nach Sektoren Die wesentlichen Maßnahmen der Szenarien, die zu weiteren Minderungen im Klimaszenario führen, sind: höhere Gebäudesanierungsrate und Erneuerung der Heizungssysteme, hocheffizienter Gebäudeneubau und effiziente Beleuchtung, weiße Ware und IuK-Technologien. Im Wirtschaftssektor (inkl. Sonderverbraucher) sind absolut die zweithöchsten Minderungen zu erwarten, die relativen Minderungen liegen mit -20,9 % im Referenz- und -27,4 % im Klimaszenario aber noch deutlich über denen des Haushaltssektors. Die hohe Differenz zwischen den beiden Szenarien wird im Wesentlichen durch die folgenden Maßnahmen, die im Klimaszenario angenommen werden, erreicht: höhere Gebäudesanierungsrate und Erneuerung der Heizungssysteme, effiziente Beleuchtung und Bürogeräte, Optimierung von RLT-Systemen. Der Endenergieverbrauch durch die kommunale Verwaltung macht im Jahr 2010 nur rund 10 % des gesamten Endenergieverbrauchs aus und auch die absoluten Minderungen fallen nicht sehr hoch aus. Die prognostizierten relativen Minderungen sind jedoch im Bereich der kommunalen Verwaltung mit -23,4 % im Referenz- und -29,6 % im Klimaszenario die höchsten. Die wesentlichen Maßnahmen des Klimaszenarios entsprechen den im Sektor Wirtschaft genannten Maßnahmen. Eine detaillierte Betrachtung der Potenziale zur Einsparung von Energie in den kommunalen Gebäuden erfolgt im Abschnitt 4. Bei den Darstellungen ist zu berücksichtigen, dass die Entwicklung der Bevölkerung eine nicht unwesentliche Hilfe bei den Energieeinsparungen bringt, denn verkürzt betrachtet verbrauchen weniger Einwohner auch weniger Energie. Wird der gesamte Endenergieverbrauch auf die Einwohnerzahl bezogen, ergibt sich ein relativiertes Bild, in Abbildung 21 ist dazu der Endenergieverbrauch pro Person dargestellt. 54
57 MWh/a 4. Szenarien, Leitbild, Ziele Nach dem Referenzszenario ist hier lediglich eine Abnahme von rund 9 % prognostiziert. Im Klimaszenario wird erwartet, dass der Endenergieverbrauch pro Einwohner um rund 14 % Pro-Kopf-Endenergieverbrauch nach Energieträgern für die Stadt Bad Belzig Biogase Braunkohle Erdgas Fernwärme 6 Flüssiggas 4 Heizöl EL Holz 2 Sonnenkollektoren (Startjahr) 2020 (Ref erenzszenario) 2020 (Klimaszenario) Strom Umweltwärme Abbildung 21: Szenarien für den Pro-Kopf-Endenergieverbrauch in Bad Belzig zurückgeht. In Tabelle 25 sind die einwohnerbezogenen Endenergieverbräuche zusammengestellt. Jahr Gesamtergebnis [MWh] Absolute Minderung [MWh] Jährliche Minderung [MWh/a] Prozentuale Minderung [%] Jährliche Minderung [%] 2010 (Startjahr) 10, (Referenzszenario) 9,68-0,99-0,10-9,25% -0,92% 2020 (Klimaszenario) 9,14-1,53-0,15-14,33% -1,43% Tabelle 25: Pro-Kopf-Endenergieverbrauch in Bad Belzig Im Vergleich zu den Minderungen des Endenergieverbrauchs bis 2020 wird ersichtlich, dass rund 10 % der prognostizierten Minderungen jeweils durch den angenommenen Bevölkerungsrückgang verursacht werden. 55
58 4. Szenarien, Leitbild, Ziele Szenarien bis 2020 CO 2 -Emissionen Wie in Abschnitt dargestellt, werden mit Hilfe von Emissionsfaktoren die Endenergieverbräuche in die CO 2 -Bilanz überführt. Analog wird bei den folgend dargestellten Szenarien der CO 2 -Emissionen für die Stadt Bad Belzig bis zum Jahr 2020 vorgegangen. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass von konstanten Emissionsfaktoren ausgegangen wird. Für die meisten Energieträger wird sich diese Annahme als mehr oder weniger gültig erweisen bei den Endenergieträgern Strom und Fernwärme sind real jedoch Veränderungen zu erwarten. Beim Strom wird nach aktueller Gesetzeslage durch weiteren Zubau der erneuerbaren Energien und die entsprechende (bilanzielle) Umlage über das EEG der Emissionsfaktor in den kommenden Jahren weiter absinken. Nach aktueller Diskussion über die Kosten(-verteilung) der Energiewende ist derzeit nicht absehbar, wie sich die künftige Gesetzeslage entwickeln wird. Auf den Einbezug von Prognosen zur Entwicklung des Emissionsfaktors von Strom wird daher verzichtet. 45 Der Emissionsfaktor für Fernwärme wird sich entsprechend der künftigen geplanten Änderungen zur Bereitstellung von Fernwärme ändern. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Konzepts lagen verschiedene Planvarianten vor, jedoch noch keine konkrete Aussage zu Energieträgereinsatz und Art der Bereitstellung, so dass hier ebenfalls auf eine Prognose der Entwicklung des Emissionsfaktors für Fernwärme verzichtet wurde. Analog zur Energiebilanz sind in Tabelle 26 die CO 2 -Emissionen der Stadt Bad Belzig im Jahr 2010 mit den beiden Szenarien im Jahr 2020 gegenübergestellt. Startjahr Referenzszenario Klimaszenario Energieträger 2010 [t CO 2 ] Absolut 2020 [t CO 2 ] 2010 << 2020 [%] Absolut 2020 [t CO 2 ] 2010 << 2020 [%] Umweltwärme ,6% ,3% Strom ,9% ,7% Sonnenkollektoren ,4% 4 118,2% Holz ,4% 43 8,3% Heizöl ,1% ,7% Flüssiggas ,7% ,9% Fernwärme ,7% ,3% Erdgas ,3% ,3% Braunkohle ,0% ,8% Biogase ,3% 22 0,3% Summe ,0% ,5% Tabelle 26: Szenarien CO 2-Emissionen bis 2020 nach Energieträgern Entsprechend der prognostizierten Energieverbräuche sind auch bei den künftigen CO 2 - Emissionen deutliche Minderungen zu erwarten: im Referenzszenario wird erwartet, dass im Jahr 2020 rund t CO 2 in Bad Belzig ausgestoßen werden, nach dem Klimaszenario werden dann immer noch t CO 2 emittiert. 45 Dier verwendeten Emissionsfaktoren finden sich in Tabelle
59 4. Szenarien, Leitbild, Ziele In Abbildung 22 sind die prognostizierten Minderungen je Energieträger und Sektor für das Referenz- und das Klimaszenario dargestellt. Die Szenarien für die künftigen CO 2 -Emissionen in der Stadt Bad Belzig stellen sich Zusammenfassende Darstellung der CO2-Emissionen nach Sektoren und Energieträgern für die Stadt Bad Belzig Haushalte Wirtschaf t/ Erdgastank- Kommunale Sonderverbraucher telle Verwaltung Biogase Braunkohle Erdgas 1000 t CO Fernwärme Flüssiggas Heizöl EL Holz Sonnenkollektoren 0 Strom Umweltwärme Abbildung 22: Vergleich CO 2-Emissionen 2010 und Szenarien 2020 nach Sektoren prinzipiell ähnlich zum Endenergieverbrauch dar. Beim Vergleich der Abbildung 20 mit der Abbildung 22 wird jedoch deutlich, dass sich die Anteile der Energieträger unterscheiden die unterschiedlichen Höhen der Emissionsfaktoren geben hier den Ausschlag für die Anteile an den Emissionen (vgl. Abschnitt 3.4.1). 57
60 4. Szenarien, Leitbild, Ziele 4.3. Szenarien bis 2030 Die eingesetzten Szenarien bieten die Möglichkeit zu Prognosen des Endenergieverbrauchs und den daraus resultierenden CO 2 -Emissionen bis zum Jahr Für die Maßnahmenplanung in den kommenden Jahren ist dieser Zeithorizont jedoch weniger bedeutend. Dennoch ist folgend ein kurzer Überblick über die zu erwartenden Endenergieverbräuche und CO 2 -Emissionen in der Stadt Bad Belzig im Jahr 2030 gegeben Szenarien bis 2030 Endenergie Die zu erwartenden Endenergieverbräuche je Energieträger im Jahr 2030 nach Referenzund Klimaszenario sind in der Tabelle 27 dargestellt. Startjahr Referenzszenario Klimaszenario Energieträger 2010 [MWh] Absolut 2030 [MWh] 2010 << 2030 [%] Absolut 2030 [MWh] 2010 << 2030 [%] Umweltwärme ,5% ,0% Strom ,5% ,7% Sonnenkollektoren ,7% ,8% Holz ,2% 649 5,5% Heizöl ,2% ,3% Flüssiggas ,7% ,9% Fernwärme ,1% ,5% Erdgas ,4% ,4% Braunkohle ,0% ,2% Biogase ,4% 945-6,2% Summe ,2% ,3% Tabelle 27: Szenarien Endenergieverbrauch bis 2030 nach Energieträgern Gemäß dem Referenzszenario wird der Endenergieverbrauch bis zum Jahr 2030 um 35 % abnehmen und rund 78 GWh pro Jahr entsprechen. Im Klimaszenario verringert sich der Endenergieverbrauch um rund 44 % auf ca. 67 GWh/a. Die bereits in Abschnitt aufgezeigten Trends beim Endenergieträgereinsatz setzen sich weiter fort: es gibt in beiden Szenarien einen deutlichen Rückgang bei den fossilen Energieträgern und Strom sowie ein Zuwachs bei den erneuerbaren Energieträgern zur Wärmebereitstellung, lediglich Biogas als erneuerbarer Energieträger erfährt im Klimaszenario ebenfalls eine Abnahme im Vergleich zu Die sektoralen Endenergieverbräuche je Energieträger sind in Abbildung 23 für das Jahr 2010 dargestellt und verglichen mit den Werten für 2030 entsprechend dem Referenz- und Klimaszenario. 58
61 GWh/a 4. Szenarien, Leitbild, Ziele Zusammenfassende Darstellung des Endenergieverbrauchs nach Sektoren und Energieträgern für die Stadt Bad Belzig Haushalte Wirtschaf t/ Erdgastank- Kommunale Sonderverbraucher stelle Verwaltung Biogase Braunkohle Erdgas Fernwärme Flüssiggas Heizöl EL Holz Sonnenkollektoren Strom Umweltwärme Abbildung 23: Vergleich Endenergieverbrauch 2010 und Szenarien 2030 nach Sektoren In Tabelle 27 sind die sektoralen Endenergieverbräuche aufsummiert dargestellt und Veränderungen bis 2030 dokumentiert Referenzszenario 2030 Klimaszenario Sektoren Verbrauch [MWh] Verbrauch [MWh] Minderung [%] Verbrauch [MWh] Minderung [%] Haushalte ,7% ,0% Wirtschaft / Sonderverbraucher ,3% ,2% Erdgastankstelle ,8% ,0% Kommunale Verwaltung ,6% ,1% Summe ,2% ,3% Tabelle 28: Szenarien Endenergieverbrauch bis 2030 nach Sektoren Auch hier zeigt sich, mit Ausnahme des Absatzes der Erdgastankstelle werden die Endenergieverbräuche in allen Sektoren deutlich abnehmen. Die größten absoluten Minderungen werden auch bis 2030 (Referenz- und Klimaszenario) im Bereich der privaten Haushalte zu erwarten sein, gefolgt vom Sektor Wirtschaft (inkl. Sonderverbraucher). Die größten relativen Minderungspotenziale sind ebenso wie bis 2020 im Bereich der kommunalen Verwaltung lokalisiert (im Referenz- und Klimaszenario). 59
62 4. Szenarien, Leitbild, Ziele Szenarien bis 2030 CO 2 -Emissionen Die zu erwartenden CO 2 -Emissionen bis zum Jahr 2030 werden in der folgenden Tabelle 29 differenziert nach eingesetzten Energieträgern und betrachtetem Szenario dargestellt. Startjahr Referenzszenario Klimaszenario Energieträger 2010 [t CO 2 ] Absolut 2030 [t CO 2 ] 2010 << 2030 [%] Absolut 2030 [t CO 2 ] 2010 << 2030 [%] Umweltwärme ,5% ,0% Strom ,5% ,7% Sonnenkollektoren ,7% 7 301,8% Holz ,2% 42 5,5% Heizöl ,2% ,3% Flüssiggas ,7% ,9% Fernwärme ,1% ,5% Erdgas ,4% ,4% Braunkohle ,0% ,2% Biogase ,4% 21-6,2% Summe ,7% ,8% Tabelle 29: Szenarien CO2-Emissionen bis 2030 nach Energieträgern Abbildung 24 zeigt die CO 2 -Emissionen sektoral und nach Energieträgern aufgeschlüsselt. Entsprechend den obigen Darstellungen verschieben sich die Anteile der Energieträger an den gesamten CO 2 -Emissionen, so werden in der CO 2 -Bilanz beispielsweise Strom und Heizöl deutlich relevanter, Erdgas und Fernwärme z.b. verlieren dagegen an Gewicht. 60
63 4. Szenarien, Leitbild, Ziele Zusammenfassende Darstellung der CO2-Emissionen nach Sektoren und Energieträgern für die Stadt Bad Belzig 1000 t CO Haushalte Wirtschaf t/ Erdgastank- Kommunale Sonderverbraucher stelle Verwaltung Biogase Braunkohle Erdgas Fernwärme Flüssiggas Heizöl EL 5 0 Holz Sonnenkollektoren Strom Umweltwärme Abbildung 24: Vergleich CO 2-Emissionen 2010 und Szenarien 2030 nach Sektoren 4.4. Zusammenfassung der Ergebnisse der Szenarienanalyse Die Herangehensweise eine Abschätzung über die künftige energetische Situation in Bad Belzig und den daraus resultierenden Emissionen mit Hilfe einer Szenarienanalyse liefert Hinweise, in welchen Bereichen und bei welchen Endenergieträgern die wesentlichen Potenziale zu finden sind Zusammenfassung der Ergebnisse für die Sektoren Die größten absoluten Einsparpotenziale liegen im Bereich der privaten Haushalte, bis zum Jahr 2020 können alleine in diesem Bereich ca. 13 GWh/a Endenergie oder knapp 22 % eingespart werden. Die wesentlichen Maßnahmen zur Einsparung sind Gebäude- und Heizungsanlagensanierung und hocheffizienter Neubau zur Verringerung des Wärmebedarfs sowie vermehrter Einsatz von effizienter Beleuchtung, sowie weißer Ware und IuK- Technologien zur Verringerung des Strombedarfs. Im Bereich Wirtschaft stellt sich die Situation ähnlich dar: auch hier sind sehr hohe Einsparpotenziale zu erwarten: bis 2020 können in diesem Bereich ebenfalls rund 13 GWh/a oder 27 % weniger Endenergie verbraucht werden. Die wesentlichen Maßnahmen ähneln denen der privaten Haushalte, jedoch spielen in diesem Sektor effiziente Bürogeräte sowie optimierte Raumlufttechnik zusätzlich eine wichtige Rolle. 61
64 4. Szenarien, Leitbild, Ziele Die kommunalen Einflussmöglichkeiten auf diese beiden Sektoren sind verhältnismäßig gering. Denkbar ist die Einrichtung von Unternehmerstammtischen im Bereich der Wirtschaft, die Einrichtung einer Arbeitsgruppe Energieeffizienz für die Wohnungswirtschaft oder die kommunale Förderung von Sanierungsmaßnahmen. Bei Neubau kann durch definierte energetische Vorgaben in der Bauleitplanung Einfluss auf künftigen Verbrauch genommen werden. Da sich die Stadt Bad Belzig im Schrumpfen befindet, ist aber der Bestand der wesentliche Faktor, so dass empfohlen wird, verstärkt Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zu Energieeffizienz und Energieeinsparung für private Haushalte und Gewerbe und Industrie durchzuführen. Weitere Hinweise dazu werden in Abschnitt 5.3 gegeben. Der Verbrauch durch die Erdgastankstelle wird entsprechend den Anforderungen der Stadtverwaltung gesondert ausgewiesen. Die Verkehrsmodelle, die den Studien der Szenarien zugrunde liegen, berechnen, dass im Energieträgermix beim Straßenverkehr der Erdgas-Anteil deutlich zunehmen wird. Entsprechend gewinnt dieser Sektor an Relevanz. Da jedoch der übrige Verkehrssektor in der Bilanz und Potenzialanalyse nicht betrachtet wurde, können an dieser Stelle auch keine weiteren Aussagen zu möglichen Maßnahmen getroffen werden. Der Bereich der kommunalen Verwaltung bietet absolut gesehen, im Vergleich mit den privaten Haushalten und der Wirtschaft, nur geringe Minderungspotenziale: rund 3,5 GWh/a Endenergie können hier im Jahr 2020 vermieden werden. Jedoch sind die relativen Einsparmöglichkeiten in diesem Sektor besonders hoch: knapp 30 % des Endenergieverbrauchs können bis 2020 vermieden werden. Die wesentlichen Maßnahmen, die diesen Einsparpotenzialen zugrunde liegenden, sind (analog zum Sektor Wirtschaft) die vermehrte Gebäudesanierung und Erneuerung der Heizungssysteme, der vermehrte Einsatz von effizienter Beleuchtung und Bürogeräten sowie die Optimierung von Raumlufttechnik- Systemen. Im Unterschied zum Wirtschaftssektor sind hier die Einflussmöglichkeiten auf die genannten Potenziale vorhanden. Mögliche Maßnahmen in kommunalen Gebäuden werden in Abschnitt 4 vertieft untersucht und konkret beschrieben. Die Durchführung von Maßnahmen in diesem Sektor auch einen positiven Nebennutzen durch die Vorbildwirkung auf die weiteren Sektoren wird Zusammenfassung der Ergebnisse für die Energieträger Bei den Energieträgern wird für die fossilen Energieträger ein Schrumpfen prognostiziert (im Referenz- und Klimaszenario) besonders deutlich ist dies bei Braunkohle, Flüssiggas und Heizöl zu beobachten. Der Erdgas- und Fernwärmeverbrauch wird aufgrund der künftig besseren Qualität der Gebäudehüllen durch Sanierungen ebenfalls sinken, jedoch deutlich weniger stark. Erdgas und Fernwärme werden auch 2030 noch die dominanten Energieträger in der Stadt Bad Belzig sein. In den Ortsteilen wird auch Heizöl noch signifikante Anteile am Energieverbrauch haben. Strom wird künftig wahrscheinlich der stärkste Energieträger sein. Es ist zwar zu erwarten, dass neue stromsparende Technologien relevanter werden, jedoch ist mit einem Rebound-Effekt, der die Ersparnisse durch neue zusätzliche Verbräuche aufzehrt, zu rechnen. Eindeutiges Wachstum wird bei den erneuerbaren Energieträgern erwartet. Insbesondere Geo- und Solarthermie zur Wärmeversorgung werden ein starkes Wachstum erfahren am Gesamtenergieverbrauch werden diese Energieträger aber auch 2030 nur einen geringen Anteil haben. Die vermehrte thermische Nutzung von Biogas verspricht weitere Potenziale. 62
65 4. Szenarien, Leitbild, Ziele 4.5. Ziele im Bereich Energieeffizienz, -einsparung und Klimaschutz Im vorangegangenen Abschnitt wurden mögliche Potenziale für die Stadt Bad Belzig je Sektor und Energieträger theoretisch aufgezeigt. In diesem Abschnitt werden vorhandene Ziele und Leitbilder auf den verschiedenen Ebenen zusammengestellt und in Zusammenhang mit den ermittelten Potenzialen gebracht. Im Anschluss wird eine realistische Empfehlung für eine Zielstellung für die Stadt Bad Belzig gegeben Leitbild Bad Belzig 2030 Das Leitbild der Stadt Bad Belzig formuliert keine originären Ziele zur Energieeffizienz und zum Klimaschutz, es werden aber Leitlinien definiert, die auch für die energetische Zukunft der Stadt Bedeutung haben (können). Von 2010 bis 2011 wurde in der Stadt Bad Belzig ein Leitbild für 2030 entworfen. Neben einer Präambel sind insgesamt zehn Oberziele unter anderem die Umsetzung der Agenda 21 zur nachhaltigen Entwicklung und 19 Ziele für insgesamt sechs Handlungsfelder definiert. Zusätzlich wurde ein weiteres Handlungsfeld Innovative Projekte und Ideen mit konkreten Maßnahmenvorschlägen und einer Priorisierung erarbeitet. Als langfristige Projekte wurden in diesem Handlungsfeld die Energieautarke Region PM mit der Kurstadt Bad Belzig und Atomstromfreies Bad Belzig benannt (siehe auch Anhang 3) Leitbild des Landkreises Potsdam-Mittelmark Auf Ebene des Landkreises Potsdam-Mittelmark existiert ebenfalls ein Leitbild. In diesem wird unter anderem benannt, dass sich Potsdam-Mittelmark als Träger der Energiewende versteht. Ein Leitziel sieht vor, dass der Stromenergiebedarf des Landkreises bis zum Jahr 2022 nahezu vollständig aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt wird Ziele auf Landesebene Brandenburg Energiestrategie des Landes Brandenburg 2020 In der Energiestrategie 2020 des Landes Brandenburg sind unter anderem die folgenden Ziele benannt, die bis zum Jahr 2020 erreicht werden sollen: Reduzierung der CO 2 -Emissionen um 40 % gegenüber dem Jahr 1990, Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energieträger am Primärenergieverbrauch auf 20 %, Senkung des Endenergieverbrauchs um 13 % gegenüber Das Förderprogramm RENPlus des Landes Brandenburg unterstützt u. a. Kommunen dabei einen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele zu leisten. 46 Quelle: 47 Potsdam-Mittelmark: Wir bringen unsere Zukunft auf den Punkt. Das Leitbild des Landkreises Potsdam-Mittelmark Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg: Energiestrategie 2020 des Landes Brandenburg
66 4. Szenarien, Leitbild, Ziele Energiestrategie des Landes Brandenburg 2030 Im Jahr 2012 wurde eine Weiterentwicklung der Energiestrategie für das Land Brandenburg formuliert. Als wesentliche Ziele wurden benannt: Der Endenergieverbrauch soll bis 2030 um 23 Prozent sinken (Basis 2007), das entspricht durchschnittlich 1,1 Prozent pro Jahr. Der Primärenergieverbrauch soll um 20 Prozent sinken (der Primärenergieverbrauch ergibt sich aus dem Endenergieverbrauch und den Verlusten, die bei der Erzeugung der Endenergie aus der Primärenergie auftreten). Die erneuerbaren Energien sollen bis 2030 einen Anteil von mindestens 32 Prozent am Primärenergieverbrauch haben, am Endenergieverbrauch soll der Anteil 40 Prozent betragen. Die CO 2 -Emissionen sollen bis 2030 um 72 Prozent (auf 25 Millionen Tonnen gegenüber dem international üblichen Referenzjahr 1990) gesenkt werden Ziele auf Bundesebene Auf Bundesebene sind ebenfalls Ziele zu Energieeffizienz und -einsparung sowie zum Klimaschutz definiert. Die wesentlichen Ziele des Energiekonzeptes der Bundesregierung sind folgend für die Jahre 2020 und 2030 zusammengestellt. Bis 2020: 10 % weniger Stromverbrauch (Endenergie, Basis 2008), 35 % des Stroms durch erneuerbare Energien erzeugt, 18 % des gesamten Endenergieverbrauchs durch erneuerbare Energien, 20 % weniger Primärenergieverbrauch (Basis 2008), 40 % weniger Emissionen (Basis 1990). Bis 2030: 15 % weniger Stromverbrauch (Endenergie, Basis 2008), 50 % des Stroms durch erneuerbare Energien erzeugt, 30 % des gesamten Endenergieverbrauchs durch erneuerbare Energien, 30 % weniger Primärenergieverbrauch (Basis 2008), 55 % weniger Emissionen (Basis 1990) Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg: Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU): Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung
67 4. Szenarien, Leitbild, Ziele Übergeordnete Ziele auf internationaler und europäischer Ebene Auf internationaler und auf europäischer Ebene sind weitere Ziele definiert, die folgend überblicksartig und ohne Anspruch auf Vollständigkeit zusammengestellt sind. Erneuerbare Energien Der Sonderbericht des IPCC vom Mai 2011 geht davon aus, dass bis zum Jahr 2050 rund drei Viertel (77 %) der weltweiten Energieversorgung durch erneuerbare Energien gedeckt werden kann. 51 Auf europäischer Ebene wird bis zum Jahr 2020 angestrebt, dass der Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch auf 20 % erhöht wird. 52 Energieeffizienz Der EU-Energieeffizienzplan 2011 sieht vor, dass der Primärenergieverbrauch für das Jahr 2020 um 20 % unter den bisherigen Prognosen für 2020 liegen soll. 53 Reduzierung der Treibhausgasemissionen Durch Umsetzung des europäischen Emissionshandelssystems sollen die Treibhausgasemissionen um 20 % gegenüber 1990 sinken Ziele Bund und Brandenburg für die Stadt Bad Belzig Im Folgenden werden die relevanten Ziele des Landes Brandenburg und der Bundesregierung (siehe Abschnitt 4.5) zusammengestellt und in Bezug zur erstellten Energie- und CO 2 -Bilanz (Abschnitt 3.4) gestellt, dabei werden lediglich die Strom- und Wärmeverbräuche und dem zu Folge auch lediglich die Ziele in diesen Bereichen berücksichtigt. Die Zielformulierungen von Bund und Land Brandenburg benennen keine sektoralen Einsparziele, dementsprechend ist einschränkend zu bemerken, dass die Struktur Bad Belzigs mit dem bundesdeutschen bzw. brandenburgischen Durchschnitt in Bezug gesetzt wird. Dennoch ist die folgende Darstellung nützlich, um einen Pfad vorzuzeichnen, der beschritten werden muss, um die Ziele auch auf kommunaler Ebene zu erreichen. Eingeflossen in die folgende Betrachtung sind die höchstrangigen Ziele 55 : 1) Endenergieverbrauch -23 % (Basis 2007) oder -1,1 % jährlich (Brandenburgziel), 2) 50 % des Endenergieverbrauch durch erneuerbare Energien (Brandenburgziel), 3) Primärenergieverbrauch bis % (Basis 2008), bis % (Bundesziel). 51 IPCC: Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation Quelle: 53 Europäische Kommission: Energieeffizienzplan Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union: Richtlinie über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten für die Gemeinschaft Grundlage sind die in und formulierten Ziele, wobei in jeder Zieldimension, die zur Entwicklung eines Zielpfades notwendig ist, lediglich das Ziel mit den größten Minderungen aufgeführt ist und so Redundanz vermieden wurde. 65
68 MWh/Jahr 4. Szenarien, Leitbild, Ziele Bezogen werden die genannten Zieldimensionen auf die witterungsbereinigte Endenergiebilanz der Stadt Bad Belzig für das Jahr Die Werte zwischen den Zieljahren 2020 und 2030 sind linear interpoliert. Die Minderungsziele (Ziel 1.) und 3.)) werden auf den Ist-Stand der Bilanz bezogen und von dem jeweiligen Zielbasisjahr bis dahin linear interpoliert. Das zweite Ziel formuliert einen Anteil den Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch der derzeitige Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch beträgt knapp 8 %. 56 In Abbildung 25 sind die zusammengestellten Ziele Bund und Brandenburg Zielpfad Bund und Brandenburg Abbildung 25: Skalierung der Ziele des Landes Brandenburg auf die Energiebilanz Bad Belzig Ziele in Zusammenhang mit der ermittelten Energiebilanz dargestellt. Bezogen auf die Potenziale (siehe Abschnitt 4.2 und 4.3), ergibt sich folgende Abbildung 26. Zur Erreichung der Ziele sind nach dieser Darstellung keine besonderen Anstrengungen der Kommune notwendig, da bereits im Referenzszenario die Zielpfade des Landes Brandenburg und des Bundes deutlich unterschritten werden: der gesamte Endenergieverbrauch wird im Referenzszenario im Jahr 2030 rund 10 GWh (77,8 GWh/a) unter dem Endenergieverbrauch der Ziele (87,4 GWh/a) liegen. Nach dem Klimaszenario liegt der gesamte Endenergieverbrauch nochmals deutlich niedriger bei insgesamt rund 70 GWh/a. Es muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass die Bevölkerungsentwicklung einen wesentlichen Einfluss auf die Energieverbräuche hat, so dass in Bad Belzig ein nicht unerheblicher Anteil der prognostizierten Energieeinsparungen vor allem durch die prognostizierte schrumpfende Bevölkerungszahl erreicht wird (vgl. Abschnitt 4.2.1). 56 Hier liegen die Werte der Bilanz für die Wärmeerzeugung zu Grunde (2,7 % erneuerbare Energien) sowie die Stromkennzeichnung von E.ON Edis für das Jahr 2010 (20,4 % erneuerbare Energien), da bilanziell der auf dem Stadtgebiet verbrauchte und nicht der erzeugte Strom ausschlaggebend ist. 66
69 MWh/Jahr 4. Szenarien, Leitbild, Ziele Entwicklung des Energieverbrauchs 2010 und Ziele Bund und Brandenburg (witterungsbereinigt) Zielpfad Bund und Brandenburg Referenzszenario Klimaszenario Abbildung 26: Gegenüberstellung Zielpfad Bund und Brandenburg mit Referenz- und Klimaszenario Bad Belzig Um den Einfluss der Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen, wird folgend der Energieverbrauch je Einwohner betrachtet so kann ein aussagekräftiger Vergleich zwischen den erstellten Szenarien und den Zielen auf Bundes- und Landesebene erfolgen. In Abbildung 27 sind zunächst die Ziele des Landes Brandenburg und der Bundesregierung in Bezug auf den Pro-Kopf-Endenergieverbrauch dargestellt. Der Wert für das Ausgangsjahr wird dabei auf die derzeitige Bevölkerung Bad Belzigs bezogen. Um den Bezug zu den Landes- und Bundeziele darzustellen, wird die Bevölkerungsentwicklung gemäß den Prognosen des Landes Brandenburg eingebracht hier wird zwar auch eine Minderung der Bevölkerung erwartet jedoch deutlich geringer als für der Stadt Bad Belzig. 57 Gemäß diesen Annahmen wird eine Abnahme des Pro-Kopf-Endenergieverbrauchs bis 2020 von 12,5 % und bis 2030 von 18,5 % erwartet oder bezogen auf den Pro-Kopf-Verbrauch in Bad Belzig 9,3 MWh im Jahr 2020 und 8,7 MWh im Jahr Quelle der Bevölkerungsprognose: LBV, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
70 MWh/Jahr MWh/Jahr 4. Szenarien, Leitbild, Ziele Ziele Bund und Brandenburg (witterungsbereinigt) Pro-Kopf Zielpfad Bund und Brandenburg Abbildung 27: Ziele Bund und Brandenburg bezogen auf die Bevölkerungsentwicklung in Bad Belzig Abbildung 28 stellt die Ziele Bund und Brandenburg noch ins Verhältnis zu den erarbeiteten Szenarien für den Pro-Kopf-Endenergieverbrauch in Bad Belzig. 58 Entwicklung des Energieverbrauchs 2010 und Ziele Bund und Brandenburg (witterungsbereinigt) Zielpfad Bund und Brandenburg 10 Referenzszenario 9 8 Klimaszenario 7 6 Abbildung 28: Ziele Bund und Brandenburg und Referenz- und Klimaszenario bezogen auf die Bevölkerungsentwicklung in Bad Belzig Ohne wesentliche zusätzliche Anstrengungen sind gemäß dem Referenzszenario bis zum Jahr 2020 Einsparungen beim Pro-Kopf-Endenergieverbrauch von rund 9,2 % auf ca. 9,7 MWh zu erwarten, bis 2030 nimmt der Pro-Kopf-Endenergieverbrauch um 17,5 % auf 58 Hier wird die Bevölkerungsprognose der Stadt Bad Belzig zu Grunde gelegt vgl. Abbildung
71 4. Szenarien, Leitbild, Ziele 8,8 MWh ab. Entwickelt sich die Stadt dem Klimaszenario folgend, resultiert bis 2020 eine Minderung um rund 14,3 % auf ca. 9,1 MWh; bis 2030 nimmt in diesem Szenario der Pro- Kopf-Endenergieverbrauch um knapp 30 % auf ca. 7,6 MWh ab. Zur Erreichung der Ziele des Landes und des Bundes müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden. Die Maßnahmen, die im Klimaszenario eine Rolle spielen, können hier aufgegriffen und angepasst (vgl. Abschnitt 4.2 und Anhang 2), weitere für Bad Belzig spezifische Maßnahmen müssen entwickelt werden. Unter Umständen ist bei einigen Maßnahmen die Einflussmöglichkeit der Kommune begrenzt hier ist zu erörtern, was die Stadt Bad Belzig leisten kann (z.b. Fördermittel zur Verfügung stellen, Beratungsleistungen initiieren etc.). Konkrete Maßnahmen zur Minderung des Energieverbrauchs im Gebäudebestand der Kommune und bei der Straßenbeleuchtung sowie zum vermehrten Einsatz von erneuerbaren Energien werden in den Abschnitten 6, 7, 8 und 9 erarbeitet und dargestellt. In jedem Fall ist es empfehlenswert alle relevanten Akteure bei der Ausformulierung des Zielpfades durch die Maßnahmenkonstruktion einzubinden ein erster Schritt dazu ist bereits im Rahmen bei der Erstellung des Energiekonzeptes mit der Einrichtung einer Steuerungsgruppe, einem Workshop und der Durchführung einer Befragung gegangen (siehe Abschnitt 5.1). 69
72 5. Controlling und Öffentlichkeitsarbeit 5. Controlling und Öffentlichkeitsarbeit 5.1. Akteursbeteiligung Steuerungsgruppe Zu Beginn des Projektes wurde eine Steuerungsgruppe einberufen der projektbegleitend regelmäßig die Vorgehensweise und der Projektfortschritt dargelegt wurden. Die Mitglieder aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Energieversorgung wurden zu Beginn gemeinsam mit dem Auftraggeber ausgewählt (siehe Anhang 1). Die erste der drei Sitzungen der Steuerungsgruppe hat vor allem eine Einführung in das Projekt gegeben, den Ablauf dargelegt und die Vorgehensweise erläutert. In der folgenden Sitzung wurden die Zwischenergebnisse der Energie- und CO 2 -Bilanz sowie des Konzeptes für die öffentliche Gebäude und die Straßenbeleuchtung vorgestellt und diskutiert. Die dritte und letzte Sitzung der Steuerungsgruppe hatte als wesentliches Thema die Ziel- und Leitbilddiskussion zum Inhalt Workshop Am wurde ein Workshop durchgeführt. Nach einer fachlichen Einführung und Präsentation der Zwischenergebnisse, wurde über mögliche Maßnahmen diskutiert. Folgend sind die Ergebnisse des Workshops dokumentiert (die Teilnehmer des Workshops sind in Anhang 1 festgehalten, eine ausführliche Dokumentation der Ergebnisse findet sich in Anhang 3). Maßnahmendiskussion Zur Einführung in die Diskussion wurden die folgenden Maßnahmenvorschläge eingebracht: 4) Energiekonzept öffentliche Gebäude, 5) Energieeinsparung Straßenbeleuchtung, 6) Energieeinsparungen in Sanierungsgebieten / Ortsteilen, 7) Ausbau der Nutzung von Photovoltaik, 8) Energieautarkie am Beispiel Dippmannsdorf, 9) Ausbau Nutzung von Biomasse, 10) Interkommunale Zusammenarbeit, 11) Konzepte zur Bürgerbeteiligung. Im intensiven Diskussionsprozess in der Gruppe wurden die vorgestellten Maßnahmen umformuliert/umbenannt und weiter diskutiert und schließlich auf einer Stelltafel gesammelt (siehe Abbildung 29) 70
73 5. Controlling und Öffentlichkeitsarbeit Abbildung 29: Maßnahmendiskussion II und Priorisierung der Maßnahmen Die Maßnahmen 1 und 2 wurden von der Gruppe übernommen. Die 3. Maßnahme wurde umbenannt in Energieeinsparungen Wohngebäude-Bestand (während der Diskussion wurde eingeworfen, dass es dabei nur um Liegenschaften im Privatbesitz gehen kann, weil die Wohnungsgesellschaften schon viel getan hätten und die Gebäude auf einem guten energetischen Stand sind). Die 4. Maßnahme wurde ebenfalls übernommen. Die Maßnahme Energieautarkie am Beispiel Dippmannsdorf hat durch die Diskussion neue Aspekte bekommen: die kalte Nahwärme, folglich wurde als konkrete Maßnahme formuliert Rechtssicherheit und Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Maßnahmen 6 und 7 wurden zusammengefasst, da es bei der Interkommunalen Zusammenarbeit unter anderem um die gemeinsame Nutzung von Biomasse geht und Gespräche dazu laufen. Die Maßnahme 8 wurde eher in Richtung der zu schaffenden Projekte umformuliert und schließlich ist noch eine neue Maßnahme mit dem Titel Nutzerverhalten und Bewusstsein hinzugekommen. Die Priorisierung der Maßnahmen ist in Tabelle 121 dargestellt Maßnahmenname Punkte Energiekonzept öffentliche Gebäude 7 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 3 Energieeinsparung Wohngebäudebestand 5 Ausbau Nutzung von Photovoltaik 4 Rechtsicherheit und Rahmenbedingungen 5 Interkommunale Zusammenarbeit 5 Projekte zur Bürgerbeteiligung 5 Nutzerverhalten und Bewusstsein 5 Tabelle 30: Maßnahmenpriorisierung In einer abschließenden Diskussion wurden vier Maßnahmen, die von der Gruppe als prioritär bewertet wurden weiter ausformuliert und so in eine relativ konkrete Handlungsanweisung überführt. Diskutiert wurden die Maßnahmen: Energiekonzept öffentliche Gebäude, Energieeinsparung Wohngebäudebestand, Interkommunale Zusammenarbeit und 71
74 5. Controlling und Öffentlichkeitsarbeit Rechtssicherheit und Rahmenbedingungen für die Nutzung von kalter Nahwärme und Wärmepumpen am Beispiel Dippmannsdorf. Eine weitere Ausformulierung der Maßnahmen findet sich in Anhang Befragung Zu Beginn des Projektes wurde eine Bürgerbefragung zum Energieträgereinsatz durchgeführt. Grund für die Durchführung dieser Befragung war nicht so sehr die Datenerhebung, sondern vielmehr der Einbezug einer breiten Öffentlichkeit. Die Befragung verlief zweigleisig: über die Internet-Startseite der Stadt Bad Belzig ( konnte eine Online-Befragung erreicht werden, parallel dazu wurden schriftliche Fragebögen (siehe Anhang 5) der Stadtwerkezeitschrift beigelegt. Um eine möglichst hohe Rücklaufquote zu erhalten, wurde die Befragung so kurz wie möglich gehalten und auf lediglich fünf Fragen beschränkt: 12) Wohnen Sie zur Miete oder im Eigentum? 13) Wohnen Sie in der Kernstadt oder im Ortsteil? 14) Wie viel m² misst Ihre Wohnung / Ihr Haus? 15) Wie viele Mitglieder zählt Ihr Haushalt? 16) Mit welchem Energieträger beheizen Sie Ihre Wohnung / Ihr Haus und bereiten Sie Warmwasser? Wie hoch ist Ihr jährlicher Verbrauch an dem jeweiligen Energieträger? Insgesamt haben 44 Haushalte an der Befragung teilgenommen. Rund drei Viertel der Befragten wohnen im Eigentum und ca. 80% der Befragten leben in der Kernstadt, siehe Wohnen Sie zur Miete oder im Eigentum? Wohnen Sie in der Kernstadt oder im Ortsteil? Miete Kernstadt 23% Eigentum 20% Ortsteil 77% 80% Abbildung 30: Auswertung der Befragung. Ergebnisse Miete/Eigentum und Wohnort Abbildung 30. Der Median der Wohnungsgröße liegt bei 97 m² mit durchschnittlich 2 Bewohnern. 72
75 5. Controlling und Öffentlichkeitsarbeit Je ein Viertel der Befragten setzen Öl und Erdgas zur Beheizung und zur Warmwasserbereitung ein. 19 % nutzen dafür Elektrizität und 12 % Fernwärme. Die Anteile der eingesetzten Energieträger am Energieverbrauch teilen sich etwas anders auf. Auch hier dominieren Öl und Gas, Elektrizität spielt aber mit nur 5 % eine deutlich untergeordnete Rolle. Überaschend ist der niedrige Anteil der Fernwärme am Häufigkeit der eingesetzten Energieträger Anteile der eingesetzten Energieträger am Energieverbrauch Öl 19% 25% 4% 0% 0% 10% 5% 36% Erdgas Kohle Holz 2% 2% 12% 11% 6% 23% 11% 4% 30% Pellets Solarthermi e Fernwärme Elektrizität Abbildung 31: Diagramm Energieverbrauch. Im Vergleich mit der Bilanz (Abschnitt 3.4) wird deutlich. dass Ergebnisse der Befragung nicht repräsentativ sind das primäre Ziel der Befragung war die Bürgerschaft einzubinden und über die Erarbeitung eines Energiekonzeptes zu informieren Controlling Die Einrichtung eines Controlling-Systems Bad Belzig ist entscheidend für voranschreitende Energieeffizienz und stetigen Klimaschutz. Es dient der Erfolgskontrolle der gesteckten Ziele sowie der Überprüfung der Effizienz der geplanten bzw. durchgeführten Maßnahmen. Zudem sichert ein solches System die Weiterentwicklung des Energiekonzeptes und garantiert eine dauerhafte organisatorische Verankerung des Themas in Bad Belzig. Im Wesentlichen muss das Controlling-System die folgenden Bausteine zur Erfüllung der notwendigen Anforderungen enthalten: Die Schaffung personeller Voraussetzungen in der Stadt zur Moderation, Steuerung und Sicherung des Prozesses (Energiemanager). Die organisatorische Verankerung des Prozesses durch Einrichtung kompetenter Teams, Ausschüsse oder Gremien (z.b. eines Energieteams). Die Etablierung eines kontinuierlichen Prozesses, der eine laufende periodische Überprüfung der Zielerreichungsgrade und der Effizienz einzelner Maßnahmen ermöglicht. 73
76 5. Controlling und Öffentlichkeitsarbeit Fortschreibung der Energie- und CO 2 -Bilanz (Monitoring) Schaffung personeller Voraussetzungen Um das Thema mit all seinen Facetten in Bad Belzig umzusetzen, dieses in die Bürgerschaft zu tragen sowie diese stärker einzubeziehen, gibt es derzeit keine dauerhafte Stelle. Es wird daher empfohlen, die Stelle eines Energiemanagers zu schaffen. Die Aufgaben des Energiemanagers sind u.a.: Initiierung von Maßnahmen gemeinsam mit anderen Akteuren und Unterstützung bei der Umsetzung von Einzelprojekten. Öffentlichkeitsarbeit, z.b. Aufbau und Pflege eines Internetportals und Durchführung von Kampagnen. Aufbau und Koordination eines Energiebeirats. Sammlung und Aufbereitung relevanter Daten und Informationen für das Controlling inkl. Berichterstattung. Vernetzung der Akteure in der Stadt, im Landkreis sowie mit anderen Kommunen. Der Energiemanger übernimmt somit die Funktion des Motivators, des Prozesssteuerers und des Kommunikators, der die Bürger sowie die Gewerbebetriebe in Bad Belzig anspricht und sie in den Prozess der Umsetzung des Energiekonzeptes einbindet Organisatorische Verankerung des Prozesses Um die Arbeit zum Thema Energieeffizienz, -einsparung und Klimaschutz in der Stadt Bad Belzig abzusichern, die Aktivitäten der Akteure zu bündeln und diese auf eine breitere Basis zu stellen, sollte ein Energieteam eingerichtet werden. Dieser Beirat könnte aus dem bisherigen Steuerungsgruppe hervorgehen Etablierung eines kontinuierlichen Prozesses für eine periodische Überprüfung Zur Dokumentation der Fortschritte wird die Einführung eines kommunalen Energiemanagements empfohlen mit einer mindestens zweijährigen Berichterstattung. Es ist Aufgabe des Energiemanagers, den Sachstand des Energiekonzeptes in Bad Belzig regelmäßig bei den relevanten Akteuren abzufragen, aufzubereiten und schriftlich zu dokumentieren sowie diesen im Rahmen eines Audits/Erfolgskontrolle mit dem Energiebeirat zu beraten und Anpassungen durchzuführen. Einzelne Mitglieder können auch für die Steuerung und Berichterstattung einzelner Maßnahmen verantwortlich sein Begleitendes Prozess- und Qualitätsmanagement Die wesentlichen Grundvoraussetzungen, um ein kontinuierliches Controlling mit relativ einfachen Eigenmitteln entwickeln zu können, wurden dargelegt, die Leistungsfähigkeit eines solchen einfachen Systems bleibt jedoch verständlicherweise weit hinter den Chancen und Möglichkeiten, die professionelle und etablierte Prozessmanagementsysteme mit sich 74
77 5. Controlling und Öffentlichkeitsarbeit bringen. Zu den führenden Managementtools zur Steuerung von Klimaschutzaktivitäten im kommunalen Handlungsraum gehört unbestritten der European Energy Award (eea). Am eea nehmen heute ca Kommunen aus 21 europäischen Ländern teil. Alleine in Deutschland sind bereits 250 Städte und Landkreise dem eea beigetreten. Der eea garantiert neben der Verbesserung interner Abläufe und der intensiven Kommunikation zwischen den Akteuren und beteiligten Fachbereichen insbesondere auch die Etablierung des Klimaschutzes als kontinuierlichen Prozess und ist vornehmlich auf die Handlungsfelder der kommunalen Verwaltung ausgerichtet. Den wesentlichen Motor des eea stellt das Energieteam (projektbegleitend in Form des Lenkungsgremiums etabliert) dar. Auch ein Energiemanager gehört selbstverständlich zum Energieteam. Dieser kann hierbei die Rolle des internen Koordinators bzw. Leiters des Energieteams übernehmen. Im Gegensatz zum Lenkungsgremium wird das Energieteam des eea zusätzlich durch einen akkreditierten eea-berater begleitet. Dieser moderiert nicht nur den eea-prozess sondern bringt auch zusätzlichen externen Sachverstand und Erfahrungen aus anderen Projekten ein. Das Energieteam und der eea-berater führen jährlich eine umfassende Bewertung des Ist- Stands durch und erstellen ein fortschreibbares energiepolitisches Arbeitsprogramm. Zur Ergebnisprüfung wird jährlich ein internes Audit durchgeführt dokumentiert in einem kurzen Bericht. Die regelmäßige Gegenüberstellung der geplanten und umgesetzten Maßnahmen ermöglichen eine gezielte Steuerung des Umsetzungsprozesses und eine konsequente Erfolgskontrolle. Dadurch wird gewährleistet, dass die geplanten und umgesetzten Maßnahmen der vergangenen zwölf Monate reflektiert, die durch sie erreichten Ergebnisse dokumentiert und eventuell auftretende Hemmnisse identifiziert und zukünftig vermieden werden können. Ein integraler Bestandteil des eea ist auch die externe Zertifizierung mit anschließender Auszeichnung. Die Erfolge der Energie- und Klimaschutzaktivitäten der Stadt Bad Belzig werden im Rahmen der Zertifizierung durch einen externen Auditor überprüft. Bestätigt der Auditor das Erreichen von definierten Standards, wird die Stadt mit dem European Energy Award ausgezeichnet. Die erzielten Erfolge werden so öffentlich dokumentiert und anerkannt, die Vorbildfunktion der Stadt hinsichtlich Energieeffizienz und Klimaschutz gestärkt und gezieltes Standortmarketing betrieben. Die Auditierung und der Vergleich mit anderen eea-kommunen finden grundsätzlich auf freiwilliger Basis statt. 75
78 5. Controlling und Öffentlichkeitsarbeit Abbildung 32: Schematische Darstellung des eea-prozess 5.3. Öffentlichkeitsarbeit Mittels einer gezielten Kommunikation ist es möglich Energieeffizienz, -einsparungen und den Klimaschutz in der Stadt Bad Belzig stärker in das öffentliche Bewusstsein zu rücken, handlungsleitende Informationen zu vermitteln, die unterschiedlichen Zielgruppen zu Verhaltensänderungen und einer aktiven Beteiligung zu motivieren und darüber hinaus zum Leitbild der Stadt Bad Belzig der nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Folgend werden Grundlagen, Leitlinien und erste Ideen für die Öffentlichkeitsarbeit in Bad Belzig aufgezeigt. Ziele der Kommunikation zu Energieeffizienz, -einsparung und zum Klimaschutz sind: Aufmerksamkeit und Interesse zu wecken, Informationen zu verbreiten, Motivation und Anleitung zum konkreten Handeln zu vermitteln. Zielgruppen für die Öffentlichkeitsarbeit sind: Bürgerinnen und Bürger von Bad Belzig, hier sind auch die Kommunikationsspezifika bestimmter Gruppen (Schüler, ältere Mitbürger und Mitbürgerinnen, sozial schwache Einkommensgruppen, etc.) zu berücksichtigen. Unternehmensleitungen aus den Bereichen Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (einschließlich Handwerk), Mitarbeiter/innen in Betrieben und Einrichtungen, Multiplikatoren (beispielsweise Vereine, Lehrpersonal, Beratungseinrichtungen, etc.), Kinder und Jugendliche. Auch bei der Vermittlung der Inhalte sollten einige Grundlagen beachtet werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass das zentrale Thema Klimawandel, also die Erwärmung der Erdtemperatur, mit ihren überwiegend negativen Folgen in der Bevölkerung in Bad Belzig bekannt ist. Regionale Auswirkungen wie Hitzewellen und Starkregenereignisse sind aber in der Kommunikation zu berücksichtigen. Auch die Verknappung (Erdöl und Erdgas) und damit Verteuerung der Energie ist anzusprechen und zu vermitteln ist außerdem, dass frühzeitig getroffene Maßnahmen zur Einsparung bzw. Substitution durch erneuerbare Energieträger sich langfristig auszahlen und auch zur regionalen Wertschöpfung beitragen. Besonders zu berücksichtigen ist, dass nicht mit Katastrophenszenarien gedroht oder an das schlechte Gewissen der Bevölkerung appelliert wird, sondern konkrete Bewertungshilfen und überschaubare Handlungsempfehlungen gegeben werden. Eine positive Motivation über 76
79 5. Controlling und Öffentlichkeitsarbeit Vorbilder und die Vorteile eines anderen Verhaltens sowie eine Verknüpfung mit Gefühlen wie Lust, Freude und Spaß ist anzustreben. Nach dem Leitsatz Tu Gutes und rede drüber sind alle Maßnahmen, die durchgeführt werden, von Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten. Dabei sind die geschilderten Leitlinien zu beachten. Die Zielgruppen werden mit einem Mix aus verschiedenen Kommunikationskanälen aus Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Aktionen angesprochen. Dazu gehören unter anderem: Elektronische Medien Internetportal oder Weiternutzung der Verknüpfung zum Energiekonzept auf der Startseite der Stadt Bad Belzig. Printmedien Pressemitteilungen, Flyer und Broschüren, Amtsblatt, Stadtwerke Nachrichten, Aushänge im Rathaus. Seminare und Aktionen Vorträge, Wettbewerb Energieeinsparung, Führungen Best-Practice Beispiele. Im Folgenden soll kurz die Einrichtung einer Stelle Energiemanager, die Gründung und Fortführung von Energie- und Klimaschutz-Netzwerken und die Nutzung eines Internetportals als zentrales Kommunikationsmedium hervorgehoben werden. Energiemanager Der Energiemanager als zentraler Ansprechpartner koordiniert alle Kommunikationsinstrumente und bindet je nach Bedarf und Maßnahme weitere Akteure ein. Dadurch entsteht ein stetig wachsendes Netzwerk. Der Energiemanager entwickelt außerdem in Abstimmung mit dem Lenkungsgremium einen jährlichen Aktionsplan Öffentlichkeitsarbeit. Dieser Aktionsplan zeigt, welche Maßnahmen und Kommunikationsinstrumente der Stadt für die Ansprache der Zielgruppen zu welchem Zweck und zu welchem Zeitpunkt eingesetzt werden. Ein weiterer wesentlicher Aspekt in der Arbeit des Energiemangers ist die Organisation und Koordinierung verschiedener Netzwerke. 77
80 5. Controlling und Öffentlichkeitsarbeit Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke Während der Erstellung des vorliegenden Energiekonzeptes wurde ein Lenkungsgremium ins Leben gerufen, um die wesentlichen (Zwischen-)Ergebnisse vorzustellen und breite Legitimierung für die Vorgehensweise einzuholen. Es wird empfohlen im weiteren Prozess dieses Gremium regelmäßig einzuberufen. Denkbar ist, dass sich das Gremium weiterhin vierteljährlich unter dem Namen Energieteam trifft. Teil der Sitzungen sollten die Fortschritte in der Umsetzung des Konzeptes sein und die gemeinsame Absprache zu weiterem Vorgehen, einzuleitende Maßnahmen und einzubeziehende Akteure. Ein besonders großes Potenzial zur Minderung des Energieverbrauchs in Bad Belzig aber auch entsprechend hoher Abstimmungsbedarf liegt im Bereich der privaten Haushalte. Sinnvoll zur Ausschöpfung der Potenziale ist die Gründung eines Runden Tisches energetische Sanierung. Dabei sollen Akteure aus den Bereichen Stadtverwaltung, Wohnungswirtschaft, Stadtwerke und lokaler Energieberater besser zu vernetzt werden, um Interessenkonflikte konstruktiv zu lösen, aber auch um die Kompetenzen und Angebote im Bereich energetische Sanierung und Einsatz erneuerbarer Energien zu bündeln und Informationen auszutauschen. Ebenfalls hohe Potenziale für die Minderung des Endenergieverbrauchs wurden im Bereich Wirtschaft identifiziert. Für diesen Sektor hat sich die Einrichtung eines Unternehmerstammtisches bewährt. Im Mittelpunkt steht dabei ein Erfahrungsaustausch der beteiligten Akteure aus Gewerbe, Handel Dienstleistung und der Stadt Bad Belzig zum Thema Energieeffizienz, -einsparungen und Klimaschutz. Schließlich wurden insbesondere im Bereich des Ausbaus der Nutzung von erneuerbaren Energien wesentliche Ausbaupotenziale in interkommunaler Zusammenarbeit identifiziert. Laufende Gespräche sollten mit dem Ziel der Schaffung einer gemeinsamen Basis intensiviert werden. Internetportal Als zentrales Kommunikationsmedium der Stadt Bad Belzig kann ein Internetportal dienen. Im Rahmen der Erstellung dieses Konzeptes wurde bereits mit einer Internetseite gearbeitet, die von der Startseite der Stadt Bad Belzig zu erreichen ist. Im Anschluss an die Konzepterstellung wird empfohlen weiterhin ein Internetportal zum Energiekonzept zu betreiben. Hier kann sich die Bevölkerung umfassend zum Thema Energieeffizienz, - einsparungen und Klimaschutz und die Aktivitäten in der Stadt Bad Belzig informieren. Zudem werden Tipps zu Energieeffizienz und Klimaschutz gegeben und für Mitmachaktionen (z.b. Wettbewerbe) motiviert. Neben wichtigen Informationen zu Einsparpotenzialen (u.a. bei Gebäuden) wird auch auf Beratungsangebote der Fachressorts und Fördermittel (Landes-, Bundes-, EU-Fördermittel) hingewiesen. 78
81 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Aufbauend auf die vorangegangenen Betrachtungen möglicher Potenziale anhand der prognostizierten Szenarien-Entwicklungen werden im folgenden Abschnitt Detailbetrachtungen durchgeführt, um konkrete Möglichkeiten zur Minderung des Energieverbrauchs und der CO 2 -Emissionen bezogen auf Teile der kommunalen Liegenschaften aufzuzeigen. Dazu sind aus dem Gebäudebestand der Stadt Bad Belzig 17 Objekte mit unterschiedlicher Nutzung ausgewählt und im Rahmen einer detaillierten Bestandsanalyse untersucht worden. Bei den baulichen Anlagen handelt es sich um folgende Gebäude und Gebäudegruppen: Bauhof Hauptgebäude, Turnhalle Karl-Liebknecht-Straße, 3-Feld-Sport- und Mehrzweckhalle Albert-Baur, Feuerwehr Hauptgebäude, Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule Hauptgebäude), Geschwister-Scholl-Schule (Oberschule Ganztagsgebäude), Krause-Tschetschog-Oberschule Belzig, Kindertagesstätte Tausendfüßler, Freizeit- und Erlebnisbad, Teilobjekt Eisbahn, Bürgerhaus Bad Belzig, Rathausgebäude Bad Belzig, Kindertagesstätte 1 (Hauptgebäude), Jugendfreizeitzentrum POGO, Gemeindehaus Bergholz, Kindertagesstätte Lütte (Hauptgebäude), Gemeindehaus Neschholz, Wärmeverbundnetz Schulgelände. In einem ersten Arbeitsschritt wurden mit Unterstützung der projektbeteiligten Akteure die vorhandenen Daten zusammengetragen, ergänzt bzw. teilweise aktualisiert. Somit konnten neben den gebäudespezifischen Kennwerten auch die Verbrauchswerte für Heizwärmeenergie und Strom ermittelt werden. Ergänzend dazu fanden im Zuge von zwei Ortsterminen am und am die Besichtigungen der einzelnen Liegenschaften statt. Diese dienten vordergründig der weiterführenden Bestandsaufnahme sowie der Fotodokumentation und Beurteilung des Zustandes der baulichen und gebäudetechnischen Anlagen der Objekte. Auf der Grundlage des erhobenen Datenbestandes und der dokumentierten Erkenntnisse entstand unter Berücksichtigung der bisher erfolgten baulichen Eingriffe und Sanierungsansätze eine zusammenfassende Beschreibung der Ist-Situation der jeweiligen Gebäudesubstanz. 79
82 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude In einem weiteren Arbeitsschritt wurden die gewonnenen Erkenntnisse und Verbrauchskennwerte untersucht und ausgewertet, mit dem Ziel die gebäudespezifischen Minderungspotenziale zu definieren. Daraus gingen in einer abschließenden Formulierung die objektbezogenen Maßnahmenempfehlungen für die Stadt Bad Belzig in der Reihenfolge der oben dargestellten Gebäudeliste hervor. In einer tabellarischen Übersicht werden objektbezogen die energetischen Optimierungskennwerte den Investitionen gegenübergestellt um die Wirtschaftlichkeit der zu Grunde gelegten Maßnahmenvorschläge zu bewerten. 59 Diesen Hochrechnung sind pauschalisierte Kostenkennwerte bezogen auf das jeweilige Bauteil bzw. die Anlagenkomponente zu Grunde gelegt. Die aufgezeigten Investitionssummen und folglich die Amortisationszeiten sind demnach als Richtwert zu verstehen. Um diese Aussagen konkretisieren zu können, wird für das jeweilige Objekt dezidierte Untersuchungen empfohlen. Die aufgezeigten Heizenergieverbräuche der jeweiligen Objekte wurden aus den Unterlagen der jährlichen Verbrauchserfassung der Stadt Bad Belzig übernommen und sind nicht klimabereinigt. Zur Berechnung der Energieeffizienzmaßnahmen hingegen wurden Heizenergieverbräuche klimabereinigt und über den Zeitraum von drei Jahren gemittelt. 59 Zur Bewertung von Energieeffizienzmaßnahmen werden die folgenden Energiepreise angenommen (Netto): *=Erdgas: 0,06 EUR/kWh, **=Strom:0,23 EUR/kWh, 80
83 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude 6.1. Bauhof Hauptgebäude Anschrift: Karl-Liebknecht-Straße 8a Bad Belzig Gebäudekennwerte: Abbildung 33: Ansicht Bauhof Hauptgebäude Baujahr: 1985 Nutzung: Verwaltung, Lager Zustand: teilsaniert (1995) Brutto-Grundfläche (BGF): 650,81 m² Konstruktions-Grundfläche(KGF): 87,85 m² Netto-Grundfläche (NGF): 562,96 m² Brutto-Rauminhalt (BRI): 4.823,13 m³ Etagenanzahl: 2 Kellergeschoss: - Energieversorgung: Heizungsanlage: Buderus G 224 LP Baujahr: 1993 Energieträger: Erdgas Leistung: 33 kw Verbrauchserfassung: Heizung kwh kwh kwh Strom kwh kwh kwh Tabelle 31: Energieverbräuche Bauhof Hauptgebäude 81
84 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Gebäude Das Objekt des Bauhofes setzt sich zusammen aus einem Bestandsgebäude und einem Erweiterungsbau, errichtet aus Porotonmauerwerk. Das zweigeschossige Gebäude beherbergt sowohl im Altbau als auch im Erweiterungsgebäude Garagenflächen, Arbeits-, Aufenthalts- und Nebenräume für die Mitarbeiter des Bauhofes. Der hofseitig gelegene eingeschossige Gebäudeteil, in dem die Werkstatthalle und zwei Garagen untergebracht sind, ist mit einer Holzbinderkonstruktion mit Trapezblecheindeckung überdacht. Die Dachflächen sind nicht gedämmt und in den Anschlussbereichen zu den Außenwänden (Trauflinie) sind offene Zwischenräume sichtbar, durch die Außenluft ungehindert in den Dachraum zirkulieren kann. In Eigeninitiative wurde die Geschossdecke oberhalb der Aufenthaltsräume im Obergeschoss in den vergangenen Jahren mit einem mineralischen Klemmfilz (Dicke: 160 mm) ausgelegt, um eine Dämmwirkung zum unbeheizten Dachraum herzustellen. Die Fenster der Straßenfront wurden ab ca schrittweise gegen Kunststofffenster mit Isolierverglasung ausgetauscht. Die kassettierten Verglasungen der Nord-Ost-Fassade bestehen aus Isolierglaselementen, die in die Öffnungen der Betonfassade geklebt wurden (ohne Rahmenverbund). Die Toranlagen sind 1996 erneuert worden und bestehen aus ungedämmten Sektionaltoren. Abbildung 34: Torelemente Bauhof Abbildung 35: Werkstatt Bauhof Abbildung 36: Anschluss Festverglasung Bauhof Bestandsbeschreibung Anlagentechnik Die Beleuchtung des Werkstadtbereiches erfolgt durch doppelflammige Langfeldleuchten mit T8 Leuchtmittel ohne Reflektoren. Die Wärmeversorgung erfolgt durch zwei getrennt installierte Wärmeerzeuger. Für die Beheizung des Bestandsgebäudes, in dem sich auch die Werkstatt befindet, ist ein Nieder- Temperaturkessel (Abbildung 38) mit einer Leistung von 33 kw mit nebenstehendem Warmwasserspeicher installiert. Der später errichtete Anbau wird durch eine wandhängende Gastherme (Abbildung 39) beheizt. In den unbeheizten, niedertemperierten Bereichen befinden sich Rohrleitungen, welche ungedämmt sind. Die Wärmeabgabe erfolgt durch 82
85 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude statische Heizflächen (Plattenheizkörper). Das außenliegende Farblager wird durch elektrische Beheizung frostsicher gehalten. Die Wärmerzeugungsanlagen und Verteilnetze befinden sich nicht auf dem Stand der Abbildung 37: Beleuchtung Bauhof Abbildung 38: Heizungsanlage Bauhof Abbildung 39: Wandtherme Bauhof Technik. Maßnahmen zur Umrüstung auf Brennwerttechnik und Optimierung der Verteilungsnetzte weisen erhebliches Energieeinsparpotenzial auf. Auch bei der Beleuchtungstechnik gibt es Optimierungspotenzial. (Abbildung 37) Potenzialanalyse Bauliche Maßnahmen Der Gebäudenutzung geschuldet, sind momentanen Bereiche mit sehr unterschiedlichen Temperierungen unter einem Dach vereint. Dies bedeutet, innerhalb der Gebäudehülle grenzen unbeheizte Räume wie Garagen direkt an beheizte Aufenthaltszonen. Durch Definierung von kalten und warmen Gebäudezonen und entsprechender thermischer Trennung z. B. durch Innendämmung kann Heizenergie eingespart werden. Eine Ertüchtigung der thermischen Hüllflächen durch Fassadendämmung und Austausch der Festverglasungen gegen in rahmen gefasste Fensterelemente (festverglast) bewirkt eine deutliche Reduzierung der Heizenergie. Durch den Einbau neuer Toranlagen mit gedämmten Profilen und Füllpanelen können die Transmissionswärmeverluste weiter reduziert werden. Des Weiteren wird empfohlen auch die verbleibenden Dach-/Deckenflächen oberhalb beheizter Nutzräume mit Dämmung zu versehen. Maßnahmen Gebäudetechnik Durch den Austausch der zwei Wärmeerzeuger und Umrüstung auf einen Gas- Wärmeerzeuger mit modulierender Brennwerttechnik und gleichzeitiger Zusammenfassung der beiden Wärmeverteilnetze inkl. hydraulischem Abgleich, können Brennerstarts reduziert und Laufzeiten des Wärmeerzeugers verlängert werden. Somit können Brennstoff und CO 2 eingespart werden. Weitere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sind der Austausch der Standard-Heizungspumpen gegen drehzahlregelbare Hocheffizienzpumpen sowie eine bedarfsgerechte Regelung. Somit lässt sich der Stromverbrauch für die Umwälzung des Heizungswassers deutlich senken. Weitere Optimierungsmaßnahmen bestehen in der Dämmung von Rohrleitungen und Armaturen nach EnEV 2009, gerade in unbeheizten oder niedertemperierten Bereichen. 83
86 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Durch den Einbau von Fenster- und Türkontakten in Verbindung mit elektrischen Stellantrieben an den Heizflächen, kann die Effizienz des Gebäudes weiter verbessert werden. Durch Austausch der Beleuchtungstechnik gegen LED- oder CCFL-Leuchten und Installation einer bedarfsgerechten Beleuchtungsregelung lassen bis zu 50 % der Beleuchtungsenergie sparen. 60 Ergebnisse Bei der Umsetzung aller beschriebenen Maßnahmen können folgende Kennwerte erreicht werden. Maßnahmen Energieeinsparung CO 2 - Einsparung Investition Amortisation kwh 3,4 t/a EUR 29 a* Dachdämmung kwh/a 6,0 t/a EUR 6 a* Austausch Fenster Fassadendämmung Einzelraumregelung Umrüstung auf Brennwerttechnik Austausch Beleuchtung kwh/a 0,5 t/a EUR 60 a* kwh/a 3,4 t/a EUR 8 a* kwh/a 1,7 t/a EUR 8 a* kwh/a 0,7 t/a EUR 13 a** Tabelle 32: Zusammenfassung Ergebnisse Bauhof Hauptgebäude Die nachfolgende Abbildung 40 zeigt den spezifischen Heizenergieverbrauch bezogen auf die Netto-Grundfläche. Der obere Pfeil zeigt den derzeitigen Verbrauchwert aus den gemittelten Energieverbräuchen aus den letzten drei Jahren. Der untere Pfeil zeigt den möglichen spezifischen Verbrauchswert bei Umsetzung aller beschriebenen Maßnahmen. Diese Grafik dient somit nur als Veranschaulichung der Energieverbräuche und ersetzt nicht den bedarfsorientierten Energieausweis nach DIN V Quelle: 84
87 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Heizenergieverbrauchskennwert CO 2 Emission 44 kg/(m² * a) 193 Nach Sanierung 77 kwh/m²a CO 2 Emission 17 kg/(m² * a) Abbildung 40: Verbrauchkennwerte Bauhofhauptgebäude 85
88 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude 6.2. Turnhalle Karl-Liebknecht-Straße Anschrift: Karl-Liebknecht-Straße 8a Bad Belzig Gebäudekennwerte: Baujahr: 1986 Nutzung: Sporthalle Zustand: teilsaniert BGF: m² KGF: 77 m² NGF: 945 m² BRI: m³ Etagenanzahl: 1 Kellergeschoss: - Abbildung 41: Ansicht Turnhalle Karl-Liebknecht- Straße Energieversorgung: Heizungsanlage: Typ: Energieträger: Leistung: Gas-Brennwert-Kessel (SW Belzig) Viessmann Vertomat Erdgas 160 kw Verbrauchserfassung: Heizung 123 MWh 132 MWh 128 MWh Strom kwh kwh kwh Tabelle 33: Verbräuche Turnhalle Karl-Liebknecht-Straße 86
89 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Gebäudesubstanz Die Sporthalle ist vom Bautyp MT als Teil des Schulstandortes errichtet worden. Dem Hallenbereich vorgelagert ist der Hallenanbau, in dem die Umkleiden, Sanitäranlagen, Sportgeräteräume und die Technikzentrale untergebracht sind. Das Objekt wurde 2004/2005 umfassend saniert. Dabei wurden die Fassaden-, Fenster- und Dachflächen erneuert. Ebenfalls im Innenbereich der Halle wurde neben einem neuen Sportboden und Prallschutzwänden auch akustische Maßnahmen an Wand- und Deckenflächen vorgenommen. Die straßenseitigen Fensterflächen, sowohl im Hallenbereich wie auch im Sozialanbau wurden gegen neue Glasprofile ausgetauscht. Darin eingebunden wurden Fensteröffnungsflügel mit Aluminiumrahmen. Die opaken Giebelflächen sind mit Hohlkammerstegplatten versehen. Im Hallenbereich wurde eine 2 m hohe Prallschutzwand errichtet, in die an den Giebelwänden die Lüftungsauslässe integriert sind. Abbildung 42: Giebelverglasung Turnhalle Karl-Liebknecht-Straße Abbildung 43: Innenansicht Turnhalle Karl-Liebknecht-Straße Abbildung 44: Hallenabluft Turnhalle Karl-Liebknecht-Straße Bestandsbeschreibung Anlagentechnik Die Wärmeerzeugung erfolgt durch einen Erdgas-Kessel mit Brenner und einer Nennwärmeleistung von 160 kw. Die Wärmeerzeugungsanlage ist in einem separaten Raum innerhalb der thermischen Hülle der Turnhalle untergebracht. Die Beheizung der Halle erfolgt durch ventilatorgestützte Konvektoren, welche sich in den Prallwänden an den Stirnseiten der Halle befinden. Vier Konvektoren werden als reine Umluftanlagen betrieben. Zwei Konvektoren werden als Mischluftanlage betrieben. Dabei wird Frischluft, durch eine Öffnung in der Fassade der Umluft beigemischt. Zwei Abluftventilatoren sind mit den Mischluftkonvektoren gekoppelt und werden von diesen angesteuert. Die weiteren zwei Abluftventilatoren werden manuell betätigt. Die Beheizung des Sozialtraktes erfolgt durch mit Thermostatköpfen ausgestatteten Stahl-Glieder-Radiatoren. Die WC- und Duschräume sind zusätzlich mit einer Abluftanlage ausgestattet. 87
90 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Die Beleuchtung der Halle erfolgt durch dreiflammige Langfeldleuchten. Im Bereich der Lüftungstechnik besteht Optimierungspotenzial. Auch im Bereich der Beleuchtungstechnik kann elektrische Energie eingespart werden. Abbildung 46: WC Abluft Turnhalle Karl-Liebknecht-Straße Abbildung 45: Beleuchtung Turnhalle Karl-Liebknecht-Straße Wärmebezugsverträge Der bestehende Wärmebezugsvertrag wurde als Sondervertrag mit den Stadtwerken Bad Belzig geschlossen. Die Laufzeit beträgt 10 Jahre und endet am Dabei betreiben die Stadtwerke einen Gas Brennwertkessel. Vertraglich vereinbart ist eine Leistung von 160 kw und eine voraussichtliche Nutzwärme von kwh/a. Der vereinbarte Leistungspreis beträgt 29 EUR/kW. Die gemessenen Verbrauchsdaten decken sich mit den angenommenen Werten des Vertrages. Die berechneten Vollbenutzungsstunden betragen 800 h/a und scheinen passend für die Objektnutzung als Sporthalle. Damit erscheint die Dimensionierung der Wärmerzeugungsanlage als geeignet Potenzialanalyse Bauliche Maßnahmen Durch die bereits erfolgten Sanierungsmaßnahmen sind die Potenziale im Hinblick auf die baulichen Möglichkeiten weitestgehend erschöpft. Lediglich der Austausch der Giebelverglasungen kann als Handlungsempfehlung aufgenommen werden hierfür sind die vorhandenen Doppelstegplatten gegen Profilglaselemente zu ersetzen, wie sie auch auf der straßenzugewandten Fassade verwendet wurden. Maßnahmen Gebäudetechnik Durch den Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG), als Kondensationswärmeübertrager, können die Lüftungswärmeverluste verringert werden. Zusätzlich kann die Luftqualität auf einer kontinuierlichen Qualität gehalten werden. Zentrale Lüftungsanlagen und dezentrale Lüftungsanlagen mit WRG sind denkbar. Wobei eine zentrale Lüftungsanlage einen besseren Wirkungsgrad besitzt, dafür meist teurer in der Anschaffung gegenüber einer dezentralen Lösung ist. Im Bereich der Beleuchtungstechnik ist eine Umrüstung auf CCFL- und LED-Leuchten sinnvoll. Die Zukunft liegt in der CCFL- und LED-Beleuchtungstechnik. So hat eine LED- 88
91 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Beleuchtung derzeitig eine Lichtausbeute von bis zu 120 lm/w. Zum Vergleich eine T5 Leuchtstofflampe hat eine Ausbeute von bis zu 90 lm/w. LEDs halten bis zu Stunden und mehr. Das sind im Dauerbetrieb sechs Jahre und bei täglich drei Stunden Betrieb 45 Jahre Somit lassen sich Wartungs- und Instandhaltungskosten deutlich senken. In Verbindung mit einer bedarfsgerechten Lichtsteuerung kann der Stromverbrauch für die Beleuchtung weiter gesenkt werden. Ergebnisse Die nachfolgende Tabelle 34 zeigt die möglichen Einsparpotenziale. Zu beachten ist, dass es bei den ermittelten Werten um eine Grobanalyse handelt. Die ermittelten Werte wurden mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten berechnet, beinhalten jedoch eine Abweichung +/- 20 %. Maßnahmen Energieeinsparung CO 2 - Einsparung Investition Amortisation Austausch Fenster kwh/a 0,5 t/a EUR 26 a* Lüftung mit WRG kwh/a 2,8 t/a EUR 9 a* Austausch Beleuchtung kwh/a 0,4 t/a EUR 24 a** Tabelle 34: Zusammenfassung Ergebnisse Turnhalle Karl-Liebknecht-Straße Abbildung 47 zeigt den spezifischen Heizenergieverbrauch bezogen auf die Netto- Grundfläche. Der obere Pfeil zeigt den derzeitigen Verbrauchwert aus den gemittelten Energieverbräuchen aus den letzten drei Jahren. Der untere Pfeil zeigt den möglichen spezifischen Verbrauchswert bei Umsetzung aller beschriebenen Maßnahmen. Diese Grafik dient somit nur als Veranschaulichung der Energieverbräuche und ersetzt nicht den bedarfsorientierten Energieausweis nach DIN V Heizenergieverbrauchskennwert CO 2 Emission 32 kg/(m² * a) 141 Nach Sanierung 116 kwh/m²a CO 2 Emission 26 kg/(m² * a) Abbildung 47: Verbrauchskennwerte Turnhalle-Karl-Liebknecht-Straße 89
92 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Feld-Sport- und Mehrzweckhalle Albert-Baur Anschrift: Weitzgrunder Weg Bad Belzig Gebäudekennwerte: Baujahr: 1997 Nutzung: Sport-Mehrzweckhalle Zustand: - BGF: 2.185,00 m² KGF: 212,23 m² NGF: 1.972,77 m² BRI: 1.972,77 m³ Etagenanzahl: 1/2 Kellergeschoss: - Abbildung 48: Ansicht 3 Feld Halle Albert-Baur Energieversorgung: Heizungsanlage: NT Gas Kessel Typ: Vissmann Paromat Triplex Baujahr: 1997 Energieträger: Erdgas Leistung: 345 kw Verbrauchserfassung: Heizung kwh kwh kwh Strom kwh kwh kwh Tabelle 35: Verbräuche 3 Feld Halle Albert-Baur 90
93 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Gebäudesubstanz Die Albert-Baur Sport- und Mehrzweckhalle ist ein Neubau aus dem Jahr 1997 und gehört zum Gebäudeensemble des Schulstandortes Weitzgrunder Weg mit dem Gebäude der Grundschule und denen der Oberschule. Zur Mehrzweckhalle gehören folgende Anbauten: Foyer, Mehrzweckraum und zwei Sanitärbereiche mit Umkleiden, Duschen und WC-Anlagen, die entlang der Hallenlängsseite angeordnet sind. Dem gegenüber befinden sich die Sportgeräteräume und mittig der Lehrerraum. Die Halle ist als Stützen-Binder-Konstruktion in Stahlbeton ausgeführt und mit Gasbeton- Wandelementen ausgefacht. Die Hallenanbauten wurden als zweischaliger Mauerwerksbau errichtet mit 50 mm starker Dämmschicht und außenseitiger Klinkeroptik. Die Dachdeckung besteht aus Trapezblechelementen mit Aufdachdämmung und Blecheindeckung mit einer Neigung von 10. Die Belichtung des Hallenbereiches erfolgt über 24 quadratische Lichtkuppeln, die gleichmäßig über den Spielfeldbereich angeordnet sind. Über Lichtschächte und Öffnungen in der abgehangenen Decke wird das Tageslicht in die Halle geleitet. Im Zwischengeschoss oberhalb der Sanitärbereiche befinden sich die Lüftungszentrale und die Steuerung der Photovoltaik-Anlage. Diese ist über einen Einstieg aus der Heizungszentrale zugänglich Bestandsbeschreibung Anlagentechnik Die Wärmeversorgung und Trinkwarmwasserbereitung des Komplexes, erfolgt durch einen Niedertemperatur- Gaskessel, einem 2-Stufen-Brenner und einer Nennwärmeleistung von 345 kw. Die Wärmeerzeugung wird von der Stadt Bad Belzig betrieben. Die Betriebsführung wird jedoch von den Stadtwerken Bad Belzig durchgeführt. Die Wassererwärmung erfolgt durch einen Trinkwasserspeicher mit einem Volumen von 1250 Litern mit externem Wärmetauscher. Alle Heizungspumpen sind als Standard Modelle ausgeführt. In der Halle sind insgesamt vier zentrale Lüftungsanlagen installiert. Die Belüftung der Halle mit Nennvolumenstrom von m³/h und der Nebenräume mit einem Nennvolumenstrom von 4.280m³/h erfolgt durch jeweils eine Umluft-Lüftungsanlage mit Heizregistern. Die WC-Räume (WC-Sportler und WC-Zuschauer) sind jeweils mit einer Abluftanlage ausgestattet. Abbildung 49: Trinkwasseranlage 3 Feld Halle Albert-Baur Abbildung 50: RLT Raum 3 Feld Halle Albert-Baur 91
94 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Auf der Turnhalle ist eine Photovoltaik Solaranlage zur Stromerzeugung installiert. Die drei Solarregler sind in den Räumlichkeiten der Lüftungsanlagen untergebracht Potenzialanalyse Bauliche Maßnahmen Abbildung 51: Solarregler 3 Feld Halle Albert-Baur Bei der Untersuchung des Sporthallengebäudes wird deutlich, dass die einzelnen Bauteile den heutigen energetischen Anforderungen nicht gerecht werden. Aus diesem Grund werden unter Berücksichtigung der vorhandenen Aufbauten zusätzliche Dämmmaßnahmen an den Gebäudehüllflächen empfohlen. Unter anderem bedeutet dies für die Außenwandflächen der Sporthalle das Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems. Bei den Anbauten (Nebenräume) zum Hallenbereich gestaltet sich diese Verfahrensweise etwas schwierig, da man hier von einem zweischaligen Wandaufbau ausgehen muss. Zudem entsprechen die Dachaufbauten nicht den geforderten energetischen Richtwerten und sollten durch zusätzliche Dämmung ertüchtig werden. Im Hallenbereich könnte dafür die Dämmung der Zwischendecke mit mineralischen Dämmmatten in Betracht kommen. Die Dachflächen der Nebenanlagen sind ebenfalls nachzurüsten inkl. der erforderlichen Begleitmaßnahmen. Durch die Umsetzung der Teilmaßnahmen können bis zu 28 MWh an jährlichen Energieeinsparungen erreicht werden. Der Austausch der Fenster- und Außentürelemente trägt ebenso zur Verbesserung der energetischen Qualität des Gebäudes bei. Dies setzt sich fort durch die Erneuerung der 24 Oberlichter im Hallenbereich. Maßnahmen Gebäudetechnik Durch den Einbau von Volumenstromreglern, frequenzgeregelter Ventilatoren, Temperatursensoren und Raum-CO 2 -/ Luftqualitätsfühler können die Luftvolumenströme bedarfsgerechter geregelt werden. Somit lässt sich Heiz- und Stromenergie für die Ventilatoren einsparen. Durch einen Rückbau des Umluftbetriebes der Lüftungsanlage der Turnhalle und Umrüstung auf eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung lassen sich die Luftvolumenströme und damit der Stromverbrauch der Ventilatoren reduzieren. Ein weiter Vorteil ist kontinuierliche Luftqualität bei niedrigem Heizenergieverbrauch. Kondensationsrotoren als Wärmerückgewinnung besitzen einen Wirkungsgrad von ca. 80 %. Durch den Austausch der Standardpumpen gegen drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpen mit Differenzdruckregelung lässt sich nochmals elektrische Energie einsparen. Durch modulierende Gas-Brennwertkessel lässt sich die Primärenergie besser ausnutzen. Die bestehende Hydraulik kann durch den Einsatz von Mehrweg-Mischern dahingehend 92
95 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude optimiert werden, dass die relativ hohen Rücklauftemperaturen der Heizregister der Lüftungsanlagen für die statischen Heizflächen genutzt werden. Somit lässt sich die Rücklauftemperatur optimal absenken, welche der entscheide Faktor bei der Brennwertnutzung darstellt. Ein weiter Vorteil der besseren Ausnutzung ist auf Grund der höheren Spreizung eine Verminderung der Pumpenleistung. Im Bereich der Beleuchtungstechnik ist der Austausch eine Umrüstung auf CCFL- und LED- Leuchten sinnvoll. In Verbindung mit einer bedarfsgerechten Lichtsteuerung kann der Stromverbrauch für die Beleuchtung weiter gesenkt werden. Ergebnisse Tabelle 36 zeigt die möglichen Einsparpotenziale. Zu beachten ist, dass es bei den ermittelten Werten um eine Grobanalyse handelt. Die ermittelten Werte wurden mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten berechnet, beinhalten jedoch eine Abweichung +/-20 %. Maßnahmen Energieeinsparung CO 2 - Einsparung Investition Amortisation kwh 2,8 t/a EUR 98 a* Dachdämmung kwh/a 6,2 t/a EUR 65 a* Austausch Fenster kwh/a 0,8 t/a EUR 60 a* Fassadendämmung Einzelraumregelung Brennwerttechnik mit Rücklaufnutzung Umbau Lüftung Co2 gesteuert Austausch Beleuchtung kwh/a 3,4 t/a EUR 8 a* kwh/a 4,5 t/a EUR 10 a* kwh/a 6,7 t/a EUR 7 a* kwh/a 3,6 t/a EUR 7 a** Tabelle 36: Zusammenfassung Ergebnisse 3 Feld Halle Albert-Baur Abbildung 52 zeigt den spezifischen Heizenergieverbrauch bezogen auf die Netto- Grundfläche. Der obere Pfeil zeigt den derzeitigen Verbrauchwert aus den gemittelten Energieverbräuchen aus den letzten drei Jahren. Der untere Pfeil zeigt den möglichen spezifischen Verbrauchswert bei Umsetzung aller beschriebenen Maßnahmen. Diese Grafik dient somit nur als Veranschaulichung der Energieverbräuche und ersetzt nicht den bedarfsorientierten Energieausweis nach DIN V
96 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Heizenergiekennwert CO 2 Emission 38 kg/(m² * a) 168 Nach Sanierung 117 kwh/m²a CO 2 Emission 26 kg/(m² * a) Abbildung 52: Verbrauchskennwerte 3 Feld Sporthalle Albert-Baur 6.4. Feuerwehr Hauptgebäude Anschrift: Niemöllerstraße Bad Belzig Gebäudekennwerte: Abbildung 53: Ansicht Feuerwehr Hauptgebäude Baujahr: 1934, 1975, 1994 Nutzung: Feuerwehrdepot Zustand: sanierungswürdig BGF: - KGF: - NGF: - BRI: - Etagenanzahl: 3 Kellergeschoss: teilunterkellert Energieversorgung: Heizungsanlage: Öl NT Heizung Buderus: Baujahr: 1992 Energieträger: Heizöl Leistung: 43 kw 94
97 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Verbrauchserfassung: Heizung (Öl) l l l Strom kwh kwh kwh Tabelle 37: Verbräuche Feuerwehr Hauptgebäude Bestandsbeschreibung Gebäude Das Feuerwehrgerätehaus der Stadt Bad Belzig wurde seit der Erbauung 1934 durch mehrere Gebäudeteile ergänzt. Das zweigeschossige Hauptgebäude mit Dachgeschoss erhielt 1975 einen ersten Garagenanbau und wurde 1994 um einen weiteren, südwestlich gelegenen Doppelgaragenanbau mit Dachausbau erweitert. Hofseitig schließt sich an das Hauptgebäude der Schlauchturm an, über den das Objekt ebenerdig erschlossen wird. Die Flächen im Erdgeschoss des Gebäudes dienen als Stellplätze für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr. Zudem befinden dort sich die Garderobenbereiche mit der Einsatzbekleidung der Feuerwehrleute. Im Ober- und den Dachgeschossen der Gebäudeteile befinden sich Büro- und Verwaltungsräume sowie Versammlungs- und Unterrichtsräume. Im unterkellerten Bereich des Hauptgebäudes ist die Heizungsanlage mit dem Öltanklager untergebracht. In Teilbereichen der Kellerräume sind deutliche Feuchteschäden sichtbar, wovon das Mauerwerk ebenfalls großflächig betroffen ist. Mit der Errichtung des zweiten Anbaus 1994 wurden die Tore und Fenster erneuert. Dabei sind Kunststofffenster mit einer Isolierverglasung (U W = 1,5) eingebaut worden. Der Anbau ist mit Holzrahmenfenstern ausgestattet. Zudem wurden mit dem Dachausausbau zum Schulungsraum die Dachflächen mit einem 14 mm Mineralklemmfilz versehen. Die dreiteiligen Falttore bestehen aus gedämmten Panelelementen mit einem quadratischen Fensterausschnitt und Kunststoffverglasung. Abbildung 54: Hofansicht Feuerwehr Hauptgebäude Abbildung 55: Öl Heizung Feuerwehr Hauptgebäude 95
98 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Anlagentechnik Die Wärmeerzeugung erfolgt durch einen Öl-Stahlkessel mit einer Nennwärmeleistung von 43 kw (vgl. Abbildung 55). Die Beheizung des Hallenbereiches erfolgt auf C Raumtemperatur. Die Garagen verfügen über eine Abgas-Abluftanlage Potenzialanalyse Bauliche Maßnahmen Bei dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bad Belzig könnten folgende Maßnahmen zur Reduzierung des Energiebedarfs umgesetzt werden: Dämmmaßnahmen an den Fassaden- und Dachflächen entsprechend dem erforderlichen Mindestwärmeschutz nach EnEV Ertüchtigung der Fenster- und Außentürelemente. Thermische Trennung von beheizten und geringtemperierten Raumzonen. Das Gebäude dient vorrangig der Nutzung als Feuerwehrgerätehaus mit den Garagenstellplätzen der Einsatzfahrzeuge und der Unterbringung der technischen Ausrüstung. Die vorhandenen Aufenthaltsräume im Obergeschoss werden zu Schulungsund Versammlungszwecken bzw. für Bürotätigkeit nur selten und auch eher kurzzeitig genutzt. Dies spiegelt sich ebenfalls im dokumentierten Energieverbrauch der vergangenen Jahre wider, der vergleichsweise sehr gering ist. Ausgehend von diesem Nutzungsprofil stellen sich die benannten Maßnahmen als sehr unwirtschaftlich dar und stehen in keinem Verhältnis zu den zu erwartenden Einsparpotenzialen, die sich daraus ergeben können. Ungeachtet der Maßnahmen zur energetischen Optimierung wird empfohlen die Ursachen des eindringenden Wassers in den Kellerbereichen zu untersuchen und zum Schutz der Gebäudesubstanz die Bauwerksabdichtung entsprechend zu erneuern. Maßnahmen Gebäudetechnik Durch modulierende Gas Brennwert Kessel lässt sich die Primärenergie besser ausnutzen und der Jahresnutzungsgrad durch Verringerung von Brennstarts erhöhen. Weitere Maßnahmen zur Effizienzsteigerungen befinden sich in dem Austausch der Standard- Heizungspumpen gegen drehzahlregelbare Hocheffizienzpumpen und bedarfsgerechte Regelung und einhergehendem hydraulischen Abgleich des Wärmeverteilnetzes. Somit lässt sich der Stromverbrauch für die Umwälzung des Heizungswassers deutlich senken. Weiter Optimierungsmaßnahmen bestehen in der Dämmung von Rohrleitungen und Armaturen nach EnEV 2009 gerade in unbeheizten oder niedertemperierten Bereichen. 96
99 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude 6.5. Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule Hauptgebäude) Anschrift: Weitzgrunder Weg Bad Belzig Gebäudekennwerte: Baujahr: 1996 Nutzung: Schulgebäude Zustand: neuwertig BGF: m² KGF: 348 m² NGF: m² BRI: m³ Etagenanzahl: 2 Kellergeschoss: - Abbildung 56: Ansicht Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule Hauptgebäude) Energieversorgung: Heizungsanlage: Gas Brennwert Kessel Typ: Viessmann Vertomat 300 Baujahr: 1996 Energieträger: Erdgas Leistung: 143 kw Verbrauchserfassung: Heizung kwh kwh kwh Strom kwh kwh kwh Tabelle 38: Verbräuche Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule Hauptgebäude) 97
100 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Gebäudesubstanz Das Hauptgebäude der Grundschule zählt zu den neueren Objekten im Immobilienbestand der Stadt Bad Belzig. Es gliedert sich in zwei zweigeschossige Gebäudeeinheiten, in denen die Unterrichtsräume untergebracht und die über einen eingeschossigen Gebäudeteil mit Galerieebene miteinander verbunden sind. Der Verbinder dient zugleich als Versammlungsund Veranstaltungsraum als auch als Speisesaal mit angrenzendem Küchenbereich. Die Außenwände der Unterrichtsgebäude sind als zweischalige Mauerwerkskonstruktion mit mineralischer Dämmung und einem hinterlüfteten Klinkersichtmauerwerk ausgeführt. Die Außenwände des Verbindungsbaus bestehen aus einer Holzrahmenkonstruktion mit gedämmten Zwischenräumen und außenseitiger Holzschalung. Bodenplatte, Geschossdecken sowie Treppen- und Aufzugsanlage sind als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt. Die Dämmebene umgibt das Gebäude in Form der hinterlüfteten Fassadendämmung über die gedämmte Geschossdecke zum Dachraum und unterseitig durch eine Fußbodendämmung auf der Bodenplatte (5-7 cm). Die Pultdachflächen des Verbindungsgebäudes sind als Walmdach mit Zwischensparrendämmung ausgeführt und straßenseitig mit einer extensiven Dachbegrünung versehen. Die großformatigen Fensteranlagen in den Unterrichtsräumen und dem Verbindungsbau sind Holzrahmenelemente mit Isolierverglasung. Abbildung 57: Aula Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule Hauptgebäude) Abbildung 58: Klassenraum Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule Hauptgebäude) 98
101 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Anlagentechnik Die Wärmeversorgung erfolgt durch einen Brennwertkessel mit 2-Stufen-Brenner mit einer Nennwärmeleistung von 130 kw und wird von den Stadtwerken Bad Belzig betrieben. (Abbildung 59, Abbildung 61). Als Warmwasserversorgung dient ein nebenstehender Trinkwasserspeicher mit einem Volumen von 350 Litern. Die Wärmeverteilung inkl. Armaturen ist augenscheinlich ausreichend gedämmt. Die Wärmeverteilung erfolgt durch Standard- und teilweise durch drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpen. Die Wärmeabgabe erfolgt durch Plane-Ventilheizkörper mit motorisch betrieben Stellantrieben. In den Klassenräumen sind Leitungsführungen für Fensterkontakte in den Rollladenkästen vorhanden, aber nicht angeschlossen. Zur Beleuchtung wurden in den Klassenräumen 15 doppelflammige Langefeldleuchten mit T8 38 W Leuchtstofflampen verbaut (Abbildung 60). Für die Beleuchtungssteuerung in dem Objekt existiert kein Lichtkonzept. Abbildung 59: Heizkreisverteiler Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule Hauptgebäude) Abbildung 61: Wärmeerzeuger Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule Hauptgebäude) Abbildung 60: Beleuchtung Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule Hauptgebäude) Potenzialanalyse Bauliche Maßnahmen Der derzeitige U-Wert der Außenwände beträgt ca. 0,44 W/m²K. Durch eine Erneuerung der Wanddämmung nach den derzeitig geltenden Richtlinien lässt sich der U-Wert auf 0,23 W/mK absenken und somit ca. 9 MWh/a Heizenergie einsparen. In der Umsetzung ist dies mit einem erheblichen baulichen Aufwand verbunden und bedeutet den Rückbau der hinterlüfteten Klinkerfassade der beiden zweigeschossigen Gebäudeeinheiten, um die innenliegende Dämmebene ersetzen bzw. verstärken zu können. Unter dem Gesichtspunkt einer Aufwand-Nutzen-Gegenüberstellung ist diese Maßnahme allerdings kritisch zu betrachten, da die zu erwartenden Energieeinsparungen sich in keinem wirtschaftlichen 99
102 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Verhältnis zu den Sanierungskosten verhalten und unrealistische Amortisationszeiträume zur Folge haben würden. Eine weitere Maßnahme ist der Austausch der Fensterelemente. Durch den Einbau von Fenstern mit einem Gesamt-U-Wert von 1,3 W/mK lassen sich ca. 19 MWh/a Heizenergie einsparen. Dabei ist neben den energetischen Potenzialen aber ebenfalls die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme zu beachten, die aufgrund des nicht unerheblichen Fensterflächenanteils der Gebäudehülle eher zu einem negativen Ergebnis führt. Das Gebäude der Geschwister-Scholl-Grundschule stellt sich unter Betrachtung der aktuellen Energieverbrauchswerte gegenüber den Vergleichswerten energetisch gut dar. Aus diesem Grund lassen sich Maßnahmen mit einem erheblichen investiven und baulichen Aufwand zum jetzigen Zeitpunkt nicht rechtfertigen. Maßnahmen Gebäudetechnik Durch modulierende Gas-Brennwertkessel lässt sich die Primärenergie besser ausnutzen und der Jahresnutzungsgrad durch Verringerung von Brennstarts erhöhen. Weitere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sind der Austausch der Standard-Heizungspumpen gegen drehzahlregelbare Hocheffizienzpumpen und die bedarfsgerechte Regelung mit hydraulischem Abgleich des Wärmeverteilnetztes. Somit lässt sich der Stromverbrauch für die Umwälzung des Heizungswassers deutlich senken. Im Bereich der Beleuchtungstechnik ist der Austausch von T8 Leuchtmittel gegen T5 Leuchtmittel oder CCFL- und LED-Leuchten sinnvoll. In Verbindung mit einer bedarfsgerechten Lichtsteuerung kann der Stromverbrauch für die Beleuchtung weiter gesenkt werden. Durch Aufschaltung der Fensterkontakte auf die Gebäudeautomation und Verknüpfung mit den motorisch betriebenen Stellantrieben der Heizkörper lassen sich die unkontrollierten Lüftungsverluste durch Fensterlüftung deutlich reduzieren. Sollte ein Fenster über eine längere Zeit geöffnet sein, unterbricht der elektrische Stellmotor die Wärmezufuhr des Heizkörpers. Somit wird verhindert, dass Wärme unnötig an die Außenluft angeben wird. Ergebnisse Tabelle 39 zeigt die möglichen Einsparpotenziale. Zu beachten ist, dass es bei den ermittelten Werten um eine Grobanalyse handelt. Die ermittelten Werte wurden mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten berechnet beinhalten jedoch eine Abweichung +/- 20 %. 100
103 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Maßnahmen CO 2 - Einsparung Investition Amortisation kwh/a 2,0 t/a EUR 64 a* Austausch Fenster kwh/a 4,4 t/a EUR 60 a* Energieeinsparung Fassadendämmung Einzelraumregelung Modulierende Brennwerttechnik mit Rücklaufnutzung Austausch Beleuchtung kwh/a 5,2 t/a EUR 13 a* kwh/a 2,0 t/a EUR 11 a kwh/a 2,5 t/a EUR 11 a** Tabelle 39: Zusammenfassung Ergebnisse Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule Hauptgebäude) Abbildung 62 zeigt den spezifischen Heizenergieverbrauch bezogen auf die Netto- Grundfläche. Der obere Pfeil zeigt den derzeitigen Verbrauchwert aus den gemittelten Energieverbräuchen aus den letzten drei Jahren. Der untere Pfeil zeigt den möglichen spezifischen Verbrauchswert bei Umsetzung aller beschriebenen Maßnahmen. Diese Grafik dient somit nur als Veranschaulichung der Energieverbräuche und ersetzt nicht den bedarfsorientierten Energieausweis nach DIN V Heizenergiekennwert CO 2 Emission 23 kg/(m² * a) 101 Nach Sanierung 73 kwh/m²a CO 2 Emission 16 kg/(m² * a) Abbildung 62: Verbrauchskennwerte Geschwister-Scholl-Schule 101
104 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude 6.6. Krause-Tschetschog-Oberschule (Ganztagsgebäude) Anschrift: Weitzgrunder Weg Bad Belzig Gebäudekennwerte: Baujahr: 1968 Nutzung: Schulgebäude Zustand: Saniert (2006) BGF: 586 m² KGF: 99 m² NGF: 487 m² BRI: - Etagenanzahl: 1 Kellergeschoss: - Abbildung 63: Ansicht Geschwister-Scholl-Schule (Oberschule Ganztagsgebäude) Energieversorgung: Heizungsanlage: Gas Brennwert Therme Typ: Viessmann Vitodens 300 Baujahr: 2006 Energieträger: Erdgas Leistung: 46 kw Verbrauchserfassung: Heizung kwh kwh kwh Strom Tabelle 40: Verbräuche Geschwister-Scholl-Schule (Oberschule Ganztagsgebäude) 102
105 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Gebäudesubstanz Das Ganztagsgebäude der Geschwister-Scholl-Schule ist ein eingeschossiger Gebäudekomplex bestehend aus zwei Gebäuderiegeln mit L-förmigem Grundriss. Darin untergebracht sind drei Unterrichtsräume (zwei kleine und ein großer, teilbarer), ein Speisesaal mit zugehöriger Lehrküche sowie den erforderlichen Nebenräumen. Unterhalb des Speisesaals befindet sich ein Kellergeschoss, dass über eine Außentür von der Straßenseite zugänglich ist. Das Objekt wurde 2006 umfassend saniert und unter Berücksichtigung der geltenden Wärmeschutzanforderungen umgebaut. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurden Kunststofffester- und Außentürelemente mit Isolierverglasung (U W = 1,2) eingebaut, die Sanitäreinrichtung saniert, Bodenbeläge erneuert und eine mineralische Geschossdeckendämmung (16 cm) zum unbeheizten Dachraum eingebracht. Die Außenwände wurden neu verputzt aber nicht gedämmt. Nach Aussage der Bauverwaltung konnten mit dem Bestandsmauerwerk die 2006 geforderten Anforderungen an den Wärmeschutz eingehalten werden. Zudem sind die südlich ausgerichteten Fenster zur Schulhofseite mit einem außenliegenden Sonnenschutz (Aluminium-Lamellen) versehen worden. Abbildung 64: Fenster Geschwister-Scholl- Schule (Oberschule Ganztagsgebäude) Abbildung 65: Fassade Geschwister-Scholl-Schule (Oberschule Ganztagsgebäude) 103
106 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Anlagentechnik Die Wärmeerzeugung erfolgt durch eine wandhängende Gas- Brennwert-Therme mit einer Nennwärmeleistung von 46 kw. Die Wärmeerzeugung und Wärmeverteilung weist augenscheinlich einen guten Zustand auf Potenzialanalyse Bauliche Maßnahmen Abbildung 66: Brennwert Therme Geschwister- Scholl-Schule (Oberschule Ganztagsgebäude) Die umgesetzten Maßnahmen im Zuge der Sanierung 2006 wirken sich auch nach den aktuellen Bewertungskriterien günstig auf die Verbrauchsbilanz des Gebäudes aus. Somit entsprechen die Anforderungen an Fenster- und Außentürelemente sowie der oberen Geschossdecke im Einzelnachweis den Mindestbestimmungen nach der EnEV Die verbleibenden Potenziale erschließen sich unter Betrachtung der Gebäudesubstanz durch die Dämmung der Fassadenflächen mit ca. 140 mm starken Dämmplatten. Durch die Verbesserung des Wärmedurchgangskoeffizienten der Wandaufbauten von ca. 0,87 W/m²K auf 0,19 W/m²K können jährliche Energieeinsparungen von überschlägig 17 MWh erzielt werden. Bezogen auf die Bruttogrundfläche ergibt sich damit eine Minderung des Energiebedarfes von 30 kwh/m²a. Unter Berücksichtigung der durchaus positiven Verbrauchssituation des Ist-Zustandes, werden somit die baulichen Möglichkeiten zur energetischen Gebäudeoptimierung ausgeschöpft Maßnahmen Gebäudetechnik Im Bereich der Beleuchtungstechnik ist der Austausch von T8 Leuchtmittel gegen T5 Leuchtmittel oder CCFL- und LED-Leuchten sinnvoll. In Verbindung mit einer bedarfsgerechten Lichtsteuerung kann der Stromverbrauch für die Beleuchtung weiter gesenkt werden. Durch die Installation von Einzelraumregelungen in Verbindung mit motorisch betrieben Heizkörperventilen und Fensterkontakten lassen sich die unkontrollierten Lüftungsverluste durch Fensterlüftung deutlich reduzieren. Im Bereich der Wärmeerzeugungsanlage und des Wärmeverteilnetzes gibt es keinen Handlungsbedarf. Die Anlagen befinden sich auf dem Stand der Technik. 104
107 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Ergebnisse Tabelle 41 zeigt die möglichen Einsparpotenziale. Zu beachten ist, dass es bei den ermittelten Werten um eine Grobanalyse handelt. Die ermittelten Werte wurden mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten berechnet beinhalten jedoch eine Abweichung +/- 20 %. Maßnahmen Fassadendämmung Einzelraumregelung Austausch Beleuchtung Energieeinsparung CO 2 - Einsparung Investition Amortisation kwh/a 4,0 t/a EUR 27 a* kwh/a 2,1 t/a EUR 14 a* kwh/a 0,5 t/a EUR 16 a** Tabelle 41: mögliche Einsparung Geschwister-Scholl-Schule (Oberschule Ganztagsgebäude) Abbildung 67 zeigt den spezifischen Heizenergieverbrauch bezogen auf die Netto- Grundfläche. Der obere Pfeil zeigt den derzeitigen Verbrauchwert aus den gemittelten Energieverbräuchen aus den letzten drei Jahren. Der untere Pfeil zeigt den möglichen spezifischen Verbrauchswert bei Umsetzung aller beschriebenen Maßnahmen. Diese Grafik dient somit nur als Veranschaulichung der Energieverbräuche und ersetzt nicht den bedarfsorientierten Energieausweis nach DIN V Heizenergiekennwert CO 2 Emission 29 kg/(m² * a) 128 Nach Sanierung 73 kwh/m²a CO 2 Emission 16 kg/(m² * a) Abbildung 67: Verbrauchkennwerte Geschwister-Scholl-Schule (Oberschule Ganztagsgebäude) 105
108 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude 6.7. Krause-Tschetschog-Oberschule (Hauptgebäude) Anschrift: Weitzgrunder Weg Bad Belzig Gebäudekennwerte: Baujahr: 1968 Nutzung: Schulgebäude Zustand: Teilsaniert BGF: m² KGF: 953 m² NGF: m² BRI: m³ Etagenanzahl : 3 Kellergeschoss: teilunterkellert Abbildung 68: Ansicht Krause-Tschetschog- Oberschule Energieversorgung: Heizungsanlage: Gas Brennwert Kessel Typ: 2 x Viessmann Vertomat Baujahr: - Energieträger: Erdgas Leistung: 2 x 225 kw Verbrauchserfassung: Heizung 536,4 MWh 621,3 MWh 407,1 MWh Strom kwh kwh kwh Tabelle 42: Verbräuche Krause-Tschetschog-Oberschule 106
109 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Gebäudesubstanz Das Hauptgebäude der Krause-Tschetschog-Oberschule ist in Stahlbeton-Montagebauweise als Typenschulbau Potsdam Atrium errichtet worden. Charakteristisch für diesen Gebäudetyp sind die zwei dreigeschossigen Baukörper, die über drei Gangbauten miteinander verbunden sind. So bilden sich aus der Gebäudestruktur zwei Innenhöfe. In jedem Verbindungsbau befindet sich eine einläufige Treppenanlage über die die Etagen erschlossen werden. Das statische System besteht aus den geschosshohen Giebelelementen und den parallel dazu ausgerichteten tragenden Querwänden aus konstruktivem Leichtbeton mit einem Achsabstand von 7,20 m. Die nichttragenden Fassadenelemente bestehen aus 29 cm starken Leichtbetonplatten, die mit den Deckenelementen verankert sind. Die Decken sind als Stahlbetonrippendecken ausgeführt, die Dachfläche als Warmdach mit 15 % Neigung zum Traufbereich und außenliegender Entwässerung. Das Schulgebäude wurde seit 1992 in Teilbereichen saniert. Beginnend mit Dämmmaßnahmen der Giebelwandflächen mit 5 cm Mineraldämmung und einer Bekleidung aus Aluminiumblech als äußerer Fassadenabschluss wurde die Dachfläche mit einer zusätzlichen Dämmebene von 6 cm ertüchtigt und eine neue bituminöse Dachabdichtung aufgebracht. Die markanten horizontalen Fensterbänder wurden sukzessive von 1992 bis 2001 erneuert. Daher ergeben sich für die Kunststofffensterelemente unterschiedliche Eigenschaften, beispielsweise U-Werte von 2,4 bis 1,8. Die Fensterbänke sind als durchlaufende Zinkverblechungen ausgebildet, stumpf mit dauerelastischer Verfugung an die Rahmenprofile stoßend und in der Betonbrüstung verschraubt (Abbildung 69, Abbildung 70). Die Türanlagen der Eingangsbereiche sind 2009 erneuert und gegen Aluminiumelemente mit Isolierverglasung (U W = 1,1) ausgetauscht worden. Im Rahmen der 2004 umgesetzten Sanierungsmaßnahem zum Brandschutz wurden an den vier Giebelfassaden des Schulobjektes Stahltreppen errichtet, um den Anforderungen an die Rettungswegsituation gerecht zu werden. In diesem Zusammenhang war es erforderlich im ersten und zweiten Obergeschoss zusätzliche Türöffnungen in die Fassadenplatten einzubauen. Abbildung 69: Fenster Krause- Tschetschog-Oberschule Abbildung 70: Fensterbank Krause-Tschetschog-Oberschule 107
110 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Anlagentechnik Die Wärmversorgung erfolgt durch zwei Brennwert-Gaskessel mit modulierenden Brennern und einer Gesamtnennwärmeleistung von 450 kw. Die Kesselanlage wird von den Stadtwerken Bad Belzig betrieben. Die Wärmverteilung erfolgt über vier geregelte Heizkreise und einen ungeregelten Heizkreis. In einem Heizkreis wurde eine drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe eingebaut. Die restlichen Heizkreise werden mit Standard-Differenzdruck geregelten Pumpen betrieben. Als Heizflächen sind im ganzen Objekt Gliederradiatoren installiert. Im Rahmen der 2004 umgesetzten Sanierungsmaßnahme zum Brandschutz wurde in den Fluren ein neues Beleuchtungskonzept mit Aufputzleuchten und Energiespar-Leuchtmitteln installiert. Zur Beleuchtung der Klassenräume sind doppelflammige Langfeldleuchten mit T8 Leuchtmittel installiert. Abbildung 71: Brennwertkessel Krause-Tschetschog-Oberschule Abbildung 72: Heizkreisverteiler Krause-Tschetschog-Oberschule Wärmebezugsvertrag Der bestehende Wärmebezugsvertrag wurde als Sondervertrag mit den Stadtwerken Bad Belzig geschlossen. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre und endet am Dabei betreiben die Stadtwerke zwei Gas Brennwertkessel. Vertraglich vereinbart ist eine thermische Leistung von 450 kw bei einem spezifischen Leistungspreis von 58 DM/kW (entspricht 29,66 EUR/kW) und eine voraussichtliche Nutzwärme von 780 MWh/a. Die daraus ermittelten Vollbenutzungsstunden betragen ca h/a. Der Wärmeverbrauch für das Jahr 2011 beträgt ca. 410 MWh/a und liegt damit deutlich unter dem vertraglich angenommen Verbrauch. Die aus dem Jahr 2011 resultierenden Vollbenutzungsstunden von ca. 900 h/a lassen auf eine Überdimensionierung der Wärmeerzeugungsanlage für die teilsanierte Schule schließen. Eine überschlägige Berechnung der notwendigen Heizlast anhand des Verbrauches aus 2011 und die nach VDI 2067 Blatt 2 angegebenen Vollbenutzungsstunden von 1300 h/a für eine Schule im Mehrschichtbetrieb, ergab eine thermische Leistung von ca. 315 kw. Somit wäre eine Leistungsreduzierung von 135 kw derzeitig denkbar. Dies würde einer jährlichen Einsparung von ca EUR/a entsprechen. 108
111 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Potenzialanalyse Bauliche Maßnahmen In Anbetracht des baulichen Zustandes des Gebäudes erscheint eine umfassende energetische Sanierung der Gebäudehüllflächen sinnvoll. Schwerpunkte bilden dabei die Dämmung der Fassadenflächen, Erneuerung der Dachdämmung und der Austausch der Fensterelemente. Durch die Fassadensanierung lassen sich ca. 160 MWh im Jahr an Energie zur Beheizung des Gebäudes einsparen. Der charakteristische U-Wert der Außenwandelemente von vergleichbaren Systembauten liegt bei ca. 1,7 W/m²K. Durch energetische Sanierungsmaßnahmen beispielhaft durch das Aufbringen eines Vollwärmeschutzes mit 140 mm mineralischer Wärmedämmung kann dieser Wert auf ca. 0,22 W/m²K reduziert werden. Diesen Maßnahmen vorangestellt, sind entsprechenden Untersuchungen zur Tragfähigkeit der Bestandsfassade notwendig, um die geeignete Montageweise des zusätzlichen Fassadenaufbaus bestimmen zu können. Im Rahmen einer solchen Maßnahme sollte ebenfalls der Austausch der Fensterelemente in Betracht gezogen werden, um diese an den aktuellen energetischen Standard anzupassen. Zudem können somit die baukonstruktiven Anschlussbereiche technisch korrekt ausgeführt, abgedichtet und eine luftdichte thermische Gebäudehülle geschaffen werden. Durch den Austausch aller Fenster im Gebäude lassen sich bis zu 60 MWh/a Heizenergie einsparen. Komplettiert wird die Ertüchtigung der Gebäudehüllflächen durch eine Erneuerung der Dachflächendämmung. In einer weiterführenden Untersuchung sollte der vorhandene Dachaufbau auf den aktuellen Zustand und die Funktionstüchtigkeit überprüft werden, um festzustellen ob dieser mit in den neuen Aufbau einbezogen werden kann oder ein Rückbau und folglich ein Neuaufbau erforderlich wird. Mit der Dämmung der Dachflächen können nochmals Energieeinsparungen von ca. 10 MWh/a bewirkt werden. Zusammenfassend betrachtet, können mit der Umsetzung aller dargestellten, baukonstruktiven Maßnahmen Minderungen des Heizenergiebedarfs von bis zu 250 MWh/a erreicht werden. Maßnahmen Gebäudetechnik Augenscheinlich weist die Wärmeversorgungsanlage keine gravierenden Mängel auf. Jedoch gibt es auf Grund des Alters Optimierungspotenzial gerade in Verbindung mit einer energetischen Sanierung der thermischen Hülle. Durch einen hydraulischen Abgleich des Wärmeverteilnetzes inkl. Einbau von drehzahlregelbaren Hocheffizienzpumpen können elektrische Energie für die Heizungspumpen reduziert und die Wärmeverteilung optimiert werden. Weitere Vorteile liegen in der Reduzierung der Heizungsrücklauftemperatur, was bei einem Einsatz von Brennwerttechnik den Primärenergieverbrauch reduziert. Durch die Installation von Einzelraumregelungen in Verbindung mit motorisch betrieben Heizkörperventilen und Fensterkontakten lassen sich die unkontrollierten Lüftungsverluste durch Fensterlüftung deutlich reduzieren. 109
112 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bei einer energetischen Sanierung der thermischen Hülle wie oben beschrieben wird das Gebäude möglichst Luftdicht gemacht. Energieintensive Dauerlüftung durch undichte Fenster und Türen, wie in Altbauten üblich, gibt es nicht mehr. Deshalb erfordern luftdichte Schulbauten eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung als Kondensationsrotor. Diese Wärmerückgewinnung hat einen Wirkungsgrad von ca. 80 %. Somit lässt sich das Gebäude bei gleichbleibender Luftqualität energieeffizient betreiben. Weitere Vorteile liegen in der Möglichkeit einer nächtlichen Sommerkühlung des Gebäudes. Somit stellt sich ein deutlicher Komfortgewinn durch den Einsatz einer zentralen Lüftungsanlage mit WRG ein. Nach Durchführung einer energetischen Sanierung kann die Kesselleistung reduziert und die Vorlauftemperatur abgesenkt werden. Im Bereich der Beleuchtungstechnik ist der Austausch von T8 Leuchtmittel gegen T5 Leuchtmittel oder CCFL- und LED-Leuchten sinnvoll. In Verbindung mit einer bedarfsgerechten Lichtsteuerung kann der Stromverbrauch für die Beleuchtung weiter gesenkt werden. Ergebnisse Die nachfolgende Tabelle 43 zeigt die möglichen Einsparpotenziale. Zu beachten ist, dass es bei den ermittelten Werten um eine Grobanalyse handelt. Die ermittelten Werte wurden mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten berechnet, beinhalten jedoch eine Abweichung +/- 20 %. Maßnahmen Energieeinsparung CO 2 - Einsparung Investition Amortisation kwh 30 t/a EUR 22 a* Dachdämmung kwh/a 1,9 t/a EUR 68 a* Austausch Fenster kwh/a 13,6 t/a EUR 51 a* Fassadendämmung Einzelraumregelung Optimierung Hydraulik Lüftung Co2 gesteuert Austausch Beleuchtung kwh/a 12 t/a EUR 12 a* kwh/a 4,5 t/a EUR 10 a kwh/a 4,4 t/a kwh/a 4,5 t/a EUR 9 a** Tabelle 43: mögliche Einsparung Krause-Tschetschog-Oberschule Die nachfolgende Abbildung 73 zeigt den spezifischen Heizenergieverbrauch bezogen auf die Netto-Grundfläche. Der obere Pfeil zeigt den derzeitigen Verbrauchwert aus den gemittelten Energieverbräuchen aus den letzten drei Jahren. Der untere Pfeil zeigt den möglichen spezifischen Verbrauchswert bei Umsetzung aller beschriebenen Maßnahmen. Diese Grafik dient somit nur als Veranschaulichung der Energieverbräuche und ersetzt nicht den bedarfsorientierten Energieausweis nach DIN V
113 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Heizenergiekennwert CO 2 Emission 36 kg/(m² * a) 159 Nach Sanierung 75 kwh/m²a CO 2 Emission 17 kg/(m² * a) Abbildung 73: Verbrauchskennwerte Krause-Tschetschog-Oberschule 111
114 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude 6.8. Kindertagesstätte Tausendfüßler Anschrift: Heinrich-Heine-Straße 3a Bad Belzig Gebäudekennwerte: Baujahr: 1975, 2008 Nutzung: Kindertagesstätte Zustand: teilsaniert BGF: m² KGF: 334 m² NGF: m² BRI: m³ Etagenanzahl: 2 Kellergeschoss: unterkellert Abbildung 74: Ansicht Kindertagesstätte Tausendfüßler Energieversorgung: Heizungsanlage: Baujahr: Energieträger: Leistung: Fernwärme indirekt Fernwärme SWB 200 kw Verbrauchserfassung: Heizung 287,21 MWh 326,11 MWh 407,10 MWh Strom kwh kwh kwh Tabelle 44: Verbräuche Kindertagesstätte Tausendfüßler 112
115 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Gebäudesubstanz Das Gebäude der Kindertagesstätte besteht aus einem dreigeschossigen Gebäuderiegel über den das Objekt durch zwei Zugänge erschlossen wird. Rückwärtig gelegen befindet sich ein eingeschossiger Gebäuderiegel mit Gruppenbereich und Zugang zum angrenzenden Außenbereich der Kindertagesstätte. Beide Gebäudeteile sind durch zwei Verbindungsgänge im Erdgeschoss miteinander verbunden. Aus dieser Anordnung ergibt sich zwischen den Objekten ein umbauter Innenhof. Die einzelnen Gebäudeteile der Kindertagesstätte sind vollunterkellert. Im Eingangsbau befinden sich in der Kellerebene weitere beheizte Aufenthaltsräume; unterhalb der Verbinder und des eingeschossigen Gebäudeteils ist ein Kriechkeller vorhanden, in dem die Versorgungsleitungen der entsprechenden Medien untergebracht sind. Die ungedämmten Fassaden- und Sockelflächen sind mit einer Putzschicht versehen. Die Fensterbänder im Objekt wurden bereits erneuert und gegen Kunststofffenster mit Isolierverglasung ausgetauscht. Ebenfalls wurden die Dachflächen energetisch ertüchtigt und Dachdämmung und Dachabdichtung erneuert. Des Weiteren erfolgten 2008 Umbaumaßnahmen, um den geltenden Brandschutzbestimmungen gerecht zu werden. In diesem Zusammenhang wurden zahlreiche Türen und Türanlagen ertüchtigt bzw. ausgetauscht und an den Giebelfassaden wurden Stahltreppenanlagen als zusätzliche Rettungswege errichtet. In einer weiteren Sanierungsetappe erfolgte im Rahmen des Konjunkturpaketes (K II) die Sanierung des Sanitäranlagen sowie die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen im Bereich des eingeschossigen Gebäudeabschnittes. Abbildung 75: Fenster Kindertagesstätte Tausendfüßler 113
116 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Anlagentechnik Die Wärmeversorgung des Objektes Erfolgt über einen Fernwärmeanschluss mit einer Nennwärmeleistung von 200 kw. Die Warmwasserbereitung erfolgt über einen Trinkwasserspeicher mit innenliegendem Wärmetauscher. Die Wärmeverteilung erfolgt über drei geregelte Heizkreise mit drehzahlgeregelten Hocheffizienz Pumpen. Als Heizflächen sind profilierte Flachheizkörper installiert. Bei einer durchgeführten Teilsanierung des Objektes, wurden die doppelflammigen Langfeldleuchten gegen quadratische Leuchten mit T5 Leuchtmittel ausgetauscht. In dem nicht sanierten Teil sind weiterhin Langfeldleuchten ohne Reflektoren mit T8 Leuchtmitteln installiert. Abbildung 76: Beleuchtung alt Kindertagesstätte Tausendfüßler Abbildung 77: Fernwärmestation mit Heizkreisverteiler Kindertagesstätte Tausendfüßler Fernwärmevertrag Der bestehende Fernwärmeversorgungsvertrag wurde mit den Stadtwerken Bad Belzig geschlossen. Dabei ist die Kita an das Fernwärmenetz der Stadtwerke indirekt angeschlossen. Die Laufzeit betrug 10 Jahre und endete am Sollte keine Kündigung erfolgt sein so verlängert sich der Vertrag um weitere fünf Jahre. Die vertraglich vereinbarte Leistung von 200 kw scheint auf Grund der relativ hohen Anzahl an Vollbenutzungsstunden von ca h/a passend für das Objekt gewählt. Als Kennwert nach VDI 2067 Blatt 2 für Mehrfamilienhäuser wird von einer Vollbenutzungsdauer von 2000 h/a ausgegangen. Damit ist eine Reduzierung der Anschlussleistung zum derzeitigen Stand nicht notwendig ist. Der damals vereinbarte Leistungspreis beträgt 54,97 DM/kW (entspricht EUR/kW) Potenzialanalyse Bauliche Maßnahmen Unter Berücksichtigung der bereits erfolgten Sanierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre sind bei dem Objekt der Kindertagesstätte Tausendfüßler noch erheblich Potenziale zur Minderung des Energieverbrauchs in der Dämmung der Fassadenflächen vorhanden. Bestandsanalysen zu Folge kann durch das Anbringen eines Wärmedämmverbundsystems mit einer Dämmstärke von 140 mm der Wärmedurchgangskoeffizient der 114
117 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Außenwandbauteile von zu Grunde gelegten 2,2 W/m²K auf einen Wert von 0,22 W/m²K verbessert werden und demzufolge eine Verbrauchsminderung von bis zu 140 MWh/a erzielt werden. Auf der Grundlage der dokumentierten Bestandssituation bieten die weiteren Bauteile der Gebäudehülle (Fenster, Dachflächen) nur ein geringes Minderungspotenzial bezogen auf den Heizenergiebedarf. Durch den Austausch der Fensterelemente können Einsparungen von ca kwh/a erreicht werden bei der Sanierung der Dachflächen ist eine Reduzierung des Energieverbrauches um bis zu kwh/a möglich. Vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit erscheint es sinnvoll, die Notwendigkeit der Maßnahmen in einer Kosten-Nutzen-Betrachtung nochmals detaillierter zu prüfen. Einen weiteren Ansatzpunkt zur Senkung der Heizenergieverbräuche bietet sich in der Dämmung der Deckenbereiche oberhalb des Kriechkellers. Durch die Kellerdeckendämmung kann der Wärmeverlust zu den unbeheizten Kellerzonen gemindert und das Kälteempfinden im Fußbodenbereich verringert werden. Dies erscheint hinsichtlich der Nutzung des Objektes als Kindertagesstätte sinnvoll, da sich die Kleinkinder der betreuten Altersgruppen hauptsächlich in dieser Raumzone aufhalten. Maßnahmen Gebäudetechnik Reduzierung der Anschlussleistung nach Fertigstellung der energetischen Sanierungsmaßnahmen und Absenkung der Auslegungsvorlauftemperatur. Durch die Installation von Einzelraumregelungen in Verbindung mit motorisch betriebenen Heizkörperventilen und Fensterkontakten, lassen sich die unkontrollierten Lüftungsverluste durch Fensterlüftung deutlich reduzieren. Durch einen hydraulischen Abgleich des Wärmeverteilnetzes, inkl. Einbau von drehzahlregelbaren Hocheffizienzpumpen kann elektrische Energie für die Heizungspumpen reduziert und die Wärmeverteilung optimiert werden. Durch Dämmung des Wärmeverteilnetzes inkl. Fernwärmeübergabestation und Armaturen, nach EnEV 2009, können die unnötigen Wärmeverluste im unbeheizten und niedertemperierten Bereich deutlich reduziert werden. Im Bereich der Beleuchtungstechnik ist der Austausch von T8 Leuchtmittel gegen T5 Leuchtmittel oder CCFL- und LED-Leuchten sinnvoll. In Verbindung mit einer bedarfsgerechten Lichtsteuerung kann der Stromverbrauch für die Beleuchtung weiter gesenkt werden. 60 Ergebnisse Tabelle 45 zeigt die möglichen Einsparpotenziale. Zu beachten ist, dass es bei den ermittelten Werten um eine Grobanalyse handelt. Die ermittelten Werte wurden mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten berechnet beinhalten jedoch eine Abweichung +/- 20 %. 115
118 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Maßnahmen Energieeinsparung CO 2 - Einsparung Investition Amortisation kwh 31 t/a EUR 9 a* Dachdämmung kwh/a 1,9 t/a EUR 66 a* Austausch Fenster kwh/a 2,2 t/a EUR 77 a* Fassadendämmung Einzelraumregelung Optimierung Hydraulik und Dämmung Austausch Beleuchtung kwh/a 15,8 t/a EUR 6 a* kwh/a 4,0 t/a EUR 6 a* kwh/a 1,9 t/a EUR 10 a** Tabelle 45: mögliche Einsparung Kindertagesstätte Tausendfüßler Abbildung 78 zeigt den spezifischen Heizenergieverbrauch bezogen auf die Netto- Grundfläche. Der obere Pfeil zeigt den derzeitigen Verbrauchwert aus den gemittelten Energieverbräuchen aus den letzten drei Jahren. Der untere Pfeil zeigt den möglichen spezifischen Verbrauchswert bei Umsetzung aller beschriebenen Maßnahmen. Diese Grafik dient somit nur als Veranschaulichung der Energieverbräuche und ersetzt nicht den Heizenergiekennwert CO 2 Emission 41 kg/(m² * a) 149 Nach Sanierung 53 kwh/m²a CO 2 Emission 16 kg/(m² * a) Abbildung 78: Heizenergiekennwerte Kindertagesstätte Tausendfüßler bedarfsorientierten Energieausweis nach DIN V
119 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude 6.9. Freizeit- und Erlebnisbad Anschrift: Weitzgrunder Weg Bad Belzig Gebäudekennwerte Baujahr: 1950, 1993 Nutzung: Freibad Zustand: saniert BGF: m² KGF: - NGF: - BRI: - Etagenanzahl : - Kellergeschoss: teilunterkellert Abbildung 79: Ansicht Freizeit- und Erlebnisbad Energieversorgung: Heizungsanlage: Buderus G-405 Baujahr: 1993 Energieträger: Erdgas Leistung: 450 kw Verbrauchserfassung: Heizung kwh kwh kwh Strom kwh kwh kwh Tabelle 46: Verbräuche Freizeit- und Erlebnisbad 117
120 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Gebäudesubstanz Die Freibadanlage der Stadt Bad Belzig setzt sich aus folgenden Bereichen und Gebäudeteilen zusammen: Schwimmbecken mit den Aktionsbereichen (Bahnenbecken, Tauchgarten, Wasserrutsche, Erlebnisbecken), Nichtschwimmerbecken, Eingangspavillon, Nebengebäude zur Wasseraufbereitung (Abb. 9.1), Nebengebäude mit Sanitäranlagen (Abb. 9.2), Pumpenkeller. Bei den Gebäuden handelt sich mit Ausnahme des Eingangspavillons um Mauerwerksbauten mit Satteldach und Ziegeldeckung. Der Dachraum ist nicht ausgebaut und jeweils über Öffnungen in der Giebelfassade zugänglich. Am Nebengebäude, in dem die Anlagen zur Wasseraufbereitung untergebracht sind, wurden 1996 die Fassadenflächen und die Fensteranlagen saniert. Ebenfalls im Sanitärtrakt wurden Holzfenster mit Isolierverglasung eingebaut und die Sanitäreinrichtungen erneuert. Die Fassadenflächen befinden sich in ungedämmten Zustand, sodass das Gebäude in der Winterpause zum Frostschutz beheizt wird. Die gebäudeeigene Versorgungsanlage befindet sich in einem an der Giebelwand gelegenen Hausanschlussraum. Abbildung 80: Nebengebäude Freizeit- und Erlebnisbad Abbildung 81: WC-/Waschhaus Freizeit- und Erlebnisbad Bestandsbeschreibung Anlagentechnik Für die Umwälzung des Wassers und zum Betreiben der Wasser-Attraktionen sind Pumpen mit einem Volumenstrom von bis zu 311 m³/h und Druckerhöhungspumpen mit einer Druckerhöhung von bis zu 40 mws installiert. Zur Erwärmung des Wassers ist einen Gaskessel mit Gasbrenner und einer Nennwärmleistung von 450 kw installiert. Die Wärmeabgabe an das Schwimmbadwasser erfolgt über zwei parallelgeschaltete Rohrbündel-Edelstahl-Wärmetauscher. Augenscheinlich sind diese deutlich zu klein dimensioniert und können die Wärme nicht ausreichend an das Schwimmbadwasser abgeben. Dies wurde auch von dem Betreiber bestätigt. 118
121 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Eine Vorerwärmung des Schwimmbadwassers erfolgt durch einen solarthermischen Flächenkollektor, welcher sich in dem Bodenbelag der der nebenstehenden Eisbahn in dem Kunststoffbelag (Tartan) befindet. Auf Grund der unterschiedlichen sportlichen Benutzung außerhalb der Winterzeit, kommt es häufig zu Undichtigkeiten des Flächenkollektors. Abbildung 82: Pumpenhaus Freizeit- und Erlebnisbad Abbildung 83: Pumpenstation Freizeit- und Erlebnisbad Potenzialanalyse Bauliche Maßnahmen Bei der Untersuchung des Objektes Freizeit- und Erlebnisbad der Stadt Bad Belzig ergeben sich die Optimierungsansätze vorrangig aus der Betrachtung der vorhandenen Anlagentechnik. Demzufolge werden hier keine baulichen Maßnahmen angeführt. Maßnahmen Gebäudetechnik Durch eine Einführung eines Lastmanagement zur Reduzierung von elektrischen Leistungsspitzen durch hohe Anlaufströme der Pumpen kann die elektrische Anschlussleistung reduziert werden. Dies hat jedoch keine Energieeinsparung zur Folge, lediglich wird die Leistungskurve geglättet und der Betreiber muss einen geringeren Leistungspreis bezahlen. Des Weiteren kann geprüft werden ob der Einsatz eines Blockheizkraftwerkes im Verbund mit der Eisbahn sinnvoll ist. So könnte die Wärme im Sommer für die Beheizung der Becken des Freibades genutzt werden und die elektrische Energie für das Betreiben der Pumpen. Die gleichzeitige Nutzung von Wärme und elektrischer Energie spricht für die Realisierung einer Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage (KWK). Im Winter könnte die Wärme zur Kälteerzeugung genutzt werden (vgl. 6.10). 119
122 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Teilobjekt Eisbahn (Technikgebäude) Anschrift: Martin-Luther-Straße 12a Bad Belzig Gebäudekennwerte: Baujahr: 1995 Nutzung: Technikräume Zustand: - BGF: 226 m² KGF: 29 m² NGF: 196 m² BRI: m³ Etagenanzahl: 1 Kellergeschoss: - Abbildung 84: Ansicht Teilobjekt Eisbahn Energieversorgung: Heizungsanlage: Abwärme / Elektro Baujahr: - Energieträger: - Leistung: - Verbrauchserfassung: Daten liegen nicht vor Bestandsbeschreibung Gebäudesubstanz Zur Eissportbahn gehört ein Gebäude in dem der Kassenraum, die Sanitäreinrichtungen, Aufenthalts- sowie Technikräumen untergebracht sind. Das Gebäude wurde 1995 als Mauerwerksbau mit Fassadendämmung und extensiv-begrüntem Satteldach errichtet. Dem Objekt schließt sich rückseitig die ganzjährig bespielte Sportfläche mit Kunststoff-Sportbelag und Bandenumrandung an. Im Sommer geeignet für Spielarten wie Handball, Volleyball, Basketball, Badminton oder Tennis. In der Winterzeit genutzt als Kunsteisbahn. Abbildung 85: Fläche Eisbahn 120
123 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Anlagentechnik Die Eisbahn wird im Winter als Freie Kunsteisbahn und in der restliche Zeit als allgemeiner Sportplatz genutzt. Für die Kühlung der Eisbahn ist Kompressionskälteanalage (Abbildung 86) mit einer Kälteleistung von 312 kw installiert. Ende 2014 läuft die Zulassung für das in der Kältemaschine eingesetzte Kältemittel aus. Die Kühlung im Freien stellt eine sehr energieintensive Energieumwandlung dar. Gerade in Verbindung mit elektrisch angetriebenen Kompressionskälte-Maschinen, wie hier in diesem Fall. Der Wärmeentzug der Eisbahn erfolgt durch in den Tartanbelag eingelassene Verdampferleitungen. Die am Enthitzer anfallende Wärme wird über einen Plattenwärmetauscher an einen gedämmten Pufferspeicher (4000 l) abgegeben. Über diesen Pufferspeicher wird die Wärme zur Beheizung der Fußbodenheizung genutzt. Ein Elektroheizstab mit einer elektrischen Anschlussleistung von 27 kw erhitzt das Trinkwasser auf das notwendige Temperaturniveau. Abbildung 86: Kälteanlage Eisbahn Abbildung 87: Pufferspeicher Eisbahn Potenzialanalyse Bauliche Maßnahmen In erweiterter Betrachtung der Freibadanlage beschränken sich auch bei der Eisbahn die Ansätze zur Minderung der Energieverbräuche und Optimierung der Unterhaltung auf die technischen Anlagenkomponenten. Maßnahmen Gebäudetechnik Durch den Einsatz eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) in Verbindung mit einer Absorptionskälteanalage kann die Wärme genutzt werden, um Kälte zu erzeugen, welche zur Kühlung der Eisfläche genutzt werden kann. Es müsste aber separat geprüft werden ob diese Maßnahme technisch und wirtschaftlich umsetzbar ist. 121
124 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bürgerhaus Bad Belzig Anschrift: Marktplatz Bad Belzig Gebäudekennwerte: Baujahr: 1925 Nutzung: Verwaltungsgebäude Zustand: Saniert (2004) BGF: 684 m² KGF: 22 m² NGF: 661 m² BRI: m³ Etagenanzahl: 4 Kellergeschoss: - Abbildung 88: Ansicht Bürgerhaus Energieversorgung: Heizungsanlage: Energieträger: Versorgung durch Rathaus Erdgas Verbrauchserfassung Energieverbräuche liegen nicht vor Bestandsbeschreibung Gebäudesubstanz Das Bürgerhaus der Stadt Bad Belzig ist ein historischer Altbau in direkter Nähe zum städtischen Marktplatz. Das Gebäude stammt aus dem Baujahr 1925 und ist 2004 aufwendig und umfassend saniert worden. In Rahmen dieser Maßnahmen sind isolierverglaste Holzfenster- und Türanlagen eingebaut und Dämmmaßnahmen an den Dachflächen und an den hofseitigen Fassadenflächen vorgenommen worden. Die zum Marktplatz hin orientierte Hauptfassade ist zum Schutz der historischen Fassadenelemente ungedämmt belassen und nur malermäßig aufgearbeitet worden. Im Innenbereich wurde das Gebäude entsprechend der momentanen Nutzung teilweise entkernt. Das Erdgeschoss wird als Bürgerbüro mit den zugehörigen Nebenflächen genutzt. Im Obergeschoss, welches über das hofseitig zugängliche Treppenhaus / Aufzug erschlossen wird, befinden sich Beratungsräume sowie im Dachgeschoss weitere Büroflächen. Der darüber befindliche Dachboden wird nicht genutzt. Das Kellergeschoss beherbergt Lagerflächen und die Sanitäreinheiten, die dem Bürgerbüro und den Versammlungseinheiten zugeordnet sind. 122
125 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Anlagentechnik Das Gebäude wird über das anliegende Rathaus mit Wärm versorgt. Die Unterzählung der verbrauchten Wärme erfolgt über Wärmemengen Zähler. Die Wärmeabgabe an die Räume erfolgt durch statische Heizflächen Potenzialanalyse Bauliche Maßnahmen Angesichts der 2004 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen bietet die Gebäudesubstanz des Bürgerhauses der Stadt Bad Belzig keine erwähnenswerten Potenziale zur Minderung des Energiebedarfes. Weitere Maßnahmenvorschläge zur weiterführenden energetischen Sanierung des Gebäudes können auch aus Gründen des Denkmalschutzes nicht definiert werden bzw. erscheinen nicht sinnvoll. Maßnahmen Gebäudetechnik Durch einen hydraulischen Abgleich des Wärmeverteilnetzes können elektrische Energie für die Heizungspumpen reduziert und die Wärmeverteilung optimiert werden. Weitere Vorteile liegen in der Reduzierung der Heizungsrücklauftemperatur, was bei einem Einsatz von Brennwerttechnik den Primärenergieverbrauch reduziert. Durch die Installation von Einzelraumregelungen in Verbindung mit motorisch betrieben Heizkörperventilen und Fensterkontakten lassen die unkontrollierte Lüftungsverluste durch Fensterlüftung deutlich reduzieren. Im Bereich der Beleuchtungstechnik ist der Austausch eine Umrüstung auf CCFL- und LED- Leuchten sinnvoll. In Verbindung mit einer bedarfsgerechten Lichtsteuerung kann der Stromverbrauch für die Beleuchtung weiter gesenkt werden. Die nachfolgende Tabelle 47 zeigt die möglichen Einsparpotenziale. Maßnahmen Einzelraumregelung Optimierung Hydraulik Energieeinsparung CO 2 - Einsparung Investition Amortisation kwh/a 2,8 t/a EUR 14 a* kwh/a 1,3 t/a EUR 12 a* Tabelle 47: Zusammenfassung Ergebnisse Bürgerhaus Bad Belzig Abbildung 89 zeigt den spezifischen Heizenergieverbrauch bezogen auf die Netto- Grundfläche. Der obere Pfeil zeigt den derzeitigen Verbrauchwert aus den gemittelten Energieverbräuchen aus den letzten drei Jahren. Der untere Pfeil zeigt den möglichen spezifischen Verbrauchswert bei Umsetzung aller beschriebenen Maßnahmen. Diese Grafik dient somit nur als Veranschaulichung der Energieverbräuche und ersetzt nicht den bedarfsorientierten Energieausweis nach DIN V
126 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Heizenergiekennwert CO 2 Emission 28 kg/(m² * a) 124 Nach Sanierung 97 kwh/m²a CO 2 Emission 22 kg/(m² * a) Abbildung 89: Heizenergiekennwerte Bürgerhaus 124
127 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Rathausgebäude Bad Belzig Anschrift Wiesenburger Straße Bad Belzig Gebäudekennwerte Baujahr: 1990 Nutzung: Verwaltungsgebäude Zustand: - BGF: m² KGF: 218 m² NGF: m² BRI: m³ Etagenanzahl: 4 Kellergeschoss: unterkellert Abbildung 90: Ansicht Rathausgebäude Energieversorgung Heizungsanlage: Buderus Lollar G-405 Baujahr: 1990 Energieträger: Erdgas Leistung: 140 kw Verbrauchserfassung: Heizung kwh kwh kwh Strom kwh kwh kwh Tabelle 48: Verbräuche Rathausgebäude 125
128 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Gebäudesubstanz Das Rathausgebäude am Marktplatz von Bad Belzig ist ein viergeschossiger Mauerwerksbau, der nach einem Brand fast vollständig zerstört und in der Zeit von 1989 bis 1991 nach historischem Vorbild wieder aufgebaut wurde. Auf drei Geschossebenen sind die Abteilungen der Stadtverwaltung Bad Belzig untergebracht, zudem wird das ehemalige Ratszimmer im Erdgeschoss momentan von der Tourismusinformation als Anlaufpunkt für den öffentlichen Besucherverkehr genutzt. Das Kellergeschoss dient als Lager- und Technikfläche. Hier befindet sich auch die zentrale Heizungsanlage, die sowohl das Rathaus wie auch das angrenzende Bürgeraus versorgt. Das Rathausgebäude wurde als Mauerwerksbau mit zwei oberirdischen Vollgeschossen und einem ausgebauten Dachgeschoss wieder errichtet. Über dem mittig angeordneten Treppenhaus schließt sich über die Dachebene hinaus der für das Erscheinungsbild prägende Rathausturm an, der über den nicht ausgebauten Teil des Dachstuhls zugänglich ist. Die überwiegend geschlossene Putzfassade wird auf der Straßenseite zur Wiesenburger Straße durch die Profilierung mit hervortretenden Halbsäulen sowie Sturz- und Brüstungsgesimsen besonders betont und hebt den Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes hervor. Eine weitere Betonung erfährt die zum Marktplatz orientierte Giebelfassade. Die Fassaden- und Dachflächen sind im momentanen Zustand nicht gedämmt. Die Fensteranlagen bestehen aus holzgerahmten Doppelkastenfenstern mit Einscheibenverglasung nach historischem Vorbild mit zu öffnendem Oberlicht. Die Fenster der Dachgauben sind mit Isolierverglasungen ausgestattet. Bei den Außentüren handelt es sich um massive Holztüren mit festverglasten Oberlichtöffnungen. Abbildung 91: Hinterhof Rathausgebäude Abbildung 92: Fenster Rathausgebäude 126
129 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Anlagentechnik Die Wärmversorgung erfolgt durch einen Gas-Gußheizkessel mit Gasbrenner und einer Gesamtnennwärmeleistung von 140 kw. Die Wärmeverteilung im Keller weist einen sanierungswürden Zustand auf. Augenscheinlich wurde bei der Nachrüstung der Wärmemengenzähler die Dämmarbeiten nicht fachgerecht ausgeführt und teilweise komplett vergessen. Für die Kühlung des Serverraumes ist eine Klein-Kälte-Anlage im Hinterhof installiert Potenzialanalyse Bauliche Maßnahmen Die erforderlichen Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Rathausgebäudes sind aufgrund der historischen Bedeutung des Objektes geprägt durch die denkmalpflegerischen Vorgaben, die es bei einer detaillierten Planung wie auch der späteren Umsetzung zu berücksichtigen gilt. Das Grobkonzept sieht auch hier die Schwerpunkte in den Dämmmaßnahmen der Gebäudehüllflächen. Im Einzelnen bedeutet dies für die Außenwandflächen, dass sich durch eine nachträglich aufgebrachte Fassadendämmung an der Hof- und Nordwestfassade der Heizenergieverbrauch jährlich um ca. 13,5 MWh senken lässt. Erforderlich dafür sind Dämmmaßnahmen in einer Mindeststärke von 120 mm, die in Verbindung mit einem Wärmedämmverbundsystem angebracht werden können. Unter Einbeziehung der vorgeschlagenen Maßnahmen kann für den möglichen Fassadenaufbau nach der Sanierung ein U-Wert von 0,22 W/m²K angestrebt werden. Erhöhte Aufmerksamkeit erfordert die dem historischen Vorbild nachempfundenen Fassadenprofilierung der Haupteingangssituation von der Wiesenburger Straße, die sich über die gesamte Fassadenhöhe erstreckt sowie die Fassadengestaltung der zum Markt hin orientierten Giebelfassade. Um in diesen Bereichen eine aufwendige Nachbildungen der Schmuckelemente zu vermeiden, da dies aus denkmalpflegerischer Sicht auch nicht gewünscht wird, bleiben diese Fassadenbereich von der Fassadendämmung unberührt. Würde der denkmalpflegerische Aspekt vernachlässigt werden und die Gesamtheit der Außenwandflächen mit einem durchgängigen Vollwärmeschutz versehen werden, können sogar Energieeinsparungen in einer Größenordnung von etwa 34 MWh im Jahr ermöglicht werden. Weitere Minderungspotenziale bestehen in der energetischen Sanierung der Dachflächen. Damit verbunden sind erforderliche Dämmmaßnahmen der Dachschrägen in den beiden Dachgeschossebenen und die Dämmung der obersten Geschossdecke zum unbeheizten Dachraum. Daraus lassen sich rechnerisch jährliche Einsparpotenziale von bis zu 11 MWh nachweisen. Der Austausch der Fenster und Außentüren führt zu einer weiteren Reduktion des Energiebedarfs um ca. 6 MWh/a. Dabei müssen ebenfalls die denkmalpflegerischen 127
130 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Anforderungen beachtet werden und bei der Planung und Ausführung der neuen Elemente Berücksichtigung finden, um dem historischem Vorbild gerecht zu werden. Zusammenfassend betrachtet lassen sich mit den dargestellten baukonstruktiven Maßnahmenempfehlungen im Hinblick auf die Wärmeversorgung des Gebäudes Einsparungen von ca. 31 MWh pro Jahr umsetzen. Die vergleichsweise geringen Potenziale liegen maßgeblich in den Vorgaben, die sich aus den Denkmalschutzanforderungen ableiten und dem nachvollziehbaren Wunsch das historische Altstadtbild von Bad Belzig zu schützen und zu erhalten, begründet. Maßnahmen Gebäudetechnik Durch modulierende Gas-Brennwertkessel lässt sich die Primärenergie besser ausnutzen und der Jahresnutzungsgrad durch Verringerung von Brennstarts erhöhen. Weitere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung befinden sich in dem Austausch der Standard-Heizungspumpen gegen drehzahlregelbare Hocheffizienzpumpen und bedarfsgerechte Regelung mit einhergehendem hydraulischen Abgleich des Wärmeverteilnetzes. Somit lässt sich der Stromverbrauch für die Umwälzung des Heizungswassers deutlich senken. Auf Grund der schlechten Dämmung der Heizungsrohre und Armaturen im unbeheizten und gerade im Bereich des Heizungskellers ist eine Neudämmung des Wärmeverteilnetzes und Armaturen nach EnEV 2009 anzuraten. Durch die Installation von Einzelraumregelungen in Verbindung mit motorisch betrieben Heizkörperventilen und Fensterkontakten lassen die unkontrollierte Lüftungsverluste durch Fensterlüftung deutlich reduzieren. Im Bereich der Beleuchtungstechnik ist der Austausch der Beleuchtungstechnik und Umrüstung auf CCFL- und LED-Leuchten sinnvoll. In Verbindung mit einer bedarfsgerechten Lichtsteuerung kann der Stromverbrauch für die Beleuchtung weiter gesenkt werden. 128
131 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Ergebnisse Tabelle 49 zeigt die möglichen Einsparpotenziale. Zu beachten ist, dass es bei den ermittelten Werten um eine Grobanalyse handelt. Die ermittelten Werte wurden mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten berechnet beinhalten jedoch eine Abweichung +/- 20 %. Maßnahmen Energieeinsparung CO 2 - Einsparung Investition Amortisation kwh/a 3,1 t/a EUR 26 a* Dachdämmung kwh/a 2,6 t/a EUR 20 a* Austausch Fenster kwh/a 1,4 t/a EUR 83 a* Fassadendämmung Einzelraumregelung Brennwerttechnik, Optimierung Hydraulik, Dämmung Leitung Austausch Beleuchtung kwh/a 5,1 t/a EUR 10 a* kwh/a 5,4 t/a EUR 8 a* 7.400kWh/a 3,6 t/a EUR 8 a** Tabelle 49: Einsparung Rathausgebäude Die nachfolgende Abbildung 93 zeigt den spezifischen Heizenergieverbrauch bezogen auf die Netto-Grundfläche. Der obere Pfeil zeigt den derzeitigen Verbrauchwert aus den gemittelten Energieverbräuchen aus den letzten drei Jahren. Der untere Pfeil zeigt den möglichen spezifischen Verbrauchswert bei Umsetzung aller beschriebenen Maßnahmen. Diese Grafik dient somit nur als Veranschaulichung der Energieverbräuche und ersetzt nicht den bedarfsorientierten Energieausweis nach DIN V Heizenergiekennwert CO 2 Emission 36 kg/(m² * a) 159 Nach Sanierung 102 kwh/m²a CO 2 Emission 23 kg/(m² * a) Abbildung 93: Heizenergiekennwerte Rathausgebäude 129
132 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Kindertagesstätte 1 (Hauptgebäude) Anschrift: Puschkinstraße Bad Belzig Gebäudekennwerte: Baujahr: 1950 Nutzung: Kindertagesstätte Zustand: teilsaniert BGF: 296 m² KGF: 50 m² NGF: 245,7 m² BRI: 887 m³ Etagenanzahl: 1 Kellergeschoss: teilunterkellert Abbildung 94: Ansicht Kindertagesstätte 1 Energieversorgung: Heizungsanlage: Buderus G-224 L Baujahr: 1991 Energieträger: Erdgas Leistung: 45 kw Verbrauchserfassung: Heizung kwh kwh kwh Strom kwh kwh kwh Tabelle 50: Verbräuche Kindertagesstätte 1 130
133 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Gebäudesubstanz Die Kindertagesstätte in der Puschkinstraße ist ein eingeschossiger Langbau, der über jeweils einen Zugang an den Giebelfassaden erschlossen wird. In den Kellerräumen befinden sich Heizungsanlage und Lagerflächen. In Teilbereichen der Kellerräume sind Feuchtebelastungen im Mauerwerk sichtbar. Nach einem Brand wurden 1994 die beschädigten Teile des Dachstuhls und die gesamte Dachdeckung (Warmdach) erneuert. Der Dachraum blieb aber ungedämmt. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurden die Außenwandflächen mit Ausnahme der Sockelflächen mit einer 6 cm starken mineralischen Dämmung und einer zweilagigen Putzschicht versehen. Die Bestandsfenster (Holzrahmen) mit Einscheibenverglasung sind bisher unsaniert. Bei dem westlich gelegenen Zugang ist nach dem Austausch der Eingangstür eine mangelhafte Ausführung (Bauschaum, unverputzte Bauteilanschlüsse) erkennbar. Des Weiteren sind auf der östlichen Giebelfassade deutlich Rissbildungen im Mauerwerk oberhalb Eingangstür sichtbar, die sich im WDVS fortsetzen Bestandsbeschreibung Anlagentechnik Die Wärmversorgung erfolgt durch einen Erdgas- Heizkessel mit einer Nennwärmeleistung von 45 kw. Der Wärmeerzeuger wurde ca errichtet. Die ca. 20 Jahre alte Kesselanlage befindet sich nicht auf dem Stand der Technik und ist sanierungsbedürftig. Die Wärmeabgabe an die Räume erfolgt durch profilierte Flachheizkörper. Die Heizflächen im Waschbereich haben deutliche Spuren von Rostansatz. Eine zentrale Trinkwasser Erwärmung ist nicht installiert. Die Beleuchtungsanlage wie Trägersystem und Leuchtmittel weisen einen sanierungsbedürftigen Zustand auf. Abbildung 95: Waschraum Kindertagesstätte 1 Abbildung 96: Wärmeerzeuger Kindertagesstätte 1 131
134 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Potenzialanalyse Bauliche Maßnahmen Das Gebäude der Kindertagesstätte bietet aufgrund der überschaubaren Größe des Objektes verbunden mit der kompakten Gebäudekubatur aus baukonstruktiver Sicht nur bedingt Optimierungsreserven. Beginnend mit der Erneuerung der Fassadendämmung und der Verwendung eines neuen Vollwärmeschutzes mit einer 120 mm starken Dämmebene. Daraus lassen sich rechnerisch Einspareffekte mit bis zu 2,8 MWh im Jahr ableiten. Im Rahmen dieser Maßnahmen wird zugleich der Austausch der veralteten Fenster gegen isolierverglaste Elemente empfohlen, um mit einem verbesserten Wärmedurchgangskoeffizienten von 1,3 W/m²K Energieeinsparungen von jährlich 8 MWh nutzen zu können. Erweitert auf die Dachflächen bedeutet eine energetische Sanierung die Dämmung der gesamten oberen Geschossdecke bzw. die Dämmung des Dachstuhls in Verbindung mit der Erneuerung der Dachdeckung und mit der Zielsetzung eine Minderung des Heizenergiebedarfes von rund 4 MWh zu erzielen. Den Maßnahmen vorangestellt wird empfohlen die Gebäudesubstanz eingehender zu untersuchen, um unter anderem die Ursachen der Schadensbilder im Fassadenbereich (Rissbildung) aufzuklären. Maßnahmen Gebäudetechnik Durch modulierende Gas-Brennwertkessel lässt sich die Primärenergie besser ausnutzen und der Jahresnutzungsgrad durch Verringerung von Brennstarts erhöhen. Weitere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung befinden sich in dem Austausch der Standard-Heizungspumpen gegen drehzahlregelbare Hocheffizienzpumpen und bedarfsgerechte Regelung und einhergehendem hydraulischen Abgleich des Wärmeverteilnetzes. Somit lässt sich der Stromverbrauch für die Umwälzung des Heizungswassers deutlich senken. Durch die Installation von Einzelraumregelungen in Verbindung mit motorisch betriebenen Heizkörperventilen und Fensterkontakten lassen sich die unkontrollierte Lüftungsverluste durch Fensterlüftung deutlich reduzieren. Im Bereich der Beleuchtungstechnik ist der Austausch eine Umrüstung auf CCFL- und LED- Leuchten sinnvoll. In Verbindung mit einer bedarfsgerechten Lichtsteuerung kann der Stromverbrauch für die Beleuchtung weiter gesenkt werden. Ergebnisse Tabelle 51 zeigt die möglichen Einsparpotenziale. Zu beachten ist, dass es bei den ermittelten Werten um eine Grobanalyse handelt. Die ermittelten Werte wurden mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten berechnet beinhalten jedoch eine Abweichung +/- 20 %. 132
135 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Maßnahmen Energieeinsparung CO 2 - Einsparung Investition Amortisation kwh/a 0,6 t/a EUR 75 a* Dachdämmung kwh/a 0,9 t/a EUR 25 a* Austausch Fenster kwh/a 1,8 t/a EUR 12 a* Fassadendämmung Einzelraumregelung Brennwerttechnik, Optimierung Hydraulik, Austausch Beleuchtung kwh/a 2,4 t/a EUR 17 a* kwh/a 1,0 t/a EUR 12 a* 2.000kWh/a 0,9 t/a EUR 10 a** Tabelle 51: Einsparung Kindertagesstätte Die nachfolgende Abbildung 97 zeigt den spezifischen Heizenergieverbrauch bezogen auf die Netto-Grundfläche. Der obere Pfeil zeigt den derzeitigen Verbrauchwert aus den gemittelten Energieverbräuchen aus den letzten drei Jahren. Der untere Pfeil zeigt den möglichen spezifischen Verbrauchswert bei Umsetzung aller beschriebenen Maßnahmen. Diese Grafik dient somit nur als Veranschaulichung der Energieverbräuche und ersetzt nicht den bedarfsorientierten Energieausweis nach DIN V Heizenergiekennwert CO 2 Emission 51 kg/(m² * a) 228 Nach Sanierung 97 kwh/m²a CO 2 Emission 22 kg/(m² * a) Abbildung 97: Heizenergiekennwert Kindertagesstätte 133
136 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Jugendfreizeitzentrum POGO Anschrift: Berliner Straße Bad Belzig Gebäudekennwerte: Baujahr: 1925, 1993 Nutzung: Jugendfreizeitzentrum Zustand: teilsaniert BGF: 793 m² KGF: 175 m² NGF: 617 m² BRI: 695 m³ Etagenanzahl: 4 Kellergeschoss: unterkellert Abbildung 98: Ansicht Jugendfreizeitzentrum POGO Energieversorgung: Heizungsanlage: Öl-Heizkessel Typ: Viessmann vitola uniferral Baujahr: 1992 Energieträger: Heizöl Leistung: 43 kw Verbrauchserfassung Heizung (Öl) l 3500 l Strom kwh kwh Tabelle 52: Verbräuche Jugendfreizeitzentrum POGO 134
137 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Gebäudesubstanz Die Jugendfreizeiteinrichtung POGO befindet sich in einem freistehenden, villenartigen Gebäude südöstlich des historischen Stadtkerns. Auf drei Vollgeschossen (inkl. vollausgebautem Kellergeschoss) und einem ausgebauten Dachgeschoss werden Freizeitmöglichkeiten angeboten vom Musikproberaum, Billardraum bis hin zum Mehrzweckraum für Filmvorführungen. Im Obergeschoss werden einzelne Räume als Büros der Verwaltung genutzt. Der Mauerwerksbau präsentiert sich nach außen mit einer Ziegeloptik auf einem verputzten Gebäudesockel. Dreiseitig gliedern horizontal verlaufende Putzbänder die Fassadenansicht. Die Außenwandflächen sind aufgrund des Erscheinungsbildes bisher ungedämmt belassen worden. Vereinzelt sind außenseitig im Bereich des Gebäudesockels Farblösungen und Putzverfärbungen, vermutlich feuchtebedingt, erkennbar. Im Zuge der 1993 durchgeführten Maßnahmen wurde umlaufend eine Drainage eingebracht und die Bauwerksabdichtung der erdberührten Außenwandflächen erneuert. Die Fensteranlagen bestehen aus holzgerahmten Doppelkastenfenstern mit Einscheibenverglasung. Der Abstand der Verglasung variiert in einzelnen Räumen zum einen in der Ausführung als Verbundkastenfenster und geschlossenem Scheibenzwischenraum bzw. in der Variante als zwei voneinander getrennten Fensterelementen mit einem Zwischenraum in der Tiefe der Fensterlaibung. In der letztgenannten Variante wurden teilweise nachträglich Jalousien als Sonnenschutz eingebracht. In der Umbauphase 1993 wurde entsprechend der Nutzung als öffentlich zugängliche Freizeiteinrichtung eine Aufzugsanlage integriert und die Sanitäreinrichtungen erneuert und barrierefrei gestaltet. Zudem sind die Dachflächen erneuert und gedämmt und zur Nutzung des Dachbodens als Aufenthaltsbereich Dachfenster mit Isolierverglasung eingebaut worden. Abbildung 100: Dachfenster Jugendfreizeitzentrum POGO Abbildung 101: Außenwand Jugendfreizeitzentrum POGO Abbildung 99: Fenster Jugendfreizeitzentrum POGO 135
138 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Anlagentechnik Die Wärmeversorgung des Objektes erfolgt durch einen Niedertemperatur-Ölkessel. Die Kesselanlage ist ca. 20 Jahre alt. Durch einen neben stehenden 200 Liter Trinkwasserspeicher erfolgt die zentrale Warmwasserversorgung. Im Objekt sind zum Großteil Rasterdecken-Leuchten mit T5 Leuchtmitteln installiert. Im Dachgeschoß sind einflammige Langfeldleuchten, ebenfalls mit T5 Leuchtmittel verbaut. Einsparpotenziale durch den Einsatz von LED oder CCFL Leuchten sind dennoch vorhanden. Für Veranstaltungen gibt es zusätzlich Beleuchtungsanlagen welche bei Bedarf aufgebaut und betrieben wird. Abbildung 102: Wärmeerzeuger Jugendfreizeitzentrum POGO Abbildung 103: Heizöl Tanks Jugendfreizeitzentrum POGO Potenzialanalyse Bauliche Maßnahmen Vor dem Hintergrund, das äußere Erscheinungsbild der eindrucksvollen Stadtvilla nicht zu beeinträchtigen, wird für den Sanierungsfall des Jugendfreizeitzentrums der Einsatz einer Außenwanddämmung an der Innenseite der Fassade vorgeschlagen. Hier können mehrere Produkte und Materialien in Bezug auf Wärmeleitfähigkeit, Verarbeitung, nachträgliche Beschichtungsaufwendungen, benötigte Materialstärken, hygrothermische Auswirkungen auf die Wandkonstruktion und Kosten vergleichend herangezogen werden. Unter anderem können Perlitewerkstoffe, Gipsverbundplatten mit Dämmstoff und Dampfsperre sowie Werkstoffe auf Aerogelbasis in Betracht gezogen werden. Letztere besitzen eine geringe Wärmeleitfähigkeit und können dadurch mit geringeren Schichtstärken verwendet werden, verursachen jedoch erheblich höhere Kosten. Perlitewerkstoffe lassen sich gut verarbeiten, benötigen aber aufgrund der höheren Wärmeleitfähigkeit größere Schichtdicken in der Anwendung, was zu Raumverlusten führen würde. Außerdem steigt der Nachbeschichtungsaufwand durch erforderliche Armierungs- und Putzarbeiten. Für die Innenwanddämmung des Jugendfreizeitzentrums POGO wurde in den weiteren Untersuchungen die Verwendung von Gipsverbundplatten mit Dämmstoff berücksichtigt. Diese sind leicht zu verarbeiten, vorgefertigte systemgleiche Laibungsdämmplatten und Dämmkeile erlauben die Weiterführung der Dämmung an angrenzenden Bauteilen wie z. B. Fensterlaibungen und Decken. Außerdem ist eine Endbeschichtung mit Farbe oder Tapete ohne großen Vorbereitungsaufwand möglich. Die Wärmeleitfähigkeit einer 93 mm starken Verbundplatte mit integrierter Dampfbremsfolie liegt bei 0,032 W/(mK). Auf dieser Grundlage 136
139 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude lassen sich durch das Anbringen einer Innenwanddämmung Reduzierungen im Heizwärmebedarf von bis zu 16 MWh im Jahr erzielen. Ergänzend zu den Maßnahmen an den Außenwandflächen erscheint es sinnvoll die Fensterelemente der Jugendfreizeiteinrichtung in diesem Zuge ebenfalls zu sanieren und mit Isolierverglasungen und neuen Fensterrahmen nach dem Bestandsvorbild auszustatten. In Verbindung mit der Innenwanddämmung ergibt sich somit der Vorteil, dass sich die Anschlussbereiche technisch korrekt ausführen lassen. Ausgehend von den zugrunde gelegten Dämmeigenschaft der bestehenden Doppelkastenfenster und dem verhältnismäßig geringen Fensterflächenanteil können durch die Umsetzung dieser Maßnahmen Einsparungseffekte in einer Größenordnung von 4,2 MWh erreicht werden. Demgegenüber stehen natürlich die damit verbundenen Investitionsaufwendungen. Unter Berücksichtigung der hier angeführten Sanierungsabsichten erscheinen diese aufgrund der Nachbildung der zum Teil aufwendigen Holzrahmen oder beispielsweise der Ertüchtigung der Bleiverglasung im Treppenraum des Hauses in einem Kosten-Nutzen-Vergleich eher unwirtschaftlich. Im Bereich der Dachflächen sind ausgehend von der Untersuchung des Bestandes nur geringe Minderungspotenziale zu erwarten. Mit den Sanierungsmaßnahmen im Jahr 1993 wurde eine Dachdämmung mit 120 mm Stärke eingebracht. In einer Betrachtung auf der Grundlage der aktuell geltenden Vorgaben ergibt sich zur Einhaltung der EnEV- Anforderungen eine erforderliche Dämmstärke von mindestens 140 mm. Damit verbunden ist eine Energieeinsparung von ca. 870 kwh/a. Aufgrund der geringen Abweichung zwischen dokumentierter Bestandssituation und angeführter Sanierungsempfehlung ist die Notwendigkeit dieser Teilmaßnahme unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten genauer zu betrachten und zu bewerten. Maßnahmen Gebäudetechnik Der ermittelte spezifische Heizungsverbrauchskennwert von 39 kwh/a ist sehr gering. Für dieses Objekt scheint dieser Wert zu gering. Potenziale im Bereich der Wärmerzeugungsanlagen und des Wärmeverteilnetz sind auf Grund der 20 Jahre alten Öl-Heizung vorhanden. Eine Installation eines Holzpellet-Kessels bietet sich auf Grund der gegebenen Platzverhältnissen und relativ geringen Heizlast gut an. Dadurch lässt sich die Kohlendioxid-Emission um ca kg/a senken. Grundlage der Berechnung bildet dabei der angegebene jährliche Öl-Verbrauch. Durch einen Austausch der Beleuchtung gegen CCFL- oder LED-Leuchtmittel lässt sich der Stromverbrauch um ca kwh/a senken. Das entspricht einer CO 2 -Einsparung von ca. 500 kg/a. 137
140 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Gemeindehaus Bergholz Anschrift: Dorfanger Bad Belzig (Ortsteil Bergholz) Gebäudekennwerte: Abbildung 104: Ansicht Gemeindehaus Bergholz Baujahr: 1978 Nutzung: Wohn-/ Geschäftshaus Zustand: saniert BGF: 209 m² KGF: 35 m² NGF: 174 m² BRI: m³ Etagenanzahl: 2 Kellergeschoss: unterkellert Energieversorgung: Heizungsanlage: Gas-Öl Heizkessel Typ: Buderus S 115 U Baujahr: 1992 Energieträger: Heizöl Leistung: 17 kw Verbrauchserfassung: Heizung (Öl) l l l Strom 940 kwh 848 kwh kwh Tabelle 53: Verbräuche Gemeindehaus Bergholz 138
141 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Gebäudesubstanz Das am Dorfanger gelegene Gemeindehaus des Ortsteils Bergholz ist in der Bauweise eines Wohnhauses 1978 errichtet worden und wird momentan als Versammlungsunterkunft für öffentliche und private Veranstaltungen genutzt. Das Hauptgeschoss (Hochparterre) gliedert sich zu diesen Zwecken in zwei voneinander abtrennbare Aufenthaltsbereiche mit angrenzender Küche und den erforderlichen Sanitäranlagen. Ein weiterer Raum ist für Büronutzung vorgesehen, wird aber momentan zu Abstell- / Lagerzwecken genutzt. Im teilunterkellerten Bereich befindet sich die Heizungsanlage mit Öltanklager und daran angrenzend ein weiterer Aufenthaltsraum, der als Jugendtreff der Gemeinde dient. Die Flächen unterhalb des Satteldaches werden über eine innenliegende Treppe erschlossen. Die straßenseitigen Fenster sowie die Eingangstüren wurden bereits erneuert und gegen Kunststofffenster mit Isolierverglasung (U-Wert = 1,1 W/(m²K)) ausgetauscht. Die Holzrahmen Kippflügel auf der Gebäuderückseite sind noch im Bestand belassen. Die Außenwandflächen des Gebäudes sind nicht gedämmt. Abbildung 105: Küchenfenster Gemeindehaus Bergholz Bestandsbeschreibung Anlagentechnik Das Gebäude wird über eine ca. 20 Jahre alte Ölheizung mit einer Leistung von 17 kw beheizt. Die Trinkwassererwärmung erfolgt über dezentrale elektrische Warmwasserbereiter. Augenscheinlich weist die Anlagen keinen dringenden Handlungsbedarf auf. Eine Umrüstung auf Brennwerttechnik aufgrund des Alters der Kesselanlage ist sinnvoll. Als Beleuchtung dienen einfach Pendelleuchten ohne Reflektoren. Als Leuchtmittel wurden kompakte Leuchtstofflampen installiert. Abbildung 106: Heizanlage Gemeindehaus Bergholz Abbildung 107: Beleuchtung Gemeindehaus Bergholz 139
142 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Potenziale Bauliche Maßnahmen Mit der Umnutzung und dem einhergehenden Umbau des Gebäudes zum Gemeindehaus des Ortsteils Bergholz wurden neben den Sanierungsarbeiten in den Innenräumen des Erdgeschosses lediglich die Fenster der Fassadenseiten zum Dorfanger und zur Teichstraße erneuert. Dies sollten auch auf die verbleibenden Bestandfenster angewandt werden. Ergänzend dazu sollten die Fassadenflächen mit einem Vollwärmeschutz versehen werden. Auf der Grundlage der bekannten Bestandsunterlagen können die Anforderungen gemäß Energieeinsparverordnung 2009 mit einer 140 mm starke Fassadendämmung eingehalten und durch die Umsetzung dieser Maßnahmen eine Minderung des Energieverbrauches von ca. 5 MWh jährlicher erreicht werden. Daran anknüpfend kann es als sinnvoll erachtet werden, die obere Geschossdecke zum unbeheizten Dachraum ebenfalls zu dämmen. Daraus lassen sich rechnerisch Energieeinsparpotenziale von bis zu 5,5 MWh pro Jahr ableiten. Ergebnisse Tabelle 54 zeigt die möglichen Einsparpotenziale. Zu beachten ist, dass es bei den ermittelten Werten um eine Grobanalyse handelt. Die ermittelten Werte wurden mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten berechnet, beinhalten jedoch eine Abweichung +/-20 %. Maßnahmen Fassadendämmung Energieeinsparung CO 2 - Einsparung Investition Amortisation kwh/a 1,5 t/a EUR 36 a* Dachdämmung kwh/a 1,8 t/a EUR 10 a* Brennwerttechnik, Optimierung Hydraulik, Austausch Beleuchtung kwh/a 0,4 t/a EUR 24 a* 145 kwh/a 0,1 t/a EUR 45 a** Tabelle 54: Einsparungen Gemeindehaus Bergholz Die nachfolgende Abbildung 108 zeigt den spezifischen Heizenergieverbrauch bezogen auf die Netto-Grundfläche. Der obere Pfeil zeigt den derzeitigen Verbrauchwert aus den gemittelten Energieverbräuchen aus den letzten drei Jahren. Der untere Pfeil zeigt den möglichen spezifischen Verbrauchswert bei Umsetzung aller beschriebenen Maßnahmen. Diese Grafik dient somit nur als Veranschaulichung der Energieverbräuche und ersetzt nicht den bedarfsorientierten Energieausweis nach DIN V
143 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Heizenergiekennwert CO 2 Emission 31 kg/(m² * a) 102 Nach Sanierung 40 kwh/m²a CO 2 Emission 13 kg/(m² * a) Abbildung 108: Heizenergiekennwerte Gemeindehaus Bergholz 141
144 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Kindertagesstätte Lütte (Hauptgebäude) Anschrift: Am Martinsberg Bad Belzig (Ortsteil Lütte) Gebäudekennwerte: Baujahr: 1920, 2003 Nutzung: Kindertagesstätte Zustand: saniert BGF: 755 m² KGF: 269 m² NGF: 486 m² BRI: m³ Etagenanzahl: 2 Kellergeschoss: teilunterkellert Abbildung 109: Ansicht Kindertagesstätte Lütte Energieversorgung: Heizungsanlage: Flüssiggas Typ: Buderus Junomat S 315 Baujahr: 1991 Energieträger: Flüssiggas Leistung: 35 kw Verbrauchserfassung Es liegen keine Daten zur Verbraucherfassung der Wärme- und Stromversorgung vor Bestandsbeschreibung Gebäudesubstanz Die Kindertagesstätte im Ortsteil Lütte besteht aus mehreren Gebäudeteilen unterschiedlicher Bauzeit. Die Altbausubstanz wurde im Jahr 1920 als zweigeschossiger Mauerwerksbau mit einem Satteldach errichtet. Dieser wurde später um einen ersten Anbau auf der Südfassade ergänzt. Im Zuge einer Erweiterung und Sanierung des Objektes 2003 entstand ebenfalls auf der südlich orientierten Fassadeseite ein zweiter Erweiterungsanbau über beide Etagen und an der Nordfassade ein neuer Eingangsbereich mit zusätzlichem Treppenhaus als Haupterschließungseinheit der Kindertagesstätte. Beide Anbauten wurden mit Mauerwerk aus Dämmziegeln hergestellt. Die Sanierungsmaßnahmen umfassten des Weiteren die Fassadendämmung des Bestandsgebäudes sowie den Einbau neuer Holzrahmenfenster und Türelemente mit 2-Scheibenisolierverglasung. Mit dem Ausbau des Dachraumes werden entsprechende Dämmmaßnahmen angenommen genauere Aussagen zu Materialität und Aufbaustärken konnten leider im Zuge der Bestandsuntersuchungen nicht dokumentiert werden. 142
145 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude In einem weiteren Bauabschnitt wurde in den letzten Jahren entsprechend den Brandschutzanforderungen an den südlichen Erkerneubau eine Fluchttreppenkonstruktion montiert Potenziale Bauliche Maßnahmen Im Rahmen der Objektuntersuchung und Begehung konnte ein sehr guter Zustand und auch keine offensichtlichen Mängel dokumentiert werden. Auf der Basis der zu Grunde gelegten Annahmen zur Gebäudesubstanz der Kindertagesstätte Lütte ergeben sich aus baulicher Sicht vorrangig Minderungspotenziale im Bereich der Fassadendämmung der 2003 errichteten Gebäudeteile. Das 36,5 cm starke Mauerwerk aus Porotonziegeln entspricht in der Dämmwirkung nicht den aktuellen Wärmeschutzanforderungen und müsste folglich um eine zusätzliche Fassadendämmung mit einer Mindeststärke von mm ergänzt werden. Ähnliche Bestimmungen ergeben sich für die Fassadendämmung des Altbaubestandes. Diese erhöhten Anforderungen wirken sich auch auf die 2003 verbauten Fenster- und Türelemente aus. Da sich die Werte des maximal zulässigen Wärmedurchgangskoeffizienten nach aktueller Energieeinsparverordnung für außen liegende Fenster und Fenstertüren auf 1,3 W/(m²K) reduziert haben, ist davon auszugehen, dass die entsprechenden transparenten Bauteile im Gebäude diese Grenzwerte nicht erfüllen. Bezüglich der Dachdämmung konnten wie bereits in der Bestandsbeschreibung erwähnt keine genauen Angaben in Erfahrung gebracht werden. Begründet in der Annahme, dass die Bauteile der Dachflächen ebenfalls den zur Bauzeit geltenden Bestimmung entsprachen und sich diese Anforderungswerte nach geltender EnEV 2009 ebenfalls verschärft haben, wird unterstellt, dass auch hier erhöhte Dämmstärken bzw. verbesserte Dämmmaterialien erforderlich werden, um die vorgegebenen Grenzwerte einhalten zu können. Zusammenfassend betrachtet, stellen die angeführten Sanierungsvorschläge Minderungspotenziale des Heizenergiebedarfs in Aussicht, die auf einer Betrachtungsweise rein nach energetischen Bewertungskriterien basieren. Wird der Kosten-Nutzen-Aspekt in die Betrachtung einbezogen, stellt sich die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen in einem anderen Blickwinkel dar. Aus diesem Grund werden detailliertere Bestanduntersuchungen notwendig, um eine Aussage über Wirtschaftlichkeit und Amortisation einzelner Maßnahmen treffen zu können. 143
146 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Gemeindehaus Neschholz Anschrift: Neschholz Bad Belzig (Ortsteil Neschholz) Gebäudekennwerte: Baujahr: 1911, 2000 Nutzung: Verwaltungsgebäude Zustand: saniert BGF: 362 m² KGF: 68 m² NGF: 293 m² BRI: m³ Etagenanzahl: 2 Kellergeschoss: Abbildung 110: Ansicht Gemeindehaus Neschholz Energieversorgung: Heizungsanlage: Energieträger: Elektrospeicheröfen Strom Verbrauchserfassung: Heizung (Strom) kwh kwh kwh Strom kwh kwh kwh Tabelle 55 Verbräuche Gemeindehaus Neschholz 144
147 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Bestandsbeschreibung Gebäudesubstanz Das an der Dorfstraße gelegene Gebäude im Ortsteil Neschholz wurde 1911 vermutlich als Wohngebäude errichtet. Für die derzeitige Nutzung als Gemeindehaus wurde das Erdgeschoss des Gebäudes im Jahr 2000 umgebaut und saniert. So entstanden zwei Versammlungs- und Schulungsräume mit angrenzendem Küchenbereich und Büro sowie der zugehörige Sanitärbereich. Im Dachgeschoss werden derzeit weitere Umbaumaßnahmen durchgeführt hier soll eine Wohneinheit entstehen. Das Gebäude wurde als unverputzter Mauerwerksbau errichtet. Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen wurde auf Dämmmaßnahmen der Fassadenflächen zugunsten des äußeren Erscheinungsbildes (Sichtmauerwerk) verzichtet. Ebenfalls wurden die Doppelfenster mit Einscheibenverglasung erhalten und aufgearbeitet. Lediglich im Innenraum des Gemeindehauses wurden Wand- und Bodenflächen aufwendig saniert und befinden sich auch aktuell in einem sehr guten Zustand. Der hölzerne Dachstuhl ist als Satteldach mit einer Neigung von ca. 43 ausgebildet. In Teilen wurde der Dachstuhl zusammen mit der Sanierung der Dachdeckung erneuert und im Zuge der Umbaumaßnahmen zu Wohnzwecken entstand auf der Hofseite eine Gaube. Die Fensterelemente des Dachgeschosses sind ebenfalls bereits gegen isolierverglaste Kunststofffenster ausgetauscht worden. Es ist davon auszugehen, dass mit dem Ausbau zur Wohneinheit die Dachflächen mit einer Zwischensparrendämmung in der erforderlichen Stärke versehen und die notwendigen Maßnahmen zur Luftdichtigkeit durchgeführt werden, um den Anforderungen an die Energieeffizienz zu entsprechen. Abbildung 111: Fenster Gemeindehaus Neschholz Abbildung 112: Dachstuhl Gemeindehaus Neschholz Bestandsbeschreibung Anlagentechnik Die Wärmeversorgung des Objektes erfolgt durch elektrische Nachspeicheröfen. Diese nutzen den Niedertarifstrom der Nacht um das Gebäude zu beheizen. Diese Technologie zur Beheizung nutzt zwar günstigeren Strom, jedoch emittiert diese Art der Beheizung fast doppelt so viel CO 2 pro kwh wie eine Gasheizung. Die Beleuchtungsanlage mit Pendel-Langfeldleuchten und T5 Leuchtmittel weist keinen dringenden Handlungsbedarf auf. 145
148 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Abbildung 113: Nachtspeicherofen Gemeindehaus Neschholz Potenzialanalyse Bauliche Maßnahmen Aufgrund des augenscheinlich guten Zustandes des Objektes und der zeitnah bzw. derzeit durchgeführten Sanierungsmaßnahmen, bietet die Gebäudesubstanz nahezu keine Ansatzpunkte für weitere Sanierungsempfehlungen, die auch wirtschaftlich vertretbar sind. Würde man letzteres außer Acht lassen, besteht bei dem Gebäude die Möglichkeit Dämmmaßnahmen an den Fassadenflächen durchzuführen. Um das äußere Fassadenbild nicht zu beeinträchtigen, würde man hier auf eine Innendämmung der Außenwandflächen zurückgreifen. Des Weiteren kann der Austausch der Fensterelemente im Erdgeschoss in Betracht gezogen werden. Da es sich um einen eher geringen Fensterflächenanteil handelt, werden auch die zu erwartenden Energieeinsparungen, die aus dieser Maßnahme resultieren eher gering ausfallen. Maßnahmen Gebäudetechnik Eine sinnvolle Maßnahme ist die Umrüstung der Wärmeversorgung von Elektrospeicheröfen auf Brennwerttechnik. Als Energieträger kann Flüssiggas eingesetzt werden. Trotz der relativ neuen Beleuchtungstechnik gibt es auch hier Einsparpotenziale. Durch Umrüstung auf LED- oder CCFL-Beleuchtung und bedarfsgerechter Lichtsteuerung lässt sich der Stromverbrauch für die Beleuchtung weiter senken. Ergebnisse Durch Umrüstung der Wärmeerzeugungsanlage auf Flüssiggas lassen sich ca kg CO 2 pro Jahr einsparen. Durch den Einsatz von Biomasse lässt sich dieser Wert nochmals drastisch senken. Die nachfolgende Abbildung 114 zeigt den spezifischen Heizenergieverbrauch bezogen auf die Netto-Grundfläche. Der obere Pfeil zeigt den derzeitigen Verbrauchwert aus den gemittelten Energieverbräuchen aus den letzten drei Jahren. Der untere Pfeil zeigt den möglichen spezifischen Verbrauchswert bei Umsetzung aller beschriebenen Maßnahmen. Diese Grafik dient somit nur als Veranschaulichung der Energieverbräuche und ersetzt nicht den bedarfsorientierten Energieausweis nach DIN V
149 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Heizenergiekennwert CO 2 Emission 57 kg/(m² * a) 236 Nach Sanierung 236 kwh/m²a CO 2 Emission 31 kg/(m² * a) Abbildung 114: Heizenergiekennwerte Gemeindehaus Neschholz 147
150 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Sondermaßnahme Wärmeverbundnetz Schulgelände Durch einen Zusammenschluss der Geschwister-Scholl-Grundschule, der 3-Feld-Sporthalle und der Krause-Tschetschog-Oberschule zu einem Nahwärmeverbund kann eine effiziente Wärmeversorgungsanlage mit Kraft-Wärme-Kopplung installiert werden. Die Grundlast kann dabei von einem Gas-Blockheizkraftwerk, die Mittellast eine Holzpellet-Kesselanlage und die Spitzenlast einen Gasbrennwertkessel übernommen werden. Somit kann eine effiziente, umweltfreundliche und wirtschaftlich optimierte Wärmeversorgung auf dem Schulgelände am Weitzgrunder Weg sichergestellt werden. Wie in der nachfolgenden Abbildung zu erkennen ist, bietet sich der alte Heizraum zur Errichtung der Energiezentrale an. Von dort aus können alle drei Hauptgebäude relativ einfach erschlossen werden. Zu sehen ist auch eine mögliche Leitungsführung zur Anbindung der drei Gebäude. Ein Anschluss des Ganztagsgebäudes am südlichen Ende des Areals an das Nahwärmenetz scheint auf Grund der schwierigen/ langen Anbindeleitung und der geringen Heizlast wirtschaftlich nicht sinnvoll, technisch ist es jedoch denkbar. Für die Änderung der Versorgung der Häuser müssen keine großen Änderungen an den bestehen Hydraulik der Gebäude vorgenommen werden. An Stelle der Heizkessel wird einen Plattenwärmetauscher hydraulisch angebunden. Somit würde ein indirektes Nahwärmenetz entstehen. In den Gebäuden ist der Installationsaufwand sehr gering. Lediglich die Nahwärmeleitungen müssen in die bestehenden Heizzentralen der Häuser geführt werden. Mögliche Abstufungen der thermischen Leistungen wären denkbar. Dabei soll das BHKW möglichst lange Laufzeiten erreichen: Grundlast: BHKW % (aufgrund des geringen Warmwasserverbrauches), Mittellast: Pellet-Kessel 20 %, Spitzenlast/ Redundanz: Gasbrennwert-Kessel 80 %. Somit wären 120 % der benötigten Leistung installiert und der Gaskessel stellt eine Redundanz zu den alternativen Wärmeversorgungsanlagen dar. In Abhängigkeit der energetischen Sanierungsmaßnahmen der einzelnen Gebäude (siehe oben beschrieben) muss die gesamt benötigte thermische Leistung ermittelt werden. Derzeit ist eine Gesamtleistung für die drei Gebäude von 938 kw installiert. Unterlagen über die reale benötigte Heizlast liegen nicht vor. Die derzeitig installierte gesamte Heizleistung von 938 kw scheint auf Grund der einzelnen Sicherheitszuschläge und Gleichzeitigkeit um ca. min. 20 % zu hoch. 148
151 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Geschwister Scholl Grundschule ca. 70m Heizhaus ca. 170m ca. 60m 3-Feld-Sport- und Mehrzweckhalle Albert-Baur Krause- Tschetschog- Oberschule Oberschule Ganztagsgebäude Abbildung 115: Verbundnetz Schulgelände 149
152 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Zusammenfassung der Potenzialbetrachtung der öffentlichen Gebäude Die Stadt Bad Belzig konnte durch die Umsetzung gebäudespezifischer Sanierungsmaßnahmen vereinzelt Potenziale ausschöpfen beispielhaft kann dabei die Sanierung des Bürgerhauses angeführt werden. Mit den merklich verbesserten energetischen Kennwerten des Gebäudes konnten erhebliche Energieeinspareffekte erzielt werden. Im Rahmen der durchgeführten Potenzialanalyse der zu untersuchenden kommunalen Liegenschaften wird deutlich, dass sich rein quantitativ noch erhebliche Energieeinspareffekte bei der Gebäudesubstanz erzielen lassen. Die betrachteten Objekte bieten aufgrund ihrer Vielfalt, hinsichtlich der Nutzungsart, des Baujahrs und der damit verbundenen Bauweise und Materialität unterschiedliche Ansatzpunkte, die im Rahmen dieser Konzepterstellung untersucht und daraus resultierend Maßnahmenempfehlungen formuliert wurden. Für den Erhalt der Gebäudesubstanz und zur Förderung einer energieeffizienten Bewirtschaftung gilt es, für zukünftige Sanierungsvorhaben die Potenziale eines jeden Gebäudes weiterführend zu untersuchen und darauf abgestimmte Maßnahmen zu definieren. Die wesentlichen Maßnahmen umfassen: Dämmmaßnahmen der Gebäudehülle (Fassade, Dach, Kellerdecken), Austausch von Fenstern und Außentüren, Ertüchtigung bzw. Neuausrichtung der Anlagentechnik eines Gebäudes. Auch wenn der Anteil des Energiebedarfs der kommunalen Liegenschaften bezogen auf den städtischen Gesamtenergiebedarfes vergleichsweise gering ist, sollte die Stadt Bad Belzig seiner Vorbildwirkung für Ressourceneffizienz und Klimaschutz nachkommen. Darüber hinaus stehen die Anstrengungen auch im finanziellen Interesse der Kommune, da monetäre Einsparungen im Unterhalt der Gebäude der Stadt zu Gute kommen und die Gebäudesubstanz langfristig gesichert wird. Die folgende Tabelle 56 bietet einen zusammenfassenden Überblick der untersuchten Objekte mit den entsprechenden Maßnahmenempfehlungen und den daraus resultierenden Einspareffekten. Zudem stellt die Reihenfolge der angeführten Liegenschaften eine Priorisierung, gemessen an der Höhe der zu erwartenden Minderung des Energieverbrauches durch die Umsetzung der beschrieben Maßnahmenempfehlungen, dar. 150
153 6. Energiekonzept öffentliche Gebäude Gebäude Krause-Tschetschog- Oberschule Kindertagesstätte Tausendfüssler 3-Feld-Sport-Halle Albert-Baur Rathausgebäude Bad Belzig Bauhof Hauptgebäude Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule Hauptgebäude) Kindertagesstätte 1 (Hauptgebäude) Geschwister-Scholl-Schule (Oberschule Ganztagsgebäude) Jugendfreizeitzentrum POGO Turnhalle Karl-Liebknecht- Straße Gemeindehaus Bergholz Kindertagesstätte Lütte (Hauptgebäude) Gemeindehaus Neschholz Feuerwehr Hauptgebäude Maßnahmenempfehlung Sanierung der thermischen Hüllflächen Einbau Lüftungsanalage Austausch Beleuchtung Einzelraumregelung Reduzierung Kesselleistung/ Optimierung Hydraulik Sanierung der thermischen Hüllflächen Austausch Kesselanlage/ Optimierung Hydraulik Sanierung der thermischen Hüllflächen Optimierung Lüftung Optimierung Heizungshydraulik Sanierung der thermischen Hüllflächen Austausch Kesselanlage/ Optimierung Hydraulik Sanierung der thermischen Hüllflächen Zusammenschluss der Heizkreise Austausch Beleuchtung Sanierung der thermischen Hüllflächen Einzelraumregelung Austausch Beleuchtung Sanierung der thermischen Hüllflächen Austausch Kesselanlage/ Optimierung Hydraulik Sanierung der Fassadenflächen mit WDVS-System Einzelraumregelung Austausch Beleuchtung Sanierung der thermischen Hüllflächen Austausch Beleuchtung Optimierung Lüftungsanalage Austausch Beleuchtung Sanierung der thermischen Hüllflächen Austausch Beleuchtung Einzelraumregelung Rückbau Nachtspeicheröfen Sanierung der thermischen Hüllflächen Austausch Beleuchtung Energie- Einsparung ca. 296 MWh/a ca. 228 MWh/a ca. 105,5 MWh/a ca. 84,4 MWh/a ca. 67,9 MWh/a ca. 65,5 MWh/a ca. 33,5 MWh/a ca. 27,5 MWh/a ca. 21 MWh/a ca. 12MWh/a Tabelle 56: Übersicht Einsparungen öffentliche Gebäude 151
154 7. Energie- und Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung 7. Energie- und Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung 7.1. Bestandsaufnahme und Analyse Leuchtmittel Anhand der Dokumentationen der Stadt Bad Belzig wird der Bestand an Straßenleuchten und -leuchtmitteln in der Stadt untersucht. Die Anzahl und Verteilung der Leuchten im Bestand wird in folgender Tabelle dargestellt (ausgeschaltete Lampen wurden nicht berücksichtigt). Leuchtmittel Anzahl [Stück] Prozent [%] Natriumdampf-Hochdrucklampen ca Quecksilberdampflampen ca Kompaktleuchtstofflampen ca Tabelle 57: Anzahl der bestehenden Leuchtmittel in Bad Belzig Die Auswertung der Bestandsdaten ergibt, dass über 70 Prozent der Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampen und lediglich 22 % der bestehenden Lampen Quecksilberdampflampen sind. Im Folgenden werden die einzelnen Leuchtmittel hinsichtlich der Energieeffizienz untersucht und mit anderen Lampentypen verglichen. Quecksilberdampflampen (HQL) Quecksilberdampflampen sind wegen ihrer geringen Energieeffizienz und ihres insektenschädlichen Lichtspektrums nicht mehr zeitgemäß. Zudem sieht die EU-Ökodesign- Richtlinie vor, dass Quecksilberdampflampen ab 2015 nicht mehr in den Verkehr gebracht werden dürfen. 61,62 Daher besteht bei der Sanierung der noch vorhandenen Quecksilberdampflampen Handlungsbedarf. Natriumdampf-Hochdrucklampen (NAV) Die Natriumdampf-Hochdrucklampe ist bei Sanierungen und Neuplanungen der am häufigsten eingesetzte Lampentyp. Besondere Verwendung findet sie bei der Beleuchtung von Industriegebieten und Ein- und Ausfallstraßen. In Verbindung mit einer Leuchte mit Spiegeloptik bietet sie sowohl energetisch als auch wirtschaftlich Vorteile. Zudem zeichnet sie sich durch eine geringe Anlockwirkung auf Insekten aus. Allerdings haben Studien ergeben, dass ihr gelbliches Licht eine etwas schlechtere Sehleistung als das weiße Licht der Halogenmetalldampflampe aufweist Umweltministerium Baden-Württemberg: Handreichung zur energieeffizienten Straßenbeleuchtung Online verfügbar: ng_strassenbeleuchtung.pdf 62 Siteco: Lichtwerkzeuge für die CO 2-Reduktion Online abrufbar: 152
155 7. Energie- und Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung Halogenmetalldampflampen Halogenmetalldampflampen haben sich hinsichtlich ihrer Lichtausbeute stark verbessert und sind inzwischen mit den Natriumdampf-Hochdrucklampen vergleichbar. Ausgestattet mit einem elektronischen Vorschaltgerät und einer genau angepassten Spiegeloptik bieten sie höhere Beleuchtungsgrade als vergleichbare effiziente Beleuchtungssysteme. Daher gewinnt die Halogenmetalldampflampe für eine Stadtgestaltung mit weißem Licht, besonders im Innenstadtbereich, zunehmend an Bedeutung. Jedoch lockt das weiße Licht der Halogenmetalldampflampe vermehrt Insekten an. 63 Kompaktleuchtstofflampen Die Lichtausbeute von Kompaktleuchtstofflampen ist in der Regel niedriger als die von Leuchtstofflampen. Zudem kann ihr Licht wegen der größeren Abmessungen schlechter gelenkt werden. Daher werden sie in der Regel nur bei besonderen Anforderungen wie geringen Lichtpunkthöhen oder einer gewünschten symmetrischen Lichtverteilung eingesetzt. Da sie in weißen und warmen Lichtfarben, mit kleinen Leistungen sowie einer guten Farbwiedergabe verfügbar sind, eignen sie sich für die energiesparende Nutzung, z. B. in Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen. 63 LED LED-Leuchten werden nicht mehr nur für dekorative Außenbeleuchtung eingesetzt, sondern eignen sich durch ihr weißes Licht auch für die Straßen- und Wegebeleuchtung. LED-Leuchten haben ein homogenes Licht und eine exakte Lichtlenkung, die unerwünschtes Streulicht verhindert. LEDs sind sehr effiziente Lichtquellen, deren Entwicklung rasant voran schreitet. Für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten sind verschiedene Weißtöne möglich: von warmweiß ( K) über neutralweiß ( K) bis zu tageslichtweiß ( K). 64 Ein großer Vorteil der LEDs ist die lange Lebensdauer, welche bei Hochleistungs-LEDs Stunden und mehr betragen kann. Folgende Tabelle gibt einen zusammenfassenden Überblick über die verschiedenen Leuchtmittel und ihrer Merkmale. 63 Umweltministerium Baden-Württemberg: Handreichung zur energieeffizienten Straßenbeleuchtung Online verfügbar: ng_strassenbeleuchtung.pdf 64 Fördergemeinschaft Gutes Licht: LED: Das Licht der Zukunft. Online abrufbar: 153
156 7. Energie- und Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung Lampentyp Quecksilberdampflampe Natriumdampf- Hochdrucklampe Halogenmetalldampflampe Kompaktleuchtstofflampe Stabf. Leuchtstofflampen Lebensdauer [h] Lichtfarbe Bemerkung weiß veraltet gelblich Stand der Technik, insektenfreundlich weiß Weniger insektenfreundlich als NAV weiß Nur für geringe Lichtpunkthöhen geeignet weiß Erfordert großvolumige Leuchten, nur für geringe Lichtpunkthöhen geeignet LED ca weiß - Tabelle 58: Übersicht über bestehende Lampentypen und deren Merkmale 65 Folgende Grafik stellt die Systemlichtausbeuten der oben beschriebenen Lampentypen dar. Abbildung 116: Effizienz der Lichtquellen, Quelle: licht.de Für die Bestandslampen der Stadt Belzig wird geschlussfolgert, dass insgesamt fast 80 % der Lampen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Natriumdampf- 65 Umweltministerium Baden-Württemberg: Handreichung zur energieeffizienten Straßenbeleuchtung Online verfügbar: ng_strassenbeleuchtung.pdf 154
157 7. Energie- und Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung Hochdrucklampen und Kompaktleuchtstofflampen sind effiziente Leuchtmittel und bedürfen vorerst keiner Sanierung. Quecksilberdampflampen hingegen sind veraltet und sollten gegen effizientere Leuchtmittel getauscht werden. Leuchten In den Bestandsunterlagen sind neben den eingesetzten Leuchtmitteln auch die Leuchten vermerkt. Zum Teil sind diese nur grob erfasst. In folgender Tabelle werden die am häufigsten vorkommenden Leuchten dargestellt. Leuchte Anzahl [Stück] Prozent [%] Ost -Schinkel ca Hellux Schinkel ca Ansatzleuchten Betonmast ca Ansatzleuchte Stahlmast ca Aufsatzleuchte Trilux 9321 ca Selux/ Histo/ Ansatzleuchte ca Selux Saturn Aufsatzleuchte ca Trapp 348 Aufsatzleuchte ca RSL Aufsatzleuchte ca. 5 5 Aufsatzleuchte/ Whitecroft ca Tabelle 59: Anzahl der bestehenden Leuchten in Bad Belzig Über 80 % der Leuchten wurden nach der Wende saniert und mit Spiegeloptik ausgestattet. 66 Die restlichen Leuchten stammen aus der Zeit vor der Wende und sind ohne Spiegeloptik. An Wannenmaterial wurde für die modernen Leuchten größtenteils geriffeltes Glas verwendet. Die älteren Leuchten haben zum Teil keine Abdeckung. Vollbetriebsstunden Die Leuchtmittel werden mit Dämmerungsschaltern betrieben. Dabei wird bei dieser Analyse von einer Vollbetriebszeit von Stunden/Jahr ausgegangen. Einige Lampen werden in den Nachtstunden abgeschaltet, bei anderen Lampen wird in den Nachtstunden die Leistung von 70 Watt auf 50 Watt reduziert. 66 Informationen Frau Moritz, Stadt Belzig, Telefoninterview am
158 7. Energie- und Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung Energieverbrauch Der Energieverbrauch der einzelnen Unterzähler wird in der Stadt erfasst. Der Wert für den Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung der Stadt Belzig betrug laut Abrechnung im Jahr kwh/a und im Jahr kwh/a. Daraus ergeben sich jährliche Stromkosten für die Beleuchtung der Stadt Belzig von rd EUR/a (bei einem angesetzten Strompreis von rd. 0,21 EUR/kWh 67, welcher für alle folgenden Berechnungen angesetzt wird). Die CO 2 -Emissionen betragen bei einem Energieverbrauch von kwh/a ca. 334 t/a (bei einem CO 2 -Emissionsfaktor von 475 g/kwh). Anhand der erfassten Leistung der Bestandslampen und unter Annahme der Vollbetriebsstunden wurde ein theoretischer Energieverbrauch von rd kwh ermittelt. 68 In folgendem Unterkapitel werden auf Basis der erfassten Leistungsdaten und den angesetzten Vollbetriebsstunden mögliche Einsparpotenziale berechnet Optimierungspotenziale Leuchtmittel Wie in der Bestandsaufnahme ersichtlich weisen über 80 % der Bestandslampen bereits eine hohe Energieeffizienz auf. Die veralteten Quecksilberdampflampen hingegen sollten gegen effizientere Leuchtmittel ersetzt werden. Bei dem Ersatz von Leuchtmitteln gibt es verschiedene Möglichkeiten. Diese werden im Folgenden kurz dargestellt. Plug-In Bei dem Plug-In wird die veraltete Lampe durch eine neue Lampe anderer Technologie ersetzt, welche in der Originalbrennstelle (Fassung, Vorschaltgerät, Reflektor) betrieben werden kann. Quecksilberdampflampen können durch Natriumdampf-Hochdrucklampen Plug-Ins mit integriertem Zünder für vorhandene Vorschaltgeräte ersetzt werden. Jedoch stellen diese Plug-Ins nur eine Übergangslösung dar, da diese ab April 2015 nicht mehr im Handel erhältlich sein werden. 69 Umrüsten Unter Beibehaltung von Sockel und Reflektor wird das Vorschaltgerät und ggf. das Zündgerät gewechselt. Hierbei bleibt die Höhe des Lichtstroms erhalten. Die Energieeinsparung ergibt sich durch eine bessere Technologie der Lampe und des Vorschaltgeräts. Erneuerung 67 Angaben für den Preis je kwh Beleuchtung von E.ON Edis. 68 Leistungsaufnahme der bestehenden Vorschaltgeräte wurde pauschal mit einem Faktor von 1,1 berücksichtigt 69 Aussage Herr Krause, Firma Osram, Niederlassung München, Telefoninterview am
159 7. Energie- und Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung Bei der Erneuerung wird der komplette Leuchtenkopf inklusive Reflektortechnik gewechselt. Durch diese Erneuerung wird zusätzlich die Lichtverteilung optimiert. Diese Variante ist die teuerste aber mit Abstand energieeffizienteste Version, welche alle technischen Fortschritte von Lampe und Leuchte nutzt. Folgende Grafik zeigt beispielhaft Einsparpotenziale auf, welche beim Austausch von Quecksilberdampflampen gegen Natriumdampf-Hochdrucklampen, Halogen- Metalldampflampen sowie LED zu erreichen sind. Abbildung 117: Einsparpotenziale Straßenbeleuchtung, Quelle: licht.de Im Folgenden wird der Austausch der Quecksilberdampflampen durch NAV Plug-Ins, NAV- Lampen sowie Halogenmetalldampflampen ausgehend von den Bestandsunterlagen für die Lampenleistungen hinsichtlich des Energieeinsparpotenzials untersucht. Dabei wird von einer gleichbleibenden Beleuchtungsstärke und dem Einsatz von elektronischen Vorschaltgeräten ausgegangen. Zudem wird der Austausch der Quecksilberdampflampen durch LED untersucht. Bei einem Austausch der Lampen ist es sinnvoll zu prüfen, ob die Lampen hinsichtlich der Beleuchtungsstärken und Leuchtdichten richtig oder über-/ unterdimensioniert sind. 157
160 7. Energie- und Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung Austausch der Bestandslampen durch NAV Plug-Ins Für die Berechnung werden folgende Leistungen für NAV Plug-Ins angesetzt, die in ihrem Lichtstrom den Bestands-Quecksilberdampflampen entsprechen, siehe Tabelle 60. Lampe Bestand HQL Lichtstrom [lm] Leistung NAV Plug-In Lichtstrom W W W W W W Tabelle 60: HQL-Bestandsleuchten und entsprechende NAV Plug-Ins 69 Werden die bestehenden Quecksilberdampflampen mit 80 W, 125 W und 250 W durch NAV Plug-Ins ersetzt, werden der Energieverbrauch und die CO 2 -Emissionen gesenkt. Bei einer Berechnung ausgehend von den Bestandsunterlagen können durch einen Ersatz folgende Kennwerte erreicht werden, Tabelle 61. Einsparung Strom [kwh/a] Einsparung Energiekosten [EUR/a] [lm] Einsparung CO 2 - Emissionen [t/a] Gesamt ca ca ca. 5,0 Tabelle 61: Einsparpotenziale durch NAV Plug-Ins Austausch der Bestandslampen durch NAV Lampen Wird das gelbliche Licht der Natriumdampf-Hochdrucklampen langfristig gewünscht, können die Bestandslampen anstelle von Plug-Ins durch richtige Natriumdampf-Hochdrucklampen ersetzt werden. Werden die Quecksilberdampflampen gegen Natriumdampf-Hochdrucklampen getauscht, werden die Systemleistungen verglichen mit der Natriumdampf Plug-In Lampe weiter reduziert. Die Kennwerte der Lampen werden in folgender Tabelle dargestellt. Lampe Bestand HQL Lichtstrom 71 [lm] Leistung NAV (ohne VG) Lichtstrom 72 [lm] 125 W W W W W W Tabelle 62: HQL-Bestandsleuchten und entsprechende NAV Lampen 70 Osram, Produktreihe Vialox NAV-E Plug-in 71 Osram, Produktreihe HQL 72 Osram, Produktreihe Vialox NAV-E SUPER 4Y 158
161 7. Energie- und Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung Durch den Ersatz der bestehenden HQL-Lampen durch NAV-Lampen werden der Energieverbrauch und die CO 2 -Emissionen deutlich reduziert, wie folgende Tabelle zeigt. Einsparung Strom [kwh/a] Einsparung Energiekosten [EUR/a] Einsparung CO 2 - Emissionen [t/a] Gesamt ca ca ,0 Tabelle 63: Einsparpotenziale durch NAV-Lampen Austausch der Bestandslampen durch Halogenmetalldampflampen Halogenmetalldampflampen (im Folgenden HMD) unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Farbwiedergabe von den Natriumdampfhochdrucklampen und sind durch ihr weißes Licht je nach Beleuchtungssituation von den Nutzern z. T. stärker gewünscht. Hinsichtlich der Beleuchtungsstärke entsprechen folgende Halogenmetalldampflampen den Lichtströmen der Quecksilberdampflampen, siehe Tabelle 64. Lampe Bestand HQL Lichtstrom [lm] Leistung HMD (ohne VG) Lichtstrom 73 [lm] 125 W W W W W W Tabelle 64: HQL-Bestandsleuchten und entsprechende HMD Lampen Werden die bestehenden Quecksilberdampflampen durch Halogenmetalldampflampen ersetzt, resultieren folgende Werte (Tabelle 65). Bei den HMD führt der Einsatz von elektronischen Vorschaltgeräten zu einem sehr effizienten Betrieb der Lampen. Einsparung Strom [kwh/a] Einsparung Energiekosten [EUR/a] Einsparung CO 2 - Emissionen [t/a] Gesamt ca ,0 Tabelle 65: Einsparpotenziale durch HMD Lampen Austausch der Bestandslampen durch LED Bisher können LED konventionelle Leuchtmittel wie Quecksilberdampflampen nur in wenigen Fällen direkt ersetzen. Ein Wechsel auf LED erfordert meist einen Austausch der gesamten Leuchte. Da jedoch viele Altanlagen in einem schlechten Zustand sind, bietet sich in vielen Fällen ein vollständiger Ersatz von Leuchtmittel und Leuchte an. Hier kann die moderne LED-Technik zum Einsatz kommen. Folgende Tabelle zeigt die mögliche Leistungsreduzierung durch den Ersatz an LEDs. 73 Osram, Produktreihe Powerball HCI-TT 159
162 7. Energie- und Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung Lampe Bestand HQL Lichtstrom [lm] Tabelle 66: HQL-Bestandsleuchten und LED-Leuchten Leistung LED W W 125 W W 80 W W 50 W W Die Einsparpotenziale, welche durch den Austausch der HQL-Lampen durch LED zu erreichen sind, werden in folgender Tabelle dargestellt. Einsparung Strom [kwh/a] Einsparung Energiekosten [EUR/a] Gesamt ca ca ca. 36,0 Tabelle 67: Einsparpotenziale durch LED Leuchten Einsparung CO 2 - Emissionen [t/a] Auch die bestehenden Leuchten können hinsichtlich der Energieeffizienz optimiert werden. Gehäuse mit Wannenmaterial aus Opal- oder Milchglas sind weniger effizient als klares Glas. Wird das alte Wannenmaterial durch klares Glas ersetzt, erhöhen sich die Lichtdurchlässigkeit und somit auch der Wirkungsgrad. Da ein Großteil der Leuchten bereits mit Spiegeloptik ausgestattet ist, gibt es bei den schon getauschten Leuchten hinsichtlich der Lichtlenkung wenige Optimierungspotenziale. Ältere Leuchten ohne Spiegeloptik können nachgerüstet werden. Durch eine effiziente Spiegeloptik wird das Licht an die richtige Stelle gelenkt. So können ggf. Lampen mit geringerer Leistung eingesetzt werden. Lichtsteuerung Für die Steuerung von Straßenbeleuchtung gibt es verschiedene Steuerungsmöglichkeiten: vom einfachen An- und Abschalten bis zur stufenlosen Regelung und Überwachung jedes einzelnen Lichtpunkts vom Zentralrechner. Moderne Entwicklungen erhöhen die Schalt- und Regelintelligenz einzelner Lichtpunkte. Zu den Neuentwicklungen gehören u. a. die elektronischen Vorschaltgeräte (EVG) mit einer stufenlosen Leistungsreduktion für Natriumdampf-Hochdrucklampen und Halogenmetalldampflampen, welche im Vergleich zu den konventionellen Vorschaltgeräten ca. 10 % an Energie einsparen. Zudem können in die EVG von Natriumdampf-Hochdruck, Halogenmetalldampflampen und LED intelligente Zusatzfunktionen integriert werden, wie z. B. eine interne Uhr zur autarken Nachtabsenkung in verkehrsarmen Zeiten oder eine Programmfunktion zur Kompensation des alterungsbedingten Lichtstromabfalls. 74 Aussage Herr Wrobel, Siteco, Telefoninterview am
163 7. Energie- und Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung Auch können Zusatzkomponenten zur bewegungsgesteuerten Regelung der Straßenbeleuchtung für Straßenzüge mit geringem Verkehrsaufkommen oder Steuereinheiten für den straßenseitigen Schaltschrank mit GSM-Kommunikation zum Zentralrechner integriert werden. 75 Die daraus realisierbaren Energieeinsparungen werden in folgender Tabelle pauschal aufgezeigt. 75 Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit, Energieeffiziente Straßen- und Platzbeleuchtung in Kommunen,
164 7. Energie- und Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung Art der Leistungsreduktion Abschaltung einer Lampe in zweilampigen Leuchten in verkehrsarmen Zeiten, Leistungsreduktion zwischen Uhr Zentrale Absenkung über Steuerader in verkehrsarmen Zeiten, Leistungsreduktion zwischen Uhr Programmierung im Lichtpunkt in verkehrsarmen Zeiten, Leistungsreduktion zwischen Uhr Lichtmanagement jedes einzelnen Lichtpunkts von Zentralrechner Bewegungsgesteuerte Lichtregelung der betroffenen Leuchtengruppe Energieeinsparung Anmerkungen, Vor- und Nachteile ca. 50 % geringe bis keine Einschränkung der Verkehrssicherheit; Konformität mit DIN EN abhängig von konkreter Beleuchtungssituation Steuerader erforderlich Leuchten mit zwei getrennten Vorschaltgeräten und Lampen erforderlich ca. 33 % bei angemessener Reduzierung keine Einschränkung der Verkehrssicherheit und Konformität mit DIN EN Steuerader erforderlich Leuchten mit Schalttechnik an der Steuerphase erforderlich ca. 33 % bei angemessener Reduzierung keine Einschränkung der Verkehrssicherheit und Konformität mit DIN EN keine Steuerader erforderlich Leuchten mit interner Steuerung (Uhr) erforderlich (bei LED Leuchten meist Standard) bis zu 60 % keine Einschränkung der Verkehrssicherheit bei angemessener Reduzierung hoher Komfort in Installation und Pflege und bei wechselnden Beleuchtungsaufgaben (z. B. Straßenfesten) uni/bidirektionale Signalstrecke vom Zentralrechner zu jedem Lichtpunkt erforderlich dimmbare Vorschaltgeräte mit Kommunikationsschnittstelle und Steuerbaustein in jedem Lichtpunkt bis zu 80 % Einsatz nur in Straßen mit geringem Verkehrsaufkommen höchstes Reduzierungspotenzial bei Energieverbrauch und Lichtverschmutzung noch in der Erprobungsphase hohe Investitionskosten für Hochleistungssensoren, Signalübertragung von Leuchte zu Leuchte und Steuereinheiten LED Leuchten erforderlich Tabelle 68: Energieeinsparung durch Lichtsteuerung Norm DIN EN 13201, Straßenbeleuchtung, Teile Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit: Energieeffiziente Straßen- und Platzbeleuchtung in Kommunen
165 7. Energie- und Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung 7.3. Untersuchung der Ortsteile Über die Dienstleistungsverträge der E.ON edis sind für einige Beleuchtungsanlagen in den Ortsteilen Fredersdorf, Hagelberg, Lüsse, Neschholz, Schwanebeck, Ragösen, Werbig und in den Belziger Waldsiedlungen Informationen zu den einzelnen Lichtpunkten vorhanden. Insgesamt liegen hier für 375 Lichtpunkte Daten zu den Bestandslampen vor, welche im Folgenden ausgewertet werden. Zu den anderen kommunalen Beleuchtungsanlagen in den Ortsteilen gibt es bisher keine genaue Erfassung der Lichtpunkte. Hier liegen lediglich Verbrauchsdaten vor, so dass keine Einsparpotenziale definiert werden können. Insgesamt beträgt der in den Ortsteilen erfasste Energieverbrauch rd kwh/a 78. Daraus ergeben sich jährliche Stromkosten von rd EUR/a und CO 2 -Emissionen von 147 t/a. Die folgende Tabelle 69 zeigt die Leuchtmittel, der durch die E.ON edis erfassten Lichtpunkte. Leuchtmittel Anzahl [Stück] Natriumdampflampen 365 Quecksilberdampflampen 8 Kompaktleuchtstofflampen 2 Tabelle 69: Bestandsdaten zu Lichtpunkten in den Ortsteilen aus Dienstleistungsverträgen Werden die Quecksilberdampflampen durch Natriumdampf-Hochdrucklampen, Halogenmetalldampflampen oder auch LEDs ersetzt, kann die Leistungsaufnahme der Lampen bei ähnlicher Beleuchtungsstärke reduziert werden (siehe dazu Punkt 7.2). Folgende Tabelle zeigt die durch einen Lampenaustausch möglichen Einsparpotenziale hinsichtlich Stromverbrauch, Energiekosten und CO 2 -Emissionen. Ersatzlampe Einsparung Strom [kwh/a] Einsparung Energiekosten [EUR/a] Einsparung CO 2 - Emissionen [kg/a] NAV Plug-In ca. 350 ca. 80 ca. 160 NAV ca. 920 ca. 200 ca. 420 HMD ca. 780 ca. 170 ca. 360 LED ca ca. 370 ca. 760 Tabelle 70: Einsparpotenziale durch Austausch der Quecksilberdampf-Lampen 7.4. Aktuelle Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Straßenbeleuchtung Für den Austausch veralteter Straßenbeleuchtung gegen effizientere Technik, gibt es verschiedene Fördermittel. Sowohl die KfW Bank als auch der Projektträger Jülich fördern den Einsatz energieeffizienter Straßenbeleuchtung. 78 Summe aus den Bestandstabellen der Dienstleistungsverträge und den Zählern der Ortsteile 163
166 7. Energie- und Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung KfW-Bank Die KfW Bank fördert mit dem Programm 215 KfW-Investitionskredit Kommunen Premium Energieeffiziente Stadtbeleuchtung Investitionen in eine energieeffiziente Stadtbeleuchtung inklusive Planungs- und Beratungskosten für eine Bestandsanalyse, für ein Umsetzungskonzept sowie für einen Sachverständigen. Im Programm können beispielsweise folgende energetische Maßnahmen bei Ersatz, bzw. Nachrüstung veralteter Beleuchtung oder bei Neubau moderner Straßenbeleuchtungsanlagen gefördert werden: Installation von neuen bzw. Austausch alter Leuchten durch neue Leuchten mit hocheffizienter lichtlenkender Optik und effizienten Leuchtmitteln, Neuinstallation oder Ersatz von Vorschalt- und anderen Betriebsgeräten, Ersterrichtung und Erneuerung von Lichtmasten in Verbindung mit der Installation (hoch-) effizienter Leuchten, Installation einer Lichtsteuerung oder eines Telemanagementsystems zur bedarfsgerechten Anpassung des Beleuchtungsniveaus, Komponenten zur sensorgesteuerten bedarfsgerechten Anpassung des Beleuchtungsniveaus. Gefördert werden die Maßnahmen, wenn damit klar definierte energetische Standards erreicht werden, z. B. ein bestimmter Wert für den Energieverbrauch nicht überschritten oder ein Mindestwert für die Energieeinsparung erreicht wird. Projektträger Jülich Der kommunale Klimaschutz spielt eine wichtige Rolle in der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen werden Klimaschutzprojekte in Kommunen gefördert. Gefördert werden nach dieser Richtlinie u. a. investive Maßnahmen, die zu einer CO 2 - Emissionsminderung führen. Die Förderung betrifft u. a. den Einbau hocheffizienter LED- Beleuchtungs-, Steuer- und Regelungstechnik bei der Sanierung von Außen- und Straßenbeleuchtung mit einem CO 2 -Minderungspotenzial von mindestens 60 %. Anträge werden beim Projektträger Jülich eingereicht. Die Einreichungsfrist läuft ab dem bis zum Zusammenfassung Energie- und Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung Die Bestandsaufnahme hat verdeutlicht, dass im Bereich der Straßenbeleuchtung bereits viele Optimierungsmaßnahmen durchgeführt worden sind. So wurde bereits ein Großteil der veralteten Quecksilberdampflampen (HQL) gegen Natriumdampfhochdrucklampen (NAV) 164
167 7. Energie- und Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung ausgetauscht, welche dem Stand der Technik entsprechen. Da jedoch noch ein Teil der HQL-Lampen vorhanden ist, wird empfohlen, diese gegen effizientere Natriumdampflampen, Halogenmetalldampflampen oder LED-Technik zu ersetzen. Weitere Einsparpotenziale liegen in der Optimierung der Lichtverteilung der Leuchten sowie der Reduktion der Vollbetriebsstunden durch eine bedarfsgerechte Steuerung. 165
168 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand 8.1. Untersuchung Referenzobjekt: Goethestraße Im folgenden Abschnitt wird der energetische Gebäudebestand in den Wohngebieten Klinkengrund, Kurparksiedlung und der Altstadt untersucht. Dazu wurden fünf Gebäude, welche für diese Gebiete als stellvertretend angesehen werden, als Referenzobjekte ausgewählt. 79 Die Referenzobjekte werden hinsichtlich der Anlagentechnik und der Gebäudehülle im Bestand erfasst und bewertet. Darauf aufbauend werden energetische Optimierungspotenziale ausgearbeitet. Anhand von vorliegenden Daten sowie ausgewählten Interviews wurden pauschale Annahmen als Grundlage für die Berechnungen der Einsparpotenziale und Kostenschätzungen angesetzt. Die überschlägigen Berechnungen können aufgrund von z. T. mangelhaften Datenbeständen von den realen Werten abweichen. Den Berechnungen zugrunde liegen folgende angesetzte Energiekosten und CO 2 - Emissionsfaktoren. Preis [EUR/kWh] CO 2 -Emission [g/kwh] Strom Fernwärme 0, Erdgas 0, Tabelle 71: Preise und Emissionsfaktoren Bad Belzig Bestandsaufnahme Das Auswahlobjekt in der Goethestraße ist ein Mehrfamilienhaus mit 18 Wohneinheiten. Das Haus besteht aus drei Geschossen mit sechs Mietparteien pro Geschoss. Errichtet wurde das Gebäude 1960 als Mauerwerksbau aus Ziegelstein. Die Gebäudenutzfläche nach EnEV beträgt 1149 m². Energetische Gesamtbewertung 2007 wurde ein Energieausweis für das Gebäude auf Basis der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2004 erstellt. Demnach lag der Jahresprimärenergiebedarf von 112,6 kwh/m²a für Beheizung, Lüftung und Warmwasser über dem zulässigen Höchstwert von 90,40 kwh/m²a. Der Heizwärmebedarf des Objektes lag entsprechend der Berechnung bei 61,3 kwh/m²a und wurde nach den Bewertungskriterien der EnEV 2004 als niedrig eingestuft. Anhand der Eingabedaten des Energieausweises von 2007 wurde ein Vergleich nach der aktuellen EnEV 2009 erstellt. Hierbei wurde der Austausch der Fenster gegen 79 Die Auswahl der Gebäude erfolgte über die Wohnungsbaugesellschaften sowie über die Stadtverwaltung Belzig 166
169 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Isolierverglasungen berücksichtigt. Alle eingegebenen Werte beziehen sich auf die Eingabedaten des Energieausweises von Daraus ergeben sich die in folgender Tabelle dargestellten Kennwerte. Die Tabelle zeigt, dass der Primärenergiebedarf über dem zulässigen Höchstwert für einen sanierten Altbau, der Transmissionswärmeverlust jedoch bereits unter dem zulässigen Höchstwert für sanierte Altbauten liegt. Ist-Wert Objekt Zulässiger Höchstwert EnEV 2009 Jahres-Primärenergiebedarf 109,7 kwh/m² 86,5 kwh/m² Transmissionswärmeverlust 0,4 W/m²K 0,7 W/m²K Tabelle 72: Ist-Werte des Objektes nach Berechnung EnEV 2009, Hottgenroth Energieberater Plus Tatsächlicher Energieverbrauch Die Wärmeverbrauchskennwerte der letzten drei Jahre sowie der auf Basis des o. g. Energieausweises errechnete Wärmebedarf werden in folgender Tabelle 73 dargestellt. Fernwärme [kwh/a] Klimabereinigter Wert [kwh/a] Errechneter Bedarf nach EnEV Tatsächlicher Bezug Tatsächlicher Bezug Tatsächlicher Bezug Durchschnitt Bezug Tabelle 73: Wärmeverbrauch des Objekts in der Goethestraße Die Tabelle zeigt einen relativ konstanten Wärmeverbrauch in den letzten drei Jahren. Auf die Gebäudenutzfläche bezogen beträgt der Wärmeverbrauchswert rd. 98 kwh/m²a. Folgende Abbildung 118 zeigt den spezifischen Wärmeverbrauch auf einer mit Vergleichswerten gefüllten Skala der EnEV Diese Grafik dient nur als Veranschaulichung des Energieverbrauchs und ersetzt nicht den bedarfsorientierten Energieausweis der EnEV Der Energieausweis wurde am von Wolfgang Krüger, DENA Registrierter Nr erstellt. 167
170 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Heizenergiekennwert Co 2 Emission 27 kg/(m² * a) 98 Abbildung 118: Energieverbrauchswert für Heizung und Warmwasser, Goethestraße Die Einordnung zeigt, dass das zu betrachtende Objekt über dem Kennwert für ein MFH Neubau liegt. Nach Angabe der EnEV liegt der Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwärme beheizten Gebäudes normalerweise um % unter vergleichbaren Gebäuden mit Kesselheizung. Thermische Hüllfläche Das Gebäude wurde im Jahr 1992 saniert. Im Rahmen dieser Sanierung wurden die Außenwände mit 8 cm (Mineralfasern WLG 040) und die Kellerdecken mit 4 cm Styrodur (WLG 035) gedämmt wurde nachträglich Dämmung auf die oberste Geschossdecke zum unbeheizten Dachraum eingebracht. Nach der Erstellung des Energieausweises wurden zwischen 2007 und 2011 von insgesamt 90 Bestandsfenstern ca. 44 Stück gegen moderne Fensterelemente mit Wärmeschutzverglasungen ausgetauscht. Die Fenster wurden zu ca. 50 % auf der Südseite und zu 50 % auf der Nordseite getauscht. 81 Die aus den Sanierungen resultierenden U-Werte werden in folgender Tabelle 74 dargestellt und mit den Grenzwerten der EnEV 2009 verglichen. 81 Information von Frau Anita Wacher, Wohnungsgenossenschaft am Klinkengrund, Telefoninterview am
171 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand U-Wert nach Sanierung [W/m²K] U-Wert Grenzwert EnEV 2009 [W/m²K] Fenster Getauscht 1,3 82 1,3 Fenster Bestand 2,6 1,3 Außenwand 0,34 0,24 Kellerdecke 0,39 0,30 Oberste Geschossdecke 0,30 0,24 Tabelle 74: Kennwerte der Bauteile der thermischen Hülle in der Goethestraße In der Tabelle wird deutlich, dass die U-Werte der Außenwand, der Kellerdecke und dem Dachboden nicht mehr den aktuellen Grenzwerten der EnEV 2009 entsprechen. Die neuen Fenster weisen hingegen bereits einen ausreichend guten U-Wert auf. Anlagentechnik Die vorliegenden Angaben zur bestehenden Anlagentechnik basieren auf dem o. g. Energieausweis von 2007 sowie z. T. auf Angaben der Wohnungsgenossenschaft am Klinkengrund und den Stadtwerken Bad Belzig. Lüftung In dem untersuchten Wohngebäude ist keine mechanische Lüftungsanlage vorhanden. Das Gebäude wird ausschließlich über Fenster belüftet. Heizung Die Beheizung des Gebäudes erfolgt über Fernwärme der Stadtwerke Belzig mit einem Primärenergiefaktor von 1,1 83 (im vorliegenden Energieausweis wurde mit einem Primärenergiefaktor für die Fernwärme von 1,2 gerechnet). Im Rahmen der Sanierung 1992 wurden die dezentralen Öfen entfernt und das Gebäude an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Bad Belzig angebunden. Es wurden Heizkörper mit regulierbaren Thermostatventilen installiert und ein hydraulischer Abgleich durchgeführt. Zudem wurde eine Nachtabsenkung realisiert. Die Vor- und Rücklauftemperaturen der Verteilung liegen bei 85/ 65 C. 84. Die Umwälzpumpe läuft leistungsgeregelt. Die Verteilleitungen für die Heizung verlaufen außerhalb der thermischen Hülle im Keller und sind wie die Strangleitungen und Anbindeleitungen nach halber EnEV(2004)-Stärke gedämmt (U = 0,3 W/m²K) 82 Angenommener Kennwert für das gesamte Fenster, Ug = 1,1 W/m²K 83 Laut Protokoll vom , Projekt KKK206, Bad Belzig, Thema Fernwärmeversorgung der Wohnsiedlungen Klinkengrund und Kurparksiedlung 84 Quelle: der Stadtwerke Bad Belzig, Michael Behringer,
172 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Warmwasser Die Warmwasserverteilung erfolgt zentral über die Fernwärme der Stadtwerke Belzig. Der Trinkwasserwärmebedarf wurde im Energieausweis mit 12,5 kwh/m²a angesetzt. Der Warmwasserspeicher hat ein Fassungsvermögen von 830 Litern und ist nach regulärer EnEV(2004)-Stärke gedämmt. Die Warmwasserverteilleitungen verlaufen außerhalb der thermischen Hülle und sind nur nach halber EnEV(2004)-Stärke (U = 0,3 W/m²K) gedämmt Maßnahmenanalyse zur Optimierung Thermische Hülle Im Folgenden werden mögliche weitere Sanierungsmaßnahmen an der thermischen Hüllfläche untersucht. Da die U-Werte der Außenbauteile nicht den Grenzwerten der EnEV 2009 entsprechen, wird im ersten Schritt eine Sanierung zur Erreichung des aktuellen EnEV- Standards untersucht und aufgezeigt. Erneuerung der thermischen Hülle nach den Grenzwerten der EnEV 2009 Folgende Tabelle 75 zeigt die zusätzlichen Dämmstärken, die notwendig sind, um den aktuellen EnEV-Grenzwert zu erreichen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die bestehenden Dämmstärken an Außenwand, Kellerdecke und oberster Geschossdecke noch nutzbar sind und ihre Dämmwirkung erfüllen. 170
173 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Bauteil Fenster Getauscht Fenster Bestand U-Wert nach Sanierung [W/m²K] U-Wert Grenzwert EnEV 2009 [W/m²K] Benötigte zusätzl. Dämmung zur Erreichung des Grenzwertes Durch Dämmung erreichter Wert [W/m²K] 1,3 1, ,6 1,3 z. B. 2-Scheiben- Wärmeschutzverglasung U g = 1,1; U f = 1,2 85 Außenwand 0,34 0,24 6 cm WLG 040 0,22 Kellerdecke 0,39 0,30 4 cm WLG 040 0,28 Oberste Geschossdecke 0,30 0,24 4 cm WLG 040 0,23 Tabelle 75: Zusätzliche Dämmstärken zur Erreichung der EnEV-Grenzwerte Werden diese Sanierungsmaßnahmen umgesetzt, können die Transmissionswärmeverluste und damit der Heizwärmeverbrauch reduziert werden. Folgende Tabelle 76 zeigt die zu erwartende Einsparung an Heizkosten sowie die Investitionssumme. Die Kostenschätzung bezieht sich lediglich auf das Anbringen der zusätzlichen Dämmstärke. Maßnahme Einsparung Heizenergie [kwh/a] Einsparung Heizenergie [EUR/a] Investition Dämmstärke [EUR] Reduktion CO 2 - Emissionen [t/a] Fenstertausch ca ca. 200 ca ca. 700 Dämmung AW ca ca. 600 ca ca Dämmung oberste Geschossdecke Dämmung Kellerdecke Gesamt- Sanierung ca ca. 150 ca ca. 450 ca ca. 180 ca ca. 500 ca ca ca ca Tabelle 76: Wirtschaftliche Kenndaten nach Fenstertausch Da das untersuchte Objekt im Jahr 1992 bereits grundlegend saniert worden ist und in den letzten Jahren weitere energetische Optimierungsmaßnahmen durchgeführt worden sind, kann eine energetische Ertüchtigung der thermischen Hülle nach den Grenzwerten der EnEV 2009 nicht empfohlen werden. Die notwendigen Dämmstärken und die Einsparung der Heizenergie stehen in keinem Verhältnis zum Aufwand einer Sanierung. Wenn aufgrund von Mängeln an den bestehenden Dämmungen o. ä. zu einem späteren Zeitpunkt eine erneute Sanierung durchgeführt werden soll, ist es sinnvoll die aktuellen Grenzwerte zu unterschreiten und den Heizenergieverbrauch deutlich zu reduzieren. Dafür 1,3 85 g = 0,6, Rahmenanteil = 30 %, Bauteil aus Katalog, Energieberater Plus, Hottgenroth 171
174 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand wird im Folgenden eine Unterschreitung der EnEV-Grenzwerte um 30 % untersucht. Diese Unterschreitung orientiert sich an den technischen Anforderungen des auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche des Gebäudes bezogenen Transmissionswärmeverlustes eines KfW-Effizienzhauses 55. Im Falle einer erneuten Sanierung wird empfohlen, auf die Umweltbilanz der eingesetzten Baumaterialien und ökologische Dämmstoffe zu achten. Nachwachsende Dämmstoffe wie Holzfasern, Zellulose oder Hanffasern bieten eine gute Alternative zu konventionellen mineralischen, synthetischen und mineralisch-synthetischen Dämmstoffen und erreichen ähnliche Wärmeleitkoeffizienten (λ= 0,040 W/mK). Dämmung der thermischen Hülle zur Unterschreitung der EnEV-Grenzwerte um -30 % In folgender Tabelle 77 werden die notwendigen zusätzlichen Dämmstärken dargestellt, welche zur Unterschreitung der EnEV-Grenzwerte um 30 % notwendig sind. Bauteil U-Wert Grenzwert EnEV 2009 [W/m²K] Benötigte zusätzl. Dämmung zur Erreichung des Grenzwertes Fenster 1,3 3-Scheiben-WSV (U g = 0,6; U f = 1,2; g = 0,68) Durch Dämmung erreichter Wert [W/m²K] Außenwand 0,24 12 cm WLG 040 0,167 Kellerdecke 0,30 10 cm WLG 040 0,197 Oberste Geschossdecke 0,91 0,24 12 cm WLG 040 0,158 Tabelle 77: Zusätzliche Dämmstärken zur Unterschreitung der EnEV-Werte um 30 % Durch eine Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen und eine daraus resultierende Unterschreitung der EnEV-Grenzwerte um 30 % werden folgende Kennwerte erreicht (siehe Tabelle 78). Bei der Kostenschätzung wird davon ausgegangen, dass die gesamte Dämmstärke durch neue ökologische Dämmstoffe aufgebracht wird. Maßnahme Einsparung Heizenergie [kwh/a] Einsparung Heizenergie [EUR/a] Investition für gesamte Dämmstärke [EUR] Reduktion CO 2 - Emissionen [kg/a] Außenwand ca ca. 900 ca ca Fenster ca ca. 450 ca ca Kellerdecke ca ca. 300 ca ca Ob. Geschossdecke ca ca. 250 ca ca. 900 Gesamt ca ca ca ca Tabelle 78: Wirtschaftliche Kenndaten bei Sanierung nach EnEV -30 % 172
175 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Anlagentechnik Dämmung der Rohrleitungen nach EnEV 2009 für Warmwasser und Heizung Eine nachträgliche Dämmung der Verteilleitungen für Heizung und Warmwasser außerhalb der thermischen Hülle nach den Grenzwerten der EnEV 2009 führt zu einer Reduktion der Wärmeverluste über die Rohrleitungen. Die daraus resultierenden Kennwerte werden in Tabelle 79 dargestellt. Maßnahme Dämmung Verteilleitungen Einsparung Heizenergie [kwh/a] Einsparung Heizkosten [EUR/a] Investition [EUR] Reduktion CO 2 - Emissionen [kg/a] ca ca. 90 ca ca. 200 Tabelle 79: Wirtschaftliche Kenndaten bei Dämmung der Rohrleitungen nach EnEV Das Temperaturniveau des Heizkreises ist sehr hoch. Im Zuge einer Sanierung sollte die gesamte Heizungsverteilung erneuert und die Vorlauftemperaturen gesenkt werden. Solarthermieanlage/ Photovoltaik: Die zur Verfügung stehenden Dachflächen könnten für Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen genutzt werden. Unter Berücksichtigung der geplanten Entwicklungen zur Fernwärmeversorgung über Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), sollte auf eine Wärmeerzeugung durch Solarthermie aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Fernwärme abgesehen werden. 86 Jedoch könnten die Dachflächen für die Stromproduktion durch Photovoltaikanlagen genutzt werden. Bei einer Inbetriebnahme ab dem 1. Januar 2013 betragen die Vergütungssätze 0,1614 EUR/kWh bei einer Anlagengröße von kw p 87. Die Vergütungssätze bei einer Inbetriebnahme nach Januar 2013 stehen noch nicht fest. 86 Laut Protokoll vom , Projekt KKK206, Bad Belzig, Thema Fernwärmeversorgung der Wohnsiedlungen Klinkengrund und Kurparksiedlung 87 Quelle: 173
176 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Abbildung 119: Bestückung der Dachfläche mit Photovoltaikanlagen Da die lange Seite des Satteldaches nach Südwesten ausgerichtet ist, eignet sie sich für die Nutzung von Photovoltaikanlagen. Die Dachneigung beträgt Abbildung 119 zeigt eine mögliche Anordnung von Photovoltaikmodulen. Die Leistung der dargestellten Anlage beträgt 26,50 kw p. In folgender Tabelle 80 werden die wirtschaftlichen Kenndaten der Anlage dargestellt. 89 Jährliche Stromerzeugung [kwh/a] Investition Gesamt [EUR] Einspeisevergütung Prognose 20 Jahre [EUR] Amortisationszeit [a] CO 2 - Einsparung [t/a] ,0 Tabelle 80: Wirtschaftliche Kenndaten der Photovoltaikanlage Empfohlene Maßnahmen Für die Sanierung der Gebäudehülle besteht aufgrund der erfolgten Sanierung kein kurzfristiger Handlungsbedarf. 88 Dachschnitt aus Plänen von Frau Wachner, Wohnungsgenossenschaft Klinkengrund 89 Die Angaben beziehen sich auf die Berechnung im Rahmen eines Angebots der Sonnenhandwerker, Bearbeitung von Ralf Schmidt 90 Komplettsystem Basic, German-Modul, 250 W p 174
177 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Bei einer Sanierung zu einem späteren Zeitpunkt ist es sinnvoll, die bestehende Dämmung zu erneuern und die aktuellen Grenzwerte der EnEV 2009 um ca. 30 % zu unterschreiten, um den Heizenergiebedarf deutlich zu reduzieren. Zudem können durch diese Unterschreitung der Grenzwerte ggf. Fördermittel, wie der KfW-Bank, angefragt werden. Bei der Sanierung wird empfohlen, ökologische und nachhaltige Bau- und Dämmstoffe zu nutzen, da bereits beim Bau, bzw. einer Sanierung auf die Umweltbilanz der verwendeten Baustoffe geachtet werden sollte. Nachwachsende Dämmstoffe wie Holzfasern, Zellulose oder Hanffasern bieten eine gute Alternative zu konventionellen mineralischen, synthetischen und mineralisch-synthetischen Dämmstoffen. Dabei werden vergleichbare Wärmeleitkoeffizienten (λ = 0,040 W/mK) wie bei herkömmlichen Dämmstoffen erreicht. Hanffaser-Dämmungen z. B. bringen schon vor dem Einbau eine positive CO 2 -Bilanz mit. Im Rahmen einer Sanierung sollten die Heizungsverteilung und die Wärmeübertragungsflächen erneuert und die Systemtemperaturen von Vorlauf und Rücklauf abgesenkt werden. Damit können die Leitungswärmeverluste reduziert und die Behaglichkeit in den Wohnräumen erhöht werden. Auch sind in Verbindung mit der geplanten Kraft- Wärme-Kopplungsanlage als Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Bad Belzig niedrige Systemtemperaturen anzustreben, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Folgende Abbildung 120 zeigt, wie der Heizenergieverbrauch durch die vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen gesenkt werden kann. Heizenergiekennwert Co 2 Emission 21 kg/(m² * a) Nach Sanierung: 76 Abbildung 120: Heizenergiekennwert nach Sanierungsmaßnahmen Vergleichbare Gebäude der WG Klinkengrund Tabelle 81 zeigt die mit dem Referenzobjekt vergleichbaren Gebäude im Klinkengrund auf. Vier Gebäude in der Friedrich-Schiller-Straße sind nahezu identisch mit dem Referenzobjekt. Weitere zehn Gebäude eines anderen Gebäudetyps, gleichem dem Gebäude hinsichtlich 175
178 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand des energetischen Standards, so dass die vorgeschlagenen Maßnahmen pauschal auf diese Gebäude übertragen werden können. Objekt Friedrich-Schiller-Str. 1-5 Friedrich-Schiller-Str Friedrich-Schiller-Str Friedrich-Schiller-Str Goethestraße 12 Goethestraße 13/15 Goethestraße 17/19 Goethestraße 17A Erich-Weinert-Straße Heinrich-Heine-Straße 2-6 Heinrich-Heine-Straße 8-14 Hans-Marchwitza-Str Erich-Weinert-Str Friedrich-Schiller-Str Fläche [m²] Bemerkung 1.104,12 Gleicher Typ wie Referenzgebäude 1.044,00 Gleicher Typ wie Referenzgebäude 1.080,90 Gleicher Typ wie Referenzgebäude 1.485,42 Gleicher Typ wie Referenzgebäude 330,04 Anderer Gebäudetyp, gleicher energetischer Standard wie Referenzobjekt 465,20 Anderer Gebäudetyp, gleicher energetischer Standard wie Referenzobjekt 491,12 Anderer Gebäudetyp, gleicher energetischer Standard wie Referenzobjekt 60,74 Anderer Gebäudetyp, gleicher energetischer Standard wie Referenzobjekt 864,00 Anderer Gebäudetyp, gleicher energetischer Standard wie Referenzobjekt 1.185,60 Anderer Gebäudetyp, gleicher energetischer Standard wie Referenzobjekt 1.892,80 Anderer Gebäudetyp, gleicher energetischer Standard wie Referenzobjekt 3.826,93 Anderer Gebäudetyp, gleicher energetischer Standard wie Referenzobjekt 1.910,24 Anderer Gebäudetyp, gleicher energetischer Standard wie Referenzobjekt 1.603,95 Anderer Gebäudetyp, gleicher energetischer Standard wie Referenzobjekt Tabelle 81: Mit dem Referenzgebäude vergleichbare Gebäude im Klinkengrund 176
179 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand 8.2. Untersuchung Referenzobjekt: Erich-Weinert-Straße Bestandsaufnahme Das Objekt in der Erich-Weinert-Straße besteht aus vier Häusern mit jeweils fünf Geschossen und insgesamt 74 Wohneinheiten. Im Erdgeschoss befinden sich zum Teil Gewerbeflächen. Die Gesamtwohnfläche der vier Häuser beträgt m² 91. Nach EnEV 2009 beträgt die Gebäudenutzfläche somit m² 92. Die Häuser sind als Plattenbau WBS 70 mit Flachdach im Jahr 1989 errichtet worden. Energieverbrauch und energetische Bewertung Der Wärmeverbrauch des Objekts kann anhand der Verbrauchsdaten von dargestellt und über Vergleichswerte der EnEV 2009 eingestuft werden (Tabelle 82). Fernwärme [MWh/a] Klimabereinigter Wert [MWh/a] 93 Verbrauch ,80 479,97 Verbrauch ,38 481,74 Verbrauch ,94 494,97 Durchschnittswert 485,56 Tabelle 82: Wärmeverbrauchswerte von Der durchschnittliche klimabereinigte Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser über die Jahre beträgt auf die Gebäudenutzfläche der Häuser bezogen rd. 92 kwh/m²a. Abbildung 121 zeigt den spezifischen Wärmeverbrauch im Vergleich zu typischen Kennwerten der EnEV Diese Abbildung dient nur als Veranschaulichung des Energieverbrauchs und ersetzt nicht den bedarfsorientierten Energieausweis der EnEV Information von Herrn Udo Kunze, BEWOG 92 Nach EnEV 2009: Gebäudenutzfläche bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohneinheiten = 1,2*Wohnfläche 93 Multiplikation mit dem Klimafaktor für Energieverbrauchskennwerte nach EnEV, für die Wetterstation Berlin-Tempelhof, Quelle: Institut Wohnen und Umwelt
180 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Heizenergiekennwert Co 2 Emission 25 kg/(m² * a) 92 Abbildung 121: Einordnung des Energieverbrauchs mit Vergleichswerten der EnEV 2009 Der Vergleich des spezifischen Wärmeverbrauchs mit Referenzwerten aus der EnEV 2009 zeigt, dass das zu betrachtende Objekt zwischen den Kennwerten für MFH Neubau und EFH Neubau liegt. Der Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwärme beheizten Gebäudes liegt laut der EnEV normalerweise um % unter vergleichbaren Gebäuden mit Kesselheizung. Thermische Hülle 1995 wurden an dem Referenzobjekt energetische Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Dabei wurden die Außenwände, die oberste Geschossdecke sowie die Kellerdecke wärmegedämmt und die Fenster ausgetauscht. Die alten Fenster wurden durch neue Kunststofffenster mit Isolierverglasung mit einem U- Wert von 1,8 W/m²K ersetzt. Die oberste Geschossdecke wurde mit mineralischen Faserstoffen mit einer Stärke von 10 cm gedämmt. 94 Die Außenwand wurde mit ca. 8 cm Dämmwolle gedämmt. An die Kellerdecken wurden ebenfalls ca. 8 cm dicke Dämmplatten angebracht. 95 Der Keller selbst ist ungedämmt und liegt außerhalb der thermischen Hülle. Für die Außenbauteile der thermischen Hülle liegen hinsichtlich der Bauteilaufbauten keine detaillierten Angaben vor. Um Einsparpotenziale durch Sanierungsmaßnahmen berechnen zu können, wurden Pauschalwerte für die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) vor und nach der Sanierung angesetzt. Diese werden in folgender Tabelle 83 dargestellt und mit den Grenzwerten aus der bei der Sanierung geltenden Wärmeschutzverordnung 1995 und den aktuellen Grenzwerten aus der EnEV 2009 verglichen. 94 Othmer, J. u. a.,: Wettbewerb Energetische Sanierung von Großwohnsiedlungen Wohngebiet Klinkengrund Geschätzte Daten/ Aussage von Herrn Udo Kunze, Bewog, im Telefoninterview am
181 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Bauteil U-Wert vor San. [W/m²K] U-Wert nach San. [W/m²K] U-Grenzwert WSchVO 1995 [W/m²K] U-Grenzwert EnEV 2009 [W/m²K] Fenster 1, ,8 1,3 Außenwand 0, , ,40 0,24 Oberste Geschossdecke 0,43 0,22 0,30 0,24 Kellerdecke 1,16 0, ,50 0,3 Tabelle 83: Bauteilkennwerte des Objekts in der Erich-Weinert-Straße In Tabelle 83 wird deutlich, dass die oberste Geschossdecke bereits nach heutigen Grenzwerten ausreichend gedämmt ist, die anderen Bauteile jedoch Optimierungspotenziale aufweisen. Anlagentechnik Die Heizung und die Warmwasserbereitung des Gebäudes erfolgen über Fernwärme der Stadtwerke Belzig. Die Übergabe erfolgt über einen Fernwärmeanschluss im Direktsystem. Die Fernwärme-Übergabestation verfügt über zwei witterungsgeführt geregelte Heizkreise. Eine Rücklauftemperaturbegrenzung der Station ist nicht vorhanden. Die maximale Vorlauftemperatur der Heizkreise beträgt 85 C. Die Anlagentechnik und die Hausanschlussstation befinden sich derzeit noch auf dem Stand von Auch wurde das Wärmeverteilnetz bisher nicht hydraulisch abgeglichen. 99 Eine Strangsanierung wurde 1995 im Rahmen der energetischen Sanierung durchgeführt. Zudem wurden die Wasserversorgungsleitungen sowie die Heizungsverteilungen im Kellergeschoss saniert Maßnahmenanalyse zur Optimierung Thermische Hülle Dämmung der Bauteile der thermischen Hülle nach EnEV 2009 Da die U-Werte der Außenbauteile von den Grenzwerten nach der EnEV 2009 abweichen, wird im Folgenden eine Ertüchtigung der thermischen Hülle zur Erreichung der EnEV 2009 untersucht. Folgende Tabelle 84 stellt die Dämmstärken dar, welche zur Erreichung der aktuellen EnEV- Grenzwerte zusätzlich zu den bisherigen Dämmstärken notwendig sind. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Pauschalwerte für den Bauteilaufbau nach WBS 70 sowie die Angaben zu den bisherigen Dämmmaßnahmen zutreffen und die Dämmungen noch nutzbar sind. 96 Angabe vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, telefonische Auskunft von Frau Brigitte Mann 11/ Annahme: 8 cm Dämmwolle (Aussage Herr Kunze, BEWOG) mit WLG Annahme: 8 cm Styropor (Aussage Herr Kunze, BEWOG) WLG Quelle: Aussage von Herrn Udo Kunze, Bewog, im Telefoninterview am Othmer, J. u. a.,: Wettbewerb Energetische Sanierung von Großwohnsiedlungen Wohngebiet Klinkengrund
182 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Bauteil U-Wert nach Sanierung [W/m²K] U-Wert Grenzwert EnEV 2009 [W/m²K] Benötigte zus. Dämmung zur Erreichung des Grenzwertes Durch Dämmung erreichter Wert [W/m²K] Außenwand 0,32 0,24 4 cm WLG 040 0,24 Oberste Geschossdecke 0,22 0, Kellerdecke 0,38 0,3 4 cm WLG 040 0,28 Fenster 1,8 1,3 z. B. 2-Scheiben- Wärmeschutzverglasung U g = 1,1; U f = 1,2 101 Tabelle 84: Benötigte Dämmstärken zur Erreichung des Grenzwertes nach EnEV 2009 Im Folgenden werden die Einsparpotenziale durch o. g. Sanierungsmaßnahmen berechnet und dargestellt (Tabelle 85). Da für das Gebäude weder Grundrisse noch Bauteilaufbauten vorliegen, konnten diese Berechnungen nur sehr pauschal ausgeführt werden. 1,3 Maßnahme Sanierung EnEV 2009 Einsparung Heizenergie [kwh/a] Einsparung Heizkosten [EUR/a] Investition [EUR] Reduktion CO 2 - Emissionen [t/a] ca ca ca ca. 14,0 Tabelle 85: Wirtschaftliche Kenndaten bei Sanierung nach EnEV Die Untersuchung zeigt, dass eine Sanierung um die Grenzwerte der EnEV 2009 zu erreichen, nur geringe zusätzliche Dämmstärken erfordert. Eine solche Sanierung kann hinsichtlich des Aufwands der Sanierung nicht als sinnvoll erachtet werden. Bei einer Sanierung zu einem späteren Zeitpunkt (z. B. bei Mängeln an den bestehenden Dämmstoffen) wäre es sinnvoll, die bestehende Dämmung durch neue ökologische Dämmstoffe zu ersetzen und die EnEV-Grenzwerte um ca. 30% zu unterschreiten. Diese Maßnahmen werden im Folgenden untersucht. Dämmung der Bauteile der thermischen Hülle: Unterschreitung der EnEV um 30 % In folgender Tabelle 86 wird dargestellt, welche U-Werte erreicht werden müssen und welche zusätzlichen Dämmstärken notwendig sind, um die EnEV-Grenzwerte um 30 % zu unterschreiten. 101 g = 0,6, Rahmenanteil = 30%, Bauteil aus Katalog, Energieberater Plus, Hottgenroth 180
183 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Bauteil U-Wert Grenzwert EnEV 2009 [W/m²K] Benötigte zusätzliche Dämmung zur EnEV- Unterschreitung -30% Erreichter U-Wert [W/m²K] Außenwand 0,24 12 cm WLG 040 0,16 Oberste Geschossdecke 0,24 6 cm WLG 040 0,17 Kellerdecke 0,3 10 cm WLG 040 0,20 Fenster 1,3 3-Scheiben- Wärmeschutzvergl., Passivhausfenster Tabelle 86: Zusätzliche Dämmstärke bei Sanierung nach EnEV -30 % Anhand der dargestellten Maßnahmen wurden resultierende Einsparpotenziale berechnet und in folgender Tabelle 87 dargestellt. Bei der Kostenschätzung wird davon ausgegangen, dass die bestehenden Dämmstoffe durch neue ökologische Dämmstoffe ersetzt wurden. Maßnahme Einsparung Heizenergie [kwh/a] Einsparung Heizkosten [EUR/a] Investition für gesamte Dämmstärke [EUR] Reduktion CO 2 - Emissionen Außenwand ca ca ca ca. 11,0 oberste Geschossdecke [t/a] ca ca. 300 ca ca. 0,9 Kellerdecke ca ca. 800 ca ca. 2,0 Fenster ca ca ca ca. 12,0 Alle Bauteile ca ca ca ca. 27,00 Tabelle 87: Wirtschaftliche Kenndaten bei Sanierung nach EnEV -30 % Anlagentechnik Optimierung der Anlagentechnik In dem seit 1989 unveränderten Wärmeverteilnetz sollten im Rahmen einer energetischen Sanierung die Heizungsverteilung und die Wärmeübertragungsflächen erneuert und die Systemtemperaturen von Vorlauf und Rücklauf abgesenkt werden (siehe Goethestraße 14-18). Damit können die Leitungswärmeverluste reduziert und durch die geringeren Oberflächentemperaturen auch die Behaglichkeit in den Wohnräumen erhöht werden. Auch sind in Verbindung mit der geplanten Kraft-Wärme-Kopplungsanlage der Stadtwerke Bad Belzig geringere Systemtemperaturen anzustreben, um einen effizienten Betrieb der KWK-Anlage sicher zu stellen. Die Fernwärmeübergabestation sollte auf ein indirektes System umgebaut und mit einer Rücklauftemperaturbegrenzung ausgestattet werden. Das Wärmeverteilnetz inkl. Warmwasser- und Zirkulationsleitung sollte nach dem Standard der EnEV 2009 gedämmt werden. 0,91 181
184 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Folgende Tabelle 88 zeigt die durch eine Optimierung der Anlagentechnik zu erwartenden Einsparpotenziale. Maßnahme Optimierung Anlagentechnik Einsparung Heizenergie [kwh/a] Einsparung Heizkosten [EUR/a] Investition [EUR] Einsp. CO 2 - Emissionen [t/a] ca ca ca ca. 10 Tabelle 88: Wirtschaftliche Kenndaten bei optimierter Anlagentechnik Photovoltaikanlagen Da es sich bei den vier Häusern des Objekts um Flachdächer handelt, können auf den Dächern Photovoltaikanlagen in Südrichtung aufgeständert werden. Die mögliche Leistungsgröße der Anlage wurde anhand der vorhandenen Dachflächen überprüft. Für die Berechnung wurde von einer Modulleistung von 250 W 102 ausgegangen. Die gesamte installierte Leistung bei einer Aufständerung nach folgender Abbildung 122 beträgt 30 kw p. 102 Komplettsystem Basic, German-Modul, 250 W p 182
185 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Abbildung 122: Mögliche Aufstellung von Photovoltaik-Modulen Erich-Weinert-Straße Die Ertragsprognose sowie die wirtschaftlichen Kenndaten werden in folgender Tabelle 89 dargestellt. Jährlicher Energieertrag [kwh/a] Investition [EUR] Einspeisevergütung Prognose 20 Jahre [EUR] Amortisationszeit [a] CO 2 - Einsparung [t/a] Tabelle 89: Wirtschaftliche Kenndaten bei Installation einer Photovoltaikanlage Empfohlene Maßnahmen Im ersten Schritt werden die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs, die Erneuerung der Fernwärmeübergabestation sowie der Umbau auf ein indirektes System empfohlen. Für die Sanierung der Gebäudehülle besteht aufgrund der erfolgten Sanierung kein kurzfristiger Handlungsbedarf. 103 Angebot Sonnenhandwerker GmbH, Bearbeitung durch Ralf Schmidt 183
186 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Falls eine Sanierung zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wird, ist es sinnvoll, die bestehende Dämmung zu erneuern und die aktuellen Grenzwerte der EnEV 2009 um 30 % zu unterschreiten. Durch diese Unterschreitung wird der Heizenergiebedarf deutlich reduziert und es können ggf. Fördermittel, wie der KfW-Bank, angefragt werden. Auch sollten bei einer Sanierung die ökologischen Gesichtspunkte bezüglich der Verwendung von Bau- und Dämmstoffen berücksichtigt werden, siehe dazu Punkt Die genannten Maßnahmen führen zu einer deutlichen Reduktion des Heizwärmeverbrauchs und der CO 2 -Emissionen. Folgende Abbildung 123 zeigt den spezifischen Heizenergiekennwert nach Durchführung der vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen. Heizenergiekennwert Co 2 Emission 18 kg/(m² * a) Nach Sanierung: 64 Abbildung 123: Energieverbrauchswert nach Sanierungsmaßnahmen Vergleichbare Gebäude der BEWOG Folgende Tabelle zeigt die Objekte, welche hinsichtlich des energetischen Standards der Erich-Weinert-Straße entsprechen. In einigen Objekten ist der Standard etwas besser, da in diesen Gebäuden bereits Optimierungsmaßnahmen in der Anlagentechnik durchgeführt wurden (s. u. Bemerkung). 184
187 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Objekt Wohnfläche [m²] Hans-Marchwitza-Str ,59 Hans-Marchwitza-Str ,35 Hans-Marchwitza-Str. 6,8,10,12 Hans-Marchwitza-Str. 17,19, ,06 Gewerbefläche [m²] Bemerkung 2161,14 Hydr. Abgleich (2011); neue HAST; Leitungsdämmung innerhalb der Wohnungen Lessingstr. 2, ,76 Hydr. Abgleich (2011); neue HAST; Leitungsdämmung innerhalb der Wohnungen Lessingstr. 6, ,8 Hydr. Abgleich (2011); neue HAST; Leitungsdämmung innerhalb der Wohnungen Hans-Marchwitza-Str. 25 Hans-Marchwitza-Str. 27, 29 Hans-Marchwitza-Str. 30, 32 Hans-Marchwitza-Str. 31, 33 Hans-Marchwitza-Str. 34, 36 Hans-Marchwitza-Str. 38, 40 Hans-Marchwitza-Str. 42, 44 Hans-Marchwitza-Str. 46, 48 Hans-Marchwitza-Str. 50, 52 Hans-Marchwitza-Str. 54, 56 Hans-Marchwitza-Str. 58,60,62,64 Hans-Marchwitza-Str. 66,68,70, ,1 281,56 Hydr. Abgleich (2011); neue HAST; Leitungsdämmung innerhalb der Wohnungen 1081,68 890, ,68 978,36 898,76 980,48 898,76 892,76 964, , ,23 Hans-Marchwitza-Str. 74,76,78,80 Hans-Marchwitza-Str. 82,84,86, ,4 1910,4 109,58 185
188 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Friedrich-Schiller- Str.22,24,26,28 Friedrich-Schiller-Str. 27 Friedrich-Schiller- Str.29,31,33,35 Friedrich-Schiller- Str.30,32,34, , ,75 Hydr. Abgleich (2011); neue HAST; Leitungsdämmung innerhalb der Wohnungen 1858,4 1852,68 Tabelle 90: Vergleichbare Gebäude wie die Erich-Weinert-Straße 15-27, Bestand BEWOG 8.3. Untersuchung Referenzobjekt: Weitzgrunder Straße Bestandsaufnahme Das Mehrfamilienhaus in der Weitzgrunder Straße 9 ist ein dreigeschossiges Gebäude mit sechs Wohneinheiten. Errichtet wurde es ca in massiver Bauweise. Die Wohnfläche beträgt seit der Sanierung im Jahr 2004 rund 466 m². 104 Daraus ergibt sich eine Gebäudenutzfläche nach EnEV von 560 m². 105 Energieverbrauch und energetische Bewertung Für die Jahre 2009 bis 2011 Jahre liegen Erdgas-Verbrauchsabrechnungen für Heizung und Warmwasser vor. Die Verbrauchswerte werden in folgender Tabelle 91 dargestellt. Verbrauch [kwh/a] Klimabereinigter Wert [kwh/a] 106 Bezug , ,1 Bezug , ,8 Bezug , ,2 Durchschnittlicher Verbrauch ,0 Tabelle 91: Erdgasverbrauch Weitzgrunder Straße , Quelle: Minol Über den witterungsbereinigten durchschnittlichen Verbrauchswert wird der energetische Kennwert nach EnEV berechnet. Auf die Gebäudenutzfläche bezogen beträgt der Verbrauchswert ca. 90 kwh/m²a. Abbildung 124 zeigt den spezifischen Wärmeverbrauch verglichen mit EnEV-Referenzwerten für Wohngebäude. Diese Abbildung ersetzt nicht den bedarfsorientierten Energieausweis der EnEV Angaben basieren auf der Dokumentation zur Sanierung der Roland Zimmer GmbH, Nach EnEV 2009: Gebäudenutzfläche bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohneinheiten = 1,2*Wohnfläche 106 Multiplikation mit dem Klimafaktor für Energieverbrauchskennwerte nach EnEV, für die Wetterstation Berlin-Tempelhof, Quelle: Institut Wohnen und Umwelt
189 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Heizenergiekennwert Co 2 Emission 20 kg/(m² * a) 90 Abbildung 124: Einordnung des Energieverbrauchs nach EnEV Abbildung 124 zeigt, dass der Wert über dem energetischen Kennwert für ein neu erbautes Mehrfamilienhaus, jedoch unter dem Wert für ein neu erbautes Einfamilienhaus liegt. Thermische Hülle Im Rahmen der Sanierung von 2004 wurde die thermische Hülle nach den Grenzwerten der damals gültigen Energiesparverordnung (nach EnEV 2002) saniert. Dabei wurden im Keller die Außenwände sowohl horizontal als vertikal neu isoliert. Das Gebäude ist bis ca. 1,2 m tief in den Boden eingebunden. Die alten Kellertüren wurden entsorgt und durch neue Lattentüren getauscht. Die alten Holzkellerfenster wurden durch moderne Stahlkellerfenster ersetzt. An die Kellerdecke wurde eine 4 cm starke Wärmedämmung als Wärmedämmverbundsystem mit Gewebeputz angebracht. Sämtliche Fenster des Gebäudes wurden erneuert und als Holzfenster mit Wärmeschutzverglasung neu eingebaut. Die Hauseingangstür wurde erneuert. Die Fassade wurde mit einem Wärmedämmverbundsystem von 8 cm Polystyrol-Hartschaum gedämmt. Die Dacheindeckung und die Regenschutzanlage wurden komplett erneuert. Als Dachsteine wurden Betondachsteine verwendet. Zusätzlich wurde eine Zwischensparrendämmung mit einer Stärke von 14 cm eingebracht. 107 Tabelle 92 zeigt die anhand der Angaben pauschal angesetzten U-Werte der Bauteile im Vergleich mit den Grenzwerten der EnEV 2002 und der aktuellen EnEV Angaben basieren auf der Dokumentation zur Sanierung von Roland Zimmer GmbH,
190 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Bauteil U-Wert vor Sanierung 108 [W/m²K] U-Wert nach Sanierung [W/m²K] U-Wert Grenzwert EnEV 2002 [W/m²K] U-Wert Grenzwert EnEV 2009 [W/m²K] Fenster - 1,7 1,7 1,3 Außenwand 1,7 0, ,35 0,24 Dach 1,4 0, ,3 0,24 Kellerdecke 1,2 0, ,5 0,3 Tabelle 92: U-Grenzwerte nach der EnEV 2002 und 2009 Deutlich wird, dass die U-Werte nach der aktuell gültigen EnEV 2009 stark von den Grenzwerten der EnEV 2002 abweichen, da die Anforderungen deutlich angestiegen sind. Anlagentechnik Im Rahmen der Sanierung 2004 wurde eine Zentralheizung mit zentraler Warmwasserbereitung auf der Basis von Erdgas eingebaut, dabei wurde ein Erdgasanschluss gelegt. Die Wärmeversorgungsanlage wurde als Brennwert- Wandheizkessel errichtet. Die Raumbeheizung erfolgt über Flachheizkörper mit Thermostatventilen. Die Heizungsrohre wurden im unbeheizten Keller gedämmt. Die Heizungsrohre in den beheizten Geschossen sind nicht isoliert. Die Heizung wird witterungsgeführt und mit Nachtabsenkung gefahren. 112 Bisher wurde in dem Objekt kein hydraulischer Abgleich durchgeführt Maßnahmenanalyse zur Optimierung Thermische Hülle Die Außenbauteile der thermischen Hülle wurden 2004 nach damaligen Grenzwerten saniert. Unter der Voraussetzung, dass die Dämmstärken von 2004 noch nutzbar sind und die angenommenen Angaben zutreffen, müssten die Außenbauteile leicht nachgedämmt werden, um die heutigen Grenzwerte zu erreichen. Folgende Tabelle 93 zeigt die notwendigen zusätzlichen Dämmstärken zur Erreichung der aktuellen Grenzwerte auf. 108 Nach den Pauschalwerten für Wärmedurchgangskoeffizienten für die Baualtersklasse 1919 bis 1948 aus der Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebäudebestand, BMVBS, Unter Annahme einer Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/mK bei 8 cm Dämmung 110 Bei einem angenommenen Sparrenanteil von 10 % und einer WLG 040 für die Zwischensparrendämmung 111 Bei einer angenommenen Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/m²K 112 Aussage von Herrn Tschiersch, Wohnungsbaugenossenschaft 1919 Bad Belzig eg, Telefoninterview am von Herrn Tschiersch, Wohnungsbaugenossenschaft 1919 Bad Belzig eg,
191 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Bauteil U-Istwert [W/m²K] U-Grenzwert EnEV 2009 [W/m²K] Benötigte Dämmung zur Erreichung des Grenzwertes Fenster 1,7 1,3 z. B. 2-Scheiben- Wärmeschutzverglasu ng Ug = 1,1; Uf = 1,2 114 Erreichter U-Wert durch Dämmstärke [W/m²K] AW 0,35 0,24 6 cm WLG 040 0,23 Dach 0,28 0,24 4 cm WLG 040 0,23 Kellerdecke 0,5 0,3 6 cm WLG 040 0,29 Tabelle 93: Benötigte Dämmstärken zur Erreichung des Grenzwertes nach der EnEV 2009 Im Folgenden wird die Einsparung der Heizenergie durch eine Verbesserung der Außenbauteile der thermischen Hülle nach der EnEV 2009 pauschal berechnet und in folgender Tabelle 94 dargestellt. 1,3 Maßnahme Gesamtsanierung nach EnEV 2009 Einsparung Heizenergie [kwh/a] Einsparung Heizkosten [EUR/a] Investition [EUR] Reduktion CO 2 - Emissionen [t/a] ca ca. 600 ca ca. 2,2 Tabelle 94: Wirtschaftliche Kenndaten bei Sanierung nach EnEV Die Tabelle 94 zeigt, dass die Investition in keinem Verhältnis zu der zu erwartenden Einsparung steht. Daher wird im Folgenden untersucht, wie sich eine Sanierung auf eine Unterschreitung der EnEV-Grenzwerte um 30 % auswirkt. Sanierung der thermischen Hülle: EnEV Unterschreitung um 30 % Wird eine Sanierung zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt (z. B. bei Mängeln an der bestehenden Dämmung), ist es sinnvoll, durch diese Sanierung eine deutliche Einsparung an Heizwärme und CO 2 -Emissionen zu erreichen. Dafür wird vorgeschlagen, bei einer weiteren Sanierung die bestehende Dämmung zu entfernen und durch neue ökologische Dämmstoffen zu ersetzen und die EnEV-Grenzwerte um min. 30 % zu unterschreiten. Folgende Tabelle 95 zeigt die zusätzlichen Dämmstärken auf, welche für eine Unterschreitung der EnEV-Grenzwerte um 30 % notwendig sind. 114 g = 0,6, Rahmenanteil = 30 %, Bauteil aus Katalog, Energieberater Plus, Hottgenroth 189
192 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Bauteil U-Wert Grenzwert EnEV 2009 [W/m²K] Benötigte zusätzl. Dämmung zur Unterschreitung der EnEV- Grenzwerte um 30% Erreichter U-Wert [W/m²K] Außenwand 0,24 14 cm WLG 040 0,16 Dach 0,24 12 cm WLG 040 0,16 Kellerdecke 0,3 12 cm WLG 040 0,20 Fenster 1,3 3-Scheiben- Wärmeschutzvergl. Tabelle 95: Zusätzliche Dämmung zur Unterschreitung der EnEV um 30 % Mit den dargestellten U-Werten wurden die zu möglichen Einsparpotenziale berechnet. Diese werden in folgender Tabelle 96 dargestellt (bei der Kostenschätzung wurde davon ausgegangen, dass die bestehende Dämmung durch neue ökologische Dämmstoffe ersetzt wird). Maßnahme Einsparung Heizenergie [kwh/a] Einsparung Heizkosten [EUR/a] Investition für gesamte Dämmstärke [EUR] 0,91 Reduktion CO 2 - Emissionen Außenwand ca ca. 500 ca ca. 1,7 Kellerdecke ca ca. 200 ca ca. 0,6 Fenster ca ca. 300 ca ca. 1,0 Dach ca ca. 170 ca ca. 0,5 Gesamt ca ca ca. 3,8 Tabelle 96: Wirtschaftliche Kenndaten bei Sanierung nach EnEV -30 % Anlagentechnik Hydraulischer Abgleich und Dämmung der Warmwasser- und Zirkulationsleitungen Da in dem betrachteten Objekt bislang noch kein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde, ist dieser gemäß DIN sowie EnEV 2009 zu empfehlen. Der hydraulische Abgleich umfasst den Einbau von Strangregulier- und Absperrventilen sowie die Montage voreinstellbarer Thermostatventile. Auch ist der Einsatz von Hocheffizienzpumpen zur Umwälzung der Wärmemengen vorzusehen. Eine Dämmung der Warmwasser- und Zirkulationsleitungen nach aktuellem Standard führt zu einer weiteren Reduktion der Wärmeverluste. Die zu erreichenden Einsparungen dieser Maßnahmen werden in folgender Tabelle 97 dargestellt. [t/a] 190
193 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Maßnahme Optimierung Anlagentechnik Einsparung Heizenergie [kwh/a] Einsparung Heizkosten [EUR/a] Investition [EUR] Reduktion CO 2 - Emissionen [t/a] ca ca. 140 ca ca. 0,5 Tabelle 97: Wirtschaftliche Kenndaten bei Optimierung der Anlagentechnik Empfohlene Maßnahmen Im ersten Schritt werden die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs sowie die Dämmung der Warmwasser- und Zirkulationsleitungen empfohlen. Da das Gebäude bereits 2004 saniert worden ist, besteht für eine weitere Sanierung kein direkter Handlungsbedarf. Um die Wärmeverluste jedoch weiter zu reduzieren, sollten bei einer Sanierung zu einem späteren Zeitpunkt (z. B. bei Mängeln an den bestehenden Dämmstoffen) die Dämmung erneuert und die Grenzwerte der EnEV 2009 um ca. 30 % unterschritten werden. Durch eine Unterschreitung der Grenzwerte können bei einer Sanierung ggf. Fördermittel, wie von der KfW-Bank, beantragt werden. Auch sollten bei der Sanierung die ökologischen Gesichtspunkte bezüglich der Verwendung von Bau- und Dämmstoffen, wie unter Punkt bereits beschrieben, beachtet werden. Die hier aufgeführten Maßnahmen führen zu einer Reduktion des Heizenergieverbrauchs und der CO 2 -Emissionen. Folgende Abbildung zeigt den spezifischen Heizenergiekennwert nach Durchführung der vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen. Heizenergiekennwert Co 2 Emission 12 kg/(m² * a) Nach Sanierung: 55 Abbildung 125: Energieverbrauchswert nach Sanierung 191
194 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Vergleichbare Gebäude der WBG 1919 Bad Belzig eg Trotz des Standorts in der Weitzgrunder Straße, welche außerhalb des Wohngebiets Klinkengrund, Kurparksiedlung oder Altstadt liegt, eignet sich das Gebäude als Referenzobjekt für die Untersuchung des energetischen Gebäudebestands im Klinkengrund, da weitere sieben Objekte der Wohnungsbaugenossenschaft 1919 Bad Belzig eg im Klinkengrund diesem energetischen Gebäudebestand entsprechen. Insgesamt weisen neben dem Referenzobjekt weitere 13 Gebäude annähernd denselben Standard auf wie das Objekt in der Weitzgrunder Straße 9. Diese werden in folgender Tabelle 98 dargestellt. Damit entspricht der Gebäudebestand einem recht guten energetischen Standard hinsichtlich der Gebäudehülle. Optimierungspotenziale bestehen jedoch hinsichtlich der Anlagentechnik. In keinem dieser Gebäude wurde bisher ein hydraulischer Abgleich durchgeführt. Objekt Gebiet Wohnfläche [m²] Karl- Marx- Straße ,05 Karl- Marx- Straße ,16 Weitzgrunder Straße ,69 R.- Breitscheid- Straße 1 280,47 R.- Breitscheid- Straße 3 266,75 Friedrich- Schiller- Straße ,69 Goethestraße ,8 Goethestraße ,77 Goethstraße ,27 Goethestraße ,84 Goethestraße ,58 Goethestraße ,3 Weitzgrunder Straße 9 466,29 August- Bebel- Straße 4 307,25 GESAMT 7.628,91 Tabelle 98: Mit Referenzgebäude vergleichbare Gebäude in Bad Belzig 8.4. Untersuchung Referenzobjekt: Kurpark Bestandsaufnahme Das Gebäude am Kurpark 14 ist ein Neubau von Erbaut wurde es aus Kalksandstein und hat eine Wohnfläche von 824 m² bei einer Anzahl von 12 Wohneinheiten. 192
195 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Die Grundfläche nach EnEV beträgt 989 m². 115 Energieverbrauch und energetische Bewertung Für die Jahre 2009 bis 2011 liegen Verbrauchsabrechnungen für Heizung und Warmwasser vor. Der Fernwärmebezug wird in folgender Tabelle 99 dargestellt. Verbrauch [kwh/a] Klimabereinigter Wert [kwh/a] 116 Bezug Bezug Bezug Durchschnittlicher Verbrauch Tabelle 99: Fernwärmeverbrauch Kurpark Damit beträgt der spezifische Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser 78 kwh/m²a. Folgende Abbildung 126 zeigt den spezifischen Heizenergieverbrauchs verglichen mit Referenzwerten aus der EnEV Diese Abbildung gilt nur als Veranschaulichung und ersetzt nicht den bedarfsorientierten Energieausweis der EnEV Heizenergiekennwert Co 2 Emission 22 kg/(m² * a) 78 Abbildung 126: Einordnung des Energieverbrauchs nach EnEV 2009 Thermische Hüllfläche Das Gebäude wurde nach den damaligen Grenzwerten (Wärmeschutzverordnung 1995) erbaut. Bislang wurden keine Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Da für die 115 Nach EnEV 2009: Gebäudenutzfläche bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohneinheiten = 1,2*Wohnfläche 116 Multiplikation mit dem Klimafaktor für Energieverbrauchskennwerte nach EnEV, für die Wetterstation Berlin-Tempelhof, Quelle: Institut Wohnen und Umwelt
196 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Außenbauteile der thermischen Hülle keine detaillierten Informationen zu den Bauteilaufbauten und U-Werten vorliegen, werden im Folgenden Pauschalwerte für den Bau nach der Wärmeschutzverordnung 1995 angesetzt. Für die Außenwand wird der U-Wert anhand von Grundrissen pauschal ermittelt. Die angesetzten U-Werte werden in folgender Tabelle 100 dargestellt und mit den Grenzwerten nach der aktuellen EnEV 2009 verglichen. Der Keller des Objekts wird nicht beheizt, liegt jedoch bislang innerhalb der thermischen Hülle, da die Außenwände des Kellers sowie der Kellerboden gedämmt sind. Bauteil U-Wert Grenzwert WSchVO 1995 [W/m²K] U-Wert Ist pauschal [W/m²K] U-Wert Grenzwert EnEV 2009 [W/m²K] Fenster 1,8 1,8 1,3 Außenwand außen Außenwand Erde gegen gegen 0,5 0,33 0,24 0,5 0,5 0,3 Dach 0,3 0,3 0,24 Kellerboden 0,5 0,5 0,3 Kellerdecke (bisher in der thermischen Hülle) Tabelle 100: U-Werte der Außenbauteile thermische Hülle, Kurpark 14 Die Tabelle 100 verdeutlicht, dass ein nach den Grenzwerten von 1995 erbautes Gebäude nicht mehr den verschärften Anforderungen der EnEV entspricht. Anlagentechnik Die Heizung- und Warmwasserbereitung erfolgt über Fernwärme der Stadtwerke Belzig. Ein hydraulischer Abgleich wurde im Baujahr 1997 durchgeführt. Die Hausanschlussstation ist von Die Heizung wird witterungsgeführt und mit Nachtabsenkung gefahren. Zudem wurde das Energiesparsystem adapterm von der Firma Techem eingebaut. Durch diese Heizungssteuerung wird die Wärmeerzeugung reguliert und nur dann Wärme bezogen, wenn von den Bewohnern im Haus Wärme benötigt wird. 0, Maßnahmenanalyse zur Optimierung Thermische Hüllfläche Da das Gebäude erst 1997 erbaut worden ist, wird eine Sanierung auf den aktuellen EnEV- Standard nicht untersucht. Um bei einer Sanierung zu einem späteren Zeitpunkt (z. B. bei 117 Energieeinsparverordnung 2009: Anlage 3, Tabelle 1 194
197 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Mängeln an den bestehenden Dämmungen) die Transmissionswärmeverluste durch die Außenbauteile der thermischen Hülle deutlich zu reduzieren, sollte eine Unterschreitung der EnEV-Grenzwerte von 30 % erreicht werden. Hierbei wird empfohlen, die bestehenden Dämmungen zu entfernen und durch neue ökologische Dämmstoffe zu ersetzen. Da der Keller unbeheizt ist, wird anstelle einer Optimierung der Bauteile gegen Erdreich empfohlen, die Kellerdecke zu dämmen. Folgende Tabelle 101 zeigt die notwendigen zusätzlichen Dämmstärken, welche für eine Unterschreitung der EnEV-Grenzwerte um 30 % notwendig sind. Bauteil Außenwand gegen außen U-Wert Grenzwert EnEV 2009 [W/m²K] Benötigte zusätzl. Dämmung zur Unterschreitung der EnEV- Grenzwerte um 30% Erreichter U-Wert [W/m²K] 0,24 12 cm WLG 040 0,17 Dach 0,24 12 cm WLG 040 0,16 Kellerdecke 0,3 14 cm WLG 040 0,21 Fenster 1,3 3-Scheiben- Wärmeschutzvergl. Tabelle 101: Benötigte zusätzliche Dämmstärken bei Sanierung nach EnEV -30 % Werden bei einer Sanierung die oben dargestellten Grenzwerte eingehalten, können die Transmissionswärmeverluste über die Bauteile der thermischen Hülle stark reduziert werden. Die resultierenden Kennwerte werden in folgender Tabelle 102 dargestellt. Bei der Kostenschätzung wird davon ausgegangen, dass die bestehenden Dämmstoffe durch ökologische Dämmstoffe ersetzt werden. Maßnahme Außenwand gegen außen Einsparung Heizenergie [kwh/a] Einsparung Heizkosten [EUR/a] Investition für gesamte Dämmstärke [EUR] 0,91 Reduktion CO 2 - Emissionen [t/a] ca ca. 700 ca ca. 2,3 Kellerdecke ca ca ca ca. 3,2 Fenster ca ca ca ca. 3,2 Dach ca ca. 400 ca ca. 1,4 Gesamt ca ca ca ca. 10,0 Tabelle 102: Wirtschaftliche Kenndaten bei Sanierung nach EnEV -30 % Anlagentechnik Eine Dämmung der Warmwasser- und Zirkulationsleitungen nach aktuellem EnEV-Standard führt zu einer weiteren Reduktion der Wärmeverluste. Die daraus resultierenden Kennwerte werden in folgender Tabelle 103 dargestellt. 195
198 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Maßnahme Dämmung Warmwasser- und Zirkulationsleitungen Einsparung Heizenergie [kwh/a] Einsparung Heizkosten [EUR/a] Investition [EUR] Einsp. CO 2 - Emissionen [t/a] ca ca. 150 ca ca. 0,5 Tabelle 103: Wirtschaftliche Kenndaten bei Dämmung der Warnwasser- und Zirkulationsleitungen Empfohlene Maßnahmen Da das Gebäude erst 1997 erbaut wurde, bestehen hinsichtlich einer Sanierung keine direkten Optimierungspotenziale. Falls das Gebäude zu einem späteren Zeitpunkt saniert wird, da beispielsweise Mängel in den bestehenden Dämmstoffen auftreten, sollte eine erneute Sanierung zu deutlichen Heizwärmeeinsparungen führen. So wird empfohlen, bei einer weiteren Sanierung die bestehenden Dämmstoffe durch ökologische Dämmstoffe zu ersetzen und die EnEV- Grenzwerte um ca. 30 % zu unterschreiten. Die beschriebenen Sanierungsmaßnahmen führen zu einer Reduktion des Heizenergieverbrauchs und der CO 2 -Emissionen. Folgende Abbildung 127 zeigt den daraus resultierenden spezifischen Heizenergiekennwert. Heizenergiekennwert Co 2 Emission 12 kg/(m² * a) Nach Sanierung: 40 Abbildung 127: Heizenergiekennwert nach Sanierungsmaßnahmen 196
199 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Vergleichbare Gebäude der BEWOG Folgende Gebäudeliste der BEWOG stellt die Objekte dar, die einen vergleichbaren energetischen Standard wie das Referenzgebäude im Kurpark 14 aufweisen. Objekt Wohnfläche ges. [m²] Goethestraße 10A-C 924,6 Lessingstr. 1,3,5 1415,87 Lessingstr. 10,12,14,16, Lessingstr. 7, 9 616,4 Lessingstr. 11, 13, ,6 Friedrich-Schiller-Str. 1A 308,2 Am Kurpark 1, 3, 5 883,78 Am Kurpark 2, 4, 6 883,78 Am Kurpark 7, 9, 11, ,82 Am Kurpark 8, 10, ,78 Ahornhof 1, 2 616,04 Ahornhof 3, 4, 5 918,9 Ahornhof 6,7,8,9 1586,44 Am Teich 2 220,47 Am Teich 4 480,62 Am Teich 6 480,62 Am Teich 8 480,62 Am Teich ,62 Am Teich ,62 Am Teich ,47 Buchenhof 1, Buchenhof 3, 4 616,04 Buchenhof 5,6 970,4 Buchenhof 7 306,3 Ahornweg 1 824,23 Ahornweg 2 838,87 Ahornweg 3 838,87 Ahornweg 4 838,87 Bemerkung Tabelle 104: Gebäude mit vergleichbarem energetischen Standard wie der Kurpark 14, BEWOG Informationen von Herrn Udo Kunze, BEWOG 197
200 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand 8.5. Darstellung Klinkengrund Energetischer Gebäudebestand Die Wohnungsbaugenossenschaft 1919 Bad Belzig eg (WBG 1919) hat im Klinkengrund einen Bestand von sieben Objekten mit insgesamt rd m² Wohnfläche. Diese sind vom Gebäudetyp anders als das Referenzgebäude in der Weitzgrunder Straße 9, gleichen diesem jedoch hinsichtlich des energetischen Standards. Im Klinkengrund hat die WBG 1919 keine unsanierten Gebäude. Die Wohnungsgenossenschaft Klinkengrund (WgK) hat im Klinkengrund 14 Gebäude mit einer gesamten Wohnfläche von rd m². Vier Gebäude gleichen dem untersuchten Referenzobjekt in der Goethestraße hinsichtlich des Gebäudetyps und dem energetischen Standard. Die anderen Objekte unterscheiden sich vom Gebäudetyp, gleichem dem Referenzobjekt jedoch hinsichtlich des energetischen Standards. Auch im Bestand der WgK gibt es keine unsanierten Gebäude. Die Bad Belziger Wohnungsgesellschaft mbh (BEWOG) hat im Klinkengrund einen Gebäudebestand von 43 Gebäuden und einer gesamten Wohnfläche von rd m². Sechs Gebäude gleichem dem Referenzobjekt im Kurpark 14 hinsichtlich des energetischen Standards. Weitere 28 entsprechen dem Objekt in der Erich-Weinert-Straße hinsichtlich des energetischen Standards. Die anderen neun Gebäude der BEWOG lassen sich durch ihre unterschiedlichen Gebäudetypen in keinen Vergleich einordnen und werden daher nicht in die Berechnung einbezogen, obwohl sie sich hinsichtlich des energetischen Standards nicht stark vom Referenzobjekt unterscheiden. Auch im Bestand der BEWOG sind keine unsanierten Gebäude vorhanden. Anhand der untersuchten Referenzobjekte und den vergleichbaren Gebäuden wird für das gesamte Wohngebiet Klinkengrund das Einsparpotenzial an Heizenergie und CO 2 - Emissionen überschlägig berechnet und in folgender Tabelle dargestellt. Dazu ist anzumerken, dass fünf Gebäude der BEWOG, welche der Erich-Weinert-Straße gleichen, bereits über eine verbesserte Anlagentechnik (neue Hausanschlussstation, hydraulischer Abgleich) verfügen (s. u. Punkt 8.2.4). Dies wird in der Ermittlung der gesamten Einsparpotenziale berücksichtigt. Gebäude nach folgendem Referenzobjekt Einsparpotenzial Heizenergie aller Gebäude [MWh/a] Einsparpotenzial CO 2 - Verbrauch aller Gebäude Kurpark 14 ca. 200 ca. 60 Erich-Weinert-Str ca ca. 300 Goethestraße ca. 450 ca. 100 Weitzgrunder Str. 9 ca. 150 ca. 40 Gesamt ca ca. 500 Tabelle 105: Einsparpotenziale im Gebäudebestand des Klinkengrunds [t/a] 198
201 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Vergleichbarer energetischer Standard wie Erich-Weinert-Str , Gebäudebestand BEWOG Vergleichbarer energetischer Standard wie am Kurpark 14, Gebäudebestand BEWOG Vergleichbarer energetischer Standard wie Weitzgrunder Str.9, Gebäudebestand WBG 1919 Vergleichbarer energetischer Standard wie Goethestraße 14-18, Gebäudebestand WgK Abbildung 128: Wohngebiete im Klinkengrund, vergleichbar mit Referenzobjekten 199
202 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand 8.6. Darstellung Kurparksiedlung Energetischer Gebäudebestand In der Kurparksiedlung hat die BEWOG Immobilien, die WBG 1919 und die WgK jedoch nicht. Die restlichen Gebäude befinden sich in privater Hand, über die keine Aussagen hinsichtlich der Fläche und dem energetischem Standard getroffen werden können. Die Gebäude der BEWOG in der Kurparksiedlung wurden im selben Jahr wie das Referenzobjekt am Kurpark 14 erbaut und entsprechen diesem hinsichtlich des energetischen Standards. Insgesamt haben damit weitere 23 Gebäude mit einer Fläche von rd m² den energetischen Standard wie das Gebäude am Kurpark 14. Damit ergibt sich für die Gebäude der BEWOG in der Kurparksiedlung das in Tabelle 106 und Abbildung 129 dargestellte Einsparpotenzial. Gebäude nach folgendem Referenzobjekt Einsparpotenzial Heizenergie aller Gebäude [MWh/a] Einsparpotenzial CO 2 - Verbrauch aller Gebäude Kurpark 14 ca. 700 ca. 180 Tabelle 106: Einsparpotenziale im Gebäudebestand der Kurparksiedlung [t/a] 200
203 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Vergleichbarer energetischer Standard wie Kurpark 14, Gebäudebestand BEWOG Abbildung 129: Darstellung des bewerteten Gebäudebestands in der Kurparksiedlung Reduktion des Primärenergiefaktors in Referenzgebäuden Die untersuchten Maßnahmen zur Reduktion des Heizenergieverbrauchs beziehen sich auf die Endenergie. Die Gebäude im Klinkengrund und in der Kurparksiedlung werden über Fernwärme von der Stadtwerke Bad Belzig GmbH versorgt, welche bislang mit einem Primärenergiefaktor von 1,1 119 erzeugt wird. Eine Reduktion des Primärenergiefaktors durch die Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung auf Basis von erneuerbaren Energien spielt für die Reduktion der CO 2 -Emissionen eine entscheidende Rolle. 119 Laut Protokoll vom , Projekt KKK206, Bad Belzig, Thema Fernwärmeversorgung der Wohnsiedlungen Klinkengrund und Kurparksiedlung 201
204 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand 8.7. Untersuchung Referenzobjekt: Straße der Einheit 15 - Altstadt Bestandsaufnahme Das Referenzgebäude in der Straße der Einheit 15 ist ein Wohn- und Geschäftshaus in der historischen Altstadt von Bad Belzig. Das Gebäude entstand vermutlich um 1670 nach dem Stadtbrand im 30-jährigen Krieg und steht unter Denkmalschutz. Das Gebäude hat drei Geschosse. Im Erdgeschoss sind zwei Gewerbeeinheiten mit einer gesamten Fläche von rd. 86 m² vorhanden. Das 1. OG bildet eine Wohneinheit, welche jedoch seit 2011 als Büro genutzt wird, mit einer Fläche von rd. 95 m² und das 2. OG bildet eine weitere Wohneinheit von rd. 84 m². Daraus ergibt sich nach EnEV eine gesamte Gebäudenutzfläche von ca. 315 m². 120 Energieverbrauch und energetische Bewertung In dem Gebäude gibt es zwei verschiedene Heizungssysteme. Das EG und das 1. OG werden über eine gemeinsame Heizungsanlage auf Basis von Erdgas versorgt. Die Mansardenwohnung im 2. OG verfügt über einen eigenen Gasanschluss. Im 2.OG erfolgt die Warmwasserbereitung elektrisch. Die Heizwärmeverbrauchswerte der einzelnen Geschosse liegen für die Jahre 2011 und 2012 vor und werden in folgender Tabelle 107 dargestellt. Gewerbeflächen EG Wohneinheit 1. OG Mansardenwohnung 2. OG Energieverbrauch 2011 [kwh/a] Klimabereinigter Verbrauch 2011 [kwh/a] Energieverbrauch 2012 [kwh/a] Klimabereinigter Verbrauch 2012 [kwh/a] Tabelle 107: Wärmeverbrauch Straße der Einheit 15 Aus den klimabereinigten Kennwerten wird ein durchschnittlicher Wärmeverbrauch des ganzen Gebäudes von kwh/a gebildet. Damit beträgt der auf die Gebäudenutzfläche bezogene spezifische Wärmeverbrauch rd. 91 kwh/m²a. Thermische Hülle Das Gebäude entstand, wie oben beschrieben, vermutlich um Das Gebäude ist vollständig unterkellert. Die Kellerdecke ist mit Feldstein gewölbeförmig gemauert worden. An der Kellerdecke wurden bislang keine Dämmmaßnahmen vorgenommen. 120 Nach EnEV 2009: Gebäudenutzfläche bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohneinheiten = 1,2*Wohnfläche 202
205 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Die oberste Geschossdecke zum unbeheizten Dachraum wurde im Standard des 18. Jahrhunderts ausgeführt. Bei der Decke handelt es sich vermutlich um eine Holzbalkendecke mit Strohlehmwickeln. Dieser Aufbau ist typisch bei oberen Geschossdecken von Fachwerkgebäuden der Baualtersklassen bis Dabei füllen mit Strohlehm umwickelte Stakhölzer die Balkenzwischenräume aus. 121 Bisher wurden an der obersten Geschossdecke keine Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Der Dachstuhl des Gebäudes zieht sich über die Außenwände des 2. OG an der Seite zur Straße der Einheit sowie zur Hofseite. Der Dachaufbau wurde vermutlich Mitte bis Ende des 20. Jahrhunderts errichtet. Aus diesen Angaben wird auf einen typischen Aufbau aus den Jahren geschlossen. In dieser Baualtersklasse erhielten die Dachaufbauten schon eine dünne Zwischensparrendämmung. Über den Sparren befindet sich eine einfache Lattung mit Ziegeleindeckung. Trotz der schwachen Dämmstärke führt dieser Aufbau zu relativ hohen Transmissionswärmeverlusten sowie zu einer Hitzebelastung im Sommer. 122 An dem Dachaufbau wurden bislang keine Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Außenwände im Erdgeschoss zur Straße der Einheit, zur Reißigerstraße sowie zum Hof bestehen aus verputztem Ziegelmauerwerk mit einer Stärke bis zu 67 cm und wurden bisher nicht gedämmt. In Richtung Süden grenzt das Objekt an ein Nachbargebäude. Diese Zwischenwand besteht aus Fachwerk mit Lehmausfachung wurde eine Gipskartonwand mit ca. 6 cm Dämmung vor die Fachwerkwand gebaut. Die Außenwände des 1. OG zur Straße der Einheit sowie des 1. und 2. OG an der Giebelseite zur Reißigerstraße sind Fachwerk mit Lehmausfachung. Bisher wurden an diesen Wänden außer einer Putzanbringung keine Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Außenwand des 1. OG zur Hofseite besteht aus Ziegelmauerwerk und wurde 2010 mit einer 10 cm starken Gasbetonvormauerung auf der Innenseite versehen. Einige der Fenster wurden in den vergangenen Jahren bereits saniert. Rd. 89 % aller Fenster des Gebäudes sind zweifach isolierverglast von Ca. 6 % der Fensterfläche sind 3-fach verglaste Fenster, welche nach 2000 eingebaut wurden und lediglich 5 % sind noch 1-fach verglaste Fenster. Wobei angemerkt wird, dass die 1-fach verglasten Fenster im kalten Treppenhaus liegen. Anlagentechnik Das Erdgeschoss und das 1. OG werden über einen Gasanschluss und eine gemeinsame Heizung mit Wärme versorgt. Die Mansardenwohnung im 2. OG verfügt über einen eigenen Gasanschluss. Im 2. OG erfolgt die Warmwasserbereitung elektrisch. Beide Heizungsanlagen wurden in den Jahren 1999 und 2002 installiert. Bei dem 1999 eingebauten Heizsystem handelt es sich um ein Niedertemperaturgerät ohne Brennwertnutzen mit einer Nennleistung von 20 kw (Typ: Buderus Logamax). Über dieses Heizgerät werden das Erdgeschoss und das 1. OG mit Wärme versorgt. 121 Institut für Wohnen und Umwelt: Konstruktionshandbuch Verbesserung des Wärmeschutzes im Wohngebäudebestand Online abrufbar: Ebd. 203
206 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Das zweite Heizsystem von 2002 versorgt das 2. OG mit Wärme. Es handelt sich um ein Brennwertgerät mit 22 kw Nennleistung (Typ: Buderus Logamax Plus) Optimierungspotenziale Thermische Hülle Im Folgenden werden Optimierungspotenziale hinsichtlich der Verbesserung der Transmissionswärmeverluste durch die Außenbauteile der thermischen Hülle untersucht und dargestellt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es sich um pauschale Annahmen und überschlägige Berechnungen auf Basis der vorliegenden Daten handelt. Da für denkmalgeschützte Bauten in der EnEV 2009 Ausnahmeregelungen gelten können, werden die Dämmmaßnahmen nicht auf die im Regelfall geltenden Grenzwerte der EnEV bezogen. Vor einer tatsächlichen Umsetzung von Dämmmaßnahmen müssen verschiedene Aspekte detailliert untersucht werden. Dazu gehören u. a. die Materialauswahl der Dämmstoffe sowie das Zusammenspiel von Bestands- und Dämmmaterialien, die Anforderungen der zuständigen Denkmalschutzbehörde sowie die für Fachwerk- und Denkmalschutzgebäude geltenden EnEV-Grenzwerte. Da das untersuchte Objekt unter Denkmalschutz mit Sichtfachwerk steht, werden einige Dämmmaßnahmen wie eine Außendämmung der Fachwerkfassaden ausgeschlossen. Jedoch lassen sich auch bei denkmalgeschützten Gebäuden Energiesparmaßnahmen mit der historischen Bausubstanz vereinen. In jedem Fall müssen alle baulichen Maßnahmen mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden. Bei der Durchführung von Dämmmaßnahmen ist besonders bei Fachwerkhäusern die Beratung eines erfahrenen Planers vor Ort wichtig. Im Folgenden werden verschiedene Sanierungsmaßnahmen untersucht und vorgestellt. Die Berechnungen zu den Energieeinsparpotenzialen durch Optimierung der thermischen Hülle beziehen sich auf die Angaben des tatsächlichen Wärmeverbrauchs. Dämmung der obersten Geschossdecke Trotz des Stroh-, Lehmgemisches im Aufbau der obersten Geschossdecke entspricht der Wärmeschutz nicht den heutigen Anforderungen an den Wärmeschutz. Um die Transmissionswärmeverluste zu reduzieren, ist eine Dämmung der obersten Geschossdecke zu empfehlen. Dazu kann auf dem Boden des Dachgeschosses eine Dämmschicht ausgelegt werden. Hier können ökologische Dämmstoffe wie Kork-, Holzweichfaser- oder Thermohanfplatten zum Einsatz kommen. Um bei einer Sanierung die Wärmeverluste deutlich zu reduzieren, wird empfohlen, die oberste Geschossdecke mit einer 20 cm starken Dämmung zu versehen. Daraus können pauschal in Tabelle 108 dargestellte Einsparpotenziale gehoben werden. 204
207 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Maßnahme Oberste Geschossdecke Einsparung Heizenergie [kwh/a] Einsparung Heizkosten [EUR/a] Investition [EUR] Reduktion CO 2 - Emissionen [t/a] ca ca. 150 ca ca. 0,5 Tabelle 108: Einsparpotenziale bei Dämmung der obersten Geschossdecke Kellerdecke/ Fußboden Erdgeschoss Da über den ungedämmten Fußboden zum unbeheizten Keller viel Wärme verloren geht, wird empfohlen, den Fußboden, bzw. die Kellerdecke zu dämmen. Um die historische Feldsteinmauerei im Gewölbekeller zu erhalten, wird vorgeschlagen, anstelle der Kellerdecke den Fußboden im Erdgeschoss zu dämmen. Auch ist diese Lösung bei einem Gewölbekeller effizienter, da die Wärme durch die Fußbodendämmung nicht über die Gewölbemauerei und die Zwischenräume im Deckenaufbau verloren geht. Falls dennoch die Kellerdecke gedämmt werden sollte, gibt es flexible Dämmplatten (z. B. Bimax-Therm Gewölbe), welche die Gewölbeform erhalten. Um die Kellerdecke auf der Erdgeschossebene zu dämmen, muss der Fußbodenbelag geöffnet und eine Dämmschüttung eingebracht werden. Die mögliche Dämmstärke variiert je nach Fußbodenaufbau. Bei einer durchschnittlich angenommenen Dämmstärke von 10 cm können folgende Einsparungen überschlägig berechnet werden. Maßnahme Einsparung Heizenergie [kwh/a] Einsparung Heizkosten [EUR/a] Investition [EUR] Reduktion CO 2 - Emissionen [t/a] Fußboden EG ca ca. 140 ca ca. 0,4 Tabelle 109: Einsparpotenziale bei Dämmung der Fußbodens im Erdgeschoss Außenwand Fachwerk Fassaden mit Sichtfachwerk unterliegen meist einem hohen Sanierungsbedarf. Obwohl Innendämmungen generell sowohl unter bautechnischen als auch bauphysikalischen Aspekten problematischer sind als Außendämmungen, stellen sie bei Sichtfachwerk oft die einzige Möglichkeit dar, die Wärmeverluste zu minimieren. Dabei unterliegt die Innendämmung besonderen bauphysikalischen Anforderungen und sollte vor Ort von einem Fachmann überprüft werden. Eine Innendämmung wird in der Regel nicht größer als mit 8 cm Stärke angesetzt. Dies hat zum einen den Grund, dass bei Innendämmungen höhere Dämmstärken nur noch zu geringen zusätzlichen Energieeinsparungen führen aufgrund der bei einer Innendämmung 205
208 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand verbleibenden Wärmebrücken (Innenwände, Geschossdecken u. a.). Zum anderen muss der Wohnraumverlust beachtet werden. 123 Für eine überschlägige Berechnung wurde von einer Dämmstärke von 8 cm ausgegangen. Folgende Tabelle 110 zeigt resultierende Einsparpotenziale auf. Maßnahme Einsparung Heizenergie [kwh/a] Einsparung Heizkosten [EUR/a] Investition [EUR] Reduktion CO 2 - Emissionen [t/a] AW Fachwerk ca ca. 300 ca ca. 1,0 Tabelle 110: Einsparpotenziale bei Dämmung der Fachwerk-Außenwand Außenwand Ziegelmauerwerk Eine Möglichkeit, um den Wärmeschutz der Außenwand zu verbessern, wäre das Aufbringen von Dämmputz auf der Außenfassade oder das Anbringen eines Wärmedämmverbundsystems. Da diese Maßnahmen jedoch die Außenansicht beeinträchtigen, müsste dies mit der Denkmalschutzbehörde abgesprochen werden. Als Alternative zum Dämmputz bietet sich auch bei dem Ziegelmauerwerk eine Innendämmung mit einer Stärke von 8 cm an. Daraus ergeben sich die in Tabelle 111 dargestellten Einsparmöglichkeiten. Maßnahme AW Ziegelmauerwerk Innendämmung Einsparung Heizenergie [kwh/a] Einsparung Heizkosten [EUR/a] Investition [EUR] Reduktion CO 2 - Emissionen [t/a] ca ca. 140 ca ca. 0,4 Tabelle 111: Einsparpotenziale bei Dämmung des Ziegelmauerwerks Die Ziegelwand auf der Hofseite im 1.OG wurde hinsichtlich des Wärmeschutzes durch die Gasbetonvormauerung bereits optimiert. Eine zusätzliche Innendämmung würde den Wärmeverlust weiter reduzieren, müsste jedoch hinsichtlich des Wohnraumverlusts geprüft werden. Außenwand Schrägdach Mansardenwohnung Um neben einer Reduktion der Wärmeverluste auch die Überhitzung im Sommer zu reduzieren, sollte das Schrägdach im 2. OG saniert werden. Zu empfehlen ist, die Hohlräume zwischen den Sparren mit Dämmung auszufüllen. Die Einsparpotenziale, welche sich durch eine Zwischensparrendämmung ergeben, werden in folgender Tabelle 112 aufgezeigt. Bei dieser Berechnung wird davon ausgegangen, dass 123 Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: Wärmedämmung von Außenwänden mit der Innendämmung. Überarbeitung Online abrufbar: 206
209 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand die Sparrenhöhe 18 cm beträgt und die Zwischenräume vollständig mit Dämmstoff ausgefüllt werden. Maßnahme Einsparung Heizenergie [kwh/a] Einsparung Heizkosten [EUR/a] Investition [EUR] Reduktion CO 2 - Emissionen [t/a] AW Schrägdach ca. 900 ca. 60 ca. 700 ca. 0,2 Tabelle 112: Einsparpotenziale bei Dämmung des Schrägdachs im 2.OG Austausch der Fenster Im ersten Schritt sollten die Fenster mit einer 1-Scheiben-Verglasung gegen moderne isolierverglaste Fenster ausgetauscht werden. Da der Fensterflächenanteil jedoch klein ist, sind auch die Einsparpotenziale in diesem Bereich gering. Da die 2-fach verglasten Fenster von 1999 nicht mehr den aktuellen Kennwerten von modernen 2-Scheiben-Isolierverglasungen entsprechen, kann ein Austausch der Fenster die Transmissionswärmeverluste reduzieren. Die 3-Scheiben-Isolierverglasungen bedürfen keiner Sanierung, entsprechen aber auch nur einem kleinen Teil der gesamten Fensterfläche. Der Fenstertausch der 1- und 2-Scheiben- Verglasungen zu modernen Fenstern mit einem U-Wert von 1,3 W/m²K führt zu den in Tabelle 113 aufgeführten Einsparpotenzialen. Maßnahme Einsparung Heizenergie [kwh/a] Einsparung Heizkosten [EUR/a] Investition [EUR] Reduktion CO 2 - Emissionen [t/a] Fenster 1-fach ca. 350 ca. 20 ca ca. 0,1 Fenster 2-fach ca. 800 ca. 60 ca ca. 0,2 Tabelle 113: Einsparpotenziale bei Austausch der Fenster Durch die vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen kann der auf die Nutzfläche des Gebäudes bezogene Wärmeverbrauch von rd. 91 kwh/m²a auf ca. 49 kwh/m²a gesenkt werden. Anlagentechnik Bisher wird das Gebäude über zwei verschiedene Heizungsanlagen (Niedertemperatur und Brennwertgerät) versorgt. Als Optimierungsmaßnahme wird der Umbau zu einer gemeinsamen Wärmeversorgung mit einem Brennwertgerät sowie einer zentralen Warmwasserbereitung empfohlen. An dieser Stelle wird angemerkt, dass durch die oben vorgeschlagenen Optimierungsmaßnahmen die Heizlast reduziert wird. Dies kann bei der Auswahl der Kesselgröße berücksichtigt werden. Notwendige Reserven für die Warmwasserbereitung sollten jedoch vorgehalten werden. 207
210 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Potenziale Altstadt Aufgrund des besonderen und schützenswerten Ortsbildes der Altstadt werden keine konkreten CO 2 - und Energie-Reduktionsziele für die Altstadt benannt. Um eine energetische Optimierung zu unterstützen, wird aber die Strategie verfolgt, Eigentümer bei Sanierungen auf grundsätzliche Energie-Einsparpotenziale und Energie-Einsparmaßnahmen in Bezug auf das untersuchte Referenzgebäude in der Altstadt hinzuweisen sowie unterstützend für die Umsetzung dieser Maßnahmen Fördermittel aus der Städtebauförderung bereitzustellen. Ferner wurden Regelungen im Umgang mit energetischen Sanierungsmaßnahmen in der Altstadt, die die Gebäudehülle betreffen, in Bezug auf die Gestaltungssatzung getroffen. Damit soll ein grundsätzlicher Ausschluss bestimmter energetischer Sanierungsmaßnahmen und eine fallbezogene Anwendung ermöglicht werden Fördermittel Fördermittel der Stadtwerke Belzig 124 Richtlinie zur Förderung des Erdgaseinsatzes bei der Stadtwerke Bad Belzig GmbH Seit dem fördert die Stadtwerke Bad Belzig GmbH den Erdgaseinsatz bei Heizungsanlagen. Die Förderung erfolgt unter der Voraussetzung eines 2-jährigen Sondervertrags für den Erdgasbezug bei der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Folgende Tabelle 114 zeigt die Brutto-Förderbeträge. Umrüstung auf Erdgas- Brennwert- Technik Einsatz von Erdgas- Brennwerttechnik (Neubau) Einsatz von Solarkollektoren (in Verbindung mit Erdgas- Brennwerttechnik) 400,00 EUR 400,00 EUR 50,00 EUR/m² Bruttokollektorfläche max. 250,00 EUR/Anlage Mini-Kraft-Wärme- Kopplungsanlagen 1-15 kw 300,00 EUR/Anlage kw 500,00 EUR/Anlage (mehrere BHKW-Module werden als eine Anlage gewertet) Tabelle 114: Förderbeträge der Stadtwerke Belzig Fördermittel der KfW-Bank 125 Energieeffizient Sanieren Baubegleitung, Programm 431 (Zuschuss) In diesem Förderprogramm bezuschusst die KfW die energetische Fachplanung und Baubegleitung für Sanierungsmaßnahmen zum KfW-Effizienzhaus oder von Einzelmaßnahmen an bestehenden Wohngebäuden oder Eigentumswohnungen. 124 Quelle: Stadtwerke Bad Belzig GmbH 125 Quelle: Internetseite der KfW Bankengruppe: Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie: 208
211 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Die Höhe der Förderung beträgt 50 % der förderfähigen Kosten, wobei der Höchstbetrag pro Antragssteller und Investitionsvorhaben EUR beträgt. Voraussetzung für einen Zuschuss ist eine Förderung der Sanierungsmaßnahmen im KfW- Programm Energieeffizient Sanieren (bzw. eine Förderung eines aus diesen Mitteln refinanzierten Programms eines Landesförderinstituts). Energieeffizient Sanieren Kredit, Programm 151 und 152 Diese Förderprogramme dienen der langfristigen und zinsgünstigen Finanzierung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Reduktion von CO 2 -Emissionen bei bestehenden Wohngebäuden. Gefördert werden energetische Sanierungen (Einzelmaßnahmen sowie KfW-Effizienzhäuser) von Wohngebäuden sowie Wohn-, Alten- und Pflegeheimen, für welche vor dem der Bauantrag oder die Bauanzeige gestellt wurde. Die Förderung erfolgt als zinsgünstiges Darlehen. Die Höhe des Darlehens beträgt bis zu 100 % der Investitionskosten, wobei der Höchstbetrag bei EUR pro Wohneinheit bei einer Sanierung zu einem KfW-Effizienzhaus und bei EUR pro Wohneinheit bei Einzelmaßnahmen liegt. Tilgungszuschüsse werden in Abhängigkeit des energetischen Niveaus des KfW-Effizienzhauses gewährt. Energieeffizient Sanieren Investitionszuschuss, Programm 430 In diesem Programm werden der Kauf eines energetisch sanierten Gebäudes (oder einer Eigentumswohnung) oder auch die Sanierung eines Bestandsgebäudes zum KfW- Effizienzhaus oder Einzelmaßnahmen an Wohngebäuden (Bauantrag oder Bauanzeige vor dem 1. Januar 1995) gefördert. Die Höhe des Förderbetrags richtet sich nach dem Standard des KfW-Effizienzhauses, wobei der Höchstbetrag EUR pro Wohneinheit beträgt. Energetische Stadtsanierung Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und Sanierungsmanager, Programm 432 Im Rahmen des Energiekonzepts der Bundesregierung fördert die KfW-Bank aus Mitteln des Sondervermögens Energie- und Klimafonds Maßnahmen zur energetischen Stadtsanierung. Unterstützt werden sowohl die Planung als auch das Management bei der Realisierung von energetischen Sanierungsmaßnahmen. Über Zuschüsse werden sowohl Sach- und Personalkosten für die Erstellung eines integrierten Konzepts zur Verbesserung der Energieeffizienz der Gebäude sowie der Wärmeversorgung im Quartier als auch ein Sanierungsmanager mitfinanziert. Der Zuschuss beträgt 65 % der förderfähigen Kosten, wobei der maximale Zuschussbetrag für Sanierungsmanager EUR pro Quartier beträgt. IKK Energetische Stadtsanierung Energieeffizient Sanieren, Programm 218 (Kredit) 209
212 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand In diesem Programm werden sowohl die Sanierung von Gebäuden der sozialen Infrastruktur zum KfW-Effizienzhaus 55, 70, 85, 100 oder zum Effizienzhaus Denkmal als auch Einzelmaßnahmen gefördert. Voraussetzung ist, dass die Gebäude vor dem 01. Januar 1995 fertig gestellt worden sind. Der Kredithöchstbetrag liegt bei 100 % der Investitionskosten. Bei einer Sanierung zu einem KfW-Effizienzhaus wird abhängig vom erreichten Effizienzhaus-Niveau ein Tilgungszuschuss von bis zu 12,5 % des Zusagebetrages geleistet. IKK-Energetische Stadtsanierung Quartiersversorgung, Programm 201 (Kredit) Im Programm 201 wird die nachhaltige Verbesserung der Energieeffizienz bei kommunalen Versorgungssystemen in Stadtquartieren durch zinsgünstige und langfristige Darlehen gefördert. Bei einer quartiersbezogenen Wärmeversorgung werden der Neubau und die Erweiterung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Anlagen zur Nutzung industrieller Abwärme sowie der Neu- und Ausbau des Wärmenetzes zur Wärmeversorgung und von dezentralen Wärmespeichern gefördert. Weiterhin werden Maßnahmen zur Optimierung einer energieeffizienten Wasserver- und Abwasserentsorgung gefördert. Förderung von Energieberatungen im Mittelstand Dieses Programm ist Teil der gemeinsamen Initiative Energieeffizienz im Mittelstand der KfW und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Durch eine Bezuschussung werden kleine und mittlere Unternehmen bei der Inanspruchnahme von fachkundigen und unabhängigen Energieeffizienzberatungen unterstützt. Gefördert werden sowohl Initialberatungen, die energetische Schwachstellen untersuchen, als auch Detailberatungen, welche anhand einer vertiefenden Energieanalyse einen konkreten Maßnahmenplan erarbeiten. Die Höhe der Förderung beträgt für die Initialberatung bis zu 80 % der förderfähigen Beratungskosten (Höchstbetrag EUR) sowie bis zu 60 % der förderfähigen Beratungskosten bei einer Detailberatung (Höchstbetrag EUR). Weitere Informationen und detaillierte Beschreibungen der Konditionen für alle Förderprogramme sind unter und zu finden Zusammenfassung Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Auf Basis vorhandener Unterlagen wurden insgesamt fünf Referenzobjekte, welche stellvertretend für die Wohngebiete Klinkengrund, Kurparksiedlung sowie die Altstadt sind, untersucht. 210
213 8. Energieeinsparung in Sanierungsgebieten und bei Wohngebäuden im Bestand Die Bestandsaufnahme zeigte, dass die untersuchten Gebäude im Klinkengrund und in der Kurparksiedlung zwischen 1992 und 2004 bereits saniert bzw. neu erbaut worden sind. Eine Sanierung der thermischen Hülle wird daher im ersten Schritt nicht empfohlen. Im Bereich der Anlagentechnik konnten jedoch direkte Optimierungsmaßnahmen ausfindig gemacht werden. Wenn eine Sanierung zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet, wird eine Unterschreitung der aktuellen Grenzwerte unter Einsatz von ökologischen Dämmstoffen empfohlen. In der historischen Altstadt können durch die verschiedenen Gebäudetypen, welche sich hinsichtlich Gebäudestruktur, Denkmalschutz, Baujahr u. a. zum Teil deutlich unterscheiden, keine Aussagen für das ganze Stadtgebiet getroffen werden. Für das Referenzgebäude konnten jedoch unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes Einsparpotenziale im Bereich der thermischen Hülle definiert werden. 211
214 9. Nutzung von erneuerbaren Energien 9. Nutzung von erneuerbaren Energien 9.1. Bestandsaufnahme Allgemein Der Nutzung und dem Ausbau von erneuerbaren Energien wird im Land Brandenburg ein hoher Stellenwert zugewiesen. So soll der Anteil der erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch bis zum Jahr % betragen. Ein weiteres Ziel ist die rechnerische Deckung des gesamten Stromverbrauchs aus regenerativen Energien. Dabei soll die Windkraft mit 80 % den größten Anteil übernehmen. 126 Im folgenden Bericht wird untersucht, welche erneuerbaren Energien in Bad Belzig genutzt werden können und welche Potenziale vorhanden sind. Zudem wird analysiert, ob und wie sich der Ortsteil Dippmannsdorf bilanziell selbst versorgen könnte. Im ersten Schritt werden die energetischen Verbrauchsdaten ausgewertet. Dabei wird zwischen dem Stadtgebiet und den umliegenden Ortsteilen unterschieden. In Abbildung 130 wird der Energieverbrauch für das Stadtgebiet nach Energieträgern untergliedert dargestellt. 46% 16% 0% 0% Endenergieverbrauch 2010 Stadtgebiet 29% 9% Strom Heizöl EL Gas (Erdgas, Flüssiggas) Fernwärme Braunkohle Regenerativ Abbildung 130: Endenergieverbrauch Stadtgebiet von Bad Belzig (Quelle: B&SU) In der Grafik ist erkennbar, dass der größte Verbrauchsanteil mit ca. 46 % durch Gas erfolgt. Dem entgegen steht die Fernwärme mit einem relativ geringen Anteil von ca. 16 % am Endenergieverbrauch. Abbildung 131 stellt den Energieverbrauch in den Ortsteilen dar. 126 Quelle: 212
215 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Endenergieverbrauch 2010 Ortsteile 3% 8% 5% 40% Strom Heizöl EL Gas (Erdgas, Flüssiggas) Braunkohle 44% Regenerativ Abbildung 131: Endenergieverbrauch Ortsteile von Bad Belzig (Quelle: B&SU) In Abbildung 131 ist zu erkennen, dass der Endenergieverbrauch in den Ortsteilen aufgrund der vorrangig dezentralen Energieerzeugung von Heizwärme und des gering ausgebauten Gasnetzes zum größten Teil durch Heizöl gedeckt wird. Hier wird betont, dass der Endenergieverbrauch in Form von Strom (Stromanteil Stadt 29 %, Stromanteil Ortsteile 40 %) zu einem nicht näher bestimmten Anteil auch durch den Einsatz regenerativer Energien wie Photovoltaik oder der Verbrennung von Biogas erzeugt wird. Die grün eingefärbten Anteile in Abbildung 130 und Abbildung 131 zeigen die Endenergie aus erneuerbaren Energien, welche in Form von Wärme, z. B. durch solarthermische Anlagen erzeugt wird. Um einen anteiligen Vergleich zu ermöglichen, wird in Abbildung 132 der durchschnittliche Endenergieverbrauch der gesamten Bundesrepublik Deutschland als Vergleichsgröße herangezogen. Die Abbildung stellt den Anteil der Energieträger am Endenergieverbrauch von Deutschland aus dem Jahr 2010 dar. 213
216 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Endenergieverbrauch Deutschland % 10% 6% 1% 12% Steinkohle Braunkohle 28% Heizöl leicht Gas 2) 36% Strom Fernwärme Sonstige 3) Abbildung 132: Endenergieverbrauch Bundesrepublik Deutschland 2010 (Datenquelle: Bundesumweltamt) Erneuerbare Energien In Bad Belzig wurden im Jahr 2010 ca MWh Strom aus erneuerbaren Energien ins elektrische Netz eingespeist. Dies entspricht ca. 15 % des gesamten elektrischen Energieverbrauchs von Die Energie wurde im Jahr 2010 durch 105 installierte Photovoltaikanlagen mit einer gesamten Leistung von rd kw und durch zwei Biogasanlagen mit einer gesamt installierten elektrischen Leistung von rd. 500 kw erzeugt. 127 Bei der Wärmeerzeugung besteht der Anteil aus erneuerbaren Energien für die Ortsteile und die Stadt insgesamt ca. aus 2 %. Darunter fallen die Wärmeerzeugung durch Holz, Umweltwärme (in Form von Wärmepumpen), Biogas und solarthermischen Anlagen Potenziale zur Nutzung von erneuerbaren Energien Im Folgenden werden die Nutzungspotenziale von erneuerbaren Energien in Belzig untersucht. Bei dieser Analyse kann z. T. nur pauschal vorgegangen werden, da aufgrund des begrenzten zeitlichen Rahmens auf vorhandene Daten zurückgegriffen werden muss. In manchen Teilbereichen ist es sinnvoll, vertiefende Studien durchzuführen. Diese Analyse arbeitet Prioritäten für weiterführende Untersuchungen heraus. 127 Quelle: Landkreis Potsdam-Mittelmark, Energiestatistiken: Schriftliche Informationen von Wolfgang Lorenz, Landkreis Potsdam-Mittelmark vom Hochrechnungen von der B&SU 214
217 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Photovoltaik Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) zur Stromerzeugung werden in Belzig z. T. bereits betrieben (s ). PV- Anlagen können auf Gebäudedächern oder auf Freiflächen errichtet werden. Für die großflächige Nutzung von Aufdachanlagen ist das Wohngebiet Klinkengrund gut geeignet. In diesem Gebiet sind viele große Flach- und Schrägdächer mit Südausrichtung vorhanden. Daher wird im Folgenden eine mögliche Installation von Aufdachanlagen für dieses Wohngebiet untersucht. Photovoltaik-Nutzung im Klinkengrund Wie bereits im Arbeitspaket 6 (AP6) in der Beschreibung der Referenzgebäude Goethestraße und Erich-Weinert-Straße aufgezeigt wird, eignen sich sowohl die Flach- als auch die Schrägdächer mit Südausrichtung für die Errichtung von Photovoltaikanlagen. Folgende Abbildung 133 zeigt die für PV-Anlagen verwendbaren Flächen im Klinkengrund auf. Die nutzbaren Schrägdächer werden in violett und die Flachdächer in blau dargestellt. Abbildung 133: Darstellung Flach- und Schrägdächer im Wohngebiet Klinkengrund Für die in der Abbildung eingefärbten Dächer wird die installierbare Systemleistung sowie der zu erwartende Jahresertrag pauschal ermittelt und in folgender Tabelle darstellt. 215
218 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Dachtyp Dachfläche [m²] Leistung PV [kw p ] Ertrag [kwh/a] CO 2 - Einsparung [t/a] 129 Erwartete Investitionskosten [Mio. EUR] Flachdächer ca ca ca. 1,3 Schrägdächer ca ca ca. 0,6 Tabelle 115: Potenziale PV Bad Belzig Mit der erzeugbaren Strommenge könnten rein rechnerisch ca. 190 Haushalte (bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch eines 4-Personen-Haushaltes von kwh/a) versorgt werden. Untersuchung eines Referenzgebäudes Für das Referenzgebäude aus AP6 (Goethestraße 14-18) wird im Folgenden untersucht, inwieweit der von den Mietern verbrauchte Strom durch den mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Gebäudes erzeugbare Strom zu decken wäre. Der Jahresertrag der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Goethestraße würde jährlich ca kwh betragen (s. AP6). Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von kwh/a für einen 2-Personen-Haushalt, ohne elektrische Warmwasser-Bereitung, werden in der Goethestraße jährlich ca kwh verbraucht. 130 Somit wäre selbst eine rechnerische Deckung des elektrischen Stroms ohne Senkung der spezifischen Stromverbräuche der einzelnen Haushalte durch die PV-Anlage nicht möglich. Folgende Abbildung 134 zeigt anhand von typischen Jahresverläufen den Jahresstromverbrauch des Referenzgebäudes sowie die auf dem Dach durch PV-Anlagen erzeugbare Menge an Strom auf. Der Stromverbrauch eines Haushalts schwankt im Jahresverlauf in der Regel nur sehr gering (tagesabhängige Leistungsschwankungen werden hier nicht berücksichtigt). Der Stromertrag durch die PV-Anlage hingegen liegt im Sommer deutlich höher als in den Wintermonaten. 129 Angesetzter Faktor für CO 2-Emissionen: 475 g/kwh Strom 130 Pauschale Rechnung mit Annahmen: 35 Mieter, 18 Wohneinheiten, hauptsächlich 2-Personen-Haushalte, durchschnittlicher Stromverbrauch pro 2-Personen-Haushalt: 2850 kwh/a. 216
219 kwh 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Stromverbrauch Stromerzeugung durch PV Abbildung 134: Stromverbrauch/ Potenzial PV Strom In Abbildung 134 wird deutlich, dass der durch PV-Anlagen erzeugte Strom auf den Dächern der Mehrfamilienhäuser in den Sommermonaten einen großen Teil abdecken könnte Solarthermie Solarthermie bildet eine gute Ergänzung zu klassischen Wärmeenergieerzeugern wie Gas, Öl und Holz. Auch ist eine Verbindung mit Wärmepumpen denkbar. Durch eine solche Kombination kann der Heizwärmebedarf für die Trinkwarmwasserbereitung gerade im Sommer z. T. vollständig durch die Solarthermie gedeckt werden. Eine Verbindung von Solarthermie mit Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ist jedoch in den meisten Fällen nicht sinnvoll, da die Wirtschaftlichkeit der KWK-Anlagen oftmals stark von dem Warmwasserbedarf -besonders in den Sommermonaten- abhängig ist. Die Wohngebiete Klinkengrund und Kurparksiedlung werden mit Fernwärme der Stadtwerke Belzig versorgt. Von Seiten der Stadtwerke ist geplant, den Primärenergiefaktor von derzeit 1,1 durch den Einsatz von BHKWs auf Basis erneuerbarer Energien auf 0,6 bis 0,65 zu senken. In Zusammenhang mit der Umrüstung der Fernwärme ist eine Untersuchung der Solarthermienutzung in diesen Wohngebieten nicht zweckmäßig, da die Versorgung vorrangig durch die verbesserte Fernwärme erfolgen soll. Ein Umbau der Fernwärmeversorgung auf einen Primärenergiefaktor von 0,6 bis 0,65 führt zu einer deutlichen Reduktion der CO 2 -Emissionen. Jedoch werden in einigen Stadtgebieten und in den Ortsteilen die Gebäude über dezentrale Wärmeerzeugungsanlagen versorgt. Für viele Gebäude ist auch in Zukunft kein Anschluss 217
220 9. Nutzung von erneuerbaren Energien an die Fernwärme vorgesehen. Für diese Gebäude stellt die Nutzung von Solarthermie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eine sinnvolle Alternative dar. Wie bei der Installation von Photovoltaikanlagen eignen sich auch für solarthermische Kollektoren Dächer mit Südausrichtung besonders. Bei der Dimensionierung der Anlage muss darauf geachtet werden, die Anlagen nicht zu groß auszulegen. So wird vermieden, dass im Sommer große Mengen an Wärmeüberschuss produziert werden. Vakuumröhrenkollektoren arbeiten effizienter und mit einer wesentlich höheren Temperatur als Flachkollektoren. Durch den Einsatz von Vakuumröhrenkollektoren kann die Kollektorfläche reduziert werden, so dass ein Teil des Daches z. B. auch für Photovoltaikanlagen genutzt werden kann. Bei einem Einfamilienhaus von ca. 120 m² sollte für die Warmwasserbereitung mit Heizungsunterstützung eine Vakuumröhrenkollektorfläche von ca. 7 m² gewählt werden 131. Die daraus resultierenden Kenndaten werden in folgender Tabelle dargestellt. Montage Neigung Fläche [m²] Ertrag [kwh/a] 132 CO 2 - Einsparung 133 [kg/a] Erwartete Investitionskosten [EUR] Aufdachmontage 40 7 ca ca. 800 ca Tabelle 116: Durchschnittlicher Ertrag Solarthermie, Beispiel Einfamilienhaus Förderung Solarthermieanlagen 134 Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert Solarkollektoranlagen auf Bestandsgebäuden u. a. zur Raumheizung sowie zur kombinierten Warmwasserbereitung und Raumheizung. Diese Förderung beträgt bei der Erstinstallation von Solarkollektoranlagen 90 EUR je angefangenem Quadratmeter Bruttokollektorfläche bis 40 m², mindestens jedoch EUR. Dabei müssen die Vakuumröhrenkollektoren mindestens 7 m² groß sein und eine Speichergröße von mindestens 50 Litern je m² Bruttokollektorfläche installiert werden. Bei einer Erstinstallation von Solarkollektoranlagen mit mehr als 40 m² Bruttokollektorfläche beträgt die Förderung für die ersten 40 m² 90 EUR je angefangenem Quadratmeter und für die darüber hinaus errichtete Bruttokollektorfläche 45 EUR je angefangenem Quadratmeter. Als zusätzliche Fördervoraussetzung gilt, dass die Anlagen Ein- oder Zweifamilienhäusern zur kombinierten Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung dienen und mit Pufferspeichergrößen von mindestens 100 Litern je Quadratmeter Bruttokollektorfläche ausgestattet werden. 131 Angesetzte Kollektorfläche: 0,6 m² Vakuumröhrenkollektor pro 10 m² Wohnfläche 132 Angesetzter Ertrag für Vakuumröhrenkollektoren in Belzig: ca. 400 kwh/m²a 133 Angesetzter CO 2-Faktor für Heizöl: 313 g/kwh 134 Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle: 218
221 9. Nutzung von erneuerbaren Energien 9.3. Biomasse Biomasseverwertung: Restholz Holz ist ein wichtiger Bioenergieträger, welcher in Brandenburg in erster Linie als Rohstoff für die Säge- und Holzwerkstoffindustrie genutzt wird. Belzig verfügt über insgesamt rd ha Waldfläche, wovon der Kleinprivatwald rd ha beträgt (Gemarkung Belzig plus die 14 Ortsteile). Von der gesamten auf dieser Fläche zur Verfügung stehenden Holzmenge wird der größte Teil in der holzverarbeitenden Industrie genutzt. Die Hauptsortimente, die im Allgemeinen eingeschlagen werden, sind Industrieholz Kiefer sowie Stammholzabschnitte Kiefer. Das Restholz wird teilweise von den Waldbesitzern als Brennholz aufgewertet. Der nicht zu verwertende Teil stellt die Grundlage für die Humusbildung dar und verbleibt im Wald. 135 Da von der gesamten zuwachsenden Holzmenge der größte Teil in der holzverarbeitenden Industrie genutzt wird, steht für die Nutzung von Energieholz nur ein geringer Teil zur Verfügung. Energieholz kann aus der Durchforstung von Schwachholzbeständen und aus der Nutzung von Kronen- und Restholz, welches bei der Jungbestandspflege anfällt, gewonnen werden. Dieses Energieholz aus der Forstwirtschaft kann in Holzvergaser-BHKW in thermische und elektrische Energie (KWK-Anlagen) umgewandelt werden. Dabei wird der Brennstoff aufbereitet und vergast. Anschließend wird das Holzgas einem Verbrennungsmotor zugeführt, welcher einen Generator zur Stromerzeugung antreibt. Die Abwärme lässt sich zusätzlich zu Heizzwecken nutzen. 136 Allein aus den gesamten Flächen des Kleinprivatwaldes in Belzig stehen ca RM Restholz zur Verfügung. Bei einer energetischen Verwertung über Holzvergaser-BHKWs ständen ca MWh elektrische Energie und ca MWh thermische Energie zur Verfügung. Voraussetzung für einen wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb eines BHKWs ist die Abnahme der thermischen Energie. Dazu würden die Einbindung in das vorhandene Fernwärmenetz und eine damit verbundene Erweiterung des Netzes notwendig sein. Der Standort einer solchen KWK-Anlage müsste somit siedlungsnah errichtet werden Biomasseverwertung: Grünschnitt Aus der Pflege und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen, Straßen und Gewässer fallen jährlich Grünreste aus Mähgut und Laubabfällen an. Diese stellen heute vielerorts ein noch ungenutztes Biomassepotenzial dar. Ebenso verhält es sich mit organischen Küchenabfällen. In der Studie EUDYSÉ 137 wurden die theoretischen Mengen-Potenziale für Küchenabfall und Grünschnitt aus Siedlungs- und Verkehrsflächen sowie der Gewässerpflege für Belzig ermittelt. Das theoretische Potenzial reduziert sich bei der Ermittlung der tatsächlich 135 Quelle: Frau Hanitzsch, Oberförsterei Dippmannsdorf, Schreiben vom Quelle: Studie Eudysé: Effizienz und Dynamik. Siedlungsentwicklung in Zeiten räumlich und zeitlich disparater Entwicklungstrends. 219
222 9. Nutzung von erneuerbaren Energien nutzbaren Mengen durchschnittlich auf ca. 50 % (technisch-ökonomisches Potenzial). In Belzig liegt das technisch-ökonomische Potenzial sogar unter 50 %, siehe Tabelle 117. Theoretisches Potenzial (Frischmasse) Grünschnitt Küchenabfall [t/a] [t/a] Technisch-ökonomisches Potenzial (geschätzt) Küchenabfall und Grünschnitt (Frischmasse) [t/a] Belzig, Stadt Tabelle 117: Grünschnitt- und Küchenabfallpotenzial in Belzig 138 Die anfallenden Mengen an Grünschnitt und Küchenabfällen können zur Biogaserzeugung genutzt werden. Aus den in Tabelle 117 dargestellten Mengen ergibt sich ein Biogasertrag von ca m³. 139 Zusammen mit der in der Landwirtschaft anfallenden Biomasse könnten der Grünschnitt und die Küchenabfälle zur Biogaserzeugung genutzt werden. Auf die Biogaserzeugung wird im Folgenden genauer eingegangen Biogas aus Biomasse Aus Biomasse lässt sich auch Biogas herstellen. Zur Herstellung von Biogas werden Klärschlämme, tierische Exkremente, Futter- und Lebensmittelreste, Altfette oder andere biologische Abfallstoffe in einer Biogasanlage unter Abschluss von Sauerstoff durch bakterielle Faulung vergoren. Bei diesem Prozess entsteht ein brennbares Gas, welches überwiegend aus Methan und Kohlendioxid sowie in geringen Mengen aus Schwefelwasserstoff, Ammoniak und anderen Gasen in Spuren besteht. Biogas wird hauptsächlich in Verbrennungsmotoren wie in Blockheizkraftwerken (BHKW) genutzt und in Strom und Wärme umgewandelt. Oft werden die BHKW nur als reine Stromerzeuger betrieben und die Wärme geht aufgrund der geringen Abnahmen verloren. In solchen Fällen kann die Stromkennzahl durch einen nachgeschalteten ORC-Prozess erhöht werden. In der Studie RUBIRES 140 wurden u. a. für Belzig die regionalen Biomassepotenziale berechnet. Das Potenzial von Biogas wurde anhand der verfügbaren Menge von Silagen (Winterroggen und Silomais) und Gülle ermittelt. Bei Volllaststunden im Jahr beträgt das ermittelte Potenzial für Belzig 549 kw el im Normaljahr und 195 kw el für ein Trockenjahr (Veranschaulichung eines extremen Dürrejahres mit durchschnittlich 395 mm Niederschlag pro Jahr). Da auch in Trockenjahren die Versorgung der Anlage gesichert sein muss, müssen die verfügbaren Mengen der Silagen bei geringeren Niederschlägen in trockenen Zeiten mit berücksichtigt werden. 138 Studie Eudysé: Effizienz und Dynamik. Siedlungsentwicklung in Zeiten räumlich und zeitlich disparater Entwicklungstrends. 139 Biogasertrag pro t FM aus: Kaltschmitt, Martin: Regenerative Energien in Österreich Grundmann, Philipp u. a.: Endbericht Regionale Potenzialanalyse Biomasse als Energierohstoff in regionalen Wirtschaftskreisläufen in der Region Havelland-Fläming. 220
223 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Aus den in der Studie RUBIRES ermittelten Kennwerten ergibt sich in dem Trockenjahr eine Menge von ca m³ Biogas aus Winterroggen, Silomais und Gülle. Dazu kommen die m³ Biogas aus Grünschnitt und Küchenabfällen (siehe 9.3.2). Bei Nutzung der gesamten Biogasmenge, welche aus den Studien entnommen werden, können über ein BHKW ca MWh Strom und ca MWh Wärme erzeugt werden. Wenn Biogas nicht über ein BHKW verstromt wird, sondern erneut aufbereitet und enthaltene Spurenelemente, Wasser und Kohlendioxid abgetrennt werden, kann Biogas direkt in das Erdgasnetz eingespeist und über dieses transportiert werden. 141 Für diesen Prozess müssen Gasaufbereitungsanlagen installiert und Anschlussleitungen von der Biogasanlage zum Erdgasnetz verlegt werden. Der Betrieb von Biogasanlagen empfiehlt sich in der Nähe von Substratquellen, wie an Kläranlagen oder landwirtschaftlichen Betrieben, damit die Transportwege gering gehalten werden können. In Belzig gibt es bereits zwei Biogasanlagen in den Ortsteilen Werbig und Schwanebeck, welche über ein zugehöriges BHKW Strom erzeugen. Das BHKW in Werbig hat eine Größe von 499 kw el (Inbetriebnahme 2008), das BHKW in Schwanebeck eine Größe von 875 kw el (Inbetriebnahme 1999). Die BHKWs werden mit über 8000 Vollbetriebsstunden betrieben. 142 Damit sind die beiden bestehenden BHKWs mit einer gesamten installierten Leistung von kw el für die ausgewiesenen Potenziale von Grünschnitt, Küchenabfällen, Silagen und Gülle aus den Studien RUBIRES und Eudysé überdimensioniert. Die zusätzliche Menge an Biomasse kann zum Teil aus anderen Regionen zugekauft werden. Auch können die theoretisch ermittelten Potenziale von den real zur Verfügung stehenden Mengen abweichen, z. B. durch einen Zuwachs an landwirtschaftlicher Fläche oder einer größeren Anzahl an Kühen und Schweinen. In der RUBIRES-Studie werden bei der Ermittlung der Biogaspotenziale die Agrarerträge herangezogen, wobei 81 % für Nahrungs- und Futtermittel dienen und die restlichen 19 % zur Biogasproduktion zur Verfügung stehen sollen. Auf dieser Basis wird das Szenario für die Biogasproduktion ermittelt. In vielen Fällen wird jedoch ein Großteil an Nahrungsmitteln aus dem Ausland importiert, so dass das angestellte Szenario stark von der Realität abweichen kann Biogas aus Klärschlamm - Klärgas Klärgas wird aus anfallendem Restschlamm von Abwässern gewonnen. Dabei wird der Klärschlamm in Faultürmen einem Fäulnisprozess unterworfen und bildet so ein methanhaltiges Gas. Dieser Prozess dauert bei 30 C bis 38 C ca. 20 bis 25 Tage. Die Hauptbestandteile des Produktes sind Methan (CH 4 ) und Kohlendioxid (CO 2 ). Aus 1 m³ Klärschlamm lassen sich ca. 20 m³ Klärgas gewinnen. Bei einem Methangehalt von 63 % bis 68 % und einem Kohlendioxidanteil von 32 % bis 37 % ergibt sich ein Heizwert von 6,4 bis 7 kwh/m³. Durch zusätzliche Aufbereitung lässt sich der Kohlendioxidanteil reduzieren und der Brennwert auf 10 kwh/m³ erhöhen. Dieses Gas kann schließlich in das bestehende Erdgasnetz eingespeist werden. 141 Quaschning, Volker: Erneuerbare Energien und Klimaschutz Quaschning, Volker: Regenerative Energiesysteme Quelle: Zwischenergebnisse der Studie Eudysé, Stand 03/
224 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Eine weitere Nutzungsmöglichkeit ist, das gewonnene Klärgas über den Einsatz eines Blockheizkraftwerks in Strom und Wärme umzuwandeln. Damit kann in der Regel ein Großteil des für die Kläranlage elektrischen und thermischen Eigenenergiebedarfs gedeckt werden. Für den Produktionsprozess werden ca. 45 % des Klärgases zur Trocknung des Klärschlamms genutzt, ca. weitere 10 % werden zur Beheizung des Faulturms benötigt, so dass ca. 45 % des über das BHKW in Strom und Heizwärme umgewandelten Klärgases genutzt werden können. 143 Bei einer überschlägigen Berechnung des anfallenden Klärgases des Klärwerks Belzig ( Einwohnerwerten (EW)) steht eine gesamte Klärgasmenge von ca m³/a zur Verfügung. Bei einer Verstromung über ein BHKW und Nutzung der Abwärme ergeben sich daraus ca. 180 MWh Strom und ca. 270 MWh Wärme. Für diese Menge an Klärgas wäre der Einsatz eines BHKW mit einer elektrischen Leistung von ca kw sinnvoll. Überschüssige elektrische und thermische Energie könnte an das angrenzende Gewerbegebiet über ein Nahwärmenetz verkauft werden. Eine weitere Möglichkeit zur Erzeugung thermischer Energie ist der Einsatz von Gaswärmepumpen. Zum einen kann die thermische Energie des Abwassers als Umweltwärme in der Wärmepumpe genutzt werden. Dabei wirkt sich das übers Jahr relativ gleichbleibende Temperaturniveau des Abwassers günstig aus. Zum anderen kann der Gasmotor zum Antrieb der Wärmepumpe mit Klärgas betrieben werden Klärgasnutzung mit benachbarten Kommunen Das Klärwerk in Bad Belzig hat eine Ausbaugröße von Einwohnerwerten. Bisher ist im Klärwerk Bad Belzig kein Faulturm vorhanden. Um die Produktion von Faulgas und die anschließende Verstromung und Wärmenutzung über Kraft-Wärme-Kopplung wirtschaftlicher zu gestalten, wäre eine Partnerschaft zwischen den umliegenden Klärwerken zu einer zentralisierten Klärschlammbehandlung sinnvoll. Dazu werden die Größen der Klärwerke in den umliegenden Gemeinden untersucht. Nachfolge Abbildung 135 zeigt die Kläranlagen in Belzig und den umliegenden Gemeinden auf. Erkennbar ist, dass in Brück, Niemegk und Wiesenburg/ Mark Kläranlagen vorhanden sind, welche nicht weit von Belzig entfernt sind. Auch in diesen Kläranlagen sind bisher keine Faultürme vorhanden Informationsplattform Regionales Stoffstrommanagement, URL: Zugriff: Aussage Herr Terp, Stadtwerke Belzig, Telefonat 01/
225 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Abbildung 135: Kläranlagen in Bad Belzig und in Nachbarkommunen 145 Die Kläranlage in Niemegk ist mit einer Ausbaugröße von EW kleiner als die Anlage in Belzig, ebenso wie die Anlage in Wiesenburg/ Mark mit einer Größe von EW. Das Klärwerk in Brück hingegen ist mit einer Anlagengröße von EW größer als die Anlage in Belzig. 145 Wird der Klärschlamm der vier umliegenden Klärwerke zusammen behandelt, ergibt sich die Menge an Klärschlamm aus einer gesamten Ausbaugröße von Einwohnerwerten. Daraus kann ein Gasertrag von ca m³/h gewonnen werden. Aus überschlägigen Berechnungen folgt, dass für diesen Einsatz ein BHKW mit einer Größe von ca. 100 kw elektrischer Leistung geeignet wäre. Daraus könnten im Jahr ca. 650 MWh Strom und ca MWh Wärme generiert werden. 146 Für die Umsetzung dieser zentralisierten Klärschlammbehandlung müsste der anfallende Klärschlamm aus den einzelnen Kläranlagen zu einem zentralen Ort transportiert werden, an dem durch einen Faulturm Klärgas erzeugt und über BHKW zu Strom und Wärme umgewandelt wird. Diese mögliche Zentralisierung der Klärschlammbehandlung kann als eine wirtschaftliche und sinnvolle Lösung betrachtet werden. Bisher lag die Anwendungsgrenze für eine wirtschaftliche Faulung bei ca EW, wobei dieser Wert angesichts der steigenden Energie- und Entsorgungskosten bereits heute fraglich ist. 147 Durch eine interkommunale Zusammenarbeit und eine Zentralisierung der Klärschlammbehandlung kann neben einer Optimierung der Wirtschaftlichkeit auch die Leistungsfähigkeit der Anlagentechnik gestärkt werden. 145 Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Land Brandenburg: Kommunale Abwasserbeseitigung im Land Brandenburg Lagebericht Online abrufbar: Quelle: Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann + Partner GmbH u.a.: Entwicklung von Kostenfunktionen zur Prüfung einer Umstellung von aerober Stabilisierung auf Schlammfaulung. 223
226 9. Nutzung von erneuerbaren Energien 9.4. Geothermie Die geothermische Nutzung zur Strom- und Wärmegewinnung verfügt über ein großes Innovations- und Entwicklungspotenzial. Mittel- bis langfristig wird diese Technologie zu einem nachhaltigen Energiemix beitragen und soll in Zukunft die Funktion der Grundlastkraftwerke übernehmen. Derzeit befindet sich die Technologie noch in einem frühen Entwicklungsstadium. 148 Überall auf der Welt findet sich ein breites Angebot an geothermischen Ressourcen und viele verschiedene Technologien, um diese zu nutzen. So kann Geothermie direkt zum Heizen oder Kühlen (meistens über eine Wärmepumpe) oder auch zur elektrischen Stromerzeugung sowie für Kraft-Wärme-Kopplung genutzt werden. Bei der oberflächennahen Geothermie wird die Erdwärme bei einer Tiefe von bis zu 400 m direkt zum Heizen oder Kühlen genutzt, meistens über die Anwendung einer Wärmepumpe. Die tiefe Geothermie nutzt die Erdwärme ab einer Tiefe von 400 m. Für eine hydrothermale Stromerzeugung sind Wassertemperaturen von mindestens 100 C notwendig. Hydrothermale Heiß- und Trockendampfvorkommen mit Temperaturen über 150 C können direkt zum Antrieb einer Turbine genutzt werden. Neu entwickelte Organic Rankine Cycle (ORC-Anlagen) ermöglichen eine Stromerzeugung bei einer Temperatur ab 80 C. Diese Anlagen arbeiten mit einem organischen Medium, welches bei niedrigen Temperaturen verdampft und so über eine Turbine den Generator antreibt. 152 Um eine Energieversorgung ohne den Einsatz von Wärmepumpen zu realisieren, müssen Teufen (Bohrtiefen) von ca m (ca. 100 C) erreicht werden. Hier kann die geothermische Energie direkt für Heizzwecke genutzt werden. Um geothermische Energie auch zur Stromerzeugung und Kraft-Wärme-Kopplung einzusetzen, müssen Teufen von mind m erreicht werden. Hier würde eine Temperatur von ca. 150 C zur Verfügung stehen. 149 In Bad Belzig wurde im Jahr 1996 eine geothermische Bohrung zur Nutzung des Thermalwassers in der Steintherme durchgeführt. Die Messung erfolgte in einer Teufe von ca. 768 m. Die dort ermittelte Temperatur beträgt ca. 32 C. 150 Die vorhandene geothermische Bohrung kann demnach für energetische Zwecke nur über den Einsatz einer Wärmepumpe erfolgen. Da jedoch die Fördermenge des salinaren Wassers zu gering ist (derzeitige Entnahme ca. 1,5 m³/tag), ist eine Nutzung des Thermalwassers nicht möglich 151. In Deutschland gibt es einige Kraftwerke, welche die Tiefengeothermie nutzen. Derzeitig befindet sich z. B. eine Pilotanlage in Gross Schönbeck (im Nord-Osten Brandenburgs), in der die Wirtschaftlichkeit der Verstromung geothermischer Energie wissenschaftlich untersucht wird. Die in Gross Schönebeck geförderte Wassertemperatur beträgt ca. 150 C und soll einen Organic Rankine Cycle-Kraftprozess antreiben Quelle: GeothermieBohrung-de_pdf;jsessionid=3E23EA632A2EBD90D283FD14393DC213?binary=true&status=300&language=de 149 Quelle: GeothermieBohrung-de_pdf;jsessionid=169A16EFEA5A597FF7577E1A6DCCA071?binary=true&status=300&language=de 150 Aussage Herr Göthel, Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg, Telefoninterview am Quelle: der Stadtwerke Bad Belzig, Michael Behringer,
227 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Ein weiteres Geothermiekraftwerk befindet sich in Neustadt-Glewe (Mecklenburg- Vorpommern). Die dort geförderten Temperaturen betragen ca. 100 C. Dieses Kraftwerk ist mit einem Heizwerk gekoppelt, da die thermische Versorgung im Vordergrund steht. Mit einem elektrischen Wirkungsgrad von 7,7 % ist die Stromausbeute ausgesprochen gering Windenergie Windenergie wird ein hoher Stellenwert bei der Energiewende zugesprochen. Nach der Energiestrategie des Landes Brandenburg soll der Anteil der Windenergie bis zum Jahr 2020 auf 55 PJ, bzw MW gesteigert werden. 153 Das Land Brandenburg verfügt durch viele windhöffige Gebiete mit relativ geringen Einwohnerdichten grundsätzlich über günstige Voraussetzungen zur Nutzung von Windenergie. In der Region Havelland-Fläming beträgt die installierte Leistung 950 MW (Stand 2010). Daraus ergibt sich eine erzeugte Strommenge von GWh, welche im Jahr % des Stromverbrauchs des Landes Brandenburg entsprach. 154 Im Landkreis Potsdam-Mittelmark allein werden derzeit 145 Windkraftanlagen mit einer gesamten installierten Leistung von 223 MW betrieben. 155 Obwohl der umweltpolitische Nutzen der Windenergie hoch ist, bedarf es einer räumlichen Steuerung, um Konflikte mit anderen Nutzungen und Belangen, wie dem Natur- und Landschaftsschutz, zu minimieren. Daher werden in sogenannten Regionalplänen spezielle Eignungsgebiete für die Windenergienutzung in den einzelnen Regionen ausgewiesen. Außerhalb dieser Eignungsgebiete wird eine Errichtung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen ausgeschlossen. Im Regionalplan für Havelland-Fläming werden insgesamt 24 Eignungsgebiete ausgewiesen, wobei in Bad Belzig selbst keine Flächen geeignet sind. Da eine Errichtung von Windenergieanlagen außerhalb der ausgewiesenen Gebiete ausgeschlossen ist, wird eine Installation von Windenergieanlagen in Bad Belzig nicht weiter untersucht. Unter den ausgewiesenen Flächen befinden sich z. T. noch ungenutzte Flächen in den umliegenden Gemeinden von Belzig, wie in Beelitz, Brück, Kloster Lehnin und Treuenbrietzen. Folgende Tabelle zeigt die in der Region Potsdam-Mittelmark ausgewiesenen und noch ungenutzten Flächen (Stand 03/2012). Eignungsgebiet Stadt, Gemeinde Größe [ha] Bemerkungen Karower Platte Gemeinden Bensdorf und Wusterwitz 500 Teilflächen mit besonderer Zweckbindung Repowering 152 Kobelt, Manuel: Untersuchung der Abwärmeströme eines BHKW Moduls zur Dampferzeugung im ORC Prozess zur Stromerzeugung. BHKW 0,5-1 MW. Berlin Quelle: MUGV Brandenburg: Quelle: Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming: Quelle: MUGV Brandenburg: 225
228 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Bliesendorfer Heide Reesdorfer- Schäper Heide Stadt Werder (Havel), Gemeinden Klister Lehnin, Schwielowsee 945 Stadt Beelitz 723 Wittbrietzen Städte Beelitz und Treuenbrietzen, Gemeinde Nuthe-Urstromtal Treuenbrietzener Vorfläming Stadt Treuenbrietzen, Gemeinde Mühlenfließ Teilflächen mit besonderer Zweckbindung Repowering Tabelle 118: Für Windenergie ausgewiesene, bislang ungenutzte Flächen in Potsdam-Mittelmark 156 Wie in Tabelle 118 erkennbar, befinden sich in der Umgebung von Belzig noch große ungenutzte Flächenpotenziale für die Installation von Windenergieanlagen. Um Windenergie zu nutzen, sollte in Bad Belzig eine Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden verfolgt werden Fernwärme Derzeitig beträgt die installierte thermische Leistung in Belzig ca. 10 MW. Als Hauptbrennstoff wird Erdgas mit einem Anteil von % eingesetzt. Der Primärenergiefaktor der Fernwärme liegt derzeit bei ca. 1,1. Zum Vergleich: der Primärenergiefaktor für Nah- und Fernwärme aus Heizkraftwerken mit fossilen Energieträgern beträgt laut der EnEV 2009 durchschnittlich 1,3. Bei der Planung und der Dimensionierung des Fernwärmenetzes und der Hausanschlussstationen wurde von einem steigenden Wärmebedarf ausgegangen. Dieser ist jedoch aufgrund des demografischen Wandels und der erfolgten Gebäudesanierungsmaßnahmen nicht eingetreten, sondern gesunken. Es wird prognostiziert, dass bis 2030 ca. 176 Wohneinheiten zurück gebaut werden müssen. 157 Aufgrund dieser Thematik erhöhen sich die Leitungsverluste, da das Netz an vielen Stellen überdimensioniert ist. Die durchschnittlichen Fernwärmepreise liegen derzeit noch über 0,09 EUR/kWh. Ein Vergleich mit anderen mit Fernwärme versorgten Mehrfamilienhäusern zeigt, dass der durchschnittliche Netto-Verbrauchspreis für Fernwärme unter den 0,09 EUR/kWh liegt (Stand 01/2011) 158. Nach Aussage der Stadtwerke soll im Jahr 2013 weiter in die energetische Optimierung der Fernwärme investiert werden. So sollen die Hausanschlussstationen weiter erneuert und ein Blockheizkraftwerk installiert werden. Unter anderem ist für das Heizwerk Klinkengrund ein Blockheizkraftwerk vorgesehen; ggf. sollen auch andere Heizungsanlagen durch Blockheizkraftwerke ergänzt werden. 159 Als mögliche Energieträger sollen Biomethan und Erdgas eingesetzt werden. Somit soll der Primärenergiefaktor auf 0,6 bis 0,65 gesenkt werden. Durch die Kraft-Wärme-Kopplung könnten ca % im Grundlastbereich bereitgestellt werden. Der vom Blockheizkraftwerk 156 RPG Havelland-Fläming: Regionalplan Havelland-Fläming Laut Protokollen der Steuerungsrunde vom und vom , Projekt KKK206, Bad Belzig 158 Quelle: Verband Berlin-Brandenburgerischer Wohnungsunternehmen e.v., Auszug aus der BBU-Preisdatenbank Quelle: Stadtwerke Belzig, Zeitschrift der Stadtwerke, Ausage 03/2013 und 12/
229 9. Nutzung von erneuerbaren Energien erzeugte Strom soll in das Netz eingespeist und verkauft werden. Durch den Stromverkauf sollen die Kosten für die Fernwärme gesenkt werden. Eine Erweiterung des Netzes ist jedoch derzeitig nicht geplant. Die erhöhten Wärmeverluste im Fernwärmenetz sollen durch einen möglichen Anschluss des Altenheims reduziert werden. Dadurch könnte die thermische Leistung um 400 bis 500 kw erhöht und der Wärmeabsatz könnte um 800 bis MWh/a gesteigert werden. 160 Wenn diese Maßnahmen umgesetzt werden und der Primärenergiefaktor somit auf 0,6 bis 0,65 reduziert wird, dann ist das Erlassen einer Fernwärmesatzung für die fernwärmeerschlossenen Wohngebiete sinnvoll Erdgas-Fahrzeuge Bei gasbetriebenen Fahrzeugen wird grundsätzlich zwischen Erdgas (Compressed Natural Gas, CNG) und Flüssiggas (Liquified Petroleum Gas, LPG) unterschieden. Flüssiggas, welches oft Autogas genannt wird, ist flüssig und wird bei niedrigem Druck gelagert. Erdgas hingegen wird gasförmig bei einem Druck von bar gelagert. Im Folgenden wird nur auf den Erdgaseinsatz eingegangen, da es in Bad Belzig bereits eine Erdgastankstelle gibt und der Absatz erweitert werden soll. Die Erdgas-Tankstelle in Bad Belzig ist die Aral-Tankstelle in der Brücker Landstraße 22a, welche über eine Erdgaszapfsäule verfügt. Der dort ausgegebene Gas-Kraftstoff ist mit 10 % Bioerdgas versetzt. 161 Im Jahr 2010 wurden in Belzig bereits ca. 640 MWh Erdgas als Kraftstoff verbraucht. 162 Um den Absatz unter der Bevölkerung Bad Belzigs steigern zu können, ist die öffentliche Aufklärung und Verbreitung dieses Fahrkonzepts ein wichtiger Schritt. Daher werden im Folgenden die Vorteile, bzw. Eigenschaften des Kraftstoffs Erdgas sowie die wirtschaftlichen Aspekte umrissen. Die Umweltauswirkungen bei Erdgasautos sind deutlich geringer als bei konventionell angetriebenen Fahrzeugen. Die CO 2 -Emissionen liegen bei Erdgas um bis zu 25 % unter den Emissionen von Benzin. Mit reinem Bio-Erdgas kann der CO 2 -Ausstoß sogar um bis zu 97 % gesenkt werden. 163 Wie in nachfolgender Abbildung 136 zu erkennen ist, lässt sich der Schadstoffausstoß durch erdgasbetriebene Fahrzeuge gegenüber diesel- oder benzinbetriebenen Fahrzeugen deutlich reduzieren. 160 Quelle: der Stadtwerke Bad Belzig, Quelle: Stadtwerke Bad Belzig GmbH: Hochrechnungen der B&SU 163 Quelle: 227
230 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Abbildung 136: Schadstoffeinsparung Erdgasantrieb 165 Entgegen verschiedener Ängste bezüglich Sicherheit eines gasbetriebenen Autos, ist die Sicherheit bei korrekt eingebauten Gasanlagen und bei Neufahrzeugen nicht beeinträchtigt. Durchgeführte Crashtests zeigten, dass die Sicherheitseinrichtungen bei Erdgaseinsatz gut funktionierten, die eingebauten Tanks dicht hielten und zu keiner Zeit eine Explosionsgefahr bestand. Demnach kann laut dem TÜV Süd allgemein davon ausgegangen werden, dass verglichen mit benzinbetriebenen Fahrzeugen kein erhöhtes Gefahrenpotenzial besteht. 164 Das Erdgas-Tankstellennetz wird stetig erweitert, so dass Erdgasfahrer deutschlandweit sowohl autobahnnah als auch in kleineren Ortschaften an über 900 Tankstellen den alternativen Kraftstoff tanken können. Bad Belzig leistet mit seiner Erdgaszapfsäule bereits einen Anteil am Ausbau eines flächendeckenden Erdgastankstellennetzes. Unter ist sowohl eine deutschlandweite Übersichtskarte von Erdgastankstellen als auch ein Routenplaner vorhanden. Folgende Abbildung zeigt aus der Übersichtskarte den Ausschnitt um Brandenburg. 164 Quelle: TÜV Süd, online abrufbar: 228
231 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Abbildung 137: Übersichtskarte Erdgastankstellennetz, Ausschnitt Brandenburg, Quelle: Auch im Ausland ist bereits ein Netz an Erdgastankstellen vorhanden. Unter finden sich Anzahl und Informationen von Erdgastankstellen im europäischen Ausland. Spitzenreiter sind Italien mit gesamt 103 CNG-Tankstellen und Schweden mit gesamt 189 Tankstellen. Eine Routenplanung bezüglich Erdgastankstellen im europäischen Ausland kann auf der Internetseite durchgeführt werden. Die Auswahl an erdgasbetriebenen Fahrzeugen ist bereits relativ groß und vielfältig. So gibt es Erdgasfahrzeuge für verschiedenste Einsatzmöglichkeiten, ob Kleinwagen, Familien-Van oder Limousine und von verschiedensten Herstellern wie z. B. Fiat, Audi, VW oder Opel. Auch können Fahrzeuge mit Ottomotor mit Erdgastanks nachgerüstet werden, jedoch verliert das Fahrzeug bei einer Nachrüstung deutlich an Kofferraumvolumen. Bei den Neuwagen werden die Erdgastanks platzsparend eingebaut. Die Kraftstoffersparnis beträgt bei einem neuen Erdgasfahrzeug gegenüber einem mit Benzin betriebenem Fahrzeug 50 % und bei einem Dieselfahrzeug 30 % 165. Der 165 Quelle: Stadtwerke Düsseldorf: 229
232 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Äquivalentpreis für Erdgas (umgerechnet auf den Energiegehalt von einem Liter Super- Benzin) entspricht bei einem angenommenen Erdgaspreis von 1,08 EUR/kg ca. 0,7 EUR/Liter 166. Neben der Kosteneinsparung beim Tanken können Erdgasfahrer auch durch steuerliche Vorteile profitieren, wie durch die emissionsbezogene Kfz-Steuer, welche ab 07/2009 in Kraft getreten ist. Den niedrigeren Unterhaltskosten eines erdgasbetriebenen Fahrzeugs gegenüber stehen die Mehrkosten eines Neuwagen, bzw. den Kosten einer Umrüstung. Bei einer Umrüstung auf Erdgas können je nach Fahrzeugmodell mit bis EUR gerechnet werden. Somit müssen bei einem Fahrzeug mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 8 l/100km und ein Preis von 1,6 EUR/Liter für Superbenzin ca km gefahren werden, damit sich die Umrüstung amortisiert. Demnach lohnt sich die Umrüstung für Vielfahrer oder Fahrzeuge mit einem hohen spezifischen Verbrauch schneller. Die Mehrkosten eines erdgasbetriebenen Neuwagens gegenüber einem benzinbetriebenen Fahrzeug liegen derzeit bei ca bis EEUR 167. Im Folgenden werden anhand eines Kleinwagens (Vier-Sitzer) 168 die Superbenzin-Variante und die Erdgas-Variante hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs und der CO 2 -Emissionen verglichen und Amortisationszeiten pauschal berechnet. Die Mehrkosten des erdgasbetriebenen Modells betragen in der Neuanschaffung rd EUR. Dem Kraftstoffverbrauch des benzinbetriebenen Modells steht mit 4,5 Liter/100 km der Verbrauch von 2,9 kg/100 km Erdgas entgegen. Bei einem angenommenen Preis von 1,6 EUR/Liter für Superbenzin und 1,08 EUR/kg Erdgas 169 hat sich der Mehrpreis hinsichtlich der Kraftstoffkosten nach rd km amortisiert. Neben den geringeren Kraftstoffkosten und der niedrigeren Steuern werden Erdgasfahrer in vielen Regionen auch durch Anschaffungsprämien der Energieversorger unterstützt. So auch bieten die Stadtwerke Belzig einen Anreiz für die Anschaffung von Erdgasfahrzeugen für das Jahr 2012/ Im Rahmen einer Förderung werden Tankgutscheine von 750 kg Erdgas bei Anmeldung eines Neufahrzeugs im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Belzig vergeben. Die Förderung ist auf ein Jahr nach Ausgabe des Gutscheines begrenzt. Weiterhin besteht die Möglichkeit, vom Vorversorger der Stadtwerke Bad Belzig, der Energie Mark Brandenburg GmbH, zusätzlich 333,00 EUR zu erhalten. 170 Durch Untersuchung der dargestellten Vorteile wird vorgeschlagen, die Diskussion um erdgasbetriebene Fahrzeuge stärker in die Öffentlichkeit der Stadt zu stellen, um so dass Bewusstsein zu stärken. Die Stärkung des Bewusstseins hinsichtlich der positiven Eigenschaften von Erdgasfahrzeugen erscheint wichtiger als eine weitere Ausstattung von Erdgaszapfsäulen in Belzig. Eine weitere Möglichkeit, das Bewusstsein der Bevölkerung für Erdgasfahrzeuge zu stärken, stellt die Vorreiterrolle der Kommunen und Verkehrsbetriebe dar, welche ihren Fuhrpark sukzessive auf Erdgasantrieb umstellen könnten. Wie für private Autos gibt es auch für kleine Flotten oder große Fuhrparks bereits eine große Auswahl an Erdgasfahrzeugen. Eine grobe Auswahl an Kastenwagen, Klein-Bussen, Linienbussen, LKWs u. a. werden unter 166 Energiegehalt Super-Benzin: 8,6 kwh/l, Erdgas: ca. 13,3 kwh/kg, Quelle: Quelle: Untersuchung der VW-Modelle Standard up und Eco-up 169 Quelle Kraftstoffpreise: (Stand 02/2013) 170 Quelle: Stadtwerke Bad Belzig GmbH 230
233 9. Nutzung von erneuerbaren Energien dargestellt. Z.B. bietet der Motorenhersteller MAN die komplett modernisierte Niederflur-Stadtbusreihe für den Linienverkehr auch als Erdgasvariante an. 171 Da diese Nutzung nur bei Neuanschaffung wirtschaftlich sinnvoll ist, könnten die Linienbusse der Verkehrsgesellschaft Belzig mbh schrittweise auf Erdgasnutzung umgestellt werden. Eine Voraussetzung dafür wäre, dass die Verkehrsgesellschaft über eine eigene Erdgastankstelle verfügt. In diesem Fall würde sich eine Erweiterung der TOTAL-Tankstelle in der Brandenburger Straße anbieten Speichermöglichkeiten von erneuerbaren Energien Um die Erzeugung und den Verbrauch von Strom aus regenerativen Energiequellen wie aus Wind- und Photovoltaikanlagen räumlich zu entkoppeln, werden Speichermöglichkeiten benötigt. An konventionellen Stromspeichern dienen neben Akkumulatoren bisher beispielweise Pumpspeicher- und Druckluftspeicherkraftwerke. Mit Hilfe der Systemlösung Power to Gas kann Strom aus erneuerbaren Energien in Wasserstoff oder synthetisches Erdgas umgewandelt und im Erdgasnetz gespeichert werden. Durch dieses System wäre es möglich, große Mengen an Strom aus erneuerbaren Energien langfristig zu speichern. Erzeugtes Gas könnte in das deutsche Erdgasnetz eingespeist und gespeichert werden. Die Umwandlung von Strom in synthetisches Erdgas erfolgt in zwei Schritten. Im ersten Schritt wird der überschüssige Strom mit Hilfe von Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt. Im zweiten Schritt erfolgt die Methanisierung, in der aus Wasserstoff und Kohlendioxid künstliches Methan gewonnen wird, siehe Abbildung 138. Die Speicherung von Strom in Wasserstoffsystemen wurde bisher in verschiedenen Pilotprojekten demonstriert, davon befinden sich zwei im Land Brandenburg (ENERGTRAG- Hybridkraftwerk in Prenzlau; Falkenhagener Pilotanlage von E.ON). Einige Pilotprojekte befinden sich noch in der Umsetzung. 172 Bei einem möglichen Ausbau von Photovoltaikanlagen in Belzig sollte diese Technologie als Speichermöglichkeit verfolgt werden. 171 Quelle: Quelle:
234 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Abbildung 138: Anwendungsfelder im Power-to-Gas -Prozess, Quelle: dena Eine weitere Möglichkeit, regenerative Energien in Form von Wärme zu speichern, ist der Einsatz von Latentwärmespeichern. Dort können ca. 2/3 der eingesetzten Wärme verlustfrei gespeichert werden. 232
235 9. Nutzung von erneuerbaren Energien 9.9. Energieautarker Ortsteil: Dippmannsdorf Bestandsaufnahme Im Folgenden wird anhand des Ortsteils Dippmannsdorf untersucht, wie eine bilanzielle Selbstversorgung in Belzig aussehen könnte. Als Grundlage für die überschlägigen Berechnungen dienen die Energieverbräuche aus dem Jahr 2010 sowie die ermittelten Potenziale aus den vorangegangenen Kapiteln. Dippmannsdorf ist ein Ortsteil der Stadt Belzig und hat 355 Einwohner (Stand 01/2012). Der Ort ist verkehrsmäßig über die Bundesstraße B 102 angebunden, welche durch den Ort führt (siehe Abbildung 139). Die Entfernung zur Stadt Belzig beträgt 9 km und die Autobahnausfahrten Wollin, Brandenburg, Linthe und Niemegk befinden sich in der Nähe. 173 Mehrheitlich sind in dem Ort Einfamilienhäuser zu finden. 173 Quelle: 233
236 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Abbildung 139: Dippmannsdorf, Quelle: Energieverbrauch Der Stromverbrauch in Dippmannsdorf beträgt ca MWh/a. Der Wärmeverbrauch liegt bei ca MWh/a. Zurzeit wird der Wärmebedarf durch unterschiedliche dezentrale Energieerzeugungsanlagen gedeckt, wobei Heizöl mit ca. 72 % den größten Anteil trägt. Mit Flüssiggas werden ca. 14 %, mit Braunkohle ca. 5 %, mit Biogas ca. 6 % und mit Holz ca. 2,2 % des Wärmebedarfs gedeckt. Weniger als 5 % der Wärme wird durch Umweltwärme (Wärmepumpen) und Sonnenkollektoren bereitgestellt. 174 Aus der Verbrauchsbetrachtung wird deutlich, dass rd MWh Strom und rd MWh Wärme aus fossilen Energieträgern erzeugt werden. Um den Ortsteil als energieautark bezeichnen zu können, muss die gesamte Energie aus erneuerbaren Energien bereitgestellt werden. In vorliegender Analyse wird untersucht, wie bilanziell und konzeptionell eine Eigenversorgung auf Basis von regionalen erneuerbaren Energien von Dippmannsdorf möglich wäre. 174 Datengrundlage: Hochrechnungen B&SU 234
237 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Vorhandene Anlagen zur Nutzung Erneuerbarer Energien Neben den Hochrechnungen aus dem Energieverbrauch aller Ortsteile liegen in Dippmannsdorf Bestandsdaten für einen Biomasse-Heizkessel in der Dippmannsdorfer Schule vor. Der Heizkessel wird mit Holzpellets betrieben und hat eine Nennleistung von 76 kw Potenziale zur Nutzung von Erneuerbaren Energien Bei der Überlegung, Dippmannsdorf zu einem bilanziell selbstversorgten Ortsteil zu gestalten, sollten im ersten Schritt Potenziale zur Energieeinsparung und Effizienzsteigerung genutzt werden, um den aktuellen Wärme- und Stromverbrauch der Bevölkerung zu senken. Die vorliegenden überschlägigen Berechnungen berufen sich jedoch auf die Verbrauchsdaten von Photovoltaik - Aufdachanlagen Die Häuser wurden in Dippmannsdorf zu einem Großteil mit Schrägdächern und einer Ausrichtung der Längsseiten nach Osten und Westen erbaut. Dies hat zur Folge, dass nur wenige Dachflächen für die Aufdachmontage von Photovoltaik-Anlagen optimal geeignet sind. Vereinzelt weisen die langen Seiten der Dächer nach Norden und Süden. Die nach Süden (auch Süd-Ost und Süd-West) zeigenden größeren Dachflächen können für die Montage von Photovoltaikanlagen genutzt werden, um einen optimalen Ertrag zu erzielen. Die ermittelten Gesamtdachflächen, welche hinsichtlich Ausrichtung und Neigung für die Verwendung von Photovoltaikanlagen geeignet sind, betragen ca. 700 m². Daraus ergeben sich eine installierbare Leistung von ca. 70 kwp und ein Stromertrag von ca kwh/a. Soll der Photovoltaikstrom selbst verbraucht werden, gibt es verschiedene Produkt- Möglichkeiten für intelligente Steuerungen. Über ein System wird der selbst erzeugte Strom so gesteuert, dass der Bedarf des Hauses abgedeckt wird und der überschüssige Strom im nächsten Schritt die Batteriespeicher auflädt. Photovoltaik-Freiflächenanlagen Durch die Ausrichtung der Schrägdächer (ein Großteil nach Ost und West) sind in Dippmannsdorf nur geringe Flächen für die Nutzung von Photovoltaikanlagen geeignet. Daher sollte geprüft werden ob ungenutzte Freiflächen für die Errichtung von Solarparks genutzt werden können. Solarthermie Solarthermieanlagen eignen sich für die dezentrale Warmwasserbereitung sowie zur Heizungsunterstützung im dezentralen Bereich. 175 Quelle: Unterlagen der Stadt Belzig, Ansprechpartner Herr Friedrich 235
238 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Da die wenigen Schrägdachflächen für Photovoltaik genutzt werden könnten, ist eine Fassadennutzung für die Solarthermie in Betracht zu ziehen. Der Vorteil bei einer Fassadenanlage ist, dass im Sommer der Wärmeüberschuss reduziert wird und dafür in den Übergangs- und Wintermonaten mehr Wärme durch die tiefstehende Sonne eingefangen werden kann. Für diese Nutzung eignen sich Gebäudefassaden, welche nach Süden ausgerichtet und unverschattet sind. Wie bereits unter Kapitel beschrieben, werden für ein beispielhaftes Einfamilienhaus ca. 7 m² Vakuumröhrenkollektoren benötigt. Auch hier sollte darauf geachtet werden, dass nur Haushalte ohne KWK-Anlagen mit Solarthermie ausgestattet werden. Besonders in den Sommermonaten stellt die Warmwasserbereitung für ein BHKW oft die einzig sinnvolle Wärmenutzung dar. Daher stehen die Solarthermie- und KWK-Anlagen in Konkurrenz zueinander. Anders verhält es sich bei Wärmepumpen, welche solarthermische Anlagen sinnvoll ergänzen können. Nutzung von Oberflächen-Wasser Wasser/ Wasser-Wärmepumpen (W/W WP) nutzten den Wärmeinhalt von Wasser. Diese Art der Wärmepumpen stellt den effizientesten Typ dar und es werden hohe Leistungszahlen (COP) von bis zu 6 erreicht. Die gängigste Variante ist die Nutzung von Grundwasser. Dazu werden zwei Brunnen (Förder- und Schluckbrunnen) mit Mindestabstand und einer Tiefe von m gebohrt. Dort steht eine ganzjährige Temperatur von 7-12 C zur Verfügung. Voraussetzung für die Nutzung stellt ein geeigneter Grundwasserleiter. Eine weitere Möglichkeit der Wasser/ Wasser-Wärmepumpennutzung besteht darin, oberflächennahe Gewässer wie Flussläufe, Teiche und Seen als Wärmequelle zu nutzen. Dort steht aufgrund der Anomalie des Wassers eine minimale Temperatur von 4 C (nicht durchgefroren) zur Verfügung. Im Raum Dippmannsdorf und Umgebung grenzen die Belziger Landschaftwiesen an. Dort steht eine Vielzahl kleiner und größerer Wasserquellen zur Verfügung. Meist tritt das Grundwasser flächig, an mehreren Punkten auf den Wiesen gleichzeitig, aus dem Erdboden hervor. So entstehen in den Wiesen Quellsümpfe. Eine Hauptquelle ist meist nicht zu sehen, vielmehr sickern viele kleine Rinnsale aus dem Boden, die sich oft erst in einiger Entfernung zu einem Bachlauf vereinigen. Quellsümpfe erinnern auf den ersten Blick an normale Feuchtwiesen oder Bruchwaldgebiete. Quellgebiete frieren fast nie zu und selbst im Winter findet man in ihnen noch frische, grüne Vegetation. Diese Besonderheit wird durch eine das ganze Jahr relativ gleichbleibende Wassertemperatur von 4 bis 13 C bewirkt. 176 Dieses Wasser könnte in frostfrei-verlegten Leitungen transportiert werden und zu einem kalten Nahwärmenetz ausgebaut werden. Dies setzt eine Erdreichüberdeckung von min. 80 cm voraus. Einzelverbraucher können die Umweltwärme aus diesem Netz beziehen und damit eine Wasser/ Wasser-Wärmepumpe betreiben. Das abgekühlte Wasser müsste den Belziger Landschaftwiesen wieder zugeführt werde. Voraussetzung für das Betreiben einer solchen Wärmeverteilung ist der ausreichend zur Verfügung stehende Volumenstrom des Quellwassers (Schüttleistung). Dies müsste gesondert untersucht werden. Für eine Anlage mit einer thermischen Leistung von 19 kw müsste ein Wasservolumenstrom von ca. 3,9 m³/h
239 9. Nutzung von erneuerbaren Energien zur Verfügung stehen. Aufgrund des tiefen Temperaturniveaus im Winter besteht jedoch die Gefahr des Einfrierens von Anlagenteilen und Rohrleitungen, da dem 4 C kalten Wasser Energie entzogen wird und es sich weiter Richtung Gefrierpunkt abkühlt. Notwendige Sicherungsmaßnahmen gegen das Einfrieren müssten für einen sicheren ganzjährigen Betrieb getroffen werden. Viele W/W-WP sind nicht für eine direkte Oberflächenwassernutzung, ohne Systemtrennung, freigegeben. Grund dafür ist die schwankende Verunreinigung und chemischen Zusammensetzung des Quellwassers. Eine Freigabe durch die Hersteller ist meist nur bei grundwasserbetriebenen Anlagen möglich Da es sich bei den Belziger Landschaftwiesen um ein europäisches Vogelschutzgebiet handelt, muss die Umweltverträglichkeit gesondert geprüft werden. Darüber hinaus sind Wasser/Wasser-Wärmepumpen bei der Nutzung von Grund- oder Oberflächenwasser genehmigungspflichtig. 179 Oberflächennahe Geothermie Die oberflächennahe Geothermie bezieht sich auf die Nutzung der Erdwärme bis zu einer Tiefe von 400 m unterhalb der Erdoberfläche. In Deutschland beträgt die mittlere Temperatur an der Erdoberfläche ca C und in 100 m Tiefe durchschnittlich 9-15 C. In Verbindung mit einer Wärmepumpe lassen sich zur Erhöhung der Heiztemperatur alle Gebäude effektiv beheizen, welche mit einem Niedertemperaturheizsystem ausgestattet sind wie z. B. Fußbodenheizung. Die Wärmepumpen-Heizung eignet sich gut als alleiniges Heizsystem im Einfamilien-Wohnhausbereich und ist daher für den Einsatz in einem Ort wie Dippmannsdorf gut geeignet. Die oberflächennahe Geothermie kann in zwei Systemen unterschieden werden. Bei den geschlossenen Systemen wird die Erdenergie über ein geschlossenes Rohrsystem genutzt, wo hingegen bei den offenen Systemen das Grundwasser direkt genutzt wird. Zu den geschlossenen Systemen gehören Erdwärmesonden, Erdwärmekollektoren, während Brunnenanlagen und Aquiferspeicher zu den offenen Systemen zählen. Für die Nutzung des geothermischen Wärmepotenzials im Untergrund werden meist Erdwärmesonden verwendet. Unter diesen Erdwärmesonden versteht man zwei U-Rohre, welche in vertikale Bohrungen eingebracht werden. Die Bohrungen sind zwischen mehreren zehn bis einige hundert Meter tief. Der Durchmesser der Bohrungen liegt zwischen 12 cm und 20 cm. Je nach Untergrund und Betriebsstunden schwanken die Längen der benötigten Erdwärmesonden stark. Bei einem Einfamilienhaus mit einer Heizleistung von ca. 8 kw und einer Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe von 4, werden bei einem schlechten Untergrund ca. 300 m Erdwärmesonde benötigt (bei Betriebsstunden). Wo hingegen bei einer spezifischen Entzugsleistung von 84 W/m bei einem Gestein mit hoher Wärmeleitfähigkeit Beispielsweise nur ca. 72 m benötigt werden (1.800 h)
240 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Während bei Erdwärmesonden die Wärme aus tieferen Schichten entnommen wird, nutzen Horizontalkollektoren die Wärme aus Schichten zwischen 1 2,5 m unter der Geländeoberkante. Hierbei werden Kunststoffleitungen horizontal in der Erde verlegt. Der Vorteil bei diesem System ist der geringe Aufwand. Auch hier ist die Größe der zu dimensionierenden Kollektorfläche abhängig von der Geologie des Bodens. Als Faustwert sollte bei neuen Einfamilienhäusern mindestens die beheizte Gebäudefläche als Kollektorfläche angesetzt werden. Wenn die Wärmepumpe mit Strom betrieben wird, muss dieser aus regenerativen Quellen bereitgestellt werden. Am Beispiel eines Einfamilienhauses werden für die Deckung der Heizleistung von ca.8 kw durch eine geothermische Wärmepumpe ca kwh/a Strom benötigt. Dies ist z. B. durch eine Photovoltaikanlage von ca. 5 kwp rechnerisch deckbar. 180 Möglich ist auch, gasbetriebene Wärmepumpen einzusetzen, welche mit dem regional erzeugten Biogas betrieben werden könnten (siehe folgende Beschreibungen). Biogas-BHKW und virtuelle Kraftwerke Ein Großteil der Energie könnte über den Betrieb einer KWK-Anlage auf Basis von Biogas und virtuellen Kraftwerken in Form von Biogas-BHKW bereit gestellt werden. Da jedoch, wie in den vorangegangenen Kapiteln bereits beschrieben, die vorhandenen Biomassepotenziale durch die zwei bestehenden Biogasanlagen theoretisch bereits aufgebraucht werden, ist die Errichtung einer dritten Biogasanlage nicht sinnvoll. Jedoch könnte bei notwendigen Sanierungsmaßnahmen der Bestandsanlagen über eine strukturelle Veränderung des Standortes nachgedacht und eine Ersatzerrichtung im Raum Dippmannsdorf in Betracht gezogen werden. Dort können die biologischen Erzeugnisse und Abfälle aus Belzig in Biogas umgewandelt werden (siehe Abschnitt 9.3). Unter dieser Annahme wird im Folgenden ein Szenario erstellt, welches auf der Nutzung von Biogas basiert. Ein virtuelles Kraftwerk ist eine Zusammenschaltung von mehreren dezentralen Stromerzeugungseinheiten. Viele flexible Kraftwerke in Form von BHKW, welche sich innerhalb von wenigen Minuten an- und abschalten lassen, können die Schwankungen der Stromerzeugung von regenerativen Energien wie Sonne und Wind ausgleichen. Der Begriff virtuell bedeutet in diesem Fall, dass bei diesem Kraftwerk mehrere Standorte vorhanden sind. Das Ziel dieses virtuellen Kraftwerks ist, flexibel einsetzbare Kraftwerksleistung bereit zu stellen und so den Eigenbedarf ohne externe Energieversorgung zu decken. Um einen Energieträger für die Nutzung der BHKW auf regenerativer Basis bereit zu stellen und damit das Dorf autark mit Energie versorgen zu können, müsste eine Biogasanlage im Raum Dippmannsdorf errichtet werden. Dort können die biologischen Erzeugnisse und Abfälle aus Belzig in Biogas umgewandelt werden (siehe Biomasse- Potenzialbeschreibungen unter 9.2). 180 Bußmann, Werner : Geothermie Energie aus dem Innern der Erde. 238
241 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Voraussetzung für eine bilanzielle Selbstversorgung ist neben der Biogasanlage auch die Errichtung eines örtlichen Gasnetzes. So kann das Biogas in der Anlage erzeugt und in das neu errichtete Gasnetz eingespeist werden. Im Ortskern wird über ein Nahwärmenetz und das mit Biogas betriebene BHKW die elektrische Grundlast des Ortes gedeckt. Für die thermischen Spitzenlasten können mit Biogas betriebene Wärmeerzeuger (Stückholz, Pellets, u. a.) die notwendige zusätzliche thermische Leistung liefern. In einzelnen Wohnkomplexen werden die monovalenten Blockheizkraftwerke als dezentrale Wärmeerzeuger (virtuelle Kraftwerke) eingesetzt, um die Stromspitzenlasten abzudecken und somit das elektrische Stromnetz zu stabilisieren. Monovalent bedeutet in diesem Fall, dass die Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf die gesamte Heizlast ausgelegt wird und nicht - wie sonst üblich- nur auf die thermische Grundlast. In Verbindung mit ausreichend dimensionierten Heizungspufferspeichern kann somit ganzjährig der benötigte Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser gedeckt werden. Die einzelnen Kraftwerke werden vernetzt und von einer zentralen Leitstelle geregelt. Wärmebedarf und Strombedarf werden dabei analysiert und die Kraftwerke intelligent zuoder abgeschaltet. Somit kann das Stromnetz stabilisiert werden. Der Naturstrom aus PV- Anlagen oder ggf. aus Windkraft hat dabei den Vorrang. Durch einen Zusammenschluss des Grundlast-BHKWs im Ortskern, den dezentralen PV- Anlagen, Wärmepumpen, Solarthermieanlagen und den dezentralen BHKW unter der Annahme von örtlich produziertem Biogas) könnte sich Dippmannsdorf bilanziell selbst versorgen Aufbau und Struktur: Bilanzielle Selbstversorgung Die folgende beschreibende Zusammenfassung der bilanziellen Selbstversorgung basiert auf der Nutzung von selbst erzeugtem Biogas. Dazu müsste die Ersatzerrichtung einer der bestehenden Biogasanlagen im Raum Dippmannsdorf erfolgen. Da dieses Konzept sich zwar auf den Ortsteil Dippmannsdorf konzentriert, aber auch pauschal auf andere Ortsteile übertragbar sein soll, wird trotz der Problematik in Dippmannsdorf dieses Szenario auf Basis von Biogas entwickelt. Eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der Maßnahmen zum selbstversorgten Ortsteil bildet die Stabilisierung des elektrischen Netzes. Es darf zu keiner Zeit weder zu einer Übernoch zu einer Unterversorgung kommen. Durch die Vernetzung der Klein-BHKW (Virtuelle Kraftwerke) und der intelligenten zentralen Steuerung inkl. Netzüberwachung kann das elektrische Netz stabilisiert werden. Bei Bedarf werden die Klein-BHKW zu-/ oder abgeschaltet. Durch die relativ geringe elektrische Leistung können diese kleinen Kraftwerke (ca. 20 kw el ) schnell ans Netz gehen. Kleinere Leistungsschwankungen können durch den Einsatz von Batterien geglättet werden. Die Grundlast kann durch die zentrale KWK-Anlage auf Basis von Biogas im Ortskern sichergestellt werden. Diese liefert Strom und Wärme für die an das Nahwärmenetz angeschlossenen Verbraucher. Um die KWK-Anlage auch in den Sommermonaten betreiben zu können, werden Latentwärmespeicher eingesetzt. Nicht benötigte Wärmeenergie wird 239
242 9. Nutzung von erneuerbaren Energien dort eingespeichert und im Bedarfsfall wieder freigesetzt. Ca. 2/3 der eingesetzten Wärmeenergie kann so verlustfrei gespeichert werden. Wärmeverbraucher ohne Gasanschluss können durch den Einsatz von Wärmepumpen den Wärmebedarf sicherstellen. Für das Betreiben der Wärmepumpen kann der erzeugte Strom aus KWK-Anlagen oder Photovoltaikanlagen genutzt werden. Gerade in den Wintermonaten wird es zu einer Überproduktion an elektrischer Energie kommen. Diese kann z. T. für die Wärmepumpen genutzt werden. Der überschüssige Strom kann an benachbarte Kommunen verkauft werden. Eine weitere Möglichkeit der Wärmeerzeugung ist der Einsatz von fester und flüssiger Biomasse in Form von Holzhackschnitzeln, Stückholz, Holzpellets und Bioölen. Somit können auch abgelegene Wärmeverbraucher mit regionaler Bioenergie versorgt werden. Folgende Anlagen-Bestandteile sind zusammenfassend für eine bilanzielle Selbstversorgung notwendig: Biogasanlage Biogasnetz mit Biogas betriebene zentrale KWK-Anlage mit Nahwärmenetz und Latentwärmespeichern mit Biogas betriebene virtuelle Kraftwerke (Klein-BHKW) Photovoltaikanlagen Wärmepumpen Solarthermie Die nachfolgende Abbildung stellt das beschriebene Zusammenspiel der verschiedenen Energieträger zur Umsetzung eines bilanziell selbstversorgten Ortsteils Dippmannsdorf dar. Um die untersuchten Maßnahmen umzusetzen, müssen große infrastrukturelle Veränderungen hinsichtlich Brennstoffversorgung und Wärmeabnahmen umgesetzt werden. Zudem spielt für die Umsetzung die Akzeptanz und die Beteiligung der Bewohner eine wichtige Rolle. 240
243 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Fazit Das vorliegende Konzept stellt ein Gerüst für eine mögliche bilanzielle Selbstversorgung in Sonnenenergie Erdwäme Photovoltaik anlage Virtuelle Kraftwerke Klein-BHKW Wärmepumpe Solarthermie Spitzenlast ca. 350MWh ca. 550 MWh ca kwh ca.1100mwh ca kwh ca kWh Strombedarf Dippmannsdorf ca.1,2mwh ca.400mwh KWK Anlage Nahwärmenetz Dorfkern Grundlast ca.500mwh Wärmebedarf Dippmannsdorf ca. 1,7MWh/a Batterie Speicher Latent wärmespeicher Biologische Abfälle Biogas Maissilage/ Winterrogge Legende Strom Wärme Biogas sonstiges Wärme m³/a 6kWh/m³ Grünschnitt Rindergülle Abbildung 140: Energiekonzept Dippmannsdorf Dippmannsdorf dar und bietet Raum für weitere detaillierte Untersuchungen. In dem beschriebenen Szenario spielt jedoch die Bereitstellung der notwendigen Biomasse eine wichtige Rolle. Da jedoch die beiden Biogasanlagen in Werbig und Schwanebeck stehen, ist eine Biogaserzeugung in Dippmannsdorf derzeit nicht möglich. Da auch die angrenzenden Belziger Landschaftswiesen nicht für Agrarwirtschaft und eine eigene Produktion von Biomasse genutzt werden können, stellt Dippmannsdorf keinen idealen Standort für eine energetische Selbstversorgung dar. 241
244 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Finanzierungs- und Betreibermodelle Oft sind die Möglichkeiten für einzelne Bürger beschränkt, um Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien zu errichten und zu betrieben. Selbst wenn das Interesse da ist, werden jedoch die eigenen finanziellen Möglichkeiten schnell überstiegen. 181 Eine mögliche Lösung stellt eine sogenannte Bürgerenergieanlage dar, um Kapital, Wissen und Zeitkapazitäten zu bündeln. Dabei betreiben und finanzieren Bürger gemeinsam eine Energieanlage und profitieren an der gesetzlich gesicherten Einspeisevergütung. Es gibt zwei unterschiedliche Modelle. Zum einen gibt es die Möglichkeit, dass Bürger eine Betreibergesellschaft für eine Energieanlage gründen und Miteigentümer dieser Gesellschaft werden. Über diese Form sind die Bürger direkt am Gewinn des Projekts beteiligt, übernehmen aber auch unternehmerische Risiken. Beim anderen Modell finanzieren Bürger Energieanlagen unter der Führung eines anderen Unternehmens mit. Je nach unterschiedlicher Beteiligungsform stellen die Bürger dem Projektbetreiber ihr Geld direkt zur Verfügung oder es ist ein Finanzinstitut dazwischen geschaltet. Die unterschiedlichen Betreiber- und Finanzierungsmodelle werden im Folgenden erläutert. Bürgerenergieanlagen: Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) In diesem Modell gründen Bürger eine Betreibergesellschaft für eine Energieanlage und werden Miteigentümer dieser Gesellschaft. Dabei haben sie Mitbestimmungs- und Kontrollrechte und profitieren direkt am Gewinn. Jedoch übernehmen sie auch die unternehmerischen Risiken. Am bekanntesten sind aus diesem Modell wohl die Bürgersolaranlagen. Gegründet wird eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) und die Aufgaben unter sich aufgeteilt, wie die Suche einer geeigneten Fläche, das Aushandeln eines Pachtvertrages, die Versicherung, Wartung, etc. Die GbR erhält als Eigentümerin der Energieanlage die Einspeisevergütung für den erzeugten und eingespeisten Strom. Der Überschuss des Geldes wird nach Abzug der laufenden Kosten unter den GbR-Gesellschaftern aufgeteilt. Bei diesem Modell ist der Nachteil, dass die Gesellschafter in vollem Umfang mit ihrem Privatvermögen haften. Daher sollte bei der Vorbereitung auf eine Risikobegrenzung, wie durch geeignete Versicherungen, erfahrene Installateure etc. geachtet werden. Als weitere Möglichkeit zur Minderung der Risiken haben einige Bürgerenergieanlagen die GbR mit einem Verein kombiniert. Dabei bleibt die GbR weiterhin Eigentümern und der Verein wird als Dienstleister für die Errichtung und die Betriebsführung benannt. In diesem Fall übernimmt der Verein für diesen Bereich die Haftung und haftet aber nur mit dem Vereinsvermögen. Bürger finanzieren Energieprojekte unter der Führung eines anderen Unternehmens Bei diesem Modell wird das Bürgerkapital über Inhaberschuldverschreibungen eingebunden. Ein Unternehmen, wie z. B. ein Stadtwerk, verpflichtet sich den Zeichnern der Schuldverschreibungen den gezeichneten Betrag am Ende der Laufzeit zuzüglich vereinbarter Zinsen zurückzuzahlen. 181 Energieagentur Nordrhein-Westfalen: Klimaschutz mit Bürgerenergieanlagen
245 9. Nutzung von erneuerbaren Energien In diesem Fall haben die Bürger keine Mitspracherechte bei der Geschäftsführung, ihnen fällt eher die Aufgabe der Geldgeber zu. Inhaberschuldverschreibungen bieten Gestaltungsfreiheit hinsichtlich Laufzeit, Verzinsung, Rückzahlungsschritten und Kündigungsfristen. Stille Beteiligung bei energetischen Sanierungen Bei einer stillen Beteiligung ist die Geldeinlage des stillen Gesellschafters für Außenstehende nicht erkennbar. Ein stiller Gesellschafter wird in der Regel nicht an der Geschäftsführung beteiligt, wobei er auch nur mit dem eingelegten Kapital haftet. Eine Gewinnbeteiligung wird im Vertrag festgelegt. Diese stille Beteiligungsform wurde in NRW in einem Pilotprojekt durchgeführt. In diesem Projekt wurden an vier Schulgebäuden Energiesparmaßnahmen umgesetzt und eine Photovoltaikanlage installiert. Hierbei konnten Bürger das ausführende Unternehmen über eine stille Beteiligung mitfinanzieren. Bürger-Contracting In einem weiteren Pilotprojekt in NRW wurden an vier Schulen über eine finanzielle Beteiligung von Bürgern Energiesparmaßnahmen umgesetzt und eine Photovoltaikanlage installiert. Für jede der vier Schulen wurde eine eigene GmbH & Co. KG gegründet. Die Gesellschaft schloss mit der Kommune als Gebäudeeigentümer einen Contracting-Vertrag und verpflichtete sich damit, Energiesparmaßnahmen umsetzen zu lassen. Auch wurde das Schuldach für die Nutzung der Photovoltaikanlage an die Gesellschaft verpachtet. Während der Vertragslaufzeit profitiert die Schule an der Dachpacht und an einem Anteil der eingesparten Energiekosten. Nach dem Ende der Vertragslaufzeit profitieren die Schulen allein über eingesparten Energiekosten. Während der Vertragslaufzeit erhält die GmbH & Co.KG einen Anteil der eingesparten Energiekosten. Finanzierung über Fonds Auch über Fonds ist eine Mitfinanzierung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien für Bürger möglich. Bei einem Fonds werden von mehreren Kapitalgebern Gelder für ein gemeinsames Projekt zur Verfügung gestellt. Bei diesem Modell kann man mit geringem Aufwand an rentablen Großprojekten teilhaben. Finanzierung über Sparbriefe Bei diesem Modell können Bürger an der Finanzierung von Anlagen zur Nutzung von Erneuerbaren Energien teilhaben, ohne selbst unternehmerische Risiken einzugehen. In diesem Fall übernehmen die Banken und Sparkassen das Risiko. Einige Banken haben damit begonnen, Sparangebote mit Umwelt- oder Klimaschutzaspekten zu kombinieren. So wird ein Sparbrief z. B. zu einem KlimaGut-Brief. Hierbei vergibt die Sparkasse, die den Sparbrief aufgelegt hat, Kredite für die Finanzierung von Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien an ihre Kunden. Bei diesem Verfahren 243
246 9. Nutzung von erneuerbaren Energien gilt das Versprechen, bis zu der Höhe der insgesamt gezeichneten Sparbriefe Energieanlagen im heimischen Landkreis zu finanzieren. Der Anleger erhält dabei die Sicherheit eines normalen Bankprodukts und über eine festgeschriebene Verzinsung profitiert der Anleger von einer planbaren Rendite. Dieses Modell kann greifbarer gemacht werden, wenn z. B. das Finanzinstitut und das Stadtwerk in einem Ort kooperieren. So kann z. B. ein Sparbrief konzipiert werden, der den Kunden der Stadtwerke angeboten wird. Das Finanzinstitut gibt das Geld der Anleger über einen Kredit an das Stadtwerk weiter, welches damit eine bestimmte Energieanlage errichtet. Unterstützung von Bürgerenergieanlagen durch Kommunen Kommunen können das Zustandekommen von Bürgerenergieanlagen versuchen zu unterstützen. Zum einen werden Bürgerenergieanlagen häufig auf kommunalen Dachflächen oder Grundstücken errichtet. Hier könnte die Kommune durch eine Überprüfung und Bereitstellung ihrer Dachflächen unterstützend auftreten. Zudem können über die Kommunalverwaltung Ideen und Einschätzungen zur Durchführung von Bürgerenergieanlagen an die Bürger weitergetragen und verbreitet werden. Auch können Kommunen selbst Bürgerkapital einsetzen, sowohl bei energetischen Gebäudesanierungen, als auch bei der Errichtung von Energieanlagen. Weitere Informationen zu Bürgerenergieanlagen und Finanzierungsmodellen können in der Broschüre der Energieagentur NRW Klimaschutz mit Bürgerenergieanlagen eingesehen werden Fördermittel Energie vom Land Darlehen der landwirtschaftlichen Rentenbank 182 Die landwirtschaftliche Rentenbank stellt zinsgünstige Kredite für Investitionen in die Gewinnung und Nutzung von erneuerbaren Energien bereit. Dabei werden Investitionen zur energetischen Verwertung von nachwachsenden Rohstoffen und anderen organischen Verbindungen, sowie Investitionen von Unternehmern der Agrarund Ernährungswirtschaft (einschließlich Landwirten) in Photovoltaik-, Wind- und Wasserkraftanlagen gefördert. Zudem werden Investitionen von Windenergieunternehmen gefördert, deren Gesellschaftanteile mehrheitlich von Bürgern, Unternehmern und Grundstückseigentümern vor Ort gehalten werden. Die Höhe des Darlehens beträgt bis zu 100 % der förderfähigen Kosten, wobei je Kreditnehmer und Jahr 10 Mio. EUR nicht überschritten werden sollen. 182 Quelle: Förderdatenbank für Förderprogramme und Finanzhilfen des Bundes, der Länder und der EU: 244
247 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Fördermittel der KfW-Bankengruppe 183 Erneuerbare Energien Premium, Programm 271, 281 (Kredit) Mit diesem Programm werden Investitionen zur Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland gefördert. Folgende Anlagen können mit dem Programmteil Premium errichtet und erweitert werden: solarthermische Anlagen von mehr als 40 m² Bruttokollektorfläche zur Warmwasserbereitung und/oder Raumheizung von Wohngebäuden mit drei oder mehr Wohneinheiten sowie von Nichtwohngebäude mit mindestens 500 m² Nutzfläche (zur überwiegenden Bereitstellung von Prozesswärme oder zur solaren Kälteerzeugung) große, automatisch beschickte Biomasse-Anlagen zur Verbrennung fester Biomasse für die thermische Nutzung mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 100 kw wärmegeführte KWK-Biomasse-Anlagen mit einer Nennwärmeleistung von bis zu 2 MW aus erneuerbaren Energien gespeiste Nahwärmenetze, wobei der Wärmeabsatz mindestens 500 kwh pro Jahr und Meter Trasse betragen soll große aus erneuerbaren Energien gespeiste Wärmespeicher mit mehr als 10 m³ große effiziente Wärmepumpen mit einer installierten Nennwärmeleistung von mehr als 100 kw (mit Ausnahme von Luft/Wasser-Wärmepumpen) Biogasleitungen für unaufbereitetes Biogas Die Förderung erfolgt über ein zinsgünstiges Darlehen. Die Höhe des Darlehens kann bis zu 100 % der förderfähigen Investitionskosten, jedoch in der Regel 10 Millionen Euro pro Vorhaben betragen. Erneuerbare Energien Standard, Programm 270, 274 (Kredit) In dem Teil Standard dieses Förderprogramms werden Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, z. B. aus Sonne, Biomasse, Wasser, Wind, Erdwärme gefördert. Zudem werden Anlagen zur Wärmeerzeugung und Anlagen zur kombinierten Strom- und Wärmeerzeugung (KWK) gefördert, welche nicht groß genug für die Premium -Förderung sind oder deren technische Anforderungen nicht erfüllen. Auch in diesem Programmteil erfolgt die Förderung über ein zinsgünstiges Darlehen. Die Höhe des Darlehens beträgt bis zu 100 % der förderfähigen Kosten, wobei die Grenze bei 25 Millionen Euro pro Vorhaben liegt. Weitere Informationen und detaillierte Beschreibungen der Konditionen für alle Förderprogramme sind unter beschrieben. 183 Quelle: Internetseite der KfW-Bankengruppe: 245
248 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 184 ) Die Bundesregierung unterstützt den Ausbau von erneuerbaren Energien an der Stromversorgung. Über das EEG wird der vorrangige Anschluss von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien an die öffentlichen Elektrizitätsnetze sowie die Abnahme, Übertragung und Vergütung dieses Stroms durch die Netzbetreiber geregelt. Gefördert wird die Erzeugung von Strom aus Wasserkraft, Deponie-, Klär- und Grubengas, Biomasse, Geothermie, Windenergie sowie aus solarer Strahlungsenergie. Das Ziel ist, den Anteil an der gesamten Stromversorgung bis zum Jahr 2020 auf mindestens 35% zu steigern und danach kontinuierlich bis 2050 auf 80% zu erhöhen. Dabei soll eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung ermöglicht werden, wobei die Weiterentwicklung von Technologien zur Nutzung von erneuerbaren Energien unterstützt, die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung reduziert und so die fossilen Energieressourcen geschont werden sollen. Für die in Betrieb genommenen Anlagen werden festgelegte Vergütungssätze gewährt, wobei die Höhe der Vergütung von der Energiequelle, der Größe der Anlage sowie dem Zeitpunkt der Installation der Anlage abhängt. Als Ansprechpartner dienen die zuständigen Netzbetreiber sowie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz Über das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) werden die Modernisierung und der Neubau von KWK-Anlagen von der Bundesregierung gefördert. Auch werden über das Gesetz der Neu- und Ausbau von Wärme- und Kältenetzen und speichern, solange die Wärme, bzw. Kälte aus KWK-Anlagen eingespeist wird sowie die Markteinführung der Brennstoffzelle unterstützt. Durch das Gesetz werden Netzbetreiber verpflichtet, förderfähige KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen, den KWK-Strom vorrangig abzunehmen und zu vergüten Förderung von Mini-KWK-Anlagen Im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative wird die Neuerrichtung von Mini-KWK- Anlagen bis einschließlich 20 kw el vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gefördert. Die Höhe der Förderung ist abhängig von der Nutzungsdauer und Leistung der Anlage und erfolgt in Form eines Zuschusses. Als Ansprechpartner für weitere Informationen dient das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). 184 Siehe Fußnote
249 9. Nutzung von erneuerbaren Energien Marktanreizprogramm für Erneuerbare Energien (BAFA) Mit Investitionszuschüssen wird im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt des Bundesministeriums für Umwelt der stärkere Einsatz von erneuerbaren Energien gefördert. Die förderfähigen Maßnahmen sind Solarkollektoranlagen, Anlagen zur Verbrennung fester Biomasse für thermische Nutzung und für die kombinierte Wärme- und Stromerzeugung (KWK) sowie effiziente Wärmepumpen. Zudem werden Anlagen zur Nutzung der Tiefengeothermie, Nahwärmenetze welche mit Wärme aus erneuerbaren Energien gespeist werden, sowie besonders innovative Technologien zur Wärme- und Kälteerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland bezuschusst. Informationen zu den einzelnen Fördersegmenten und Fördervoraussetzungen finden Sie unter Zusammenfassung Nutzung von erneuerbaren Energien In diesem Kapitel wurden verschiedene erneuerbare Energien hinsichtlich Nutzungs- und Anwendungsmöglichkeiten in Bad Belzig untersucht. Auch wurde die Umsetzung eines energieautarken Ortsteils anhand von Dippmannsdorf betrachtet. Abschließend ist zu sagen, dass die Potenziale für Photovoltaik besonders im Wohngebiet Klinkengrund hoch sind. Auch wurden im Bereich der Biomasse bzw. Biogas durch die Restholzverwertung, die Nutzung von Grünschnitt, Gülle sowie Silagen Nutzungspotenziale ermittelt. Eine Zusammenarbeit mit anderen Kommunen wäre im Bereich der Klärgas- sowie der Windenergienutzung sinnvoll. Bei der Betrachtung des energieautarken Ortsteils spielt die Nutzung von Biogas über BHKW und virtuelle Kraftwerke eine bedeutende Rolle. Eine Ergänzung der Energiebereitstellung erfolgt über Photovoltaik- und Solarthermieanlagen, oberflächennahe Geothermie sowie entsprechende Speichertechnologien. 247
250 Quellenverzeichnis Quellenverzeichnis Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit: Energieeffiziente Straßen- und Platzbeleuchtung in Kommunen Bertelsmannstiftung: Demografiebericht Bad Belzig BEWOG: Wettbewerb Energetische Sanierung von Großwohnsiedlungen Wohngebiet Klinkengrund BMVBS: Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebäudebestand Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU): Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung Bußmann, Werner : Geothermie Energie aus dem Innern der Erde. Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union: Richtlinie über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten für die Gemeinschaft Energieagentur Nordrhein-Westfalen: Klimaschutz mit Bürgerenergieanlagen Europäische Kommission: Energieeffizienzplan EWI, GWS, Prognos für das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Hrsg.): Energieszenarien für ein Energiekonzept der Bundesregierung. Basel/Köln/Osnabrück Fördergemeinschaft Gutes Licht: LED: Das Licht der Zukunft. Online abrufbar: Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin Brandenburg: Landesentwicklungsplan Berlin- Brandenburg (LEP B-B). März Grundmann, Philipp u. a.: Endbericht Regionale Potenzialanalyse Biomasse als Energierohstoff in regionalen Wirtschaftskreisläufen in der Region Havelland-Fläming. Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: Wärmedämmung von Außenwänden mit der Innendämmung. Überarbeitung Online abrufbar: IDAS Planungsgesellschaft mbh: Flächennutzungsplan Begründung Entwurf. März Online abrufbar: IFEU, Fraunhofer ISI, GWS, Prognos AG (Hg.): Energieeffizienz: Potenziale, volkswirtschaftliche Effekte und innovative Handlungs- und Förderfelder für die Nationale Klimaschutzinitiative. Heidelberg, Karlsruhe, Berlin, Osnabrück, Freiburg Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann + Partner GmbH u.a.: Entwicklung von Kostenfunktionen zur Prüfung einer Umstellung von aerober Stabilisierung auf Schlammfaulung. 248
251 Quellenverzeichnis Institut für Wohnen und Umwelt: Konstruktionshandbuch Verbesserung des Wärmeschutzes im Wohngebäudebestand Online abrufbar: Integriertes Stadtentwicklungskonzept Bad Belzig IPCC: Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation Kaltschmitt, Martin: Regenerative Energien in Österreich Kobelt, Manuel: Untersuchung der Abwärmeströme eines BHKW Moduls zur Dampferzeugung im ORC Prozess zur Stromerzeugung. BHKW 0,5-1 MW. Berlin Landkreis Potsdam-Mittelmark: Demografiebericht Nr. 1. Oktober LBV Landesamt für Bauen und Verkehr: Mittelbereichsprofil Bad Belzig Online abrufbar: LBV, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2010: Bevölkerungsprognose Land Brandenburg 2009 bis Online abrufbar: Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Land Brandenburg: Kommunale Abwasserbeseitigung im Land Brandenburg Lagebericht Online abrufbar: Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg: Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg Othmer, J. u. a.,: Wettbewerb Energetische Sanierung von Großwohnsiedlungen Wohngebiet Klinkengrund Quaschning, Volker: Erneuerbare Energien und Klimaschutz Quaschning, Volker: Regenerative Energiesysteme RPG Havelland-Fläming: Regionalplan Havelland-Fläming Sattler, Herbert: Gutachten zur Ermittlung der Zonenanfangswerte für das Sanierungsgebiet Historische Altstadt Belzig Belzig Siteco: Lichtwerkzeuge für die CO 2 -Reduktion Online abrufbar: Stadt Bad Belzig: Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Bad Belzig, Bad Belzig, Studie Eudysé: Effizienz und Dynamik. Siedlungsentwicklung in Zeiten räumlich und zeitlich disparater Entwicklungstrends. Umweltministerium Baden-Württemberg: Handreichung zur energieeffizienten Straßenbeleuchtung Online abrufbar: 249
252 Quellenverzeichnis wuerttemberg.de/servlet/is/55053/handreichung_strassenbeleuchtung.pdf?command=downl oadcontent&filename=handreichung_strassenbeleuchtung.pdf Internetquellen (alle zuletzt geprüft am ): PR-Faltblatt-GeothermieBohrungde_pdf;jsessionid=3E23EA632A2EBD90D283FD14393DC213?binary=true&status=300&lan guage=de les_energiekonzept.pdf
253 Quellenverzeichnis
254 Abkürzungsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis AW BGF BHKW BRI BSF CCFL EEG EFH EnEV EVG EW GEMIS GSM HAST HID HMD HQL IPCC IuK KGF KVG KWK LED MFH NAV NGF Außenwand Brutto Grundfläche Block-Heizkraftwerk Brutto Rauminhalt Bezirksschornsteinfeger Cold-Cathode Fluorescent Lamp Erneuerbare Energien Gesetz Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung Elektronisches Vorschaltgerät Einwohner Globales Emissions-Modell integrierter Systeme Global System for Mobile Communications Hausübergabestation Hochdruck-Endladungslampe Halogenmetalldampflampe Hochdruck-Quecksilberdampflampe Intergovernmental Panel on Climate Change Informations- und Kommunikationstechnologien Konstruktionsgrundfläche Konventionelles Vorschaltgerät Kraft-Wärme-Kopplung Light Emitting Diode Mehrfamilienhaus Natriumdampf-Hochdrucklampe Netto Grundfläche 252
255 Abkürzungsverzeichnis PM RLT U VG WBS WDS WDVS WLG WRG WSchVO Potsdam-Mittelmark Raumluft-Technik Wärmedurchgangskoeffizient Vorschaltgerät Wohnbauserie Wärme-Direkt-Service Wärmedämmverbundsystem Wärmeleitfähigkeitsgruppe Wärmerückgewinnung Wärmeschutzverordnung 253
256 Einheitenverzeichnis 254 Einheitenverzeichnis a Jahr cm Zentimeter EUR Euro g Gramm GW Gigawatt GWh Gigawattstunde h Stunde K Kelvin kg Kilogramm km Kilometer kw Kilowatt kwh Kilowattstunde kw p Kilowatt peak l Liter lm Lumen m Meter mm Millimeter MW Megawatt MWh Megawattstunde mws Meter Wassersäule t Tonne W Watt
257 Abbildungsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Endenergieverbrauch 2010 nach Teilräumen... 6 Abbildung 2: Vergleich der Endenergieverbräuche 1992, 2000 und Abbildung 3: CO 2 -Emissionen nach Sektoren... 9 Abbildung 4: Ziele Bund und Brandenburg und Referenz- und Klimaszenario bezogen auf die Bevölkerungsentwicklung in Bad Belzig...12 Abbildung 5: Die Lage Bad Belzigs im Landkreis Potsdam-Mittelmark und im Land Brandenburg...18 Abbildung 6: Karte der Stadt Bad Belzig mit Ortsteilen und Einwohnerzahlen Abbildung 7 Bevölkerungsentwicklung in Bad Belzig von 2000 bis 2008 und Prognose bis Abbildung 8: Übersichtsplan der Gasversorgung in Bad Belzig...24 Abbildung 9: Kernstadt mit den Teilräumen und Kartierung der leitungsgebundenen Energieträger...26 Abbildung 10: Kartierung der Energieerzeugungsanlagen Bad Belzig...30 Abbildung 11: Pro-Kopf-Endenergieverbrauch Strom und Wärme nach Teilräumen für das Jahr Abbildung 12: Endenergieverbrauch 2010 nach Sektoren...38 Abbildung 13: Endenergieverbauch 2010 nach Teilräumen...40 Abbildung 14: Pro-Kopf-Endenergieverbrauch 2010 nach Teilräumen...40 Abbildung 15: Vergleich der Endenergieverbräuche 1992, 2000 und Abbildung 16: CO 2 -Emissionen nach Sektoren...45 Abbildung 17: CO 2 -Emissionen nach Teilräumen...46 Abbildung 18: Vergleich der CO 2 -Emissionen 1992, 2000 und Abbildung 19: Bevölkerungsentwicklung Bad Belzig 2010 bis Abbildung 20: Vergleich Endenergieverbrauch 2010 und Szenarien 2020 nach Sektoren...53 Abbildung 21: Szenarien für den Pro-Kopf-Endenergieverbrauch in Bad Belzig...55 Abbildung 22: Vergleich CO 2 -Emissionen 2010 und Szenarien 2020 nach Sektoren...57 Abbildung 23: Vergleich Endenergieverbrauch 2010 und Szenarien 2030 nach Sektoren...59 Abbildung 24: Vergleich CO 2 -Emissionen 2010 und Szenarien 2030 nach Sektoren
258 Abbildungsverzeichnis Abbildung 25: Skalierung der Ziele des Landes Brandenburg auf die Energiebilanz Bad Belzig...66 Abbildung 26: Gegenüberstellung Zielpfad Bund und Brandenburg mit Referenz- und Klimaszenario Bad Belzig...67 Abbildung 27: Ziele Bund und Brandenburg bezogen auf die Bevölkerungsentwicklung in Bad Belzig...68 Abbildung 28: Ziele Bund und Brandenburg und Referenz- und Klimaszenario bezogen auf die Bevölkerungsentwicklung in Bad Belzig...68 Abbildung 29: Maßnahmendiskussion II und Priorisierung der Maßnahmen...71 Abbildung 30: Auswertung der Befragung. Ergebnisse Miete/Eigentum und Wohnort...72 Abbildung 31: Diagramm...73 Abbildung 32: Schematische Darstellung des eea-prozess...76 Abbildung 33: Ansicht Bauhof Hauptgebäude...81 Abbildung 34: Torelemente Bauhof...82 Abbildung 35: Werkstatt Bauhof...82 Abbildung 36: Anschluss Festverglasung Bauhof...82 Abbildung 37: Beleuchtung Bauhof...83 Abbildung 38: Heizungsanlage Bauhof...83 Abbildung 39: Wandtherme Bauhof...83 Abbildung 40: Verbrauchkennwerte Bauhofhauptgebäude...85 Abbildung 41: Ansicht Turnhalle Karl-Liebknecht-Straße...86 Abbildung 42: Giebelverglasung Turnhalle Karl-Liebknecht-Straße...87 Abbildung 43: Innenansicht Turnhalle Karl-Liebknecht-Straße...87 Abbildung 44: Hallenabluft Turnhalle Karl-Liebknecht-Straße...87 Abbildung 45: Beleuchtung Turnhalle Karl-Liebknecht-Straße...88 Abbildung 46: WC Abluft Turnhalle Karl-Liebknecht-Straße...88 Abbildung 47: Verbrauchskennwerte Turnhalle-Karl-Liebknecht-Straße...89 Abbildung 48: Ansicht 3 Feld Halle Albert-Baur...90 Abbildung 49: Trinkwasseranlage 3 Feld Halle Albert-Baur...91 Abbildung 50: RLT Raum 3 Feld Halle Albert-Baur...91 Abbildung 51: Solarregler 3 Feld Halle Albert-Baur
259 Abbildungsverzeichnis Abbildung 52: Verbrauchskennwerte 3 Feld Sporthalle Albert-Baur...94 Abbildung 53: Ansicht Feuerwehr Hauptgebäude...94 Abbildung 54: Hofansicht Feuerwehr Hauptgebäude...95 Abbildung 55: Öl Heizung Feuerwehr Hauptgebäude...95 Abbildung 56: Ansicht Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule Hauptgebäude)...97 Abbildung 57: Aula Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule Hauptgebäude)...98 Abbildung 58: Klassenraum Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule Hauptgebäude)...98 Abbildung 59: Heizkreisverteiler Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule Hauptgebäude).99 Abbildung 60: Beleuchtung Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule Hauptgebäude)...99 Abbildung 61: Wärmeerzeuger Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule Hauptgebäude)..99 Abbildung 62: Verbrauchskennwerte Geschwister-Scholl-Schule Abbildung 63: Ansicht Geschwister-Scholl-Schule (Oberschule Ganztagsgebäude) Abbildung 64: Fenster Geschwister-Scholl-Schule (Oberschule Ganztagsgebäude) Abbildung 65: Fassade Geschwister-Scholl-Schule (Oberschule Ganztagsgebäude) Abbildung 66: Brennwert Therme Geschwister-Scholl-Schule (Oberschule Ganztagsgebäude) Abbildung 67: Verbrauchkennwerte Geschwister-Scholl-Schule (Oberschule Ganztagsgebäude) Abbildung 68: Ansicht Krause-Tschetschog-Oberschule Abbildung 69: Fenster Krause-Tschetschog-Oberschule Abbildung 70: Fensterbank Krause-Tschetschog-Oberschule Abbildung 71: Brennwertkessel Krause-Tschetschog-Oberschule Abbildung 72: Heizkreisverteiler Krause-Tschetschog-Oberschule Abbildung 73: Verbrauchskennwerte Krause-Tschetschog-Oberschule Abbildung 74: Ansicht Kindertagesstätte Tausendfüßler Abbildung 75: Fenster Kindertagesstätte Tausendfüßler Abbildung 76: Beleuchtung alt Kindertagesstätte Tausendfüßler Abbildung 77: Fernwärmestation mit Heizkreisverteiler Kindertagesstätte Tausendfüßler Abbildung 78: Heizenergiekennwerte Kindertagesstätte Tausendfüßler Abbildung 79: Ansicht Freizeit- und Erlebnisbad
260 Abbildungsverzeichnis Abbildung 80: Nebengebäude Freizeit- und Erlebnisbad Abbildung 81: WC-/Waschhaus Freizeit- und Erlebnisbad Abbildung 82: Pumpenhaus Freizeit- und Erlebnisbad Abbildung 83: Pumpenstation Freizeit- und Erlebnisbad Abbildung 84: Ansicht Teilobjekt Eisbahn Abbildung 85: Fläche Eisbahn Abbildung 86: Kälteanlage Eisbahn Abbildung 87: Pufferspeicher Eisbahn Abbildung 88: Ansicht Bürgerhaus Abbildung 89: Heizenergiekennwerte Bürgerhaus Abbildung 90: Ansicht Rathausgebäude Abbildung 91: Hinterhof Rathausgebäude Abbildung 92: Fenster Rathausgebäude Abbildung 93: Heizenergiekennwerte Rathausgebäude Abbildung 94: Ansicht Kindertagesstätte Abbildung 95: Waschraum Kindertagesstätte Abbildung 96: Wärmeerzeuger Kindertagesstätte Abbildung 97: Heizenergiekennwert Kindertagesstätte Abbildung 98: Ansicht Jugendfreizeitzentrum POGO Abbildung 99: Fenster Jugendfreizeitzentrum POGO Abbildung 100: Dachfenster Jugendfreizeitzentrum POGO Abbildung 101: Außenwand Jugendfreizeitzentrum POGO Abbildung 102: Wärmeerzeuger Jugendfreizeitzentrum POGO Abbildung 103: Heizöl Tanks Jugendfreizeitzentrum POGO Abbildung 104: Ansicht Gemeindehaus Bergholz Abbildung 105: Küchenfenster Gemeindehaus Bergholz Abbildung 106: Heizanlage Gemeindehaus Bergholz Abbildung 107: Beleuchtung Gemeindehaus Bergholz Abbildung 108: Heizenergiekennwerte Gemeindehaus Bergholz
261 Abbildungsverzeichnis Abbildung 109: Ansicht Kindertagesstätte Lütte Abbildung 110: Ansicht Gemeindehaus Neschholz Abbildung 111: Fenster Gemeindehaus Neschholz Abbildung 112: Dachstuhl Gemeindehaus Neschholz Abbildung 113: Nachtspeicherofen Gemeindehaus Neschholz Abbildung 114: Heizenergiekennwerte Gemeindehaus Neschholz Abbildung 115: Verbundnetz Schulgelände Abbildung 116: Effizienz der Lichtquellen, Quelle: licht.de Abbildung 117: Einsparpotenziale Straßenbeleuchtung, Quelle: licht.de Abbildung 118: Energieverbrauchswert für Heizung und Warmwasser, Goethestraße Abbildung 119: Bestückung der Dachfläche mit Photovoltaikanlagen Abbildung 120: Heizenergiekennwert nach Sanierungsmaßnahmen Abbildung 121: Einordnung des Energieverbrauchs mit Vergleichswerten der EnEV Abbildung 122: Mögliche Aufstellung von Photovoltaik-Modulen Erich-Weinert-Straße Abbildung 123: Energieverbrauchswert nach Sanierungsmaßnahmen Abbildung 124: Einordnung des Energieverbrauchs nach EnEV Abbildung 125: Energieverbrauchswert nach Sanierung Abbildung 126: Einordnung des Energieverbrauchs nach EnEV Abbildung 127: Heizenergiekennwert nach Sanierungsmaßnahmen Abbildung 128: Wohngebiete im Klinkengrund, vergleichbar mit Referenzobjekten Abbildung 129: Darstellung des bewerteten Gebäudebestands in der Kurparksiedlung Abbildung 130: Endenergieverbrauch Stadtgebiet von Bad Belzig (Quelle: B&SU) Abbildung 131: Endenergieverbrauch Ortsteile von Bad Belzig (Quelle: B&SU) Abbildung 132: Endenergieverbrauch Bundesrepublik Deutschland 2010 (Datenquelle: Bundesumweltamt) Abbildung 133: Darstellung Flach- und Schrägdächer im Wohngebiet Klinkengrund Abbildung 134: Stromverbrauch/ Potenzial PV Strom Abbildung 135: Kläranlagen in Bad Belzig und in Nachbarkommunen
262 Abbildungsverzeichnis Abbildung 136: Schadstoffeinsparung Erdgasantrieb Abbildung 137: Übersichtskarte Erdgastankstellennetz, Ausschnitt Brandenburg, Quelle: Abbildung 138: Anwendungsfelder im Power-to-Gas -Prozess, Quelle: dena Abbildung 139: Dippmannsdorf, Quelle: Abbildung 140: Energiekonzept Dippmannsdorf Abbildung 141: Leitbild Bad Belzig, Präambel Abbildung 142: Leitbild Bad Belzig, Oberziele Abbildung 143: Leitbild Bad Belzig, Handlungsfeld innovative Projekte und Ideen Abbildung 144: Maßnahmendiskussion II und Priorisierung der Maßnahmen Abbildung 145: Ausformulierte Maßnahme: Energiekonzept öffentliche Gebäude Abbildung 146: Ausformulierte Maßnahme: Energieeinsparung Wohngebäudebestand Abbildung 147: Ausformulierte Maßnahme: Interkommunale Zusammenarbeit Abbildung 148: Ausformulierte Maßnahme: Rechtsicherung und Rahmenbedingungen kalte Nahwärme Abbildung 149: Fragebogen zur Bürgereinbindung
263 Tabellenverzeichnis Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Endenergieverbrauch in der Stadt Bad Belzig 2010 nach Energieträgern und Sektoren... 6 Tabelle 2: Vergleich Endenergieverbrauch 2000 und Tabelle 3: CO 2 -Emissionen nach Teilräumen...10 Tabelle 4: Sonstige Schadstoffemissionen gesamt 1992, 2000 und Tabelle 5: Szenarien Endenergieverbrauch bis 2020 nach Energieträgern...11 Tabelle 6: Übersicht Einsparungen öffentliche Gebäude...14 Tabelle 7: Potenziale PV Bad Belzig...16 Tabelle 8: Übersicht der nach EEG vergüteten erneuerbare Energien...31 Tabelle 9: Datenquellen und -qualität Energiebilanz Bad Belzig...32 Tabelle 10: Statistische Daten und Annahmen zur Energiebilanz...33 Tabelle 11: Endenergieverbrauch in der Stadt Bad Belzig 2010 nach Energieträgern und Sektoren...34 Tabelle 12: Endenergieverbrauch in der Stadt Bad Belzig 2010 differenziert nach Energieträgern und Teilräumen...35 Tabelle 13: Pro-Kopf-Endenergieverbrauch differenziert nach Teilräumen...36 Tabelle 14: Endenergieverbrauch nach Verbrauchssektoren...37 Tabelle 15: Endenergieverbrauch 2010 nach Teilräumen differenziert...39 Tabelle 16: Vergleich Endenergieverbrauch 2000 und Tabelle 17: Emissionsfaktoren nach GEMIS 4.6 und Angaben der E.ON edis sowie der Stadtwerke Bad Belzig...43 Tabelle 18: CO 2 -Bilanz nach Sektoren...44 Tabelle 19: CO 2 -Emissionen nach Teilräumen...46 Tabelle 20: Vergleich der CO 2 -Emissionen 2000 und Tabelle 21: Sonstige Schadstoffemissionen gesamt 1992, 2000 und Tabelle 22: Sonstige Schadstoffemissionen nach Energieträgern 1992, 2000 und Tabelle 23: Szenarien Endenergieverbrauch bis 2020 nach Energieträgern...52 Tabelle 24: Szenarien Endenergieverbrauch bis 2020 nach Sektoren...54 Tabelle 25: Pro-Kopf-Endenergieverbrauch in Bad Belzig...55 Tabelle 26: Szenarien CO 2 -Emissionen bis 2020 nach Energieträgern
264 Tabellenverzeichnis Tabelle 27: Szenarien Endenergieverbrauch bis 2030 nach Energieträgern...58 Tabelle 28: Szenarien Endenergieverbrauch bis 2030 nach Sektoren...59 Tabelle 29: Szenarien CO2-Emissionen bis 2030 nach Energieträgern...60 Tabelle 30: Maßnahmenpriorisierung...71 Tabelle 31: Energieverbräuche Bauhof Hauptgebäude...81 Tabelle 32: Zusammenfassung Ergebnisse Bauhof Hauptgebäude...84 Tabelle 33: Verbräuche Turnhalle Karl-Liebknecht-Straße...86 Tabelle 34: Zusammenfassung Ergebnisse Turnhalle Karl-Liebknecht-Straße...89 Tabelle 35: Verbräuche 3 Feld Halle Albert-Baur...90 Tabelle 36: Zusammenfassung Ergebnisse 3 Feld Halle Albert-Baur...93 Tabelle 37: Verbräuche Feuerwehr Hauptgebäude...95 Tabelle 38: Verbräuche Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule Hauptgebäude)...97 Tabelle 39: Zusammenfassung Ergebnisse Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule Hauptgebäude) Tabelle 40: Verbräuche Geschwister-Scholl-Schule (Oberschule Ganztagsgebäude) Tabelle 41: mögliche Einsparung Geschwister-Scholl-Schule (Oberschule Ganztagsgebäude) Tabelle 42: Verbräuche Krause-Tschetschog-Oberschule Tabelle 43: mögliche Einsparung Krause-Tschetschog-Oberschule Tabelle 44: Verbräuche Kindertagesstätte Tausendfüßler Tabelle 45: mögliche Einsparung Kindertagesstätte Tausendfüßler Tabelle 46: Verbräuche Freizeit- und Erlebnisbad Tabelle 47: Zusammenfassung Ergebnisse Bürgerhaus Bad Belzig Tabelle 48: Verbräuche Rathausgebäude Tabelle 49: Einsparung Rathausgebäude Tabelle 50: Verbräuche Kindertagesstätte Tabelle 51: Einsparung Kindertagesstätte Tabelle 52: Verbräuche Jugendfreizeitzentrum POGO Tabelle 53: Verbräuche Gemeindehaus Bergholz Tabelle 54: Einsparungen Gemeindehaus Bergholz
265 Tabellenverzeichnis Tabelle 55 Verbräuche Gemeindehaus Neschholz Tabelle 56: Übersicht Einsparungen öffentliche Gebäude Tabelle 57: Anzahl der bestehenden Leuchtmittel in Bad Belzig Tabelle 58: Übersicht über bestehende Lampentypen und deren Merkmale Tabelle 59: Anzahl der bestehenden Leuchten in Bad Belzig Tabelle 60: HQL-Bestandsleuchten und entsprechende NAV Plug-Ins Tabelle 61: Einsparpotenziale durch NAV Plug-Ins Tabelle 62: HQL-Bestandsleuchten und entsprechende NAV Lampen Tabelle 63: Einsparpotenziale durch NAV-Lampen Tabelle 64: HQL-Bestandsleuchten und entsprechende HMD Lampen Tabelle 65: Einsparpotenziale durch HMD Lampen Tabelle 66: HQL-Bestandsleuchten und LED-Leuchten Tabelle 67: Einsparpotenziale durch LED Tabelle 68: Energieeinsparung durch Lichtsteuerung Tabelle 69: Bestandsdaten zu Lichtpunkten in den Ortsteilen aus Dienstleistungsverträgen Tabelle 70: Einsparpotenziale durch Austausch der Quecksilberdampf-Lampen Tabelle 71: Preise und Emissionsfaktoren Bad Belzig Tabelle 72: Ist-Werte des Objektes nach Berechnung EnEV 2009, Hottgenroth Energieberater Plus Tabelle 73: Wärmeverbrauch des Objekts in der Goethestraße Tabelle 74: Kennwerte der Bauteile der thermischen Hülle in der Goethestraße Tabelle 75: Zusätzliche Dämmstärken zur Erreichung der EnEV-Grenzwerte Tabelle 76: Wirtschaftliche Kenndaten nach Fenstertausch Tabelle 77: Zusätzliche Dämmstärken zur Unterschreitung der EnEV-Werte um 30 % Tabelle 78: Wirtschaftliche Kenndaten bei Sanierung nach EnEV -30 % Tabelle 79: Wirtschaftliche Kenndaten bei Dämmung der Rohrleitungen nach EnEV Tabelle 80: Wirtschaftliche Kenndaten der Photovoltaikanlage Tabelle 81: Mit dem Referenzgebäude vergleichbare Gebäude im Klinkengrund Tabelle 82: Wärmeverbrauchswerte von
266 Tabellenverzeichnis Tabelle 83: Bauteilkennwerte des Objekts in der Erich-Weinert-Straße Tabelle 84: Benötigte Dämmstärken zur Erreichung des Grenzwertes nach EnEV Tabelle 85: Wirtschaftliche Kenndaten bei Sanierung nach EnEV Tabelle 86: Zusätzliche Dämmstärke bei Sanierung nach EnEV -30 % Tabelle 87: Wirtschaftliche Kenndaten bei Sanierung nach EnEV -30 % Tabelle 88: Wirtschaftliche Kenndaten bei optimierter Anlagentechnik Tabelle 89: Wirtschaftliche Kenndaten bei Installation einer Photovoltaikanlage Tabelle 90: Vergleichbare Gebäude wie die Erich-Weinert-Straße 15-27, Bestand BEWOG Tabelle 91: Erdgasverbrauch Weitzgrunder Straße , Quelle: Minol Tabelle 92: U-Grenzwerte nach der EnEV 2002 und Tabelle 93: Benötigte Dämmstärken zur Erreichung des Grenzwertes nach der EnEV Tabelle 94: Wirtschaftliche Kenndaten bei Sanierung nach EnEV Tabelle 95: Zusätzliche Dämmung zur Unterschreitung der EnEV um 30 % Tabelle 96: Wirtschaftliche Kenndaten bei Sanierung nach EnEV -30 % Tabelle 97: Wirtschaftliche Kenndaten bei Optimierung der Anlagentechnik Tabelle 98: Mit Referenzgebäude vergleichbare Gebäude in Bad Belzig Tabelle 99: Fernwärmeverbrauch Kurpark Tabelle 100: U-Werte der Außenbauteile thermische Hülle, Kurpark Tabelle 101: Benötigte zusätzliche Dämmstärken bei Sanierung nach EnEV -30 % Tabelle 102: Wirtschaftliche Kenndaten bei Sanierung nach EnEV -30 % Tabelle 103: Wirtschaftliche Kenndaten bei Dämmung der Warnwasser- und Zirkulationsleitungen Tabelle 104: Gebäude mit vergleichbarem energetischen Standard wie der Kurpark 14, BEWOG Tabelle 105: Einsparpotenziale im Gebäudebestand des Klinkengrunds Tabelle 106: Einsparpotenziale im Gebäudebestand der Kurparksiedlung Tabelle 107: Wärmeverbrauch Straße der Einheit Tabelle 108: Einsparpotenziale bei Dämmung der obersten Geschossdecke Tabelle 109: Einsparpotenziale bei Dämmung der Fußbodens im Erdgeschoss
267 Tabellenverzeichnis Tabelle 110: Einsparpotenziale bei Dämmung der Fachwerk-Außenwand Tabelle 111: Einsparpotenziale bei Dämmung des Ziegelmauerwerks Tabelle 112: Einsparpotenziale bei Dämmung des Schrägdachs im 2.OG Tabelle 113: Einsparpotenziale bei Austausch der Fenster Tabelle 114: Förderbeträge der Stadtwerke Belzig Tabelle 115: Potenziale PV Bad Belzig Tabelle 116: Durchschnittlicher Ertrag Solarthermie, Beispiel Einfamilienhaus Tabelle 117: Grünschnitt- und Küchenabfallpotenzial in Belzig Tabelle 118: Für Windenergie ausgewiesene, bislang ungenutzte Flächen in Potsdam- Mittelmark Tabelle 119: Mitglieder der Steuerungsgruppe Tabelle 120: Teilnehmer des Workshops Tabelle 121: Maßnahmenpriorisierung
268 Anhangsverzeichnis Anhangsverzeichnis Anhang 1 Partizipation Anhang 2 Zentrale Annahmen der in der Potenzialanalyse eingesetzten Szenarien Anhang 3 Leitbild Bad Belzig Anhang 4 Workshop Anhang 5 Befragung
269 Anhang 1 Anhang 1 Partizipation Im Rahmen der Konzepterstellung wurden drei Treffen einer Steuerungssgruppe durchgeführt. Teilnehmer dieser Sitzungen sind in Tabelle 119 dargestellt. Name Vorname Institution Bartels Harald Stadtverordneter Behringer Michael GF Stadtwerke GmbH Dr. Kirchner Christian GF KuF Bad Belzig GmbH Friedrich Frank SB Bauverwaltung Grund Christoph FB Ltr. Bauverwaltung Hummel Dietmar Stadtverordneter Klabunde Hannelore BGM Stadt Bad Belzig Kunze Udo GF Bewog mbh Lacher Harald NaturEnergieFläming e.g. Lahr Markus Reg. Planungsgem. Hvl.-Flä Nimpsch Heiko E.ON edis Reg.-bereich West Rothe Marek Ltr. Landeswaldoberförsterei Seewald Stefan Reg. Planungsgem. Hvl.-Flä Tschiersch Steffen GF GWG Bad Belzig e.g. Wachner Anita GF WGK Bad Belzig e.g. Windrich Günter Stadtverordneter Tabelle 119: Mitglieder der Steuerungsgruppe Zur weiteren Akteurseinbindung wurde am ein Workshop durgeführt. Teilnehmer des Workshops sind in Tabelle 120 aufgeführt. Name Vorname Institution Bartels Harald Stadtverordneter Behringer Michael GF Stadtwerke GmbH Friedrich Frank SB Bauverwaltung Gleisenring Klaus Ortsvorsteher Dippmannsdorf Grund Christoph FB Ltr. Bauverwaltung Kunze Udo GF Bewog mbh Lacher Harald NaturEnergie Fläming e.g. Lorenz Wolfgang Landkreis Potsdam-Mittelmark Nimpsch Heiko E.ON edis Reg.-bereich West Rothe Marek Ltr. Landeswaldoberförsterei Stahn Uwe NaturEnergie Fläming e.g. Schiller Andreas IG Schiller + Drobka Tragmann Thomas OT Dippmannsdorf Tschiersch Steffen GF GWG Bad Belzig e.g. Windrich Günter Stadtverordneter Tabelle 120: Teilnehmer des Workshops 267
270 Anhang 2 Anhang 2 Zentrale Annahmen der in der Potenzialanalyse eingesetzten Szenarien Zentrale Annahmen der Studie Energieszenarien für ein Energiekonzept der Bundesregierung Industrie: Im Referenzszenario werden Strukturwandel und Technologieentwicklung im Wesentlichen fortgeschrieben: weniger energieintensive Branchen weisen ein deutlich stärkeres Produktionswachstum auf als energieintensive Branchen. Hochwertige und wissensintensive Produkte und Produktionsweisen bilden den Kern der industriellen Wertschöpfung. Wissensintensive industriebezogene Dienstleistungen werden zunehmend outgesourcet und dem Dienstleistungssektor zugerechnet. Bestehende energiepolitische Instrumente werden fortgeschrieben und effektiviert. Darüber hinaus wird angenommen, dass die Umsetzung energieeffizienter Lösungen in vielen Unternehmensbereichen aus unterschiedlichen Motivationen zunimmt: stärkerer Einsatz bester Technologien (IuK, Beleuchtung, Motoren, Pumpen etc.) Verbesserung der Prozesse zur Bereitstellung von mechanischer Energie und Prozesswärme (unter anderem durch den Anreiz des Emissionshandels). Abwärme wird konsequent genutzt. Erzielte Endenergieverbräuche stellen eine Grenze dessen dar, was in der wahrscheinlichen Fortschreibung der derzeitigen Technologie-, Produkt- und Branchenentwicklung dankbar ist. Private Haushalte: Insgesamt nimmt der Energieverbrauch der Haushalte ab. Am größten ist die Einsparung im Bereich Raumwärmeerzeugung, am kleinsten bei der Warmwasserbereitstellung. Die Reduktion im Bereich der Raumwärme ist vor allem auf energetische Sanierungen zurückzuführen. Von geringerer Bedeutung sind effiziente Heizanlagen. Trotz rückläufiger Bevölkerungsentwicklung erhöht sich die die Wohnfläche dadurch werden die effizienzbedingten Einsparungen teilweise kompensiert (bis %). Ähnlich die Entwicklung bei Elektrogeräten: Eine Ausweitung der Gerätebestände wirkt den durch technische Maßnahmen erzielte Effizienzsteigerungen entgegen (bis %). Die Sanierungsrate ist im Referenzszenario absinkend: von 1,1 % auf lediglich 0,5 % in Dies ist der Änderung der Bevölkerungs- und Altersstruktur der Gebäude geschuldet. Der Einsatz erneuerbarer Energien in privaten Haushalten steigt signifikant auf 22 % in Gewerbe, Handel, Dienstleistungen: Der Sektor wächst bis 2050 um rund 50 % entsprechend nehmen genutzte Flächen und Arbeitsplätze zu was Auswirkungen auf Verbrauch von Wärme und Strom hat. Bei der Beleuchtung wird davon ausgegangen, dass derzeitige Technologieentwicklungen, die erhebliche Einsparpotenziale ermöglichen, konsequent eingesetzt werden. Bei der Prozesswärme wird wie im Industriesektor davon ausgegangen, dass hier konsequent die Abwärme genutzt wird. 268
271 Anhang 2 Verkehr: Die Verkehrsleistungen im MIV geht etwas zurück (8 % bis 2050). Der Verbrauch ist dann um fast zwei Drittel niedriger. Außerdem verändert sich der Energieträger-Mix im MIV: 2050 beträgt der Anteil der Flüssigkraftstoffe nur noch 77 %. Durch die rückläufige Bevölkerung sinkt die Zahl der Personenkilometer, die mit der Bahn zurückgelegt werden. Die Personenverkehrsleistung im Flugverkehr dagegen nimmt weiter zu (12 % bis 2050). Die Güterverkehrsleistung nimmt deutlich zu, gleichzeitig werden Antriebstechnolgien effizienter und der Energieträgermix verändert sich. Zentrale Annahmen des Klimaszenarios Grundlage des Klimaszenarios ist die Studie Energieeffizienz: Potenziale, volkswirtschaftliche Effekte und innovative Handlungs- und Förderfelder für die Nationale Klimaschutzinitiative. Untersuchung von 43 konkret definierten Energieeffizienz- und Energieeinsparmaßnahmen bis zum Jahr 2030 und deren zu erschließenden kosteneffizienten Potenziale über die Referenz hinaus. Grundlage sind marktverfügbare und wirtschaftliche Technologien, wie z.b. energiesparende Gebäude, effiziente Geräte, Heizungsanlagen, raumlufttechnische Anlagen etc. Auflistung der 43 Energieeffizienz- und Energieeinsparmaßnahmen: Private Haushalte P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 Gebäudesanierung und Erneuerung Heizungssysteme Hocheffizienter Gebäudeneubau Effiziente Beleuchtung Effiziente Kühlschränke, Kühl-Gefrier-Geräte, Gefriergeräte Effiziente Waschmaschinen, Waschtrockner, Wäschetrockner Effiziente IuK-Geräte Gewerbe, Handel, Dienstleistungen G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 7 Gebäudesanierung und Erneuerung Heizungssysteme Effiziente Beleuchtung Optimierung von RLT-Systemen Optimierung von Kühl- und Gefriersystemen Effiziente Bürogeräte LED Ampelanlagen Effiziente Straßenbeleuchtung 269
272 Anhang 2 Industrie (I1 I8 Querschnittstechnologien / I9 I15 branchenspezifische Technologien) I 1 Elektromotoren I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 Druckluft Pumpensysteme Lüftungssysteme Kältebereitstellung Übrige Motorsysteme Beleuchtung Gas-Brennwertkessel Metallerzeugung Nicht-Eisen Metalle Papiergewerbe Glas und Keramik Steine-Erden Grundstoffchemie Ernährungsgewerbe Verkehr V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10 Einführung effizienter Pkw Einführung Hybrid-Linienbusse Einführung Hybrid-Leichte-Nutzfahrzeuge Leichtlaufreifen Pkw Leichtlaufreifen Lkw Leichtlauföle Pkw Energieeffizientes Fahren Pkw Fahrerschulung Lkw Verlagerung innerörtlicher Pkw-Verkehr auf ÖPNV und Fahrrad Verlagerung im Güterverkehr Abfall und Abwasser A 1 A 2 Steigerung der getrennten Erfassung von Bioabfall aus Haushalten Nachrüstung Kompostierungsanlagen um anaerobe Stufe 270
273 Anhang 2 A 3 A 4 A 5 Optimierungen der MVAn in Deutschland Erschließung bislang ungenutzter holziger Grünabfälle und Landschaftspflegereste Erschließung bislang ungenutzter krautiger Grünabfälle und Landschaftspflegereste 271
274 Anhang 3 Anhang 3 Leitbild Bad Belzig Abbildung 141: Leitbild Bad Belzig, Präambel 272
275 Anhang 3 Abbildung 142: Leitbild Bad Belzig, Oberziele 273
276 Anhang 3 Abbildung 143: Leitbild Bad Belzig, Handlungsfeld innovative Projekte und Ideen 274
277 Anhang 4 Anhang 4 Workshop Am wurde ein Workshop durchgeführt. Nach einer fachlichen Einführung und Präsentation der Zwischenergebnisse wurde über mögliche Maßnahmen diskutiert. Folgend sind Diskussionen und die Ergebnisse dokumentiert. Maßnahmendiskussion I: Vorstellung der Maßnahmenvorschläge durch die GFE: 17) Energiekonzept öffentliche Gebäude 18) Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 19) Energieeinsparungen in Sanierungsgebieten / Ortsteilen 20) Ausbau der Nutzung von Photovoltaik 21) Energieautarkie am Beispiel Dippmannsdorf 22) Ausbau Nutzung von Biomasse 23) Interkommunale Zusammenarbeit 24) Konzepte zur Bürgerbeteiligung Diskussion während der Vorstellung der Maßnahmen - Im Bereich der Straßenbeleuchtung ist bereits ein Projekt in Arbeit außerdem ist bereits ein Großteil der Lampen auf einem relativ aktuellen Stand. Im Ortsteil Lütte erfolgt ein Versuch mit der Dimmung der Lampen zwischen 22:00 und 6:00 Uhr differenziert zwischen Haupt- und Nebenstraßen auf 50 bis 30 % der Leistung. - Projekte wie z.b zur Nutzermotivation in Schulen und öffentlichen Gebäuden fehlen noch. - Es sollte untersucht werden, ob KWK-Projekte für mehrere Gebäudeteile möglich sind. - Es gibt weitere Untersuchungen zu KWK-Projekten, bei denen Nah- und Fernwärme- Lösungen untersucht werden. - Bei dem weiteren Einsatz von PV-Anlagen ist vor allem die Entwicklung der Einspeisevergütung entscheidend und im Moment nicht absehbar. - PV-Installation ist auf einigen Dächern im Klinkengrund wegen Verschattung problematisch ansonsten würde sich das Gebiet gut dazu eignen, dass kombinierte PV- und Smart-Metering- Lösungen zur Steigerung der Eigennutzung zum Einsatz kommen. - Zum energieautarken Dorf: Ist es denn tatsächlich möglich, Dippmannsdorf komplett autark zu versorgen? Grundsätzlich sollte ein anderer Begriff genommen werden: z.b. bilanzielle Eigenversorgung des Ortsteils. - Entscheidend bei einem solchen Beispiel ist, dass auch die Ökonomie betrachtet wird. - In dem Gebiet rund um Dippmannsdorf liegt ein sehr hohes Grundwasser-Niveau vor, das ständig mit nachfließendem Wasser gespeist wird. Diesem Wasser kann man relativ einfach Wärme entziehen, die verteilt durch ein kalten Nahwärmenetzes in umliegenden Ortschaften mit Hilfe von Wärmepumpen genutzt wird. 275
278 Anhang 4 - Die steigenden Strompreise machen Wärmepumpen teilweise unrentabel. - Problem an der Nutzung von Wärmepumpen ist, dass die (Nutz-)Wärme dann auf einem niedrigen Temperatur-Niveau vorliegt. Ein Problem an der Konzeption für Dippmannsdorf ist auch, dass Biogas in der Ortschaft schwer zu erzeugen ist, da nicht besonders große Ressourcen vorliegen. - Die Genossenschaft NaturEnergie Fläming eg war die zweite Energiegenossenschaft in Brandenburg und es mangelt nicht an Unterstützung der Bürgerschaft, sondern an konkreten möglichen Projekten. Es wird unter anderem an möglichen Windprojekten in Nachbarkommunen gearbeitet. - Für ein Projekt wie ein kaltes Nahwärme-Netz müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden und Rechtssicherheit vorliegen. Maßnahmendiskussion II In diesem Abschnitt des Workshops werden die vorgestellten Maßnahmen umformuliert/umbenannt und weiter diskutiert und schließlich auf einer Stelltafel gesammelt: Abbildung 144: Maßnahmendiskussion II und Priorisierung der Maßnahmen Die Maßnahmen 1 und 2 wurden von der Gruppe übernommen. Die 3. Maßnahme wurde umbenannt in Energieeinsparungen Wohngebäude-Bestand (während der Diskussion wurde eingeworfen, dass es dabei nur um Liegenschaften im Privatbesitz gehen kann, weil die Wohnungsgesellschaften schon 276
279 Anhang 4 viel getan hätten und die Gebäude auf einem guten energetischen Stand sind). Die 4. Maßnahme wurde ebenfalls übernommen. Die Maßnahme Energieautarkie am Beispiel Dippmannsdorf hat durch die Diskussion neue Aspekte bekommen: die kalte Nahwärme, folglich wurde als konkrete Maßnahme formuliert Rechtssicherheit und Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Maßnahmen 6 und 7 wurden zusammengefasst, da es bei der Interkommunalen Zusammenarbeit unter anderem um die gemeinsame Nutzung von Biomasse geht und Gespräche dazu laufen. Die Maßnahme 8 wurde eher in Richtung der zu schaffenden Projekte umformuliert und schließlich ist noch eine neue Maßnahme mit dem Titel Nutzerverhalten und Bewusstsein hinzugekommen. Die Priorisierung der Maßnahmen ist in Tabelle 121 dargestellt Maßnahmenname Punkte Energiekonzept öffentliche Gebäude 7 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 3 Energieeinsparung Wohngebäudebestand 5 Ausbau Nutzung von Photovoltaik 4 Rechtsicherheit und Rahmenbedingungen 5 Interkommunale Zusammenarbeit 5 Projekte zur Bürgerbeteiligung 5 Nutzerverhalten und Bewusstsein 5 Tabelle 121: Maßnahmenpriorisierung 277
280 Anhang 4 Ausformulierung von prioritären Maßnahmen. Titel der Maßnahme: Energiekonzept öffentliche Gebäude Inhalt der Maßnahme: Priorisierung von Sanierungen / Objekte Prüfung von Fremdfinanzierung (Contracting) Bürgerbeteiligung (Contracting) Akteure: Stadtverwaltung Bad Belzig Zielgruppe: Stadt Bad Belzig Erste Handlungsschritte: Siehe oben (Inhalt der Maßnahme) Prüfung und Recherche von Fördermitteln (z.b. KfW, NKI) Abbildung 145: Ausformulierte Maßnahme: Energiekonzept öffentliche Gebäude 278
281 Anhang 4 Titel der Maßnahme Energieeinsparung Wohngebäudebestand Inhalt der Maßnahme: Energieberatungen Thermografieaufnahmen Gebäude-Check / Energiecheck Beratung zum Thema Solarthermie Akteure: Stadt Bad Belzig Stadtwerke Bad Belzig Verbraucherzentrale Zielgruppe: Gebäudebesitzer Erste Handlungsschritte: Information und Öffentlichkeitsarbeit Internetauftritt Förderprogramme der Stadtwerke Abbildung 146: Ausformulierte Maßnahme: Energieeinsparung Wohngebäudebestand 279
282 Anhang 4 Titel der Maßnahme: Interkommunale Zusammenarbeit Inhalt der Maßnahme: Akteure: Fortführung von Gesprächen In Zusammenarbeit/Kooperation mit Nachbarkommunen Nutzung von Biomassepotenzialen Möglicherweise Nutzung Windenergie Prüfung der rechtlichen Basis Stadt Bad Belzig Stadtwerke Bad Belzig Landkreis Potsdam-Mittelmark Mittelbereich Belzig (Amt Ziesar, Gemeinde Wiesenburg, Amt Niemegk, Stadt Treuenbrietzen, Amt Brück) Erste Handlungsschritte: Fortführung der Gespräche Parlamentarischer Beschluss Einrichtung einer Koordinierung der Gespräche durch einen Energiemanager Gemeinsame Beantragung eines Energiemanagers (RENPlus) Abbildung 147: Ausformulierte Maßnahme: Interkommunale Zusammenarbeit 280
283 Anhang 4 Titel der Maßnahme: Rechtssicherheit und Rahmenbedingungen für die Nutzung von kalter Nahwärme und Wärmepumpen am Beispiel Dippmannsdorf Inhalt der Maßnahme: Zusammenstellung der Rechtsnormen Zusammenstellung der Fördermöglichkeiten Akteure: Stadt Bad Belzig Untere Wasserbehörde Naturschutzamt Zielgruppe: Bürger Erste Handlungsschritte: Prüfung ob Interesse in der Bürgerschaft für ein solches Projekte besteht Beantragung eines Energiemanagers (RENPlus) Abbildung 148: Ausformulierte Maßnahme: Rechtsicherung und Rahmenbedingungen kalte Nahwärme 281
284 Anhang 5 Anhang 5 Befragung Abbildung 149: Fragebogen zur Bürgereinbindung 282
Integriertes kommunales Klimaschutzkonzept Rathenow
 Integriertes kommunales Klimaschutzkonzept Rathenow 1 Agenda Kurze Einführung Klimaschutzkonzept Ergebnisse Ziele Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit Controlling 2 Einführung Klimaschutzkonzept 3 Einführung
Integriertes kommunales Klimaschutzkonzept Rathenow 1 Agenda Kurze Einführung Klimaschutzkonzept Ergebnisse Ziele Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit Controlling 2 Einführung Klimaschutzkonzept 3 Einführung
Energie- und CO 2 -Bilanz der Stadt Sigmaringen
 Energie- und CO 2 -Bilanz der Stadt Sigmaringen Aufgestellt im Oktober 2012 Datenbasis: 2009 Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Sigmaringen ggmbh Energie- und Klimaschutzziele des Bundes,
Energie- und CO 2 -Bilanz der Stadt Sigmaringen Aufgestellt im Oktober 2012 Datenbasis: 2009 Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Sigmaringen ggmbh Energie- und Klimaschutzziele des Bundes,
Kirchheimer. Auftaktveranstaltung 18. April 2013
 Kirchheimer Klimaschutzkonzept Auftaktveranstaltung 18. April 2013 Klimawandel: Doch nicht in Kirchheim - oder? LUBW: Die Temperatur steigt Starkregenereignisse und Stürme nehmen zu Jährliche Anzahl der
Kirchheimer Klimaschutzkonzept Auftaktveranstaltung 18. April 2013 Klimawandel: Doch nicht in Kirchheim - oder? LUBW: Die Temperatur steigt Starkregenereignisse und Stürme nehmen zu Jährliche Anzahl der
Integriertes Klimaschutzkonzept. Stadt Löningen. Energie- und CO 2 -Bilanzierung mit ECORegion. Stadt Löningen. -Ergebnisse- infas enermetric GmbH
 Integriertes Klimaschutzkonzept Stadt Löningen Energie- und CO 2 -Bilanzierung mit ECORegion Stadt Löningen -Ergebnisse- Vorgehensweise mit ECORegion 1. Festlegen der Bilanzierungsmethodik und Bilanzierungstiefe
Integriertes Klimaschutzkonzept Stadt Löningen Energie- und CO 2 -Bilanzierung mit ECORegion Stadt Löningen -Ergebnisse- Vorgehensweise mit ECORegion 1. Festlegen der Bilanzierungsmethodik und Bilanzierungstiefe
Energie- und CO 2 -Bilanz der Stadt Ravensburg
 Energie- und CO 2 -Bilanz der Stadt Ravensburg Aufgestellt im Mai 2012, Stand 31.12.2010 Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg ggmbh Energie- und Klimaschutzziele des Bundes, Landes
Energie- und CO 2 -Bilanz der Stadt Ravensburg Aufgestellt im Mai 2012, Stand 31.12.2010 Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg ggmbh Energie- und Klimaschutzziele des Bundes, Landes
KOMMUNALES ENERGIEKONZEPT DER STADT GROßRÄSCHEN
 KOMMUNALES ENERGIEKONZEPT DER STADT GROßRÄSCHEN 2 Energiekonzept MehrWert für Alle 1 Beschreibung des Untersuchungsraums 2 Bestandsaufnahme 3 Szenarien Leitbilder Ziele 4 Detailuntersuchung Potenziale
KOMMUNALES ENERGIEKONZEPT DER STADT GROßRÄSCHEN 2 Energiekonzept MehrWert für Alle 1 Beschreibung des Untersuchungsraums 2 Bestandsaufnahme 3 Szenarien Leitbilder Ziele 4 Detailuntersuchung Potenziale
Energiepotenzialstudie Ergebnisse der Gemeinde Gottenheim Rathaus Gottenheim,
 Energiepotenzialstudie Ergebnisse der Gemeinde Gottenheim Rathaus Gottenheim, 17.06.2014 Nina Weiß Innovations- & Ökologiemanagement Dokumentation der Energienutzungsstruktur in Energie- und CO 2 -Bilanzen
Energiepotenzialstudie Ergebnisse der Gemeinde Gottenheim Rathaus Gottenheim, 17.06.2014 Nina Weiß Innovations- & Ökologiemanagement Dokumentation der Energienutzungsstruktur in Energie- und CO 2 -Bilanzen
. Workshop ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE
 . Workshop ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE Massen-Niederlausitz, 12. Februar 2014 Agenda 2 Analyse der Energieverbräuche und der Energieerzeugung im Amt Kleine Elster ENERGIE BRAUCHT
. Workshop ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE Massen-Niederlausitz, 12. Februar 2014 Agenda 2 Analyse der Energieverbräuche und der Energieerzeugung im Amt Kleine Elster ENERGIE BRAUCHT
Die Blumensiedlung. Vogelperspektive: Teil der Blumensiedlung, bing.com, Luftbild vor 2012
 Die Blumensiedlung 1 Vogelperspektive: Teil der Blumensiedlung, bing.com, Luftbild vor 2012 Zusammenfassung Gebäude BEDARF - 1.000 Gebäude bzw. 1.600 Wohneinheiten, 3.800 Einwohner - Wohnviertel mit einzelnen
Die Blumensiedlung 1 Vogelperspektive: Teil der Blumensiedlung, bing.com, Luftbild vor 2012 Zusammenfassung Gebäude BEDARF - 1.000 Gebäude bzw. 1.600 Wohneinheiten, 3.800 Einwohner - Wohnviertel mit einzelnen
Energie- und Klimakonzept für Ilmenau Zwischenstand
 Energie- und Klimakonzept für Ilmenau Zwischenstand 3.2.212 Ist-Analyse und Trendszenario bis 225 Einleitung Im Auftrag der Stadt Ilmenau erstellt die Leipziger Institut für Energie GmbH derzeit ein kommunales
Energie- und Klimakonzept für Ilmenau Zwischenstand 3.2.212 Ist-Analyse und Trendszenario bis 225 Einleitung Im Auftrag der Stadt Ilmenau erstellt die Leipziger Institut für Energie GmbH derzeit ein kommunales
Kommunales Energiekonzept in der Stadt Schwedt/Oder
 Kommunales Energiekonzept in der Stadt Schwedt/Oder 1. Workshop ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE Schwedt/Oder, 23. September 2014 Agenda Vortrag 1: Analyse der Energieverbräuche und der
Kommunales Energiekonzept in der Stadt Schwedt/Oder 1. Workshop ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE Schwedt/Oder, 23. September 2014 Agenda Vortrag 1: Analyse der Energieverbräuche und der
Energiewende in Niederösterreich
 1 Energiewende in Niederösterreich Dr. Herbert Greisberger Energie- und Umweltagentur Niederösterreich 1 Was ist enu? Die Energie- und Umweltagentur NÖ ist DIE gemeinsame Anlaufstelle für alle Energie-
1 Energiewende in Niederösterreich Dr. Herbert Greisberger Energie- und Umweltagentur Niederösterreich 1 Was ist enu? Die Energie- und Umweltagentur NÖ ist DIE gemeinsame Anlaufstelle für alle Energie-
Wärmeversorgung der Region Brandenburg- Berlin auf Basis Erneuerbarer Energien
 Wärmeversorgung der Region Brandenburg- Berlin auf Basis Erneuerbarer Energien Jochen Twele Brandenburg + Berlin = 100 % Erneuerbar Aus Visionen Wirklichkeit machen Cottbus, 20.04.2012 Wärmeverbrauch der
Wärmeversorgung der Region Brandenburg- Berlin auf Basis Erneuerbarer Energien Jochen Twele Brandenburg + Berlin = 100 % Erneuerbar Aus Visionen Wirklichkeit machen Cottbus, 20.04.2012 Wärmeverbrauch der
Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept für den Vogelsbergkreis
 Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept für den Projektgruppensitzung Herzlich willkommen! Posthotel Johannesberg Lauterbach, 23.02.2016 Inhalte und Ziel der Veranstaltung Abstimmung über die Szenarien
Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept für den Projektgruppensitzung Herzlich willkommen! Posthotel Johannesberg Lauterbach, 23.02.2016 Inhalte und Ziel der Veranstaltung Abstimmung über die Szenarien
Energiegespräch 2016 II ES. Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude. Klaus Heikrodt. Haltern am See, den 3. März 2016
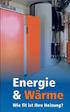 Energiegespräch 2016 II ES Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude Klaus Heikrodt Haltern am See, den 3. März 2016 Struktur Endenergieverbrauch Deutschland Zielsetzung im Energiekonzept 2010 und in
Energiegespräch 2016 II ES Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude Klaus Heikrodt Haltern am See, den 3. März 2016 Struktur Endenergieverbrauch Deutschland Zielsetzung im Energiekonzept 2010 und in
Informationsveranstaltung Energienutzungsplan - Stadt Bischofsheim -
 Informationsveranstaltung Energienutzungsplan - Stadt Bischofsheim - B.Eng. Simon Achhammer Institut für Energietechnik IfE GmbH an der ostbayerischen technischen Hochschule Amberg-Weiden Kaiser-Wilhelm-Ring
Informationsveranstaltung Energienutzungsplan - Stadt Bischofsheim - B.Eng. Simon Achhammer Institut für Energietechnik IfE GmbH an der ostbayerischen technischen Hochschule Amberg-Weiden Kaiser-Wilhelm-Ring
Energetische Quartiersentwicklung. Chancen für Stadtwerke
 Energetische Quartiersentwicklung Chancen für Stadtwerke Gütersloh 28.01.2016 Gütersloh unsere Stadt Stadtgebiet: 113 km² Stadtteile: 13 Einwohnerzahl: 99.781 Einwohner (Stand 31.12.2015) 1 Unternehmensgruppe
Energetische Quartiersentwicklung Chancen für Stadtwerke Gütersloh 28.01.2016 Gütersloh unsere Stadt Stadtgebiet: 113 km² Stadtteile: 13 Einwohnerzahl: 99.781 Einwohner (Stand 31.12.2015) 1 Unternehmensgruppe
Landkreis Fürstenfeldbruck
 Landkreis Fürstenfeldbruck Potenziale Energieeinsparung, Effizienz und erneuerbare Energien 1 Ist-Zustand 2010 1.1 Allgemeine Daten Fläche: 43.478 ha Einwohnerzahl: 204.538 Anzahl Erwerbstätige: 49.185
Landkreis Fürstenfeldbruck Potenziale Energieeinsparung, Effizienz und erneuerbare Energien 1 Ist-Zustand 2010 1.1 Allgemeine Daten Fläche: 43.478 ha Einwohnerzahl: 204.538 Anzahl Erwerbstätige: 49.185
Impulsvortrag. Die Energiewende im Land ist eingeläutet. Wo stehen wir bei Kraft und Wärme in der Kommune?
 Impulsvortrag Die Energiewende im Land ist eingeläutet. Wo stehen wir bei Kraft und Wärme in der Kommune? Bürgermeister Alexander Uhlig Stadt Pforzheim erneuerbare Energien Klimaschutzprofil Stadt Pforzheim
Impulsvortrag Die Energiewende im Land ist eingeläutet. Wo stehen wir bei Kraft und Wärme in der Kommune? Bürgermeister Alexander Uhlig Stadt Pforzheim erneuerbare Energien Klimaschutzprofil Stadt Pforzheim
Klimaschutzquartier am Wildbergplatz. Energetischer Umbau in wachsenden Quartieren
 Energetischer Umbau in wachsenden Quartieren Agenda 1. Bisherige Energie- & Klimaschutzpolitik in einer wachsenden Stadt 2. Untersuchung der ökologischen und ökonomischen Auswirkungen eines Nahwärmenetzes
Energetischer Umbau in wachsenden Quartieren Agenda 1. Bisherige Energie- & Klimaschutzpolitik in einer wachsenden Stadt 2. Untersuchung der ökologischen und ökonomischen Auswirkungen eines Nahwärmenetzes
2.1 Datenbasis Stadt Arnsberg im Bereich Energie
 2.1 Datenbasis Stadt Arnsberg im Bereich Energie Die CO 2-Bilanz für Arnsberg basiert auf der lokalspezifischen Datengrundlage. Die Bilanz beinhaltet den Endenergieverbrauch nach Verbrauchssektoren und
2.1 Datenbasis Stadt Arnsberg im Bereich Energie Die CO 2-Bilanz für Arnsberg basiert auf der lokalspezifischen Datengrundlage. Die Bilanz beinhaltet den Endenergieverbrauch nach Verbrauchssektoren und
Integriertes Klimaschutzkonzept für die Marktgemeinde Wiggensbach. Ziele und Aktivitätenprogramm. Energieteamsitzung am
 Integriertes Klimaschutzkonzept für die Marktgemeinde Wiggensbach Energieteamsitzung am 06.11.2012 Ziele und Aktivitätenprogramm 1 Dr. Kerstin Koenig-Hoffmann 1. 2. Arbeitsschritte bei der Konzepterstellung
Integriertes Klimaschutzkonzept für die Marktgemeinde Wiggensbach Energieteamsitzung am 06.11.2012 Ziele und Aktivitätenprogramm 1 Dr. Kerstin Koenig-Hoffmann 1. 2. Arbeitsschritte bei der Konzepterstellung
Klimaschutz und Klimaanpassung auf kommunaler Ebene
 Klimaschutz und Klimaanpassung auf kommunaler Ebene Beispiele aus Freiburg Walter Außenhofer Stadt Freiburg, Umweltschutzamt Überblick 1. Freiburg: Zahlen und Fakten 2. Freiburger Agenda 3. Klimaschutzkonzept
Klimaschutz und Klimaanpassung auf kommunaler Ebene Beispiele aus Freiburg Walter Außenhofer Stadt Freiburg, Umweltschutzamt Überblick 1. Freiburg: Zahlen und Fakten 2. Freiburger Agenda 3. Klimaschutzkonzept
KLIMASCHUTZ IN EBERSBERG
 KLIMASCHUTZ IN EBERSBERG Auftaktveranstaltung am 24.November 2011 Willi Steincke & Matthias Heinz Unsere Themen. Kurzvorstellung der beiden Fachbüros Warum ein Integriertes Klimaschutzkonzept? Wie läuft
KLIMASCHUTZ IN EBERSBERG Auftaktveranstaltung am 24.November 2011 Willi Steincke & Matthias Heinz Unsere Themen. Kurzvorstellung der beiden Fachbüros Warum ein Integriertes Klimaschutzkonzept? Wie läuft
Wärmeatlas Jena. Mit all unserer Energie. Frank Schöttke
 Wärmeatlas Jena Mit all unserer Energie. Inhalt 1. Ausgangssituation und Motivation 2. Erhebung Status Quo 3. Ergebnisse Wärmeatlas 4. Weiteres Vorgehen 2 06.02.2014 Ausgangssituation und Motivation Frage
Wärmeatlas Jena Mit all unserer Energie. Inhalt 1. Ausgangssituation und Motivation 2. Erhebung Status Quo 3. Ergebnisse Wärmeatlas 4. Weiteres Vorgehen 2 06.02.2014 Ausgangssituation und Motivation Frage
Erneuerbare Energien in Kasachstan Energiestrategie 2050
 Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ministerialdirigent Edgar Freund Erneuerbare Energien in Kasachstan Energiestrategie 2050 15.09.2014 Inhaltsübersicht 1. Politischer Hintergrund
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ministerialdirigent Edgar Freund Erneuerbare Energien in Kasachstan Energiestrategie 2050 15.09.2014 Inhaltsübersicht 1. Politischer Hintergrund
Integriertes Klimaschutzkonzept Kreis Siegen-Wittgenstein und acht Städte und Gemeinden
 Stadt Siegen 1. Energie- und CO 2 -Bilanz Stadt Siegen: Endenergieverbrauch nach Sektoren (1990 bis 2004: indikatorgestützte Abschätzung; 2005 bis 2011: Endbilanz; 2007 bis 2011: kommunale Verbräuche getrennt
Stadt Siegen 1. Energie- und CO 2 -Bilanz Stadt Siegen: Endenergieverbrauch nach Sektoren (1990 bis 2004: indikatorgestützte Abschätzung; 2005 bis 2011: Endbilanz; 2007 bis 2011: kommunale Verbräuche getrennt
Erhöhte Energieeinsparung bei Schulen durch internes Contracting am Beispiel der Landeshauptstadt Stuttgart
 Erhöhte Energieeinsparung bei Schulen durch internes Contracting am Beispiel der Landeshauptstadt Stuttgart Dr. Jürgen Görres Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz, Abteilung Energiewirtschaft
Erhöhte Energieeinsparung bei Schulen durch internes Contracting am Beispiel der Landeshauptstadt Stuttgart Dr. Jürgen Görres Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz, Abteilung Energiewirtschaft
ECORegion. Das internetbasierte Instrument zur CO 2 -Bilanzierung für Kommunen
 ECORegion Das internetbasierte Instrument zur CO 2 -Bilanzierung für Kommunen Warum eine Bilanzierung der CO 2 -Emissionen? Welche Bereiche sollten betrachtet werden? Klima-Bündnis Gemeinden : - Reduktion
ECORegion Das internetbasierte Instrument zur CO 2 -Bilanzierung für Kommunen Warum eine Bilanzierung der CO 2 -Emissionen? Welche Bereiche sollten betrachtet werden? Klima-Bündnis Gemeinden : - Reduktion
Energie- und CO 2 -Bilanzierung mit ECORegion Stadt Herdecke - Ergebnisse-
 gefördert durch: Energie- und CO 2 -Bilanzierung mit ECORegion Stadt Herdecke - Ergebnisse- ierung Vorgehensweise mit ECORegion 1. Festlegen der Bilanzierungsmethodik und Bilanzierungstiefe 2. Datenerhebung
gefördert durch: Energie- und CO 2 -Bilanzierung mit ECORegion Stadt Herdecke - Ergebnisse- ierung Vorgehensweise mit ECORegion 1. Festlegen der Bilanzierungsmethodik und Bilanzierungstiefe 2. Datenerhebung
Ulrich Ahlke Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit
 Inhalte des Vortrages Der Zukunftskreis Netzwerke energieland 2050: der strategische Ansatz Masterplan 100 % Klimaschutz Maßnahmen, Projekte und Aktivitäten Fazit Der Zukunftskreis Gesamtfläche: 1.793
Inhalte des Vortrages Der Zukunftskreis Netzwerke energieland 2050: der strategische Ansatz Masterplan 100 % Klimaschutz Maßnahmen, Projekte und Aktivitäten Fazit Der Zukunftskreis Gesamtfläche: 1.793
e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr Bielefeld Telefon: 0521/ Fax: 0521/
 Klimaschutzkonzept Werther Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung 18.04.2013 e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Inhalt
Klimaschutzkonzept Werther Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung 18.04.2013 e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Inhalt
Claudia Wolf Stadt Spremberg FB Planen und Bauen Werkstattgespräch Energetischer Umbau im Quartier
 Claudia Wolf Stadt Spremberg FB Planen und Bauen 20.03.2013 Werkstattgespräch Energetischer Umbau im Quartier Eigenheimsiedlung mit individuellen Versorgungslösungen Geschosswohnungsbau mit Gasheizungen
Claudia Wolf Stadt Spremberg FB Planen und Bauen 20.03.2013 Werkstattgespräch Energetischer Umbau im Quartier Eigenheimsiedlung mit individuellen Versorgungslösungen Geschosswohnungsbau mit Gasheizungen
Energie- und CO 2 -Bilanz Gemeinde Haar
 Energie- und -Bilanz Gemeinde Haar Aktualisierung für 2008 und 2009 Uwe Dankert (Dipl.Phys., M.Sc.) Tel.: +49 89 55 29 68 57 Mobil: +49 175 217 0008 email: uwe.dankert@udeee.de Management Energie Effizienz
Energie- und -Bilanz Gemeinde Haar Aktualisierung für 2008 und 2009 Uwe Dankert (Dipl.Phys., M.Sc.) Tel.: +49 89 55 29 68 57 Mobil: +49 175 217 0008 email: uwe.dankert@udeee.de Management Energie Effizienz
e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr Bielefeld Telefon: 0521/ Fax: 0521/
 Klimaschutzkonzept Remscheid e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Arbeitsgruppe Einsparungen bei Wohngebäuden 13.03.2013 Inhalt 1 Einleitung...3
Klimaschutzkonzept Remscheid e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Arbeitsgruppe Einsparungen bei Wohngebäuden 13.03.2013 Inhalt 1 Einleitung...3
PRESSEMELDUNG vom Biosphärenreservat Bliesgau auf dem Weg zur Null-Emissions- Region
 PRESSEMELDUNG vom 30.4.2014 Biosphärenreservat Bliesgau auf dem Weg zur Null-Emissions- Region Die Ziellatte hängt hoch beim "Masterplans 100% Klimaschutz" im Biosphärenreservat Bliesgau. Bis 2050 soll
PRESSEMELDUNG vom 30.4.2014 Biosphärenreservat Bliesgau auf dem Weg zur Null-Emissions- Region Die Ziellatte hängt hoch beim "Masterplans 100% Klimaschutz" im Biosphärenreservat Bliesgau. Bis 2050 soll
Nutzung der Wasserkraft im Gemeindegebiet weitgehend ausgereizt
 Ausgangssituation (17) Bestandsaufnahme Erneuerbare Energien Wasserkraft (1) Wasserkraftnutzung an der Glonn 3 Wasserkraftwerke in Betrieb Nutzung der Wasserkraft im Gemeindegebiet weitgehend ausgereizt
Ausgangssituation (17) Bestandsaufnahme Erneuerbare Energien Wasserkraft (1) Wasserkraftnutzung an der Glonn 3 Wasserkraftwerke in Betrieb Nutzung der Wasserkraft im Gemeindegebiet weitgehend ausgereizt
Stadt Lindau. (Bodensee) 1. Original-Ausfertigung zui/üak an federführendes Amt (Kopiervorlage) Bau- und Umweltausschuss
 Amt/Abt.: Az.: Datum: 60/6013 6011 21.03.2016 Stadt Lindau (Bodensee) Vorlage für: am: Bau- und Umweltausschuss 05.04.2016 Drucksache: 4-42/2016 TOP: 7. öffentliche Sitzung Betreff: Sachverhalt in der
Amt/Abt.: Az.: Datum: 60/6013 6011 21.03.2016 Stadt Lindau (Bodensee) Vorlage für: am: Bau- und Umweltausschuss 05.04.2016 Drucksache: 4-42/2016 TOP: 7. öffentliche Sitzung Betreff: Sachverhalt in der
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 31.12.2017 1 Gebäude Gebäudetyp freistehendes Einfamilienhaus Adresse Musterstraße 1, 12345 ABC-Stadt Gebäudeteil Einfamilienhaus Baujahr Gebäude 1960 Baujahr Anlagentechnik 1989 Anzahl Wohnungen
Gültig bis: 31.12.2017 1 Gebäude Gebäudetyp freistehendes Einfamilienhaus Adresse Musterstraße 1, 12345 ABC-Stadt Gebäudeteil Einfamilienhaus Baujahr Gebäude 1960 Baujahr Anlagentechnik 1989 Anzahl Wohnungen
Frankfurt am Main, krsfr. Stadt
 Rahmendaten Status Quelle Kommentar Datenqualität* Einwohner 701.350 Statistik Hessen Datenstand: 31.12.2013 IST_Gebietsfläche 248.300.000 m² Statistik Hessen Datenstand: 05/2014 Basisjahr 2013 Einzelne
Rahmendaten Status Quelle Kommentar Datenqualität* Einwohner 701.350 Statistik Hessen Datenstand: 31.12.2013 IST_Gebietsfläche 248.300.000 m² Statistik Hessen Datenstand: 05/2014 Basisjahr 2013 Einzelne
Ergänzung zum Integrierten Klimaschutzkonzept des Kreises Paderborn
 Teichweg 6 33100 Paderborn-Benhausen Tel. 0 52 52 3504 Fax 0 52 52 52945 Ergänzung zum Integrierten Klimaschutzkonzept des Kreises Paderborn (22.12.2011) Dipl. Ing. Dietmar Saage 1 1. Ermittlung des Erneuerbaren
Teichweg 6 33100 Paderborn-Benhausen Tel. 0 52 52 3504 Fax 0 52 52 52945 Ergänzung zum Integrierten Klimaschutzkonzept des Kreises Paderborn (22.12.2011) Dipl. Ing. Dietmar Saage 1 1. Ermittlung des Erneuerbaren
KLIMASCHUTZ IN PFAFFENHOFEN Wo steht die Stadt und was ist möglich?
 KLIMASCHUTZ IN PFAFFENHOFEN Wo steht die Stadt und was ist möglich? AUFTAKTVERANSTALTUNG 14.MAI 2012 Mirjam Schumm, Green City Energy Gliederung Wer sind wir? Wo steht die Stadt Pfaffenhofen heute? Welche
KLIMASCHUTZ IN PFAFFENHOFEN Wo steht die Stadt und was ist möglich? AUFTAKTVERANSTALTUNG 14.MAI 2012 Mirjam Schumm, Green City Energy Gliederung Wer sind wir? Wo steht die Stadt Pfaffenhofen heute? Welche
Klimaschutz in Hansestadt und Landkreis Lüneburg
 Klimaschutz in Hansestadt und Landkreis Lüneburg Tobias Winkelmann Klimaschutzleitstelle für Hansestadt und Landkreis Lüneburg Auf dem Michaeliskloster 8 21335 Lüneburg Gliederung 1. Klimaschutzleitstelle:
Klimaschutz in Hansestadt und Landkreis Lüneburg Tobias Winkelmann Klimaschutzleitstelle für Hansestadt und Landkreis Lüneburg Auf dem Michaeliskloster 8 21335 Lüneburg Gliederung 1. Klimaschutzleitstelle:
Wie viel bringt uns das Energiesparen? Wärmedämmung, neue Produktionsweisen in der Industrie, Haushaltsgeräte, Bürotechnik, Carsharing etc.
 Wie viel bringt uns das Energiesparen? Wärmedämmung, neue Produktionsweisen in der Industrie, Haushaltsgeräte, Bürotechnik, Carsharing etc. Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Mauch Forschungsstelle für Energiewirtschaft
Wie viel bringt uns das Energiesparen? Wärmedämmung, neue Produktionsweisen in der Industrie, Haushaltsgeräte, Bürotechnik, Carsharing etc. Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Mauch Forschungsstelle für Energiewirtschaft
Entwicklung des Wärmebedarfs in Deutschland was sind die Auswirkungen auf die KWK-Ziele?
 Hannes Seidl Entwicklung des Wärmebedarfs in Deutschland was sind die Auswirkungen auf die KWK-Ziele? 9. Mai 2012, Berlin 1 Energiepolitische Ziele der Bundesregierung. Senkung des Primärenergieverbrauchs
Hannes Seidl Entwicklung des Wärmebedarfs in Deutschland was sind die Auswirkungen auf die KWK-Ziele? 9. Mai 2012, Berlin 1 Energiepolitische Ziele der Bundesregierung. Senkung des Primärenergieverbrauchs
14. Arbeitskreis Energie. Das Landkreis-Klimaschutzkonzept und seine Umsetzung. KSK Sindelfingen, Berthold Hanfstein, Susann Schöne
 14. Arbeitskreis Energie Das Landkreis-Klimaschutzkonzept und seine Umsetzung KSK Sindelfingen, 16.04.2013 Berthold Hanfstein, Susann Schöne 23.04.2013 www.ea-bb.de 1 Historie: Energiekonzept für den LK
14. Arbeitskreis Energie Das Landkreis-Klimaschutzkonzept und seine Umsetzung KSK Sindelfingen, 16.04.2013 Berthold Hanfstein, Susann Schöne 23.04.2013 www.ea-bb.de 1 Historie: Energiekonzept für den LK
Kommunalsteckbrief Warendorf
 Handlungsleitlinie zur CO 2 -Reduzierung im Münsterland Kommunalsteckbrief Warendorf Fachhochschule Münster Fachbereich Energie Gebäude Umwelt Stegerwaldstraße 39 48565 Steinfurt Gemeindekenndaten Landkreis:
Handlungsleitlinie zur CO 2 -Reduzierung im Münsterland Kommunalsteckbrief Warendorf Fachhochschule Münster Fachbereich Energie Gebäude Umwelt Stegerwaldstraße 39 48565 Steinfurt Gemeindekenndaten Landkreis:
FAKTENBLATT ERNEUERBARE ENERGIEN IM KANTON ZUG Beilage zur Medienmitteilung vom 26. Januar 2011
 Baudirektion FAKTENBLATT ERNEUERBARE ENERGIEN IM KANTON ZUG Beilage zur Medienmitteilung vom 26. Januar 211 Das vorliegende Faktenblatt fasst die Ergebnisse der Studie "Erneuerbare Energien im Kanton Zug:
Baudirektion FAKTENBLATT ERNEUERBARE ENERGIEN IM KANTON ZUG Beilage zur Medienmitteilung vom 26. Januar 211 Das vorliegende Faktenblatt fasst die Ergebnisse der Studie "Erneuerbare Energien im Kanton Zug:
Die Steuerung der regionalen Energiewende
 Die Steuerung der regionalen Energiewende Referent: Ulrich Ahlke, Kreis Steinfurt Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit Inhalte des Vortrages das energieland2050 o das Team o unsere Netzwerke o Daten,
Die Steuerung der regionalen Energiewende Referent: Ulrich Ahlke, Kreis Steinfurt Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit Inhalte des Vortrages das energieland2050 o das Team o unsere Netzwerke o Daten,
Ein integriertes Klimaschutzkonzept für Bad Driburg. Arbeitskreis Erneuerbare Energie/KWK Themen
 e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3, 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Internet: www.eundu-online.de Ein integriertes Klimaschutzkonzept für Bad Driburg Arbeitskreis Erneuerbare
e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3, 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Internet: www.eundu-online.de Ein integriertes Klimaschutzkonzept für Bad Driburg Arbeitskreis Erneuerbare
Das Klimaschutzkonzept des Bezirkes Steglitz-Zehlendorf
 Das Klimaschutzkonzept des Bezirkes Steglitz-Zehlendorf S-Z Energie- und Klimaschutztag Sonnabend, den 10. Oktober 2015 Dr. Christian Wilke Koordinationsstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Umwelt-und
Das Klimaschutzkonzept des Bezirkes Steglitz-Zehlendorf S-Z Energie- und Klimaschutztag Sonnabend, den 10. Oktober 2015 Dr. Christian Wilke Koordinationsstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Umwelt-und
Bevölkerung Entwicklung und Prognose
 Bevölkerung Entwicklung und Prognose - Ergänzung per 31.12.2011 - Herausgegeben vom Landkreis Dahme-Spreewald Der Landrat Amt für Kreisentwicklung und Denkmalschutz Druck: Eigendruck Stand: 10/2012 LDS
Bevölkerung Entwicklung und Prognose - Ergänzung per 31.12.2011 - Herausgegeben vom Landkreis Dahme-Spreewald Der Landrat Amt für Kreisentwicklung und Denkmalschutz Druck: Eigendruck Stand: 10/2012 LDS
Maßnahmenwerkstatt Seligenstadt. 15. Januar 2013
 Maßnahmenwerkstatt Seligenstadt 15. Januar 2013 Ablaufplan Klimaschutzkonzept Seligenstadt Ideenwerkstatt 23.06.12 Steuerungsgruppe 22.05.12 simwatt 20.09.12 Maßnahmenwerkstatt 15.01.13 Klimaschutzziele
Maßnahmenwerkstatt Seligenstadt 15. Januar 2013 Ablaufplan Klimaschutzkonzept Seligenstadt Ideenwerkstatt 23.06.12 Steuerungsgruppe 22.05.12 simwatt 20.09.12 Maßnahmenwerkstatt 15.01.13 Klimaschutzziele
Energieeinsparkonzepte und Energienutzungspläne
 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie Energieeinsparkonzepte und Energienutzungspläne Merkblatt zum Förderschwerpunkt Energieeinsparkonzepte und Energienutzungspläne
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie Energieeinsparkonzepte und Energienutzungspläne Merkblatt zum Förderschwerpunkt Energieeinsparkonzepte und Energienutzungspläne
Energieverbrauch eines Beispielhaushaltes in Deutschland
 Abschlussvortrag zum Hauptseminar Energieverbrauch eines Beispielhaushaltes in Deutschland 10.04.2014 von Christoph Gass Betreuer: Dr.-Ing. Christoph M. Hackl Gliederung Motivation Verwendete Daten Festlegung
Abschlussvortrag zum Hauptseminar Energieverbrauch eines Beispielhaushaltes in Deutschland 10.04.2014 von Christoph Gass Betreuer: Dr.-Ing. Christoph M. Hackl Gliederung Motivation Verwendete Daten Festlegung
Energie- und CO 2 -Bilanz für die Kommunen im Landkreis Ostallgäu
 Energie- und CO 2 -Bilanz für die Kommunen im Landkreis Ostallgäu Gemeindeblatt für die Gemeinde Günzach Die vorliegende Energie- und CO 2-Bilanz umfasst sämtliche Energiemengen, die für elektrische und
Energie- und CO 2 -Bilanz für die Kommunen im Landkreis Ostallgäu Gemeindeblatt für die Gemeinde Günzach Die vorliegende Energie- und CO 2-Bilanz umfasst sämtliche Energiemengen, die für elektrische und
Klimaschutz-Teilkonzept für den Ilzer-Land e.v.
 Klimaschutz-Teilkonzept für den Ilzer-Land e.v. Gemeinde Fürsteneck Dieses Projekt wird gefördert durch: Klimaschutz in eigenen Liegenschaften für ausgewählte kommunale Nichtwohngebäude Erstellt durch:
Klimaschutz-Teilkonzept für den Ilzer-Land e.v. Gemeinde Fürsteneck Dieses Projekt wird gefördert durch: Klimaschutz in eigenen Liegenschaften für ausgewählte kommunale Nichtwohngebäude Erstellt durch:
Endpräsentation. Energiebedarfserhebung
 Endpräsentation Energiebedarfserhebung Rücklaufquote 9,21 % Danke für die Mitarbeit! Rücklaufquoten Fragebögen Private Haushalte 127 von 1415 8,98 % Landwirts. Haushalte 21 von 225 9,33 % Gewerbe-Betriebe
Endpräsentation Energiebedarfserhebung Rücklaufquote 9,21 % Danke für die Mitarbeit! Rücklaufquoten Fragebögen Private Haushalte 127 von 1415 8,98 % Landwirts. Haushalte 21 von 225 9,33 % Gewerbe-Betriebe
Klimaschutzkonzept der Stadt Jena
 Klimaschutzkonzept der Stadt Jena 1. öffentlicher Workshop in der Rathausdiele am 04. März 2015 Bearbeiter: Dr. Matthias Mann, Dipl.- Geogr. Heiko Griebsch ThINK Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und
Klimaschutzkonzept der Stadt Jena 1. öffentlicher Workshop in der Rathausdiele am 04. März 2015 Bearbeiter: Dr. Matthias Mann, Dipl.- Geogr. Heiko Griebsch ThINK Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und
Effiziente Technik und Erneuerbare Energien
 Effiziente Technik und Erneuerbare Energien Schloß Holte-Stukenbrock, 25. September Dr. Jochen Arthkamp, ASUE www.asue.de Herausforderungen an die Energieversorgung zunehmender Energiebedarf weltweit begrenzte
Effiziente Technik und Erneuerbare Energien Schloß Holte-Stukenbrock, 25. September Dr. Jochen Arthkamp, ASUE www.asue.de Herausforderungen an die Energieversorgung zunehmender Energiebedarf weltweit begrenzte
Erneuerbare Energien für Bayern
 Erneuerbare Energien für Bayern Kommunalpolitikertag der BayernSPD- Landtagsfraktion 06.06.2011 Energiewende Bayern Herausforderung und Chance Ein erster Blick auf eine schnelle Lösung Ein ebenso schneller
Erneuerbare Energien für Bayern Kommunalpolitikertag der BayernSPD- Landtagsfraktion 06.06.2011 Energiewende Bayern Herausforderung und Chance Ein erster Blick auf eine schnelle Lösung Ein ebenso schneller
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 30.09.2020 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) freistehendes Mehrfamilienhaus 1968 2007 40 2.766,0 m² Erneuerbare
Gültig bis: 30.09.2020 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) freistehendes Mehrfamilienhaus 1968 2007 40 2.766,0 m² Erneuerbare
Energetische Sanierung Lerchenberg Mehrfamilienhäuser
 Energetische Sanierung Lerchenberg Mehrfamilienhäuser Architektur + Energie Grabs 1 Thema: energetische Sanierung von Mehrfamilienhäusern Lerchenberg: Die meisten Mehrfamilienhäuser des Mainzer Stadtteils
Energetische Sanierung Lerchenberg Mehrfamilienhäuser Architektur + Energie Grabs 1 Thema: energetische Sanierung von Mehrfamilienhäusern Lerchenberg: Die meisten Mehrfamilienhäuser des Mainzer Stadtteils
Erstellung des Integrierten Klimaschutzkonzepts für die Stadt Freising. Auftaktveranstaltung
 Erstellung des Integrierten Klimaschutzkonzepts für die Stadt Freising Auftaktveranstaltung Hr. Dipl.-Ing. Univ. Josef Konradl Hr. Dr. André Suck Freising, 12. September 2012 KEWOG Holding 100% Tochtergesellschaften
Erstellung des Integrierten Klimaschutzkonzepts für die Stadt Freising Auftaktveranstaltung Hr. Dipl.-Ing. Univ. Josef Konradl Hr. Dr. André Suck Freising, 12. September 2012 KEWOG Holding 100% Tochtergesellschaften
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
 65 Anlage 6 (zu 6) Muster Energieausweis Wohngebäude Gültig bis: Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Gebäudefoto (freiwillig) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche
65 Anlage 6 (zu 6) Muster Energieausweis Wohngebäude Gültig bis: Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik Gebäudefoto (freiwillig) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche
Energiebericht 2014 Strom für die Stadt Delbrück
 Energiebericht 2014 Strom für die Stadt Delbrück 06.05.2015 Workshop Erneuerbare Energie Klimaschutzkonzept Stadt Delbrück Mike Süggeler Westfalen Weser Netz AG / 03.04.2014 UNTERNEHMENSSTRUKTUR - Stromnetz
Energiebericht 2014 Strom für die Stadt Delbrück 06.05.2015 Workshop Erneuerbare Energie Klimaschutzkonzept Stadt Delbrück Mike Süggeler Westfalen Weser Netz AG / 03.04.2014 UNTERNEHMENSSTRUKTUR - Stromnetz
ENERGETISCHES QUARTIERSKONZEPT für die Siedlungen Eichkamp und Heerstraße in Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf
 ENERGETISCHES QUARTIERSKONZEPT für die Siedlungen Eichkamp und Heerstraße in Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf Runder Tisch Wärmeversorgung im Quartier 07. April 2016 TOP / was haben wir vor? 1. Begrüßung
ENERGETISCHES QUARTIERSKONZEPT für die Siedlungen Eichkamp und Heerstraße in Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf Runder Tisch Wärmeversorgung im Quartier 07. April 2016 TOP / was haben wir vor? 1. Begrüßung
Energiepotentiale. Geschichte und Effekte des Umstiegs auf erneuerbare Energieträger.
 Energiepotentiale Güssing: Geschichte und Effekte des Umstiegs auf erneuerbare Energieträger. Dr. Richard Zweiler 1 Die Welt verbraucht 10 Mio. to Erdöl 12,5 Mio. to Steinkohle 7,5Mrd. m³ Erdgas PRO TAG!
Energiepotentiale Güssing: Geschichte und Effekte des Umstiegs auf erneuerbare Energieträger. Dr. Richard Zweiler 1 Die Welt verbraucht 10 Mio. to Erdöl 12,5 Mio. to Steinkohle 7,5Mrd. m³ Erdgas PRO TAG!
Frankfurt am Main. 100 % Klimaschutz 100 % erneuerbare Energie
 DAS ENERGIEREFERAT Frankfurt am Main 100 % Klimaschutz 100 % erneuerbare Energie Dr. Werner Neumann, Leiter des Energiereferats der Stadt Frankfurt am Main 1 Globale Klimaschutzziele Begrenzung des mittleren
DAS ENERGIEREFERAT Frankfurt am Main 100 % Klimaschutz 100 % erneuerbare Energie Dr. Werner Neumann, Leiter des Energiereferats der Stadt Frankfurt am Main 1 Globale Klimaschutzziele Begrenzung des mittleren
Wärmeszenario Erneuerbare Energien 2025 in Schleswig-Holstein
 Wärmeszenario Erneuerbare Energien 2025 in Schleswig-Holstein Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, in Schleswig-Holstein bis zum Jahr 2020 einen Anteil von 18% des Endenergieverbrauchs (EEV)
Wärmeszenario Erneuerbare Energien 2025 in Schleswig-Holstein Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, in Schleswig-Holstein bis zum Jahr 2020 einen Anteil von 18% des Endenergieverbrauchs (EEV)
Stadtverordnetenversammlung, 08.10.2015
 Stadtverordnetenversammlung, Gegenstand und Ausgangszustand Gegenstand: Verbrauch von Strom und Wärme in Müncheberg und die dadurch bedingten CO 2 -Emissionen Zeitrahmen: 2015 bis 2030 Eckdaten (Ist):
Stadtverordnetenversammlung, Gegenstand und Ausgangszustand Gegenstand: Verbrauch von Strom und Wärme in Müncheberg und die dadurch bedingten CO 2 -Emissionen Zeitrahmen: 2015 bis 2030 Eckdaten (Ist):
Energiewende und Klimaschutz
 Energiewende und Klimaschutz Integriertes Klimaschutzkonzept Gemeinde Owingen Owingen, Billafingen, Hohenbodman, Taisersdorf, Was passiert heute? Agenda. 1. Bilanzdaten Owingen Energiedaten Treibhausgase
Energiewende und Klimaschutz Integriertes Klimaschutzkonzept Gemeinde Owingen Owingen, Billafingen, Hohenbodman, Taisersdorf, Was passiert heute? Agenda. 1. Bilanzdaten Owingen Energiedaten Treibhausgase
Integriertes bezirkliches Klimaschutzkonzept
 Integriertes bezirkliches Klimaschutzkonzept für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf von Berlin Das Integrierte Klimaschutzkonzept des Bezirkes Steglitz-Zehlendorf wurde durch das Bundesministerium für Umwelt,
Integriertes bezirkliches Klimaschutzkonzept für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf von Berlin Das Integrierte Klimaschutzkonzept des Bezirkes Steglitz-Zehlendorf wurde durch das Bundesministerium für Umwelt,
Klimaschutzkonzept Energie- & CO 2 -Bilanz Potenzialanalyse
 Klimaschutzkonzept Energie- & CO 2 -Bilanz Potenzialanalyse Planungs- & Umweltausschuss 22. April 2015 Prof. Dr.-Ing. Isabel Kuperjans FH AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INSTITUT NOWUM-ENERGY FACHBEREICH
Klimaschutzkonzept Energie- & CO 2 -Bilanz Potenzialanalyse Planungs- & Umweltausschuss 22. April 2015 Prof. Dr.-Ing. Isabel Kuperjans FH AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INSTITUT NOWUM-ENERGY FACHBEREICH
Energie- und CO 2 -Bilanz für den Kreis Herzogtum Lauenburg
 Energie- und CO 2 -Bilanz für den Kreis Herzogtum Lauenburg Mit Hilfe der Software ECORegion smart der Firma Ecospeed wurde auf der Grundlage kreisspezifischer Daten sowie in der Software integrierter
Energie- und CO 2 -Bilanz für den Kreis Herzogtum Lauenburg Mit Hilfe der Software ECORegion smart der Firma Ecospeed wurde auf der Grundlage kreisspezifischer Daten sowie in der Software integrierter
Energiewende im Landkreis Pfaffenhofen a.d.ilm. Leben und mehr landkreis-pfaffenhofen.de
 Energiewende im Landkreis Pfaffenhofen a.d.ilm Leben und mehr landkreis-pfaffenhofen.de Windkraft 10.10.2016 Foto: Gemeinde Gerolsbach Folie 2 Landkreis-Förderprogramm Energieeinsparung Start: 2016 Budget:
Energiewende im Landkreis Pfaffenhofen a.d.ilm Leben und mehr landkreis-pfaffenhofen.de Windkraft 10.10.2016 Foto: Gemeinde Gerolsbach Folie 2 Landkreis-Förderprogramm Energieeinsparung Start: 2016 Budget:
Wärmeschutz ist Klimaschutz das magische Dreieck von Politik, Industrie und Wissenschaft
 Wärmeschutz ist Klimaschutz das magische Dreieck von Politik, Industrie und Wissenschaft 1 Ausgangslage Die Energieeffizienz - Steigerung ist ökonomisch, ökologisch und sozial sinnvoll, sie ist damit ein
Wärmeschutz ist Klimaschutz das magische Dreieck von Politik, Industrie und Wissenschaft 1 Ausgangslage Die Energieeffizienz - Steigerung ist ökonomisch, ökologisch und sozial sinnvoll, sie ist damit ein
Integriertes Klimaschutzkonzept Stadt Ostfildern
 Integriertes Klimaschutzkonzept Stadt Ostfildern Kurzzusammenfassung des Abschlussberichts Das Integrierte Klimaschutzkonzept für Ostfildern umfasst Ergebnisse in fünf aufeinander aufbauenden Abschnitten:
Integriertes Klimaschutzkonzept Stadt Ostfildern Kurzzusammenfassung des Abschlussberichts Das Integrierte Klimaschutzkonzept für Ostfildern umfasst Ergebnisse in fünf aufeinander aufbauenden Abschnitten:
Klimaschutz-Strategie Bayern
 Klimaschutz-Strategie Bayern Pressekonferenz München, 12. November 2007 Veit Bürger (v.buerger@oeko.de) Christof Timpe (c.timpe@oeko.de) Öko-Institut e.v. Freiburg/Darmstadt/Berlin Germany Aufgabenstellung
Klimaschutz-Strategie Bayern Pressekonferenz München, 12. November 2007 Veit Bürger (v.buerger@oeko.de) Christof Timpe (c.timpe@oeko.de) Öko-Institut e.v. Freiburg/Darmstadt/Berlin Germany Aufgabenstellung
Der Energiebericht wird 2015 von der Abteilung Service, Technische Dienste und Bauunterhaltung (ZHVII) herausgegeben und erscheint jährlich.
 Seite 2 Einleitung Der Energiebericht wird 2015 von der Abteilung Service, Technische Dienste und Bauunterhaltung (ZHVII) herausgegeben und erscheint jährlich. Die Veröffentlichung des Energieberichts
Seite 2 Einleitung Der Energiebericht wird 2015 von der Abteilung Service, Technische Dienste und Bauunterhaltung (ZHVII) herausgegeben und erscheint jährlich. Die Veröffentlichung des Energieberichts
gefördert durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
 Projektvorstellung 1. Hintergrund Warum Thema Gebäude? 2. Stadtteilebene Warum Stadtteil - Warum Haslach? 3. Ziele Was und Wen wollen wir erreichen? 4. Vorbereitung Was haben wir bisher unternommen? 5.
Projektvorstellung 1. Hintergrund Warum Thema Gebäude? 2. Stadtteilebene Warum Stadtteil - Warum Haslach? 3. Ziele Was und Wen wollen wir erreichen? 4. Vorbereitung Was haben wir bisher unternommen? 5.
Nachhaltigkeitskonzept und Klimaschutzfahrplan der Stadt Neumarkt i.d.opf.
 Nachhaltigkeitskonzept und Klimaschutzfahrplan der Stadt Neumarkt i.d.opf. Ruth Dorner Bürgermeisterin, Agenda 21-Beauftragte und Klimaschutzreferentin des Stadtrates Stadtleitbild Verankerung des Klimaschutzes
Nachhaltigkeitskonzept und Klimaschutzfahrplan der Stadt Neumarkt i.d.opf. Ruth Dorner Bürgermeisterin, Agenda 21-Beauftragte und Klimaschutzreferentin des Stadtrates Stadtleitbild Verankerung des Klimaschutzes
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Gültig bis: 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik 1) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Erneuerbare Energien Lüftung Gebäudefoto (freiwillig) Anlass der
Gültig bis: 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude Baujahr Anlagentechnik 1) Anzahl Wohnungen Gebäudenutzfläche (A N ) Erneuerbare Energien Lüftung Gebäudefoto (freiwillig) Anlass der
ENDENERGIEVERBRAUCH UND CO 2 -EMISSIONEN IN ERLANGEN ENTWICKLUNG FÜR DIE ZUKUNFT - TRENDS UND ZIELE
 ENDENERGIEVERBRAUCH UND CO 2 -EMISSIONEN IN ERLANGEN ENTWICKLUNG FÜR DIE ZUKUNFT - TRENDS UND ZIELE September 2008 1 Vorbemerkung Der Klimaschutz als eine der zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts,
ENDENERGIEVERBRAUCH UND CO 2 -EMISSIONEN IN ERLANGEN ENTWICKLUNG FÜR DIE ZUKUNFT - TRENDS UND ZIELE September 2008 1 Vorbemerkung Der Klimaschutz als eine der zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts,
Interne Bestellung. Prognose und Umrechnung des Kapazitätsbedarfs
 Interne Bestellung Prognose und Umrechnung des Kapazitätsbedarfs Seite 1 Agenda Entwicklung des Erdgasverbrauchs Deutschland Ist- und temperaturbereinigter PEV Erdgas 2000-2012 Einsparpotenziale im Raumwärmemarkt
Interne Bestellung Prognose und Umrechnung des Kapazitätsbedarfs Seite 1 Agenda Entwicklung des Erdgasverbrauchs Deutschland Ist- und temperaturbereinigter PEV Erdgas 2000-2012 Einsparpotenziale im Raumwärmemarkt
Integriertes Klimaschutzkonzept für Bad Driburg AK Bauen und Sanieren
 e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3, 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Internet: www.eundu-online.de Integriertes Klimaschutzkonzept für Bad Driburg AK Bauen und Sanieren Bad
e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3, 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Internet: www.eundu-online.de Integriertes Klimaschutzkonzept für Bad Driburg AK Bauen und Sanieren Bad
Energiewende Kreis Groß Gerau. Strategische Handlungsschwerpunkte
 Energiewende Kreis Groß Gerau Strategische Handlungsschwerpunkte Fachbereich Wirtschaft und Energie III/2 Straßer März 2016 Energiewende Kreis Groß Gerau Der Kreistag des Kreises Groß Gerau hat im Frühjahr
Energiewende Kreis Groß Gerau Strategische Handlungsschwerpunkte Fachbereich Wirtschaft und Energie III/2 Straßer März 2016 Energiewende Kreis Groß Gerau Der Kreistag des Kreises Groß Gerau hat im Frühjahr
Kosten-Nutzen-Analyse von Förderprogrammen zur Steigerung der Energieeffizienz
 Kosten-Nutzen-Analyse von Förderprogrammen zur Steigerung der Energieeffizienz Marcel Bellmann 1 Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH Kurzpräsentation GRACE Laufzeit: Juni 2011 bis Mai 2013 Partner:
Kosten-Nutzen-Analyse von Förderprogrammen zur Steigerung der Energieeffizienz Marcel Bellmann 1 Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH Kurzpräsentation GRACE Laufzeit: Juni 2011 bis Mai 2013 Partner:
Wie viel bringt uns das Energiesparen? Wärmedämmung, neue Produktionsweisen in der Industrie, Haushaltsgeräte, Bürotechnik, Carsharing etc.
 Wie viel bringt uns das Energiesparen? Wärmedämmung, neue Produktionsweisen in der Industrie, Haushaltsgeräte, Bürotechnik, Carsharing etc. Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Mauch Forschungsstelle für Energiewirtschaft
Wie viel bringt uns das Energiesparen? Wärmedämmung, neue Produktionsweisen in der Industrie, Haushaltsgeräte, Bürotechnik, Carsharing etc. Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Mauch Forschungsstelle für Energiewirtschaft
Klimaschutzmanagement Stadt Merseburg Klimaschutzmanagement der Stadt Merseburg
 Klimaschutzmanagement der Stadt Merseburg 1 Inhalte 1. Vorstellung Klimaschutzmanager 2. Arbeitsplan 2. Halbjahr 216 3. Entwicklung der Verbräuche ausgewählter energetisch sanierter Gebäude der Stadt Merseburg
Klimaschutzmanagement der Stadt Merseburg 1 Inhalte 1. Vorstellung Klimaschutzmanager 2. Arbeitsplan 2. Halbjahr 216 3. Entwicklung der Verbräuche ausgewählter energetisch sanierter Gebäude der Stadt Merseburg
Wickrathberger Str Mönchengladbach. Verkauf - Vermietung
 gültig bis: 23.03.2024 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude 1900 Baujahr Anlagentechnik 1995 Anzahl Wohnungen 109 Mehr-Familienwohnhaus Wickrathberger Str. 2+10+12+16 41189 Mönchengladbach
gültig bis: 23.03.2024 1 Gebäude Gebäudetyp Adresse Gebäudeteil Baujahr Gebäude 1900 Baujahr Anlagentechnik 1995 Anzahl Wohnungen 109 Mehr-Familienwohnhaus Wickrathberger Str. 2+10+12+16 41189 Mönchengladbach
Energie- und CO 2 -Bilanz für die Kommunen im Landkreis Ostallgäu
 Energie- und CO 2 -Bilanz für die Kommunen im Landkreis Ostallgäu Gemeindeblatt für die Marktgemeinde Waal Die vorliegende Energie- und CO 2-Bilanz umfasst sämtliche Energiemengen, die für elektrische
Energie- und CO 2 -Bilanz für die Kommunen im Landkreis Ostallgäu Gemeindeblatt für die Marktgemeinde Waal Die vorliegende Energie- und CO 2-Bilanz umfasst sämtliche Energiemengen, die für elektrische
Klimaschutz - Dezentrale Energiewende Bayern
 Klimaschutz - Dezentrale Energiewende Bayern 30. November 2015 Nürnberg, BN-Mitarbeitertagung Dr. Herbert Barthel, Referat für Energie und Klimaschutz herbert.barthel@bund-naturschutz.de Energiewende AKW
Klimaschutz - Dezentrale Energiewende Bayern 30. November 2015 Nürnberg, BN-Mitarbeitertagung Dr. Herbert Barthel, Referat für Energie und Klimaschutz herbert.barthel@bund-naturschutz.de Energiewende AKW
Energie- und CO 2 -Bilanz für die Kommunen im Landkreis Ostallgäu
 Energie- und CO 2 -Bilanz für die Kommunen im Landkreis Ostallgäu Gemeindeblatt für die Gemeinde Biessenhofen Die vorliegende Energie- und CO 2-Bilanz umfasst sämtliche Energiemengen, die für elektrische
Energie- und CO 2 -Bilanz für die Kommunen im Landkreis Ostallgäu Gemeindeblatt für die Gemeinde Biessenhofen Die vorliegende Energie- und CO 2-Bilanz umfasst sämtliche Energiemengen, die für elektrische
2. Meininger Energiekonferenz Das Energiesystem Deutschlands im Jahr 2050 und die Konsequenzen für die Thüringer Energiepolitik
 2. Meininger Energiekonferenz Das Energiesystem Deutschlands im Jahr 2050 und die Konsequenzen für die Thüringer Energiepolitik Prof. Dr.-Ing. Viktor Wesselak Institut für Regenerative Energietechnik (in.ret)
2. Meininger Energiekonferenz Das Energiesystem Deutschlands im Jahr 2050 und die Konsequenzen für die Thüringer Energiepolitik Prof. Dr.-Ing. Viktor Wesselak Institut für Regenerative Energietechnik (in.ret)
Agenda. 1. Eröffnung der 1. Frankfurter Energie-Effizienz-Konferenz Martin Patzelt, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder)
 Agenda 1. Eröffnung der 1. Frankfurter Energie-Effizienz-Konferenz Martin Patzelt, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder) 2. Die Energiebilanz von Frankfurt (Oder): Energieverbrauch und CO2-Emissionen
Agenda 1. Eröffnung der 1. Frankfurter Energie-Effizienz-Konferenz Martin Patzelt, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder) 2. Die Energiebilanz von Frankfurt (Oder): Energieverbrauch und CO2-Emissionen
IAB Fachbereich Energie + Umwelt Dipl.-Ing. U. Büchner
 IAB Fachbereich Energie + Umwelt Dipl.-Ing. U. Büchner Zielsetzung Analyse des eigenen Standes der Energieversorgung Aufdeckung von Potentialen zur Senkung des Energieverbrauches, zur Steigerung der Energieeffizienz,
IAB Fachbereich Energie + Umwelt Dipl.-Ing. U. Büchner Zielsetzung Analyse des eigenen Standes der Energieversorgung Aufdeckung von Potentialen zur Senkung des Energieverbrauches, zur Steigerung der Energieeffizienz,
Besuch in Edirne Mai Marion Dammann Bürgermeisterin der Stadt Lörrach
 Besuch in Edirne Mai 2011 Marion Dammann Bürgermeisterin der Stadt Lörrach 1 Lörrach: im Südwesten Deutschlands Lörrach: Einwohner: 48.200 Fläche: 3942 ha Energieverbrauch städtischer Gebäude: Wärme: ca.
Besuch in Edirne Mai 2011 Marion Dammann Bürgermeisterin der Stadt Lörrach 1 Lörrach: im Südwesten Deutschlands Lörrach: Einwohner: 48.200 Fläche: 3942 ha Energieverbrauch städtischer Gebäude: Wärme: ca.
Entwicklung der erneuerbaren Energien im Jahr 2005 in Deutschland Stand: Februar 2006
 Entwicklung der erneuerbaren Energien im Jahr 2005 in Deutschland Stand: Februar 2006 2005 hat sich die Nutzung erneuerbarer Energien erneut positiv weiterentwickelt. Nach Angaben der Arbeitsgruppe Erneuerbare
Entwicklung der erneuerbaren Energien im Jahr 2005 in Deutschland Stand: Februar 2006 2005 hat sich die Nutzung erneuerbarer Energien erneut positiv weiterentwickelt. Nach Angaben der Arbeitsgruppe Erneuerbare
Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe)
 Gesetzlicher Prüfungsverband Gültig bis: Seite 1 von 5 Gebäude Gebäudetyp MFH Adresse Waldstrasse 115, Stuttgart 61-151 Gebäudeteil Baujahr Gebäude 1990 Baujahr Anlagetechnik 1990 Gebäudefoto (freiwillig)
Gesetzlicher Prüfungsverband Gültig bis: Seite 1 von 5 Gebäude Gebäudetyp MFH Adresse Waldstrasse 115, Stuttgart 61-151 Gebäudeteil Baujahr Gebäude 1990 Baujahr Anlagetechnik 1990 Gebäudefoto (freiwillig)
