VEGAS Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung
|
|
|
- Maike Baumgartner
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung VEGAS Institut für Wasserbau Universität Stuttgart Pfaffenwaldring 61 D Stuttgart Universität Stuttgart Institut für Wasserbau Wissenschaftlicher Leiter VEGAS Jürgen Braun, PhD F Technischer Leiter VEGAS Dr.-Ing. H.-P. Koschitzky F Pfaffenwaldring 61 D Stuttgart Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) vegas@iws.uni-stuttgart.de EU-Projekt PURE, WP7 Simultane Sanierung der gesättigten und ungesättigten Zone durch Dampf-Luft-Injektion und Alkoholspülung Ziele Die In-situ-Sanierung von Grundwasserleitern, kontaminiert mit organischen Schadstoffen in Phase bzw. in residualer Sättigung stellt für herkömmliche Pump & Treat Verfahren aufgrund der zumeist geringen Wasserlöslichkeit der organischen Schadstoffe und den damit verbundenen sehr langen Sanierungszeiten ein Problem dar. Im Rahmen des EU-Projektes PURE sollte ein Verfahren zur simultanen Sanierung der gesättigten und ungesättigten Zone entwickelt werden. Hierbei wurden die beiden innovativen In-situ-Sanierungstechnologien Co-Solvent Flooding (CSF) und Thermally Enhanced Soil Vapour Extraction (TSVE) standortbezogen weiterentwickelt und in Großbehälterversuchen einzeln und in Kombination zur Sanierung eines AKW-Schadenfalls (LNAPL) angewendet. Projektrahmen PURE Das von der EU im 5. Rahmenprogramm geförderte Projekt PURE (Protection of Groundwater Resources at Industrially Contaminated Sites) hatte sich zum Ziel gesetzt, die Bearbeitung von Altlastenstandorten effektiver zu gestalten, sowohl hinsichtlich der Erkundungstechnik, der Altlastenbewertung als auch der Sanierungstechnik (Abb. 1). An diesem Projekt beteiligt waren vier Altlastenbesitzer, zwei Ingenieurbüros, vier Universitäten und vier Forschungseinrichtungen. Bei VEGAS wurde das Teilprojekt (Workpackage WP 7) "Simultaneous remediation of the saturated and the unsaturated zone" bearbeitet.
2 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 2 Protection of Groundwater Resources at Industrially Contaminated Sites PURE 4 Industriestandorte 2 Ingenieurbüros 4 Universitäten 4 Forschungseinrichtungen Altlastenbewertung Sanierungsverfahren Erkundungstechniken WP 7 Simultane Sanierung der gesättigten und ungesättigten Bodenzone Feldstandort: -site 3 -site 4 Co-Solvent Flooding (CSF) Thermally Enhanced Soil Soil Vapour Vapour Extraction (TSVE) (TSVE) Abbildung 1: Projektstruktur PURE und Arbeitspaket (WP7) von VEGAS Im Rahmen des Teilprojektes (WP 7) wurden zwei innovative In-situ-Sanierungsverfahren (CSF und TSVE) miteinander kombiniert und bis zur Feldanwendungsreife weiterentwickelt. Das angestrebte Ergebnis des Teilprojektes war eine pilothafte Anwendung beider Verfahren an einem Standort eines Industriepartners inklusive einer Wirtschaftlichkeitsstudie. Sanierungstechnologie Co-Solvent-Flooding (CSF): Die Alkoholspülung dient der Sanierung kontaminierter Bodenbereiche in der gesättigten Bodenzone. Durch entsprechende Alkoholinjektion und -extraktion werden die kontaminierten Bereiche eines Grundwasserleiters durchströmt. Für die Injektion und Extraktion sind geeignete Brunnenanordnungen (Horizontal-, Vertikal-, Grundwasserzirkulationsbrunnen oder Kombinationen) erforderlich. Der Vorteil der Alkoholspülung im Vergleich zu herkömmlichen Pump-and-Treat Verfahren mit Wasser liegt in höheren Schadstoffaustragsraten, wobei der Schadstoff sowohl in gelöster Form, als auch (kontrolliert) als freie Phase ausgetragen wird. Durch die Wahl eines geeigneten Alkohols, der auf den Schadstoff bzw. das Schadstoffgemisch abgestimmt werden muss, wird die Löslichkeit des Schadstoffes erhöht und die Grenzflächenspannung zwischen Wasser und Schadstoff herabgesetzt. Die so mobilisierten Schadstoffe werden infolge der Strömungsführung sowie der geringeren Dichte auf Höhe des Grundwasserspiegels transportiert und können dort abgepumpt werden. Im Anschluss an die Sanierung des Grundwasserleiters kann die ungesättigte Zone mittels thermisch unterstützter Bodenluftabsaugung (TSVE) abgereinigt werden. Der einzusetzende Alkohol ist in Abhängigkeit von der Dichte des Schadstoffs zu wählen. Für LNAPL (Light Nonaqueous Phase Liquid), wie im Rahmen des PURE-Projektes untersucht, ist eine Mischung aus Wasser und einem geeigneten Alkohol ausreichend, da der mobilisierte Schadstoff aufgrund der Dichteunterschiede hydraulisch kontrollierbar ist.
3 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 3 Für mobilisierte DNAPL (Dense Nonaqueous Phase Liquid) besteht bei konventionellen Verfahren die potentielle Gefahr eines unkontrollierten Absinken des Schadstoffes. Durch den Einsatz eines Alkohol-Cocktails mit lipophilen Anteilen ist es möglich, die Dichte des Schadstoffes derart zu verringern, dass auch ein mobilisierter DNAPL hydraulisch kontrollierbar wird und mit einer resultierenden Dichte kleiner als die von Wasser gefördert wird. Ein DNAPL wird zum LNAPL. Eine zusätzlich angelegte aufwärtsgerichtete Strömung dient einerseits dem gezielten Einsatz des Cocktails und andererseits als zusätzliche Sicherheit gegen die vertikale Verlagerung des Schadstoffes (Einzelheiten können den folgenden Projekten entnommen werden). Sowohl aus ökologischen als auch aus ökonomischen Gesichtspunkten wird das extrahierte Wasser-Alkohol-Schadstoff-Gemisch getrennt, und der Alkohol bzw. die Alkohole aufkonzentriert. Somit können die Alkohole für weitere Spülvorgänge wiederverwendet werden. Abbildung 2: Prinzipskizze der simultanen Sanierung der gesättigten und ungesättigten Zone über die Kombination von CSF und TSVE Sanierungstechnologie Dampf-Luft-Injektion (TSVE, subtsve) Durch Injektion von Sattdampf bzw. einer Mischung aus Sattdampf und Luft unterhalb des Wasserspiegels wird Grundwasser verdrängt und weite Teile der gesättigten Zone, der gesamte Kapillarsaum als auch die ungesättigte Zone rasch aufgeheizt. Da sich mit dem Temperaturanstieg die Flüchtigkeit der Schadstoffe erhöht, kann so der Massenaustrag im Vergleich zur normalen (kalten) Air-Sparging-Anwendung mit Betrieb einer Bodenluftabsaugung vervielfacht und die Sanierungszeit erheblich verkürzt. Die Technologie stellt die Erweiterung der Dampf-Luft-Injektion in die ungesättigte Zone (TUBA) der Arbeiten von Färber (1997) und
4 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 4 Betz (1998), sowie Schmid (2001) dar. Schmid (2001) hatte bereits die Injektion in die gesättigte Zone experimentell in wenigen kleinskaligen Versuchen untersucht. Großskalige Versuche, die technische Umsetzung, der Nachweis der Anwendbarkeit in der Praxis und finanzielle Aspekte waren hierbei jedoch noch weitgehend offen geblieben. Abbildung 3: Prinzipskizze der simultanen Sanierung der gesättigten und ungesättigten Zone über subtsve Vorgehensweise Sanierungsverfahren Alkoholspülung (CSF) Die Weiterentwicklung der Alkoholspülung erfolgte anhand von zwei der insgesamt vier am Projekt beteiligten Industriestandorte. Zur Optimierung der Prozessparameter wurden zunächst Säulenversuche durchgeführt, wobei sowohl das Untergrundmaterial als auch der jeweilige Schadstoffcocktail der Industriestandorte zum Einsatz kam. Auf den Ergebnissen der Säulenversuche aufbauend wurden Untersuchungen zur Stabilität der Alkoholfahne in Abhängigkeit der aufwärtsgerichteten Abstandsgeschwindigkeit des Alkohols in einer Küvette durchgeführt. Neben der Stabilitätsuntersuchung wurde die Sanierungseffektivität der Alkoholspülung unter den testfeldspezifischen Bedingungen (Untergrundmaterial und Schadstoffcocktail) im Rahmen eines in der Küvette durchgeführten Experimentes bestimmt. Zur Bestimmung der Sanierungseffektivität der Alkoholspülung unter realitätsnahen Testfeldbedingungen wurden zwei Sanierungsexperimente in einem der großen VEGAS-
5 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 5 Container (Länge: 9 m, Breite: 6 m, Höhe: 4,5 m) durchgeführt. Das erste Experiment, die Kombination aus Alkoholspülung und Dampf-Luft-Injektion diente der Behandlung eines Schadenfalls mit Kontamination der gesättigten und ungesättigten Zone. Im zweiten, reinen CSF-Experiment wurde das Augenmerk auf die Sanierung einer Kontamination in der gesättigten Zone einzig unter Einsatz von Alkohol gelegt. Auf der Basis der Ergebnisse dieser Versuche wurde eine Wirtschaftlichkeitsstudie durchgeführt. Sanierungsverfahren Dampf-Luft-Injektion (TSVE) Die Entwicklung der Sanierungstechnologie zur simultanen Sanierung der gesättigten und ungesättigten Zone erfolgte basierend auf zwei industriellen Feldstandorten (site 3 und site 4). Nach Datensichtung wurden in einem ersten Schritt die Standortverhältnisse zusammengefasst. Nach der experimentellen Bestimmung der relevanten Bodenparameter der Feldstandorte zur Anwendung von TSVE (spezifische Wärmekapazität, Permeabilität) in Säulenversuchen, erfolgte die Bestimmung der Sanierungseffizienz bei Injektion von Sattdampf in die gesättigte Zone (SubTSVE) in 2-D Küvettenexperimenten unter Bezug auf die vorliegenden Kontaminationen an den Industriestandorten. Zur Übertragung der Ergebnisse der Laboruntersuchungen und des entwickelten Verfahrens auf die Feldstandorte wurden Pilotuntersuchungen in einem VEGAS Großbehälter mit natürlichem Bodenmaterial vom Standort durchgeführt. Durch die Weiterentwicklung der Sanierungstechnik zur Dampfinjektion in die gesättigte Zone (SubTSVE) unter Berücksichtigung der Bedingungen an den Feldstandorten wurde die Sanierungstechnologie zur Anwendungsreife gebracht. Abschließend erfolgte die Planung mit Kostenschätzung der Sanierung von zwei Feldstandorten mit SubTSVE. Ergebnisse Die Ergebnisse der Standortcharakterisierung sind nachfolgend zusammengefasst. Tabelle 1: Charakterisierung der Feldstandorte site 3 site 4 Kontamination und räumliche Ausbreitung BTEX: Kernbereich: m² bis 10 m Tiefe, Umgebung: m² bis 5 m Tiefe BTEX, CKW: m² bis 10 m Tiefe mit BTEX, bis 27 m Tiefe mit CKW Schadstoffkonzentrationen KW BTEX BTEX CKW Grundwasser (mg/m³) Ø 7800, max Ø 6111, max Ø 15700, max Ø 1160, max Bodenluft (mg/m³) n.b. Ø 21, max. 120 Ø 250 Ø 160 gesättigte Bodenzone (mg/kg) Ø 433, max Ø 3,28, max. 15 Ø 170,max. 700 n.b. ungesättigte Bodenzone (mg/kg)
6 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 6 Ø 391, max. 637 Ø 1850, max oberflächennahe hochkontaminierte ungesättigte Bodenzone ausgekoffert. Geologie Rheintal: Rheintal: Holozäner Lehm: 0-4,5 m u. GOK Niederterrasse (4,5-12,5 m u. GOK): Mittelsand Unt. Mittelterrasse (12,5-30 m u. GOK): Fein-, Mittelsand (kiesig) Rinnenschotter (30-37 m u. GOK): Grobkies (sandig) Tertiärer Aquiclude (> 37 m u. GOK): sandiger Schluff, Ton Holozäner Lehm: 0-4,5 m u. GOK Niederterrasse(4,5 14 m. u. GOK): Grobsand, unterliegend Feinsand Unt.Mittelterrasse (14-18,5 m u. GOK): Fein-, Mittelsand (lehmig) Obere Mittelterrasse (18,5-21 m u. GOK): Feinkies (sandig) Hauptterrasse (21-28 m u. GOK): Grobkies mit Feinsand Tertiärer Aquiclude (> 28 m u. GOK): sandiger Schluff, Ton Hydrologie System direkt an Rhein gekoppelt System effluent zum Rhein Flurabstand: 8 m ± 2 m Schwankung Flurabstand: 6,3 m ± 1,5 m Schwankung effluent in Rhein bei Niedrigwasser, parallel zu Grundwasserfließgeschwindigkeit: 0,3 m/d Rhein bei Mittelwasser, diffluent aus Rhein bei Hochwasser, Grundwasserfließgeschwindigkeit: Mittelwasser: 0,43 m/d, Niedrigwasser: 0,2 m/d, Hochwasser: bis 0,9 m/d Beide Standorte sind im Bereich der gesättigten und ungesättigten Zone mit BTEX und höhersiedenden Aromaten kontaminiert. In den Laboruntersuchungen wurden die sanierungsrelevanten Bodenkenngrößen ermittelt.
7 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 7 Sanierungsverfahren Alkoholspülung Säulenversuche Die Säulenversuche wurden mit dem Untergrundmaterial (Abb. 4) als auch dem Schadstoffcocktail des jeweiligen Industriestandortes durchgeführt. Abbildung 4:: Sieblinie der verwendeten Säulenmaterialien Das mit dem Schadstoffcocktail residual gesättigte Säulenmaterial wurde von unten nach oben mit einer Alkoholmischung der Zusammensetzung 60 Vol.-% Isopropanol und 40 Vol.-% Wasser gespült (Abb. 5). Nach Injektion von drei Porenvolumen der Alkoholmischung wurden laut Analyse der Auslaufproben rund 75 % des eingebrachten Schadstoffs aus der Säule ausgetragen (Abb. 6). Die Analyse des Säulenmaterials im Anschluss an die Alkohol- bzw. Wasserspülung ergab einen Restgehalt an Schadstoff von rund 0,1% sowie einen Restgehalt an Isopropanol von unter 1 %.
8 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 8 Abbildung 5: Foto des Säulenversuchsstandes Abbildung 6: Verlauf der kumulativen Austragsrate in Abhängigkeit vom injizierten Porenvolumen der Alkoholmischung (Alkoholcocktail)
9 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 9 Zu Beginn der Alkoholspülung setzten sich die Proben am Säulenauslauf aus zwei Phasen zusammen - einer wässrigen und einer organischen Phase. Die Dichte der wässrigen Phase lag im Bereich der Dichte von Wasser, während die Dichte der organischen Phase annähernd der des Schadstoffs entsprach (Abb. 7). Abbildung 7: Dichteänderung der Auslaufproben in Abhängigkeit vom injizierten Porenvolumen an Alkoholmischung Aufgrund der zwei Flüssigphasen am Säulenauslauf ist davon auszugehen, dass in der Anfangsphase des Versuchs nur ein geringer Alkoholanteil in die Schadstoffphase partitionierte und der Schadstoff dementsprechend hauptsächlich durch Mobilisierung und in einem nur untergeordnetem Maße durch Solubilisierung aus der Säule ausgetragen wurde. Im weiteren Verlauf der Alkoholspülung ging ein zunehmender Anteil der Alkoholmischung in die Schadstoffphase über, so dass ab der Injektion von zwei Porenvolumen Alkoholmischung der Säulenauslauf nur noch aus einer Flüssigphase (Mischung aus Alkoholen und Schadstoff) bestand. In dieser Versuchsphase wurde der Schadstoff also ausschließlich infolge von Solubilisierung aus der Säule entfernt. Nach Injektion von drei Porenvolumina Alkoholmischung wurde das Säulenmaterial mit Wasser gespült. Der zunehmende Wassergehalt führte zu einem Wiederanstieg der Dichte am Säulenauslauf. Küvettenexperimente Für die Anwendung der Alkoholspülung im Feldmaßstab ist ein hydraulisch kontrollierbares Strömungsfeld von essentieller Bedeutung. Die hydraulische Stabilität der Alkoholspülung während des nach oben gerichteten Spülprozesses hängt von unterschiedlichen Parametern wie z.b. der Dichte und Viskosität der Sanierungslösung sowie der Porenraumverteilung des Grundwasserleiters ab. Zudem spielt die mittlere Abstandsgeschwindigkeit der
10 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 10 Sanierungslösung im Untergrund eine entscheidende Rolle. Der Einfluss der Abstandsgeschwindigkeit der Sanierungslösung auf die Stabilität des Fließfeldes wurde unter Nachbildung der Standortbedingungen Testfeld 3 (site 3) untersucht. Dazu wurde eine Küvette (Höhe: 0,60 m, Länge: 1,40 m, Breite: 0,08 m) so homogen wie möglich mit dem Aquifermaterial vom Testfeld gefüllt (HOFSTEE et al. 1998) und mittels zweier Horizontalbrunnen vertikal mit der Alkohol-Sanierungslösung durchströmt. Zur Visualisierung der Strömungsprozesse wurde ein fluoreszierender Tracer der infiltrierten Alkohollösung zugegeben (Uranin). Extraktionsbrunnen Probenahmestellen mit integrierten Lichtleiterfluorometern Injektionsbrunnen Pumpe Abbildung 8: Foto des Küvettenversuchsstandes mit kontinuierlicher Fluoreszensmessung Die mittlere Abstandsgeschwindigkeit der aufwärts gerichteten Strömung betrug in einem Fall 0,7 m/d und im anderen Fall 5 m/d. Wie man anhand der Abbildung 9 erkennen kann, traten während des Durchströmungsversuchs mit der geringeren Abstandsgeschwindigkeit Strömungsinstabilitäten auf, wohingegen dies bei der höheren Fließgeschwindigkeit nicht der Fall war.
11 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 11 Abbildung 9: Vorderansicht der Küvette während des Durchströmungsversuchs mit einer Abstandsgeschwindigkeit von 0,7 m/d (links, Durchströmungsdauer: 480 min) und 5,0 m/d (rechts, Durchströmungsdauer: 120 min) Die Destabilisierung des Fließfeldes ist auf eine dichteinduzierte Migration sowohl der Sanierungslösung als auch des Porenwassers zurückzuführen: Bedingt durch die geringe Dichte der Sanierungslösung von 0,88 kg/l migriert diese nach oben während das schwerere Wasser nach unten sinkt. Im Gegensatz zu den Dichteeffekten wirken sich die unterschiedlichen Viskositäten der beiden Fluide stabilisierend auf das Fließfeld aus (Kueper & Frind, 1988). Die Ausbildung von bevorzugten Fließwegen während des Durchströmungsversuchs mit der Abstandsgeschwindigkeit von 0,7 m/d weist auf eine Dominanz der Dichteeffekte hin. Mit zunehmender Filtergeschwindigkeit gewinnen die Viskositätseffekte an Bedeutung bis sie schließlich die Dichteeffekte kompensieren und sich ein stabiles Fließfeld ausbildet. Die während des zweiten Durchströmungsversuchs beobachtete stabile Alkoholfahne (Abb. 9, rechts) deutet darauf hin, dass dies bei der gewählten mittleren Abstandsgeschwindigkeit von 5 m/d der Fall war. Im Anschluss an die Stabilitätsstudie wurde die Sanierungseffizienz des Verfahrens getestet. Hierzu wurde das Einbaumaterial der Rinne mit 219,61 g des Testfeld 3 -spezifischen Schadstoffcocktails (44 % m-/p-xylol (m/m), 35 % 1, 2, 4 Trimethylbenzol, 13 % o-xylol, 4 % 1, 3, 5 Trimethylbenzol, 2 % Ethylbenzol and 2 % Toluol) kontaminiert. Die Sanierungslösung wurde dann in die Rinne injiziert, die mittlere Abstandsgeschwindigkeit der nach oben gerichteten Strömung betrug 2,1 m/d. Der kumulative Schadstoff-Austrag aus der Rinne während der Alkoholspülung ist in Abb. 10 als Funktion des durchströmten Porenvolumens dargestellt Austrag [%] ,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 Porenvolumen [-] Schadstoff Isopropanol Abbildung 10: Kumulativer Schadstoff- und Isopropanol-Austrag als Funktion des durchströmten Porenvolumens
12 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 12 Die Analysen der Auslaufproben ergaben einen kumulativen Austrag des Schadstoffcocktails von 182,02 g, bezogen auf die eingesetzte Schadstoffmenge von 219,61 g entspricht das einer Extraktionsrate von 82,88 % (Abb. 10). Die Analyse der Bodenproben, die im Anschluss an die Alkoholspülung über die gesamte Rinne verteilt genommen wurden, zeigte eine verhältnismäßig heterogene Schadstoffverteilung zwischen 0,5 mg und 542,8 mg Schadstoffcocktail pro Kilogramm Trockensubstanz. Über alle Bodenproben gemittelt betrug die Schadstoffkonzentration 73,11 mg Schadstoffcocktail pro Kilogramm Trockensubstanz. Unter Berücksichtigung der Trockenmasse des gesamten eingebauten Bodens von 116,86 kg entspricht dies einer Restschadstoffmasse von 8,54 g. Daraus ergibt sich eine Sanierungseffizienz von 96,11 %. Die Diskrepanz zwischen der Extraktionsrate und der Sanierungseffizienz ist auf Verdunstungsverluste während der Probennahme und Probenvorbereitung sowie auf eine analytische Bestimmungsgenauigkeit von 95 % zurückzuführen. Unter Einbeziehung der Verdunstungsverluste sowie der Bestimmungsgenauigkeit liegt die erzielte Sanierungseffizienz bei ca. 90 %. Großbehälterexperimente Basierend auf den positiven Ergebnissen der Laboruntersuchungen wurde ein Konzept zur kombinierten Sanierung der gesättigten und ungesättigten Bodenzone im Pilotmaßstab entwickelt. Hierzu wurde in einen VEGAS-Großbehälter mit den Innenmaßen 5,8 m x 2,9 m x 4,2 m (L x B x H) natürliches Bodenmaterial vom Testfeld 3 eingebracht. Beginn der Containerbefüllung Einbau der Feinsandlinse Einbau der Vertikalbrunnen Einbau der Temperaturfühler Einbau der Grundwasserdrainage Abschließende Feinsandschicht Abbildung 11: Befüllung des Großbehälters
13 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 13 Im unteren Bereich des Behälters wurde eine Feinsandlinse eingebaut (Abb. 12). Der Grundwasserspiegel wurde über einen am Rand umlaufend eingebauten Kiesfilter (30 cm Dicke) konstant gehalten. Über 80 im gesättigten Bereich des Behälters integrierte Probenahmestellen konnte die Änderung der Grundwasserzusammensetzung während des Sanierungsexperimentes verfolgt werden. Die im unteren Bereich des Behälters eingebauten drei Horizontalbrunnen (4 ) dienten der Injektion der Alkoholmischung bzw. von Frischwasser (Abb. 11). Während der Alkoholspülung erfolgt die hydraulische Sicherung über vier vollverfilterte Extraktionsbrunnen (Abb. 12). Über zwei Multilevel-Extraktionsbrunnen im Zentrum des Containers erfolgte die Extraktion der kontaminierten Sanierungslösung. Im zweiten Schritt des Sanierungsexperiments wurde neben der Grundwasserentnahme Bodenluft aus den vier Extraktionsbrunnen abgesaugt. Es wurde eine Dampf-Luft-Mischung unterhalb des Wasserspiegels, oberhalb der Feinsandlinse injiziert. Die verbliebenen Schadstoffe sollten aus der gesättigten Zone und der nicht durch die Alkoholspülung erfassten Schadstoffe aus dem Grundwasserwechselbereich und der ungesättigten Zone extrahiert werden (Abb. 13). Vor der Durchführung des Sanierungsexperimentes wurde der Schadstoffcocktail über Injektionslanzen in der ungesättigten und gesättigten Zone bei abgesenktem Wasserspiegel eingebaut und über Anheben des Wasserspiegels im Grundwasserwechselbereich verteilt. Abbildung 12: Prinzipskizze Schritt 1 zur großskaligen Anwendung der Alkoholspülung (Kombination CSF-TSVE)
14 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 14 Abbildung 13: Prinzipskizze Schritt 2 zur großskaligen Anwendung der Alkoholspülung (Kombination CSF-TSVE) Durch die 72-stündige Alkoholspülung konnten nur ca. 30 % des eingesetzten Schadstoffs entfernt werden (Abb. 12). Mehr als 97 % der injizierten Isopropanol-Masse (3311 kg) wurden während der Alkoholspülung bzw. der anschließenden dreitägigen Wasserspülung extrahiert, ca. 67 % des extrahierten Alkohols wurden recycelt. Etwa 33% des eingesetzten Isopropanols wurden über eine aerobe biologische Abwasseraufbereitung aufbereitet. Die beobachtete geringe Sanierungsleistung beruhte im Wesentlichen auf einem Ausfall der Isopropanol-Dosierpume. Dadurch wurde über einem Zeitraum von zwölf bis vierundzwanzig Stunden nach Begin der Alkoholinjektion stark verdünnter Alkohol in den Aquifer injiziert. Nach erfolgtem Austausch der defekten Pumpe stieg der Isopropanol-Gehalt in der injizierten Alkoholmischung zwar wieder an, die Ausgangskonzentration konnte jedoch aufgrund kontinuierlich fortschreitender Verdünnung nicht wieder erreicht werden.
15 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 15 Massenbilanz Isopropanol [%] Porenvolumen [-] Zugabe IPA Wasserspülung Schadstoffaustrag [%] Isopropanol Toluol o-xylol Ethylbenzol m-p-xylol 1,2,4- Trimethylbenzol Zeit [h] 0 1,3,5- Trimethylbenzol Schadstoffmischung Abbildung 14: Schadstoffaustrag und Wiedergewinnung von Isopropanol während Schritt 1 des Sanierungsexperiments Mit Einsatz der Dampf-Luft-Injektion konnte der Massenaustrag an Schadstoffen gesteigert werden und nach Ende der thermischen Sanierungsphase (3 Tage) ergab sich nachfolgend dargestellte hohe Sanierungsleistung von ca. 96%. Tabelle 2: Zusammenstellung des Schadstoffaustrags (LNAPL) im kombinierten Sanierungsexperiment Gesamtaustrag LNAPL Kombiniertes Sanierungsexperiment LNAPL als organische Phase LNAPL als Kondensat (BLA) Wässrig gelöster LNAPL Adsorbiert auf Luftaktivkohle Bodenproben nach Sanierung Austrag über Co-Solvent Flooding Austrag über Dampf-Injektion Gesamtaustrag CSF TSVE Alkohol- Dampf-Luft- spülung Injektion <0.1% 3.1% - 8.5% < 0.1% 0.4% 17.2% 66.3% < 0.1% 17.2% % 95.5% Zur Überprüfung des aus den Küvettenversuchen erwarteten hohen Reinigungspotentials der Alkoholspülung wurde in einem zweiten Sanierungsexperiment der Schadstoff gezielt in die gesättigte Zone infiltriert. Das Strömungsregime wurde unter Einsatz eines dreidimensionalen numerischen Modells (Modflow) des Behälters simuliert und die hydraulische Sanierung mit Einsatz einer 60%-igen Isopropanol-Lösung ausgelegt (Abb. 15).
16 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 16 Mit einer Gesamtentnahme von 200 l/h aus zwei ehemaligen Dampfinjektionsbrunnen (mittlerer Injektionsfilter) und Zugabe der Alkohollösung über den mittleren, unteren Horizontalbrunnen (160 l/h) konnte eine hydraulisch gesicherte Alkoholspülung durchgeführt werden. Abbildung 15: Numerische Simulation des Strömungsfelds und der Isopropanolkonzentrationen während der Sanierung der kontaminierten gesättigten Zone Über Gewährleistung einer Mindestkonzentration von 150 g/l Isopropanol in den Entnahmebrunnen (Zugabekonzentration zwischen g/l) konnte die gesättigte Zone innerhalb von 2 Tagen mittels Alkoholspülung gereinigt werden. Insgesamt wurden über 88% der infiltrierten Schadstoffmasse entfernt. Über die Nachspülphase mit einer Dauer von ca. 10 Tagen konnte die gesamte Spülmenge an Isopropanol wieder gewonnen werden.
17 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 17 Schadstoffkonzentration [mg/l] Alkoholspülung Wasserspülung Massenbilanz Schadstoffaustrag [%] Sanierungsdauer [h] Schadstoffkonzentration (LNAPL) [mg/l] Schadstoffaustrag [%] Abbildung 16: Schadstoffkonzentrationen und austrag während der Alkoholspülung im Großbehälter (CSF in gesättigter Zone) Im Rahmen einer zusätzlichen Untersuchung zur Sanierung eines Carbondisulfid- Grundwasserschadens (CS 2 ) in England konnte der Vorteil von CSF, der Behandlung und Extraktion eines DNAPL sowohl hydraulisch als auch monetär untersucht werden (Weber et. al., 2003). Der Standorteigner war einer der Industriepartner aus dem PURE-Projekt. Die dabei anzusetzenden Alkoholmengen und deren Aufbereitung entstammen den Untersuchungen im Rahmen des PURE-Projekts. Gesondert untersucht wurde in Küvettenexperimenten der zu erwartende Schadstoffaustrag. Untere Einbeziehung der Ergebnisse aus Küvetten- und Großbehälterversuchen wurden die Sanierungskosten im Vergleich zur hydraulischen Sanierung für den Standort in England bestimmt. Es zeigte sich ein leichter finanzieller Vorteil der klassischen hydraulischen Sanierung gegenüber CSF. Aufgrund der Kostenstruktur bedarf der Einsatz von CSF eines hohen Anteils an Investitionskosten, die vor der Sanierung innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit aufgebracht werden müssen. Der vergleichbar hohe Anteil an Betriebskosten während einer klassischen hydraulischen Sanierung, bedingt durch die lange Sanierungszeit, wirkt sich unter dem Aspekt der Bereitstellung von Finanzmitteln positiv für die klassische Sanierungstechnologie aus.
18 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 18 CSF vs. hydraulische Sanierung Kostenschätzung test-site UK : CSF: ~ 225 /m³ Boden Pump & Treat : ~ 200 /m³ 22% 64% 21% 43% 14% 37% Investitionskosten Betriebskosten Verbrauchskosten Abbildung 16: Kostenvergleich Co-Solvent-Flooding gegenüber hydraulischer Sanierung für einen CS 2 -Schadensfall in England
19 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 19 Sanierungsverfahren Dampf-Luft-Injektion Die grundlegenden, zur Anwendung einer Dampf-Luft-Injektion bestimmbaren Bodenkennwerte wurden bestimmt und sind in Tabelle 3 zusammengefasst. Tabelle 3: Bodenkennwerte des Bodens von den Industriestandorten site 3 site 4 Teufe Schüttdichte c p Boden Porosität Hydr. d 50 (m u. GOK) (kg/m³) trocken (kj/kg x K) (-) Leitfähigkeit (x 10-4 m/s) (mm) ,32 1,6 0,39 0, ,30 1,9 0, ,25 0,8 0, ,94 0,31 1,0 0, ,30 1,9 0,99 Küvettenexperimente Die Untersuchungen im 2-D Maßstab (Küvettenexperimente) zeigten die Eignung zur Sanierung der kapillar- und der wassergesättigten Zone über die Injektion von Sattdampf in die gesättigte Zone für das eingesetzte Bodenmaterial von den Feldstandorten auf. Abbildung 17: Versuchsbedingungen während den Küvettenexperimenten
20 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 20 Das Verhalten der Dampfausbreitung bei Injektion von Sattdampf in die wassergesättigten Zone lässt sich zusammenfassen: Abbildung 18: Mechanismus der Dampfausbreitung in den Küvettenexperimenten Die nachfolgenden Darstellungen der im Verlauf der Experimente gemessenen Temperaturen verdeutlichen dies.
21 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 21 Abbildung 19: Vergleich der Wärmeausbreitung bei Injektion von Sattdampf in die gesättigte Zone (links) und in den Kapillarsaum (rechts) Insgesamt konnte ein verstärkter Austrag an Schadstoffen bei Einsatz der Dampfinjektion unterhalb des Wasserspiegels (SubTSVE) im Vergleich zum Austrag bei Injektion in den Kapillarsaum (TSVE) festgestellt werden.
22 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 22 Abbildung 20: Vergleich der erzielten Sanierungseffizienz bei Einsatz von SubTSVE und TSVE Während den Sanierungsexperimenten wurde der größte Anteil an Schadstoffen als organische Phase, aufschwimmend auf dem Wasserspiegel entfernt. Zur Vermeidung der Kondensation von gasförmigem Schadstoff im kalten Boden und Grundwasser wurde die Technologie um den Einsatz von Luft, entsprechend Färber, A., Betz, C. und Schmidt, R. ( ) erweitert. Die Technik der Dampf-Luft-Injektion unterhalb des Wasserspiegels wurde in den Großbehälterversuchen umgesetzt. Hierzu wurde in einen VEGAS-Großbehälter mit den Innenmaßen 5,8 m x 2,9 m x 4,1 m (L x B x H) natürliches Bodenmaterial von site 3 eingebracht. Im unteren Bereich des Behälters wurde eine Feinsandlinse eingebaut (Abb. 21). Der Grundwasserspiegel konnte über einen am Rand umlaufend eingebauten Kiesfilter (30 cm Dicke) konstant gehalten werden. Insgesamt 120 in der gesättigten und ungesättigten Zone installierte Temperaturfühler dienten zur Bestimmung der Temperaturverteilung im Großbehälter. Vier vollverfilterte Extraktionsbrunnen (5 ) wurden während der Sanierung als Extraktionspegel für die Bodenluft und das Grundwasser eingesetzt. Über höhenverstellbare, wassergekühlte Lanzen konnte im Bedarfsfall an den Extraktionsbrunnen aufschwimmende organische Phase abgezogen werden. Die Injektion des Dampfes (Abb. 21) erfolgte wahlweise über einen der drei verfilterten Bereiche der beiden Dampfinjektionspegel (4 ).
23 VEGAS Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 23 Abbildung 21: Prinzip der Dampf-Luft-Injektion in das Grundwasser (subtsve) In einem Wärmeexperiment wurde die Reichweite der Ausbreitung der Wärmefront untersucht. Die Ausbreitung erfolgte ähnlich den Experimenten im 2-D Maßstab. Bereits nach 17 Stunden Dampfinjektion erreichte die Dampffront die Extraktionsbrunnen. Zu diesem Zeitpunkt lag der Radius der Dampffront um die Injektionsbrunnen bei ca. 0,7 m (Abb. 22). Die nachfolgende Erhöhung der Dampfrate führte zu einer gleichmäßigen Ausbreitung des Dampfes in der gesättigten und ungesättigten Zone. Nach ca. 200 Stunden lag der Radius der Wärmefront auf Höhe des Grundwasserspiegels bei ca. 1 m. Die Injektion erfolgte ca. 1.7 m unterhalb des Wasserspiegels. Die Ausbreitung in der wassergesättigten Zone zeigt eine steile vertikale Wärmefront. E3 I2 I1 E1 E3 I2 I1 E1 E4 E2 E4 E2 Depth [cm] X Z Y Depth [cm] X Z Y Length [cm] Width [cm] Length [cm] Width [cm] 250 Abbildung 22: Wärmeausbreitung wahrend der Dampfinjektion im Pilotmaßstab (SubTSVE)
24 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 24 Im anschließenden Sanierungsexperiment wurden ca. 20 kg einer TEX-Mesitylen-Mischung entsprechend der Kontamination von site 3 im Grundwasserwechselbereich zwischen 2,5 und 3,5 m Höhe infiltriert und der Wasserspiegel auf 3 m Höhe eingestellt. Nach ca. 24 h Wartezeit wurde die Bodenluftabsaugung gestartet und anschließend der Dampf (30 kg/h) gemischt mit der Luft (15 kg/h) injiziert. Die Behandlung der Bodenluft erfolgte über Kondensation der heißen Bodenluft mit anschließender Phasenabscheidung. Dem kalten Luftstrom (20 C) wurde Fremdluft beigemischt (Abluftkonzentration maximal 0,1 x UEG). Die Konzentrationen wurden mit einem GC-PID gemessen. Die Abreinigung der Abluft erfolgte nach dem Verdichter über Aktivkohle. Während der Versuchsdurchführung konnte an den Extraktionsbrunnen keine organische Phase festgestellt und vom Grundwasserspiegel entnommen werden. Die Ausbreitung der Dampffront während des Sanierungsexperiments entsprach derjenigen des Wärmeexperiments. Es konnte ein Massenaustrag der leichtflüchtigen Komponenten TEX von über 98% der infiltrierten Masse festgestellt werden, der Mesitylenaustrag lag bei ca. 93%. Der Austrag erfolgte zu über 98% über die Bodenluftabsaugung mit einem Anteil von ca. 10 % als kondensierbare flüssige Schadstoffphase. In der abschließenden Bodenuntersuchung mittels Rammkernsondierung im Bereich der initialen Kontamination konnte kein Schadstoff nachgewiesen werden Dampfdurchbruch Ethylbenzol, m-,p-xylol 100.0% 87.5% 3.0 Massenaustrag (%) 75.0% concentration (g/m³) thermisch unterstütztes Air Sparging 62.5% 50.0% 37.5% extracted mass (%) 1.0 Trimethylbenzol 25.0% % Toluol time (h) o-xylol Abbildung 23: Schadstoffkonzentration der Bodenluftabsaugung nach dem Kondensator 0.0% Die Austragskurve der Bodenluft zeigt eine signifikante Erhöhung der Konzentrationen nach dem Durchbruch der Wärmefront (14 h, Abb. 23). Jede weitere Erhöhung der Dampfrate mit Verringerung der Luftinjektionsrate zur weitergehenden Erwärmung des Bodens führte, teilweise kurzfristig, zu einer weiteren Konzentrationserhöhung bei abklingenden Austragsraten.
25 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 25 Zu Sanierungsende (ca. 50 h) lagen die Bodenluftkonzentrationen des TEX-Anteils kleiner 1 mg/nm³, die des Mesitylen um 5 mg/nm³. Aufbauend auf den Ergebnissen zur Dampf- und Wärmeausbreitung erfolgte die Planung und Kostenschätzung der Sanierung für beide Feldstandorte unter dem Ansatz einer gleichförmigen linearen Ausbreitung der Dampffront. Die Planung umfasste die Bestimmung der erforderlichen Injektions- und Extraktionsraten, die Bestimmung der Lage und des Ausbaus der erforderlichen Brunnen, die Auslegung der erforderlichen Anlagentechnik, sowie der Spezifikation des Sanierungsablaufs. Entsprechend der Größe und der Lage der Kontamination an den Standorten "site 4" ("site 3") sind 19 (37) Dampf-Luft-Injektionsbrunnen, sowie 34 (50) Entnahmebrunnen erforderlich. Die Injektionsleistung liegt bei 250 kw (1.250 kw), die Bodenluftabsaugrate liegt bei Nm³/h (1.900 Nm³/h). Die Sanierungszeit errechnete sich zu 10 Monaten (15 Monaten). Die Gesamtkosten der Sanierung wurden unter marktüblichen Gesichtpunkten abgeschätzt. Je nach Standort lagen diese zwischen 50 /m³ (site 3) und 120 /m³ (site 4) behandelten Bodens. Auf site 4 erfolgte eine Sanierung mittels Air-Sparging, kombiniert mit einer Bodenluftabsaugung und einer Grundwasserhaltung. Unter dem Ansatz einer konstant hohen jährlichen Austragsrate und einer jährlichen biologischen Abbaurate von kg Schadstoff (2002) würde die Sanierung weitere fünf Jahre dauern. Zur Aufrechterhaltung der hohen Sanierungsleistungen müssten 10 weitere Luftinjektionsbrunnen und 15 weitere Extraktionsbrunnen installiert werden. Sowohl das geförderte Grundwasser, als auch die Bodenluft würden über Aktivkohle gereinigt. Die technische Ausstattung und die Kostenkalkulation wurden durch ein Ingenieurbüro, dem Projektpartner VHE für den Britischen Markt verifiziert. Die Kosten für den Betrieb dieser Sanierungsmethode wurden mit der Dampf-Luft-Injektionstechnik verglichen (Abb. 24). Durch Einsatz der Dampf-Luft-Injektion könnten die Sanierungskosten um ca. 30% gesenkt werden und lägen um 120 /m³ behandelten Bodens. Abbildung 24: Vergleich der Sanierungskosten für site 4 Zusammenfassung Im Rahmen des EU-Forschungsprojektes PURE wurde die In-situ-Sanierungstechnologie Dampf-Luft-Injektion zur simultanen Sanierung der gesättigten und ungesättigten Bodenzone
26 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 26 von organischen Kontaminationen weiterentwickelt und im Rahmen von naturnahen Technikumsversuchen erfolgreich getestet. Die Sanierung von zwei Standorten der Industriepartner wurde geplant und die Kosten ermittelt (Kostenschätzung). Ein Vergleich mit dem an einem der Standorte eingesetzten Standardsanierungsverfahren zeigte deutlich geringere Kosten für die Dampf-Luft unterstützte Sanierung auf. Die Berechnung der Dampffrontausbreitung in der gesättigten Zone erfolgte unter dem vereinfachten Ansatz eines linearen Zusammenhangs zwischen dem Ausbreitungsradius und dem Abstand zwischen Injektionstiefe und Grundwasserspiegel. Zudem wurde ein logarithmischer Zusammenhang zwischen Dampfinjektionsrate und dem Radius der Dampfausbreitung angesetzt. Die Bestimmung der Dampfausbreitung soll im Rahmen zukünftiger Projekte über numerische Methoden erfolgen. Für den Einsatz der In-situ-Sanierungstechnologie CSF (Co-solvent Flooding, Alkohol-Flooding) machten die Untersuchungen deutlich, dass beim Einsatz dieser Technologie die genaue Einhaltung der erforderlichen, optimalen Verhältnisse der Alkohole, bzw. des Mischungsverhältnisses mit Wasser ein Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz ist. Eine genaue Kenntnis der hydraulischen Bedingungen und der Schadstoffverteilung am Standort ist eine weitere Voraussetzung für eine hydraulische Dimensionierung der Maßnahme anhand numerischer Modelle. Ist das System hydraulisch kontrollierbar, so kann eine vollständige Sanierung der gesättigten Zone erreicht werden. Während für das In-situ-Verfahren der Dampf-Luft-Injektion zwischenzeitlich erfolgreiche Pilotvorhaben vorliegen, steht der Nachweis der Einsatzfähigkeit und Praxistauglichkeit der Alkoholspülung (CSF) im Rahmen eines Pilotvorhabens noch aus. Danksagung Die Forschungsarbeiten wurden im Rahmen von Framework 5 durch die EU mit der Fördernummer EVK1-CT finanziell und personell unterstützt. Literaturhinweise Färber, A. (1997): Wärmetransport in der ungesättigten Bodenzone: Entwicklung einer thermischen In-situ-Sanierungstechnologie. Mitteilungsheft Nr. 096, (Promotionsschrift) Institut für Wasserbau, Universität Stuttgart, ISBN: Betz, C. (1998): Wasserdampfdestillation von Schadstoffen im porösen Medium: Entwicklung einer thermischen In-situ-Sanierungstechnologie. Mitteilungsheft Nr. 097, (Promotionsschrift) Institut für Wasserbau, Universität Stuttgart, ISBN: Schmid, R. (2001): Wasserdampf- und Heißluftinjektion zur thermischen Sanierung kontaminierter Standorte. Mitteilungsheft Nr. 106, (Promotionsschrift) Institut für Wasserbau, Universität Stuttgart, ISBN: , Trötschler, O.; Hofstee, C.; & Koschitzky, H.-P. (2001): Kombination von Dampfinjektion und Alkoholspülung zur Entfernung von organischen Kontaminationen in der gesättigten und ungesättigten Bodenzone. - Vorträge zum VEGAS Statuskolloquium am 12. Oktober 2001, Stuttgart.
27 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Seite 27 Trötschler, O.; Färber, A.; Weber, K.; Haslwimmer, T. & Koschitzky, H.-P. (2003): Development and technical implementation of the thermally enhanced soil vapour extraction using steam injection for the saturated and unsaturated zone. pp in: Proceedings of Consoil 2003, May 16 18, 2003, Gent, Belgium. Gudjberg, J., Trötschler O., Färber, A., Sonnenborg, T.O. and Jensen, K.H. (2003): Unphysical behavior during numerical simulation of steam injection into water saturated soil. Journal of Contaminant Hydrology 75 (2004) Trötschler, O., Färber, A., Koschitzky, H.-P.,. (2003): Wasserdampf-Luftinjektion im Grundwasser zur Extraktion von organischen Schadstoffen, Symposium Ressource Fläche und VEGAS-Statuskolloquium 2003, pp , Eds. Schrenk, Batereau, Barczewski, Weber, Koschitzky, Heft 124, Institut für Wasserbau, Universität Stuttgart Kueper, BH and Frind, EO (1988): An overview of immiscible fingering in porous media. Journal of Contaminant Hydrology, Vol. 2, No. 2, pp Weber, K., Trötschler, O., Koschitzky, H.-P. (2003): Investigation of Remediation Options for a CS2-Contaminated Aquifer Applying Alcohol Flushing. Technical Report 03/09(VEG03), Institut für Wasserbau, Universität Stuttgart. Ansprechpartner Dr.-Ing. Hans-Peter Koschitzky (Projektleiter) Dipl. Ing. (FH) Oliver Trötschler Dr. rer. nat. Karolin Weber
VEGAS Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung
 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung VEGAS Institut für Wasserbau Universität Stuttgart Pfaffenwaldring 61 D-70550 Stuttgart
Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung VEGAS Institut für Wasserbau Universität Stuttgart Pfaffenwaldring 61 D-70550 Stuttgart
VEGAS Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung
 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung VEGAS Institut für Wasserbau Universität Stuttgart Pfaffenwaldring 61 D-70550 Stuttgart
Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung VEGAS Institut für Wasserbau Universität Stuttgart Pfaffenwaldring 61 D-70550 Stuttgart
Thermische In-Situ-Sanierung: Einsatz der DLI Dampf-Luft-Injektion am Standort Eppsteiner Straße 13 in Oberursel
 Thermische In-Situ-Sanierung: Einsatz der DLI Dampf-Luft-Injektion am Standort Eppsteiner Straße 13 in Oberursel Dr.-Ing. Hans-Peter Koschitzky & Dipl.-Ing.(FH) Oliver Trötschler Versuchseinrichtung zur
Thermische In-Situ-Sanierung: Einsatz der DLI Dampf-Luft-Injektion am Standort Eppsteiner Straße 13 in Oberursel Dr.-Ing. Hans-Peter Koschitzky & Dipl.-Ing.(FH) Oliver Trötschler Versuchseinrichtung zur
Pilotanwendung DLI Zeitz: Erste Ergebnisse der thermischen Sanierung des Kernbereichs eines Benzolschadens mittels Dampf-Luft- Injektion
 Pilotanwendung DLI Zeitz: Erste Ergebnisse der thermischen Sanierung des Kernbereichs eines Benzolschadens mittels Dampf-Luft- Injektion O. Trötschler 1, H.-P. Koschitzky 1, B. Limburg, 1, M. Hirsch 2,
Pilotanwendung DLI Zeitz: Erste Ergebnisse der thermischen Sanierung des Kernbereichs eines Benzolschadens mittels Dampf-Luft- Injektion O. Trötschler 1, H.-P. Koschitzky 1, B. Limburg, 1, M. Hirsch 2,
Machbarkeitsstudie zum Einsatz von chemischer Oxidation (ISCO) zur Sanierung von CKW-Kontaminationen
 Machbarkeitsstudie zum Einsatz von chemischer Oxidation (ISCO) zur Sanierung von CKW-Kontaminationen Oliver Trötschler, Norbert Klaas, Steffen Hetzer, Jürgen Braun () Trötschler, Klaas, Braun 1/13 Grundlagen
Machbarkeitsstudie zum Einsatz von chemischer Oxidation (ISCO) zur Sanierung von CKW-Kontaminationen Oliver Trötschler, Norbert Klaas, Steffen Hetzer, Jürgen Braun () Trötschler, Klaas, Braun 1/13 Grundlagen
VEGAS Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung
 CKWSanierung im geklüfteten Festgestein: Thermische InsituSanierung mit DampfLuftInjektion Ergebnisse einer Pilotanwendung Oliver Trötschler 1, HansPeter Koschitzky 1 Bernd Lidola, Michaela Epp, Stefan
CKWSanierung im geklüfteten Festgestein: Thermische InsituSanierung mit DampfLuftInjektion Ergebnisse einer Pilotanwendung Oliver Trötschler 1, HansPeter Koschitzky 1 Bernd Lidola, Michaela Epp, Stefan
Seminar. Umweltforschung im Brennpunkt - Behandlung von Teeröl-Standorten. 8. Mai - 9. Mai 2014 Redoutensäle, Promenade 39, 4021 Linz
 Seminar Umweltforschung im Brennpunkt - Behandlung von Teeröl-Standorten 8. Mai - 9. Mai 2014 Redoutensäle, Promenade 39, 4021 Linz Thema: Sanierung Altlast O76 Kokerei Linz Referenten: DI (FH) Christoph
Seminar Umweltforschung im Brennpunkt - Behandlung von Teeröl-Standorten 8. Mai - 9. Mai 2014 Redoutensäle, Promenade 39, 4021 Linz Thema: Sanierung Altlast O76 Kokerei Linz Referenten: DI (FH) Christoph
Sachstandsbericht Bodensanierung Eppsteiner Straße
 Sachstandsbericht Bodensanierung Eppsteiner Straße Berichtszeitraum: 01.07.2017 30.09.2017 Betriebsweise: Durchschnittlicher LHKW-Austrag pro Tag: Ausgetragene Menge LHKW im Zeitraum: Ausgetragene Menge
Sachstandsbericht Bodensanierung Eppsteiner Straße Berichtszeitraum: 01.07.2017 30.09.2017 Betriebsweise: Durchschnittlicher LHKW-Austrag pro Tag: Ausgetragene Menge LHKW im Zeitraum: Ausgetragene Menge
In-situ Sanierung einer LCKW-Kontamination auf einem ehemaligen Industriegelände mittels Grundwasser-Zirkulations-Brunnen (GZB )
 In-situ Sanierung einer LCKW-Kontamination auf einem ehemaligen Industriegelände mittels Grundwasser-Zirkulations-Brunnen (GZB ) Marc Sick*, Eduard J. Alesi*, Irina Przybylski**; * IEG Technologie GmbH,
In-situ Sanierung einer LCKW-Kontamination auf einem ehemaligen Industriegelände mittels Grundwasser-Zirkulations-Brunnen (GZB ) Marc Sick*, Eduard J. Alesi*, Irina Przybylski**; * IEG Technologie GmbH,
Leitfaden zur Umsetzung und Bewertung thermischer in situ Herdsanierungen und Software- Tool zur Vorplanung einer Dampf-Luft-Injektion
 Leitfaden zur Umsetzung und Bewertung thermischer in situ Herdsanierungen und Software- Tool zur Vorplanung einer Dampf-Luft-Injektion 3. TASK Symposium "Zukunft Altlasten" Leipzig, 09. Juni 2011 Dr.-Ing.
Leitfaden zur Umsetzung und Bewertung thermischer in situ Herdsanierungen und Software- Tool zur Vorplanung einer Dampf-Luft-Injektion 3. TASK Symposium "Zukunft Altlasten" Leipzig, 09. Juni 2011 Dr.-Ing.
VEGAS Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung
 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung VEGAS Institut für Wasserbau Universität Stuttgart Pfaffenwaldring 61 D-70550 Stuttgart
Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung VEGAS Institut für Wasserbau Universität Stuttgart Pfaffenwaldring 61 D-70550 Stuttgart
CKW-Schadensherde: Möglichkeiten und Beispiele der thermischen In-situ-Sanierung mit Dampf-Luft-Injektion
 CKW-Schadensherde: Möglichkeiten und Beispiele der thermischen In-situ-Sanierung mit Dampf-Luft-Injektion Hans-Peter Koschitzky Oliver Trötschler Institut für Wasserbau, Universität Stuttgart, Germany
CKW-Schadensherde: Möglichkeiten und Beispiele der thermischen In-situ-Sanierung mit Dampf-Luft-Injektion Hans-Peter Koschitzky Oliver Trötschler Institut für Wasserbau, Universität Stuttgart, Germany
Sachstandsbericht Bodensanierung Eppsteiner Straße
 Sachstandsbericht Bodensanierung Eppsteiner Straße Berichtszeitraum: 01.10.2017 31.12.2017 Betriebsweise: Durchschnittlicher LHKW-Austrag pro Tag: Ausgetragene Menge LHKW im Zeitraum: Ausgetragene Menge
Sachstandsbericht Bodensanierung Eppsteiner Straße Berichtszeitraum: 01.10.2017 31.12.2017 Betriebsweise: Durchschnittlicher LHKW-Austrag pro Tag: Ausgetragene Menge LHKW im Zeitraum: Ausgetragene Menge
Sachstandsbericht Bodensanierung Eppsteiner Straße
 Sachstandsbericht Bodensanierung Eppsteiner Straße Berichtszeitraum: 01.01.2018 31.03.2018 Betriebsweise: Durchschnittlicher LHKW-Austrag pro Tag: Ausgetragene Menge LHKW im Zeitraum: Ausgetragene Menge
Sachstandsbericht Bodensanierung Eppsteiner Straße Berichtszeitraum: 01.01.2018 31.03.2018 Betriebsweise: Durchschnittlicher LHKW-Austrag pro Tag: Ausgetragene Menge LHKW im Zeitraum: Ausgetragene Menge
In-situ thermische Sanierung eines LCKW-Schadens unter einem denkmalgeschützten Gebäude
 In-situ thermische Sanierung eines LCKW-Schadens unter einem denkmalgeschützten Gebäude Hans-Georg Edel und Steffen Hetzer 2. ÖVA Technologieworkshop Thermische unterstütze In-Situ Sanierungsverfahren
In-situ thermische Sanierung eines LCKW-Schadens unter einem denkmalgeschützten Gebäude Hans-Georg Edel und Steffen Hetzer 2. ÖVA Technologieworkshop Thermische unterstütze In-Situ Sanierungsverfahren
ÖVA-Sanierungsreport
 standortbulletin ÖVA-Reports sollen die Akzeptanz und den Einsatz von innovativen Technologien in der Sanierung von kontaminierten Standorten in Österreich unterstützen. Hierzu werden eingereichte Fallbeispiele
standortbulletin ÖVA-Reports sollen die Akzeptanz und den Einsatz von innovativen Technologien in der Sanierung von kontaminierten Standorten in Österreich unterstützen. Hierzu werden eingereichte Fallbeispiele
Wissenschaftlicher Bericht. Nr. 99/17 (HG 267) Sanierung von kohlenwasserstoffverunreinigten Aquiferen
 Universität Stuttgart Institut für Wasserbau Lehrstuhl für Hydraulik und Grundwasser Prof. Dr. h.c. Helmut Kobus, Ph.D. Pfaffenwaldring 61 70569 Stuttgart Telefon: (0711) 6 85-47 14/15 Telefax: (0711)
Universität Stuttgart Institut für Wasserbau Lehrstuhl für Hydraulik und Grundwasser Prof. Dr. h.c. Helmut Kobus, Ph.D. Pfaffenwaldring 61 70569 Stuttgart Telefon: (0711) 6 85-47 14/15 Telefax: (0711)
Regierungspräsidium Darmstadt In-situ chemische Oxidation mit Permanganat - ein Fallbeispiel
 In-situ chemische Oxidation mit Permanganat - ein Fallbeispiel Präsentation anlässlich des HLUG-Seminars Altlasten und Schadensfälle am 24./25.05.2011 in Wetzlar Referenten: Theresia Trampe, RP Darmstadt
In-situ chemische Oxidation mit Permanganat - ein Fallbeispiel Präsentation anlässlich des HLUG-Seminars Altlasten und Schadensfälle am 24./25.05.2011 in Wetzlar Referenten: Theresia Trampe, RP Darmstadt
DOPSOL Development of a Phosphate-Elimination System of Lakes (Entwicklung eines Systems zur Entfernung von Phosphat aus Seen)
 DOPSOL Development of a Phosphate-Elimination System of Lakes (Entwicklung eines Systems zur Entfernung von Phosphat aus Seen) Die natürliche Ressource Wasser ist weltweit durch die verschiedensten Kontaminationen
DOPSOL Development of a Phosphate-Elimination System of Lakes (Entwicklung eines Systems zur Entfernung von Phosphat aus Seen) Die natürliche Ressource Wasser ist weltweit durch die verschiedensten Kontaminationen
Thermische In-situ-Sanierung eines CKW-Schadens unter einem denkmalgeschützten Gebäude - von der Planung bis zur erfolgreichen Sanierung
 - von der Planung bis zur erfolgreichen Sanierung Hans-Peter Koschitzky, Oliver Trötschler, Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung, Universität Stuttgart Stephan Denzel, dplan, Karlsruhe
- von der Planung bis zur erfolgreichen Sanierung Hans-Peter Koschitzky, Oliver Trötschler, Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung, Universität Stuttgart Stephan Denzel, dplan, Karlsruhe
Diplomarbeit: Modellierung des Austausches zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser mit Hilfe des Umwelttracers Temperatur
 Diplomarbeit: Modellierung des Austausches zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser mit Hilfe des Umwelttracers Temperatur Von Johannes Ahrns Betreuer Prof. Dr.-Ing. Thomas Grischek Dipl.-Ing. Kerstin
Diplomarbeit: Modellierung des Austausches zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser mit Hilfe des Umwelttracers Temperatur Von Johannes Ahrns Betreuer Prof. Dr.-Ing. Thomas Grischek Dipl.-Ing. Kerstin
Grundwassersanierung mit Nano-Technologie. CKW-Schaden Bornheim-Roisdorf
 Grundwassersanierung mit Nano-Technologie CKW-Schaden Bornheim-Roisdorf Beschreibung des Schadens und der bisherigen Maßnahmen zur Sanierung Der Schaden wurde vermutlich in den 70er Jahren durch eine chemische
Grundwassersanierung mit Nano-Technologie CKW-Schaden Bornheim-Roisdorf Beschreibung des Schadens und der bisherigen Maßnahmen zur Sanierung Der Schaden wurde vermutlich in den 70er Jahren durch eine chemische
Nachhaltige Sanierung mit innovativen Technologien
 74 Sauberes Grundwasser Nachhaltige Sanierung mit innovativen Technologien Trinkwasser, unser wichtigstes Nahrungsmittel, wird in Deutschland zu 65 Prozent aus dem Grundwasser gewonnen. Diese Trinkwasserressource
74 Sauberes Grundwasser Nachhaltige Sanierung mit innovativen Technologien Trinkwasser, unser wichtigstes Nahrungsmittel, wird in Deutschland zu 65 Prozent aus dem Grundwasser gewonnen. Diese Trinkwasserressource
Weiche Methoden der Grundwassersanierung
 Weiche Methoden der Grundwassersanierung ITVA Arbeitshilfe Innovative In-situ-Sanierungsverfahren Hans-Peter Koschitzky, Versuchseinrichtung zur Grundwasserund Altlastensanierung, Universität Stuttgart
Weiche Methoden der Grundwassersanierung ITVA Arbeitshilfe Innovative In-situ-Sanierungsverfahren Hans-Peter Koschitzky, Versuchseinrichtung zur Grundwasserund Altlastensanierung, Universität Stuttgart
VEGAS Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung
 Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung VEGAS Institut für Wasserbau Universität Stuttgart Pfaffenwaldring 61 D-70550 Stuttgart
Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung VEGAS Institut für Wasserbau Universität Stuttgart Pfaffenwaldring 61 D-70550 Stuttgart
Verfahren zur Sanierung CKW-belasteter Böden und Grundwässer. - Einsatz oberflächenaktiver, mikrobiologisch - wirksamer Substanzen -
 Verfahren zur Sanierung CKW-belasteter Böden und Grundwässer - Einsatz oberflächenaktiver, mikrobiologisch - wirksamer Substanzen - Dipl.-Geol. Carsten Schulz Dr. Erwin Weßling GmbH Die Sanierung CKW kontaminierter
Verfahren zur Sanierung CKW-belasteter Böden und Grundwässer - Einsatz oberflächenaktiver, mikrobiologisch - wirksamer Substanzen - Dipl.-Geol. Carsten Schulz Dr. Erwin Weßling GmbH Die Sanierung CKW kontaminierter
Betreff: Untersuchungen der Auswirkungen von wasserspeichernden Zusatzstoffen
 Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt Institut für Hydraulik und landeskulturelle Wasserwirtschaft Fa. Aquita z.hd. Herrn Ludwig FÜRST Pulvermühlstr. 23 44 Linz Wien, 9. Juni 9 Betreff: Untersuchungen
Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt Institut für Hydraulik und landeskulturelle Wasserwirtschaft Fa. Aquita z.hd. Herrn Ludwig FÜRST Pulvermühlstr. 23 44 Linz Wien, 9. Juni 9 Betreff: Untersuchungen
Sanierung Altlast O76 Kokerei Linz
 Sanierung Altlast O76 Kokerei Linz 4.ÖVA Technologie Workshop 2014 Christoph Angermayer / voestalpine Stahl GmbH Donnerstag, 27. März 2014 Linz, Promenade 39 www.voestalpine.com/stahl Übersicht Veranlassung
Sanierung Altlast O76 Kokerei Linz 4.ÖVA Technologie Workshop 2014 Christoph Angermayer / voestalpine Stahl GmbH Donnerstag, 27. März 2014 Linz, Promenade 39 www.voestalpine.com/stahl Übersicht Veranlassung
Gekoppelte thermisch-hydraulische Simulation einer Spülung zur Altlastensanierung
 Gekoppelte thermisch-hydraulische Simulation einer Spülung zur Altlastensanierung Dipl.-Ing. Michael Berger, BSc Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dietmar Adam Dipl.-Ing. Dr.techn. Roman Markiewicz Institut
Gekoppelte thermisch-hydraulische Simulation einer Spülung zur Altlastensanierung Dipl.-Ing. Michael Berger, BSc Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dietmar Adam Dipl.-Ing. Dr.techn. Roman Markiewicz Institut
Grundwasserhydraulik Und -erschließung
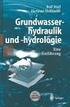 Vorlesung und Übung Grundwasserhydraulik Und -erschließung DR. THOMAS MATHEWS TEIL 5 Seite 1 von 19 INHALT INHALT... 2 1 ANWENDUNG VON ASMWIN AUF FALLBEISPIELE... 4 1.1 BERECHNUNGSGRUNDLAGEN... 4 1.2 AUFGABEN...
Vorlesung und Übung Grundwasserhydraulik Und -erschließung DR. THOMAS MATHEWS TEIL 5 Seite 1 von 19 INHALT INHALT... 2 1 ANWENDUNG VON ASMWIN AUF FALLBEISPIELE... 4 1.1 BERECHNUNGSGRUNDLAGEN... 4 1.2 AUFGABEN...
Thermische Verfahren zur Bodensanierung Wirkungsweise und Anwendungsgrenzen
 S e m i n a r A l t l a s t e n 2 0 0 6 : A. F Ä R B E R & U. H I E S T E R Thermische Verfahren zur Bodensanierung Wirkungsweise und Anwendungsgrenzen ARNE FÄRBER & UWE HIESTER Der vorliegende Beitrag
S e m i n a r A l t l a s t e n 2 0 0 6 : A. F Ä R B E R & U. H I E S T E R Thermische Verfahren zur Bodensanierung Wirkungsweise und Anwendungsgrenzen ARNE FÄRBER & UWE HIESTER Der vorliegende Beitrag
Innovative In-situ-Sanierungsverfahren - die ITVA-Arbeitshilfe zur Unterstützung bei der Altlastensanierung
 Innovative In-situ-Sanierungsverfahren - die ITVA-Arbeitshilfe zur Unterstützung bei der Altlastensanierung Hans-Peter Koschitzky, Versuchseinrichtung zur Grundwasserund Altlastensanierung, Universität
Innovative In-situ-Sanierungsverfahren - die ITVA-Arbeitshilfe zur Unterstützung bei der Altlastensanierung Hans-Peter Koschitzky, Versuchseinrichtung zur Grundwasserund Altlastensanierung, Universität
Thermische In-situ-Sanierung: Grundlagen und Fallbeispiele
 Hans-Peter Koschitzky und Oliver Trötschler 1 Problemstellung und Begrifflichkeiten Die Sanierung von Boden- und Grundwasserkontaminationen, die durch halogenierte chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW, LHKW)
Hans-Peter Koschitzky und Oliver Trötschler 1 Problemstellung und Begrifflichkeiten Die Sanierung von Boden- und Grundwasserkontaminationen, die durch halogenierte chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW, LHKW)
Workshop Sanierungsentscheidung Dresden, Praktische Fallbeispiele
 Workshop Sanierungsentscheidung Praktische Fallbeispiele Standortsituation Branche: Lager und Umschlagplatz für Mineralöle Kontaminationssituation: Boden: MKW (bis 19.600 mg/kg) bis in den GW Wechselbereich
Workshop Sanierungsentscheidung Praktische Fallbeispiele Standortsituation Branche: Lager und Umschlagplatz für Mineralöle Kontaminationssituation: Boden: MKW (bis 19.600 mg/kg) bis in den GW Wechselbereich
NAPASAN: Einsatz von Nanopartikeln zur Sanierung von Grundwasserschadensfäl len
 NAPASAN: Einsatz von Nanopartikeln zur Sanierung von Grundwasserschadensfäl len Jürgen Braun VEGAS, Uni versität Stuttgart 2. Clustertreffen der BMBF-Fördermaßnahmen NanoCare und NanoNature 13. - 14. März
NAPASAN: Einsatz von Nanopartikeln zur Sanierung von Grundwasserschadensfäl len Jürgen Braun VEGAS, Uni versität Stuttgart 2. Clustertreffen der BMBF-Fördermaßnahmen NanoCare und NanoNature 13. - 14. März
Grundlagen der Modellierung von Wärmetransport im Grundwasser. `ÉåíÉê=Ñçê=dêçìåÇï~íÉê=jçÇÉäáåÖ=áå=íÜÉ=aef=dêçìé
 Grundlagen der Modellierung von Wärmetransport im Grundwasser `ÉåíÉê=Ñçê=dêçìåÇï~íÉê=jçÇÉäáåÖ=áå=íÜÉ=aef=dêçìé Geothermische Energie Geothermische Energie gewinnt zunehmend an Bedeutung. Sei es im Bereich
Grundlagen der Modellierung von Wärmetransport im Grundwasser `ÉåíÉê=Ñçê=dêçìåÇï~íÉê=jçÇÉäáåÖ=áå=íÜÉ=aef=dêçìé Geothermische Energie Geothermische Energie gewinnt zunehmend an Bedeutung. Sei es im Bereich
Technologiequickscan In-situ-Sanierungstechnologien
 Technologiequickscan In-situ-Sanierungstechnologien ÖVA-Technologie-Workshop: Anwendung von In-situ-Sanierungstechnologien am Beispiel Airsparging 16. Juni 2010, Wien T. Dörrie & H. Längert-Mühlegger (Umweltbundesamt)
Technologiequickscan In-situ-Sanierungstechnologien ÖVA-Technologie-Workshop: Anwendung von In-situ-Sanierungstechnologien am Beispiel Airsparging 16. Juni 2010, Wien T. Dörrie & H. Längert-Mühlegger (Umweltbundesamt)
Inhalt. Sanierung eines Dieselschadens in situ durch Belüftung und Nährstoffoptimierung
 Inhalt Einleitung Erkundungsmaßnahmen Geologie Bodenluft Abbauversuche Umsetzung der Sanierung Beweissicherung und Ergebnisse Hartwig Kraiger 6. ÖVA Technologieworkshop Einleitung 1 7.3.2007 Bahnhof Gmunden
Inhalt Einleitung Erkundungsmaßnahmen Geologie Bodenluft Abbauversuche Umsetzung der Sanierung Beweissicherung und Ergebnisse Hartwig Kraiger 6. ÖVA Technologieworkshop Einleitung 1 7.3.2007 Bahnhof Gmunden
Foto: Fritsch. Übung 3: Bestimmung der gesättigten hydraulischen Leitfähigkeit (k f -Wert) - Ermittlung aus der Kornverteilungskurve -
 Übung 3 Hydrogeologie I: Bestimmung der gesättigten hydraulischen Leitfähigkeit Dipl.-Geoökol. M. Schipek TU Bergakademie Freiberg, Institut für Geologie Lehrstuhl für Hydrogeologie Foto: Fritsch Kenngrößen
Übung 3 Hydrogeologie I: Bestimmung der gesättigten hydraulischen Leitfähigkeit Dipl.-Geoökol. M. Schipek TU Bergakademie Freiberg, Institut für Geologie Lehrstuhl für Hydrogeologie Foto: Fritsch Kenngrößen
State-of-the-art bei in situ-sanierungen-
 State-of-the-art bei in situ-sanierungen- Vergleichende Untersuchungen mehrerer innovativer Sanierungsverfahren an einem Raffinerie-Altstandort Holger Weiß, UFZ und Jochen Großmann, GICON 1 Der Standort
State-of-the-art bei in situ-sanierungen- Vergleichende Untersuchungen mehrerer innovativer Sanierungsverfahren an einem Raffinerie-Altstandort Holger Weiß, UFZ und Jochen Großmann, GICON 1 Der Standort
Voruntersuchungen. zur in situ Sanierung der Altlast W26. Kontakt: Björn Tobias Bogolte Ölalarm:
 Voruntersuchungen zur in situ Sanierung der Altlast W26 Altlast W26 Altstandort: Historie: Schadstoff: Frachtenbahnhof Praterstern Bereich Werkstätte, Wien Kriegsaltlast Werkstätte bzw. Umschlagplatz Mineralöle
Voruntersuchungen zur in situ Sanierung der Altlast W26 Altlast W26 Altstandort: Historie: Schadstoff: Frachtenbahnhof Praterstern Bereich Werkstätte, Wien Kriegsaltlast Werkstätte bzw. Umschlagplatz Mineralöle
Voruntersuchungen. zur in situ Sanierung der Altlast W26. Kontakt: Björn Tobias Bogolte Ölalarm:
 Voruntersuchungen zur in situ Sanierung der Altlast W26 Altlast W26 Altstandort: Frachtenbahnhof Praterstern Bereich Werkstätte, Wien Historie: Kriegsaltlast Werkstätte bzw. Umschlagplatz Mineralöle Schadstoff:
Voruntersuchungen zur in situ Sanierung der Altlast W26 Altlast W26 Altstandort: Frachtenbahnhof Praterstern Bereich Werkstätte, Wien Historie: Kriegsaltlast Werkstätte bzw. Umschlagplatz Mineralöle Schadstoff:
 Kartengrundlage: Auszug aus Topografische Karte 1 : 25.000 7221 Stuttgart-Südost Landesvermessungsamt Baden-Württemberg Standort des Untersuchungsgeländes Anlage 1 Lageplan des Untersuchungsgebietes Ostfildern-Scharnhausen
Kartengrundlage: Auszug aus Topografische Karte 1 : 25.000 7221 Stuttgart-Südost Landesvermessungsamt Baden-Württemberg Standort des Untersuchungsgeländes Anlage 1 Lageplan des Untersuchungsgebietes Ostfildern-Scharnhausen
ISCO Chemische Oxidation von Schadstoffen als Sanierungsmethode
 ISCO Chemische Oxidation von Schadstoffen als Sanierungsmethode - Machbarkeitsstudie und Laboruntersuchungen zu einer Feldanwendung - - Statuskolloquium 2005 O. Trötschler, N. Klaas, S. Hetzer, T. Theurer
ISCO Chemische Oxidation von Schadstoffen als Sanierungsmethode - Machbarkeitsstudie und Laboruntersuchungen zu einer Feldanwendung - - Statuskolloquium 2005 O. Trötschler, N. Klaas, S. Hetzer, T. Theurer
Physikalische Grundlagen der Klimaarchive Eis und Grundwasser
 Inhalt der heutigen Vorlesung Physikalische Grundlagen der Klimaarchive Eis und Grundwasser 6. Grundwasser: Dynamik, Transport von Spurenstoffen, Eignung als Archiv 1) Dynamik von Grundwasser Grundlagen
Inhalt der heutigen Vorlesung Physikalische Grundlagen der Klimaarchive Eis und Grundwasser 6. Grundwasser: Dynamik, Transport von Spurenstoffen, Eignung als Archiv 1) Dynamik von Grundwasser Grundlagen
ISCO In-situ chemische Oxidation
 ISCO In-situ chemische Oxidation Einsatzmöglichkeiten und Grenzen VEGAS Kolloquium 2010 Patrick Jacobs 1 Dokumentierte in-situ Verfahren Alkohol-Spülung 8% Tensid-Spülung 7% Mikrobiologische Verfahren
ISCO In-situ chemische Oxidation Einsatzmöglichkeiten und Grenzen VEGAS Kolloquium 2010 Patrick Jacobs 1 Dokumentierte in-situ Verfahren Alkohol-Spülung 8% Tensid-Spülung 7% Mikrobiologische Verfahren
Enhanced Geothermal Response Test (EGRT): Erfahrungen aus der Praxis und Vergleiche mit dem klassischen Thermal Response Test (TRT)
 Inhalt des Vortrags: Prinzipielle Unterschiede zw. TRT und EGRT Theorie EGRT Praxis EGRT Vergleich TRT und EGRT in der Praxis EGRT zur Qualitätskontrolle der Verfüllung Philipp Heidinger 1, Jürgen Dornstädter
Inhalt des Vortrags: Prinzipielle Unterschiede zw. TRT und EGRT Theorie EGRT Praxis EGRT Vergleich TRT und EGRT in der Praxis EGRT zur Qualitätskontrolle der Verfüllung Philipp Heidinger 1, Jürgen Dornstädter
Rolf Mull Hartmut Holländer. Grundwasserhydraulik. und -hydrologie. Eine Einführung. Mit 157 Abbildungen und 20 Tabellen. Springer
 Rolf Mull Hartmut Holländer Grundwasserhydraulik und -hydrologie Eine Einführung Mit 157 Abbildungen und 20 Tabellen Springer VI 1 Bedeutung des Grundwassers 1 2 Strukturen der Grundwassersysteme 4 2.1
Rolf Mull Hartmut Holländer Grundwasserhydraulik und -hydrologie Eine Einführung Mit 157 Abbildungen und 20 Tabellen Springer VI 1 Bedeutung des Grundwassers 1 2 Strukturen der Grundwassersysteme 4 2.1
Die zeitabhängige Durchströmung von Dämmen
 Wechselwirkung Bauwerk Grundwasser Die zeitabhängige Durchströmung von Dämmen Einleitung Dr.-Ing. H. Montenegro, BAW Karlsruhe Dämme und Deiche stellen Erdbauwerke dar, die so dimensioniert werden müssen,
Wechselwirkung Bauwerk Grundwasser Die zeitabhängige Durchströmung von Dämmen Einleitung Dr.-Ing. H. Montenegro, BAW Karlsruhe Dämme und Deiche stellen Erdbauwerke dar, die so dimensioniert werden müssen,
Ein Berechnungsinstrument für Sickerwasserprognosen
 ALTEX 1D Ein Berechnungsinstrument für Sickerwasserprognosen Volker Zeisberger HLUG-Altlastenseminar 12./13.6.2013 in Limburg Sickerwasserprognose nach BBodSchV Die Sickerwasserprognose ist die Abschätzung
ALTEX 1D Ein Berechnungsinstrument für Sickerwasserprognosen Volker Zeisberger HLUG-Altlastenseminar 12./13.6.2013 in Limburg Sickerwasserprognose nach BBodSchV Die Sickerwasserprognose ist die Abschätzung
6 In-situ-Sanierung von Schadstoffherden im Grundwasser mit Festen Wärmequellen Erweiterung der Einsatzbereiche des THERIS-Verfahrens
 6 In-situ-Sanierung von Schadstoffherden im Grundwasser mit Festen Wärmequellen Erweiterung der Einsatzbereiche des THERIS-Verfahrens Uwe Hiester, Hans-Peter Koschitzky, Oliver Trötschler, VEGAS, Universität
6 In-situ-Sanierung von Schadstoffherden im Grundwasser mit Festen Wärmequellen Erweiterung der Einsatzbereiche des THERIS-Verfahrens Uwe Hiester, Hans-Peter Koschitzky, Oliver Trötschler, VEGAS, Universität
Welche Böden/geogenen Ausgangssubstrate liegen in Norddeutschland vor? Wie sind die jeweiligen Schutzfunktionen der Böden in Bezug auf den LCKW-
 Welche Böden/geogenen Ausgangssubstrate liegen in Norddeutschland vor? Wie sind die jeweiligen Schutzfunktionen der Böden in Bezug auf den LCKW- Eintrag bzw. die Verlagerung bis in das Grundwasser zu beurteilen?
Welche Böden/geogenen Ausgangssubstrate liegen in Norddeutschland vor? Wie sind die jeweiligen Schutzfunktionen der Böden in Bezug auf den LCKW- Eintrag bzw. die Verlagerung bis in das Grundwasser zu beurteilen?
Grundwassersanierung: Status quo quo vadis?
 Was können Sie erwarten Nanomaterialien in der Bodenund Grundwassersanierung: Status quo quo vadis? Wie klein ist nano? Nanopartikel für die In-situ-Sanierung Status quo Kenntnisstand / Stand des Wissens
Was können Sie erwarten Nanomaterialien in der Bodenund Grundwassersanierung: Status quo quo vadis? Wie klein ist nano? Nanopartikel für die In-situ-Sanierung Status quo Kenntnisstand / Stand des Wissens
Transportmodellierung mit nichtlinearer Sorption und stochastischer Strömung
 5 Endlagersicherheitsforschung 5.1 Transportmodellierung mit nichtlinearer Sorption und stochastischer Strömung Die Programmpakete d 3 f (distributed density-driven flow) und r 3 t (radionuclides, reaction,
5 Endlagersicherheitsforschung 5.1 Transportmodellierung mit nichtlinearer Sorption und stochastischer Strömung Die Programmpakete d 3 f (distributed density-driven flow) und r 3 t (radionuclides, reaction,
Entwicklung einer Sanierungstechnologie für PFC belastete Grundwässer
 Entwicklung einer Sanierungstechnologie für PFC belastete am Beispiel Flughafen Nürnberg Inhalt 1. Projekt: Entwicklung einer Sanierungstechnologie für PFC-haltige In Zusammenarbeit mit TZW Karlsruhe Versuche
Entwicklung einer Sanierungstechnologie für PFC belastete am Beispiel Flughafen Nürnberg Inhalt 1. Projekt: Entwicklung einer Sanierungstechnologie für PFC-haltige In Zusammenarbeit mit TZW Karlsruhe Versuche
Klausur Technische Chemie SS 2008 Prof. M. Schönhoff // PD Dr. C. Cramer-Kellers Klausur zur Vorlesung
 Klausur zur Vorlesung Technische Chemie: Reaktionstechnik 14.7.2008 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr Name, Vorname Geburtsdatum Studiengang/Semester Matrikelnummer Hinweis: Alle Ansätze und Rechenwege sind mit
Klausur zur Vorlesung Technische Chemie: Reaktionstechnik 14.7.2008 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr Name, Vorname Geburtsdatum Studiengang/Semester Matrikelnummer Hinweis: Alle Ansätze und Rechenwege sind mit
Ermittlung der Verteilung ausströmender Kohlensäure im Bereich der Getränkeschankanlagen
 im Bereich der Getränkeschankanlagen 1. Einführung 2. Numerische Strömungssimulation 3. Praktischer Ausströmversuch 4. Zusammenfassung und Ausblick Folien-Nr. 2 Mai 2004 Bier-Schankanlage Folien-Nr. 3
im Bereich der Getränkeschankanlagen 1. Einführung 2. Numerische Strömungssimulation 3. Praktischer Ausströmversuch 4. Zusammenfassung und Ausblick Folien-Nr. 2 Mai 2004 Bier-Schankanlage Folien-Nr. 3
Das Baustellenhandbuch für den Tiefbau
 FORUM VERLAG HERKERT GMBH Mandichostraße 18 86504 Merching Telefon: 08233/381-123 E-Mail: service@forum-verlag.com www.forum-verlag.com Das Baustellenhandbuch für den Tiefbau Liebe Besucherinnen und Besucher
FORUM VERLAG HERKERT GMBH Mandichostraße 18 86504 Merching Telefon: 08233/381-123 E-Mail: service@forum-verlag.com www.forum-verlag.com Das Baustellenhandbuch für den Tiefbau Liebe Besucherinnen und Besucher
Neue Feuerungssysteme mit hoher Brennstoffflexibilität für Gasturbinen
 22. Deutscher Flammentag, 21./22. Sept. 2005, TU Braunschweig Neue Feuerungssysteme mit hoher Brennstoffflexibilität für Gasturbinen Dr.-Ing. A. Giese; Dr.-Ing. habil. A. Al-Halbouni; Dr.-Ing. M. Flamme;
22. Deutscher Flammentag, 21./22. Sept. 2005, TU Braunschweig Neue Feuerungssysteme mit hoher Brennstoffflexibilität für Gasturbinen Dr.-Ing. A. Giese; Dr.-Ing. habil. A. Al-Halbouni; Dr.-Ing. M. Flamme;
Dreidimensionale Ausbreitungsrechnung am Rhein zur Beurteilung von Stoffkonzentrationen
 Dreidimensionale Ausbreitungsrechnung am Rhein zur Beurteilung von Stoffkonzentrationen Einführung Datenlage, Modell, Hydraulik Stoffparameter Ergebnisse Fazit Dr. Oliver Stoschek, Anika Scholl DHI-WASY
Dreidimensionale Ausbreitungsrechnung am Rhein zur Beurteilung von Stoffkonzentrationen Einführung Datenlage, Modell, Hydraulik Stoffparameter Ergebnisse Fazit Dr. Oliver Stoschek, Anika Scholl DHI-WASY
Untersuchungen zur Eignung von Messinggranulat zur In-situ-Entfernung von Quecksilber aus Grundwässern
 Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das Logo einsetzen Untersuchungen zur Eignung von Messinggranulat zur In-situ-Entfernung von Quecksilber aus Grundwässern Jan-Helge Richard, Thomas Schöndorf,
Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das Logo einsetzen Untersuchungen zur Eignung von Messinggranulat zur In-situ-Entfernung von Quecksilber aus Grundwässern Jan-Helge Richard, Thomas Schöndorf,
Information Bau und Umweltausschuss 23.September 2015
 24.9.215 LHKW Sanierung Altlastenfläche Eppsteiner Straße, Oberursel Information Bau und Umweltausschuss 23.September 215 Dr. Ing. Volker Schrenk Agenda Verlauf der Erwärmung Schadstoffaustrag Anlagenbetrieb
24.9.215 LHKW Sanierung Altlastenfläche Eppsteiner Straße, Oberursel Information Bau und Umweltausschuss 23.September 215 Dr. Ing. Volker Schrenk Agenda Verlauf der Erwärmung Schadstoffaustrag Anlagenbetrieb
Auswertung internationaler Fachliteratur zu In-situ-Anwendungen in der gesättigten Zone bei der Altlastenbearbeitung
 Auswertung internationaler Fachliteratur zu In-situ-Anwendungen in der gesättigten Zone bei der Altlastenbearbeitung H. Leiteritz, H. D. Stupp (DSC) S. Schroers, M. Odensaß (LANUV) LABO-Aktivitäten Bestandsaufnahme
Auswertung internationaler Fachliteratur zu In-situ-Anwendungen in der gesättigten Zone bei der Altlastenbearbeitung H. Leiteritz, H. D. Stupp (DSC) S. Schroers, M. Odensaß (LANUV) LABO-Aktivitäten Bestandsaufnahme
Bestimmung der feuchte- und temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen
 Bestimmung der feuchte- und temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen F. Ochs 1), H. Stumpp 1), D. Mangold 2), W. Heidemann 1) 1) 2) 3), H. Müller-Steinhagen 1) Universität Stuttgart, Institut
Bestimmung der feuchte- und temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen F. Ochs 1), H. Stumpp 1), D. Mangold 2), W. Heidemann 1) 1) 2) 3), H. Müller-Steinhagen 1) Universität Stuttgart, Institut
Funktionsansprüche an die Hinterfüllung einer Erdwärmesonde
 Vorstellung aktueller Messmethoden bei der Überprüfung der Zementationsgüte von Erdwärmesonden Qualitätsansprüche an eine EWS Messtechnik Temperaturprofile Kurz TRT in Kombination mit Temperaturprofilen
Vorstellung aktueller Messmethoden bei der Überprüfung der Zementationsgüte von Erdwärmesonden Qualitätsansprüche an eine EWS Messtechnik Temperaturprofile Kurz TRT in Kombination mit Temperaturprofilen
HLUG-Seminar Altlasten und Schadensfälle Neue Entwicklungen in Wetzlar
 HLUG-Seminar Altlasten und Schadensfälle Neue Entwicklungen 24.05. 25.05.2011 in Wetzlar Dipl.-Geol. Michael Woisnitza Bereich Altlastensanierung HIM-ASG HIM GmbH Pilot-Feldversuch mittels THERIS-Verfahren
HLUG-Seminar Altlasten und Schadensfälle Neue Entwicklungen 24.05. 25.05.2011 in Wetzlar Dipl.-Geol. Michael Woisnitza Bereich Altlastensanierung HIM-ASG HIM GmbH Pilot-Feldversuch mittels THERIS-Verfahren
Arbeitspaket 2: Untersuchungen zur Grundwasserbeschaffenheit im quartären Grundwasserleiter der Stadt Dresden in der Folge des Augusthochwassers 2002
 BMBF-Projekt Hochwasser Nachsorge Grundwasser Dresden Arbeitspaket 2: Untersuchungen zur Grundwasserbeschaffenheit im quartären Grundwasserleiter der Stadt Dresden in der Folge des Augusthochwassers 2002
BMBF-Projekt Hochwasser Nachsorge Grundwasser Dresden Arbeitspaket 2: Untersuchungen zur Grundwasserbeschaffenheit im quartären Grundwasserleiter der Stadt Dresden in der Folge des Augusthochwassers 2002
Bestimmung vertikaler kf -Wert Verteilungen Detektierung hydraulischer Kurzschlüsse horizontierte Probenahme kombinierter Immissionspumpversuch
 Thermo-Flowmeter Bestimmung vertikaler kf -Wert Verteilungen Detektierung hydraulischer Kurzschlüsse horizontierte Probenahme kombinierter Immissionspumpversuch Peter Halla (Dipl.Geol.) Berghof Analytik
Thermo-Flowmeter Bestimmung vertikaler kf -Wert Verteilungen Detektierung hydraulischer Kurzschlüsse horizontierte Probenahme kombinierter Immissionspumpversuch Peter Halla (Dipl.Geol.) Berghof Analytik
Ergebnisse und Interpretation 54
 Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
Universität Koblenz-Landau Landau Fachbereich 7: Natur- und Umweltwissenschaften Institut für Umweltwissenschaften
 Universität Koblenz-Landau Landau Fachbereich 7: Natur- und Umweltwissenschaften Institut für Umweltwissenschaften Dr. Horst Niemes (Lehrbeauftragter) Systemanalyse 1 Fallbeispiel 1: Grundwassersanierung
Universität Koblenz-Landau Landau Fachbereich 7: Natur- und Umweltwissenschaften Institut für Umweltwissenschaften Dr. Horst Niemes (Lehrbeauftragter) Systemanalyse 1 Fallbeispiel 1: Grundwassersanierung
Modellierung von Kälte- und Wärmefahnen in der oberflächennahen Geothermie Philipp Blum, Valentin Wagner, Jozsef Hecht-Méndez, Peter Bayer
 Modellierung von Kälte- und Wärmefahnen in der oberflächennahen Geothermie Philipp Blum, Valentin Wagner, Jozsef Hecht-Méndez, Peter Bayer INSTITUT FÜR ANGEWANDTE GEOWISSENSCHAFTEN ABTEILUNG INGENIEURGEOLOGIE
Modellierung von Kälte- und Wärmefahnen in der oberflächennahen Geothermie Philipp Blum, Valentin Wagner, Jozsef Hecht-Méndez, Peter Bayer INSTITUT FÜR ANGEWANDTE GEOWISSENSCHAFTEN ABTEILUNG INGENIEURGEOLOGIE
Anwendung der Verdünnte Verbrennung für regenerativ beheizte Glasschmelzwannen Eine Möglichkeit zur NO x -Reduzierung
 Anwendung der Verdünnte Verbrennung für regenerativ beheizte Glasschmelzwannen Eine Möglichkeit zur NO x -Reduzierung Dr.-Ing. Anne Giese, Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus Görner 24. Deutscher Flammentag Postersession
Anwendung der Verdünnte Verbrennung für regenerativ beheizte Glasschmelzwannen Eine Möglichkeit zur NO x -Reduzierung Dr.-Ing. Anne Giese, Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus Görner 24. Deutscher Flammentag Postersession
Handlungsempfehlung "Prüfung und Bewertung der Effizienz laufender Pump-and-Treat- Sanierungen
 LUBW Projekt Handlungsempfehlung "Prüfung und Bewertung der Effizienz laufender Pump-and-Treat- Sanierungen im Rahmen des EU-Life + Projektes MAGPlan Folie 1 Einführung in die Thematik Beispielfall einer
LUBW Projekt Handlungsempfehlung "Prüfung und Bewertung der Effizienz laufender Pump-and-Treat- Sanierungen im Rahmen des EU-Life + Projektes MAGPlan Folie 1 Einführung in die Thematik Beispielfall einer
Forensische Methoden in der Altlastenerkundung. ITVA Regionalgruppe Nordost/ BVB/ Harbauer GmbH - 26.06.2014 - Dr. Ulrike Meyer 1
 Forensische Methoden in der Altlastenerkundung ITVA Regionalgruppe Nordost/ BVB/ Harbauer GmbH - 26.06.2014 - Dr. Ulrike Meyer 1 Gliederung Begriffe Methoden Anwendungsbereiche Fallgeschichte Mögliche
Forensische Methoden in der Altlastenerkundung ITVA Regionalgruppe Nordost/ BVB/ Harbauer GmbH - 26.06.2014 - Dr. Ulrike Meyer 1 Gliederung Begriffe Methoden Anwendungsbereiche Fallgeschichte Mögliche
BA Arbeiten 2017 LS Hydrogeologie
 BA Arbeiten 2017 LS Hydrogeologie Hydrogeology and Biogeochemistry Group Thema: Entwicklung einer Diffusionszelle zur Beprobung von Sedimenten Entwicklung eines Aufbaus zur Beprobung von geochemischen
BA Arbeiten 2017 LS Hydrogeologie Hydrogeology and Biogeochemistry Group Thema: Entwicklung einer Diffusionszelle zur Beprobung von Sedimenten Entwicklung eines Aufbaus zur Beprobung von geochemischen
Kurzdarstellung. Landkreis Rotenburg (Wümme) Abfallwirtschaft. Aerobe in situ Stabilisierung der Deponie Helvesiek
 Landkreis Rotenburg (Wümme) Abfallwirtschaft Aerobe in situ Stabilisierung der Deponie Helvesiek - Eine Umweltschutzmaßnahme mit Förderung der Nationalen Klimaschutzinitiative Kurzdarstellung 1 Potenzialanalyse
Landkreis Rotenburg (Wümme) Abfallwirtschaft Aerobe in situ Stabilisierung der Deponie Helvesiek - Eine Umweltschutzmaßnahme mit Förderung der Nationalen Klimaschutzinitiative Kurzdarstellung 1 Potenzialanalyse
Fachbeitrag Altlasten
 Deutsche Bahn AG Sanierungsmanagement Regionalbüro Süd-West (FRS-SW) Lammstraße 19 76133 Karlsruhe Fachbeitrag Altlasten Projekt Standort 7080 Tübingen B-Plan-Verfahren Tübingen Gbf 23. Januar 2013 Fachbeitrag
Deutsche Bahn AG Sanierungsmanagement Regionalbüro Süd-West (FRS-SW) Lammstraße 19 76133 Karlsruhe Fachbeitrag Altlasten Projekt Standort 7080 Tübingen B-Plan-Verfahren Tübingen Gbf 23. Januar 2013 Fachbeitrag
VEGAS Kolloquium 2010 In-situ-Sanierung Stand und Entwicklung Nano und ISCO in Stuttgart
 VEGAS Kolloquium 2010 In-situ-Sanierung Stand und Entwicklung Nano und ISCO 07.10.2010 in Stuttgart Bedeutung/Anforderungen der In-situ-Verfahren aus Sicht der Altlastenbesitzer Birgit Schmitt-Biegel HIM
VEGAS Kolloquium 2010 In-situ-Sanierung Stand und Entwicklung Nano und ISCO 07.10.2010 in Stuttgart Bedeutung/Anforderungen der In-situ-Verfahren aus Sicht der Altlastenbesitzer Birgit Schmitt-Biegel HIM
Sanierung von Grundwasserverunreinigungen
 Sanierung von Grundwasserverunreinigungen Matthias Willmann (Bafu, 2009) HS 2015 Grundwasser I - Sanierung 1 Grundwassersanierung Wiederherstellung der Grundwasserqualität nach Unfällen oder bei Verschmutzungen,
Sanierung von Grundwasserverunreinigungen Matthias Willmann (Bafu, 2009) HS 2015 Grundwasser I - Sanierung 1 Grundwassersanierung Wiederherstellung der Grundwasserqualität nach Unfällen oder bei Verschmutzungen,
Aktivierung des biologischen Abbaus von Perchlorethen (PCE) und Trichlorethen (TCE) mittels des Konsortiums DHC-KB1
 Aktivierung des biologischen Abbaus von Perchlorethen (PCE) und Trichlorethen (TCE) mittels des Konsortiums DHC-KB1 Dr. Christoph Henkler, Planreal AG 1. Mikroorganismen, die PCE abbauen können Natürlich
Aktivierung des biologischen Abbaus von Perchlorethen (PCE) und Trichlorethen (TCE) mittels des Konsortiums DHC-KB1 Dr. Christoph Henkler, Planreal AG 1. Mikroorganismen, die PCE abbauen können Natürlich
Kombination von Flacher Geothermie und Bodensanierung Praxiserfahrungen in den Niederlanden. Flache Geothermie in den Niederlanden
 Kombination von Flacher Geothermie und Bodensanierung Praxiserfahrungen in den Niederlanden Charles Pijls, Tauw bv Inhalte Flache Geothermie in den Niederlanden Konfigurationen Bodenschutzgesetze Auswirkungen
Kombination von Flacher Geothermie und Bodensanierung Praxiserfahrungen in den Niederlanden Charles Pijls, Tauw bv Inhalte Flache Geothermie in den Niederlanden Konfigurationen Bodenschutzgesetze Auswirkungen
11. Biberacher Geothermietag am 23. Oktober 2014
 11. Biberacher Geothermietag am 23. Oktober 2014 Auswirkungen der thermischen Nutzung des Grundwassers im Stadtgebiet Biberach: Brauchen wir ein thermisches Management? Dr. Rainer Klein, boden & grundwasser
11. Biberacher Geothermietag am 23. Oktober 2014 Auswirkungen der thermischen Nutzung des Grundwassers im Stadtgebiet Biberach: Brauchen wir ein thermisches Management? Dr. Rainer Klein, boden & grundwasser
Stadt Diepholz. Herr Andy Blumberg B.Sc. (FH) 04441/ Rathausmarkt Diepholz. 01. April 2015
 Ingenieurgeologie Dr. Lübbe Füchteler Straße 29 49377 Vechta Stadt Diepholz Dipl.-Geow. Torsten Wagner Herr Andy Blumberg B.Sc. (FH) 04441/97975-13 Rathausmarkt 1 49356 Diepholz 01. April 2015 Füchteler
Ingenieurgeologie Dr. Lübbe Füchteler Straße 29 49377 Vechta Stadt Diepholz Dipl.-Geow. Torsten Wagner Herr Andy Blumberg B.Sc. (FH) 04441/97975-13 Rathausmarkt 1 49356 Diepholz 01. April 2015 Füchteler
Abschlussbericht zu Kennziffer 2472: Experimentelle Bestimmung von Grenzaktivitätskoeffizienten in ternären und höheren Elektrolytsystemen
 Abschlussbericht zu Kennziffer 2472: Experimentelle Bestimmung von Grenzaktivitätskoeffizienten in ternären und höheren Elektrolytsystemen Während es bei Nichtelektrolytsystemen möglich ist, mit Hilfe
Abschlussbericht zu Kennziffer 2472: Experimentelle Bestimmung von Grenzaktivitätskoeffizienten in ternären und höheren Elektrolytsystemen Während es bei Nichtelektrolytsystemen möglich ist, mit Hilfe
D i p l o m a r b e i t
 D i p l o m a r b e i t Auswirkung von Tiefbauwerken auf die Grundwassertemperatur in Dresden Inhalt 1 Einleitung 2 Methodik 3 Auswertung 4 Zusammenfassung/ Schlussfolgerungen Von Linda Wübken Betreuer:
D i p l o m a r b e i t Auswirkung von Tiefbauwerken auf die Grundwassertemperatur in Dresden Inhalt 1 Einleitung 2 Methodik 3 Auswertung 4 Zusammenfassung/ Schlussfolgerungen Von Linda Wübken Betreuer:
Kármánsche Wirbelstraßen in
 Kármánsche Wirbelstraßen in der Atmosphäre Untersuchungen mittels Large Eddy Simulation Rieke Heinze und Siegfried Raasch Institut für Meteorologie and Klimatologie Leibniz Universität Hannover DACH 2010
Kármánsche Wirbelstraßen in der Atmosphäre Untersuchungen mittels Large Eddy Simulation Rieke Heinze und Siegfried Raasch Institut für Meteorologie and Klimatologie Leibniz Universität Hannover DACH 2010
Neues Verfahren für die Planung, Begleitung und Auswertung von in situ Grundwassersanierungsmaßnahmen
 Neues Verfahren für die Planung, Begleitung und Auswertung von in situ Grundwassersanierungsmaßnahmen D. Poetke 1, J. Großmann 1, N. Hüsers und C. Nitsche 2 1 GICON Großmann Ingenieur Consult GmbH www.gicon.de
Neues Verfahren für die Planung, Begleitung und Auswertung von in situ Grundwassersanierungsmaßnahmen D. Poetke 1, J. Großmann 1, N. Hüsers und C. Nitsche 2 1 GICON Großmann Ingenieur Consult GmbH www.gicon.de
Offene Masterarbeitsthemen der AG Geothermie am LS Hydrogeologie
 Thema: Geothermie/Wärmespeicherung (1 bis 2 MA Arbeiten) Bestimmung der Matrixwärmeleitfähigkeit von Sand- und Karbonatgesteinen durch Labormessungen und Inverse Numerische Modellierung mit FeFlow Die
Thema: Geothermie/Wärmespeicherung (1 bis 2 MA Arbeiten) Bestimmung der Matrixwärmeleitfähigkeit von Sand- und Karbonatgesteinen durch Labormessungen und Inverse Numerische Modellierung mit FeFlow Die
Vom Immissionspumpversuch zum Grundwassermanagementplan
 M A G P l a n - A b s c h l u s s k o n f e r e n z 2.- 3. J u l i 2 0 1 5 H a u s d e r W i r t s c h a f t S t u t t g a r t Vom Immissionspumpversuch zum Grundwassermanagementplan 20 Jahre integrale
M A G P l a n - A b s c h l u s s k o n f e r e n z 2.- 3. J u l i 2 0 1 5 H a u s d e r W i r t s c h a f t S t u t t g a r t Vom Immissionspumpversuch zum Grundwassermanagementplan 20 Jahre integrale
Al t s t a n d o r t S ä g ew erk S t ö c k l e r K arl T eilber e i c h N or d
 1 9. O k t o b e r 201 5 B e i l a g e z u Z l. 1 1 3-6 0 2 / 1 5 Al t s t a n d o r t S ä g ew erk S t ö c k l e r K arl T eilber e i c h N or d Z u s a m m e n f a s s u n g Beim untersuchten Teilbereich
1 9. O k t o b e r 201 5 B e i l a g e z u Z l. 1 1 3-6 0 2 / 1 5 Al t s t a n d o r t S ä g ew erk S t ö c k l e r K arl T eilber e i c h N or d Z u s a m m e n f a s s u n g Beim untersuchten Teilbereich
5 Experimenteller Teil I Absorption und Anreicherung schwermetallhaltiger Gase
 5 5 Experimenteller Teil I Absorption und Anreicherung schwermetallhaltiger Gase 67 5 Experimenteller Teil I Absorption und Anreicherung schwermetallhaltiger Gase 5.1 Absorption und Anreicherung von Schwermetallen
5 5 Experimenteller Teil I Absorption und Anreicherung schwermetallhaltiger Gase 67 5 Experimenteller Teil I Absorption und Anreicherung schwermetallhaltiger Gase 5.1 Absorption und Anreicherung von Schwermetallen
Kurzstellungnahme zu Altlastverdachtsflächen. auf dem Gelände der ehemaligen Filmstudios. Am Schierenberg in Bendestorf
 Kurzstellungnahme zu Altlastverdachtsflächen auf dem Gelände der ehemaligen Filmstudios Am Schierenberg in Bendestorf Auftraggeber: Friedrich W. Lohmann Projektentwicklung Lange Gärten 2 E 29308 Winsen
Kurzstellungnahme zu Altlastverdachtsflächen auf dem Gelände der ehemaligen Filmstudios Am Schierenberg in Bendestorf Auftraggeber: Friedrich W. Lohmann Projektentwicklung Lange Gärten 2 E 29308 Winsen
Löslichkeitsverbesserung
 Paul Elsinghorst, Jürgen Gäb Versuchsprotokoll Versuch Flüssig A1 Löslichkeitsverbesserung 1. Stichworte Lösungen (ideale/reale, gesättigte/übersättigte), Löslichkeit, Löslichkeitsprodukt Wasserstruktur
Paul Elsinghorst, Jürgen Gäb Versuchsprotokoll Versuch Flüssig A1 Löslichkeitsverbesserung 1. Stichworte Lösungen (ideale/reale, gesättigte/übersättigte), Löslichkeit, Löslichkeitsprodukt Wasserstruktur
Phytosanierung von CKW das Projekt PHYTOTOP (Mikrokosmosversuche, Standorte, Modellrechnung)
 Phytosanierung von CKW das Projekt PHYTOTOP (Mikrokosmosversuche, Standorte, Modellrechnung) Bernhard Wimmer, Andrea Watzinger, Johann Riesing, Philipp Holzknecht, Philipp Schöftner, Sarah Quast, Thomas
Phytosanierung von CKW das Projekt PHYTOTOP (Mikrokosmosversuche, Standorte, Modellrechnung) Bernhard Wimmer, Andrea Watzinger, Johann Riesing, Philipp Holzknecht, Philipp Schöftner, Sarah Quast, Thomas
in einem städtischen Raum
 Darmstadt 28. u. 29. November 2013 DECHEMA-Symposium Strategien zur Boden- und Grundwassersanierung Sanierungsstrategien Integrale Ansätze Managementplan für Grundwasser in einem städtischen Raum H.J.
Darmstadt 28. u. 29. November 2013 DECHEMA-Symposium Strategien zur Boden- und Grundwassersanierung Sanierungsstrategien Integrale Ansätze Managementplan für Grundwasser in einem städtischen Raum H.J.
In-situ Verfahren (Sanierung ohne Bauverzug) Grundwasser Behandlung (z.b. zum Schutz des Trinkwassers) Bodenluft Sanierung (zur Gefahrenbeseitigung)
 In-situ Verfahren (Sanierung ohne Bauverzug) Grundwasser Behandlung (z.b. zum Schutz des Trinkwassers) Bodenluft Sanierung (zur Gefahrenbeseitigung) Spezial Techniken (u.a. ISCO ISCR ENA) CARO SBU AG Schlottermilch
In-situ Verfahren (Sanierung ohne Bauverzug) Grundwasser Behandlung (z.b. zum Schutz des Trinkwassers) Bodenluft Sanierung (zur Gefahrenbeseitigung) Spezial Techniken (u.a. ISCO ISCR ENA) CARO SBU AG Schlottermilch
Bestimmung der gesättigten hydraulischen Leitfähigkeit (k f -Wert) aus der Kornverteilungskurve
 Bestimmung der gesättigten hydraulischen Leitfähigkeit (k f -Wert) aus der Kornverteilungskurve Methodik: - Verfahren beruht auf der praktischen Erfahrung, dass der k f -Wert abhängig ist: vom wirksamen
Bestimmung der gesättigten hydraulischen Leitfähigkeit (k f -Wert) aus der Kornverteilungskurve Methodik: - Verfahren beruht auf der praktischen Erfahrung, dass der k f -Wert abhängig ist: vom wirksamen
1. Einleitung. 1.1 Lage, Historie. 1.2 Schadenssituation
 Unterstützung einer hydraulischen Sanierungsmaßnahme durch den Einsatz des Airsparging Verfahrens am Beispiel eines LCKW- Schadens auf einem ehemaligen Produktionsstandort für den medizinischen Gerätebau
Unterstützung einer hydraulischen Sanierungsmaßnahme durch den Einsatz des Airsparging Verfahrens am Beispiel eines LCKW- Schadens auf einem ehemaligen Produktionsstandort für den medizinischen Gerätebau
Modellierung der Interaktion zwischen Fluss und Grundwasser Zwei Beispiele aus der Region Zürich
 Tagung Numerische Grundwassermodellierung Graz, 24.-25. Juni 2008 Modellierung der Interaktion zwischen Fluss und Grundwasser Zwei Beispiele aus der Region Zürich Fritz STAUFFER, Tobias DOPPLER und Harrie-Jan
Tagung Numerische Grundwassermodellierung Graz, 24.-25. Juni 2008 Modellierung der Interaktion zwischen Fluss und Grundwasser Zwei Beispiele aus der Region Zürich Fritz STAUFFER, Tobias DOPPLER und Harrie-Jan
