Mit diesem Beitrag soll ein Einblick
|
|
|
- Innozenz Esser
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Baukerntemperierung Möglichkeiten und Grenzen Die thermische Aktivierung von Böden bzw. Decken in Bürogebäuden zur Kühlung und zur Beheizung solcher Bauwerke stößt in jüngster Zeit bei Architekten, Bauherren und Fachplanern auf Interesse. Die Ursachen liegen in erster Linie in dem großen Kostesparpotential und der Möglichkeit der energetisch besonders günstigen, nächtlichen Rückkühlung. Nach [1] werden bereits für ein Drittel aller Neubauten sogenannte Thermoaktive Decken vorgesehen. Prof. Dr.-Ing. Gerhard Hausladen, Dipl.-Ing. Ludwig Langer Ingenieurbüro Hausladen GmbH, Kirchheim Mit diesem Beitrag soll ein Einblick in die vielfältigen, mit dem System Thermoaktive Decke verbundenen Fragestellungen sowie deren Lösung gegeben werden. Eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema erscheint aufgrund der (noch) nicht existierenden Dimensionierungsregeln und der komplexen physikalischen Vorgänge dringend erforderlich. Nur auf diesem Weg können Planungsfehler vermieden werden. Dies ist wiederum Voraussetzung, um in der Öffentlichkeit ein positives Bild über das ökonomisch und ökologisch vielversprechende System Thermoaktive Decke entstehen zu lassen. Das Prinzip Die Beheizung und die Kühlung insbesondere von Bürogebäuden erfolgt in der Regel über seperate Systeme wie zum Beispiel Heizkörper und Kühldecke. Die Temperierung der Bauteile, insbesondere der Betondecke, ermöglicht es, beide Funktionen in einem System zusammenzuführen. Charakteristisch für eine solche Bauteilheizung bzw. Bauteilkühlung ist die Wärmeabgabe (Heizen) und -aufnahme (Kühlen) über die Fußboden- und die Deckenfläche. Die Temperierung des Deckenaufbaus erfolgt über im Bauteil verlegte, wasserdurchströmte Rohrschlangen. Diese können sowohl in der Betonplatte als auch im Estrich eingegossen sein. Bild 1: Thermoaktive Decke Rohrschlangen auf der Bodenplatte vor dem Eingießen in den Verbundestrich Einbausituation Da bei der Baukerntemperierung generell ein Wärmestrom von den wasserführenden Leitungen zur Fußboden- und Deckenoberfläche (Heizfall) bzw. in umgekehrter Richtung (Kühlfall) vorliegt, erweisen sich jegliche Schichten mit hohen Wärmedurchgangswiderständen als Einschränkung der Leistungsfähigkeit. Hohe Wärmedurchgangswiderstände resultieren aus abgehängten Decken, aus Teppich- oder Parkettböden oder auch aus der Trittschalldämmung. Der Deckenaufbau ist bezüglich der Wärmedurchgangswiderstände zu optimieren. Übernimmt ein gut dämpfender Bodenbelag wie ein Teppichboden den Trittschallschutz, kann u. U. auf eine zusätzliche Trittschalldämmung verzichtet werden. Eine akzeptable Raumakustik kann statt mit abgehängten Decken auch mit frei schwebenden Akustikpaneelen erreicht werden. Rechenmodell Für die Dimensionierung und die Regelung der Thermoaktiven Decke existieren heute noch keine allgemein gültigen Re TAB 6/2 55
2 geln wie beispielsweise für die Auslegung von Heizkörpern. Die Berechnung der thermischen Vorgänge in der Decke und im Raum werden mit dynamischen Simulationsprogrammen durchgeführt. Mit diesen können reale oder fiktive Wetterszenarien und Belegungsprofile des Gebäudes nachgefahren werden. Die Be- und Entladung der Speichermasse sowie die Wärmeabgabe an den Raum (Heizen) bzw. die Wärmeaufnahme aus dem Raum (Kühlen) lässt sich modellieren und berechnen. Ein spezielles Modul für die Berechnung der thermischen Abläufe im Bodenaufbau ermöglicht mit Hilfe eines Finite-Differenzen-Verfahrens die Abbildung der dreidimensionalen Wärmeleitvorgänge. Die Physik Die Auslegung einer Bauteilheizung bzw. einer Bauteilkühlung erfordert ein grundsätzliches Verständnis der physikalischen Vorgänge in dem temperierten Bauteil sowie im Gebäude. Die große Speichermasse und die damit verbundene thermische Trägheit solcher Systeme bergen ein nicht zu unterschätzendes Fehlerpotential. Die falsche Auslegung kann im Sommer zu Überhitzung sowie zu Behaglichtkeitsproblemen führen. In der Übergangszeit besteht die Gefahr, dass Räume mit geringen inneren oder solaren Lasten nicht ausreichend beheizt werden, während Räume mit hohen Lasten überhitzen. Die Speichermassen der Thermoaktiven Decke werden genutzt, um den Raum zu heizen und zu kühlen. Die Temperierung erfolgt über in der Bodenplatte oder im Estrich verlegte Rohrschlangen. Die Thermoaktive Decke unterscheidet sich von allen gängigen Heiz- und Kühlsystemen durch deren große thermische Trägheit. So benötigt die Decke bei schnellen Lastwechseln einige Stunden, bis sie auf die neuen Randbedingungen eingeschwungen ist. Beispielhaft für einen warmen Sommertag ist in Bild 2 das typische Temperaturverhalten eines mit der Thermoaktiven Decke ausgestatteten Büros aufgezeigt. Bild 2 zeigt dabei drei klare Tage mit hohen solaren Einstrahlungswerten. Die steigt deutlich über 3 C. Die Raumtemperatur in dem typischen Büroraum klettert im Laufe des Tages bis auf etwa 28 C. Sie liegt damit während der Belegung zwischen 2 und Wärmestrom [W] Temperatur [ C] Raumtemperatur innere Last Büro 2 m 2 innere Last 15 W/m 2 solare Last 25 W/m 2 Belegung 8 bis 18 Uhr Fensterlüftung Luftwechselraten während Belegung 1,5 1/h zusätzlich Infiltration,2 1/h Fensterflächenanteil 4 % Orientierung West außenliegender Sonnenschutz September 2. September Tabelle 1: Randbedingungen solare Last 3. September Bild 2: Thermoaktive Decke Raumtemperaturverlauf im Sommer 4 K unter der. Überschüssige Wärmemengen, hervorgerufen durch solare Einstrahlung und innere Lasten, werden in den Böden und Decken zwischengespeichert und bewirken einen Anstieg der mittleren Deckentemperatur. Mit diesem Temperaturanstieg erfolgt parallel der Anstieg der operativen Raumtemperatur, welcher jedoch durch die Speichermassen stark gedämpft wird. Der Abtransport der überschüssigen Wärmemenge erfolgt kontinuierlich rund um die Uhr. Es lässt sich feststellen, dass die Begrenzung der Raumtemperatur für die mit raumlufttechnischen Anlagen ausgestatteten Gebäude nach DIN 1946 Teil 2 geltende Maximaltemperatur von 26 C (bei en größer als 3 C : 27 C) mit dem System Thermoaktive Decke in der Regel nicht eingehalten werden kann. Die vorgefundene Situation, tagsüber Raumtemperaturen deutlich unter der Außenlufttemperatur vorzutreffen, wird vom Nutzer aber trotzdem noch als angenehm empfunden. Eine Raumtemperatur von bis zu 28 C erscheint akzeptabel. Anhand des in Bild 2 betrachteten Raumes sowie der entsprechenden Randbedingungen werden die Raumtemperaturen bei unterschiedlichen Kühlstrategien in Bild 3 gegenübergestellt: Ohne Kühlung steigen die Raumtemperaturen auf über 3 C, die vom Nutzer als unbehaglich empfunden werden. Das System Thermoaktive Decke ist in der Lage, die Raumtemperatur deutlich unter der Außenluft zu halten und damit noch behagliche Verhältnisse zu gewährleisten. Mit einer Vollklimatisierung lässt sich eine beliebige Raumtemperatur einstellen. Die maximale Leistung des Systems Thermoaktive Decke hängt u. a. von der jeweiligen Einbaulage der Rohrschlangen, vom Verlegeabstand, vom Durchsatz sowie von den Vorlauftemperaturen ab. Die angegebenen Zahlenwerte geben die Grenzen an, die bei Berücksichtigung allgemein gültiger technischer Regeln unter Einhaltung der Behaglichkeit erreicht werden können. Die Heizleistung der Thermoaktiven Decke reicht aus, um den Transmissionswärmebedarf nach heutigem Standard gedämmter Bürogebäude mit einem Fensterflächenanteil von bis etwa 7 % zu decken. Der Lüftungswärmebedarf kann beispielsweise von einer Lüftungsanlage aufgebracht werden. Die Regelung Aufgrund der großen thermischen Trägheit der Thermoaktiven Decke muss deren Temperierung eine speziell an die Charakteristik des Systems angepasste 56 TAB 6/
3 [W/m 2 ] Temperatur [ C] Raumtemperatur ohne Kühlung Raumtemperatur mit thermoaktiver Decke Raumtemperatur mit Vollklimatisierung solare Einstrahlung Fassade (West) September 2. September 3. September Bild 3: Vergleich von Kühlstrategien Thermoaktive Decke in Bereitschaft. Dieser Zustand wird im Flow-Chart in Bild 5 mit Aus beschrieben. Um auch in der Betriebsweise Aus die nötige Information über den Zustand der Thermoaktiven Decke zu erhalten und damit bei Bedarf zum Zustand Heizen oder Kühlen zurück zu gelangen, wird ein auf einem Bruchteil des Auslegungsmassenstroms reduzierter Durchsatz gefahren. Da die Durchströmungsgeschwindigkeit klein ist, nimmt das Wasser in den Rohren in diesem Betriebszustand nahezu die Temperatur der Decke an. Unterschreitet die Rücklauftemperatur t R = 21, C, so ist dies ein Indiz für eine notwendige Beheizung des Raumes, die maximale Leistung Kühlfall 3 4 W/m 2 Heizfall 25 3 W/m 2 Tabelle 2: Heiz- und Kühlleistungen -12 C +2 C heizen +32 C +26 C kühlen heizen Start. Aus m= 1 % +22 C +22 C Regelung übernehmen. Eine dem System nicht entsprechende Regelung kann aufgrund der großen Totzeiten nicht durch kurzfristiges Gegensteuern kompensiert werden. Eine vorausschauende oder prognosegesteuerte Regelung vermag zu starken Absinken oder Ansteigen der Raumtemperatur entgegenwirken. Wetterprognosen, aktuelle Wetterdaten und auch Belegungsdichten können zur Festlegung der Durchströmung und der gewählten Vorlauftemperaturen dienen. Diese Methode beinhaltet das Risiko, dass sich bei nicht korrekter Prognose die im Vorfeld berechneten Verhältnisse nicht einstellen, im schlimmsten Fall kann es zu zu niedrigen Raumtemperaturen oder zur Überhitzung des Raumes kommen. Eine alternative Methode ist, die Temperatur der Decke in einem Temperaturband von etwa 21 bis 23 C zu halten. Wird dieses Temperaturband eingehalten, so können plötzliche Lastwechsel keinen Schaden anrichten. Bleibt eine hohe Einstrahlung beispielsweise bei gleichzeitigem Abfallen der Außenlufttemperaturen aus, so ist die 22 C warme Decke in der Lage, ein Büro auf einer Raumtemperatur von 2 C zu halten. Die so temperierte Decke ist gleichzeitig in der Lage, einen Raum mit 26 C zu kühlen. Diese Fähigkeit, je nach Raumtemperatur die Funktionen Heizen oder Kühlen abdecken zu können, wird als Selbstregelungseffekt bezeichnet. Eine sehr einfache Methode, Aufschluss über die Temperatur der Thermoaktiven Decke zu erhalten und damit die Temperatur der Decke zu regeln, ist das Messen der Rücklauftemperatur. Die auf diese Methode aufbauende Regelung wird an dieser Stelle vorgestellt. Grundsätzlich existieren die Betriebsweise Heizen und Kühlen. Besteht weder Heiz- noch Kühlbedarf, so schaltet die t R < 21 C?. Heizen m= 1 % t R > 23,5 C? t R 23 C. Kühlen m= 1 % t R < 21,5 C? kühlen Bild 4: Thermoaktive Decke Heizen und Kühlen Bild 5: Thermoaktive Decke Regelung nach Rücklauftemperatur Thermoaktive Decke geht in die Betriebsweise Heizen. Erreicht die Rücklauftemperatur t R = 23, C, so wird die Betriebsweise Heizen wieder verlassen. Das Überschreiten der 23,5 C Grenze ist ein Indiz für zu hohe Kühllasten im Raum. Die Decke geht in die Betriebsweise Kühlen. Sinkt die Rücklauftemperatur t R auf unter 21,5 C ab, so wird die Kühlung abgeschaltet, der Betriebszustand Aus tritt in Kraft. In der hier vorgestellten Regelung ist ein TAB 6/2 57
4 Temperatur [ C] 23,5 23, 21,5 21, Aus Heizen Aus Kühlen Aus. m= 1 % m= 1 % Hystereseband von 2 K eingebaut. Das heißt ein im Zustand Heizen befindender Regelkreis, welcher bei einer Unterschreitung der Rücklauftemperatur von 21 C aktiviert wurde, verlässt erst bei einem Anstieg der Rücklauftemperatur auf über 23 C den Zustand Heizen. Analog wird der Zustand Kühlen, der bei einer Rücklauftemperatur von über 23,5 C aktiviert wurde, bei einem Absinken der Rücklauftemperatur auf unter 21,5 C ausgeschaltet. In Bild 6 ist ein exemplarischer Verlauf der Rücklauftemperatur mit dem jeweilig angesteuerten Betriebszustand dargestellt. Für den in Bild 2 betrachteten Fall sind in Bild 7 Vor- und Rücklauftemperatur sowie der Massenstrom der Thermoaktiven Decke dargestellt. Die Kühlung erfolgt hier mittels Grundwasser rund um die Uhr. Zu erkennen ist am 31. August ein [W/m 2 ] [ C] [kg/h] Temperatur [ C] m= 1 % Zeit Bild 6: Thermoaktive Decke Wechsel zwischen einzelnen Betriebsweisen Anstieg der Rücklauftemperatur bis auf 23,5 C. Bei diesem Wert geht die Kühlung in Betrieb. Am 4. September schaltet sie aufgrund der zu starken Abkühlung der Decke und damit der Rücklauftemperatur kurzfristig aus, geht jedoch wegen der weiterhin hohen Wärmelasten nach wenigen Stunden wieder an. Am Ende des 6. Septembers schaltet die Kühlung in Folge der zurückgehenden erneut ab. In Bild 8 ist für zwei mit unterschiedlichen Lasten beaufschlagte, identische Räume der Wärmestrom von Thermoaktiver Decke zum Raum (Heizen: positive Werte im Diagramm) bzw. in entgegengesetzter Richtung (Kühlen:negative Werte) dargestellt. Gewählt ist eine Periode der Übergangszeit von 3 Tagen. Am Ausschlag der Kurven ist zu erkennen, in Aug. 31. Aug. 1. Sept. 2. Sept. 3. Sept. 4. Sept. 5. Sept. 6. Sept. Vorlauftemperatur empfundene Raumtemperatur Massenstrom 7. Sept. solare Einstrahlung Fassade (West) welchem Betriebszustand sich die Thermoaktive Decke befindet: Im Raum ohne innere Lasten befindet sich die Regelung z. B. zu Beginn und am Ende der Periode im Zustand Heizen, dazwischen einige Tage im Zustand Aus. Der Raum mit inneren Lasten schaltet dagegen überhaupt nicht in den Zustand Heizen, bei en über etwa 15 C geht er in den Zustand Kühlen über. Insgesamt lässt sich für beide Räume ein stabiles Verhalten ohne häufiges Umschalten erkennen. Die individuell für jedes Gebäude zu wählenden Vorlauftemperaturen und Massenströme ergeben sich aus der jeweiligen Heiz- bzw. Kühllast. Sie sind so zu wählen, dass das System stabil läuft (kein häufiges Takten). Die Vorlauftemperaturen sollten sich im Bereich der Raumsolltemperaturen bewegen, damit der oben beschriebene Selbstregeleffekt erhalten bleibt. Liegt die Vorlauftemperatur beispielsweise über 3 C, so kann die Decke Temperaturen von 25 bis 3 C annehmen. Die Decke ist damit bei plötzlichen Lastwechseln nicht in der Lage, eine Kühlfunktion zu erfüllen. Analog dazu können zu niedrige Vorlauftemperaturen im Kühlfall zu zu niedrigen Bodentemperaturen führen und damit ein Unbehaglichkeitsempfinden beim Nutzer hervorrufen. Energetisches Verhalten von Gebäuden mit Baukerntemperierung Wie bereits oben beschrieben werden bei dem System Thermoaktive Decke sehr große Speichermassen thermisch aktiviert. Die große Trägheit bewirkt ein relativ langes Nachschwingen des Systems. Das Fahren exakter Raumtemperaturen gelingt beispielsweise im Heizfall nur mit zusätzlichen Heizkörpern. Darüber hinaus ist bei der Thermoaktiven Decke aufgrund der geringen Temperaturspreizungen mit einem höheren Massenstrom als beispielsweise bei Heizkörpern oder einer Kühldecke zu rechnen. Damit erhöht sich der Strombedarf für die Pumpen. Einsatzgebiete Thermoaktive Decke Die Thermoaktive Decke weist beim Einsatz als Heiz- und Kühlsystem im Vergleich zu konventionellen Systemen, wie Bild 7: Thermoaktive Decke Beispiel Regelung 58 TAB 6/
5 Bild 8: Verwaltungsgebäude der deutschen Messe AG, die thermoaktive Decke wird über ein auf dem Dach aufgestelltes Kühlwerk während der Nacht rückgekühlt das Beispiel in Tabelle 3 auf der folgenden Seite zeigt, deutlich geringere Investitionskosten auf. Auf der anderen Seite ergibt sich, wie oben aufgezeigt, ein höherer Pumpenstrombedarf. Rein ökonomisch betrachtet, schneidet die Thermoaktive Decke in der Regel bei der Betrachtung der Gesamtkosten inklusive der Betriebskosten deutlich besser ab als ein konventionelles Heiz-/Kühlsystem. Aus ökologischen Gründen sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Vorzüge des Systems genutzt werden, um den Primärenergiebedarf des Gebäudes durch das System Thermoaktive Decke so gering wie möglich und damit niedriger als bei konventionellen Heiz- und Kühlsystemen zu halten. Folgende Eigenschaften sollten hierzu genutzt werden: Im Heizfall kommt die Thermoaktive Decke mit Vorlauftemperaturen von unter 3 C aus. Es bietet sich somit besonders der Einsatz von Wärmepumpen an. Darüber hinaus wird die Nutzung von Abwärme, soweit vorhanden, durch das niedrige Temperaturniveau begünstigt. Die Be- und Entladung der Speichermassen kann kontinuierlich erfolgen. Damit entfallen hohe Lastspitzen. Kältemaschinen können wesentlich geringer dimensioniert werden bzw. bei der Kühlung mit Nachtkälte oder Grundwasser gänzlich entfallen TAB 6/2 59
6 [W/m 2 ] [ C] Wärmestrom [W] Di.3.Apr. Fr.6.Apr. Mo.9.Apr. Do.12.Apr. So.15.Apr. Mi.18.Apr. Sa.21.Apr. Di.24.Apr. Fr.27.Apr. Mo.3.Apr. Do.3.Mai Raum ohne innere Lasten Raum mit inneren Lasten Bild 9: Thermoaktive Decke Stabilität Regelung solare Einstrahlung Fassade (Süd) Tabelle 3 enthält die geschätzten Kosten zweier Systeme zur Beheizung und Kühlung von Gebäuden. Gegenübergestellt sind ein konventionelles System mit separaten Funktionen Heizen (Heizkörper) und Kühlen (Kühldecke) mit dem System Thermoaktive Decke, bei dem die Heizfunktion zur besseren Einzelraumregelung mit Heizkörpern unterstützt wird. Beide Systeme sind mit einer Lüftungsanlage ausgestattet, die auf einen hygienischen Mindestluftwechsel ausgelegt ist. Die Nutzung der Nachtkälte kann über Wasserrückkühlwerke realisiert werden. Die großen Speichermassen ermöglichen eine Zwischenspeicherung der überschüssigen Wärme während des Tages. Der Rückkühlvorgang erfolgt während der Nachtstunden. Bei Wasserrückkühlwerken stammt der größere Teil der Kühlenergie aus der Verdunstung des Kühlwassers selbst (offene Kühlwerke) bzw. aus der Verdunstung des aufgesprühten Wassers (geschlossene Kühlwerke). Die sensible Wärmeabgabe an die Außenluft macht den geringeren Anteil aus. konventionelles System System Thermoaktive Decke Heizkörper 6 DM/m 2 4 DM/m 2 Baukerntemperierung 13 DM/m 2 Kühldecke 4 DM/m 2 Lüftungsanlage 6 DM/m 2 6 DM/m 2 gesamt 52 DM/m 2 23 DM/m 2 Tabelle 3: Vergleich der Investitionskosten Fazit Die Baukerntemperierung stellt ein kostengünstiges System zur Beheizung und Kühlung von Gebäuden dar. Bei richtiger Planung und Nutzung der Besonderheiten des Systems kann der Primärenergiebedarf gegenüber einem konventionellen System deutlich reduziert werden. Bezüglich Behaglichkeit und Komfort sind geringfügige Abstriche in Kauf zu nehmen: das Fahren einer konstanten Raumtemperatur von 26 C im Sommer ist mit dem System nicht möglich, eine individuelle Einzelraumregelung in der Heizperiode kann ohne zusätzlich installierte, separat zu regelnde Heizflächen nicht erreicht werden. Insgesamt stellt das System eine interessante Alternative zur konventionellen Klimatisierung dar. Die Planung sollte jedoch von erfahrenen Teams durchgeführt werden. Dynamische Simulationswerkzeuge sind für die Auslegung zu empfehlen. Bild 1: Verwaltungsgebäude Dormagen: Außenansicht Architekt: ArlS Dipl.-Ing. B. Schuster + S. Blume, A. Brauser Planung: Ingenieurbüro Hausladen GmbH Die Thermoaktive Decke wird über Grundwasser rückgekühlt. Die Beheizung erfolgt über eine Grundwasser-Wärmepumpe Literatur [1] Zukunftstechnologie Aktivspeichersysteme, TAB 8/99, Dr.-Ing. Rudi Marek, HL Technik 6 TAB 6/
Planungspraxis mit Hilfe der thermischen Simulation anhand von Projektbeispielen
 Planungspraxis mit Hilfe der thermischen Simulation anhand von Projektbeispielen Dipl.-Ing. Roland Miller 3.02.01 Theaterschiff Stuttgart 04.07.2014 www.kurz-fischer.de Winnenden Halle (Saale) Bottrop
Planungspraxis mit Hilfe der thermischen Simulation anhand von Projektbeispielen Dipl.-Ing. Roland Miller 3.02.01 Theaterschiff Stuttgart 04.07.2014 www.kurz-fischer.de Winnenden Halle (Saale) Bottrop
effektiver einsatz von heiz- und kühlenergie bauteiltemperierung
 effektiver einsatz von heiz- und kühlenergie bauteiltemperierung bauteilaktivierung für stahlbetonkonstruktionen. im gebäudebereich ist die nutzung der thermischen speicherkapazität der böden, decken und
effektiver einsatz von heiz- und kühlenergie bauteiltemperierung bauteilaktivierung für stahlbetonkonstruktionen. im gebäudebereich ist die nutzung der thermischen speicherkapazität der böden, decken und
Unser Innovationsprojekt WIE FUNKTIONIERT DIE BETONKERNAKTIVIERUNG? Wissenswertes
 Unser Innovationsprojekt 2017 WIE FUNKTIONIERT DIE BETONKERNAKTIVIERUNG? Wissenswertes WIEN 23 Kugelmanngasse 1A Wie funktionierts? Das Prinzip Das Behaglichkeitsdiagramm In der Betondecke ist ein Rohrsystem
Unser Innovationsprojekt 2017 WIE FUNKTIONIERT DIE BETONKERNAKTIVIERUNG? Wissenswertes WIEN 23 Kugelmanngasse 1A Wie funktionierts? Das Prinzip Das Behaglichkeitsdiagramm In der Betondecke ist ein Rohrsystem
Thermischer Komfort im Sommer
 Musterdokumentation Kriterium Nr. 19 Thermischer Komfort im Sommer Die Musterbeispiele - eine Auswahl bereits eingereichter und bearbeiteter Prüfungsunterlagen unterschiedlicher Bauprojekte sollen Unterstützung
Musterdokumentation Kriterium Nr. 19 Thermischer Komfort im Sommer Die Musterbeispiele - eine Auswahl bereits eingereichter und bearbeiteter Prüfungsunterlagen unterschiedlicher Bauprojekte sollen Unterstützung
Wärme und Kälteversorgung Komfortkonzept
 Wärme und Kälteversorgung Komfortkonzept Neubau Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Präsentation zur Sitzung am 16.07.2014 Revisionsstand 12.07.2014 IFH/TRANSSOLAR 1 Basisdaten Neubau Rathaus Verbandsgemeinde
Wärme und Kälteversorgung Komfortkonzept Neubau Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Präsentation zur Sitzung am 16.07.2014 Revisionsstand 12.07.2014 IFH/TRANSSOLAR 1 Basisdaten Neubau Rathaus Verbandsgemeinde
Flächenheizung: Zusatznutzen für die Behaglichkeit im Sommer Flächenkühlung
 Flächenheizung: Zusatznutzen für die Behaglichkeit im Sommer Flächenkühlung Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz ITG Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden Inhalt Kühlung im Wohnbau Motivation Technische
Flächenheizung: Zusatznutzen für die Behaglichkeit im Sommer Flächenkühlung Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz ITG Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden Inhalt Kühlung im Wohnbau Motivation Technische
Kühl und energieeffizient
 August 2012 Kühl und energieeffizient Uponor: passive Kühlung ohne Wärmepumpe Die solare Erwärmung und die starke Dämmung der Gebäudehülle führen in den Sommermonaten und in der Übergangszeit immer häufiger
August 2012 Kühl und energieeffizient Uponor: passive Kühlung ohne Wärmepumpe Die solare Erwärmung und die starke Dämmung der Gebäudehülle führen in den Sommermonaten und in der Übergangszeit immer häufiger
ClouSet Projektierung
 1 Allgemeine Informationen und Grundlagen Für die optimale Auslegung der Fußbodenheizung ist die wichtigste Grundlage eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 (Ausführliches Verfahren). Für eine korrekte
1 Allgemeine Informationen und Grundlagen Für die optimale Auslegung der Fußbodenheizung ist die wichtigste Grundlage eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 (Ausführliches Verfahren). Für eine korrekte
Innovative Systeme zur Beheizung und Kühlung von Gebäuden
 Innovative Systeme zur Beheizung und Kühlung von Gebäuden Strahlungsheizung / -kühlung Ulmann Rolf Leiter Technik Zürich / Luzern, Mai 2011 Thermische Behaglichkeit Einflussfaktoren Bekleidung Beschäftigungsgrad
Innovative Systeme zur Beheizung und Kühlung von Gebäuden Strahlungsheizung / -kühlung Ulmann Rolf Leiter Technik Zürich / Luzern, Mai 2011 Thermische Behaglichkeit Einflussfaktoren Bekleidung Beschäftigungsgrad
HYBRIDKÜHLDECKEN A11 Hybrid. Klimadecken & Hybridsysteme
 HYBRIDKÜHLDECKEN A11 Hybrid Klimadecken & Hybridsysteme Reduktion des CO 2 -Ausstosses durch Energieeffizienz 2 3 Langfristige Entwicklung der CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre In der Atmosphäre herrscht
HYBRIDKÜHLDECKEN A11 Hybrid Klimadecken & Hybridsysteme Reduktion des CO 2 -Ausstosses durch Energieeffizienz 2 3 Langfristige Entwicklung der CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre In der Atmosphäre herrscht
ALTE-PUMPSTATION-HAAN Neuste Technik hinter alter Fassade
 ALTE-PUMPSTATION-HAAN Neuste Technik hinter alter Fassade Objekt: Alte-Pumpstation-Haan Zur Pumpstation 1 42781 Haan Planer Energietechnik: PBS & Partner Zur Pumpstation 1 42781 Haan 02129 / 375 72-0 Architekt:
ALTE-PUMPSTATION-HAAN Neuste Technik hinter alter Fassade Objekt: Alte-Pumpstation-Haan Zur Pumpstation 1 42781 Haan Planer Energietechnik: PBS & Partner Zur Pumpstation 1 42781 Haan 02129 / 375 72-0 Architekt:
Holz macht Lust auf mehr. Unternehmermagazin für Holzbau und Ausbau August. Komfort und Technik. Wohngesundheit Holz tut gut
 8.213 ISSN 944-5749 12,8 C= Unternehmermagazin für Holzbau und Ausbau Wohngesundheit Holz tut gut Fenster, Türen, Tore Schutz mal drei Energieeffizienz Wissen ist Markt Komfort und Technik Holz macht Lust
8.213 ISSN 944-5749 12,8 C= Unternehmermagazin für Holzbau und Ausbau Wohngesundheit Holz tut gut Fenster, Türen, Tore Schutz mal drei Energieeffizienz Wissen ist Markt Komfort und Technik Holz macht Lust
FLÄCHENKÜHLSYSTEM - FUßBODENKÜHLUNG
 FLÄCHENKÜHLSYSTEM - FUßBODENKÜHLUNG INHLATSVERZEICHNIS AUFBAU / KONSTRUKTIONEN FUNKTIONSWEISE ANLAGENTECHNIK Vorteile und nachteile AUFBAU / KONSTRUKTION Die Komponenten der Fußbodenkühlung entsprechen
FLÄCHENKÜHLSYSTEM - FUßBODENKÜHLUNG INHLATSVERZEICHNIS AUFBAU / KONSTRUKTIONEN FUNKTIONSWEISE ANLAGENTECHNIK Vorteile und nachteile AUFBAU / KONSTRUKTION Die Komponenten der Fußbodenkühlung entsprechen
Wärmeübergabe als wichtiger Baustein in zukünftigen Heizsystemen. Ralf Kiryk Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.v.
 Wärmeübergabe als wichtiger Baustein in zukünftigen Heizsystemen Ralf Kiryk Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.v. Energieeffizienz in Deutschland Heutiger Primärenergiebedarf entspricht rund
Wärmeübergabe als wichtiger Baustein in zukünftigen Heizsystemen Ralf Kiryk Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.v. Energieeffizienz in Deutschland Heutiger Primärenergiebedarf entspricht rund
Thermische Bauteilaktivierung
 Oktober 2012 Thermische Bauteilaktivierung Effiziente und stille Kühlung Neben steigenden Nutzeranforderungen an Ausstattung, Komfort und Innenraumklima ist Wirtschaftlichkeit im heutigen Büro- und Gewerbebau
Oktober 2012 Thermische Bauteilaktivierung Effiziente und stille Kühlung Neben steigenden Nutzeranforderungen an Ausstattung, Komfort und Innenraumklima ist Wirtschaftlichkeit im heutigen Büro- und Gewerbebau
Beton Kemmler Information zur Betonkernaktivierung mit Verbundrohren. Copyright 2015 Beton Kemmler GmbH Matthias Siegel Dipl.-Bauing.
 Beton Kemmler Information zur Betonkernaktivierung mit Verbundrohren Copyright 2015 Beton Kemmler GmbH Matthias Siegel Dipl.-Bauing.(FH) 1 Information: Betonkernaktivierung 1. Was ist Betonkernaktivierung
Beton Kemmler Information zur Betonkernaktivierung mit Verbundrohren Copyright 2015 Beton Kemmler GmbH Matthias Siegel Dipl.-Bauing.(FH) 1 Information: Betonkernaktivierung 1. Was ist Betonkernaktivierung
Simulation des energieautarken Hauses Brütten
 Simulation des energieautarken Hauses Brütten Forschung & Entwicklung Zentrum für Integrale Gebäudetechnik Nadège Vetterli Senior Wissenschaftliche Mitarbeiterin T direkt +41 41 349 39 13 nadege.vetterli@hslu.ch
Simulation des energieautarken Hauses Brütten Forschung & Entwicklung Zentrum für Integrale Gebäudetechnik Nadège Vetterli Senior Wissenschaftliche Mitarbeiterin T direkt +41 41 349 39 13 nadege.vetterli@hslu.ch
Neubauten Thermischer Komfort und sommerlicher Wärmeschutz. Thermischer Komfort. Referentin: B.Sc. Theresa Hecking GMW-Ingenieurbüro GmbH
 Neubauten Thermischer Komfort und sommerlicher Wärmeschutz Thermischer Komfort 1 Referentin: B.Sc. Theresa Hecking GMW-Ingenieurbüro GmbH Thermischer Komfort Eigene Darstellung; Inhaltlich Klaus Daniels
Neubauten Thermischer Komfort und sommerlicher Wärmeschutz Thermischer Komfort 1 Referentin: B.Sc. Theresa Hecking GMW-Ingenieurbüro GmbH Thermischer Komfort Eigene Darstellung; Inhaltlich Klaus Daniels
Erweiterung der GELSENWASSER Hauptverwaltung Heizen und Kühlen mit Erdwärme
 Institut für Gebäude- und Solartechnik Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch Mühlenpfordtstraße 23 D-38106 Braunschweig Erweiterung der GELSENWASSER Hauptverwaltung Heizen und Kühlen mit Erdwärme Dipl.-Ing.
Institut für Gebäude- und Solartechnik Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch Mühlenpfordtstraße 23 D-38106 Braunschweig Erweiterung der GELSENWASSER Hauptverwaltung Heizen und Kühlen mit Erdwärme Dipl.-Ing.
Bericht Nr. H.0611.S.393.EMCP-Produktion
 Beheizung von Industriehallen Rechnerischer Vergleich der Wärmeabgabe von Deckenstrahlplatten und Industrieflächenheizungen - Produktionshallen - Auftragnehmer: HLK Stuttgart GmbH Pfaffenwaldring 6A 70550
Beheizung von Industriehallen Rechnerischer Vergleich der Wärmeabgabe von Deckenstrahlplatten und Industrieflächenheizungen - Produktionshallen - Auftragnehmer: HLK Stuttgart GmbH Pfaffenwaldring 6A 70550
Neubau FOS/BOS Erding Bestehende Gastro- Berufsschule
 Bestehende Gastro- Berufsschule mb/ 22. April 2009 / 29 Folien 1 Gastro-Berufsschule Fertigstellung Oktober 2004 mb/ 22. April 2009 2 1.0 Geförderte Maßnahmen und Zielsetzungen 1.1 Passiv + nachhaltig
Bestehende Gastro- Berufsschule mb/ 22. April 2009 / 29 Folien 1 Gastro-Berufsschule Fertigstellung Oktober 2004 mb/ 22. April 2009 2 1.0 Geförderte Maßnahmen und Zielsetzungen 1.1 Passiv + nachhaltig
Sockeltemperierung, Heizkörper und Kühldecken zum Heizen und Kühlen
 Sockeltemperierung, Heizkörper und Kühldecken zum Heizen und Kühlen Zahnarztpraxis Dr. Schütz, 97529 Sulzheim Um auch an warmen Sommertagen die Patienten bei angenehmen Raumtemperaturen behandeln zu können,
Sockeltemperierung, Heizkörper und Kühldecken zum Heizen und Kühlen Zahnarztpraxis Dr. Schütz, 97529 Sulzheim Um auch an warmen Sommertagen die Patienten bei angenehmen Raumtemperaturen behandeln zu können,
Dynamische exergetische Bewertungsverfahren
 Dynamische exergetische Bewertungsverfahren Dr.-Ing. Joachim Seifert Professur für Heiz- und Raumlufttechnik, TU Dresden Dipl.-Ing. Alexander Hoh EBC Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik Zielgrößen
Dynamische exergetische Bewertungsverfahren Dr.-Ing. Joachim Seifert Professur für Heiz- und Raumlufttechnik, TU Dresden Dipl.-Ing. Alexander Hoh EBC Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik Zielgrößen
Heizen und Kühlen mit geringem Exergieeinsatz - neue Komponenten und Systeme der Versorgungstechnik - RWTH Aachen E.ON ERC Prof. Dr.-Ing.
 Heizen und Kühlen mit geringem xergieeinsatz - neue Komponenten und Systeme der Versorgungstechnik - RWTH Aachen.ON RC Prof. Dr.-Ing. Dirk Müller Stadtgebiete, Gebäude, Räume, Menschen Auswirkung der Bewertungsmethoden
Heizen und Kühlen mit geringem xergieeinsatz - neue Komponenten und Systeme der Versorgungstechnik - RWTH Aachen.ON RC Prof. Dr.-Ing. Dirk Müller Stadtgebiete, Gebäude, Räume, Menschen Auswirkung der Bewertungsmethoden
LoWaTec Betonkernaktivierung
 SYSTEMBESCHREIBUNG Die thermische Betonkernaktivierung bezeichnet Systeme, welche die speicherwirksame Bauwerksmasse/Gebäudemasse zur Reduzierung der Raumtemperaturen sowie Temperaturregulierung nutzen.
SYSTEMBESCHREIBUNG Die thermische Betonkernaktivierung bezeichnet Systeme, welche die speicherwirksame Bauwerksmasse/Gebäudemasse zur Reduzierung der Raumtemperaturen sowie Temperaturregulierung nutzen.
Um- und Neubau des Jakob-Brucker-Gymnasiums in Kaufbeuren zum Effizienzhaus Plus
 Um- und Neubau des Jakob-Brucker-Gymnasiums in Kaufbeuren zum Effizienzhaus Plus Seite 1 Seite 2 Derzeit laufen umfangreiche bauliche Maßnahmen am Jakob- Brucker-Gymnasium in Kaufbeuren. Der weitläufige
Um- und Neubau des Jakob-Brucker-Gymnasiums in Kaufbeuren zum Effizienzhaus Plus Seite 1 Seite 2 Derzeit laufen umfangreiche bauliche Maßnahmen am Jakob- Brucker-Gymnasium in Kaufbeuren. Der weitläufige
Aktuelle Trends im Bereich Klimatisierung mit VRF-Systemen
 ASYB12LDC / AOYS12LDC Aktuelle Trends im Bereich Klimatisierung mit VRF-Systemen Dr.-Ing. Manfred Stahl 6.03.2015 Seite 1 Thema 1: Eurovent-Zertifizierung von VRF-Systemen bestehende Zertifizierungssysteme
ASYB12LDC / AOYS12LDC Aktuelle Trends im Bereich Klimatisierung mit VRF-Systemen Dr.-Ing. Manfred Stahl 6.03.2015 Seite 1 Thema 1: Eurovent-Zertifizierung von VRF-Systemen bestehende Zertifizierungssysteme
Technische Gebäudeausrüstung für Bürogebäude
 Technische Gebäudeausrüstung für Bürogebäude Teil 1: Grundlagen Dr.-Ing. habil. Stefan Wirth Gliederung 1 Beispiele 1.1 Entwicklung der Bürogebäude während der letzten hundert Jahre 1.2 Beispiele für Bürogebäude
Technische Gebäudeausrüstung für Bürogebäude Teil 1: Grundlagen Dr.-Ing. habil. Stefan Wirth Gliederung 1 Beispiele 1.1 Entwicklung der Bürogebäude während der letzten hundert Jahre 1.2 Beispiele für Bürogebäude
Gebäudeplanung. - Auslegung von Heizungsanlagen - Prof. Dr. Ulrich Hahn SS Fachhochschule Dortmund
 Gebäudeplanung - Auslegung von Heizungsanlagen - Prof. Dr. Ulrich Hahn SS 2012 Dortmund Auslegung von Heizkörpern DIN 4701: Abhilfe: EN 12831: Wärmebedarf ohne Reserven Aufheizen nach Stillstand größere
Gebäudeplanung - Auslegung von Heizungsanlagen - Prof. Dr. Ulrich Hahn SS 2012 Dortmund Auslegung von Heizkörpern DIN 4701: Abhilfe: EN 12831: Wärmebedarf ohne Reserven Aufheizen nach Stillstand größere
Sanierung im Altbestand. Clemens Lehr
 Sanierung im Altbestand Clemens Lehr 1 2 Wärmebedarf ermitteln Energetische Sanierung? 3 Wärmebedarf ermitteln Durch eine Wärmebedarfsrechnung (früher nach DIN 4701, seit 2004 nach DIN EN 12831) wird die
Sanierung im Altbestand Clemens Lehr 1 2 Wärmebedarf ermitteln Energetische Sanierung? 3 Wärmebedarf ermitteln Durch eine Wärmebedarfsrechnung (früher nach DIN 4701, seit 2004 nach DIN EN 12831) wird die
Bauphysik Apero SIA 180:2014 Sommerlicher Wärmeschutz
 Bauphysik Apero SIA 180:2014 Sommerlicher Wärmeschutz Achim Geissler Raumtemperatur & Leistungsfähigkeit Raumtemperatur Leistungsfähigkeit 2000-2011 Leuwico GmbH, Wiesenfeld Bauphysik-Apero - SIA 180:2014
Bauphysik Apero SIA 180:2014 Sommerlicher Wärmeschutz Achim Geissler Raumtemperatur & Leistungsfähigkeit Raumtemperatur Leistungsfähigkeit 2000-2011 Leuwico GmbH, Wiesenfeld Bauphysik-Apero - SIA 180:2014
Knauf PCM Smartboard. Intelligentes Temperaturmanagement. Trockenbau- und Boden-Systeme 10/2008
 Knauf PCM Smartboard Intelligentes Temperaturmanagement Trockenbau- und Boden-Systeme 10/2008 emperaturaus Knauf PCM Smartboard TM Temperaturmanagement in Bestform Knauf PCM Smartboard enthält Micronal
Knauf PCM Smartboard Intelligentes Temperaturmanagement Trockenbau- und Boden-Systeme 10/2008 emperaturaus Knauf PCM Smartboard TM Temperaturmanagement in Bestform Knauf PCM Smartboard enthält Micronal
Kühlen statt heizen?
 Kühlen statt heizen? Eine Studie über Gebäudeverhalten im Klimawandel Arch. Dipl.-Ing. Renate Hammer, MAS Dipl.-Ing. Peter Holzer, Krems KÜHLEN STATT HEIZEN? SOMMERTAUGLICHKEIT IM KLIMAWANDEL Inhalt Prognose
Kühlen statt heizen? Eine Studie über Gebäudeverhalten im Klimawandel Arch. Dipl.-Ing. Renate Hammer, MAS Dipl.-Ing. Peter Holzer, Krems KÜHLEN STATT HEIZEN? SOMMERTAUGLICHKEIT IM KLIMAWANDEL Inhalt Prognose
Fußboden-Niedrigtemperaturheizung
 Fußboden-Niedrigtemperaturheizung mit 36 Heiztemperatur körperlich nicht wahrnehmbar Spar Tipp: Halten Sie die Fenster während der Heizphasen geschlossen. Die Wohnungen werden über das Lüftungssystem der
Fußboden-Niedrigtemperaturheizung mit 36 Heiztemperatur körperlich nicht wahrnehmbar Spar Tipp: Halten Sie die Fenster während der Heizphasen geschlossen. Die Wohnungen werden über das Lüftungssystem der
Berechnung der Kühllast nach VDI 2078:2015
 Institut für Luft- und Kältetechnik gemeinnützige Gesellschaft mbh Bertolt-Brecht-Allee 20 01309 Dresden, Deutschland Web: www.ilkdresden.de E-Mail: Andreas.Hantsch@ilkdresden.de Tel.: +49-351-4081-684
Institut für Luft- und Kältetechnik gemeinnützige Gesellschaft mbh Bertolt-Brecht-Allee 20 01309 Dresden, Deutschland Web: www.ilkdresden.de E-Mail: Andreas.Hantsch@ilkdresden.de Tel.: +49-351-4081-684
Kühlen Kopf bewahren Begrenzung nicht nutzbarer solarer Effekte. Kühlen Kopf bewahren. Die Begrenzung nicht nutzbarer solarer Effekte
 Kühlen Kopf bewahren Die Begrenzung nicht nutzbarer solarer Effekte Der Effekt (lat.: effectum zu efficere = bewirken) eine durch eine bestimmte Ursache hervorgerufene Wirkung Die Intensität der Sonneneinstrahlung
Kühlen Kopf bewahren Die Begrenzung nicht nutzbarer solarer Effekte Der Effekt (lat.: effectum zu efficere = bewirken) eine durch eine bestimmte Ursache hervorgerufene Wirkung Die Intensität der Sonneneinstrahlung
Planungszentrum Linth AG, Uznach
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Schlussbericht 15.12.2015 Planungszentrum Linth AG, Uznach Heizen und Kühlen mit saisonalen Energiespeichern,
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Schlussbericht 15.12.2015 Planungszentrum Linth AG, Uznach Heizen und Kühlen mit saisonalen Energiespeichern,
Entwicklung eines Planungstools zur standardisierten Auslegung thermischer/ solarer Kühlsysteme
 Entwicklung eines Planungstools zur standardisierten Auslegung thermischer/ solarer Kühlsysteme Katrin Spiegel *, Uli Jakob SolarNext AG, Nordstrasse 10, 83253 Rimsting *Tel +49 8051 6888 400, Fax +49
Entwicklung eines Planungstools zur standardisierten Auslegung thermischer/ solarer Kühlsysteme Katrin Spiegel *, Uli Jakob SolarNext AG, Nordstrasse 10, 83253 Rimsting *Tel +49 8051 6888 400, Fax +49
Systemoptimierung von Bürogebäuden
 Institut für Gebäude- und Solartechnik Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch Mühlenpfordtstraße 23 D-38106 Braunschweig www.igs.bau.tu-bs.de Systemoptimierung von Bürogebäuden Dipl.-Ing. Franziska Bockelmann
Institut für Gebäude- und Solartechnik Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch Mühlenpfordtstraße 23 D-38106 Braunschweig www.igs.bau.tu-bs.de Systemoptimierung von Bürogebäuden Dipl.-Ing. Franziska Bockelmann
Krüger + Co AG Informationsveranstaltung vom 29. Oktober 2015
 Strategien gegen Schimmel Krüger + Co AG Informationsveranstaltung vom 29. Oktober 2015 Inhaltsverzeichnis Vorstellung Einleitung Ursachen der Schimmelpilzbildung Strategien gegen Schimmelpilzbildungen
Strategien gegen Schimmel Krüger + Co AG Informationsveranstaltung vom 29. Oktober 2015 Inhaltsverzeichnis Vorstellung Einleitung Ursachen der Schimmelpilzbildung Strategien gegen Schimmelpilzbildungen
Wie ist eine Bodenplatte abzubilden, die innerhalb des 5m Bereichs gedämmt und außerhalb ungedämmt ist?
 DIN V 18599 Frage & Antwort des Monats März 2011 Frage: Wie ist eine Bodenplatte abzubilden, die innerhalb des 5m Bereichs gedämmt und außerhalb ungedämmt ist? Gastbeitrag Dipl.-Ing. (FH) Lutz Friederichs
DIN V 18599 Frage & Antwort des Monats März 2011 Frage: Wie ist eine Bodenplatte abzubilden, die innerhalb des 5m Bereichs gedämmt und außerhalb ungedämmt ist? Gastbeitrag Dipl.-Ing. (FH) Lutz Friederichs
Der Forschungsbericht wurde mit Mitteln der Forschungsinitiative Zukunft Bau des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung gefördert.
 Technische Universität Berlin Institut für Energietechnik Fachgebiet Gebäude-Energie-Systeme Hermann-Rietschel-Institut Entwicklung einer Regelung für Flächenheizsysteme zur Minderung der Pumpenergie,
Technische Universität Berlin Institut für Energietechnik Fachgebiet Gebäude-Energie-Systeme Hermann-Rietschel-Institut Entwicklung einer Regelung für Flächenheizsysteme zur Minderung der Pumpenergie,
Bayerisches Landesamt für Umwelt. Betonkernaktivierung im Passivhaus Planung, Umsetzung und Erfahrungen aus der Sicht des Bauherren
 Betonkernaktivierung im Passivhaus Planung, Umsetzung und Erfahrungen aus der Sicht des Bauherren Dr. Josef Hochhuber Bezugsobjekte für den Vortrag Passivhaus der Fam. Hochhuber Planungsleitfaden des Landesamtes
Betonkernaktivierung im Passivhaus Planung, Umsetzung und Erfahrungen aus der Sicht des Bauherren Dr. Josef Hochhuber Bezugsobjekte für den Vortrag Passivhaus der Fam. Hochhuber Planungsleitfaden des Landesamtes
Heizwärmeübergabe. Standardheizkörper Flächenheizung Heizungsregelung. Exemplarisch dargestellt anhand Beispielen von
 Standardheizkörper Flächenheizung Heizungsregelung Exemplarisch dargestellt anhand Beispielen von Standardheizkörper Bild: Buderus Bild: Buderus Heizkörper wie Konvektoren oder Radiatoren sind Bestandteil
Standardheizkörper Flächenheizung Heizungsregelung Exemplarisch dargestellt anhand Beispielen von Standardheizkörper Bild: Buderus Bild: Buderus Heizkörper wie Konvektoren oder Radiatoren sind Bestandteil
SystemlÄsungen der nåchsten Generation!
 SystemlÄsungen der nåchsten Generation! die ideale ErgÅnzung jeder Solar- und WÅrmepumpenanlage ist natçrlich eine FuÉboden-/Wand- oder Deckenheizung fçr mäglichst niedrige Systemtemperaturen. Die haben
SystemlÄsungen der nåchsten Generation! die ideale ErgÅnzung jeder Solar- und WÅrmepumpenanlage ist natçrlich eine FuÉboden-/Wand- oder Deckenheizung fçr mäglichst niedrige Systemtemperaturen. Die haben
Schaltbare Wärmedämmung zur Solarenergienutzung
 Schaltbare Wärmedämmung zur Solarenergienutzung Zur Entlastung der konventionellen Gebäudeheizung wurde im Rahmen des Projektes Schaltbare Wärmedämmung zur Nutzung der Sonnenenergie in Gebäuden am ZAE
Schaltbare Wärmedämmung zur Solarenergienutzung Zur Entlastung der konventionellen Gebäudeheizung wurde im Rahmen des Projektes Schaltbare Wärmedämmung zur Nutzung der Sonnenenergie in Gebäuden am ZAE
Heiz- und Kühldecken-Systeme Ratgeber Energieeinsparung. Heizung Kühlung Frische Luft Saubere Luft
 Heiz- und Kühldecken-Systeme Ratgeber Energieeinsparung Heizung Kühlung Frische Luft Saubere Luft Energie sparen per Strahlungswärme. Energie ist kostbar. Je knapper die Ressourcen werden, aus denen Energie
Heiz- und Kühldecken-Systeme Ratgeber Energieeinsparung Heizung Kühlung Frische Luft Saubere Luft Energie sparen per Strahlungswärme. Energie ist kostbar. Je knapper die Ressourcen werden, aus denen Energie
Herzlich Willkommen. Umweltenergie Aus Erfahrung - Fortschritt für die Zukunft!!!
 Herzlich Willkommen Entwicklung zum 1996-2015 1996 1997 1999 2000 2001 2004 2001 2002 2003 2005 2005 2006 2006 2008 2009 2010 2011 Effizienzhaus Plus nutzt die Bauteile als Energiespeicher Estrich als
Herzlich Willkommen Entwicklung zum 1996-2015 1996 1997 1999 2000 2001 2004 2001 2002 2003 2005 2005 2006 2006 2008 2009 2010 2011 Effizienzhaus Plus nutzt die Bauteile als Energiespeicher Estrich als
Heizung, Kühlung, Be- und Entlüftung
 Neue Entwicklungen bei an Fassaden Heizung, Kühlung, Be- und Entlüftung Ingenieurbüro Timmer Reichel GmbH Ohligser Str. 37 42781 Haan Tel. 02129-9377- 0 Fax - 32033 E- Mail : wreichel@itr-haan.de Internet
Neue Entwicklungen bei an Fassaden Heizung, Kühlung, Be- und Entlüftung Ingenieurbüro Timmer Reichel GmbH Ohligser Str. 37 42781 Haan Tel. 02129-9377- 0 Fax - 32033 E- Mail : wreichel@itr-haan.de Internet
Studie EnEV 2002 BRUCK ZUM GLÜCK GIBT S. Ein typisches Einfamilienwohnhaus nach der Energieeinsparverordnung EnEV
 ZUM GLÜCK GIBT S BRUCK INGENIEURBÜRO FÜR BAUSTATIK BAUPHYSIK SCHALLSCHUTZ BRANDSCHUTZ ENERGIEBERATUNG BLOWER DOOR Studie Ein typisches Einfamilienwohnhaus nach der Energieeinsparverordnung EnEV Erstellt
ZUM GLÜCK GIBT S BRUCK INGENIEURBÜRO FÜR BAUSTATIK BAUPHYSIK SCHALLSCHUTZ BRANDSCHUTZ ENERGIEBERATUNG BLOWER DOOR Studie Ein typisches Einfamilienwohnhaus nach der Energieeinsparverordnung EnEV Erstellt
Herzlich Willkommen zum Fachseminar Smart Building mit Produkten von BEKA und DGA. und Winfried Sellnau
 Herzlich Willkommen zum Fachseminar Smart Building mit Produkten von BEKA und DGA BEKA Heiz-und Kühlmatten GmbH DGA Gebäudeautomation Deutschland GmbH Albrecht Bauke, Geschäftsführer - Heinz-Ulrich Kölling,
Herzlich Willkommen zum Fachseminar Smart Building mit Produkten von BEKA und DGA BEKA Heiz-und Kühlmatten GmbH DGA Gebäudeautomation Deutschland GmbH Albrecht Bauke, Geschäftsführer - Heinz-Ulrich Kölling,
Solare Kühlung Solare Kühlung für Büros, Geschäfts-/ Schulungsräume und Hotels
 Solare Kühlung Solare Kühlung für Büros, Geschäfts-/ Schulungsräume und Hotels Dipl.-Ing. Uwe Ibanek Verkaufsleiter Schüco Int. KG Inhalt 1 Vorstellung 2 Auslegung und Rahmenbedingungen 3 Portfolio 4 Beispielanlagen
Solare Kühlung Solare Kühlung für Büros, Geschäfts-/ Schulungsräume und Hotels Dipl.-Ing. Uwe Ibanek Verkaufsleiter Schüco Int. KG Inhalt 1 Vorstellung 2 Auslegung und Rahmenbedingungen 3 Portfolio 4 Beispielanlagen
Energieeffizientes Bauen und Modernisieren
 Energieeffizientes Bauen und Modernisieren Dipl.-Ing. Maleen Holm IngenieurBüro Holm Architektur Bauphysik Energieberatung Prof. Dr. -Ing. Andreas H. Holm 8-9 Monate des Jahres wird geheizt! Schwachstellen
Energieeffizientes Bauen und Modernisieren Dipl.-Ing. Maleen Holm IngenieurBüro Holm Architektur Bauphysik Energieberatung Prof. Dr. -Ing. Andreas H. Holm 8-9 Monate des Jahres wird geheizt! Schwachstellen
Energiegespräch 2016 II ES. Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude. Klaus Heikrodt. Haltern am See, den 3. März 2016
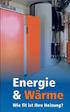 Energiegespräch 2016 II ES Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude Klaus Heikrodt Haltern am See, den 3. März 2016 Struktur Endenergieverbrauch Deutschland Zielsetzung im Energiekonzept 2010 und in
Energiegespräch 2016 II ES Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude Klaus Heikrodt Haltern am See, den 3. März 2016 Struktur Endenergieverbrauch Deutschland Zielsetzung im Energiekonzept 2010 und in
HEIZEN & KÜHLEN MIT GEOTHERMIE REHAU SYSTEMLÖSUNGEN FÜR DIE ERDWÄRMENUTZUNG
 HEIZEN & KÜHLEN MIT GEOTHERMIE REHAU SYSTEMLÖSUNGEN FÜR DIE ERDWÄRMENUTZUNG www.rehau.de Bau Automotive Industrie GEOTHERMIE REFERENT + AGENDA Referent: Dipl.-Ing. Jan Tietz REHAU AG+Co Erlangen Verantwortungsbereich:
HEIZEN & KÜHLEN MIT GEOTHERMIE REHAU SYSTEMLÖSUNGEN FÜR DIE ERDWÄRMENUTZUNG www.rehau.de Bau Automotive Industrie GEOTHERMIE REFERENT + AGENDA Referent: Dipl.-Ing. Jan Tietz REHAU AG+Co Erlangen Verantwortungsbereich:
Potenzial und Einsatzgrenzen der Bauteilaktivierung im Wohnungsbau
 Potenzial und Einsatzgrenzen der Bauteilaktivierung im Wohnungsbau (Gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, Förderkennzeichen: 0327413A). Definition: Bauteilaktivierung:
Potenzial und Einsatzgrenzen der Bauteilaktivierung im Wohnungsbau (Gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, Förderkennzeichen: 0327413A). Definition: Bauteilaktivierung:
Hybridwärmepumpe: Kombination einer Erdwärmesondenanlage mit einem Sole-Luftwärmetauscher
 Hybridwärmepumpe: Kombination einer Erdwärmesondenanlage mit einem Sole-Luftwärmetauscher Prof. Dipl.-Ing. Werner Schenk Hochschule ünchen Lothstraße 34, D-80335 ünchen werner.schenk@hm.edu 1. Anlagentechnik
Hybridwärmepumpe: Kombination einer Erdwärmesondenanlage mit einem Sole-Luftwärmetauscher Prof. Dipl.-Ing. Werner Schenk Hochschule ünchen Lothstraße 34, D-80335 ünchen werner.schenk@hm.edu 1. Anlagentechnik
Effektive Gebäudelüftungssysteme
 Effektive Gebäudelüftungssysteme Lüftungstechnik kritisch Dipl. Ing Bernd Schwarzfeld BZE ÖKOPLAN Büro für zeitgemäße Energieanwendung Energiedesign Gebäudeanalyse Solare Systeme Trnsys-; CFD-Simulationen
Effektive Gebäudelüftungssysteme Lüftungstechnik kritisch Dipl. Ing Bernd Schwarzfeld BZE ÖKOPLAN Büro für zeitgemäße Energieanwendung Energiedesign Gebäudeanalyse Solare Systeme Trnsys-; CFD-Simulationen
Kühlen mit vollflächigen Systemen. Raumkühlung durch flächenorientierte Systeme. Kühlen mit vollflächigen Systemen
 Erwin Müller Gruppe Lingen Raumkühlung durch flächenorientierte Systeme Kühlen mit vollflächigen Systemen Düsseldorf, 18.10.2005 Prof. Boiting 16.10.2005 1 Kühldeckensysteme werden unterschieden nach:
Erwin Müller Gruppe Lingen Raumkühlung durch flächenorientierte Systeme Kühlen mit vollflächigen Systemen Düsseldorf, 18.10.2005 Prof. Boiting 16.10.2005 1 Kühldeckensysteme werden unterschieden nach:
1. Objektbeschreibung. Datum der Aufstellung: 16. Mai Bezeichnung des Gebäudes oder des Gebäudeteils Nutzungsart Straße und Hausnummer :
 Energiebedarfsausweis nach 13 der Energieeinsparverordnung für den Neubau eines Gebäudes mit normalen Innentemperaturen Nachweis nach Anhang 1 Ziffer 2 der EnEV (Monatsbilanzverfahren) 1. Objektbeschreibung
Energiebedarfsausweis nach 13 der Energieeinsparverordnung für den Neubau eines Gebäudes mit normalen Innentemperaturen Nachweis nach Anhang 1 Ziffer 2 der EnEV (Monatsbilanzverfahren) 1. Objektbeschreibung
Expertenforum Beton. Heizen mit Sonne und Beton Erfahrungen aus Planung und Baupraxis
 Heizen mit Sonne und Beton Erfahrungen aus Planung und Baupraxis Bmstr. Dipl.-HTL-Ing. Anton FERLE, MAS, MSc Blitzblau Architektur GmbH, Innerschwand Harald KUSTER Kuster & Kuster GmbH, Salzburg Seit nun
Heizen mit Sonne und Beton Erfahrungen aus Planung und Baupraxis Bmstr. Dipl.-HTL-Ing. Anton FERLE, MAS, MSc Blitzblau Architektur GmbH, Innerschwand Harald KUSTER Kuster & Kuster GmbH, Salzburg Seit nun
Auslegungskriterien für thermische Behaglichkeit
 Auslegungskriterien für thermische Behaglichkeit TB 9 / 2008 n der thermischen Behaglichkeit Hinsichtlich der thermischen Behaglichkeit in Komfortanlagen definiert die europäische Norm EN ISO 7730 drei
Auslegungskriterien für thermische Behaglichkeit TB 9 / 2008 n der thermischen Behaglichkeit Hinsichtlich der thermischen Behaglichkeit in Komfortanlagen definiert die europäische Norm EN ISO 7730 drei
3. Allgemeine Schlussfolgerungen für das Bauen
 3. Allgemeine Schlussfolgerungen für das Bauen Das klimagerechte Bauen im heißem Klima muss dafür Sorge tragen, die Wärmegewinne durch die Außenbauteile während der warmen Stunden am Tag zu beschränken
3. Allgemeine Schlussfolgerungen für das Bauen Das klimagerechte Bauen im heißem Klima muss dafür Sorge tragen, die Wärmegewinne durch die Außenbauteile während der warmen Stunden am Tag zu beschränken
Prädiktive Gebäudeautomation mittels Wetterprognose
 Prädiktive Gebäudeautomation mittels Wetterprognose Prädiktive Gebäudeautomation mittels Wetterprognose Referent: Lars Willemen 26.04.2010 Practical use modumeteo 1 SAUTER Cumulus GmbH Hans Bunte Straße
Prädiktive Gebäudeautomation mittels Wetterprognose Prädiktive Gebäudeautomation mittels Wetterprognose Referent: Lars Willemen 26.04.2010 Practical use modumeteo 1 SAUTER Cumulus GmbH Hans Bunte Straße
Technische Gebäudeausrüstung
 - Heizungsanlagen 2 - Prof. Dr. Ulrich Hahn SS 2008 Wärmetransport Heizkörper Anteile Strahlung Konvektion: 2 Fußbodenheizung: Heizkörper oder flächen? Niedertemperatursystem: T Vorl < 45 C, T Boden
- Heizungsanlagen 2 - Prof. Dr. Ulrich Hahn SS 2008 Wärmetransport Heizkörper Anteile Strahlung Konvektion: 2 Fußbodenheizung: Heizkörper oder flächen? Niedertemperatursystem: T Vorl < 45 C, T Boden
Tipps zum Wohlfühlen und Energiesparen
 Tipps zum Wohlfühlen und Energiesparen Tipps zum Wohlfühlen und Energiesparen Wir wollen, dass Sie es zu Hause bequem und warm haben, denn Ihre Lebensqualität ist uns ein Anliegen. Als regionaler Wärmeversorger
Tipps zum Wohlfühlen und Energiesparen Tipps zum Wohlfühlen und Energiesparen Wir wollen, dass Sie es zu Hause bequem und warm haben, denn Ihre Lebensqualität ist uns ein Anliegen. Als regionaler Wärmeversorger
Bericht Temperaturmessungen
 Hochbauamt Energiemanagement Bericht Temperaturmessungen Liegenschaft: Julius-Leber-Schule Auftrag: Temperaturmessungen Bearbeiter: Giuseppe Vitale Datum: 16.01-31.01.2013 Hochbauamt Energiemanagement
Hochbauamt Energiemanagement Bericht Temperaturmessungen Liegenschaft: Julius-Leber-Schule Auftrag: Temperaturmessungen Bearbeiter: Giuseppe Vitale Datum: 16.01-31.01.2013 Hochbauamt Energiemanagement
Neu von Dimplex: Heizen und Kühlen mit einem System
 Neu von Dimplex: Heizen und Kühlen mit einem System f Innovative Toptechnik: Die ersten Luft/Wasser-Wärmepumpen von Dimplex, die auch kühlen können. f Kombinierte Regelung für Heizen und stilles oder dynamisches
Neu von Dimplex: Heizen und Kühlen mit einem System f Innovative Toptechnik: Die ersten Luft/Wasser-Wärmepumpen von Dimplex, die auch kühlen können. f Kombinierte Regelung für Heizen und stilles oder dynamisches
5. KONGRESS ZUKUNFTSRAUM SCHULE. Bildungsbauten nachhaltig gestalten Schwerpunkt Energieeffizienz
 5. KONGRESS ZUKUNFTSRAUM SCHULE Bildungsbauten nachhaltig gestalten Schwerpunkt Energieeffizienz GYMNASIUM NEUTRAUBLING Wirtschaftliche Lösungen durch integrale Planung Stuttgart, 15.11.2017 Landkreis
5. KONGRESS ZUKUNFTSRAUM SCHULE Bildungsbauten nachhaltig gestalten Schwerpunkt Energieeffizienz GYMNASIUM NEUTRAUBLING Wirtschaftliche Lösungen durch integrale Planung Stuttgart, 15.11.2017 Landkreis
Keine Angst vor Akustikdecken
 Keine Angst vor Akustikdecken Die Anzahl an Bauprojekten mit thermoaktiven Bauteilsystemen (TABS) nimmt stetig zu. Die Nutzung vom Betonkern des Gebäudes als Bestandteil der Temperaturregulierung senkt
Keine Angst vor Akustikdecken Die Anzahl an Bauprojekten mit thermoaktiven Bauteilsystemen (TABS) nimmt stetig zu. Die Nutzung vom Betonkern des Gebäudes als Bestandteil der Temperaturregulierung senkt
GUTACHTEN T-STRIPE. für T-STRIPE GmbH Rautenweg Wien
 GUTACHTEN T-STRIPE für T-STRIPE GmbH Rautenweg 8 1220 Wien www.t-stripe.com IBO - Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie GmbH Alserbachstraße 5/8 1090 Wien www.ibo.at Autoren DI (FH) Felix
GUTACHTEN T-STRIPE für T-STRIPE GmbH Rautenweg 8 1220 Wien www.t-stripe.com IBO - Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie GmbH Alserbachstraße 5/8 1090 Wien www.ibo.at Autoren DI (FH) Felix
Betonkerntemperierung mit Luft CONCRETCOOL
 Betonkerntemperierung mit Luft CONCRETCOOL Das innovative System Bei uns kühlt die Natur Zentralbibliothek, Ulm Foto Martin Dukeck Arcus Sportklinik, Pforzheim Foto Arcus Sportklinik Berufskolleg Kreis
Betonkerntemperierung mit Luft CONCRETCOOL Das innovative System Bei uns kühlt die Natur Zentralbibliothek, Ulm Foto Martin Dukeck Arcus Sportklinik, Pforzheim Foto Arcus Sportklinik Berufskolleg Kreis
Von der Fußbodenheizung zu Heiz- und Kühlflächen an Wand und Decke
 Von der Fußbodenheizung zu Heiz- und Kühlflächen an Wand und Decke Dr. Michael Schröder Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und Umwelttechnik e. V. Agenda Rahmenbedingungen des Wandels der
Von der Fußbodenheizung zu Heiz- und Kühlflächen an Wand und Decke Dr. Michael Schröder Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und Umwelttechnik e. V. Agenda Rahmenbedingungen des Wandels der
Solares Kühlen: Systemoptimierung mit Einsatz der Planungssoftware Polysun
 Pressemitteilung, keine Sperrfrist Solares Kühlen: Systemoptimierung mit Einsatz der Planungssoftware Polysun Innovationsprojekt der Partner, Vela Solaris AG und SPF Institut für Solartechnik HSR Rapperswil
Pressemitteilung, keine Sperrfrist Solares Kühlen: Systemoptimierung mit Einsatz der Planungssoftware Polysun Innovationsprojekt der Partner, Vela Solaris AG und SPF Institut für Solartechnik HSR Rapperswil
Die Energieeinsparverordnung und ihre Auswirkung auf die Wohnungslüftung
 Die Energieeinsparverordnung und ihre Auswirkung auf die Wohnungslüftung Dipl.-Ing. Claus Händel. www.kwl-info.de Hd 20.04.01 EnEV_SHK2002-1 5 Dichtheit, Mindestluftwechsel (2) Zu errichtende Gebäude sind
Die Energieeinsparverordnung und ihre Auswirkung auf die Wohnungslüftung Dipl.-Ing. Claus Händel. www.kwl-info.de Hd 20.04.01 EnEV_SHK2002-1 5 Dichtheit, Mindestluftwechsel (2) Zu errichtende Gebäude sind
Laborrunde 2006, Berlin Innovative Energiekonzepte: Wie wir Performance von der Theorie in die Praxis bringen können!
 Laborrunde 2006, Berlin Innovative Energiekonzepte: Wie wir Performance von der Theorie in die Praxis bringen können! Dipl.-Ing. Architekt Stefan Plesser Institut für Gebäude- und Solartechnik (IGS) Prof.
Laborrunde 2006, Berlin Innovative Energiekonzepte: Wie wir Performance von der Theorie in die Praxis bringen können! Dipl.-Ing. Architekt Stefan Plesser Institut für Gebäude- und Solartechnik (IGS) Prof.
Vergleich Leistungsumfang Rechenkern ibp18599kernel und EXCEL Tool zur DIN V 18599
 Bauaufsichtlich anerkannte Stelle für Prüfung, Überwachung und Zertifizierung Zulassung neuer Baustoffe, Bauteile und Bauarten Forschung, Entwicklung, Demonstration und Beratung auf den Gebieten der Bauphysik
Bauaufsichtlich anerkannte Stelle für Prüfung, Überwachung und Zertifizierung Zulassung neuer Baustoffe, Bauteile und Bauarten Forschung, Entwicklung, Demonstration und Beratung auf den Gebieten der Bauphysik
Erfahrungen aus dem Anlagenbetrieb und Optimierungspotenzial der solaren DEC-Anlage im Passivhausbürogebäude ENERGYbase, Wien
 Erfahrungen aus dem Anlagenbetrieb und Optimierungspotenzial der solaren DEC-Anlage im Passivhausbürogebäude ENERGYbase, Wien Markus Brychta, Anita Preisler, Florian Dubisch AIT- Austrian Institute of
Erfahrungen aus dem Anlagenbetrieb und Optimierungspotenzial der solaren DEC-Anlage im Passivhausbürogebäude ENERGYbase, Wien Markus Brychta, Anita Preisler, Florian Dubisch AIT- Austrian Institute of
2 Energie Begriffe und Definitionen Gesetze, Verordnungen und Normen...23
 Teil I Wohngebäude 0 Einleitung Wohngebäude...14 1 Energetische Sanierung von bestehenden Gebäuden... 15 1.1 Wohnkomfort...16 1.2 Wirtschaftlichkeit...16 1.3 Umwelt...16 2 Energie...17 2.1 Begriffe und
Teil I Wohngebäude 0 Einleitung Wohngebäude...14 1 Energetische Sanierung von bestehenden Gebäuden... 15 1.1 Wohnkomfort...16 1.2 Wirtschaftlichkeit...16 1.3 Umwelt...16 2 Energie...17 2.1 Begriffe und
Regenerative Energien dann nutzen, wenn sie zur Verfügung stehen Gebäude als Speicher
 Regenerative Energien dann nutzen, wenn sie zur Verfügung stehen Gebäude als Speicher Jakob Schneegans jakob.schneegans@lrz.tum.de 5. Klausurtagung Oberland, 21. November 2013 1 Lehrstuhl für Bauklimatik
Regenerative Energien dann nutzen, wenn sie zur Verfügung stehen Gebäude als Speicher Jakob Schneegans jakob.schneegans@lrz.tum.de 5. Klausurtagung Oberland, 21. November 2013 1 Lehrstuhl für Bauklimatik
Einzigartig einfach: die WeGo Klimadecke
 Einzigartig einfach: die WeGo Klimadecke Ein überzeugendes System: die WeGo Klimadecke eine coole Sache! Ein überschaubares und durchdachtes System aus hochwertigen Einzelkomponenten, mit einfacher, aus
Einzigartig einfach: die WeGo Klimadecke Ein überzeugendes System: die WeGo Klimadecke eine coole Sache! Ein überschaubares und durchdachtes System aus hochwertigen Einzelkomponenten, mit einfacher, aus
29. April 2016, Wirtschaftskammer Wien
 29. April 2016, Wirtschaftskammer Wien DI Reinhard Margreiter Ingenieurbüro seit 1997 Tätigkeitsfelder: Energieberatung für Unternehmen Energieaudits nach EEffG für Gebäude, Prozesse, Transport Ausbildungen:
29. April 2016, Wirtschaftskammer Wien DI Reinhard Margreiter Ingenieurbüro seit 1997 Tätigkeitsfelder: Energieberatung für Unternehmen Energieaudits nach EEffG für Gebäude, Prozesse, Transport Ausbildungen:
Energieeffizienz bei Verwaltungsgebäuden
 Energieeffizienz bei Verwaltungsgebäuden Gliederung EnEV Zielfindung Bauausführung Wärmeschutz Tageslicht und Beleuchtung Heizung Regelungstechnik Elektrische Verbraucher Beispiele Ausblick/ Fazit Richtlinien
Energieeffizienz bei Verwaltungsgebäuden Gliederung EnEV Zielfindung Bauausführung Wärmeschutz Tageslicht und Beleuchtung Heizung Regelungstechnik Elektrische Verbraucher Beispiele Ausblick/ Fazit Richtlinien
2.4 Energetische und technische Bewertung von RLT- und Kälteanlagen
 02.xml (090184.fmt), Seite 46 von 82, 19-10-09 13:37:03 2.4 Energetische und technische Bewertung von RLT- und Kälteanlagen Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) dienen zur Sicherstellung von Raumluftqualität
02.xml (090184.fmt), Seite 46 von 82, 19-10-09 13:37:03 2.4 Energetische und technische Bewertung von RLT- und Kälteanlagen Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) dienen zur Sicherstellung von Raumluftqualität
Energie speichern und verteilen Multifunktionale Betondecken für Bürogebäude
 Energie speichern und verteilen Multifunktionale Betondecken für Bürogebäude Thomas Friedrich Innogration GmbH Multifunktionale Betondecken für Bürogebäude: Beton als thermoaktive Speichermasse Bürogebäude
Energie speichern und verteilen Multifunktionale Betondecken für Bürogebäude Thomas Friedrich Innogration GmbH Multifunktionale Betondecken für Bürogebäude: Beton als thermoaktive Speichermasse Bürogebäude
Klima-Optimierte Regelung Vorstandsgebäude 178
 GLT-Anwendertagung,TU Ilmenau, 6.-8.09.2017 Klima-Optimierte Regelung Vorstandsgebäude 178 Rüdiger Schröder, ZIM-FS Zentrales Infrastruktur Management Erfahrungsbericht der Ihr Referent Dipl.-Ing. Rüdiger
GLT-Anwendertagung,TU Ilmenau, 6.-8.09.2017 Klima-Optimierte Regelung Vorstandsgebäude 178 Rüdiger Schröder, ZIM-FS Zentrales Infrastruktur Management Erfahrungsbericht der Ihr Referent Dipl.-Ing. Rüdiger
HLK-Fachwissen. Wärmeübertragung Solarthermie Klimatechnik Strömungstechnik Regelungstechnik Regeltechnische Anwendungen
 HLK-Fachwissen Wärmeübertragung Solarthermie Klimatechnik Strömungstechnik Regelungstechnik Regeltechnische Anwendungen Winfried Sellnau Elektroingenieur, Dipl.-Ing. (FH) Freier Mitarbeiter der DGA Gebäudeautomation
HLK-Fachwissen Wärmeübertragung Solarthermie Klimatechnik Strömungstechnik Regelungstechnik Regeltechnische Anwendungen Winfried Sellnau Elektroingenieur, Dipl.-Ing. (FH) Freier Mitarbeiter der DGA Gebäudeautomation
Metawell KRANKENHAUSDECKE. A n wendungsbeispiel. metal sandwich technology. Krankenhausdecke
 Metawell KRANKENHAUSDECKE A n wendungsbeispiel Inhaltsverzeichnis Einleitung 3-4 Akustik 5 Auslegung 6 Montage 7-8 Einleitung ANGENEHM, SAUBER UND GESUND Deckenkonstruktionen für Krankenhäuser sollen keine
Metawell KRANKENHAUSDECKE A n wendungsbeispiel Inhaltsverzeichnis Einleitung 3-4 Akustik 5 Auslegung 6 Montage 7-8 Einleitung ANGENEHM, SAUBER UND GESUND Deckenkonstruktionen für Krankenhäuser sollen keine
Heizkörper, Flächenheizung, Thermostatventile
 Heizkörper, Flächenheizung, Thermostatventile Es gibt unterschiedliche Heizflächen (Heizkörper und Flächenheizungen), mit denen die Wärme an den Raum abgegeben wird. Man sollte sie so auswählen, dass sie
Heizkörper, Flächenheizung, Thermostatventile Es gibt unterschiedliche Heizflächen (Heizkörper und Flächenheizungen), mit denen die Wärme an den Raum abgegeben wird. Man sollte sie so auswählen, dass sie
Grundlagen und Anleitung zu Auslegungsdiagrammen
 Leistungsdiagramme I.9.2 Grundlagen und Anleitung zu Auslegungsdiagrammen Zur Projektierung einer Flächen hei zung müssen die spezifischen Leis tungs - ab ga ben eines jeden Systems separat nach DIN EN
Leistungsdiagramme I.9.2 Grundlagen und Anleitung zu Auslegungsdiagrammen Zur Projektierung einer Flächen hei zung müssen die spezifischen Leis tungs - ab ga ben eines jeden Systems separat nach DIN EN
WÄRMESCHUTZ IM WINTERGARTENBAU
 DIN 4108-2 EnEV Europäische Energie-Gesetzgebung bezüglich des Wintergartenbaus Dr. Martin H. Spitzner, Obmann DIN 4108-2 WÄRMESCHUTZ IM WINTERGARTENBAU Wintergarten in der EnEV und in der DIN 4108-2 Inhalt
DIN 4108-2 EnEV Europäische Energie-Gesetzgebung bezüglich des Wintergartenbaus Dr. Martin H. Spitzner, Obmann DIN 4108-2 WÄRMESCHUTZ IM WINTERGARTENBAU Wintergarten in der EnEV und in der DIN 4108-2 Inhalt
FÖRMLICHER NACHWEIS ZUM SOMMERLICHEN WÄRMESCHUTZ NACH DIN 4108 NEUBAU BÜROGEBÄUDE SCHÖNESTRASSE 1 IN BERLIN P 1000/13
 ITA INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR Ahornallee 1, 428 Weimar Telefon 03643 2447-0, Telefax 03643 2447-17 E-Mail ita @ ita-weimar.de, Internet http://www.ita-weimar.de FÖRMLICHER NACHWEIS ZUM SOMMERLICHEN WÄRMESCHUTZ
ITA INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR Ahornallee 1, 428 Weimar Telefon 03643 2447-0, Telefax 03643 2447-17 E-Mail ita @ ita-weimar.de, Internet http://www.ita-weimar.de FÖRMLICHER NACHWEIS ZUM SOMMERLICHEN WÄRMESCHUTZ
November/Dezember Architektur ExklusivLifestyle 8,90. 10,80 SFr ISSN
 November/Dezember 2015 Archite Architektur ExklusivLifestyle 8,90 10,80 SFr ISSN 2190-1554 Kühnl + Schmidt Architekten AG Liststraße 22 D-76185 Karlsruhe Tel.: +49 (0)721/565980 Fax: +49 (0)721/5659832
November/Dezember 2015 Archite Architektur ExklusivLifestyle 8,90 10,80 SFr ISSN 2190-1554 Kühnl + Schmidt Architekten AG Liststraße 22 D-76185 Karlsruhe Tel.: +49 (0)721/565980 Fax: +49 (0)721/5659832
Sommerlicher Wärmeschutz Vermeidung von Überhitzung
 Sommerlicher Wärmeschutz Vermeidung von Überhitzung Claudia Reckefuß Dipl. Ing. Umweltingenieurin Uwe ter Vehn Dipl. Ing. Versorgungstechnik e&u energiebüro gmbh www.eundu-online.de Werk-statt-Schule Hannover
Sommerlicher Wärmeschutz Vermeidung von Überhitzung Claudia Reckefuß Dipl. Ing. Umweltingenieurin Uwe ter Vehn Dipl. Ing. Versorgungstechnik e&u energiebüro gmbh www.eundu-online.de Werk-statt-Schule Hannover
"Messtechnische Untersuchungen zur thermischen Leistungsfähigkeit des PVT- Kollektorsystems im Plusenergiehaus ECOLAR der HTWG Konstanz"
 Masterstudiengang SENCE (Sustainable Energy Competence) 2. Projektarbeit: "Messtechnische Untersuchungen zur thermischen Leistungsfähigkeit des PVT- Kollektorsystems im Plusenergiehaus ECOLAR der HTWG
Masterstudiengang SENCE (Sustainable Energy Competence) 2. Projektarbeit: "Messtechnische Untersuchungen zur thermischen Leistungsfähigkeit des PVT- Kollektorsystems im Plusenergiehaus ECOLAR der HTWG
Komfortforschung und Nutzerakzeptanz Soziokulturelle Kriterien zur Nachhaltigkeitsbewertung in Bürogebäuden
 Komfortforschung und Nutzerakzeptanz Soziokulturelle Kriterien zur Nachhaltigkeitsbewertung in Bürogebäuden Fraunhofer Institut für Bauphysik Holzkirchen IBO-Kongress Wien 19.-20. Februar 2009 Deutsches
Komfortforschung und Nutzerakzeptanz Soziokulturelle Kriterien zur Nachhaltigkeitsbewertung in Bürogebäuden Fraunhofer Institut für Bauphysik Holzkirchen IBO-Kongress Wien 19.-20. Februar 2009 Deutsches
Giacomini Klimadeckensystem GKC DRY. GKC DRY 0226D.indd 1 13/12/10 15:19
 Giacomini Klimadeckensystem GKC DRY GKC DRY 0226D.indd 1 13/12/10 15:19 Inhalt 1. Allgemeines über das GKC DRY System 1. Aufbau des GKC DRY Systems 2. Ein System viele Versionen 2. Vorteile des GKC DRY
Giacomini Klimadeckensystem GKC DRY GKC DRY 0226D.indd 1 13/12/10 15:19 Inhalt 1. Allgemeines über das GKC DRY System 1. Aufbau des GKC DRY Systems 2. Ein System viele Versionen 2. Vorteile des GKC DRY
Sommerlicher Wärmeschutz für Wohnbauten
 QUA DRO Sommerlicher Wärmeschutz für Wohnbauten Komfort während des ganzen Jahres Bei guter Planung und angepasstem Nutzerverhalten lassen sich Überhitzungen vermeiden Die wichtigsten Massnahmen in Kürze
QUA DRO Sommerlicher Wärmeschutz für Wohnbauten Komfort während des ganzen Jahres Bei guter Planung und angepasstem Nutzerverhalten lassen sich Überhitzungen vermeiden Die wichtigsten Massnahmen in Kürze
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten. Einführung in die Oberflächennahe Geothermie
 Einführung in die Oberflächennahe Geothermie Dr.-Ing. Timo Krüger Ingenieurgesellschaft Heidt + Peters mbh Gliederung 1. Grundlagen 2. Projektphasen 3. Bemessung und Auslegung von Sondenfeldern 4. Mehrwert
Einführung in die Oberflächennahe Geothermie Dr.-Ing. Timo Krüger Ingenieurgesellschaft Heidt + Peters mbh Gliederung 1. Grundlagen 2. Projektphasen 3. Bemessung und Auslegung von Sondenfeldern 4. Mehrwert
Fenster und Fassaden als Solarkraftwerk
 Seite 1 von 7 ift Rosenheim Solar Power contra Sonnenschutz und Behaglichkeit 1 Solare Gewinne überall Der Begriff erneuerbare Energien ist in aller Munde und zum Synonym für saubere Energien geworden.
Seite 1 von 7 ift Rosenheim Solar Power contra Sonnenschutz und Behaglichkeit 1 Solare Gewinne überall Der Begriff erneuerbare Energien ist in aller Munde und zum Synonym für saubere Energien geworden.
