V Academic. Niclas Förster / J. Cornelis de Vos, Juden und Christen unter römischer Herrschaft
|
|
|
- Carin Becke
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1
2 V Academic
3 Schriften des Institutum Judaicum Delitzschianum Band 10 Vandenhoeck & Ruprecht
4 Niclas Förster / J. Cornelis de Vos (Hg.) Juden und Christen unter römischer Herrschaft Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung in den ersten beiden Jahrhunderten n. Chr. Vandenhoeck & Ruprecht
5 Mit einer Abbildung Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar. ISBN / Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U.S.A. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Produced in Germany. Satz: SchwabScantechnik, Göttingen
6 Inhalt Vorwort... 7 Niclas Förster und J. Cornelis de Vos Einleitung... 9 Hermann Lichtenberger To See Ourselves as Others See Us (Robert Burns) Juden und Christen unter römischer Herrschaft: Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung Thomas Witulski Integration und Separation im Vierten Makkabäerbuch Manuel Vogel Jesusgemeinden und Täufergruppen zwischen Abgrenzung und Wertschätzung eine Skizze Niclas Förster Kultische Reinheit und Identitätsfindung Jesus und der jüdische Tempel nach P.Oxy J. Cornelis de Vos Schriftgelehrte und Pharisäer im Matthäusevangelium: Das ambivalente Verhältnis des Matthäus zu seinem jüdischen Hintergrund Detlev Dormeyer Kein Prozess Jesu: Die römische Strafjustiz gegen Juden nach den neutestamentlichen Passionsgeschichten und Josephus Gottfried Schimanowski Religiöse Identität im Fokus: Selbstbeschreibungen und polemische Kontrastierung in Philos apologetischen Traktaten
7 6 Inhalt Joseph Sievers Nichtjüdische Autoren im Geschichtswerk des Josephus Jan Willem van Henten The Demolition of Herod s Eagle Daniel R. Schwartz A Breslau Translation of Josephus s Minor Works Die Autoren des Bandes Abkürzungen Stellenregister Sach-, Orts- und Namenregister Autorenregister
8 Vorwort Die hier zusammengestellten Beiträge gehen, mit einer Ausnahme, auf ein Symposium zurück, das vom 19. bis zum 20. April 2012 an der Evangelisch-Theologischen Fakultät bzw. dem Institutum Judaicum Delitzschianum der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster zu Ehren des 65. Geburtstags von Prof. Dr. Folker Siegert stattgefunden hat. Allen Teilnehmern sei noch einmal herzlich für die Diskussionen zum Thema und für ihre Beiträge gedankt. Die Tagung wurde finanziell von der Franz-Delitzsch-Gesellschaft und von der Evangelisch-Theologischen Fakultät unterstützt, wofür wir zu großem Dank verpflichtet sind. Zu danken ist ferner den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Institutum Judaicum Delitzschianums, vor allem Frau Maria Arnold und Herrn Florian Oepping, für ihre tatkräftige Hilfe bei der Durchführung der Tagung. Der Franz-Delitzsch-Gesellschaft sowie der Evangelischen Kirche in Westfalen danken wir außerdem für die Gewährung großzügiger Zuschüsse zu den Publikationskosten. Das Team des Verlags Vandenhoeck & Ruprecht hat uns durch sachkundige Betreuung des Manuskripts zuverlässig unterstützt. Folker Siegert, Direktor des Institutum Judaicum Delitzschianum von 1996 bis 2012, war und ist die Verhältnisbestimmung von Juden und Christen von der Antike bis zur Gegenwart ein zentrales Forschungsanliegen. Wir kennen ihn als einen Menschen, der sich stets Zeit nimmt, engagiert und mit Freude über Themen der Judaistik, neutestamentlichen Exegese sowie das Verhältnis von Kirche und Synagoge zu diskutieren. Mögen die vorliegenden Beiträge einige dieser Diskussionen aufnehmen und fortsetzen. Es ist uns Freude und Anliegen, diesen Band Folker Siegert zu widmen. Münster, im Oktober 2014 Niclas Förster und J. Cornelis de Vos
9
10 Einleitung Niclas Förster und J. Cornelis de Vos Menschliche Identität ist multiperspektivisch, denn im Spiegel eines Gegenübers erfahren wir uns selbst.1 Dies trifft auch auf sozioreligiöse Gruppen zu. Stimmt man dieser These zu, so ist im Hinblick auf die Antike nach der Wahrnehmung zu fragen, die unterschiedliche sozioreligiöse Gruppen voneinander hatten: Welche Sicht prägte ihr gegenseitiges Bild voneinander? Zudem gilt damals wie heute, dass, wer sich ein Bild von seinem Gegenüber macht, dabei immer auch sich selbst erfährt, eigene Gewissheiten gewinnt oder aufgeben muss. In diesem Prozess verschränken sich also wahrnehmende Erkenntnis, Selbst- und Fremdbild und Identitätsfindung. Dabei steht kein Geringes auf dem Spiel, denn es zeigt sich, ob Menschen sich ihrer selbst vergewissern können und zugleich die Anderen als Andere in die eigene Weltdeutung einbeziehen oder nicht. Gelingt dies nicht, so werden andere Menschen leicht als bedrohliches Gegenüber angesehen, ja werden vielleicht sogar als Feinde betrachtet. Es geht also bei dem bisher skizzierten Prozess um ein Wechselspiel gegenseitiger Perspektiven: Bleiben Menschen sich in diesem Geschehen lediglich bedrohlich fremd oder werden sie einander vertraut und sind doch oder gerade darum im Hinblick auf das eigene Selbstbild voneinander geschieden? Die mit diesen Überlegungen eng verknüpfte Frage nach der religiösen Identität in der Antike, und vor allem die Frage nach der Identität des antiken Judentums, ist in den letzten Jahren mehr und mehr in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses gerückt. Hierbei konzentrierte sich die Aufmerksamkeit oft auf die Erhebung der historischen und sozialen Faktoren, die identitätsstiftend wirksam wurden. Vielfach umstritten ist darüber hinaus das Thema der jüdischen Identität im historischen Wandel, wie er etwa durch die Tempelzerstörung im Jahre 70 n. Chr. ausgelöst wurde.2 Von neutestamentlicher Seite wurde in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit unterstrichen, das Koordinatensystem, das die theologische Entwicklung in Abhängigkeit von äußeren Gegebenheiten und Veränderungen bestimmen hilft,3 neu zu definieren. Ein Forschungskonsens scheint noch in weiter Ferne zu liegen. Es lässt sich aber festhalten, dass, sofern dies die multireligiöse Gesellschaft der Antike anbelangt, das Problem der Identitätsfindung und -erhaltung mittels Selbst- und Fremdwahrnehmung unter ganz 1 S. u. a. Siegert, Israel als Gegenüber, Vgl. hierzu den konzisen Überblick von Herr, The Identity, passim. 3 Mittmann, Die theologische Bedeutung, 1305.
11 10 Niclas Förster und J. Cornelis de Vos verschiedenen Fragestellungen und methodischen Zugängen4 zumindest schon in den Blick genommen wurde, ohne jedoch in den Mittelpunkt des allgemeinen Forschungsinteresses zu gelangen.5 Dies schließt auch die Beobachtung ein, dass persönliche sowie nationale Identitätsmuster in der Antike in verschiedener Hinsicht perspektivisch gebrochen sein konnten. Ein und dieselbe Person hatte mitunter sogar eine Art multiple Identität, was Joseph Geiger u. a. am Beispiel des Paulus herausgearbeitet hat.6 Was für Personen gilt, gilt auch für Gruppen und Gemeinschaften. Die eigene Gruppe kann sich zum Teil der Kultur der Umwelt anpassen (Akkulturation) oder darin mehr oder weniger aufgehen (Assimilation). In den meisten Fällen durchdringen sich die Kulturen verschiedener Gruppen gegenseitig (Transkulturation). Das Mit- und Gegeneinander der verschiedenen Kulturen ist ein wichtiger Faktor in der Identitätswerdung der jeweiligen Gruppen. Dies beleuchten eine Reihe von Studien zum Thema Judentum und Hellenismus in Palästina,7 zum Verhältnis von Juden und Christen zum imperium romanum8 sowie zum multikulturellen Umfeld im antiken Alexandria.9 Sie zeigen u. a., dass eine Gemeinschaft nie eine statische Größe ist, sondern dass die Eigenheit stets intern und extern ausgehandelt werden muss. In diesem Zusammenhang spielt die Wahrnehmung der Differenz eine wesentliche Rolle. Im Kern geht es dabei um die Frage, um hier Impulse der Systemtheorie aufzugreifen,10 wie und ab welchem Zeitpunkt die Differenz zum Anderen nicht nur wahrgenommen, sondern zum Bestandteil des eigenen Selbstbildes gemacht wird, das sich dann seinerseits aus jener Differenzerfahrung speist und in ihr fundiert ist. Hinsichtlich des Verhältnisses solch einer Differenzerfahrung zur Akkulturation, Assimilation oder 4 Zahlreiche Projekte mit einem Bezug zur aktuellen Säkularisierungsdebatte oder Fragen religiöser Identität und Abgrenzung in der Moderne zeigen diese Entwicklung in der Forschung an. Als Beispiel mögen hier das Centrum für Religion und Moderne an der Universität Münster ( und das Projekt Mobilisierung von Religion in Europa ( an der Universität Erfurt, der Friedrich- Schiller-Universität Jena und der Fachhochschule Jena genannt sein. In diesem Zusammenhang sei ferner auf das seit 2008 (elektronisch) erscheinende Journal of Jewish Identities hingewiesen, dessen Beiträge ihren Fokus aber nicht in der Antike haben. 5 Als Beispiel sei hier der Exzellenzcluster Religion und Politik an der Westfälischen Wilhelms- Universität Münster angeführt, der in seinen Teilprojekten dieser Frage nachgeht; z. B. Projekt C3: Initiation Beschneidung Identität ( forschung/projekte/c3.html); C9: Konkurrenzen und Identitäten in polytheistischen Gesellschaften des antiken Kleinasien lokale Kulte zwischen Abgrenzung und Integration ( oder A2 10: Der jüdische nomos zwischen Normativität und Identität am Beispiel Alexandrias im Jh. n. Chr. ( uni-muenster.de/religion-und-politik/forschung/projekte/a2 10.html). 6 Geiger, The Jew, passim. 7 Z. B. Hengel, Judentum und Hellenismus. 8 S. die noch immer wegweisende Untersuchung von Smallwood, Jews under Roman Rule, sowie Goodman, Judaism in the Roman World; Rajak, The Jewish Dialogue with Greece and Rome. 9 S. neuerdings z. B. die zwei Themenhefte Alexandria Stadt der Bildung und der Religion in BN 147, 2010, 148, Vgl. Luhmann, Einführung, 92 ff. Zum Phänomen von Inklusion und Exklusion im Allgemeinen s. ders., Inklusion und Exklusion.
12 Einleitung 11 Transkulturation sozioreligiöser Gruppen stellt sich die Frage, ob diese im Rahmen der genannten Prozesse aufgehoben oder spezifisch modifiziert wird. Religiös-gesellschaftliche Selbst- und Fremdwahrnehmung und die durch diese generierten Prozesse der Identitätsbestimmung sind also höchst komplexe Phänome und können eigentlich nicht allein auf der Basis schriftlicher Überlieferungen erhoben werden, die zudem in etlichen Fällen nur das Selbstverständnis einer einzelnen Gruppe oder sogar eines bestimmten Autors widerspiegeln.11 Auch andere Phänomene wie Rituale oder mehrheitlich geteilte und statistisch nachweisbare Glaubensvorstellungen müssten analysiert und berücksichtigt werden. Da wir aber aus der Antike in vielen Fällen nur Texte besitzen und anderes Datenmaterial uns lediglich in sehr begrenztem Umfang zur Verfügung steht, wird sich auch dieser Band darauf beschränken, das Phänomen der Perspektive auf sich selbst und andere anhand der relevanten Texte zu studieren. Dabei soll es sowohl um die Selbst- als auch um die Fremdwahrnehmung gehen.12 Das heißt: Die in diesem Band versammelten Beiträge nehmen nicht allein die Sicht von Juden auf Christen oder Christen auf Juden in den Blick, sondern wenden sich ebenso der Perspektive auf diejenigen zu, die sich von der jeweiligen Mehrheit abgrenzten und eigenständig entwickelten. In dem vorliegenden Band soll an den nachgezeichneten Forschungstrend ausdrücklich angeknüpft werden. Einen gewissen Einschnitt markiert dabei wohl die von Jacob Neusner und Ernest S. Frerichs herausgegebene Aufsatzsammlung mit dem bekannten Zitat des Dichters Robert Burns im Titel: To See Ourselves as Others See Us. Schon die Einleitung verweist auf die fundamentale Dimension der Grundfrage der Selbst- und Fremderkenntnis und des damit inhärenten Problems des Anderen, der auch zum outsider werden kann.13 In dieser Problematik gehen zudem Judentum und Christentum parallel. Den hier begonnenen Faden greift Hermann Lichtenberger im ersten Beitrag dieses Bandes wieder auf. Für die Anregungen, die die Forschung durch sozialgeschichtliche Fragestellungen erfahren hat, soll hier beispielhaft die Studie von Philip A. Harland erwähnt werden,14 der Gruppenidentität im Blick auf antike Vereine und christliche Gemeinden untersucht hat. In diesem Band nimmt vor allem die Untersuchung von Manuel Vogel Anregungen soziologischer Zugänge zum Thema auf. Im Hinblick auf die Erörterung der christlich-jüdischen Identitätsproblematik sei aus der Fülle der einschlägigen Veröffentlichungen die umfangreiche Monographie, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World von Judith Lieu angeführt. Exemplarisch sei ferner auf den von Markus Öhler herausgegebenen Sammelband 11 Vgl. grundsätzlich dazu Bengt Holmberg und Michael Winninge in: Identity Formation, Preface, VII. 12 Dieser Ansatz ist bisher vornehmlich in soziologischen Forschungsbeiträgen verfolgt worden, s. z. B. Hans-Jürgen Hildebrandts Aufsatzsammlung mit dem Titel Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, obwohl die Veröffentlichungen zur Identitätsfrage auch in Religionswissenschaft und Theologie zunehmen. 13 Ebd., Preface, XI bzw. XIV. 14 Harland, Dynamics of Identity.
13 12 Niclas Förster und J. Cornelis de Vos Religionsgemeinschaft und Identität. Prozesse jüdischer und christlicher Identitätsbildung in der Antike hingewiesen. Die Einleitung bietet einen konzisen und hilfreichen Überblick über die verschiedenen Begriffe von Identität.15 Für die Analyse antiker Identitäten sind die Begriffe der ethnischen, religiösen und sozialen Identität am hilfreichsten. Die in diesem Band versammelten Beiträge erörtern das Thema nicht in seiner ganzen Bandbreite, vielmehr konzentrieren sie sich abgesehen von dem programmatischen Einleitungsbeitrag von Hermann Lichtenberger, der vor allem auch das Selbst- und Fremdbild in der apologetischen Auseinandersetzung beleuchtet jeweils auf einen Aspekt der behandelten Problematik. Thomas Witulski analysiert das Vierte Makkabäerbuch als Dokument einer geschickten, nach innen gerichteten Apologetik, die sich gegen die weitgehende Anpassung integrationswilliger Kreise im hellenistischen Judentum an ihre pagane Umgebung, wahrscheinlich in Antiochia am Orontes, richtet, was sich u. a. in der Aufgabe der jüdischen Speisegesetze konkretisiert. Dabei wird ebenfalls die Debatte um diese Toragebote mit paganen Opponenten behandelt. Manuel Vogel schlägt eine Brücke zur Untersuchung sozialer Gruppen, wobei er seinen Ausgangspunkt von der auffällig unpolemischen Konkurrenz zwischen den Anhängern von Johannes dem Täufer und ihrem christlichen Gegenüber nimmt. Niclas Förster wechselt zum Thema der Reinheit und der im Tempel für alle jüdischen Besucher der inneren Höfe üblichen kultischen Reinigungen, insbesondere auch der gebotenen Ritualbäder, über, deren Wertigkeit in dem in P.Oxy. 840 erhaltenen Fragment eines judenchristlichen Evangeliums durchaus unterschiedlich beurteilt wird. Diese Fragestellung verbindet sich eng mit der identitätsstiftenden Abgrenzung gegenüber der pharisäischen Halacha und wird auf dem Hintergrund bestimmter Passagen der Gemeinschaftsregel aus Qumran profiliert. J. Cornelis de Vos argumentiert in seinem Beitrag zu Schriftgelehrten und Pharisäern im Matthäusevangelium, dass der Matthäusevangelist und sein Trägerkreis sich von ihrer eigenen wohl pharisäischen Vergangenheit absetzen, indem sie ein stereotypisches Bild der Schriftgelehrten und Pharisäer konstruieren, das als externalisierte Eigenwahrnehmung fungiert. Schriftgelehrte und Pharisäer stehen respektive für Lehren und Handeln und zusammen für das Nichthandeln nach der Lehre. Die matthäische Gruppe findet und stärkt ihre eigene Identität, indem sie mittels der Negativfolie Schriftgelehrte und Pharisäer die Einheit von Lehren und Handeln betont. Detlev Dormeyer vergleicht die Regeln und Praxen der römischen Strafjustiz des ersten Jahrhunderts n. Chr. mit der neutestamentlichen Passionsgeschichte und kommt zum Ergebnis, dass es keinen förmlichen Prozess Jesu gegeben [hat], weder vor dem jüdischen Synhedrion, noch vor dem Präfekten Pilatus.16 Die Verurteilung Jesu bewegte sich rechtlich gesehen also innerhalb der koerzitiven Amtsgewalt des Statt- 15 Öhler, Identität. 16 S. 137 in diesem Band.
14 Einleitung 13 halters und wurde erst in späterer christlicher Perspektive zum Ergebnis eines regelrechten Prozesses umgedeutet. Gottfried Schimanowskis Beitrag widmet sich den apologetischen Schriften Philos von Alexandria. Schimanowski fragt nach dem Verhältnis zwischen Selbstbeschreibung und polemischer Kontrastierung. Gerade im multikulturellen Alexandria und in Hinblick auf Philo, der sich bewusst als Alexandriner und als Jude versteht, ist das Verhältnis zwischen gesellschaftlicher Integration und religiöser, ethnischer Abgrenzung immer wieder zu bestimmen. Schimanowski argumentiert, dass Philos Glaube an die Vorsehung hierbei eine entscheidende Rolle spielt. Joseph Sievers analysiert die Verwendung nichtjüdischer Autoren durch Flavius Josephus in seinen Werken. Welche Quellen zitiert er wie und warum, und welche nicht und warum? Sievers zeigt, dass sich Josephus, außer in Contra Apionem, nicht mit seinen nichtjüdischen Quellen auseinandersetzt, sondern sie als Gewährsleute für seine eigenen Angaben anführt.17 Jan Willem van Henten interpretiert die bei Flavius Josephus überlieferte Episode, nach der der goldene Adler des Herodes, der sich im Jerusalemer Tempelkomplex befand, demoliert wurde. Möglicherweise repräsentierte der Adler für die Juden, die ihn abgerissen hatten, das römische Imperium und damit Herodes Verbindung mit den Römern. Für bestimmte jüdische Gelehrte stellte es einen Verstoß gegen das dekalogische Bilderverbot dar. Die Demolierung des Adlers symbolisierte, dass Herodes als fremd wahrgenommen wurde und es nicht wert war, König der Juden zu sein. Daniel Schwartz schlägt am Ende des Bandes einen forschungsgeschichtlichen Bogen von der Sicht auf Josephus als einen Verräter, die ihm viele seiner jüdischen Zeitgenossen vorhielten, wie der Historiker selbst konzedieren muss, hin zu der frühen Auseinandersetzung mit Josephus und dessen Apologetik durch jüdische Forscher des 19. Jahrhunderts, denen Josephus in einer Epoche des Nationalismus eine durchaus problematische Figur blieb. In allen Beiträgen wird das am Anfang Gesagte deutlich: Die eigene sozioreligiöse Identität entsteht durch ein Wechselspiel von Selbst- und Fremdwahrnehmung. Dies ist ein Prozess, der sich selbst im Lauf der Geschichte immer wieder neu generiert und in diesem Band mit Blick auf die ersten beiden Jahrhunderte nach Christus zum Gegenstand wissenschaftlicher Erörterung gemacht wird. Der Fokus des Interesses richtet sich dabei auf das Judentum und das aufkommende Christentum, sowohl im Wechselspiel zueinander als auch jeweils zur hellenistisch-römischen Umwelt. 17 S. 173 in diesem Band.
15 14 Niclas Förster und J. Cornelis de Vos Literatur Baberowski, J. et al., Selbstbilder und Fremdbilder. Repräsentation sozialer Ordnung im Wandel, Eigene und fremde Welten 1, Frankfurt/New York Cohen, S. J. D., The Beginnings of Jewishness. Boundaries, Varieties, Uncertainties, Berkeley u. a , Those Who Say They Are Jews and Are Not. How Do You Know a Jew in Antiquity When You See One? in: Diasporas in Antiquity hg. v. S. J. D. Cohen/E. S. Frerichs, BJS 288, Atlanta 1993, Faller, St. (Hg.), Studien zu antiken Identitäten, Identitäten und Alteritäten 9, Altertumswissenschaftliche Reihe 2, Würzburg Feldmeier, R./Heckel, U. (Hg.), Die Heiden. Juden, Christen und das Problem des Fremden, mit einer Einl. v. M. Hengel, WUNT 70, Tübingen Frishman, J. et al. (Hg.), Religious Identity and the Problem of Historical Foundation. The Foundational Character of Authoritative Sources in the History of Christianity and Judaism, JCPS 8, Leiden/Boston Frey, J. et al. (Hg.), Jewish Identity in the Greco Roman World. Jüdische Identität in der griechisch-römischen Welt, AJEC 71, Leiden/Boston García Martínez, F./PopoviĆ, M., Defining Identities: We, You, and the Other in the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the Fifth Meeting of the IOQS in Groningen, StTDJ 70, Leiden/Boston Geiger, J., The Jew and the Other. Doubtful and Multiple Identities in the Roman Empire, in: Jewish Identities in Antiquity. Studies in Memory of M. Stern hg. v. L. I. Levine/D. R. Schwartz, TSAJ 130, Tübingen 2009, Gephart, W./Waldenfels, H., Religion und Identität im Horizont des Pluralismus, stw 1411, Frankfurt a. M Goodman, M., Judaism in the Roman World. Collected Essays, AJEC 66, Leiden/Boston Gruen, E. S. (Hg.), Cultural Identity in the Ancient Mediterranean, Issues & debates, Los Angeles Hacham, N., Exile and Self-Identity in the Qumran Sect and in Hellenistic Judaism, in: New Perspectives on Old Textes. Proceedings of the Tenth International Symposium of the Orion Centre für the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 9 11 January, 2005 hg. v. E. G. Chazon/B. Halpern-Amaru/R. A. Clements, StTDJ 88, Leiden/Boston 2010, Harland, Ph. A., Dynamics of Identity in the World of the Early Christians. Associations, Judeans, and Cultural Minorities, New York/London Hengel, M., Judentum und Hellenismus. Studien zu ihrer Begegnung unter besonderer Berücksichtigung Palästinas bis zur Mitte des 2. Jh.s v. Chr., Tübingen Henten, J. W. van/houtepen, A. (Hg.), Religious Identity and the Invention of Tradtion. Papers Read at a Noster Conference in Soesterberg, January 4 6, 1999, Studies in Theology and Relgion 3, Assen Herr, M. D., The Identity of the Jewish People before and after the Destruction of the Second Temple: Continuity or Change? in: Jewish Identities in Antiquity. Studies in Memory of M. Stern hg. v. L. I. Levine/D. R. Schwartz, TSAJ 130, Tübingen 2009, Hildebrandt, H.-J., Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ethnologisch-soziologische Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte und Theoriebildung, mit zwei Beiträgen v. L. Pützstück/M. Bernhold, Memmendorf Holmberg, B. (Hg.), Exploring Early Christian Identity, WUNT 226, Tübingen Holmberg, B./Winninge, M., Identity Formation in the New Testament, WUNT 227, Tübingen Lieu, J. M., Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, Oxford Luhmann, N., Einführung in die Systemtheorie hg. v. D. Baecker, Heidelberg , Inklusion und Exklusion, in: ders., Soziologische Aufklärung. Bd. 6: Die Soziologie und der Mensch, Wiesbaden 22005, Mittmann, U., Die theologische Bedeutung der jüdischen Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit. Eine Problemanzeige, ThLZ 138, 2013, Müller, H.-P. /Siegert, F. (Hg.), Antike Randgesellschaften und Randgruppen im östlichen Mittelmeerraum. Ringvorlesung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, MJSt 5, Münster 2000.
16 Einleitung 15 Neusner, J./Frerichs, E. S., To See Ourselves as Others See Us. Christians, Jews, Others in Late Antiquity, Studies in the Humanities, Chico Öhler, M., Identität eine Problemanzeige, in: ders. (Hg.), Religionsgemeinschaft und Identität. Prozesse jüdischer und christlicher Identitätsbildung im Rahmen der Antike, BThS 142, Neukirchen-Vluyn 2013, (Hg.), Religionsgemeinschaft und Identität. Prozesse jüdischer und christlicher Identitätsbildung im Rahmen der Antike, BThS 142, Neukirchen-Vluyn Perkins, J., Roman Imperial Identities in the Early Christian Era, London/New York Rajak, T., The Jewish Dialogue with Greece and Rome. Studies in Cultural and Social Interaction, Boston Roth, J. P., Distinguishing Jewishness in Antiquity, in: J.-J. Aubert/Z. Várhelyi (Hg.), A Tall Order. Writing the Social History of the Ancient World, München/Leipzig 2005, Rudolph, K., Christlich und Christentum in der Auseinandersetzung zwischen Kirche und Gnosis. Gedanken zur Terminologie und zum Verhältnis von Selbstverständnis und Fremdverständnis, in: ders., Gnosis und spätantike Religionsgeschichte. Gesammelte Aufsätze, NHMS 42, Leiden u. a. 1996, (= Bilde, P./Nielsen, H. K./Podemann Sorensen, J. (Hg.), Apocryphon Severini, FS S. Giversen, Aarhus 1993, ). Satlow, M. L., Defining Judaism. Accounting for Religions in the Study of Religion, JAAR 74, 2006, Scharfenberg, J. et al., Religion: Selbstbewußtsein Identität. Psychologische, theologische und philosophische Analysen und Interpretationen mit einer Einführung v. T. Rendtorff, TEH 182, München Schwartz, S., How Many Judaisms Were There? A Critique of Neusner and Smith on Definition and Mason and Boyarin on Categorization, JAJ 2, 2011, Siegert, F. (Hg.), Israel als Gegenüber. Vom Alten Orient bis zur Gegenwart, Studien zur Geschichte eines wechselvollen Zusammenlebens, SIJD 5, Göttingen Smallwood, E. M., The Jews under Roman Rule. From Pompey to Diocletian, SJLA 20, Leiden 1976 [Boston 22001]. Tajfel, H., Human Groups and Social Categories. Studies in Social Psychology, Cambridge 1981., Gruppenkonflikt und Vorurteil. Entstehung und Funktion sozialer Stereotypen, Bern u. a Tajfel, H./Turner, J., An Integrative Theory of Intergroup Conflict, in: Austin, W. G./Worchel, S. (Hg.), The Social Psychology of Intergroup Relations, Monterey, Calif., 1979, Taylor, M. S., Anti-Judaism and Early Christian Identity. A Critique of the Scholarly Consensus, StPB 46, Leiden u. a
17
18 To See Ourselves as Others See Us (Robert Burns) Juden und Christen unter römischer Herrschaft: Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung Hermann Lichtenberger I. Einleitung In seiner Schrift Gegen Apion erinnert Josephus gleich zu Beginn an die Antiquitates, in denen er eine 5000 Jahre umfassende Geschichte seines Volkes in griechischer Sprache dargestellt habe, und fährt fort: Da ich aber sehe, dass viele den übelwollenden Nachreden, die von einigen geäußert wurden, Beachtung schenken und dem in der Altertumskunde von mir Geschriebenen misstrauen [ ], hielt ich es für nötig, über all dies in Kürze zu schreiben und den Lästerern die Böswilligkeit und vorsätzliche Lüge nachzuweisen und der Unwissenheit der anderen abzuhelfen, alle aber zu belehren, die die Wahrheit wissen wollen, (und zwar) die über unser Alter.1 Sich selbst zu sehen, wie andere einen sehen, wird nur akzeptiert, wenn diese Sicht der Wahrheit entspricht. Ist sie verfälscht aus Böswilligkeit oder Unkenntnis, muss die zutreffende Sichtweise durch Belehrung und Information hergestellt werden. Genau das beabsichtigt Josephus in seinem Buch über Die Ursprünge oder Ursprünglichkeit (so der Buchtitel des Münsteraner Arbeitskreises) des Judentums. Dabei geht es um das Wahre (τἀληθές), und er wendet sich an die, die das Wahre/die Wahrheit wissen wollen. Am Ende seines Werkes wird Josephus noch einmal auf die Wahrheit (ἀλήθεια) zu sprechen kommen, wenn er über diejenigen spricht, die ungerecht über uns geschrieben haben, und er sie nun überführe, dass sie schamlos gegen die Wahrheit selbst den Zank begonnen haben.2 Josephus weiß, dass man sich nur dann im Spiegel des anderen wiedererkennen kann, wenn dieser Spiegel nicht verzerrt. Entsteht ein Zerrbild, dann muss man es zurechtrücken. Es geschieht dadurch, dass man sich auf die Position des anderen erst einmal einlässt, das heißt, sie wahrnimmt und zu verstehen sucht. Genau dies tut Josephus. Er zitiert sie und führt daraufhin die Auseinandersetzung, und zwar weniger apologetisch 1 Ich zitiere nach der Übersetzung von Contra Apionem des Josephus-Arbeitskreises am Institutum Judaicum Delitzschianum unter Leitung von Folker Siegert (Abk.: Siegert, Ursprünglichkeit); Apion. I 2 f, Siegert, Ursprünglichkeit, 1:99. 2 Apion. II 287; Siegert, Ursprünglichkeit, 1:214.
19 18 Hermann Lichtenberger als affirmativ. Apologie hat er überhaupt nicht nötig, ist er sich doch seiner Sache gewiss. Nur weiß er, dass es für manche schwer zu begreifen ist, und darum erklärt er es, geduldig und ausführlich. Aber gehen wir zunächst einen Schritt zurück. Die alttestamentliche Überlieferung weiß längst um das Problem. In Ex 23,9 heißt es: Die Fremdlinge sollt ihr nicht unterdrücken; denn ihr wisst um der Fremdlinge Herz, weil ihr auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen seid (vgl. Ex 22,20). Das Wissen um die eigene Identität und Geschichte lässt die anderer kennen: Ihr wisst, was Fremdheit ist. Umgekehrt wurden die heidnischen Geschichten über Israel in Ägypten und den Auszug eine Bedrohung für Juden, als sie selbst unter fremder Herrschaft standen (von Manetho bis Tacitus). An diesem Punkt musste der Fremdwahrnehmung widersprochen werden, und das hat Josephus in Contra Apionem getan.3 Konnten sich Juden in dem Bild wiederfinden, das andere von ihnen zeichneten? Sich selbst zu sehen, wie andere einen sehen, kann die Wahrheit hervorbringen. Der andere kann aber auch falsche oder gehässige Bilder haben; aber auch diese tragen zur besseren Erkenntnis seiner selbst bei. Zu wissen, warum man abgelehnt oder gehasst wird, kann wohl einen Erkenntnisgewinn über einen selbst bedeuten gerade wenn die Ablehnung oder der Hass unbegründet sind. Es ist also ein beziehungsreiches Geflecht von Nachrichten und Traditionen, das unser Thema umfasst, und von dem wir nur wenige Aspekte aufzeigen können. Wir beginnen mit einer Problemanzeige, die sich in zwei rabbinischen Erzählungen bereits in der Mischna findet: Peroqlos der Philosoph [ ] fragte Rabban Gamli el in Ἀkko, als der im Bad der Aphrodite badete. Er sagte zu ihm: in eurer Tora steht geschrieben An deiner Hand soll nichts mit dem Bann Belegtes kleben bleiben (Dtn 13,18) ; und weshalb badest du (als Jude dennoch) in einem (heidnischen) Bad der Aphrodite? Er sagte zu ihm: man gibt im Bad keine Antwort [d. h. man spricht im Bad im Zustand der Nacktheit nicht von Gott]. Als er hinausgegangen war, sagte er zu ihm: ich bin nicht in ihren (= der Aphrodite) Bereich gekommen, sie ist (vielmehr) in meinen Bereich gekommen. Man sagt (nämlich) nicht das Bad ist zur Ausschmückung der Aphrodite gemacht worden, sondern (man sagt) die Aphrodite ist zur Ausschmückung des Bades gemacht worden. Oder: wenn man dir viel Geld geben würde, würdest du (dann etwa) nackt oder samenergussbehaftet zu deinem Götzen (in dessen Tempel) eintreten und vor ihm urinieren? Aber diese (Statue der Aphrodite) steht bei der Rinne, und jeder Mensch uriniert vor ihr. Und es steht (schließlich) nur geschrieben: Ihre (= der Heiden) Götter (zerschlagt) (Dtn 12,3). [Der Ausdruck Götter meint:] etwas das als Gottheit behandelt wird, ist verboten; aber etwas, das nicht als Gottheit behandelt wird, ist erlaubt.4 3 Siegert, Ursprünglichkeit. 4 mas 3,4; Übersetzung der Mischna nach jas 42d,45 48 (Wewers, Avoda Zara, 102); Mischna und Gemara bas 44b (Übersetzung nach Goldschmidt, Babylonischer Talmud, 9: ).
20 To See Ourselves as Others See Us 19 Man fragte die (jüdischen) Ältesten in Rom: wenn er (= Gott) am Götzendienst [d. h. an Götzen] nicht Gefallen hat, weshalb vernichtet er ihn nicht? Sie sagten zu ihnen: wenn die (Heiden) eine Sache verehren würden, an der die Welt keinen Bedarf hat, hätte er sie (bereits) vernichtet; aber sie verehren doch die Sonne, den Mond, die Sterne, die Planeten, die Berge und die Hügel sollte er seine Welt wegen der Narren zerstören? Sie sagten zu ihnen: wenn das so ist, könnte er (doch) die Sache zerstören, an der die Welt keinen Bedarf hat, und die Sache bestehen lassen, an der die Welt Bedarf hat. Sie sagten zu ihnen: aber dann würden wir deren Verehrer bestärken, und sie würden sagen: erkennt, daß sie Gottheiten sind, denn diese hat man (= Gott) vernichtet, und jene hat man nicht vernichtet.5 In Rom werden Juden noch in ganz anderer Weise mit Götzendienst konfrontiert als im Palästina des zweiten Jahrhunderts n. Chr., selbst, wenn auch dort die Präsenz heidnischer Göttinnen und Götter die Städte beherrschte. Die Perspektive unseres Themas wird deutlich im Gespräch des heidnischen Philosophen und Rabban Gamliels im Bad beziehungsweise außerhalb des Bads von Akko. Der heidnische Philosoph ist erstaunt, dass sich Rabban Gamliel überhaupt ins Bad der Aphrodite in Akko begibt. Nun gibt es neben der Nacktheit im Bad einen Hauptanstoß: die Statue der Aphrodite. Sollte der Gelehrte darum das Bad meiden? Wäre das nicht eine Vorbildfunktion, die man vom großen Lehrer erwarten könnte? Rabban Gamliel weiß, dass er gegen die Statue der Aphrodite im Bad nichts tun kann und betrachtet die Frage scheinbar als ein Adiaphoron: Ich bin nicht in ihren, sie ist vielmehr in meinen Bereich gekommen. Die Statue schmückt höchstens das Bad, aber das Bad ist nicht ihretwegen errichtet. Aber dann geht er zum Angriff über: Die Göttin wird durch ihre heidnischen Verehrer entweiht, indem man sich vor ihr nackt, kultisch unrein und urinierend verhält. Das heißt, man verhält sich ihr gegenüber überhaupt nicht als einer Göttin, und etwas, das nicht als Gottheit behandelt wird, ist erlaubt. Also, worin soll das Problem für mich bestehen? Das Argument ist stichhaltig, war doch schon seit Tiberius6 unehrerbietiges Verhalten bereits im Umkreis einer Kaiserstatue untersagt: daß als todeswürdiges Verbrechen angesehen wurde, wenn jemand in der Nähe eines Augustus- Bildes einen Sklaven auspeitschen ließ oder seine Kleider wechselte, ein Geldstück oder einen Ring mit dem Bild des Augustus auf den Abtritt oder in ein Bordell mitnahm.7 5 mas 4,7; Übersetzung nach jas 44a,43 48 (Wewers, Avoda Zara, 139); Mischna und Gemara bas 45b 55a (Übersetzung nach Goldschmidt, Babylonischer Talmud, 9: ). 6 Sueton, Tiberius, Sueton, Tiberius, 58, zitiert nach Lambert, Suetonius, 152; Hinweis Achim Lichtenberger, vgl. Pekary, Kaiserbildnis; dort der Hinweis auf Historia Augusta, Caracalla 5,7: Zu jener Zeit wurden Leute verurteilt, die ihr Wasser dort abgeschlagen hatten, wo sich Statuen oder Bilder des Kaisers befanden (ebd., 114). Schon zur Zeit des Domitian wurde nach Cassius Dio LXVII 12,2 eine Frau zum Tod verurteilt, die sich vor einer Statue des Kaisers umkleidete (Pekary, Kaiserbildnis, ).
21 20 Hermann Lichtenberger Nun ist damit das Problem noch nicht erledigt, und in einer Bekenntnissituation wäre die Antwort sicher anders. Und doch lässt diese ruhige und sichere Art der Argumentation Wichtiges für unsere Fragestellung erkennen: sich selbst zu sehen, wie andere einen sehen. Der Philosoph zitiert die Tora und packt Gamliel an einer wunden Stelle. Wie kann er es als jüdischer Lehrer verantworten, ins heidnische Bad mit der Statue der Aphrodite zu gehen? Jede Hörerin und jeder Hörer der Geschichte spürten die Brisanz der Frage angesichts der gebotenen Trennung vom Heidnischen und viel mehr wegen der Martyrien um dieser Abgrenzung willen; hier stehen vor allem die Martyrien der Jahre vor Augen. Die erste Antwort Ich bin nicht in ihren, vielmehr ist sie in meinen Bereich gekommen kann nicht wirklich befriedigen, denn auch wenn Aphrodite ein Eindringling ist, so ist sie doch da und Rabban Gamliel in ihrer Nähe. Dennoch zeugt die Antwort von großer Souveränität. Der zweite Argumentationsgang bringt über triviale Beobachtungen die Sache auf den Punkt: Aphrodite wird von ihren (heidnischen) Verehrern gar nicht als Göttin gewürdigt: man geht vor ihr nackt, man ist möglicherweise kultisch unrein, man uriniert vor ihr. Das heißt, sie wird gar nicht als Göttin behandelt, und etwas, das nicht als Gottheit behandelt wird, ist erlaubt. Diese Argumentationsfigur ist bestimmend für den Traktat Avoda Sara: Nur Bilder, die verehrt und angebetet werden, sind Götterbilder und darum verwerflich. Wenn, wie in unserem Fall, eine Statue verächtlich behandelt wird, handelt es sich gar nicht um ein Götterbild. Der Philosoph argumentiert mit der Tora, der Rabbi weist nach, dass Aphrodite überhaupt nicht als Göttin verehrt wird und also keine ist. Im Sinn unseres Themas: Die zweite Antwort, die der (heidnische) Philosoph erhält, macht ihm den Blickwinkel des jüdischen Gelehrten deutlich: Eine Statue, vor der man nackt geht und Wasser lässt, kann keine Gottheit repräsentieren. Aber die Argumentation ist damit nicht zu Ende. Der (heidnische) Philosoph hätte doch sofort zugestimmt, dass man sich vor Statuen von Göttinnen und Göttern nicht unehrerbietig verhalten darf. Der Philosoph macht sich die Sichtweise des jüdischen Gelehrten zu eigen. Interessanterweise geschieht dies über den Weg, dass er an die Ehrerbietung erinnert, die von Heiden eigentlich einer Göttinnenstatue entgegengebracht werden muss. Das heißt, beide schlüpfen in die Rolle des andern und gewinnen daraus überzeugende Argumente für sich selbst. Die zweite Erzählung fügt Einzelaspekte hinzu: Auch hier handelt es sich um eine Auseinandersetzung zwischen Heiden und Juden. Die Frage ist: Warum vernichtet Gott nicht die heidnischen Götzen, die ihm doch missfallen? Auch hier ist die Reflexionsebene zunächst sehr pragmatisch: Das wäre natürlich der Fall, wenn die Heiden Phänomene verehren würden, die keine Bedeutung für die Welt haben, nun aber verehren sie Sonne, Mond, Sterne, Planeten, Berge und Hügel sollte er seine Welt wegen der Narren zerstören? Doch dann geschieht auch hier der Übergang zur theologischen Argumentation: Würde Gott all das vernichten, das nicht notwendig für den Bestand der Welt ist, dann könnten die Heiden behaupten, dass die Dinge, die notwendig für den Bestand der Welt sind, Gottheiten sind, weswegen Gott sie erhalten hat.
22 To See Ourselves as Others See Us 21 Die jüdischen Ältesten bestreiten also vehement, dass aus der Tatsache, dass Sonne, Mond, Sterne, Planeten, Berge und Hügel existieren bleiben, geschlossen werden kann, dass sie göttlich seien. Der Text lässt die Opponenten gegen die jüdische Position noch einen Schritt weiter gehen: Wenn Gott all das vernichtete, das für den Bestand der Welt nicht von Bedeutung ist, dann könnten doch die für den Bestand wichtigen Dinge als Gottheiten anerkannt werden. Aber gerade das soll nach dem Willen der jüdischen Ältesten nicht geschehen. Für unser Thema ergibt sich ein wichtiger Gesichtspunkt: Die Gegner versetzen sich in die Situation der jüdischen Ältesten und versuchen ihnen zu suggerieren: Gott könnte doch alles abschaffen, was für den Bestand der Welt nicht vonnöten ist. Die jüdische Seite erkennt sogleich die Versuchung: Dann könnte man ja das, was nicht vernichtet wurde, als Gottheiten bezeichnen, nämlich Sonne, Mond, Sterne etc. Und darauf kann sich eine jüdische Position nicht einlassen. Es ist bezeichnend, wie beide Erzählungen mit großem Einverständnis arbeiten, zugleich aber große Missverständnisse zeigen. To see ourselves as others see us scheint zunächst einmal darin zu bestehen, dass wir uns präsentieren wollen, wie wir uns sehen. Zu erkennen, wie andere uns sehen, führt oft zu Abwehrreaktionen, Verteidigungsstrategien und Verweigerung. Wir nähern uns dem Thema in vier Schritten, indem wir zunächst nach der gegenseitigen Wahrnehmung von Qumran-Essenern und Römern fragen (II), uns dann dem antiken Antijudaismus zuwenden (III) und der Beurteilung Roms durch die Rabbinen (IV). Das letzte Kapitel (V) wird die christliche Gemeinde im Verhältnis zur heidnischen Welt zum Thema haben. II. Qumran-Essener und die Römer: Innen- und Außenperspektive 1. Das Bild der Römer im Habakuk-Kommentar von Qumran8 Der Kommentar aus Qumran deutet fortlaufend den Bibeltext des Propheten im Hinblick auf die eigene Zeit der Qumran-Gemeinde. Wenn es in Hab 1,6 heißt9: Denn siehe, ich lasse erstehen die Chaldäer, das bittere und ungestüme Volk, so wird das sogleich auf die Römer (Kittäer) bezogen: Seine Deutung bezieht sich auf d[ie] Kittäer, die schnell sind und stark im Kampf, vi[el]e zu verderben, [so daß das Land unterworfen wird] der Herrschaft der Kittäer. Sie haben in Besitz genommen [viele Länd]er und glauben nicht an die Gesetze [Gottes]. (1QpHab II 12 15) Die politische Expansion und Herrschaft wird in der Auslegung von Hab 1,6 f weiter angeprangert: 8 Siehe Lichtenberger, Rombild. 9 Übersetzung im Folgenden nach Lohse, Texte.
23 22 Hermann Lichtenberger Seine Deutung bezieht sich auf die Kittäer, vor denen Furcht [und Schr]ecke[n] auf allen Völkern liegt. Und mit Absicht ist all ihr Sinnen darauf gerichtet, Böses zu tun, und [mit L]ist und Trug gehen sie mit allen Völkern um. (1QpHab III 4 6) In diesem Sinne wird auch Hab 1,8 f auf die Kittäer gedeutet, die das Land mit [ihren] Rossen und mit ihren Tieren zerstampfen. Und von fernher kommen sie, von den Inseln des Meeres, um alle Völker zu fressen wie ein Geier, ohne Sättigung zu finden. (1QpHab III 9 12) Die Gewalt der römischen Befehlshaber, die Übermacht der römischen Heere und ihre Belagerungstechnik sind das Thema der Auslegung von Hab 1,10: Seine Deutung bezieht sich auf die Herrscher der Kittäer, die die Befestigungen der Völker verachten und höhnisch über sie lachen. Und mit viel Volk schließen sie sie ein, um sie einzunehmen. Und mit Furcht und Schrecken werden sie in ihre Hand gegeben. (1QpHab IV 5 8) Mit Hab 1,17, und kennt keine Schonung, wird über die Grausamkeit der Kriegführung geklagt: Seine Deutung bezieht sich auf die Kittäer, die viele mit dem Schwert vernichten, wehrlose Knaben und Greise, Frauen und Kinder, und sogar mit der Frucht im Mutterleibe haben sie kein Erbarmen. (1QpHab VI 10 12) Die Herrscher der Kittäer handeln nach dem Rat des Sündenhauses, womit vermutlich der römische Senat gemeint ist; sie kommen einer nach dem anderen, um das Land zu verderben (1QpHab IV 11 13). Diese Wendungen haben nicht nur Roms militärische Gewalt im Blick, sondern auch die wechselnden Präfekten beziehungsweise Prokuratoren und die wirtschaftliche Ausbeutung. In Hab 1,16b, denn durch sie wurde sein Anteil fett und seine Speise reichlich, erkennt der Ausleger die Methoden, mit denen Rom zu Lasten anderer Völker nicht nur Judäas zu seinem Reichtum kommt: Seine Deutung ist, daß sie ihr Joch und ihre Fronlast, ihre Speise, auf alle Völker Jahr um Jahr verteilen, so daß sie viele Länder verwüsten (1QpHab VI 5 8). Und Hab 1,16a gibt Anlass, neben den finanziellen Lasten, die Rom auferlegt, auch die in den römischen Legionen gepflegte religiöse Verehrung der Feldzeichen zu geißeln, denen die Eroberer ihren Erfolg zu verdanken meinen: Und sie [die Kittäer] häufen ihren Besitz mit all ihrer Beute wie Fische des Meeres. Und wenn es heißt: Deshalb opfert er seinem Netz und bringt Rauchopfer seinem Fischergarn, so ist seine Deutung die, daß sie ihren Zeichen Opfer bringen, und ihre Kriegswaffen sind Gegenstand ihrer Verehrung. (1QpHab VI 1 5)
24 To See Ourselves as Others See Us 23 Auch die letzte Eroberung Jerusalems am Ende der Tage werde durch die Hand der Römer geschehen, ihnen wird sogar der Reichtum der Priester aus Jerusalem, den sie aus den Völkern gesammelt haben, in die Hände fallen (1QpHab IX 2 7)10: Das schreckliche eschatologische Volk das konnte nur das grausame Volk sein, das in der Gegenwart des Auslegers alle Völker bedroht ; der Schrecken, den die Kittäer verbreiteten, war der Schrecken der Endzeit. Die Vermutung, in den Kittim des Habakuk-Kommentars die Römer zu erkennen, wird zur Gewissheit durch den Nahum-Kommentar 4Q169 (4QpNah) Frgm. 3+4 I 3, wo von den Königen Javans (= Griechenlands, d. h. den Seleukiden) gesprochen wird, von Antiochus bis zum Auftreten der Herrscher der Kittäer, das heißt, die Zeitspanne von Antiochus IV. ( ) bis zur römischen Eroberung mit der Entsendung aufeinander folgender Prokonsule und späterer Präfekten in Judäa. 2. Essener, Qumran und andere jüdische und christliche Romperspektiven Die scharfe Kritik der Qumrangemeinde an Rom, seiner militärischen Expansion und politischen Herrschaft, an der Ausbeutung der unterworfenen Völker und an der römischen Religion fügt sich ein in die Romkritik jüdisch-apokalyptischer Texte wie der Esra-Apokalypse (4Esr 11,1 12,3) und der jüdischen Sibylle (Sib 3, ). Die scharfen Töne gegen Pompejus in den pharisäischen Psalmen Salomos (17 f) aus dem ersten Jahrhundert v. Chr. ergänzen das Bild. In der rabbinischen Literatur der ersten Jahrhunderte wird sich der geistige Widerstand gegen Rom fortsetzen und die antirömische Polemik zu neuer Entfaltung kommen. Ein christliches Pendant hat die jüdische Ablehnung Roms in der vehementen Romkritik der Johannesapokalypse. Es ist eine bittere Ironie der Geschichte, dass wir gerade Rom, gegen das der Verfasser des Habakuk-Kommentars so schonungslos deutliche Worte fand und dessen Ende die Kriegsregel so definitiv erwartete, die Erhaltung der Qumrantexte verdanken: Um sie 68 n. Chr. vor den Römern zu schützen, waren sie in Höhlen versteckt worden, wo sie, nachdem ihre Besitzer umgebracht oder zerstreut worden waren, 1879 Jahre ruhten, bis ein Beduinenjunge auf der Suche nach einer verlorenen Ziege die erste Höhle entdeckte. a) Die Essener in römischer Perspektive I.: Plinius Der Habakuk-Kommentar gibt den Blick einer spezifischen jüdischen Gruppe auf Rom wieder, die zumindest in Verbindung mit den Essenern steht. Glücklicherweise haben wir auch einen römischen Blick auf diese Gruppe, die Notiz bei Plinius dem Älteren in der Naturalis historia V 73: Es handelt sich dabei um eine außerordentlich sympathische Beschreibung der Essener als 10 Jeremias, Lehrer, 29.
25 24 Hermann Lichtenberger ein einsamer und auf dem ganzen Erdkreis vor allen andern merkwürdiger Stamm (gens), ohne jede Frau, jeder Wollust abhold, ohne Geld und nur in Gesellschaft von Palmen. Er erneuert sich gleichmäßig Tag für Tag durch die Menge der Neuankömmlinge, da viele dorthin wandern, die das Schicksal durch seine Stürme als Lebensmüde veranlasst, ihre Sitten anzunehmen. So besteht ein ewiger Stamm (eine gens aeterna), bei dem niemand geboren wird, über Jahrhunderte fort, was unglaublich scheint. So fruchtbar ist für jene der Lebensüberdruß anderer.11 Wir wollen nicht die Einzelaussagen auf ihren historischen Gehalt überprüfen, auch nicht die Beziehungen zu andern antiken Essenerberichten und den Qumranfunden herstellen, sondern einzig auf die staunende Darstellung der Essener verweisen. Sicher ist dies im Rahmen antiker Ethnographie nur eine kurze Notiz, aber doch geeignet, bei einem römischen Publikum Interesse und vielleicht auch Bewunderung zu wecken. b) Die Essener in römischer Perspektive II.: Josephus Einen andern römischen Blick auf die Essener finden wir bei Josephus: Hier schreibt ein Jude, und die intendierten Adressaten sind Römer. Dies mag für das Bellum, die Antiquitates, die Vita und Contra Apionem je verschieden sein, aber sein ausführlichster Bericht im Bellum ist in seiner uns überkommenen griechischen Gestalt zweifelsohne an Römer adressiert. Dabei sind vor allem auch solche Charakteristika wichtig, die Interaktionen mit Römern berichten: Deutlich in jeder Beziehung brachte ihren Charakter der Krieg gegen die Römer ans Licht, in dem sie gemartert und gefoltert, gebrannt und zerbrochen wurden und ihr Weg durch sämtliche Folterkammern führte, damit sie entweder den Gesetzgeber schmähen oder etwas Verbotenes essen sollten, und doch blieben sie fest, weder das eine noch das andere auf sich zu nehmen, auch nicht dazu, ihren Peinigern zu schmeicheln oder Tränen zu vergießen. Unter Schmerzen lächelnd und der Folterknechte spottend gaben sie freudig ihr Leben dahin in der Zuversicht, es wieder zu empfangen. (bell. II 152 f)12 In anderer Weise wird ein griechisch-römischer Standpunkt bei Josephus sichtbar, wenn er den Essenern Züge pythagoräischer Lebensweise zuschreibt eventuell aufgrund einer pythagoraisierenden Quelle13, wie das morgendliche Gebet zur Sonne oder den Vegetarismus, sowie in der angeblichen Lehre von der Unsterblichkeit der Seelen: In Übereinstimmung mit den Söhnen der Griechen tun sie dar, daß den guten Seelen ein Leben jenseits des Ozeans beschieden sei und ein Ort, der von Regen und Schnee und Hitze nicht belästigt wird, dem vielmehr vom Ozean her ein ständig sanft wehender Zephir Frische 11 Übersetzung nach Winkler, Plinius, 58 f. 12 Michel/Bauernfeind, Bello Judaico, 1: Siehe Bergmeier, Essenerberichte.
26 To See Ourselves as Others See Us 25 spendet. Den schlechten dagegen sprechen sie eine dunkle und winterliche Schlucht zu, voll von unablässigen Strafen. (bell II 155 f)14 Josephus bringt dies mit den Inseln der Seligen und dem Hades in Beziehung. Ganz deutlich ist Josephus um Verständnismöglichkeiten seiner griechischrömischen Leserschaft bemüht, wenn er die jüdischen Religionsgruppen mit griechischen Philosophenschulen vergleicht. Die jüdischen Philosophenschulen und ihre Äquivalente in der griechisch-römischen Welt sind: Essener Pythagoräer (ant. XV 371) Pharisäer Stoiker (vita 12) Sadduzäer Epikureer (vgl. ant. X 277) Leitendes Prinzip für die Zuordnungen ist die Frage nach der εἱμαρμένη: Die Pharisäer sagen, dass einiges, aber nicht alles Werk der εἱμαρμένη ist, bei einigen hängt es von einem selbst ab, ob es geschieht oder nicht (ant. XIII 172), sie sind also Vertreter stoischer Schulmeinung im Sinne des Ineinanders von Schicksal und Selbstbestimmung.15 Die Gruppe der Essener jedoch hält die εἱμαρμένη für die Herrin von allem, und dass den Menschen nichts ohne deren Bestimmung geschieht, sie sind also Vertreter eines unbedingten Fatums (ant. XIII 172). Die Sadduzäer verneinen die Vorsehung in der Meinung, weder gebe es sie noch nähmen die menschlichen Geschicke ihr zufolge ihren Ausgang. 16 Natürlich ist die Beschreibung der drei beziehungsweise vier Schulen oder Gruppen viel ausführlicher und inhaltlich reicher hinsichtlich der Lebensführung, des Verhältnisses zur Schrift, der Erwartung eines Gerichts, der Unsterblichkeit der Seele und vieles andere mehr. Aber mit dem popularphilosophischen Thema der Frage nach dem Fatum hat Josephus die drei religiösen Gruppen zu Philosophenschulen gemacht, die in nichts den griechisch-römischen nachstehen. Obwohl er sich nach eigenem Bekunden nach Erprobungen der drei Schulen und eines zusätzlichen Voluntariats bei Bannus den Pharisäern anschließt (vita 10 12), gilt seine Liebe eindeutig den Essenern. Auf sie fällt bei Plinius und Josephus der ethnographisch interessierte römische Blick und nimmt ein Staunen erregendes Völklein wahr, die incredibile dictu Juden sind. Dies scheint in Widerspruch mit dem nachfolgenden Komplex des römischen Antijudaismus zu stehen, der Juden generell unter negativen Vorzeichen sieht. Vielleicht erklärt sich der Widerspruch daraus, dass sich der antike Antijudaismus gegen die Juden insgesamt richtet, mit den Essenern dagegen liebenswürdige Ausnahmen gezeigt werden. 14 Michel/Bauernfeind, Bello Judaico, 1: Bergmeier, Essenerberichte, 57 f. 16 Übersetzung nach Bergmeier, Essenerberichte, 57.
V Academic. Felix Albrecht, Die Weisheit Salomos
 V Academic Kleine Bibliothek der antiken jüdischen und christlichen Literatur Herausgegeben von Jürgen Wehnert Vandenhoeck & Ruprecht Die eisheit Salomos Übersetzt und eingeleitet von Felix Albrecht Vandenhoeck
V Academic Kleine Bibliothek der antiken jüdischen und christlichen Literatur Herausgegeben von Jürgen Wehnert Vandenhoeck & Ruprecht Die eisheit Salomos Übersetzt und eingeleitet von Felix Albrecht Vandenhoeck
Michael Tilly Einführung in die Septuaginta
 Michael Tilly Einführung in die Septuaginta Michael Tilly Einführung in die Septuaginta Wissenschaftliche Buchgesellschaft Im Andenken an Günter Mayer (1936 2004) Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese
Michael Tilly Einführung in die Septuaginta Michael Tilly Einführung in die Septuaginta Wissenschaftliche Buchgesellschaft Im Andenken an Günter Mayer (1936 2004) Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese
Predigt am , zu Markus 3,31-35
 Predigt am 10.9.17, zu Markus 3,31-35 Da kommen seine Mutter und seine Geschwister, und sie blieben draußen stehen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn herum, und sie sagen zu
Predigt am 10.9.17, zu Markus 3,31-35 Da kommen seine Mutter und seine Geschwister, und sie blieben draußen stehen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn herum, und sie sagen zu
Inhaltsverzeichnis Seite I
 Inhaltsverzeichnis Seite I NEUES TESTAMENT (Kurstyp 1) Vorwort Inhaltsverzeichnis 1. Der Weg der Schriftwerdung S. 1 1.1 Die Bibel als Heilige Schrift 1.2 Inspiration und Kanon apokryphe Schriften S. 3
Inhaltsverzeichnis Seite I NEUES TESTAMENT (Kurstyp 1) Vorwort Inhaltsverzeichnis 1. Der Weg der Schriftwerdung S. 1 1.1 Die Bibel als Heilige Schrift 1.2 Inspiration und Kanon apokryphe Schriften S. 3
Friedemann Richert. Platon und Christus
 Friedemann Richert Platon und Christus Friedemann Richert Platon und Christus Antike Wurzeln des Neuen Testaments 2. Auflage Herrn Robert Spaemann gewidmet Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
Friedemann Richert Platon und Christus Friedemann Richert Platon und Christus Antike Wurzeln des Neuen Testaments 2. Auflage Herrn Robert Spaemann gewidmet Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
Inhaltsübersicht. Einleitung!/..1
 Inhaltsübersicht Einleitung!/..1 1. Zur Forschungsgeschichte der Apostelgeschichte im Rahmen der antiken Historiographie 4 1.1. J. Molthagen Die Apostelgeschichte im Vergleich mit Herodot, Thukydides und
Inhaltsübersicht Einleitung!/..1 1. Zur Forschungsgeschichte der Apostelgeschichte im Rahmen der antiken Historiographie 4 1.1. J. Molthagen Die Apostelgeschichte im Vergleich mit Herodot, Thukydides und
Holger Zeigan, Die Bibel: Entstehung - Wirkung - Botschaft. Themenheft für den evangelischen Religionsunterricht in der Oberstufe
 Holger Zeigan Die Bibel Entstehung Wirkung Botschaft Themenheft für den evangelischen Religionsunterricht in der Oberstufe Vandenhoeck & Ruprecht Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Holger Zeigan Die Bibel Entstehung Wirkung Botschaft Themenheft für den evangelischen Religionsunterricht in der Oberstufe Vandenhoeck & Ruprecht Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
V Academic. Bonifatia Gesche, Die Esra-Apokalypse
 V Academic Kleine Bibliothek der antiken jüdischen und christlichen Literatur Herausgegeben von Jürgen Wehnert Vandenhoeck & Ruprecht Die Esra-Apokalypse Übersetzt und eingeleitet von Bonifatia Gesche
V Academic Kleine Bibliothek der antiken jüdischen und christlichen Literatur Herausgegeben von Jürgen Wehnert Vandenhoeck & Ruprecht Die Esra-Apokalypse Übersetzt und eingeleitet von Bonifatia Gesche
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Kirche, Die Kirche im Dorf lassen? Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Kirche, Die Kirche im Dorf lassen? Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Bibliografische Information
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Kirche, Die Kirche im Dorf lassen? Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Bibliografische Information
Die Anfänge der Christologie
 Stefan Schreiber Die Anfänge der Christologie Deutungen Jesu im Neuen Testament 1. Auflage 2015 Neukirchener Theologie Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek
Stefan Schreiber Die Anfänge der Christologie Deutungen Jesu im Neuen Testament 1. Auflage 2015 Neukirchener Theologie Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek
Bibelstudium (5) Hauptgrundsätze: Zusammenhang eines Schriftworts
 Bibelstudium (5) Hauptgrundsätze: Zusammenhang eines Schriftworts Willem Johannes Ouweneel EPV,online seit: 03.03.2006 soundwords.de/a1306.html SoundWords 2000 2017. Alle Rechte vorbehalten. Alle Artikel
Bibelstudium (5) Hauptgrundsätze: Zusammenhang eines Schriftworts Willem Johannes Ouweneel EPV,online seit: 03.03.2006 soundwords.de/a1306.html SoundWords 2000 2017. Alle Rechte vorbehalten. Alle Artikel
Inhaltsverzeichnis. Bibliografische Informationen digitalisiert durch
 Vorwort VII 1 Einleitung 1 1.1 Das Thema: Die Christen als,heilige' bei Paulus 2 1.2 Forschungsüberblick 4 1.2.1 O. HANSSEN: Heilig. Die Auseinandersetzung zwischen Paulus und den Korinthern um die ethischen
Vorwort VII 1 Einleitung 1 1.1 Das Thema: Die Christen als,heilige' bei Paulus 2 1.2 Forschungsüberblick 4 1.2.1 O. HANSSEN: Heilig. Die Auseinandersetzung zwischen Paulus und den Korinthern um die ethischen
Predigt über Jes 7,10-14 München, den
 Predigt über Jes 7,10-14 München, den 24.12.2011 Liebe Gemeinde, Vom Himmel hoch, da komm ich her, so haben wir gerade gesungen. In den ersten fünf Strophen dieses Liedes hat Martin Luther alles gesagt,
Predigt über Jes 7,10-14 München, den 24.12.2011 Liebe Gemeinde, Vom Himmel hoch, da komm ich her, so haben wir gerade gesungen. In den ersten fünf Strophen dieses Liedes hat Martin Luther alles gesagt,
Reformation inklusive
 Marion Keuchen / Gabriele Klappenecker Reformation inklusive Material für Reformation und Inklusion für die Klassen 7/8 Marion Keuchen/Gabriele Klappenecker Reformation inklusive Material zu Reformation
Marion Keuchen / Gabriele Klappenecker Reformation inklusive Material für Reformation und Inklusion für die Klassen 7/8 Marion Keuchen/Gabriele Klappenecker Reformation inklusive Material zu Reformation
Die wahre Familie. Wie Jesus unsere Zugehörigkeit neu definiert. Bibel lesen Bibel auslegen
 Die wahre Familie Wie Jesus unsere Zugehörigkeit neu definiert Bibel lesen Bibel auslegen 1 Bibel lesen Persönliche Resonanz! Was macht der Text mit mir?! Was lerne ich durch den Text?! Welche Fragen löst
Die wahre Familie Wie Jesus unsere Zugehörigkeit neu definiert Bibel lesen Bibel auslegen 1 Bibel lesen Persönliche Resonanz! Was macht der Text mit mir?! Was lerne ich durch den Text?! Welche Fragen löst
Kleine Bibelforscher
 Hella Schlüter Kleine Bibelforscher Kopiervorlagen für die Klassen 3 6 Vandenhoeck & Ruprecht Alle Illustrationen von Katrin Wolff, Wiesbaden / S. 38: Shutterstock, Zvonimir Atletic / S. 41: Shutterstock,
Hella Schlüter Kleine Bibelforscher Kopiervorlagen für die Klassen 3 6 Vandenhoeck & Ruprecht Alle Illustrationen von Katrin Wolff, Wiesbaden / S. 38: Shutterstock, Zvonimir Atletic / S. 41: Shutterstock,
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Judentum. Alles, was wir wissen müssen
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Judentum. Alles, was wir wissen müssen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Kopiervorlagen für die Grundschule
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Judentum. Alles, was wir wissen müssen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Kopiervorlagen für die Grundschule
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: 12 kreative Gottesdienste mit Mädchen und Jungen
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: 12 kreative Gottesdienste mit Mädchen und Jungen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Dirk Schliephake (Hg.) 12
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: 12 kreative Gottesdienste mit Mädchen und Jungen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Dirk Schliephake (Hg.) 12
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Wie Kinder Verlust erleben. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Wie Kinder Verlust erleben Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Stephanie Witt-Loers Wie Kinder Verlust erleben...
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Wie Kinder Verlust erleben Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Stephanie Witt-Loers Wie Kinder Verlust erleben...
Zum Wohle aller? Religionen, Wohlfahrtsstaat und Integration in Europa
 Theologische Fakultät Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät VORTRAG UND BUCHVERNISSAGE Prof. em. Dr. Dr. h.c. Karl Gabriel (Universität Münster) Zum Wohle aller? Religionen, Wohlfahrtsstaat und
Theologische Fakultät Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät VORTRAG UND BUCHVERNISSAGE Prof. em. Dr. Dr. h.c. Karl Gabriel (Universität Münster) Zum Wohle aller? Religionen, Wohlfahrtsstaat und
Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht"
 Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Thomas Morus - Utopia. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Thomas Morus - Utopia Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de e lectio Herausgegeben von Matthias Hengelbrock Thomas
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Thomas Morus - Utopia Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de e lectio Herausgegeben von Matthias Hengelbrock Thomas
Arbeitsbuch zur Exegese des Neuen Testaments
 Wolfgang Fenske Arbeitsbuch zur Exegese des Neuen Testaments Ein Proseminar Chr. Kaiser Gütersloher Verlagshaus Inhalt I. Einleitung 1. Warum befassen wir uns mit dem Neuen Testament? 13 2. Historisch-kritische
Wolfgang Fenske Arbeitsbuch zur Exegese des Neuen Testaments Ein Proseminar Chr. Kaiser Gütersloher Verlagshaus Inhalt I. Einleitung 1. Warum befassen wir uns mit dem Neuen Testament? 13 2. Historisch-kritische
Gerd Lehmkuhl / Ulrike Lehmkuhl. Kunst als Medium psychodynamischer Therapie mit Jugendlichen
 Gerd Lehmkuhl / Ulrike Lehmkuhl Kunst als Medium psychodynamischer Therapie mit Jugendlichen V Herausgegeben von Franz Resch und Inge Seiffge-Krenke Gerd Lehmkuhl/Ulrike Lehmkuhl Kunst als Medium psychodynamischer
Gerd Lehmkuhl / Ulrike Lehmkuhl Kunst als Medium psychodynamischer Therapie mit Jugendlichen V Herausgegeben von Franz Resch und Inge Seiffge-Krenke Gerd Lehmkuhl/Ulrike Lehmkuhl Kunst als Medium psychodynamischer
geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch
 Gnade sei mit euch Liebe Gemeinde! Der vorgeschlagene Predigttext für den 2. Advent 2016 steht im Evangelium nach Matthäus, im 24. Kapitel: Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm
Gnade sei mit euch Liebe Gemeinde! Der vorgeschlagene Predigttext für den 2. Advent 2016 steht im Evangelium nach Matthäus, im 24. Kapitel: Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm
Predigt zu 1Petr 1,8 12
 Predigt zu 1Petr 1,8 12 J. Cornelis de Vos, Münster, Universitätskirche, Johannistag, 24.6.2018 Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Liebe Gemeinde, Der Predigttext
Predigt zu 1Petr 1,8 12 J. Cornelis de Vos, Münster, Universitätskirche, Johannistag, 24.6.2018 Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Liebe Gemeinde, Der Predigttext
Lernbegleiter im Konfirmandenkurs
 Lernbegleiter im Konfirmandenkurs Das Vaterunser 1 Vater unser im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.
Lernbegleiter im Konfirmandenkurs Das Vaterunser 1 Vater unser im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.
WILLKOMMEN ZUM STUDIENTAG ISRAEL. Die messianische Bewegung. Der Glaube an den Messias Jesus unter den Juden heute
 WILLKOMMEN ZUM STUDIENTAG ISRAEL Die messianische Bewegung. Der Glaube an den Messias Jesus unter den Juden heute I Fakten zu einem Faszinosum der neuesten christlichen Glaubensgeschichte, der Entstehung
WILLKOMMEN ZUM STUDIENTAG ISRAEL Die messianische Bewegung. Der Glaube an den Messias Jesus unter den Juden heute I Fakten zu einem Faszinosum der neuesten christlichen Glaubensgeschichte, der Entstehung
Röm 9, >>> später Wort islamistisch Gedanken um Terror und Opfer AFD antisemitische (also gegen Juden gerichtete) Äußerungen
 "Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht Röm 9,1-8+14-16 >>> später." Gebet: "Gott, gib uns deinen Heiligen Geist und leite uns nach deiner Wahrheit. AMEN." Liebe Gemeinde! Das Wort islamistisch
"Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht Röm 9,1-8+14-16 >>> später." Gebet: "Gott, gib uns deinen Heiligen Geist und leite uns nach deiner Wahrheit. AMEN." Liebe Gemeinde! Das Wort islamistisch
I. Einleitung II. Exogamie in griechischen und römischen Schriften der späten Republik bis zur hohen Kaiserzeit...43
 9 I. Einleitung... 15 1. Forschungsgeschichte zu Exogamie in neutestamentlichen, jüdischen und griechisch-römischen Schriften...17 1.1 Neutestamentliche Forschung zu 1 Kor 7,12-16...19 1.1.1 Herbert Preisker
9 I. Einleitung... 15 1. Forschungsgeschichte zu Exogamie in neutestamentlichen, jüdischen und griechisch-römischen Schriften...17 1.1 Neutestamentliche Forschung zu 1 Kor 7,12-16...19 1.1.1 Herbert Preisker
Friedensethik und Theologie
 Religion Konflikt Frieden 9 Elisabeth Gräb-Schmidt Julian Zeyher-Quattlender [Hrsg.] Friedensethik und Theologie Systematische Erschließung eines Fachgebiets aus der Perspektive von Philosophie und christlicher
Religion Konflikt Frieden 9 Elisabeth Gräb-Schmidt Julian Zeyher-Quattlender [Hrsg.] Friedensethik und Theologie Systematische Erschließung eines Fachgebiets aus der Perspektive von Philosophie und christlicher
sondern ein wenn auch unzureichendes Verfahren, ein komplexeres Selbstverständnis zu entwickeln, eine Form der Identität anzunehmen und denen, die
 sondern ein wenn auch unzureichendes Verfahren, ein komplexeres Selbstverständnis zu entwickeln, eine Form der Identität anzunehmen und denen, die dessen bedürfen, das Gefühl zu vermitteln, einer größeren
sondern ein wenn auch unzureichendes Verfahren, ein komplexeres Selbstverständnis zu entwickeln, eine Form der Identität anzunehmen und denen, die dessen bedürfen, das Gefühl zu vermitteln, einer größeren
mit Mädchen und Jungen
 Dirk Schliephake (Hg.) 12 kreative Gottesdienste mit Mädchen und Jungen Zum EKD-Plan für den Kindergottesdienst 2011 kinder in der kirche Dirk Schliephake (Hg.) 12 kreative Gottesdienste für Mädchen
Dirk Schliephake (Hg.) 12 kreative Gottesdienste mit Mädchen und Jungen Zum EKD-Plan für den Kindergottesdienst 2011 kinder in der kirche Dirk Schliephake (Hg.) 12 kreative Gottesdienste für Mädchen
Der Ursprung. LXX
 Der Ursprung oder wie jüdische Schriftgelehrte zum ersten mal das hebräische Wort Sabbat שׁ בּ ת (#7676 shabbath {shab-bawth'}) ins Alt-Griechische mit Wochen übersetzten! http://www.blueletterbible.org/bible.cfm?b=lev&c=23&v=1&t=lxx#top
Der Ursprung oder wie jüdische Schriftgelehrte zum ersten mal das hebräische Wort Sabbat שׁ בּ ת (#7676 shabbath {shab-bawth'}) ins Alt-Griechische mit Wochen übersetzten! http://www.blueletterbible.org/bible.cfm?b=lev&c=23&v=1&t=lxx#top
Die Anfänge des Christentums in Kleinasien. Ephesus als paulinisches Missionszentrum
 Geisteswissenschaft Oliver Prode Die Anfänge des Christentums in Kleinasien. Ephesus als paulinisches Missionszentrum Essay Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...1 2. Bedeutung Kleinasiens für die Ausbreitung
Geisteswissenschaft Oliver Prode Die Anfänge des Christentums in Kleinasien. Ephesus als paulinisches Missionszentrum Essay Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...1 2. Bedeutung Kleinasiens für die Ausbreitung
Predigt im Gottesdienst am 3. Advent, in der Cyriakuskirche Illingen Predigttext: Römer 15,5-13
 1 Predigt im Gottesdienst am 3. Advent, 17.12.17 in der Cyriakuskirche Illingen Predigttext: Römer 15,5-13 Miteinander Gott loben. Liebe Gemeinde, kann es für Christen eine schönere Sache geben? Miteinander
1 Predigt im Gottesdienst am 3. Advent, 17.12.17 in der Cyriakuskirche Illingen Predigttext: Römer 15,5-13 Miteinander Gott loben. Liebe Gemeinde, kann es für Christen eine schönere Sache geben? Miteinander
Das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe
 Prof. Dr. Gerhard Lohfink Das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe Gottesdienst zum 80. Geburtstag von Abt em. Dr. Gregor Zasche OSB, Kloster Schäftlarn am 4. November 2018 / 31. Sonntag im Jahreskreis
Prof. Dr. Gerhard Lohfink Das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe Gottesdienst zum 80. Geburtstag von Abt em. Dr. Gregor Zasche OSB, Kloster Schäftlarn am 4. November 2018 / 31. Sonntag im Jahreskreis
Inhalt. Ein historischer Anschlag auf den Glauben 17
 Inhalt Vorwort 13 Kapitel I Ein historischer Anschlag auf den Glauben 17 Studierende lernen die Bibel kennen 18 Probleme mit der Bibel 23 Von der Universität auf die Kanzel 30 Die historisch-kritische
Inhalt Vorwort 13 Kapitel I Ein historischer Anschlag auf den Glauben 17 Studierende lernen die Bibel kennen 18 Probleme mit der Bibel 23 Von der Universität auf die Kanzel 30 Die historisch-kritische
Hildegard Aepli. Single und wie?! Erfülltes Leben mit unerfüllten Wünschen IGNATIANISCHE IMPULSE. echter
 Hildegard Aepli Single und wie?! Erfülltes Leben mit unerfüllten Wünschen IGNATIANISCHE IMPULSE echter Hildegard Aepli Single und wie?! Erfülltes Leben mit unerfüllten Wünschen Ignatianische Impulse Herausgegeben
Hildegard Aepli Single und wie?! Erfülltes Leben mit unerfüllten Wünschen IGNATIANISCHE IMPULSE echter Hildegard Aepli Single und wie?! Erfülltes Leben mit unerfüllten Wünschen Ignatianische Impulse Herausgegeben
Birgit Behrensen. Was bedeutet Fluchtmigration? Soziologische Erkundungen für die psychosoziale Praxis
 Birgit Behrensen Was bedeutet Fluchtmigration? Soziologische Erkundungen für die psychosoziale Praxis V Geflüchtete Menschen psychosozial unterstützen und begleiten Herausgegeben von Maximiliane Brandmaier
Birgit Behrensen Was bedeutet Fluchtmigration? Soziologische Erkundungen für die psychosoziale Praxis V Geflüchtete Menschen psychosozial unterstützen und begleiten Herausgegeben von Maximiliane Brandmaier
Wer schrieb die Bibel?
 Richard Elliott Friedman Wer schrieb die Bibel? So entstand das Alte Testament Aus dem Amerikanischen von Hartmut Pitschmann Anaconda Verlag qáíéä=çéê=~ãéêáâ~åáëåüéå=lêáöáå~ä~ìëö~äéw=tüç têçíé íüé _áääé
Richard Elliott Friedman Wer schrieb die Bibel? So entstand das Alte Testament Aus dem Amerikanischen von Hartmut Pitschmann Anaconda Verlag qáíéä=çéê=~ãéêáâ~åáëåüéå=lêáöáå~ä~ìëö~äéw=tüç têçíé íüé _áääé
Herzlich willkommen! Bibel. - Abend. Heute: Thora, Bibel und Koran im Vergleich
 Herzlich willkommen! Bibel. - Abend Die Bibel auf den Punkt gebracht. Die Bibel im Mittelpunkt. 60 Minuten biblischer Lehre, ansprechend und anschaulich vorgetragen. Immer dienstags 19:00-20:00 Uhr, alle
Herzlich willkommen! Bibel. - Abend Die Bibel auf den Punkt gebracht. Die Bibel im Mittelpunkt. 60 Minuten biblischer Lehre, ansprechend und anschaulich vorgetragen. Immer dienstags 19:00-20:00 Uhr, alle
OST-WEST- PASSAGEN FRIEDENSROUTEN IN GOTTES NAMEN.
 OST-WEST- PASSAGEN FRIEDENSROUTEN IN GOTTES NAMEN. GEOGRAPHIE UND THEOLOGIE IM WEIHNACHTSEVANGELIUM WEIHNACHTSVORLESUNG 2017 THOMAS SÖDING LEHRSTUHL NEUES TESTAMENT KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT RUHR-UNIVERSITÄT
OST-WEST- PASSAGEN FRIEDENSROUTEN IN GOTTES NAMEN. GEOGRAPHIE UND THEOLOGIE IM WEIHNACHTSEVANGELIUM WEIHNACHTSVORLESUNG 2017 THOMAS SÖDING LEHRSTUHL NEUES TESTAMENT KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT RUHR-UNIVERSITÄT
Eine neutestamentliche Exegese aufgezeigt am Beispiel der Bibelstelle Matthäus 6, 9-13
 Geisteswissenschaft Pia Brinkkoetter Eine neutestamentliche Exegese aufgezeigt am Beispiel der Bibelstelle Matthäus 6, 9-13 Studienarbeit Exegese Eine neutestamentliche Exegese aufgezeigt am Beispiel
Geisteswissenschaft Pia Brinkkoetter Eine neutestamentliche Exegese aufgezeigt am Beispiel der Bibelstelle Matthäus 6, 9-13 Studienarbeit Exegese Eine neutestamentliche Exegese aufgezeigt am Beispiel
Glaube kann man nicht erklären!
 Glaube kann man nicht erklären! Es gab mal einen Mann, der sehr eifrig im Lernen war. Er hatte von einem anderen Mann gehört, der viele Wunderzeichen wirkte. Darüber wollte er mehr wissen, so suchte er
Glaube kann man nicht erklären! Es gab mal einen Mann, der sehr eifrig im Lernen war. Er hatte von einem anderen Mann gehört, der viele Wunderzeichen wirkte. Darüber wollte er mehr wissen, so suchte er
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 6 Unterrichtsvorhaben: Die gute Nachricht breitet sich aus die frühe Kirche
 Unterrichtsvorhaben: Die gute Nachricht breitet sich aus die frühe Kirche Inhaltliche Schwerpunkte ( Inhaltsfelder): Anfänge der Kirche (IHF 5); Bildliches Sprechen von Gott (IHF 2) Lebensweltliche Relevanz:
Unterrichtsvorhaben: Die gute Nachricht breitet sich aus die frühe Kirche Inhaltliche Schwerpunkte ( Inhaltsfelder): Anfänge der Kirche (IHF 5); Bildliches Sprechen von Gott (IHF 2) Lebensweltliche Relevanz:
Ich darf dich nicht ärgern. Römer 14,13. Jacob Gerrit Fijnvandraat. SoundWords,online seit: soundwords.de/a673.html
 Ich darf dich nicht ärgern Römer 14,13 Jacob Gerrit Fijnvandraat SoundWords,online seit: 28.01.2003 soundwords.de/a673.html SoundWords 2000 2017. Alle Rechte vorbehalten. Alle Artikel sind lediglich für
Ich darf dich nicht ärgern Römer 14,13 Jacob Gerrit Fijnvandraat SoundWords,online seit: 28.01.2003 soundwords.de/a673.html SoundWords 2000 2017. Alle Rechte vorbehalten. Alle Artikel sind lediglich für
Realisation Verwirklichung und Wirkungsgeschichte
 Studien Internationale CarDinal-Newman-Studien XX. Folge Günter Biemer / Bernd Trocholepczy (Hrsg.) Realisation Verwirklichung und Wirkungsgeschichte 20 Newman Studien zur Grundlegung der Praktischen Theologie
Studien Internationale CarDinal-Newman-Studien XX. Folge Günter Biemer / Bernd Trocholepczy (Hrsg.) Realisation Verwirklichung und Wirkungsgeschichte 20 Newman Studien zur Grundlegung der Praktischen Theologie
Predigt zum Israelsonntag Am 10. Sonntag nach dem Trinitatisfest (31. Juli 2016) Predigttext: Johannes 4,19-25
 Predigt zum Israelsonntag Am 10. Sonntag nach dem Trinitatisfest (31. Juli 2016) Predigttext: Johannes 4,19-25 Friede sei mit euch und Gnade von dem, der da ist und der da war und der da kommen wird. Amen.
Predigt zum Israelsonntag Am 10. Sonntag nach dem Trinitatisfest (31. Juli 2016) Predigttext: Johannes 4,19-25 Friede sei mit euch und Gnade von dem, der da ist und der da war und der da kommen wird. Amen.
Gideon Botsch Die extreme Rechte in der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis heute
 Gideon Botsch Die extreme Rechte in der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis heute Geschichte kompakt Herausgegeben von Kai Brodersen, Martin Kintzinger, Uwe Puschner, Volker Reinhardt Herausgeber für den
Gideon Botsch Die extreme Rechte in der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis heute Geschichte kompakt Herausgegeben von Kai Brodersen, Martin Kintzinger, Uwe Puschner, Volker Reinhardt Herausgeber für den
Theologie des Neuen Testaments
 Udo Schnelle Theologie des Neuen Testaments Vandenhoeck & Ruprecht Inhalt 1 Der Zugang: Theologie des Neuen Testaments als Sinnbildung. 15 1.1 Das Entstehen von Geschichte 17 1.2 Geschichte als Sinnbildung
Udo Schnelle Theologie des Neuen Testaments Vandenhoeck & Ruprecht Inhalt 1 Der Zugang: Theologie des Neuen Testaments als Sinnbildung. 15 1.1 Das Entstehen von Geschichte 17 1.2 Geschichte als Sinnbildung
Lernverse AG I. 2. Timotheus 3/16:
 Lernverse AG I I / 1 I / 2 2. Timotheus 3/16: Psalm 119/162: Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ich freue
Lernverse AG I I / 1 I / 2 2. Timotheus 3/16: Psalm 119/162: Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ich freue
Das eine Evangelium, die vier Evangelien und ihre Autoren
 Das eine Evangelium, die vier Evangelien und ihre Autoren Situation der christlichen Gemeinde(n) in den ersten Jahrzehnten nach Jesu Tod und Auferweckung: Versammlung in Häusern (cf. Obergeschoss ) Elemente
Das eine Evangelium, die vier Evangelien und ihre Autoren Situation der christlichen Gemeinde(n) in den ersten Jahrzehnten nach Jesu Tod und Auferweckung: Versammlung in Häusern (cf. Obergeschoss ) Elemente
Leben.Lieben.Arbeiten SYSTEMISCH BERATEN. Barbara Ollefs. Die Angst der Eltern vor ihrem Kind. Gewaltloser Widerstand und Elterncoaching
 Leben.Lieben.Arbeiten SYSTEMISCH BERATEN Barbara Ollefs Die Angst der Eltern vor ihrem Kind Gewaltloser Widerstand und Elterncoaching V Leben.Lieben.Arbeiten SYSTEMISCH BERATEN Herausgegeben von Jochen
Leben.Lieben.Arbeiten SYSTEMISCH BERATEN Barbara Ollefs Die Angst der Eltern vor ihrem Kind Gewaltloser Widerstand und Elterncoaching V Leben.Lieben.Arbeiten SYSTEMISCH BERATEN Herausgegeben von Jochen
Nicht von dieser Welt Aus der Reihe FürZüg Zügs wo mir defür sind Predigt vom 18. August 2013 Text: Joh 18, 33-40; Joh 17, 13-17
 Nicht von dieser Welt Aus der Reihe FürZüg Zügs wo mir defür sind Predigt vom 18. August 2013 Text: Joh 18, 33-40; Joh 17, 13-17 Einleitung Ich möchte euch zwei Freunde von mir vorstellen. Jenny und Anton.
Nicht von dieser Welt Aus der Reihe FürZüg Zügs wo mir defür sind Predigt vom 18. August 2013 Text: Joh 18, 33-40; Joh 17, 13-17 Einleitung Ich möchte euch zwei Freunde von mir vorstellen. Jenny und Anton.
34. Sonntag im Jahreskreis - Christkönigssonntag - Lk 23, C - Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst
 34. Sonntag im Jahreskreis - Christkönigssonntag - Lk 23, 35-43 - C - Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst Wir hören König und denken an Macht und Glanz auf der einen, gehorsame
34. Sonntag im Jahreskreis - Christkönigssonntag - Lk 23, 35-43 - C - Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst Wir hören König und denken an Macht und Glanz auf der einen, gehorsame
Predigt an Palmsonntag, Text: Jesaja 50,4-10
 Predigt an Palmsonntag, 25.3.2018 Text: Jesaja 50,4-10 Gott der HERR hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das
Predigt an Palmsonntag, 25.3.2018 Text: Jesaja 50,4-10 Gott der HERR hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das
Thema 2: Gottes Plan für dein Leben
 Thema 2: für dein Leben Einleitung Viele Menschen blicken am Ende ihres Lebens auf ihr Leben zurück und fragen sich ernüchtert: Und das war s? Eine solche Lebensbilanz ziehen zu müssen ist eine große Tragik!
Thema 2: für dein Leben Einleitung Viele Menschen blicken am Ende ihres Lebens auf ihr Leben zurück und fragen sich ernüchtert: Und das war s? Eine solche Lebensbilanz ziehen zu müssen ist eine große Tragik!
Marianne Katterfeldt. Die Urschönheit des Menschen
 Marianne Katterfeldt Die Urschönheit des Menschen Berichte aus der Psychologie Marianne Katterfeldt Die Urschönheit des Menschen Der siebenstufige Weg unter besonderer Berücksichtigung der Individuation
Marianne Katterfeldt Die Urschönheit des Menschen Berichte aus der Psychologie Marianne Katterfeldt Die Urschönheit des Menschen Der siebenstufige Weg unter besonderer Berücksichtigung der Individuation
Bibel für Kinder zeigt: Die Geburt Jesu
 Bibel für Kinder zeigt: Die Geburt Jesu Text: Edward Hughes Illustration: M. Maillot Adaption: E. Frischbutter und Sarah S. Übersetzung: Siegfried Grafe Produktion: Bible for Children www.m1914.org 2013
Bibel für Kinder zeigt: Die Geburt Jesu Text: Edward Hughes Illustration: M. Maillot Adaption: E. Frischbutter und Sarah S. Übersetzung: Siegfried Grafe Produktion: Bible for Children www.m1914.org 2013
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Inklusion im Religionsunterricht. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Inklusion im Religionsunterricht Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de V Patrick Grasser Inklusion im Religionsunterricht
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Inklusion im Religionsunterricht Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de V Patrick Grasser Inklusion im Religionsunterricht
GESCHICHTE DES HELLENISMUS
 GESCHICHTE DES HELLENISMUS VON HANS-JOACHIM GEHRKE 3., überarbeitete und erweiterte Auflage R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 2003 INHALT Vorwort Vorwort zur 3. Auflage XIII XIII I. Darstellung 1 Einleitung:
GESCHICHTE DES HELLENISMUS VON HANS-JOACHIM GEHRKE 3., überarbeitete und erweiterte Auflage R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 2003 INHALT Vorwort Vorwort zur 3. Auflage XIII XIII I. Darstellung 1 Einleitung:
ÜBERBLICK ÜBER DIE GERICHTE IN DER OFFENBARUNG
 ÜBERBLICK ÜBER DIE GERICHTE IN DER OFFENBARUNG Die Kapitel 6 bis 18 des Buches Offenbarung sind von den Gerichten Gottes geprägt: den 7 Siegeln, den 7 Posaunen und den 7 Schalen. Aus dem jeweils siebten
ÜBERBLICK ÜBER DIE GERICHTE IN DER OFFENBARUNG Die Kapitel 6 bis 18 des Buches Offenbarung sind von den Gerichten Gottes geprägt: den 7 Siegeln, den 7 Posaunen und den 7 Schalen. Aus dem jeweils siebten
Inhalt.
 1 Hinführung 1 1.1 Zum Thema der Abhandlung 1 1.1.1 Allgemeine Bemerkungen und Grundfragestellung 1 1.1.2 Umfang des Stoffes und terminologische Bezeichnungen 3 1.1.3 Vorbemerkung zu eventuellen paganen
1 Hinführung 1 1.1 Zum Thema der Abhandlung 1 1.1.1 Allgemeine Bemerkungen und Grundfragestellung 1 1.1.2 Umfang des Stoffes und terminologische Bezeichnungen 3 1.1.3 Vorbemerkung zu eventuellen paganen
Karin Mlodoch. Gewalt, Flucht Trauma? Grundlagen und Kontroversen der psychologischen Traumaforschung
 Karin Mlodoch Gewalt, Flucht Trauma? Grundlagen und Kontroversen der psychologischen Traumaforschung V Geflüchtete Menschen psychosozial unterstützen und begleiten Herausgegeben von Maximiliane Brandmaier
Karin Mlodoch Gewalt, Flucht Trauma? Grundlagen und Kontroversen der psychologischen Traumaforschung V Geflüchtete Menschen psychosozial unterstützen und begleiten Herausgegeben von Maximiliane Brandmaier
Gestalten und Geschichten der Hebräischen Bibel
 Gestalten und Geschichten der Hebräischen Bibel Jerusalemer Texte Schriften aus der Arbeit der Jerusalem-Akademie herausgegeben von Hans-Christoph Goßmann Band 6 Verlag Traugott Bautz Hans-Christoph Goßmann
Gestalten und Geschichten der Hebräischen Bibel Jerusalemer Texte Schriften aus der Arbeit der Jerusalem-Akademie herausgegeben von Hans-Christoph Goßmann Band 6 Verlag Traugott Bautz Hans-Christoph Goßmann
Bibelstellen zum Wort Taufe und "verwandten" Wörtern Mt 3,6 sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen.
 Bibelstellen zum Wort Taufe und "verwandten" Wörtern Mt 3,6 sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Mt 3,7 Als Johannes sah, daß viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen,
Bibelstellen zum Wort Taufe und "verwandten" Wörtern Mt 3,6 sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Mt 3,7 Als Johannes sah, daß viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen,
Daniel Siemens. SOLA FIDE Allein durch Glauben
 Daniel Siemens SOLA FIDE Allein durch Glauben Missionswerk FriedensBote 2011 3 Daniel Siemens SOLA FIDE Allein durch Glauben 2011 Missionswerk FriedensBote Postfach 14 16 D-58530 Meinerzhagen Umschlag:
Daniel Siemens SOLA FIDE Allein durch Glauben Missionswerk FriedensBote 2011 3 Daniel Siemens SOLA FIDE Allein durch Glauben 2011 Missionswerk FriedensBote Postfach 14 16 D-58530 Meinerzhagen Umschlag:
Bibel für Kinder zeigt: Geschichte 36 von 60.
 Bibel für Kinder zeigt: Die Geburt Jesu Text: Edward Hughes Illustration: M. Maillot Übersetzung: Siegfried Grafe Adaption: E. Frischbutter und Sarah S. Deutsch Geschichte 36 von 60 www.m1914.org Bible
Bibel für Kinder zeigt: Die Geburt Jesu Text: Edward Hughes Illustration: M. Maillot Übersetzung: Siegfried Grafe Adaption: E. Frischbutter und Sarah S. Deutsch Geschichte 36 von 60 www.m1914.org Bible
Kurze Einleitung zum Buch Sacharja
 Geisteswissenschaft David Jäggi Kurze Einleitung zum Buch Sacharja Der Versuch einer bibeltreuen Annäherung an den Propheten Studienarbeit Werkstatt für Gemeindeaufbau Akademie für Leiterschaft in Zusammenarbeit
Geisteswissenschaft David Jäggi Kurze Einleitung zum Buch Sacharja Der Versuch einer bibeltreuen Annäherung an den Propheten Studienarbeit Werkstatt für Gemeindeaufbau Akademie für Leiterschaft in Zusammenarbeit
Klemens Schaupp. Ein spiritueller Übungsweg. echter
 Klemens Schaupp Ein spiritueller Übungsweg echter Inhalt 1. Einleitung................................. 7 2. Grundbedürfnisse und menschliche Entwicklung.............................. 13 3. Der Übungsweg...........................
Klemens Schaupp Ein spiritueller Übungsweg echter Inhalt 1. Einleitung................................. 7 2. Grundbedürfnisse und menschliche Entwicklung.............................. 13 3. Der Übungsweg...........................
Die Gnade. Liebe Gemeinde! Der vorgeschlagene Predigttext für den diesjährigen 17.S.n.Tr. steht im Brief des Paulus an die Römer, im 10. Kapitel.
 Die Gnade Liebe Gemeinde! Der vorgeschlagene Predigttext für den diesjährigen 17.S.n.Tr. steht im Brief des Paulus an die Römer, im 10. Kapitel. Der Apostel schreibt: Wenn du mit deinem Munde bekennst,
Die Gnade Liebe Gemeinde! Der vorgeschlagene Predigttext für den diesjährigen 17.S.n.Tr. steht im Brief des Paulus an die Römer, im 10. Kapitel. Der Apostel schreibt: Wenn du mit deinem Munde bekennst,
Christine Hubka / Ramazan Demir. Abraham Ibrahim. Interreligiöses Grundschulmaterial zum Stammvater von Juden, Christen und Muslimen
 Christine Hubka / Ramazan Demir Abraham Ibrahim Interreligiöses Grundschulmaterial zum Stammvater von Juden, Christen und Muslimen Christine Hubka/Ramazan Demir Abraham Ibrahim Interreligiöses Grundschulmaterial
Christine Hubka / Ramazan Demir Abraham Ibrahim Interreligiöses Grundschulmaterial zum Stammvater von Juden, Christen und Muslimen Christine Hubka/Ramazan Demir Abraham Ibrahim Interreligiöses Grundschulmaterial
Melito von Sardes: Passa-Homilie
 Geisteswissenschaft Magnus Kerkloh Melito von Sardes: Passa-Homilie Theologie der ältesten erhaltenen Osterpredigt des Christentums Studienarbeit Unterseminar: Ostern in der Alten Kirche SS 2000 Referat:
Geisteswissenschaft Magnus Kerkloh Melito von Sardes: Passa-Homilie Theologie der ältesten erhaltenen Osterpredigt des Christentums Studienarbeit Unterseminar: Ostern in der Alten Kirche SS 2000 Referat:
Ein Blick in die Bibel
 Ein Blick in die Bibel Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben (Johannes 14,1-7) Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern!, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott
Ein Blick in die Bibel Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben (Johannes 14,1-7) Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern!, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott
Predigt zum Thema Sag die Wahrheit : Kanzelgruß: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen.
 Predigt zum Thema Sag die Wahrheit : Kanzelgruß: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Sag die Wahrheit. Da denke ich erstmal daran,
Predigt zum Thema Sag die Wahrheit : Kanzelgruß: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Sag die Wahrheit. Da denke ich erstmal daran,
Das Gesetz: Die Lebensregel des Christen? Johannes 14,21; 1.Johannes 3,21-24; Römer 7 8
 Das Gesetz: Die Lebensregel des Christen? Johannes 14,21; 1.Johannes 3,21-24; Römer 7 8 Charles Henry Mackintosh Heijkoop-Verlag,online seit: 28.10.2003 soundwords.de/a780.html SoundWords 2000 2017. Alle
Das Gesetz: Die Lebensregel des Christen? Johannes 14,21; 1.Johannes 3,21-24; Römer 7 8 Charles Henry Mackintosh Heijkoop-Verlag,online seit: 28.10.2003 soundwords.de/a780.html SoundWords 2000 2017. Alle
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Bibel - etwas für mich? Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Bibel - etwas für mich? Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Bibel - etwas für mich? Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Weinfelder. Predigt. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Juni 2016 Nr Römer 8,38-39
 Weinfelder Juni 2016 Nr. 777 Predigt Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes Römer 8,38-39 von Pfr. Johannes Bodmer gehalten am 27. Juni 2016 Römer 8,38-39 Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von
Weinfelder Juni 2016 Nr. 777 Predigt Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes Römer 8,38-39 von Pfr. Johannes Bodmer gehalten am 27. Juni 2016 Römer 8,38-39 Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von
Vier Altkirchliche Bekenntnisse
 Vier Altkirchliche Bekenntnisse Das Apostolische Glaubensbekenntnis Das Nicänische Glaubensbekenntnis Das Glaubensbekenntnis von Chalcedon Das Athanasische Glaubensbekenntnis Online- und Selbstdruckversion
Vier Altkirchliche Bekenntnisse Das Apostolische Glaubensbekenntnis Das Nicänische Glaubensbekenntnis Das Glaubensbekenntnis von Chalcedon Das Athanasische Glaubensbekenntnis Online- und Selbstdruckversion
Bei uns gelten andere Grundsätze: Gal 3, lesen
 Liebe Gemeinde! Wir und die anderen! Wer gehört zum Wir dazu und wer sid die anderen? Ein Dankgebet aus der griechischen Tradition, dem Sokrates oder Thales zugeschrieben: Wegen dieser 3 Dinge sage ich
Liebe Gemeinde! Wir und die anderen! Wer gehört zum Wir dazu und wer sid die anderen? Ein Dankgebet aus der griechischen Tradition, dem Sokrates oder Thales zugeschrieben: Wegen dieser 3 Dinge sage ich
Bibel für Kinder. zeigt: Die Geburt Jesu
 Bibel für Kinder zeigt: Die Geburt Jesu Text: Edward Hughes Illustration: M. Maillot Adaption: E. Frischbutter und Sarah S. Übersetzung: Siegfried Grafe Produktion: Bible for Children www.m1914.org BFC
Bibel für Kinder zeigt: Die Geburt Jesu Text: Edward Hughes Illustration: M. Maillot Adaption: E. Frischbutter und Sarah S. Übersetzung: Siegfried Grafe Produktion: Bible for Children www.m1914.org BFC
Inhalt. Einleitung Die Unterschätzung des Spiels in der evangelischen Religionspädagogik - Problemanzeige 19
 VORWORT 13 I. ERSTES KAPITEL Einleitung 15 1.1 Die Unterschätzung des Spiels in der evangelischen Religionspädagogik - Problemanzeige 19 1.2 Das gute Spiel - Annäherung an eine theologische Spieltheorie
VORWORT 13 I. ERSTES KAPITEL Einleitung 15 1.1 Die Unterschätzung des Spiels in der evangelischen Religionspädagogik - Problemanzeige 19 1.2 Das gute Spiel - Annäherung an eine theologische Spieltheorie
Die Rückkehr der Zwölf und die Speisung der 5000
 Geisteswissenschaft Matthias Kaiser Die Rückkehr der Zwölf und die Speisung der 5000 Zur Perikope Mk 6,30-44 Studienarbeit Die Rückkehr der Zwölf und die Speisung der Fünftausend Eine Hausarbeit über
Geisteswissenschaft Matthias Kaiser Die Rückkehr der Zwölf und die Speisung der 5000 Zur Perikope Mk 6,30-44 Studienarbeit Die Rückkehr der Zwölf und die Speisung der Fünftausend Eine Hausarbeit über
Der Erste und Zweite Petrusbrief Der Judasbrief
 Der Erste und Zweite Petrusbrief Der Judasbrief Übersetzt und erklärt von Otto Knoch Verlag Friedrich Pustet Regensburg Inhaltsverzeichnis Vorwort 9-10 DER ERSTE PETRUSBRIEF EINLEITUNG 13-30 1. Name, Stellung,
Der Erste und Zweite Petrusbrief Der Judasbrief Übersetzt und erklärt von Otto Knoch Verlag Friedrich Pustet Regensburg Inhaltsverzeichnis Vorwort 9-10 DER ERSTE PETRUSBRIEF EINLEITUNG 13-30 1. Name, Stellung,
Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck
 Es gilt das gesprochene Wort! Sperrfrist: Freitag, 06. Januar 2017, 17:30 Uhr Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck Predigt im Pontifikalamt zum Hochfest der Erscheinung des Herrn JK A Freitag, 06. Januar 2017,
Es gilt das gesprochene Wort! Sperrfrist: Freitag, 06. Januar 2017, 17:30 Uhr Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck Predigt im Pontifikalamt zum Hochfest der Erscheinung des Herrn JK A Freitag, 06. Januar 2017,
1. Staatsexamen (LPO I), nicht vertieft Klausurthemen: Neues Testament
 1. Staatsexamen (LPO I), nicht vertieft Klausurthemen: Neues Testament Herbst 2005 Die Gleichnisse Jesu Stellen Sie das so genannte Messiasgeheimnis bei Markus dar! Als Ausgangspunkt kann Markus 9,9 10
1. Staatsexamen (LPO I), nicht vertieft Klausurthemen: Neues Testament Herbst 2005 Die Gleichnisse Jesu Stellen Sie das so genannte Messiasgeheimnis bei Markus dar! Als Ausgangspunkt kann Markus 9,9 10
Paul Schütz: Die politische Religion Eine Untersuchung über den Ursprung des Verfalls in der Geschichte (1935)
 Vorwort aus: Paul Schütz: Die politische Religion Eine Untersuchung über den Ursprung des Verfalls in der Geschichte (1935) Herausgegeben und eingeleitet von S. 7 8 Impressum und Bildnachweis Bibliografische
Vorwort aus: Paul Schütz: Die politische Religion Eine Untersuchung über den Ursprung des Verfalls in der Geschichte (1935) Herausgegeben und eingeleitet von S. 7 8 Impressum und Bildnachweis Bibliografische
I. Teil: Eine Einführung in drei Schritten
 Inhalt Ein Wort zuvor............................ 11 I. Teil: Eine Einführung in drei Schritten 1. Ein bekanntes Bild und seine fragwürdige biblische Grundlage... 15 2. Was vom Verhältnis der Testamente
Inhalt Ein Wort zuvor............................ 11 I. Teil: Eine Einführung in drei Schritten 1. Ein bekanntes Bild und seine fragwürdige biblische Grundlage... 15 2. Was vom Verhältnis der Testamente
3. Drei Männer im Feuerofen (Daniel 3) 5. Daniel in der Löwengrube (Daniel 6) 6. Daniel und die Bibel (Gesamtschau)
 1. Daniel in Babylon (Daniel 1) 2. Nebukadnezars Traum (Daniel 2) 3. Drei Männer im Feuerofen (Daniel 3) 4. Belsazars Fest (Daniel 5) 5. Daniel in der Löwengrube (Daniel 6) 6. Daniel und die Bibel (Gesamtschau)
1. Daniel in Babylon (Daniel 1) 2. Nebukadnezars Traum (Daniel 2) 3. Drei Männer im Feuerofen (Daniel 3) 4. Belsazars Fest (Daniel 5) 5. Daniel in der Löwengrube (Daniel 6) 6. Daniel und die Bibel (Gesamtschau)
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lucius Annaeus Seneca, Zeit und Freizeit
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lucius Annaeus Seneca, Zeit und Freizeit Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de e lectio Herausgegeben von Matthias
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lucius Annaeus Seneca, Zeit und Freizeit Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de e lectio Herausgegeben von Matthias
Der ungläubige Thomas, wie er so oft genannt wird, sieht zum ersten Mal den auferstandenen Herrn und Heiland Jesus Christus, den die andern Apostel be
 Joh 20,28 - stand der allmächtige Gott vor Thomas? Einleitung Eine weitere bei Anhängern der Trinitätslehre sehr beliebte und oft als Beweis zitierte Stelle sind die Wortes des Apostels Thomas, die uns
Joh 20,28 - stand der allmächtige Gott vor Thomas? Einleitung Eine weitere bei Anhängern der Trinitätslehre sehr beliebte und oft als Beweis zitierte Stelle sind die Wortes des Apostels Thomas, die uns
Liebe Mitchristen, wenn ich bei einer Bestattung den Weihwasserbusch in der Hand halte und an die Taufe erinnere,
 Vierter Sonntag der Osterzeit, Lesejahr C Schwäbisch Hall, 21. April 2013 Lesung: Offb 7,9.14b-17 Evangelium: Joh 10,27-30 Handy und Palmzweig Ein Blick in die Zukunft tut gut. Die Unzählbaren aus allen
Vierter Sonntag der Osterzeit, Lesejahr C Schwäbisch Hall, 21. April 2013 Lesung: Offb 7,9.14b-17 Evangelium: Joh 10,27-30 Handy und Palmzweig Ein Blick in die Zukunft tut gut. Die Unzählbaren aus allen
Bibelverse An(ge)dacht Glaubensstärkung auf dem Weg durch das Jahr
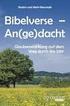 Kerstin und Mark Marzinzik Bibelverse An(ge)dacht Glaubensstärkung auf dem Weg durch das Jahr Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
Kerstin und Mark Marzinzik Bibelverse An(ge)dacht Glaubensstärkung auf dem Weg durch das Jahr Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
V Academic. Reinhard von Bendemann, Philo von Alexandria Über die Freiheit des Rechtschaffenen
 V Academic Kleine Bibliothek der antiken jüdischen und christlichen Literatur Herausgegeben von Jürgen Wehnert Vandenhoeck & Ruprecht Philo von Alexandria Über die Freiheit des Rechtschaffenen Übersetzt
V Academic Kleine Bibliothek der antiken jüdischen und christlichen Literatur Herausgegeben von Jürgen Wehnert Vandenhoeck & Ruprecht Philo von Alexandria Über die Freiheit des Rechtschaffenen Übersetzt
Herausgeber. West-Europa-Mission e.v. Postfach Wetzlar. Tel / Fax /
 17/VDSK West-Europa-Mission e.v. Postfach 2907 35539 Wetzlar WEM e.v., 2016 Tel. 0 64 41/4 28 22 Fax 0 64 41/4 31 79 email: info@wem-online.de Internet: www.wem-online.de Herausgeber Ohne Religion zu Gott
17/VDSK West-Europa-Mission e.v. Postfach 2907 35539 Wetzlar WEM e.v., 2016 Tel. 0 64 41/4 28 22 Fax 0 64 41/4 31 79 email: info@wem-online.de Internet: www.wem-online.de Herausgeber Ohne Religion zu Gott
Predigt zu Markus 9,14-21 "Ich glaube, hilf meinem Unglauben" Pfrin Martina Müller, 31. Oktober 2000, Muttenz Dorf, Jubiläum Goldene Hochzeit
 Predigt zu Markus 9,14-21 "Ich glaube, hilf meinem Unglauben" Pfrin Martina Müller, 31. Oktober 2000, Muttenz Dorf, Jubiläum Goldene Hochzeit 1. Einleitung Ich möchte Sie heute dazu anstiften, über Ihren
Predigt zu Markus 9,14-21 "Ich glaube, hilf meinem Unglauben" Pfrin Martina Müller, 31. Oktober 2000, Muttenz Dorf, Jubiläum Goldene Hochzeit 1. Einleitung Ich möchte Sie heute dazu anstiften, über Ihren
LEONARDO BOFF. Was kommt nachher? DAS LEBEN NACH DEM TODE OTTO MÜLLER VERLAG SALZBURG
 LEONARDO BOFF Was kommt nachher? DAS LEBEN NACH DEM TODE OTTO MÜLLER VERLAG SALZBURG Inhalt Einleitung 13 1. Kapitel: Tod und Gericht, Hölle, Fegefeuer und Paradies - Woher wissen wir das? 15 1. Die Gründe
LEONARDO BOFF Was kommt nachher? DAS LEBEN NACH DEM TODE OTTO MÜLLER VERLAG SALZBURG Inhalt Einleitung 13 1. Kapitel: Tod und Gericht, Hölle, Fegefeuer und Paradies - Woher wissen wir das? 15 1. Die Gründe
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Wie ein Fenster zu Gott - Gleichnisse sehen lernen. Alles, was wir wissen müssen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Wie ein Fenster zu Gott - Gleichnisse sehen lernen. Alles, was wir wissen müssen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Jesus Christus Geburt und erstes Wirken
 Die Bibel im Bild Band 12 Jesus Christus Geburt und erstes Wirken Die Welt, in die Jesus kam 3 Lukas 1,5-22 Ein Geheimnis 8 Lukas 1,23-55 Der Wegbereiter 9 Lukas 1,57-80; Matthäus 1,18-25; Lukas 2,1-5
Die Bibel im Bild Band 12 Jesus Christus Geburt und erstes Wirken Die Welt, in die Jesus kam 3 Lukas 1,5-22 Ein Geheimnis 8 Lukas 1,23-55 Der Wegbereiter 9 Lukas 1,57-80; Matthäus 1,18-25; Lukas 2,1-5
