Elemente des Handlungsbegriffs bei Thomas von Aquin
|
|
|
- Brit Otto
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Herbert Huber Vorlesung SoSe 2006 I. Handlung (1) II. Objekt (3) 1. Äußeres Objekt, d. i. der Inhalt der Handlung (6) 2. Inneres Objekt, d. i. die Absicht der Handlung (8) III. Umstände (10) 1. Begriff der Handlungsumstände (10) 2. Der Umstand Handlungsfolgen (10) Schriften (13) Elemente des Handlungsbegriffs bei Thomas von Aquin (1) Der sittliche Gesamtcharakter einer Handlung, d. h. ihr Gutsein oder Schlechtsein, hängt von vier Elementen ab (Sth I-II, 18,4): [b] [c] davon, dass es tatsächlich eine Handlung ist, von dem Inhalt (obiectum), den sie von sich her hat, von der Absicht (finis), d. h. dem Inhalt, der durch sie realisiert werden soll, [d] von den Umständen (circumstantiae). 1 Zusatz: [1750] Actuum humanorum moralitas dependet: ex obiecto electo; ex fine intento seu ex intentione; ex circumstantiis actionis. Obiectum, intentio et circumstantiae «fontes» constituunt, seu elementa constitutiva, moralitatis actuum humanorum.... [1756] Erroneum ergo est de actuum humanorum moralitate iudicare, solummodo intentionem quae illos inspirat, vel circumstantias considerando (rerum ambitum, socialem pressionem, coactionem vel necessitatem agendi) quae quasi eorum sunt scaena. Actus sunt qui per se ipsos et in se ipsis, independenter a circumstantiis et ab intentionibus, ratione sui obiecti semper sunt graviter illiciti; sic blasphemia et periurium, homicidium et adulterium. Non licet malum facere ut exinde bonum proveniat. Betrachtet man eine Handlung nach Objekt, Absicht und Umständen, hat man sie in ihrer Ganzheit erfasst: actus humanus in sua integritate spectatus, wie der Thomaskommentator Cajetan sagt (Anmerkung 6 zu Sth I-II, 19,2 in der Marietti-Ausgabe, Turin 1952). 2 I. Handlung (2) Handlungen sind willentlich (Sth I-II, 6 und 8), während ein Geschehen, das nicht Ausdruck eines Wollens ist, keine Handlung darstellt (Freiheit). Richtig zu handeln heißt, zwischen alternativen Möglichkeiten des Verhaltens so zu wählen (Intentionalität; Sth I-II, 1 und 12), dass die Handlung der Situation gerecht wird (Verantwortlichkeit; Sth I-II, 9). 3 In dem Maße, in dem jemand ohne viel zu überlegen, sich von den Ereignissen treiben lässt, ist sein Verhalten keine Handlung, sondern nur ein Geschehen aus äußerer Kausalität. Das Verhalten gehört dann insoweit nicht der Gattung (genus) Handlung an. Deshalb bemisst sich, Thomas zufolge, die generische Gutheit einer Handlung daran, dass sie nicht hinter dem erforderlichen Maß an Willensanstrengung, sowie überlegter und verantworteter Alternativenauswahl zurückbleibt. 1 Katechismus der Katholischen Kirche, Nr und Als erste Hinführung zum Denken des hl. Thomas von Aquin eignet sich ganz hervorragend Chesterton Sehr instruktiv auch Chenu Vgl. auch Gilson 1972,
2 Zusatz 1: Das menschliche Handeln wird von Thomas im Zweiten Teil seiner theologischen Summe erörtert. Die Ethik des Thomas ist nicht aus ihrer Verflechtung mit der Theologie zu lösen. 4 Aber worin besteht diese Verflechtung? Nicht darin, dass eine durch Gott vorgegebene Moral gelehrt würde. 5 Geltungsgrund des Sittlichen ist bei Thomas nicht ein Befehl Gottes, sondern die innere Evidenz des sittlich Gebotenen. Wir erkennen das Sittliche als eigenes Ziel unserer Vernunftnatur. Wir würden zwar nicht existieren und dies Ziel auch nicht erkennen, wenn nicht Gott uns geschaffen hätte, und insofern liegt Gott der Moral zugrunde. Aber das einmal erfasste sittliche Ziel hat seine Beglaubigung in sich selbst und bedarf keines äußerlichen göttlichen Imperativs. Das sittlich Gebotene ist nicht von Gott willkürlich gesetzt (denn die Setzung aus reiner Willkür widerspricht der Vernunft 6 ), sondern folgt der Natur der jeweiligen Sache. 7 So ist das Sittliche in und durch sich selbst Imperativ. Das menschliche Handeln ist selbstständig. Der Mensch versteht selbst die Welt und er handelt selbst, nicht Gott drängt ihm etwas auf und Gott handelt auch nicht in ihm als einer Marionette. Dennoch steht der Mensch in seinem Verstehen und Handeln in der Abhängigkeit von Gott, weil er sich die Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit seines Verstehens und Handelns nicht selbst gegeben und geschaffen hat, sondern durch eine höhere Macht (die mehr vermag als er) dazu ermächtigt wird. So ist er gerade in seiner Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit das Ebenbild jener höheren Macht, ohne die er selbst nicht selbstständig wäre 8 : Quia, sicut Damascenus dicit, homo factus est ad imaginem Dei dicitur, secundum quod per imaginem significatur intellectuale et arbitrio liberum et per se potestativum; postquam praedictum est de exemplari, scilicet de Deo, et de his quae processerunt ex divina potestate secundum eius voluntatem; restat ut consideremus de eius imagine, idest homine, secundum quod et ipse est suorum operum principium, quasi liberum arbitrium habens et suorum operum potestatem (Sth I-II, Prologus: Da, wie Damascenus sagt, der Mensch als zum Ebenbild Gottes geschaffen geheißen wird, wobei mit der Ebenbildlichkeit das Vernünftige und dem Willen nach Freie und das durch sich selbst Mächtigsein bezeichnet ist, bleibt, nachdem vorhin schon vom Urbild, d. h. von Gott und dem, was aus der göttlichen Macht gemäß derer Willen hervorgegangen ist, die Rede war, übrig, dass wir über dessen Ebenbild nachdenken, d. h. über den Menschen, insofern auch er selber der Ursprung seiner Handlungen ist, weil er nämlich freien Willen hat und Macht über seine Handlungen ). Zusatz 2: Das natürliche Gesetz (lex naturalis) d. h. das aus der Natur eines jeden Wesens fließende Gesetz oder die in seiner Natur bzw. als seine Natur gesetzte Dynamik seines Daseins ist die in jedem Wesen schon ohne sein Zutun wirksame Tendenz oder Intentionalität 9 all seiner Daseinsvollzüge auf sein je spezifisches Selbstsein hin. Diese Dynamik lässt den Fisch in s Wasser, den Vogel in die Luft streben, den Menschen aber zur Betätigung seiner spezifischen leiblichen, seelischen und vernünftigen Daseinsvollzüge. Dieses Gesetz oder diese spezifische Normativität 10 eines jeden Wesens ist ihm vorgegeben, d. h. sie unterliegt nicht seinem Belieben, und setzt es sich dennoch darüber hinweg (indem z. B. der Fisch versucht, an Land zu leben, oder der Mensch, durch Betrug Karriere zu machen), so beeinträchtigt das betreffende Wesen sich selbst in dem, was es in Wahrheit oder eigentlich selber ist. Das spezifische natürliche Gesetz eines Wesens artikuliert die Weise seiner Teilhabe an der von Gott geschaffenen (für uns nicht überschaubaren) Gesamtordnung des Universums, also seine Teilhabe an der lex aeterna. Anders gesagt: Durch die lex naturalis wird die lex aeterna für die je bestimmten Wesen konkret. Das bedeutet: Wie Gott die Welt insgesamt will, wissen wir nicht. Aber wir wissen sehr, wohl, dass er die Welt insgesamt so will, dass sie am Ort des Elephanten Elephant, am Ort des Granits Granit und am Ort des Menschen Mensch ist. Was die Weltordnung insgesamt hier und jetzt ist und sein will, das erkennen wir aus dem, als was sie sich hier und jetzt unserer Vernunft zeigt ( 7 Zusatz). Zusatz 3: Die lex naturalis stellt den weiten Rahmen dar, den der Mensch durch sein Handeln in persönlicher Freiheit ausgestaltet. Gott bewegt zwar den Willen des Menschen, insofern er ihn als des Wollens fähiges Wesen überhaupt erst schafft (der Mensch hat sich diese Fähigkeit nicht selber gegeben, noch könnte er sie sich geben). Gott setzt also den Willen des Menschen in Gang, er determiniert ihn dazu, wollendes Wesen zu sein. Aber Gott bestimmt und determiniert nicht, was der Mensch wollen soll, außer in den Bestrebungen, die er von Natur in ihn gelegt hat, wie zu atmen, zu denken usw. (Sth I-II, 10,4). Der grundlegende sittliche Imperativ 4 Kluxen 1998, 87 5 Für gläubige Christen sind es Normen, die Gott erlassen bzw. Jesus den Menschen mitgeteilt hat (Hoerster 2006, Ziffer 9). Das ist eine (überdies schlechte) Karikatur des christlichen Moralverständnisses. 6 Schönberger 1998, Spaemann 2001, 10ff ( = Spaemann 1990, Xff) 8 Kluxen 1998, Huber 2006, 41ff 10 Huber 2006, 60f 2
3 (primum praeceptum legis) besagt: bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum (Sth I-II, 94,2: Das Gute ist zu tun und zu verfolgen und das Schlechte ist zu meiden ). Aber was ist gut? Gut ist für jedes Wesen das, wozu es eine naturalis inclinatio eine natürliche Hinneigung in sich trägt, d. h. das, was es arttypischerweise normalerweise von sich aus und gerne tut. Thomas spricht in Sth I-II, 94,2 zwar ausdrücklich nur vom Menschen, aber das Gesagte gilt tatsächlich für jedes Wesen. Denn die inclinatio ist das, was ohne bewussten Willen und ohne bewusste Absicht von Natur aus in allen Wesen wirkt (Sth I-II, 1,2). So stellt Thomas fest, [b] [c] dass der Mensch mit allen Wesen (substantiis) darin übereinkommt, nach seinem eigenen spezifischen Dasein zu streben: quaelibet substantia appetit conservationem sui esse secundum suam naturam (Sth I-II, 94,2: Jedes Wesen erstrebt die Erhaltung seines Seins gemäß seiner [spezifischen] Natur ); dass der Mensch mit allen Tieren darin übereinkommt, nach bestimmten Daseinsvollzügen zu streben, wie z. B. der Vereinigung der Geschlechter und der Aufzucht der Kinder (Sth I-II, 94,2); dass der Mensch vermöge seiner eigenen spezifischen Natur seiner Vernunftnatur 11 dazu geneigt ist, die Wahrheit zu erforschen (d. h. Welt und Gott verstehen zu wollen) und in Gemeinschaft mit anderen Menschen, samt den darin begründeten sittlichen Verhältnissen und den in diesen liegenden Verpflichtungen 12, statt in rücksichtsloser Selbstbezogenheit zu leben: homo habet naturalem inclinationem ad hoc quod veritatem cognoscat de Deo, et ad hoc quod in societate vivat (Sth I-II, 94,2: Der Mensch hat eine natürliche Neigung dazu, die Wahrheit über Gott zu erkennen und dazu, in menschlicher Gemeinschaft zu leben ). Alle Handlungen, die gemäß der menschlichen Vernunftnatur [c], also auf spezifisch menschliche Weise vollzogen werden, sind actiones humanae. Alle anderen Verrichtungen des Menschen stellen bloß actiones hominis dar (Sth I-II, 1,1). So ist das Atmen als bloß biologische Funktion eine actio hominis, als Meditationstechnik oder Gebetshilfe vollzogen, erhält der vitale Akt eine kulturelle Überformung gemäß der spezifischen Perspektive der Vernunftnatur, weil nicht nur geatmet wird, um zu leben, sondern um diesen oder jenen religiösen Inhalt besser zu erfassen. So wird das Atmen zur actio humana, zu einem Atmen, das auf diese Weise keinem Tiere möglich ist. II. Objekt (3) Der Inhalt einer Handlung ist nicht der äußere Gegenstand, auf den sie sich bezieht. Und menschliche Handlungen sind mehr als die äußeren Ereignisse, aus denen sie bestehen. Wenn z. B. einer einen anderen ausraubt, so verursacht er nicht bloß die Ortsveränderung von Gegenständen (das Geld war vorher in der Tasche des Beraubten, jetzt ist es in der des Räubers), sondern er beeinträchtigt auf eine bestimmte Weise die Ordnung eines bestimmten Lebensbereiches, nämlich der Eigentumsverhältnisse. Handlungen haben also eine Wirklichkeit, die nur von vernünftigen Wesen geistig wahrgenommen werden kann: Handlungen haben objektive Bedeutungen, denn in ihnen verschafft sich das menschliche Leben seinen Ausdruck. Objektiv sind diese Bedeutungen deshalb, weil sie nicht nach Belieben vom Handelnden selbst in die Handlungen gelegt werden können, sondern diesen vermöge des jeweils vorgegebenen lebensweltlichen Kontextes innewohnen. Zusatz 1: Eine Handlung hat eine natürliche und eine moralische Artbestimmung (species naturalis / species moris). So ist das Totschlagen eines Menschen in allen Fällen dieselbe natürliche Artbestimmung, es kann aber unter ganz unterschiedliche moralische Artbestimmungen fallen, je nach dem, auf welche Absicht oder welchen Zweck die Tat hingeordnet ist. Und so kann es sich beim Töten um Raubmord, Rache, Strafe oder Opfer handeln (Sth I-II, 1,3 ad tertium). Zusatz 2: Handlungen bedeuten etwas für den Handelnden, für die Betroffenen und für die Allgemeinheit. Sie beeinflussen bestimmte Lebensbereiche auf bestimmte Weise. Wenn ein Arzt Patienten heilt, so betreffen seine 11 Huber 2006, 3, 54, 78, 223. Zu den drei Gruppen von inclinationes vgl. das honestum bei Cicero: De officiis I, (dazu Huber 2006, ). 12 Huber 2006, 62, 76 3
4 Handlungen auf verschiedene Weise den Bereich der körperlichen und seelischen Gesundheit. Wenn die Industrie Luft und Wasser verseucht, betreffen diese Handlungen die Natur. Wenn Eltern einkaufen oder in Elternsprechabende gehen, betreffen ihre Handlungen den Bereich der Familie. Weitere Lebensbereiche bzw. Handlungsfelder sind etwa Sprache, Nahrung, Geschlechtlichkeit, Familie, Gemeinwesen, Ehre, Herrschaft, Recht, Numinoses. Derartige Lebensinhalte sind allgemeinmenschliche Konstanten. Sie prägen sie sich in den einzelnen Kulturen auf unterschiedliche Weise aus und werden vom einzelnen Handelnden nochmals auf persönliche Weise verlebendigt. Dabei wird jedoch nicht ihre Natur verändert, sondern lediglich ihre konkrete Gestalt modifiziert. 13 Deshalb kann die Bedeutung einer Handlung hinter ihrer kulturellen Einkleidung im Prinzip von allen Menschen verstanden werden. Je nach dem Lebensbereich, den eine Handlung berührt, und je nach der Art und Weise, in der sie ihn beeinflusst, hat eine Handlung ihre spezifische Bedeutung. Die Bedeutung ergibt sich aus der Natur des jeweiligen Lebensbereiches und daraus, in welcher Weise die betreffende Handlung dieser Natur der Sache gerecht wird oder sie verfehlt bzw. verfälscht. (4) Die spezifische Bedeutung die ein Gegenstand kraft der jeweiligen Art, wie mit ihm handelnd umgegangen wird, und kraft der eigentümlichen Struktur des Lebensbereiches, dem er angehört, für das menschliche Leben entfaltet, ist der Inhalt oder das Objekt des Handelns. Das Objekt macht die Handlung daher identifizierbar und klassifizierbar. Zusatz: Wenn jemand lügt, tätigt er eine Lautäußerung, genauso wie einer, der die Wahrheit spricht. Zwei Schüler sagen zum Lehrer denselben Satz, z. B. Ich habe die Mappe von Fritz nicht zum Fenster hinausgeworfen, das war Martin. Wenn der eine Schüler die Wahrheit spricht und der andere lügt, dann bringen beide dieselbe Art von physikalischem Ereignis hervor. Aber es sind zwei vollkommen verschiedene Arten von Handlung: das eine ist eine Lüge, das andere eine wahre Aussage. Lügner und Wahrsprecher verursachen dasselbe äußere Ereignis, aber die Bedeutung, die dem Ereignis dadurch zukommt, dass es nicht in neutraler Natur, sondern im Raum menschlicher Sprache stattfindet, verkehrt der Lügner in ihr Gegenteil. Der Lügner tut nur so, als nehme er an der durch Sprache eröffneten gemeinsamen Welt teil. Tatsächlich benützt er die Sprache, um die anderen über seine abweichende Welt zu täuschen. Das Ereignis Sprechen kann somit als Handlung zwei völlig verschiedene Bedeutungen (oder Objekte) haben: Wahrreden und Lügen. Und es kann sogar noch viel mehr Bedeutungen haben: Sich entschuldigen, Beleidigen, Schwören, Anbeten und so fort. (5) Der Willensakt beim Handeln ist ein in sich doppelter (Sth I-II, 6,4; 8,2 und 3; 18,6), denn Handeln heißt, ein Ziel wollen und es realisieren wollen. So muss z. B. jemand, der Fußballspielen will (Ziel), auch laufen, schießen und trainieren wollen (realisierende Handlungsinhalte). Daher gilt: [b] Der Wille ist auf das Ziel (finis) gerichtet, das er in einer inneren Vorstellung vor Augen hat. Das Ziel ist das Objekt des inneren Willensaktes das innere Objekt oder die Absicht oder der verfolgte Zweck. Das Ziel (die Absicht, der Zweck) formuliert, was jemand tun will, also das quid einer Handlung. Der Wille ist aber auch auf die einzelnen Handlungsinhalte gerichtet, die erforderlich sind, um sein Ziel in der äußeren Welt zu realisieren. Die Inhalte dieser Handlungen sind die Objekte der äußeren Willensakte das äußere Objekt oder die Mittel. Die Inhalte oder Objekte der das Ziel realisierenden Handlungen (der Mittel) bilden das In-Bezug-Worauf jemand handelt, um sein Ziel (seinen Zweck) zu realisieren, also das circa quid bzw. circa quod der Handlung (Sth 7,3; 18,6). Zusatz 1: Das circa quid ist die objektive Bedeutung, die sich in einer Handlung ausdrückt, unabhängig davon, was der Handelnde wollte ( 3). Wenn ich in einer Scheune voller trockenen Strohs ein brennendes Streichholz wegwerfe, weil es mir die Finger versengt, dann geht meine Handlung darauf, Schmerz zu vermeiden. Das ist es, was (quid) ich tun will. Was ich aber tatsächlich tue, ist, einen Brand zu verursachen. Der Handlungsinhalt, durch den oder in Bezug auf welchen (circa quid) ich meine Absicht realisiere, ist die Auslösung eines Brandes. Wenn Titus den Tempel in Jerusalem ausraubt, um Beute zu machen, dann ist das Beutema- 13 Huber 1996,
5 chen das, was (quid) er tut, seine Absicht. Das Mittel, durch welches oder in Bezug worauf (circa quid) er die Absicht, Beute zu machen, realisiert, ist die Schändung eines Tempels, also ein Sakrileg. Gesetzt, Schüler spielen auf dem Pausenhof Fußball, der aufsichtführende Lehrer verbietet es durch Zuruf, und einer der Schüler schießt den Ball neben dem Tor in s Aus. Der Schüler kann die Absicht gehabt haben, das Spiel dadurch zu beenden. Dann wäre das, was (quid) er getan hat, dem Lehrer zu gehorchen. Der Handlungsinhalt, durch den oder in Bezug auf welchen (circa quid) der Schüler seinen Gehorsam realisiert, hat aber objektiv die Bedeutung des Fußballspielens: Wer den Ball Richtung Tor schießt (auch wenn er daneben trifft), spielt Fußball. Und so kann der Lehrer sagen, der Schüler habe nicht gehorcht, sondern mit dem Fußballspielen trotz Verbot einfach weitergemacht. So kann der objektive Gehalt einer Handlung die in ihr zum Ausdruck kommende Absicht verdecken. Zusatz 2: Der Mensch wünscht als oberstes oder letztes Ziel die vollkommene Erfüllung, über die hinaus nichts weiter zu wünschen bleibt (Sth I-II, 2,8 und 3,8). Das ist das bonum universale, das alles umfassende Gut. Alle partikulären Güter sind insofern wünschenswürdig und erfüllend, als sie für sich genommen tatsächlich gut sind. Aber sie sind nicht wünschenswürdig, insofern sie andere Wünsche offen lassen und nicht erfüllen. Wer etwas Gutes schmecken will, für den ist ein italienischer Rotwein wünschenswürdig. Wer aber nicht nur etwas Gutes schmecken will, sondern möglichst alles Gute, für den ist der italienische Rotwein nicht mehr wünschenswürdig, wenn er dazu führt, dass der Genuss eines französischen Rotweins durch ihn auf Dauer verdrängt wird. Der Wille kann also vielerlei wollen, und er wird es immer auch wieder nicht (als Einziges) wollen, insofern es ihm nicht genügt und er auch noch anderes will. Weil nichts in der Welt in jeder Hinsicht gut ist, kann es immer auch nicht gewollt werden 14. Hierin besteht die Freiheit des Willens, der, da er nie alles haben kann, zu wählen hat. Das einzige Gut, was der Wille notwendigerweise wollen muss, was er nicht nicht wollen kann, ist das universale Gut, weil in diesem nichts Unerfülltes mehr liegt, das den Willen veranlassen könnte, darüber hinauszugehen. Und dies ist die beatitudo (Sth I-II, 10,2), also das, was Aristoteles die eudaimonia genannt hatte. 15 Aristoteles hat zwischen der menschlichen und der göttlichen eudaimonia unterschieden. Entsprechend unterscheidet Thomas zwischen der imperfecta und der perfecta beatitudo (Sth I-II, 3,6). Die beatitudo perfecta ist das verstehende Erleben aller Güter. Weil es nicht allein um den Genuss, sondern um den verstehenden Genuss der Güter geht 16, darum ist die beatitudo ein Schauen und eher eine Tätigkeit der spekulativen als der praktischen Vernunft (Sth I-II, 3,5). Das menschliche Betrachten der spekulativen Dinge ist während seines irdischen Lebens, in welchem er den Endlichkeitsbedingungen von Raum und Zeit unterworfen ist, nur eine unvollkommene Teilhabe an dem, was nur Gott allein vollkommen erschaut. Erst in der visio divinae essentiae (Sth I- II, 3,8) im jenseitigen Leben ist dem Menschen die Teilhabe an der ewigen und vollkommenen göttlichen Schau selbst möglich. Zusatz 3: Das bonum perfectum muss eines sein. Es kann zwar viele partikulare Güter umfassen, die aber untereinander zu einer Einheit zusammenhängen müssen. Das rührt daher, dass das vollkommene Gut nicht nur objektiv alles Gute erschöpft, sondern für den Menschen auch subjektiv die vollkommene Erfüllung (completivum sui ipsius) bedeutet (Sth I-II, 1,5 und 1,7). In der Einheit meiner Person und meines Erlebens müssen die unterschiedlichsten Güter zusammenbestehen können, andernfalls zerfiele ich in so viele Personen als ich unvereinbare Güter mit letztem Ernst erstreben würde. Das vollkommene Gut ist nicht die Lust, sondern die Teilhabe an den Gütern. Dieser Teilhabe folgt die Lust nur per accidens, sie ist Nebenfolge, die für sich allein gar nicht angestrebt wird (Sth I-II, 2,6): delectatio est appetibilis propter aliud, idest propter bonum, quod est delectationis obiectum, et per consequens est principium eius, et dat ei formam: ex hoc enim delectatio habet quod appetatur, quia est quies in bono desiderato (Sth I-II, 2,6 ad primum: Die Lust ist erstrebenswürdig wegen etwas anderem, nämlich wegen des Guten, das der Gegenstand [Inhalt] der Lust ist und folglich ihr Ursprung, und das ihr die Form gibt: dass die Lust erstrebt wird, kommt nämlich daher, dass sie das Ruhen im erwünschten Gut ist ). Das vollkommene Gut kann nicht in der Summe aller geschaffenen Güter bestehen, sondern nur in der Teilhabe an Gott als dem Urgrund aller Gutheit und aller Güter. Denn jedes Gut ist nur gut durch die Teilhabe (participatio) an Gott, und so ist man alles Guten dann wirklich teilhaftig, wenn man seiner Quelle teilhaftig geworden ist (Sth I-II, 2,8). Das Gut eines vollendeten Puzzlebildes liegt auch nicht in der Summe seiner Teile, sondern in der richtig angeordneten Summe der Teile und dem Überblick über dies Ganze. So ist das vollkommene Gut nicht eine Ansammlung einzelner partikulärer, je für sich aber auch wieder ungenügender Güter, sondern der Überblick über alle und ihr Zusammenspiel, d. h. die Teilhabe am Gottesstandpunkt (sub specie aeternitatis). Aus der Summe der Güter (wie auch aus jedem einzelnen) können wir schließen, dass es eine diese 14 Schönberger 1998, 142. Aber bestimmte Handlungen sind in jeder Hinsicht schlecht, dann nämlich, wenn sie die Würde des Menschen verletzen (Huber 2006, 78). 15 Scriptum zur Nikomachischen Ethik, Kluxen 1998, Vgl. Scriptum zur Nikomachischen Ethik, 44, besonders [c]. 5
6 Güter insgesamt ordnende Macht gibt (an est), aber wir sehen nicht, wie diese Ordnung beschaffen ist (quid est), solange wir nicht alles im Ganzen überblicken und somit den Blickpunkt der ordnenden Macht (Gottes) selber einnehmen, mithin also der visio divinae essentiae teilhaftig geworden sind (Sth I-II, 3,8). Auch hier gilt wieder, dass die Schau ursprünglicher ist, als die damit verbundene Lust (Sth I-II, 4,2). (6) Weil das Ziel den realisierenden Handlungsinhalten die Richtung bestimmt, gibt es der gesamten Handlung gewissermaßen die Form. Die Objekte ( 3f) der einzelnen zielrealisierenden Handlungen machen den materialen Aspekt der Gesamthandlung aus (Sth I-II, 7,3; 18,7; 19,10 ad sec. und ad sec. zum Sed contra). Wenn Thomas vom Objekt spricht, meint er oft nur das äußere Objekt, während er das innere Objekt meist Ziel nennt (z. B. Sth I-II, 18,7). Dieser Sprachgebrauch wird auch von mir im Folgenden beibehalten. (7) Das Objekt einer Handlung (der Handlungsinhalt) ist entweder sittlich indifferent (Sth I- II, 19,8) oder es hat sittliche Bedeutung. Die sittliche Bedeutung wird dem Handlungsinhalt nicht beliebig zugeschrieben, sondern sie liegt objektiv in ihm selbst. Denn es ist die Vernunftordnung des Seins, die dem Handlungsinhalt (dem inneren und dem äußeren Objekt) seine Bedeutung seine Natur der Sache gibt. Man sieht daher einer Sache ihre sittliche Qualität (gut oder böse) an, indem man sie vernünftig betrachtet: Unde si obiectum actus includat aliquid quod conveniat ordini rationis, erit actus bonus secundum suam speciem, sicut dare eleemosynam indigenti (Sth I-II, 18,8: Daher, falls das Objekt der Handlung etwas einschließt, was der Vernunftordnung entspricht, wird die Handlung von ihrer Art her gut sein, wie das Almosengeben an einen Bedürftigen ). [b] Dies gilt für das äußere Objekt (die realisierende Handlung, die Mittel): actus exterior habet bonitatem vel malitiam secundum se, scilicet secundum materiam vel circumstantias (Sth 20,3: die äußere Handlung hat ihre Gutheit oder Schlechtheit gemäß sich selbst, d. h. gemäß der Materie oder der Umstände ). Und es gilt für das innere Objekt (die Absicht, den Zweck): finis est obiectum voluntatis... Unde quantum ad actum voluntatis, non differt bonitas quae est ex obiecto, a bonitate que est ex fine (Sth I-II, 19,2 ad primum: die Absicht ist das Objekt des Willens... Daher unterscheidet sich, insofern es den Willensakt betrifft, die Gutheit, die aus dem Objekt stammt, nicht von der Gutheit, die aus der Absicht stammt ). Zusatz: Vernunft kommt von Vernehmen 17. Daher besteht die vernünftige Betrachtung darin, das, was eine Sache ist (ihr Sein), unverkürzt und unparteiisch nach all ihren Seiten zu vernehmen Äußeres Objekt, d. i. der Inhalt der Handlung ( 1-b) (8) Äußere Handlungsinhalte sind in sich gut oder schlecht. Aber sie sind außerdem auf die Absicht (den inneren Inhalt) bezogen, die sie realisieren sollen. Dabei kann der Fall eintreten, dass die sittliche Qualität des inneren und des äußeren Handlungsinhaltes differieren, d. h. dass z. B. die Absicht gut, die sie realisierende Handlung aber schlecht ist oder umgekehrt. So etwa wenn jemand stiehlt, um Almosen zu geben 19. Ist für die Beurteilung der Handlung nun das innere oder das äußere Objekt ausschlaggebend? Thomas stellt zuerst fest (Sth I-II, 20,1), dass von der Seinsordnung her der äußere Handlungsinhalt seine Gutheit oder 17 Schopenhauer I, 73 (Die Welt als Wille und Vorstellung, Erstes Buch 8) 18 Wie dies im Einzelnen vor sich geht, dazu vgl. Huber 2006, Das Beispiel erwähnt Thomas in Sth I-II 18,7 6
7 Schlechtheit vor und außerhalb seiner Bezogenheit auf ein Handlungsziel (d. h. vor aller und unabhängig von aller Absicht, die der Handelnde damit verbindet) in sich selbst hat. So ist im Beispiel das Stehlen in sich selbst schlecht, wenn es auch auf ein gutes Ziel hingeordnet wird. Innerhalb des Handlungsvollzuges ist es jedoch umgekehrt: Hier ist die gute oder schlechte Absicht (das innere Objekt) primär, auf welche sekundär eine gute oder schlechte Realisierungshandlung folgt. So folgt im Beispiel auf die gute Absicht des Almosengebens die schlechte Realisierungshandlung des Stehlens. Wenn wir eine Handlung beurteilen, gehen wir tatsächlich so vor: Wir sagen: Natürlich hat jener damit, dass er gestohlen hat, etwas Schlechtes getan (das bezieht sich auf die Seinsordnung); aber umgekehrt sagen wir: Dem Stehlen lag doch eine gute Absicht zugrunde (das bezieht sich auf den Handlungsvollzug). Das Ergebnis der Analyse der Beispielhandlung ist daher folgendes: Einerseits ist die Handlung schlecht nämlich von der Seinsordnung her, weil Stehlen in sich schlecht ist und bleibt. Andererseits ist die Handlung gut vom Handlungsvollzug her, weil ihr eine gute Absicht zugrunde liegt. (9) Mit einem einerseits-andererseits ist aber die Frage nicht entschieden, zu welchem Gesamtergebnis die Beurteilung einer Handlung kommen muss, deren inneres und äußeres Objekt hinsichtlich ihrer sittlichen Qualität differieren. Daher zeigt Thomas als Nächstes, dass die Gutheit/Schlechtheit einer äußeren Handlung zwar auch davon abhängt, auf welches Ziel sie hingeordnet ist, dass dies jedoch nicht über die ganze Gutheit/Schlechtheit (tota bonitas [vel malitia]) der äußeren Handlung entscheidet (Sth I-II, 20,2). Denn eine äußere zielrealisierende Handlung ist nicht erst dann schlecht, wenn sie einem schlechten Ziel (Zweck) als Mittel dient, sondern bereits dann, wenn sie zwar einem guten Ziel dient, von sich her aber schlecht ist. Eine zielrealisierende Handlung hat zwei sittliche Aspekte: Ihre eigene sittliche Qualität (ex actu volito) und die sittliche Qualität des Zieles, auf welches sie hingeordnet ist (ex intentione finis). Es genügt, dass einer der beiden Aspekte schlecht ist, um die ganze Handlung schlecht zu machen. Denn was auch nur einen einzigen Mangel aufweist, ist nicht mehr einfachhin gut (bonum causatur ex integra causa, malum autem ex singularibus defectibus [Sth I-II, 19,6 ad primum: Das Gute wird durch die unverdorbene Sache begründet, das Schlechte durch einzelne Mängel ). Zusatz 1: Mit anderen Worten: Über die Gutheit/Schlechtheit eines Mittels kann nicht allein vom Zweck her, dem es dient, entschieden werden. Der Zweck heiligt die Mittel nicht. Es kann also die gute Absicht eine schlechte Tat nicht insgesamt gut machen aber auch eine schlechte Absicht die gute Tat nicht insgesamt schlecht: Wenn jemand stiehlt, um Almosen zu geben, bleibt das Stehlen als solches schlecht; und wenn jemand nur aus Eitelkeit Almosen gibt (um sein Ansehen zu steigern), bleibt das Almosengeben als solches gut. Hinsichtlich der Gesamthandlung hingegen muss man in beiden Fällen sagen, dass sie schlecht ist, weil wenn eine der beiden Komponenten (Absicht oder Objekt) schlecht ist, das Ganze nicht mehr gut ist. Max will seinem Freund Ludwig helfen und belügt daher den Lehrer. Das Ziel (die Absicht) von Max ist gut: es ist nicht das Lügen (die Verdrehung des wahren Sachverhalts), sondern die Hilfe für den Freund. Realisiert hat er dieses Ziel aber durch die Handlung des Lügens, die schlecht ist. Deshalb ist die Handlung insgesamt schlecht. Robin Hood will Almosen geben, und zu diesem Zweck stiehlt er fremdes Eigentum. Sein Ziel (oder seine Absicht) ist gut, sein realisierender Handlungsinhalt jedoch schlecht. So ist die Handlung insgesamt schlecht. Zusatz 2: Allerdings ist der Grad der Gutheit oder Schlechtigkeit der Gesamthandlung abhängig von der Ranghöhe des Gutes, um welches es geht. So lehrt Thomas, dass die Sünde sich mindert, wenn man um eines hohen Gutes willen lügt (Sth II-II 110,2; vgl. Katechismus der Katholischen Kirche Nr. 2488). Wer also etwa lügt, um einem anderen das Leben zu retten 20, sündigt sozusagen in vernachlässigbarer Größenordnung. Ähnlich beurteilen wir auch die Wegnahme fremden Eigentums im Falle großer Not: Mundraub ist nicht strafbar. 20 Dies ist ein berühmtes Beispiel, das Kant diskutiert. Vgl. Huber 1997, 95f. 7
8 2. Inneres Objekt, d. i. die Absicht der Handlung ( 1-c) (10) Die Gutheit/Schlechtheit des Willens der Absicht hängt von der Gutheit bzw. Schlechtheit seines Inhalts ab, also von der Gutheit/Schlechtheit, die das innere Objekt von sich her besitzt (Sth I-II, 19,1 und 2; vgl. 7 [2]). Gut ist ein Inhalt durch die Vernunft (Sth I-II, 19,3), nämlich durch den, die göttliche Weltvernunft, die in seinem, wie in allem Sein als ewiges Gesetz (Sth I-II, 19,4) waltet ( 2 Zusatz 2). (11) Die objektive Vernunft des Seins wird von der subjektiven Vernunft des Menschen erkannt. Zwischen beiden kann es zur Differenz kommen, so dass etwas, das seiner Natur nach (secundum sui naturam) gut ist, als schlecht aufgefasst wird (a ratione apprehenditur ut malum). In diesem Fall irrt die (subjektive) Vernunft. Verpflichtet nun diese irrende Vernunft, das irrende Gewissen? Würde in genannten Fall der Wille der irrenden Vernunft nicht folgen, verrichtete er zwar etwas objektiv Gutes, würde aber subjektiv etwas Schlechtes erstreben. Und so wäre der Wille schlecht (ex quo aliquid proponitur a ratione ut malum, voluntas, dum in illud fertur, accipit rationem mali.... Unde voluntas erit mala, quia vult malum: non quidem id quod est malum per se, sed id quod est malum per accidens, propter apprehensionem rationis [Sth I-II, 19,5: Daraus, dass etwas von der Vernunft als schlecht erfasst wird, nimmt der Wille, wenn er darauf geht, den Charakter des Schlechten an.... Von daher wird der Wille schlecht sein, weil er Schlechtes will: freilich nicht etwas, das schlecht in sich ist, sondern etwas, das beiherspielend schlecht ist, wegen der [in diesem Fall: irrenden] Wahrnehmung der Vernunft ]). Allgemein gilt, dass der Wille immer dann schlecht ist, wenn er der subjektiven Vernunft nicht folgt, sei diese irrend oder nicht (Sth I-II, 19,5). (12) Wenn das irrende Gewissen verpflichtet ( 11), entschuldigt es dann auch? Das hängt davon ab, wie der Irrtum des Gewissens das subjektive Nichtwissen des Guten zustande kommt. Ist das Nichtwissen gewollt oder durch Nachlässigkeit entstanden, so dass man nicht weiß, was zu wissen man als Mensch gehalten ist, dann entschuldigt es nicht. Ist das Nichtwissen unverschuldet, so geschieht das, was man aus ihm heraus tut, ungewollt, und daher entschuldigt es (Sth I-II, 19,6). Über die Arten des Nichtwissens ist Sth I-II, 6,8 zu vergleichen. Bestimmte Dinge gibt es für Thomas, die man nicht nicht wissen kann. So würden wir es z. B. nicht akzeptieren, wenn ein Lehrer einen Streitfall zwischen Schülern auf die Aussage nur eines der Beteiligten hin regeln, und, darüber zur Rede gestellt, behaupten würde, er habe nicht gewusst, dass man gerecht sein und auch die andere Seite hören müsse. Nichtwissen in solchen Dingen, die zu wissen man gehalten ist (weil sie humane Selbstverständlichkeiten betreffen), entschuldigt niemals, weil es nicht vorkommen darf. Derartiges Nichtwissen hebt die Schuld nicht auf, sondern ist selber eine Schuld. In den Fällen, in denen Dinge betroffen sind, über die man sich tatsächlich täuschen kann, gibt es drei Möglichkeiten: [b] Entweder geht das Nichtwissen (Nichtwissen von etwas, das man zu wissen auch nicht gehalten ist) dem Wollen und Handeln vorher (antecedenter), so dass man etwas tut, was man, wenn man jenes gewusst hätte, auf keinen Fall getan hätte. Das Nichtwissen ist so gewissermaßen eine Vorbedingung des Handelns, weil die Handlung ohne das Nichtwissen ja unterblieben wäre. In diesem Fall entschuldigt das Nichtwissen, weil es die Handlung schlechthin (simpliciter) unfreiwillig macht. Man wollte nämlich das, was man tat, gar nicht tun, und hat es nur aufgrund des Nichtwissens getan. Oder das Nichtwissen folgt dem Entschluss zur Handlung nach (consequenter), weil 8
9 der Handelnde aus Absicht oder Nachlässigkeit gar nicht wissen will, was er wissen könnte und sollte (ignorare vult ut excusationem peccati habeat [Sth I-II, 6,8: er will nichtwissen, um eine Entschuldigung für die Sünde zu haben ]). Das Nichtwissen ist so gewissermaßen eine Folge des Handlungsentschlusses, weil es vom Handelnden zu dem Zweck herbeigeführt wird, dass er unbeschwerter das tun könne, von dem er befürchtet, es nicht mehr so leicht tun zu können, wenn er Genaueres wüsste. Dieses Nichtwissen entschuldigt nicht, weil es willentlich herbeigeführt wurde. Die Handlung ist somit nicht schlechthin unfreiwillig, weil das Nichtwissen gewollt ist. Allerdings ist sie in bestimmter Hinsicht (secundum quid) unfreiwillig, nämlich im Hinblick darauf, dass nun eben tatsächlich (wenn auch unentschuldbar) etwas nicht gewusst wurde, dessen Wissen die Handlung nicht hätte geschehen lassen. Einerseits folgt das Nichtwissen dem Willen zur Handlung hier nach, denn erst nachdem man etwas tun will, entschließt man sich, sich nicht zu genau auf das erforderliche Wissen einzulassen. Andererseits liegt das Nichtwissen dem Entschluss, jetzt tatsächlich auch ohne weiteres Wissen zu handeln, zugrunde. Das Nichtwissen folgt dem Entschluss nach, liegt ihm aber dann, wenn es einmal da ist, im weiteren Verlauf zugrunde (ignorantia... praecedit motum voluntatis..., qui non esset scientia praesente [Sth I-II, 6,8: das Nichtwissen... geht der Willensbewegung..., vorher, die nicht wäre, wenn das Wissen gegenwärtig wäre ]). [c] Oder das Nichtwissen geht neben der Handlung einher (concomitanter), so dass man etwas tut, was man nicht weiß, was man aber auch getan hätte, wenn man es gewusst hätte. So wie wenn jemand auf einen Hirsch schießt, dabei aber seinen Feind trifft, den er schon lange töten wollte. Das Nichtwissen ist so gewissermaßen ein Begleiter der Handlung, der auf den sie bestimmenden Willen gar keinen Einfluss hat. Ob nichtwissend oder wissend, der Handelnde hätte das, was er will und tut, in jedem Fall gewollt und getan. Das Nichtwissen ist nicht der Grund dafür, dass der Handelnde das will und tut, was er will und tut (wie in ), denn er hätte auch wissend dasselbe gewollt und getan. Ein solches Nichtwissen entschuldigt wohl in Bezug auf die einzelne betreffende Handlung, weil in dieser der Tod des Feindes nicht ausdrücklich gewollt wird. Wollen kann man ja nur, was man weiß, und wenn man in einer gegebenen Handlungssituation nicht weiß, dass der Feind überhaupt anwesend ist, kann man mit dieser Handlung nicht seinen Tod beabsichtigen. Der Schütze könnte also zum Richter zurecht sagen: Ich wollte mit jenem Schuss damals den Mann nicht töten. Für diese Tat könnte er nicht wegen Mordes verurteilt werden, auch wenn er sonst seinen Feind gerne getötet hätte. Das Nichtwissen in dieser Tat entschuldigt jedoch den Willen nicht schlechthin, denn unabhängig von dieser Tat will der Wille ja den Tod des Feindes. Was in dieser Tat aus Unwissen heraus geschieht, ist dennoch nicht ungewollt, weil es nicht gegen den sonstigen Willen des Handelnden ist. (13) Damit die Absicht der Inhalt, auf den das Handeln aus ist gut sei, ist nicht erforderlich, dass der Mensch das will, was Gott will. Denn Gott überblickt und ist zuständig für das Gut der ganzen Welt (bonum totius universi). Der Mensch hingegen, überblickt dieses Ganze nicht und ist folglich dafür auch nicht zuständig. Die Zuständigkeit des Menschen liegt in begrenzten Gütern, die sich in den konkreten sittlichen Verhältnissen zeigen, in denen er steht (bonum particulare proportionatum suae naturae). 21 Wenn der Mensch will, was die Verantwortlichkeit für diese Güter fordert, ist sein Wollen gut: Dann will er das, von dem 21 Miseratio hominis circa proximum: misericordia autem Dei super omnem carnem (Ecclesiasticus [Jesus Sirach] 18,12; Missale Romanum: Introitus zum 20. Oktober St. Joannes Cantius). 9
10 Gott will, dass er es wolle (vult hoc quod Deus vult eum velle). Freilich darf der Mensch keines dieser partikularen Güter verabsolutieren. Er muss dafür offen sein, dass das, was er (aus seiner Sicht zurecht) für ein Gut hält, es unter übergeordneter Perspektive nicht ist (Sth I-II, 19,10). Das bedeutet, dass man auch das Scheitern des eigenen Gutes als gut akzeptieren können muss. 22 Zusatz: Dass der Mensch nicht für das Gut der ganzen Welt zuständig ist, bedeutet, dass er die Grundordnungen von Natur und menschlichem Leben nicht zum Gegenstand von Optimierungsaktionen machen darf, weil er dieses Optimum gar nicht kennen kann. Und es bedeutet auch, dass er partikulare Dinge, von denen er weiß oder vermuten kann, dass sie schlechte Folgen für das Ganze haben könnten, nicht tun darf. Beide Übersteigerungen Weltverbesserung wie Weltzerstörung liegen für Thomas nicht als konkrete Realitäten vor: Seine Zeit kennt keine Weltrevolutionen und keine Technik von universalem Zerstörungspotential. III. Umstände 1. Begriff der Handlungsumstände (14) Die Umstände einer Handlung sind das, was um die Handlung herum geschieht, ohne dass dadurch der Charakter der Handlung ihr Objekt sich verändert. Umstände können aber so schwerwiegend sein, dass ihr Hinzutreten den sittlichen Charakter der Handlung (das Objekt) doch verändert. In solchen Fällen ist der betreffende Umstand für die sittliche Vernunftordnung von Bedeutung (respicit ordinem rationis in bono vel malo [Sth I-II, 18,11]). Zusatz: Ein Dieb stiehlt etwas, aber es ist das goldene Ciborium aus einem Tabernakel. So macht dieser Umstand die Handlung des Diebstahls außerdem zu einem Sakrileg (Sth I-II, 18,10; vgl. St. Thomas: In Eth. Nic. 413). So kann eine Handlung auch durch ihre Umstände einen Bedeutungszuwachs erfahren. (15) Thomas zählt auch Objekt und Absicht (finis) als Handlungsumstände auf (Sth I-II, 7,3). Dies ist aus der Perspektive der Gesamthandlung gesprochen. Für die Gesamthandlung ist jedes Element des Gesamtzusammenhangs ein einzelner Umstand dem Ganzen gegenüber. Jedoch haben finis (propter quid) und obiectum (quid oder substantia actus) eine grundlegendere Bedeutung als die übrigen Umstände (Sth I-II, 7,4). Zusatz: Der spezifische Handlungsinhalt (Objekt) ist immer durch bestimmte Umstände spezifiziert. Die Tötung eines Menschen beispielsweise wird durch den Umstand, dass es sich dabei um einen zum Tode verurteilten Verbrecher handelt, zum Vollzug einer Strafe; durch den Umstand, dass mittels der Tötung eine Beleidigung vergolten werden soll, zur Rache; durch den Umstand, dass sie als sakraler Akt vollzogen wird, zu einem Menschenopfer; durch den Umstand, dass sie durch einen unbeabsichtigt sich lösenden Schuss geschah, zu einem Jagdunfall. 2. Der Umstand Handlungsfolgen (16) Zu den wichtigen Umständen einer Handlung gehören ihre Folgen. Denn handelnd zielen wir auf bestimmte Folgen. Folgen tragen daher mit zur Bedeutung einer Handlung bei. Auch Folgen sagen uns, was wir getan haben, und deshalb entscheiden auch die Folgen darüber mit, ob eine Handlung gut oder schlecht ist. Jede Handlung wirkt sich unabsehbar weit, letztlich auf den ganzen Weltzusammenhang aus. Die Folgen einer jeden Handlung umfassen daher alle gegenwärtigen und zukünftigen Veränderungen, die durch sie im Weltzustand insgesamt bewirkt werden. 22 Zu diesem vgl. Huber 1997,
11 Zusatz: Wenn jemand die Wahrheit sagt und die Folge etwa das Martyrium ist, dann hat diese Handlung doch insgesamt eine andere, schwerwiegendere Bedeutung als wenn ein Anderer im Alltag gewöhnlich die Wahrheit sagt und damit an sich dieselbe Handlung ( die Wahrheit sagen ) vollzieht. Eine Handlung kann so einen Bedeutungszuwachs durch ihre Folgen erfahren. Folgen, wenn sie entsprechend schwerwiegend sind, können die Bedeutung einer Handlung aber auch völlig verändern. So wird sich ein Autofahrer, der ohne eigenes Verschulden jemanden totfährt, später vermutlich immer wieder vorwurfsvoll sagen: Ich habe einen Menschen getötet. Die ursprüngliche und beabsichtigte Bedeutung der Handlung war vielleicht zum Einkaufen Fahren. Aber die Tatsache, dass in der Folge dieser Tat der Tod eines unschuldigen Menschen eintritt, ist so schwerwiegend, dass der Autofahrer den Eindruck haben muss, er habe etwas ganz Anderes getan als zum Einkaufen Fahren. Die unbeabsichtigte (und nicht einmal vorhersehbare) Folge schiebt sich an die Stelle der ursprünglichen Bedeutung, weil sie wegen ihrer Schwere den Charakter der Handlung verändert. Man muss wegen der (unbeabsichtigten) Folge die Tat anders beschreiben. Ähnlich ist es, wenn die beabsichtigte Bedeutung beim Klonieren das Heilen von Krankheiten ist, dies aber nur geschehen kann, indem Embryonen getötet werden. Die Handlung kann dann nicht mehr als Heilung beschrieben werden, sondern sie bedeutet jetzt Tötung unschuldiger Personen. Die unbeabsichtigte (jedoch vorhergewusste und in Kauf genommene) Folge hat den Charakter der Handlung grundlegend verändert. (17) Bei den Handlungsfolgen und ihrer Bedeutsamkeit für die sittliche Qualität der Handlung sind folgende Unterscheidungen zu beachten: [b] Vorbedachte Folgen: Vorbedacht praecogitatus (I-II 20,5) ist eine Folge für Thomas, wenn sie vorhergesehen (praevisus) und beabsichtigt (intentus) ist (Sth I-II, 73,8). Nichtvorbedachte Folgen: Dies sind in Kauf genommene Nebenfolgen. Hier sind wieder zwei Fälle zu unterscheiden. [b-a] Im starken Sinn (nämlich wissend) werden Nebenfolgen in Kauf genommen, wenn sie vorhergesehen, als solche aber nicht beabsichtigt sind. So wenn man an embryonalen Stammzellen forschen will: In diesem Fall beabsichtigt (finis) man die Heilung von Menschen, realisiert diese Absicht aber wissend mittels der Tötung eines Menschen (obiectum actus exterioris). [b-b] Im schwachen Sinn (nämlich unwissend) werden Nebenfolgen in Kauf genommen, wenn sie nicht vorhergesehen und auch nicht beabsichtigt sind. Auch Nebenfolgen, von denen man gar nichts wissen kann, werden in gewisser Weise doch aktiv in Kauf genommen, weil wir immer wissen, dass unser Handeln unabsehbare Folgen hat. Indem wir in diesem Wissen handeln, nehmen wir in Kauf, was wir nicht wissen. Hier sind wiederum zwei Fälle zu unterscheiden: [] Die Folge ist mit der Handlung wesentlich (secundum se) verbunden. Die Folge ist dann nur unter dem Gesichtspunkt ihres Nichtvorhergesehenseins eine Nebenfolge, während es aus der Natur der Handlung zwangsläufig folgt. So wenn man unwissend tödliches Gift trinkt, um seinen Durst zu stillen und der Tod eintritt. Die Todesfolge ist mit der Handlung tödliches-gift-trinken wesentlich verbunden, denn tödliches Gift tötet: es hat diese Wirkung aus seiner Natur (secundum quod est per se) und daher in den meisten Fällen (ut in pluribus, d. h. es wäre eine Ausnahme, wenn es versagte). Eine Folge die mit einem Handlungsinhalt (obiectum actus exterioris) wesentlich verbunden ist, macht den Akt (actus exterior) je nach ihrem eigenen Gutsein oder Schlechtsein besser oder schlechter (Sth I-II, 20,5). [] Die Folge ist mit der Handlung beiläufig (per accidens) verbunden. Die Folge ist dann auch unter dem Gesichtspunkt der Natur der Handlung eine Nebenfolge, weil es 11
12 aus ihr nicht zwangsläufig folgt. So wenn man vor Freude hüpft, dabei über einen Stein stolpert, der am Rande eines Abgrundes liegt, und deshalb zu Tode stürzt. Die Todesfolge ist mit der Handlung Hüpfen nicht zwangsläufug verbunden: es tötet nicht aus seiner Natur (per accidens) und daher auch nur in den wenigsten Fällen (ut in paucioribus) (Sth I-II, 20,5). Zusatz: Man könnte meinen, man müsse noch den Fall berücksichtigen, dass die Nebenfolgen nicht vorhergesehen, aber beabsichtigt sind. So wenn jemand auf ein Wild schießt, dabei aber zufällig seinen Feind trifft, den aus Rache schon lange zu töten beabsichtigt (Sth I-II, 6,8). Die schlechte Folge der Handlung ist zwar beabsichtigt, jedoch nicht in der Handlung, deren Folge sie ist: Wer ein Wild schießen will, der beabsichtigt mit dieser Handlung nicht, seinen Feind zu töten, wenn er ihn auch zufällig mit dieser Handlung dann doch trifft. So reduziert sich [] auf [b-b]: Die schlechte Folge ist nicht vorhergesehen und mit dieser Handlung auch nicht beabsichtigt. Zusatz: Thomas behandelt die Unterscheidung zwischen vorbedachten und [b-a] im starken wie [b-b] im schwachen Sinn in Kauf genommenen Folgen im Zusammenhang mit der Frage nach der Schwere einer Sünde (Sth I-II, 73,8): [b-a] [b-b] [b-c] Der Fall erschwert die Sünde direkt, weil zusätzlich zum Übel der Sünde auch noch das ihrer schlechten Folge wissend gewollt wird. In diesem Fall geht es in meinem obigen Beispiel (Embryonentötung) um die schlechte Folge nicht einer Sünde, sondern eines guten Zieles. Dennoch gilt dasselbe, was auch bei der schlechten Folge einer Sünde (von welcher Thomas ausgeht) gilt: Die vorhergesehene (wenn auch nicht beabsichtigte) schlechte Folge erschwert die Sünde (in meinem Beispiel: macht sie die an sich gute Tat schlecht) indirekt, weil die schlechte Folge nicht als solche gewollt wird: Wenn nicht die Sünde gewollt würde, an die sie geknüpft ist, würde die schlechte Folge selbst nicht gewollt werden. Auch in diesem Fall habe ich zwei Beispiele (Gifttrinken und Hüpfen) gewählt, in denen es nicht um die schlechte Folgen einer Sünde, sondern einer an sich guten Handlung geht. Es gilt aber wiederum dasselbe, was auch im Falle der schlechten Folge einer Sünde gilt: Wenn die schlechte Folge [b-b-] eine wesentliche Folge der Sünde ist, erschwert sie direkt die Sünde (in meinem Beispiel: macht sie die gute Tat schlecht), weil die Steigerung des Übels in der Folge zur Sünde selbst gehört. Wenn die schlechte Folge [b-b-] jedoch eine beiläufige Folge der Sünde ist, erschwert sie die Sünde (macht sie dir gute Tat schlecht) indirekt (non directe): Der Handelnde hat es an der notwendigen Sorgfalt bei der Folgenabschätzung fehlen lassen (propter negligentiam considerandi nocumenta quae consequi possent). Den Fall einer nichtgewussten, aber beabsichtigten Folge behandelt Thomas in Sth I-II, 73,8 nicht, wohl weil die Folge wegen ihres Nichtgewusstseins gar nicht im Horizont der jeweils zu beurteilenden Handlung auftaucht. 12
13 Schriften: Chenu, Marie-Dominique: Das werk des Hl. Thomas von Aquin (Paris 1950, dt. Graz: Styria 1960) Chesterton, Gilbert Keith: Thomas von Aquin. In: Thomas von Aquin / Franz von Assisi (dt. Bonn: nova et vetera 2003), Gilson, Etienne: Le Thomisme. Introduction à la Philosophie de Saint Thomas d Aquin ( 7 Paris: J. Vrin 1972) Hoerster, Norbert: Ethik und Interesse (Ziffer 9). Erscheint in: Erwägen, Wissen, Ethik, Jahrgang 17 (2006) Huber, Herbert: Sittlichkeit und Sinn. Ein Beitrag zu den Grundlagen sittlicher Bildung (Donauwörth: Auer 1996) Huber, Herbert: Ethische Themen in Märchen und Sagen (Donauwörth: Auer 1997) Huber, Herbert: Philosophieren wie und wozu? ( = Philosophie und Ethik. Eine Hinführung, Band I, Donauwörth: Auer 2006) Kluxen, Wolfgang: Philosophische Ethik bei Thomas von Aquin ( 3 Hamburg: Meiner 1998) Schönberger, Rolf: Thomas von Aquin zur Einführung (Hamburg: Junius 1998) Schönberger, Rolf: Übersetzung von Summa theologiae I-II, q In: Thomas von Aquin (2001), ( = Thomas von Aquin 1990, 1-175) Schopenhauer, Arthur: Werke in fünf Bänden. Nach den Ausgaben letzter Hand hg. von Ludger Lütkehaus (Zürich: Haffmans Verlag 1988) Spaemann, Robert: Einleitung. In: Thomas von Aquin (2001), 7-18 ( = Thomas von Aquin 1990, VII-XVI) Thomas von Aquin: Über die Sittlichkeit der Handlung. Summa theologiae I-II q Einleitung von Robert Spaemann. Übersetzung und Kommentar von Rolf Schönberger (Weinheim: Acta humaniora 1990) Thomas von Aquin: Über sittliches Handeln. Summa theologiae I-II q Lateinisch/Deutsch. Übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Rolf Schönberger. Einleitung von Robert Spaemann (Stuttgart: Reclam 2001 [UB 18162]) 13
Medizinethischer Arbeitskreis
 Medizinethischer Arbeitskreis 06. Mai 2010 Prof. P. Dr. Heribert Niederschlag SAC Ethik Was ist das eigentlich? Versteht sich das Ethische von selbst? Das Gute eine Idee in der Seele (Platon) 3 Ebenen:
Medizinethischer Arbeitskreis 06. Mai 2010 Prof. P. Dr. Heribert Niederschlag SAC Ethik Was ist das eigentlich? Versteht sich das Ethische von selbst? Das Gute eine Idee in der Seele (Platon) 3 Ebenen:
Was ist ein Gedanke?
 Lieferung 8 Hilfsgerüst zum Thema: Was ist ein Gedanke? Thomas: Es bleibt zu fragen, was der Gedanke selbst [ipsum intellectum] ist. 1 intellectus, -us: Vernunft, Wahrnehmungskraft usw. intellectum, -i:
Lieferung 8 Hilfsgerüst zum Thema: Was ist ein Gedanke? Thomas: Es bleibt zu fragen, was der Gedanke selbst [ipsum intellectum] ist. 1 intellectus, -us: Vernunft, Wahrnehmungskraft usw. intellectum, -i:
David Hume zur Kausalität
 David Hume zur Kausalität Und welcher stärkere Beweis als dieser konnte für die merkwürdige Schwäche und Unwissenheit des Verstandes beigebracht werden? Wenn irgend eine Beziehung zwischen Dingen vollkommen
David Hume zur Kausalität Und welcher stärkere Beweis als dieser konnte für die merkwürdige Schwäche und Unwissenheit des Verstandes beigebracht werden? Wenn irgend eine Beziehung zwischen Dingen vollkommen
Hilfsgerüst zum Thema:
 Lieferung 11 Hilfsgerüst zum Thema: Das Böse 1. Die Lehre des Averroes Alles Gute geht auf Gott zurück; Böses geht auf die Materie zurück. Die erste Vorsehung ist die Vorsehung Gottes. Er ist die Ursache,
Lieferung 11 Hilfsgerüst zum Thema: Das Böse 1. Die Lehre des Averroes Alles Gute geht auf Gott zurück; Böses geht auf die Materie zurück. Die erste Vorsehung ist die Vorsehung Gottes. Er ist die Ursache,
Thomas von Aquin. Das irrende Gewissen. Summa theologiae, I a II ae, Frage 19, Lieferung 16
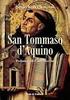 Lieferung 16 Thomas von Aquin Das irrende Gewissen Summa theologiae, I a II ae, Frage 19, Artikel 6 Artikel Ist ein von einer irrenden Vernunft abweichender Wille schlecht? Es scheint, daß ein von einer
Lieferung 16 Thomas von Aquin Das irrende Gewissen Summa theologiae, I a II ae, Frage 19, Artikel 6 Artikel Ist ein von einer irrenden Vernunft abweichender Wille schlecht? Es scheint, daß ein von einer
Immanuel Kant. *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg
 Immanuel Kant *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg ab 1770 ordentlicher Professor für Metaphysik und Logik an der Universität Königsberg Neben Hegel wohl der bedeutendste deutsche
Immanuel Kant *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg ab 1770 ordentlicher Professor für Metaphysik und Logik an der Universität Königsberg Neben Hegel wohl der bedeutendste deutsche
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über die Bedeutung der Wahrheit nach Thomas von Aquin.
 Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über die Bedeutung der Wahrheit nach Thomas von Aquin Zweite Lieferung Zum Thema: Die Klugheit als das Wesen der Moralität [1] Inwiefern
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über die Bedeutung der Wahrheit nach Thomas von Aquin Zweite Lieferung Zum Thema: Die Klugheit als das Wesen der Moralität [1] Inwiefern
Aspekte der göttlichen Vorsehung
 Lieferung 12 Hilfsgerüst zum Thema: Aspekte der göttlichen Vorsehung ScG, Buch III, Kap. 64 77 die allgemeine Lenkung Gottes. In Kap. 111 163 werden die Besonderheiten des verstandesbegabten Geschöpfe
Lieferung 12 Hilfsgerüst zum Thema: Aspekte der göttlichen Vorsehung ScG, Buch III, Kap. 64 77 die allgemeine Lenkung Gottes. In Kap. 111 163 werden die Besonderheiten des verstandesbegabten Geschöpfe
Der Begriff der Wirklichkeit
 Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Der Begriff der Wirklichkeit Die letzte Vorlesung in diesem Semester findet am 18. Juli 2014 statt. Die erste Vorlesung im Wintersemester 2014/2015 findet am 10. Oktober
Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Der Begriff der Wirklichkeit Die letzte Vorlesung in diesem Semester findet am 18. Juli 2014 statt. Die erste Vorlesung im Wintersemester 2014/2015 findet am 10. Oktober
Vorlesung. Willensfreiheit. Prof. Dr. Martin Seel 8. Dezember Kant, Kritik der reinen Vernunft, B472:
 Vorlesung Willensfreiheit Prof. Dr. Martin Seel 8. Dezember 2005 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B472: Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Erscheinungen der
Vorlesung Willensfreiheit Prof. Dr. Martin Seel 8. Dezember 2005 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B472: Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Erscheinungen der
Gott als das Gute. Hilfsgerüst zum Thema: 1. In der Dimension des Guten ist Gott das Gute selbst, bzw. die Gutheit alles Guten.
 Lieferung 9 Hilfsgerüst zum Thema: Gott als das Gute Die Religion richtet den Menschen auf Gott aus, nicht wie auf ihr Objekt, sondern wie auf ihr Ziel. Thomas von Aquin, Summa theologiae, I II, q. 81,
Lieferung 9 Hilfsgerüst zum Thema: Gott als das Gute Die Religion richtet den Menschen auf Gott aus, nicht wie auf ihr Objekt, sondern wie auf ihr Ziel. Thomas von Aquin, Summa theologiae, I II, q. 81,
Wilhelm von Ockham. Lieferung 15 (1288/ ) [Das Ersterkannte ist das Einzelne, nicht das Allgemeine]
![Wilhelm von Ockham. Lieferung 15 (1288/ ) [Das Ersterkannte ist das Einzelne, nicht das Allgemeine] Wilhelm von Ockham. Lieferung 15 (1288/ ) [Das Ersterkannte ist das Einzelne, nicht das Allgemeine]](/thumbs/54/35271140.jpg) Lieferung Wilhelm von Ockham (1288/ 1349) [Das Ersterkannte ist das Einzelne, nicht das Allgemeine] 2 Meine Antwort auf die Frage [ob das Ersterkannte der Vernunft, bezüglich der Erstheit des Entstehens,
Lieferung Wilhelm von Ockham (1288/ 1349) [Das Ersterkannte ist das Einzelne, nicht das Allgemeine] 2 Meine Antwort auf die Frage [ob das Ersterkannte der Vernunft, bezüglich der Erstheit des Entstehens,
Wille und Vorstellung
 Wille und Vorstellung HORST TIWALD 20. 03. 2006 I. In den Reden BUDDHAS findet sich hinsichtlich der ethischen Wert-Erkenntnis folgende Denk-Struktur: Als Subjekt der ethischen Erkenntnis kommt nur ein
Wille und Vorstellung HORST TIWALD 20. 03. 2006 I. In den Reden BUDDHAS findet sich hinsichtlich der ethischen Wert-Erkenntnis folgende Denk-Struktur: Als Subjekt der ethischen Erkenntnis kommt nur ein
Glück als Begründung und Sinn der Moral
 Lieferung 4 Hilfsgerüst zum Thema: Glück als Begründung und Sinn der Moral 1. Glück ist das erste Thema der thomasischen Ethik Der Aufbau der Ethik: (1) Glück und (2) das, was dahin führt bzw. davon ablenkt
Lieferung 4 Hilfsgerüst zum Thema: Glück als Begründung und Sinn der Moral 1. Glück ist das erste Thema der thomasischen Ethik Der Aufbau der Ethik: (1) Glück und (2) das, was dahin führt bzw. davon ablenkt
Die Frage nach der Existenz Gottes
 Lieferung 12 Hilfsgerüst zum Thema: Die Frage nach der Existenz Gottes Die letzte Vorlesung des Semesters findet am 19. Juli 2013 statt. 1. Vorbemerkungen An sich ist die Existenz Gottes selbstevident
Lieferung 12 Hilfsgerüst zum Thema: Die Frage nach der Existenz Gottes Die letzte Vorlesung des Semesters findet am 19. Juli 2013 statt. 1. Vorbemerkungen An sich ist die Existenz Gottes selbstevident
Thomas von Aquin. Einer der wichtigsten Philosophen der Scholastik; verbindet Philosophie des Aristoteles mit christlicher Theologie
 Thomas von Aquin *1224 (1225?) bei Aquino ab ca. 1230 Schüler des Benediktinerklosters auf dem Monte Cassino Studium in Neapel 1243: Eintritt in den Dominikanerorden ab 1244 Studien in Bologna, Paris und
Thomas von Aquin *1224 (1225?) bei Aquino ab ca. 1230 Schüler des Benediktinerklosters auf dem Monte Cassino Studium in Neapel 1243: Eintritt in den Dominikanerorden ab 1244 Studien in Bologna, Paris und
Grundformel, Naturgesetzformel und Menschheitsformel des kategorischen Imperativs nur verschiedene Formulierungen desselben Prinzips?
 Grundformel, Naturgesetzformel und Menschheitsformel des kategorischen Imperativs nur verschiedene Formulierungen desselben Prinzips? Fabian Hundertmark Matrikel-Nummer: 1769284 1. August 2007 1 Was werde
Grundformel, Naturgesetzformel und Menschheitsformel des kategorischen Imperativs nur verschiedene Formulierungen desselben Prinzips? Fabian Hundertmark Matrikel-Nummer: 1769284 1. August 2007 1 Was werde
Die Wunder Jesu. Eigentlich braucht der Glaube nicht mehr als die Auferstehung.
 Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Die Wunder Jesu 1. Unsere Skepsis heute Eigentlich braucht der Glaube nicht mehr als die Auferstehung. 2. Wunder definiert als Durchbrechung eines Naturgesetzes Historisches
Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Die Wunder Jesu 1. Unsere Skepsis heute Eigentlich braucht der Glaube nicht mehr als die Auferstehung. 2. Wunder definiert als Durchbrechung eines Naturgesetzes Historisches
THOMAS VON AQUIN Textblatt 1
 THOMAS VON AQUIN Textblatt 1 I) Das Dreistufenmodell - der Mensch als Imago Dei (STh I 93, 4): Der Mensch ist, da er aufgrund seiner vernünftigen Natur (intellectualem naturam) als nach dem Bilde Gottes
THOMAS VON AQUIN Textblatt 1 I) Das Dreistufenmodell - der Mensch als Imago Dei (STh I 93, 4): Der Mensch ist, da er aufgrund seiner vernünftigen Natur (intellectualem naturam) als nach dem Bilde Gottes
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über das. Dritte und letzte Lieferung. Zum Thema: Ist Gott das Glück?
 Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über das Glück Dritte und letzte Lieferung Zum Thema: Ist Gott das Glück? 1. Wer war Boethius? 2. Wie lautet die Glücksdefinition des Boethius?
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über das Glück Dritte und letzte Lieferung Zum Thema: Ist Gott das Glück? 1. Wer war Boethius? 2. Wie lautet die Glücksdefinition des Boethius?
Inhaltsverzeichnis. 1 Piaton Aristoteles Biografisches DieSophistik 15
 Inhaltsverzeichnis 1 Piaton 13 1.1 Biografisches 13 1.2 DieSophistik 15 1.3 Gorgias 16 1.3.1 Erster Teil: Das Gespräch mit Gorgias 20 1.3.2 Zweiter Teil: Das Gespräch mit Polos 22 1.3.3 Dritter Teil: Das
Inhaltsverzeichnis 1 Piaton 13 1.1 Biografisches 13 1.2 DieSophistik 15 1.3 Gorgias 16 1.3.1 Erster Teil: Das Gespräch mit Gorgias 20 1.3.2 Zweiter Teil: Das Gespräch mit Polos 22 1.3.3 Dritter Teil: Das
VL März 2012 R Was ist der Mensch? Andreas Brenner FS 12
 VL 4 12. März 2012 R.3.119 Was ist der Mensch? Andreas Brenner FS 12 1 Der Mensch als moralisches Wesen 2 1. Der Mensch als moralisches Wesen: Aristoteles Die staatliche Gemeinschaft (besteht) der tugendhaften
VL 4 12. März 2012 R.3.119 Was ist der Mensch? Andreas Brenner FS 12 1 Der Mensch als moralisches Wesen 2 1. Der Mensch als moralisches Wesen: Aristoteles Die staatliche Gemeinschaft (besteht) der tugendhaften
Toleranz und Intoleranz in der christlichen Geschichte
 Lieferung 11 Hilfsgerüst zum Thema: Toleranz und Intoleranz in der christlichen Geschichte Teil V: Thomas von Aquin ( 1274) 1. Toleranz gegenüber Nicht-Christen Thomas: Von den Ungläubigen haben einige
Lieferung 11 Hilfsgerüst zum Thema: Toleranz und Intoleranz in der christlichen Geschichte Teil V: Thomas von Aquin ( 1274) 1. Toleranz gegenüber Nicht-Christen Thomas: Von den Ungläubigen haben einige
Descartes, Dritte Meditation
 Descartes, Dritte Meditation 1. Gewissheiten: Ich bin ein denkendes Wesen; ich habe gewisse Bewusstseinsinhalte (Empfindungen, Einbildungen); diesen Bewusstseinsinhalten muss nichts außerhalb meines Geistes
Descartes, Dritte Meditation 1. Gewissheiten: Ich bin ein denkendes Wesen; ich habe gewisse Bewusstseinsinhalte (Empfindungen, Einbildungen); diesen Bewusstseinsinhalten muss nichts außerhalb meines Geistes
2. Seinsweise, die in der Angleichung von Ding und Verstand besteht. 3. Unmittelbare Wirkung dieser Angleichung: die Erkenntnis.
 THOMAS VON AQUIN - De veritate (Quaestio I) - Zusammenfassung Erster Artikel: Was ist Wahrheit?! Ziel ist die Erschließung des Wortes Wahrheit und der mit diesem Begriff verwandten Wörter.! 1. Grundlage
THOMAS VON AQUIN - De veritate (Quaestio I) - Zusammenfassung Erster Artikel: Was ist Wahrheit?! Ziel ist die Erschließung des Wortes Wahrheit und der mit diesem Begriff verwandten Wörter.! 1. Grundlage
Lust und Freude. Hilfsgerüst zum Thema: 1. Der Hedonismus. Am 15. Mai findet die Vorlesung ausnahmsweise im Hörsaal Sch 3, Scharnhorststr. 100 statt.
 Lieferung 4 Hilfsgerüst zum Thema: Lust und Freude Am 15. Mai findet die Vorlesung ausnahmsweise im Hörsaal Sch 3, Scharnhorststr. 100 statt. Ist Glück ein Gefühl? 1. Der Hedonismus Das Glück sei Lust.
Lieferung 4 Hilfsgerüst zum Thema: Lust und Freude Am 15. Mai findet die Vorlesung ausnahmsweise im Hörsaal Sch 3, Scharnhorststr. 100 statt. Ist Glück ein Gefühl? 1. Der Hedonismus Das Glück sei Lust.
Hilfsgerüst zum Thema:
 Lieferung 11 Hilfsgerüst zum Thema: Schöpfung 1. Die Beziehungen, die Gott als dem Schöpfer zugesprochen werden, sind in Ihm nicht wirklich Es ist also offenbar, daß vieles von Gott im Sinne eines Bezuges
Lieferung 11 Hilfsgerüst zum Thema: Schöpfung 1. Die Beziehungen, die Gott als dem Schöpfer zugesprochen werden, sind in Ihm nicht wirklich Es ist also offenbar, daß vieles von Gott im Sinne eines Bezuges
Das Böse. Prof. Dr. Detlef Horster
 Das Böse Prof. Dr. Detlef Horster 1 Immanuel Kant war der Auffassung, dass es ein irdisches Geschöpf nie dazu bringen könne, vollkommen moralisch zu sein. (Kritik der praktischen Vernunft, A 149) Gott
Das Böse Prof. Dr. Detlef Horster 1 Immanuel Kant war der Auffassung, dass es ein irdisches Geschöpf nie dazu bringen könne, vollkommen moralisch zu sein. (Kritik der praktischen Vernunft, A 149) Gott
Realität des Leides, Wirklichkeit Go4es - Das Problem der Theodizee. 6. Sitzung
 Realität des Leides, Wirklichkeit Go4es - Das Problem der Theodizee 6. Sitzung Einleitende Abhandlung über die ÜbereinsFmmung des Glaubens mit der VernunH 16: Es wird zu zeigen sein, dass die absolute
Realität des Leides, Wirklichkeit Go4es - Das Problem der Theodizee 6. Sitzung Einleitende Abhandlung über die ÜbereinsFmmung des Glaubens mit der VernunH 16: Es wird zu zeigen sein, dass die absolute
Immanuel Kant in KdrV zu menschlicher Freiheit und Kausalität.
 DILEMMA: MENSCHLICHE FREIHEIT UND KAUSALITÄT Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft 2. Analogie der Erfahrung: Grundsatz der Zeitfolge nach dem Gesetz der Kausalität (B 233 ff.): Alles, was geschieht
DILEMMA: MENSCHLICHE FREIHEIT UND KAUSALITÄT Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft 2. Analogie der Erfahrung: Grundsatz der Zeitfolge nach dem Gesetz der Kausalität (B 233 ff.): Alles, was geschieht
Gott ist Geist und Liebe...
 Gott ist Geist und Liebe... Lasst uns Ihn anbeten und Ihm gehorchen gemäss dem, was Er ist 11/21/05 Ein Brief von Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören Denkt daran, wenn ihr das Wort Gottes
Gott ist Geist und Liebe... Lasst uns Ihn anbeten und Ihm gehorchen gemäss dem, was Er ist 11/21/05 Ein Brief von Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören Denkt daran, wenn ihr das Wort Gottes
Ethik-Klassiker von Platon bis John Stuart Mill
 Ethik-Klassiker von Platon bis John Stuart Mill Ein Lehr- und Studienbuch von Max Klopfer 1. Auflage Kohlhammer 2008 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 17 020572 7 Zu Leseprobe schnell
Ethik-Klassiker von Platon bis John Stuart Mill Ein Lehr- und Studienbuch von Max Klopfer 1. Auflage Kohlhammer 2008 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 17 020572 7 Zu Leseprobe schnell
Thomas von Aquin Das Übel [Das Böse; das Schlechte; malum]
![Thomas von Aquin Das Übel [Das Böse; das Schlechte; malum] Thomas von Aquin Das Übel [Das Böse; das Schlechte; malum]](/thumbs/65/52967675.jpg) Lieferung 16 Hilfsgerüst zum Thema: Thomas von Aquin Das Übel [Das Böse; das Schlechte; malum] ScG, Buch III, Kap. 3 17 Wegen der um die gleiche Zeit stattfindenden Antrittsvorlesung von Herrn Prof. Dr.
Lieferung 16 Hilfsgerüst zum Thema: Thomas von Aquin Das Übel [Das Böse; das Schlechte; malum] ScG, Buch III, Kap. 3 17 Wegen der um die gleiche Zeit stattfindenden Antrittsvorlesung von Herrn Prof. Dr.
Wow! Beine WERKE GLAUBE WENN DER GLAUBE BEINE BEKOMMT [10] C h r i s t l i c h e G e m e i n d e A c h e n b a c h
![Wow! Beine WERKE GLAUBE WENN DER GLAUBE BEINE BEKOMMT [10] C h r i s t l i c h e G e m e i n d e A c h e n b a c h Wow! Beine WERKE GLAUBE WENN DER GLAUBE BEINE BEKOMMT [10] C h r i s t l i c h e G e m e i n d e A c h e n b a c h](/thumbs/96/128403397.jpg) Wow! Beine WERKE GLAUBE WENN DER GLAUBE BEINE BEKOMMT [10] C h r i s t l i c h e G e m e i n d e A c h e n b a c h Woher kommen Streitigkeiten? Jakobus 4,1-10 Woher kommen Streitigkeiten? Reden Jakobus
Wow! Beine WERKE GLAUBE WENN DER GLAUBE BEINE BEKOMMT [10] C h r i s t l i c h e G e m e i n d e A c h e n b a c h Woher kommen Streitigkeiten? Jakobus 4,1-10 Woher kommen Streitigkeiten? Reden Jakobus
Projekt Grundlagenkurs für ein großartiges Leben aus der Perspektive Gottes
 Projekt Grundlagenkurs für ein großartiges Leben aus der Perspektive Gottes GRUNDLAGENKURS FÜR EIN GROßARTIGES LEBEN AUS DER PERSPEKTIVE GOTTES REINHOLD THALHOFER & ADNAN KRIKOR LEKTION 1 OKTOBER 2016
Projekt Grundlagenkurs für ein großartiges Leben aus der Perspektive Gottes GRUNDLAGENKURS FÜR EIN GROßARTIGES LEBEN AUS DER PERSPEKTIVE GOTTES REINHOLD THALHOFER & ADNAN KRIKOR LEKTION 1 OKTOBER 2016
Die ewige Wahrheit 22. Teil
 22. Teil Die ewige Wahrheit 22. Teil Nimm und lies und rufe dabei diesem Meinen Heiligen Geist an. Lies das, was dich erleuchten kann. Lies und erkenne. Und lies, lies, und lies immer wieder und meditiere
22. Teil Die ewige Wahrheit 22. Teil Nimm und lies und rufe dabei diesem Meinen Heiligen Geist an. Lies das, was dich erleuchten kann. Lies und erkenne. Und lies, lies, und lies immer wieder und meditiere
Gebet bewirkt Veränderung. Poster oder Karten mit einem
 Kapitel Ein souveräner und persönlicher Gott 9 Gebet bewirkt Veränderung. Poster oder Karten mit einem Spruch in dieser Richtung findet man überall. Vielleicht haben Sie ja sogar welche zu Hause. Unzählige
Kapitel Ein souveräner und persönlicher Gott 9 Gebet bewirkt Veränderung. Poster oder Karten mit einem Spruch in dieser Richtung findet man überall. Vielleicht haben Sie ja sogar welche zu Hause. Unzählige
Thema 2: Gottes Plan für dein Leben
 Thema 2: für dein Leben Einleitung Viele Menschen blicken am Ende ihres Lebens auf ihr Leben zurück und fragen sich ernüchtert: Und das war s? Eine solche Lebensbilanz ziehen zu müssen ist eine große Tragik!
Thema 2: für dein Leben Einleitung Viele Menschen blicken am Ende ihres Lebens auf ihr Leben zurück und fragen sich ernüchtert: Und das war s? Eine solche Lebensbilanz ziehen zu müssen ist eine große Tragik!
1. Johannes 4, 16b-21
 Predigt zu 1. Johannes 4, 16b-21 Liebe Gemeinde, je länger ich Christ bin, desto relevanter erscheint mir der Gedanke, dass Gott Liebe ist! Ich möchte euch den Predigttext aus dem 1. Johannesbrief vorlesen,
Predigt zu 1. Johannes 4, 16b-21 Liebe Gemeinde, je länger ich Christ bin, desto relevanter erscheint mir der Gedanke, dass Gott Liebe ist! Ich möchte euch den Predigttext aus dem 1. Johannesbrief vorlesen,
Beihilfe zur Selbsttötung, Tötung aus Mitleid, Tötung auf Verlangen?
 Beihilfe zur Selbsttötung, Tötung aus Mitleid, Tötung auf Verlangen? Eine theologisch-ethische und seelsorgerische Beurteilung Prof. Dr. theol. Ulrich Eibach, Ev. Theol. Fakultät Uni Bonn und Klinikseelsorge
Beihilfe zur Selbsttötung, Tötung aus Mitleid, Tötung auf Verlangen? Eine theologisch-ethische und seelsorgerische Beurteilung Prof. Dr. theol. Ulrich Eibach, Ev. Theol. Fakultät Uni Bonn und Klinikseelsorge
Glaube kann man nicht erklären!
 Glaube kann man nicht erklären! Es gab mal einen Mann, der sehr eifrig im Lernen war. Er hatte von einem anderen Mann gehört, der viele Wunderzeichen wirkte. Darüber wollte er mehr wissen, so suchte er
Glaube kann man nicht erklären! Es gab mal einen Mann, der sehr eifrig im Lernen war. Er hatte von einem anderen Mann gehört, der viele Wunderzeichen wirkte. Darüber wollte er mehr wissen, so suchte er
Von den Forderungen der Freiheit. Mascherode,
 Von den Forderungen der Freiheit Mascherode, 16.8.2015 Und siehe, einer trat zu Jesus und fragte: Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? 17 Er aber sprach zu ihm: Was fragst du
Von den Forderungen der Freiheit Mascherode, 16.8.2015 Und siehe, einer trat zu Jesus und fragte: Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? 17 Er aber sprach zu ihm: Was fragst du
Naturethik. William K. Frankena: Ethik und die Umwelt. Fabian Grenz, Till Schramm, Simon Wennemann
 Naturethik William K. Frankena: Ethik und die Umwelt Fabian Grenz, Till Schramm, Simon Wennemann Einführung keine Notwendigkeit einer neuen Ethik, sondern Wiederbelebung moralischen Engagements jede vollständige
Naturethik William K. Frankena: Ethik und die Umwelt Fabian Grenz, Till Schramm, Simon Wennemann Einführung keine Notwendigkeit einer neuen Ethik, sondern Wiederbelebung moralischen Engagements jede vollständige
1 Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Erster Abschnittäus ders.: Kritik
 In diesem Essay werde ich die Argumente Kants aus seinem Text Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Erster Abschnitt 1 auf Plausibilität hinsichtlich seiner Kritik an der antiken Ethik überprüfen (Diese
In diesem Essay werde ich die Argumente Kants aus seinem Text Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Erster Abschnitt 1 auf Plausibilität hinsichtlich seiner Kritik an der antiken Ethik überprüfen (Diese
Die Menschengemäßheit des Ewigen Lebens
 Lieferung 5 Hilfsgerüst zum Thema: Die Menschengemäßheit des Ewigen Lebens 1. Der menschliche Faktor im Ewigen Leben eine heuristische Regel Katechismus der katholischen Kirche, Nr. 1024:»Der Himmel ist
Lieferung 5 Hilfsgerüst zum Thema: Die Menschengemäßheit des Ewigen Lebens 1. Der menschliche Faktor im Ewigen Leben eine heuristische Regel Katechismus der katholischen Kirche, Nr. 1024:»Der Himmel ist
Was lehrt der Lehrer?
 Lieferung 7 Hilfsgerüst zum Thema: Was lehrt der Lehrer? 1. Die Schrift des Thomas von Aquin Über die Einheit des Geistes gegen die Averroisten Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die
Lieferung 7 Hilfsgerüst zum Thema: Was lehrt der Lehrer? 1. Die Schrift des Thomas von Aquin Über die Einheit des Geistes gegen die Averroisten Thomas von Aquin, Über die Einheit des Geistes gegen die
Das Gewissen als Konvergenzpunkt der Wahrheit
 Lieferung 3 Hilfsgerüst zum Thema: Das Gewissen als Konvergenzpunkt der Wahrheit wo Wahrheiten und die Wahrheit konvergieren, so daß ihre Differenz deutlich wird Wahrheit und Wahrhaftigkeit Grundgesetz
Lieferung 3 Hilfsgerüst zum Thema: Das Gewissen als Konvergenzpunkt der Wahrheit wo Wahrheiten und die Wahrheit konvergieren, so daß ihre Differenz deutlich wird Wahrheit und Wahrhaftigkeit Grundgesetz
Die Frage nach dem Sinn des Seins Antworten der Metaphysik Europas
 Die Frage nach dem Sinn des Seins Antworten der Metaphysik Europas Prof. Dr. Gerald Weidner Metapysik Definition Metaphysik war seit Aristoteles die erste Philosophie, weil sie Fragen der allgemeinsten
Die Frage nach dem Sinn des Seins Antworten der Metaphysik Europas Prof. Dr. Gerald Weidner Metapysik Definition Metaphysik war seit Aristoteles die erste Philosophie, weil sie Fragen der allgemeinsten
Schuld nach Thomas von Aquin
 Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Schuld nach Thomas von Aquin Das tiefste Leid Gegenstimmen: Friedrich Nietzsche: Der Gewissensbiss ist, wie der Biss des Hundes gegen einen Stein, eine Dummheit. (Menschliches,
Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Schuld nach Thomas von Aquin Das tiefste Leid Gegenstimmen: Friedrich Nietzsche: Der Gewissensbiss ist, wie der Biss des Hundes gegen einen Stein, eine Dummheit. (Menschliches,
Einführung in die Praktische Philosophie II
 Einführung in die Praktische Philosophie II Herzlich willkommen! Claus Beisbart Sommersemester 2012 Stellen Sie sich vor: Erinnern Sie sich? Die heutige Vorlesung Einführung in die Praktische Philosophie
Einführung in die Praktische Philosophie II Herzlich willkommen! Claus Beisbart Sommersemester 2012 Stellen Sie sich vor: Erinnern Sie sich? Die heutige Vorlesung Einführung in die Praktische Philosophie
Deontologie Die Bausteine der Kantischen Ethik
 Deontologie Die Bausteine der Kantischen Ethik Der gute Wille Ohne Einschränkungen gut ist allein der gute Wille. Alle anderen Dinge wie Talente oder Tugenden sind nicht an sich, sondern nur relativ gut
Deontologie Die Bausteine der Kantischen Ethik Der gute Wille Ohne Einschränkungen gut ist allein der gute Wille. Alle anderen Dinge wie Talente oder Tugenden sind nicht an sich, sondern nur relativ gut
ERKLÄRUNG DER DEUTSCHEN BISCHÖFE ZUR PARTEIPOLITISCHEN TÄTIGKEIT DER PRIESTER
 ERKLÄRUNG DER DEUTSCHEN BISCHÖFE ZUR PARTEIPOLITISCHEN TÄTIGKEIT DER PRIESTER Vorwort Aus Sorge um die Schäden, die der Kirche aus der parteipolitischen Betätigung der Priester erwachsen, haben die deutschen
ERKLÄRUNG DER DEUTSCHEN BISCHÖFE ZUR PARTEIPOLITISCHEN TÄTIGKEIT DER PRIESTER Vorwort Aus Sorge um die Schäden, die der Kirche aus der parteipolitischen Betätigung der Priester erwachsen, haben die deutschen
Vorlesung Willensfreiheit
 Vorlesung Willensfreiheit 17. November 2005 Prof. Martin Seel Hobbes, Leviathan, Kap. 21: Freiheit bedeutet eigentlich eine Abwesenheit äußerlicher Hindernisse bei einer Bewegung und kann unvernünftigen
Vorlesung Willensfreiheit 17. November 2005 Prof. Martin Seel Hobbes, Leviathan, Kap. 21: Freiheit bedeutet eigentlich eine Abwesenheit äußerlicher Hindernisse bei einer Bewegung und kann unvernünftigen
Ich tue nicht, was ich will
 Ich tue nicht, was ich will Römer 7,14-25a 14 Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist; ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. 15 Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was
Ich tue nicht, was ich will Römer 7,14-25a 14 Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist; ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. 15 Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was
Joachim Stiller. Platon: Menon. Eine Besprechung des Menon. Alle Rechte vorbehalten
 Joachim Stiller Platon: Menon Eine Besprechung des Menon Alle Rechte vorbehalten Inhaltliche Gliederung A: Einleitung Platon: Menon 1. Frage des Menon nach der Lehrbarkeit der Tugend 2. Problem des Sokrates:
Joachim Stiller Platon: Menon Eine Besprechung des Menon Alle Rechte vorbehalten Inhaltliche Gliederung A: Einleitung Platon: Menon 1. Frage des Menon nach der Lehrbarkeit der Tugend 2. Problem des Sokrates:
Es reicht, einfach mit dem zu sein, was wir erfahren, um fundamentales Gut- Sein oder Vollkommenheit zu erkennen.
 Heilige Vollkommenheit Teil 2 Die Vollkommenheit aller Dinge zu erkennen, braucht Genauigkeit. Mit Vollkommenheit ist gemeint, dass die Dinge in einem tieferen Sinn in Ordnung sind und zwar jenseits unserer
Heilige Vollkommenheit Teil 2 Die Vollkommenheit aller Dinge zu erkennen, braucht Genauigkeit. Mit Vollkommenheit ist gemeint, dass die Dinge in einem tieferen Sinn in Ordnung sind und zwar jenseits unserer
Definition des Glaubens
 Lieferung 2 Hilfsgerüst zum Thema: Definition des Glaubens Mehrdeutigkeit der rettende Glaube Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen (Hebräerbrief11, 6). 1. Der Glaube ist das Feststehen im Erhofften,
Lieferung 2 Hilfsgerüst zum Thema: Definition des Glaubens Mehrdeutigkeit der rettende Glaube Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen (Hebräerbrief11, 6). 1. Der Glaube ist das Feststehen im Erhofften,
Version 25. Juni 2015 Heilsgewissheit Einbildung oder Wirklichkeit?
 www.biblische-lehre-wm.de Version 25. Juni 2015 Heilsgewissheit Einbildung oder Wirklichkeit? 1. Erkennungszeichen: Vertrauen in die Heilige Schrift... 2 2. Erkennungszeichen: Rechte Selbsterkenntnis und
www.biblische-lehre-wm.de Version 25. Juni 2015 Heilsgewissheit Einbildung oder Wirklichkeit? 1. Erkennungszeichen: Vertrauen in die Heilige Schrift... 2 2. Erkennungszeichen: Rechte Selbsterkenntnis und
Predigt zu Markus 9,14-21 "Ich glaube, hilf meinem Unglauben" Pfrin Martina Müller, 31. Oktober 2000, Muttenz Dorf, Jubiläum Goldene Hochzeit
 Predigt zu Markus 9,14-21 "Ich glaube, hilf meinem Unglauben" Pfrin Martina Müller, 31. Oktober 2000, Muttenz Dorf, Jubiläum Goldene Hochzeit 1. Einleitung Ich möchte Sie heute dazu anstiften, über Ihren
Predigt zu Markus 9,14-21 "Ich glaube, hilf meinem Unglauben" Pfrin Martina Müller, 31. Oktober 2000, Muttenz Dorf, Jubiläum Goldene Hochzeit 1. Einleitung Ich möchte Sie heute dazu anstiften, über Ihren
Das Menschenbild der Neurowissenschaften und die Ethik des Kaisers neue Kleider? Dieter Birnbacher
 Das Menschenbild der Neurowissenschaften und die Ethik des Kaisers neue Kleider? Dieter Birnbacher 1. Die modernen Neurowissenschaften: wie groß ist der Fortschritt? Ist das neu gewonnene Wissen geeignet,
Das Menschenbild der Neurowissenschaften und die Ethik des Kaisers neue Kleider? Dieter Birnbacher 1. Die modernen Neurowissenschaften: wie groß ist der Fortschritt? Ist das neu gewonnene Wissen geeignet,
Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori
 Geisteswissenschaft Pola Sarah Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori Essay Essay zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a
Geisteswissenschaft Pola Sarah Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori Essay Essay zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a
Wissen und Werte (Philosophie-Vorlesung für BA)
 Vorlesung Wissen und Werte (Philosophie-Vorlesung für BA) Zeit: Fr, 10-12 Uhr Raum: GA 03/142 Beginn: 15.04.2016 Anmeldefrist: BA: Modul V MEd nach alter Ordnung: - - - VSPL-Nr.: 020002 MA: - - - MEd nach
Vorlesung Wissen und Werte (Philosophie-Vorlesung für BA) Zeit: Fr, 10-12 Uhr Raum: GA 03/142 Beginn: 15.04.2016 Anmeldefrist: BA: Modul V MEd nach alter Ordnung: - - - VSPL-Nr.: 020002 MA: - - - MEd nach
Harry G. Frankfurt Gründe der Liebe. suhrkamp taschenbuch wissenschaft
 Harry G. Frankfurt Gründe der Liebe suhrkamp taschenbuch wissenschaft 20 6 Was also heißt das: eine Sache liegt einem am Herzen? Es wird hilfreich sein, dieses Problem indirekt anzugehen. Fangen wir also
Harry G. Frankfurt Gründe der Liebe suhrkamp taschenbuch wissenschaft 20 6 Was also heißt das: eine Sache liegt einem am Herzen? Es wird hilfreich sein, dieses Problem indirekt anzugehen. Fangen wir also
Die Existenzweise des Habens ist wesentlich einfacher zu beschreiben, als die
 92 6.4. Die Existenzweise des Seins Die Existenzweise des Habens ist wesentlich einfacher zu beschreiben, als die des Seins. Beim Haben handelt es sich um toten Besitz, also um Dinge. Und Dinge können
92 6.4. Die Existenzweise des Seins Die Existenzweise des Habens ist wesentlich einfacher zu beschreiben, als die des Seins. Beim Haben handelt es sich um toten Besitz, also um Dinge. Und Dinge können
ICH SCHREIBE... - ICH SCHREIBE, UND ICH MÖCHTE DARÜBER SCHREIBEN, "WARUM ICH SCHREIBE". -
 ICH SCHREIBE... - ICH SCHREIBE, UND ICH MÖCHTE DARÜBER SCHREIBEN, "WARUM ICH SCHREIBE". - - WENN ICH ARBEITEN GEHE, HABE ICH "DIE ABSICHT, GELD ZU VERDIENEN", - WENN ICH LESE, DANN "MIT DER ABSICHT, MICH
ICH SCHREIBE... - ICH SCHREIBE, UND ICH MÖCHTE DARÜBER SCHREIBEN, "WARUM ICH SCHREIBE". - - WENN ICH ARBEITEN GEHE, HABE ICH "DIE ABSICHT, GELD ZU VERDIENEN", - WENN ICH LESE, DANN "MIT DER ABSICHT, MICH
Religion ist ein organisiertes Glaubenssystem mit Regeln, Zeremonien und Gott/Götter.
 Religion ist ein organisiertes Glaubenssystem mit Regeln, Zeremonien und Gott/Götter. Jesus hasste Religion und stellte sich gegen die Frömmigkeit der religiösen Elite. Wir sind mit unseren Traditionen,
Religion ist ein organisiertes Glaubenssystem mit Regeln, Zeremonien und Gott/Götter. Jesus hasste Religion und stellte sich gegen die Frömmigkeit der religiösen Elite. Wir sind mit unseren Traditionen,
Verzeihung. Hilfsgerüst zum Thema: 1. Entschuldigung ist weniger als Verzeihung. 2. Verzeihung erkennt zugleich das Böse und die Menschenwürde an
 Lieferung 12 Hilfsgerüst zum Thema: Verzeihung 1. Entschuldigung ist weniger als Verzeihung Entschuldigung genau genommen bedeutet, daß der, der mich verletzt hat, gar nicht schuldig war. Es gut sein lassen.
Lieferung 12 Hilfsgerüst zum Thema: Verzeihung 1. Entschuldigung ist weniger als Verzeihung Entschuldigung genau genommen bedeutet, daß der, der mich verletzt hat, gar nicht schuldig war. Es gut sein lassen.
...den Schöpfer des Himmels und der Erde. Credo IV BnP
 ...den Schöpfer des Himmels und der Erde Credo IV BnP 18.6.2107 Gen 1,1: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde Großes Credo: der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare
...den Schöpfer des Himmels und der Erde Credo IV BnP 18.6.2107 Gen 1,1: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde Großes Credo: der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare
Predigt über Johannes 9,1-7: Leben im Licht
 Predigt über Johannes 9,1-7 Seite 1 Predigt über Johannes 9,1-7: Leben im Licht Leben im Licht = das Thema dieses Sonntags. Und dazu sind 3 Dinge nötig: 1. Das Licht muss da sein 2. Ich muss das Licht
Predigt über Johannes 9,1-7 Seite 1 Predigt über Johannes 9,1-7: Leben im Licht Leben im Licht = das Thema dieses Sonntags. Und dazu sind 3 Dinge nötig: 1. Das Licht muss da sein 2. Ich muss das Licht
Predigt EINLEITUNG. HP I Arten der menschlichen Liebe. Johannes 3,16. André Schneider. Stockerau NOVUM Hauptstrasse 38 A Stockerau
 Predigt Stockerau NOVUM Hauptstrasse 38 A- 2000 Stockerau Stockerau, 09.10.2011 Johannes 3,16 EINLEITUNG Ich hab vor kurzem in einem Buch einen interessanten Gedanken gelesen. Sinngemäß stand da: Es gibt
Predigt Stockerau NOVUM Hauptstrasse 38 A- 2000 Stockerau Stockerau, 09.10.2011 Johannes 3,16 EINLEITUNG Ich hab vor kurzem in einem Buch einen interessanten Gedanken gelesen. Sinngemäß stand da: Es gibt
Der metaethische Relativismus
 Geisteswissenschaft Julia Pech Der metaethische Relativismus Was spricht für/gegen eine relativistische Position in der Moral? Essay Julia Pech 8.5.2011 Universität Stuttgart Proseminar: Einführung in
Geisteswissenschaft Julia Pech Der metaethische Relativismus Was spricht für/gegen eine relativistische Position in der Moral? Essay Julia Pech 8.5.2011 Universität Stuttgart Proseminar: Einführung in
Kritik der Urteilskraft
 IMMANUEL KANT Kritik der Urteilskraft Herausgegeben von KARLVORLÄNDER Mit einer Bibliographie von Heiner Klemme FELIX MEINER VERLAG HAMBURG Vorbemerkung zur siebenten Auflage Zur Entstehung der Schrift.
IMMANUEL KANT Kritik der Urteilskraft Herausgegeben von KARLVORLÄNDER Mit einer Bibliographie von Heiner Klemme FELIX MEINER VERLAG HAMBURG Vorbemerkung zur siebenten Auflage Zur Entstehung der Schrift.
Leviathan (1651) englische Fassung, (1670, lateinische Fassung)
 Vorlesung Der Begriff der Person : WS 2008/09 PD Dr. Dirk Solies Begleitendes Thesenpapier nur für Studierende gedacht! Hobbes (1588 1679) Philosophierelevante Werke: Elements of Law (1640) Objectiones
Vorlesung Der Begriff der Person : WS 2008/09 PD Dr. Dirk Solies Begleitendes Thesenpapier nur für Studierende gedacht! Hobbes (1588 1679) Philosophierelevante Werke: Elements of Law (1640) Objectiones
3. Juli Lasst uns reden! Wie frei ist der Mensch wirklich? Freiheit im Spannungsverhältnis zwischen Wissenschaft und Religion.
 These: Der Mensch ist auch dann frei, wenn er es nicht merkt. 3. Juli 2018 Lasst uns reden! Wie frei ist der Mensch wirklich? Freiheit im Spannungsverhältnis zwischen Wissenschaft und Religion Veranstaltungsort:
These: Der Mensch ist auch dann frei, wenn er es nicht merkt. 3. Juli 2018 Lasst uns reden! Wie frei ist der Mensch wirklich? Freiheit im Spannungsverhältnis zwischen Wissenschaft und Religion Veranstaltungsort:
Zu Gustave Le Bons: "Psychologie der Massen"
 Geisteswissenschaft Karin Ulrich Zu Gustave Le Bons: "Psychologie der Massen" Die Massenseele - Über Massenbildung und ihre wichtigsten Dispositionen Essay Technische Universität Darmstadt Institut für
Geisteswissenschaft Karin Ulrich Zu Gustave Le Bons: "Psychologie der Massen" Die Massenseele - Über Massenbildung und ihre wichtigsten Dispositionen Essay Technische Universität Darmstadt Institut für
Erste Hilfe bei starken Emotionen
 Erste Hilfe bei starken Emotionen Eine Anleitung zum etwas anderen Umgang mit unangenehmen Gefühlen. Für mehr innere Freiheit! Erste Hilfe-Toolkit In wenigen Schritten zur wahren Botschaft Deiner Emotionen
Erste Hilfe bei starken Emotionen Eine Anleitung zum etwas anderen Umgang mit unangenehmen Gefühlen. Für mehr innere Freiheit! Erste Hilfe-Toolkit In wenigen Schritten zur wahren Botschaft Deiner Emotionen
Eph. 2,4-10 Predigt am 7. August 2016 in Landau. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
 Eph. 2,4-10 Predigt am 7. August 2016 in Landau Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 1 4 Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen
Eph. 2,4-10 Predigt am 7. August 2016 in Landau Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 1 4 Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen
"DER ERLÖSER IN DIR": Aus: ad.php?t=5342
 "DER ERLÖSER IN DIR": Aus: http://www.foren4all.de/showthre ad.php?t=5342 Es gibt seit langer Zeit eine Prophezeihung auf dieser Ebene, die von der "Wiederkunft Christi" spricht. Nun, diese Prophezeihung
"DER ERLÖSER IN DIR": Aus: http://www.foren4all.de/showthre ad.php?t=5342 Es gibt seit langer Zeit eine Prophezeihung auf dieser Ebene, die von der "Wiederkunft Christi" spricht. Nun, diese Prophezeihung
Kritik der Urteilskraft
 IMMANUEL KANT Kritik der Urteilskraft Anaconda INHALT Vorrede...................................... 13 Einleitung..................................... 19 I. Von der Einteilung der Philosophie..............
IMMANUEL KANT Kritik der Urteilskraft Anaconda INHALT Vorrede...................................... 13 Einleitung..................................... 19 I. Von der Einteilung der Philosophie..............
[Erste Intention: eine Intention, die nicht für eine Intention steht]
![[Erste Intention: eine Intention, die nicht für eine Intention steht] [Erste Intention: eine Intention, die nicht für eine Intention steht]](/thumbs/54/35269604.jpg) Aus der summa logicae des William von Ockham (ca. 1286 - ca. 1350) Übersetzung: Ruedi Imbach, nach Wilhelm von Ockham, Texte zur Theorie der Erkenntnis und der Wissenschaft, lat./dt., hg., übersetzt und
Aus der summa logicae des William von Ockham (ca. 1286 - ca. 1350) Übersetzung: Ruedi Imbach, nach Wilhelm von Ockham, Texte zur Theorie der Erkenntnis und der Wissenschaft, lat./dt., hg., übersetzt und
Wer denkt meine Gedanken?
 Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Wer denkt meine Gedanken? FORTSETZUNG 1. Andere islamische Aristoteliker lehren, daß der Geist sich mit dem Leib wie der Beweger mit dem Bewegten verbindet Anders als
Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Wer denkt meine Gedanken? FORTSETZUNG 1. Andere islamische Aristoteliker lehren, daß der Geist sich mit dem Leib wie der Beweger mit dem Bewegten verbindet Anders als
Geisteswissenschaft. Robin Materne. Utilitarismus. Essay
 Geisteswissenschaft Robin Materne Utilitarismus Essay Essay IV Utilitarismus Von Robin Materne Einführung in die praktische Philosophie 24. Juni 2011 1 Essay IV Utilitarismus Iphigenie: Um Guts zu tun,
Geisteswissenschaft Robin Materne Utilitarismus Essay Essay IV Utilitarismus Von Robin Materne Einführung in die praktische Philosophie 24. Juni 2011 1 Essay IV Utilitarismus Iphigenie: Um Guts zu tun,
Fragen der Ethik, Moritz Schlick Kapitel II: Warum handelt der Mensch?
 Fragen der Ethik, Moritz Schlick Kapitel II: Warum handelt der Mensch? 1. Tätigkeit und Handlung Wie die Erfahrung lehrt, gibt nicht jedes beliebige menschliche Tun Anlaß zu sittlicher Beurteilung; vielmehr
Fragen der Ethik, Moritz Schlick Kapitel II: Warum handelt der Mensch? 1. Tätigkeit und Handlung Wie die Erfahrung lehrt, gibt nicht jedes beliebige menschliche Tun Anlaß zu sittlicher Beurteilung; vielmehr
Jesus kam für dich! - Echt krass!
 Die schönste Geschichte der Welt: Jesus kam für dich! - Echt krass! Der Herr Jesus ist Gottes Sohn und lebte bei seinem Vater im Himmel. Das ist ein herrlicher Ort. Voller Licht und voller Freude! Seit
Die schönste Geschichte der Welt: Jesus kam für dich! - Echt krass! Der Herr Jesus ist Gottes Sohn und lebte bei seinem Vater im Himmel. Das ist ein herrlicher Ort. Voller Licht und voller Freude! Seit
Friedo Ricken. Allgemeine Ethik. Grundkurs Philosophie 4. 3., erweiterte und überarbeitete Auflage. Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln
 Friedo Ricken Allgemeine Ethik Grundkurs Philosophie 4 3., erweiterte und überarbeitete Auflage Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln Inhalt Aus dem Vorwort zur ersten Auflage 9 Vorwort zur dritten
Friedo Ricken Allgemeine Ethik Grundkurs Philosophie 4 3., erweiterte und überarbeitete Auflage Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln Inhalt Aus dem Vorwort zur ersten Auflage 9 Vorwort zur dritten
DER INDIVIDUELLE MYTHOS DES NEUROTIKERS
 DER INDIVIDUELLE MYTHOS DES NEUROTIKERS LACANS PARADOXA Was Sie eine Analyse lehrt, ist auf keinem anderen Weg zu erwerben, weder durch Unterricht noch durch irgendeine andere geistige Übung. Wenn nicht,
DER INDIVIDUELLE MYTHOS DES NEUROTIKERS LACANS PARADOXA Was Sie eine Analyse lehrt, ist auf keinem anderen Weg zu erwerben, weder durch Unterricht noch durch irgendeine andere geistige Übung. Wenn nicht,
Realität des Leides, Wirklichkeit Go4es - Das Problem der Theodizee Vierte Sitzung
 Realität des Leides, Wirklichkeit Go4es - Das Problem der Theodizee Vierte Sitzung E. Jüngel: Die Offenbarung der Verborgenheit Go4es. Ein Beitrag zum evangelischen Verständnis der Verborgenheit des gö4lichen
Realität des Leides, Wirklichkeit Go4es - Das Problem der Theodizee Vierte Sitzung E. Jüngel: Die Offenbarung der Verborgenheit Go4es. Ein Beitrag zum evangelischen Verständnis der Verborgenheit des gö4lichen
Kraft der Barmherzigkeit
 George Augustin Kraft der Barmherzigkeit Mensch sein aus den Quellen des Glaubens Matthias Grünewald Verlag Für die Schwabenverlag AG ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Maßstab ihres Handelns. Wir achten
George Augustin Kraft der Barmherzigkeit Mensch sein aus den Quellen des Glaubens Matthias Grünewald Verlag Für die Schwabenverlag AG ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Maßstab ihres Handelns. Wir achten
Übertragung mit Russland, einschließlich der Ukraine, Kasachstan, Weißrussland, Litauen und Estland am 3. Januar 2009
 Übertragung mit Russland, einschließlich der Ukraine, Kasachstan, Weißrussland, Litauen und Estland am 3. Januar 2009 Bhagavan: Namaste zu euch allen! Ich wünsche euch allen ein sehr sehr glückliches neues
Übertragung mit Russland, einschließlich der Ukraine, Kasachstan, Weißrussland, Litauen und Estland am 3. Januar 2009 Bhagavan: Namaste zu euch allen! Ich wünsche euch allen ein sehr sehr glückliches neues
Protokoll: 1. Ergänzungen zu Leibniz Begriff der Rationalität Ausgehend von dem, was in der letzten Sitzung über die doppelte Bedeutung des Begriffs R
 Proseminar zu: G.W. Leibniz, Confessio philosophi, Das Glaubensbekenntnis eines Philosophen Ergebnisprotokoll vom 02.11.1999 von Dominique Kaspar Gliederung 1. Ergänzungen zu Leibniz Begriff der Rationalität
Proseminar zu: G.W. Leibniz, Confessio philosophi, Das Glaubensbekenntnis eines Philosophen Ergebnisprotokoll vom 02.11.1999 von Dominique Kaspar Gliederung 1. Ergänzungen zu Leibniz Begriff der Rationalität
Evangelien Heilung des Blinden
 Studientext Markus 8:22-26 Einstimmung Es ist für uns sehr interessant zu beobachten, wie Jesus arbeitet. Jesus kam auf diese Erde, um dem Menschen zu helfen. Er wollte ihn ganz heilen, körperlich und
Studientext Markus 8:22-26 Einstimmung Es ist für uns sehr interessant zu beobachten, wie Jesus arbeitet. Jesus kam auf diese Erde, um dem Menschen zu helfen. Er wollte ihn ganz heilen, körperlich und
F könnte sich durch die Messerattacke auf M wegen Totschlags gem. 212 I StGB strafbar gemacht haben.
 I. Strafbarkeit der F gem. 212 I StGB F könnte sich durch die Messerattacke auf M wegen Totschlags gem. 212 I StGB strafbar gemacht haben. 1. Tatbestand a) Objektiver Tatbestand aa) Taterfolg Der Tod eines
I. Strafbarkeit der F gem. 212 I StGB F könnte sich durch die Messerattacke auf M wegen Totschlags gem. 212 I StGB strafbar gemacht haben. 1. Tatbestand a) Objektiver Tatbestand aa) Taterfolg Der Tod eines
Kants 'guter Wille' in: "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten"
 Geisteswissenschaft Alina Winkelmann Kants 'guter Wille' in: "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" Studienarbeit Inhaltsverzeichnis: 1. Vorwort 2. Begriffserklärung 2.1 Was ist gut? 2.2 Was ist ein
Geisteswissenschaft Alina Winkelmann Kants 'guter Wille' in: "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" Studienarbeit Inhaltsverzeichnis: 1. Vorwort 2. Begriffserklärung 2.1 Was ist gut? 2.2 Was ist ein
Was bedeutet Dir die Auferstehung? Welche Auswirkung hat sie auf dein Leben?
 Was bedeutet Dir die Auferstehung? Welche Auswirkung hat sie auf dein Leben? Bedeutung der Auferstehung: Der Beweis, dass der Vater das Erlösungswerk Jesu angenommen hat, es bestätigt hat. Der Beweis,
Was bedeutet Dir die Auferstehung? Welche Auswirkung hat sie auf dein Leben? Bedeutung der Auferstehung: Der Beweis, dass der Vater das Erlösungswerk Jesu angenommen hat, es bestätigt hat. Der Beweis,
Paul Natorp. Philosophische Propädeutik. in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen
 Paul Natorp Philosophische Propädeutik (Allgemeine Einleitung in die Philosophie und Anfangsgründe der Logik, Ethik und Psychologie) in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen C e l t i s V e r l a g Bibliografische
Paul Natorp Philosophische Propädeutik (Allgemeine Einleitung in die Philosophie und Anfangsgründe der Logik, Ethik und Psychologie) in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen C e l t i s V e r l a g Bibliografische
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über Theologische Fragen an die Hirnforschung. Erste Lieferung
 Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über Theologische Fragen an die Hirnforschung Erste Lieferung Zum Thema: Einführung: Verbreitete Ansichten, die für die Theologie relevant
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über Theologische Fragen an die Hirnforschung Erste Lieferung Zum Thema: Einführung: Verbreitete Ansichten, die für die Theologie relevant
Predigtthema: >>Gottes Willen erkennen & Nach Gottes Willen leben<<
 Predigtthema: >>Gottes Willen erkennen & Nach Gottes Willen leben
Predigtthema: >>Gottes Willen erkennen & Nach Gottes Willen leben
Top-Thema mit Vokabeln
 Der Vatikan und der Verkehr Autofahren kann gefährlich sein - und sündhaft. Mit den Zehn Geboten für Autofahrer warnt der Vatikan vor Sünden im Straßenverkehr und fordert eine christliche Vorbildfunktion.
Der Vatikan und der Verkehr Autofahren kann gefährlich sein - und sündhaft. Mit den Zehn Geboten für Autofahrer warnt der Vatikan vor Sünden im Straßenverkehr und fordert eine christliche Vorbildfunktion.
