Bausteine des Gedächtnisses: Untersuchungen der menschlichen Hippokampusfunktion in-vivo und in-vitro
|
|
|
- Martha Bauer
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Bausteine des Gedächtnisses: Untersuchungen der menschlichen Hippokampusfunktion in-vivo und in-vitro Thomas Grunwald, Heinz Beck und Christian E. Elger Zusammenfassung Die Frage nach strukturellen, zellulären und molekularen Basisprozesse des menschlichen Gedächtnisses ist eine der wichtigsten Fragen der heutigen neurowissenschaftlichen Forschung. Die Untersuchung vieler Aspekte menschlicher (speziell deklarativer) Gedächtnisprozesse ist in einem epilepsiechirurgischen Zentrum in besonderer Weise möglich, da hier am Menschen neuropsychologische Analysen, und elektrophysiologische Messungen in-vivo und in-vitro durchgeführt werden können. Ableitungen ereigniskorrelierter Potentiale von implantierten Tiefenelektroden erlauben eine Analyse der Grundlagen deklarativer Gedächtnisprozesse im Menschen mit einer hohen Zeitauflösung, und einem exzellenten Signal-Rauschabstand. Innerhalb gewisser Grenzen können bei derartigen Messungen auch Anhaltspunkte über die pharmakologische Beeinflussbarkeit von Gedächtnisprozessen gewonnen werden. Nach Resektion des epileptogenen Areals können an vitalen Hirnschnitten elektrophysiologische in-vitro Experimente durchgeführt werden, um Einblicke in zelluläre Mechanismen von aktivitätsinduzierter Plastizität im menschlichen ZNS zu gewinnen. Abstract The elements of memory: studies of human hippocampal function in vivo and in vitro. To elucidate the structural, cellular and molecular basis of memory processes in humans is one of the currently greatest challenges in neuroscience research. The parallel investigation of human cognition on many levels of complexity is possible in the setting of an epilepsy surgery programme because neuropsychological and electrophysiological analyses can be carried out in-vivo, in addition to in-vitro experiments after surgical removal of the epileptogenic area. Recording event-related potentials from implanted depth electrodes it is possible to analyze electrophysiological correlates of declarative memory processes with high time resolution and excellent signal-to-noise ratio. This also permits to examine aspects of the pharmacosensitivity of these memory processes. After resection of the epileptogenic area, living brain slices can be prepared using standard methods. In-vitro experiments in slice preparations allow to study cellular mechanisms of activity-induced plasticity in the human CNS. Keywords: declarative memory, hippocampus, NMDA receptor, long-term potentiation, event-related potential Einleitung und Fragestellung Was müssen die Nervenzellen in Ihrem Hippokampus leisten, damit Sie sich später an diesen Artikel erinnern? Vorausgesetzt, Sie wollen dies nach seiner Lektüre überhaupt, und die Eingangsfrage hat Sie nicht bereits jetzt zu der Überzeugung gebracht, man könne ihre Beantwortung getrost vergessen! Tatsächlich scheint es zunächst ein vielleicht eher utopischer als frommer Wunsch zu sein, die zellphysiologischen Korrelate des menschlichen Sprachgedächtnisses untersuchen zu wollen. Zwar haben Befunde aus Tierexperimenten viel zum Verständnis der Hippokampusfunktionen beigetragen, aber gelten diese Erkenntnisse auch für das menschliche Sprachgedächtnis? Ist es tatsächlich möglich, eine Brücke von der Neuropsychologie sprachlicher Gedächtnisprozesse hinüber zur Zellphysiologie zu schlagen? Im Folgenden möchten wir Ihnen Bausteine für eine solchen Brücke vorstellen und zu zeigen versuchen, dass sie zu tragfähigeren Gebäuden taugen als zu Luftschlössern. Gedächtnissysteme des Menschen Wesentliche Erkenntnisse über die Funktionsweise des menschlichen Sprachgedächtnisses verdanken wir neuropsychologischen Untersuchungen seiner spezifischen Störung ausgehend von wohl einer der berühmtesten neuropsychologischen Katastrophen: Zur Behandlung seiner nicht auf Medikamente ansprechenden epileptischen Anfälle wurden 1953 bei dem Patienten H.M. in beiden Schläfenlappen große Teile der Hippokampusformation entfernt (Scoville and Milner, 1957). Dies führte zu einer dramatischen Gedächtnisstörung, die es H.M. seither unmöglich macht, neue Ereignisse oder Fakten länger als ca. eine Minute im Gedächtnis zu behalten. Nicht zuletzt H.M., der sich seit seiner Operation immer wieder ausführlichen Tests zur Verfügung stellte, ist die Erkenntnis zu verdanken, dass das Gedächtnis des Menschen keinen unstrukturierten Speicher für alle Arten von Erinnerungen darstellt, sondern aus spezialisierten Subsystemen für jeweils bestimmte Arten von Inhalten besteht. So wurde deutlich, dass Schädigungen des limbischen Systems - und hier insbesondere der Hippokampus-Formation - zu erheblichen Beeinträchtigungen zu erheblichen Beeinträchtigungen des deklarativen (Squire, 1992;Squire and Zola-Morgan, 1991) bzw. episodischen Gedächtnisses (Tulving and Markowitsch, 1998) führen, d.h. der Fähigkeit, (begrifflich fassbare) sprachliche und nicht-sprachliche Inhalte und Ereignisse abzuspeichern und sich diese explizit und bewusst zu vergegenwärtigen. Eine solche Störung betrifft damit auch das autonoëtische Gedächtnis, die (möglicherweise spezifisch menschliche) Fähigkeit, sich quasi in der Zeit zurück zu versetzen, um einer vergangenen Episode erneut gewahr zu werden. Unberührt von einer Läsion des Hippokampus bleiben dagegen prozedurale Gedächtnisinhalte wie Fertigkeiten oder Gewohnheiten etc. und andere implizite Gedächtnisspuren. Diese können sich etwa darin zeigen, dass die Reaktion auf einen Zielreiz schneller erfolgt, wenn dieser wiederholt wird, - auch wenn die Tatsache der Wiederholung selbst nicht bewusst wird ( priming ). 114 Neuroforum 3/01
2 GRUNWALD ET AL. Modellerkrankung TemporallappenEpilepsie Selbstverständlich wird eine Entfernung des Hippokampus inzwischen nicht mehr in beiden Temporallappen durchgeführt. Patienten mit einer Temporallappen-Epilepsie (TLE) leiden aber nicht selten bereits aufgrund ihrer Erkrankung an Gedächtnisdefiziten, speziell wenn die TLE mit einem Zellverlust und begleitenden bindegewebigen Umbau des eigentlichen Hippokampus, der sogenannten Ammonshorn-Sklerose, einhergeht. Im Temporallappen der sprachdominanten (also meist linken) Hemisphäre führt dies in der Regel zu Defiziten im Bereich sprachlicher Gedächtnisleistungen (Hermann et al., 1988), während es auf der nicht-dominanten Seite Beeinträchtigungen des bildhaften Gedächtnisses verursacht (Helmstaedter et al., 1991). Die Störungen des Sprachgedächtnisses bei einer linksseitigen TLE werden in einem Test deutlich, bei dem eine Liste von 15 Wörtern gelernt werden soll. Während die Patient(inn)en während der Lernphase oft noch keine besonderen Schwierigkeiten haben, schneiden sie in einer späteren Testphase schlechter ab: Nach einer Verzögerung von 30 Minuten können sie sich an signifikant weniger Wörter erinnern als Patient(inn)en mit einer rechtsseitigen TLE oder gesunde Kontrollpersonen. Wenn es mit einer medikamentösen Behandlung nicht möglich ist, eine befriedigende Anfallskontrolle zu erreichen, so kann in nicht wenigen Fällen ein epilepsiechirurgischer Eingriff erfolgreich sein. Die einseitige Entfernung des Hippokampus (im Rahmen einer sog. selektiven Amygdalo-Hippokampektomie oder einer anterioren Temporallappen-Resektion) ist dabei häufig für eine postoperative Anfallskontrolle unabdingbar, birgt jedoch das Risiko zusätzlicher postoperativer Gedächtnisdefizite, vor allem wenn der kontralaterale Hippokampus ebenfalls funktionelle Beeinträchtigungen aufweist. Ein wesentliches Ziel der neuropsychologischen Forschung innerhalb der Epileptologie ist es daher einerseits zu klären, was genau und wie der Hippokampus zu Gedächtnisprozessen beiträgt, andererseits aber auch die möglichst genaue Charakterisierung der Funktionsfähigkeit beider Hippokampi individueller Patient(inn)en, um so die neuropsychologischen Folgen epilepsiechirurgischer Eingriffe kontrollieren zu können. Ihren Modellcharakter für die Erforschung menschlicher Gedächtnisprozesse erhält die TLE in der prächirurgischen Epilepsiediagnostik nun dadurch, dass hier eine Vielzahl unterschiedlicher und schließlich korrelierneuroforum 3/01 barer Untersuchungsmethoden zum Einsatz kommen. Überdies kann auch der resezierte Hippopkampus postoperativ weiter untersucht werden. Dabei machen es die graduell abgestuften Gedächtnisdefizite der TLEPatient(inn)en überhaupt erst möglich, nach Korrelationen zu suchen, um hippokampale Funktionen auf diese Weise zu charakterisieren. Limbische Ereignis-korrelierte Potentiale Wenn es nicht möglich ist, den Ursprungsort der Anfälle mit nicht-invasiven Methoden zu identifizieren, so kann die prächirurgische Epilepsiediagnostik bei manchen Patienten die Implantation von Tiefenelektroden beiden Temporallappen erfordern (Abb. 1). In diesen Fällen ist es dann auch möglich, sogenannte Ereignis-korrelierte Potentiale (EKP) direkt aus dem Hippokampus und dem angrenzenden entorhinalen Cortex abzuleiten, ohne dass damit irgendein zusätzliches Risiko für die Patienten verbunden wäre (s. Abb. 2). EKP sind Spannungsschwankungen der elektrischen Hirnaktivität, die genau definierten Ereignissen, wie spezifischen visu- ellen oder akustischen Stimuli, folgen oder vorangehen. Sie werden auch endogen oder kognitiv genannt, da ihre Ausprägung weniger von den physikalischen Eigenschaften der Stimuli abhängt als von der Art und Weise, wie diese verarbeitet werden (Rugg and Coles, 1995). Die Hauptquelle der neuronalen Aktivität, die der Erzeugung der EKP zugrunde liegt, sind dendritische exzitatorische post-synaptische Potentiale. Die so generierten Spannungsschwankungen sind jedoch klein im Vergleich zu den spontan im Hintergrund -EEG auftretenden Fluktuationen. Um EKP sichtbar zu machen und den Signal-Rausch-Abstand zu vergrößern, ist es daher in der Regel nötig, EEG-Episoden zu mitteln, die von experimentell äquivalenten Stimuli hervorgerufen wurden. Die einzelnen Komponenten der so evozierten EKP werden nach ihrer Polarität und Gipfellatenz benannt. N400 bezeichnet somit eine negative Auslenkung der EKP-Wellenform mit einer mittleren Gipfellatenz von 400 ms (Abb. 2B). Die Amplitude der N400-Komponente wird insbesondere von sprachlichen Stimuli beeinflusst. So nimmt sie etwa bei Wort-Wiederholungen ab, während innerhalb eines Satzes unerwartete oder semantisch abweichende Wörter N400-Potentiale Abb. 1: Postoperative T1-gewichtete Kernspin-Tomogramme zur Kontrolle der Lage hippokampaler Tiefenelektroden. (A) axial; (B) sagittal; (C) coronar (vergrößerter Ausschnitt) Limbische AMTL-N400 Potentiale werden von im anterioren mesialen Temporallappen gelegenen Kontakten registriert. 115
3 A B Abb. 2: Limbische AMTL-N400 Potentiale A: Schema des Gebiets (schraffiertes Feld), in dem limbische AMTL-N400-Potentiale typischerweise aufgezeichnet werden können; a = Hippokampus, b = Sulcus collateralis, c = Amygdala. B: AMTL-Potentiale auf der Seite der Ammonshornsklerose (AHS) und auf der kontralateralen nonfokalen Seite gemittelt über 16 Patienten. Im Vergleich zu alten Wörtern (blau) evozieren neue Wörter (rot) AMTL-N400 Potentiale signifikant größerer Amplitude auf der nonfokalen Seite. Dieser Effekt wird durch Gabe des NMDA-Rezeptor-Blockers Ketamin unterdrückt. höherer Amplitude evozieren als erwartete und semantisch passende Wörter (Abb. 2B). Bei intrakraniellen Ableitungen fanden wir in zwei Regionen beider Hemisphären N400-Potentiale, die sowohl durch Wörter als auch durch Bilder von Gegenständen evoziert wurden: temporo-lateral im Gyrus temporalis medius sowie im anterioren mesialen Temporallappen (Elger et al., 1997). Die Befunde verschiedener Untersuchungen sprechen dafür, dass die letztere, AMTL-N400 genannte, Komponente im entorhinalen Cortex generiert wird (Halgren et al., 1994;McCarthy et al., 1995;Fernandez et al., 1999), dass aber der eigentliche Hippokampus ( hippocampus proper ) zumindest teilweise zu ihrer Entstehung beiträgt (Grunwald et al., 1999a;Grunwald et al., 1998a). Die Analyse der temporo-mesialen, limbischen EKP hat sich inzwischen im Rahmen der prächirurgischen Epilepsiediagistik als praktisch wertvoll erwiesen, da sie sowohl zur Lateralisation des epileptogenen Fokus beitragen (Grunwald et al., 1995) als auch die Prognostizierbarkeit der zu erwartenden (oder ggf. ausbleibenden) postoperativen Anfallskontrolle verbessern kann (Grunwald et al., 1999b) Können limbische EKP nun aber auch dazu genutzt werden, den spezifischen Beitrag hippokampaler Strukturen zu verbalen Gedächtnisprozessen weiter aufzuklären? Um dies zu untersuchen, korrelierten wir die Amplituden intrakranieller N400-Potentiale mit den Leistungen von TLE-Patienten in dem oben skizzierten Test des Lernens von Wortlisten (Elger et al., 1997). Zur Stimulation verwendeten wir zwei sogenannte kontinuierliche Rekognitionsparadigmata, bei denen entweder einzelne Wörter (oder Bilder) auf einem Monitor gezeigt wurden. Ein Teil der verbalen (oder bildhaften) Stimuli wurde im Verlauf der Untersuchung je einmal wiederholt. Die Patient(inn)en wurden dabei gebeten, bei jedem Stimulus zu entscheiden, ob es sich um eine Erstpräsentation (= neu ) oder einer Wiederholung (= alt ) handelte. Dabei zeigte sich, dass nur die durch Wörter, nicht jedoch die durch Bilder im sprachdominanten Temporallappen evozierten Potentiale mit spezifischen Teilleistungen assoziiert waren: während die Amplitude der temporo-lateralen neokortikalen N400-Potentiale mit dem unmittelbaren freien Abruf nach dem fünften Lerndurchgang korrelierten, fand sich eine hochsignifikante positive Korrelation der mesialen AMTL-N400 Amplituden mit dem verzögerten freien Abruf nach einer 30-minütigen Pause sowie eine negative mit der Zahl von Wörtern, die während dieser Zeit vergessen worden waren. Diese Befunde zeigen, dass temporo-laterale und mesiale Strukturen der sprachdominanten Hemisphäre unterschiedliche Aspekte verbaler Gedächtnisprozesse vermitteln: Während der gyrus temporalis medialis für das verbale Lernen und den unmittelbaren Abruf wichtig ist, beruht der (von Konsolidierungsprozessen abhängige) verzögerte freie Abruf zuvor gelernter Wörter mehr auf der Aktivität hippokampaler Areale. Interessanterweise fanden sich die genannten Korrelationen nur für die Amplituden von N400-Potentialen, die durch erstgezeigte ( neue ) und nicht durch wiederholte ( alte ) Wörter evoziert wurden. Dies legte die Vermutung nahe, dass die durch neue und zu lernende Stimuli ausgelöste hippokampale Aktivität mit dem Enkodieren deklarativer Gedächtnisinhalte assoziiert ist und dass es die Störung gerade dieser Aktivität ist, die die Gedächtnisdefizite von TLE-Patienten bedingt. Diese Hypothese wird unterstützt durch weitere Befunde, die wir inzwischen erheben konnten. Erstens scheint der Grad der mesio-temporalen Aktivierung während des Lernens darüber zu entscheiden, ob wir uns später an das zu Lernende erinnern können oder nicht: Während der Lernphase evozieren Wörter, die später wiedererkannt werden, AMTL-N400 Potentiale signifikant höherer 116 Neuroforum 3/01
4 Im Menschen ist über hippokampale (Beck et al., 2000) und kortikale (Chen et al., 1996) synaptische Plastizität und ihre Mechanismen in-vitro noch wenig bekannt. Dies liegt an der begrenzten Verfügbarkeit vitalen menschlichen Hirngewebes aus diesen Regionen. Die Möglichkeit, derartige Experimente an menschlichem Hirngewebe durchzuführen, besteht im Moment eigentlich nur nach epilepsiechirurgischen Eingriffen, mit denen ein Teil der medikamentös therapieresistenten Epilepsien behandelt werden kann. Dies bietet den Vorteil, dass sowohl die Untersuchung neuropsychologischer Parameter als auch in-vivo Elektrophysiologie und in-vitro Elektrophysiologie an demselben Patientenkollektiv durchgeführt werden kann. Bei derartigen in-vitro Untersuchungen an Hippokampuspräparaten von Epilepsiepatienten nach epilepsiechirurgischen Eingriffen haben wir uns die folgenden Fragen gestellt: (1) kann eine NMDA-Rezeptorabhängige LTP im menschlichen Hippokampus ausgeenz nach hochfrequenter Stimulation afferenter Fasern. Sie ist abhängig von einer hohen postsynaptischen Kalzium-Konzentration, wobei der wichtigste Kalzium-Einstrom während der Induktion der LTP durch Ionenkanäle erfolgt, die an den NMDA-Subtyp der Glutamat-Rezeptoren gekoppelt sind. Es wird daher angenommen, dass NMDA- Rezeptoren im CA1-Sektor des Hippokampus eine entscheidende Rolle für die assoziative LTP spielen, die wiederum als ein mögliches Substrat von Lern- und Gedächtnisprozessen diskutiert wird. Um zu überprüfen, ob auch die hippokampale Aktivität beim Enkodieren neuer verbaler Stimuli wesentlich von der Aktivierung von NMDA- Rezeptoren abhängt, untersuchten wir den Einfluss des nicht-kompetitiven NMDA- Rezeptorblockers Ketamin auf limbische EKP und die Wiedererkennungsleistung im Rahmen des beschriebenen Wort-Rekognitionsparadigmas (Grunwald et al., 1999a). Dabei fanden wir, dass die Blockade der NMDA-Rezeptoren zu einer markanten und selektiven Amplitudenreduktion der AMTL- N400 auf neue, nicht aber auf alte Wörter führte, so dass der neu-minus-alt Rekognitioseffekt durch Ketamin völlig eliminiert wurde (Abb. 2B). Im Gegensatz dazu erwiesen sich andere hippokampale Potentiale und die mit ihnen assoziierten Rekognitionseffekte als völlig unbeeinflusst durch die Gabe von Ketamin, so dass dessen Effekt auf die AMTL-N400 als spezifisch und nicht als Folge einer generellen Reduktion aller limbischen EKP angesehen werden muss. Gleichzeitig wurde unter Ketamin auch die Gedächtnisleistung gemessen an der Zahl erkannter Wortwiederholungen signifikant schlechter. Diese Befunde sind durchaus mit unserer Hypothese vereinbar, dass die hippokampale Dekodierung des Neuigkeitswertes eines Stimulus zur Enkodierung verbaler Gedächtnisinhalte beiträgt und dass dieser Prozess nicht zuletzt auf der Aktivierung hippokampaler NMDA-Rezeptoren beruht. Eigenschaften von NMDA-Rezeptoren Welches sind nun die Eigenschaften von NMDA Rezeptoren, die für die zentrale Rolle dieses Rezeptorkomplexes bei LTP wichtig sind? Bei normaler synaptischer Transmission dominieren in den meisten glutamatergen synaptischen Verbindungen non- NMDA Rezeptoren, weil NMDA Rezeptorkanäle durch extrazelluläre Mg 2+ Ionen blokkiert werden. Bei Depolarisation der postsynaptischen Membran jedoch wird der Mg 2+ Block aufgehoben, und die synaptische Aktivierung von NMDA-Rezeptoren resultiert Amplitude als später nicht wiedererkannte (Fernandez et al., 1999). Und zweitens führt die Atrophie und Sklerose des Hippokampus bei mesialer TLE nur zu einer Reduktion der AMTL-N400 Amplitude auf neue Wörter, während die AMTL-N400 auf alte Wörter keine Veränderung im Vergleich zur nicht epileptischen Gegenseite aufweist (Grunwald et al., 1998a). Tatsächlich korreliert die Amplitude der AMTL-N400 auf neue nicht auf alte Wörter hochsignifikant mit der Dichte der Pyramidenzellen im hippokampalen Subsektor CA1 (nicht aber mit der Zellzahl in anderen Regionen des Hippokampus und Gyrus dentatus (Grunwald et al., 1999a). Diese Ergebnisse sind auch vereinbar mit der Auffassung, dass der Hippokampus des Menschen wesentlich an der Detektion des Neuigkeitsgrades wahrgenommener Stimuli ( novelty detection ) beteiligt ist (Knight, 1996). Demnach würden wir eher das Auftreten eines neuen (und damit vielleicht wichtigen ) Stimulus in einer bestimten Situation enkodieren und uns später daran erinnern als an das Auftreten eines alten (und vielleicht weniger wichtigen) Ereignisses. Wenn nun perisylvische Sprachareale bereits die linguistische Verarbeitung eines verbalen Stimulus leisten, könnte die hippokampale novelty detection dann aber vielleicht auch weniger materialspezifisch sein und somit prinzipiell auch von beiden Hippokampusformationen geleistet werden. Schließlich führt die epilepsiechirurgische Resektion des Hippokampus der sprachdominanten Hemisphäre eben nicht zu einem völligen Verlust des Sprachgedächtnisses zumindest dann, wenn der kontralaterale Hippokampus nicht (oder nur wenig) funktionsgestört ist. Und in der Tat ist es bei Patienten mit linksseitiger Sprachdominanz möglich, mit Hilfe der vor der Operation im rechten Hippokampus gemessenen AMTL- N400 (auf neue Wörter) die Leistungsfähigkeit des Sprachgedächtnisses nach der Resektion des linken Hippokampus vorherzusagen (Grunwald et al., 1998b). Ein solches Modell der Enkodierung verbaler Gedächtnisinhalte durch die hippokampale Dekodierung des Neuigkeitswertes eines Stimulus würde auch mit den beobachteten Gedächtnisdefiziten nach isolierter Läsion des Hippokampus-Sektors CA1 übereinstimmen (Zola-Morgan et al., 1986). Diese Region ist nicht zuletzt auch deshalb besonders interessant, da (allerdings nicht nur) hier in Tiermodellen der Vorgang der assoziativen long-term potentiation (LTP) nachgewiesen werden konnte. LTP ist eine nachhaltige Steigerung der synaptischen Effiziin einem Einstrom von Na + und Ca 2+ Ionen. Diese Eigenschaft des NMDA-Rezeptors führt zu charakteristischen Eigenschaften der NMDA-Rezeptor-abhängigen LTP, die als Kooperativität und Assoziativität bezeichnet werden. Kooperativität bedeutet, dass LTP nur bei gleichzeitiger Aktivierung mehrerer erregender synaptischer Eingänge ausgelöst wird. Hierbei muss die gleichzeitiger Aktivierung einer grossen Anzahl von non- NMDA Rezeptoren eine postsynaptische Depolarisation verursachen, die ausreichend ist, um den Mg 2+ -Block postsynaptischer NMDA-Rezeptoren aufzuheben. Assoziativität bezeichnet die Vorstellung, dass präund postsynaptische Aktivierung gleichzeitig vorhanden sein muss, damit LTP ausgelöst werden kann. Synaptische Potenzierung kann zum Beispiel ausgelöst werden durch Koinzidenz einer präsynaptischen Aktivierung mit einem somatischen Aktionspotential, welches in die Dendriten zurückpropagiert (Markram et al., 1997). Eine weitere wichtige Eigenschaft von NMDA-Rezeptoren ist die spezifische Kopplung dieses Rezeptors an eine Reihe wichtiger intrazellulärer Signaltransduktionswege, die für die Ausprägung synaptischer Modifikationen wichtig sind (Sprengel et al., 1998). Diese spezifischen Eigenschaften des NMDA Rezeptors prädisponieren diesen Rezeptor für eine Rolle bei der Speicherung von Information im ZNS. NMDA-abhängige synaptische Plastizität im menschlichen ZNS 118 Neuroforum 3/01
5 GRUNWALD ET AL. Abbildung 3: NMDA-Rezeptorabhängige LTP im menschlichen Hippokampus. Aus epilepsiechirurgisch gewonnenem menschlichen Hippokampuspräparaten wurden mit einem Vibratom 400 µm dicke Vitalschnitte angefertigt, und in einer Interfacekammer äquilibriert. A: Es wurden dann (s.schemazeichnung) zwei unabhängige Anteile des Tractus perforans gereizt (2 und 3 Sterne), und in der Molekularschicht des Gyrus dentatus (DG-ML) mit Feldpotentialelektroden abgeleitet. Beispielhafte erregende postsynaptische Potentiale (fepsps) sind in Abb. B 1 und B 2 dargestellt. B 1 und B 2 : Experimente in Hippokampusschnitten von Patienten ohne (B 1 ) und mit (B 2 ) einem hippokampalen Anfallsfokus. LTP wurde durch Applikation einer tetanischen Stimulation (8 x 20 Stimulationen mit 100 Hz im Abstand von 10 s) bei einem der synaptischen Eingänge (runde Symbole) ausgelöst. Der Zeitpunkt der tetanischen Stimulation ist durch einen * gekennzeichnet. Der untetanisierte Kontrollinput zeigt keine Veränderung nach Tetansierung. Beispielhafte fepsps sind zu den verschiedenen Zeitpunkten (a, b, c) während des Experimentes gezeigt. Die Dauer der Applikation des NMDA-Rezeptorantagonisten APV ist durch einen horizontalen Balken gekennzeichnet. C: Auswertung der Steigerung synaptischer Effizienz in beiden Patientengruppen 1 Stunde nach tetanischer Stimulation. Patienten mit extrahippokampalem Anfallsfokus (Extra-hipp.) zeigen deutlich mehr synaptische Potenzierung (p<0.05). Für eine ausführliche Beschreibung s. Beck et al löst werden? und (2) ist das Potenzial zur Auslösung NMDA-Rezeptor-abhängiger LTP durch die Präsenz eines hippokampalen Anfallsherdes vermindert? Hierzu haben wir unsere Patienten in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe zeigte einen hippokampalen Anfallsbeginn mit einem charakteristischen neuropathologischen Schädigungsmuster im Hippokampus. Die zweite Gruppe zeigte einen extrahippokampalen Anfallsfokus, etwa auf der Grundlage eines Tumors, einer Entwicklungsfehlbildung oder einer anderen Läsion. Diese Patienten zeigten keine ausgeprägte morphologische Schädigung des Hippokampus selbst. Wir konnten zunächst zeigen, dass bei Patienten mit einem extrahippokampalen Anfallsfokus klassische NMDA-Rezeptorabhängige LTP in der Tractus perforans-körnerzellsynapse des Hippokampus ausgelöst werden kann (Abb. 3A, B 1 ). Diese Potenzierung konnte - wie bei Tiermodellen auch durch niederfrequente Stimulation zum Teil wieder rückgängig gemacht werden. Im Gegensatz hierzu konnte in Patienten mit einem hippokampalen Anfallsfokus keine NMDA-Rezeptor-abhängige LTP ausgelöst werden (Abb. 3B 2 ). Ein ähnlicher Unterschied fand sich auch für die synaptische Langzeitpotenzierung, die durch pharmakologische Anhebung der intrazellulären camp Konzentration induziert werden kann (Beck et al., 2000). Diese Reduktion synaptischer Plastizität bei Patienten mit einem hippokampalen Anfallsfokus korreliert mit den vermehrten Defiziten im sprachlichen Gedächtnis bei dieser Patientengruppe. Ein Verlust hippokampaler synaptischer Plastizität fand sich bisher auch bei Epilepsietiermodellen an verschiedenen Synapsen (Goussakov et al., 2000) und unpublizierte Daten). Die Modifikation synaptischer Plastizität durch Anfallserkrakungen könnte also einen attraktiven Basismechanismus für den Verlust an kognitiven Leistungen bei Epilepsiepatienten darstellen. Der letztendliche Beweis für einen solchen Zusammenhang beim Menschen ist durch korrelative Untersuchungen natürlich nicht zu erbringen. Nichtsdestoweniger bietet die parallele Untersuchung von Gedächtnisprozessen in-vivo, und Plastizität in-vitro eine interessante und derzeit auch die einzige - Möglichkeit, Hypothesen über zelluläre Grundlagen von deklarativem Gedächtnis zu testen. Neuroforum 3/01 119
6 Exkurs Rolle von NMDA-Rezeptoren für Gedächtnisprozesse in Tiermodellen Wie ist die Beweislage für eine Rolle von NMDA Rezeptoren bei Gedächtnisprozessen in Tiermodellen? Diese Frage kann nur beantwortet werden, wenn man die Funktion von NMDA-Rezeptoren oder nachgeschalteter Signalkaskaden in-vivo möglichst selektiv inhibieren kann. Anfangs wurde versucht, die Funktion von NMDA- Rezeptoren durch in-vivo Applikation von pharmakologischen Antagonisten in den Bereich des Hippokampus zu hemmen. In derartigen Experimenten konnten meist parallel Defizite im räumlichen Lernen, und eine Hemmung von hippokampalem LTP in der CA1 Region beobachtet werden (Morris, 1989;Davis et al., 1992;Morris et al., 1986). Allerdings wurde in ähnlichen Experimenten eine Hemmung von LTP in einer anderen Hippokampusregion, dem Gyrus Dentatus, hervorgerufen, die nicht mit Defiziten im räumlichen Lernvermögen einherging (Saucier and Cain, 1995). Dass der Zusammenhang zwischen NMDA-Rezeptorabhängigem LTP und räumlichem Lernen nicht trivial ist, wurde auch durch weitere Experimente aus der Gruppe von Morris gezeigt, in denen z.b. vor Applikation der NMDA Rezeptorantagonisten eine Trainingssitzung in einem etwas veränderten Lernparadigma durchgeführt wurde. In diesen Ratten konnte das unter NMDA-Rezeptorblockade normalerweise vorhandene räumliche Lerndefizit fast völlig normalisiert werden (Bannerman et al., 1995). Später wurde versucht, mit Hilfe von transgenen Mäusen Aufschluss über die Rolle von NMDA-Rezeptorabhängiger Plastizität über die Ausschaltung von involvierten Enzymkaskaden zu bekommen (Grant et al., 1992;Silva et al., 1992a;Silva et al., 1992b). Eine ganze Reihe dieser transgener Tiere zeigt einen parallelen Verlust synaptischer Plastizität und räumlichen Lernvermögens. Interessanterweise zeigen Literatur Beck H, Goussakov IV, Lie A, Helmstaedter C, Elger CE (2000) Synaptic plasticity in the human dentate gyrus. J Neurosci 20: Grunwald T, Beck H, Lehnertz K, Blumcke I, Pezer N, Kurthen M, Fernandez G, Van Roost D, Heinze HJ, Kutas M, Elger CE (1999a) Evi- transgene Mäuse, welchen die für die Kopplung an intrazelluläre Signaltransduktionswege wichtige intrazelluläre C-terminale Proteindomäne des NR2A Subtyps des NMDA-Rezeptors fehlt, ebenfalls defekte synaptische Plastizität und räumliches Lernen (Sprengel et al., 1998). Diese Resultate deuteten eine mögliche Rolle von NMDA-Rezeptorabhängiger Plastizität in der CA1 Region bei räumlichem Lernen und Gedächtnis an. Allerdings ist sowohl in der pharmakologischen wie auch den transgenen Experimenten die Blockade der Funktion plastizitätsrelevanter Moleküle weder räumlich noch zeitlich sehr spezifisch. Aus diesem Grund hatten einige Gruppen damit begonnen, transgene Tiere zu entwickeln, in denen für synaptische Plastizität wichtige Gene in spezifischen Zelltypen oder zu bestimmten Zeitpunkten inaktiviert werden können (Mayford et al., 1996;Rotenberg et al., 1996). Interessanterweise führte die selektive genetische Inaktiverung von NMDA-Rezeptoren nur in CA1 Neuronen des Hippokampus zu einem Verlust NMDA-Rezeptorabhängiger LTP, zu einer Störung in der Bildung ortsspezifischer Neurone in der CA1 Region, und zu Störungen in räumlichen Gedächtnis (McHugh et al., 1996;Tsien et al., 1996). In einem sehr eleganten transgenen Experiment wurde dann kürzlich ein inverser Ansatz versucht: Durch regionalspezifisch erhöhte Expression der NR2B Untereinheit des NMDA-Rezeptors wurde die Auslösbarkeit synaptischer Plastizität erleichtert. Diese Mäuse zeigten erstaunlicherweise in einem umfangreichen Sortiment von Gedächtnis- und Verhaltenstests eine verbesserte Leistung (Tang et al., 1999). Zusammengenommen sind die meisten dieser Experimente mit einigen Ausnahmen - mit einer Rolle NMDA-abhängiger synaptischer Plastizität bei Lernen und Gedächtnis vereinbar. Diese Experimente zeigen auch, dass die parallele Untersuchung von LTP in-vitro und Gedächtnisfunktion invivo Hinweise auf das Verhältnis von synaptischer Plastizität und Gedächtnis geben können. dence relating human verbal memory to hippocampal N-methyl-D- aspartate receptors. PNAS 96: Knight R (1996) Contribution of human hippocampal region to novelty detection. Nature 383: McCarthy G, Nobre AC, Bentin S, Spencer DD (1995) Language-related field potentials in the anterior-medial temporal lobe: I. intracranial distribution and neural generators. J Neurosci 15: Tsien JZ, Huerta PT, Tonegawa S (1996) The essential role of hippocampal CA1 NMDA receptor-dependent synaptic plasticity in spatial memory. Cell 87: Eine ausführliche Literaturliste kann bei den Autoren angefordert werden. Kurzbiographien der Autoren Heinz Beck: geb. 1966, studierte Medizin in Köln und promovierte 1992 bei Prof. Uwe Heinemann (Institut für Physiologie) in Köln über entwicklungsabhängige Regulation von spannungsabhängigen Ionenkanälen im Zentralnervensystem. Im Jahr 1994 Wechsel an die Universität Bonn und Aufbau einer eigenständigen Arbeitsgruppe an der Klinik für Epileptologie. Themen der Arbeitsgruppe sind aktivitätsabhängige Plastizität im Zentralnervensystem und Pathogenese von Anfallserkrankungen, unterstützt durch die DFG und das BMBF. Auszeichnung der Arbeitsgruppe durch den internationalen Michael Preis und den Hauptmann Preis für Epilepsieforschung, sowie den Bennigsen-Förder Preis des Landes Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 2001 Habilitation im Fach Physiologie und Verleihung eines Heisenberg Stipendiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Christian E. Elger: geb. 1949, studierte Medizin in Münster und promovierte an dem Institut für Physiologie in Münster (Prof. E. Speckmann). Im Jahre 1982 Habilitation im Fach Physiologie. Danach Ausbildung in klinischer Neurologie in Münster mit Auslandsaufenthalten in Zürich (Prof. H.G. Wieser) und Tennessee (Prof. A. Wyler) Erlangung des Facharztes für Neurologie. Seit 1987 Direktor der Klinik für Epileptologie der Universität Bonn. Auszeichnung durch mehrere Preise, darunter der internationale Michael Preis, der Hauptmann Preis und der Merell Dow Preis für Epilepsieforschung. Themen der Arbeitsgruppen sind die Erforschung der Grundlagen von menschlichen Epilepsien und von kognitiven und emotionalen Prozessen am Menschen. Thomas Grunwald: geb , studierte Phonetik und Linguistik an den Universitäten Marburg, Edinburgh und Köln, und promovierte im Jahre 1982 in Köln (Institut für Phonetik). Ab 1984 bis 1990 studierte er in Bonn Medizin und promovierte im Jahre 1992 (Klinik für Neurochirurgie). 120 Neuroforum 3/01
7 GRUNWALD ET AL. Er arbeitete von zunächst an der Klinik für Neurologie in Bonn und ab 1992 dann an der Klinik für Epileptologie. Hier baute er eine potente Arbeitsgruppe auf, die sich vorwiegend mit der Analyse von kognitiven und sprachlichen Prozessen im menschlichen Temporallappen beschäftigt. Die Arbeitsgruppe macht sich hierbei zunutze, dass in manchen Fällen im Rahmen der prächirurgischen Abklärungen vor epilepsiechirurgischen Eingriffen die Implantation von Tiefenelektroden notwendig ist, von denen reigniskorrelierte Potentiale abgeleitet werden können. Er habilitierte sich 2001 für Neurologie. Abkürzungen CA1, CA1 und CA3 Sektor des CA3 Ammonshornes EKP Ereigniskorrelierte Potentiale GD Gyrus dentatus LTP Synaptische Langzeitpotenzierung (long-term potentiation) N400 Komponente ereigniskorrelierter Potentiale mit einem Maximum etwa 400 ms nach Reizpräsentation AMTL-N400 Potential, gemessen im N400 anterioren Mesiotemporallappen NMDA N-Methyl-D-Aspartat TLE Temporallappenepilepsie (temporal lobe epilepsy) ZNS Zentralnervensystem Kontaktaddresse Thomas Grunwald, Heinz Beck, Christian E. Elger Klinik für Epileptologie Medizinische Einrichtungen der Universität Bonn Sigmund-Freud Str. 25 D Bonn Tel: [49] Fax: [49] thomas.grunwald@ukb.uni-bonn.de Neuroforum 3/01 121
Neurale Grundlagen kognitiver Leistungen II
 Neurale Grundlagen kognitiver Leistungen II Inhalt: 1. Lernen und Gedächtnis: Hirnregionen und wichtige Bahnen 2. Aufbau der Hippocampusformation 2.1 Anatomie und Mikroanatomie der Hippocampusformation
Neurale Grundlagen kognitiver Leistungen II Inhalt: 1. Lernen und Gedächtnis: Hirnregionen und wichtige Bahnen 2. Aufbau der Hippocampusformation 2.1 Anatomie und Mikroanatomie der Hippocampusformation
Beeinflusst Epilepsie das Gedächtnis?
 Beeinflusst Epilepsie das Gedächtnis? Klinik für Epileptologie Universität Bonn Tag der offenen Tür, 14.4.2007 EPIxxxx/x Ursachen kognitiver Störungen bei Epilepsie Strukturell nicht variabel Funktionell
Beeinflusst Epilepsie das Gedächtnis? Klinik für Epileptologie Universität Bonn Tag der offenen Tür, 14.4.2007 EPIxxxx/x Ursachen kognitiver Störungen bei Epilepsie Strukturell nicht variabel Funktionell
Junge Zellen lernen leichter: Adulte Neurogenese im Hippocampus
 Junge Zellen lernen leichter: Adulte Neurogenese im Hippocampus Prof. Dr. Josef Bischofberger Physiologisches Institut Departement Biomedizin Universität Basel Junge Zellen lernen leichter: Adulte Neurogenese
Junge Zellen lernen leichter: Adulte Neurogenese im Hippocampus Prof. Dr. Josef Bischofberger Physiologisches Institut Departement Biomedizin Universität Basel Junge Zellen lernen leichter: Adulte Neurogenese
Biologische Psychologie II
 Biologische Psychologie II Kapitel 11 Lernen, Gedä Gedächtnis und Amnesie Lernen Erfahrung verändert das Gehirn! Gedächtnis Veränderungen werden gespeichert und können später reaktiviert werden! Patienten
Biologische Psychologie II Kapitel 11 Lernen, Gedä Gedächtnis und Amnesie Lernen Erfahrung verändert das Gehirn! Gedächtnis Veränderungen werden gespeichert und können später reaktiviert werden! Patienten
Übersicht der Themen für Abschlussarbeiten im B.Sc.-Studiengang. AE 08 Klinische Neuropsychologie mit Schwerpunkt Epilepsieforschung
 Übersicht der Themen für Abschlussarbeiten im B.Sc.-Studiengang AE 08 Klinische Neuropsychologie mit Schwerpunkt Epilepsieforschung Jun.Prof. Kirsten Labudda: Thema 1: Zusammenhang zwischen subjektiven
Übersicht der Themen für Abschlussarbeiten im B.Sc.-Studiengang AE 08 Klinische Neuropsychologie mit Schwerpunkt Epilepsieforschung Jun.Prof. Kirsten Labudda: Thema 1: Zusammenhang zwischen subjektiven
neuronale Plastizität
 Neuroanatomie Forschung: Unter neuronaler Plastizität versteht man die Fähigkeit des Gehirns, seine strukturelle und funktionelle Organisation veränderten Bedingungen anzupassen. Neuronale Plastizität
Neuroanatomie Forschung: Unter neuronaler Plastizität versteht man die Fähigkeit des Gehirns, seine strukturelle und funktionelle Organisation veränderten Bedingungen anzupassen. Neuronale Plastizität
Tutorium Medizinische Psychologie SS 05 Grundlagen von Lernen und Gedächtnis
 Tutorium Medizinische Psychologie SS 05 Grundlagen von Lernen und Gedächtnis 1) Formen von Lernen und Gedächtnis 2) Anatomie 3) Physiologie: Langzeitpotenzierung Tutor: Christian Frisch Was ist Lernen?
Tutorium Medizinische Psychologie SS 05 Grundlagen von Lernen und Gedächtnis 1) Formen von Lernen und Gedächtnis 2) Anatomie 3) Physiologie: Langzeitpotenzierung Tutor: Christian Frisch Was ist Lernen?
Der Vorhersagewert des Wada Tests auf postoperative Leistungen im Verbalgedächtnis bei Patienten mit Temporallappenepilepsie
 Geisteswissenschaft Hermann Sinz Der Vorhersagewert des Wada Tests auf postoperative Leistungen im Verbalgedächtnis bei Patienten mit Temporallappenepilepsie Diplomarbeit Der Vorhersagewert des Wada Tests
Geisteswissenschaft Hermann Sinz Der Vorhersagewert des Wada Tests auf postoperative Leistungen im Verbalgedächtnis bei Patienten mit Temporallappenepilepsie Diplomarbeit Der Vorhersagewert des Wada Tests
Impaired synaptic plasticity in a rat model of tuberous sclerosis
 Impaired synaptic plasticity in a rat model of tuberous sclerosis Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Hohen Medizinischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn
Impaired synaptic plasticity in a rat model of tuberous sclerosis Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Hohen Medizinischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn
Biologische Psychologie II
 Wo sind denn nun Erinnerungen im gesunden Gehirn gespeichert? Es wurde bereits die Idee erwähnt, dass Erinnerungen im Rahmen der Strukturen gespeichert sind, die an der ursprünglichen Erfahrung beteiligt
Wo sind denn nun Erinnerungen im gesunden Gehirn gespeichert? Es wurde bereits die Idee erwähnt, dass Erinnerungen im Rahmen der Strukturen gespeichert sind, die an der ursprünglichen Erfahrung beteiligt
Zellen des Nervensystems, Zellbiologie von Neuronen I
 Zellen des Nervensystems, Zellbiologie von Neuronen I 1. Prinzipieller Aufbau eines Nervensystems 2. Zelltypen des Nervensystems 2.1 Gliazellen 2.2 Nervenzellen 3. Zellbiologie von Neuronen 3.1 Morphologische
Zellen des Nervensystems, Zellbiologie von Neuronen I 1. Prinzipieller Aufbau eines Nervensystems 2. Zelltypen des Nervensystems 2.1 Gliazellen 2.2 Nervenzellen 3. Zellbiologie von Neuronen 3.1 Morphologische
Vorlesung: Kognitive Neuropsychologie
 Vorlesung: Kognitive Neuropsychologie Do: 11-13; Geb. B21 HS http://www.neuro.psychologie.unisaarland.de/downloads.html 1 26.04. Geschichte der kognitiven Neurowissenschaft (1) 2 3.05. Funktionelle Neuroanatomie
Vorlesung: Kognitive Neuropsychologie Do: 11-13; Geb. B21 HS http://www.neuro.psychologie.unisaarland.de/downloads.html 1 26.04. Geschichte der kognitiven Neurowissenschaft (1) 2 3.05. Funktionelle Neuroanatomie
Gedächtnis. Istvan Tiringer Institut für Verhaltenswissenschaften
 Gedächtnis Istvan Tiringer Institut für Verhaltenswissenschaften Gedächtnisformen Expliziter Gedächtnisgebrauch: Gedächtnisspeicher, der Erinnerung an Fakten und Erfahrungen, die man bewusst wissen und»erklären«kann,
Gedächtnis Istvan Tiringer Institut für Verhaltenswissenschaften Gedächtnisformen Expliziter Gedächtnisgebrauch: Gedächtnisspeicher, der Erinnerung an Fakten und Erfahrungen, die man bewusst wissen und»erklären«kann,
Erinnern und Vergessen am Beispiel der Alzheimer Erkrankung
 Erinnern und Vergessen am Beispiel der Alzheimer Erkrankung Roland Brandt www.neurobiologie.uni-osnabrueck.de [password: nrblgos] Programm: Teil 1: Erinnern und Vergessen am Beispiel der Alzheimer Erkrankung
Erinnern und Vergessen am Beispiel der Alzheimer Erkrankung Roland Brandt www.neurobiologie.uni-osnabrueck.de [password: nrblgos] Programm: Teil 1: Erinnern und Vergessen am Beispiel der Alzheimer Erkrankung
Lernen und Gedächtnis: Inhaltsverzeichnis
 Bio 402 Struktur und Funktion des ZNS und der Sinnesorgane (Teil II) Lernen und Gedächtnis David Paul Wolfer Anatomisches Institut, Universität Zürich Institut für Bewegungswissenschaften und Sport, ETH
Bio 402 Struktur und Funktion des ZNS und der Sinnesorgane (Teil II) Lernen und Gedächtnis David Paul Wolfer Anatomisches Institut, Universität Zürich Institut für Bewegungswissenschaften und Sport, ETH
Mechanismen der synaptischen Plastizitaet. Andreas Frick MPI fuer Medizinische Forschung Heidelberg
 Mechanismen der synaptischen Plastizitaet Andreas Frick MPI fuer Medizinische Forschung Heidelberg Hippocampus - deklaratives Gedaechtnis Hebbsche Synapse Donald Hebb (1949): "When an axon of cell A is
Mechanismen der synaptischen Plastizitaet Andreas Frick MPI fuer Medizinische Forschung Heidelberg Hippocampus - deklaratives Gedaechtnis Hebbsche Synapse Donald Hebb (1949): "When an axon of cell A is
Lernen und Gedächnis. Was ist Gedächtnis? Explizites vs implizites Gedächtnis Anatomisches Substrat Neuronale Mechanismen Plastizität
 Lernen und Gedächnis Was ist Gedächtnis? Explizites vs implizites Gedächtnis Anatomisches Substrat Neuronale Mechanismen Plastizität Definitionen Gedächtnis bezeichnet die Information, die mehr oder weniger
Lernen und Gedächnis Was ist Gedächtnis? Explizites vs implizites Gedächtnis Anatomisches Substrat Neuronale Mechanismen Plastizität Definitionen Gedächtnis bezeichnet die Information, die mehr oder weniger
Wie lernt unser Gehirn?
 Wie lernt unser Gehirn? Einblicke in die Neurokognition des Gedächtnisses Christian Fiebach Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Psychologisches Institut Neurologische Klinik Abteilung Neuroradiologie
Wie lernt unser Gehirn? Einblicke in die Neurokognition des Gedächtnisses Christian Fiebach Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Psychologisches Institut Neurologische Klinik Abteilung Neuroradiologie
Expression und Funktion. von Neurotransmitterrezeptoren auf Astrozyten im intakten. Hirngewebe der Maus
 Expression und Funktion von Neurotransmitterrezeptoren auf Astrozyten im intakten Hirngewebe der Maus Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) von Dipl.-Biochem.
Expression und Funktion von Neurotransmitterrezeptoren auf Astrozyten im intakten Hirngewebe der Maus Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) von Dipl.-Biochem.
Vorlesung: Grundlagen der Neurobiologie (Teil des Grundmoduls Neurobiologie) Synaptische Verbindungen. R. Brandt
 Vorlesung: Grundlagen der Neurobiologie (Teil des Grundmoduls Neurobiologie) Synaptische Verbindungen R. Brandt Synaptische Verbindungen - Synapsen, Dornen und Lernen - Alzheimer Krankheit und Vergessen
Vorlesung: Grundlagen der Neurobiologie (Teil des Grundmoduls Neurobiologie) Synaptische Verbindungen R. Brandt Synaptische Verbindungen - Synapsen, Dornen und Lernen - Alzheimer Krankheit und Vergessen
Kindliche Fieberkrämpfe und ihre Auswirkung auf das Gedächtnis. Dr. Kerstin Kipp Martina Becker
 Kindliche Fieberkrämpfe und ihre Auswirkung auf das Gedächtnis Dr. Kerstin Kipp Martina Becker Das größte unerforschte Gebiet auf der Welt ist der Raum zwischen den Ohren. (William O Brien) Universität
Kindliche Fieberkrämpfe und ihre Auswirkung auf das Gedächtnis Dr. Kerstin Kipp Martina Becker Das größte unerforschte Gebiet auf der Welt ist der Raum zwischen den Ohren. (William O Brien) Universität
Reine Glückssache? Epilepsiechirurgie und ihre Chancen
 Reine Glückssache? Epilepsiechirurgie und ihre Chancen Christoph Baumgartner Karl Landsteiner Institut für Klinische Epilepsieforschung und Kognitive Neurologie 2. Neurologische Abteilung, Krankenhaus
Reine Glückssache? Epilepsiechirurgie und ihre Chancen Christoph Baumgartner Karl Landsteiner Institut für Klinische Epilepsieforschung und Kognitive Neurologie 2. Neurologische Abteilung, Krankenhaus
Biologische Psychologie II
 Letztes Mal: H.M. Mediale Temporallappenamnesie Tiermodell (Objekterkennung!) Delayed-nonmatching-to-sample-Test Hippocampusläsion bei Affen und bei Ratten Wir machen weiter mit dem Gedächtnis für Objekterkennung:
Letztes Mal: H.M. Mediale Temporallappenamnesie Tiermodell (Objekterkennung!) Delayed-nonmatching-to-sample-Test Hippocampusläsion bei Affen und bei Ratten Wir machen weiter mit dem Gedächtnis für Objekterkennung:
Die Entwicklung der Gefühle: Aspekte aus der Hirnforschung. Andreas Lüthi, Friedrich Miescher Institut, Basel
 Die Entwicklung der Gefühle: Aspekte aus der Hirnforschung Andreas Lüthi, Friedrich Miescher Institut, Basel Wie lernen wir Angst zu haben? Wie kann das Gehirn die Angst wieder loswerden? Angst und Entwicklung
Die Entwicklung der Gefühle: Aspekte aus der Hirnforschung Andreas Lüthi, Friedrich Miescher Institut, Basel Wie lernen wir Angst zu haben? Wie kann das Gehirn die Angst wieder loswerden? Angst und Entwicklung
Medizin Förderung von 2001 bis 2012 Zur Homepage
 TRR 3: Mesiale Temporallappen-Epilepsien Fachliche Zuordnung Förderung Webseite Medizin Förderung von 2001 bis 2012 Zur Homepage Projektbeschreibung Im Rahmen eines transregionalen Verbunds von Arbeitsgruppen
TRR 3: Mesiale Temporallappen-Epilepsien Fachliche Zuordnung Förderung Webseite Medizin Förderung von 2001 bis 2012 Zur Homepage Projektbeschreibung Im Rahmen eines transregionalen Verbunds von Arbeitsgruppen
Biologische Psychologie II
 Parkinson-Erkrankung: Ca. 0,5% der Bevölkerung leidet an dieser Krankheit, die bei Männern ungefähr 2,5 Mal häufiger auftritt als bei Frauen! Die Krankheit beginnt mit leichter Steifheit oder Zittern der
Parkinson-Erkrankung: Ca. 0,5% der Bevölkerung leidet an dieser Krankheit, die bei Männern ungefähr 2,5 Mal häufiger auftritt als bei Frauen! Die Krankheit beginnt mit leichter Steifheit oder Zittern der
Sprachverarbeitung und Integration von stereotypen Erwartungen bei auditiver Wahrnehmung
 Sprachen Valentina Slaveva Sprachverarbeitung und Integration von stereotypen Erwartungen bei auditiver Wahrnehmung Studienarbeit Johannes Gutenberg Universität - Mainz Department of English and Linguistics
Sprachen Valentina Slaveva Sprachverarbeitung und Integration von stereotypen Erwartungen bei auditiver Wahrnehmung Studienarbeit Johannes Gutenberg Universität - Mainz Department of English and Linguistics
Exzitatorische (erregende) Synapsen
 Exzitatorische (erregende) Synapsen Exzitatorische Neurotransmitter z.b. Glutamat Öffnung von Na+/K+ Kanälen Membran- Potential (mv) -70 Graduierte Depolarisation der subsynaptischen Membran = Erregendes
Exzitatorische (erregende) Synapsen Exzitatorische Neurotransmitter z.b. Glutamat Öffnung von Na+/K+ Kanälen Membran- Potential (mv) -70 Graduierte Depolarisation der subsynaptischen Membran = Erregendes
Funktionsprinzipien von Synapsen
 17.3.2006 Funktionsprinzipien von Synapsen Andreas Draguhn Aufbau Transmitter und präsynaptische Vesikel Postsynaptische Rezeptoren Funktion einzelner Synapsen Prinzipien der Informationsverarbeitung:
17.3.2006 Funktionsprinzipien von Synapsen Andreas Draguhn Aufbau Transmitter und präsynaptische Vesikel Postsynaptische Rezeptoren Funktion einzelner Synapsen Prinzipien der Informationsverarbeitung:
Neurobiologie des Lernens. Hebb Postulat Die synaptische Verbindung von zwei gleichzeitig erregten Zellen wird verstärkt
 Neurobiologie des Lernens Hebb Postulat 1949 Die synaptische Verbindung von zwei gleichzeitig erregten Zellen wird verstärkt Bliss & Lomo fanden 1973 langdauernde Veränderungen der synaptischen Aktivität,
Neurobiologie des Lernens Hebb Postulat 1949 Die synaptische Verbindung von zwei gleichzeitig erregten Zellen wird verstärkt Bliss & Lomo fanden 1973 langdauernde Veränderungen der synaptischen Aktivität,
Einführung in die Lernpsychologie
 Dr. Andreas Eickhorst Pädagogische Psychologie Einführung in die Lernpsychologie 1. Was ist Lernen? Gliederung 2. Reflexe, Instinkte und Reifung 3. Neurologische Grundlagen 4. Formen des Lernens Was ist
Dr. Andreas Eickhorst Pädagogische Psychologie Einführung in die Lernpsychologie 1. Was ist Lernen? Gliederung 2. Reflexe, Instinkte und Reifung 3. Neurologische Grundlagen 4. Formen des Lernens Was ist
Synaptische Verbindungen - Alzheimer
 Vorlesung: Grundlagen der Neurobiologie (Teil des Grundmoduls Neurobiologie) Synaptische Verbindungen - Alzheimer R. Brandt (Email: brandt@biologie.uni-osnabrueck.de) Synaptische Verbindungen - Synapsen,
Vorlesung: Grundlagen der Neurobiologie (Teil des Grundmoduls Neurobiologie) Synaptische Verbindungen - Alzheimer R. Brandt (Email: brandt@biologie.uni-osnabrueck.de) Synaptische Verbindungen - Synapsen,
Möglichkeiten der Anfallsvorhersage
 mögliche anfallsgenerierende Mechanismen primär epileptogenes Areal: hoch-synchronisiertes Neuronennetzwerk aber inhibitorische Umgebung Annahme: Aufbau einer "kritischen Masse" gegenwärtige (Tier-)Modelle:
mögliche anfallsgenerierende Mechanismen primär epileptogenes Areal: hoch-synchronisiertes Neuronennetzwerk aber inhibitorische Umgebung Annahme: Aufbau einer "kritischen Masse" gegenwärtige (Tier-)Modelle:
Zusammenfassung. Bei Patienten mit PAH zeigte sich in Lungengewebe eine erhöhte Expression von PAR-1 und PAR-2. Aktuelle Arbeiten weisen darauf
 Zusammenfassung Die pulmonal arterielle Hypertonie (PAH) ist eine schwerwiegende, vaskuläre Erkrankung, die mit einer hohen Sterblichkeit einhergeht. Die zugrundeliegenden Pathomechanismen sind multifaktoriell
Zusammenfassung Die pulmonal arterielle Hypertonie (PAH) ist eine schwerwiegende, vaskuläre Erkrankung, die mit einer hohen Sterblichkeit einhergeht. Die zugrundeliegenden Pathomechanismen sind multifaktoriell
Gedächtniskonsolidierung im Schlaf - Modell
 Martin Heinzerling Peter Steinke 02.07.2007 Inhaltverzeichnis Einleitung Modell Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Diskussion Autoren Autoren Szabolcs Káli Forschungsstudent am Gatsby Computational
Martin Heinzerling Peter Steinke 02.07.2007 Inhaltverzeichnis Einleitung Modell Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Diskussion Autoren Autoren Szabolcs Káli Forschungsstudent am Gatsby Computational
Entdeckungen unter der Schädeldecke. Jean-Marc Fritschy Institut für Pharmakologie und Toxikologie
 Entdeckungen unter der Schädeldecke Jean-Marc Fritschy Institut für Pharmakologie und Toxikologie Inhalt 1. GFP, das Wunderprotein 2. Die Nervenzellen bei der Arbeit beobachten 3. Nervenzellen mit Licht
Entdeckungen unter der Schädeldecke Jean-Marc Fritschy Institut für Pharmakologie und Toxikologie Inhalt 1. GFP, das Wunderprotein 2. Die Nervenzellen bei der Arbeit beobachten 3. Nervenzellen mit Licht
Gibt es den richtigen Zeitpunkt für ein zweites Cochlea-Implantat? -
 Gibt es den richtigen Zeitpunkt für ein zweites Cochlea-Implantat? - Überlegungen aus der neuropsychologischen Perspektive Martin Meyer Neuroplasticity and Learning in the Healthy Aging Brain (HAB LAB)
Gibt es den richtigen Zeitpunkt für ein zweites Cochlea-Implantat? - Überlegungen aus der neuropsychologischen Perspektive Martin Meyer Neuroplasticity and Learning in the Healthy Aging Brain (HAB LAB)
In der Gegenwart gefangen
 In der Gegenwart gefangen Henry Gustav Molaison (* 26. Februar 1926 in Manchester, Connecticut; 2. Dezember 2008 in Windsor Locks, Connecticut), auch bekannt unter der Bezeichnung HM oder H.M., war ein
In der Gegenwart gefangen Henry Gustav Molaison (* 26. Februar 1926 in Manchester, Connecticut; 2. Dezember 2008 in Windsor Locks, Connecticut), auch bekannt unter der Bezeichnung HM oder H.M., war ein
the NAcc core or shell alone, without tetanus to the PP, would have an effect on baseline values after stimulating the DG. The results for these
 MSc. John J.K. Kudolo Zusammenfassung der Dissertation Thema der Dissertation: Influence of nucleus accumbens core or shell stimulation on early long-term potentiation in the dentate gyrus of freely moving
MSc. John J.K. Kudolo Zusammenfassung der Dissertation Thema der Dissertation: Influence of nucleus accumbens core or shell stimulation on early long-term potentiation in the dentate gyrus of freely moving
Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Medizinischen Doktorgrades der Medizinischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau
 Der Effekt der epilepsiechirurgischen Behandlung auf Patienten mit fokaler Epilepsie - Untersuchungen zur Exzitabilität des motorischen Cortex mit Hilfe transcranieller Magnetstimulation Inaugural-Dissertation
Der Effekt der epilepsiechirurgischen Behandlung auf Patienten mit fokaler Epilepsie - Untersuchungen zur Exzitabilität des motorischen Cortex mit Hilfe transcranieller Magnetstimulation Inaugural-Dissertation
Erregungsübertragung an Synapsen. 1. Einleitung. 2. Schnelle synaptische Erregung. Biopsychologie WiSe Erregungsübertragung an Synapsen
 Erregungsübertragung an Synapsen 1. Einleitung 2. Schnelle synaptische Übertragung 3. Schnelle synaptische Hemmung chemische 4. Desaktivierung der synaptischen Übertragung Synapsen 5. Rezeptoren 6. Langsame
Erregungsübertragung an Synapsen 1. Einleitung 2. Schnelle synaptische Übertragung 3. Schnelle synaptische Hemmung chemische 4. Desaktivierung der synaptischen Übertragung Synapsen 5. Rezeptoren 6. Langsame
Einführung in die Lernpsychologie
 Peter Bednorz Martin Schuster Einführung in die Lernpsychologie Mit 38 Abbildungen und 8 Tabellen 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage Ernst Reinhardt Verlag München Basel Inhalt 1 Psychologie
Peter Bednorz Martin Schuster Einführung in die Lernpsychologie Mit 38 Abbildungen und 8 Tabellen 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage Ernst Reinhardt Verlag München Basel Inhalt 1 Psychologie
Seminar. LV Entwicklungswissenschaft I: Biopsychosoziale Grundlagen der Entwicklung. Gliederung. Prof. Dr. phil. Herbert Scheithauer
 Seminar Prof. Dr. phil. Herbert Scheithauer Arbeitsbereich Entwicklungswissenschaft und Angewandte Entwicklungspsychologie LV 12-526 Entwicklungswissenschaft I: Biopsychosoziale Grundlagen der Entwicklung
Seminar Prof. Dr. phil. Herbert Scheithauer Arbeitsbereich Entwicklungswissenschaft und Angewandte Entwicklungspsychologie LV 12-526 Entwicklungswissenschaft I: Biopsychosoziale Grundlagen der Entwicklung
Universitätsklinikum Bonn (AöR) Klinik für Epileptologie
 Universitätsklinikum Bonn (AöR) Klinik für Epileptologie Adresse Sigmund-Freud-Straße 25 53127 Bonn Deutschland Telefon +49 228 287-15727 Telefax +49 228 287-14328 E-Mail rosemarie.luster@ukb.uni-bonn.de
Universitätsklinikum Bonn (AöR) Klinik für Epileptologie Adresse Sigmund-Freud-Straße 25 53127 Bonn Deutschland Telefon +49 228 287-15727 Telefax +49 228 287-14328 E-Mail rosemarie.luster@ukb.uni-bonn.de
Workshop C Gedächtnis und Plastizität des Gehirns
 Neurobiologie Workshop C Gedächtnis und Plastizität des Gehirns KQ-Gruppe Biologie GY/GE Gedächtnis und Plastizität des Gehirns Gliederung Bezüge zum Kernlehrplan: Inhaltsfeld Neurobiologie Gedächtnis
Neurobiologie Workshop C Gedächtnis und Plastizität des Gehirns KQ-Gruppe Biologie GY/GE Gedächtnis und Plastizität des Gehirns Gliederung Bezüge zum Kernlehrplan: Inhaltsfeld Neurobiologie Gedächtnis
Kognitive Elektrophysiologie von Gedächtnisprozessen und -defiziten bei mesialen Temporallappen-Epilepsien
 BEL_Inhalt_2_2010_N 26.05.2010 14:33 Uhr Seite 79 Kognitive Elektrophysiologie von Gedächtnisprozessen und -defiziten bei mesialen Temporallappen-Epilepsien Thomas Grunwald, Martin Kurthen, Schweiz. Epilepsie-Zentrum,
BEL_Inhalt_2_2010_N 26.05.2010 14:33 Uhr Seite 79 Kognitive Elektrophysiologie von Gedächtnisprozessen und -defiziten bei mesialen Temporallappen-Epilepsien Thomas Grunwald, Martin Kurthen, Schweiz. Epilepsie-Zentrum,
Neurobiologische Grundlagen einfacher Formen des Lernens
 Professur für Allgemeine Psychologie Vorlesung im WS 2011/12 Lernen und Gedächtnis Neurobiologische Grundlagen einfacher Formen des Lernens Prof. Dr. Thomas Goschke Neurowissenschaftliche Gedächtnisforschung
Professur für Allgemeine Psychologie Vorlesung im WS 2011/12 Lernen und Gedächtnis Neurobiologische Grundlagen einfacher Formen des Lernens Prof. Dr. Thomas Goschke Neurowissenschaftliche Gedächtnisforschung
griechisches Wort für Gepacktwerden, Ergriffenwerden, Angefallenwerden, Anfall Fallende Sucht, Fallendes Übel, Schwere Noth, Böses Wesen
 Epilepsie griechisches Wort für Gepacktwerden, Ergriffenwerden, Angefallenwerden, Anfall andere Begriffe im deutschsprachigen Raum: Fallende Sucht, Fallendes Übel, Schwere Noth, Böses Wesen Epilepsie Geschichtliches:
Epilepsie griechisches Wort für Gepacktwerden, Ergriffenwerden, Angefallenwerden, Anfall andere Begriffe im deutschsprachigen Raum: Fallende Sucht, Fallendes Übel, Schwere Noth, Böses Wesen Epilepsie Geschichtliches:
Neue Behandlungsmöglichkeit für Patienten
 Erstmals europaweit Hirnschrittmacher gegen Epilepsie implantiert Neue Behandlungsmöglichkeit für Patienten Tübingen (26. November 2010) - Ich bin ins Büro gekommen, habe mir einen Kaffee geholt - und
Erstmals europaweit Hirnschrittmacher gegen Epilepsie implantiert Neue Behandlungsmöglichkeit für Patienten Tübingen (26. November 2010) - Ich bin ins Büro gekommen, habe mir einen Kaffee geholt - und
Einführung in die moderne Psychologie
 WZ 04 Donald O. Hebb Einführung in die moderne Psychologie Neu übersetzt nach der dritten völlig überarbeiteten Auflage von Hermann Rademacker A 015784 Landes-Lehrer-Bibliothek des Fürstentums Li2ci:tcnstsin
WZ 04 Donald O. Hebb Einführung in die moderne Psychologie Neu übersetzt nach der dritten völlig überarbeiteten Auflage von Hermann Rademacker A 015784 Landes-Lehrer-Bibliothek des Fürstentums Li2ci:tcnstsin
Lernen und Gedächtniss
 Lernen und Gedächtniss Lernen und Gedächtniss - Definitionen Explizites Gedächtniss codiert Information über eigene Situation Lebenserfahrungen und auch Sachwissen ist auf kognitive Prozesse angewiesen
Lernen und Gedächtniss Lernen und Gedächtniss - Definitionen Explizites Gedächtniss codiert Information über eigene Situation Lebenserfahrungen und auch Sachwissen ist auf kognitive Prozesse angewiesen
3.1 Oszillatorisch induzierte synaptische Plastizität in Standard- Ringer
 3 Ergebnisse Die Aktionspotentiale aller Zellen (n=136) erreichten ihr Maximum über der mv-spannungslinie. Das Ruhemembranpotential lag durchschnittlich um 73 ± 9 mv, das AP-Schwellenpotential um 4 ± 6
3 Ergebnisse Die Aktionspotentiale aller Zellen (n=136) erreichten ihr Maximum über der mv-spannungslinie. Das Ruhemembranpotential lag durchschnittlich um 73 ± 9 mv, das AP-Schwellenpotential um 4 ± 6
Dynamische Systeme in der Biologie: Beispiel Neurobiologie
 Dynamische Systeme in der Biologie: Beispiel Neurobiologie Caroline Geisler geisler@lmu.de April 18, 2018 Elektrische Ersatzschaltkreise und Messmethoden Wiederholung: Membranpotential Exkursion in die
Dynamische Systeme in der Biologie: Beispiel Neurobiologie Caroline Geisler geisler@lmu.de April 18, 2018 Elektrische Ersatzschaltkreise und Messmethoden Wiederholung: Membranpotential Exkursion in die
Epilepsie. ein Vortrag von Cara Leonie Ebert und Max Lehmann
 Epilepsie ein Vortrag von Cara Leonie Ebert und Max Lehmann Inhaltsverzeichnis Definition Epilepsie Unterschiede und Formen Ursachen Exkurs Ionenkanäle Diagnose Das Elektroenzephalogramm (EEG) Therapiemöglichkeiten
Epilepsie ein Vortrag von Cara Leonie Ebert und Max Lehmann Inhaltsverzeichnis Definition Epilepsie Unterschiede und Formen Ursachen Exkurs Ionenkanäle Diagnose Das Elektroenzephalogramm (EEG) Therapiemöglichkeiten
Hirnentwicklung in der zweiten Lebenshälfte. Institut für Kognitive Neurowissenschaft, Biopsychologie
 Hirnentwicklung in der zweiten Lebenshälfte PD Dr. Martina Manns Institut für Kognitive Neurowissenschaft, Biopsychologie Das Neuronen-Dogma: Neue Neurone werden im erwachsenen Gehirn nicht mehr gebildet
Hirnentwicklung in der zweiten Lebenshälfte PD Dr. Martina Manns Institut für Kognitive Neurowissenschaft, Biopsychologie Das Neuronen-Dogma: Neue Neurone werden im erwachsenen Gehirn nicht mehr gebildet
integrative Wahrnehmungsprozesse (multisensorisch, oft auf Erfahrung beruhend)
 Was ist Kognition? integrative Wahrnehmungsprozesse (multisensorisch, oft auf Erfahrung beruhend) Erkennen von Ereignissen; Klassifizieren von Objekten, Personen und Geschehnissen interne Repräsentationen
Was ist Kognition? integrative Wahrnehmungsprozesse (multisensorisch, oft auf Erfahrung beruhend) Erkennen von Ereignissen; Klassifizieren von Objekten, Personen und Geschehnissen interne Repräsentationen
Kulturen von humanen Nabelschnur-Endothelzellen (HUVEC) produzieren konstant Endothelin-1 (ET-1) und geben dieses in das Kulturmedium ab.
 4 ERGEBNISSE 4.1 Endothelin Kulturen von humanen Nabelschnur-Endothelzellen (HUVEC) produzieren konstant Endothelin-1 (ET-1) und geben dieses in das Kulturmedium ab. 4.1.1 Dosisabhängige Herabregulation
4 ERGEBNISSE 4.1 Endothelin Kulturen von humanen Nabelschnur-Endothelzellen (HUVEC) produzieren konstant Endothelin-1 (ET-1) und geben dieses in das Kulturmedium ab. 4.1.1 Dosisabhängige Herabregulation
Lernen im Schlaf - Neuropsychologische und neurophysiologische Mechanismen
 Lernen im Schlaf - Neuropsychologische und neurophysiologische Mechanismen Jan Born Christian Benedikt, Stoyan Dimitrov, Spyridos Drosopoulos, Horst L. Fehm, Stephan Fischer, Steffen Gais, Manfred Hallschmid,
Lernen im Schlaf - Neuropsychologische und neurophysiologische Mechanismen Jan Born Christian Benedikt, Stoyan Dimitrov, Spyridos Drosopoulos, Horst L. Fehm, Stephan Fischer, Steffen Gais, Manfred Hallschmid,
Entwicklungsamnesien. Daniela Mink, Sarah Schreiner
 Entwicklungsamnesien Daniela Mink, Sarah Schreiner Inhalt: Einführung Studie von Vargha-Khadem et al. Andere Positionen Rolle des Alters bei der Schädigung Einführung: Memory Long-term memory Short-term
Entwicklungsamnesien Daniela Mink, Sarah Schreiner Inhalt: Einführung Studie von Vargha-Khadem et al. Andere Positionen Rolle des Alters bei der Schädigung Einführung: Memory Long-term memory Short-term
Von der Synapse zum Lerneffekt
 Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/von-der-synapse-zumlerneffekt/ Von der Synapse zum Lerneffekt Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr - so
Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/von-der-synapse-zumlerneffekt/ Von der Synapse zum Lerneffekt Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr - so
Kein Hinweis für eine andere Ursache der Demenz
 die später nach ihm benannte Krankheit. Inzwischen weiß man, dass die Alzheimer-Krankheit eine sogenannte primär-neurodegenerative Hirnerkrankung ist. Das bedeutet, dass die Erkrankung direkt im Gehirn
die später nach ihm benannte Krankheit. Inzwischen weiß man, dass die Alzheimer-Krankheit eine sogenannte primär-neurodegenerative Hirnerkrankung ist. Das bedeutet, dass die Erkrankung direkt im Gehirn
Gedächtnis (Gruber T., 2018) Basiswissen Psychologie 2. Auflage. Denkanstöße durch Vertiefungsfragen
 Gedächtnis (Gruber T., 2018) Basiswissen Psychologie 2. Auflage Denkanstöße durch Vertiefungsfragen Verständnisfragen zu Kapitel 1 1. Versuchen Sie einige alltäglichen Beispiele zu finden, in denen die
Gedächtnis (Gruber T., 2018) Basiswissen Psychologie 2. Auflage Denkanstöße durch Vertiefungsfragen Verständnisfragen zu Kapitel 1 1. Versuchen Sie einige alltäglichen Beispiele zu finden, in denen die
Biologische Psychologie II Peter Walla
 Kapitel 16 Lateralisierung, Sprache und das geteilte Gehirn Das linke und das rechte Gehirn: Das menschliche Gehirn besteht aus 2 cerebralen Hemisphären, die voneinander getrennt sind, abgesehen von den
Kapitel 16 Lateralisierung, Sprache und das geteilte Gehirn Das linke und das rechte Gehirn: Das menschliche Gehirn besteht aus 2 cerebralen Hemisphären, die voneinander getrennt sind, abgesehen von den
Erfahrungsbericht zum Projekt Etablierung des Tractus-perforans-Modells der Temporallappenepilepsie an der Philipps-Universität Marburg
 Dr. med. Sebastian Bauer Klinik für Neurologie, Standort Marburg Universitätsklinikum Giessen und Marburg GmbH und Philipps-Universität Marburg Baldingerstraße 35033 Marburg Erfahrungsbericht zum Projekt
Dr. med. Sebastian Bauer Klinik für Neurologie, Standort Marburg Universitätsklinikum Giessen und Marburg GmbH und Philipps-Universität Marburg Baldingerstraße 35033 Marburg Erfahrungsbericht zum Projekt
Uli Monzel Universität des Saarlandes FR 5.3 Psychologie Seminar: Elektrophysiologie kognitiver Prozesse Dozentin: Nicola Ferdinand
 Uli Monzel Universität des Saarlandes FR 5.3 Psychologie Seminar: Elektrophysiologie kognitiver Prozesse Dozentin: Nicola Ferdinand Definition EKP Extraktion von Komponenten aus dem EEG Identifikation
Uli Monzel Universität des Saarlandes FR 5.3 Psychologie Seminar: Elektrophysiologie kognitiver Prozesse Dozentin: Nicola Ferdinand Definition EKP Extraktion von Komponenten aus dem EEG Identifikation
Ereignisse: Erinnerung und Vergessen
 Vergessen Der Selbstversuch von Ebbinghaus (~1880) Lernte 169 Listen mit je 13 sinnlosen Silben Versuchte diese Listen nach variablen Intervallen wieder zu lernen, und fand, dass offenbar ein Teil vergessen
Vergessen Der Selbstversuch von Ebbinghaus (~1880) Lernte 169 Listen mit je 13 sinnlosen Silben Versuchte diese Listen nach variablen Intervallen wieder zu lernen, und fand, dass offenbar ein Teil vergessen
Nachhaltigkeit des Lernens aus neurobiologischer Sicht
 Studienseminar Koblenz Teildienststelle Altenkirchen Nachhaltigkeit des Lernens aus neurobiologischer Sicht Wie erreichen wir aus neurobiologischer Sicht ein nachhaltiges Lernen? Unterrichtsprinzipien
Studienseminar Koblenz Teildienststelle Altenkirchen Nachhaltigkeit des Lernens aus neurobiologischer Sicht Wie erreichen wir aus neurobiologischer Sicht ein nachhaltiges Lernen? Unterrichtsprinzipien
5 DISKUSSION. 5.1 Normalwerte. 5.2 Korrelation von Hochfrequenzdämpfung und F- Chronodispersion
 5 DISKUSSION 5.1 Normalwerte Die aus der Gruppe der Kontrollen erhaltenen Werte sowie ihre Quotienten für die Nervenleitgeschwindigkeit, Amplitude, Fläche und Potentialdauer der Summenaktionspotentiale
5 DISKUSSION 5.1 Normalwerte Die aus der Gruppe der Kontrollen erhaltenen Werte sowie ihre Quotienten für die Nervenleitgeschwindigkeit, Amplitude, Fläche und Potentialdauer der Summenaktionspotentiale
Erinnern und Vergessen am Beispiel der. Alzheimer Erkrankung
 Roland Brandt Programm: Erinnern und Vergessen am Beispiel der Alzheimer Erkrankung Teil 1: Erinnern und Vergessen am Beispiel der Alzheimer Erkrankung Teil 2: Diagnose und Forschung mittels bildgebender
Roland Brandt Programm: Erinnern und Vergessen am Beispiel der Alzheimer Erkrankung Teil 1: Erinnern und Vergessen am Beispiel der Alzheimer Erkrankung Teil 2: Diagnose und Forschung mittels bildgebender
Neuropsychologische Störungen der visuellen Wahrnehmung. Vorlesung / Seminar SoSe FU Berlin
 Neuropsychologische Störungen der visuellen Wahrnehmung Vorlesung / Seminar SoSe 2007 FU Berlin 1 Gliederung: Freitag, 22.6.07 (vormittag): Visuelles System, Visuelle Basisleistungen, Gesichtsfeldstörungen
Neuropsychologische Störungen der visuellen Wahrnehmung Vorlesung / Seminar SoSe 2007 FU Berlin 1 Gliederung: Freitag, 22.6.07 (vormittag): Visuelles System, Visuelle Basisleistungen, Gesichtsfeldstörungen
Themenvorschläge für Masterarbeiten (Franz Pauls)
 Themenvorschläge für Masterarbeiten (Franz Pauls) 1. Depression und Gedächtnis: Der freie Abruf von deklarativen Gedächtnisinhalten im Vergleich zwischen Depressiven und Gesunden Beschreibung: In wissenschaftlichen
Themenvorschläge für Masterarbeiten (Franz Pauls) 1. Depression und Gedächtnis: Der freie Abruf von deklarativen Gedächtnisinhalten im Vergleich zwischen Depressiven und Gesunden Beschreibung: In wissenschaftlichen
Zusammenfassung...1. Abstract...3
 INHALTSVERZEICHNIS Zusammenfassung...1 Abstract...3 1 Einleitung...4 1.1 Die Leber...4 1.1.1 Funktion der Leber...4 1.1.2 Mikroanatomie der Leber...5 1.1.3 LSEC...6 1.1.4 Hepatozyten...6 1.1.5 Effektorfunktionen
INHALTSVERZEICHNIS Zusammenfassung...1 Abstract...3 1 Einleitung...4 1.1 Die Leber...4 1.1.1 Funktion der Leber...4 1.1.2 Mikroanatomie der Leber...5 1.1.3 LSEC...6 1.1.4 Hepatozyten...6 1.1.5 Effektorfunktionen
Bipolar Disorder (BD) Nina Stremmel, Universität zu Köln,
 Bipolar Disorder (BD) Nina Stremmel, Universität zu Köln, 07.06.18 Inhalt Allgemein Genetische Grundlagen CACNA I C, NCAN, ANK3 Neurobiologische Grundlagen Dopamin und Glutamat Behandlung Allgemein Neuropsychotische
Bipolar Disorder (BD) Nina Stremmel, Universität zu Köln, 07.06.18 Inhalt Allgemein Genetische Grundlagen CACNA I C, NCAN, ANK3 Neurobiologische Grundlagen Dopamin und Glutamat Behandlung Allgemein Neuropsychotische
Neuronale Grundlagen bei ADHD. (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) Mechanismen der Ritalinwirkung. Dr. Lutz Erik Koch
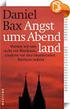 Neuronale Grundlagen bei ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) Mechanismen der Ritalinwirkung Dr. Lutz Erik Koch Die Verschreibung von Ritalin bleibt kontrovers Jeden Tag bekommen Millionen von
Neuronale Grundlagen bei ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) Mechanismen der Ritalinwirkung Dr. Lutz Erik Koch Die Verschreibung von Ritalin bleibt kontrovers Jeden Tag bekommen Millionen von
Funktionelles Neuroimaging im VS/MCS Kann man Bewusstsein sichtbar machen?
 Jahrestagung 2008 der Österreichischen Wachkoma Gesellschaft 17. Oktober 2008, Wien Funktionelles Neuroimaging im VS/MCS Kann man Bewusstsein sichtbar machen? S.M. Golaszewski Univ.-Klinik für Neurologie
Jahrestagung 2008 der Österreichischen Wachkoma Gesellschaft 17. Oktober 2008, Wien Funktionelles Neuroimaging im VS/MCS Kann man Bewusstsein sichtbar machen? S.M. Golaszewski Univ.-Klinik für Neurologie
Violent persons with schizophrenia and comorbid disorders: A functional magnetic resonance imaging study (Joyal et al., 2007)
 Violent persons with schizophrenia and comorbid disorders: A functional magnetic resonance imaging study (Joyal et al., 2007) Seminar: Forensische Neuropsychologie Referentin: Sarah Brettnacher Datum:
Violent persons with schizophrenia and comorbid disorders: A functional magnetic resonance imaging study (Joyal et al., 2007) Seminar: Forensische Neuropsychologie Referentin: Sarah Brettnacher Datum:
Die Sprache der Neurone: Lernen, Gedächtnis und Vergessen
 Die Sprache der Neurone: Lernen, Gedächtnis und Vergessen Korte, Martin Veröffentlicht in: Jahrbuch 2011 der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, S.123-132 J. Cramer Verlag, Braunschweig
Die Sprache der Neurone: Lernen, Gedächtnis und Vergessen Korte, Martin Veröffentlicht in: Jahrbuch 2011 der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, S.123-132 J. Cramer Verlag, Braunschweig
Das EEG: Spontan-EEG und EKP
 Das EEG: Spontan-EEG und EKP Biopsychologische Vertiefung Katja Bertsch Psychophysiologisches Labor Gliederung 1. EEG-Erhebung Labor Elektroden Artefakte 2. Spontan-EEG Frequenzbänder Fourier Transformation
Das EEG: Spontan-EEG und EKP Biopsychologische Vertiefung Katja Bertsch Psychophysiologisches Labor Gliederung 1. EEG-Erhebung Labor Elektroden Artefakte 2. Spontan-EEG Frequenzbänder Fourier Transformation
Sexuelle Erregung bei Pädophilen auf neuronaler Ebene
 Sexuelle Erregung bei Pädophilen auf neuronaler Ebene Pedophilia is linked to reduced activation in hypothalamus and lateral prefrontal cortex during visual erotic stimulation (Walter et al., 2007) Annika
Sexuelle Erregung bei Pädophilen auf neuronaler Ebene Pedophilia is linked to reduced activation in hypothalamus and lateral prefrontal cortex during visual erotic stimulation (Walter et al., 2007) Annika
Zusammenfassung in deutscher Sprache
 Zusammenfassung in deutscher Sprache Zusammenfassung Man schätzt, dass in den Niederlanden einer von 200 Erwachsenen (=60.000) eine verborgene Nierenschädigung hat. Ungefähr 40.000 Menschen sind bekennt
Zusammenfassung in deutscher Sprache Zusammenfassung Man schätzt, dass in den Niederlanden einer von 200 Erwachsenen (=60.000) eine verborgene Nierenschädigung hat. Ungefähr 40.000 Menschen sind bekennt
Zwei Modelle retinaler Verarbeitung
 Zwei Modelle retinaler Verarbeitung 8.1.2006 http://www.uni-oldenburg.de/sinnesphysiologie/15247.html Vorlesungsprogramm 17.10.05 Motivation 24.10.05 Passive Eigenschaften von Neuronen 31.10.05 Räumliche
Zwei Modelle retinaler Verarbeitung 8.1.2006 http://www.uni-oldenburg.de/sinnesphysiologie/15247.html Vorlesungsprogramm 17.10.05 Motivation 24.10.05 Passive Eigenschaften von Neuronen 31.10.05 Räumliche
Erinnern, Vergessen und die Alzheimer Erkrankung
 Erinnern, Vergessen und die Alzheimer Erkrankung Roland Brandt www.neurobiologie.uni-osnabrueck.de Lehrmaterial [password: nrblgos] Neurobiologie macht Schule Alzheimer Erkrankung / Brandt / 2 Programm:
Erinnern, Vergessen und die Alzheimer Erkrankung Roland Brandt www.neurobiologie.uni-osnabrueck.de Lehrmaterial [password: nrblgos] Neurobiologie macht Schule Alzheimer Erkrankung / Brandt / 2 Programm:
Einstieg: Drogen und Glück
 Einstieg: Drogen und Glück Heroin ist ein synthetisches Morphin. Morphin ist Bestandteil von Opium, welches aus Schlafmohn gewonnen wird. Die euphorisierende und schmerzlindernde Wirkung beruht auf dem
Einstieg: Drogen und Glück Heroin ist ein synthetisches Morphin. Morphin ist Bestandteil von Opium, welches aus Schlafmohn gewonnen wird. Die euphorisierende und schmerzlindernde Wirkung beruht auf dem
Neuronale Kodierung sensorischer Reize. Computational Neuroscience Jutta Kretzberg
 Neuronale Kodierung sensorischer Reize Computational Neuroscience 30.10.2006 Jutta Kretzberg (Vorläufiges) Vorlesungsprogramm 23.10.06!! Motivation 30.10.06!! Neuronale Kodierung sensorischer Reize 06.11.06!!
Neuronale Kodierung sensorischer Reize Computational Neuroscience 30.10.2006 Jutta Kretzberg (Vorläufiges) Vorlesungsprogramm 23.10.06!! Motivation 30.10.06!! Neuronale Kodierung sensorischer Reize 06.11.06!!
Kognitives Training mit sensorischer Stimulation bei leichter bis mittelschwerer Alzheimer-Demenz
 Direktor der Klinik: Univ.-Prof. Dr. G.R. Fink Telefon: (+49) 0221/478-4000 Fax: (+49) 0221/478-7005 www.neurologie.koeln Klinikum der Universität zu Köln (AöR) Klinik und Poliklinik für Neurologie 50924
Direktor der Klinik: Univ.-Prof. Dr. G.R. Fink Telefon: (+49) 0221/478-4000 Fax: (+49) 0221/478-7005 www.neurologie.koeln Klinikum der Universität zu Köln (AöR) Klinik und Poliklinik für Neurologie 50924
Physiologische Messungen am Gehirn bei bewussten und unbewussten Wahrnehmungen. André Rupp Sektion Biomagnetismus Neurologische Universitätsklinik
 Physiologische Messungen am Gehirn bei bewussten und unbewussten Wahrnehmungen André Rupp Sektion Biomagnetismus Neurologische Universitätsklinik Elektroenzephalographie - EEG Gliederung 1. Methodik -
Physiologische Messungen am Gehirn bei bewussten und unbewussten Wahrnehmungen André Rupp Sektion Biomagnetismus Neurologische Universitätsklinik Elektroenzephalographie - EEG Gliederung 1. Methodik -
Wie funktioniert der Wada Test und was lässt sich mit ihm untersuchen?
 Wie funktioniert der Wada Test und was lässt sich mit ihm untersuchen? Was versteht man unter cross cuing? Schildern Sie ein Beispiel. Theorien der cerebralen Asymmetrie Analytisch-synthetische Theorie
Wie funktioniert der Wada Test und was lässt sich mit ihm untersuchen? Was versteht man unter cross cuing? Schildern Sie ein Beispiel. Theorien der cerebralen Asymmetrie Analytisch-synthetische Theorie
Der Hirnschrittmacher neue Wege der Therapie durch Hirnstimulation. A. Schulze-Bonhage Epilepsiezentrum Feiburg
 Der Hirnschrittmacher neue Wege der Therapie durch Hirnstimulation A. Schulze-Bonhage Epilepsiezentrum Feiburg Warum das Hirn stimulieren? Epileptische Anfälle sind charakterisiert durch abnorme Synchronisation
Der Hirnschrittmacher neue Wege der Therapie durch Hirnstimulation A. Schulze-Bonhage Epilepsiezentrum Feiburg Warum das Hirn stimulieren? Epileptische Anfälle sind charakterisiert durch abnorme Synchronisation
Das autobiographische Gedächtnis
 Das autobiographische Gedächtnis Hirnorganische Grundlagen und biosoziale Entwicklung Klett-Cotta Inhalt Bereich I Das Gedächtnis aus interdisziplinärer Sicht 1 Eine neue Betrachtungsweise des Gedächtnisses
Das autobiographische Gedächtnis Hirnorganische Grundlagen und biosoziale Entwicklung Klett-Cotta Inhalt Bereich I Das Gedächtnis aus interdisziplinärer Sicht 1 Eine neue Betrachtungsweise des Gedächtnisses
Ereigniskorrelierte Hirnpotentiale - eine (kleine) Einführung -
 Ereigniskorrelierte Hirnpotentiale - eine (kleine) Einführung - 11.12.2003 Gregor Kohls Neurolinguistisches Labor Freiburg Gliederung Grundlegendes zum Elektroenzephalogramm (kurz EEG) Was sind Ereigniskorrelierte
Ereigniskorrelierte Hirnpotentiale - eine (kleine) Einführung - 11.12.2003 Gregor Kohls Neurolinguistisches Labor Freiburg Gliederung Grundlegendes zum Elektroenzephalogramm (kurz EEG) Was sind Ereigniskorrelierte
Vorlesung: Kognitive Neuropsychologie
 Vorlesung: Kognitive Neuropsychologie Do: 11-13; Geb. B21 HS http://www.neuro.psychologie.unisaarland.de/downloads.html 1 26.04. Geschichte der kognitiven Neurowissenschaft (1) 2 3.05. Funktionelle Neuroanatomie
Vorlesung: Kognitive Neuropsychologie Do: 11-13; Geb. B21 HS http://www.neuro.psychologie.unisaarland.de/downloads.html 1 26.04. Geschichte der kognitiven Neurowissenschaft (1) 2 3.05. Funktionelle Neuroanatomie
Erinnern & Vergessen
 Vorlesung Medizinische Psychologie SS 2005 Erinnern & Vergessen Bitte lesen Sie folgenden Text: Der Erbe einer großen Schnellimbißkette war in Schwierigkeiten. Er hatte eine reizende junge Frau geheiratet,
Vorlesung Medizinische Psychologie SS 2005 Erinnern & Vergessen Bitte lesen Sie folgenden Text: Der Erbe einer großen Schnellimbißkette war in Schwierigkeiten. Er hatte eine reizende junge Frau geheiratet,
Erinnern und Vergessen: Wie funktioniert unser Gedächtnis? PD Dr. Thomas Schmidt
 Erinnern und Vergessen: Wie funktioniert unser Gedächtnis? PD Dr. Thomas Schmidt Uni Gießen, Abteilung Allgemeine Psychologie 1 http://www.allpsych.uni-giessen.de/thomas Zeitliche Spezialisierung von Gedächtnisspeichern
Erinnern und Vergessen: Wie funktioniert unser Gedächtnis? PD Dr. Thomas Schmidt Uni Gießen, Abteilung Allgemeine Psychologie 1 http://www.allpsych.uni-giessen.de/thomas Zeitliche Spezialisierung von Gedächtnisspeichern
Zur pädagogischen Relevanz neurowissenschaftlicher Erkenntnisse ein Überblick über die Debatte
 Zur pädagogischen Relevanz neurowissenschaftlicher Erkenntnisse ein Überblick über die Debatte Vortrag im Rahmen der Tagung Wer ruft, wenn sich das Gewissen meldet? an der Evangelischen Akademie im Rheinland
Zur pädagogischen Relevanz neurowissenschaftlicher Erkenntnisse ein Überblick über die Debatte Vortrag im Rahmen der Tagung Wer ruft, wenn sich das Gewissen meldet? an der Evangelischen Akademie im Rheinland
Inhalt. Vorwort zur deutschen Übersetzung. Vorwort zur fünften amerikanischen Auflage. Einführung 1
 Inhalt Vorwort zur deutschen Übersetzung Vorwort zur fünften amerikanischen Auflage XI XV Einführung 1 Teil I: Die Entdeckung der Hemisphärenasymmetrie: Befunde aus der Klinik 5 1. Hirnschädigungen und
Inhalt Vorwort zur deutschen Übersetzung Vorwort zur fünften amerikanischen Auflage XI XV Einführung 1 Teil I: Die Entdeckung der Hemisphärenasymmetrie: Befunde aus der Klinik 5 1. Hirnschädigungen und
postsynaptische Potentiale graduierte Potentiale
 postsynaptische Potentiale graduierte Potentiale Postsynaptische Potentiale veraendern graduierte Potentiale aund, wenn diese Aenderungen das Ruhepotential zum Schwellenpotential hin anheben, dann entsteht
postsynaptische Potentiale graduierte Potentiale Postsynaptische Potentiale veraendern graduierte Potentiale aund, wenn diese Aenderungen das Ruhepotential zum Schwellenpotential hin anheben, dann entsteht
Präfrontalkortex & Sucht: Jugendalter im Fokus
 Präfrontalkortex & Sucht: Jugendalter im Fokus KAP-plus Veranstaltung Fachverband Sucht 19.9.2017 Dr. phil. Maria Stein Überblick Einleitung: Sucht und Gehirn * das Gehirn * Neurowissenschaftliche Sicht
Präfrontalkortex & Sucht: Jugendalter im Fokus KAP-plus Veranstaltung Fachverband Sucht 19.9.2017 Dr. phil. Maria Stein Überblick Einleitung: Sucht und Gehirn * das Gehirn * Neurowissenschaftliche Sicht
Gedächtnis. Dr. phil. Esther Studer-Eichenberger. Lernziele
 Gedächtnis Dr. phil. Esther Studer-Eichenberger Lernziele Kenntnisse der zeitlichen, prozessbedingten und systemischen Gedächtnisklassifikationen Kenntnisse der Gedächtnisfunktionen und - störungen Kenntnisse
Gedächtnis Dr. phil. Esther Studer-Eichenberger Lernziele Kenntnisse der zeitlichen, prozessbedingten und systemischen Gedächtnisklassifikationen Kenntnisse der Gedächtnisfunktionen und - störungen Kenntnisse
LERNEN UND VERGESSEN. Woche des Gehirns Ao.Univ.Prof.Dr.Mag. Margarete Delazer
 LERNEN UND VERGESSEN Woche des Gehirns 2014 Ao.Univ.Prof.Dr.Mag. Margarete Delazer Lernen und Vergessen - aus der Perspektive der Neuropsychologie Was ist Gedächtnis? Wie kommt es zu Gedächtnisstörungen?
LERNEN UND VERGESSEN Woche des Gehirns 2014 Ao.Univ.Prof.Dr.Mag. Margarete Delazer Lernen und Vergessen - aus der Perspektive der Neuropsychologie Was ist Gedächtnis? Wie kommt es zu Gedächtnisstörungen?
