FACHHOCHSCHULE WEDEL Seminararbeit
|
|
|
- Insa Simen
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 FACHHOCHSCHULE WEDEL Seminararbeit In der Fachrichtung Wirtschaftsinformatik Thema: XML und Datenbanken Eingereicht von: Simon Temp (Mat.-Nr. 4684) Guipavasring Barsbüttel Telefon (040) Mobil: Erarbeitet im: 10. Semester Abgegeben am: Referent: Prof. Dr. Sebastian Iwanowski Fachhochschule Wedel Feldstraße Wedel Telefon (04103)
2 INHALTSVERZEICHNIS 1 PROBLEMSTELLUNG - VORWORT VERGLEICH VON XML UND RELATIONALEN DATENBANKEN INTEGRATIONSARCHITEKTUR FÜR XML UND RELATIONALER DATENBANKEN INTEGRATIONSSTRATEGIE VON XML MIT RELATIONALEN DATENBANKEN MAPPING VON XML UND RELATIONALEN DATEN HERSTELLERUNTERSTÜTZUNG VON XML IN DATENBANKEN NATIVE XML-DATENBANKEN SCHLUSSWORT LITERATURVERZEICHNIS
3 ABBILDUNGSVERZEICHNIS Abbildung 1 XML-Dokumente gespeichert in RDBMS Abbildung 2 XML-Dokumente und Schemata gespeichert in RDBMS Abbildung 3 XML-Dokumente fragmentiert gespeichert in RDBMS Abbildung 4 XML-Dokumente und Schemata fragmentiert gespeichert in RDBMS Abbildung 5 DB Daten werden als XML-Dokumente geliefert Abbildung 6 Relationale Daten werden gemappt Abbildung 7 XML-Daten sind im Speicher zwischengespeichert Abbildung 8 Bear Sigthings Datenbank Abbildung 9 Elementzentrierte Darstellung Abbildung 10 Attributzentrierte Darstellung Abbildung 11 XML-Dokument mit ID and IDREF Abbildung 12 XML-Dokument mit ID and IDREF Abbildung 13 Vordefinierte Typen in XSD Abbildung 14 XML-Tools von Datenbankherstellern Abbildung 15 Unterschiede in der XML-Unterstützung der Datenbankherstellern
4 1 Problemstellung - Vorwort XML (Extensible Markup Language) hat in den letzten hren immer mehr an Bedeutung gewonnen und ist in der heutigen Zeit als universelles Austauschformat nicht mehr zu vernachlässigen. XML ist zu einem Standardformat für die Repräsentation von strukturierten, als auch unstrukturierten Daten, geworden. Daher stellt sich die Frage, ob nicht auch relationale Datenbanken verwendet werden können, um XML zu speichern. Ziel dieser Seminararbeit ist es nicht, dem Leser zur Implementierung eines XML-Speichersystems zu befähigen, sondern es werden Integrationsbeispiele gezeigt und Modelle vorgestellt, um XML-Daten auf Datenbanken abzubilden und um bereits bestehende Datenbankinhalte mit XML zu repräsentieren. Die Seminararbeit hält sich zum größten Teil an Thomas Erl, der in seinem Buch Service-Oriented Architecture A Field Guide to Integrating XML and Web Services im Kapitel sieben sich mit diesem Thema beschäftigt. Sollten andere Behauptungen aufgestellt werden, sind entsprechende Quellenangaben vorhanden. 4
5 2 Vergleich von XML und relationalen Datenbanken Die XML- und relationale Datenbank-Technologien unterscheiden sich wesentlich voneinander. Um XML besser in eine relationale Datenbank zu integrieren, werden diese unterschiedlichen Merkmale zuvor kurz erläutert. Während Datenbanken, die Daten in einer kontrollierten Speicherumgebung sichern, erfolgt die Speicherung bei der XML-Technologie ausschließlich als reine Textdatei. Dadurch muss die Sicherheit beim XML auf Datei und Verzeichnisebene durch die eigene Anwendung implementiert werden. Bedeutende Unterschiede liegen in der Repräsentation der Daten. Das Datenmodell einer Datenbank beruht auf tabellarischen Instanzen mit Zeilen und Spalten. Ein XML-Dokument ist dagegen hierarchisch aufgebaut und beinhaltet eine Dokumentenstruktur mit Elementen und Attributknoten. Die umfangreiche Typendefinition einer Datenbank kann XML nur mit Hilfe von XSD (XML-Schema-Definition) liefern. Die Beziehungen zwischen den Elementen können bei XML durch deren Struktur selber vorliegen, oder durch ein Schema definiert werden. Die Datenbank stellte die Beziehungen durch die DDL (Date Definition Language) da, die innerhalb von Tabellen oder zwischen den Tabellen bestehen können. Eine der grundlegenden Eigenschaft einer Datenbank ist die Plausibilität und Integrität der Daten. Die Integrität der Daten wird in der Datenbank durch Beziehungsbedingungen, sowie die Fähigkeit von Änderungen, die in Beziehung stehen, über kaskardierende Löschungen oder Updates sichergestellt. Die Plausibilität der Daten können durch gespeicherte Prozeduren und Trigger bei Datenbanken unterstützt werden. XML kann diese Plausibilität z.b. nur mit einem XSD Schema realisieren. Bei der Integritätsprüfung müssen derartige Schemata ebenfalls eingesetzt werden und können meist nur simuliert werden. Es entspricht nicht dem Umfang einer Datenbank. Die Suche von Daten in der Datenbank wird durch die Indexierung unterstützt, die anpassbar auf das Spaltenniveau ist und auch für bestimmte 5
6 Sucheigenschaften optimiert werden kann. Als Anfragesprache hat sich in der relationalen Datenbankwelt der industrielle Standard SQL durchgesetzt, der von Datenbankherstellern teilweise properitär erweitert wird. Eine Indexierung wird von XML selber nicht angeboten und muss, wenn benötigt, von der eigenen Anwendung erzeugt und gewartet werden. Bei der Abfragesprache gibt es eine Menge an Auswahlmöglichkeiten. XQuery für XML ist mit SQL zum Vergleich. 6
7 3 Integrationsarchitektur für XML und relationaler Datenbanken Für die Integrationsarchitektur von XML und Datenbanken gibt es keinen Standard, an den sich gehalten werden kann. Bevor nach einer Möglichkeit gesucht wird, müssen einige Punkte nach Thomas Erl beantwortet werden. Dazu gehört das klare Verständnis, warum und wie XML in die Anwendung eingebunden ist oder werden soll, falls noch keine Anwendung vorhanden ist. Weiterhin muss dargestellt werden, wie und wo die XML-Daten manipuliert werden und wie diese Daten in der Datenbank vorhanden sind. Erst nachdem diese Fragen beantwortet sind, ist die Wahl einer Integrationsstrategie möglich und sinnvoll. Thomas Erl stellt in seinem Buch Möglichkeiten für die Integration vor, die keinen Anspruch haben, jegliche Eventualitäten abzudecken und gegebenenfalls angepasst werden müssen. Sie unterscheiden sich in Ihrer Art der Speicherung der Daten und dem Zeitpunkt der Erstellung der XML- Dokumente, sowie dem Speicherort der entsprechenden XML-Schemata. Am wenigsten wird das Datenmodell einer bereits existierenden, relationalen Datenbank beeinflusst, wenn die XML-Dokumente in separaten Tabellen abgespeichert werden, die keine Beziehungen zwischen den XML-Daten und den bestehenden Daten des Modells aufweisen. Dafür reichen einspaltige Tabellen, die in einem allgemeinen Datentyp mit langer Zeichenkette, z.b. CLOB (DB2) oder VARCHAR, das gesamte XML-Dokument abspeichern (siehe Abbildung 1). Dies bezeichnet man auch als opake Speicherung1. Aus diesem Grund entfällt auch das Mapping zwischen dem XML-Dokument und der Datenbank, was später im Kapitel 5 erläutert wird. 1 Schöning, H.: XML und Datenbanken ; München: Carl Hanser Verlag, 2003, S
8 Abbildung 1 XML-Dokumente gespeichert in RDBMS Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, die Daten nicht in einem einzelnen XML- Dokument abzuspeichern, sondern in kleine Fragmentteile, die dynamisch zusammengestellt werden können (siehe Abbildung 3). Abbildung 2 XML-Dokumente und Schemata gespeichert in RDBMS Die Daten sind durch diese Techniken redundant in der Datenbank abgespeichert, und es muss für eine Synchronisation zwischen den Datenbankdaten und dem XML-Dokument gesorgt werden. 8
9 Änderungsoperationen betreffen das gesamte Dokument, das dafür ebenfalls komplett ausgetauscht werden muss 2. Probleme ergeben sich bei einer Anfrage, die sich auf die XML-Daten beziehen, da hier nur eine Volltextsuche auf dem XML-Dokument oder Fragmentteil möglich ist, die langsam und meistens nicht zwischen XML- Daten und Markierungen unterscheiden kann. Ebenfalls lassen sich werteorientierte und strukturierte Anfragen nicht beantworten 3. Für die Sicherheit, bezüglich des Zugriffsrechtes auf die Daten, ergeben sich auch Einschränkungen bei diesem Verfahren. Bei der opaken Speicherung gibt es nur die Möglichkeit, die Zugriffsrechte auf die Daten der Dokumentebene vom RDBMS zu überwachen, nicht aber auf einer kleineren Ebene, wie knotenspezifische Zugriffsrechte 4. Bei diesem Ansatz der opaken Speicherung weist das aktuelle Datenmodell keine Datengleichheit mehr auf. Das zugehörige Schema kann entweder auf der Datenbankseite zum entsprechenden XML-Dokument abgespeichert (siehe Abbildung 4 und 2), oder auf der Anwenderseite zur Laufzeit eingebunden werden. Abbildung 3 XML-Dokumente fragmentiert gespeichert in RDBMS 2 Schöning, (FN 1), S Schöning, (FN 1), S Schöning, (FN 1), S
10 Abbildung 4 XML-Dokumente und Schemata fragmentiert gespeichert in RDBMS Einige RDBMS Hersteller bieten properitäre XML-Erweiterungen an, mit denen die bestehenden Datenbankdaten in ein XML-Format gebracht werden können. Dieses bezeichnet man auch als XML publishing oder wrapping, da die Datenbankdaten in XML-Markierungen verpackt werden 5. Dadurch ist es möglich, aus Anfragesichten dynamisch ein XML-Dokument zu erstellen, das auf der Anwenderseite durch ein entsprechendes Schema noch validiert werden kann (siehe Abbildung 5). 5 Schöning, (FN 1), S
11 Abbildung 5 DB Daten werden als XML-Dokumente geliefert Durch die Unterstützung, die die Datenbankhersteller zur Verfügung stellen, ist dieser Ansatz leicht zu implementieren und beeinträchtig das vorhandene Datenbankschema ebenfalls nicht. Komplexer ist der Ansatz der inhaltsorientierten Zerlegung, indem die relationale Datenbankstruktur in eine XML-Struktur umgesetzt wird und umgekehrt. Diese Technik wird oft als shredding bezeichnet 6. Diese Integrationsart erfordert ein Mapping der Struktur (siehe Kapitel 5 und Abbildung 6), auf dem auch der Fokus liegt. Als XML-Struktur eignet sich jedoch nur eine datenorientierte Struktur, deren Schema im Vorfelde bekannt ist, da sich ein gemischter Inhalt eines XML-Dokumentes nicht abbilden lässt 7. Die originalgetreue Struktur kann bei diesem Verfahren nicht garantiert werden 8. 6 Schöning, (FN 1), S Schöning, (FN 1), S Schöning, (FN 1), S
12 Abbildung 6 Relationale Daten werden gemappt Es wird eine hohe Abstraktion von der Datenbank erreicht. Es ermöglicht das Erstellen von XML-Dokumenten, die nur Teilausschnitte der vorhandenen Daten repräsentieren. Die Architektur gestattet das Einfügen und Aktualisieren von Daten in die Datenbank durch XML-Dokumente. XML kann die Performance der Anwendung steigern, indem die benötigten relationalen Daten im XML-Format zwischengespeichert werden. Dies gelingt jedoch nur bei sehr statischen Inhalten. Für diese Caching-Strategie wird eine IMDB Komponente (in-memory database) auf der Anwenderseite integriert (siehe Abbildung 7). Da die Daten jedoch nur im flüchtigen Speicher zwischengespeichert sind, verliert diese Architektur an Robustheit. Dieser Ansatz einer IMDB Komponente kann mit den anderen Architekturmöglichkeiten kombiniert werden. 12
13 Abbildung 7 XML-Daten sind im Speicher zwischengespeichert 13
14 4 Integrationsstrategie von XML mit relationalen Datenbanken Da das Senden von Informationen Bandbreite in Anspruch nimmt und das Verpacken der Daten in XML-Markierungen Rechenzeit benötigt, ist der wichtigste Aspekt einer Integrationsstrategie, dass nur benötigte Daten betrachtet werden. Somit sollte das Datenmodell auf der XML-Seite möglichst klein gehalten werden. Es empfiehlt sich ebenfalls auf der Datenbankseite möglichst mit virtuellen Sichten zu arbeiten, die die erforderlichen Daten entsprechend zur Verfügung stellen, anstatt die Informationen immer über die Tabellenbeziehungen neu zu generieren. Dies ist nur möglich, wenn immer die gleiche Zusammenstellung der Informationen benötigt wird. Durch diese virtuellen Sichten lassen sich zusätzlich auch bei einem bestehenden Datenbankmodell neue Spaltennamen für die Sicht vergeben. Dadurch werden die erstellten XML- Dokumente selbstbeschreibender und die XML-Markierungen werden von einigen Datenbankerweiterungen on demand optimiert. Die virtuellen Sichten unterstützen in den meisten Fällen nur lesenden Zugriff, so dass ein Einfügen oder Aktualisieren nicht realisierbar ist. Sollte noch kein Datenbankmodell vorhanden sein, kann ein XML freundliches Modell geplant werden. Hierzu muss folgendes beachtet werden. Im Datenbankmodell sollte möglichst auf zu zahlreiche Beziehungen verzichtet werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Datenbankmodell dadurch eingeschränkt wird. Es ist jedoch wesentlich einfacher, Datenbank und XML-Daten zu mappen, wenn das Modell weniger Beziehungen beinhaltet. Zusätzlich sollte eine Tabelle im Modell angelegt werden, in dem ganze Dokumente gespeichert werden können (z.b. CLOB, VARCHAR). Diese Daten sind zwar redundant, die Datenbank stellt möglicherweise eine automatisierte Funktion zum Synchronisieren durch Speicherprozeduren, Tigger oder anderen Techniken zur Verfügung. Es sollte vermieden werden, zusammengesetzte Schlüssel im Datenbankmodell zu verwenden. Die Schematechnik XSD unterstützt 14
15 allerdings derartige Schlüsselbildung. Beim Einsatz der DTD Technik ist diese nicht möglich. Gültigkeitsüberprüfungen sollten nicht fest in der Anwendung implementiert werden. Dies passiert häufig, wenn die Verweis-Integrität sichergestellt werden soll. Dies ist allerdings die Aufgabe des Schemas und sollte es auch bleiben. Die XSD Schematechnik unterstützt ein dynamisches Einbinden von Prozessregeln durch den appinfo Typen, der zur Verfügung gestellt wird und eine Art Kommentar ist. Diese Technik der Gültigkeitsprüfung kann komplett in ein eigenes XSD Schema ausgelagert werden und muss nicht im entsprechenden Schema stehen. Somit lassen sich dynamisch zur Laufzeit die entsprechenden Regeln zusammenstellen, da ein XSD Schema selbst ein XML-Dokument ist und somit den gleichen Regeln unterliegt. Dies bedeutet, dass Anfragesprachen wie XQuery ebenfalls bei XSD greifen. Dies gilt natürlich nicht nur für das XSD Schema mit dem Inhalt des appinfo, sondern ebenfalls für das eigentliche Schema. XML Dokumente zur Laufzeit zu generieren ist eine prozessorintensive Aufgabe und kann durch Caching-Strategien reduziert werden. In Kapitel 2 wurde eine IMDB Komponente vorgestellt, die in betracht gezogen werden sollte, oder zumindest über andere Caching-Verfahren. Dies ist jedoch nur bei statischen Daten sinnvoll, wie z.b. Statusreporte oder Sitzungsinformationen. Da die Suchanfragen in XML-Dokumenten wesentlich langsamer sind, gegenüber Datenbankanfragen, sollten die Daten vor dem wrapping entsprechend gefiltert werden. Sollte im Vorfeld nicht klar sein, welche Daten benötigt werden, muss darauf geachtet werden, die XML-Dokumente möglichst klein zu modellieren. 15
16 5 Mapping von XML und relationalen Daten Wie schon in Kapitel 2 beschrieben, gehört die Integrationstechnik zu den aufwendigsten und wird in diesem Kapitel genauer erläutert. Es wird vom folgenden Datenmodell ausgegangen, in dem Camp- Informationen abgespeichert werden und Bären, die in diesen Camps gesichtet wurden. Es besteht eine 1:n Beziehung. MiningCamp ID Company Region one many Bear Species Cubs Nickname ThreatLevel CampID Abbildung 8 Bear Sigthings Datenbank Der hierarchische Aufbau eines XML-Dokumentes erlaubt das einfache Abbilden einer 1:1 oder 1:n Beziehung, durch das Anordnen von Kindelementen innerhalb eines Elternelementes. 16
17 one MiningCamp ID Company Region one <BearSigthings> <MiningCamp> <Company>YukonGoldMining.com</Company> <Region>Highet Creek</Region> many Bear Species Cubs Nickname ThreatLevel CampID many <Bear> <Species>Black</Species> <Cubs>2</Cubs> <Nickname>Cub Scout</Nickname> <ThreatLevel>6</ThreatLevel> </Bear> <Bear> <Species>Grizzly</Species> <Nickname>Beartuzzi</Nickname> <ThreatLevel>9</ThreatLevel> </Bear> </MiningCamp> </BearSigthings> Abbildung 9 Elementzentrierte Darstellung Die Abbildung 9 zeigt dies entsprechend als elementzentrierte Darstellung, in der Tabellenzeilen durch Kindelemente repräsentiert werden. Ein XML- Dokument kann die Daten aber auch in einer attributzentrierten Darstellung wiedergeben, wie das folgende Beispiel zeigt (siehe Abbildung 10). one MiningCamp ID Company Region one <BearSigthings> <MiningCamp Company= YukonGold <Bear Species = Black Cubs= 2 <Bear Species= Grizzly Nickname= </MiningCamp> </BearSigthings> Bear many many Species Cubs Nickname ThreatLevel CampID Abbildung 10 Attributzentrierte Darstellung Diese Darstellungsarten scheitern jedoch, sobald ein Kindelement nicht nur zu einem Elternelement eine Beziehung hat, sondern zu mehreren. 17
18 Für derartige Darstellungen benötigt man z.b. ein DTD oder XSD Schemata, die in der Lage sind, mit Zeigern zu operieren. Ein solches XML-Schema beschreibt schematisch die Struktur eines XML-Dokumentes, ähnlich dem eines Datenbankschemas. Es beschreibt somit den schematischen Aufbau eines XML-Dokumentes und kann eingesetzt werden, um deren Struktur zu erzwingen. Zuerst soll das DTD Schema betrachtet werden. Es kann den Wertebereich, den die Daten annehmen dürfen, beschreiben und festlegen. Das DTD stellt hierfür lediglich drei Typen zur Verfügung. Dazu gehört der Typ ANY, PCDATA und EMPTY, sodass die Typinformation der Datenbank verloren geht und nicht validiert werden kann. Eine Möglichkeit, diese Restrektion zu umgehen, ist das Einfügen der Typinformation als ein Attribut. <ThreatLevel DataType= integer >9</ThreatLevel> Dadurch würde die Information nicht verloren gehen, das ThreatLevel vom Typ Integer ist. Da dieses jedoch selbst definiert wurde und außerhalb der eigenen Umgebung nicht bekannt gemacht werden kann und wofür diese Information steht, wird davon abgeraten. Diese Lösung ist kein Standardverfahren. Ein DTD Schema kennt auch nicht den Typen NULL, welcher von Datenbanken unterstützt wird. Hierfür kann zum Beispiel ein Schlüsselwort definiert werden, wie es das nächste Beispiel zeigt. <ThreatLevel>NULL</ThreatLevel> Es kann aber auch wie folgt gelöst werden: Sollte ein Element oder Attribut nicht im XML-Dokument vorkommen, besitzt es den Wert NULL. Beide Lösungen sind hier denkbar. Primärschlüssel können in DTD durch das ID Attribut dargestellt werden, die durch die XML-Spezifikation unterstützt wird. Es ist somit möglich, ein bestimmtes Element im XML-Dokument zu identifizieren. Als Beispiel wird ein ID Attribut namens id in die MiningCamp Definition eingefügt. 18
19 <!ELEMENT MiningCamp (Company, Region, Bear*)> <!ATTLIST MiningCamp id ID #REQUIRED> Es ergeben sich jedoch für die Wahl eines Primärschlüssels folgende Restrektionen, die in einer Datenbank nicht gegeben sind. Der Schlüssel darf nicht mit einer Zahl beginnen. Das bedeutet, wenn der Schlüssel in der Datenbank als Zahl vorliegt, dieser ebenso konvertiert werden muss. Das Voranstellen des Tabellennamen oder ein Teil dessen, eignet sich hierfür. z.b: <MiningCamp ID= Camp1 > Dadurch umgeht man auch die zweite Restrektion, dass ein Schlüssel nur einmal im XML-Dokument auftreten darf. Dies ist der Fall, wenn zwei oder mehrere Tabellen im XML-Dokument mit identischen Schlüsseln abgebildet werden. Für die Fremdschlüssel gilt dies ebenso. Sie werden durch das IDREF oder IDREFS Attribut abgebildet. Diese Attribute stellen die Beziehung zu einem oder mehreren ID Attributen her. Da bei IDREFS nicht zwingend ein Mehrfachverweis besteht, bietet es sich an, auf das IDREF Attribut vollständig zu verzichten, da sich somit das Erweitern zu einem späteren Zeitpunkt einfacher gestaltet. <!ELEMENT Bear (Species, Cubs?, Nickname, ThreatLevel)> <!ATTLIST Bear CampID IDREF #REQUIRED> Wird dieses auf das Modellbeispiel angewendet, ergibt sich daraus folgendes XML-Dokument (siehe Abbildung 11). 19
20 one MiningCamp ID Company Region one <BearSigthings> <MiningCamp id= Camp1 > <Company>YukonGoldMining.com</Company> <Region>Highet Creek</Region> <Bear CampID= Camp1 > <Species>Black</Species> <Cubs>2</Cubs> <Nickname>Cub Scout</Nickname> <ThreatLevel>6</ThreatLevel> Bear many </Bear> <Bear CampID= Camp1 > Species Cubs Nickname ThreatLevel <Species>Grizzly</Species> <Nickname>Beartuzzi</Nickname> <ThreatLevel>9</ThreatLevel> </Bear> many CampID </MiningCamp> </BearSigthings> Abbildung 11 XML-Dokument mit ID and IDREF Die Beziehungen zwischen Kind- und Elternelementen werden durch Zeiger, welche die Datenbankschlüssel repräsentieren, dargestellt. In diesem Fall wird dies zusätzlich noch durch die Verschachtelung der Elemente selber abgebildet, was nun nicht mehr erforderlich ist. Dadurch lässt sich das XML- Dokument in der Struktur folgendermaßen darstellen (siehe Abbildung 12). <BearSigthings> <MiningCamp id= Camp1 > <Company>YukonGoldMining.com</Company> <Region>Highet Creek</Region> </MiningCamp> <Bear CampID= Camp1 > <Species>Black</Species> <Cubs>2</Cubs> <Nickname>Cub Scout</Nickname> <ThreatLevel>6</ThreatLevel> </Bear> <Bear CampID= Camp1 > <Species>Grizzly</Species> <Nickname>Beartuzzi</Nickname> <ThreatLevel>9</ThreatLevel> </Bear> </BearSigthings> Abbildung 12 XML-Dokument mit ID and IDREF 20
21 Das ehemalige Kindelement Bear steht jetzt in der gleichen hierarchischen Ebene, wie das MiningCamp Element, und die hierarchische Ebene stellt nicht mehr die Beziehung her. Das vollständige DTD Schema hierzu: <!ELEMENT BearSightings (MiningCamp+, Bear*)> <!ELEMENT MiningCamp (Company, Region)> <ATTLIST MiniCamp id ID #REQUIRED> <!ELEMENT Company (#PCDATA)> <!ELEMENT Region (#PCDATA)> <!ELEMENT Bear (Species, Cubs?, Nickname, ThreatLevel)> <!ATTLIST Bear CampID IDREFS #REQUIRED> <!ELEMENT Species (#PCDATA)> <!ELEMENT Cubs (#PCDATA)> <!ELEMENT Nickname (#PCDATA)> <!ELEMENT ThreatLevel (#PCDATA)> Wie zu erkennen ist, entspricht die Syntax nicht dem eines XML-Dokumentes und stellt auch keines dar. Entsprechende XML-Suchanfragen, wie XQuery lassen sich nicht auf ein DTD Schema anwenden. Dies sieht bei der Schematechnik XSD anders aus. Es ist selber ein XML- Dokument und bietet darüber hinaus noch weitere Vorteile. Es ist nicht wie DTD, auf drei Typen beschränkt, so dass die Typinformationen der Datenbank nicht verloren gehen, wie in Abbildung 13 zu sehen ist. 21
22 Abbildung 13 Vordefinierte Typen in XSD 9 Zusätzlich erlaubt es XSD eigene Typen zu definieren. Diese ermöglicht es, eine Tabelle des relationalen Modells als eigene Typen zu definieren. Die Bear Tabelle lässt sich somit wie folgt abbilden: <element name= Bear > <complextype> <attribut name= Species type= string /> <attribut name= Nickname type= string /> <attribut name= ThreatLevel type= integer /> </complextype> </element> Das Problem des NULL Wertes besteht jedoch genauso wie beim DTD Schema und muss entsprechend behandelt werden. 9 Erl, T.: Service-Oriented Architecture A Field Guide to Integrating XML and Web Services ; New Jersey: Prentice Hall PTR,
23 Referenzbeziehungen sind in XSD weiterhin zum Nachbilden von Primärschlüssel- und Fremdschlüsselbeziehungen eines relationalen Datenbankmodells möglich. Primärschlüssel werden durch key definiert, sodass sich für die MiningCamp Tabelle folgende Definition ergibt. <key name= MiningCampPrimaryKey > <selector xpath.//miningcamp /> <field xpath= PrimaryKey /> </key> Das ID Attribut ist auch in XSD bekannt, doch bietet key Vorteile. Es kann nicht nur ein Attribut als Schlüssel auftreten, sondern auch Elemente oder auch Kombinationen davon. Dies ist bei DTD nicht möglich 10. Zusätzlich kann mit den Xpath-Pfadausdrücken gearbeitet werden, um anzugeben, für welchen Pfad der Schlüssel eindeutig sein soll. Bei den Fremdschlüsseln, kann im Gegensatz zur IDREF Technik angegeben werden, auf welchen Primärschlüssel er verweist. Definiert werden Fremdschlüssel mit keyref, was am Beispiel der Bear Tabelle gezeigt wird. <keyref name= MiningCampForeignKey refer= x:miningcampprimarykey > <selector xpath.//bear /> <field xpath= ForeignKey /> </keyref> Beziehungen können in XSD anzahlmäßig mit minoccurs und maxoccurs festgelegt werden. Somit lassen sich alle Beziehungskombinationen wie 1:1, 1:n, n:1, m:n oder sogar Beziehungen wie 4:n abbilden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass XSD zum Modellieren besser geeignet ist als DTD. Es besitzt ein umfangreiches Typsystem mit der Möglichkeit, eigene Deklarationen vorzunehmen. Das Konzept der Referenzbeziehungen entspricht eher dem einer Datenbank. 10 Schöning, (FN 1), S
24 6 Herstellerunterstützung von XML in Datenbanken In diesem Kapitel wird nicht auf die einzelnen Tools (siehe Abbildung 14), die die Hersteller anbieten eingegangen, sondern allgemeiner auf die Bedeutung der properitären Erweiterungen für die Architektur selbst. Oracle SQL Server IBM DB2 XML aus Relationen lesen XSU und XSQL Servlet DAD über SQL- und RDB- Zuordnung. XML- Objektgruppen FOR XML XML in Relationen schreiben XSU und XSQL Servlet, ifs DAD über RDB- Zuordnung. XML- Objektgruppen Update Grams XML Sichten über Relationen DAD über RDB- Zuordnung. XML- Objektgruppen XDR-, XMLSchema- Annotationen Relationale Sicht über XML OpenXML Anfragen in XML- Spalten SQL Constraints, WITHIN XPath XPath Schreiben als Ganzes (CLOB oder XML-Typ) InterMedia Text, Indizierung möglich, als CLOB, XMLType und extern DAD, XML-Spalte, Indizierung über Seitentabelle, Update einzelner Elemente möglich, CLOB, XML-Typ CLOB und extern Abbildung 14 XML-Tools von Datenbankherstellern 11 Die einzelnen Hersteller gehen ihre eigenen Wege, sodass eine Standardisierung nicht vorhanden ist. Mit der Wahl des RDBMS wird gleichzeitig eine bestimmte Zugriffsmethode gewählt. SQL wird in einigen Fällen properitär erweitert, um angeben zu können, ob die Anfrage als Ergebnis, ein XML-Dokument liefern soll. Auf der einen Seite wird die Anwendung stärker an das properitäre SQL gebunden, gewinnt dadurch aber eine höhere Abstraktion zum Datenbankzugriff selbst. Durch eine Auslagerung in eine eigene Komponentenebene gelingt es der Anwendung trotzdem unabhängig vom RDBMS-Hersteller zu bleiben. Oft werden Tools oder API-Schnittstellen, die für das Transferieren von vorhanden relationalen Daten zu und nach XML-Dokumenten, angeboten. Die Vorschriften für das Mappen liegen oft in herstellerspezifischen Dateien vor und nicht im unabhängigen XSD oder XSLT Format, sodass eine Umstellung 11 Schöning, (FN 1), S
25 in andere Systeme sich als schwerer gestaltet. Die Anwendung selber wird durch die API-Schnittstelle ebenfalls an den Hersteller gebunden. Hauptproblem ist die schlechte Unterstützung von Suchanfragen auf abgespeicherten XML-Dokumenten. Es werden nicht alle Anfragesprachen für XML unterstützt. Bei der Volltextsuche auf ein gespeichertes XML-Dokument haben Datenbanken die Schwierigkeiten, Daten von Markierungen zu unterscheiden. Spezifische Herstellerunterschiede der drei meist verbreiteten Systeme ist in Abbildung 15 kurz tabellarisch dargestellt. Oracle SQL Server IBM DB2 Standardkonformität (Namensräume, XML Schema) Eingeschränkt Inhaltsorientierte Zerlegung generisch Inhaltsorientierte Zerlegung definitorisch Opake Speicherung Originaltreue Speicherung beliebiger XML Dokumente (Speicherung von rekursiven Elementen, gemischtem Inhalt, Kommentaren, Verabeitungsanweis.) Kodierungen XML-Generierung: nur UTF-8 und UCS-2 Kann für Ausgabe via HTTP gewählt werden inkonsistent Validierung (DTD oder XML Schema) Schema-Evolution möglich Offenes Inhaltsmodell möglich Speicherung schemaloser Dokumente möglich Textsuche (nur wenn ein Textindex definiert ist) (nur wenn einer der Text- Extender vorhanden ist und ein Textindex definiert ist) Direkte Web-Anbindung (reine URL-Adressierung) unvollständig gut Erweiterbarkeit Speicherungsstrukturunabhängigkeit (es gibt nur eine Speicherungsform) Abbildung 15 Unterschiede in der XML-Unterstützung der Datenbankherstellern 12 Es empfiehlt sich eine möglichst lose Verbindung zwischen der Anwendung und der herstellerspezifischen Datenbank zu entwerfen. 12 Schöning, (FN 1), S
26 7 Native XML-Datenbanken XML-Fähigkeit wird von den relationalen Datenbanken nur mit Einschränkungen angeboten. Native XML-Datenbanken (NXDB) oder auch Reine XML-Datenbanken genannt, sollen die Einschränkungen aufheben und bieten volle XML-Unterstützung an, ohne auf Datenbankfunktionalitäten zu verzichten. Oft werden derartige Datenbanksysteme nicht in Unternehmen eingesetzt, obwohl deren Umgebung XML orientiert ist. Stattdessen wird weiterhin auf die bereits bestehenden RDBMS gesetzt. Es gibt jedoch Integrationsmöglichkeiten von NXDB in die bestehende Architektur. Sie können die Performance und Sicherung der Datenintegrität in der Architektur steigern. NXDB können die XML-Dokumentenstruktur, unabhängig von ihrem Inhalt, speichern und verwalten. An diesem Punkt scheitern RDBMS mit XML- Unterstützung, da sie nicht in der Lage sind, Daten und Markierungen zu unterscheiden. Weiterer Vorteil einer NXDB ist, dass das XML-Schema (DTD, XSD, etc.) integriert wird. In RDBMS können diese auch abgespeichert (siehe Kapitel 3), die aber wie Textdaten hinterlegt werden, da unbekannt ist, dass es sich um Schemainhalte handelt. NXDB können dadurch einen Index um die Schemastruktur selbst herum aufbauen. Es ergeben sich dadurch Leistungssteigerungen bei Abfragen und Datenaufrufen. Die Schnittstelle ist in einem NXDB System XML-spezifisch, die jedoch nicht standardisiert ist. Die XML:DB-Initiative versucht hierfür einen Standard zu definieren. 13 Auch die NXDB Systeme selber unterscheiden sich untereinander sehr. 13 Schöning, (FN 1), S
27 8 Schlusswort Es wurde gezeigt, das XML und relationale Datenbanken zusammen arbeiten können. XML kann als Austauschformat zwischen Anwendung und Datenbank fungieren und wird vor allem bei Web-Services verwendet. Die relationalen Datenbankhersteller haben sich dem Thema schon angenommen und bauen die Unterstützung von Version zu Version weiter aus. 27
28 9 Literaturverzeichnis Erl, T.: Service-Oriented Architecture A Field Guide to Integrating XML and Web Services ; New Jersey: Prentice Hall PTR, 2004 Schöning, H.: XML und Datenbanken ; München: Carl Hanser Verlag, 2003 Malhotra, A., V. Biron, P.: XML Schema Part 2: Datatypes, W3C Proposed Recommendation 30 March (Visit: ) 28
Speicher in der Cloud
 Speicher in der Cloud Kostenbremse, Sicherheitsrisiko oder Basis für die unternehmensweite Kollaboration? von Cornelius Höchel-Winter 2013 ComConsult Research GmbH, Aachen 3 SYNCHRONISATION TEUFELSZEUG
Speicher in der Cloud Kostenbremse, Sicherheitsrisiko oder Basis für die unternehmensweite Kollaboration? von Cornelius Höchel-Winter 2013 ComConsult Research GmbH, Aachen 3 SYNCHRONISATION TEUFELSZEUG
Kapitel 4 Die Datenbank Kuchenbestellung Seite 1
 Kapitel 4 Die Datenbank Kuchenbestellung Seite 1 4 Die Datenbank Kuchenbestellung In diesem Kapitel werde ich die Theorie aus Kapitel 2 Die Datenbank Buchausleihe an Hand einer weiteren Datenbank Kuchenbestellung
Kapitel 4 Die Datenbank Kuchenbestellung Seite 1 4 Die Datenbank Kuchenbestellung In diesem Kapitel werde ich die Theorie aus Kapitel 2 Die Datenbank Buchausleihe an Hand einer weiteren Datenbank Kuchenbestellung
... MathML XHTML RDF
 RDF in wissenschaftlichen Bibliotheken (LQI KUXQJLQ;0/ Die extensible Markup Language [XML] ist eine Metasprache für die Definition von Markup Sprachen. Sie unterscheidet sich durch ihre Fähigkeit, Markup
RDF in wissenschaftlichen Bibliotheken (LQI KUXQJLQ;0/ Die extensible Markup Language [XML] ist eine Metasprache für die Definition von Markup Sprachen. Sie unterscheidet sich durch ihre Fähigkeit, Markup
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren
 Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
4. BEZIEHUNGEN ZWISCHEN TABELLEN
 4. BEZIEHUNGEN ZWISCHEN TABELLEN Zwischen Tabellen können in MS Access Beziehungen bestehen. Durch das Verwenden von Tabellen, die zueinander in Beziehung stehen, können Sie Folgendes erreichen: Die Größe
4. BEZIEHUNGEN ZWISCHEN TABELLEN Zwischen Tabellen können in MS Access Beziehungen bestehen. Durch das Verwenden von Tabellen, die zueinander in Beziehung stehen, können Sie Folgendes erreichen: Die Größe
XINDICE. The Apache XML Project 3.12.09. Name: J acqueline Langhorst E-Mail: blackyuriko@hotmail.de
 Name: J acqueline Langhorst E-Mail: blackyuriko@hotmail.de 3.12.09 HKInformationsverarbeitung Kurs: Datenbanken vs. MarkUp WS 09/10 Dozent: Prof. Dr. M. Thaller XINDICE The Apache XML Project Inhalt Native
Name: J acqueline Langhorst E-Mail: blackyuriko@hotmail.de 3.12.09 HKInformationsverarbeitung Kurs: Datenbanken vs. MarkUp WS 09/10 Dozent: Prof. Dr. M. Thaller XINDICE The Apache XML Project Inhalt Native
Im Original veränderbare Word-Dateien
 Objekte einer Datenbank Microsoft Access Begriffe Wegen seines Bekanntheitsgrades und der großen Verbreitung auch in Schulen wird im Folgenden eingehend auf das Programm Access von Microsoft Bezug genommen.
Objekte einer Datenbank Microsoft Access Begriffe Wegen seines Bekanntheitsgrades und der großen Verbreitung auch in Schulen wird im Folgenden eingehend auf das Programm Access von Microsoft Bezug genommen.
In diesem Thema lernen wir die Grundlagen der Datenbanken kennen und werden diese lernen einzusetzen. Access. Die Grundlagen der Datenbanken.
 In diesem Thema lernen wir die Grundlagen der Datenbanken kennen und werden diese lernen einzusetzen. Access Die Grundlagen der Datenbanken kurspc15 Inhaltsverzeichnis Access... Fehler! Textmarke nicht
In diesem Thema lernen wir die Grundlagen der Datenbanken kennen und werden diese lernen einzusetzen. Access Die Grundlagen der Datenbanken kurspc15 Inhaltsverzeichnis Access... Fehler! Textmarke nicht
AGROPLUS Buchhaltung. Daten-Server und Sicherheitskopie. Version vom 21.10.2013b
 AGROPLUS Buchhaltung Daten-Server und Sicherheitskopie Version vom 21.10.2013b 3a) Der Daten-Server Modus und der Tresor Der Daten-Server ist eine Betriebsart welche dem Nutzer eine grosse Flexibilität
AGROPLUS Buchhaltung Daten-Server und Sicherheitskopie Version vom 21.10.2013b 3a) Der Daten-Server Modus und der Tresor Der Daten-Server ist eine Betriebsart welche dem Nutzer eine grosse Flexibilität
2.5.2 Primärschlüssel
 Relationale Datenbanken 0110 01101110 01110 0110 0110 0110 01101 011 01110 0110 010 011011011 0110 01111010 01101 011011 0110 01 01110 011011101 01101 0110 010 010 0110 011011101 0101 0110 010 010 01 01101110
Relationale Datenbanken 0110 01101110 01110 0110 0110 0110 01101 011 01110 0110 010 011011011 0110 01111010 01101 011011 0110 01 01110 011011101 01101 0110 010 010 0110 011011101 0101 0110 010 010 01 01101110
Handbuch ECDL 2003 Basic Modul 5: Datenbank Grundlagen von relationalen Datenbanken
 Handbuch ECDL 2003 Basic Modul 5: Datenbank Grundlagen von relationalen Datenbanken Dateiname: ecdl5_01_00_documentation_standard.doc Speicherdatum: 14.02.2005 ECDL 2003 Basic Modul 5 Datenbank - Grundlagen
Handbuch ECDL 2003 Basic Modul 5: Datenbank Grundlagen von relationalen Datenbanken Dateiname: ecdl5_01_00_documentation_standard.doc Speicherdatum: 14.02.2005 ECDL 2003 Basic Modul 5 Datenbank - Grundlagen
WinVetpro im Betriebsmodus Laptop
 WinVetpro im Betriebsmodus Laptop Um Unterwegs Daten auf einem mobilen Gerät mit WinVetpro zu erfassen, ohne den Betrieb in der Praxis während dieser Zeit zu unterbrechen und ohne eine ständige Online
WinVetpro im Betriebsmodus Laptop Um Unterwegs Daten auf einem mobilen Gerät mit WinVetpro zu erfassen, ohne den Betrieb in der Praxis während dieser Zeit zu unterbrechen und ohne eine ständige Online
Grundzüge und Vorteile von XML-Datenbanken am Beispiel der Oracle XML DB
 Grundzüge und Vorteile von XML-Datenbanken am Beispiel der Oracle XML DB Jörg Liedtke, Oracle Consulting Vortrag zum Praxis-Seminar B bei der KIS-Fachtagung 2007, Ludwigshafen Agenda
Grundzüge und Vorteile von XML-Datenbanken am Beispiel der Oracle XML DB Jörg Liedtke, Oracle Consulting Vortrag zum Praxis-Seminar B bei der KIS-Fachtagung 2007, Ludwigshafen Agenda
etutor Benutzerhandbuch XQuery Benutzerhandbuch Georg Nitsche
 etutor Benutzerhandbuch Benutzerhandbuch XQuery Georg Nitsche Version 1.0 Stand März 2006 Versionsverlauf: Version Autor Datum Änderungen 1.0 gn 06.03.2006 Fertigstellung der ersten Version Inhaltsverzeichnis:
etutor Benutzerhandbuch Benutzerhandbuch XQuery Georg Nitsche Version 1.0 Stand März 2006 Versionsverlauf: Version Autor Datum Änderungen 1.0 gn 06.03.2006 Fertigstellung der ersten Version Inhaltsverzeichnis:
LDAP Konfiguration nach einem Update auf Version 6.3 Version 1.2 Stand: 23. Januar 2012 Copyright MATESO GmbH
 LDAP Konfiguration nach einem Update auf Version 6.3 Version 1.2 Stand: 23. Januar 2012 Copyright MATESO GmbH MATESO GmbH Daimlerstraße 7 86368 Gersthofen www.mateso.de Dieses Dokument beschreibt die Konfiguration
LDAP Konfiguration nach einem Update auf Version 6.3 Version 1.2 Stand: 23. Januar 2012 Copyright MATESO GmbH MATESO GmbH Daimlerstraße 7 86368 Gersthofen www.mateso.de Dieses Dokument beschreibt die Konfiguration
Handbuch Fischertechnik-Einzelteiltabelle V3.7.3
 Handbuch Fischertechnik-Einzelteiltabelle V3.7.3 von Markus Mack Stand: Samstag, 17. April 2004 Inhaltsverzeichnis 1. Systemvorraussetzungen...3 2. Installation und Start...3 3. Anpassen der Tabelle...3
Handbuch Fischertechnik-Einzelteiltabelle V3.7.3 von Markus Mack Stand: Samstag, 17. April 2004 Inhaltsverzeichnis 1. Systemvorraussetzungen...3 2. Installation und Start...3 3. Anpassen der Tabelle...3
Arbeiten mit UMLed und Delphi
 Arbeiten mit UMLed und Delphi Diese Anleitung soll zeigen, wie man Klassen mit dem UML ( Unified Modeling Language ) Editor UMLed erstellt, in Delphi exportiert und dort so einbindet, dass diese (bis auf
Arbeiten mit UMLed und Delphi Diese Anleitung soll zeigen, wie man Klassen mit dem UML ( Unified Modeling Language ) Editor UMLed erstellt, in Delphi exportiert und dort so einbindet, dass diese (bis auf
2. Im Admin Bereich drücken Sie bitte auf den roten Button Webseite bearbeiten, sodass Sie in den Bearbeitungsbereich Ihrer Homepage gelangen.
 Bildergalerie einfügen Wenn Sie eine Vielzahl an Bildern zu einem Thema auf Ihre Homepage stellen möchten, steht Ihnen bei Schmetterling Quadra das Modul Bildergalerie zur Verfügung. Ihre Kunden können
Bildergalerie einfügen Wenn Sie eine Vielzahl an Bildern zu einem Thema auf Ihre Homepage stellen möchten, steht Ihnen bei Schmetterling Quadra das Modul Bildergalerie zur Verfügung. Ihre Kunden können
GEONET Anleitung für Web-Autoren
 GEONET Anleitung für Web-Autoren Alfred Wassermann Universität Bayreuth Alfred.Wassermann@uni-bayreuth.de 5. Mai 1999 Inhaltsverzeichnis 1 Technische Voraussetzungen 1 2 JAVA-Programme in HTML-Seiten verwenden
GEONET Anleitung für Web-Autoren Alfred Wassermann Universität Bayreuth Alfred.Wassermann@uni-bayreuth.de 5. Mai 1999 Inhaltsverzeichnis 1 Technische Voraussetzungen 1 2 JAVA-Programme in HTML-Seiten verwenden
Fachbericht zum Thema: Anforderungen an ein Datenbanksystem
 Fachbericht zum Thema: Anforderungen an ein Datenbanksystem von André Franken 1 Inhaltsverzeichnis 1 Inhaltsverzeichnis 1 2 Einführung 2 2.1 Gründe für den Einsatz von DB-Systemen 2 2.2 Definition: Datenbank
Fachbericht zum Thema: Anforderungen an ein Datenbanksystem von André Franken 1 Inhaltsverzeichnis 1 Inhaltsverzeichnis 1 2 Einführung 2 2.1 Gründe für den Einsatz von DB-Systemen 2 2.2 Definition: Datenbank
XML und Datenbanken. Simon Temp Hamburg, 30 Nov. 2005
 XML und Datenbanken Simon Temp Hamburg, 30 Nov. 2005 Vergleich von XML und relationalen Datenbanken Integrationsarchitektur für XML und relationaler Datenbanken Integrationsstrategie von XML mit relationalen
XML und Datenbanken Simon Temp Hamburg, 30 Nov. 2005 Vergleich von XML und relationalen Datenbanken Integrationsarchitektur für XML und relationaler Datenbanken Integrationsstrategie von XML mit relationalen
Inhaltsverzeichnis Seite
 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Email mit Anhang versenden 2 1.a Email vorbereiten und zweites Fenster (Tab) öffnen. 2 1. b. Bild im Internet suchen und speichern. 3 1.c. Bild als Anlage in Email einbinden
Inhaltsverzeichnis Seite 1. Email mit Anhang versenden 2 1.a Email vorbereiten und zweites Fenster (Tab) öffnen. 2 1. b. Bild im Internet suchen und speichern. 3 1.c. Bild als Anlage in Email einbinden
Word 2010 Schnellbausteine
 WO.001, Version 1.0 02.04.2013 Kurzanleitung Word 2010 Schnellbausteine Word 2010 enthält eine umfangreiche Sammlung vordefinierter Bausteine, die sogenannten "Schnellbausteine". Neben den aus den früheren
WO.001, Version 1.0 02.04.2013 Kurzanleitung Word 2010 Schnellbausteine Word 2010 enthält eine umfangreiche Sammlung vordefinierter Bausteine, die sogenannten "Schnellbausteine". Neben den aus den früheren
Downloadfehler in DEHSt-VPSMail. Workaround zum Umgang mit einem Downloadfehler
 Downloadfehler in DEHSt-VPSMail Workaround zum Umgang mit einem Downloadfehler Downloadfehler bremen online services GmbH & Co. KG Seite 2 Inhaltsverzeichnis Vorwort...3 1 Fehlermeldung...4 2 Fehlerbeseitigung...5
Downloadfehler in DEHSt-VPSMail Workaround zum Umgang mit einem Downloadfehler Downloadfehler bremen online services GmbH & Co. KG Seite 2 Inhaltsverzeichnis Vorwort...3 1 Fehlermeldung...4 2 Fehlerbeseitigung...5
Primzahlen und RSA-Verschlüsselung
 Primzahlen und RSA-Verschlüsselung Michael Fütterer und Jonathan Zachhuber 1 Einiges zu Primzahlen Ein paar Definitionen: Wir bezeichnen mit Z die Menge der positiven und negativen ganzen Zahlen, also
Primzahlen und RSA-Verschlüsselung Michael Fütterer und Jonathan Zachhuber 1 Einiges zu Primzahlen Ein paar Definitionen: Wir bezeichnen mit Z die Menge der positiven und negativen ganzen Zahlen, also
Vorgaben und Erläuterungen zu den XML-Schemata im Bahnstromnetz
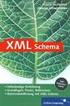 Anwendungshandbuch Vorgaben und Erläuterungen zu den XML-Schemata im Bahnstromnetz Version: 1.0 Herausgabedatum: 31.07.2015 Ausgabedatum: 01.11.2015 Autor: DB Energie http://www.dbenergie.de Seite: 1 1.
Anwendungshandbuch Vorgaben und Erläuterungen zu den XML-Schemata im Bahnstromnetz Version: 1.0 Herausgabedatum: 31.07.2015 Ausgabedatum: 01.11.2015 Autor: DB Energie http://www.dbenergie.de Seite: 1 1.
Hilfedatei der Oden$-Börse Stand Juni 2014
 Hilfedatei der Oden$-Börse Stand Juni 2014 Inhalt 1. Einleitung... 2 2. Die Anmeldung... 2 2.1 Die Erstregistrierung... 3 2.2 Die Mitgliedsnummer anfordern... 4 3. Die Funktionen für Nutzer... 5 3.1 Arbeiten
Hilfedatei der Oden$-Börse Stand Juni 2014 Inhalt 1. Einleitung... 2 2. Die Anmeldung... 2 2.1 Die Erstregistrierung... 3 2.2 Die Mitgliedsnummer anfordern... 4 3. Die Funktionen für Nutzer... 5 3.1 Arbeiten
Projektmanagement in Outlook integriert
 Projektmanagement in Outlook integriert InLoox PM 8.x Update auf InLoox PM 9.x Ein InLoox Whitepaper Veröffentlicht: Februar 2016 Copyright: 2016 InLoox GmbH. Aktuelle Informationen finden Sie unter http://www.inloox.de
Projektmanagement in Outlook integriert InLoox PM 8.x Update auf InLoox PM 9.x Ein InLoox Whitepaper Veröffentlicht: Februar 2016 Copyright: 2016 InLoox GmbH. Aktuelle Informationen finden Sie unter http://www.inloox.de
Datenbanken Kapitel 2
 Datenbanken Kapitel 2 1 Eine existierende Datenbank öffnen Eine Datenbank, die mit Microsoft Access erschaffen wurde, kann mit dem gleichen Programm auch wieder geladen werden: Die einfachste Methode ist,
Datenbanken Kapitel 2 1 Eine existierende Datenbank öffnen Eine Datenbank, die mit Microsoft Access erschaffen wurde, kann mit dem gleichen Programm auch wieder geladen werden: Die einfachste Methode ist,
1 Mathematische Grundlagen
 Mathematische Grundlagen - 1-1 Mathematische Grundlagen Der Begriff der Menge ist einer der grundlegenden Begriffe in der Mathematik. Mengen dienen dazu, Dinge oder Objekte zu einer Einheit zusammenzufassen.
Mathematische Grundlagen - 1-1 Mathematische Grundlagen Der Begriff der Menge ist einer der grundlegenden Begriffe in der Mathematik. Mengen dienen dazu, Dinge oder Objekte zu einer Einheit zusammenzufassen.
Synchronisations- Assistent
 TimePunch Synchronisations- Assistent Benutzerhandbuch Gerhard Stephan Softwareentwicklung -und Vertrieb 25.08.2011 Dokumenten Information: Dokumenten-Name Benutzerhandbuch, Synchronisations-Assistent
TimePunch Synchronisations- Assistent Benutzerhandbuch Gerhard Stephan Softwareentwicklung -und Vertrieb 25.08.2011 Dokumenten Information: Dokumenten-Name Benutzerhandbuch, Synchronisations-Assistent
mobilepoi 0.91 Demo Version Anleitung Das Software Studio Christian Efinger Erstellt am 21. Oktober 2005
 Das Software Studio Christian Efinger mobilepoi 0.91 Demo Version Anleitung Erstellt am 21. Oktober 2005 Kontakt: Das Software Studio Christian Efinger ce@efinger-online.de Inhalt 1. Einführung... 3 2.
Das Software Studio Christian Efinger mobilepoi 0.91 Demo Version Anleitung Erstellt am 21. Oktober 2005 Kontakt: Das Software Studio Christian Efinger ce@efinger-online.de Inhalt 1. Einführung... 3 2.
Windows. Workshop Internet-Explorer: Arbeiten mit Favoriten, Teil 1
 Workshop Internet-Explorer: Arbeiten mit Favoriten, Teil 1 Wenn der Name nicht gerade www.buch.de oder www.bmw.de heißt, sind Internetadressen oft schwer zu merken Deshalb ist es sinnvoll, die Adressen
Workshop Internet-Explorer: Arbeiten mit Favoriten, Teil 1 Wenn der Name nicht gerade www.buch.de oder www.bmw.de heißt, sind Internetadressen oft schwer zu merken Deshalb ist es sinnvoll, die Adressen
Stundenerfassung Version 1.8 Anleitung Arbeiten mit Replikaten
 Stundenerfassung Version 1.8 Anleitung Arbeiten mit Replikaten 2008 netcadservice GmbH netcadservice GmbH Augustinerstraße 3 D-83395 Freilassing Dieses Programm ist urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe
Stundenerfassung Version 1.8 Anleitung Arbeiten mit Replikaten 2008 netcadservice GmbH netcadservice GmbH Augustinerstraße 3 D-83395 Freilassing Dieses Programm ist urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe
Dokumentation. Black- und Whitelists. Absenderadressen auf eine Blacklist oder eine Whitelist setzen. Zugriff per Webbrowser
 Dokumentation Black- und Whitelists Absenderadressen auf eine Blacklist oder eine Whitelist setzen. Zugriff per Webbrowser Inhalt INHALT 1 Kategorie Black- und Whitelists... 2 1.1 Was sind Black- und Whitelists?...
Dokumentation Black- und Whitelists Absenderadressen auf eine Blacklist oder eine Whitelist setzen. Zugriff per Webbrowser Inhalt INHALT 1 Kategorie Black- und Whitelists... 2 1.1 Was sind Black- und Whitelists?...
Anton Ochsenkühn. amac BUCH VERLAG. Ecxel 2016. für Mac. amac-buch Verlag
 Anton Ochsenkühn amac BUCH VERLAG Ecxel 2016 für Mac amac-buch Verlag 2 Word-Dokumentenkatalog! Zudem können unterhalb von Neu noch Zuletzt verwendet eingeblendet werden. Damit hat der Anwender einen sehr
Anton Ochsenkühn amac BUCH VERLAG Ecxel 2016 für Mac amac-buch Verlag 2 Word-Dokumentenkatalog! Zudem können unterhalb von Neu noch Zuletzt verwendet eingeblendet werden. Damit hat der Anwender einen sehr
Mandant in den einzelnen Anwendungen löschen
 Mandant in den einzelnen Anwendungen löschen Bereich: ALLGEMEIN - Info für Anwender Nr. 6056 Inhaltsverzeichnis 1. Allgemein 2. FIBU/ANLAG/ZAHLUNG/BILANZ/LOHN/BELEGTRANSFER 3. DMS 4. STEUERN 5. FRISTEN
Mandant in den einzelnen Anwendungen löschen Bereich: ALLGEMEIN - Info für Anwender Nr. 6056 Inhaltsverzeichnis 1. Allgemein 2. FIBU/ANLAG/ZAHLUNG/BILANZ/LOHN/BELEGTRANSFER 3. DMS 4. STEUERN 5. FRISTEN
Web Services stellen eine Integrationsarchitektur dar, die die Kommunikation zwischen verschiedenen Anwendungen
 9 3 Web Services 3.1 Überblick Web Services stellen eine Integrationsarchitektur dar, die die Kommunikation zwischen verschiedenen Anwendungen mit Hilfe von XML über das Internet ermöglicht (siehe Abb.
9 3 Web Services 3.1 Überblick Web Services stellen eine Integrationsarchitektur dar, die die Kommunikation zwischen verschiedenen Anwendungen mit Hilfe von XML über das Internet ermöglicht (siehe Abb.
Anleitung über den Umgang mit Schildern
 Anleitung über den Umgang mit Schildern -Vorwort -Wo bekommt man Schilder? -Wo und wie speichert man die Schilder? -Wie füge ich die Schilder in meinen Track ein? -Welche Bauteile kann man noch für Schilder
Anleitung über den Umgang mit Schildern -Vorwort -Wo bekommt man Schilder? -Wo und wie speichert man die Schilder? -Wie füge ich die Schilder in meinen Track ein? -Welche Bauteile kann man noch für Schilder
Inhalt. 1 Einleitung AUTOMATISCHE DATENSICHERUNG AUF EINEN CLOUDSPEICHER
 AUTOMATISCHE DATENSICHERUNG AUF EINEN CLOUDSPEICHER Inhalt 1 Einleitung... 1 2 Einrichtung der Aufgabe für die automatische Sicherung... 2 2.1 Die Aufgabenplanung... 2 2.2 Der erste Testlauf... 9 3 Problembehebung...
AUTOMATISCHE DATENSICHERUNG AUF EINEN CLOUDSPEICHER Inhalt 1 Einleitung... 1 2 Einrichtung der Aufgabe für die automatische Sicherung... 2 2.1 Die Aufgabenplanung... 2 2.2 Der erste Testlauf... 9 3 Problembehebung...
Achtung Konvertierung und Update von BDE nach SQL
 Achtung Konvertierung und Update von BDE nach SQL Allgemeine Informationen Dieses Dokument unterstützt Sie beim Umstieg bzw. Update von den bisherigen BDE-Versionen der Programme Auftrag, Rechnungswesen,
Achtung Konvertierung und Update von BDE nach SQL Allgemeine Informationen Dieses Dokument unterstützt Sie beim Umstieg bzw. Update von den bisherigen BDE-Versionen der Programme Auftrag, Rechnungswesen,
Kapitel 33. Der xml-datentyp. In diesem Kapitel: Der xml-datentyp 996 Abfragen aus xml-datentypen 1001 XML-Indizierung 1017 Zusammenfassung 1023
 Kapitel 33 Der xml-datentyp In diesem Kapitel: Der xml-datentyp 996 Abfragen aus xml-datentypen 1001 XML-Indizierung 1017 Zusammenfassung 1023 995 996 Kapitel 33: Der xml-datentyp Eine der wichtigsten
Kapitel 33 Der xml-datentyp In diesem Kapitel: Der xml-datentyp 996 Abfragen aus xml-datentypen 1001 XML-Indizierung 1017 Zusammenfassung 1023 995 996 Kapitel 33: Der xml-datentyp Eine der wichtigsten
ecaros2 - Accountmanager
 ecaros2 - Accountmanager procar informatik AG 1 Stand: FS 09/2012 Inhaltsverzeichnis 1 Aufruf des ecaros2-accountmanager...3 2 Bedienung Accountmanager...4 procar informatik AG 2 Stand: FS 09/2012 1 Aufruf
ecaros2 - Accountmanager procar informatik AG 1 Stand: FS 09/2012 Inhaltsverzeichnis 1 Aufruf des ecaros2-accountmanager...3 2 Bedienung Accountmanager...4 procar informatik AG 2 Stand: FS 09/2012 1 Aufruf
Drucken aus der Anwendung
 Drucken aus der Anwendung Drucken aus der Anwendung Nicht jeder Großformatdruck benötigt die volle Funktionsvielfalt von PosterJet - häufig sind es Standarddrucke wie Flussdiagramme und Organigramme die
Drucken aus der Anwendung Drucken aus der Anwendung Nicht jeder Großformatdruck benötigt die volle Funktionsvielfalt von PosterJet - häufig sind es Standarddrucke wie Flussdiagramme und Organigramme die
Nicht kopieren. Der neue Report von: Stefan Ploberger. 1. Ausgabe 2003
 Nicht kopieren Der neue Report von: Stefan Ploberger 1. Ausgabe 2003 Herausgeber: Verlag Ploberger & Partner 2003 by: Stefan Ploberger Verlag Ploberger & Partner, Postfach 11 46, D-82065 Baierbrunn Tel.
Nicht kopieren Der neue Report von: Stefan Ploberger 1. Ausgabe 2003 Herausgeber: Verlag Ploberger & Partner 2003 by: Stefan Ploberger Verlag Ploberger & Partner, Postfach 11 46, D-82065 Baierbrunn Tel.
1. Adressen für den Serienversand (Briefe Katalogdruck Werbung/Anfrage ) auswählen. Die Auswahl kann gespeichert werden.
 Der Serienversand Was kann man mit der Maske Serienversand machen? 1. Adressen für den Serienversand (Briefe Katalogdruck Werbung/Anfrage ) auswählen. Die Auswahl kann gespeichert werden. 2. Adressen auswählen,
Der Serienversand Was kann man mit der Maske Serienversand machen? 1. Adressen für den Serienversand (Briefe Katalogdruck Werbung/Anfrage ) auswählen. Die Auswahl kann gespeichert werden. 2. Adressen auswählen,
Access [basics] Rechnen in Berichten. Beispieldatenbank. Datensatzweise berechnen. Berechnung im Textfeld. Reporting in Berichten Rechnen in Berichten
![Access [basics] Rechnen in Berichten. Beispieldatenbank. Datensatzweise berechnen. Berechnung im Textfeld. Reporting in Berichten Rechnen in Berichten Access [basics] Rechnen in Berichten. Beispieldatenbank. Datensatzweise berechnen. Berechnung im Textfeld. Reporting in Berichten Rechnen in Berichten](/thumbs/30/14319702.jpg) Berichte bieten die gleichen Möglichkeit zur Berechnung von Werten wie Formulare und noch einige mehr. Im Gegensatz zu Formularen bieten Berichte die Möglichkeit, eine laufende Summe zu bilden oder Berechnungen
Berichte bieten die gleichen Möglichkeit zur Berechnung von Werten wie Formulare und noch einige mehr. Im Gegensatz zu Formularen bieten Berichte die Möglichkeit, eine laufende Summe zu bilden oder Berechnungen
Verschlüsseln von Dateien mit Hilfe einer TCOS-Smartcard per Truecrypt. T-Systems International GmbH. Version 1.0 Stand 29.06.11
 Verschlüsseln von Dateien mit Hilfe einer TCOS-Smartcard per Truecrypt T-Systems International GmbH Version 1.0 Stand 29.06.11 Impressum Herausgeber T-Systems International GmbH Untere Industriestraße
Verschlüsseln von Dateien mit Hilfe einer TCOS-Smartcard per Truecrypt T-Systems International GmbH Version 1.0 Stand 29.06.11 Impressum Herausgeber T-Systems International GmbH Untere Industriestraße
Sonderrundschreiben. Arbeitshilfe zu den Pflichtangaben in Immobilienanzeigen bei alten Energieausweisen
 Sonderrundschreiben Arbeitshilfe zu den Pflichtangaben in Immobilienanzeigen bei alten Energieausweisen Sonnenstraße 11-80331 München Telefon 089 / 5404133-0 - Fax 089 / 5404133-55 info@haus-und-grund-bayern.de
Sonderrundschreiben Arbeitshilfe zu den Pflichtangaben in Immobilienanzeigen bei alten Energieausweisen Sonnenstraße 11-80331 München Telefon 089 / 5404133-0 - Fax 089 / 5404133-55 info@haus-und-grund-bayern.de
Jederzeit Ordnung halten
 Kapitel Jederzeit Ordnung halten 6 auf Ihrem Mac In diesem Buch war bereits einige Male vom Finder die Rede. Dieses Kapitel wird sich nun ausführlich diesem so wichtigen Programm widmen. Sie werden das
Kapitel Jederzeit Ordnung halten 6 auf Ihrem Mac In diesem Buch war bereits einige Male vom Finder die Rede. Dieses Kapitel wird sich nun ausführlich diesem so wichtigen Programm widmen. Sie werden das
Erster Schritt: Antrag um Passwort (s. www.ifb.co.at Rubrik -> techn. Richtlinien/Antrag für Zugangsberechtigung)
 Benutzeranleitung Sehr geehrte Mitglieder und Experten! Diese Benutzeranleitung erklärt die Handhabung und Navigation zu den spezifischen Arbeitsgruppen unter der Rubrik Technische Richtlinien auf der
Benutzeranleitung Sehr geehrte Mitglieder und Experten! Diese Benutzeranleitung erklärt die Handhabung und Navigation zu den spezifischen Arbeitsgruppen unter der Rubrik Technische Richtlinien auf der
Hinweise zum elektronischen Meldeformular
 Paul-Ehrlich-Institut Postfach 63207 Langen Jochen Halbauer Referat Pharmakovigilanz 2 Tel. +49 (0) 6103 77 3114 Fax +49 (0) 6103 77 1268 E-Mail pharmakovigilanz2@pei.de 22.06.2015 Hinweise zum elektronischen
Paul-Ehrlich-Institut Postfach 63207 Langen Jochen Halbauer Referat Pharmakovigilanz 2 Tel. +49 (0) 6103 77 3114 Fax +49 (0) 6103 77 1268 E-Mail pharmakovigilanz2@pei.de 22.06.2015 Hinweise zum elektronischen
teamsync Kurzanleitung
 1 teamsync Kurzanleitung Version 4.0-19. November 2012 2 1 Einleitung Mit teamsync können Sie die Produkte teamspace und projectfacts mit Microsoft Outlook synchronisieren.laden Sie sich teamsync hier
1 teamsync Kurzanleitung Version 4.0-19. November 2012 2 1 Einleitung Mit teamsync können Sie die Produkte teamspace und projectfacts mit Microsoft Outlook synchronisieren.laden Sie sich teamsync hier
Ist Excel das richtige Tool für FMEA? Steve Murphy, Marc Schaeffers
 Ist Excel das richtige Tool für FMEA? Steve Murphy, Marc Schaeffers Ist Excel das richtige Tool für FMEA? Einleitung Wenn in einem Unternehmen FMEA eingeführt wird, fangen die meisten sofort damit an,
Ist Excel das richtige Tool für FMEA? Steve Murphy, Marc Schaeffers Ist Excel das richtige Tool für FMEA? Einleitung Wenn in einem Unternehmen FMEA eingeführt wird, fangen die meisten sofort damit an,
Advoware mit VPN Zugriff lokaler Server / PC auf externe Datenbank
 Advoware mit VPN Zugriff lokaler Server / PC auf externe Datenbank Die Entscheidung Advoware über VPN direkt auf dem lokalen PC / Netzwerk mit Zugriff auf die Datenbank des zentralen Servers am anderen
Advoware mit VPN Zugriff lokaler Server / PC auf externe Datenbank Die Entscheidung Advoware über VPN direkt auf dem lokalen PC / Netzwerk mit Zugriff auf die Datenbank des zentralen Servers am anderen
XML und Datenbanken. Wintersemester 2003/2004. Vorlesung: Dienstag, 13:15-15:00 Uhr IFW A36. Übung: Dienstag, 15:15-16:00 Uhr IFW A36
 XML und Datenbanken Wintersemester 2003/2004 Vorlesung: Dienstag, 13:15-15:00 Uhr IFW A36 Übung: Dienstag, 15:15-16:00 Uhr IFW A36 Dozenten: Dr. Can Türker IFW C47.2 Email: WWW: tuerker@inf.ethz.ch http://www.dbs.ethz.ch/~xml
XML und Datenbanken Wintersemester 2003/2004 Vorlesung: Dienstag, 13:15-15:00 Uhr IFW A36 Übung: Dienstag, 15:15-16:00 Uhr IFW A36 Dozenten: Dr. Can Türker IFW C47.2 Email: WWW: tuerker@inf.ethz.ch http://www.dbs.ethz.ch/~xml
DIRECTINFO 5.7 SICHERHEITSKONZEPTE FÜR BENUTZER, INFORMATIONEN UND FUNKTIONEN
 DIRECTINFO 5.7 SICHERHEITSKONZEPTE FÜR BENUTZER, INFORMATIONEN UND FUNKTIONEN - Whitepaper 1 Autor: Peter Kopecki Version: 1.2 Stand: Mai 2006 DIRECTINFO 5.7... 1 SICHERHEITSKONZEPTE FÜR BENUTZER, INFORMATIONEN
DIRECTINFO 5.7 SICHERHEITSKONZEPTE FÜR BENUTZER, INFORMATIONEN UND FUNKTIONEN - Whitepaper 1 Autor: Peter Kopecki Version: 1.2 Stand: Mai 2006 DIRECTINFO 5.7... 1 SICHERHEITSKONZEPTE FÜR BENUTZER, INFORMATIONEN
Wie Sie mit Mastern arbeiten
 Wie Sie mit Mastern arbeiten Was ist ein Master? Einer der großen Vorteile von EDV besteht darin, dass Ihnen der Rechner Arbeit abnimmt. Diesen Vorteil sollten sie nutzen, wo immer es geht. In PowerPoint
Wie Sie mit Mastern arbeiten Was ist ein Master? Einer der großen Vorteile von EDV besteht darin, dass Ihnen der Rechner Arbeit abnimmt. Diesen Vorteil sollten sie nutzen, wo immer es geht. In PowerPoint
OP-LOG www.op-log.de
 Verwendung von Microsoft SQL Server, Seite 1/18 OP-LOG www.op-log.de Anleitung: Verwendung von Microsoft SQL Server 2005 Stand Mai 2010 1 Ich-lese-keine-Anleitungen 'Verwendung von Microsoft SQL Server
Verwendung von Microsoft SQL Server, Seite 1/18 OP-LOG www.op-log.de Anleitung: Verwendung von Microsoft SQL Server 2005 Stand Mai 2010 1 Ich-lese-keine-Anleitungen 'Verwendung von Microsoft SQL Server
Umzug der abfallwirtschaftlichen Nummern /Kündigung
 Umzug der abfallwirtschaftlichen Nummern /Kündigung Um sich bei ebegleitschein abzumelden/ zu kündigen sind folgende Schritte notwendig: Schritt 1: Sie erteilen bifa Umweltinstitut GmbH den Auftrag, Ihre
Umzug der abfallwirtschaftlichen Nummern /Kündigung Um sich bei ebegleitschein abzumelden/ zu kündigen sind folgende Schritte notwendig: Schritt 1: Sie erteilen bifa Umweltinstitut GmbH den Auftrag, Ihre
Zwischenablage (Bilder, Texte,...)
 Zwischenablage was ist das? Informationen über. die Bedeutung der Windows-Zwischenablage Kopieren und Einfügen mit der Zwischenablage Vermeiden von Fehlern beim Arbeiten mit der Zwischenablage Bei diesen
Zwischenablage was ist das? Informationen über. die Bedeutung der Windows-Zwischenablage Kopieren und Einfügen mit der Zwischenablage Vermeiden von Fehlern beim Arbeiten mit der Zwischenablage Bei diesen
Enigmail Konfiguration
 Enigmail Konfiguration 11.06.2006 Steffen.Teubner@Arcor.de Enigmail ist in der Grundkonfiguration so eingestellt, dass alles funktioniert ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen. Für alle, die es
Enigmail Konfiguration 11.06.2006 Steffen.Teubner@Arcor.de Enigmail ist in der Grundkonfiguration so eingestellt, dass alles funktioniert ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen. Für alle, die es
Allgemeines zu Datenbanken
 Allgemeines zu Datenbanken Was ist eine Datenbank? Datensatz Zusammenfassung von Datenelementen mit fester Struktur Z.B.: Kunde Alois Müller, Hegenheimerstr. 28, Basel Datenbank Sammlung von strukturierten,
Allgemeines zu Datenbanken Was ist eine Datenbank? Datensatz Zusammenfassung von Datenelementen mit fester Struktur Z.B.: Kunde Alois Müller, Hegenheimerstr. 28, Basel Datenbank Sammlung von strukturierten,
mobifleet Beschreibung 1. Terminverwaltung in der Zentrale
 mobifleet Beschreibung 1. Terminverwaltung in der Zentrale Die Termine werden wie bisher im Outlook verwaltet und erfasst. Der Außendienst selbst, wie auch andere Personen, die Termine für den Außendienst
mobifleet Beschreibung 1. Terminverwaltung in der Zentrale Die Termine werden wie bisher im Outlook verwaltet und erfasst. Der Außendienst selbst, wie auch andere Personen, die Termine für den Außendienst
Diese Anleitung wurde erstellt von Niclas Lüchau und Daniel Scherer. Erste Anmeldung. Schritt 1: Anmeldung..2. Schritt 2: Passwort setzen 3
 Diese Anleitung wurde erstellt von Niclas Lüchau und Daniel Scherer Inhalt Erste Anmeldung. Schritt 1: Anmeldung..2 Schritt 2: Passwort setzen 3 Schritt 3: Nachträgliches Ändern des Passworts..4 Schreiben
Diese Anleitung wurde erstellt von Niclas Lüchau und Daniel Scherer Inhalt Erste Anmeldung. Schritt 1: Anmeldung..2 Schritt 2: Passwort setzen 3 Schritt 3: Nachträgliches Ändern des Passworts..4 Schreiben
Handbuch ECDL 2003 Basic Modul 5: Datenbank Access starten und neue Datenbank anlegen
 Handbuch ECDL 2003 Basic Modul 5: Datenbank Access starten und neue Datenbank anlegen Dateiname: ecdl5_01_02_documentation_standard.doc Speicherdatum: 14.02.2005 ECDL 2003 Basic Modul 5 Datenbank - Access
Handbuch ECDL 2003 Basic Modul 5: Datenbank Access starten und neue Datenbank anlegen Dateiname: ecdl5_01_02_documentation_standard.doc Speicherdatum: 14.02.2005 ECDL 2003 Basic Modul 5 Datenbank - Access
ZID Hotline hotline@boku.ac.at
 Plagiatsprüfung Die unüberblickbare Informationsfülle des Internet macht es Lehrenden schwierig, Plagiate in Abschlussarbeiten zu entdecken. Plagiatsprüfungssoftware unterstützt Lehrende bei dieser Aufgabe.
Plagiatsprüfung Die unüberblickbare Informationsfülle des Internet macht es Lehrenden schwierig, Plagiate in Abschlussarbeiten zu entdecken. Plagiatsprüfungssoftware unterstützt Lehrende bei dieser Aufgabe.
Access 2000 und MS SQL Server im Teamwork
 Access 2000 und MS SQL Server im Teamwork von Irene Bauder, Jürgen Bär 1. Auflage Hanser München 2000 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 446 21473 6 Zu Inhaltsverzeichnis schnell und
Access 2000 und MS SQL Server im Teamwork von Irene Bauder, Jürgen Bär 1. Auflage Hanser München 2000 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 446 21473 6 Zu Inhaltsverzeichnis schnell und
15 Arten von QR-Code-Inhalten!
 15 Arten von QR-Code-Inhalten! Quelle: www.rohinie.eu QR-Codes(= Quick Response Codes) sind Pop-Art-Matrix Barcodes, die Informationen in einer kleinen rechteckigen Grafik enthalten. Sie sind auch eine
15 Arten von QR-Code-Inhalten! Quelle: www.rohinie.eu QR-Codes(= Quick Response Codes) sind Pop-Art-Matrix Barcodes, die Informationen in einer kleinen rechteckigen Grafik enthalten. Sie sind auch eine
HANDBUCH PHOENIX II - DOKUMENTENVERWALTUNG
 it4sport GmbH HANDBUCH PHOENIX II - DOKUMENTENVERWALTUNG Stand 10.07.2014 Version 2.0 1. INHALTSVERZEICHNIS 2. Abbildungsverzeichnis... 3 3. Dokumentenumfang... 4 4. Dokumente anzeigen... 5 4.1 Dokumente
it4sport GmbH HANDBUCH PHOENIX II - DOKUMENTENVERWALTUNG Stand 10.07.2014 Version 2.0 1. INHALTSVERZEICHNIS 2. Abbildungsverzeichnis... 3 3. Dokumentenumfang... 4 4. Dokumente anzeigen... 5 4.1 Dokumente
L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016
 L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016 Referentin: Dr. Kelly Neudorfer Universität Hohenheim Was wir jetzt besprechen werden ist eine Frage, mit denen viele
L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016 Referentin: Dr. Kelly Neudorfer Universität Hohenheim Was wir jetzt besprechen werden ist eine Frage, mit denen viele
Abwesenheitsnotiz im Exchange Server 2010
 Abwesenheitsnotiz im Exchange Server 2010 1.) Richten Sie die Abwesenheitsnotiz in Outlook 2010 ein und definieren Sie, an welche Absender diese gesendet werden soll. Klicken Sie dazu auf Datei -> Informationen
Abwesenheitsnotiz im Exchange Server 2010 1.) Richten Sie die Abwesenheitsnotiz in Outlook 2010 ein und definieren Sie, an welche Absender diese gesendet werden soll. Klicken Sie dazu auf Datei -> Informationen
Bereich METIS (Texte im Internet) Zählmarkenrecherche
 Bereich METIS (Texte im Internet) Zählmarkenrecherche Über die Zählmarkenrecherche kann man nach der Eingabe des Privaten Identifikationscodes einer bestimmten Zählmarke, 1. Informationen zu dieser Zählmarke
Bereich METIS (Texte im Internet) Zählmarkenrecherche Über die Zählmarkenrecherche kann man nach der Eingabe des Privaten Identifikationscodes einer bestimmten Zählmarke, 1. Informationen zu dieser Zählmarke
Webalizer HOWTO. Stand: 18.06.2012
 Webalizer HOWTO Stand: 18.06.2012 Copyright 2003 by manitu. Alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Bezeichnungen dienen lediglich der Kennzeichnung und können z.t. eingetragene Warenzeichen sein, ohne
Webalizer HOWTO Stand: 18.06.2012 Copyright 2003 by manitu. Alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Bezeichnungen dienen lediglich der Kennzeichnung und können z.t. eingetragene Warenzeichen sein, ohne
Professionelle Seminare im Bereich MS-Office
 Serienbrief aus Outlook heraus Schritt 1 Zuerst sollten Sie die Kontakte einblenden, damit Ihnen der Seriendruck zur Verfügung steht. Schritt 2 Danach wählen Sie bitte Gerhard Grünholz 1 Schritt 3 Es öffnet
Serienbrief aus Outlook heraus Schritt 1 Zuerst sollten Sie die Kontakte einblenden, damit Ihnen der Seriendruck zur Verfügung steht. Schritt 2 Danach wählen Sie bitte Gerhard Grünholz 1 Schritt 3 Es öffnet
Thematische Abfrage mit Computerlinguistik
 Thematische Abfrage mit Computerlinguistik Autor: Dr. Klaus Loth (ETH-Bibliothek Zürich) Zusammenfassung Der Beitrag befasst sich mit dem Einsatz der Computerlinguistik bei der thematischen Abfrage einer
Thematische Abfrage mit Computerlinguistik Autor: Dr. Klaus Loth (ETH-Bibliothek Zürich) Zusammenfassung Der Beitrag befasst sich mit dem Einsatz der Computerlinguistik bei der thematischen Abfrage einer
STRATO Mail Einrichtung Mozilla Thunderbird
 STRATO Mail Einrichtung Mozilla Thunderbird Einrichtung Ihrer E-Mail Adresse bei STRATO Willkommen bei STRATO! Wir freuen uns, Sie als Kunden begrüßen zu dürfen. Mit der folgenden Anleitung möchten wir
STRATO Mail Einrichtung Mozilla Thunderbird Einrichtung Ihrer E-Mail Adresse bei STRATO Willkommen bei STRATO! Wir freuen uns, Sie als Kunden begrüßen zu dürfen. Mit der folgenden Anleitung möchten wir
Suche schlecht beschriftete Bilder mit Eigenen Abfragen
 Suche schlecht beschriftete Bilder mit Eigenen Abfragen Ist die Bilderdatenbank über einen längeren Zeitraum in Benutzung, so steigt die Wahrscheinlichkeit für schlecht beschriftete Bilder 1. Insbesondere
Suche schlecht beschriftete Bilder mit Eigenen Abfragen Ist die Bilderdatenbank über einen längeren Zeitraum in Benutzung, so steigt die Wahrscheinlichkeit für schlecht beschriftete Bilder 1. Insbesondere
Step by Step Softwareverteilung unter Novell. von Christian Bartl
 Step by Step Softwareverteilung unter Novell von Softwareverteilung unter Novell 1) Starten von einfachen *.EXE-Dateien: Starten sie ConsoleOne Erstellen sie eine eigene Organisationseinheit für ihre Anwendungen
Step by Step Softwareverteilung unter Novell von Softwareverteilung unter Novell 1) Starten von einfachen *.EXE-Dateien: Starten sie ConsoleOne Erstellen sie eine eigene Organisationseinheit für ihre Anwendungen
Beuth Hochschule Die erweiterbare Markierungssprache XML WS10/11
 Die erweiterbare Markierungssprache XML 1. Einleitung Eine Markierungssprache (markup language) dient dazu, Textdateien mit zusätzlichen Informationen anzureichern. Die verbreitete Markierungssprache HTML
Die erweiterbare Markierungssprache XML 1. Einleitung Eine Markierungssprache (markup language) dient dazu, Textdateien mit zusätzlichen Informationen anzureichern. Die verbreitete Markierungssprache HTML
Dokumentation zur Versendung der Statistik Daten
 Dokumentation zur Versendung der Statistik Daten Achtung: gem. 57a KFG 1967 (i.d.f. der 28. Novelle) ist es seit dem 01. August 2007 verpflichtend, die Statistikdaten zur statistischen Auswertung Quartalsmäßig
Dokumentation zur Versendung der Statistik Daten Achtung: gem. 57a KFG 1967 (i.d.f. der 28. Novelle) ist es seit dem 01. August 2007 verpflichtend, die Statistikdaten zur statistischen Auswertung Quartalsmäßig
die wichtigsten online-tools für augenoptiker websites
 die wichtigsten online-tools für augenoptiker websites Warum online-tools für Ihre website nutzen? Ich brauche das nicht, ich verkauf Online keine Brillen. Diesen Satz haben wir schon oft gehört. Richtig
die wichtigsten online-tools für augenoptiker websites Warum online-tools für Ihre website nutzen? Ich brauche das nicht, ich verkauf Online keine Brillen. Diesen Satz haben wir schon oft gehört. Richtig
mysql - Clients MySQL - Abfragen eine serverbasierenden Datenbank
 mysql - Clients MySQL - Abfragen eine serverbasierenden Datenbank In den ersten beiden Abschnitten (rbanken1.pdf und rbanken2.pdf) haben wir uns mit am Ende mysql beschäftigt und kennengelernt, wie man
mysql - Clients MySQL - Abfragen eine serverbasierenden Datenbank In den ersten beiden Abschnitten (rbanken1.pdf und rbanken2.pdf) haben wir uns mit am Ende mysql beschäftigt und kennengelernt, wie man
euro-bis Import von Bestellungen aus Buch- und Aboauskunft Stand 22.02.2007
 euro-bis Import von Bestellungen aus Buch- und Aboauskunft Stand 22.02.2007 INHALTSVERZEICHNIS Konfiguration... 3 Buch- und Aboauskunft... 3 euro-bis... 3 Aufträge einlesen... 5 Kundendaten prüfen... 6
euro-bis Import von Bestellungen aus Buch- und Aboauskunft Stand 22.02.2007 INHALTSVERZEICHNIS Konfiguration... 3 Buch- und Aboauskunft... 3 euro-bis... 3 Aufträge einlesen... 5 Kundendaten prüfen... 6
Dateimanagement in Moodle Eine Schritt-für
 Übersicht: Lehrende können Dateien in einen Moodle-Kurs hochladen, in Verzeichnissen verwalten und für Studierende zugänglich machen. Jeder Moodle-Kurs hat einen Hauptordner Dateien im Administrationsblock.
Übersicht: Lehrende können Dateien in einen Moodle-Kurs hochladen, in Verzeichnissen verwalten und für Studierende zugänglich machen. Jeder Moodle-Kurs hat einen Hauptordner Dateien im Administrationsblock.
FH-SY Chapter 2.4 - Version 3 - FH-SY.NET - FAQ -
 FH-SY Chapter 2.4 - Version 3 - FH-SY.NET - FAQ - Version vom 02.02.2010 Inhaltsverzeichnis 1. KANN ICH BEI EINER EIGENEN LEKTION NACHTRÄGLICH NOCH NEUE LERNINHALTE ( WAS WURDE BEHANDELT? ) EINFÜGEN?...
FH-SY Chapter 2.4 - Version 3 - FH-SY.NET - FAQ - Version vom 02.02.2010 Inhaltsverzeichnis 1. KANN ICH BEI EINER EIGENEN LEKTION NACHTRÄGLICH NOCH NEUE LERNINHALTE ( WAS WURDE BEHANDELT? ) EINFÜGEN?...
1 Übungsaufgaben mit Lösungen YAWL-System
 1 Übungsaufgaben mit Lösungen YAWL-System 1.1 Beispiel für das YAWL System (Reisebuchungsszenario) Um den Umgang mit YAWL und insbesondere mit dem YAWL-editor zu illustrieren soll ein Beispiel bearbeitet
1 Übungsaufgaben mit Lösungen YAWL-System 1.1 Beispiel für das YAWL System (Reisebuchungsszenario) Um den Umgang mit YAWL und insbesondere mit dem YAWL-editor zu illustrieren soll ein Beispiel bearbeitet
Datenmanagement in Android-Apps. 16. Mai 2013
 Datenmanagement in Android-Apps 16. Mai 2013 Überblick Strukturierung von datenorientierten Android-Apps Schichtenarchitektur Möglichkeiten der Datenhaltung: in Dateien, die auf der SDCard liegen in einer
Datenmanagement in Android-Apps 16. Mai 2013 Überblick Strukturierung von datenorientierten Android-Apps Schichtenarchitektur Möglichkeiten der Datenhaltung: in Dateien, die auf der SDCard liegen in einer
SICHERN DER FAVORITEN
 Seite 1 von 7 SICHERN DER FAVORITEN Eine Anleitung zum Sichern der eigenen Favoriten zur Verfügung gestellt durch: ZID Dezentrale Systeme März 2010 Seite 2 von 7 Für die Datensicherheit ist bekanntlich
Seite 1 von 7 SICHERN DER FAVORITEN Eine Anleitung zum Sichern der eigenen Favoriten zur Verfügung gestellt durch: ZID Dezentrale Systeme März 2010 Seite 2 von 7 Für die Datensicherheit ist bekanntlich
Universität Augsburg, Institut für Informatik Wintersemester 2011/2012 Prof. Dr. W. Kießling 03. Feb. 2012. Semesterklausur
 Universität Augsburg, Institut für Informatik Wintersemester 2011/2012 Prof. Dr. W. Kießling 03. Feb. 2012 Dr. M. Endres, Dr.-Ing. S. Mandl Datenbankprogrammierung (Oracle) Semesterklausur Hinweise: Die
Universität Augsburg, Institut für Informatik Wintersemester 2011/2012 Prof. Dr. W. Kießling 03. Feb. 2012 Dr. M. Endres, Dr.-Ing. S. Mandl Datenbankprogrammierung (Oracle) Semesterklausur Hinweise: Die
Architektur des agimatec-validation Frameworks
 Development : Implementierung Validierungskonzept (Dokumentation) This page last changed on Apr 03, 2008 by roman.stumm. Architektur des agimatec-validation Frameworks Generierung der Metainformationen
Development : Implementierung Validierungskonzept (Dokumentation) This page last changed on Apr 03, 2008 by roman.stumm. Architektur des agimatec-validation Frameworks Generierung der Metainformationen
TrueCrypt Anleitung: Datenschutz durch Festplattenverschlüsselung
 TrueCrypt Anleitung: Datenschutz durch Festplattenverschlüsselung 1. Installation Seite 2 2. Datenträger mittels Truecrypt verschlüsseln Seite 2 a) Container erstellen Seite 3 b) Normales Volumen Seite
TrueCrypt Anleitung: Datenschutz durch Festplattenverschlüsselung 1. Installation Seite 2 2. Datenträger mittels Truecrypt verschlüsseln Seite 2 a) Container erstellen Seite 3 b) Normales Volumen Seite
Consulting. Dokumentenmanagement. Stand: 25.01.2005. jwconsulting GmbH Caspar-David-Friedrichstr. 7 69190 Walldorf
 Dokumentenmanagement jw GmbH Caspar-David-Friedrichstr. 7 69190 Walldorf Stand: 25.01.2005 GmbH, http://www.jwconsulting.eu 1 von 6 25.01.05 Dokumentenmanagement Das Dokumentenmanagement der Firma jw GmbH
Dokumentenmanagement jw GmbH Caspar-David-Friedrichstr. 7 69190 Walldorf Stand: 25.01.2005 GmbH, http://www.jwconsulting.eu 1 von 6 25.01.05 Dokumentenmanagement Das Dokumentenmanagement der Firma jw GmbH
Lineare Differentialgleichungen erster Ordnung erkennen
 Lineare Differentialgleichungen erster Ordnung In diesem Kapitel... Erkennen, wie Differentialgleichungen erster Ordnung aussehen en für Differentialgleichungen erster Ordnung und ohne -Terme finden Die
Lineare Differentialgleichungen erster Ordnung In diesem Kapitel... Erkennen, wie Differentialgleichungen erster Ordnung aussehen en für Differentialgleichungen erster Ordnung und ohne -Terme finden Die
CMS.R. Bedienungsanleitung. Modul Cron. Copyright 10.09.2009. www.sruttloff.de CMS.R. - 1 - Revision 1
 CMS.R. Bedienungsanleitung Modul Cron Revision 1 Copyright 10.09.2009 www.sruttloff.de CMS.R. - 1 - WOZU CRON...3 VERWENDUNG...3 EINSTELLUNGEN...5 TASK ERSTELLEN / BEARBEITEN...6 RECHTE...7 EREIGNISSE...7
CMS.R. Bedienungsanleitung Modul Cron Revision 1 Copyright 10.09.2009 www.sruttloff.de CMS.R. - 1 - WOZU CRON...3 VERWENDUNG...3 EINSTELLUNGEN...5 TASK ERSTELLEN / BEARBEITEN...6 RECHTE...7 EREIGNISSE...7
Dieses Tutorial gibt eine Übersicht der Form Klassen von Struts, welche Besonderheiten und Unterschiede diese aufweisen.
 Übersicht Struts Forms Dieses Tutorial gibt eine Übersicht der Form Klassen von Struts, welche Besonderheiten und Unterschiede diese aufweisen. Allgemeines Autor: Sascha Wolski http://www.laliluna.de/tutorials.html
Übersicht Struts Forms Dieses Tutorial gibt eine Übersicht der Form Klassen von Struts, welche Besonderheiten und Unterschiede diese aufweisen. Allgemeines Autor: Sascha Wolski http://www.laliluna.de/tutorials.html
Handbuch. NAFI Online-Spezial. Kunden- / Datenverwaltung. 1. Auflage. (Stand: 24.09.2014)
 Handbuch NAFI Online-Spezial 1. Auflage (Stand: 24.09.2014) Copyright 2016 by NAFI GmbH Unerlaubte Vervielfältigungen sind untersagt! Inhaltsangabe Einleitung... 3 Kundenauswahl... 3 Kunde hinzufügen...
Handbuch NAFI Online-Spezial 1. Auflage (Stand: 24.09.2014) Copyright 2016 by NAFI GmbH Unerlaubte Vervielfältigungen sind untersagt! Inhaltsangabe Einleitung... 3 Kundenauswahl... 3 Kunde hinzufügen...
Microsoft PowerPoint 2013 Folien gemeinsam nutzen
 Hochschulrechenzentrum Justus-Liebig-Universität Gießen Microsoft PowerPoint 2013 Folien gemeinsam nutzen Folien gemeinsam nutzen in PowerPoint 2013 Seite 1 von 4 Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 Einzelne
Hochschulrechenzentrum Justus-Liebig-Universität Gießen Microsoft PowerPoint 2013 Folien gemeinsam nutzen Folien gemeinsam nutzen in PowerPoint 2013 Seite 1 von 4 Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 Einzelne
Kennen, können, beherrschen lernen was gebraucht wird www.doelle-web.de
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 1 Grundlagen... 2 Hyperlinks innerhalb einer Datei... 2 Verweisziel definieren... 2 Einen Querverweis setzen... 3 Verschiedene Arten von Hyperlinks... 3 Einfache
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 1 Grundlagen... 2 Hyperlinks innerhalb einer Datei... 2 Verweisziel definieren... 2 Einen Querverweis setzen... 3 Verschiedene Arten von Hyperlinks... 3 Einfache
Mind Mapping am PC. für Präsentationen, Vorträge, Selbstmanagement. von Isolde Kommer, Helmut Reinke. 1. Auflage. Hanser München 1999
 Mind Mapping am PC für Präsentationen, Vorträge, Selbstmanagement von Isolde Kommer, Helmut Reinke 1. Auflage Hanser München 1999 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 446 21222 0 schnell
Mind Mapping am PC für Präsentationen, Vorträge, Selbstmanagement von Isolde Kommer, Helmut Reinke 1. Auflage Hanser München 1999 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 446 21222 0 schnell
