B&B Agrar. Eiweißpflanzen als Anbaualternative. Praxisnah erprobt Die Zeitschrift für Bildung und Beratung. Juli/August
|
|
|
- Jan Fried
- vor 4 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 B&B Agrar Die Zeitschrift für Bildung und Beratung Juli/August Jahrgang Praxisnah erprobt Eiweißpflanzen als Anbaualternative Bildung Lernfelder konzipieren Beratung Diversifizierung begleiten Quellen, Daten, Kommentare Barcamp erleben
2 unabhängig praxisorientiert wissenschaftlich fundiert Es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Mehr unter aid-medienshop.de
3 EDITORIAL IMPRESSUM Herausgeber: aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e.v. Heilsbachstraße 16, Bonn Liebe Leserinnen, liebe Leser, Leguminosen können mit vielen Vorteilen punkten. Dank einer neuen Initiative erleben sie eine Art Renaissance auf deutschen Feldern. Die Eiweißpflanzenstrategie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, die heimischen Kulturen von Soja, Lupine, Erbse und Bohne zu stärken. Dafür sind Netzwerke entstanden, die den Wissenstransfer zwischen Forschung, Beratung und Praxis fördern sollen. Im Schwerpunkt dieser Ausgabe lesen Sie mehr über die Arbeit dieser Netzwerke. Außerdem erfahren Sie, welche Erkenntnisse das Versuchsprogramm mit Körnerleguminosen am Eichhof in Hessen für die Beratung bereithält und wie diese direkt für Landwirtinnen und Landwirte nutzbar gemacht werden. Auch die Stimmen aus der Praxis zeigen: Eiweißpflanzen sind eine nachhaltige und naturverträgliche Alternative. Zwei Landwirte berichten über ihre Erfahrungen bei Anbau und Verwertung von Erbse und Ackerbohne. Heimische Hülsenfrüchte sollen zukünftig nicht nur in der Landwirtschaft beliebter werden, sondern als hochwertige Eiweißträger auch in den Köpfen der Verbraucher einen festen Platz bekommen. Deshalb hat die Pädagogische Hochschule Freiburg eine Unterrichtskonzeption für allgemeinbildende und berufliche Schulen entwickelt, die unter dem Titel Soja Vom Acker auf den Teller 2017 an den Start gehen wird. Die Eiweißpflanzenstrategie ist also auf gutem Wege: In den vergangenen zwei Jahren hat die Anbaufläche von Soja, Lupine, Erbse, Ackerbohne und weiteren Hülsenfrüchten zur Körnergewinnung in Deutschland wieder zugenommen. Sicher auch ein Erfolg der Netzwerke und anderen Initiativen, die den Wissenstransfer gefördert haben. Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht Ihnen Ihre Dr. Bärbel Brettschneider-Heil, Chefredakteurin Redaktion: Dr. Bärbel Brettschneider-Heil (bb) (Chefredaktion und v.i.s.d.p.) Telefon: , Hildegard Gräf (hg) Telefon: , Michaela Kuhn (mk) Redaktionsbüro: Margret Paulus Telefon: , Fax: , B&B Agrar im Internet: Redaktionsbeirat: Regina Bartel, Wissenschaftsjournalistin, Syke; Markus Bretschneider, Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn; Anne Dirking, Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Uelzen; Peter Gach, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Weiden; Jürgen Käßer, Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume, Schwäbisch Gmünd; Martin Lambers, Deutscher Bauern verband, Berlin; Martin Maier- Walker, Berufsbildungszentrum am Nord- Ostsee-Kanal, Rendsburg; Jörn Möller, Sächsisches Landesamt, Dresden; Michael Stein, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Kassel; Dr. Karl Wessels, Bundesministe rium für Ernährung und Landwirtschaft, Berlin Erscheint 6-mal im Jahr Jahresbezugspreis: 18,00 Euro Einzelbezugspreis: 3,60 Euro Layout und Umsetzung: tiff.any GmbH, Berlin Druck: Druckerei Lokay e. K. Königsberger Straße 3, Reinheim D Titelbild: BÖLN Dieses Heft wurde in einem klimaneutralen Druckprozess mit Farben aus nachwachsenden Rohstoffen bei der EMASzer tifizierten Druckerei Lokay hergestellt (D ). Das Papier besteht zu 100 Prozent aus Recyclingpapier. Abonnentenservice: aid infodienst e. V. Vertrieb Heilsbachstraße 16, Bonn Telefon: Fax: Die namentlich gekennzeichneten Beiträge geben nicht unbedingt die Auffassung des aid wieder. Nachdruck auch auszugsweise oder in abgeänderter Form nur mit Zustimmung der Redaktion gestattet. ISSN , Bestell-Nr B&B Agrar 4 /
4 INHALT B&B Agrar Die Zeitschrift für Bildung und Beratung Foto: BÖLN Foto: Michael Schlag 09 Der in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangene Anbau von Leguminosen in Deutschland soll gefördert werden. 22 Lernfeldunterricht erfordert regelmäßigen Austausch unter den Lehrkräften. RUBRIKEN 3 Impressum 6 Aktuell 35 Bundesgesetzblatt 38 Bücher & Medien 39 aid-medien FORSCHUNGSFELDER 36 Neues aus der Ressortforschung des Bundeslandwirtschaftsministeriums Foto: Rido Fotolia.com SCHWERPUNKT 9 Förderung für die Eiweißpflanzen Kristin Nerlich Die Eiweißpflanzenstrategie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat seit ihrem Start Ende 2012 besonders die Körnerleguminosen Soja, Lupine, Erbse und Bohne im Fokus. 11 Heimische Soja forcieren Nina Weiher Hauptaufgaben des Soja-Netzwerks: den Wissensaustausch zwischen Forschung, Beratung und Praxis unterstützen und so den Anbau und die Verwertung von Sojabohnen in Deutschland ausweiten. 13 Vorzüge der Lupine ausschöpfen Annett Gefrom Den Anbau und die Verarbeitung von Lupinen für die Tier- und Humanernährung auszuweiten und zu verbessern, ist Ziel des Lupinen-Netzwerks. 15 Erbse und Bohne mit Potenzial Hella Hansen und Kerstin Spory 75 Demobetriebe zeigen, wie Anbau und Wertschöpfung der Leguminosen gelingen. Wissen wird gesammelt, gebündelt und für die landwirtschaftliche Praxis aufbereitet. 17 Körnererbsen und Ackerbohnen Chancen nutzen Gabriele Käufler Im Rahmen der hessischen Eiweißinitiative werden Landwirte durch gezielte Beratung zu Anbau und Verwertung von Körnerleguminosen unterstützt. 4 B&B Agrar 4 / 2016
5 @ ONLINE-SPEZIAL Soja auf dem Weg in die Schulen Sonja Huber, Theresa Mayer und Udo Ritterbach Soja Vom Acker auf den Teller : Unter diesem Titel geht 2017 eine Unterrichtskonzeption mit Unterrichtsmaterialien und einer Lehrerhandreichung für allgemeinbildende und berufliche Schulen an den Start. Ab September online Mehr Effizienz durch Selbst- Führung Katja Prinz Wie können Beratungskräfte sich selbst motivieren, um erfolgreich zu sein? Eine Frage, die in einem Workshop auf der IALB-Tagung in Irland diskutiert wurde. Das Zauberwort für eine effiziente Beratung heißt: Selbst-Führung. 20 Fester Bestandteil in der Fruchtfolge Michael Schlag Wie lässt sich der Anbau von Bohne und Erbse ganz praktisch im Betrieb umsetzen? Zwei Landwirte berichten über ihre Erfahrungen mit diesen Kulturen. BILDUNG 22 Gemeinsam zu mehr Unterrichtsqualität Andrea Pfirrmann und Roland Dörr Lernfeldunterricht soll die Handlungskompetenz jedes einzelnen Schülers fördern. Die Berufsschulpraxis im Ausbildungsberuf Pferdewirt/-in zeigt, wie wichtig Absprachen und Erfahrungsaustausch unter den Lehrkräften sind. 25 Breites Einsatzspektrum an berufsbildenden Schulen Antje Eder und Marcel Robischon An den Universitätsstandorten München und Berlin werden angehende Lehrkräfte umfassend auf ihren späteren Einsatz an beruflichen Schulen vorbereitet. 28 Telefonverhalten professionalisieren Ingrid Ute Ehlers und Regina Schäfer Die angemessene telefonische Kommunikation besitzt einen hohen Stellenwert im Berufsalltag. Allerdings werden Auszubildende darauf häufig zu unspezifisch vorbereitet. BERATUNG 30 Mehr als Milchkühe Innovationen fördern Bärbel Brettschneider-Heil Innovative Ideen zur Waldnutzung wurden unter anderem bei der IALB-Tagung in Limerick (Irland) präsentiert. PORTRÄT 31 Die Landwirtschaftsschule Weiden Ulrike Bletzer Wer Führungsverantwortung übernehmen möchte, erwirbt mit dem Wirtschafter für Landbau das erforderliche Rüstzeug. SCHUL-PROJEKTE 32 Wie man Sekt herstellt Oliver Schmidt Prickelndes Projekt an der Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg: Fachwissen, Teamarbeit und Medienkompetenz werden gestärkt. QUELLEN DATEN KOMMENTARE 34 Barcamp, Webinar und Co. Anne Dirking Das Spektrum der Angebote und Formate auf dem Weiterbildungsmarkt ist groß. Der Durchblick fällt oft schwer. Was ist was? B&B Agrar 4 /
6 AKTUELL Ausbildungsbetrieb des Jahres Auszeichnung für die niedersächsische Bentloh KG Foto: DBV Beim Deutschen Bauerntag in Hannover wurde die Bentloh KG in Scharnhorst (Niedersachsen), eine Betriebsgemeinschaft des Vollerwerbsbetriebs von Dirk Drögemüller und des Nebenerwerbsbetriebs von Wolfgang Alps, als Ausbildungsbetrieb des Jahres 2016 ausgezeichnet. Der Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV) und Vorsitzende des DBV- Fachausschusses Berufsbildung Werner Schwarz würdigte die vorbildlichen Ausbildungsbemühungen der Betriebsgemeinschaft, die stellvertretend für die aktiven Ausbildungsbetriebe in Deutschland stehen. Besonderes Engagement zeigte die Bentloh KG in der Öffentlichkeitsarbeit für die Land wirtschaft im Rahmen des niedersächsischen Projektes Trans parenz schaffen. Die Auszubildenden werden in die Hoferkundungen mit den Schulklassen fest integriert und lernen so, mit jungen Verbrauchern über den eigenen Beruf und die Landwirtschaft zu reden, sagte Schwarz. Bisher hat die Bentloh KG im Landkreis Celle 275 Hektar mit Schwerpunkt Milchviehhaltung 17 angehenden Landwirten das Rüstzeug für ihren späteren Beruf vermittelt. 130 Milchkühe werden in dem 2009 gebauten Boxenlaufstall von zwei Melkrobotern gemolken. Sorge um Zukunft der Gartenbauwissenschaften Der Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) sorgt sich um die Zukunft der Gartenbauwissenschaften in Deutschland. ZVG- Präsident Jürgen Mertz und ZVG-Generalsekretär Bertram Fleischer besuchten jetzt das Institut für gartenbauliche Produktionssysteme an der Leibniz-Universität in Hannover. Wir beobachten besonders an den Uni versitäten einen zunehmenden wissenschaftlichen Aderlass, erklärte Mertz. Die Leibniz Universität Hannover ist neben der Technischen Universität München und der Humboldt-Universität zu Berlin einer der drei universitären Standorte für das Gartenbaustudium in Deutschland. So ist auch in Hannover eine Negativentwicklung in den Gartenbauinstituten festzustellen. Dies äußert sich zum Beispiel durch nicht wieder besetzte Professorenstellen. Parallelen sieht der ZVG auch bei dem aktuellen Entschluss der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern (GWK) zur Abwicklung des Erfurter Standortes des Leibniz-Instituts für Ge müsebau- und Zierpflanzenforschung Großbeeren und Erfurt. Um die Zukunft der Gartenbauwissenschaft und -forschung in Deutschland zu sichern, sei zunächst wichtig, so der ZVG, dass Universitäten und Hochschulen die Leistungen der Gartenbauwissenschaft mit ihrem hohen gesamtgesellschaftlichen Wert wieder schätzen. Gleichzeitig sei eine stärker länderübergreifende Vernetzung der Wissenschaftsstandorte wichtig. Für die Betriebe des Gartenbaus ist die Überführung der wissenschaftlichen Leistungen in betriebliche Innovationen eine Frage des Überlebens im immer schärfer werdenden Wettbewerb. Dafür brauchen wir auch in Zukunft eine hervorragend aufgestellte Gartenbauwissenschaft, betonte Mertz. Auch bei der akademischen Feier des Albrecht Daniel Thaer- Azubis aus der EU: Große Welle blieb aus Eine Lehrstelle in Deutschland schien in den vergangenen Jahren vielen jungen Menschen in den EU-Krisenländern ein Ausweg aus der Perspektivlosigkeit allerdings nicht so vielen, wie allgemein gehofft. Letztlich haben weniger Jugendliche aus Südeuropa Ausbildungschancen in Deutschland wahrgenommen als von vielen erwartet, so Achim Dercks, stellvertretender Haupt geschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zu groß seien oftmals Sprachbarrieren sowie Bindungen an Familie und Dirk Drögemüller vermittelt den Auszubildenden, Praktikanten und Studierenden mit viel Gespür für junge Menschen das notwendige Fachwissen für einen erfolgreichen Abschluss. Die Auszubildenden schätzen das gute und familiäre Betriebsklima. Ausbilder Dirk Drögemüller betonte in seinen Dankesworten: Als Landwirte brauchen wir ein positives Image und die Akzeptanz in der Bevölkerung, um wirtschaften zu können. Es ist uns wichtig, junge Menschen während der Ausbildung unter anderem in Kommunikation zu schulen. An der hofeigenen Milchzapfstelle seien beispielsweise die Auszubildenden gefordert, Fragen der Verbraucher zur Tierhaltung oder über den Verzehr von Rohmilch zu beantworten. DBV Instituts für Agrar- und Gartenbauwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin nutzte der ZVG-Präsident die Gelegenheit, die Bedeutung von Forschung und Wissenschaft im Berufsstand hervorzuheben. Nicht nur der Strukturwandel im deutschen Gartenbau, sondern auch gesellschaftliche, demografische und klimatische Veränderungen stehen für einen Paradigmenwechsel, dem es zu begegnen gilt, erklärte Mertz. Fach- und Führungskräfte mit einer zugleich praktisch und wissenschaftlich fundierten Ausbildung werden auch zukünftig für die Gartenbaubranche unerlässlich sein. ZVG Freunde im Herkunftsland gewesen. Derzeit werden etwa ausländische Jugendliche über das Programm Mobi-Pro EU gefördert, sagte Dercks. Sie erlernen vor allem Berufe im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Pflegebereich sowie in der Metall- und Elektrotechnik. Zwar sei die Zahl dieser Azubis im Vergleich zu 2015 leicht gestiegen, die große Welle sei jedoch ausgeblieben. Der DIHK rechnet angesichts der Flüchtlingszuwanderung auch nicht mit einer nennenswerten Belebung. DIHK 6 B&B Agrar 4 / 2016
7 Bauernhofkindergarten Vom 2. bis 4. September findet im Bildungs- und Tagungszentrum Ostheide (Niedersachsen) die Bundestagung zum Kindergarten auf dem Bauernhof statt. Die Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof (BAGLoB) e.v. wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gefördert und gibt einen Überblick über die inhaltlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Chancen für einen Kindergarten auf dem Bauernhof. Die Zahl der Neugründungen von Bauernhofkindergärten ist stetig gestiegen. Die große Nachfrage lässt sich laut Ulrich Hampl von der BAGLoB dadurch erklären, dass immer mehr Eltern und Erzieher/-innen das große Entwicklungsund Bildungspotenzial für Kinder auf dem Bauernhof erkennen. Tiere füttern und Pflanzen versorgen auf einem echten Bauernhof erleben Kinder als sinnvoll, es macht Freude und schafft die Basis für umweltbewusste Lebensgestaltung. Immer mehr Höfe sehen in dem Angebot eine sinnvolle Weiterentwicklung ihrer Betriebe. Die Tagung bringt interessierte Landwirtinnen und Landwirte, Erzieherinnen und Erzieher Kreative Beratungstechniken nutzen Der Bundesverband Einzelhandelsgärtner (BVE) hat Beratungskräfte aus Österreich, Italien und Deutschland zum Beraterseminar nach Regensburg eingeladen, um einen länderübergreifenden Austausch zu aktuellen Marketingstrategien zu ermöglichen. Zunächst richteten Josef Hofbauer, Gartenbauzentrum Bayern Mitte, und Jörg Freimuth, Verbandsgeschäftsführer des Bayrischen Gärtnerei-Verbandes e. V. (BGV), den Blick auf die gartenbauliche Situation in Bayern. Vorträge externer Referenten ergänzten das Programm. Frank Teuber, Marketingmanager Blumenbüro Holland (BBH), erläuterte in seinem Vortrag Die Einzelhandelsgärtnerei Foto: agrarfoto.com sowie Vertreterinnen und Vertreter von Trägerorganisationen für Kindergärten zusammen. Anhand von Praxisbeispielen werden geeignete Organisationsformen vorgestellt und erörtert. Wer vor einer Neugründung steht, bekommt zahlreiche Tipps, was im Vorfeld zu bedenken ist und wie ein pädagogisches Konzept gestaltet werden kann. Ebenso werden bei der Tagung Herausforderungen thematisiert, die sich etablierten Bauernhofkindergärten stellen, wie zum Beispiel der Umgang mit steigender Nachfrage. Programm und Anmeldeunterlagen sind zu finden unter BAGLoB Bauernhof mit Entwicklungsund Bildungspotenzial für Kinder der Catwalk für Blumen und Pflanzen die Bedeutung gezielter Marketingstrategien und generischer Kommunikation ange sichts sich wandelnder Käufergruppen. Sanjay Sauldie, Direktor des European Internet Marketing Institute, berichtete über neueste Trends im Internet-Marketing und die zunehmende Relevanz von Social Media. Britta Tröster, Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI), stellte aktuelle Mark t- daten des gärtnerischen Fachhandels vor. Praxisnahe Denkanstöße gab der Workshop Kreativtechniken in der Gruppenberatung von Judith Landes, Mediatorin entra GmbH. Die Exkursionen führten zu vier Betrieben in der Nähe des Foto: BVE Mit dem Trendbarometer 2016 legt imove bereits zum sechsten Mal eine aktuelle Selbsteinschätzung der deutschen Bildungsexportbranche vor. Berufsbildungsexport weiter im Aufwind Die deutsche Bildungswirtschaft sieht die Entwicklung des Berufsbildungsexports weiterhin positiv verbunden mit vielen neuen Herausforderungen. Die Bildung strategischer Allianzen zum Aufbau des Auslandsgeschäfts, die Vernetzung der Bildungsangebote mit Industrie 4.0 sowie Investitionen in die Mehrsprachigkeit der Bildungsangebote gehören zu den wichtigsten Themen der Branche. Dies sind Ergebnisse des Trendbarometer 2016 Exportbranche Aus- und Weiterbildung von imove im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) (kostenlos verfügbar unter publikationen). Grundlegend ist und bleibt dabei das Alleinstellungsmerkmal der deutschen Berufsbildung: der hochgeschätzte duale Tagungsortes. Abschließend nutzten die Berater die Möglichkeit, sich über die gewonnenen Eindrücke auszutauschen, Kritik zu üben und mögliche Lösungen aufzuzeigen. Im Rahmen der Ideenwerkstatt wurden viele Beiträge der Berater Ansatz mit seinem Praxisbezug. 83 Prozent der Kunden im Ausland kennen die duale Ausbildung. Duale Bildungsangebote werden im Ausland bei 46 Prozent der Bildungsanbieter explizit nachgefragt. Asien und hier insbesondere China und Indien ist weiterhin der attraktivste Markt für die deutsche Bildungswirtschaft mit den größten Wachstumspotenzialen. imove (International Marketing of Vocational Education) ist die Exportinitiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Bildungsbereich. Als Arbeitsbereich des BIBB unterstützt imove deutsche Bildungsanbieter bei der Erschließung internationaler Märkte mit einem umfangreichen Serviceangebot. BIBB dazu genutzt, aktuelle Marketingprojekte vorzustellen und konkrete Themen des Arbeitsalltags zu besprechen. Das nächste Beraterseminar wird vom 15. bis 18. Mai 2017 in Südtirol stattfinden. ZVG/BVE Berater aus Italien, Österreich und Deutschland lernen neue praxis nahe Möglichkeiten kennen, um Gruppenberatungen aktiv zu gestalten. Foto: BIBB/iMOVE B&B Agrar 4 /
8 AKTUELL Hohe Qualität und Aktualität Die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Landwirtschaftlicher Fachbildung (vlf) betonte Anfang Juni in Bad Kreuznach die hohe Qualität und Aktualität der Aus- und Weiterbildung in den Grünen Berufen. In allen beruflichen Bildungsgängen wird den jungen, angehenden Fach- und Führungskräften die notwendige Fach- und Sachkunde vermittelt, die für eine erfolgreiche Wege zur Integration berufliche Tätigkeit unverzichtbar ist, hob Johann Biener, Präsident des vlf-bundesverbandes hervor. Die erworbenen Kenntnisse befähigen zu ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Wirtschaftsweisen. Mit Seminaren, Vortragsveranstaltungen, Exkursionen und Lehrfahrten engagiert sich der vlf bundesweit für eine qualifizierte Weiterbildung. DBV Den agrarischen Berufsschulen drohen bundesweit erhebliche Personalengpässe. Die Integration von jungen Geflüchteten in den Ausbildungsund Arbeitmarkt ist eine machbare Aufgabe, betonte der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), Friedrich Hubert Esser. Ein jetzt veröffentlichtes BIBB-Positionspapier beschreibt zehn Kernpunkte, wie es gelingen kann, jungen Geflüchteten ausgehend von ihren Potenzialen den Zugang in eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen und sie im weiteren Verlauf zu unterstützen (Download unter veroeffentlichungen/de/publication/show/id/8033). Eine Schlüsselrolle dabei nehmen laut BIBB-Positionspapier handlungsorientierte Angebote und betriebliche Phasen ein, wie zum Beispiel Einstiegsqualifizierungen, Praktika und Werkstatttage. Aber auch die Betriebe und vor allem das betriebliche Ausbildungspersonal benötigen besondere Unterstützung und Begleitung. Durch eine Ausweitung des externen Ausbildungsmanagements und der Assistierten Ausbildung muss ihre Ausbildungsfähigkeit gerade gegenüber jungen Geflüchteten gestärkt werden. Für betriebliche Ausbilderinnen und Ausbilder sollten in ihrer neuen Rolle als Lernbegleitung im Umgang mit dieser sehr heterogenen Zielgruppe spezielle, individuell ausgerichtete Fortbildungs- und Unterstützungsangebote konzipiert und angeboten werden. BIBB Foto: landpixel.de Lehrer für Grüne Berufe gesucht Angesichts des erheblichen Bedarfs an agrarischen Berufsschullehrern sind mehr Anstrengungen notwendig, die Aus- und Weiterbildung zu forcieren und für den Beruf zu werben. Der Deutsche Bauernverband (DBV) verweist auf Einschätzungen des Bundesverbandes Landwirtschaftlicher Fachbildung (vlf), der im Rahmen seiner Jahrestagung das Berufsbild des Berufsschullehrers in den Vordergrund rückte und ein Positionspapier formulierte (download unter In den kommenden Jahren werden laut vlf außerordentlich viele gut ausgebildete Berufsschullehrer gesucht, da viele Lehrkräfte in den Ruhestand gehen. Aus Sicht des Berufsverbandes ist es deshalb notwendig, nicht nur die Vielfältigkeit und Attraktivität dieses Berufes hervorzuheben, sondern auch die Lehrerausbildung möglichst attraktiv und bedarfsorientiert zu gestalten. Gleichzeitig muss auch die Weiterbildung von Lehrkräften der Berufsschulen gestärkt, möglichst praxisnah gestaltet und breiter verankert werden. Konkret fordert der vlf, bereits bei der Berufs- und Studienorientierung gezielt und systematisch über Qualifizierungs-, Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten als Berufs schullehrer/-in zu informieren. Unverzichtbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Lehrer tätigkeit sind neben einer fachlich und pädagogisch soliden Lehrerausbildung auch fundierte Kenntnisse der Berufspraxis sowie eine kontinuierliche berufsbegleitende Weiterbildung. Der vlf spricht sich dafür aus, angehende Berufsschullehrer in einem eng verzahnten Fach- und Pädagogikstudium einschließlich eines mindestens einjährigen beruflichen Praktikums zu qualifizieren. Dabei sollte eine bedarfsorientierte und flexible Auswahl von Zweit fächern möglich sein. Für die Personalauswahl und -ausstattung sowie den Personaleinsatz der Berufsschulen werden längerfristig angelegte Personalkonzepte gefordert. Dabei sollte auch der Einsatz geeigneter Personen aus der betrieblichen Praxis im Rahmen des Berufsschulunterrichts ermöglicht werden. Der vlf bietet sich in den Bundesländern nicht nur als Kooperationspartner bei der Weiterbildung von Berufsschullehrern an, sondern auch bei der Vermittlung von geeigneten Exkursions- und Projektbetrieben sowie Praxiselementen. DBV Auszeichnung für Helmut Born Der Bundesverband landwirtschaftlicher Fachbildung (vlf) hat Dr. Helmut Born mit der Theodor-Hensen-Medaille ausgezeichnet. Damit würdigt der vlf die besonderen Verdienste des langjährigen vlf-bundesgeschäftsführers und Generalsekretärs des Deutschen Bauernverbandes um die Förderung der beruflichen Bildung des Agrarbereichs auf Bundesebene. vlf-präsident Johann Biener hob in seiner Laudatio hervor, dass Born mehr als zwei Jahrzehnte lang nicht nur die bildungsfachlichen und bildungspolitischen Belange des vlf, sondern auch dessen konzeptionelle und operative Ausrichtung nach vorn entwickelt habe. Auch das umfangreiche Weiterbildungsangebot des vlf von der Kreis- bis zur Bundesebene wurde unter der Geschäftsführung von Born auf veränderte inhaltliche und organisatorische Anforderungen eingestellt. Mit hohem berufsständischen Engagement brachte er zudem neue Impulse zum Ausbau der bildungspolitischen Profilierung des vlf ein. vlf Foto: vlf 8 B&B Agrar 4 / 2016
9 SCHWERPUNKT Foto: Michael Schlag Kristin Nerlich Förderung für die Eiweißpflanzen Weltweit zählen über Arten zu den Leguminosen (Hülsenfrüchten). Die Eiweißpflanzenstrategie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat seit ihrem Start Ende 2012 besonders die Körnerleguminosen Soja, Lupine, Erbse und Bohne im Fokus. Der Anbau von Leguminosen ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Im Vergleich zu anderen Kulturen wie Mais, Getreide und Raps liefern Leguminosen geringere Erträge, die zudem stärker schwanken und auch das Anbaumanagement ist komplexer. Hinzu kommen mangelnde Vermarktungs- und Aufbereitungsmöglichkeiten. Durch den Anbaurückgang schwanden produktionstechnische Kenntnisse, Fortschritte in der Leguminosenzüchtung waren nur noch gering und auch die Verfügbarkeit von geeigneten und wirksamen Pflanzenschutzmaßnahmen nahm ab. Eiweißpflanzenstrategie Um diesem Negativtrend entgegenzuwirken und einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft zu leisten, sollen mit der Eiweißpflanzenstrategie des BMEL Leguminosen, das Wissen um ihren Anbau sowie die Verarbeitungs- und Verwendungsmöglichkeiten erhalten und weiterentwickelt werden. Ziel dabei ist es: Ökosystemleistungen und Ressourcenschutz zu verbessern, Wettbewerbsnachteile heimisch angebauter Leguminosen zu verringern, regionale Wertschöpfungsketten zu stärken, Forschungslücken zu schließen und erforderliche Maßnahmen in der Praxis zu erproben und umzusetzen. Zu Beginn der BMEL-Eiweißpflanzenstrategie vor über drei Jahren lag der Schwerpunkt zunächst auf der Etablierung von modellhaften Demonstrationsnetzwerken zur Stärkung des Wissenstransfers zwischen Forschung, Beratung und Praxis. So ist das Soja-Netzwerk im September 2013 gestartet. Das Lupinen-Netzwerk folgte etwa ein Jahr danach im Oktober Noch relativ jung ist das modellhafte Netzwerk zu Erbsen und Bohnen, das seit Frühjahr dieses Jahres läuft. Mit den Netzwerken werden entlang der gesamten Wertschöpfungskette beispielhaft Möglichkeiten vom Anbau bis zur Verwertung aufgezeigt und auf den Demonstrationsbetrieben aktuelle Ergebnisse aus der Forschung in die Praxis umgesetzt. Begleitend zu den Netzwerken kam die Förderung von Forschungsvorhaben hinzu. Mit diesen sollen bestehende Verfahren verbessert, Innovationen erzeugt und insbesondere die Züchtung leistungsstarker Sorten vorangebracht werden. Die BMEL-Eiweißpflanzenstrategie wird von der Geschäftsstelle Mehr zur Eiweißpflanzenstrategie und zu den Forschungsvorhaben: B&B Agrar 4 /
10 SCHWERPUNKT aid-pocket kostenlos, 10,5 x 10,5 cm 28 Seiten, Erstauflage 2016 Bestell-Nr Die Autorin Kristin Nerlich Geschäftsstelle Eiweißpflanzenstrategie Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Bonn eps@ble.de Eiweißpflanzenstrategie, die in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung angesiedelt ist, umgesetzt und koordiniert. Bis Ende 2018 stehen insgesamt 19 Millionen Euro Fördermittel für die Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Verfügung. Begleitende Forschung Die ersten begleitenden Forschungsvorhaben zu den modellhaften Demonstrationsnetzwerken Soja und Lupine sind im Herbst 2014 oder zu Vegetationsbeginn Anfang 2015 gestartet. Erbse und Bohne folgen in 2016 und Ein Überblick: Bei den Soja-Züchtungsprojekten geht es um die Entwicklung neuer Sorten, die zum Beispiel auch unter kühleren Bedingungen angebaut werden können. Ein weiteres Zuchtmerkmal ist die Frühzeitigkeit. Wichtiges Zuchtziel sowohl bei Soja als auch bei Lupinen stellt die Inhaltsstoffqualität dar. Bei den Lupinen stehen darüber hinaus vor allem der Kornertrag, die Ertragssicherheit und -stabilität im Vordergrund. Im Bereich Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit wird in einem Teilvorhaben zu Soja ein Schnelltest für das Auftreten von Pathoge nen entwickelt und in einem Lupinenprojekt erfolgt die Erarbeitung von Strategien zur Regulierung von Lupinenblattrandkäfern. Für einen erfolgreichen Sojaanbau ist gerade die frühere Entwicklungsphase entscheidend. Daher werden in einem Vorhaben Maßnahmen für ein zügiges, gleichmäßiges Auflaufen sowie ein kräftiges Jugendwachstum untersucht. Die Vorfruchtleistung, Stickstofffixierung und Reduzierung der Bodenbearbeitung zur Erosionsminderung stehen bei einem weiteren Projekt im Fokus. Darüber hinaus wird ein Vorhaben gefördert, das begleitend zu den Erhebungen in den drei Netzwerken Soja, Lupine und Erbse/ Bohne umfangreiche Daten zu Standort, Bewirtschaftung, phytopathologische Aspekte und Umwelt erfasst. Mit Futtermitteln beschäftigen sich derzeit drei Projekte. Ziel eines Sojavorhabens ist die Optimierung der dezentralen Sojaaufbereitung mittels Online-Prozesssteuerung unter Verwendung von Nahinfrarot-Spektroskopie. Um die Verwendung von Lupinen als Eiweißlieferant in der Fischfutterindustrie zu steigern, erfolgt in einem weiteren Vorhaben die Entwicklung von Verfahren zur Verbesserung der Verdaulichkeit von Lupinenmehl. Beim Vorhaben Forum Nachhaltigere Eiweißfuttermittel wird ein Dialogprozess mit allen Akteuren der Wertschöpfungskette für Eiweißfuttermittel aufgebaut, bei dem der Einsatz von nachhaltig erzeugten Eiweißfuttermitteln diskutiert wird. Fazit Mit der Eiweißpflanzenstrategie des BMEL soll der in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangene Anbau von Leguminosen in Deutschland gefördert werden. Im Fokus stehen dabei vor allem die Leguminosenforschung und Warum sind Leguminosen wertvoll? Vorhaben zur Demonstration von Möglichkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Aber auch agrarpolitische Maßnahmen wie die Ökologischen Vorrangflächen (Erste Säule) und die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (Zweite Säule) im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU tragen zu einer Anbauzunahme bei. In den vergangenen zwei Jahren hat die Anbaufläche von Soja, Lupine, Erbse, Ackerbohne und weiteren Hülsenfrüchten zur Körnergewinnung wieder zugenommen. In 2015 lag die Fläche bei etwa Hektar und hat sich damit im Vergleich zu 2013 mehr als verdoppelt. Einen weiteren Impuls und Stärkung des Bewusstseins in der Öffentlichkeit für den Nutzen von Leguminosen bietet das Internationale Jahr der Hülsenfrüchte (IJH), das die Generalversammlung der Vereinten Nationen für 2016 ausgerufen hat. Mit dem IJH wird die Möglichkeit genutzt, auch weltweit die Produktion von Hülsenfrüchten zu stimulieren, Herausforderungen beim Handel mit Hülsenfrüchten anzugehen und Eiweiß aus Hülsenfrüchten besser zu nutzen. Leguminosen weisen zahlreiche positive Eigenschaften auf. Die vielleicht bekannteste ist die Symbiose mit Knöllchenbakterien, den sogenannten Rhizobien. Diese sind in der Lage, den Stickstoff aus der Luft zu binden und den Pflanzen zur Verfügung zu stellen. Auf die Stickstoffdüngung kann somit in der Regel verzichtet werden, wodurch Treibhausgas-Emissionen reduziert werden, die bei der Produktion, dem Transport und der Ausbringung der Düngemittel entstehen würden. Von dem fixierten Stickstoff profitieren nicht nur die Leguminosen selbst, sondern auch nachfolgenden Kulturen steht ein Teil dieses Nährstoffs zur Verfügung und die Bodenfruchtbarkeit wird gefördert. Zudem weisen Leguminosen eine positive Humuswirkung auf. Mit den Pfahlwurzeln können Leguminosen den Boden tief durchwurzeln, Bodenschadverdichtungen werden aufgeschlossen und die Regenwurmpopulation nimmt zu. Durch den Anbau von Leguminosen wird das Fruchtartenspektrum erweitert und enge Fruchtfolgen werden aufgelockert, wodurch die Agrobio diversität gefördert wird. Mit weiter gestellten Fruchtfolgen wird das Risiko von Resistenzbildungen gegen Pflanzenschutzmittelwirkstoffe vermindert und ein Beitrag zum integrierten Pflanzenschutz geleistet. Dadurch kann der Einsatz an Pflanzenschutzmitteln reduziert und deren negative Wirkung auf die biologische Vielfalt verringert werden. Für nektar- und pollensammelnde Insekten stellen die Blüten der Leguminosen eine gute Nahrungsgrundlage dar. Darüber hinaus sind Leguminosen ein wertvoller Eiweißlieferant und werden sowohl in der menschlichen als auch in der tierischen Ernährung verwendet. Weitere Informationen auch unter 10 B&B Agrar 4 / 2016
11 Nina Weiher Heimische Soja forcieren Das Soja-Netzwerk ist Teil der Eiweißpflanzenstrategie des Bundes. Hauptaufgaben: den Wissensaustausch zwischen Forschung, Beratung und Praxis unterstützen und so den Anbau und die Ver wertung von Sojabohnen in Deutschland ausweiten. Foto: Alexander Kögel Soja ist aufgrund seines hohen Eiweißgehaltes unverzichtbar in der Nutztierfütterung und wird ebenfalls für den menschlichen Verzehr genutzt. Der Bedarf an Soja ist hierzulande deutlich höher als das Angebot. Ziel des im September 2013 gestarteten Projekts ist die Ausweitung des Anbaus und der Verarbeitung von Sojabohnen in Deutschland. Das Verbundvorhaben Soja-Netzwerk wird von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), der Landesvereinigung für den Ökologischen Landbau in Bayern e. V. (LVÖ), dem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) sowie der Life Food GmbH/ Taifun Tofuprodukte be arbeitet. Die Gesamtkoordination sowie das Datenmanagement des Verbundprojektes übernimmt die LfL. Praxiserfahrungen Wichtiger Bestandteil des Projekts sind die Demonstrationsbetriebe, auf denen aktuelle Erkenntnisse aus der Soja-Forschung in die Praxis umgesetzt werden. Zudem werden schlagbezogene Daten zum Sojaanbau, zu Fruchtfolgen sowie Vergleichs- und Nachfrüchten erfasst. Die Demonstrationsbetriebe sind der Kern des Soja-Netzwerks, dabei wird zwischen zwei Kategorien (Leuchtturm- und Datenerfassungsbetriebe) unterschieden. Auf allen Betrieben werden Daten zum Sojaanbau erhoben, die Aufschluss über die Wirtschaftlichkeit geben sollen. Auf Leuchtturmbetrieben werden zudem Demonstrationsflächen angelegt, um den aktuellen Stand des Wissens zum Sojaanbau einem interessierten Publikum auf Feldtagen oder Feldbegehungen zu vermitteln. Im Netzwerk sind 120 ökologisch und konventionell wirtschaftende Betriebe (46 Prozent der Betriebe wirtschaften konventionell, 54 Prozent ökologisch) aus elf Bundesländern eingebunden; der Schwerpunkt liegt in Bayern und Baden-Württemberg. Die Demonstrationsbetriebe (ökologisch und konventionell) in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und im Saarland werden über die ins Netzwerk eingebundenen Ländereinrichtungen betreut. Die Leuchtturmbetriebe stellen sich mit Hofportraits vor: leuchtturmbetriebe/. Die Daten werden bei der LfL zentral analysiert und informieren über Wirtschaftlichkeit, Vorfruchtwirkung und Ökosystemleistungen der Sojabohne. Alle bisherigen Ergebnisse der Datenauswertung zu Betrieben, Schlägen und Demonstrationsanlagen sind zu finden unter: datenzusammenfassung-der-jahre /. Verwertung von Soja Zur Verbesserung der Verwertung von Soja in Deutschland werden drei modellhafte Wertschöpfungsketten konzipiert, bei denen vom Feld bis zum Futter oder Lebensmittel alle maßgebenden Stationen analysiert werden: Wertschöpfungskette ökologische Futtersoja Ziel sind die Konzeption und der modellhafte Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten für Bio-Futtersoja unter Einbeziehung von Erzeugern, Erzeugergemeinschaften (Erfassung, Lagerung, Aufbereitung, Qualitätsfeststellung), Verarbeitungsunternehmen (thermische Aufbereitung, Futterherstellung) und Veredelungsbetrieben (Verwertern). Nach der Erarbeitung von möglichen Erfolgsfaktoren, Problemen und Flaschenhälsen erstellt die LVÖ gemeinsam mit Experten entlang der Wertschöpfungskette ein Konzept für den Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten für ökologisch erzeugte Futtersoja. Dieses Konzept wird in enger Zusammenarbeit mit den Marktakteuren umgesetzt und anhand der gewonnenen Erfahrungen optimiert. Ziel ist die Erstellung eines Leitfadens, der kritische Erfolgsfaktoren benennt und Problemlösungen beim Aufbau einer Wertschöpfungskette für Öko-Futtersoja aufzeigt, und damit Online-Sojaportal Weitere Partner im Netzwerk: Landeskuratorium für pflanzliche Erzeugung in Bayern e. V., Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Leibnitz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e. V., Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Landwirtschaftskammern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Saarland, Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, Kraichgau Raiffeisen Zentrum eg, die ZG Raiffeisen Gruppe, überregionaler Berater Jürgen Unsleber, Pädagogische Hochschule Freiburg Seit Anfang April 2014 ist eine gemeinsame Website des Projektes Soja-Netzwerk und des Deutschen Sojaförderrings für die Öffentlichkeit zugänglich. Unter entsteht ein umfassendes Sojaportal für alle Akteure entlang der Soja-Wertschöpfungskette für Landwirte, Erfasser, Verarbeiter, Züchter, Saatguterzeuger und Forscher. Landwirte und Berater finden auf der Website ausführliche Informationen zu allen Aspekten der Soja- Produktionstechnik von der richtigen Saatgutimpfung bis zu Finessen der Erntetechnik. Über eine interaktive Deutschlandlandkarte können die Sorten-Versuchsergebnisse der letzten drei Jahre von 36 Standorten abgerufen werden. Bei Fragen finden interessierte Erzeuger die Kontaktdaten von Sojaberatern in ihrer Nähe sowie Veranstaltungshinweise. B&B Agrar 4 /
12 SCHWERPUNKT Foto: Alexander Kögel Wichtig beim Sojaanbau ist eine erfolgreiche Impfung des Saatgutes mit Bradyrhizobien, die in den Böden hierzulande nicht vorhanden sind und deshalb mit der Saat ausgebracht werden müssen. Der Vergleich des Knöllchenbesatzes an den Sojawurzeln gibt Aufschluss über den Erfolg verschiedener Impfverfahren. Die Aktivität der Knöllchenbakterien sichert den Großteil der N-Versorgung der oberirdischen Pflanzenteile der Soja. Gesunde, aktive und somit leistungsfähige Knöllchen sind durch rote Färbung im Inneren gekennzeichnet, absterbende Knöllchen sind olivgrün gefärbt. Projekt Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zur Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und der Verwertung von Sojabohnen in Deutschland (Soja- Netzwerk), Laufzeit: bis , gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages im Rahmen der BMEL- Eiweißpflanzenstrategie. Die Autorin Dr. Nina Weiher Projektkoordination Soja-Netzwerk Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Freising ein für andere Akteure übertragbares Erfolgskonzept darstellt. In Bayern wurden im Jahr 2013 etwa 860 Hektar Bio-Soja angebaut, dies entspricht in etwa einem Drittel der gesamten Sojaanbaufläche im Bundesland. Die Hauptanbaugebiete sind die körnermaisfähigen Standorte in Niederbayern, Oberbayern, Schwaben und Unterfranken. In der Schweine- und Geflügelfütterung haben vor allem die Trypsininhibitoren in der rohen Bohne eine antinutritive Wirkung und senken die Verdaulichkeit des Proteins. Diese müssen durch Wärmebehandlung inaktiviert werden (Toasten). Hierzu gibt es in Bayern aktuell vier Sojaaufbereitungsanlagen mit unterschiedlichen Aufbereitungskonzepten. Die langen Transportwege zu den wenigen Aufbereitungsanlagen stellen ein entscheidendes Hemmnis für die Ausweitung des Sojaanbaus in Bayern dar. Daher ist ein intensiver Ausbau der Infrastruktur zur Erfassung und Aufbereitung von Soja wichtig. Kritisch zu sehen, ist auch die unzureichende Auslastung der Aufbereitungsanlagen für Futtersoja (nur zu knapp 50 Prozent). Dieser Problematik soll durch die Konzeption innovativer Vertragsproduktion entgegengewirkt werden. Im Laufe des Projektes werden exemplarische Wertschöpfungsketten begleitet. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen als Grundlage für den praxisgerechten Leitfaden. Wertschöpfungskette konventionelle, gentechnikfreie Futtersoja Die modellhafte Wertschöpfungskette für konventionelle, gentechnikfreie Futtersojabohnen wird am Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg gemeinsam mit den Projektpartnern Kraichgau Raiffeisen Zentrum eg Eppingen (KRZ) und der ZG Raiffeisen Gruppe (ZG) konzipiert, wobei vom Feld bis zum Futter alle maßgebenden Stationen berücksichtigt und zusammengeführt werden. Dieser Überblick wird in der Projektlaufzeit noch ergänzt und verfeinert. Dabei zeichnet das KRZ unter anderem für eine Potenzialanalyse und Steigerung der Wertschöpfungskette bei Futtersoja mit Erbsen-Soja-Gemisch verantwortlich. Die ZG bearbeitet unter anderem die Optimierung der Saatgutvermehrung und Saatgutaufbereitung. Beide Wirtschaftspartner übernehmen zudem Aufgaben in den Bereichen Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit. Wertschöpfungskette Lebensmittelsoja Die Firma Life Food GmbH/Taifun Tofuprodukte betreibt seit 1997 Vertragsanbau von Tofu-Sojabohnen. Inzwischen stammen gemäß Firmenziel mindestens 70 Prozent der verbrauchten Sojabohnen aus europäischem Anbau in Deutschland (vor allem Baden), Frankreich und Österreich. Taifun hat sich als namhafter Partner für den Vertragsanbau von hochpreisigen Qualitäts- Sojabohnen etabliert. In den vergangenen Jahren wurden neue Vertragsflächen vor allem in Frankreich und Österreich akquiriert. In Deutschland geht der Flächenzuwachs deutlich langsamer als gewünscht voran. Im Rahmen des Projektes Soja- Netzwerk wird daher ein Konzept erstellt und umgesetzt, mit dem innerhalb von zwei Jahren zehn neue Sojaerzeuger für den Vertragsanbau von Tofu-Sojabohnen gewonnen werden können. Die Erkenntnisse werden in eine Broschüre Erfolgreicher Vertragsanbau von Tofu-Sojabohnen in Deutschland einfließen. Es werden fördernde Faktoren dargestellt und mögliche Schwierigkeiten, Hindernisse und Flaschenhälse herausgearbeitet. Wissenstransfer Eine der Hauptaufgaben des Soja- Netzwerks ist der Wissensaustausch zwischen Forschung, Beratung und Praxis. Daher werden über die gesamte Projektlaufzeit von allen Projektpartnern Maßnahmen wie Feldtage, Seminare und Vortragsveranstaltungen durchgeführt. Zudem entwickelt die Pädagogische Hochschule Freiburg eine Unterrichtskonzeption zum Thema Pflanzliche Eiweiße für die Ernährung des Menschen aus nachhaltiger Landwirtschaft am Beispiel Soja für allgemein- und berufsbildende Schulen (s. Online Spezial). Bisher wurden zahlreiche Feldtage und Feldbegehungen, zwei Lehrfahrten, eine große Tagung sowie Vorträge und Seminare angeboten. Die Exkursionen gaben einen Einblick in den aktuellen Soja-Anbau, es wurden Feldversuche besichtigt und Soja-Züchter und -Aufbereiter sowie Praxisbetriebe besucht. Mit großem Interesse nahmen jeweils bis zu 200 Landwirte und Personen aus Handel, Beratung und Forschung bei den Veranstaltungen teil. Auf den Demoanlagen der Leuchtturmbetriebe im Netzwerk wurden aktuelle Erkenntnisse wie beispielsweise verschiedene Anbautechniken (Drillsaat, Einzelkornsaat, Direktsaat, Striptillage), Zwischenfruchtvarianten vor Soja (Hafer, Senf, Wicke, Phazelia, Zwischenfruchtmischung), Soja-Sorten verschiedener Reifeklassen, Reihen abstandvarianten, verschiedene Varianten der Unkrautregulierung (konventionell: Vorauflauf- und Nachauflauf-Herbizidvarianten, öko: verschiedene mechanische Verfahren der Beikrautregulierung), verschiedene Impfvarianten, verschiedene Saatstärken in der Praxis vorgestellt. Ebenso wurden produktionstechnische Maßnahmen und Optimierungsansätze besprochen und erarbeitet. Die anschließenden fachspezifischen Diskussionen dienten zur Beratung und zum Wissensaustausch. 12 B&B Agrar 4 / 2016
13 Annett Gefrom Vorzüge der Lupine ausschöpfen Als Teil der Eiweißpflanzenstrategie des Bundes ist es Ziel des Lupinen-Netzwerks, den Anbau und die Verarbeitung von Lupinen für die Tier- und Humanernährung auszuweiten und zu verbessern. Regionale Wertschöpfungsketten sollen weiterentwickelt werden. Foto: A. Gefrom, LFA MV Die Fähigkeit der Lupine, Luftstickstoff mit Hilfe von Knöllchenbakterien zu fixieren so wie schwer lösliche Phosphate zu mobilisieren, macht sie zu einer hervorragenden Vorfrucht, besonders auf leichten Standorten. Durch Ausbildung einer Pfahlwurzel lockert die Kultur den Boden auf. Hülsenfrüchtler erweitern zudem enge Getreide-Raps-Fruchtfolgen. Diese und noch viele andere Ökosystemleistungen machen den Lupinenanbau ackerbaulich so interessant. Da aber Lupinen in den vergangenen Jahrzehnten weitestgehend aus der Fruchtfolge verdrängt wurden, ging auch das Wissen um den Anbau verloren. So sind geringe Erträge und Ertragsschwankungen im Lupinenanbau häufig auch Folge von Fehlern im Anbauverfahren. Die Bodenvorbereitung und Pflege genügen oft nicht den Ansprüchen der Pflanze. Saattiefe und Saattermin sind nicht immer optimal gewählt. Doch alle Körnerleguminosen benötigen einen bestmöglichen Start. Zu den Erfolgsfaktoren im Lupinenanbau zählt neben Saatgutverfügbarkeit und Saatgutqualität, der Guten Fachlichen Praxis bei der Saatbettbereitung, Saatgutimpfung und Unkrautbekämpfung vor allem die Züchtung ertragssicherer Sorten mit hohem Proteinertrag und wünschenswert mit passendem Aminosäuremuster bei gleichmäßiger Abreife. Produktionstechnische Innovationen und die Inves tition in den Pflanzenschutz sind gefordert, auch um einheitliche große Partien mit definierter Qualität für den Handel bereitzustellen. Lupinen-Netzwerk Als Teil der Eiweißpflanzenstrategie des Bundes besteht das Ziel im Projekt Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zu Anbau und Verwertung von Lupinen (Kurzbezeichnung: Lupinen-Netzwerk) in der Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und der Verarbeitung von Lupinen für die Tier- und Humanernährung und der Weiterentwicklung regionaler Wertschöpfungsketten. Hierfür arbeiten unter Leitung der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern verschiedene Verbundpartner (Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt, Landwirtschaftskammer Nordrhein- Westfalen, Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung im Land Brandenburg, LMS Agrarberatung GmbH und ZALF e. V.) sowie weitere Kompetenzstandorte mit vielen Fachleuten, beginnend in der Züchtungsforschung bis zur Lebensmittelherstellung, zusammen. Die Berater sind Bindeglieder zwischen den Projektpartnern in der Forschung und landwirtschaftlichen Praxis. Wichtiger Bestandteil des Projekts sind die 52 Leuchtturm- und Datenerfassungsbetriebe, auf denen aktuelle Erkenntnisse zum Lupinenanbau und zur -verwertung aus der Forschung in die Praxis umgesetzt werden. Hierzu werden Daten zu Anbau (Boden, Witterung, Anbautechnik), Futterwert der Lupine (Analytik), zur Wirtschaftlichkeit (Kosten, Erlöse) und Ökosystemleistung (Vorfruchtwert der Lupine) erfasst. All diese Daten werden vom Datenmanagement für die Beratung aufgearbeitet. So kann bereits heute der Wissensaustausch zwischen Forschung, Beratung und Praxis wirksam werden. Hierzu dienen auch die in den Leuchtturmbetrieben durchzuführenden Feldtage mit Demonstrationen zum Best-Practice-Anbau von Lupinen. Über den Anbau hinaus werden auch die Aufbereitung und Verwertung von Lupinen in der Tierhaltung (zum Beispiel Milchkuh, Legehennen, Schwein) sowie innerhalb der Produktveredelung für die Human ernährung als einzelne Wertschöpfungsketten transparent dargestellt. Es gehört zum ehrgeizigen Ziel, im Verbundvorhaben Perspektiven für die Verwertung aufzuzeichnen sowie Handels- und Vermarktungsstrukturen darzustellen, um regionale Wertschöpfungsketten zu stärken und weiterzu- Projekt Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zur Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und der Verwertung von Lupinen in Deutschland (Lupinen-Netzwerk), Laufzeit bis , gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundes tages im Rahmen der BMEL-Eiweißpflanzenstrategie. Erfahrungen aus der Netzwerkarbeit und dem Demonstrationsanbau: landwirtschaft-mv.de/ cms2/lfa_prod/lfa/ content/de/fachinfor- mationen/lupinen- NETZWERK/index.jsp B&B Agrar 4 /
14 SCHWERPUNKT Foto: A. Priepke, LFA MV Die Ausbildung landwirtschaftlicher Fachkräfte profitiert vom Lupinen-Netzwerk. Die SWOT-Analyse engl. Akronym für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Bedrohungen) ist ein Instrument der strategischen Planung. Sie dient der Positionsbestimmung und der Strategieentwicklung von Unternehmen und anderen Organisationen. Die Autorin Dr. Annett Gefrom Projektkoordination Lupinen-Netzwerk Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei MV, Gülzow-Prüzen entwickeln und um Voraussetzungen zu schaffen, die Lupine dauerhaft im Lebensmittelbereich zu etablieren. Erste Erfolge Das Lupinen-Netzwerk wird durch intensive Öffentlichkeitsarbeit gut wahrgenommen und für die Beratung zu Anbau und Verwertung von Landwirten aus ganz Deutschland frequentiert. Die Netzwerkstrukturen konnten bereits durch Zuarbeit von Landwirten, Vertretern der Züchtung, der Beratung, des Agrarhandels, der Verarbeitungsindustrie und der Politik ausgebaut werden. Mithilfe von Umfragen bei Landwirten und Projektpartnern zu Beweggründen, Problemen und Erfolgsfaktoren sowie Perspektiven und Zielen bezüglich Anbau, Vermarktung und Verwertung wurde der Weg der Lupine entlang vieler Wertschöpfungsketten aufgezeichnet und eine SWOT-Analyse erstellt: cms2/lfa_prod/lfa/content/de/ Fachinformationen/LUPINEN- NETZWERK/index.jsp Die Beweggründe der Landwirte zur Teilnahme im Lupinen-Netzwerk definieren grundlegend die Aufgaben für die Akteure in den Bereichen Anbau, Aufbereitung und Verwertung. Der in Umfragen ermittelte Bedarf an produktions- technischen Innovationen hinsichtlich Anbau, Technologien und Produktentwicklungen über Lagerung, Aufbereitung und Futterwertverbesserung bietet die Möglichkeit zur Initiierung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (F&E) aus der Netzwerkarbeit heraus. Bei der Betreuung der Feldbestände arbeiten die Projektberater eng mit dem Landwirt zusammen. Einige Landwirte nutzten die Zusammenarbeit im Lupinen-Netzwerk zur Ausbildung der landwirtschaftlichen Fachkräfte (zum Beispiel Meister schüler). Durch die Zusammenarbeit mit Universitäten (zum Beispiel Lupinenschaugarten an der FH Neubrandenburg, Agrarfakultät Rostock) erhalten Studenten die Möglichkeit, Praktika im Rahmen des Netzwerks zu absolvieren und Qualifizierungsarbeiten zu schreiben, beispielsweise bei der ackerbaulichen Datenerhebung oder bei der Ausgestaltung von Einsatzmöglichkeiten der Lupine in der Tier ernährung oder bei der Darstellung weiterer Wertschöpfungsketten. Neben der Demonstration von Lupinenanbau und -verwertung sowie der betriebsindividuellen Beratung ermöglicht die Teilnahme im Lupinen-Netzwerk die Vernetzung zwischen Anbauer, Verarbeiter und Verwerter und die Rückkopplung zwischen Forschung, Beratung, Praxis, Wirtschaft und Politik, um Innovationen zu unterstützen und Handels- und Vermarktungsstrukturen aufzuzeigen. Erste Erkenntnisse aus dem Demonstrationsanbau, aus den integrierten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben und aus dem Erfahrungsaustausch zum Lupinenanbau mit Landwirten wurden mit den Anbauempfehlungen aus Landessortenversuchen und der Züchter abgeglichen und sind online abrufbar ( NEN-NETZWERK/index.jsp). Ergebnisse aus den Arbeiten können für die Erstellung von Lehrmaterialien an Berufsschulen bis hin zu Universitäten verwendet werden. Bei Fach- und Verbrauchermessen wie der Internationalen Grünen Woche, Biofach, Agrar oder Mela oder den DLG-Feldtagen und dem Tag des offenen Hofes ist das Lupinen-Netzwerk in Zusammenarbeit mit Projektpartnern in der Öffentlichkeitsarbeit zur Lupine präsent. Hier informieren Mitarbeiter die Besucher Schüler, Studenten, Landwirte und Verbraucher (Vegetarier oder Veganer). Denn die Lupine findet seit einigen Jahren auch Platz in den Lebensmittelregalen der Discounter. Zur Erhöhung von Akzeptanz und Attraktivität bei pflanzenbasierten Drinks, Joghurts, Eiscremes, Kuchen, Brot-, Fleisch- und Wurstwaren und Grundzutaten für schmackhafte Speisen kommt der Beratung auch hier eine Schlüsselrolle zu. Herausforderungen Durch Greening-Förderung und Förderprogramme der Bundesländer wie zum Beispiel Agrarumweltmaßnahmen (Vielfältige Fruchtfolgen) wurde die Anbaufläche von Körnerleguminosen in Deutschland 2015 im Vergleich zum Vorjahr vor allem im konventionellen Ackerbau stark ausgedehnt. Der Lupinenanbau stieg dabei um 39 Prozent. Das noch junge Lupinen-Netzwerk möchte für die anstehende Lupinenernte den teilnehmenden Landwirten bei der Vermarktungsplanung helfen und mögliche Handelspartner benennen und bezüglich der vom Handel geforderten Qualitäten und Mengen an Lupinen unterstützend zuarbeiten. Hierzu sucht das Lupinen-Netzwerk den offenen Dialog mit den Akteuren entlang aller Wertschöpfungsketten und allen Lupinen-Kompetenzen. Die Erfassung von Angebot und Nachfrage soll heimisch erzeugte Hülsenfrüchte in die Handelswege bringen, Wertschöpfungsketten in ihrer weiteren Entwicklung voranbringen und so den Anbauumfang sukzessiv steigern. Das Verwertungspotenzial der Lupine im Ackerbau, der Tierhaltung und der Humanernährung oder zukünftig auch in der verarbeitenden Industrie bietet verschiedenen Unternehmen unterschiedliche Ansatzpunkte im Lupinen-Netzwerk mitzuwirken, um dieses auch über die Projektlaufzeit (bis Dezember 2017) hinaus zu verstetigen. Nur eine funktionierende Wertschöpfungskette schafft auch den ökonomischen Anreiz für einen wachsenden Anbau von heimischen Eiweißpflanzen. 14 B&B Agrar 4 / 2016
15 Foto: Klaus-Peter Wilbois, FiBL Hella Hansen und Kerstin Spory Erbse und Bohne mit innovativem Potenzial 75 Demobetriebe zeigen, wie Anbau und Wertschöpfung der Leguminosen gelingen. Wissen wird gesammelt, gebündelt und für die landwirtschaftliche Praxis aufbereitet. Das Ziel des modellhaften Demonstrationsnetzwerks Erbse/Bohne ist es, Anbau und Verarbeitung dieser beider Kulturen in Deutschland zu unterstützen sowie Nachfrage und Angebot zusammenzubringen, erklärt Projektkoordinator Ulrich Quendt vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH). Unter der Leitung des LLH sind deutschlandweit 75 landwirtschaftliche und verarbeitende Demonstrationsbetriebe aus zehn Bundesländern sowie weitere bundesweit agierende Partner für das Demonstrati- onsnetzwerk Erbse/Bohne (Demo- NetErBo) aktiv. Wissen wird gesammelt, gebündelt und so aufbereitet, dass es allen Interessierten zur Verfügung steht. Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) ist im Projekt für den Bereich Wissenstransfer verantwortlich. Es sorgt mit weiteren Projektpartnern dafür, dass die Erfahrungen der einzelnen Landwirte in die Branche gelangen. Alle, die sich für Kulturen der Erbse und Bohne interessieren, finden auf der Projektwebseite eine Fülle von Anregungen und Tipps. Durch eine professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden vor allem auch die konventionellen Fachmedien auf die Aktivitäten des Netzwerkes aufmerksam gemacht. Praktische Ansätze Circa 60 Prozent der Demobetriebe wirtschaften konventionell, 40 Prozent ökologisch. Sie zeigen innovative und praktische Ansätze im Anbau und in der Verwertung von Erbsen und Bohnen. Dazu veranstalten die Demobetriebe Feldtage und Betriebsbesichtigungen und sind Ansprechpartner sowie Vernetzungspunkte für Berufskollegen. Außerdem werden ihre Erfahrungen erfasst und daraus Hinweise zur Optimierung von Anbau, Aufbereitung und Nutzung abgeleitet. Denn der Anbau von Erbsen und Bohnen hat viele Vorteile. Die Leguminosen erweitern die Frucht- Projekt Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zur Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und der Verwertung von Leguminosen mit Schwerpunkt Erbsen und Bohnen in Deutschland, Laufzeit 2016 bis 2018, gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages im Rahmen der BMEL-Eiweißpflanzenstrategie, Projektkoordination: Ulrich Quendt, ulrich. Informationen zum Netzwerk, zu den Demobetrieben und zu Feldtagen und Betriebsbesichtigungen sowie zu Erbsen und Bohnen unter: agrarpraxisforschung. de B&B Agrar 4 /
16 SCHWERPUNKT Foto: FH Südwestfalen Landwirte haben zum Beispiel Fragen zur Verfütterung der Leguminosen. Die Autorinnen Hella Hansen Kerstin Spory Beide: FiBL Projekte GmbH, Frankfurt folgen, helfen die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern und steigern die Nährstoffverfügbarkeit. Leistungen für das Ökosystem erweitern ihr Potenzial um einen gesellschaftlichen Nutzen: Sie dienen als Nahrungsquelle für Bestäuber und fördern so die biologische Vielfalt. Erbsen und Bohnen enthalten zudem wertvolles Eiweiß, das sowohl als Tierfutter wie auch für die menschliche Ernährung ideal geeignet ist. Das hört sich nach wahren Wunderpflanzen an. Warum also werden sie in Deutschland nur auf einer verschwindend geringen Fläche von weniger als einem Prozent angebaut? Wissen vermitteln Wie immer gibt es auch eine Kehrseite der Medaille. Erbsen und Bohnen sind schwierig anzubauen, Rückschläge nicht immer zu vermeiden. Die Kulturen reagieren empfindlich auf Bodenverdichtung, werden deshalb züchterisch wenig bearbeitet und es gibt nur relativ wenige Pflanzenschutzmittel, mit denen sie behandelt werden dürfen. Die Erfahrungen zur Kultivierung sowie Aufbereitung, Fütterung und Vermarktung von Erbsen und Bohnen ist aus diesen Gründen in der landwirtschaftlichen Praxis weitgehend verloren gegangen, erläutert Projektleiter Quendt. Das DemoNetErBo soll das Wissen über die Vorteile der Leguminosen wieder in die Breite der Betriebe bringen. Am dringendsten haben die Landwirte Fragen zum Anbau, zur Foto: LLH Saattechnik, zur Sortenwahl, dem Umgang mit Krankheits- und Schädlingsdruck sowie der Verfütterung. Es gibt viele Ansprechpartner im Netzwerk, an die sie sich wenden können. Neben den Netzwerk-Betrieben in zehn Bundesländern können in jedem dieser Länder noch sogenannte Netzwerkpartner weiterhelfen. Das sind Landesämter, Kammern oder Dienstleistungszentren. Dort gibt es spezielle Berater, die den Demobetrieben mit Rat und Tat zur Seite stehen, den Wissenstransfer und Feldtage sowie Betriebsbesichtigungen organisieren. Ackerbohne: Wurzel mit Rhizobien Zusätzlich zu den Ländereinrichtungen gibt es weitere Netzwerkpartner, die beispielweise wissenschaftliche Fragestellungen bearbeiten oder koordinierende Funktionen haben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachhochschule Südwestfalen betrachten beispielsweise den Anbau und die Verwertung aus ökonomischen Gesichtspunkten. Dabei werden natürlich auch die Ökosystemleistungen wie Fruchtfolgeeffekte mit einbezogen. In der Universität Hamburg werden die Qualitäten der Ernteprodukte untersucht, um den Einsatz als Futter oder in der verarbeitenden Industrie zu bewerten. Es muss sich noch herausstellen, welche Qualitäten über den Rohproteingehalt hinaus benötigt werden und ob sich daraus neue Vermarktungsfelder ergeben könnten. Schwerpunkt des Netzwerkes ist die Abbildung der gesamten Wertschöpfungskette: also nicht nur die innerbetriebliche Verwertung, sondern auch die Verwertung im nachgelagerten Bereich, sei es durch die Einbindung des Landhandels, der Futtermischer oder der Verarbeitung. Nur ein gesicherter Absatz und ein angemessener Erlös für den Landwirt geben diesem Anreiz, Erbsen und Bohnen anzubauen. Die Demobetriebe zeigen viele Beispiele, wie Anbau, Aufbereitung und Vermarktung funktionieren können. 16 B&B Agrar 4 / 2016
17 Foto: Michael Schlag Gabriele Käufler Körnererbsen und Ackerbohnen Chancen nutzen Im Rahmen der hessischen Eiweißinitiative werden Landwirte durch gezielte Beratung zu Anbau und Verwertung von Körnerleguminosen unterstützt. Die im Versuchswesen gewonnenen Erkenntnisse fließen dabei ein. Das Versuchsprogramm mit Körnerleguminosen beim Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) wurde in den vergangenen Jahren sukzessive ausgeweitet, um der steigenden Nachfrage nach Daten Rechnung zu tragen. An unterschiedlichen Standorten, die typische Anbaulagen für diese Kulturen in Hessen repräsentieren, werden Landessortenversuche (LSV) mit Körnererbsen und Ackerbohnen betreut. Dazu kommen weitere Anlagen mit produktionstechnischen Fragestellungen. Hier werden Sortenempfehlungen und Hinweise zur Bestandsführung entwickelt, die direkt in Ausbildung und Beratung der Landwirte Eingang finden. Auch während der Vegetationsperiode stehen die Versuchsanlagen der Praxis offen. Im Rahmen von Feldführungen erfolgt ein interaktiver Wissenstransfer am Objekt anhand der Vorstellung und Kommentierung der Prüfglieder. Dieser Austausch zwischen Fachberatung und Praxis erweist sich oftmals als sehr fruchtbar, denn so können aktuelle Fragestellungen aufgenommen und bearbeitet werden. Am Landwirtschaftszentrum Eichhof, Bad Hersfeld, bieten die Versuchsanlagen darüber hinaus auch umfangreiches Anschauungsmaterial für die überbetriebliche Ausbildung und zahlreiche Weiterbildungsveranstaltungen. Beispielsweise fand im vergangenen Jahr eine gut besuchte Fachtagung zum Thema Körnerleguminosen statt. Im Vortragsteil berichteten Praktiker von ihren Erfahrungen zu Anbau, Verfütterung und Vermarktung, die im Anschluss gemeinsam diskutiert wurden. Die Versuchsflächen boten vielfältige Informationen und Gesprächsstoff zu Themen wie Sortenwahl, Aussaatmanagement, Unkraut- und Schädlingskontrolle, Gemengeanbau sowie der Bedeutung von Körnerleguminosen im Anbausystem und der Fruchtfolgegestaltung. Regelmäßig wird in den Versuchsanlagen auch mit Fachgruppen aus dem In- und Ausland sowie Studierenden der Hochschulen und Technikerschulen diskutiert. Anbau lohnt sich Regionale Eiweißversorgung zu verlässlichen Preisen anstelle der Abhängigkeit von Import-Soja ist für viele Landwirte die Motivation sich mit dem Anbau von heimischen Körnerleguminosen zu beschäftigen. Fütterungsversuche bestätigen, dass Erbsen völlig problemlos B&B Agrar 4 /
18 SCHWERPUNKT Körnererbsen Die Leistungsfähigkeit der Körnererbsen lässt sich anhand der Versuchsergebnisse belegen. Die letztjährigen Durchschnittserträge der hessischen LSV Standorte lagen bei den Körnererbsen trotz ausgeprägter Frühjahrstrockenheit mit 63,1 Dezitonnen je Hektar nochmals leicht über denen des Vorjahres. Mehrjährig erreichten die Sorten in den LSV einen mittleren Rohproteingehalt von 21,5 Prozent. Damit konnte dreijährig ein Rohproteinertrag von 12,4 Dezitonnen je Hektar erzielt werden (s. Tabelle). Spitzenergebnisse einzelner Sorten lagen bei über 15 Dezitonnen je Hektar Proteinertrag, der ohne Einsatz von Stickstoffdüngemitteln und mit vergleichsweise geringem Aufwand erwirtschaftet wurde. Mehrjährig hohe Rohproteingehalte liefern Navarro, Salamanca und die neueren Sorten Astronaute und Mythic. Körnererbsen eigenen sich hervorragend für die innerbetriebliche Verwertung in der Schweine- oder Rinderfütterung. Der wertgebende Bestandteil ist neben der Energie das Rohprotein. Aktuelle Versuche und Praxisergebnisse belegen, dass in der Endmast Sojaschrot vollständig durch Erbsen ersetzt werden kann. Je Mastschwein ließen sich bei einem Versuch der LWK Niedersachsen rund 7,3 Kilogramm Soja- und 4,5 Kilogramm Rapsextraktionsschrot einsparen. Insgesamt wurde auch ein niedrigerer Futterverbrauch und damit gerinin den hofeigenen Mischungen einsetzbar sind. Ackerbohnen können in der Rinderfütterung ohne Einschränkungen innerbetrieblich verwertet werden. Der Futterwert liegt deutlich über den derzeit vom Handel gebotenen Preisen. Damit ist der Anbau bisher für reine Ackerbaubetriebe noch nicht sehr attraktiv, und sie müssen sich eigene Vermarktungswege erschließen. Hierbei wird das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen der Eiweißpflanzenstrategie geförderte Projekt Demonstrationsnetzwerk Erbse/Bohne den Anbauern und Verarbeitern in den nächsten Jahren umfassende Hilfestellung anbieten (s. Beitrag Seite 15 f). Die Anrechnungsmöglichkeit der Körnerleguminosen auf die über das Greening geforderten ökologischen Vorrangflächen (ÖVF, Faktor 0,7) machen Erbsen und Bohnen zusätzlich interessant. Aktuelle Berechnungen belegen, dass die ÖVF-Variante mit Körnerleguminosen bei innerbetrieblicher Verwertung ökonomisch besser abschneidet als die Varianten Stilllegung oder Anbau von Zwischenfrüchten. Derzeit wird ein deutlicher Anstieg der Anbauflächen bei Ackerbohne und Körnererbsen beob achtet. In Hessen wurden in 2015 auf rund 3900 Hektar Ackerbohnen und auf 2400 Hektar Körnererbsen angebaut, eine Flächenausdehnung um fast 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. gere Futterkosten beim Einsatz von Erbsen ermittelt. Der Verfütterung von Erbsen steht also nichts im Wege. Da Standort- und Witterungseffekte des Einzeljahres regel mäßig die Sortenunterschiede über lagern, ist es ratsam die Ertrags sicherheit einer Sorte in den Vordergrund zu stellen. Die wichtigste Eigenschaft bei der Auswahl einer Erbsensorte ist die Standfestigkeit der entscheidende Faktor zur Risikominderung bei der Ernte. Die mehrjährige Ertragssicherheit einer Sorte beruht ganz wesentlich auf diesem Merkmal. Hinsichtlich der Standortwahl stellt die Körnererbse weniger hohe Ansprüche als die Ackerbohne. Insbesondere toleriert sie Trockenheit deutlich besser, wie die Versuchsergebnisse aus 2015 erneut bestätigen. Dennoch können länger anhaltende Phasen mit hohen Temperaturen bei gleichzeitig reduziertem Wasserangebot zum Hülsenabwurf oder zur Reduktion von Kornanlagen führen. Daher muss über die rechtzeitige Saat, möglichst noch im März, eine gute Wurzelentwicklung und ein zügiger Bestandsschluss erreicht werden. Saatstärken von rund 75 Körnern je Quadratmeter haben sich bewährt, das Saatgut sollte mindestens vier bis fünf Zentimeter tief abgelegt werden. Eine gezielte und frühzeitige Unkrautbekämpfung ist unerlässlich. Durchwuchs von Spätverunkrautung kann zu erheblichen Ernteproblemen füh- Tabelle: LSV Körnererbsen Hessen Rohproteinertrag (dt/ha bei 86 % TM) Mehrjährige Auswertung relativ zum Versuchsdurchschnitt (VD) Sorte Jahr Mittel VD Rohprotein (dt/ha) 11,1 13,5 13,3 12,4 Rocket Respect Alvesta Salamanca Navarro Volt Mythic Astronaute Mittel B&B Agrar 4 / 2016
19 In den Landessortenversuchen wird die Leistungsfähigkeit und Ertragssicherheit der Sorten geprüft. ren. Wichtig ist es, innerhalb der Fruchtfolge ausreichende Anbaupausen zwischen den Leguminosen einzuhalten. Erbsen sollten nicht häufiger als alle sechs bis sieben Jahre angebaut werden. Ackerbohnen Bei der Auswahl von für den Ackerbohnenanbau geeigneter Standorte ist unbedingt auf eine gute Bodenstruktur sowie ein ausreichendes Wassernachlieferungsvermögen zu achten. Kühl gemäßigte Anbaulagen reduzieren das Risiko von Hitzestress. Die Wasserversorgung während und nach der Blüte muss gesichert sein, wenn hohe Erträge angestrebt werden. Im LSV am Standort Eichhof wurde im Mittel der Jahre 2012 bis 2015 bei Ackerbohne ein Durchschnittsertrag von 53,4 Dezitonnen je Hektar gemessen. Erheblicher Trockenstress trat in 2010 und 2011 auf, wodurch die Erträge deutlich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die hohen Sommertemperaturen während und nach der Blüte hatten die Pflanzen irreversibel geschädigt. Es traten erhebliche Welkeerscheinungen an den Pflanzen auf, die den Blattapparat teilweise zum Absterben brachten und zum Hülsenabwurf führten, sodass die Erträge bei rund 33 Dezitonnen stehen blieben. Die Rohproteingehalte liegen mehrjährig bei 26 Prozent, die besten Sorten können über 27 Pro zent Rohprotein erreichen. Tanninfreie Sorten wie zum Beispiel Taifun eignen sich insbesondere als Eiweißträger für die innerbetriebliche Verwertung in der Schweinefütterung. Sie bringen hohe Eiweißgehalte mit, liegen in den Versuchen aber ertraglich rund zehn Prozent unter dem Sortenmittel. Mit der innerbetrieblichen Verwertung von Ackerbohnen werden sowohl in der Rinder- wie auch in der Schweinehaltung durchweg positive Erfahrungen gemacht. Auch die Kombination mit Erbsen in der Fütterung ist möglich. Aus Nordrhein-Westfalen wird über Ackerbohnenanteile von bis zu 15 Prozent in der Endmast mit guten Erfolgen berichtet. Höhere Anteile sollten nur mit tanninfreien Sorten gefahren werden. Ackerbohnen können, falls es die Witterung und die Bodenverhältnisse zulassen, bereits im Februar gesät werden. Das Saatgut muss bei Ackerbohnen mindestens sechs bis acht Zentimeter tief abgelegt werden, damit ausreichend Keimfeuchte gewährleistet ist. Der Foto: Gabriele Käufler Pflanzenschutz ist auf die frühzeitige Unkrautkontrolle (Vorauflauf) sowie die rechtzeitige Bekämpfung von eventuell auftretender Schwarzer Bohnenlaus auszurichten. Ackerbohnen reagieren sehr positiv auf einen gut durchlüfteten Boden. Mechanische Unkrautbekämpfung durch Einsatz von Striegel oder Hacke ab etwa zehn Zentimeter Wuchshöhe wirkt auf verkrusteten Böden Wunder. Ackerbohnen werden oft auch von pilzlichen Schaderregern befallen. Inwie weit diese ertragswirksam werden hängt von Zeitpunkt und Intensität des Befalls ab. Innerhalb der Fruchtfolge sind Anbaupausen von mindestens fünf, besser sechs Jahren einzuhalten. Fruchtfolgeleistungen Die hervorragende Vorfruchtleistung der Leguminosen hat sich herumgesprochen. Diese summiert sich auf rund 200 Euro je Hektar und beruht auf mehreren Effekten. Einerseits profitieren die Nachfrüchte sowohl bezüglich der Ertragshöhe als auch im Hinblick auf die Ertragssicherheit von den Leguminosen. Andererseits können betriebliche Arbeitsspitzen entzerrt und die Maschinenauslastung verbessert werden, weil die Körnerleguminosen hinsichtlich der Aussaat- und Erntetermine sowie der Bestandsführung andere zeitliche Ansprüche haben als die Winterungen. Darüber hinaus werden die Risiken enger Fruchtfolgen mit hohen Getreideanteilen mehr und mehr spürbar. Hier sei nur auf das zunehmende Auftreten von Resistenzen zum Beispiel bei Ungräsern und pilzlichen Schaderregern hingewiesen. Dies treibt den Beobachtungsaufwand und die Kosten der Bestandsführung in die Höhe. Bei der ökonomischen Betrachtung der Gesamtfruchtfolgen schneiden daher vielgestaltige Fruchtfolgen mehrheitlich besser ab, insbesondere wenn die Arbeitserledigungskosten mit einbezogen werden. Nicht zuletzt sind die Leguminosen Pollen- und Nektarspender für Bienen und viele andere Insektenarten und dienen der Erhöhung der Artenvielfalt in der Landschaft. Mit dem Anbau dieser Kulturen trägt die Landwirtschaft auch gesamtgesellschaftlichen Anforderungen Rechnung. Die Autorin Gabriele Käufler Fachreferentin Marktfruchtbau Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Eichhof, Bad Hersfeld B&B Agrar 4 /
20 SCHWERPUNKT Fester Bestand teil in der Fruchtfolge Wie lässt sich der Anbau von Bohne und Erbse ganz praktisch im Betrieb umsetzen? Zwei Landwirte berichten über ihre Erfahrungen mit diesen Kulturen. Karl-Heinz Kasper bewirtschaftet einen Ackerbaubetrieb nach den Richtlinien des Demeter Verbandes in Alsfeld-Liederbach (Vogelsbergkreis). Zum Betrieb gehören daneben Mutter kühe in Weidehaltung. Warum bauen Sie Ackerbohnen an? Kasper: Als Bio-Betrieb sind wir darauf angewiesen, dass wir die Bodenfruchtbarkeit auf natür liche Art und Weise erhalten. Und die Ackerbohne ist eben in der Lage, im Verbund mit Knöllchenbakterien Stickstoff aus der Luft einzulagern. Unsere Fruchtfolge hat sieben Glieder: Am Anfang stehen zwei Jahre Kleegras, hier geben uns die Leguminosen schon eine gute natürliche Bodenfruchtbarkeit. Danach kommen die Verkaufsfrüchte Winterweizen und Sommerhafer. Im fünften Jahr steht dann Ackerbohne, sie frischt nach dem Getreide noch einmal die Bodenfruchtbarkeit auf. Auf die Ackerbohne folgen Dinkel und dann Roggen, in den Roggen wird bereits das Kleegras für den Beginn des nächsten Zyklus eingesät. Wie viel Ackerbohnen bauen Sie an? Kasper: Das ist von der Fruchtfolge vorgegeben und leicht auszurechnen. Wir haben 210 Hektar Ackerland, ein Siebtel davon sind notwendigerweise Ackerbohnen, also 30 Hektar. Die Bohnenflächen wechseln jedes Jahr, nach jedem Anbau sind sechs Jahre Pause. Das heißt, bei den Bohnen geht es gar nicht zuerst um die verkaufsfähige Frucht, sondern um die Bedürfnisse des Bodens? Kasper: Es geht hier wirklich in erster Linie um die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, im Bio-Anbau arbeiten wir ja ohne synthetische Düngemittel und die Ackerbohne hinterlässt uns eine natürliche Bodenfruchtbarkeit. Das Getreide, das wir in der Fruchtfolge vor den Bohnen anbauen, wird mit Stallmist gedüngt, aber die Ackerbohnen selber bekommen gar keinen Dünger brauchen sie auch nicht. Beim Stickstoff sind sie Selbstversorger und die Düngung mit Mist aus den Vorjahren reicht für sie aus. Ich mache das seit 38 Jahren, und davor hat es mein Vater auch schon so gemacht. Einzige Ausnahme ist in manchen Jahren Kalk, um den PH-Wert zu halten. Was machen Sie mit den geernteten Bohnen? Kasper: Der größte Teil wird an Milchviehbetriebe verkauft, hauptsächlich in Grünlandregionen, wo der Anbau von Ackerbohnen schlecht möglich ist. Oder an Betriebe mit sandigen Böden, hier ist der Anbau auch schwierig. Einen kleineren Teil der Ernte verfüttere ich im Winter an die Schafe. Die Ackerbohnen auf Ihren Feldern sind ungewöhnlich hoch und dicht. Ist das Absicht? Kasper: Ja, das ist gewollt, das hat mit der Unkrautunterdrückung zu tun. Als Bio-Betrieb verwenden wir ja keine Herbizide, deshalb säen wir die Bohnen mit sehr hoher Dichte, bis zu 120 Pflanzen pro Quadratmeter. Die Keimfähigkeit beträgt 95 Prozent und beim Striegeln gehen auch einige Pflanzen verloren, aber es bleibt ein Bestand mit 80, manchmal 100 Bohnenpflanzen pro Quadratmeter. So schließt der Bestand sehr schnell und das brauchen wir unbedingt zur Unterdrückung des Unkrauts. Sonst haben wir später ein großes Problem beim Mähdrusch, ein verun krauteter Bohnenbestand ist nur ganz schwer zu dreschen. Ein Nachteil ist, dass die Korngröße der geernteten Bohnen kleiner ist, als wenn die Ackerbohnen nur mit 50 oder 60 Pflanzen pro Quadratmeter stehen. Der hohe Wuchs liegt an der Sorte, die wir anbauen. Die hat mein Vater vor 50 Jahren auf dem Hof eingeführt, sie wächst deutlich höher als die modernen, neu gezüchteten Sorten. Was machen Sie im Pflanzenschutz? Kasper: Im Frühjahr striegeln wir zwei- bis dreimal. In diesem Jahr hat zweimal gereicht, wegen des guten Wuchses hatten wir schnell einen guten Bestandsschluss. In dem trockenen Jahr davor mussten wir dreimal striegeln, weil die Bohnen nicht so hoch geworden sind. An Schädlingen haben wir eigentlich nur den Bohnenkäfer. Der ist zwar da, macht aber keinen großen Schaden, am Ende fehlen durch den Bohnenkäfer vielleicht fünf Prozent am Ertrag. Blattläuse sind ganz selten, und wenn, dann befallen sie hauptsächlich Einzelpflanzen, aber die Läuse haben keine großen Chancen, hier Schaden anzurichten. Unsere Hauptmaßnahme im Pflanzenschutz ist im Grunde die siebengliedrige Fruchtfolge. Was ist bei der Saat zu beachten? Kasper: Man kann die Ackerbohne mit einer ganz normalen Drillmaschine säen, man muss aber genügend Bodendruck geben. Denn die Bohne will tief liegen, das heißt sieben bis acht Zentimeter tief, sie braucht viel Wasser zum Keimen. Wie gut kommt die Bohne mit Trockenheit zurecht? Kasper: Trockenheit kann die Acker bohne nicht vertragen, da ist sie ganz anders als die Erbse. Sie braucht ausreichend Wasser und einen Boden mit guter Wasserhaltefähigkeit Wir haben einen sandigen Lehm mit Lößanteilen, da gedeiht sie gut. 20 B&B Agrar 4 / 2016
21 Warum bauen Sie Erbsen an? Brede: Wir nutzen die Erbsen als eigene Futtergrundlage in der Schweinemast. Mir ist es ganz wichtig, etwas unabhängiger vom Eiweißmarkt zu werden und mit den Erbsen können wir unsere Schweine mit Futter aus eigenem Anbau versorgen. Das heißt, ich muss viel weniger Sojaschrot zukaufen. Die Erbsen werden ohne weitere Verarbeitung hier auf dem Hof gemahlen und mit Futtergetreide gemischt, das natürlich auch aus eigenem Anbau stammt. Welchen Anteil haben die Erbsen in der Proteinration? Brede: Wir können etwa die Hälfte des Proteinbedarfs der Schweine mit Erbsen aus eigenem Anbau decken, die andere Hälfte ist Soja. Die Mischung bringt dann ein ausgewogenes Eiweißfutter. Eine Mast mit Erbsen alleine können wir leider nicht machen, sie enthalten nicht alle Aminosäuren im optimalen Verhältnis. Aber 50 Prozent heimischer Anbau ist doch schon ein gutes Ergebnis. Welche Gründe sprechen aus Sicht des Ackerbauern für Erbsen? Brede: Das ist der zweite Grund, warum wir Erbsen anbauen; die Erbse passt wunderbar in der Fruchtfolge. Sie erweitert den Anbau um eine zusätzliche Kultur, das ist vorteilhaft für Boden und Pflanzenschutz. Und die Erbse gehört zur Familie der Leguminosen, die Stickstoff aus der Luft sammeln. Das gibt ihr einen hohen Vorfruchtwert, der im Boden angesammelte Stickstoff kommt ja dem nachfolgenden Getreide zugute. So kann ich bei der Düngung der Folgefrucht 30 bis 40 Kilogramm Rein-Stickstoff einsparen. Welchen Anteil hat die Erbse bei Ihnen in der Fruchtfolge? Brede: Wir bauen jedes Jahr Erbsen an, aber nie hintereinander auf demselben Acker. Erbsen sind nicht selbstverträglich, nach der Ernte braucht der Boden eine Anbaupause von fünf bis sechs Jahren. Für die Fruchtfolge ist das ideal, und betrieblich passt das auch bei uns. Die fünf Hektar Erbsen, die wir jedes Jahr als Schweinefutter brauchen, rotieren also auf den Flächen des Betriebes, so kommt dann auch ein großer Teil der Äcker in den Genuss der längeren Fruchtfolge. Erst nach fünf bis sechs Jahren kehren die Erbsen auf die erste Fläche zurück. Ist der Anbau von Erbsen schwierig? Brede: Man braucht schon etwas Fingerspitzengefühl. Die Saat ist für eine Sommerfrucht ungewöhnlich früh, manchmal schon Mitte März. Sobald der Boden gut zu bearbeiten und krümelig ist, können die Erbsen in den Boden. Sie werden recht tief abgelegt, etwa sechs Zentimeter. Bis die späten Fröste kommen, sollen sie schon gut entwickelt sein, dann überstehen sie auch die Eisheiligen ohne Schaden. Wie anspruchsvoll ist die Erbse im Anbau? Brede: Also bei der Düngung ist die Erbse vollkommen anspruchslos, für die Stickstoffversorgung sorgt sie ja selber, sie braucht auch keinen Stickstoff als Startgabe. Sie muss natürlich Phosphor, Kali und die anderen Grundnährstoffe haben, aber das können wir mit dem Festmist aus unserer Schweinemast abdecken. Das heißt: In einem Erbsenjahr findet auf dem jeweiligen Acker keine mineralische Düngung statt. Welchen Pflanzenschutz braucht die Erbse? Brede: Im besten Fall sehr wenig. Gegen Unkraut wird im Frühjahr zweimal gestriegelt, das erste Mal als sogenanntes Blindstriegeln. Der Boden ist dann noch kahl, Erbsen und Unkraut sind noch nicht zu sehen, aber wir können mit dem Striegel die Unkraut-Keime im Boden stören. Nach dem zweiten Striegeln etwas zwei Wochen später muss man dann sehen, wie der Aufgang sich entwickelt. Lässt er Lücken mit zögerlichem Wuchs der Erbsen, brauchen wir im späteren Frühjahr eine Herbizidmaßnahme. Gegen Pilze mussten wir in den vergangenen Jahren nichts unternehmen, hier zeigt sich die vorbeugende Wirkung der langen Anbaupause. Bei den Insekten macht uns ab Mai die Erbsenblattlaus Sorgen, die verbreitet sich aus den Blütenanlagen heraus. Wenn sie überhandnimmt, muss man einmal ein Insektizid einsetzen. Aber in der Regel bleibt es unterhalb der Schadschwelle, sodass ich darauf verzichte. Ich mache das auch nicht gerne. Die Fahrgassen sind dann schon geschlossen, der Bestand steht in Blüte, und es ist Ernst-Heinrich Brede bewirtschaftet einen Ackerbaubetrieb mit Schweinemast und Direktvermarktung im nordhessischen Lohne, einem Ortsteil von Fritzlar (Landkreis Schwalm-Eder). Seit 25 Jahren baut er Körnererbsen auf seinen Ackerflächen an. mir einfach zu schade, dann noch durch den Bestand zu fahren. Ich finde auch, ein gewisses Maß an Schädlingen kann man tolerieren. Wie kommen die Erbsen mit Frühjahrstrockenheit zurecht? Brede: Damit hatten wir in diesem Jahr 2016 schon wieder zu tun, Ende Mai fehlten uns schon 60 Millimeter Niederschlag. Aber die Erbsen kommen da ganz gut durch. Sie werden ja tief und früh gesät und haben den Boden bis dahin schon durchwurzelt und eine gute Wasseraufnahmefähigkeit entwickelt. Der Anbau von Körnerleguminosen ist als Greening-Maßnahme anerkannt, wenn die Früchte im eigenen Betrieb verwendet werden Brede: was uns natürlich sehr entgegen kommt. Der Anbau von Erbsen wird im Greening mit dem Faktor 0,7 bewertet. Das heißt, wir können unsere fünf Hektar Erbsen mit 3,5 Hektar beim Greening geltend machen. Damit sind die be- Der Autor trieblichen Umweltauflagen der EU für unseren Betrieb schon zum größten Teil erfüllt. Michael Schlag Dipl.-Ing.agr. und freier Journalist Butzbach-Ebersgöns Fotos (2): Michael Schlag B&B Agrar 4 /
22 BILDUNG Foto: Rido Fotolia.com Andrea Pfirrmann und Roland Dörr Gemeinsam zu mehr Unterrichtsqualität Lernfeldunterricht ist seit einigen Jahren das Stichwort für die Umsetzung der Lehrpläne in den Berufsschulen auch im Ausbildungsberuf Pferdewirt/-in. Oberstes Ziel: die Handlungskompetenz jedes einzelnen Schülers zu fördern. Dazu sind Absprachen unter den beteiligten Lehrkräften erforderlich. Netzwerktagungen dienen dem Erfahrungsaustausch über Ländergrenzen hinweg. Berufsschulen, die Auszubildende im Beruf Pferdewirt/ -in unterrichten, setzen den seit 2010 gültigen bundesweiten Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Pferdewirt/Pferdewirtin (Kultusministerkonferenz vom 25. März 2010) im Lernfeldunterricht um. Dieser Rahmenlehrplan ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Pferdewirt/ zur Pferdewirtin (BGBl. PfWirtAusbV 2010) abgestimmt. Für die drei Ausbildungsjahre wurden insgesamt 15 Lernfelder mit klaren Zielvorgaben formuliert. Diese am Output orientierte Vorgehensweise löst den Gedanken des getrennten Unterrichtens in verschiedenen Unterrichtsfächern weitgehend ab. Gemäß 1 Abs. 3 Berufsbildungsgesetz (BBiG 2005) umfasst die berufliche Handlungsfähigkeit die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit in einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. Handlungskompetenz ist erforderlich, um sich in verschiede- Tabelle 1: Lernfelder für den Ausbildungsberuf Pferdewirt/ Pferdewirtin 1. Ausbildungsjahr 1 Betriebliche Zusammenhänge erkunden und darstellen 2 Pferde pflegen und versorgen 3 Futtermittel für Pferde auswählen 4 Pferde beschreiben und entsprechend der Nutzung auswählen 5 Pferde bewegen 2. Ausbildungsjahr 6 Pferde züchten 7 Futterrationen verdauungsphysiologisch gestalten 8 Grünland für Pferde bewirtschaften 9 Haltungsformen und -systeme gestalten 10 Pferde für spezielle Disziplinen trainieren und ausbilden 3. Ausbildungsjahr 11 Spezielle Futterrationen gestalten 12 An zuchtorganisatorischen Maßnahmen teilnehmen 13 Infektionskrankheiten feststellen und kranke Pferde betreuen 14 Pferdesportler ausbilden 15 Dienstleistungen und Produkte vermarkten In Anlehnung an Kultusministerkonferenz vom B&B Agrar 4 / 2016
23 nen Situationen im Berufsalltag sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortungsbewusst verhalten zu können. Sie beinhaltet Fachkompetenz, Humankompetenz und Sozialkompetenz. Um die Entwicklung der Handlungskompetenz im Berufsschulunterricht besser fördern zu können, wurde die Fächersystematik aufgelöst. Es wurden Lernfelder für die verschiedenen beruflichen Handlungsfelder formuliert (s. Tabelle 1). Jedes Lernfeld (s. Tabelle 2) enthält die Lernfeldbezeichnung sowie einen Zeitrichtwert. Die Zielformulierungen enthalten die Kompetenzen, die vermittelt werden sollen und aus denen die Handlungen entwickelt werden. Die Inhalte ergänzen und veranschaulichen die einzelnen Lernfelder. Lernsituationen Für die Umsetzung der Lernfelder im Unterricht bedeutet dies, dass problemhaltige Lernsituationen mit Praxisbezug geschaffen werden, also Situationen, mit denen die Lernenden im Berufsalltag konfrontiert werden und die es ermöglichen, Fachwissen und fachübergreifende Kompetenzen zu erwerben. Die Lernsituationen sind so gestaltet, dass sie individuelle Lernwege und unterschiedliche Lernergebnisse zulassen. Entscheidend ist dabei die selbstständige Bearbeitung der Lernsituationen vom Auszubildenden. Das umfasst, nach dem Prinzip der vollständigen Handlung, ein selbstständiges Informieren und Planen, die Entscheidung für einen Lösungsansatz sowie dessen Durchführung und eine abschließende Kontrolle und Bewertung. Diese Vorgehensweise soll den Auszubildenden ermöglichen, Situationen ganzheitlich zu erfassen, das heißt unterschiedliche Aspekte dieser Situation zu bedenken. Die Anzahl der Lernsituationen richtet sich dabei nach den Inhalten und Zielen der einzelnen Lernfelder. Die Lernsituationen werden weiter konkretisiert, indem ein Handlungsrahmen formuliert und darin die berufliche Handlung festgelegt wird. Anschließend wird gemeinsam mit den Lernenden der Arbeitsauftrag konkretisiert (s. Abbildung ). Alle Lernfelder werden im Fach Berufsfachliche Kompetenz zusammengefasst. Berechnungen werden direkt dann vorgenommen, wenn dies die jeweilige Problemstellung erfordert. Methodenmix Verwirklichen lässt sich diese Art des Unterrichtens durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden wie Gruppenpuzzle, Stationenlauf, Mind Mapping, Rollenspiele, selbstorganisierter Unterricht, arbeitsteilige Gruppenarbeiten oder das Erstellen von Lernplakaten. Die Rolle der Lehrkraft hat sich dadurch verändert, sie wird zum Moderator, der Aufgaben stellt, den Arbeitsverlauf der Lernenden beobachtet und bei Bedarf beratend unterstützt. Bei auftretenden Schwierigkeiten gibt sie Impulse, die ein Weiterarbeiten ermöglichen. Ein ganz entscheidender Aufgabenbereich ist die Formulierung der Arbeitsaufträge. Dabei ist besonders auf eine kleinschrittige Vorgehensweise bei der Bearbeitung durch die Schülerinnen und Schüler zu achten. Eine Arbeitsatmosphäre, in der kooperatives Arbeiten möglich ist, muss geschaffen werden. Die Rahmenbedingungen unterscheiden sich teilweise vom herkömmlichen Unterricht. So ist es sinnvoll, unabhängig von der Schulglocke über einen längeren Zeitraum hinweg zu arbeiten. Die Lernenden sollten sich im Unterrichtsraum so einrichten, dass effizientes Arbeiten möglich ist. Bei Bedarf ist Zugang zum PC zu ermöglichen. Der Lehrervortrag behält nach wie vor seinen Platz, aber es ist nur eine Methode des bunten Straußes an Möglichkeiten, den Lehrstoff zu erarbeiten. Zu Beginn und am Ende bestimmter Themenbereiche sorgt die Lehrkraft für den gezielten Einstieg in die Thematik beziehungsweise für die Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. Ebenfalls integrativ wird die Projektkompetenz im Fach Berufsfachliche Kompetenz vermittelt. An der Beruflichen Schule Münsingen werden beispielsweise pro Ausbildungsjahr zwei Projekte bezogen auf die Zielbeschreibungen der Lernfelder durchgeführt. Die Projektkompetenz beschreibt in erster Linie überfachliche Kompetenzen wie Sozialkompetenz, Personalkompetenz, Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz. Die Foto: Jürgen Fälchle Fotolia.com Lernsituationen aus dem Berufsalltag ermöglichen eine bessere Verknüpfung von Theorie und Praxis. Projektthemen sind so formuliert, dass unterschiedliche Lernzielebenen (selbstorganisiertes Lernen, Reproduktion, Reorganisation und Transfer) angesprochen werden. Lehrerteams Zu Beginn der Umsetzung des neuen Rahmenlehrplans erfolgte zunächst eine gemeinsame Stoffsammlung für jedes Lernfeld. Daraus wurden anschließend passende, wenn erforderlich aufeinander aufbauende Lernsituationen für jedes Lernfeld formuliert und die Tabelle 2: Beispiel Lernfeld 7 Lernfeld 7: Futterrationen verdauungsphysiologisch gestalten 2. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 60 Stunden Ziel: Ausgehend vom Aufbau der Verdauungsorgane sowie deren Funktion gestalten und berechnen die Schülerinnen und Schüler Rationen nach verdauungsphysiologischen Gesichtspunkten. Sie informieren sich über den Bedarf des Pferdes sowie die Kosten und Verfügbarkeit von wirtschaftseigenen Futtermitteln und Zukaufsfuttermitteln. Die Schülerinnen und Schüler wählen Futtermittel aus und berechnen Rationen. Sie bewerten die berechnete Ration an Hand von Faustzahlen und der Bedarfsnormen sowie des Futterzustandes des Pferdes. Die Schülerinnen und Schüler beobachten das Verhalten und die Gesundheit der Pferde und ziehen Rückschlüsse auf die Rationsgestaltung. Dadurch vermeiden sie Fütterungsfehler und Leistungsminderungen. Die Schülerinnen und Schüler nehmen eine ökonomische Bewertung der Rationen vor. Sie beraten ihre Kunden bei der Futterauswahl und Rationsgestaltung. Inhalte: Fütterungshygiene Prozent-, Verhältnis-, Masseberechnung In Anlehnung an Kultusministerkonferenz vom B&B Agrar 4 /
24 BILDUNG Abbildung: Konkretisierung einer Lernsituation Beispiel im Lernfeld 7 Ein Handlungsrahmen wird formuliert Die berufliche Handlung wird festgelegt Der Arbeitsauftrag wird konkretisiert Die Autoren Dr. Andrea Pfirrmann Roland Dörr Beide: Berufliche Schule Münsingen Sie sind auf einem Pferdezuchtbetrieb für die Fütterung des Bestands verantwortlich. Der Pferdebestand setzt sich aus 7 Deckhengsten und 40 Zuchtstuten (Rasse Warmblut) zusammen. Von den Zuchtstuten sind 70 % tragend, 25 % güst, 5 % laktierend. Von den tragenden Stuten sind 75 % niedertragend, 25 % hochtragend. Erstellen Sie für diese Pferde ein Fütterungskonzept. Erstellen Sie eine Übersicht über die speziellen Anforderungen bezüglich der Fütterung der Pferde in den verschiedenen Leistungsstadien. Wählen Sie geeignete Futtermittel aus, begründen Sie Ihre Auswahl und schlagen Sie für jede Leistungsgruppe eine Tagesration vor. Berechnen Sie für jedes Leistungsstadium die Futterration und beurteilen Sie diese. Korrigieren Sie ggf. die Futterration entsprechend den Bedarfswerten. Berechnen Sie die benötigte Lagerkapazität für Heu für diesen Pferdebestand für 8 Monate. Das Heu wird selbst erzeugt; berechnen Sie, wie viel Grünfläche zur Gewinnung dieser Heumenge benötigt wird. dabei zu vermittelnden Kompetenzen aufgeführt. Am Anfang des Schuljahres erfolgt eine Jahresplanung, in der geregelt wird, welche Lehrkraft welche Lernsituationen und welche Projekte unterrichtet. Dafür wird ein ungefährer zeitlicher Ablauf festgelegt. Es muss ein Fundament geschaffen werden, das erfolgreiches Lernen möglich macht. Dazu ist es erforderlich, den Schülerinnen und Schülern Methodenkompetenzen an die Hand zu geben, die sie im Unterricht bei der selbstständigen Bearbeitung der Lernsituationen benötigen. Aus diesem Grund wird zu Beginn des Schuljahres eine Absprache unter allen beteiligten Lehrkräften getroffen, wer wann welche Methode im Rahmen seines Unterrichts vermittelt. Im Laufe des Schuljahres erfolgen in Teamsitzungen regelmäßige Rückmeldungen über den Verlauf der Planungen, bei Bedarf werden Anpassungen vorgenommen. Zur Umsetzung der Projekte im Rahmen der Projektkompetenz wurden alle Projekte von den beteiligten Lehrkräften dokumentiert. Für jedes Projekt sind die Ziele, die Durchführung, der zeitliche Rahmen sowie die Evaluation der Projektarbeit erfasst. Um die Entwicklung der beruflichen Handlungsfähigkeit zu erreichen, ist eine koordinierte Vorgehensweise erforderlich; diesbezüglich immer wieder Anregungen zu erhalten, ist sehr wertvoll. Deshalb ist es seit einigen Jahren gelungen, dass sich die Lehrkräfte aus den verschiedenen Schulen der Bundesländer zu Netzwerktagungen treffen: 2010 in Hannover: Fortbildung zum Thema Handlungsorientierter Unterricht von der Fachsystematik zur Lernsituation; 2012 in Esslingen: Austausch über die Inhalte einzelner Lernfelder und Formulierung konkreter Lernsituationen; 2014 in Meißen: Bewertung handlungsorientierter Aufgaben, weiterer Austausch über Inhalte einzelner Lernfelder und Lernsituationen; 2016 in Plön: Unterrichtshospitationen zu verschiedenen Lernsituationen mit anschließenden Workshops; Austausch über die Absprache der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse im Bereich der Pferdefütterung sowie deren Umsetzung im Lernfeldunterricht. Die bundeseinheitliche Umsetzung des Rahmenlehrplans zu gewährleisten, ist dabei das übergeordnete Ziel. Darüber hinaus ist das kollegiale Miteinander eine wichtige Voraussetzung für einen zielführenden Erfahrungsaustausch. Bisherige Erfahrungen Durch die Formulierung von Lernsituationen aus dem Berufsalltag der Auszubildenden gelingt eine noch bessere Verknüpfung von Theorie und Praxis. Die Lernenden können sich durch den intensiven Praxisbezug gut mit den Lerninhalten auseinandersetzen und eigene Praxisbeispiele mit in den Unterricht einbringen. Dabei ist eine erhöhte Motivation bei den Auszubildenden zu beobachten. Auch der Erwerb von Fachkompetenz und überfachlicher Kompetenz ist durch die veränderte Unterrichtsorganisation aus Sicht der Lehrkräfte gestiegen. Die veränderte Lehrerrolle wird von den Lernenden gut angenommen, vorausgesetzt es findet ein häufiger Methodenwechsel statt und es wird der erforderliche Input an Fachinformationen geboten. Durch die gemeinsame Formulierung von Lernsituationen wird das Wissen und die Erfahrungen aller Lehrkräfte zusammengetragen und in die Planung integriert. Die Festlegung der Unterrichtsziele im Lehrerteam fördert durch mehr Verbindlichkeit die gemeinsame Verantwortung und damit auch die Motivation der Lehrkräfte. Die gemeinsame Planung schafft Transparenz bezüglich der Unterrichtsinhalte jedes Einzelnen. Somit werden Wiederholungen in verschiedenen Lernsituationen weitestgehend vermieden. Durch die Einbindung allgemeinbildender Fächer wird deren Bedeutung gestärkt. Das gemeinsame Vorgehen könnte noch intensiviert werden, indem nicht lehrkraftbezogene, sondern lernfeldbezogene Klassenarbeiten durchgeführt werden. Die Umsetzung von Lernfeldern im Unterricht erfordert allerdings regelmäßige Absprachen unter den Lehrkräften sowie eine hohe Flexibilität aller Beteiligten, da die zeitliche Planung nicht immer eingehalten werden kann. 24 B&B Agrar 4 / 2016
25 Foto: VadimGuzhva Fotolia.com Antje Eder und Marcel Robischon Breites Einsatzspektrum an berufsbildenden Schulen Das Studium Bachelor und Master of Education Agrarwirtschaft wird an den Universitätsstandorten München und Berlin angeboten. Angehende Lehrkräfte werden umfassend auf ihren späteren Einsatz an beruflichen Schulen und die vielfältigen Anforderungen vorbereitet. TU München Die akademische Lehrerbildung an der Technischen Universität München hat eine mehr als 50-jährige Tradition. Sie ist durch eine deutliche Praxis- und Anwendungsorientierung geprägt (Huber 2004, S. 18) wurden erstmals Absolventen der damaligen Abbildung 1: Aufbau des Bachelor- und Master studien ganges an der TU München Master-Studium Bachelor -Studium Berufliche Fachrichtung Master-Thesis Unterrichtsfach Bachelor-Thesis Berufliche Fachrichtung Sozialwissenschaften Unterrichtsfach Sozialwissenschaften Universitätsschulen SFP (ca. 15 Tage) FBP (15 Tage) TUMpaedagogicum (30 Tage) Technischen Hochschule München nach einem zweijährigen Referendariat in den höheren Beamtendienst eingestellt wurde die Technische Hochschule München in Technische Universität München (TUM) umbenannt. Im gleichen Jahr erfolgte die Ausweitung der Mindeststudiendauer auf acht Semester und die gleichzeitige Einführung eines obligatorischen Zweitfaches. Der Studiengang Lehramt an beruflichen Schulen mit dem Erstfach Agrarwirtschaft wurde erstmals 1977/78 in Kooperation mit dem TUM-Standort in Weihenstephan angeboten. Das Studium sieht bis heute eine berufliche Fachrichtung (zum Beispiel Agrarwirtschaft), ein nicht vertieftes Unterrichtsfach und Studieninhalte der Sozialwissenschaften, in erster Linie Pädagogik und Psychologie sowie Politikwissenschaften und Soziologie vor. Neben den fachtheoretischen Studieninhalten müssen die Anwärter für das höhere Lehramt an beruflichen Schulen zum Eintritt in das Referendariat entweder ein 48-wöchiges Betriebspraktikum oder eine abgeschlossene Berufsausbildung im Berufsfeld Agrarwirtschaft vorweisen wurde die Lehrerbildung im gewerblich-technischen Bereich den europäischen Standards des Bologna-Prozesses angeglichen. Mit der Gründung der Fakultät School of Education 2008 übernahm die TUM die gesellschaftli- Literatur Huber, W. (2004): Praxisorientierte Lehrerbildung an der Technischen Universität München. In: 40 Jahre Lehrerbildung an der Technischen Universität München Festschrift. URL: ub.tum.de/doc/ / pdf (Abruf ) B&B Agrar 4 /
26 BILDUNG Abbildung 2: Praktikumsphasen Schule Master Bachelor Planen/Durchführen Orientieren Fachdidaktisches Blockpraktikum Unterrichtsfach (15 Tage an einer FOS/BOS) Reflexion der eigenen Lehrperson/Unterrichtsqualität/ komplexes Lehrerhandeln Studienbegleitendes fachdidaktisches Praktikum Praktikumstag an einer Schule über ein Semester + Seminar TUMpaedagogicum (30 Praktikumstage an einer Berufsfachschule) + seminaristische Begleitphasen Reflexion der eigenen Lehrperson che Verantwortung, der Lehrerbildung eine zentrale Aufgabe zukommen zu lassen, diese federführend zu koordinieren, aber auch durch die Existenz einer eigenen Fakultät diese zu stärken ( Huber 2004, S. 18). Bachelor und Master Das Bachelorstudium (s. Abbildung 1) sieht sechs Semester mit Fokus auf dem beruflichen Erstfach vor. Neben dem beruflichen Erstfach müssen die Studierenden ein zweites Unterrichtsfach auswählen. Das Studium wird mit einer Bachelorarbeit abgeschlossen. Im Anschluss an den Abschluss Bachelor of Education folgt der Masterstudiengang der beruflichen Fachrichtung Agrarwirtschaft. Im Master gewinnen die Studierenden im Besonderen in der Fachdidaktik Agrarwirtschaft Lehr- und Unterrichtserfahrungen in den verschiedenen Ausbildungsberufen (Landwirt, Gärtner, Floristen), optimieren dadurch ihr Lehrerhandeln und können Rückschlüsse auf die eigene Lehrerpersönlichkeit ziehen. Aktuelle didaktische Vorgehensweisen und komplexe Unterrichtsformen sind zentrale Elemente der fachdidaktischen Ausbildung. Das Zweitfach und die Erziehungswissenschaften werden durch Themen wie Inklusion, Deutsch als Fremdsprache, Umgang mit Konflikten komplettiert. Mit dem Ab- schluss des Masters of Education können Studierende in den Vorbereitungsdienst für das höhere Lehramt an beruflichen Schulen in verschiedenen Bundesländern eintreten. Zum Wintersemester 2015/16 erfolgte die Neustrukturierung des Bachelor of Science Gartenbauund Agrarwissenschaften, an dem sich auch das Lehramtsstudium orientiert. Gründe für die Neustrukturierung waren, einerseits fachwissenschaftliche Studieninhalte weiter zu vertiefen und andererseits den Wechsel zwischen den Studiengängen Bachelor of Science Agrarwissenschaften und Bachelor of Education Agrarwirtschaft zu ermöglichen. Praktikumsphasen Während des Bachelor- und Masterstudiums durchlaufen die Studierenden drei Praktikumsphasen an beruflichen Schulen: das TUMpaedagogicum, ein Fachdidaktisches Blockpraktikum (FBP) und ein Studienbegleitendes Blockpraktikum (SFP) (s. Abbildung 2). Die Schulpraktika zielen darauf ab, die Tätigkeitsanforderungen einer Lehrkraft an beruflichen Schulen zu erfahren und geleitete Unterrichtsversuche durchzuführen. Reflexions- und Feedbackphasen unterstützen die Studierenden dabei, ihre Berufswahl kritisch zu hinterfragen und die Entwicklung ihres professionellen Lehrerhandelns zu fördern. Das einjährige Berufspraktikum umfasst 48 Wochen in Vollzeit, die der regulären wöchentlichen Arbeitszeit der Arbeitnehmer entspricht. Eine Erweiterung des Praktikums zur abgeschlossenen Berufsausbildung im grünen Bereich ist wünschenswert und kann durch vorgezogenes und angeschlossenes Praktikum an das Studium in einem anerkannten Ausbildungsberuf erreicht werden. Somit sind die Voraussetzungen für die Teilnahme an externen Gehilfenprüfungen gegeben. Vor allem beim konkreten Planen und Umsetzen von Unterricht sind Anwendungsbezüge aus dem direkten beruflichen Handeln im Berufsfeld Agrarwirtschaft unabdingbar, um gegenüber den Schülerinnen und Schülern den Lernstoff innerhalb ihrer Ausbildung legi timieren zu können und qualitativ möglichst hochwertige Lernergebnisse auf verschiedenen Kompetenzniveaus zu erzielen. HU zu Berlin Berufliches Handeln in den grünen Branchen bedeutet ein immer neues Umsetzen und In-Bezug- Setzen von Erfahrungswissen, theoretischen Kenntnissen und praktischen Fertigkeiten, um Lösungsmöglichkeiten für sich wandelnde Herausforderungen im Gefüge naturräumlicher Bedingungen und sozioökonomischer Entwicklungen zu finden. Der Unterricht an Berufsschulen in den agrarwirtschaftlichen Fächern zielt daher darauf ab, sowohl einen Fundus theoretischer Kenntnisse zu vermitteln, als auch die Kompetenzentwicklung durch eigenes Handeln in praxisorientierten Lernsituationen zu fördern. Zur Ausbildung von Fachleuten, die solche Prozesse der Kompetenzentwicklung initiieren und gestalten, trägt die Humboldt-Universität (HU) zu Berlin mit ihrem durch das Fachgebiet Fachdidaktik Agrar- und Gartenbauwissenschaften koordinierten Angebot lehramtsbezogener agrarwirtschaftlicher Bachelorstudiengänge (B.Sc.) sowie eines hierauf aufbauenden Masterstudiengangs (M.Ed.) bei (s. Abbildung 3 und Tabelle). Studienprofile Der Komplexität agrarwirtschaftlichen Handelns in gesellschaftlichen und ökologischen Systemen entsprechend erfordert das Studium dieser Systemwissenschaften die Auseinandersetzung mit einem breiten Spektrum natur-und sozialwissenschaftlicher Inhalte. Während im Monobachelor jeweils Agrarwissenschaften oder Gartenbauwissenschaften studiert werden, können im Kombinationsbachelor die beiden Fächer zwar nicht miteinander, aber mit zahlreichen anderen Fächer aus dem Kanon der Universität kombiniert werden. So lassen sich ganz eigene auf eine angestrebte Tätigkeit hin ausgerichtete Studienprofile entwerfen, wie beispielsweise eine Verbindung von Gartenbauwissenschaften und Betriebswirtschaftslehre. Im Kombinationsbachelorstudiengang mit Lehramtsoption ist das Zweitfach ein Unterrichtsfach 26 B&B Agrar 4 / 2016
27 Biologie oder Deutsch, Geschichte, Sport oder jedes andere Fach, das an einer Berliner Universität gelehrt und an einer Berufsschule unterrichtet wird. Eine Vorbereitung auf besonders anspruchsvolle Aufgaben bietet das, sich zunehmender Beliebtheit erfreuende Studium der Sonderpädagogik. Im Lehramtsstudium werden die beiden studierten Fächer zudem um die bildungswissenschaftlichen Studienanteile, die das Schulpraktikum sowie Sprachbildung, Inklusion und die Fachdidaktik mit einschließen, ergänzt. Die fachdidaktischen Module werden im Fachgebiet Fachdidaktik Agrar-und Gartenbauwissenschaften koordiniert und durchgeführt. Im Bachelorstudium ist dies zunächst das Grundlagenmodul Fachdidaktik Einführung. In diesem Modul lernen die Studierenden Spezifika des Lehramts einer beruflichen Fachrichtung kennen und erarbeiten Grundlagen der agrarwirtschaftlichen Fachdidaktik. Bachelor und Master Abbildung 3: Aufbau Masterstudiengang HU Berlin 4 Fachdidaktik Unterrichtsfach I Fachdidaktik Unterrichtsfach II Wahl fachübergreifendes Angebot Masterarbeit 3 Praxissemester mindestens 3 Tage Schule + 1 Tag in der Uni Lernforschungs - projekt Fachdidaktik Unterrichtsfach I Fachdidaktik Unterrichtsfach II Inklusion Sprachbildung 2 Fachdidaktik Unterrichtsfach I 1 Erziehungswissenschaft Inklusion Inklusion Inklusion Fachdidaktik Unterrichtsfach II Sprachbildung Sprachbildung Inklusion Inklusion Fachwissenschaft (I) verändert aus Kipf, S., Schaumburg, H., Lohse, A. (2015) Tabelle: Pflichtbereich Bachelorstudium HU Berlin Agrarwissenschaften Biologie der Tiere Tierernährung und Futtermittelkunde Nutztierhaltung Fachwissenschaft (I) Fachwissenschaft (II) Fachwissenschaft (II) Während die Bachelorarbeit grundsätzlich zu einem fachwissenschaftlichen, nicht aber fachdidaktischen Thema angefertigt werden soll, sind auch hier bildungswissenschaftliche Bezüge möglich, etwa durch an außerschulischen Lernorten angesiedelte Forschungsvorhaben. Absolventinnen und Absolventen des B. Sc. mit Lehramtsoption können sich in das Masterstudium einschreiben. Ein Abschluss des M. Ed. (s. Abbildung 3) ist Voraussetzung für das Referendariat. Im Masterstudium werden sowohl die fachwissenschaftlichen Themen als auch die Fachdidaktik vertieft. Letzteres geschieht in den drei Modulen Unterrichtskompetenz ausprägen, Unterrichts- und Forschungskompetenz weiterentwickeln und Unterrichts- und Forschungskompetenz reflektieren. Eine Besonderheit des Masterstudiums ist das, innerhalb des Moduls Unterrichts- und Forschungskompetenz weiterentwickeln für das dritte Mastersemester eingeplante Praxissemester. Dieses verbringt der/die Studierende größtenteils in einer Schule und lernt hier beispielhaft die möglichen zukünftigen Wirkungsstätten und den beruflichen Alltag einer Fachlehrkraft aus erster Hand kennen. Im Verlauf des Praxissemesters gewinnen Studierende durch die Durchführung eines eigenen Lernforschungsprojekts weitere, im Hinblick auf die Masterarbeit wichtige Einblicke in die Methoden und Ansätze bildungswissenschaftlicher Forschung. In der Masterarbeit bringen Studierende ihre Forschungskompetenzen zur Anwendung häufig in Anbindung an laufende Forschungsprojekte eines Fachgebietes der Universität. Am Fachgebiet Fachdidaktik Agrar- und Gartenbauwissenschaften sind Arbeiten zu fachdidaktischen wie auch verschiedenen fachwissenschaftlichen Schwerpunkten mit Bezug zu Bildungsthemen, wie etwa im Bereich Umwelt- und Naturschutzbildung, möglich. Die Autoren Gartenbauwissenschaften Botanische Systematik und Entwicklungsbiologie Gemüseanbau Grundlagen der Biochemie Biologie der Pflanzen Agrar- und Gartenbautechnik Bodenkunde Grundlagen des Zierpflanzenbaus Phytomedizin I: Grundlagen der Phytomedizin Pflanzenernährung und Düngung Gärtnerischer Acker- und Pflanzenbau Einführung in die Agrarökonomie Fachdidaktik Einführung Bachelor-Arbeit Antje Eder Wissenschaftszentrum Weihenstephan der TUM München Fachdidaktik Agrarwissenschaft antje.eder@tum.de Prof. Dr. Marcel Robischon Humboldt-Universität zu Berlin Fachdidaktik Agrarund Gartenbauwissenschaften B&B Agrar 4 /
28 BILDUNG Foto: Karin & Uwe Annas Fotolia.com Ingrid Ute Ehlers und Regina Schäfer Telefonverhalten professionalisieren Die angemessene telefonische Kommunikation besitzt einen hohen Stellenwert, wenn es um das Ansehen eines Unternehmens bei Kunden, Geschäftspartnern oder Lieferanten geht. Allerdings werden Auszubildende häufig zu unspezifisch für die Anforderungen beim Telefonieren im Beruf sensibilisiert. ARTIKELSERIE Gerade Azubis führen Telefonate häufig mehr schlecht als recht aus Unerfahrenheit im Umgang mit anderen Menschen und aus der Unkenntnis heraus, welches Kommunikationsverhalten die jeweiligen Gesprächspartner am Telefon erwarten. Die Folge sind unglücklich verlaufende Telefonsituationen, bei denen Kunden, Geschäftspartner oder Lieferanten genervt oder auch verärgert reagieren, weil sie sich nicht wertschätzend behandelt fühlen oder mit ihren Fragen nicht ernst genommen werden. Doch Tipps für die Ausbildungspraxis In Beiträgen dieser Serie werden typische Problemstellungen im Ausbildungsalltag aufgegriffen und Ausbildungsverantwortlichen Werkzeuge im Umgang damit an die Hand gegeben. warum tun sich Auszubildende mit beruf lichen Telefonaten häufig schwer? Zunächst einmal glauben Auszubildende, dass es bei Telefonaten im Beruf in erster Linie auf Sachkompetenz und fehlerfreies Faktenwissen ankommt und haben daher Angst, Auskünfte zu erteilen und dann möglicherweise kritisiert zu werden. Dies lässt sie am Telefon entweder unsicher und schüchtern oder zu forsch und unfreundlich reagieren, was den Gesprächsverlauf in beiden Fällen nachteilig beeinflusst. Andere Auszubildende haben ganz einfach Lampenfieber, verhaspeln sich am Telefon, sind unkonzentriert und vergessen Gesprächsinhalte. Manche Auszubildende fühlen sich sogar extrem gehemmt, wenn andere ihnen bei den Telefonaten zuhören. Dies alles kann dazu führen, dass Auszubildende versuchen, sich vor Außentelefonaten zu drücken was ihre Ängste wiederum verstärkt. Luxusproblem? Ausbildungsverantwortliche unterschätzen häufig die Bedeutung beruflicher Telefonate in Hinblick auf Kundenbindung, Unternehmensimage und Wettbewerbsfähigkeit und vernachlässigen daher die Vermittlung und Förderung von Telefonkompetenz. Häufig setzen sie auch bei den Auszubildenden grundlegende kommunikative Fähigkeiten als selbstverständlich voraus. Folglich werden Auszubildende vielfach unzureichend auf das Telefonieren vorbereitet es sei denn, Ausbildungsverantwortliche werden Ohrenzeuge eines unangemessenen Telefonats. Punktuelle Kritikgespräche reichen dann allerdings zum tieferen Verständnis der kommunikativen Zusammenhänge nicht aus. Welche praxisnahen Ansatz punkte lassen sich also für 28 B&B Agrar 4 / 2016
29 die erfolgreiche Vermittlung von Telefonkompetenz finden? Die Auszubildenden sollten zunächst dafür sensibilisiert werden, dass Kunden, Geschäftspartner und Lieferanten am Telefon in erster Linie folgende Erwartungen an sie haben: eine freundliche Begrüßung und einen höflichen Umgangston, aufmerksames Zuhören und interessiertes Nachfragen bei Unklarheiten, Zeichen von Hilfsbereitschaft bei Anliegen des Telefonpartners, einen sachlichen Ton, auch wenn Kritik geübt wird, Zuverlässigkeit bei Zusagen (beispielsweise Rückruf). Außerdem sollten sich Auszubildende stets als Azubis outen dürfen, falls sie Fragen nicht beantworten können: Ich befinde mich noch in der Ausbildung und kann Ihnen jetzt die gewünschte Auskunft nicht geben. Ich kümmere mich darum und werde Sie gleich zurückrufen., Ich bitte um Verständnis, dass ich Ihnen diese Frage jetzt nicht beantworten kann, denn ich habe erst Anfang des Monats meine Ausbildung begonnen. Frau Schubert meldet sich nachher bei Ihnen.. Diese Hinweise bedeuten eine willkommene Entlastung und nehmen Auszubildenden ihre Ängste vor dem Telefon. Sie erleben, dass Nicht-Wissen keinen Makel darstellt und in ihrem speziellen Fall auch keinen Imageschaden für den Ausbildungsbetrieb zur Folge hat. Allerdings funktioniert diese Herangehensweise nur dann, wenn die Kommunikation weitergeht und den Gesprächspartnern zusätzlich ein nächster Schritt, eine Lösung oder eine Alternative in Aussicht gestellt werden, beispielsweise indem man sie an eine kompetente Person verbindet oder indem man kurz unterbricht, um nachzufragen. Geschieht dies nicht, wird dies von den Telefonpartnern als mangelndes Interesse, Überheblichkeit und unzureichende Serviceorientierung betrachtet (s. Tabelle). Gute Vorbereitung Die Funktionsweise der Telefonanlage gehört zu den grundlegenden betrieblichen Informationen, mit denen neue Auszubildende von Beginn an versorgt werden sollen. Zum einen sollten Anrufer nicht dadurch verärgert werden, dass sie ergebnislos hin- und her verbunden werden oder aus der Leitung fliegen. Zum anderen sollten sich die Auszubildenden auf die Gesprächsführung konzentrieren können ohne Stress mit der Technik haben zu müssen. So wird beispielsweise erwartet, dass man Gesprächspartner stets darüber informiert, was gerade geschieht oder was man als nächstes tun wird: Bitte legen Sie nicht auf, ich erkundige mich kurz, an wen ich Sie verbinden kann., Ich schaue sofort nach. Dazu bitte ich Sie, kurz zu warten.. Der Zusammenhang zwischen mangelnder Vorbereitung und der Tabelle: Wie funktioniert eine angemessene telefonische Kommunikation? So nicht: Da sind Sie bei mir vollkommen falsch, da bin ich nicht zuständig. Oje, da habe ich keine Ahnung. Vielleicht rufen Sie später noch mal an, dann ist mein Chef wieder aus der Pause zurück. Da kann ich doch nichts dafür. Frau Kaufmann hat momentan Urlaub. Versuchen Sie es doch nächste Woche noch einmal. Tja, da kann man halt nix machen. Lieber so: Um was genau handelt es sich? Moment, ich notiere Darf ich Sie mit dem Ab tei lungsleiter/mit der Buchhaltung/mit meiner Chefin verbinden? Er/sie kann Ihnen mit Sicherheit weiterhelfen. Es tut mir leid, das zu hören. Ich habe folgenden Vorschlag Frau Kaufmann ist im Urlaub, aber ihre Kollegin Frau Meier weiß da auch Bescheid. Ich verstehe, wie schwierig das für Sie ist. Vielleicht können wir negativen Außenwirkung ist vielen Auszubildenden nicht klar. Sie sind für konkrete Hinweise dankbar, wie es gelingt, höflich und souverän rüberzukommen, wenn sie nach außen telefonieren: ausreichend Zeitpuffer für wichtige Telefonate einplanen (so ist man weniger gestresst und das drückt sich auch im Sprechverhalten aus), schriftliche Informationen im Zugriff oder schnell abrufbar halten (Kundendaten, Gesprächsprotokoll, Verträge, Rechnungen), Gesprächspartner nicht durch einen ungünstigen Zeitpunkt des Telefonates nerven (montags früh, kurz vor Frühstücksoder Mittagspausen, kurz vor Feierabend), Namen ihrer Gesprächspartner parat haben und korrekt aussprechen können. So können die Auszubildenden der eigenen Unsicherheit konstruktiv begegnen, weil eine gute Vorbereitung viel ausmacht. Notizen machen Aus Telefonaten ergibt sich speziell für Auszubildende deren Entscheidungskompetenz ja beschränkt ist weiterer Handlungsbedarf. Dies betrifft vor allem die korrekte Weitergabe von Fragen und die Siche rung von Ergebnissen. Hier überschätzen Auszubildende erfahrungsgemäß ihre Merkfähigkeit. Umso wichtiger ist es, sie dazu zu bringen, entsprechende Informationen stets aufzuschreiben. Wenn Auszubildende die Mög lichkeit erhalten, ihre eigene Gesprächsnotiz zu entwickeln und auszugestalten, erhöht dies die Akzep tanz und die Nutzung dieses Hilfsmittels erheblich. Das kann bedeuten, dass das Formular in Sprache und Aufbau von den sonst gebräuchlichen Formen abweicht. Das macht überhaupt nichts Hauptsache, die wesentlichen Informationen gehen nicht verloren. So professionalisieren die Azubis ihr Telefonverhalten Schritt für Schritt. Gleichzeitig erleben sie, dass die Vorbereitung vor unangenehmen Telefonsituationen schützt. Dies schafft Sicherheit und zunehmende Souveränität. Die Autorinnen Ingrid Ute Ehlers Regina Schäfer Beide: Expertinnen für Kommunikation im Beruf, Frankfurt am Main Beraterinnen, Trainerinnen, Dozentinnen, Buchautorinnen B&B Agrar 4 /
30 BERATUNG Fotos (3): B. Brettschneider-Heil, aid Bärbel Brettschneider-Heil Mehr als Milchkühe Innovationen fördern Eichenstämme als Kultursubstrat für eine Waldpilzzucht und Eschenholz als Basis für Hurling- Schläger, die für den in Irland sehr beliebten Mannschaftssport keltischen Ursprungs benötigt werden. Zwei innovative Ideen zur Waldnutzung, die auf einer der acht Exkursionen der IALB- Tagung in Limerick präsentiert wurden. Michael Sommers (Teagasc) und Waldbesitzer John O Connell erläutern den Exkursionsteilnehmern, wie Hurling-Schläger (Hurleys) aus Eschenholz entstehen. Die Autorin Dr. Bärbel Brettschneider-Heil aid infodienst e. V. Etwa 350 Beratungskräfte trafen sich vom 19. bis 23. Juni in Limerick (Irland) zur 55. Tagung der Akademie Land- und Hauswirtschaftlicher Beraterinnen und Berater (IALB) und zum 5. Treffen der Europäischen Organisation der Beratungseinrichtungen EUFRAS. Die Teilnehmenden diskutierten, welche Unterstützung die Beratung den landwirtschaftlichen Betrieben bieten kann, die innovative Ideen umsetzen. Innovation Support for a Diverse Agriculture war das Leitthema der Tagung, die von der irischen Beratungs-, Bildungs- und Forschungseinrichtung TEAGASC organisiert wurde. In Vorträgen, Workshops, einer Postersession und auf Exkursionen zu landwirtschaftlichen Betrieben zeigte sich, dass ein breites Spektrum der Innovationsunterstützung möglich ist. Über 80 Prozent der Agrarflächen Irlands sind Weide- und Grasland, welches überwiegend für die Milch- und Rindfleischproduktion genutzt wird. Viele Innovationen entstehen daher auch in diesen Produktionsbereichen und werden entsprechend stark durch die Beratung unterstützt. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, im Agrarsektor Geld zu verdienen. Beispiele zur Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte, zum Tourismus oder zu erneuerbaren Energien konnten auf den Exkursionen erlebt werden, die zu sehr unterschiedlichen Betrieben führten und innovative Betriebsideen ganz praktisch und anschaulich präsentierten. Vorträge und Diskussionsrunden ergänzten die Eindrücke aus der Praxis. Vorgestellt wurden unter anderem der europäische Ansatz der Innovations-Partnerschaften (EIP-AGRI), aber auch die Ideen und Beiträge der irischen Beratungsorganisationen (öffentliche und private Beratung) und die ganz persönliche Sichtweise der Landwirte zum Thema Innovationen auf dem eigenen Betrieb. Im Plenum und in den Workshops wurden Methoden erarbeitet, um Beratungskräfte noch besser zu trainieren (zum Beispiel im Hinblick auf Selbstführung), Ideen entwickelt, um Kontakte zu schwer erreichbaren Betrieben zu knüpfen, oder auch Initiativen diskutiert, um die Beratungsorganisationen europaweit besser zu vernetzen besteht wieder in Deutschland die Möglichkeit, eine IALB- Tagung zu erleben. Vom 18. bis zum 22. Juni werden sich die Beratungskräfte zum Thema Neue Wege zwischen globalisierten Märkten und regionalen Ansprüchen in Münster treffen. Die Teilnehmenden der Exkursion Wald, erneuerbare Energien und Bildung 30 B&B Agrar 4 / 2016
31 PORTRÄT Ulrike Bletzer Die Landwirtschaftsschule Weiden Wer einen landwirtschaftlichen Betrieb führen oder eine verantwortungsvolle Position im Dienst leistungssektor übernehmen möchte, kann sich an der Landwirtschaftsschule Weiden das erforderliche Rüstzeug aneignen. Foto: Landwirtschaftsschule Weiden Die Landwirtschaftsschule Weiden in der Oberpfalz, deren Wurzeln bis ins Jahr 1869 zurückreichen, bildet ihre Absolventen zu staatlich geprüften Wirtschaftern für Landbau aus. Ziel ist es, angehenden Unternehmern Handlungs- und Entscheidungskompetenzen sowie Grundlagen der Mitarbeiterführung zu vermitteln. Doch obwohl es sich bei den meisten der insgesamt rund 40 Studierenden um Hofnachfolger handelt, bietet die Bildungseinrichtung, wie Schulleiter Dr. Siegfried Kiener betont, auch optimale Voraussetzungen für eine spätere Tätigkeit im Dienstleistungssektor etwa als Beamter im mittleren Dienst oder als Berater bei einer Erzeugerorganisation. Einer der Vorteile der Weidener Schule Zugangsvoraussetzung ist ein landwirtschaftlicher Berufsabschluss ist ihre zentrale Lage in einer Region mit zahlreichen Milchviehbetrieben. Dadurch haben wir genügend Studierende, um jedes Jahr mit einem ersten Semester an den Start gehen zu können, freut sich Dr. Kiener. Dem eigentlichen Schulbesuch ist ein Praxisjahr vorgeschaltet, in dem die künftigen Wirtschafter für Landbau zur Vorbereitung auf die Lerninhalte der Fachschule Daten und Unterlagen über den elterlichen Betrieb sammeln. Bereits während dieses Praxisjahrs werden sie intensiv von den Lehrkräften der Landwirtschaftsschule betreut. Wir besuchen die Betriebe mit dem gesamten Kollegium, analysieren bestehende Probleme und unterbreiten Verbesserungsvorschläge, berichtet Schulleiter Dr. Kiener, und Semesterleiter Peter Gach fügt hinzu: Dabei verstehen wir uns als Vermittler zwischen den Vorstellungen der Studierenden und denen ihrer Eltern. Mitte Oktober beginnt dann die dreisemestrige Ausbildung. In den beiden fachtheoretischen Wintersemestern stehen Fächer wie Pflanzliche und Tierische Produktion und Vermarktung oder Naturschutz und Landschaftspflege, aber auch betriebswirtschaftliche Inhalte auf dem Stundenplan. Kenntnisse in der Berufs- und Arbeitspädagogik sowie allgemeine Themen wie soziale und religiöse Bildung oder Rhetorik ergänzen den Unterricht. Dabei vertiefen wir Themen aus dem Lehrplan auch mit dem Wissen unserer Verbundpartner aus der Beratung wie zum Beispiel Maschinenring oder Pflanzenbau, erklärt Dr. Kiener. Persönlichkeitsbildung Landwirtschaftsschule Weiden Beethovenstraße Weiden Tel.: poststelle@aelf-we.bayern.de Das Sommersemester umfasst einen schulischen Teil mit 15 Unterrichtstagen, dessen Schwerpunkt die Fachpraxis ist. In diesem fachpraktischen Teil befassen sich die Studierenden mit sehr konkreten Dingen wie zum Beispiel mit Trächtigkeitsuntersuchungen oder der Zusammenstellung von Futterrationen, präzisiert der Schulleiter. Neben dem Fachlichen legt die Landwirtschaftsschule großen Wert auf die Persönlichkeitsbildung. So besuchen die Studierenden einmal im Semester einen Herrenausstatter, der sie in Sachen Outfit schult, oder verfeinern ihre Kenntnisse im Seminar Stil und Etikette bei Tisch. Zwei Dinge liegen Semesterleiter Peter Gach darüber hinaus am Herzen: Wir möchten das Bewusstsein der Studierenden für den Wert ihres Landes und für die Notwendigkeit eines nachhaltigen Umgangs mit diesem Land schärfen in der Hoffnung, dass sie dieses Bewusstsein später weitertragen. Und wir lassen sie ausgewählte Inhalte wie zum Beispiel Arbeitswirtschaft oder Betriebsorganisation gemeinsam erarbeiten. Die gezielte Ausrichtung des Unterrichts an den Betrieben der Studierenden, die mit W-LAN-Anschluss ausgestatteten modernen Schulräume und auch die Möglichkeit zum Mittagessen im Haus all das nennen die beiden Pädagogen als weitere Vorzüge der Landwirtschaftsschule, deren Ein zugsgebiet sich im 50-Kilometer-Radius rund um Weiden erstreckt. Eine Stärke liegt auch darin, dass wir im örtlichen Verbund mit der Berufsschule in benachbarten Neustadt an der Waldnaab und dem Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Milchviehhaltung in Almesbach zusammenarbeiten und die Bildungsziele aufeinander abstimmen, ergänzt Dr. Kiener. Am Ende des ersten Semesters legen die Absolventen eine Prüfung im Fach Berufsausbildung und Mitarbeiterführung, am Ende des dritten Semesters jeweils eine weitere in den Fächern Pflanzenproduktion und Tierproduktion ab. Dazu kommt eine Semesterarbeit. 80 bis 100 Prozent unserer Studierenden machen von der Möglichkeit Gebrauch, den Meister abzulegen, betont der Schulleiter. Die Autorin Ulrike Bletzer Freie Journalistin, Bad Ems ulibletzer@aol.com B&B Agrar 4 /
32 PORTRÄT SCHUL-PROJEKTE Oliver Schmidt Wie man Sekt herstellt Eine prickelnde Angelegenheit ist das Schul- Projekt an der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg. Neben dem fachlichen Wissen werden Teamarbeit und Medienkompetenz gestärkt. Fotos (2): O. Schmidt, LVWO Während der zweijährigen Ausbildung zum Techniker für Weinbau und Oenologie lernen die Schüler im Rahmen des Schul-Projektes nicht nur vieles über die traditionelle Sektherstellung, sondern wenden auch verschiedene Präsentationstechniken an und stärken ihre Medienkompetenz. Folgende Ziele sollen erreicht werden: Vermittlung von theoretischen Kenntnissen rund um die Sektbereitung, Vertiefung und Festigung der Theorie durch die Anwendung des Gelernten, Tabelle: Die Sektprojekte der Schüler der Technikerklasse 1 Name des Projektsektes = Facebook Suchkriterium Ri VIER a Sky sektgrenzenlos Weinsberg Origin Passion of Chardonnay Pole Position Kurze Charakterisierung Muskateller Vier Weinbaugebiete für einen Sekt riviera = lautmalerisch selbsterklärend Chardonnay/Spätburgunder Klassische Rebsortenkombination zeitlos elegant verleiht Flügel JustINus verklausulierte Rebsorte (Justinus K) Fest verwurzelt bodenständig und doch hipp Starkes Logo Chardonnay Passion für das gemeinsame Projekt Begeisterung für eine Rebsorte Weißburgunder Sekt für Siegertypen = Ehrgeiz, Stärke, Ausdauer und Dynamik 5 junge Winzer mit einem Ziel der Titel Techniker für Weinbau & Oenologie Teamarbeit in Gruppen von vier bis sechs Schülern, zielorientiertes Arbeiten, Arbeitsorganisation über lange Zeiträume, Training der gesetzlichen Dokumentationspflicht (Kellerbuch), Erfassung des Materialaufwands und Kostenanalyse, Erweiterung und Üben von Kommunikationsfähigkeiten, Entwicklung eines stringenten Konzeptes für den Projektsekt, Anwendung moderner Marketinginstrumente. Da die traditionelle Sektbereitung viel Zeit in Anspruch nimmt, startet das Sektprojekt schon eine Woche nach Ausbildungsbeginn im September. Der erste Schritt ist die Gruppenbildung, die in den Anfangsjahren den Schülern überlassen wurde. Die selbst gebildeten Gruppen arbeiteten allerdings nicht immer harmonisch zusammen. Außerdem orientierten sie sich oft am Weinbaugebiet und bestanden dann zu 100 Prozent aus Württembergern, Badenern oder Moselanern. Das Problem: Eine Mosel-Gruppe kommt zu der Feststellung, dass ein guter Sekt nur aus der Rebsorte Riesling hergestellt werden kann, während Schüler aus Baden zu dem Schluss gelangen, dass dafür nur ein Spätburgunder infrage kommt. Um den interkulturellen Austausch zu fördern, werden die Gruppen jetzt per Zufallsgenerator ausgewählt. Zwei Wochen nach Schulbeginn muss jede Gruppe mithilfe einer gemeinsam erstellten PowerPoint- Präsentation vor der Klasse einen ersten Entwurf für den geplanten Sekt vorstellen. Für viele Schüler ist diese Art der Kommunikation neu. Um sie nicht zu überfordern, wird eine umfangreiche, verbindliche Gliederung vorgegeben. So ist die Aufgabe für alle klar definiert und die Leistung besser vergleichbar. Bei dieser ersten Präsentation ist noch alles sehr vage und ungewiss. Aber das ist auch später im Berufsleben so, wenn Neuland beschritten wird. Im Team organisieren Es folgt die praktische Umsetzung, bei der die Gruppen jeweils zwischen 150 und 300 Kilo Trauben 32 B&B Agrar 4 / 2016
33 verarbeiten. Manche Schüler bringen sich hier voll ein, nachdem sie sich mit PowerPoint eher schwer getan haben. Bei anderen ist es genau umgekehrt. So wird der Wert eines funktionierenden Teams in einer arbeitsteiligen Wirtschaft erkennbar. Die Gruppen müssen Trauben bonitieren, die Reife einschätzen, Analysen erstellen und den Lesezeitpunkt festlegen, dann folgen Lese und Traubenverarbeitung. Immer wieder sind Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen zu treffen. Die Gruppe muss sich für einen gemeinsamen Weg entscheiden und zahlreiche Punkte besprechen, zum Beispiel: Wie hoch soll der maximale Druck beim Pressen sein? Zusatz von Schwefeldioxid zum Most? Wenn ja, wie viel? Welche Analysen braucht man? Welche Hefe soll eingesetzt werden? Ist ein biologischer Säureabbau geplant? Auch bei der Gärkontrolle gilt es sich im Team zu organisieren. Die haptischen und sensorischen Erfahrungen während der Bereitung der Sektgrundweine in Verbindung mit dem intensiven Austausch sind sehr lehrreich und gewährleisten, dass die Gruppen eine Beziehung zum eigenen Produkt aufbauen. In den allermeisten Fällen sind die Grundweine bis Mitte Dezember vergoren und die Klärung und Stabilisierung steht an. Frei präsentieren Bereits vorher, Anfang Dezember, muss die Gruppe die zweite PowerPoint-Präsentation halten. Sie soll: aufzeigen, was bislang bei der Produktion des Sektgrundweins passierte und in welchem Stadium der Sektgrundwein sich momentan befindet, und die ursprünglichen, im September formulierten Projektziele hinterfragen. Es kann (und wird zwangsläufig) immer wieder vorkommen, dass es aufgrund der Witterung, eines Problems bei der Traubenbeschaffung oder wegen Gärschwierig keiten zu Korrekturen, Anpassungen oder Ergänzungen kommt. Die Gruppe hält den Vortrag gemeinsam, jeder sollte gleich lang und gleich viel vortragen. So üben die Schüler die freie Rede und den Umgang mit der Technik. Im Anschluss wird die Präsentation besprochen, die Vorträge werden auf Video aufgezeichnet und als DVD an die Schüler weitergegeben. Dies bietet jedem Schüler die Gelegenheit, sich selbst zu betrachten und einzuschätzen. Im modernen Schulalltag wird zunehmend Wert auf Präsentationsfähigkeiten gelegt. Spätestens bei den mündlichen Abschlussprüfungen und der Vorstellung der Technikerarbeit sind sie von enormer Bedeutung. Mediale Kompetenz Aber das Projekt umfasst noch mehr Aufgaben: Die Gruppe erstellt eine Seite auf Facebook und kommuniziert die Entwicklung des werdenden Sektes im Web. Parallel dazu gestaltet sie ein kurzes Video über ihre selbst erschaffene Sektmarke. Der Film wird über YouTube weltweit verfügbar gemacht und ergänzt die Facebook- Darstellung. Die Ergebnisse im Web zeigen, dass die Schüler hochmotiviert ans Werk gehen, tolle Ideen haben und diese nahezu professionell umsetzen. Eine starke Leistung, denn immerhin sind hier keine Audio- und Video-Profis am Werk sind, sondern gelernte Winzer und Küfer. Der Nebeneffekt: Die Gruppe muss sich abermals mit dem selbst erschaffenen Image beschäftigen und ihr Produkt kompetent darstellen. Und die Anwendung der komplexen Digitaltechnik ist eine gute Übung für andere komplexe Aufgaben. Im Moment ist es noch ein Spiel, ein Wettbewerb unter (Schul-)Freunden. Nach dem Abschluss kann die erworbene mediale Kompetenz zielorientiert in den Berufsalltag eingebracht werden. Marketing-Ideen Im auf die Ernte folgenden Mai erarbei ten die Schüler eine dritte PowerPoint-Präsentation. Spätestens jetzt sollten alle Gruppen eine schlüssige, mitreißende Marketing- Idee entwickelt haben. Denn zu diesem Zeitpunkt sind alle Rohsekte vergoren und Korrekturen nur noch in kleinem Umfang realisierbar. Wenn es zu Problemen kommt, werden diese möglichst mit der gesamten Klasse besprochen und danach von der Gruppe gelöst. So wird Krisenmanagement geübt. Der Endspurt findet im zweiten Schuljahr statt. Nach dem Abrütteln wird in Vorversuchen die optimale Dosage ermittelt, dann degorgiert (der im Flaschenhals befindliche Hefepfropf entfernt). Üblicherweise erfolgt dies zwischen Januar und März. Die Schüler der Abschlussklasse präsentieren ihre Projektsekte kurz vor den Prüfungen im Mai vor großem Publikum eine gute Gelegenheit, die freie Rede vor über 60 Personen zu so lautet der Name des kreierten Projektsektes. Fazit Das fächerübergreifende Sektprojekt zeigt beispielhaft, wie zukünftige Betriebsleiter nicht nur technologische, sondern unter anderem auch mediale Kompetenzen erwerben. Marktkonforme Produkte können nur entstehen, wenn Weinbau, Oenologie und Marketing sowie Kommunikation eng verzahnt zusammenarbeiten. Die gemeinsame Entwicklung eines Produktkonzeptes in einer Gruppe und dessen Kommunikation mittels unterschiedlicher Medien ist für die Schüler eine sehr gute Gelegenheit zum Anwenden vieler theoretischer Lerninhalte. Sie sind hochmotiviert und arbeiten im Team für ein gemeinsames, selbst geschaffenes Produkt. Der Autor Dr. Oliver Schmidt Lehrer an der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg B&B Agrar 4 /
34 QUELLEN DATEN KOMMENTARE Barcamp im Wissenschaftszentrum Kiel Foto: Sebastian Schack Anne Dirking Barcamp, Webinar und Co. Wer die Programme der einschlägigen Weiterbildungsanbieter durchblättert, hat die Qual der Wahl. Ob im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung oder in der beruflichen Qualifizierung das Spektrum der Angebote und Formate ist groß. Der Durchblick fällt oft schwer. Barcamp, Webinar, Workshop was ist was? Der aid veranstaltet in regelmäßigen Abständen kostenlose Webinare zu aktuellen Themen aus Landwirtschaft und Ernährung: webinare-514.html Jeder hat schon mal einen Vortrag gehört. Bei einem Vortrag steht der Referent im Vordergrund. Es liegt auf der Hand: Die Vermittlung von Wissen erfolgt durch Vortragen. Die vortragende Person referiert in einer begrenzten Zeit zu einem bestimmten Thema. Sie leitet und spricht üblicherweise allein. Die Teilnehmer fungieren als Zuhörer. Gleichbedeutend und jedem Schüler bekannt ist ein Referat. Ein Seminar ist eine einmalige Weiterbildungsveranstaltung, die in der Regel länger dauert als ein Vortrag. Während ein Vortrag eher eine reine Informationsveranstaltung ist, geht es beim Seminar um das Vermitteln von Wissen und Fähigkeiten. Ein Thema wird gemeinsam erarbeitet, die Teilnehmer werden aktiver eingebunden. Soll heißen: Von ihnen wird Mitarbeit erwartet, sie sind nicht reine Zuhörer, sondern nehmen durch Fragen und Diskussionen aktiv am Geschehen teil. Der viel beschworene Blick über den Tellerrand ist in dieser Trainingsform inklusive. Übrigens: Auch eine Lehrveranstaltung (etwa an einer Hochschule) gilt als Seminar. Hier erarbeiten die Teilnehmer unter (wissenschaftlicher) Anleitung bestimmte Themen. Die Begriffe Seminar und Training werden häufig synonym verwendet. Training ist ursprünglich für den sportlichen Bereich reserviert. Bei einem Training wird ein Programm planmäßig durchgeführt. Vielfältige Übungen zur Ausbildung von Können, Stärkung der Kondition und Steigerung der Leistungsfähigkeit stehen auf dem Plan. Im Unterschied zum Seminar läuft ein Kurs über einen längeren Zeitraum. Das Wort Kurs kommt aus dem Lateinischen: currere bedeutet laufen. Beim Kurs erfolgt die Wissensvermittlung also etappenweise. Auch eine zusammengehörende Folge von Unterrichtsstunden nennt sich Kurs. Gleichbedeutend sind ein Lehrgang und eine Schulung. Die Schulung ist der Klassiker der Personalentwicklung, sozusagen der Frontalunterricht im Arbeitsleben. Ziel ist standardisierte Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln. Der aktive Anteil des Schulungsleiters ist entsprechend hoch. Die Aktivität der Schüler hat eher übenden Charakter. Sie wenden an, was sie vorher gelernt haben, oft 1:1. Typische Beispiele sind Schulungen zur Einführung neuer Software und Schulungen zur Vermittlung geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen. Die Vorteile: Standardisierte Inhalte sind schnell vermittelt, es können viele Teilnehmer in kurzer Zeit geschult werden und die Kosten pro Teilnehmer halten sich in Grenzen. Die Nachteile: Die Teilnehmer haben wenig Freiraum, was Inhalte und Ablauf einer Schulung betrifft. Ein Workshop hat mit dem klassischen Konzept Vorne steht einer, die anderen hören zu nichts mehr zu tun. Die Wissensvermittlung erfolgt durch Gruppenarbeit, also durch work (Arbeit). Erkenntnisse werden gemeinsam erarbeitet. Im Gegensatz zu einem Seminar steht hier die Praxis im Vordergrund. Deshalb nehmen an einem Workshop weniger Teilnehmer teil. Die Teilnehmer bilden eine Form von Arbeitsgemeinschaften, in denen das Wissen und die Fähigkeiten gemeinsam erarbeitet werden. Der Trainer ist Moderator; er lenkt, leitet und gibt bestenfalls Impulse. Workshops sind meist kreativ, da ergebnisoffen innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen. Typische Beispiele: Workshop zur Entwicklung eines Leitbilds, Workshop Produktentwicklung, Workshop zur Entwicklung einer Verkaufsstrategie für eine neues Produkt. Webinar ist ein Kunstwort und setzt sich aus den Wörtern Web und Seminar zusammen. Ein Web- 34 B&B Agrar 4 / 2016
35 inar findet live im Internet statt. Ort des Geschehens ist ein virtueller Klassenraum. Die Teilnehmer können somit ortsunabhängig teilnehmen und sich interaktiv beteiligen. Mittels Mikrofon und Webcam kommunizieren sie miteinander oder auch per Chat. Die Teilnehmerzahl ist nach oben offen. Jeder kann teilnehmen. Voraussetzungen sind lediglich ein Internetanschluss mit Lautsprecher und eine -Adresse. Die Vorteile: Es fallen keine Fahrtzeiten und keine Reisekosten an und man kann sich bequem von zu Hause aus informieren. Die Besonderheit: Referent und Teilnehmer und auch die Teilnehmer untereinander sehen sich gegenseitig nicht. Dennoch können alle das Gleiche tun wie bei einem richtigen Seminar: lernen, zuhören, mitdenken und Fragen stellen. Inhalt und Ablauf offen Ein gutes Handwerkszeug erleichtert das Arbeiten. Für viele noch ein Buch mit sieben Siegeln: das Barcamp. Andere inspirieren, selbst inspiriert werden und gemeinsam mehr bewegen darum geht es. Ein Barcamp geht meist über zwei Tage. Beliebt ist diese Methode bei Themen rund um Computer und Internet. Es treten keine Referenten auf, ein Barcamp besteht nur aus einem Moderator und Teilnehmenden. Oft sind es Hunderte. Es wird nur das Allernötigste organisiert, also Raum, Anmeldungen, Finanzierung (meist über Sponsoren) und Durchführung. Zu Beginn stehen weder Inhalte noch Ablauf fest, beides wird von den Teilnehmenden selbst entwickelt und gestaltet. Sie stellen am Morgen spontan eine Art Tagesplan auf, alle Anwesenden werden eingebunden. Diese sogenannten Sessions (Vorträge, Diskussionsrunden und Workshops) werden auf Whiteboards oder Pinwänden notiert. Eine tragende Rolle hat der Moderator: Er übernimmt sowohl Start als auch Schlussplenum. Wichtig ist aber auch eine gute Infrastruktur (Getränke, Papier). In einem Barcamp gilt das Motto: Man muss sich ranhalten! Denn es wird gleichzeitig diskutiert, zugehört und notiert. Letzteres auf dem Bildschirm. Manche Barcamps werden sogar live im Internet übertragen. Jeder Teilnehmer bringt sein Wissen und seine Erfahrungen in Workshops, Vorträgen und Diskussionen ein. In einem Barcamp geht es primär darum, dass die Teilnehmer voneinander lernen. Die grundlegenden Regeln: Jeder Teilnehmer soll selbst einen kurzen Vortrag halten; das Thema muss sich mit drei Worten beschreiben lassen, der Referent stellt sich mit maximal einem Satz vor. Jede Session dauert höchsten 45 Minuten. Diese Form einer Weiterbildungsveranstaltung ist relativ neu. Barcamps gehen über Umwege auf Tim O Reilly zurück, einem aus Irland stammenden Verleger und Softwareentwickler. Er initiierte Brainstorming-Wochenenden mit Gleichgesinnten. Gedankenaustausch ohne Regeln lautete seine Vision. Nur ausgewählte Personen waren eingeladen zum Austausch und zur Übernachtung. Einige Teilnehmer wollten das Format allen zugänglich machen und entwickelten die Barcamps. Das erste fand 2005 in Kalifornien statt, im deutschsprachigen Raum ist diese Art der Weiterbildung seit 2006 ein Thema. Oft hat man die Möglichkeit, im Schlafsack vor Ort zu übernachten. Es ist üblich, dass die Kosten für Verpflegung Sponsoren übernehmen. Organisiert werden Barcamps hauptsächlich im Internet, etwa über Blogs. Hier findet man auch die Dokumentationen darüber. Viele Programmierworkshops finden als Barcamps statt. Aber auch andere Bereiche ziehen nach: Bei einem BibCamp steht alles rund um das Thema Bibliotheken im Mittelpunkt. Im EduCamp werden Fragen des Lehrens und Lernens diskutiert. Findet ein Barcamp im touristischen Umfeld statt, handelt es sich um Tourismuscamps oder Hotelcamps. Übrigens: Hinter dem Namen Barcamp steckt ein Wortspiel: Bar wird in der Informatik als Platzhalter bezeichnet. Und Camp steht für Camping. Die Autorin Anne Dirking Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Uelzen anne.dirking@lwkniedersachsen.de Foto: Martin Schemm, pixelio.de Bundesgesetzblatt Mai bis Juni 2016 Fünfte Verordnung zur Änderung tierseuchenrechtlicher Verordnungen vom (BGBl I Nr. 21, Seite 1057) Neufassung der Lebensmittelrechtlichen Straf- und Bußgeldverordnung vom (BGBl I Nr. 23, Seite 1166) Verordnung zur Bestimmung der Rentenwerte in der gesetzlichen Rentenversicherung und in der Alterssicherung der Landwirte zum 1. Juli 2016 (Rentenwertbestimmungsverordnung 2016 (RWBestV 2016) vom (BGBl I Nr. 28, Seite 1360) Verordnung zum Schutz von Oberflächengewässern vom (BGBl I Nr. 28, Seite 1373) Erste Verordnung zur Änderung der Tabakerzeugnisverordnung vom (BGBl I Nrr. 29, Seite 1468) Neufassung der Lebensmittelhygiene-Verordnung vom (BGBl I Nr. 29, Seite 1469) Zweite Verordnung zur Änderung der BVDV-Verordnung vom (BGBl I Nr. 29, Seite 1480) Neufassung der BVDV-Verordnung vom (BGBl I Nr. 29, Seite 1483) Zwölfte Verordnung zur Änderung der Saatgutverordnung vom (BGBl I Nr. 30, Seite 1508) Neunte Verordnung zur Änderung der Lebensmittelrechtlichen Straf- und Bußgeldverordnung vom (BGBl I Nr. 32, Seite 1563) Zweite Verordnung zur Änderung der Geflügelpest-Verordnung vom (BGBl I Nr. 32, Seite 1564) Unter finden Sie einen Bürgerzugang, über den Sie kostenlos und ohne Anmeldung direkten Zugriff auf das komplette Archiv des Bundesgesetzblattes haben. B&B Agrar 4 /
36 In Zusammenarbeit mit dem Magazin FORSCHUNGSFELDER Mit Drohnen gegen Unkraut Drohnen können sehr nützliche Aufgaben übernehmen: Neben beeindruckenden Luftaufnahmen von Landschaften und Gebäuden helfen sie Landwirten bei der Arbeit, wenn sie in fünf bis zehn Metern Höhe über Ackerland schweben: Sie zeigen an, wo Unkraut wächst. Der Nutzen: Man muss Pflanzenschutzmittel nicht mehr nach dem Gießkannenprinzip auf dem gesamten Acker verteilen, sondern kann sich auf die verunkrauteten Stellen konzentrieren. So lautet der Plan am Julius-Kühn- Institut (JKI) in Braunschweig. Dort befasst sich ein Forscherteam mit der Unkrauterkennung mit Hilfe unbemannter Luftfahrzeuge. Das Team hat einen kleinen, GPS-gesteuerten Hexakopter (mit sechs Rotoren) mit einer modifizierten HD-Digitalkamera ausgestattet und Testflüge über Ackerflächen gestartet. Die Wissenschaftler-/innen sind zuversichtlich: Die Versuche lassen ein großes Potenzial für die sogenannte räumlich aufgelöste Unkrautkontrolle erahnen. JKI Mit Artenschutz punkten Die Vielfalt der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten in landwirtschaftlich geprägten Lebensräumen zu erhöhen das ist das erklärte Ziel des Projekts Landwirtschaft für Artenvielfalt. Wissenschaftler/-innen des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) im brandenburgischen Müncheberg haben dafür ein System zur Bewertung von Naturschutzleistungen ent wickelt, die mit der ökologischen Landwirtschaft erbracht werden können. Grundlage bildet ein Leistungskatalog, der über 70 Maßnahmen zusammenfasst. Über ein Punktesystem wird schließlich die Effizienz der einzelnen Handlungsweisen bewertet. Mit dem Label Landwirtschaft für Artenvielfalt erhalten die rund 40 teilnehmenden Ökobetriebe einen höheren Abnahmepreis. Verbraucher können durch den Kauf so erzeugter Lebensmittel aktiv einen Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt leisten. Im Rahmen der UN-Dekade Biologische Vielfalt wurde das Vorhaben als wegweisendes Projekt ausgezeichnet. ZALF Extreme Wetterlagen nehmen zu Im Sommer 2003 bescherte das Hochdruckgebiet Michaela den Deutschen den heißesten Sommer seit Wetteraufzeichnungen. Ein Märchensommer, der gleichzeitig eine der größten Naturkatastrophen bescherte: Wälder standen in Flammen, Felder verdorrten. Ob sich solche oder andere Wetterextreme in Zukunft häufen, hat eine aktuelle Studie des Thünen-Instituts im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) untersucht. Hitzestress hemmt das Pflanzenwachstum. Foto: agrarfoto.com Extreme Wetterlagen wie Dürre, Überschwemmungen, Hagel, Hitze, Frost oder Sturm können der deutschen Landund Forstwirtschaft binnen Stunden oder innerhalb weniger Wochen erheblichen Schaden zufügen und ganze Ernten vernichten. Die Folge: hohe finanzielle Belastungen für die einzelnen Betriebe, aber auch für die gesamte Volkswirtschaft. Das Forschungsprojekt Agrarrelevante Extremwetterlagen und Möglichkeiten des Risikomanagements lieferte nun in einer europaweit einzigartigen Studie neue Erkenntnisse. Ziel war es herauszufinden, ob extreme Wetterlagen in der Vergangenheit seltener waren und ob sie in Zukunft zunehmen werden, sagt Projektleiter Dr. Horst Gömann. Wichtig war auch zu untersuchen, welche Konsequenzen das für die Landwirtschaft haben wird. Zunächst wurde dazu definiert, welche Wetterlagen jeweils extrem sind. Temperaturen unter minus 15 Grad Celsius ohne schützende Schneeschicht über mehrere Tage schädigen das Wintergetreide ebenso wie extreme Hitze während der Ährenbildung, Spätfröste bei der Apfelblüte oder sehr niedrige Bodenfeuchten wirken sich ebenfalls negativ auf die Ernte aus, erklärt der Experte. Daraufhin hat der Deutsche Wetterdienst die beobachteten Wetterdaten von 1961 bis heute regional differenziert und mit Blick auf das Auftreten dieser extremen Wetterlagen ausgewertet. Zugleich wurden sämtliche vorliegenden Klimaprojektionen analysiert, um zu sehen, was für die Zukunft zu erwarten ist. Die Sommer werden gegen Ende dieses Jahrhunderts aufgrund des Klimawandels deutlich trockener und heißer. Unsere Studien haben ergeben, dass die Tage mit über 30 Grad Celsius in den vergangenen fünf Jahrzehnten zugenommen haben, sagt Gömann. Kritische Trockenzeiten erwarten wir vor allem zum Ende des Jahrhunderts in Teilen Ost- und Süddeutschlands. Zunehmende Trockenheit war bereits in den vergangenen 15 Jahren zu beobachten, insbesondere im Frühjahr. Für den Ackerbau ist das ein Problem, wenn der ausgebrachte Dünger mangels Regen nicht zu den Wurzeln gelangt. Darüber hinaus wird sich laut der ausgewerteten Klimaprojektionen die Zahl der heißen Tage bis 2098 verdoppeln. Die Folge: Böden trocknen aus, der Hitzestress hemmt das Pflanzenwachstum. Wenn während der Weizenblüte von Mitte Mai bis Mitte Juni sehr viele Hitzetage auftreten, beeinträchtigt das die Kornbildung. Das kann zu erheblichen Ernteausfällen führen, so der Experte. Auch für die Wälder hat die Zunahme der Hitzetage Konsequenzen: Die Trockenheit bedroht vor allem junge Fichten und Kiefern und damit das Nachwachsen des Waldes. Gleichzeitig gehen die Forscher davon aus, dass künftig extreme Niederschläge zunehmen. Auch wird die Zahl der Tage mit tiefen Temperaturen im Winter sinken. Infolge der milden Winter keimen die Pflanzen früher, treiben eher aus. Gefährlich ist hier vor allem der Spätfrost in der Blütezeit, der sehr große Ernte- und somit Ertragseinbußen mit sich bringt, sagt Gömann. Besonders betroffen: Obst und Gemüse, Wein und Hopfen. Neben Spätfrost richten hier Hagel und Dauerregen sowie Trockenheit die größten Schäden an. Ein entsprechendes Risikomanagement ist in vielen Betrieben bereits Standard. In Zukunft werden auch spezielle Versicherungen immer wichtiger, mit denen sich Landund Forstwirte gegen solche Extremwetterlagen absichern können. Thünen-Institut 36 B&B Agrar 4 / 2016
37 Gemüsebau boomt Der Gemüsebau in Deutschland zeigt hohe Zuwachsraten: Betrug die Anbaufläche für Freilandgemüse im Jahr 2000 noch knapp Hektar, so waren es 2015 annähernd Hektar. Die Arbeitsgruppe Gartenbauökonomik des Thünen-Instituts für Betriebswirtschaft hat den Sektor analysiert und gibt einen umfassenden Überblick über die strukturellen Entwicklungen (s. Thünen Working Paper, Band 56). 52 Prozent der Anbaufläche entfallen auf die drei Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Der Strukturwandel im Gemüsebau, der hin zu immer weniger, aber größeren Betriebseinheiten erfolgt, hat sich weiter fortgesetzt. Die Anzahl der Betriebe, die bundesweit Gemüse im Freiland anbauen, sank seit 2000 deutlich und lag 2015 bei rund Bei einem gleichzeitigen Anstieg der Gemüseanbaufläche in Deutschland wuchs die durchschnittliche Fläche pro Betrieb von 7,3 Hektar im Jahr 2000 auf 18,9 Hektar im Jahr Das in Deutschland angebaute Gemüsespektrum hat sich im Lauf der Zeit verändert. So nahm die Spargelanbaufläche weiter zu war der Spargel mit Hektar Anbaufläche die am weitesten verbreitete Gemüseart. Speisezwiebeln und Möhren werden auf jeweils circa Hektar für den Frischmarkt und als Verarbeitungsgemüse angebaut. Der Kohlanbau ist insgesamt rückläufig und wird nach wie vor von Weißkohl, Blumenkohl und Rotkohl dominiert. Der Salatanbau wurde in den vergangenen zehn Jahren um 17 Prozent ausgedehnt. Der Anbauumfang von Rucola (plus 116 Prozent) und Speisekürbis (plus 136 Prozent) nahm am stärksten zu und hat regelrecht einen Boom erlebt. Thünen-Institut Methanausstoß verringern Selbstlernender Stall Kühe mögen es gerne kühl. Je wärmer und feuchter die Umgebung, desto schneller geraten sie unter Hitzestress. Professor Thomas Amon vom ATB forscht seit 20 Jahren daran, wie man Tierwohl objektiv messen kann. Vor allem die Atemfrequenz, aber auch die Zahl der Herzschläge sind Parameter, an denen sich das Befinden der Tiere gut ablesen lässt. Aktuell entwickelt Amon noch bessere Sensoren am Foto: agrarfoto.com Rinder rülpsen Methan (CH 4 ) aus. So viel, dass sie zum Klimawandel beitragen. Ihre Fähigkeit als Wiederkäuer rohfaserreiches Futter zu verdauen, macht sie für rund 15 Prozent der weltweiten Methanemissionen verantwortlich. Das Gas wirkt in der Atmosphäre sehr viel stärker als Kohlendioxid (CO 2 ). Gesucht sind also Rinder, die wenig Methan produzieren. Bislang stellte man dafür die Kühe einzeln in eine Respirationskammer, in der die Zu- und Abluft gemessen wird. Allerdings dauert die Untersuchung zwei Tage und ist zu umständlich, um die Höhe der Methanemissionen von vielen Tieren zu bestimmen. Die einzigen vier Kammern dieser Art in Deutschland gibt es im Leibniz-Institut für Nutztierbiologie (FBN) im mecklenburgischen Dummerstorf. Dort arbeitet Dr. Cornelia Metges an einer einfacheren Methode, um Kühe mit geringem Methanausstoß zu identifizieren. Kühe leben in Symbiose mit uralten Bakterien, den Archaeen, erklärt sie. Die Archaeen helfen im Pansen bei der Verdauung. Sie sind die eigentlichen Produzenten des Methans. Im Kuhfladen lassen sich ihre Überreste messen. Wenn der Anteil der Archaeen proportional zum ausgestoßenen Methan wäre, hätte man einen einfachen Biomarker gefunden und könnte Kühe mit geringem Methanausstoß identifizieren. Ob das gelingt, weiß Cornelia Metges in einem Jahr nach Auswertung ihrer Versuche. Allerdings: Die methanfreie Kuh wird es nicht geben, sagt die Forscherin. Der Ausstoß könnte jedoch durch gezielte Fütterung sinken. Das erforschen die Wissenschaftler/-innen des FBN zusammen mit dem Leibniz- Institut für Agrartechnik in Pots dam-bornim (ATB). Die Kühe bekommen im Versuch vier unterschiedliche Diäten: mit viel Heu und Grassilage oder mit Heu und Maissilage, jeweils mit und ohne Leinsamen. Leinsamen im Futter kann durch den hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren den Methanausstoß der Tiere senken. Eine Untersuchung von Dr. Werner Berg und seinem Team vom ATB beschäftigt sich mit der Berechnung der Menge aller Klimagase, der Gesamtbilanz vom Anbau der Futterpflanzen bis zu den Emissionen aus den Exkrementen. Denn Getreide wird gedüngt, der Dünger muss produziert und ausgebracht werden, bei beiden Prozessen entstehen Klimagase. Auf dem Feld entsteht schließlich Lachgas, das noch viel klimaschädlicher ist als Methan. ATB, FBN Ein Bakterium im Kuhmagen sorgt dafür, dass Rinder als Klimakiller abgestempelt werden. Zudem leiden die Tiere selbst unter den zunehmenden Temperaturen. Für beide Probleme suchen Forscher nach Lösungen. Tier dafür. Wenn die Sensoren aus Amons Projekt einsatzbereit sind, könnten ihre Daten die Belüftung im Stall so steuern, dass die Kühe jederzeit optimale Bedingungen vorfinden. Ziel ist der selbstlernende Stall, sagt er. Um das in die Praxis umzusetzen, arbeitet das ATB eng mit den Herstellern von Stalltechnik zusammen. Auch die perfekte Stallarchitektur ist Teil des Forschungsprojekts am ATB. In den offenen Ställen, wie sie heute in der Rinderhaltung üblich sind, soll sich die Luft möglichst gut verteilen. Welche Bauweise dafür geeignet ist, erforschen die Wissenschaftler an Stallmodellen im Windkanal des ATB. Die Verteilung von künstlichem Rauch wird darin mit Laserstrahlen gemessen. So kann man sichtbar machen, wie frische Luft zu den Tieren kommt. ATB B&B Agrar 4 /
38 BÜCHER & MEDIEN Berufsschulen auf dem Abstellgleis A. Himmelrath & K. Blaß 330 anerkannte Ausbildungsberufe gibt es aktuell in Deutschland und rund Studiengänge. Reicht das duale Ausbildungssystem also nicht mehr aus, um den Bedarf der Wirtschaft an qualifizierten Fachkräften zu decken? Oder rächt sich nun, dass die Bildungspolitik sich auf die Gymnasien und die Erhöhung der Akademikerquote konzentriert und die Berufsschulen einfach vergessen hat? Die kombinierte Ausbildung im Betrieb und in Berufsschulen oder -kollegs wird von Portugal bis Lettland kopiert. Sie repräsentiert und sichert Deutschlands wirtschaftliche Stärke. Hierzulande dagegen scheint es, als habe die Ausbildung als Einstieg in die berufliche Laufbahn ihren Zenit überschritten. Das praxisorientierte Buch zeigt die Situation deutscher Berufsschulen. Die Autoren skizzieren die aktuelle Lage und sprechen mit Berufsschullehrern, Ausbildern und Auszubildenden. Sie zeigen bestehende Defizite auf, die vor allem der langen Vernachlässigung dieser Schulform geschuldet sind. Und sie berichten von Modellen und Impulsen sowie von Berufsschulen, die zum Experimentierfeld für Veränderungen der Bildungslandschaft geworden sind. 2016, 240 Seiten, 16 Euro ISBN Edition Körber-Stiftung, Hamburg Gutes Essen arme Erzeuger R. Buntzel & F. Marí Wenn wir heute im Supermarkt Kaffee, Bananen oder andere weit entfernt produzierte Lebensmittel einkaufen, möchten wir nicht nur beste Qualität bekommen, sondern auch zum Wohl von Erzeugern und Umwelt beitragen. Kommerzielle Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards geben an, dies zu garantieren. Doch Kleinerzeugern überall auf der Welt fällt es schwer, den Auflagen nachzukommen. Standards bei Lebensmitteln sind so zu einem globalen Herrschaftsinstrument entwickelter Länder geworden. Sie räumen unseren Konzernen und unserer Esskultur den Vorrang auf der Welt ein. Was gutes Essen ist, sollte aber nicht allein von den Supermärkten in Europa und den USA bestimmt werden. Private Standards müssen daher in einen staatlichen Rahmen gesetzt werden, um Missbrauch auszuschließen und gerechte internationale Agrarbeziehungen zu etablieren. Dieses Buch wird herausgegeben von Brot für die Welt Evangelischer Entwicklungsdienst, Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. 2016, 380 Seiten, 29,95 Euro ISBN oekom verlag, München Forsttechnik Bernhard Henning In diesem Buch werden alle wichtigen Forstmaschinen in ihren Funktionen und ihrer Anwendung vorgestellt. Zudem gibt es Tipps und Hinweise zur Bodenschonung während der Holzernte und zur Vermeidung von Schäden am verbleibenden Bestand. Kalkulationsmodelle für die Berechnung der betriebseigenen Kosten oder die Anschaffung von Forstmaschinen sowie Hinweise zur Auswahl eines geeigneten Lohnunternehmers runden das Buch ab. Landwirte und Kleinwaldbesitzer können so die richtige Technik und das optimale Verfahren für ihre Holzernte auswählen. 2016, 192 Seiten, 24,90 Euro ISBN Leopold Stocker Verlag, Graz Zertifizierung R. Friedel & E. A. Spindler (Hrsg.) Die Wirtschaft setzt zunehmend auf Zertifikate und auch bei den Verbrauchern dienen Normen und Nachweise zur Orientierung und zur Absicherung von Kaufentscheidungen. Doch die weltweit mittlerweile über 1,1 Millionen Zertifkate repräsentieren unterschiedliche Transparenz und genießen differenziertes Vertrauen. In diesem Buch werden Erfahrungen sowie neue Ideen vorgestellt, wie Zertifizierungssysteme ihre Rolle in Wirtschaft und Gesellschaft erhalten und weiterentwickeln können. Das Buch vermittelt Grundlagen für die Zertifizierungen von Produkten, Dienstleistungen Weltklimavertrag J. Sommer & M. Müller (Hrsg.) Im Dezember 2015 einigte sich die Weltklimakonferenz in Paris auf das erste Klimaschutzabkommen, das alle Länder in die Pflicht nimmt. Damit bekennt sich die Weltgemeinschaft völkerrechtlich verbindlich zum Ziel, die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen. Doch was ist dieses Paris-Abkommen wert? Wo liegen seine Stärken, welche Herausforderungen kommen auf die Weltgemeinschaft zu? Welche Risiken birgt es? Was muss jetzt politisch folgen? Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik, Medien und Nichtregierungsorganisationen analysieren in diesem Buch Hintergründe, Inhalte und Konsequenzen des neuen Weltklimavertrages. 2016, 320 Seiten, 19,80 Euro ISBN Hirzel Verlag, Stuttgart und Managementsystemen in den Handlungsfeldern Nachhaltigkeit, Ökologie, Klimaschutz und Lebensmittelsicherheit. 2016, 562 Seiten, 49,99 Euro ISBN Springer-Gabler Verlag, Heidelberg 38 B&B Agrar 4 / 2016
39 -Medien NEU! Nächste Ausgabe von B&B Agrar: 30. September 2016 Hülsenfrüchte Lebensmittelrecht Fahrzeuge Krankheitsrisiken In der neuen Ausgabe der Fachzeitschrift erfährt man, was es Neues über Proteine tierische und pflanzliche und über die besten pflanzlichen Proteinlieferanten, die Leguminosen, zu wissen gibt. Nicht umsonst haben die Vereinten Nationen das Jahr 2016 zum Jahr der Hülsenfrüchte erklärt. Das LeguAN-Projekt (Leguminosen Anbau und Nutzung) wird vorgestellt. Außerdem geht es zum Beispiel um regionale Lebensmittel, Nahrungsunverträglichkeiten, eine gelungene Kommunikation mithilfe der Embodied- Communication-Theorie und um australische Esskultur. Zeitschrift Ernährung im Fokus 4,50 Euro, DIN A4, 68 Seiten Erstauflage 2016 Bestell-Nr Das Heft führt systematisch durch die Strukturen des Lebensmittelrechts und erläutert die praktische Umsetzung der relevanten Vorschriften. Neben nationalen und europäischen Gesetzen beschreibt der Text die Grundprinzipien des Lebensmittelrechts, von Hygiene und Infektionsschutz und der Kennzeichnung loser und verpackter Ware. Verantwortliche erfahren, wie die Kennzeichnung von Allergenen, biologisch erzeugten Lebensmitteln und gesundheitsbezogenen Angaben erfolgen muss. Weitere Kapitel informieren über die Organisation der amtlichen Lebensmittelüberwachung und den Umgang mit Krisensituationen. aid-broschüre Wichtige Bestimmungen des Lebensmittelrechts für Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung 6,50 Euro, DIN A4, 76 Seiten 9. Auflage 2016 Bestell-Nr Landwirtschaftliche Fahrzeuge werden immer größer, schneller und schwerer. Gleichzeitig werden immer mehr landwirtschaftliche Erzeugnisse über größere Strecken auf öffentlichen Straßen transportiert. Für eine sichere Fahrt bietet die Neuauflage der Broschüre wertvolle Informationen für Fahrer und Halter. Behandelt werden rechtliche Fragen rund um die Fahrerlaubnis, die Straßenverkehrszulassungsverordnung, die Zulassungspflicht und die Vorschriften zur Beleuchtung und Kenntlichmachung. Auch das Güterkraftverkehrsgesetz wird ausführlich erläutert. Schließlich werden praktische Hinweise zu einer rücksichtsvollen Fahrweise gegeben. aid-heft Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr 5, Euro, DIN A5, 136 Seiten 23. Auflage 2016 Bestell-Nr Die Erholung in der Natur und besonders im Wald hat außerordentlich positive Wirkungen auf die Gesundheit. Man sollte aber auch auf einige wenige Krankheitsrisiken achten. Diese Risiken lassen sich aber weitgehend vermeiden, wenn man sich richtig verhält. Was man beachten sollte, ist nicht sehr kompliziert und lässt sich mit geringem Aufwand umsetzen. Das Heft beschreibt, wie man sich verhalten soll und im Falle eines Falles richtig reagiert. aid-heft Gesund durch Wald und Natur 2, Euro, DIN A5, 40 Seiten 2. Auflage 2016 Bestell-Nr Bestellung aid infodienst e. V. Vertrieb Heilsbachstr. 16, Bonn Telefon: Telefax: bestellung@aid.de Referendare aufgepasst 30 % Rabatt auf aid-medien Wenn Sie Lehrerin oder Lehrer im Vorbereitungsdienst sind, erhalten Sie aid- Medien mit 30 % Rabatt und versandkostenfrei (ausgenommen Downloads und Abonnements). SCHULSTEMPEL NICHT VERGESSEN! Foto: VRD-Fotolia.com Bestellformular für Referendare, Bestell-Nr Laden Sie sich mithilfe des QR-Codes den Referendare-Flyer (Bestell-Nr. 0415) aus dem aid- Medienshop herunter, füllen ihn entsprechend aus und senden ihn an: bestellung@aid.de oder per Fax an +49 (0)
40 Alternativ wirtschaften Solidarische Landwirtschaft als neues Konzept aid-broschüre Solidarische Landwirtschaft 5, Euro, DIN A5, 88 Seiten Erstauflage 2016 Bestell-Nr Das Konzept Die Solidarische Landwirtschaft kurz Solawi beweist, dass eine nicht-industrielle, marktunabhängige Landwirtschaft möglich ist. Ihr Ziel ist es, Lebensmittel zu erzeugen, die Mensch, Umwelt und Gesellschaft langfristig gut tun. Seit etwa 25 Jahren verbreitet sich das alternative Landwirtschaftsmodell rund um die Welt. In Deutschland haben sich seitdem mehr als hundert Solawis gegründet Tendenz steigend. Jede Solidarische Landwirtschaft funktioniert ein bisschen anders. Das Prinzip ist aber gleich: Mehrere private Haushalte tragen die gesamten Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebs von den Löhnen über das Saatgut bis zum Traktor. Im Gegenzug erhalten sie den Ernteertrag und Mitbestimmung über das, was und vor allem wie es angebaut wird. Landwirte können sich auf die Produktion konzentrieren und müssen sich nicht um Vermarktung, Verkauf und Marktpreise sorgen. Sie haben ein stabiles Einkommen, geben ihre Ernte direkt an die Haushalte ab und kennen die Menschen, für die sie die Lebensmittel erzeugen. Risiken teilen Egal ob ein gutes Jahr Gemüse im Überfluss bringt oder eine Ernte verhagelt: Landwirte und Abnehmer teilen die Risiken. Es wird auch nichts aussortiert - die Menschen bekommen die ganze Vielfalt, die auf den Feldern wächst. Die Verteilung der Ernteanteile funktioniert in den Solawis unterschiedlich. Manche haben sogenannte Depots eingerichtet, in anderen Solawis gilt Hofabholung. Auch die Ernteanteile variieren manche bauen nur Gemüse an, andere halten auch Tiere, die Milch, Eier und Fleisch liefern. Die allermeisten Solawis produzieren ihre Lebensmittel ökologisch. Foto: Yuri_Arcurs istock.com Engagement und Gemeinschaft Wie sich eine Solawi organisiert und entwickelt, hängt vom Engagement der Mitglieder ab. Meist gibt es eine Kerngruppe, die den Prozess steuert und die Kommunikation in die Hand nimmt. Bei manchen Solawis arbeiten alle Mitglieder mit auf dem Acker, bei anderen ist die Mithilfe möglich, aber keine Pflicht. Solidarische Landwirtschaft lebt von Engagement und Gemeinschaft. Die Landwirte machen transparent, wie viel Geld sie im kommenden Jahr benötigen, was mittel- und langfristig angeschafft werden muss und was im vergangenen Jahr ausgegeben wurde. Aus dem Jahresbudget errechnet sich dann der durchschnittliche Mitgliedsbeitrag. Eine Solawi gründen so geht s! Aber wie gründet man eine Solidarische Landwirtschaft? Die neue aid-broschüre zeigt die ersten Schritte, gibt Tipps für die Kommunikation nach innen und nach außen. Sie benennt auch Stolpersteine und zeigt verschiedene Modelle und Finanzierungsformen. Beispiele aus der Praxis und Portraits von etablierten Solidarischen Landwirtschaften in Deutschland zeigen, wie und vor allem dass Solidarische Landwirtschaft funktioniert. Erhältlich unter: Bestell-Nr. 1618
Vorstellung des Projektes. Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft. Nina Weiher, LfL
 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zur Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und der Verwertung von Sojabohnen in Deutschland (Laufzeit: 1.9.2013 31.12.2016)
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zur Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und der Verwertung von Sojabohnen in Deutschland (Laufzeit: 1.9.2013 31.12.2016)
Sojainformationsveranstaltung
 Sojainformationsveranstaltung 20.02.2017 Donau Soja Raiffeisen Warendorf Landwirtschaftskammer NRW 9:30 Uhr Tagesprogramm Begrüßung und Vorstellung Sojanetzwerk, Jan-Malte Wichern 10:00 Uhr Vorstellung
Sojainformationsveranstaltung 20.02.2017 Donau Soja Raiffeisen Warendorf Landwirtschaftskammer NRW 9:30 Uhr Tagesprogramm Begrüßung und Vorstellung Sojanetzwerk, Jan-Malte Wichern 10:00 Uhr Vorstellung
BMELV - Eiweißpflanzenstrategie: aktueller Stand und Perspektiven
 BMELV - Eiweißpflanzenstrategie: aktueller Stand und Perspektiven Bilder : BLE, Wilbois/Fibl BMELV BLE Dienstsitz Bonn, BPA / Stefan Müller Dienstsitz Berlin, BMELV / Ursula Böhmer BLE, Hauptsitz Bonn
BMELV - Eiweißpflanzenstrategie: aktueller Stand und Perspektiven Bilder : BLE, Wilbois/Fibl BMELV BLE Dienstsitz Bonn, BPA / Stefan Müller Dienstsitz Berlin, BMELV / Ursula Böhmer BLE, Hauptsitz Bonn
Demonstrationsnetzwerk Erbsen und Ackerbohnen in Sachsen. 1 Mai 2016 Heike Gröber
 Demonstrationsnetzwerk Erbsen und Ackerbohnen in Sachsen 1 Mai 2016 Heike Gröber Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zur Ausweitung und Verbesserung des Anbau und der Verwertung von Legumniosen mit Schwerpunkt
Demonstrationsnetzwerk Erbsen und Ackerbohnen in Sachsen 1 Mai 2016 Heike Gröber Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zur Ausweitung und Verbesserung des Anbau und der Verwertung von Legumniosen mit Schwerpunkt
Öko-Futtersoja in Bayern - vom Landwirt zum Kunden - Soja-Tagung , Freising. Maria Bär & Andreas Hopf
 Öko-Futtersoja in Bayern - vom Landwirt zum Kunden - Soja-Tagung 27.11.2015, Freising Maria Bär & Andreas Hopf Soja-Netzwerk - Projektstruktur Verbund Kooperationspartner Päd. Hochschule Freiburg Gesamtkoordination
Öko-Futtersoja in Bayern - vom Landwirt zum Kunden - Soja-Tagung 27.11.2015, Freising Maria Bär & Andreas Hopf Soja-Netzwerk - Projektstruktur Verbund Kooperationspartner Päd. Hochschule Freiburg Gesamtkoordination
Die Eiweißpflanzenstrategie des BMLEV und Stand der Entwicklung einer Modellregion zum Lupinenanbau in Mecklenburg Vorpommern
 Die Eiweißpflanzenstrategie des BMLEV und Stand der Entwicklung einer Modellregion zum Lupinenanbau in Mecklenburg Vorpommern SAATZUCHT STEINACH GmbH & Co KG, Klockower Str. 1, 17219 Bocksee, Germany Anne-Kathrin
Die Eiweißpflanzenstrategie des BMLEV und Stand der Entwicklung einer Modellregion zum Lupinenanbau in Mecklenburg Vorpommern SAATZUCHT STEINACH GmbH & Co KG, Klockower Str. 1, 17219 Bocksee, Germany Anne-Kathrin
Dr. Annett Gefrom LFA MV GFL Tagung in Bernburg LLFG ST von 31
 Gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages im Rahmen der BMEL Eiweißpflanzenstrategie (FKZ 2814EPS016) Dr. Annett Gefrom
Gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages im Rahmen der BMEL Eiweißpflanzenstrategie (FKZ 2814EPS016) Dr. Annett Gefrom
KTBL-Fachgespräch am Eiweißpflanzenstrategie des BMEL Clemens Neumann, BMEL Folie 1
 KTBL-Fachgespräch am 18.01.2014 Eiweißpflanzenstrategie des BMEL Clemens Neumann, BMEL 20.01.2014 Folie 1 Zentrale Ziele der BMEL-Eiweißpflanzenstrategie zur Versorgung mit nicht gentechnisch verändertem
KTBL-Fachgespräch am 18.01.2014 Eiweißpflanzenstrategie des BMEL Clemens Neumann, BMEL 20.01.2014 Folie 1 Zentrale Ziele der BMEL-Eiweißpflanzenstrategie zur Versorgung mit nicht gentechnisch verändertem
Berufliches Bildungssystem der Landwirtschaft. Anforderungen erfüllt?
 Berufliches Bildungssystem der Landwirtschaft Anforderungen erfüllt? Martin Lambers Deutscher Bauernverband (DBV) Berlin 1 Persönliche Vorstellung M. Lambers Deutscher Bauernverband (DBV) Referatsleiter
Berufliches Bildungssystem der Landwirtschaft Anforderungen erfüllt? Martin Lambers Deutscher Bauernverband (DBV) Berlin 1 Persönliche Vorstellung M. Lambers Deutscher Bauernverband (DBV) Referatsleiter
Vermarktung von Öko-Soja in Nord- Westdeutschland
 1 1988: Andreas und Klaus Engemann übernehmen den elterlichen Hof 1990: Gründung der A&K Engemann GbR (Handel Obst- & Gemüse) 1991: Gründung der Bioland Kyffhäuser GbR (184ha) 1994: Gründung der von Bismarck
1 1988: Andreas und Klaus Engemann übernehmen den elterlichen Hof 1990: Gründung der A&K Engemann GbR (Handel Obst- & Gemüse) 1991: Gründung der Bioland Kyffhäuser GbR (184ha) 1994: Gründung der von Bismarck
Einführung in die Veranstaltung Marktchancen heimischer Ackerbohnen, Erbsen und Co. als Futter und Lebensmittel
 Fachhochschule Südwestfalen Wir geben Impulse Einführung in die Veranstaltung Marktchancen heimischer Ackerbohnen, Erbsen und Co. als Futter und Lebensmittel Akteursworkshop 2018 Soest, 6.11.2018 Die Demonetzwerke
Fachhochschule Südwestfalen Wir geben Impulse Einführung in die Veranstaltung Marktchancen heimischer Ackerbohnen, Erbsen und Co. als Futter und Lebensmittel Akteursworkshop 2018 Soest, 6.11.2018 Die Demonetzwerke
LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 6/ Wahlperiode Anbau von einheimischen Eiweißpflanzen in Mecklenburg-Vorpommern
 LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 6/3835 6. Wahlperiode 15.04.2015 KLEINE ANFRAGE des Abgeordneten Prof. Dr. Fritz Tack, Fraktion DIE LINKE Anbau von einheimischen Eiweißpflanzen in Mecklenburg-Vorpommern
LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 6/3835 6. Wahlperiode 15.04.2015 KLEINE ANFRAGE des Abgeordneten Prof. Dr. Fritz Tack, Fraktion DIE LINKE Anbau von einheimischen Eiweißpflanzen in Mecklenburg-Vorpommern
Potenziale heimischer Körnerleguminosen für den Lebensmittelmarkt: GVO-frei, regional, vegan
 Potenziale heimischer Körnerleguminosen für den Lebensmittelmarkt: GVO-frei, regional, vegan Folie 1 Die Demonetzwerke werden gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund
Potenziale heimischer Körnerleguminosen für den Lebensmittelmarkt: GVO-frei, regional, vegan Folie 1 Die Demonetzwerke werden gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund
Aktivitäten zur Zukunftsstrategie Ökolandbau (ZöL)
 Aktivitäten zur Zukunftsstrategie Ökolandbau (ZöL) im Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) und in der Eiweißpflanzenstrategie (EPS) Präsentation zur
Aktivitäten zur Zukunftsstrategie Ökolandbau (ZöL) im Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) und in der Eiweißpflanzenstrategie (EPS) Präsentation zur
Sojaanbau in Europa versus überseeische Importe
 WING Beiträge zur Geflügelwirtschaft Heft 2 Dezember 2013 Aline Veauthier, Anna Wilke, Hans Wilhelm Windhorst Sojaanbau in Europa versus überseeische Importe Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis...1
WING Beiträge zur Geflügelwirtschaft Heft 2 Dezember 2013 Aline Veauthier, Anna Wilke, Hans Wilhelm Windhorst Sojaanbau in Europa versus überseeische Importe Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis...1
EINLADUNG. Erfolgreich mit heimischen Körnerleguminosen: Aber wie? Fachtagung Körnerleguminosen in Kooperation UFOP/Fachhochschule Südwestfalen
 UNION ZUR FÖRDERUNG VON OEL- UND PROTEINPFLANZEN E. V. EINLADUNG Fachtagung Körnerleguminosen in Kooperation UFOP/Fachhochschule Südwestfalen Erfolgreich mit heimischen Körnerleguminosen: Aber wie? 20.
UNION ZUR FÖRDERUNG VON OEL- UND PROTEINPFLANZEN E. V. EINLADUNG Fachtagung Körnerleguminosen in Kooperation UFOP/Fachhochschule Südwestfalen Erfolgreich mit heimischen Körnerleguminosen: Aber wie? 20.
vorläufiges Programm Stand
 Fachtagung Leguminosen Bausteine einer nachhaltigeren Landwirtschaft 28./29.10.2014 in Bonn - Stadthalle Bad Godesberg Nationale Fachtagung mit internationaler Beteiligung Dienstag 28.10.2014 vorläufiges
Fachtagung Leguminosen Bausteine einer nachhaltigeren Landwirtschaft 28./29.10.2014 in Bonn - Stadthalle Bad Godesberg Nationale Fachtagung mit internationaler Beteiligung Dienstag 28.10.2014 vorläufiges
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Staatsminister Helmut Brunner Bio aus Bayern - wo stehen wir im heimischen Markt und wo wollen wir hin? Erster Runder Tisch BioRegio
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Staatsminister Helmut Brunner Bio aus Bayern - wo stehen wir im heimischen Markt und wo wollen wir hin? Erster Runder Tisch BioRegio
Wirtschaftlichkeit des Sojabohnenanbaus
 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Wirtschaftlichkeit des Sojabohnenanbaus Lukas Wolf Gliederung - Der Sojaanbau in Deutschland und Bayern - Wirtschaftlichkeit des Sojabohnenanbaus - Die Sojabohne
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Wirtschaftlichkeit des Sojabohnenanbaus Lukas Wolf Gliederung - Der Sojaanbau in Deutschland und Bayern - Wirtschaftlichkeit des Sojabohnenanbaus - Die Sojabohne
Eiweiß aus heimischer Erzeugung Aktueller Stand, Chancen, Herausforderungen und Perspektiven
 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Eiweiß aus heimischer Erzeugung Aktueller Stand, Chancen, Herausforderungen und Perspektiven Robert Schätzl Ausgewählte Eiweißinitiativen in Deutschland und
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Eiweiß aus heimischer Erzeugung Aktueller Stand, Chancen, Herausforderungen und Perspektiven Robert Schätzl Ausgewählte Eiweißinitiativen in Deutschland und
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Staatsminister Helmut Brunner Sojabohnenernte im Rahmen der Eiweißstrategie 5. September 2011, Gützingen Es gilt das gesprochene
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Staatsminister Helmut Brunner Sojabohnenernte im Rahmen der Eiweißstrategie 5. September 2011, Gützingen Es gilt das gesprochene
Wirtschaftlichkeit des Sojabohnenanbaus in Deutschland
 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Wirtschaftlichkeit des Sojabohnenanbaus in Deutschland Lukas Wolf Gliederung Datengrundlage Wirtschaftlichkeit des Sojabohnenanbaus Die Sojabohne im Vergleich
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Wirtschaftlichkeit des Sojabohnenanbaus in Deutschland Lukas Wolf Gliederung Datengrundlage Wirtschaftlichkeit des Sojabohnenanbaus Die Sojabohne im Vergleich
Bioland-Bayern Wintertagung 2016 _ Kloster Plankstetten _ _ Klaus Engemann. 1988: Andreas und Klaus Engemann übernehmen den elterlichen Hof
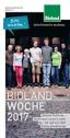 von in der Region 1 von in der Region 1988: Andreas und Klaus Engemann übernehmen den elterlichen Hof 1990: Gründung der A&K Engemann GbR (Handel Obst- & Gemüse) 1991: Gründung der Bioland Kyffhäuser GbR
von in der Region 1 von in der Region 1988: Andreas und Klaus Engemann übernehmen den elterlichen Hof 1990: Gründung der A&K Engemann GbR (Handel Obst- & Gemüse) 1991: Gründung der Bioland Kyffhäuser GbR
Rahmenempfehlungen zur Gestaltung von Qualifizierungsangeboten für den Lernort Bauernhof
 Rahmenempfehlungen zur Gestaltung von Qualifizierungsangeboten für den Lernort Bauernhof DER BAUERNHOF ALS ORT ZUM LERNEN Landwirtinnen und Landwirte produzieren unsere Lebensmittel, sie arbeiten mit Pflanzen
Rahmenempfehlungen zur Gestaltung von Qualifizierungsangeboten für den Lernort Bauernhof DER BAUERNHOF ALS ORT ZUM LERNEN Landwirtinnen und Landwirte produzieren unsere Lebensmittel, sie arbeiten mit Pflanzen
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
 1 Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor wir uns mit Dank und guten Wünschen von Ihnen verabschieden, möchte ich an dieser Stelle ein Resümee zur heutigen Veranstaltung geben und die wesentlichen
1 Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor wir uns mit Dank und guten Wünschen von Ihnen verabschieden, möchte ich an dieser Stelle ein Resümee zur heutigen Veranstaltung geben und die wesentlichen
Staatlich anerkannte Öko-Modellregionen in Bayern eine Zwischenbilanz
 Bavarian State Research Center for Agriculture Staatlich anerkannte Öko-Modellregionen in Bayern eine Zwischenbilanz Erste Allrussische Ökolandbautagung»Ökologische Landwirtschaft in der Russischen Föderation
Bavarian State Research Center for Agriculture Staatlich anerkannte Öko-Modellregionen in Bayern eine Zwischenbilanz Erste Allrussische Ökolandbautagung»Ökologische Landwirtschaft in der Russischen Föderation
Vermarktung ökologischer Körnerleguminosen
 1 1988: Andreas und Klaus Engemann übernehmen den elterlichen Hof Beitritt in den Bioland-Verband 1990: Gründung der A&K Engemann GbR (Handel Obst- & Gemüse) 1991: Gründung der Bioland Kyffhäuser GbR (184ha)
1 1988: Andreas und Klaus Engemann übernehmen den elterlichen Hof Beitritt in den Bioland-Verband 1990: Gründung der A&K Engemann GbR (Handel Obst- & Gemüse) 1991: Gründung der Bioland Kyffhäuser GbR (184ha)
Bedeutung des heimischen Sojas für die Eiweißversorgung in Deutschland
 Standbild Bedeutung des heimischen Sojas für die Eiweißversorgung in Deutschland 1. Tag des deutschen Sojas 5. / 6. August 2010 in Dasing bei Augsburg Referenten-Folie Dr. Bernd Christiansen Regierungsdirektor
Standbild Bedeutung des heimischen Sojas für die Eiweißversorgung in Deutschland 1. Tag des deutschen Sojas 5. / 6. August 2010 in Dasing bei Augsburg Referenten-Folie Dr. Bernd Christiansen Regierungsdirektor
Das Testbetriebsnetz landwirtschaftlicher Betriebe
 Das Testbetriebsnetz landwirtschaftlicher Betriebe Was ist das Testbetriebsnetz? Am Testbetriebsnetz sind mehr als 10.000 landwirtschaftliche Betriebe beteiligt. Es wird vom Bundesministerium für Ernährung
Das Testbetriebsnetz landwirtschaftlicher Betriebe Was ist das Testbetriebsnetz? Am Testbetriebsnetz sind mehr als 10.000 landwirtschaftliche Betriebe beteiligt. Es wird vom Bundesministerium für Ernährung
Ackerbohne, Erbse & Co.
 Ackerbohne, Erbse & Co. Die Eiweißpflanzenstrategie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zur Förderung des Leguminosenanbaus in Deutschland 2 Grußwort Grußwort Liebe Leserinnen und Leser,
Ackerbohne, Erbse & Co. Die Eiweißpflanzenstrategie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zur Förderung des Leguminosenanbaus in Deutschland 2 Grußwort Grußwort Liebe Leserinnen und Leser,
Übersicht über die nationalen Strukturen auf dem Gebiet der Lückenindikationen
 . Nationale Lückenstrukturen Übersicht über die nationalen Strukturen auf dem Gebiet der Lückenindikationen Arbeitsgruppe Lückenindikationen (AG LÜCK) am BMEL Die Arbeitsgruppe Lückenindikationen am BMEL
. Nationale Lückenstrukturen Übersicht über die nationalen Strukturen auf dem Gebiet der Lückenindikationen Arbeitsgruppe Lückenindikationen (AG LÜCK) am BMEL Die Arbeitsgruppe Lückenindikationen am BMEL
Wettbewerbsfähigkeit der Sojabohne in der Praxis
 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Wettbewerbsfähigkeit der Sojabohne in der Praxis Lukas Wolf Teilnehmende Betriebe nach Region, Bundesland und Bewirtschaftungsform Auswertungen für: - Deutschland
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Wettbewerbsfähigkeit der Sojabohne in der Praxis Lukas Wolf Teilnehmende Betriebe nach Region, Bundesland und Bewirtschaftungsform Auswertungen für: - Deutschland
Die Situation des Eiweißpflanzenanbaus in Baden-Württemberg
 Die Situation des Eiweißpflanzenanbaus in Baden-Württemberg Jürgen Recknagel LTZ Augustenberg, Ast. Müllheim; Dt. Sojaförderring Teller und Trog Die Zukunft des Eiweißpflanzenanbaus in Baden-Württemberg,
Die Situation des Eiweißpflanzenanbaus in Baden-Württemberg Jürgen Recknagel LTZ Augustenberg, Ast. Müllheim; Dt. Sojaförderring Teller und Trog Die Zukunft des Eiweißpflanzenanbaus in Baden-Württemberg,
Soziale Dorfentwicklung
 Soziale Dorfentwicklung Modellprojekte im Bundesprogramm Ländliche Entwicklung Ländliche Räume machen knapp 90 Prozent der Fläche Deutschlands aus. Jeder Zweite lebt auf dem Land. Mit dem Bundesprogramm
Soziale Dorfentwicklung Modellprojekte im Bundesprogramm Ländliche Entwicklung Ländliche Räume machen knapp 90 Prozent der Fläche Deutschlands aus. Jeder Zweite lebt auf dem Land. Mit dem Bundesprogramm
KAUSA Servicestelle Mecklenburg-Vorpommern
 KAUSA Servicestelle Mecklenburg-Vorpommern Vernetzen, Verstärken, Verankern Projektträger: ÜAZ, Waren (Müritz) MSE, HRO, LRO BIG, Greifswald-VP-Rügen, VP-Greifswald KHS, Schwerin-Schwerin, LuLu-Parchim
KAUSA Servicestelle Mecklenburg-Vorpommern Vernetzen, Verstärken, Verankern Projektträger: ÜAZ, Waren (Müritz) MSE, HRO, LRO BIG, Greifswald-VP-Rügen, VP-Greifswald KHS, Schwerin-Schwerin, LuLu-Parchim
Stand der Entwicklung einer Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau in Deutschland
 Stand der Entwicklung einer Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau in Deutschland Jürn Thünen-Institut für Betriebswirtschaft 7. Jahrestagung zum ökologischen Landbau, Bernburg Seite 1 Regionale und nationale
Stand der Entwicklung einer Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau in Deutschland Jürn Thünen-Institut für Betriebswirtschaft 7. Jahrestagung zum ökologischen Landbau, Bernburg Seite 1 Regionale und nationale
Verwertung und Wirtschaftlichkeit von Körnerleguminosen
 Verwertung und Wirtschaftlichkeit von Körnerleguminosen Florian Jung LTZ Augustenberg, Außenstelle Forchheim Eiweißinitiative Baden-Württemberg Riedlingen, den 28.06.2016 Übersicht 1. Anbausituation 2.
Verwertung und Wirtschaftlichkeit von Körnerleguminosen Florian Jung LTZ Augustenberg, Außenstelle Forchheim Eiweißinitiative Baden-Württemberg Riedlingen, den 28.06.2016 Übersicht 1. Anbausituation 2.
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Staatsminister Helmut Brunner Woche der Aus- und Weiterbildung 19. Februar 2016, Passau Es gilt das gesprochene Wort! Referat Presse
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Staatsminister Helmut Brunner Woche der Aus- und Weiterbildung 19. Februar 2016, Passau Es gilt das gesprochene Wort! Referat Presse
Ukraine: Ökolandbau. Bilaterales Kooperationsprojekt
 Ukraine: Ökolandbau Bilaterales Kooperationsprojekt Das Projekt Der Ökolandbau in der Ukraine verfügt aufgrund günstiger klimatischer Bedingungen und fruchtbarer Böden über gute Entwicklungspotenziale.
Ukraine: Ökolandbau Bilaterales Kooperationsprojekt Das Projekt Der Ökolandbau in der Ukraine verfügt aufgrund günstiger klimatischer Bedingungen und fruchtbarer Böden über gute Entwicklungspotenziale.
Mit Aus- und Weiterbildung gegen den Fachkräftemangel
 Mit Aus- und Weiterbildung gegen den Fachkräftemangel Auswertung der Sonderfragen der IHK-Konjunkturumfrage für das 3. Quartal 2014 Die Auswertung Mit Aus- und Weiterbildung gegen den Fachkräftemangel
Mit Aus- und Weiterbildung gegen den Fachkräftemangel Auswertung der Sonderfragen der IHK-Konjunkturumfrage für das 3. Quartal 2014 Die Auswertung Mit Aus- und Weiterbildung gegen den Fachkräftemangel
Zertifizierte/r Ausbildungsexperte/in (IHK)
 Zertifizierte/r Ausbildungsexperte/in (IHK) Im Ausbildungsmanagement, Training und Coaching Eine Initiative des In Zusammenarbeit mit der BBC Präsentation - Kontakt: Claudia Kelm - Katja Arncken Warum
Zertifizierte/r Ausbildungsexperte/in (IHK) Im Ausbildungsmanagement, Training und Coaching Eine Initiative des In Zusammenarbeit mit der BBC Präsentation - Kontakt: Claudia Kelm - Katja Arncken Warum
Weltagrarhandel am Beispiel Soja
 Weltagrarhandel am Beispiel Soja AK 1 des 16. Landesschulgeographentag 2014, Universität Vechta Dr. Aline Veauthier (WING, Universität Vechta) 1 Gliederung Strukturen des Anbaus und Handels Ausweitung
Weltagrarhandel am Beispiel Soja AK 1 des 16. Landesschulgeographentag 2014, Universität Vechta Dr. Aline Veauthier (WING, Universität Vechta) 1 Gliederung Strukturen des Anbaus und Handels Ausweitung
Fachkräftesicherung in Mitteldeutschland Handlungsansätze für die
 Fachkräftesicherung in Mitteldeutschland Handlungsansätze für die Zukunft der Berufsbildung Fachkräftesicherung in Mitteldeutschland Handlungsansätze für die Zukunft der Berufsbildung Markt der Innovationen:
Fachkräftesicherung in Mitteldeutschland Handlungsansätze für die Zukunft der Berufsbildung Fachkräftesicherung in Mitteldeutschland Handlungsansätze für die Zukunft der Berufsbildung Markt der Innovationen:
Ökologischer Landbau Förderinstrumente des Bundes
 Ökologischer Landbau Förderinstrumente des Bundes Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung; Dorothée Hahn ÖKO-KONGRESS Öko (Land) Wirtschaft innovativ, verbrauchernah und nachhaltig 8. September
Ökologischer Landbau Förderinstrumente des Bundes Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung; Dorothée Hahn ÖKO-KONGRESS Öko (Land) Wirtschaft innovativ, verbrauchernah und nachhaltig 8. September
Bauernhof als Klassenzimmer. Zielsetzung und Konzeption der Initiative. Daniela Born-Schulze. als Sprecherin der AG Bauernhof als Klassenzimmer
 Bauernhof als Klassenzimmer Zielsetzung und Konzeption der Initiative Daniela Born-Schulze als Sprecherin der AG Bauernhof als Klassenzimmer BAGLoB-Tagung am 7. März 2015 Bauernhof als Klassenzimmer eine
Bauernhof als Klassenzimmer Zielsetzung und Konzeption der Initiative Daniela Born-Schulze als Sprecherin der AG Bauernhof als Klassenzimmer BAGLoB-Tagung am 7. März 2015 Bauernhof als Klassenzimmer eine
 Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zur Laufzeit: Ausweitung 2016-2018 und Verbesserung des Anbaus und der Verwertung von Leguminosen mit Web: Schwerpunkt www.demoneterbo.agrarpraxisforschung.de/ Erbsen
Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zur Laufzeit: Ausweitung 2016-2018 und Verbesserung des Anbaus und der Verwertung von Leguminosen mit Web: Schwerpunkt www.demoneterbo.agrarpraxisforschung.de/ Erbsen
Sojabohnen aus der Region für Futtermittelerzeugung
 Sojabohnen aus der Region für Futtermittelerzeugung RKW Kehl GmbH Vorstellung Tochterunternehmen der ZG Raiffeisen eg Karlsruhe, 3.700 Mitglieder (davon die Mehrzahl Landwirte) Herstellung konventionelle
Sojabohnen aus der Region für Futtermittelerzeugung RKW Kehl GmbH Vorstellung Tochterunternehmen der ZG Raiffeisen eg Karlsruhe, 3.700 Mitglieder (davon die Mehrzahl Landwirte) Herstellung konventionelle
16:00 17:00 Uhr Besichtigung Soja-Sortenversuch Dornburg Sabine Wölfel, Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL)
 Soja-Exkursion nach Mitteldeutschland (Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt) 30. August bis 01. September 2016 Veranstaltung im Rahmen des Soja-Netzwerks Programm 30. August 2016 10:30 15:00 Uhr Überregionaler
Soja-Exkursion nach Mitteldeutschland (Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt) 30. August bis 01. September 2016 Veranstaltung im Rahmen des Soja-Netzwerks Programm 30. August 2016 10:30 15:00 Uhr Überregionaler
Die Bildungsinitiative Haus der kleinen Forscher Zahlen und Fakten (Stand: 30. Juni 2017)
 Die Bildungsinitiative Haus der kleinen Forscher Zahlen und Fakten (Stand: 30. Juni 2017) Die gemeinnützige Stiftung Haus der kleinen Forscher engagiert sich für gute frühe Bildung in den Bereichen Mathematik,
Die Bildungsinitiative Haus der kleinen Forscher Zahlen und Fakten (Stand: 30. Juni 2017) Die gemeinnützige Stiftung Haus der kleinen Forscher engagiert sich für gute frühe Bildung in den Bereichen Mathematik,
Berufsorientierung für Flüchtlinge. Praxisnah in eine Ausbildung im Handwerk
 Berufsorientierung für Flüchtlinge Praxisnah in eine Ausbildung im Handwerk Berufsorientierung eröffnet Geflüchteten Wege in eine Berufsausbildung Mit der Berufsorientierung für Flüchtlinge BOF des Bundesministeriums
Berufsorientierung für Flüchtlinge Praxisnah in eine Ausbildung im Handwerk Berufsorientierung eröffnet Geflüchteten Wege in eine Berufsausbildung Mit der Berufsorientierung für Flüchtlinge BOF des Bundesministeriums
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen,
 1 Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, zunächst muss ich den Kolleginnen und Kollegen der FDP ein Lob für Ihren Antrag aussprechen. Die Zielrichtung des Antrages
1 Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, zunächst muss ich den Kolleginnen und Kollegen der FDP ein Lob für Ihren Antrag aussprechen. Die Zielrichtung des Antrages
Anforderungen des Bio-Marktes Seitens der Verarbeiter und des Handels
 Anforderungen des Bio-Marktes Seitens der Verarbeiter und des Handels Referent: Franz Westhues 1 Biolebensmittel sind gefragt! Angebot im LEH und bei den Discountern ab Hof begrenzter Absatz Bio-Märkte
Anforderungen des Bio-Marktes Seitens der Verarbeiter und des Handels Referent: Franz Westhues 1 Biolebensmittel sind gefragt! Angebot im LEH und bei den Discountern ab Hof begrenzter Absatz Bio-Märkte
PRESSE- MITTEILUNG WORLDSKILLS LEIPZIG 2013 NEUES JAHR BRINGT BERUFE-WM NACH DEUTSCHLAND
 PRESSE- MITTEILUNG WORLDSKILLS LEIPZIG 2013 NEUES JAHR BRINGT BERUFE-WM NACH DEUTSCHLAND Leipzig, 26.12.2012: Das neue Jahr bringt die Weltmeisterschaft der Berufe nach Deutschland. Vom 2.-7. Juli ermitteln
PRESSE- MITTEILUNG WORLDSKILLS LEIPZIG 2013 NEUES JAHR BRINGT BERUFE-WM NACH DEUTSCHLAND Leipzig, 26.12.2012: Das neue Jahr bringt die Weltmeisterschaft der Berufe nach Deutschland. Vom 2.-7. Juli ermitteln
Versuche des LfULG zum Sojaanbau im Rahmen des Soja-Netzwerkes Januar 2015 Anja Schmidt, Ulf Jäckel
 Versuche des LfULG zum Sojaanbau im Rahmen des Soja-Netzwerkes 2014 20. Januar 2015 Anja Schmidt, Ulf Jäckel 2 Ulf Jäckel, Ref. 72 Anbau von Ackerbohnen, Futtererbsen und Süßlupinen in Deutschland (in
Versuche des LfULG zum Sojaanbau im Rahmen des Soja-Netzwerkes 2014 20. Januar 2015 Anja Schmidt, Ulf Jäckel 2 Ulf Jäckel, Ref. 72 Anbau von Ackerbohnen, Futtererbsen und Süßlupinen in Deutschland (in
» FACHLICHE KOMPETENZ FÜR EINE NACHHALTIGE AUSRICHTUNG
 » FACHLICHE KOMPETENZ FÜR EINE NACHHALTIGE AUSRICHTUNG «Unsere Ausbildungen für einen gesünderen Betrieb. Die Krankenkasse der neuen Generation DER GESUNDHEITSLOTSE DER GESUNDHEITSLOTSE Mit der Ausbildung
» FACHLICHE KOMPETENZ FÜR EINE NACHHALTIGE AUSRICHTUNG «Unsere Ausbildungen für einen gesünderen Betrieb. Die Krankenkasse der neuen Generation DER GESUNDHEITSLOTSE DER GESUNDHEITSLOTSE Mit der Ausbildung
Eine starke Branche. Eine starke Gemeinschaft. Ein starker Verband.
 Eine starke Branche. Eine starke Gemeinschaft. Ein starker Verband. Kompetenz aus einer Hand Die Gießerei-Industrie ist mit 600 Unternehmen und ca. 80.000 Beschäftigten eine der wichtigsten Zulieferbranchen
Eine starke Branche. Eine starke Gemeinschaft. Ein starker Verband. Kompetenz aus einer Hand Die Gießerei-Industrie ist mit 600 Unternehmen und ca. 80.000 Beschäftigten eine der wichtigsten Zulieferbranchen
Ackerbaustrategie des BMEL Stand der Erarbeitung. Stefan Hüsch, Referat 711: Pflanzenbau, Grünland
 Stand der Erarbeitung Stefan Hüsch, Referat 711: Pflanzenbau, Grünland Hintergrund Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD wurde die Erstellung einer Ackerbaustrategie beschlossen Die Umsetzung der Ackerbaustrategie
Stand der Erarbeitung Stefan Hüsch, Referat 711: Pflanzenbau, Grünland Hintergrund Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD wurde die Erstellung einer Ackerbaustrategie beschlossen Die Umsetzung der Ackerbaustrategie
Warenstrom von Ackerbohnen, Erbsen sowie Gemenge und Soja für die ökologische Fütterung
 und Soja für die ökologische Fütterung für NRW _ 5. Leguminosentag Haus Düsse _ 18.11.2015 _ Alexander Krahn 1 und Soja für die ökologische Fütterung 1988: Andreas und Klaus Engemann übernehmen den elterlichen
und Soja für die ökologische Fütterung für NRW _ 5. Leguminosentag Haus Düsse _ 18.11.2015 _ Alexander Krahn 1 und Soja für die ökologische Fütterung 1988: Andreas und Klaus Engemann übernehmen den elterlichen
Bessere Bildung trotz Haushaltskonsolidierung Die Chancen des demografischen Wandels nutzen
 Pressekonferenz, 19. August 2010 Bildungsmonitor 2010 Bessere Bildung trotz Haushaltskonsolidierung Die Chancen des demografischen Wandels nutzen Statement Hubertus Pellengahr Geschäftsführer Initiative
Pressekonferenz, 19. August 2010 Bildungsmonitor 2010 Bessere Bildung trotz Haushaltskonsolidierung Die Chancen des demografischen Wandels nutzen Statement Hubertus Pellengahr Geschäftsführer Initiative
Herausforderungen und Chancen des Sojaanbaus
 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Herausforderungen und Chancen des Sojaanbaus Robert Schätzl Anbaufläche Sojabohnen (ha) Sojabohnen Entwicklung der Anbaufläche und Anteil an der Ackerfläche
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Herausforderungen und Chancen des Sojaanbaus Robert Schätzl Anbaufläche Sojabohnen (ha) Sojabohnen Entwicklung der Anbaufläche und Anteil an der Ackerfläche
gute Qualität ist fur uns ährensache Die Natur liegt uns am Herzen.
 gute Qualität ist fur uns ährensache Die Natur liegt uns am Herzen. Inzwischen schon ein alter hase. Seit 1991 sorgen wir für beste BIO-Qualität. Biopark ist ein 1991 von engagierten Landwirten und Wissenschaftlern
gute Qualität ist fur uns ährensache Die Natur liegt uns am Herzen. Inzwischen schon ein alter hase. Seit 1991 sorgen wir für beste BIO-Qualität. Biopark ist ein 1991 von engagierten Landwirten und Wissenschaftlern
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Staatsminister Helmut Brunner Eröffnung 2. Internationaler Donau-Soja Kongress 25. November 2013, Augsburg Es gilt das gesprochene
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Staatsminister Helmut Brunner Eröffnung 2. Internationaler Donau-Soja Kongress 25. November 2013, Augsburg Es gilt das gesprochene
Mitmachen beim bundesweiten Aktionstag!
 Mitmachen beim bundesweiten Aktionstag! Ich mache mit, weil ich zeigen möchte, dass bäuerliche Landwirtschaft mit regionalen Strukturen das Klima und die Umwelt schützt, zur Artenvielfalt beiträgt und
Mitmachen beim bundesweiten Aktionstag! Ich mache mit, weil ich zeigen möchte, dass bäuerliche Landwirtschaft mit regionalen Strukturen das Klima und die Umwelt schützt, zur Artenvielfalt beiträgt und
Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Georg Nelius MdL Agrarpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. März 2019
 Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft Georg Nelius MdL Agrarpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion März 2019 1. Definition Nachhaltigkeit soll eine Entwicklung sein, die die Bedürfnisse der Gegenwart
Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft Georg Nelius MdL Agrarpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion März 2019 1. Definition Nachhaltigkeit soll eine Entwicklung sein, die die Bedürfnisse der Gegenwart
Rückmeldungen aus den Regionalen Foren und dem Nationalen Forum - ein erster Bericht - Karlsruhe,
 Rückmeldungen aus den Regionalen Foren und dem Nationalen Forum - ein erster Bericht - Karlsruhe, 17.09.2008 1. Nationales Forum zur biologischen Vielfalt, Fachkongress am 6. Dez. 2007 Expertengespräche
Rückmeldungen aus den Regionalen Foren und dem Nationalen Forum - ein erster Bericht - Karlsruhe, 17.09.2008 1. Nationales Forum zur biologischen Vielfalt, Fachkongress am 6. Dez. 2007 Expertengespräche
Rede. Klaus Kaiser. Parlamentarischer Staatssekretär für Kultur und Wissenschaft des Landes. Nordrhein-Westfalen. anlässlich der
 Rede Klaus Kaiser Parlamentarischer Staatssekretär für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen anlässlich der 2. Jahrestagung Verbundstudium "Das Verbundstudium vom Projekt zum zukunftsweisenden
Rede Klaus Kaiser Parlamentarischer Staatssekretär für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen anlässlich der 2. Jahrestagung Verbundstudium "Das Verbundstudium vom Projekt zum zukunftsweisenden
Ein Netzwerk von Leitbetrieben für Schleswig-Holstein
 Landesvereinigung Ökologischer Landbau Schleswig-Holstein und Hamburg Grüner Kamp 15-17, 24768 Rendsburg, Tel.: 04331-94 38 170, Fax: 04331-94 38 177 und Ein Netzwerk von Leitbetrieben für Schleswig-Holstein
Landesvereinigung Ökologischer Landbau Schleswig-Holstein und Hamburg Grüner Kamp 15-17, 24768 Rendsburg, Tel.: 04331-94 38 170, Fax: 04331-94 38 177 und Ein Netzwerk von Leitbetrieben für Schleswig-Holstein
Erfolgreicher Körnerleguminosenanbau. H. Schmidt
 Erfolgreicher Körnerleguminosenanbau Ergebnisse aus den Projekten: Steigerung der Wertschöpfung ökologisch angebauter Marktfrüchte durch Optimierung des Managements der Bodenfruchtbarkeit - Teilprojekt
Erfolgreicher Körnerleguminosenanbau Ergebnisse aus den Projekten: Steigerung der Wertschöpfung ökologisch angebauter Marktfrüchte durch Optimierung des Managements der Bodenfruchtbarkeit - Teilprojekt
Modellversuch Nutzung und Weiterentwicklung von Förderinstrumenten und Ausbildungspraxis in KMU im Altenburger Land
 Modellversuch Nutzung und Weiterentwicklung von Förderinstrumenten und Ausbildungspraxis in KMU im Altenburger Land Instrument: Qualifizierungsbaustein 2 Erfolgreich lernen im Betrieb 1 Vorbemerkungen
Modellversuch Nutzung und Weiterentwicklung von Förderinstrumenten und Ausbildungspraxis in KMU im Altenburger Land Instrument: Qualifizierungsbaustein 2 Erfolgreich lernen im Betrieb 1 Vorbemerkungen
Unterabteilungsleiterin im Bundesministerin für Bildung und Forschung, Susanne Burger, anlässlich der Internationalen Fachtagung:
 1 Grußwort der Unterabteilungsleiterin im Bundesministerin für Bildung und Forschung, Susanne Burger, anlässlich der Internationalen Fachtagung: Work-based Learning - Renewing Traditions im Bundesinstitut
1 Grußwort der Unterabteilungsleiterin im Bundesministerin für Bildung und Forschung, Susanne Burger, anlässlich der Internationalen Fachtagung: Work-based Learning - Renewing Traditions im Bundesinstitut
One-Stop-Shop für Unternehmen, Verbände und Kammern
 One-Stop-Shop für Unternehmen, Verbände und Kammern Beratung Intl. Netzwerk Öffentlichkeitsarbeit Beratung von Unternehmen und Verbänden zur Kooperation mit deutscher EZ (KFW/DEG, GIZ, sequa) Branchenunabhängig
One-Stop-Shop für Unternehmen, Verbände und Kammern Beratung Intl. Netzwerk Öffentlichkeitsarbeit Beratung von Unternehmen und Verbänden zur Kooperation mit deutscher EZ (KFW/DEG, GIZ, sequa) Branchenunabhängig
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Staatsminister Helmut Brunner Preisverleihung Bäuerin als Unternehmerin des Jahres 2016 26. September 2016, München Es gilt das gesprochene
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Staatsminister Helmut Brunner Preisverleihung Bäuerin als Unternehmerin des Jahres 2016 26. September 2016, München Es gilt das gesprochene
Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung
 Evaluation Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung - Kurzfassung der Ergebnisse - 1. Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung : ein Programm für alle Regionen in Deutschland Der Ansatz von Kultur macht
Evaluation Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung - Kurzfassung der Ergebnisse - 1. Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung : ein Programm für alle Regionen in Deutschland Der Ansatz von Kultur macht
Gesundheit. Grundsätze der. im Ökologischen Landbau aus Sicht der Praxis
 Grundsätze der Gesundheit im Ökologischen Landbau aus Sicht der Praxis 10 Kernaussagen von Bäuerinnen und Bauern zur Verbesserung der Gesundheit in ökologischen Anbausystemen Aussage 1 Bodengesundheit
Grundsätze der Gesundheit im Ökologischen Landbau aus Sicht der Praxis 10 Kernaussagen von Bäuerinnen und Bauern zur Verbesserung der Gesundheit in ökologischen Anbausystemen Aussage 1 Bodengesundheit
Bundesprogramm Ländliche Entwicklung
 Bundesprogramm Ländliche Entwicklung bmel.de Liebe Bürgerinnen und Bürger, der ländliche Raum ist das starke Rückgrat unseres Landes. Um die Lebensqualität in ländlichen Regionen attraktiv zu halten und
Bundesprogramm Ländliche Entwicklung bmel.de Liebe Bürgerinnen und Bürger, der ländliche Raum ist das starke Rückgrat unseres Landes. Um die Lebensqualität in ländlichen Regionen attraktiv zu halten und
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Staatsminister Helmut Brunner Besuch der Kopfstelle der Landesanstalt für Landwirtschaft 12. Januar 2018, Ruhstorf an der Rott Es
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Staatsminister Helmut Brunner Besuch der Kopfstelle der Landesanstalt für Landwirtschaft 12. Januar 2018, Ruhstorf an der Rott Es
Politische Rahmenbedingungen für Körnerleguminosen in der EU und mögliche Szenarien für die Zukunft
 Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. Politische Rahmenbedingungen für Körnerleguminosen in der EU und mögliche Szenarien für die Zukunft Dr. Manuela Specht Union zur Förderung von Oel-
Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. Politische Rahmenbedingungen für Körnerleguminosen in der EU und mögliche Szenarien für die Zukunft Dr. Manuela Specht Union zur Förderung von Oel-
Technik für die Umwelt
 Technik für die Umwelt Rhizobien Optimierung der Stickstoffverwertung im Pflanzenanbau Andreas Kammerer Fritzmeier Umwelttechnik Rhizobien aus dem Hause Fritzmeier 2 Was sind Rhizobien? Rhizobien oder
Technik für die Umwelt Rhizobien Optimierung der Stickstoffverwertung im Pflanzenanbau Andreas Kammerer Fritzmeier Umwelttechnik Rhizobien aus dem Hause Fritzmeier 2 Was sind Rhizobien? Rhizobien oder
Ackerbauliche Erkenntnisse zum Sojaanbau auf 41 Praxisbetrieben in Deutschland Harald Schmidt & Lucas Langanky
 Ackerbauliche Erkenntnisse zum Sojaanbau auf 41 Praxisbetrieben in Deutschland Harald Schmidt & Lucas Langanky Bericht aus dem Projekt: Erweiterung und ackerbauliche Auswertung der Praxiserhebungen und
Ackerbauliche Erkenntnisse zum Sojaanbau auf 41 Praxisbetrieben in Deutschland Harald Schmidt & Lucas Langanky Bericht aus dem Projekt: Erweiterung und ackerbauliche Auswertung der Praxiserhebungen und
Produktion und Praxis
 Fachtagung am 2. und 3. November 2009 im Haus der Wirtschaft, IHK zu Kiel Forum 2 Produktion und Praxis Produktives Lernen im Rahmen der flexiblen Ausgangsphase in Mecklenburg-Vorpommern Ziele und Maßnahmen
Fachtagung am 2. und 3. November 2009 im Haus der Wirtschaft, IHK zu Kiel Forum 2 Produktion und Praxis Produktives Lernen im Rahmen der flexiblen Ausgangsphase in Mecklenburg-Vorpommern Ziele und Maßnahmen
Forum 1 Tag der Regionen in Baden-Württemberg. Imke Heyen, Fichtenberg,
 Forum 1 Tag der Regionen in Baden-Württemberg Imke Heyen, Fichtenberg, 06.10.2017 Ablauf Tag der Regionen als Instrument der Regionalentwicklung Erfolgreiche Umsetzung des Tag der Regionen auf Landesebene
Forum 1 Tag der Regionen in Baden-Württemberg Imke Heyen, Fichtenberg, 06.10.2017 Ablauf Tag der Regionen als Instrument der Regionalentwicklung Erfolgreiche Umsetzung des Tag der Regionen auf Landesebene
Psychische Belastung. HR- und Gesundheitsmanagement. Kompetenz. Work-Life-Balance Industrie 4.0
 Netzwerke Motivation Gesundheit Psychische Belastung Digitalisierte Arbeitswelt HR- und Gesundheitsmanagement Kompetenz Work-Life-Balance Industrie 4.0 Führung Demografischer Wandel Maßnahmen und Empfehlungen
Netzwerke Motivation Gesundheit Psychische Belastung Digitalisierte Arbeitswelt HR- und Gesundheitsmanagement Kompetenz Work-Life-Balance Industrie 4.0 Führung Demografischer Wandel Maßnahmen und Empfehlungen
Allianz Landesbeiräte Holz: tatkräftige Initiative auf allen Ebenen
 Allianz Landesbeiräte Holz: tatkräftige Initiative auf allen Ebenen Allianz Landesbeiräte Holz: Kräfte bündeln und stärken Die Allianz Landesbeiräte Holz wurde im Sommer 2010 gegründet und ist die Dachorganisation
Allianz Landesbeiräte Holz: tatkräftige Initiative auf allen Ebenen Allianz Landesbeiräte Holz: Kräfte bündeln und stärken Die Allianz Landesbeiräte Holz wurde im Sommer 2010 gegründet und ist die Dachorganisation
Bundesland Berufsbereiche Anschrift. Fachkraft Agrarservice Forstwirt/-in Gärtner/-in Landwirt/-in Revierjäger/-in Winzer/-in
 Informationen zur Berufsbildung im Agrarbereich Zuständige Stellen in den Bundesländern (Berufliche Erstausbildung, praktische Fortbildung, Ausbildung behinderter Menschen) Bundesland Berufsbereiche Anschrift
Informationen zur Berufsbildung im Agrarbereich Zuständige Stellen in den Bundesländern (Berufliche Erstausbildung, praktische Fortbildung, Ausbildung behinderter Menschen) Bundesland Berufsbereiche Anschrift
Das Handwerk als Integrationsexperte
 Sperrfrist: Mittwoch, 12.01.2011 Das Handwerk als Integrationsexperte Am 18. Januar 2011 lädt der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) zum Integrationsforum ins Haus des deutschen Handwerks in
Sperrfrist: Mittwoch, 12.01.2011 Das Handwerk als Integrationsexperte Am 18. Januar 2011 lädt der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) zum Integrationsforum ins Haus des deutschen Handwerks in
Das Projekt AniA im Ausbildungsstrukturprogramm JOBSTARTER für die Zukunft ausbilden
 Fachtagung Arbeitgeberzusammenschlüsse Unternehmenskooperationen für Beschäftigung und Ausbildung Das Projekt AniA im Ausbildungsstrukturprogramm JOBSTARTER für die Zukunft ausbilden Peter Albrecht, GEBIFO-Berlin
Fachtagung Arbeitgeberzusammenschlüsse Unternehmenskooperationen für Beschäftigung und Ausbildung Das Projekt AniA im Ausbildungsstrukturprogramm JOBSTARTER für die Zukunft ausbilden Peter Albrecht, GEBIFO-Berlin
Bad Düben, Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau Neue Impulse für mehr Bio in Deutschland
 Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau Neue Impulse für mehr Bio in Deutschland Dr. Jürn Thünen Institut für Betriebswirtschaft Seite 53. 1 Fortbildungskurs der SIGÖL Bad Düben, Ökologisch bewirtschaftete
Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau Neue Impulse für mehr Bio in Deutschland Dr. Jürn Thünen Institut für Betriebswirtschaft Seite 53. 1 Fortbildungskurs der SIGÖL Bad Düben, Ökologisch bewirtschaftete
DIE MARKE TAIFUN. auf deren Produkte Taifun aufbaut. Drei Jahre später schließen sich beide Firmen in einer GmbH zusammen.
 1987 DIE MARKE TAIFUN Wolfgang Heck ruft die Firma Taifun ins Leben. Vorausgegangen war die Gründung von Life Food durch Klaus Kempff, auf deren Produkte Taifun aufbaut. Drei Jahre später schließen sich
1987 DIE MARKE TAIFUN Wolfgang Heck ruft die Firma Taifun ins Leben. Vorausgegangen war die Gründung von Life Food durch Klaus Kempff, auf deren Produkte Taifun aufbaut. Drei Jahre später schließen sich
Gemeinsame Veranstaltung von DBV und ZDH am 28. September 2011 in Berlin. Landwirtschaft und Handwerk Gemeinsam erfolgreich im ländlichen Raum
 Gemeinsame Veranstaltung von DBV und ZDH am 28. September 2011 in Berlin Landwirtschaft und Handwerk Gemeinsam erfolgreich im ländlichen Raum Grußwort von Dr. Helmut Born, Generalsekretär des Deutschen
Gemeinsame Veranstaltung von DBV und ZDH am 28. September 2011 in Berlin Landwirtschaft und Handwerk Gemeinsam erfolgreich im ländlichen Raum Grußwort von Dr. Helmut Born, Generalsekretär des Deutschen
Wir fördern Forschung im Auftrag des BMEL
 Wir fördern Forschung im Auftrag des BMEL Dr. Elke Saggau Förderinstrumente für Drittmittelprojekte Bundesinstitut für Risikobewertung Berlin 4. Mai 2017 Forschung fördern Wettbewerbsfähigkeit stärken
Wir fördern Forschung im Auftrag des BMEL Dr. Elke Saggau Förderinstrumente für Drittmittelprojekte Bundesinstitut für Risikobewertung Berlin 4. Mai 2017 Forschung fördern Wettbewerbsfähigkeit stärken
ÖkoAktionsplan. Gemeinsam für mehr ökologischen Landbau in Thüringen
 ÖkoAktionsplan Gemeinsam für mehr ökologischen Landbau in Thüringen ÖKOAKTIONSPLAN Gemeinsam für mehr ökologischen Landbau in Thüringen Der Ökolandbau schützt Umwelt und Klima, stärkt die heimische Landwirtschaft
ÖkoAktionsplan Gemeinsam für mehr ökologischen Landbau in Thüringen ÖKOAKTIONSPLAN Gemeinsam für mehr ökologischen Landbau in Thüringen Der Ökolandbau schützt Umwelt und Klima, stärkt die heimische Landwirtschaft
18. Wahlperiode Drucksache 18/205
 18. Wahlperiode 15.03.2019 Drucksache 18/205 Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Gisela Sengl BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 05.12.2018 Öko-Modellregionen Im Zuge von BioRegio Bayern 2020 wurden die Öko-Modellregionen
18. Wahlperiode 15.03.2019 Drucksache 18/205 Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Gisela Sengl BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 05.12.2018 Öko-Modellregionen Im Zuge von BioRegio Bayern 2020 wurden die Öko-Modellregionen
4. welche Einrichtungen und Netzwerke den Sojaanbau in Baden-Württemberg unterstützen;
 Landtag von Baden-Württemberg 15. Wahlperiode Drucksache 15 / 5744 19. 09. 2014 Antrag der Abg. Elke Brunnemer u. a. CDU und Stellungnahme des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Sojaanbau
Landtag von Baden-Württemberg 15. Wahlperiode Drucksache 15 / 5744 19. 09. 2014 Antrag der Abg. Elke Brunnemer u. a. CDU und Stellungnahme des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Sojaanbau
Produkte aus ökologischem Landbau beschaffen
 Informationsmaterialien über den ökologischen Landbau und zur Verarbeitung ökologischer Erzeugnisse für die Aus- und Weiterbildung im Ernährungshandwerk und in der Ernährungswirtschaft (Initiiert durch
Informationsmaterialien über den ökologischen Landbau und zur Verarbeitung ökologischer Erzeugnisse für die Aus- und Weiterbildung im Ernährungshandwerk und in der Ernährungswirtschaft (Initiiert durch
Anschwung für frühe Chancen Service-Programm zur Unterstützung von 600 Initiativen für frühkindliche Entwicklung
 Anschwung für frühe Chancen Service-Programm zur Unterstützung von 600 Initiativen für frühkindliche Entwicklung Ein gemeinsames Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Anschwung für frühe Chancen Service-Programm zur Unterstützung von 600 Initiativen für frühkindliche Entwicklung Ein gemeinsames Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
