Eine Zusammenfassung von Valentin Koch. Grundlagen der
|
|
|
- Achim Fiedler
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Eine Zusammenfassung von Valentin Koch Grundlagen der Kommunikationsdesign Visuelle Wahrnehmung Medienpsychologie Kompositionslehre Typografie Farbenlehre u. a. 1
2 Disclaimer Bei der hier vorliegenden Schrift handelt es sich um eine Zusammenfassung mehrerer Werke zu einem expliziten Thema. Dabei wurden ganze Passagen einfach wörtlich übernommen. Es handelt sich deshalb nicht um eine eigene geistige Leistung. Aufgrund dessen ist diese Schrift bitte nur für Lehrund Forschungszwecke zu verwenden. 2
3 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen der Gestaltung Der Gestaltungsprozess Überblick Formbegriff Form und Inhalt Form-Wahrnehmung Gesetze der visuellen Wahrnehmung Anthropogene Voraussetzungen Die Polarität zwischen Naturalismus und Abstraktion Figur und Grund Figur und Gesetze der Organisation Kontur Gruppierung Geometrisch-optische Täuschungen Übersicht der Relativität des simultan Wahrgenommenen Form und Ästhetik Wandel in der ästhetischen Rezeption Zeichentheorie Ferruccio Rossi-Landi: Theoretische Einführung Theoretische Strukturen System der visuellen Kommunikation Zeichenbereich Form Kompositionslehre Die bildnerische Form Gestaltungsbeispiele Das Maß Proportion und Harmonie Anwendungsbeispiele Größe, Wirkfelder, Formverbund, Formkontrast Abbild Zeichen Raum Klassische Perspektive Kurvenlineare Perspektive Licht und Schatten Raum, Licht und Tiefe Typografie Geschichte Einführung
4 3.3 Formlehre Schrift Schriftfamilien Klassifikation von Schriften Schriftgestaltung Satz Satzspiegel Satzausrichtung Layout Gestaltungsraster Lesetypografie Lesearten Voraussetzungen Satzspiegel Gliedern und Auszeichnen Überschriften Umbruch Verzeichnisse Detailtypografie Tabellen Text und Bild Bild mit Bild Typografie und Illustration Der Titel und das ganze Buch Detailtypografie Checkliste Schrift und Satz Checkliste für Autor und Redaktion Schriftzeichen, Wort, Absatz, Kolumne Wort, Absatz, Textkolumne Das typografische Maßsystem Schriftbearbeitung Weißräume Zeilen- und Seitenumbruch Farbenlehre Physik Farbensehen, Farbmetrik, Farbwahrnehmung Farbmodelle Farbordnungssysteme
5 4.4 Physiologische Farben Farbharmonien Farbwürfel Küppers Farbtetraeder Beispiel der Farbbestimmung im Farbtetraeder Farbmodell-Konvertierung RGB CMY CMYK HSB Medientechnik Druckverfahren Einführung Color Management Physikalische Grundlagen Farbtemperatur des Lichts Digitale Bildverarbeitung Grundlagen des digitalen Bildes Grundlagen der digitalen Fotografie Filmformate Pixelzahl und Druckgröße Weißabgleich Medienpraxis Medienkonzeption Medienkalkulation Schema einer Platzkostenrechnung Medienrecht Einleitung Einführung ins Urheberrecht Das Urheberrecht Wer ist Urheber? Das Urheberrecht in der Informationsgesellschaft Weitere Schutzrechte Die einzelnen Werke Wann ist eine Illustration geschützt? Corporate Identity Signet/Logo Entwurfsmethoden Piktogramm
6 8.2 Der Standardbrief Beispiele für Corporate Identity Kleine Gestaltungskunde Allgemein Illustration D-Echtzeit-Computergrafik Diffuse Texturierung Normal-Mapping Digital Painting Tips zum Umgang mit dem Graphik-Tablett Print Farbtabellen Farbnamen Fleischtöne Tutorials Anwendungsbeispiele Digital Painting Quellenangaben Terminologie Abbildungsverzeichnis Abb. 1 Der gestalterische Prozess Abb. 2 Die drei Bereiche menschlicher Wahrnehmung Abb. 3 Form und Inhalt Abb. 4 Beispiel Kippfiguren Abb. 5 Gliederungsmöglichkeiten eines gegebenen Reizmusters Abb. 6 Beispiel kognitiver Ansatz Abb. 7 Beispiel kognitiver Ansatz Fleckenmuster Abb. 8 Oekopsychologischer Ansatz - Orientierung anhand des Bodens Abb. 9 Beispiel für Invarianz Abb. 10 Wahrnehmungsmodell Abb. 11 Vergleich Menschenauge - Fisch-/Vogelauge Abb. 12 Archetyp - Vorder-, Mittel-, Hintergrund Abb. 13 Aufteilung der Fläche Abb. 14 Leserichtung Abb. 15 Beispiel Leserichtung in einem Bild Abb. 16 Leserichtung und Sehgewohnheit Abb. 17 Wahrnehmung von Licht und Schatten Abb. 18 Sehgewohnheit Leserichtung Abb. 19 Beispiel Sündenfall-Illustration Abb. 20 Beispiel Sündenfall-Interpretation Abb. 21 Beispiel Sündenfall-Interpretation^ Abb. 22 Beispiel für Figur und Grund Abb. 23 Figur und Gesetze der Organisation
7 Abb. 24 Figur und Kontur Abb. 25 Beispiel 2: Figur und Kontur Abb. 26 Beispiel Geschlossenheit Abb. 27 Beispiel 2: Geschlossenheit Abb. 28 Prinzip der guten Gestalt: Gute Fortsetzung Abb. 29 Prinzip Tarnung Abb. 30 Nähe und Ähnlichkeit Abb. 31 Nähe und Ähnlichkeit Abb. 32 Kippfiguren Abb. 33 Weitere dreidimensionale Kippfiguren Abb. 34 Größenkonstanz bei perspektivischer Verzerrung Abb. 35 Helligkeits- und Farbkonstanz Abb. 36 Formkonstanz einer Frisbee Abb. 37 Kontraststeigerung bei Größen Abb. 38 Kontraststeigerung bei Größen Abb. 39 Kontraststeigerung bei Größen Abb. 40 Kontraststeigerung der Richtung Abb. 41 Kontraststeigerung der Textur Abb. 42 Kontraststeigerung der Helligkeit Abb. 43 Umschlag einer Grauscala Abb. 44 Kippfigur Elefant Abb. 45 Kippfigur Zwei Quader Abb. 46 Jean-Auguste-Dominique Ingres - Das türkische Bad Abb. 47 Edouard Manet - Frühstück im Freien Abb. 48 Pablo Picasso - Les Demoiselles d'avignon Abb. 49 Fernand Léger - Femme en blue (1912) Abb. 50 Lucio Fontana (1960) Abb. 51 Jackson Pollock - Gespinst: Nummer 7 (1949) Abb. 52 Otto Muehl - Nahrungsmittelfest (1966) Abb. 53 Bridget Riley - Katarakt III (1967) Abb. 54 Edward Kienholz - Landesbewahranstalt (1966) Abb. 55 Juli Gudehus Bibelpiktogramme Abb. 56 Bestandteile einer allgemeinen Semiotik Abb. 57 Elemente der Sprache und ihre zeichentheoretischen Aspekte Abb. 58 Alltägliche Objekt als Zeichen Abb. 59 Ikonen-Beispiele Abb. 60 Symbol-Beispiel Abb. 61 Beispiel für die Wirkung von Zeichen Abb. 62 Kommunikationsschema Abb. 63 Pablo Picasso - Orangefarbener Hut/Marie-Thérèse Walter Abb. 64 Schema der Formaspekte Abb. 65 Formbeispiel für hart, kantig, spitz/für eckig, präzis Abb. 66 Formbeispiel für rund, weich Abb. 67 Gentile de Fabriano - Madonna mit Kind zwischen den Heiligen Nikolaus und Katharina (um 1390) Abb. 68 Beispiel für Punkt: Japanischer Scherenschnitt Abb. 69 Beispiel für Linien: Japanischer Scherenschnitt Abb. 70 Camille Graesser - Ohne Titel (Beispiel für Flächen) Abb. 71 Beispiel Leerform Abb. 72 Beispiel Füllform Abb. 73 Beispiel Vollform
8 Abb. 74 Beispiel konturscharf Abb. 75 Jean Pierre Velly - Trinità dei monti (1968) Abb. 76 Ambroise Vollard Abb. 77 Pablo Picasso ( ) - Ambroise Vollard (1910) Abb. 78 Pablo Picasso - Ambroise Vollard (1915) Abb. 79 Pablo Picasso - Ambroise Vollard (1937) Abb. 80 Bsp. für absolute Harmonie - Schachbrett und Ying & Yang Abb. 81 Bsp. Punkt- und Achsensymmetrie Abb. 82 Bsp. für Hierarchie Abb. 83 Bsp. Versteckte Harmonie Abb. 84 Formate Abb. 85 Kompositionsraster Hilfslinien Abb. 86 Kompositionsraster Hilfslinien Abb. 87 Kompositionsraster - Halbierung, Drittelung und Mischform Abb. 88 Punkt und Fläche Abb. 89 Punkt und Kontrapunkt Abb. 90 Focal Points nach Jack Hamm Abb. 91 Focal Area nach Jack Hamm Abb. 92 Punkt - Anordnung Abb. 93 Punkt - Anordnung Abb. 94 Punkt - Anordnung Abb. 95 Punkt - Anordnung Abb. 96 Punkt - Anordnung Abb. 97 Charakter der Linie Abb. 98 Linie - Anordnung senkrecht Abb. 99 Linie - Anordnung senkrecht Abb. 100 Linie - Anordnung waagerecht-senkrecht Abb. 101 Linie - Anordnung diagonal Abb. 102 Linie - Anordnung diagonal Abb. 103 Linie - Anordnung rund Abb. 104 Linie - Anordnung als Struktur Abb. 105 Fläche Allgemeines Abb. 106 Fläche Grundformen Abb. 107 Fläche Gliederung Abb. 108 Fläche - Gliederung Abb. 109 Fläche - Systematische Flächengliederung Abb. 110 Fläche - Systematische Flächengliederung Abb. 111 Gliederung der Fläche Beispiele Abb. 112 Das Lenken der Blickrichtung Abb. 113 Flächenkomposition Abb. 114 Die Relation von Flächen Abb. 115 Das Prinzip der Dreiteilung Abb. 116 Der Entering Point in der Landschaftsmalerei nach Jack Hamm Abb. 117 Follow Through by Jack Hamm Abb. 118 Beispiele für Follow Through Abb. 119 Beispiel Anzeigengestaltung - Joop Shoes Abb. 120 Ägyptische Proportionszeichnung Abb. 121 Polykleth Doryphoros Abb. 122 Leonardo Da Vinci - Der vitruvianische Mensch Abb. 123 Andrea Palladio - Gebäude v. Giorgio Cornaro Abb. 124 Le Corbusier
9 Abb. 125 Le Corbusier - Der Modulor Abb. 126 Le Corbusier - Der Modulor Abb. 127 Le Corbusier - Der Modulor Abb. 128 Der goldene Schnitt Einführung Abb. 129 Der Goldene Schnitt bei dem Parthenon Abb. 130 Der Goldene Schnitt bei der römischen Schrift "Capitalis Quadrata" Abb. 131 Informationsästhetik und Künstliche Intelligenz Abb. 132 Der goldene Schnitt Kreisdiagramm Abb. 133 Der Goldene Schnitt anhand einer Strecke AB Abb. 134 Der goldene Schnitt bei der Proportionierung von Rechteckflächen Abb. 135 Der goldene Schnitt bei Obelix Abb. 136 Der goldene Schnitt im Pentagramm Abb. 137 Der Goldene Schnitt - Geometrische Konstruktion Abb. 138 Der Goldene Schnitt - Geometrische Konstruktion in einem Kreis Abb. 139 Der goldene Schnitt bei Flächenproportion Quadrat Abb. 140 Harmonische Flächenaufteilung Abb. 141 Beispiele der Anordnung von Elementen nach dem Goldenen Schnitt Abb. 142 Größe Abb. 143 Größe und Räumlichkeit Abb. 144 Größe und Perspektive Abb. 145 Wirkfelder Abb. 146 Formverbund Abb. 147 Formkontrast Abb. 148 Formdifferenzierung - Oberflächenstrukturen Abb. 149 Relation von Format und Inhalt nach Jack Hamm Abb. 150 Beispiel Entwicklung von Zeichen Abb. 151 Räumlichkeit durch Abb. 152 Orthogonalprojektion Abb. 153 Kubismus, Pablo Picasso Abb. 154 Parallelprojektion Abb. 155 Verschiedene Formen der Parallelprojektion Abb. 156 Zentralperspektive Beispiel Abb. 157 Zentralperspektive Schema Abb. 158 Zentralperspektive Konstruktionsbeispiel Abb. 159 Schrägperspektive Schema Abb. 160 Schrägperspektive Konstruktionsbeispiel Abb. 161 Luftperspektive Konstruktionsbeispiel Abb. 162 Verkürzungen in der klassischen Perspektive Abb. 163 Kurvenlineare Perspektive - Konstruktionsbeispiel Abb. 164 Beispiele für kurvenlineare Perspektive Abb. 165 Schattenkonstruktion mit 1 und 2 Fluchtpunkten Abb. 166 Sonne und Schatten Abb. 167 Perspektive zwischen Himmel und Erde Abb. 168 Sättigung und räumliche Tiefe Abb. 169 Phonetische Bildzeichen Abb. 170 Entwicklung des lateinischen Alphabets Abb. 171 Seitenlayout bei einer Zeitschrift Abb. 172 Seitenlayout - konservative und dynamische Anordnung Abb. 173 Anordnung von Text Abb. 174 Ober- und Unterlinie bei Schrift Abb. 175 Spationierung
10 Abb. 176 Transport- und Kennzeichnungszone einer Schrift Abb. 177 Reduktion des Leseflusses durch Buchstabenspiegelung Abb. 178 Anordnung von Fließtext Abb. 179 Anderes Beispiel für die Anordnung von Fließtext Abb. 180 Beispiel Seitengestaltung und Leseführung Abb. 181 capitalis quadrata Abb. 182 Schriften im Geist der Zeit Abb. 183 Aufbauraster der Schrift Abb. 184 Proportionen eines Buchstabens Abb. 185 Optische Gesetze Abb. 186 Optische Gesetze Abb. 187 Manipulierte Schriften Abb. 188 Beispiele zu den Schriftfamilien Abb. 189 Antiquaschriften Abb. 190 Renaissance Antiqua Abb. 191 Barock Antiqua Abb. 192 Klassizistische Antiqua Abb. 193 Serifenlose Linearantiqua mit Renaissance-Charakter Abb. 194 Serifenlose Linearantiqua mit klassizistischem Charakter Abb. 195 Serifenlose Linearantiqua mit konstruiertem Charakter Abb. 196 Serifenbetonte Linearantiqua mit klassizistischem Charakter Abb. 197 Egyptienne Playbill Abb. 198 Serifenbetonte Linearantiqua mit konstruiertem Charakter Abb. 199 Frakturschrift Fraktur Bold Abb. 200 Beispiele für moderne Schriften Abb. 201 Beispiele für die klassizistische Antiqua Abb. 202 Beispiele für Renaissance-Schnitte Abb. 203 Typografische Maßeinheiten Abb. 204 Gliederung der Schriftgrade Abb. 205 Beispiel Überschrift und Fließtext Abb. 206 Beispiel Schriftgrade als Gestaltungsmittel Abb. 207 Typometer Abb. 208 Punze Abb. 209 Unterschiedliche Laufweiteneinstellungen Abb. 210 Geviert Abb. 211 Geviertabstände Abb. 212 Individueller Wortabstand Abb. 213 Buchstabenabstand Abb. 214 Buchstabenabstand Abb. 215 Unterschneidungstabelle Abb. 216 Textbeispiel Buchstabenabstand Abb. 217 Beispiel extreme Laufweiten Abb. 218 Schrifthöhe und Zeilenabstand Abb. 219 Mittellängen verschiedener Schriften Abb. 220 Zeilenabstand und Bildbeispiele Abb. 221 Wort- und Zeilenabstand Abb. 222 Buchstaben aus dem Satz herausgestellt Abb. 223 Textbeispiel zum Zeilenabstand Abb. 224 Zeilen kollidieren lassen Abb. 225 Auszeichnungsbeispiel Abb. 226 Auszeichnungsbeispiel
11 Abb. 227 Anführungszeichen und Textstriche Abb. 228 Regeln zu Initialen Abb. 229 Gestaltungsbeispiele für Initialen Abb. 230 Spaltenbreite und Lesbarkeit Abb. 231 Beispiel Flattersatz und Rauhsatz Abb. 232 Beispiel Mittelsatz Abb. 233 Beispiel grafische Formen Abb. 234 Layout - Einheitlichkeit Abb. 235 Layout - Überschrift und Raum Abb. 236 Layout - Gestaltungsbeispiele Abb. 237 Layout - Gestaltungsbeispiele Abb. 238 Layout - Gestaltungsbeispiele Abb. 239 Satz - Gestaltungsbeispiele Abb. 240 DIN-Formate und harmonische Seitenformate Abb. 241 Randabstände einer Doppelseite Abb. 242 Geometrische und optische Mitte Abb. 243 Satzspiegel - Zwei Konstruktionsmethoden Abb. 244 Konstruktion eines Rasters mit Spalten Abb. 245 Einpassen verschiedener Schriftgrößen in das Grundlinienraster Abb. 246 Schriftgrößen im Grundlinienraster Abb. 247 Ausfüllen eines Rasters - Beispiele Abb. 248 Satzspiegel - Konstruktion Abb. 249 Satzspiegel Bund-Schwund Abb. 250 Satzspiegel-Proportionen Abb. 251 Satzspiegel betont schmal Abb. 252 Satzspiegel betont breit Abb. 253 Klassische Leseseite Abb. 254 Einspaltiger Satzspiegel Abb. 255 Zweispaltiger Satzspiegel Abb. 256 Zweispaltiger Satz mit unterschiedlich breiten Bildern Abb. 257 Bilder außerhalb des Satzspiegels Abb. 258 Bilder außerhalb des Satzspiegels im zweispaltigen Satz Abb. 259 Dreispaltiger Satz/geschlossene Text-Bild-Seiten Abb. 260 Diskrepanz der Bildflächengrößen Abb. 261 Öffnung der Außenkontur Abb. 262 Öffnung der geschlossenen Seite Abb. 263 Geöffnete Text-Bild-Seite Abb. 264 Freie Gestaltung Abb. 265 Freie Gestaltung Abb. 266 Zwischenschlag Abb. 267 Flächenverhältnisse Abb. 268 Bildaktivität Abb. 269 Bild-Wechselwirkung Abb. 270 Angeschnittene Bilder Abb. 271 Kopfgrößen Abb. 272 Leserichtung Abb. 273 DTP-Typometer Abb. 274 Versalhöhe, Vertikalhöhe, x-höhe Abb. 275 Kontinuierliches Spektrum Abb. 276 Farbzentrum des Gehirns Abb. 277 Additives und subtraktives Farbsystem
12 Abb. 278 Primär- und Sekundärfarben Abb. 279 Die ungleichmäßige Verteilung im Farbkreis Abb. 280 Modulationen nach Grau Abb. 281 Farbverschiebungen durch unterschiedliches Umfeld Abb. 282 Nachbilder nennt man Sukzessivkontrast Abb. 283 Farbräumlichkeit Abb. 284 Scheinbarer Farbverlauf Abb. 285 Scheinbare Farbbewegung Abb. 286 Farbtonleiter Abb. 287 Farbharmonie Abb. 288 Modulationsfamilien Abb. 289 Buntfarben 100 % + Schwarz 20 % Abb. 290 Buntfarben 100 % + Schwarz 40 % Abb. 291 Buntfarben 80 % Abb. 292 Buntfarben 80 % + Schwarz 20 % Abb. 293 Buntfarben 80 % + Schwarz 40 % Abb. 294 Buntfarben 60 % Abb. 295 Buntfarben 60 % + Schwarz 20 % Abb. 296 Buntfarben 60 % + Schwarz 40 % Abb. 297 Buntfarben 40 % Abb. 298 Buntfarben 40 % + Schwarz 20 % Abb. 299 Buntfarben 40 % + Schwarz 40 % Abb. 300 Buntfarben 20 % Abb. 301 Buntfarben 20 % + Schwarz 20 % Abb. 302 Buntfarben 20 % + Schwarz 40 % Abb. 303 Farbwürfel Abb. 304 Farbtetraeder Beispiel Abb. 305 Farbtetraeder - Beispiel Abb. 306 Raster-Entwurfsmethode Abb. 307 Beispiele für Piktogramme und Piktogrammraster Abb. 308 Beispiele für Icons Abb. 309DIN-Brief und Adressensatz Abb. 310 Geschäftsbrief-Beispiel Abb. 311 Geschäftsbrief-Beispiel Abb. 312 Beispiel Signet und Corporate Identity Abb. 313 Illustration einer Figur - Erste Rough Sketches Abb. 314 Illustration einer Figur 2 - Verfeinerung der Rough Sketches
13 Grundlagen der Gestaltung Der Gestaltungsprozess - Überblick 1 Grundlagen der Gestaltung 1.1 Der Gestaltungsprozess Abb. 1 Der gestalterische Prozess Der gestalterische Prozess erfordert Produktivität und Rezeptivität (Empfängnis von Sinneseindrücken). Diese beiden Aspekte beanspruchen den kognitiven (siehe Abb. 2) Bereich d. h., sie sind erlernbar. Um das Ziel der Kommunikation zu erreichen, bedarf es der Kreativität. Sie ist primär nicht kognitiv erlernbar, aber durchaus trainierbar. Die Reflexion ermöglicht eine Korrektur bzw. Anpassung der anderen vier Aspekte. Das Sensitive Das Intuitive Abb. 2 Die drei Bereiche menschlicher Wahrnehmung Kognitiv ist geistig (Bewusstsein), sensitiv ist emotional (sowohl Bewusstsein als auch Unterbewusstsein) und intuitiv ist farblich (Unterbewusstsein) Überblick Format (DIN, amerik. willkürliche Formate, Monitor, Fernseher, Dia etc.) Stilmittel 13
14 Grundlagen der Gestaltung Formbegriff - Überblick Proportion (Goldener Schnitt, Fibonacci, Anatomie, Typografie) Flächenaufteilung Geometrische Grundelemente der Fläche Geometrische Grundelemente und Inhalt und Form Gleichheit (Ordnungsmittel: Form, Farbe, Größe und Umfeld) Distanz Geschlossenheit: nahe beieinanderstehend zusammengehörig fern auseinanderstehend getrennt Linien und Tonflächen verstärken die Zusammengehörigkeit und vermitteln Geschlossenheit Linien müssen die richtige Stärke haben. Faustregel: Anpassung an das Schriftbild der verwendeten Grundschrift Tonflächen dürfen nicht zu dunkel sein. Kontrast: Das menschliche Auge bewertet die Helligkeit einer Fläche in Beziehung zu seiner Umgebung Strukturen Permutationen: Geometrische Grundelemente nach mathematischen Ordnungsgesichtspunkten gliedern Rhythmus: Größen, Formen, Abstände weisen gesetzmäßige Proportionen auf. Dabei lassen sich rhythmische Reihen, sogenannte Progressionen, durch Zahlenreichen ausdrücken. Farbe (schmückt, signalisiert, schreit, gliedert etc.). Farbkontrast, -harmonie, -wirkung. Beispiel einer Ordnung: warm kalt, bunt unbunt, leuchtend stumpf, wenig viel, hell dunkel Raum und Licht 1.2 Formbegriff Form ist die sichtbare Gestalt des Inhalts. Form ist die äußere Seite des ästhetischen Objekts, seine Struktur, die Gesamtheit seiner Elemente und ihrer Beziehungen zueinander, durch die sein Inhalt zum Ausdruck gebracht wird. Unterschiede zwischen Wissenschaft und Kunst hinsichtlich der Form Die wissenschaftliche Form ist gegenüber ihrem Inhalt weitgehend gleichgültig. Die Kunst hingegen verbindet Form und Inhalt zu einer Einheit, sodass jede Veränderung der Form (etwa der Sprache) auch ihren Inhalt verändert. In einer weiteren Bedeutung bezeichnet Form die verschiedenen Künste (Plastik, Malerei, Musik, Dichtung etc.) Die Bedeutung der künstlerischen Form tritt in der doppelten Funktion zutage, die sie im Einzelnen Kunstwerk erfüllt. Unter dem Aspekt der Produktion und dem Aspekt der Rezeption. Aristoteles, der den Begriff der Form umfassend entwickelt hat, kennt weder ungeformten Stoff noch stofflose Form. Aristoteles fasst die Form (die er zum Teil sogar mit Platons Begriff Eidos, der Idee, benennt) als das Primäre, Ursprüngliche auf Durch die Entelechie wird der Stoff zu dem, was er dem Eidos gemäß erst der Möglichkeit nach war. (Entelechie (Philos.) etwas, was sein Ziel in sich selbst hat; die sich im Stoff verwirklichende Form (bei Aristoteles) 2. die im Organismus liegende Kraft, die seine Entwicklung und Vollendung bewirkt) 14
15 Grundlagen der Gestaltung Formbegriff - Form und Inhalt Plotin: Die innere Form in der Seele des Schaffenden ist Voraussetzung der äußeren Form, wobei das tatsächlich produzierte Werk stets an Vollkommenheit nachsteht. Schiller: Seine Konzeption der Ästhetik beruht auf der Annahme zweier Grundtriebe des Menschen, dem Stoff- und dem Formtrieb. sinnliche Natur des Menschen, auf das Leben gerichtet vernünftige Natur des Menschen, auf die Gestalt gerichtet Hegel: Inhalt und Form als Synthese Der Inhalt ist das Umschlagen der Form in Inhalt und die Form das Umschlagen des Inhalts in Form, wobei der Inhalt das primäre und bestimmende Moment darstellt. Bloch und Lukacs: Aufgabe der Kunst ist es, die geschichtlich sich entwickelnden Formen des Lebens abzubilden. Neuere Strömungen der Ästhetik kantisch ausgerichtete Kunstwissenschaft die strukturalistische, semiotische oder die Informationsästhetik Form wird dabei als Struktur oder Zeichen aufgefasst in der Relation der Zeichen untereinander (syntaktischer Aspekt) in der Relation der Zeichen zum Bezeichneten (semantischer Aspekt) und in der Beziehung der Zeichen auf den verstehenden oder interpretierenden Menschen (pragmatischer Aspekt) Form und Inhalt Abb. 3 Form und Inhalt Form-Wahrnehmung Es gibt keine Wahrnehmungstheorie, die sich über die andern stellen lässt. Was ist Wahrnehmung? Die Wahrnehmung ist eine psychologische Funktion, die dem Organismus (mittels Sinnesorgane) die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen betreffs Zustand und Veränderung der Innen- und Außenwelt ermöglicht. 15
16 Grundlagen der Gestaltung Formbegriff - Form-Wahrnehmung Sir Charles Scott Sherrington 1906 Interozeptoren (Organempfindungen) Propriozeptoren (Stellung der Gelenke, Muskelspannung, Körperlage, lineare und radiale Körperbewegungen) Exterozeptoren (Kontaktzeptoren: Tast-, Geschmacks-, Druck-, Berührungs-, Temperatur-, Schmerzsinn vermitteln Informationen über die nahe Umwelt; Distanzzeptoren: Gesichts-, Gehör-, Geruchssinn vermitteln Informationen über die weiter entfernte Umwelt.) Das Wahrnehmungssystem steht vor folgenden Problemen Wann immer sich drei Linien in der zweidimensionalen Abbildung schneiden, muss es entscheiden, ob es sich um das gleiche Objekt handelt. Auf ein- und dieselbe zweidimensionale Darstellung können sehr viele verschiedene dreidimensionale Gegenstände zurückgehen und das visuelle System steht vor der Aufgabe, das richtige Objekt zu erkennen. Beispiel für mehrdeutige Reizmuster: Kippfiguren. Abb. 4 Beispiel Kippfiguren Abb. 5 Gliederungsmöglichkeiten eines gegebenen Reizmusters 16
17 Grundlagen der Gestaltung Formbegriff - Form-Wahrnehmung Die Erscheinungsform, in der sich Objekte der Wahrnehmung präsentieren, ist oftmals sehr vielfältig und variiert je nach Form, Größe, Typ oder aber auch der Betrachtungsperspektive. Beispiel: Gesichter zweier verschiedener Personen in der Frontalansicht sind sich oft ähnlicher als das gleiche Gesicht einmal von vorne und einmal von der Seite aus betrachtet, dennoch werden die beiden unähnlicheren Ansichten als zu der gleichen Person gehörend betrachtet. Fünf klassische Theorien oder Betrachtungsweisen der Wahrnehmung hatten bis heute großen Einfluss auf die Forschung: Deduktionstheorie oder empirische Theorie der Wahrnehmung Gestaltpsychologische Theorie der Wahrnehmung Kognitive theoretische Ansätze Oekopsychologischer Ansatz Deduktionstheorie Empiristen: Hobbes, Locke, Hume wahre Erkenntnis beruht allein auf Sinneserfahrungen; der Geist des Menschen ist bei der Geburt ein unbeschriebenes Blatt, ein Tabula rasa, auf diese die Erfahrungen durch Sinneseindrücke geschrieben werden. George Berkeley 1709 Es müssen bestimmte Assoziationen an die visuellen Eindrücke geknüpft werden. Hermann von Helmholtz nach 1950 Wahrnehmungen beruhen auf einem deduktiven Vorgang, weil frühere Erfahrungen mit einbezogen werden: Die Sinneseindrücke sind Andeutungen für unser Bewusstsein; es bleibt unserem Verstand überlassen, ihre Bedeutung herauszufinden. (deduktiv = darunter versteht man den analytischen Übergang von einer oder mehreren Aussagen (Prämissen) zu einer Aussage (Schluß). Der Prozeß verläuft vom Allgemeinen zum Speziellen.) Gestaltpsychologische Theorie, Anfang 20. Jahrhundert Wahrnehmungen sind nicht aus analytisch gewonnenen Elementen zusammengesetzt, die Wahrnehmung des Ganzen ist mehr als die Summe der Teile (Aristoteles). Vordenker und Vorläufer Descartes (17. Jh.) Der Mensch besitzt angeborene Vorstellungen über Form, Größe und andere Eigenschaften von Gegenständen. Kant (18. Jh.) Der Geist verfügt über ein selbstständiges Konzept von Raum und Zeit, das er auf die empfangene Sinnesinformation anwendet. Organisation der Wahrnehmung: Das Chaos der Sinnesempfindungen wird zu sinnvollen Einheiten geordnet. Die Wahrnehmung muss also einen Sinn ergeben. Max Wertheimer (20er Jahre), Begründer der Gestaltpsychologie Gestaltgesetzte (Gesetzmäßigkeiten, welche die Organisation von Teilen zu einem Ganzen erklären) Gesetz der Nähe Elemente mit geringen Abständen werden als zusammengehörig wahrgenommen Gesetz der Ähnlichkeit einander ähnlich aussehende Elemente werden eher als zusammengehörig erlebt 17
18 Grundlagen der Gestaltung Formbegriff - Form-Wahrnehmung Gesetz der Prägnanz, auch Gesetz der guten Gestalt oder Gesetz der Einfachheit gestalthafte Wahrnehmungseinheiten bilden sich stets so aus, dass das Ergebnis eine möglichst einfache und einprägsame Gestalt darstellt Gesetz der guten Fortsetzung man neigt dazu Reizelemente in einem Zusammenhang zu sehen (z. B. Punkte in einer geraden Angeordnet) Gesetz der Geschlossenheit Tendenz, in geometrischen Gebilden diejenigen Strukturen als Figur wahrzunehmen, die eher geschlossen wirken als offen Gesetz des gemeinsamen Schicksals Elemente, die eine Bewegung oder Änderung in die gleiche Richtung erfahren, werden als Einheit wahrgenommen (z. B. Ballettgruppe in einem gemeinsamen Bewegungsablauf) Kritik: Wahrnehmungseindrücke werden nur im Nachhinein erklärt statt vorausgesagt Kognitiver Ansatz Kognitionspsychologen gehen davon aus, dass Leistungen des Gehirns notwendig sind, um trotz vielfältiger Störungen das Wahrgenommene richtig zu interpretieren oder überhaupt dessen Bedeutungsinhalt zu erkennen. Wir lenken unsere Aufmerksamkeit häufig bewusst nehmen nur Dinge war, die unserer momentanen Handlungsabsicht entsprechen bewerten das Wahrgenommene aufgrund unserer entwicklungsgeschichtlichen und kulturellen Prägung Die Lösung eines Problems umfasst nach Ansicht von Ulric Neisser die Lösungssuche die Annahme der möglichen Lösungen Abb. 6 Beispiel kognitiver Ansatz die Auswahl der bevorzugten Lösung Die folgenden Fleckenmuster stellen zuerst ein Problem dar und werden solange untersucht, bis wir eine plausible Lösung gefunden haben. Wenn wir sie erst einmal erkannt haben, ändert diese Erfahrung die Organisation und Beschreibung unserer Wahrnehmung. Abb. 7 Beispiel kognitiver Ansatz Fleckenmuster Oekopsychologischer Ansatz Oekopsychologischer Ansatz 1 18
19 Grundlagen der Gestaltung Formbegriff - Form-Wahrnehmung (Oekologie: In der Humanpsychologie ein Teilgebiet der Sozialpsychologie, das in Analogie zu der soziologischen Oekologie die sozialen, institutionellen und kulturellen Beziehungen des Menschen betrifft. Oekologische Psychologie: auch psychologische Oekologie, oder Oekopsychologie, eine noch junge Teildisziplin, die sich unter allgemeinen psychologischen, psychosozialen, auch unter praktischen Aspekten mit den Beziehungen des Menschen zur engeren und weiteren räumlichen, materiellen und sozialen Umwelt befaßt.) Viele grundlegende Informationen, die wir wahrnehmen, entstammen direkt aus der Umwelt und müssen nicht mehr über kognitive Prozesse ermittelt werden. J. J. Gibson Das Wahrnehmungssystem eines Lebewesens ist den Anforderungen seiner Umwelt angepasst. entscheidende Informationen zur Steuerung der Handlungen erhält man von dem Medium, auf dem man sich fortbewegt: z. B. dem Boden. Abb. 8 Oekopsychologischer Ansatz - Orientierung anhand des Bodens Springen? Wann? Reicht die Kraft? Runterklettern? Wann bremsen? Abstürzen? Klettern? Hinaufspringen? 19
20 Grundlagen der Gestaltung Formbegriff - Form-Wahrnehmung Oekopsychologischer Ansatz 2 1. Qualität der empfangenen Lichtwellen 2. Affordanzen (J. J. Gibson) inhaltlicher Wahrnehmungsgehalt über mögliche Handlungen (Auf dieselbe Weise wie das Licht deutet das Wahrnehmungssystem die Beschaffenheit von Objekten und nimmt dabei die Informationen über den möglichen Gebrauch der Objekte auf.) Das Wahrnehmungssystem eines jeden Lebewesens ist vor allem durch lebenslange Lernprozesse auf seine speziellen, dauernd sich ändernden Lebensbedingungen hin abgestimmt. Der Mensch verfügt über Mechanismen, diese Affordanzen direkt zu erkennen. Beispiel: Wir sehen einem Hindernis an, mit welchem Energieaufwand wir es überwinden können, ohne dabei aufwendige Berechnungen über unsere Körpermasse und die Größe und Ausdehnung des Hindernisses anzustellen. 3. Invarianz (Trotz invarianter Verhältnisse, wie z. B. perspektivische Verzerrung, veränderte Lichtverhältnisse und Bewegung, erkennen wir die Objekte, siehe Abb. 9) Abb. 9 Beispiel für Invarianz Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den Wahrnehmungstheorien die unserer Umwelt innewohnenden Affordanzen sind verhaltensbestimmend Texturen sind Informationsträger über die Lage und Orientierung von Objekten und unterstützen damit die Orientierbarkeit die Menge an Informationsgehalt ist ein notwendiges Kriterium für ästhetisches Empfinden unser Wahrnehmungssystem unterscheidet ständig Figur und Grund, was Konsequenzen für die Zuordnung von Entwurfselementen hat es gibt anscheinend Regeln, von denen das schnelle Erfassen von Reizen abhängt, was für die Lenkung von Aufmerksamkeit von Bedeutung sein kann kognitive Prozesse beeinflussen die Wahrnehmung (z. B. die Einstellung gegenüber einem Kunststil beeinflusst die Beurteilung eines Gemäldes) 20
21 Grundlagen der Gestaltung Formbegriff - Form-Wahrnehmung Wahrnehmungskette, Organisation der visuellen Wahrnehmung Umwelt Medium Interaktion Sinnesnerven Gehirn, sensorische Zentren 1. Die Umwelt Eigenschaften, die die Wahrnehmung bestimmen Objekte und Energien Verteilung und Lokalisation Physikalische Attribute (Größe, Farbe, Härte, Bewegung, Dauer, Veränderung) 2. Das Medium vermittelt uns Eigenschaften aus der Umwelt an unsere Sinne Reflektiertes Licht gelangt zu unseren Augen Schallwellen und chem. Substanzen gelangen an Ohr und Nase Druck auf die Haut Schwerkraft/Wärme 3. Interaktion Die verschiedenen Formen von Energie und anderen Reizen im Medium interagieren mit den sensiblen Rezeptoren unseres Wahrnehmungssystems 4. Die Sinnesnerven die Sinnesnerven verbinden die Rezeptorenorgane mit dem Gehirn 5. Das Gehirn mit seinen sensorischen Zentren Im Gehirn, insbesondere den sensorischen Zentren, stoßen die sensorischen Bahnen auf die Großhirnrinde. Andere Teile des Gehirns werden auch betroffen, denn von den sensorischen Zentren ausgehende Neuronen führen zur weiteren Verarbeitung in andere Gehirnregionen. 21
22 Grundlagen der Gestaltung Gesetze der visuellen Wahrnehmung - Anthropogene Voraussetzungen Abb. 10 Wahrnehmungsmodell 1.3 Gesetze der visuellen Wahrnehmung Nach welchen Prinzipien organisiert das Gehirn das Mosaik aus Signalen? Welche Rolle spielt die Erfahrung? Figur: optisches Gebilde, das als Einheit, Ganzheit aufgefasst wird. Gestalt: Gesamtheit der Beziehungen. Dieses Kapitel zeigt einen Ausschnitt von wesentlichen Gestaltgesetzen, welche einen hohen Anteil bei der Wirksamkeit von visuellen Gestaltungen ausmachen Anthropogene Voraussetzungen (anthropogen = durch den Menschen beeinflusst, verursacht (DUDEN Das Fremdwörterbuch)) 22
23 Grundlagen der Gestaltung Gesetze der visuellen Wahrnehmung - Anthropogene Voraussetzungen Abb. 11 Vergleich Menschenauge - Fisch-/Vogelauge Horizontale Dominanz entspricht dem Lebensraum Erde. Die Dominanz beider Achsen entspricht dem Lebensraum Luft/Wasser. Beim Menschen dominiert der Wahrnehmungswinkel der Horizontalen, was bedeutet, dass wir waagerechte Strecken besser abschätzen können. Archetypen Abb. 12 Archetyp - Vorder-, Mittel-, Hintergrund Eines der menschlichen Urbilder ist die Gliederung einer Landschaft in drei Ebenen. Im Vordergrund befinden sich Schutz bietende Bäume und Sträucher, im Mittelgrund ist schutz- und nahrungsgebendes Wasser und im Hintergrund eine überschaubare Steppe oder Wiese. Der Versuch, dieses innere Idealbild einer Landschaft wiederzugeben, hat die aufwendige Gartenarchitektur (franz. oder engl. Garten) hervorgebracht. Abb. 13 Aufteilung der Fläche Wir teilen eine leere Fläche (bedrohlich = das Nichts) in eine Mitte (das Zentrum = das Ich), in links rechts, oben unten ein. Diese Einteilung beinhaltet Werte, die sich durch jahrhundertelange Erziehung zu Sehgewohnheiten entwickelt haben (Sprachgebrauch: das ist ein linker Typ, ein rechter Typ, er geht aufrecht, er ist gerecht.). Abb. 14 Leserichtung Aus der Leserichtung links rechts gehen die Regeln hervor: Links ist der Anfang, rechts das Ende oder anders: Links ist die Vergangenheit, in der Mitte die Gegenwart und rechts die Zukunft. Diese Leserichtung gilt jedoch nur für den Okzident. Diese konsequente Leserichtung hat sich erst mit der Entwicklung der phönizischen Schrift (ca. 650 v. Chr.) gebildet. Sie widerspricht dem Bestreben des Menschen nach Harmonie und Ordnung. Aus Symmetriegründen wurden vorher Schrift- und Bildzeichen zum Teil in wechselndem Leserhythmus dargestellt (wie in der Abb. Oben) 23
24 Grundlagen der Gestaltung Gesetze der visuellen Wahrnehmung - Anthropogene Voraussetzungen Abb. 15 Beispiel Leserichtung in einem Bild In der linken Abb. bewegen wir uns von dem Haus weg, in der rechten gehen wir zu dem Haus hin. Abb. 16 Leserichtung und Sehgewohnheit Durch die Festlegung der rechten Schreibhand ergab sich automatisch eine Links-rechts-Leserichtung. Ein Rechtshänder zieht eine waagerechte Linie immer von links nach rechts, dementsprechend zieht er eine Senkrechte immer von oben nach unten. Bei dem Winkel in der unteren Abb. wird man nach der Waagerechten absetzen und die Senkrechte von oben nach unten ausloten. Unter keinen Umständen würde man die Waagerechte als Senkrechte von unten nach oben in einem Zug fortsetzen. Dementsprechend sind unsere Sehgewohnheiten. Erst durch eine neue gestaltete Schwerpunktfestlegung erreicht man eine neue Blickrichtung. Wir verändern damit das anerzogene Hierarchieprinzip zugunsten einer anderen Aussage. Abb. 18 Sehgewohnheit Leserichtung Abb. 17 Wahrnehmung von Licht und Schatten Licht von links oben übt einen höchst effizienteren Einfluss auf unsere Wahrnehmung. Das rechte E möchte man beinahe zu einem B ergänzen. Ein Bild wird von links nach rechts gelesen: Diese Sehgewohnheit von links nach rechts und von oben nach unten gilt es zu zerstören, um mit einer neuen Schwerpunktfestlegung eine andere Blickrichtung zu erreichen. (siehe Abb. (?)) [Lesezeichen, unklar] 24
25 Grundlagen der Gestaltung Gesetze der visuellen Wahrnehmung - Die Polarität zwischen Naturalismus und Abstraktion Biologische Voraussetzungen Sehen: Auge Gehirn Die etwa 5 m 2 große Netzhaut enthält ca. 130 Mio. lichtempfindliche Zellen, wobei nur 7 Mio. Farbinformationen erfassen können, woraus sich ergibt, dass wir weitaus besser Hell-dunkel- Unterschiede registrieren. Bei Dämmerlicht können wir z. B. Farben gleicher Helligkeit nicht mehr unterscheiden. Das Auge an sich bildet das eingehende Bild nur seitenverkehrt und kopfstehend ab. Erst im Gehirn wird das uns gewohnte Bild erzeugt. Aufgrund der großen Datenmenge filtert das Gehirn weitestgehend die Informationen außerhalb unserer kognitiven Kontrolle. Die Gewichtung bzw. Wirkung der Wahrnehmung ist von Mensch zu Mensch verschieden und hängt von unzähligen Faktoren ab, wie z. B. Lebenserfahrung, prägende Lebensereignisse, Bildung, Alter, Geschlecht usw. Bei allen bewussten Sehvorgängen laufen etwas 1,5 Mio. Bits kontinuierlich vom Auge zum Gehirn. Die Filterung hat auch zur Folge, dass wir Menschen nicht dazu fähig sind, mathematisch objektiv zu Sehen sondern sind einem individuellen Verarbeiten und Empfinden unterworfen (human feeling). Unser Gehirn lässt sich durch vorgegebene Arbeitsschritte täuschen (optische Imponderabilien). (Imponderabilien = Unwägbarkeiten; Gefühls und Stimmungswerte; Ggs. Ponderabilien: kalkulierbare, fassbare, wägbare Dinge) Variablen des visuellen Gewichts Größe: maßgebend ist die Abbildungsgröße, nicht die reale Größe Allgemeine Formatlage: Die Spannung steigt mit dem Abstand zum Formatmittelpunkt. Vertikale Formatlage: Oben hat mehr Gewicht als unten. Horizontale Formatlage: Der Blick fällt zuerst nach links, allerdings erscheint links leichter als rechts. Helligkeit und Farbe: Hell vor dunkel, warme Farben wiegen schwerer als kalte, intensive leuchtende Farben sind gewichtiger als zarte, blasse. Form: runde, geschlossene Formen wirken schwerer als eckige, senkrechte Ausrichtungen haben ein höheres Gewicht als waagerechte Die Polarität zwischen Naturalismus und Abstraktion (Naturalismus = Der Unterschied zwischen Naturalismus und Realismus ist vordergründig marginal. Der Naturalismus wendet sich der tatsächlichen Darstellung, vor allem auch in einer erzählenden Funktion, zu, d. h. Ziel ist es, Ereignisse möglichst wahrheitsgetreu wiederzugeben, z. B. bei der Darstellung des Arbeitermilieus (dreckige Kleidung, gegerbte Haut, schmutzige Umgebung etc.). Der Realismus hingegen strebt nur eine realitätsnahe Darstellungsform an, z. B. bei einer fotorealistischen Darstellung eines Glases mit den entsprechenden Lichtreflexionen und brechungen.) Während die konkrete Darstellung ein ausführlich erzählende Funktion hat, hat die abstrakte Darstellung die Aufgabe, Aussagen zu komprimieren, das Wesentliche herauszuarbeiten. 25
26 Grundlagen der Gestaltung Gesetze der visuellen Wahrnehmung - Figur und Grund Unterschied zwischen Illustration, Interpretation und Abstraktion Abb. 19 Beispiel Sündenfall-Illustration Illustration soll den Inhalt eines Textabschnitts wiedergeben, unter Beachtung von Ort, Zeit und Gegenständen. Die Technik sollte mit dem Text übereinstimmen = Einheit von Inhalt und Form. Beispiele: galante Rokokoerzählung = zarte Strichzeichnung; Nachkriegserzählung = Rohrfeder, Borstenpinsel, Holzschnitt; Kinderbuch = Buntstifte, Farbflächen. Abb. 20 Beispiel Sündenfall-Interpretation Die Interpretation ist nicht orts- und zeitgebunden und kann umfangreiche Inhalte in einer Darstellung zusammenfassen. Sie kann auf naturgetreue Darstellung verzichten, benutzt aber Naturformen (in der Übersteigerung). Abb. 21 Beispiel Sündenfall-Interpretation^ Die Abstraktion reduziert die Naturformen auf ihren geistigen Gehalt auf das Wesentliche der Dinge. Der Deutungsspielraum darf nicht zu groß sein, damit die Grundidee erfassbar bleibt Figur und Grund Figur-Grund-Differenzierung einfachste Form der Wahrnehmungsorganisation Blickfeld fast immer hebt sich ein Teil (Figur) vom übrigen (Grund) ab; bei mehreren Figuren wird meiste eine die Aufmerksamkeit erregen Figur i. d. R. klarer, schärfer umrissen und lokalisiert, massiver und integrierter als der Grund; scheint vor dem Grund zu sein. 26
27 Grundlagen der Gestaltung Gesetze der visuellen Wahrnehmung - Figur und Gesetze der Organisation Abb. 22 Beispiel für Figur und Grund Die Grenzlinie zwischen der weißen und schwarzen Fläche erscheint als Wölbung, wenn man den weißen Teil als Figur zuordnet; organisiert man sie zusammen mit der schwarzen Fläche, nimmt man eine konkave Krümmung wahr Figur und Gesetze der Organisation Abb. 23 Figur und Gesetze der Organisation Das Wort Fly in obiger Abb. 23 nimmt man nur wahr, wenn man die schwarzen Flächen als Grund betrachtet. [Lesezeichen, Rechtschreibprüfung] Kontur Die Kontur hebt die Figur vom Grund ab. Jede Figur hat ein Umfeld, von dem sie sich abhebt. Entweder befindet sich die Figur auf einem Untergrund oder vor einem Hintergrund. 27
28 Grundlagen der Gestaltung Gesetze der visuellen Wahrnehmung - Gruppierung Abb. 24 Figur und Kontur Welche Eigenschaften besitzt die Kontur? Sie ist eine imaginäre Linie, welche die Figur vom Grund absetzt und gehört zur Figur. Abb. 25 Beispiel 2: Figur und Kontur Gruppierung Geschlossenheit Eine geschlossene Fläche oder eine geschlossene lineare Form wird eher als eine Figur wahrgenommen als eine nicht geschlossene. Die geschlossene Kontur macht die Form zur Figur. Wir neigen dazu, Figuren durch subjektive nicht vorhandene Konturen zu ergänzen. Diese Tendenz der Wahrnehmung wird als Geschlossenheit bezeichnet. Subjektive Konturen entstehen am leichtesten, wenn uns ihr Vorhandensein hilft, eine komplexe Wahrnehmung zu vereinfachen. Abb. 26 Beispiel Geschlossenheit 28
29 Grundlagen der Gestaltung Gesetze der visuellen Wahrnehmung - Gruppierung In der rechten Abbildung von Abb. 26 nehmen wir an, dass die Vervollständigung der Figur ein Dreieck ergibt. Aber es ist keine starke Tendenz vorhanden, wie in der linken Abbildung. Vielmehr ist es leichter, ein anderes, auf der Spitze stehendes Dreieck vor dem Dreieck zu sehen. Abb. 27 Beispiel 2: Geschlossenheit Die Buchstaben in Abb. 27 werden erst durch die schwarze Verdeckung wahrnehmbar Prinzip der guten Gestalt Abb. 28 Prinzip der guten Gestalt: Gute Fortsetzung 29
30 Grundlagen der Gestaltung Gesetze der visuellen Wahrnehmung - Gruppierung 1. Gute Fortsetzung Tendenziell werden Elemente so miteinander verbunden, dass sie die Fortsetzung einer Linie in eine bereits eingeschlagene Richtung gestatten. In der Abb. 28 bewirkt das Prinzip der guten Fortsetzung, dass wir die oberste Figur als aus den beiden unmittelbar darunter abgebildeten Teilen bestehen sehen, obwohl sie rein logisch betrachtet auch aus den beiden untersten Teilen bestehen könnte. 2. Symmetrie Bevorzugung von Gruppierungen, die zu symmetrischen bzw. ausgewogenen Ganzen vereinigt werden können. 3. Gemeinsames Schicksal Tendenz, Elemente zusammenzufassen, die der gleichen Bewegung unterworfen sind (Beispiel: Tarnung) Abb. 29 Prinzip Tarnung Der getarnte Fisch bleibt solange unentdeckt, solange er sich nicht bewegt. Sobald er sich bewegt, löst er sich aus der Gruppierung und wird wahrgenommen Nähe und Ähnlichkeit Bei gleichen Objekten werden diejenigen als Einheit gesehen, die am nächsten benachbart sind. Abb. 30 Nähe und Ähnlichkeit 1 Die Punkte werden als senkrechte Reihen gesehen, weil sie hier näher beieinander sind. Abb. 31 Nähe und Ähnlichkeit 2 Hier sind alle Punkte gleich weit voneinander entfernt. Sie werden dennoch als horizontale Reihen wahrgenommen auf Grund von Gruppierung nach Ähnlichkeit Veränderung der Organisation Manche Veränderungen der Wahrnehmung ereignen sich infolge eines Wandels der Erwartungen, der Einstellung oder der Aufmerksamkeit des Beobachters. Manche scheinen spontan einzutreten, wie z. B. bei Kippfiguren. 30
31 Grundlagen der Gestaltung Gesetze der visuellen Wahrnehmung - Gruppierung Abb. 32 Kippfiguren Die obigen Beispiele zeigen, dass die alternative Sicht einen Austausch von Figur und Grund beinhaltet (3) oder die Struktur oder Anordnung der Figur ändert Übersättigung der Organisation Ein langes Betrachten einer Figur bewirkt eine Übersättigung und lässt die Wahrnehmung auf eine andere Figur kippen (Kippfiguren). Es könnte sein, dass es sich hier um wechselnde Gedächtnisassoziationen handelt und nicht um Ermüdungserscheinungen. 31
32 Grundlagen der Gestaltung Gesetze der visuellen Wahrnehmung - Gruppierung Abb. 33 Weitere dreidimensionale Kippfiguren Konstanz der Wahrnehmung Konstant gehalten, trotz wechselnder Reizverhältnisse, werden die Merkmale wie Helligkeit, Größe, Lage, Gestalt oder Färbung. Perzeptive Konstanz Die wahrgenommene Größe, Form, Helligkeit und Farbe eines Objektes ändert sich nicht durch z. B. verschiedene Lagen im Raum, Veränderung der Lichtverhältnisse etc. Die Annahme, wenn sich der Reiz ändert, so ändert sich auch die Wahrnehmung, ist richtig und falsch zugleich. Größenkonstanz Wenn sich ein Objekt weiter entfernt, nimmt seine Größe auf der Netzhaut ab, aber seine wahrgenommene Größe bleibt dieselbe. 32
33 Grundlagen der Gestaltung Gesetze der visuellen Wahrnehmung - Gruppierung Abb. 34 Größenkonstanz bei perspektivischer Verzerrung Helligkeits- und Farbkonstanz Wir erzielen Konstanz der wahrgenommenen Helligkeit oder des Farbtons, selbst wenn sich die Stärke oder Wellenlänge des Lichts verändert hat. Abb. 35 Helligkeits- und Farbkonstanz Formkonstanz Z. B. wird eine Frisbee immer als kreisförmig wahrgenommen. 33
34 Grundlagen der Gestaltung Geometrisch-optische Täuschungen - Übersicht der Relativität des simultan Wahrgenommenen Abb. 36 Formkonstanz einer Frisbee Muster und Wahrnehmung Eine Melodie wird trotz höherer oder tieferer Tonlage als gleich erkannt. 1.4 Geometrisch-optische Täuschungen Übersicht der Relativität des simultan Wahrgenommenen Optische Täuschungen Relativität der Wahrnehmung durch unwillkürliche Kontraststeigerung Kontraststeigerung bei Größe Richtung Textur Helligkeit Farbe Beispiele: 34
35 Grundlagen der Gestaltung Geometrisch-optische Täuschungen - Übersicht der Relativität des simultan Wahrgenommenen Kontraststeigerung bei Größen Abb. 37 Kontraststeigerung bei Größen Horizontal-Vertikal-Täuschung: Eine senkrechte Strecke erscheint immer länger als eine gleich lange waagerechte Linie. Ein geometrisch exaktes Quadrat wirkt eher wie ein Rechteck. Umgekehrt sieht ein Rechteck, dessen Grundseite nur weniger länger ist als die Höhe, wie ein Quadrat aus. (siehe Abb. 37 (1)); Müller-Lyer-Pfeiltäuschung (siehe Abb. 37 (2)); Figur-Umfeld- Einschätzung: z. B. erscheint ein Kreis umgeben von großen Kreisen kleiner als in der Umgebung von kleinen (siehe Abb. 37 (3)). Ponzo-Täuschung: Zwei gleich große Linien erscheinen im Kontext konvergierender Linien unterschiedlich groß, da wir die Figuren räumlich interpretieren. (siehe Abb. 38 (1 u. 2)) Poggendorff-Täuschung: Eine unterbrochene Linie kreuzt zwei senkrechte Parallelen. Diese wird nicht mehr als durchgehende Gerade wahrgenommen. Wir nehmen spitze Winkel im Allgemeinen größer wahr als sie sind. (siehe Abb. 38 (3)) Müller-Lyer-Täuschung: z. B. werden Linien umgeben von <- oder >-Zeichen unterschiedlich groß wahrgenommen. (siehe Abb. 38 (die letzten vier Abbildungen)) Korridor-Täuschung: gleich große Zylinder in einem perspektivisch angedeuteten Korridor (siehe Abb. 39). 35
36 Grundlagen der Gestaltung Geometrisch-optische Täuschungen - Übersicht der Relativität des simultan Wahrgenommenen Abb. 38 Kontraststeigerung bei Größen 2 Zum ersten Bild ganz oben: Die Hunde sehen verschieden groß aus (Ponzo-Täuschung); Die Wandleiste links unten ist nicht als Verlängerung der gegenüberliegenden Leiste oben rechts zu erkennen (Poggendorf-Täuschung); Die vordere Teppichkante erscheint kürzer als die Unterkante der Rückwand (Müller-Lyer- Täuschung). 36
37 Grundlagen der Gestaltung Geometrisch-optische Täuschungen - Übersicht der Relativität des simultan Wahrgenommenen Abb. 39 Kontraststeigerung bei Größen 3 Kontraststeigerung der Richtung Abb. 40 Kontraststeigerung der Richtung Kontraststeigerung der Textur Die gleiche Textur wird im Umfeld einer gröberen Textur feiner wahrgenommen und umgekehrt. 37
38 Grundlagen der Gestaltung Geometrisch-optische Täuschungen - Übersicht der Relativität des simultan Wahrgenommenen Abb. 41 Kontraststeigerung der Textur Kontraststeigerung der Helligkeit Eine Figur der gleichen Helligkeit wird im schwarzen Umfeld heller und im weißen Umfeld dunkler wahrgenommen. Abb. 42 Kontraststeigerung der Helligkeit Abb. 43 Umschlag einer Grauscala 38
39 Grundlagen der Gestaltung Form und Ästhetik - Wandel in der ästhetischen Rezeption Abb. 45 Kippfigur Zwei Quader Abb. 44 Kippfigur Elefant 1.5 Form und Ästhetik Wandel in der ästhetischen Rezeption Darstellungen von Menschen, insbesondere von Frauen, sind an gewisse moralisch-ethische Normen der gesellschaftlichen Rezeption gebunden. Etwas Schönes ist auch etwas Moralisch-Gutes. Lust und Sinnlichkeit sind moralisch eher negativ besetzte Begriffe. Die Natürlichkeit der Nacktheit als etwas Normales im Leben des Menschen gab es lange Zeit in der Geschichte der Malerei nicht. Jean-Auguste-Dominique Ingres ( ) war 83 Jahre alt als er Das türkische Bad (1863) malte. 39
40 Grundlagen der Gestaltung Form und Ästhetik - Wandel in der ästhetischen Rezeption Abb. 46 Jean-Auguste-Dominique Ingres - Das türkische Bad Edouard Manet ( ) malte 1863 Le déjeuner sur l'herbe : Da saß eine nackte Frau unter angezogenen Männern. Dies war wirklich eine Frau keine allegorische Gestalt wie die Sünde oder die Wollust. 40
41 Grundlagen der Gestaltung Form und Ästhetik - Wandel in der ästhetischen Rezeption Abb. 47 Edouard Manet - Frühstück im Freien Die Demoiselles d'avignon von Pablo Picasso ( ) markieren 1907 den Niedergang des klassischen Kunstverständnisses. Die grelle, aggressive Erotik zielte auf eine Welt der Deformation und der zerstörten Mythen. Das war der Beginn des Generalangriffs auf die Idealvorstellungen europäischer Kunst. Abb. 48 Pablo Picasso - Les Demoiselles d'avignon 41
42 Grundlagen der Gestaltung Form und Ästhetik - Wandel in der ästhetischen Rezeption Abb. 49 Fernand Léger - Femme en blue (1912) Kubismus. Auflösung der Naturform, Gestaltung nach einem klaren, vordefinierten Bildkonzept. Abb. 50 Lucio Fontana (1960) Die von ihm blutrot bemalte Leinwand schlitzte 1960 der italienische Maler mit dem Messer auf. Er hatte die alte Kunst der Illusionsmaler satt, die in räumliche Tiefen locken, wo keine ist. Ein Akt der Aggression. Abb. 51 Jackson Pollock - Gespinst: Nummer 7 (1949) Mit wirbelnden Farbspuren verwandelte der Amerikaner 1949 diese Leinwand. Abb. 52 Otto Muehl - Nahrungsmittelfest (1966) Muehl bot 1966 ein herausforderndes Happening. Bei dieser Aktion wirkten mit: Zwei Frauen, ein Schnuller, Watte, Wurst, Brötchen, Eier, Gemüse, Früchte und verschiedene süße Sachen. Die Zutaten richtete Zeremonienmeister Muehl auf durchlöcherter Leinwand zu einem Stillleben an, das aus dem Rahmen fällt. 42
43 Grundlagen der Gestaltung Zeichentheorie - Ferruccio Rossi-Landi: Theoretische Einführung Abb. 53 Bridget Riley - Katarakt III (1967) Abb. 54 Edward Kienholz - Landesbewahranstalt (1966) In dieser Anstalt sind Geisteskranke ohne Gesicht, ohne Hirn an ihre Pritschen gefesselt. Runde Aquarien füllen ihre Köpfe. Sie sind ausgemergelt. Eingewiesen für den Rest ihres Lebens. Kienholz nutzt den Schock, um gegen eine unmenschliche Psychiatrie zu mobilisieren. (Katarakt = 1 Ka ta rakt der; -[e]s, -e <gr.-lat.>: a) Stromschnelle; b) Wasserfall 2 Ka ta rakt die; -, - e: (Med.) Trübung der Augenlinse; grauer Star) 1.6 Zeichentheorie Kommunikation Wer sagt was zu wem, mit welchen Mitteln, unter welchen Umständen, mit welcher Absicht und mit welchem Erfolg? Ferruccio Rossi-Landi: Theoretische Einführung Semiotische Modelle Semiotik (= Theorie der Zeichen, Wissenschaft von den Zeichen überhaupt; Semiotiker sind Wissenschaftler, die Gestalt, Aufbau sowie Bedeutung und Wirkung von Zeichen systematisch untersuchen, um Regelsysteme von Zeichenprozessen aufstellen zu können.) Semiose, Zeichenprozess (= Jede Situation, in der etwas durch die Vermittlung eines Dritten von etwas, das nicht unmittelbar kausal wirksam wird, Notiz nimmt. Jeder Zeichenprozess ist ein Vorgang des mittelbar Notiznehmens. Die Semiose ist also der Vorgang, in dem etwas als ein Zeichen fungiert.) 43
44 Grundlagen der Gestaltung Zeichentheorie - Ferruccio Rossi-Landi: Theoretische Einführung Syntaktik (= Das Zeichen als formales Mittel. Es werden die Beziehungen der Zeichen untereinander untersucht, ohne Bedeutungsinhalte zu berücksichtigen, um Ordnungsregeln für Zeichensysteme aufstellen zu können.) Semantik (= Es werden die Beziehungen zwischen Objekt (Realität) und dem zu Bezeichnenden untersucht, um zu Regeln über Bedeutungsart und umfang eines Zeichens zu gelangen.) Zeichen Schon intuitiv unterscheiden wir zwischen natürlichen und künstlichen, (Rauch- und Verkehrszeichen) einfachen und komplexen, (Monem und Kunstwerk) menschlichen und nichtmenschlichen, (Brief oder Hundebellen) biologischen und gesellschaftlichen, (Fieber oder Artefakte) spontanen und intentionalen, (Erröten und Augenzwinkern) lautlichen und graphischen, (Papier oder Vorlesen) sowie verbalen und nichtverbalen Zeichen. Beispiel: Verkehrsschild künstliches, einfaches, menschliches gesellschaftliches, intentionales, graphisches und nichtverbales Zeichen Drei allgemeine Modelle Das Modell des Zeichens Basismodel der Linguisten von Saussure: Jedes Zeichen ist die vollzogene Synthese aus einem Signifikanten und einem Signifikat (Bedeutungsträger und Bedeutung). Es gibt keine Signifikanten ohne Signifikate. Anders: Zwei Dinge können in gewisser Weise zusammengehen, in ein Verhältnis zueinander treten, das eben jenes ist, durch welches sich die Totalität namens Zeichen konstituiert. Zeichen bilden auch Systeme Das Modell der Nachricht Modell der Informationstheorie von Shannon und Weaver (1949): Es geht nicht vom Zeichen aus, sondern von der Nachricht, also von einem Bedeutungssystem, das sich effektiv übermitteln lässt und, falls dies geschieht, besser Signal genannt wird. Das Zeichen verwandelt sich zur Nachricht und diese zum Signal Sender, Empfänger, gemeinsamer Kode sowie Kanäle Die Nachricht wird vom Sender kodifiziert und vom Empfänger entkodifiziert. Am Zielpunkt angelangt, wird das Signal wieder zur Nachricht, und diese wird wieder in Zeichen zerlegt. Redundanz: nicht notwendiger Teil einer Nachricht In der Nachricht ist zweierlei zu unterscheiden: ihre Informationsmenge und ihre Bedeutung signifikante Informationsmenge Das Modell der Semiose Charles S. Peirce und Charles Morris Semiose (Zeichensituation): wenn etwas als Zeichen eines anderen Etwas für ein drittes Etwas fungiert: 44
45 Grundlagen der Gestaltung Zeichentheorie - Ferruccio Rossi-Landi: Theoretische Einführung 1. Etwas: Der Träger: Ein Objekt, das den Charakter eines Zeichens annimmt. Im Falle der verbalen Spräche wäre dies der artikulierte Laut. 2. Etwas: Das worauf das Zeichen referenziert, wofür es steht. (Die Referenz des Wortes Wasser ist nicht das Wasser selbst. Es gibt aber auch Referenzen auf Dinge, die im gewissen Sinne nicht existieren. 3. Etwas: Interpret oder Nutznießer des Zeichens sowohl in der Position des Senders als auch des Empfängers. (Mensch, Tier oder Maschine) Außerhalb der Semiose gefasst, wird der Zeichenträger zum bloß physischen Objekt degradiert. Ein Verkehrszeichen ist bloß ein Stück bemaltes Blech. Die Totalität ist die Semiose (Semiose: Die Zeichensituation im Allgemeinen. Gegenstand der Semiotik: D. h. der Prozess der Wirkungsentfaltung eines Zeichens (Wikipedia), also der Verstehensprozess eines Zeichens (Encarta 2002) Außerhalb der Semiose wird der Zeichenträger zum bloss physischen Objekt, der Interpret zum bloßen Organismus oder zur Maschine. Die Semiose ist Totalität, weil außerhalb ihr, alle Objekte keine Bedeutung haben In welchem Verhältnis stehen die drei oberen Modelle zueinander? Das Modell des Zeichens beschreibt die innere Struktur der Einheiten, die zum Bau von Nachrichten verwendet werden, aber es vernachlässigt die Realität der Nachrichten selbst und die Situationen, in denen Nachrichten auftreten. Das Modell der Nachricht beschreibt den Gang der Information, vernachlässigt aber die innere Struktur der Nachricht sowie die Situationen. Das Modell der Semiose beschreibt die biologische und soziale Situation, in der die Zeichen auftreten, aber es vernachlässigt den Gang der Nachricht. Indessen versteht sich eine richtig gefasste Semiotik als Teil einer umfassenden Wissenschaft vom Menschen und seinen Beziehungen zum Rest der Welt. Ein Zeichen funktioniert als Zeichen nur, wenn seine Bedeutung vorher mit dem Empfänger der Nachricht vereinbart wurde. Das zeigt das folgende Beispiel in Abb. 55 Juli Gudehus Bibelpiktogramme. 45
46 Grundlagen der Gestaltung Zeichentheorie - Ferruccio Rossi-Landi: Theoretische Einführung Abb. 55 Juli Gudehus Bibelpiktogramme 46 Die Kölnerin Juli Gudehus hat den Schöpfungstext der Bibel in die Sprache heutiger, moderner Piktogramme übersetzt. Dies zeigt, dass es möglich ist sprachliche Inhalte durch bildorientierte Zeichen zu ersetzen.
47 Grundlagen der Gestaltung Zeichentheorie - Theoretische Strukturen Theoretische Strukturen Bestandteile einer allgemeinen Semiotik (Zeichentheorie) Abb. 56 Bestandteile einer allgemeinen Semiotik 47
48 Grundlagen der Gestaltung Zeichentheorie - Theoretische Strukturen Elemente der Sprache und ihre zeichentheoretischen Aspekte Abb. 57 Elemente der Sprache und ihre zeichentheoretischen Aspekte Zeichen als formale Mittel (Syntaktik) Zwei Aspekte von Beziehungen machen die Qualität eines Zeichens aus: Zeichen sind ohne die Objekte, die sie bezeichnen, nicht denkbar, denn es gibt keine Nachricht ohne Inhalt. Das Zeichen ist eine übertragene Wirklichkeit, es stellt einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit dar, ist aber nicht gleichzusetzen mit der wirklichen Wirklichkeit. Es repräsentiert einen Teil der Wirklichkeit. Ein Zeichen wird von einem Sender gesendet und von einem Empfänger empfangen. Sender und Empfänger bestimmen den Zeicheninhalt. Visuelle Zeichen besitzen stets eine Form besitzen eine ihnen eigene Helligkeit und Farbe bestehen aus einem bestimmten Material können auch als Bewegung vorkommen. Sie unterscheiden sich u. a. durch zunehmende Komplexität in oben dargestellter Reihenfolge Zeichen als Bedeutungsträger (Semantik) Die Semantik fragt nach der Bedeutung visueller Zeichen. 48
49 Grundlagen der Gestaltung Zeichentheorie - Theoretische Strukturen Abb. 58 Alltägliche Objekt als Zeichen Auch alltägliche Objekte können Zeichenfunktion übernehmen. Architekturobjekte und andere technische Geräte, Maschinen und Systeme besitzen ohnehin Zeichencharakter. Sie sind nicht nur Gerät, Maschine oder Haus, sonder repräsentieren zugleich ihre Besitzer mit ihrem soziokulturellen Umfeld und weisen also über sich hinaus auf etwas hin Das Verhältnis von Zeichen und Bezeichnetem (Sigmatik) Die Sigmatik untersucht den allgemeinen Objektbezug zwischen Zeichen und Bezeichnetem. Um dieses Verhältnis zu bestimmen, teilt man die Zeichen in drei Kategorien ein: Ikon (griech. Bild, Abbild) Index (lat. Anzeiger) Symbol (Wahrzeichen, Sinnbild) Nebst diesen drei Kategorien untersucht die Sigmatik als vierten Aspekt die Ausdrucksqualität des Zeichens. Das Zeichen als Ikon Ein Zeichen, das einen gewissen Grad der Übereinstimmung mit seinem Objekt aufweist, indem es diese abbildet oder imitiert, nennt man Ikon. Visuelle Zeichen dieser Art sind abbildhafte Fotografie, gegenständliche Darstellung der Malerei und Graphik, Plastik, aber auch Diagramme, Modelle und Schemata. 49
50 Grundlagen der Gestaltung Zeichentheorie - Theoretische Strukturen Abb. 59 Ikonen-Beispiele 1 Andy Warhol, Marcel Duchanmp, Schema eines Senders, Spielzeugflugzeug Das Zeichen als Index Das Zeichen als Index bezieht sich als Hinweis oder als Anzeiger auf das Bezeichnete. Indizes sind Orientierungshilfen: Jede Beschreibung, Unterscheidung oder Dokumentation von Sachverhalten ist auf Indizes angewiesen wie beispielsweise Landkarten, Stadtpläne, Konstruktionszeichnungen, Lagepläne usw. Solche Indizes sind umso glaubwürdiger, je mehr Indizes auf Einzelheiten und Besonderheiten des Objekts verweisen, wobei das Einmalige und Unverwechselbare des jeweiligen Sachverhalts hervortritt. Indizes sind wie ihre Objekte orts- und zeitgebunden. Das Zeichen als Symbol Symbole haben keinen direkten Bezug zu ihren Objekten, denn sie bezeichnen ihre Objekte vielmehr aufgrund einer Absprache, nicht aber mit Rücksicht auf das Objekt selbst. Während die Objekte der Indizes und Ikonen konkrete Dinge sind, beziehen sich Symbole auf abstrakte Begriffe. Symbole repräsentieren stets das Allgemeine, Ikone und Indizes dagegen das Individuelle. 50
51 Grundlagen der Gestaltung Zeichentheorie - Theoretische Strukturen Abb. 60 Symbol-Beispiel 1 Im Vergleich zu den Verkehrszeichen für Fahrzeuge aller Art sind die Verbotszeichen für Radfahrer nur abgeleitete Symbole. Wenn dieses Symbol an Ort und Stelle steht, ist es jedoch ein Index. Das Zeichen als Ausdrucksqualität Mit den drei obigen Kategorien ist die dingliche wie auch die abstrakte Wirklichkeit durch Zeichen erfasst. Doch Zeichen können auch den Bereich der Gefühle unmittelbar zum Gegenstand haben. Unsere Reaktionen auf das Aussehen von Zeichen ist stets ähnlich, häufig sogar gleich, wenn man das Geschmacksurteil außer Acht lässt. Beispiele für Gefühlsreaktionen sind: ruhige oder bewegte Formen (senkrecht, waagerecht kurvenförmig); kalte, warme Farben. Die Zuordnung von Ausdrucksqualitäten ist nur im jeweiligen Bedeutungszusammenhang möglich: waagerechte und senkrechte Richtungen standen in der klassizistischen Architektur für Schlichtheit, Vornehmheit, Zurückhaltung und Ausgewogenheit; im Nationalsozialismus standen sie für despotische Strenge, künstlerische Kargheit oder Banalität. Das Geschmacksurteil verzerrt jedoch die Ausdrucksqualität: Ob eine Form oder Farbe als schön oder hässlich empfunden wird, scheint Geschmacksache zu sein. Das Geschmacksurteil wird jedoch nicht nur von der Individualität des Einzelnen bestimmt, sondern in starkem Maße von der jeweiligen Gesellschaft, was sich u. a. die Werbung zu Nutze macht Anwendung und Zweck der Zeichen (Pragmatik) Zeichen sind nicht Selbstzweck. Zeichen werden eingesetzt um Nachrichten weiterzugeben. Nachrichten lösen wiederum Handlungen aus, beeinflussen Verhaltensweisen und Meinungen, geben Denkanstöße und verändern die Gefühlslage der Nachrichtenempfänger. Zeichen haben also stets zielgerichtete, praktische oder pragmatische Bedeutungen. Verschiedene Wirkungen auf den Empfänger: Imperative Wirkung: Zeichen können den Willen des Nachrichtenempfängers beeinflussen Suggestive Wirkung: können auf das Gefühl gerichtet sein Indikative Wirkung: hauptsächlich das Denken ansprechen. 51
52 Grundlagen der Gestaltung Zeichentheorie - System der visuellen Kommunikation Abb. 61 Beispiel für die Wirkung von Zeichen System der visuellen Kommunikation Kommunikationsschema Abb. 62 Kommunikationsschema Der Vorgang der Nachrichtenübermittlung Kommunikation ist Zeichenaustausch zwischen Sender und Empfänger. Dieser Vorgang ist äußerst kompliziert, weil alle oben genannten Faktoren dabei in Wechselbeziehung treten, so dass die Vorstellung von beständigen, statischen Größen in diesem Zusammenhang fehl am Platz ist. 52
53 Grundlagen der Gestaltung Zeichentheorie - System der visuellen Kommunikation Bedingungen des Zeichenrepertoires Das der Zeichenvorrat erst erworben werden muss, hängt die Aneignung eines Zeichenvorrates von verschiedenen Faktoren ab: Herkunft, ländliche oder städtische Herkunft, Arbeiter- oder Akademikerfamilie Ausbildungsstand, gesellschaftliche Stellung; sind geographisch und politisch, nach Altersstufen und Geschlechtszugehörigkeit sehr unterschiedlich Generationszugehörigkeit, Kind oder Erwachsener, Mann oder Frau Besitzverhältnisse, wirtschaftliche Grundlagen Individualität, unterschiedliche geistige Fähigkeiten Kommunikationsbereitschaft Wenn der Empfänger bereit die Form der Nachricht missbilligt, ist hier ebenfalls eine Inkongruenz zw. Sender und Empfänger vorhanden. Aus der Kunstgeschichte ist bekannt, dass neue Zeichenrepertoires immer wieder auf Ablehnung gestoßen sind. Die nachträgliche Wertschätzung progressiver Kunst ist aber nicht darauf zurückzuführen, dass moderne Kunstformen inzwischen verstanden werden; man hat sich lediglich an sie gewöhnt. Eine mögliche Erklärung ist, dass die Natur des Menschen auf Neues, Fremdes stets mit Misstrauen, ja sogar Furcht und Feindschaft reagiert. Aus diesen Erfahrungen können wir für die Kommunikation die Lehre ziehen, dass diese in Form und Inhalt nur in begrenztem Maße unerwartete Neuigkeiten enthalten darf, weil andernfalls die Kommunikationsbereitschaft des Empfängers darunter leidet. [Anm.: Wirklich? Hat sich das nicht durch die zunehmende Medialisierung der westlichen Zivilisation geändert, in dem wir aufgrund eines Informationsüberflusses nur noch auf extrem originelle Kommunikationsinhalte und formen reagieren, nur noch diese besonders beachten, da der große Rest aufgrund der zwangsläufigen Filterung der Wahrnehmung in Bedeutungslosigkeit versinkt.] Rückkopplung Auch wenn dem Sender durch vorausgegangene genaue Ermittlungen der Zeichenvorrat des Empfängers weitgehend bekannt ist, kann es dennoch sein, dass situationsbedingt die Verständigung abreißt. Wenn dies nun unbemerkt bleibt, fehlt die Verständigungsbasis für die nachfolgende und darauf aufbauende Information Der Kommunikationsvorgang ist eigentlich ein Lern- bzw. Lehrprozess. Am Beispiel Lehrer Schüler wird dies deutlich, denn wenn die Rückfragemöglichkeiten der Schüler begrenzt oder gar nicht vorhanden wäre, dann wäre der Lernerfolg entsprechend behindert Zusammenfassung Das Kommunikationsschema ermöglicht die Analyse und Kommunikationsplanung Kommunikation ist Zeichenaustausch Kommunikationsfaktoren sind wechselseitig voneinander abhängig Das Zeichenrepertoire des Empfängers ist durch sein soziales Umfeld bestimmt und entscheidet über den Kommunikationserfolg des Senders Die gesellschaftliche bedingte Ästhetik des Zeichens entscheidet zusätzlich den Kommunikationserfolg. Kommunikation sollte dem Empfänger die Möglichkeit der Rückkoppelung geben, so dass der Empfänger zum aktiven Sender wird usw., so dass der der ursprüngliche Sender seine Nachricht an die Verständigungsmöglichkeiten und Verständigungsbereitschaft des ursprünglichen Empfängers anpassen kann. 53
54 Grundlagen der Gestaltung Zeichentheorie - Zeichenbereich Form Da sich der Empfänger bei der Kommunikation neue Zeichen und neue Kenntnisse aneignet, ist der Kommunikationsprozess auch ein Lehr- bzw. Lernprozess Zeichenbereich Form Semiotik der Form Syntaktik Pragmatik Semantik Ausdrucksqualität z. B. z. B. Zeichen für: Formdimension Punkt Interpunktion Ende eines Satzes Bestimmtheit Linie Geometrie Grenze streng Fläche Geografie Stadt auf der Landkarte Ausdehnung Körper Panoptikum Mensch Imitation Raum Wohnung Persönlichkeit Geborgenheit Formbegrenzung Leerform Architekturzeichnung Bauelemente Nüchternheit Füllform geografische Karte Höhenlage Vielfalt Vollform Plakate Konsumgüter aufdringlich Konturschärfe Fotografie Nähe genau Konturunschärfe Landschaftsmalerei Ferne ungenau Geschlossene Form physikalische Darstellung Stromkreis Endgültigkeit Offene Form flüchtige Skizze Bewegungsvorgänge unfertig Formqualität Rund Karikatur Weiblichkeit weich Eckig Architektur Zweckhaftigkeit hart Regelmäßig Heraldik Geschlecht feierlich Unregelmäßig Naturpark liberale Auffassung ungebunden Freispielend Fasching Ungezwungenheit dynamisch 54
55 Grundlagen der Gestaltung Zeichentheorie - Zeichenbereich Form Syntaktik Pragmatik Semantik Ausdrucksqualität Formquantität Groß Propaganda Sieg Monumentalität Klein Umgebung Vorgartenzwerg niedlich, drollig Formverwirklichung z. B. Konstruieren Technik Maschinenteile rational, kalt z. B. Schmieren Provokation Protest dreckig, brutal z. B. Kritzeln als Kompensation Zeichen für irgendetwas nervös, unbewusst Allgemeine Gesichtspunkte zur Form Formen können nur dann Nachrichten vermitteln, wenn ihr jeweiliger Bedeutungsinhalt zwischen Sender und Empfänger vorher vereinbart wurde Nachrichten können sehr verschieden sein. Es braucht deshalb viele, unterschiedliche Formen, um die unterschiedlichen Absichten einer Aussage verdeutlichen und mitteilen zu können. Beim Entwurf neuer Zeichen muss vor allem auf ihre Unverwechselbarkeit geachtet werden. Sie müssen sich zudem von ihrer Umgebung eindeutig abheben, da sie sonst möglicherweise nicht wahrgenommen werden. Die Umgebung wiederum ist selber Form; wir haben es deshalb immer mit zwei Formen zu tun, wenn wir visuelle Nachrichten gestalten: Nämlich mit der gemeinten Form, die unsere Nachricht enthält und die nicht gemeinte Form als Kontrast dazu. Beide Formen sind wechselseitig voneinander abhängig. Kommunikation setzt Wissen und Gefühl voraus. Sie ist einerseits objektiv und subjektiv und auf der anderen Seite rational und emotional. D. h. in der Kommunikation eingesetzte Formen sind als Form objektiv beschreibbar, sind aber auch subjektivem Geschmack unterworfen. Das Kommunikationsereignis selber ist rational erfassbar und kann zusätzlich emotionale Folgen haben. Formuntersuchungen können also auf subjektiv-individuellen Normen basieren und/oder von allgemeingültigen, objektiven Gesichtspunkten ausgehen. Zum Beispiel kann über eine Form ausgesagt werden, sie sei hässlich und eckig. Die objektive Formbeschreibung eckig ist nachvollziehbar, wohingegen das Geschmacksurteil umstritten ist. 55
56 Grundlagen der Gestaltung Zeichentheorie - Zeichenbereich Form Abb. 63 Pablo Picasso - Orangefarbener Hut/Marie-Thérèse Walter Das Porträt links lebt vom Kontrast runder geschwungener Formen und senkrechter resp. waagerechter Richtungseinbettung. Das Porträt rechts ist mit eckigen Formen aufgebaut. Die gefühlsmäßige Wirkung ist abhängig vom subjektiven Geschmacksempfinden. Abb. 64 Schema der Formaspekte Wir untersuchen die Aspekte der Form nach folgenden Kriterien: Semiotik Syntaktik der Form Semantik der Form Pragmatik der Form 56
57 Grundlagen der Gestaltung Zeichentheorie - Zeichenbereich Form Sigmatik (Verhältnis der Form als Nachrichtenträger zur Nachricht selbst.) Ikon Index Symbol Formen, die Objekte abbilden Formen mit unmittelbarer Beziehung zu den Objekten (z. B. Ortsschilder) Formen, die aufgrund von Übereinkünften Objekte vergegenwärtigen (z. B. die Taube als Symbol für Frieden) Form-Qualität Syntaktik Formqualitätskontraste rund eckig geometrisch freispielend symmetrisch asymmetrisch regelmäßig unregelmäßig einfach komplex geschlossen offen weich hart präzis unpräzis vollständig unvollständig Ausdruck [Emotion] Syntaktische Veränderungen von Form- Qualitäten haben stets inhaltliche Konsequenzen und umgekehrt. Daher eignen sich Formen sehr gut als Auslöser von Stimmungen und Gefühlen. Semantik [Bedeutungsträger] eckig, geometrisch Strenge und Rationalität rund, freispielend auflockernde Wirkung (siehe Abb. 65 und Abb. 66) Form-Quantität Syntaktik Form- Quantitätskontraste Größenbestimmungen sind stets relativ, also Bezugsgrößen. Für die syntaktische Größenbestimmung von Formen kommen als Bezugsgrößen in Frage: Die Negativform, eine andere Positivform, Positivform und Negativform, der Betrachter selbst oder ein Vorbild: gross klein viel wenig dick dünn Ausdruck Form- Quantität Wichtigkeit, Räumlichkeit, Genauigkeit und Größe 57
58 Grundlagen der Gestaltung Zeichentheorie - Zeichenbereich Form Semantik Größenkontraste z. B. in der mittelalterlichen Malerei, um Heilige von profanen Figuren der Wichtigkeit nach zu gewichten (siehe Abb. 67) Form- Dimension Syntaktik Form- Dimensionen Ausdehnungsproportionen von Formen im räumlichen Bezugssystem: Punkt ungerichtete Form, die im Verhältnis zur Negativform verschwindend klein ist. Linie weisen nur einen Richtungsbezug auf und erscheinen unbegrenzt. Lineare begrenzte Formen sind Strecken. Fläche unbegrenzt erscheinende Formen, die Richtungsbezüge in Länge und Breite aufweisen. Figuren dagegen sind begrenzte zweidimensionale Formen. Körper/Raum Dreidimensionale Formen werden als Körper resp. Raum bezeichnet. Ausdruck Punkt = (rund oder eckig) die kleinste ausgefüllte grafische/malerische Einheit Linie = durch Aneinanderreihung von Punkten ohne Abstand, mehr oder geringem Abstand als Begrenzung, Umriss oder Kontur einer Form Fläche = runde oder eckige, leere oder ausgefüllte, geometrische oder freigestaltete zweidimensionale Form, auch dreidimensional wirkende Formen Körper/Raum = dreidimensionale, vollplastische, körperlich fassbare Formen, je nach Größe auch begehbar, durch Länge, Breite und Höhe definiert oder informierend Semantik Wahrnehmbarkeit der Formdimensionen Formen verlieren an Eindruckskraft, sobald man ihre Dimensionen reduziert, z. B. den räumlichen Abstand zu ihr vergrößert, wodurch sich ihre Dimension verkleinert. (Das erklärt auch, warum die abstrakte Kunst in Graphik und Malerei für die Allgemeinheit viel umstrittener ist als die abstrakte Plastik: körperhafte Formen beeindrucken mehr als flächenhafte, lineare.) 58
59 Grundlagen der Gestaltung Zeichentheorie - Zeichenbereich Form Form- Begrenzungen Syntaktik Formbegrenzungstypen Leerform: Die Positivform kann linear begrenzt sein, somit ist ihre Binnenform mit der Negativform identisch. Füllform: Die Positivform kann auch durch Addition einzelner Formelemente gebildet werden, was die Gesamtform zu einer Summe von Einzelformen macht. Vollform: Die Positivform ist weder linear abgegrenzt noch aus einer Anhäufung von Zeichen bestehend, sondern ein in sich geschlossenes Gebilde. Konturschärfe: Der Übergang von der Positiv- zur Negativ kann konturscharf oder unscharf gestaltet sein. (siehe Abb Abb. 74) Ausdruck Ausdrucksqualität Alle Formkategorien wirken zugleich, wenn auch mit jeweils unterschiedlicher Intensität, auf den Betrachter ein. Konturschärfe = streng, hart, bestimmt Konturunschärfe = weich, vage Füllform = Lebendigkeit Leerform = Zurückhaltung, Nüchternheit Vollform = Ausdrucksstärke mit Präzision Semantik Die Füllform ist geeignet scheinräumliche und scheinkörperhafte Eindrücke zu vermitteln. (siehe Abb. 75) Form- Verwirklichung Syntaktik Die Form-Verwirklichung ist ein gestalterischer Vorgang, bei dem Nachrichteninhalte mit visuell oder haptisch erfahrbaren Materialien verwirklicht werden. Bei dieser Umsetzung der Vorstellung in sichtbare Formen verändern sich zwangsläufig die jeweils vorgestellten Nachrichteninhalte. Die Eigengesetzlichkeit von Gestaltungsmaterialien und spezifischen Verfahren haben auf die Erscheinungsform eine prägende Funktion. (siehe Abb Abb. 79) Ausdruck Formverwirklichungsarten sind nicht ohne weiteres austauschbar, sondern sind an die jeweilige Informationsabsicht gebunden. Daher ist es möglich, 59
60 Grundlagen der Gestaltung Zeichentheorie - Zeichenbereich Form bereits von der jeweiligen Bildtechnik auf die Bildabsicht zu schließen und darüber hinaus auf das Weltbild des Autoren. Semantik Die Erfindung neuer Formverwirklichungsarten fällt stets mit soziokulturellen, wissenschaftlichen, technischen und politischen Veränderungen zusammen. Abb. 65 Formbeispiel für hart, kantig, spitz/für eckig, präzis Abb. 66 Formbeispiel für rund, weich 60
61 Grundlagen der Gestaltung Zeichentheorie - Zeichenbereich Form Abb. 67 Gentile de Fabriano - Madonna mit Kind zwischen den Heiligen Nikolaus und Katharina (um 1390) Abb. 68 Beispiel für Punkt: Japanischer Scherenschnitt Abb. 69 Beispiel für Linien: Japanischer Scherenschnitt 61
62 Grundlagen der Gestaltung Zeichentheorie - Zeichenbereich Form Abb. 70 Camille Graesser - Ohne Titel (Beispiel für Flächen) Abb. 71 Beispiel Leerform Abb. 72 Beispiel Füllform Abb. 73 Beispiel Vollform Abb. 74 Beispiel konturscharf Abb. 75 Jean Pierre Velly - Trinità dei monti (1968) 62
63 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Zeichenbereich Form Abb. 76 Ambroise Vollard berühmter Kunsthändler und Galerist in Paris, eröffnete als erster am 24. Juni 1901 eine Ausstellung mit Bildern von Pablo Picasso, der damals noch nicht 20- jährig war. Abb. 77 Pablo Picasso ( ) - Ambroise Vollard (1910) Abb. 78 Pablo Picasso - Ambroise Vollard (1915) Abb. 79 Pablo Picasso - Ambroise Vollard (1937) 1.7 Kompositionslehre Definition Komposition ist das Ordnen und Zusammenstellen von einzelnen Elementen zu einem einheitlichen Ganzen auf einer vorgegebenen Darstellungsfläche. Die klassische Kompositionslehre umfasst die Bereiche Maß, Gewicht und Qualität. Das Maß umfasst alle messbaren Elemente, das Gewicht z. B. Schwarz-Weiß-Gewicht, Grauwerte, Licht- und Schattenbereiche, Oberflächentexturen etc., die Qualität z. B. Farbharmonie, Akkorde, Kontraste, Farbempfinden, Farbpsychologie, Farbe und Raum etc. Neue Gliederung der Kompositionslehre nach Prof. Velter: 2-dimensionale Formlehre 3-dimensionale Formlehre Farbenlehre 63
64 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Die bildnerische Form Harmonie und Hierarchie Jede Hierarchie zerstört bewusst die absolute Harmonie, jedoch benötigt man eine versteckte Harmonie, um nicht durch bloße Spannung eine Ablehnung zu bewirken. Für diese Gratwanderung benötigt der Gestalter Kenntnisse über die Kompositionselemente. Abb. 80 Bsp. für absolute Harmonie - Schachbrett und Ying & Yang Alle Formen und Gewichte befinden sich im Gleichgewicht. Alle Spannungsfelder heben sich auf. Keine Dynamik, Bewegung; nur Ruhe und geistige Konzentration Prinzip = Symmetrie (Punkt- und Achsensymmetrie, siehe Abb. 81). Evtl. Gültigkeit im Gestaltungsbereich Dekor, aber bestimmt nicht in der visuellen Kommunikation Abb. 81 Bsp. Punkt- und Achsensymmetrie Abb. 82 Bsp. für Hierarchie Jede Hierarchie zerstört bewusst die absolute Harmonie trotzdem muss jede Gestaltung einem Harmonieprinzip genügen, um nicht unerträgliche Spannungen zu erzeugen, die zur Nichtbeachtung führen können. Diesen Ausgleich erzielt man mit Kontrapunkten und wir versteckte Harmonie genannt. 64
65 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Abb. 83 Bsp. Versteckte Harmonie Für diese Gratwanderung zwischen Spannung und versteckter Harmonie brauchen wir Kenntnisse über die Wirkungen und Zusammenhänge der einzelnen Kompositionselemente Format Abb. 84 Formate Formate sind leere (bedrohliche) Flächen, die natürlich auch die gleichen Aussagen wie die entsprechenden Flächen haben. 1. Hochformat Charakter: konzentriert, aufmerksam bis modisch, extravagant. Themen: Wolkenkratzer, stehender Mensch, 2. Breitformat: Charakter: ruhend, weitschweifig. Themen: Landschaft, liegender Mensch, 3. Quadrat: Charakter: neutral, unentschlossen. Themen: wie Hoch- und Breitformat. 4. Dreieck: Charakter: richtungsweisend, auffallend bis aggressiv. Themen: Warnschilder, Hinweise, 5. Kreis: Charakter: introvers, kein Oben und Unten. Themen: Aufkleber, Formate im Bereich Digitale Medien : Früher galt das Format 4:3, ist jedoch nicht mehr zeitgemäß. Heutige Fernseher und Monitore haben ein Format von 1,6:1 bzw. 1:0,625; was näherungsweise dem Goldenen Schnitt entspricht. Moderne Digitalkameras unterstützen ebenfalls dieses Breitbildformat. Das Kinoformat ist noch breiter. Mittlerweile gibt es erste Fernsehmodelle, die auch dieses Format unterstützen. 65
66 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Kompositionsraster Abb. 85 Kompositionsraster Hilfslinien Unter einem Kompositionsraster versteht man Hilfslinien, die ein Format einteilen und organisieren. Abb. 86 Kompositionsraster Hilfslinien Eine Linie unterteilt ein Format in zwei Flächen, die sich gegenseitig beeinflussen groß-klein, spitz-stumpf, rund-eckig etc. Unterteilungen verändern den Charakter eines Formats aus Breit- wird Hochformat, Verstärkung des Breitformats etc. Abb. 87 Kompositionsraster - Halbierung, Drittelung und Mischform sind typische Rasterteilungen. Je mehr Unterteilungen man vorgibt, desto straffer und damit statischer wird die Komposition. Bei den Schnittpunkten bilden sich Schwerpunkte bzw. Fixpunkte für das Auge. Idealraster: Die horizontale Drittelung entspricht dem Prinzip Vorder-, Mittel- und Hintergrund; eine vertikale Drittelung entspricht Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Eine Formatunterteilung kann funktionale (Buchseite in Titel, Textblock, Bild, Kopf- und Fußzeile) und gestalterische (Plakat in eine Rangordnung nach was, wer, wann, wo und Blickfang) Gründe haben. 66
67 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Bildnerische Elemente Punkt Die gestalterischen Grundelemente sind: Punkt, Linie, Fläche. Das kleinste Formelement ist der Punkt. Auch wenn ein Punkt sich ausdehnt, bleibt er Punkt. Der Punkt ist nicht formgebunden. Er kann aus einem Kreis, Dreieck, Quadrat oder deren Mischformen bestehen. Abb. 88 Punkt und Fläche Die Aufgabe eines Punktes in der Fläche: Er ist der Ort, der Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der Punkt an sich ist passiv. Erst im Bezug zur Fläche wird ein Spannungsfeld erzeugt. Dieses Spannungsfeld kann Ruhe, Dynamik, Aggression etc. ausstrahlen. Bei mehreren Punkten können sich die Spannungsfelder verstärken, abschwächen oder aufheben. Abb. 89 Punkt und Kontrapunkt Der Kontrapunkt löst die Spannung, er schafft eine verborgene Harmonie. Das Auge sucht förmlich nach einem Ausgleich des Schwerpunktes. 67
68 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Abb. 90 Focal Points nach Jack Hamm Jack Hamm spricht in Drawing Scenery von Focal Points (Fokuspunkten). Abb. 91 Focal Area nach Jack Hamm Punkt und Kontrapunkt, Fokuspunkt, wie auch immer man es nennen kann, haben eine besondere Gewichtung bei der Gestaltung eines Bildes und können sich zu Focal Areas ausweiten. Anordnung von Punkten Abb. 92 Punkt - Anordnung 1 1. Durch das Aneinanderreihen von Punkten entsteht eine Linie. 2. Durch das gleichmäßige Anordnen von Punkten entsteht ein Rasterverband. 3. Gleichmäßiges Aneinanderreihen von Punkten: die Punkte berühren sich. 4. Durch die versetzte Anordnung wird die Fläche dichter. Abb. 93 Punkt - Anordnung 2 1. Durch das Überschneiden der Punkte entsteht eine starke Verdichtung der Fläche 2. Anordnung der Punkte wie in Abb. 92/3 Der noch vorhandene Zwischenraum wird mit Punkten ausgelegt. Dadurch wird die Fläche sehr dicht. Die zwei verschiedenen Punktgrößen ergeben einen Wechsel von groß klein. 3. Stufung der Punkte von klein nach groß. Von unten nach oben ist dicht locker oder schwer leicht feststellbar. Bei einer solchen Abstufung spricht man von einer Progression. 4. Durch die gleichmäßige Veränderung der Punktgröße tritt eine Verdichtung nach außen ein. 68
69 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Abb. 94 Punkt - Anordnung 3 1. Anordnung der Punkte von groß nach klein im Wechsel von links nach rechts und umgekehrt. Die Fläche wirkt ausgeglichen 2. Verdichtung und Auflockerung 3. Die Punkte sind schematisch angeordnet von groß nach klein und umgekehrt. Es entsteht eine Bewegung von innen nach außen und umgekehrt. 4. wie 3 Abb. 95 Punkt - Anordnung 4 1. Anordnung der Punkte in Kreisform, wobei sich die Punkte nach innen oder außen verkleinern. Es entstehen dekorative Flächengliederungen. 2. wie 1 3. Die Punkte werden zur Mitte hin immer kleiner. Durch die Größenveränderung entsteht eine Verdichtung, welche die senkrechte Mittelachse betont. 4. Punkte in gleicher Größe, positiv und negativ. Die weißen Punkte treten optisch hervor, die schwarzen zurück, außerdem ist eine Bewegung von rechts oben nach links unten festzustellen. 69
70 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Abb. 96 Punkt - Anordnung 5 1. Punkt in drei verschiedenen Größen 2. Wechselndes Spiel zwischen verschiedenen Punktgruppen 3. Streuung von großen und kleinen Punkten 4. Punkte in verschiedenen Größen mit waagerechter Betonung 5. Gleichrhythmische Reihung 6. Verdichtung innerhalb der Reihung 7. Gleichrhythmisch mit Richtungsänderung 8. wie Linie Sie ist das Urbild des Eindimensionalen. Die Linie ist ein bewegter Punkt und damit ein aktives Element, mit einem Zeitfaktor, einem Anfang und Ende (Die Linie ist der Spaziergang eines Punktes, sie erzählt (Paul Klee: Pädagogisches Skizzenbuch)) (Leserichtung). Der Charakter der Linie Abb. 97 Charakter der Linie 1. Die Gerade ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten. Die Waagerechte: liegend, ruhend, entspannt. 2. Die Senkrechte: stehend, aufgerichtet, konzentriert. 3. Die Diagonale: richtungsweisend, aggressiv 4. Die Gebogene: gespannt, dynamisch, explosiv. Verlauf gerade gekrümmt gebrochen 70
71 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Linien können: verbinden teilen gliedern umreißen unterteilen begrenzen Verhalten treffen überkreuzen überschneiden gabeln Ausdehnung kurz lang Ausbreitung dünn fein an- bzw. abschwellend dick breit Anordnung der Linien Eine Linie zeigt immer einen bestimmten Richtungsverlauf. Die senkrechte Linie kann man als aufstrebend und aktiv bezeichnen, sie drückt eine gewisse Standhaftigkeit und Aktivität aus. Abb. 98 Linie - Anordnung senkrecht 1 1. Gleichmäßige Wiederholung der senkrechten Linie 2. Durch die Verringerung der Linienabstände wirkt die Fläche verdichtet. 3. Wiederholung der senkrechten Linie mit dreimaliger Verengung der Abstände. 4. Wiederholung von dünnen und dicken Linien. Die Abstände sind gleich. 71
72 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Abb. 99 Linie - Anordnung senkrecht 2 1. Progressive Verengung der Abstände. Dadurch entsteht ein Bewegungsablauf von links nach rechts oder von hell nach dunkel. 2. Wiederholung der progressiven Abstände. Dadurch werden Steigerung und Abschwächung spürbar. 3. Durch die Verringerung der Linienabstände von außen nach innen entsteht eine auf die Mittelachse orientierte Verdichtung. 4. Die progressiven Linienabstände bewirken eine Betonung der rechten und linken Seite, dadurch ist ein Bewegungsablauf von innen nach außen entstanden. 5. Durch die progressive Veränderung der Linienabstände entsteht ein Ablauf von hell nach dunkel oder von locker zu dicht. 6. Linienbündel mit ungleich gestuften Zwischenräumen. 7. Linien paarweise oder einzeln. Die linke Seite wirkt dichter, die rechte lockerer. 8. Die Linienabstände eng breit wiederholen sich im gleichen Rhythmus. 72
73 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Abb. 100 Linie - Anordnung waagerechtsenkrecht 1 Die Kombination von senkrechten und waagerechten Linien hebt die Richtungsbetonung auf. Die Fläche wirkt vergittert. 1. Gleichmäßige, symmetrische Teilung 2. Verspannung oder Vergitterung der Fläche; keine Richtungstendenz; ausgeglichen und ruhig 3. Verdichtung der Fläche im Vergleich zu 2. Je geringer die Abstände, umso dunkler die Fläche. 4. wie 3 5. Die Senkrechten dominieren. 6. wie 5 7. Progression bewirkt die Betonung der Mittelachsen. [räumliche Wirkung] 8. Progression nach außen wirkt allseitig umschlossen. [räumliche Wirkung] 73
74 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Abb. 101 Linie - Anordnung diagonal 1 Die Diagonale ist fortschreitend. Sie steigt und fällt und bringt dadurch Bewegung mit sich. Für den rechts orientierten Menschen steigt sie nach rechts oben und fällt nach rechts unten. Die steigende Diagonale wirkt positiv, aufstrebend, ist dem Geistigen, Himmlischen hin orientiert. Die fallende Diagonale wirkt negativ, also wie Niedergang, Abbau, Tod und Stillstand [Stillstand würde der Bewegung widersprechen.]. 1. Dynamisch, dynamische Bewegung, [ansteigend, positiv] 2. Eine dynamische Bewegung von links oben nach rechts unten [absteigend, negativ] 3. Bewirkt eine starke Vernetzung der Fläche [gleichmäßig, langweilig, unbestimmte Bewegung oder keine Bewegung, Flimmerwirkung, Moiré] 4. wie 3 5. Die Diagonale ist richtungsweisend [und damit dominant]. 6. Ausgeglichene Flächengliederung [ähnlich wie 3 und 4] 74
75 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Abb. 102 Linie - Anordnung diagonal 2 1. Die senkrechte und waagerechte Gliederung ist der Diagonalen untergeordnet. Die Diagonale wirkt dynamischer und steht deshalb im Vordergrund. [Obwohl die Fläche gleichmäßig unterteilt ist, wirkt sie unruhig, unterbrochen, ja ungleichmäßig und zwingt das Auge von einem Blickpunkt zum nächsten zu springen. Die Wirkung ist insgesamt eher störend als harmonisch.] 2. wie 1 3. Auch hier ist die Diagonale richtungsweisend. 4. Die Fläche wirkt ausgeglichen. [Wirklich? Die Fläche ist zwar ausgeglichen, wirkt auf mich eher unruhig, sporadisch räumlich, die Diagonalen wirken unterbrochen und nicht zusammengehörig, obwohl sie das sind.] 5. Bewirken eine Auf- und Abbewegung. [markante räumliche Wirkung; Das Bild hat eine Kippfigur-Wirkung.] 6. wie 5. [Flimmerwirkung; räumliche Wirkung: Jedes Dreieck scheint sich an der Längsseite vom Grund abzuheben. Ungleich dickere Linien stören die Gesamtwirkung und lenken den Blick darauf] 7. Bei Abbildung 7 und 8 handelt es sich um dasselbe Grundraster. In 8 sind die Linien unterbrochen, dadurch wird die dynamische Verspannung, die in 7 vorhanden ist, aufgelöst. [Der Gesamteindruck ist eine räumliche, isometrische Ebene. Bei längerer Betrachtung treten einzelne Rauten hervor, wodurch mehrere übereinander gestapelte Ebenen sichtbar werden.] 8. siehe 7 [Einige Löcher sind dominanter als andere. Sehr begrenzt stellenweise räumliche Wirkung.] 75
76 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Abb. 103 Linie - Anordnung rund 1. Kreise in gleicher Größe aneinandergereiht. [Da sich die Kreise berühren, wirken sie nicht isoliert voneinander, sondern eine schlangenförmige, s-förmige Linie tritt stellenweise in den Vordergrund, sowohl senkrecht als auch waagerecht.] 2. Kreise versetzt ineinandergezeichnet wirken verkettet und ornamenthaft. [Das Muster wirkt harmonisch, stellenweise dominieren einzelne Kreise oder auch Ketten von Kreisen in der Senkrechte und Waagerechte, was leicht unruhig wirkt, jedoch dominiert das Harmonische insgesamt.] 3. Kreissegmente gleichmäßig versetzt aneinandergereiht. Wirkt räumlich, wodurch der Eindruck entsteht die Kreissegmente seinen voneinander abgesetzt. [Die Kreissegmente wirken ungleichmäßig übereinandergestapelt; senkrecht wellenförmige Bewegung] 4. wie 3 [Wirkung einer von links oben nach rechts unten wellenförmigen Bewegung] 5. Halbkreise, gleichmäßig aneinandergereiht, ergeben einen gleichmäßigen Rhythmus. [die Halbkreise haben eine konvexe oder konkave räumliche Wirkung; Kippfigur] 6. Halbkreise im Wechsel aneinandergereiht wirken bewegt und wellenförmig. [Trotz ihrer Gleichmäßigkeit wirkt die Fläche stellenweise ungleichmäßig; auch hier ist eine abwechselnd konvexe bzw. konkave räumliche Wirkung zu verzeichnen; Kippfigur] 76
77 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Abb. 104 Linie - Anordnung als Struktur Freihändig gezeichnete Linien haben einen Bewegungsablauf, der sich aus der freihändigen Linienführung entwickelt. Ihre Ausdehnung, Ausbreitung und ihr Verhalten ergeben Oberflächen-Strukturen mit verschiedenen Wirkungen: Bewegung Ruhe Dynamik Raum Tiefe Dichte Vernetzung Spannung Rhythmus [Vielleicht wirkt jede noch so ziellose Anordnung von Linien, also selbst ein zielloses Gekritzel, zu einer Oberflächen-Struktur und je länger man kritzel, desto gleichmäßiger und langweiliger wird die Fläche. Man bemerke die Parallele zur Wahrscheinlichkeitsrechnung, die besagt, dass je häufiger man würfelt, desto ausgeglichener ist das Vorkommen jeder einzelnen Würfelzahl.] 77
78 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Fläche Abb. 105 Fläche Allgemeines Die Fläche ist ein gestalterisches Grundelement, in der Farbtechnik und Raumgestaltung das wesentliche Element. Definitionen 1. Die Fläche ist eine Ausdehnung, die durch ihre Form begrenzt wird, durch eine ebene oder gekrümmte Körperbegrenzung. Wenn eine geknickte oder gebogene Linie zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehrt, umschließt sie eine Fläche, die in ihrer Form fest umrissen ist. 2. Die Fläche hat die zwei Dimensionen Länge und Breite. 3. Ein von außen betrachtetes Flächengebilde bezeichnet man als Körper. 4. Ein von innen betrachtetes Flächengebilde bezeichnet man als Raum. Körper und Raum sind durch Flächen begrenzt. Man kann deshalb sagen, dass es keine Körper oder Räume gibt, die nicht ausschließlich durch Flächen begrenzt werden. 78
79 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Abb. 106 Fläche Grundformen 1. Quadrat: Form mit vier rechten Winkeln und vier gleichen Seiten. Es hat durch seine ruhige, neutrale Form eine statische Wirkung. Auf der Spitze gestellt, verliert es seinen schweren, lastenden Charakter und wirkt dynamisch. 2. Rechteck: Es ist die wandlungsfähigste Form. Es kann eine stehende oder liegende Tendenz haben. Bei Veränderung der Länge oder Breite ändert sich auch der Ausdruck der Form = Formcharakter. 3. Dreieck: Das gleichschenklige Dreieck wirkt durch seine Schrägen aktiv mit steigender oder fallender Wirkung. Die dreieckige Form besitzt durch Bewegung und Gegenbewegung Spannung und Dynamik. Es sind spitze, stumpfe, breitgezogene oder langgestreckte Formen möglich. 4. Kreis: ist die klarste Grundform. Er wirkt ruhig und vollkommen. 5. Ellipse: Je nach Lage wirkt sie aufstrebend oder ruhend. Die Wirkung ist weicher und elastischer als beim Kreis. 6. Fleck: [Charakter oder Wirkung hängt von der Form-Tendenz ab.] 79
80 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Abb. 107 Fläche Gliederung Die beabsichtigte Wirkung muss beim Gestalten oder Gliedern einer Fläche klar herausgestellt werden. Geschieht dies nicht, so entsteht eine undurchsichtige Gestaltung, die Proportionen wirken missgestaltet und lassen kein klares Ziel erkennen. Wirkung von Flächengliederung: Reihenwirkung dominierende Wirkung Gruppenwirkung progressive Wirkung Asymmetriewirkung Rhythmuswirkung polarisierende Wirkung Haufenwirkung Symmetriewirkung Proportionswirkung Es können verschiedene Wirkungen gleichzeitig vorhanden sein, man sollte jedoch darauf achten, dass eine Gliederungsart überwiegt, sonst würde die Gestaltung an Spannung, Richtung und gestalterischem Niveau verlieren. 1. Reihenwirkung/hier gleichmäßige Reihenwirkung: ruhig, sogar monoton 2. Rhythmuswirkung: lässt sich durch Gleichmaß und Takt als auch durch freie Bewegung darstellen. Durch den Wechseln von Form und Abstand, also Aktivität und Ruhe, entsteht eine belebende Fläche ohne Eintönigkeit. 3. Dominierende Wirkung: Flächen, die durch ihre Größe, Form oder Farbe vorherrschen, haben eine solche Wirkung. 4. Polarisierende Wirkung: Zwei Flächen, die sich in Form oder Größe gleich oder ähnlich sind, haben eine starke Spannung zueinander = polarisierend. [Wirklich? Das Beispiel wirkt eher symmetrisch, spiegelbildlich und damit gleich, regelmäßig und langweilig.] 5. Gruppenwirkung: Eine Gruppe entsteht durch Ähnlichkeit und Nähe, jedoch können auch verschiedene Formen und Größen eine Gruppe bilden. [Es entsteht ein Schwerpunkt in der Flächengliederung.] 6. Haufenwirkung: Eine Gruppierung ohne vordergründige Ordnung ergibt eine Haufenbildung. Bei einer geordneten Häufung, wie in der Abb., ist eine hintergründige Ordnung zu spüren, eine ungeordnete Häufung ist Chaos [und widerspricht damit vermutlich schon jedem gestalterischen Prinzip. Die philosophische Frage lautet: Gibt es überhaupt Chaos? Die Fraktale Mathematik zeigt, dass selbst chaotische Mengen einem Ordnungsprinzip unterliegen. Wenn es sich um ein unumstößliches Naturgesetzt handelt, dann würde das bedeuten, dass selbst jede ziellose Kritzelei einem Ordnungsprinzip unterliegt. Was wiederum zur Folge hätte, dass es keine Gestaltung gibt, die nicht einem Ordnungsprinzip unterworfen wäre, und damit könne man gar nicht eine schlechte Gestaltung ohne Richtung oder Tendenz produzieren, denn man müsste sich außerhalb des Systems befinden, in dem das Naturgesetz der chaotischen Ordnung nicht gilt.] 80
81 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Abb. 108 Fläche - Gliederung 2 1. Progressive Wirkung: entspricht einem Bewegungsablauf [räumliche Wirkung; Schwerpunkt] 2. Symmetriewirkung: Man unterscheidet einund zweiachsige Symmetrie. [räumliche Wirkung; zentrierte Fokusierung] 3. Asymmetriewirkung: Hierbei entsteht eine Spannung, die sich bis ins Extreme steigern kann. 4. Proportionswirkung: Goldener Schnitt; Schwerpunkt Kontrapunkt; ausgewogene Proportion] Abb. 109 Fläche - Systematische Flächengliederung 1 Grundformen sind: Quadrat, Kreis und Dreieck. Folgende Kompositionsmöglichkeiten bieten sich an: reihen verschieben drehen kippen gruppieren staffeln 1. Grundraster mit 16 Feldern; Grundform Quadrat. 2. Kombination mit Quadratformen. Es entstehen Formerweiterungen, die mit der ursprünglichen Form nichts mehr gemein haben. 3. Grundraster mit 16 Feldern; Grundform Dreieck. 4. Vier Kombinationsbeispiele mit Dreiecken. 5. Grundraster mit 16 Feldern; Grundform Kreis. 6. Vier Kombinationsbeispiele 81
82 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Abb. 110 Fläche - Systematische Flächengliederung 2 1. Kombination von Quadrat- und Dreieckformen. 2. Kombination von Quadrat- und Kreisformen. 3. Kombination von Kreis- und Dreieckformen. 4. Kombination von Quadrat-, Dreieck- und Kreisformen. 5. Gleichmäßige Aneinanderreihung von Viertelkreisformen. Form und Gegenform, positiv und negativ, werden in einfacher Weise verdeutlicht. 6. Kombination mit Viertelkreisformen. 7. Symmetrische Gliederung mit Kreisen. Die gegliederte Fläche ergibt durch teilweises Auslegen eine Vielzahl von Flächenformen. 8. Die Grundform Kreis in neun Teile gerastert, wodurch neue Formen gebildet werden, die die Grundform mehr oder weniger erahnen lassen. 82
83 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Abb. 111 Gliederung der Fläche Beispiele 1. Das Zentrale ist ruhig, aber langweilig. 2. Interessanter sind 2 3. und Entsprechend gilt dies auch für eine vertikale Unterteilung. 5. Interessanter sind 5 6. und Entsprechend gilt dies auch für eine diagonale Unterteilung. 8. Interessanter sind 8 9. und Eine Kombination ist ebenfalls entsprechend ruhig und langweilig. 11. Ein nicht zentrierte Aufteilung stellt eine Gewichtung her. 12. Vorder-, Mittel- und Hintergrund in einer langweiligen Art proportioniert. 13. VMH anders gewichtet. 14. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleich gewichtet. 15. VGZ anders gewichtet. 16. Keine Spannung, keine Gewichtung. 17. Eine Kombination von 13 und
84 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Abb. 112 Das Lenken der Blickrichtung Durch Kombination, systematischer Gestaltung kann man die Blickrichtung lenken und so die Gestaltung fokussieren. 84
85 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Abb. 113 Flächenkomposition In jedes guten Kunstwerk gibt es ein Großes, ein Mittel und ein Kleines das Prinzip der Drei. Bild 1 widerspricht diesem Prinzip. Bild 2 ist zu langweilig in seiner Anordnung. 3 und 4 sind schon etwas interessanter. In den Bildern 5, 6, 7 und 8 wird die Grundlinie aufgebrochen und so wird Dreidimensionalität erzeugt. In den Bildern 9 bis 12 wird gezeigt, wie man das Auge auf das kleine Quadrat lenken kann. In Bild 9 folgt das Auge einer imaginären Linie vom großen zum kleinen Quadrat. In Bild 10 erregt das kleine Quadrat die Aufmerksamkeit, weil es im Gegensatz zu den beiden anderen Quadraten gerade ausgerichtet ist. In Bild 11 erzeugt eine umgekehrte Anordnung der Quadrate das gleiche. In Bild 12 ist das kleine Quadrat als einziges von Leere umgeben und erzeugt so die größte Aufmerksamkeit. Abb. 114 Die Relation von Flächen Bild 13 erinnert an ein oder drei Gebäude. Ebenso Bild 14, wobei das kleine Quadrat eine Tür darstellt. 15 erinnert an ein Western-Gebäude. 16 ist 14 ähnlich, hat jedoch mehr Tiefe. 17 erzeugt langweilige, aber räumliche Tiefe. In Bild 18 sind nicht unbedingt drei Quadrate zu erkennen. Das mittlere Quadrat kann z. B. in den Hintergrund treten, während von dem großen Quadrat einfach eine L-förmige Form übrig bleibt. 19 ist ein Balanceakt und ein sehr schweres Gewicht für das kleine Quadrat. Die linke untere Ecke erzeugt in 20 ein unstimmiges Gefühl, etwas stimmt nicht in dieser Komposition. Die meisten Rezipienten würden eher der Figur 22 zustimmen als der Figur 21, obwohl beide einen ähnlichen Effekt erzielen: Sie erzeugen einen Raum im Hintergrund, in dem man sich bewegen kann. Nahezu jeder Betrachter neigt in 23 und 24 dazu drei Quadrat zu sehen als in 24 z. B. sechs inkl. dem Bildrahmen. Die Quadrate werden transparent und erwecken somit 85
86 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form den Eindruck von Leichtigkeit, Zerbrechlichkeit. Abb. 115 Das Prinzip der Dreiteilung Viele große Meisterwerke aus Musik, Literatur, Theater usw. sind dreigeteilt. Die Zeit hat eine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Raumdimension hat drei Achsen. Ein Theaterstück hat eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Dieses Prinzip der Drittelung lässt sich auch auf die Gestaltung anwenden. 86
87 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Abb. 116 Der Entering Point in der Landschaftsmalerei nach Jack Hamm Die meisten guten Landschaftsbilder haben einen Entering Point, einen Eintrittspunkt, der meistens links unten ist. Jedenfalls ist dieses Prinzip den Gestaltungsgesetzen entlehnt, denn nach dem Eintrittspunkt muss das Auge weiter gelenkt werden. Das rührt daher, da der Vordergrund meistens unten im Bild ist und meist auch der Eintrittspunkt für das Auge. Von 5A nach 5B zu führen ist riskant, da es das Bild in zwei Hälften aufteilt, wodurch die Gewichtung von 5C und 5D nicht mehr eindeutig geklärt ist. Von 6A nach 6B ist jedenfalls besser als von 5A nach 5B. Figur 7 führt gut ein in das Bild. In Bild 8 sollte man nicht nach C führen, da das Auge aus dem Bild heraus springen könnte. 87
88 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Abb. 117 Follow Through by Jack Hamm Jedes gute Bild hat einen Weg, den das Auge abläuft bei dessen Betrachtung, genannt Follow Through (Jack Hamm). Die grundsätzlichen Follow Through, denen ein Auge folgt sind: 1. Das C. 2. Das invertierte C. 3. Das S. 4. Das invertierte S. 5. Das O im Uhrzeigersinn 6. oder gegen den Uhrzeigersinn. 7. Kombinationen dieser Basic Follow Throughs sind möglich. 8. Eine Kombination aus S und O. 9. Eine Kombination aus S und O. 88
89 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Die bildnerische Form Abb. 118 Beispiele für Follow Through 1. Ein C. 2. Ein S. 3. Ein invertiertes C. 4. Ein S. 5. Ein O. 89
90 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Gestaltungsbeispiele Gestaltungsbeispiele Abb. 119 Beispiel Anzeigengestaltung - Joop Shoes Das rechte Pfeildiagramm veranschaulicht die Sehgewohnheit bei einem Bild: Zuerst richten sich die Augen auf den Mittelpunkt A; dann springt man auf Punkt B links oben und folgt der Leserichtung zu Punkt C; dann fährt man zu Punkt D. Die Anzeige Joop Shoes folgt genau diesem Prinzip. Das Hauptmotiv, die Frau, ist so ausgerichtet, dass die Blickrichtung von B nach D folgt und damit auf das eigentliche Motiv der Anzeige, nämlich die Schuhe. Der Text wird dann evtl. zu letzt identifiziert Das Maß Proportion und Harmonie Mit Proportion sind die Verhältnisse von Größen und Richtungen der linearen, flächigen und räumlich-plastischen Gestaltungselemente gemeint. Von Harmonie spricht man, wenn man Dinge zueinander ins richtige Verhältnis setzt Historie Ägypen Die Geometrie lieferte das ästhetische Instrumentarium räumliche Verkürzungen bleiben unberücksichtigt Figuren erscheinen in einer eigenartigen Kombination aus Profil- und Frontalansicht Im ersten Jahrtausend verändert sich das Zeilenraster mit zunächst unterschiedlichen Abständen zu einem gleichförmigen Quadratnetz: 1/3: von Halsgrube bis Mund; 2/3: vom Mund bis zum Haaransatz; 3/3: vom Haaransatz bis Scheitel. Der Kopf tritt als eigene Maßeinheit noch nicht auf. 90
91 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Das Maß Proportion und Harmonie Abb. 120 Ägyptische Proportionszeichnung Erhaltene Vorzeichnung aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. Gemessen werden neben einzelnen Körpergliedern auch einige eher willkürlich erscheinende Körperteile. Griechenland Polykleth (5. Jh. v. Chr.) schrieb einen nicht erhaltenen Kanon und schuf nach diesen Regeln den Doryphoros (Speerträger). Er war der erste, der seine Theorie auf Messungen am menschlichen Körper zurückgeführt hatte. Abb. 121 Polykleth Doryphoros Vermisst man die Statue mit dem Maßstab des Goldenen Schnitts, dann erhält man zwei Serien reziproker goldener Rechtecke, deren Länge beträgt: Die größere Rechteckserie umschreibt den ganzen Körper; Knie und Brustwarzen sind dabei die goldenen Schnittpunkte; die kleinere Serie reicht vom Kopf bis zu den Genitalien. Der Nabel ist hierbei der goldene Schnittpunkt der Gesamthöhe, die Genitalien liegen auf dem Punkt, der die Körperhöhe bis zum Kinn im Verhältnis 3:4 teilt. Die Überlieferung sagt: Chrysippus ist der Meinung, dass körperliche Schönheit auf der Proportioniertheit der Glieder beruht, also eines Fingers zum anderen und aller Finger zur Mittelhand und Handwurzel und dieser Teil zum Unterarm und des Unterarms zum Arm und so fort jeden Teils zu allen, gerade so, wie das in Polygklets Kanon steht. 91
92 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Das Maß Proportion und Harmonie Proportioniertheit = Verhältnismäßigkeit = Das Ganze ist die Summe seiner Einzelteile = Die Grundlage eines Systems der Proportion ist das mathematische Verhältnis. Das von Plato bezeichnete wichtigste Kapitel in dem Buch Die Elemente von Euklid befasst sich mit dem als heute bekannten Goldenen Schnitt, bereits 300 v. Chr. verfasst, wird es bis heute angewandt. Philosophisch wurde die Harmonieanforderung im Menschen durch Platon und Sokrates formuliert. Sie war definiert als das Streben nach dem Schönen, Wahren und Guten bzw. der Einheit von Geist, Körper und Seele (siehe hierzu Abb. 80). Vitruv (Marcus Vitruvius Pollio), ein röm. Architekt, Ingenieur und Schriftsteller, entwickelte auf der Grundlage Euklids ein Verhältnissystem das heute als Der vitruvianische Mensch von Da Vincis Zeichnung bekannt ist. Renaissance Abb. 122 Leonardo Da Vinci - Der vitruvianische Mensch Die Einbindung des menschlichen Körpers in Kreis und Quadrat beruht auf der archetypischen Vorstellung von der Quadratur des Kreises, die den antiken Menschen deshalb so faszinierte, weil Kreis und Quadrat als vollkommene, ja heilige Formen galten. Den Kreis hielt man für ein Symbol der himmlischen Sphären, das Quadrat galt als Symbol des festen Gevierts der Erde. Die Verbindung beider Symbole im menschlichen Körper heißt in der Sprache der Symbole, dass wir selber eine Einheit von Himmel und Erde darstellen, eine Vorstellung, die zahlreichen Mythologien und Religionen vorherrscht. [Der Bauchnabel ist das Zentrum des Kreises: Der Nabel der Welt. ] Leonardos Vitruv ist acht Köpfe groß, eine Verbesserung von Vitruvs Berechnungen über sieben Köpfe. Das älteste Buch, das Malern technischen Rat bot, Cennino Cenninis Handbuch für den Künstler (Libro dell arte o trattato della peintura, ca. 1390), enthielt tatsächlich ein Kapitel über die Proportionen, über die der Körper eines vollendet aussehenden Mannes verfügen sollte. 92
93 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Das Maß Proportion und Harmonie Abb. 123 Andrea Palladio - Gebäude v. Giorgio Cornaro Andrea Palladio ( ) schuf Bauten von strenger Klarheit und Harmonie (Hochrenaissance), rhythmisch bewegt durch Säulen und Pilaster. Er entwickelte den Stil der Hochrenaissance weiter auf der Grundlage der Arbeit von Vitruv. Die obige Gebäude steht in Piombino, einem Ort von Castel Franco. Der Hauptsaal ist im innersten Teil des Hauses angelegt, damit er vor Wärme und Kälte gleichermaßen schütze. Die Alae, in den Nischen zu sehen, haben eine Breite von einem Drittel der Länge. Die Säulen entsprechen den vorletzten der Loggien und sind voneinander so weit entfernt, wie sie lang sind. Die großen Zimmer sind ein Quadro und dreiviertel lang, die Höhe der Gewölbe richtet sich nach der ersten Art der Gewölbehöhen. Die mittleren Zimmer sind quadratisch und dreimal so hoch wie breit und haben ein Muldengewölbe mit Lünetten. Über den Kämmerchen liegen Halbgeschosse. Die oberen Loggien sind korinthischer Ordnung und um ein Fünftel kleiner als die darunterliegenden. Die Zimmer sind flach bedeckt und haben über sich einige Halbgeschosse. Auf der einen Seite befinden sich Küche und Vorratskammer, auf der anderen Räume der Dienerschaft. Neuzeit Zwischen dem 16. und 19. Jh. vertrat man die Ansicht, der Künstler müsse mit der Gabe ausgestattet sein, Muster des Ewigen zu empfangen. Er muss die Welt vom Dinglichen reinigen, ihre Mängel beseitigen und sie der Vorstellung näherbringen. Er wird darin durch sein Wissen um die Gesetze der Schönheit und durch das Studium des Altertums unterstützt. Der Künstler wurde also dazu angehalten, das Universelle zu verkörpern, nicht das Individuelle. Im 18. Jh. galt der Künstler erstmals als Genie und das Natürlich (nicht das Künstliche) wurde zum Ideal. William Hogarth ( ) kritisierte in seinem Buch Die Analyse der Schönheit die absurden Schemata von Dürer, Lomazzo und anderen: Asymmetrie statt Symmetrie, Informalität statt Formalität, geschwungene Serpentinenlinien statt Geometrie (Rokoko). Es ist jedoch interessant festzustellen, wie oft die gefälligsten proportionalen Harmonien wie der Goldene Schnitt in anderen, nicht europäischen Kulturen auftraten: in koreanischen Bronzen, japanischen Zen-Gärten und chinesischen Pagoden. Wir glauben nicht mehr an das Bild des Schönen als statische absolute Idee, aber die Proportionen bleiben ein wichtiges Verfahren zur Entschlüsselung und Bewertung seiner Eigenschaften, denn sie werden auch heute noch von Künstlern angewandt, bewusst und unbewusst, sowohl konkret als auch abstrakt. 93
94 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Das Maß Proportion und Harmonie 20. Jahrhundert Abb. 124 Le Corbusier Eigentl. Charles-Edouard Jeanneret-Gris War Architekt, der eine einzige herausragende Proportionslehre verfasste. Seine Proportionsfigur wurde bekannt als Modulor und diente dem Architekten zur Findung von Massen im Bau, die er im Einklang mit dem menschlichen Maß sah. Abb. 125 Le Corbusier - Der Modulor 1 Der Modulor ist ein Maß-Regler (Proportionierungs- Maßstab), mit dessen Hilfe das zugestaltende Objekt dimensioniert und harmonisch proportioniert werden kann. Er ist abgeleitet aus den Proportionen der menschlichen Gestalt. Er besteht aus zwei Zahlenreihen, die mit roter und blauer Serie bezeichnet werden. Sein numerischer Ausgangswert ist das Maß 113, Solarplexus eines sechs Fuß großen Menschen. Die Variation dieses Ausgangswertes geschieht auf folgende Weise: Verdoppelung des Wertes Hinzufügen seines Goldenen Schnittes Abziehen seines Goldenen Schnittes Abb. 126 Le Corbusier - Der Modulor 2 94
95 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Das Maß Proportion und Harmonie Die wichtigsten Aspekte seines Maß-Reglers beschreibt Le Corbusier wie folgt: [Lesezeichen, unklar] Abb. 127 Le Corbusier - Der Modulor 3 1. Aus dem Maß-Regler gehen die drei Massen 113, 70, 43 (cm) hervor. Diese stehen im Verhältnis des Goldenen Schnittes und der Fibonacci-Reihe zueinander: = 113 oder = 43 Ihre Addition ergibt: = = Die drei Massen 113, 183 und 226 charakterisieren den Raum, der durch einen sechs Fuß hohen Menschen eingenommen wird. 3. Das Maß 113 ergibt mit seinem Goldenen Schnitt 70, 43 eine erste, mit rote Serie bezeichnete Maßreihe: usw. Das Maß 226 (2 x 113) ergibt etc. mit seinem Goldenen Schnitt 140, 86 eine zweite, mit blaue Reihe bezeichnete Maßreihe: usw. 4. Aus diesen Werten, oder Massen, lassen sich solche bestimmen, die sich in charakteristischer Art auf die menschliche Gestalt beziehen. 5. Eine der wesentlichen Eigenschaften der Modulor- Reihen aber stellt der Rücklauf der Maßwerte dar, was praktisch unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten erlaubt. Anwendung: Ein Maßband, 2,26 m lang. Eine Tabelle, der die brauchbaren Zahlenreihen entnommen werden können. Mit brauchbaren Massen sind solche gemeint, die in einem optisch fassbaren Bereich angewandt werden sollen. 95
96 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Das Maß Proportion und Harmonie Der Goldene Schnitt Harmonie und Ästhetik Abb. 128 Der goldene Schnitt Einführung Der Goldene Schnitt findet sich überall in der Natur: In den Abständen der sich nach oben verjüngenden Astreihen bei Bäumen Bei der Anordnung der Blattadern Bei den Maßverhältnissen der Eiform Bei der Verjüngung der Spirale eines Schneckenhauses Bei den Proportionsverhältnissen des menschlichen Körpers Dieses Maßverhältnis wurde vom Menschen kulturelle benutzt z. B. in der Architektur (Tempelbauten wie das Parthenon, siehe Abb. 129) beim Idealmaß des Menschen (8 Pars-System) bei der Form von Gefäßen beim Alphabet 96
97 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Das Maß Proportion und Harmonie Abb. 129 Der Goldene Schnitt bei dem Parthenon Der Parthenon ist der Tempel der Stadtgöttin Pallas Athene Parthenos auf der Athener Akropolis. Er wurde zum Dank für die Rettung der Athener und Griechen durch die Göttin nach dem letzten Perserkrieg erbaut. Grundriss des Parthenon: Abb. 130 Der Goldene Schnitt bei der römischen Schrift "Capitalis Quadrata" Das römische Alphabet bestand aus 21 verschiedenen Buchstaben (ohne K, J, W und U = V und O formal identisch mit Q). Buchstaben, die nur aus Geraden bestehen: A, E, F, H, I, L, M, N, T, V, X, Y, Z = 13 Buchstaben. Buchstaben die aus Geraden mit Rundformen und nur aus Rundformen bestehen: B, C, D, G, O, P, R, S = 8 Buchstaben. Von diesen 8 bestehen 5 aus Geraden mit Rundungen: B, D, G, P, R); und 3 nur aus Rundungen: C, O, S. Ergibt: 3 zu 5 zu 8 zu 13 zu 21 = Fibonacci-Reihe (Edwin Zeysing 1855, Ghyka 1927) 97
98 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Das Maß Proportion und Harmonie Abb. 131 Informationsästhetik und Künstliche Intelligenz Exakte Ästhetik v. Max Bense (Kunst aus dem Computer). Shannon (1948) Entropie-Formel des realen Informationsflusses (Zeichen/Sekunde) (Skala von 0 1). p ist das Maximum der Wahrscheinlichkeit, d. h. dort ist die Auffälligkeit besonders groß. Goldener Schnitt: ( ) Das entspricht 38 %. Auffälligkeit nach der Entropie-Formel: Das entspricht 37 %. Beispiele: Besteht ein Bild aus Rot- und Nicht-Rot-Anteilen, ist das Rot besonders auffällig, wenn sein Anteil 37 % beträgt. Häuser werden dann als schön bezeichnet, wenn das Verhältnis von Fenster- und Türflächen zur Fassade 37 % beträgt. Eine Kaufhauskette in den USA reduzierte 37 % der Preise und erhöhte die anderen entsprechend. Die Kaufhauskette wurde in kürzester Zeit als preisgünstiger als die anderen bezeichnet und konnte so enorme Umsätze erzielen. Alle ästhetischen Untersuchungen gehen von einer absoluten Größe der Harmonie aus. Aber ändert sich nicht das ästhetische Empfinden aufgrund kultureller Einflüsse? Man denke dabei an das Schönheitsideal des weiblichen Körpers, das im Lauf der Geschichte vielen Änderungen unterworfen war. Heute genügt die bloße Anwendung des Goldenen Schnitts nicht mehr. Es ist ein Hilfsmittel, darf jedoch nicht Mittel zum Zweck werden. Die meisten Computer-Schriftarten haben diese alte Idealform, können heute jedoch durch diese Formvollendung einer konstruierten Harmonie charakterlos, steril und tot wirken. (Vergleiche die Entwicklung neuer Schriften, z. B. Alien, Matrix, Walt Disney u. a. (Wurde bei jenen Schriften der Goldene Schnitt angewandt?)) 98
99 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Das Maß Proportion und Harmonie Definition m = Minor (der kleinere Teil) M = Major (der größere Teil) es gilt: m : M = M : (m + M) Der Verhältniswert beträgt in etwa 1,618. Abb. 132 Der goldene Schnitt Kreisdiagramm Der Goldene Schnitt bezeichnet die Teilung einer Strecke in zwei ungleiche Teile, von denen sich der kleinere zum größeren verhält wie der größere zur gesamten Strecke. (siehe Abb. 132) Historie des Goldenen Schnitts Der Name Goldener Schnitt stammt vermutlich erst aus dem 19. Jh. Diese Form der Teilung wurde jedoch schon ca. 300 v. Chr. erstmals durchgeführt. Eine wesentliche Rolle spielte das Pentagramm, dessen Seiten sich stetig im Goldenen Schnitt teilen. Die erste erhaltene Beschreibung stammt von Euklid (300 v. Chr.), der die Teilung noch mit proportio habens medium et duo extrema (Teilung im inneren und äußeren Verhältnis) bezeichnete. Der Mathematiker Leonardo Ficonacci fand die weltbekannte Fibonacci-Folge, bei der die nächste Zahl aus der Summe der beiden Vorgänger gebildet wird: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 etc. Teilt man jedes Glied durch das vorhergehende, so erhält man eine Folge, die annähernd gegen die Zahl 1,61803 strebt, dem Goldenen Schnitt. Abb. 133 Der Goldene Schnitt anhand einer Strecke AB Eine Strecke AB wird durch C durch den goldenen Schnitt geteilt. Die Strecke lässt sich weiter unterteilen durch Kopieren der Länge CB von A bis D. Resultat: AD : DB = DB : AB Das bedeutet, dass jede Strecke zwei harmonische Teilungspunkte hat, deren Abstand DC abermals im Goldenen Schnitt-Verhältnis steht zu AD und CB. Die goldene Reihe: Wird die ursprüngliche Strecke AB über A hinaus verdoppelt, bilden die entstandenen drei Strecken eine Goldene Reihe, deren Vergrößerung als auch Verkleinerung stetig, d. h. bis ins Unendliche, fortgesetzt werden kann. 99
100 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Das Maß Proportion und Harmonie Abb. 134 Der goldene Schnitt bei der Proportionierung von Rechteckflächen Durch Schwenken der Halbdiagonale eines Initialquadrates entsteht ein Rechteck, dessen Seitenverhältnisse dem Goldenen Schnitt entsprechen. Abb. 135 Der goldene Schnitt bei Obelix Abb. 136 Der goldene Schnitt im Pentagramm 100
101 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Das Maß Proportion und Harmonie Geometrische Konstruktion [Lesezeichen, unklar] Abb. 137 Der Goldene Schnitt - Geometrische Konstruktion (siehe Formeln rechts) Näherungsweise gilt das Teilungsverhältnis 5:3. Die Teilung einer gegebenen Strecke AB im Goldenen Schnitt erfolgt: 1. AB/2 senkrecht auf Punkt B der Strecke AB abtragen ergibt Punkt C. 2. Punkt A und C verbinden. 3. Kreisbogen (r = AB/2) um C schlagen, ergibt Punkt D auf der Strecke AC. 4. Kreisbogen r = AD um A schlagen, ergibt Punkt E auf der Strecke AB. Punkt E teilt AB im Goldenen Schnitt. 101
102 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Das Maß Proportion und Harmonie Abb. 138 Der Goldene Schnitt - Geometrische Konstruktion in einem Kreis 1. Es sei m = 1, dann gilt 2. Die Verhältniszahl des Goldenen Schnitts ergibt somit: 3. was für x einen Wert von x = 0,61803 ergibt. 4. Die Vergrößerung des Goldenen Schnitts erhalten wir durch die Division 1:0,61803 = 1, Der Minor hat 38 % und der Major hat 62 % der Gesamtstrecke. Diese Streckenteilungsverhältnis lässt sich auch auf Flächenproportionen übertragen. Abb. 139 Der goldene Schnitt bei Flächenproportion Quadrat Bei welcher der drei Abbildungen ist die Auffälligkeit des dunklen Grauwertes am größten? Tabelle goldener Teilungen 1 0, , , , , , ,6 3 1, , , ,2 102
103 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Anwendungsbeispiele 4 2, , , ,8 5 3, , ,4 6 3, , , ,1 7 4, , , ,7 8 4, , , ,3 9 5, , ,9 10 6, , , ,5 11 6, , , ,2 12 7, , , , , , ,4 14 8, , , , , , ,6 16 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Anwendungsbeispiele Typografie (siehe Abb. 175) Fläche Durch die Unterteilung einer Fläche nach dem Goldenen Schnitt lässt sich ein harmonisches Raster festlegen. Unter der Voraussetzung, dass neutrale Elemente dort positioniert werden. Abb. 140 Harmonische Flächenaufteilung 103
104 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Größe, Wirkfelder, Formverbund, Formkontrast Aber: Bildelemente haben Wirkfelder. Sie erhalten nicht nur durch ihre Lage ein Spannungsfeld, sondern sie tragen in sich schon richtungsweisende Wirkfelder, die im Widerspruch zur Gesamtharmonie stehen können. (Siehe Bildnerische Elemente) Abb. 141 Beispiele der Anordnung von Elementen nach dem Goldenen Schnitt Größe, Wirkfelder, Formverbund, Formkontrast 104
105 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Größe, Wirkfelder, Formverbund, Formkontrast Die Änderung der Größe bewirkt eine Aufteilung in Vorder- und Hintergrund, also räumlich. Abb. 142 Größe Große und kleine Elemente schaffen Räumlichkeit. Abb. 143 Größe und Räumlichkeit Größe schafft Vorder-, Mittelund Hintergrund. Echte Räumlichkeit entsteht nur durch Größe und Perspektive und die drei Grundebenen. Abb. 144 Größe und Perspektive Werden komplexe Formen aus den Urformen gebildet, entstehen Wirkfelder. Abb. 145 Wirkfelder 105
106 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Größe, Wirkfelder, Formverbund, Formkontrast Durch ein Nebeneinander werden Formen optisch zueinander zugeordnet; durch einen Zusammenstoß oder eine Überschneidung miteinander verbunden. Formen können durch Richtungsänderung miteinander verknüpft sein. Abb. 146 Formverbund Abb. 147 Formkontrast Je kontrastreicher, desto spannungsreicher der Formverbund. Der Formkontrast ergibt sich aus: 1. Grundform und ihr Charakter 2. Formgröße (groß klein, dick dünn, ) 3. Formfarbe (hell dunkel, bunt unbunt) 4. Formoberfläche (transparent deckend, flächig plastisch ) 106
107 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Größe, Wirkfelder, Formverbund, Formkontrast Formdifferenzierung Voraussetzung für die Darstellung verschiedener Oberflächenstrukturen ist: 1. Genaue Naturbeobachtung, Erkennen des Wesentlichen 2. Abstraktion der Naturbeobachtung 3. Konsequente Durchgestaltung, wobei das Schema ständig variiert werden muss, um eine Gleichförmigkeit zu vermeiden. Abb. 148 Formdifferenzierung - Oberflächenstrukturen Die Relation von Formatbegrenzung und Inhalt In Beispiel 3 wird suggeriert, dass die beiden Rechtecke außerhalb des Rahmens weiter gehen. Beispiel 9 und 12 würde man niemals so realisieren, dass wichtige Objekte direkt am Rand angrenzen. Abb. 149 Relation von Format und Inhalt nach Jack Hamm 107
108 Grundlagen der Gestaltung Kompositionslehre - Abbild Zeichen Abbild Zeichen Nachdem die Ausgangsform der Zeichen mit der Naturform identisch war, haben sich in allen Kulturkreisen gleiche oder ähnliche Urzeichen entwickelt. (siehe Typografie Formlehre) Abb. 150 Beispiel Entwicklung von Zeichen 108
109 Raum Kompositionslehre - Abbild Zeichen 2 Raum Der Raum unendlich groß und leer, als ob er gar nicht da wär. Der Mensch (Daniel Mengai) Abb. 151 Räumlichkeit durch
110 Raum Kompositionslehre - Abbild Zeichen Abb. 152 Orthogonalprojektion Bei der orthogonalen Projektion werden nur die notwendigen zweidimensionalen Ansichten eines Körpers gezeichnet (Einsatzgebiete: Konstruktionspläne, technische Zeichnungen etc.). Im Kubismus wurde diese Art Raumproblemlösung angewandt. Es wurden Ansichten aus verschiedenen Blickwinkeln gleichzeitig dargestellt. Abb. 153 Kubismus, Pablo Picasso Die Parallelprojektion ist eine räumliche nicht-perspektivische Darstellung. Alle Linien verlaufen parallel im Raum (keine perspektivische Verkürzung). Abb. 154 Parallelprojektion 110
111 Raum Klassische Perspektive - Abbild Zeichen Abb. 155 Verschiedene Formen der Parallelprojektion 2.1 Klassische Perspektive Konstruktionsgrundlage ist die euklidische Geometrie. Die wissenschaftliche Entwicklung erfolgte im 16. Jh. von Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer. Die klassische Perspektive stellt nur einen Blickwinkel von etwa 30 naturgetreu dar. Gesetze der klassischen Perspektive 1. Geraden bleiben gerade. Ausnahme: Auge liegt auf der Verlängerung der Geraden wird zum Punkt. 2. Strecken verändern ihre Längen. Ausnahme: Winkel Auge = Strecke = Winkel ändern sich. Ausnahme: Winkel Auge Fläche =
112 Raum Klassische Perspektive - Abbild Zeichen Zentralperspektive Voraussetzung ist, dass der abzubildende Körper mit einer Seite senkrecht zur Blickrichtung steht, was ein naturgemäße perspektivische Abbildung ergibt (siehe Abb. 157). Abb. 156 Zentralperspektive Beispiel Abb. 157 Zentralperspektive Schema 112
113 Raum Klassische Perspektive - Abbild Zeichen Abb. 158 Zentralperspektive Konstruktionsbeispiel 1. Festlegung der Horinzontallinie. 2. Festlegung des Augenpunktes = Fluchtpunkt. 3. Zeichnen der Aufsicht des Würfels 4. Projektion der wichtigen Raumpunkte auf der Bildebene (eingeschobene Glasscheibe). 5. Übertragung der gewonnenen Maße in die perspektivische Seitenansicht. 6. Verbindung der Flächeneckpunkte (der Frontseite) mit dem Fluchtpunkt 7. Ergänzung zur fertigen Würfelabbildung 113
114 Raum Klassische Perspektive - Abbild Zeichen Schrägperspektive Sie hat zwei Fluchtpunkte, die beide auf der Horizontallinie liegen. Das Objekt steht mit allen Seiten schräg zur Blickrichtung. Abb. 159 Schrägperspektive Schema 114
115 Raum Klassische Perspektive - Abbild Zeichen Abb. 160 Schrägperspektive Konstruktionsbeispiel 1. Festlegung der Horizontallinie. 2. Festlegung des Augenpunktes 3. Zeichnung der Aufsicht des Würfels. 4. Festlegung der Bildebene (Glasscheibe) 5. Konstruktion der Fluchtpunkte (Sonderfall: Der Würfel steht achsensymmetrisch vor Ihnen, dann ist FP1 AP = FP2 AP 6. Projektion der wichtigen Raumpunkte auf die Bildebene. 7. Übertragung der Punkte in die perspektivische Zeichnung usw. 115
116 Raum Klassische Perspektive - Abbild Zeichen Luftperpektive Sie hat drei Fluchtpunkte, wobei zwei davon auf der Horizontallinie liegen. Das Objekt steht mit allen Seiten schräg zur Blickrichtung. Sicht von weit oben bzw. unten. 116
117 Raum Klassische Perspektive - Abbild Zeichen Abb. 161 Luftperspektive Konstruktionsbeispiel 1. Festlegung der Horizontallinie 2. Festlegung des Augenpunktes 3. Festlegung der Fluchtpunkte (2 Fluchtpunkte liegen auf der Horizontallinie, der 3. Fluchtpunkt liegt auf der Senkrechten durch AP, bei Aufsicht unterhalb der HL, bei Untersicht oberhalb der HL. 4. Projektion und Übertragung aller wichtigen Raumpunkte usw. Fehler in der klassischen Perspektive 1. Der Körper im Hintergrund erscheint richtig. 2. Der Plattenweg im Vordergrund erscheint auch richtig. 3. Figuren, die diagonal im Vordergrund auf den Platten stehen, erscheinen falsch. 117
118 Raum Klassische Perspektive - Abbild Zeichen Verkürzungen in der klassischen Perspektive Abb. 162 Verkürzungen in der klassischen Perspektive Halbierung der Raumfläche Der Schnittpunkt der Diagonalen ergibt die Teilung. Drittelung der Raumfläche 1. Durch Punkt A Waagerechte W legen. 2. Diagonale D verlängern ergibt Schnittpunkt B auf W. 3. Strecke AB dritteln ergibt C und D. 4. Verbinden von CD mit E ergibt C1 und D1. 5. Senkrechte durch C1 und D1. Gerade Unterteilung Erneute Unterteilung mit Diagonalen. Körperdarstellung Zum Beispiel werden Pyramide und Prisma zu einem Quader ergänzt. Rundformen werden ebenfalls zu einem Quader ergänzt. Ecken an den Enden von Ellipsen müssen vermieden werden. Bei konzentrischen Kreisen ergeben sich durch die Verkürzung unterschiedliche Ellipsenabstände. 118
119 Raum Kurvenlineare Perspektive - Abbild Zeichen 2.2 Kurvenlineare Perspektive Bei der kurvenlinearen Perspektive werden keine linearen Messungen vorgenommen (Aufsicht), sondern nur Winkelmessungen vom gleichbleibenden Standpunkt aus. Abb. 163 Kurvenlineare Perspektive - Konstruktionsbeispiel Konstruktionsbeispiel [Lesezeichen, unklar] Vor Ihnen (Abstand 3 m) steht senkrecht im rechten Winkel eine Mauer (Höhe 4 m). Die Länge überschreitet das Gesichtsfeld, angenommen 120. Ihre Augenhöhe ist 1,5 m. Größe der Zeichnung: 120/90 cm, der Augenpunkt AP liegt in der Mitte der Bildebene. Die Hauptachse Auge-Augenpunkt ist der Radius eines trigonometrischen Kreises, also ist die Höhe der Mauer über HL die Tangente des gesuchten Winkels. Die reale Höhe der Mauer über HL ist 4 1,5 = 2,5 m, der Wert der Tangente als tg 2,5 : 3 = 0,8333; entspricht einer Winkelweite von 40, in der Zeichnung von 40 cm. Damit liegt Punkt H1 fest. Fußpunkt F1: Die Tiefe der Mauer von AP ist 1,5 m (Augenhöhe). Tangente ist tg 1,5 : 3 = 0,5, entspricht 27, entspricht 27 cm. Situation 60 links und rechts vom AP, an den Rändern der Zeichnung. Der Radius des trigonometrischen Kreises ändert sich. Der Sehstrahl in der Horizontalebene ist 6 m (cos 60 = Ankathete : Hypotenuse; ½ = 3 : x; x = 6 m). Sehwinkel v. H2: tg 2,5 m : 6 = 0,41; entspricht 22 ; entspricht 22 cm Berechnung F2: Tg 1,5 : 6 = 0,25; entspricht 14 ; entspricht 14 cm. Bei 30 neben AP treten folgende Werte auf: Sehstrahl ist 3,48 m (cos 30 = ½ Wurzel 3) H4: tg 1,5 : 3,48 = 0,716; entspricht 36 ; entspricht 36 cm. F4: tg 1,5 : 3,48 = 0,43; entspricht 23, entspricht 23 cm usw. 119
120 Raum Kurvenlineare Perspektive - Abbild Zeichen 120
121 Raum Licht und Schatten - Abbild Zeichen Abb. 164 Beispiele für kurvenlineare Perspektive 2.3 Licht und Schatten Regeln 1. Künstliche Lichtquelle Die Strahlen verbreiten sich geradlinig und strahlenförmig. 2. Natürliche Lichtquelle Die Strahlen verbreiten sich geradlinig und parallel zueinander. 3. Diffuses Licht Die Strahlen verbreiten sich geradlinig und ungeordnet. Sie überkreuzen sich (gebrochen, reflektiert, gespiegelt etc.) 4. Optik Die Lichtintensität nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab. 5. Bei Licht auf Körpern fassen wir zur Vereinfachung natürlich und künstliche Lichtquellen zusammen. Bei Wurfschatten von Körpern müssen wir zwischen natürlichen und künstlichen Lichtquellen unterscheiden. 6. Hell-Dunkel-Werte auf dem Körper Im beleuchteten Teil zeigt sich die Eigenfarbe des Körpers. (Nicht ganz. Die hellste Stelle des Körpers kann ein Weiß sein, obwohl der Körper eine andere Eigenfarbe hat, z. B. bei Plastik.) 7. Wurfschatten sind die Schatten, die der Körper entgegengesetzt zur Lichtquelle auf seine Umgebung wirft. Schlagschatten sind hart begrenzte Schatten bei intensiver Lichtqualität. 8. Lichtreflexe sind helle Stellen im Eigenschatten auf dem Körper. Sie entstehen durch Lichtreflexion. Perspektivische Konstruktion 1. Darstellung mit 1 Fluchtpunkt Der Fluchtpunkt ist die Lichtquelle. 2. Darstellung mit 2 Fluchtpunkten Der 1. Fluchtpunkt ist die Lichtquelle (FPL). Der 2. ist der Schnittpunkt der Senkrechten von der Lichtquelle (FPL) auf die Standebene des Körpers, der Schattenfluchtpunkt (FPS). Bei parallelen Lichtstrahlen (Sonne) gelten andere Regeln. Abb. 165 Schattenkonstruktion mit 1 und 2 Fluchtpunkten 121
122 Raum Licht und Schatten - Abbild Zeichen Ausnahmen sind 3. Gegenlicht Die Sonne ist im Blickfeld, 2 reale Fluchtpunkte. 4. Frontallicht Die Sonne steht hinter dem Beobachter, 2 Fluchtpunkte: FPS ist real, FPL ist virtuell. 5. Sonne ist seitlich außerhalb des Blickfeldes Strahlen sind parallel, kein Fluchtpunkt. Abb. 166 Sonne und Schatten 122
123 Raum Raum, Licht und Tiefe - Abbild Zeichen 2.4 Raum, Licht und Tiefe Abb. 167 Perspektive zwischen Himmel und Erde Perspektive erzeugt räumliche Tiefe, auch in der Landschaftsmalerei, aber nicht nur. Abb. 168 Sättigung und räumliche Tiefe Auch die Sättigung erzeugt räumliche Tiefe. A. Der dunkle Streifen liegt räumlich vorn, perspektivisch jedoch hinten. B. Der Berg liegt räumlich vorn, perspektivisch hinten. Der Himmel liegt richtig. C. In dieser Zeichnung stimmt alles. Sie trifft für eine helle Tagesstimmung zu. Die Sättigung nimmt von vorn nach hinten ab. D. Hier liegt der Berg vor, perspektivisch jedoch hinten. E. Auch hier stimmt alles: Sättigung und Perspektive. 123
124 Typografie Geschichte - Abbild Zeichen 3 Typografie 3.1 Geschichte Die Entwicklung der Schrift war eine Notwendigkeit, Information über Raum und Zeit hinweg zu transportieren. Die ersten Informationssysteme waren eine Aneinanderreihung von Zeichnungen und Symbolen (Inkas: Knotenschnüre; Australien: Kerbhölzer). Diese Zeichenadditionen ergeben einen Gedanken, eine Idee (Ideenschrift). 1. Erste Abstraktionsstufe: Entwicklung von phonetischen Bildzeichen (Ägypten: Hieroglyphen mit ca Zeichen) 2. Zweite Abstraktionsstufe: Keilschrift der Sumerer in Mesopotamien (ca. 600 phonetische Zeichen; etwa 3000 v. Chr.) 3. Dritte Abstraktionsstufe: Phönizier bildeten ein Alphabet mit 22 Konsonanten. Die Griechen ergänzten das Alphabet mit 5 Vokalen. Von Griechenland kam das Alphabet nach Italien und entwickelte sich zu unserem lateinischen Alphabet (ca. 700 v. Chr.) Abb. 169 Phonetische Bildzeichen 124
125 Typografie Einführung - Abbild Zeichen Das römische Weltreich benötigte eine einheitliche Schrift, die Capitalis monumentalis, eine Versalienschrift. Erst durch Feder und Ritzgriffel entwickelten sich vereinfachte Gebrauchsschriften (Capitalis rustica, Majuskelkursiv). Geschwindigkeit und Flüchtigkeit des Schreibens führte zu Ober- und Unterlängen, Ligaturen (Buchstabenverbindungen) und Wortverbindungen (Minuskelkursive). Abb. 170 Entwicklung des lateinischen Alphabets Die Capitalis quadrata (siehe 3.3) wurde entwickelt, um dem ästhetischen Anspruch der Römer zu genügen. In den Klöstern wurden die merowingische Buchminuskel und die karolingische Minuskel entwickelt. Die Humanistische Minuskel wiederum bildete sich durch die Schreibgeschwindigkeit. Die Goten entwickelten die Frakturschrift, z. B. die Textur. Erst nach Gutenberg 1450 war es möglich Schriften wie Egyptienne, Italienne, Groteskschriften und Designerschriften zu entwickeln. 3.2 Einführung Das Grundgesetz der seriösen Typografie Gleiches muss gleich behandelt werden. 125
126 Typografie Einführung - Abbild Zeichen Das Grundgesetz der aktivierenden Typografie (Kommunikationsdesign) Anders sein, auffallen, neugierig machen! Bei der Gestaltung von Typografie und Layout gibt es die unterschiedlichsten Aspekte zu beachten. Folgende Beispiele sollen dies verdeutlichen: Abb. 171 Seitenlayout bei einer Zeitschrift Abb. 172 Seitenlayout - konservative und dynamische Anordnung Abb. 174 Ober- und Unterlinie bei Schrift Abb. 173 Anordnung von Text Abb. 175 Spationierung Die optimale Mitte der Buchstaben ist nicht die mathematische Mittel. Verrückt man Buchstaben so, dass die Binnenräume z. B. gleich sind, zerstört dies zugleich die Lesbarkeit, den Rhythmus des Textes Spationierung. Verschiedene Farben haben denselben Effekt. Wörter müssen so getrennt werden, so dass ein I mit seinen Zwischenräumen hineinpasst. Der Zeilenabstand verhält sich zur Schrifthöhe im Goldenen Schnitt. Transportzone: Untere Hälfte der Schrift; erschwert die Erkennbarkeit massiv Kennzeichnungszone: Obere Hälfte der Schrift; zur Identifikation maßgeblich. Abb. 176 Transport- und Kennzeichnungszone einer Schrift Abb. 177 Reduktion des Leseflusses durch Buchstabenspiegelung 126
127 Typografie Einführung - Abbild Zeichen Abb. 178 Anordnung von Fließtext Linksbündiger Flattersatz gut lesbar keine Worttrennung bzw. kleine Wörter nicht in eine extra Zeile schreiben Bindewörter wie und an den Anfang der Zeile Aufzähl-, Listencharakter geordnet konservativ Kolumne durch das Auseinanderziehen der Leerzeichen entstehen Löcher; diese möglichst vermeiden, da sie sofort ins Auge springen Anfang und Ende sind gleich - Rhythmus für das Auge für Mengentext max. 8 cm breite Zeilen Rechtsbündiger Flattersatz langsames Lesen z. B. geeignet für wenig Text (Gedicht) Titel oder Gedicht, Speisekarte etc. Achsensymmetrie; ruhige, harmonische Wirkung jedoch kein Lesefluss Abb. 179 Anderes Beispiel für die Anordnung von Fließtext Gebogene Linie bedeutet Spannung runde Form bedeutet Ruhe und Harmonie Textgestaltung und Lesefreundlichkeit Das Wahrnehmungsfeld des Menschen entspricht bei einem Abstand von 30 cm ca. 8 cm in der Horizontalen. Deshalb sollte die Spaltenbreite nicht wesentlich breiter als 8 cm sein. Beim Lesen werden ganze Wörter und Wortgruppen wahrgenommen, nicht einzelne Buchstaben. Saccade nennt man die ruckartigen Bewegungen des Auges. Die Fixationen der Lesesprünge liegen häufig zwischen den Wörtern. Bei zu geringem Wortabstand sind die Wörter als Einheiten schwieriger erfassbar, ist er zu groß, können weniger Wörter mit einer Saccade erfasst werden. Wörter werden vor allem durch ihre unverwechselbare Außenkontur erfasst. Lange Wörter, die uns weniger vertraut sind, stören deshalb des Lesefluss. Versalschriften haben keine markante Wortkontur und sind deshalb auch schwer lesbar. Den Großteil der Information für das Erkennen eines Wortes beziehen wir aus den Ober- und Mittellängen. 127
128 Typografie Einführung - Abbild Zeichen Beim Aufbau einer Seite ist eine einfache und überschaubare Leseführung eine wichtige Voraussetzung, da wir bequem und ökonomisch mit unseren Augen umgehen. Im ersten Beispiel in Abb. 180 ist ein größeres Bild zwischen den laufenden Text geschoben, das beim Lesen jedes Mal wie ein Hindernis übersprungen werden muss. Im zweiten Beispiel gestaltet sich das Lesen wie ein Hürdenlauf. In den unteren Beispielen ist die Leseführung etwas einfacher und übersichtlicher, was allerdings nicht bedeuten muss, dass auch das Layout immer so einfach gehalten werden muss. Abb. 180 Beispiel Seitengestaltung und Leseführung Fotosatz- oder ehemalige Bleisatzschriften wirken durch zeitlose Eleganz, vollendete Formen und ausdrucksstarke Ästhetik. Garamond Claude Garamond 1532 Baskerville John Baskerville 1754 Bodoni Giambattista Bodoni 1789 Walbaum Erich Walbaum 1810 Caslon William Caslon 1816 Gill Erich Gill 1927 Futura Paul Renner 1928 Times Stanley Morrison 1931 Palatino Hermann Zapf 1950 Clarendon H. Eidenbenz 1951 Helvetica Max Miedinger 1957 Univers Adrian Frutiger
129 Typografie Einführung - Abbild Zeichen Gegenpole von Schriftcharakteren Form: rund-eckig, weiblich-männlich, zurückhaltend-aggressiv, anmutig-technisch Dynamik: schwungvoll-statisch, fließend-stockend, lebendig-tot, zerbrechlich-stabil Anschläge: Bei Büchern, etwa 60/Zeile Trennungen: max. 3 untereinander Leseschritt: etwa 10 Buchstaben bei 6 p bis 12 p. Zeilenabstand: normal sind etwa 120 % des Schriftgrades Idealer Zeilenabstand: Halten Sie das Satzbild 30 bis 50 cm entfernt, kneifen Sie die Augen etwas zu, das sichtbare Ergebnis muss eine gleichmäßige Graufläche ergeben. Schriftgrößen Konsultationsgröße: Schriftgrad bis 8 p. (Absenderfeld, Fußnoten, Marginalien etc.) Lesegrößen: zwischen 8 und 12 p, gilt auch bei größeren Zeilenabständen und Satzspiegelformaten Schaugrößen: bis 48 p. (z. B. Titel) Plakat- oder Displayschriften: über 48 p. Typografische Gestaltungsmöglichkeit Rasterorientierte Typografie: Der Satzspiegel wird in rechteckige Flächen aufgeteilt, wobei die senkrechten und waagerechten Linien der Rechtecke die Satzkanten ergeben. Linien und Flächen Kontraste Semantische Typografie: Beziehung der Schriftzeichen zu einem Abbild, Begriff. Fuß 324,90 mm Foot 304,800 mm Zoll 27,08 mm Inch 25,400 mm Linie 2,26 mm Pica 4,233 mm Punkt 0,38 mm Point 0,353 mm 1 Didot P 0, mm oder 0,375 mm = 3/8 mm 1 Cicero 12 p = 4,5 mm Bis 1976 galt der Didot-Punkt, der auf dem französischen Fuß basierte. DTP-Software: PageMaker QuarkXPress InDesign VenturaPublisher VivaPress 129
130 Typografie Formlehre - Abbild Zeichen 3.3 Formlehre Abb. 181 capitalis quadrata Die stärkste Abstraktion des Zeichens finden wir im Alphabet. Die Urform unserer heutigen Alphabete ist die Capitalis Quadrata, eine röm. Schrift. Die Proportionsverhältnisse der einzelnen Buchstaben gelten bis heute. Die optischen Proportionen sind festgelegt auf 1/1-, ¾- und ½- Quadrate (Ausnahme I und J). Der Aufbau und der Duktus der Buchstaben unterliegen den Gesetzen des Goldenen Schnitts, in der Buchstabenform, den Buchstaben-Wort- und Zeilenabständen und im Duktus (Verhältnis von Buchstabenhöhe zu Strichstärke, von Senkrechter zu Waagerechter). (Duktus, der; a) Schriftzug, Linienführung der Schriftzeichen b) charakteristische Art der (künstlerischen) Formgebung; vgl. Ductus. Ductus, der; (lat. Führung, Leitung): (Med.) Gang, Kanal, Ausführungsgang von Drüsen; vgl. Duktus) 130
131 Typografie Formlehre - Abbild Zeichen Abb. 182 Schriften im Geist der Zeit Das Gestaltungsraster der Schriften ist immer gleich geblieben. Erst die Einhaltung des Aufbaurasters ergibt bei beliebigen Buchstabenverbindungen ein einheitliches Schriftbild. Abb. 183 Aufbauraster der Schrift 131
132 Typografie Formlehre - Abbild Zeichen Wenn die Proportionen eines Buchstabens der Urschrift geändert werden, ändern sich alle Buchstaben analog mit (Schriftfamilie). Schmale Schriften haben z. B. das Proportionsschema ½-, 3/8- und ¼-Quadrat. Abb. 184 Proportionen eines Buchstabens Siehe Abb Die optische Mitte liegt über der mathematischen Mitte. 2. Kreis, Dreieck und Quadrat haben verschiedene Wirkfelder und sie müssen deshalb verschiedene mathematische Höhen haben, um optisch gleich hoch zu wirken. Dies gilt natürlich auch für die breite der Buchstaben. 3. Waagerechte Balken wirken stärker, weshalb diese etwas dünner sind als die senkrechten. Abb. 185 Optische Gesetze 132
133 Typografie Schrift - Schriftfamilien 4. Mathematisch gleiche Abstände wirken wegen der Negativ-Formen ungleich Abb. 186 Optische Gesetze Manipulierte Schriften stören erheblich die Lesbarkeit. Selbst eine Reduzierung auf die Grundformen (Quadrat, Dreieck, Kreis) erschwert die Lesbarkeit. Abb. 187 Manipulierte Schriften 3.4 Schrift Schriftfamilien Innerhalb einer Schriftfamilie unterscheidet man: Strichstärke Laufweite Strichlage Schriftschnitt (z. B. fett, kursiv) 133
134 Typografie Schrift - Schriftfamilien Schriftgröße... wird meist mit dem typografischen Punkt (pt) bemessen: 1 pt = 0,353 mm 1 cm = 28,33 pt 1 = 2,54 cm = 72 pt Abb. 188 Beispiele zu den Schriftfamilien Beispiel 4 in Abb. 188 zeigt die Futura. Die Book ist für den Mengensatz bzw. Bücher. Die Wortzwischenräume laufen bei fetten Schnitten etwas zusammen. Dies wird optische durch das Verbreitern der Schrift korrigiert, und durch das Anheben der Mittellängen. Echte Kursivschnitte haben i. d. R. einen handschriftlichen Charakter. Vom Rechner erzeugte Kursivschnitte wirken unharmonisch und verzogen. Sonderzeichen Bruchziffern Kapitälchen Mediäval- oder Minuskelzahlen: Sie besitzen teilweise kleine Unter- und Oberlängen und harmonieren somit optisch ebenfalls besser mit dem Schriftbild. 134
135 Typografie Schrift - Klassifikation von Schriften Klassifikation von Schriften Schrifteinteilung (DIN ) Venezianische Renaissance-Antiqua Französische Renaissance-Antiqua Barock-Antiqua Klassizistische Antiqua Serifenbetonte Linearantiqua Serifenlose Linearantiqua Antiquavarianten Schreibschriften Handschriftliche Antiqua Gebrochene Schriften Fremde Schriften Antiquaschriften Klassische Antiqua Vom Schreiben entwickelt, fett halbfett Beispiele: Garamond, Times Klassizistische Antiqua Gezeichnete Schriften, fett fein Beispiele: Bodoni, Didot Abb. 189 Antiquaschriften 135
136 Typografie Schrift - Klassifikation von Schriften Renaissance-Antiqua Mit der Renaissance-Antiqua war im 14. Jh. ein Schriftsystem entstanden, das sich in seiner Lesbarkeit kaum mehr verbessern ließ. Die Garamond von Claude Garamond (16. Jh.) gehört zu den französischen Renaissanceschriften, die sich durch ausgeprägte Strichstärken kennzeichnen. Merkmale Geringe Strichstärken Serifen sind zum Grundstrich hin gerundet. Die Ansätze bei den Oberlängen der Kleinbuchstaben sind meist sehr schräg. Der Buchstabe o besitzt keine ganz senkrechte Achse. Abb. 190 Renaissance Antiqua Beispiele Garamond, Bembo, Palatino, Centaur, Sabon, Schneidler Mediaval, Van Dijk, Meridien Barock-Antiqua Merkmale deutlicherer Kontrast bei den Strichstärken Beispiele Caslon, Baskerville, Times, Concorde Abb. 191 Barock Antiqua 136
137 Typografie Schrift - Klassifikation von Schriften Klassizistische Antiqua Merkmale Strichstärkenunterschiede besonders ausgeprägt feine Serifen Ansätze und Endungen verlaufen waagerecht Beispiele Bodoni, Didot, Walbaum Abb. 192 Klassizistische Antiqua Serifenlose Linearantiqua mit Renaissancecharakter Merkmale Bei dieser Gruppe fehlt der serifenförmige Abstrich. erste Untergruppe = Groteskschriften; in ihrer Grundform an die Renaissance-Antiqua angelehnt (Syntax, Gill Sans, Frutiger, Formata) Groteskschriften Gezeichnete Schriften, keine Serifen, Verhältnis Senkrechte- Waagerechte nähert sich 1:1 Beispiele: Helvetica, Arial, Futura Abb. 193 Serifenlose Linearantiqua mit Renaissance- Charakter 137
138 Typografie Schrift - Klassifikation von Schriften Serifenlose Linearantiqua mit klassizistischem Charakter Beispiele Akzidenz Grotesk, Helvetica, Univers Abb. 194 Serifenlose Linearantiqua mit klassizistischem Charakter Serifenlose Linearantiqua mit konstruiertem Charakter sind nicht unbedingt lesbar Beispiele Kabel, Bauhaus, Avantgarde, Futura Abb. 195 Serifenlose Linearantiqua mit konstruiertem Charakter 138
139 Typografie Schrift - Klassifikation von Schriften Serifenbetonte Linearantiqua mit klassizistischem Charakter Merkmale mehr oder minder betonte Serifen auch Egyptiennenschriften genannt Beispiele Clarendon, Excelsior, Impressum Abb. 196 Serifenbetonte Linearantiqua mit klassizistischem Charakter Egyptienne und Italienne Gezeichnete Schriften, starke Betonung der Serifen. Beispiele: Playbill, Pro Arte Abb. 197 Egyptienne Playbill 139
140 Typografie Schrift - Klassifikation von Schriften Serifenbetonte Linearantiqua mit konstruiertem Character Merkmale einheitliche Strichstärke rechtwinklig angesetzte Serifen Beispiele Rockwell, Lubalin Graph, American Typewriter, Boton Abb. 198 Serifenbetonte Linearantiqua mit konstruiertem Charakter Frakturschriften Vom Schreiben entwickelt, dann überzeichnet, gebrochene Schriften. Beispiele Textur, Manuskript - Gotisch Abb. 199 Frakturschrift Fraktur Bold Schreibschriften Mit Spitzfeder oder Pinsel geschrieben, Duktus ergibt sich aus Federdruck. Beispiele Englische Schreibschrift, Taille - douce 140
141 Typografie Schrift - Klassifikation von Schriften Moderne Schriften Designerschriften Gezeichnete Schriften, Duktus beliebig, ausdrucksstarke Titelschriften, im Fließtext schwer lesbar. Beispiele Pump, Calypso Abb. 200 Beispiele für moderne Schriften 141
142 Typografie Schrift - Klassifikation von Schriften Anwendungsbeispiel Oben: Bodoni Unten: Walbaum Die klassizistischen Antiquaschnitte sind meistens eine gute Wahl, wenn Designprodukte auf hochwertigem, glattem Papier vorgestellt werden und man auf eine klassische noble Anmutung der Gestaltung Wert legt. Abb. 201 Beispiele für die klassizistische Antiqua 142
143 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Die Renaissance-Schnitte sind lesefreundlich und haben ein freundliches Aussehen. Humor, Heiterkeit = Bembo, Garamond Apple = Garamond Condensed Schreibkultur, Humanismus, sympathische Alternative zu noblen, etablierten Marken Abb. 202 Beispiele für Renaissance-Schnitte Schriftgestaltung Lesbarkeit und Lesekomfort sind die stärksten Vorgaben an die Schriftgestaltung. 143
144 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Maßsysteme Didot- und DTP-Punkt Der Schriftgrad ergibt sich entweder aus der Versalhöhe oder bemisst sich von der Ober- bis zur Unterlänge. Heute sind Didot- und DTP-Punkt gleichermaßen üblich. Der Didot wurde 1784 entwickelt. Er ist der 864ste Teil eines französischen Pied du Roi, d. h. eines königlichen Fußes (ca. 32,4 cm), also ca. 0,376 mm. Wurde später auf 0,375 abgerundet. Zwölf Didot-Punkte ergeben ein Cicero (4,5 mm), vier Cicero eine Konkordanz (18 mm). Der DTP-Punkt leitet sich vom 72sten Teil eines Inch (= 25,4 mm) ab, also ca. 0,352 mm. Aufgrund der Verbreitung von DTP wird sich entsprechend dieser Punkt vermutlich durchsetzen. Abb. 203 Typografische Maßeinheiten 144
145 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Die erste Entscheidung betrifft meistens die Größe der Grundschrift, Brotschrift bzw. Werkschrift, meist zw. 8 und 12 Punkten (Kinderbücher eher 11 bis 14 Punkte; Overhead- Präsentationen 14 bis 16 Punkte). Konsultationsgrößen beziehen sich in der Buch- und Zeitschriftengestaltung auf kleinere Textmengen wie Marginalien und Fußnoten, die dem Lesetext beigeordnet sind. Ihr Schriftgrad liegt zwischen 6 und 8 Punkt. Abb. 204 Gliederung der Schriftgrade 145
146 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Überschriften müssen nicht unbedingt größer sein als die Grundschrift. Z. B. kann eine Überschrift durch ihren großen Abstand zum übrigen Text gekennzeichnet sein. Es lässt sich ein Text auch mit Lehrraum gestalten, ohne den Schriftgrad zu verändern, z. B. bei mehrspaltigen Webseiten, um die Schrift in einem einheitlichen Grundlinienraster zu halten. Abb. 205 Beispiel Überschrift und Fließtext 146
147 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Schriftgrade als Gestaltungsmittel. Vorsicht! Dies kann die Lesbarkeit erheblich beeinträchtigen. Schriften werden auch räumlich erfahren. Große Schriften wirken nah, kleine fern. Abb. 206 Beispiel Schriftgrade als Gestaltungsmittel 147
148 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Mit einem Typometer lassen sich in erster Linie der Zeilenabstand und die Schriftgröße ausmessen. Abb. 207 Typometer 148
149 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Punzenbreite und Laufweite Wenn der Text von der optimalen Laufweite abweicht, sieht er mit größerer Laufweite besser aus, als wenn er zu eng gesetzt wird. Abb. 208 Punze Abb. 209 Unterschiedliche Laufweiteneinstellungen 149
150 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Abb. 210 Geviert Wortabstand - Schriftspezifische Laufweiten und Abstände Der Wortzwischenraum sollte immer in Zusammenhang mit der Laufweite oder dem Buchstabenabstand gesehen werden. Bei einer größeren Laufweite muss auch der Wortabstand proportional vergrößert werden, um als solcher erkennbar zu sein. In der unteren Abbildung werden die Punzenbreiten des n in verschiedenen Schriften gezeigt. Die Punzenbreite einer mageren Schrift ist größer als die einer fetten Schrift. Entsprechend können die Laufweite und der Wortabstand eines mageren und breiten Schriftschnittes größer sein als die eines fetten und schmalen Schriftschnittes. Der Wortabstand wird in Geviert gemessen. Das klassische Maß für den durchschnittlichen Wortzwischenraum ist der dritte Teil eines Gevierts. Kleine Schriftgrade (Konsultationsgrößen) werden mit einem Halbgeviert als normalem Wortzwischenraum gesetzt, damit die Buchstaben optisch nicht zusammenlaufen. Bei größeren Schriften (Schaugrößen) können die Abstände kontinuierlich verkleinert werden. Je größer der Schriftgrad, desto enger können die Abstände gesetzt werden. Abb. 211 Geviertabstände 150
151 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Abb. 212 Individueller Wortabstand Textelemente, die für das Erscheinungsbild einer Seite von besonderer Bedeutung sind, wie Kapitelüberschriften, Anreden und Schlagzeilen, sollte individuell korrigiert werden. Je größer die Schrift desto größer die optischen Unterschiede in den Wortabständen. 151
152 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Abb. 213 Buchstabenabstand 152
153 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Zu jedem Schriftschnitt gibt es eine sogenannte Unterscheidungstabelle. Bei Adobe sind dies separate AFM- Dateien (Adobe Font Metrics). In diesen Tabellen ist festgelegt, bei welchen Buchstabenverbindungen der Abstand verringert (unterschnitten) bzw. vergrößert (gesperrt) werden muss. Individuelle Unterscheidungswerte werden bei den meisten Firmen nur für die wichtigsten bzw. kritischsten Buchstabenverbindungen festgelegt. Bei dem Schriftschnitt Gill Sans werden beispielsweise die Buchstabenverbindungen WA und LT mit einem fünftel Geviert unterschnitten, nicht aber LO. Abb. 214 Buchstabenabstand 153
154 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Zu den Zeichen, die optisch viel freien Raum entstehen lassen, gehören besonders die Großbuchstaben A, L, T, V, W. Bei den Kleinbuchstaben sind es f, r, v, y Das Unterschneiden von umfangreichen Texten ist allerdings viel zu aufwendig. Für die meisten Schriften stehen deshalb Unterscheidungstabellen zur Verfügung. Abb. 215 Unterschneidungstabelle Abb. 216 Textbeispiel Buchstabenabstand Extreme Veränderungen in der Laufweite, überlegt angewendet, erzeugen Aufmerksamkeit und Spannung. Abb. 217 Beispiel extreme Laufweiten 154
155 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Abb. 218 Schrifthöhe und Zeilenabstand Gliederung der Schrifthöhe Die Kegelhöhe lässt sich unterteilen in Ober-, Mittel- und Unterlänge. Die Versalhöhe ist die Höhe der Großbuchstaben. Die Versalhöhe ist meistens etwas kleiner als die Oberlängen der Kleinbuchstaben h oder b. Optischer und numerischer Zeilenabstand Der optische Zeilenabstand wird beim gemeinen Satz (Groß- und Kleinbuchstaben) von der Grundlinie zur Mittellänge der nächsten Zeile gemessen. Beim numerischen Zeilenabstand wird die Distanz von Schriftgrundlinie zu Schriftgrundlinie gemessen (Typometer). Kompressor und durchschossener Satz Schließen zwei Zeilen mit ihren Kegelhöhen aneinander an, so wird dieser Satz als kompress bezeichnet. Das Gegenteil nennt man bisweilen noch splendid, d. h. zwischen den Zeilen ist ein zusätzlicher Abstand vorhanden, auch Durchschuss genannt. In den DTP- Programmen wird der Durchschuss als automatischer Zeilenabstand bezeichnet. Die Grundeinstellung liegt bei 120 % des kompressen Satzes. 155
156 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Wenn man eine Textseite aus einiger Entfernung betrachtet, dann sollte der Text den Eindruck einer grauen Fläche vermitteln. Abb. 219 Mittellängen verschiedener Schriften 156
157 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Abb. 220 Zeilenabstand und Bildbeispiele 157
158 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Abb. 221 Wort- und Zeilenabstand Im untersten Textbeispiel ist zu sehen, dass die großen Wortabstände sich bereits störend im kompressen Satz bemerkbar machen. 158
159 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Den linken Rand wichtiger und hervorgehobener Zeilen sollte man nach Möglichkeit optisch korrigieren. Der rechte Rand im Blocksatz kann störend bei zu vielen Trennstrichen ein. Zukünftige Programmversionen werden hoffentlich in der Lage sein, die störenden Trennstriche etwas aus dem Satz herauszustellen, damit der rechte Rand beim Blocksatz optisch als eine Linie abschließt. Abb. 222 Buchstaben aus dem Satz herausgestellt 159
160 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Abb. 223 Textbeispiel zum Zeilenabstand 160
161 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Wenn der Textgestaltung einmal ein wichtigere Rolle zukommt, kann es allerdings interessant sein, durch genau kalkulierte typografische Regelverstöße subtile grafische Qualitäten und Spannungen entstehen zu lassen. Abb. 224 Zeilen kollidieren lassen 161
162 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Abb. 225 Auszeichnungsbeispiel 1 Man unterscheidet zwischen ästhetischer und optischer Auszeichnung. Ästhetische Auszeichnungen Kursiver Schnitt Kapitälchen Mit Einschränkungen auch Großbuchstaben Optische Auszeichnungen Fetter Schnitt Großbuchstaben Sperrungen Unterstreichungen Durch das Entfallen der Mittellängen wirkt der Zeilenabstand bei Versalien sehr ungleichmäßig und unruhig. Durch eine Verkleinerung von ein bis zwei Punkt lässt sich manchmal das Satzbild verbessern. Beim Unterstreichen sollten die Unterlängen nicht durchgestrichen werden. In Abb. 225 ragt das Wort Auszeichnung aus dem Satz heraus. Mehr benötigt es nicht, um etwas hervorzuheben. Doppelte Auszeichnungen sind meist nicht notwendig. In Abb. 226 sind Beispiele für unkonventionelle Auszeichnungen. Abb. 226 Auszeichnungsbeispiel 2 162
163 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Grundsätzlich sollte man im deutsch-sprachigem Raum nur die deutsche oder französische Schreibweise der Anführungszeichen verwenden. Abb. 227 Anführungszeichen und Textstriche 163
164 Typografie Schrift - Schriftgestaltung Initialen können in einem anderen Schriftstil und schnitt gesetzt sein. 1. sollten mit dem linken Textrand gleichmäßig abschließen. 2. muss mit der Grundlinie der letzten Zeile optisch auf einer Linie liegen. 3. Der Abstand zum Fließtext sollte groß genug sein, aber keine Lücke entstehen lassen. (Zu Initialen : Für Puristen ist eine Initiale am Textanfang nicht nötig. Erst innerhalb eines Textes machen Initialen für sie Sinn, da sie dem Leser dann erst in ihrer Funktion als nötige Orientierungshilfe zum Auffinden des anschließenden Textabschnittes dienen.) Abb. 228 Regeln zu Initialen 164
165 Typografie Satz - Satzspiegel Im obigen Beispiel ist die Initiale in einem verhältnismäßig großen Format gesetzt worden, um ein Gegengewicht zum Bild auf der anderen Seite zu bilden. Wenn sich im Layout bereits viele unterschiedliche grafische Elemente befinden, kann der Gebrauch von Initialen bei den Absatzanfängen als störend empfunden werden. Hier sollten besser Einzüge verwendet werden. Abb. 229 Gestaltungsbeispiele für Initialen 3.5 Satz Seitenränder: Goldener Schnitt: Hierbei geht man vom Bund- zum Kopf- zum Außenrand zum Fuß im Verhältnis 2:3:5:8. Für Briefbögen, Visitenkarten, Flugblätter, Plakate, d. h. für einseitige Druckerzeugnisse, wird kein Satzspiegel benötigt. Je schmaler die Spalte, desto eher ist linksbündiger Flattersatz angebracht. Die Spaltenabstände im Blocksatz sollten 4 bis 6 mm betragen, im Flattersatz 3 bis 5 mm. Linien haben Schmuckfunktion oder können durch das Layout führen oder den Flattersatz stützen. Die Linienstärke sollte der Schriftstärke entsprechen, zumeist 0,1 bis 0,3 mm (0,3 bis 0,6 Punkt) Satzspiegel (siehe auch 0 und 3.5.3) Um Bilder, Grafiken und Tabellen in die Spalten einzupassen, sind geradzahlige Spaltenbreiten besser. Daher legt man den Satzspiegel noch nicht endgültig fest, sondern zuerst die Spaltenbreiten und abstände, hieraus dann die Satzspiegelbreite. 165
166 Typografie Satz - Satzspiegel Folgende Elemente sollten auf der Stammseite (Template, Muster, Vorlage) angelegt sein: Format Randeinstellungen Satzspiegel Spaltenbreite, -abstand, -höhe, -linien Schriften, alle Schrifteinstellungen angelegt in Stillisten, Druckformatlisten, Trennungsarten Zeilenabstand Alle Titelarten Rahmenarten Pagina Farbdefinitionen Stammelemente wie lebender Kolumnentitel, Logo, Passerzeichen Bedenken Sie beim Anlegen von Doppelseiten, dass im Bund zumeist kein Beschnitt nötig ist. Allerdings sollte beachtet werden, dass bei größerem Seitenumfang, wenn die Bogen ineinander gesteckt werden (Zusammentragen), der Satzspiegel bezogen auf die Papierdicke, nach außen wandert. Folgende Titel werden unterschieden: Haupttitel (Headline): kurz, prägnant, nur eine Aussage, dominante Wirkung, d. h. kein anderes Gestaltungselement darf mit ihm konkurrieren. Untertitel: ergänzen die Information des Haupttitels bzw. geben dem Haupttitel den gewünschten Sinn. Muss nahe beim Haupttitel stehen, darf auf keinen Fall dominierend wirken und muss schnell erfassbar sein. Zwischentitel (Subline): Gliedern den Fließtext. Die Registerhaltigkeit muss erhalten bleiben. Die Anordnung kann sein: eine Blindzeile (Leerzeile) nach dem Absatz Zwischentitel ohne Blindzeile darauffolgender Textblock; oder: zwei Leerzeilen Zwischentitel eine Leerzeile Textblock (halbfett in der gleichen Schriftgröße oder um einen Schriftgrad größer). toter und lebendiger Kolumnentitel (Rubriktitel) 166
167 Typografie Satz - Satzausrichtung Satzausrichtung Man unterscheidet Beim Blocksatz gibt es drei Möglichkeiten den Text auf Spaltenbreite zu setzen. 1. Wortzwischenräume etwas verringern. 2. Wort trennen. 3. Wortzwischenräume vergrößern. Breite Textspalten wirken deshalb ausgeglichener im Blocksatz, andererseits können sie die Lesbarkeit beeinträchtigen. Abb. 230 Spaltenbreite und Lesbarkeit 167
168 Typografie Satz - Satzausrichtung Flattersatz und Rauhsatz Stufen-bildungen und Rundungen sollten vermieden werden. Beim linksbündigen Flattersatz werden die Zeilen ohne Silbentrennung umgebrochen. Durch Silbentrennung erreicht man den Rauhsatz. Abb. 231 Beispiel Flattersatz und Rauhsatz Abb. 232 Beispiel Mittelsatz Durch den Mittelsatz erzielt man eine repräsentative, vornehme oder würdevolle Wirkung, andererseits wirkt es auch traditionell und konservativ. Vertikal sollte der Text ausgeglichen wirken, horizontal entsprechend abwechslungsreich und rhythmisch. Schlanke bis vollschlanke Textkörper entsprechen noch am ehesten dem typografischen Schönheitsideal. Wie in der Natur auch sind extreme (zu schlank, zu dick) nicht mehr schön. 168
169 Typografie Satz - Satzausrichtung Formsatz Der Text umfließt ein ungleichmäßiges (z. B. rundes) Bildelement. Bei Signets, Plaketten, Gütesiegeln und Abzeichen findet man häufig Text anhand einer Kurve ausgerichtet. Und drittens kann der Text in eine vorgegebene Form einfließen bzw. selbst Form annehmen. Die letzte Variante sollte inhaltlich begründet sein. Expressive grafische Elemente verlangen eher nach einfachen und ruhigen Satzformen. So kann ein im Blocksatz gesetzter ruhiger Textquader einen schönen Kontrast zu einer bewegten Figur bilden. Oder man arbeitet mit Ähnlichkeit. Zu der symmetrischen Form des Y passt auch die symmetrische Form des Mittelsatzes und beim L bietet sich ein rechtsbündiger Flattersatz an. Abb. 233 Beispiel grafische Formen 169
170 Typografie Satz - Layout Gestaltungsraster Layout Gestaltungsraster Angemessenheit, Klarheit, Originalität Spannung durch Größengefälle Balance Einheitlichkeit Rhythmus Betonung (v. Wichtigem) Abb. 234 Layout - Einheitlichkeit Im oberen Bereich scheint der Balken (Überschrift) leichter als im unteren. Abb. 235 Layout - Überschrift und Raum 170
171 Typografie Satz - Layout Gestaltungsraster Welches Bildformat? Zerfällt der Gesamteindruck einer Seite: Zerfällt eine Fläche oder der Hintergrund in diverse zusammenhanglose Bereiche, oder korrespondieren diese durch Formübereinstimmungen und feine Übergänge miteinander? Ist die Überschrift groß genug? Welches Element soll dominieren Überschrift, Bild oder Fließtext? Soll die Überschrift mehr der Abbildung oder dem Lesetext zugeordnet werden? In der unteren Abbildung stehen die Streifen für einen Fließtext, wobei jeder Streifen die Höhe der Schrift besitzt. In der grafischen Gestaltung nennt man sie Faksimiletext. Abb. 236 Layout - Gestaltungsbeispiele 171
172 Typografie Satz - Layout Gestaltungsraster Elemente ordnen und strukturieren. Abb. 237 Layout - Gestaltungsbeispiele Weitere Gestaltungselemente verwenden: Tonwerte, Rhythmus, Flächenspannungen, Abb. 238 Layout - Gestaltungsbeispiele 172
173 Typografie Satz - Layout Gestaltungsraster Gestaltungsbeispiele Abb. 239 Satz - Gestaltungsbeispiele 173
174 Typografie Satz - Layout Gestaltungsraster 174
175 Typografie Satz - Layout Gestaltungsraster 175
176 Typografie Satz - Layout Gestaltungsraster Rastergestaltung 1. Ein Raster hilft, die Fläche zu organisieren und zu gestalten. 2. Es hilft, die Information systematisch zu ordnen und zu gliedern. 3. Es hilft, Informationen in ein einheitliches System zu integrieren. 4. Es hilft, die eigenen Arbeiten zu organisieren und effektiver zu gestalten. Abb. 240 DIN-Formate und harmonische Seitenformate 176
177 Typografie Satz - Layout Gestaltungsraster Der Satzspiegel wird von vier Randbereichen eingerahmt, die man Stege nennt. Abb. 241 Randabstände einer Doppelseite Abb. 242 Geometrische und optische Mitte 177
178 Typografie Satz - Layout Gestaltungsraster In der klassischen Buchgestaltung lassen sich die Randabstände des Satzspiegels durch eine einfache Diagonalkonstruktion ermitteln. Obere Abbildung: Wenn Sie links oben auf der Diagonalen den oberen Rand des Satzspiegels nach eigenem Ermessen festgelegt haben, ergeben sich die anderen Randabstände von selbst. Untere Abbildung: Wenn sie den oberen Randabstand geometrisch festlegen wollen, können Sie eine Gerade durch den Schnittpunkt ziehen, an dem sich die beiden Diagonalen auf der rechten Seite kreuzen. Das obere Ende der geraden verbinden Sie mit dem Kreuzungspunkt auf der nächsten Seite. Damit legen Sie den Punkt fest, an dem der obere Satzspiegelrand beginnen soll. Abb. 243 Satzspiegel - Zwei Konstruktionsmethoden 178
179 Typografie Satz - Layout Gestaltungsraster Abb. 244 Konstruktion eines Rasters mit Spalten Wie viele Spalten für welchen Zweck? 1. Ein einspaltiger Satzspiegel ist am besten für textorientierte Publikationen geeignet, die nicht viel größer sind als die gängigen Taschenbuchformate. 2. In einem zweispaltigen Satzspiegel können z. B. die Bilder in die eine Spalte, der Text in die andere gesetzt werden. 3. Drei Spalten sind typisch für Broschüren und Anzeigen. 4. Vier Spalten finden sich häufig bei Zeitungen. 5. Mehr Spalten ermöglichen eigenwillige Seitenlayouts. 6. Die Spaltenaufteilung kann von Seite zu Seite variiert werden. Spaltenabstand und Spaltenlinien 4spaltig = 2-3 mm 3spaltig = 3-5 mm 2spaltig = 4-6 mm 179
180 Typografie Satz - Layout Gestaltungsraster Verschiedene Schriftgrößen können ins Grundlinienraster passen, wenn man sie entsprechend proportional festlegt. Die untere Abbildung zeigt die Schriftgrößen bei einem 12 pt Grundlinienraster. Abb. 245 Einpassen verschiedener Schriftgrößen in das Grundlinienraster Abb. 246 Schriftgrößen im Grundlinienraster 180
181 Typografie Lesetypografie - Lesearten In nebenstehender Abbildung orientieren sich alle Beispiel am gleichen Raster. Es sollte mit einem Raster so verfahren werden, dass es in der fertigen Layoutlösung nicht mehr sichtbar hervortritt. Abb. 247 Ausfüllen eines Rasters - Beispiele 3.6 Lesetypografie Die Grundregel lautet: Gleiches gleich behandeln! Zum Beispiel die Regel, dass alle Kolumnen der verschiedenen Seiten gleich hoch sein müssen. Dies gilt noch mehr für die Abstände zwischen den Kolumnen. Aufgrund dessen handelt es sich bei dieser Grundregel um eine Richtlinie, die entsprechend begründet umgangen werden kann Lesearten Lineares Lesen Lineares Lesen Zielgruppe Buchtypen Typografische Mittel Auszeichnungen Überschriften Ist der Papierrand um den Satzspiegel zu schmal, kann die Umgebung um das Buch herum vom Lesen ablenken. Hoch weißes Papier zu schwarzer Schrift gibt einen zu großen Kontrast und strengt das Auge an; gebrochenes Papier ist besser. Freiwillige Leser; möglichst großer Lesekomfort Erzählende Prosa, wenig strukturierte Texte, Roman Unaufdringliche Schrift, Leseschriftgrade ca Pt, enger Satz ohne Löcher, ca Zeichen/Zeile, Zeilen/Seite, ausgewogene Proportionen von Satzspiegel und Papierrand Integrierte Auszeichnungen: kursiv für Betonungen, Zitate und Ähnliches, Kapitälchen für Eigennamen Betonen die Individualität des Buches Informierendes Lesen Informierendes Lesen Diagonales Überfliegen 181
182 Typografie Lesetypografie - Lesearten Zielgruppe Buchtypen Typografische Mittel Auszeichnungen Überschriften Leser, die sich über Sachzusammenhänge informieren wollen, ohne ein ganzes Buch lesen zu müssen Sachbücher, Ratgeber; Prototyp: Zeitung Kürzere Zeilen, ca Anschläge pro Zeile oder kurze Abschnitte Häufig zweispaltig (schneller Überblick) Zwischenüberschriften unterscheiden sich deutlich Absätze durch Leerzeilen getrennt Beim Blocksatz stören Lücken im Text hier nicht, da diagonal gelesen wird (Hypothese) Aktive Auszeichnungen gliedern die Informationsabschnitte (z. B. halbfette Schrift), integrierte Auszeichnungen Kurze und deutliche Auskunft über den Inhalt des Abschnitts Differenzierende Typografie Differenzierende Typografie Zielgruppe Buchtypen Stark strukturierte Texte, bei denen verschiedene Begriffe in unterschiedlicher, jedoch gleichberechtigter Form dargestellt werden. Wissenschaftler sind routinierte Leser (kein Lesekomfort) Berufsleser, denen man längere Zeilen und vollere Seiten zumuten kann. Wissenschaftliche Bücher, Lehrbücher, Sonderform: Dramensatz Typografische Mittel Kursiv, Kapitälchen, halbfetter und halbfett-kursiv; bis zu 80 Zeichen/Zeile Auszeichnungen Überschriften Kursiv, Kapitälchen mit oder ohne Versalien, halbfett, Versalien, Sperrung, halbfett kursiv, halbfette Kapitälchen, kursive Kapitälchen, halbfette Versalien, leichte Schrift, Unterstreichungen, Schriftmischungen, Farbe Erkennbar durch ihre typografische Form Konsultierendes Lesen Konsultierendes Lesen Zielgruppe Buchtypen und Buchteile Gezieltes Aufsuchen bestimmter Begriffe oder Passagen Besonders motivierte Leser, die eine präzise Auskunft suchen. Nachschlagewerke; Fußnoten, Anmerkungen, Register, Bibliografien, Zeittafeln; Prototyp: Lexikon Fahrplan, Börsenkurse, Kino-, Theater-, Fernsehprogramm 182
183 Typografie Lesetypografie - Lesearten Typografisches Mittel Auszeichnungen Überschriften Kleine Schriftgrade, gut lesbare Schriften, knapper Zeilenabstand, volle Seiten, mehrspaltiger Satz Stichworte so deutlich wie möglich; andere Auszeichnungen ein- oder untergeordnet, je nach Funktion und Leseart. Deutlich gliedernd. Selektierendes Lesen Selektierendes Lesen Zielgruppe Buchtypen Typografische Mittel Auszeichnungen Überschriften Inhaltliche und typografische Gliederung eines Buches in verschiedene Ebenen, die auch unabhängig voneinander gelesen werden können. Lehrer, Schüler; da Schüler vielleicht nicht sehr motiviert sind, benötigt man einen hohen Lesekomfort. Didaktische Bücher; Kochbücher; Prototyp: Schulbücher Schulbücher sollen so gestaltet sein, dass man ohne Mühe findet, was man lernen soll. Die Gestaltung darf nicht ablenken. [Anm.: Die meisten Schulbücher sind einspaltig. Eine zweite Spalte dient z. B. Bildern und einer allg. Inhaltsorientierung.] Eindeutige typografische Trennung der verschiedenen inhaltlichen Ebenen. Gesamtes grafisch-typografisches Arsenal; aber nicht überstrapazieren Eindeutig in ihrem hierarchischen Stellenwert Typografie nach Sinnschritten Typografie nach Sinnschritten Zielgruppe Buchtypen Überschriften Typografische Mittel Gliederung des Zeilenfalls nach dem Sinnzusammenhang und nicht nach formalen Vorgaben. Leseanfänger jeden Alters. Fibeln, Bilderbücher, Lehrbücher für Fremdsprachen, Textaufgaben, Bildlegenden Inhaltsverzeichnis, Kapitelüberschriften: Sind sie zweizeilig, sollte die zweite Zeile entsprechend eingerückt sein, keinesfalls auf volle Breite Typografie nach Sinnschritten ist Pflicht. Sinngerechte Zeilenbrechung vor allem für Leseanfänger; kurze Texte, die schnell erfasst werden sollen 183
184 Typografie Lesetypografie - Voraussetzungen Aktivierende Typografie Aktivierende Typografie Typografische Gestaltung, die zum Lesen verleiten soll. Ist die Welt des Grafik- bzw. Kommunikations-Designers. Grundgesetz der aktivierenden Typografie: Anders sein, auffallen, neugierig machen! Zielgruppe Buchtypen Typografische Mittel Überschriften Leser, die keine Leser sein wollen; Schüler, die zum Lesen motiviert werden sollen; Abhebung von der Konkurrenz. Geschenkbücher, Schulbücher, Sachbücher; Prototyp: Magazin Kaum Einschränkungen. Sollen inhaltlich und formal den Leser einfangen. Inszenierende Typografie Inszenierende Typografie Zielgruppe Buchtypen Typografische Mittel Ein Text wird durch die Gestaltung gesteigert, in Maßen interpretiert, verfremdet, nicht aber dekorativ gegen die Sprache gerichtet ist. Nicht zu verwechseln mit dem Kalligramm oder der visuellen Poesie, bei denen Form und Aussage identisch sind. Leser, die Spaß am typografischem Vergnügen haben; Leser, die Anspielungen und formale Zitate verstehen und schätzen; Leser, die bereit sind, sich mit einem Text stark auseinanderzusetzen. Fast alle Arten von Büchern; Für Buchtypen mit strengen Strukturen (Lexika) kommt die typografische Inszenierung nicht in Frage. Unendliche Gestaltungsmittel. Systematik der Lesearten Lesearten können in einem typografischen Werk gemischt auftreten, bis hin zu einem ad absurdum, in dem alle Lesearten zum Tragen kommen. Die Systematik soll, aus der Praxis der Buchgestaltung heraus entstanden, bei eigenen Überlegungen und bei Gesprächen mit Auftraggebern helfen. nicht Schubladen öffnen, in denen man etwas verstauen kann. kein Vorschriften-Werk sein. die Antwort auf die Frage erleichtern: Was will ich eigentlich machen? Voraussetzungen Es gibt für die Typografie Voraussetzungen in jedem Anwendungsfall, die bedacht werden müssen. Alles, was der Typograf bei der Anlage des Satzdokuments oder in der Satzanweisung festlegt, hat 184
185 Typografie Lesetypografie - Voraussetzungen mit Lesbarkeit zu tun, unabhängig davon, ob es sich um eine Zeitung, einen Beipackzettel, einen Fahrplan etc. handelt. Die typografische Grundkonzeption Die Wahl der Schrift Schriftgröße Satzbreite Laufweite Zeilenabstand Zeilenzahl oder Bildflächengröße Die Grundeinstellungen für die verschiedenen Satzarten Auszeichnungen und Gliederungen Die Angaben für die Satzdetails Zum Verständnis der Typografie der Lesearten wird folgendes Wissen vorausgesetzt: Wahrnehmungsvorgang (Fixation, Augensprung etc.) Schriftgeschichte (Renaissance-, Barock-, klassizistische Antiqua, Grotesk, serifenlose Frakturen etc.) Typografische Begriffe (Blocksatz, Flattersatz, Kolumne, Zwischenschlag, Unterschneidung, Kerning etc.) Buchspezifische Begriffe (Vorsatz, Bundsteg, Schmutztitel, Falz etc.) Typografische Maßsysteme (Didot-Punkt, mm, Pica-Point, Durchschuss, Zeilenabstand etc.) Materialien (Druckpapiere, Vorsatz, Überzugsmaterialien, Folien etc.) Das Wort Die Schablonen-Theorie ist die für Schriftentwerfer und Typografen plausibelste Erklärung, wie wir uns Buchstaben einprägen. Durch häufiges Lesen prägen wir uns ganze Wortbild-Schablonen ein. Unbekannte Wörter sind Leseflusshemmer, können jedoch aufgrund des Sinnzusammenhangs entschlüsselt werden. Besondere, auch besonders schöne Buchstaben verändern das gewohnte Wortbild und stören beim Lesen. Aber wenn die Buchstaben zu ähnlich sind, kann die Wortbild-Schablone versagen (z. B. ein großes I oder kleines l; i oder l). Nicht die einfachsten, sondern die eindeutigsten Buchstabenformen ergeben die einprägsamsten Wortbilder. Die Zeile Wir lesen mit ruckartigen Augenbewegungen. Während einer Saccade sieht das Auge nichts, erst bei der Fixation. Bei einer Fixation sieht man ungefähr die Menge von neun Zeichen auf einmal. Passen die neun Zeichen nicht in eine bekannte Schablone, wird zuerst regressiv analysiert, d. h. das Auge springt zur nächsten Fixation und erkennt das Vorherige aus dem Zusammenhang, falls nicht, muss buchstabiert werden. Unklare Wortzusammenhänge, zu große Abstände, zu geringe Abstände, grundlos auffallende andere Elemente bedeuten Verzögerung. Ein Teil der Aufmerksamkeit wird der Beschäftigung mit dem Inhalt entzogen. Das ist eine Definition für schlechte Lesbarkeit. Die Seite Bilder in mehrspaltigen Layouts können Konfusion über die Reihenfolge des Lesens verursachen. Unklare Anordnung, Ablenkung z. B. durch visuelle Lautstärke stören beim Lesen. Das Blättern Ein Buch ist ein sinnliches Ding. Bei jedem Umblättern wird der Körper des Buches gespürt: das Material des Einbandes, des Papiers, der Klang des Papiers, der Geruch etc. Bei der Gliederung der Typografie in verschiedene Räume, wie z. B. Proportionen, Strukturen, Flächen, liegt eher der Vergleich des Typografen mit einem Architekten nahe denn einem Grafiker. Ein Buch ist ein kinetisches Objekt: Beim Umblättern vergeht Zeit und findet Bewegung statt. Im Le- 185
186 Typografie Lesetypografie - Voraussetzungen ser entsteht eine Spannung und Erwartungshaltung. Am verwirrendsten für den Leser ist, wenn etwas als abgeschlossen geblaubtes plötzlich auf der nächsten Seite weiter geht: z. B. Gedicht, Fußnote oder Aufzählung, die letzte Zeile eines Absatzes oder gar Kapitels usw. Format Besondere Formate bei Bildbänden, Quer-, Hochformat, Spalten. Bei quadratischem Format sollte die Breite etwas geringer sein als die Höhe. Exakt quadratische Formate wirken querformatig. Bei reinen Textbänden sind Bücher im Größenbereich von ca. 9 x 15 cm bis höchstens 14 x 22 cm lesegerecht. Gewicht Bei großformatigen Büchern, die man auf den Tisch legt, kann das Gewicht keine so große Rolle spielen, wie die in der Hand gehaltenen Bücher. Papier Wie wird das Buch benutzt? Wie lange soll es leben? Was soll es kosten? Was ist wichtiger: die Lesbarkeit der Schrift oder exakte Farben der Bilder? Läßt sich das Papier gut falzen und blättern? Gestrichenes Papier, Naturpapier, Kunstdruckpapier? Hochweiße, glänzende Papier stören erheblich die Lesbarkeit. Aber zum Beispiel eignet sich hochweißes Kunstdruckpapier gut für ein farbgetreue Bildwiedergabe, allerdings sollte man aufgrund einer schlechteren Lesbarkeit (Kontrast) eine stabile Schrift wählen. Durchscheinen Jede Verschiebung des Zeilenregisters stört beim Lesen. Bildflächenunterschiede und Überschneidungen durch Standdifferenzen von nur wenigen Millimetern müssen grundsätzlich vermieden werden. Ganz opak sind nur holzschliffartige, stark gefüllte oder extrem dicke Papiere. Da die meisten Papiere durchscheinend sind, muss besonders auf das Zeilenregister geachtet werden. Bei einem verschobenem Register sollten die Proportionen eingehalten werden, z. B. durch halbe Leerzeilen zwischen Überschrift und Text, die bewirken, dass jeder zweite Absatz wieder registerhaltig ist. Die Registerhaltigkeit wird durch drei Faktoren bestimmt: fehlerhafte Satzausführung (Zwischenüberschriften verschieben das Register ungleichmäßig) Stand-ungenauigkeiten bei Schön- und Widerdruck Verschiebungen beim Falzen Schrift Die Wirkung der Schrift (siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) [evtl. Teile dieses Kapitels übertragen] Schrift in einem Buch muss zweierlei leiste: Sie muss funktionieren, also dem jeweiligen Zweck des Buches, seiner Leseart, entsprechen. Sie soll die Wellenlänge des Textes haben, ihre formale Ausstrahlung soll den Charakter des Buches widerspiegeln. Schrift und Lesbarkeit Ein Text ist gut lesbar, wenn der Leser nicht merkt, dass er liest. Die Füßchen von Serifenschriften unterstützen die Zeilenführung, weshalb es mit ihnen einfacher ist einen längeren Text zu gestalten. Kriterien der Lesbarkeit von Schriften 186
187 Typografie Lesetypografie - Voraussetzungen unverwechselbare Einzelformen der Buchstaben Trennschärfe: Die Buchstaben müssen sich deutlich von ihren Nachbarn abheben. Die Buchstaben müssen leicht erkennbare Wortbilder erzeugen. Die Wörter müssen zur Zeilenbildung imstande sein. Zurichtung und Laufweite Für die Lesbarkeit eines Textes sind wichtig: Typografie Buchstabenform Detailtypografische Durcharbeitung Detailtypografie Durch die Zurichtung hat jeder Buchstabe eine bestimmte Breite: die Dickte. Durch das Kerning werden für bestimmte Zeichenpaare optimale Abstände definiert. Anpassung der Laufweite (engerer Buchstabenabstand. Verringerung der Wortzwischenräume und Laufweite bei großen Schriftgraden. Vergrößerung der Laufweite bei kleinen Schriftgraden. gleichmäßig weiterer oder Kerning und Ligaturen Beim Kerning wird bei bestimmten Buchstabenkombinationen ein optimaler Zeichenabstand eingestellt, so dass das Schriftbild rhythmisch und gleichmäßig wirkt. Beim Randausgleich werden Zeichen mit viel Fleisch geringfügig über die Satzkante hinaus geschoben. Ligaturen sind Buchstabenkombinationen, die als eigenes Schriftzeichen gezeichnet sind ( fi, fl ). Im Deutschen werden Ligaturen nicht generell gesetzt, z. B. nicht bei Wortfugen ( Auflage ). Laufweite und Lesbarkeit beträgt bei allen Text-, Satz- und Layoutprogrammen in allen Schriftgrößen null. Doch sehr viele Schriften brauchen eine schriftgrößenabhängige Veränderung der Laufweite. Wortabstand und Lesbarkeit Die Wörter einer Zeile müssen eindeutig voneinander getrennt sein, zugleich muss verhindert werden, dass das Auge in die falsche Zeile abrutscht. Der Wortabstand muss kleiner sein als der Zeilenabstand. Zeilenabstand und Lesbarkeit Je länger die Zeilen, desto größer muss der Zeilenabstand sein, je kürzer die Zeilen, desto geringer kann der Zeilenabstand sein. Weitere Komponenten der Lesbarkeit Die Wahl der richtigen Schrift Satzqualität (Laufweite, Wortabstand, Detailtypografie) Je größer die Textmenge ist, desto höher sind die Anforderungen an den Lesekomfort. Die entscheidenden Faktoren sind dabei die Verhältnisse von Schriftgrad, Laufweite, Zeilenlänge und Zeilenabstand. Übersichtlichkeit (Strukturierung v. Textgruppen, Seitengliederung etc.) Papieroberfläche, -färbung Ort und Lichtverhältnisse Lese-Erfahrung, -Motivation 187
188 Typografie Lesetypografie - Voraussetzungen Orthotypografie Orthotypografie ist die korrekte Detailtypografie. Richtig oder falsch gibt es in der Typografie nicht. Viel wichtiger sind Fragen wie: Wie wird gelesen? Was soll erreicht werden? Welche Mittel sind dafür geeignet? Wie müssen diese Mittel eingesetzt werden? Bei der Orthotypografie hingegen gibt es eindeutige Regeln. Übereinanderbelichtungen entstehen bei Buchstaben, deren Bild größer ist als ihre Dickte. Zeichen dürfen sich aber niemals berühren. Satzzeichen vor allem!? : ; dürfen nicht am letzten Buchstaben des vorherigen Wortes kleben. Sie sind kein Bestandteil des Wortbildes. Deutsche Anführungszeichen Sperren Kapitälchen ß in Kapitälchen Gedankenstrich (Streckenstrich, Minuszeichen) Kursivieren (elektronische Schrägstellung) Auslassungspunkte dürfen nicht durch Zollzeichen ersetzt werden. richtig und "falsch" (beide Anführungszeichen hochgestellt) ist eine Auszeichnungsart. Durch das Aufteilen des Restraums einer Zeile auf die Blocksatz-Zeilenbreite wird die Zeile gesperrt und damit zufällig, ohne inhaltlichen Grund, ausgezeichnet. Das ist verboten. dürfen nicht durch Verkleinerung von Versalien, sogenannte falsche Kapitälchen, imitiert werden. gibt es nicht, es muss ss gesetzt werden; ebenso bei Versalien. darf nicht durch das Divis (Trennungsstrich, Bindestrich) ersetzt werden. Der Buchstabe x sollte nicht als Mal-Zeichen [Formel einfügen] verwendet werden. verunstaltet die Schrift. Es muss immer die eigens gezeichnete Kursive verwendet werden. dürfen nicht zu eng und nicht zu weit stehen. 188
189 Typografie Lesetypografie - Satzspiegel Schließende Anführungen und Apostrophe dürfen nicht verwechselt werden. Grundregeln zum Absatz Bei einer 12 Pt-Schrift nimmt man für gewöhnlich 6 Pt Absatzabstand nach einem Absatz. Gleiche Abstände zwischen den Absätzen sind vorrangig gegenüber gleich hohen Kolumnen Satzspiegel Wie wird ein Buch gebunden und gefalzt? Wie dick ist das Buch? Welches Papier wird verwendet? All das wirkt sich auf die Aufschlagfähigkeit und damit auf den Stand des Satzspiegels aus. Entscheidend sind die Proportionen des Satzspiegels mittels des Goldenen Schnitts oder ähnlichen Proportionen. Abb. 248 Satzspiegel - Konstruktion Der Bund-Schwund muss immer berücksichtigt werden (s. Abb.) Abb. 249 Satzspiegel Bund-Schwund 189
190 Typografie Lesetypografie - Satzspiegel Welches Seitenformat, welche Textmenge wird benötigt? Wie wird das Buch gelesen (im Sitzen oder Liegen etc.)? Bei ungünstigen Seitenverhältnissen, z. B. den Formaten der DIN-A-Reihe, kann man nach dem gleichen Prinzip wie beim Goldenen Schnitt und seinen Verwandten die Satzspiegel- Proportionen den Verhältnissen der Seite anpassen. Abb. 250 Satzspiegel-Proportionen Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Proportionen des Satzspiegels in einem bewussten Gegensatz zum Seitenverhältnis stellt. Ein schlanker Satzspiegel in einem stumpfen Format kann dieses strecken. Abb. 251 Satzspiegel betont schmal Ein breiter, die Horizontale betonender Satzspiegel lässt das Buchformat breiter erscheinen. Abb. 252 Satzspiegel betont breit 190
191 Typografie Lesetypografie - Satzspiegel Bedruckte und unbedruckte Fläche Klassischer Satzspiegel Der unbedruckte Papierrand hat die Funktion eines neutralisierenden Passepartouts, das für das lesende Auge den Text von der Umgebung abschirmen soll. Wäscheleinenprinzip (Gegenteil: Regalbrett) Das Verhältnis von bedruckter zu unbedruckter Fläche ändert sich. Durch die unterschiedlichen Spaltenhöhen ergibt sich auf jeder Seite eine anders proportionierte unbedruckte Fläche, die einen zusammenhängenden Kontrapunkt zur bedruckten Fläche bildet. Bilder können sich in dieses Prinzip fügen oder es durchbrechen. 191
192 Typografie Lesetypografie - Satzspiegel Rasterschema führt zu mehr oder weniger zufälligen unbedruckten Restflächen. Bilder sind hier häufig dominant. Freie Gestaltung Bedruckte und unbedruckte Flächen werden gleichwertig eingesetzt. Die unbedruckte Fläche ist hier jedoch nicht Zufall, sondern aktiver Partner von Text und Bild Satzart und Lesen Welche Satzart ist für den Text richtig? Gute Typografie kann man nicht ausrechnen. Wenn die Typografie vom Inhalt ablenkt, wird sie zur störenden Dekoration. Rechtsbündiger Flattersatz Kurze Texte (z. B. Bildlegenden, Marginalien, Überschriften etc.), da es mühevoll für das Auge ist, den Zeilenanfang zu finden. Mittelachse Formsatz Kurze Texte. Eine trichterförmig sich verjüngende Spitzkolumne ist heute nur noch als typografisches Zitat denkbar. Inszenierende Typografie, die eher selten zum Einsatz kommt. Wird oft zur Platzersparnis eingesetzt; er umfließt dann etwa freigestellte Bilder. 192
193 Typografie Lesetypografie - Satzspiegel Blocksatz Rauhsatz Flattersatz Flattersatz ohne Trennungen Auch ausgeschlossener Satz genannt. Ist die Norm unter den Lesearten. Taugt jedoch nicht für kürzere Zeilen. Die zu lösende Problematik besteht in zu großen Wortabständen o- der schlechte und häufige Trennungen. Kleine Wortabstände, dafür schlechte und häufige Trennungen erzeugen ein ruhiges Satzbild. Flattersatz, bei dem das Trennen auch zweibuchstabiger Silben erlaubt ist. Ist nur bei billigen, kurzlebigen Erzeugnissen vertretbar. Ruhiges Satzbild aufgrund der gleichmäßigen Wortabstände. Hier ist jedoch auf Trennungen zu achten, die irritieren können: Zwei- oder Drei-Buchstaben-Wörter am Ende einer Zeile, Namenstrennungen, Trennung von Lebensdaten, abgekürzten Vornamen usw. Kann wegen der vielen zusammengesetzten Wörter im Deutschen nicht eingesetzt werden. Trennungen dürfen nicht irreführen. Flattersatz erfordert einen zusätzlichen Korrekturgang Spaltensatz Ist der Zwischenschlag kleiner als die Ausgangs-Leerzeile, besteht die Gefahr, dass das Auge den Zwischenschlag überspringt und in der falschen Spalte weiter liest. Zwischenschlag und Ausgangs- Leerzeilen sind optisch gleich groß. Das kann als klares weißes Maßwerk, aber auch als spannungslose Härte empfunden werden. Keine Gefahr des Überspringens mehr. 193
194 Typografie Lesetypografie - Satzspiegel Zwischenschlag ist größer als die Leerzeile. Die Spalten bilden nicht mehr gemeinsam einen Satzspiegel, sondern stehen einzeln nebeneinander auf der Seite. Bei Flattersatz besteht die Gefahr des Überspringens in die Nachbarspalte nicht, da der immer gleichmäßige Wortabstand gegenüber dem Zwischenschlag von vornherein ausbalanciert werden kann. Der Zwischenschlag kann geringer bemessen sein als beim Blocksatz, da er optisch größer wird. Die trennenden Spaltenlinien aktivieren die Weiß-Flächen der Ausgangszeilen und der Einzüge. Die Spaltenlinien können auch vor der ersten und nach der letzten Spalte stehen. Bei Flattersatz stehen Spaltenlinien vor der Linksachse der Kolumnen, die sich an ihnen wie an einer Fahnenstange festhalten Gedichtsatz (siehe Quelle Lesetypografie S. 94) 194
195 Typografie Lesetypografie - Gliedern und Auszeichnen Dramensatz (siehe Lesetypografie S. 100) Der Satz von Briefen Wichtig ist, dass jeder Brief als eine geschlossenen Einheit erkannt wird. Die Abstände innerhalb und zwischen den Briefen sollten möglichst so bemessen sein, dass der eigentliche Brieftext Zeilenregister oder halbzeilig verschobenes Register hält. [Lesezeichen, nicht verstanden] (siehe Quelle Lesetypografie S. 106) Arbeitsanleitungen Hier folgt auf das Lesen eine entsprechende Handlungsphase, deshalb muss das Auge schnell den Anschluss im Text finden (siehe Quelle Lesetypografie S. 112) Zweisprachiger Satz Die rechte Seite gilt als wichtigere Schauseite. Der Text in der oberen Hälfte wird als bevorrechtigt empfunden. Die linke, also die erste Kolumne, wird als prominenter empfunden. (siehe Lesetypografie S. 112 ff.) Gliedern und Auszeichnen Auf welche Weise soll der Text gelesen werden, wie müssen dann die Auszeichnungen beschaffen sein, damit sie funktionieren? Einzug Einzug und Satzart Blocksatz mit wenigen Absätzen Ohne Einzüge: Absätze können verloren gehen. Als Abhilfe wird an das Absatzende ein Leerraum eingefügt, der nicht zu klein sein darf. Mit Einzügen: Der Absatz bleibt in jedem Fall erhalten, die Seite wird lesefreundlich strukturiert. Blocksatz bei stark strukturiertem Text Ohne Einzüge Mit Einzügen: Wirkt sehr unruhig. Flattersatz Ohne Einzüge: Es ist nicht erkennbar, wann ein Satz zufällig mit einer vollen Zeile endet und wann ein Absatz zu ende ist. Mit Einzügen: Absätze sind klar erkennbar. Zeilenabstand zwischen den Absätzen: Trennen die Absätze stark voneinander. Einzug und Überschrift Wenn Absätze eingezogen werden, ist zu klären, ob der Textbeginn nach Überschriften auch eingezogen werden soll oder ob stumpf begonnen wird. 195
196 Typografie Lesetypografie - Gliedern und Auszeichnen Einzug und lange Überschrift auf Mitte: zufällige, unkontrollierbare Treppenstufen. Bei durchweg kurzen Überschriften oder Kapitelziffern besteht die Gefahr nicht. Bei stumpfem Textbeginn gibt es keine zufälligen Stufen Bei Satz der auf Linksachse verliert die Überschrift an Unterstützung, wenn die erste Textzeile nicht eingezogen wird. Sind Überschrift und erste Textzeile stumpf gesetzt, kann, wenn bald ein neuer Absatz folgt, die Beziehung zur folgenden eingezogenen Zeile verloren gehen. Überschrift und Absatz sind gleich weit eingezogen. Dies unterstützt die Akzentuierung neuer Absätze. (siehe Lesetypografie S. 122 ff.) Einzug, Absatz und Abschnitt Ein Absatz strukturiert den Text innerhalb des inhaltlichen Zusammenhangs. Ein Abschnitt kündigt eine neue Situation, einen anderen Ort, neue Personen, neue Aspekte oder neue Gedanken an. 1. Absatz und Abschnitt beginnen stumpf Absatz und Abschnitt müssen deutlich voneinander getrennt sein, z. B. durch eine Leerzeile vor dem Beginn eines neuen Abschnitts. Abschnittsbeginn stumpf auf neuer Seite Hier ist der Abschnitt vom Absatz nicht mehr zu unterscheiden 2. Absatz und Abschnitt eingezogen Die erste Zeile ist jeweils ein Geviert eingezogen, was durch die kleine weiße Fläche zu einer Hervorhebung führt. Dieser Einzug wirkt beim Absatz aktiver als beim Abschnitt. Abschnittsbeginn eingezogen auf neuer Seite Abschnitt kann mit dem Absatz verwechselt werden. 3. Absatz eingezogen, Abschnitt stumpf Um den Absatz deutlich zu akzentuieren, benötigt er einen Einzug von zwei Gevierten. Der Abschnitt ist durch die Leerzeile ausreichend gekennzeichnet Abschnitt ohne Einzug auf neuer Seite Kann verloren gehen, wenn die Ausgangszeile fast gefüllt ist. 4. Großer Einzug Bei kurzer Ausgangszeile des vorhergehenden Absatzes kann ein großer Absatz-Einzug (z. B. drei Gevierte) durch die sich scheinbar ergebende Leerzeile als Abschnitt erscheinen. Beginnt ein Abschnitt mit einer neuen Seite, so besteht nach einer vollen Kolumne kein Unterschied zum Absatz. 5. Absatz stumpf, Abschnitt eingezogen Der Abschnitt ist durch eine Leerzeile und einen Einzug doppelt gekennzeichnet. Dadurch bleibt der Abschnitt auf einer neuen Seite jedoch erkennbar. 6. Absatz eingezogen und Abschnitt stumpf mit Kopflinie Die Kopflinie verdeutlicht den Beginn einer Seite, wodurch eine Leerzeile auf einer neuen Seite vor einem Abschnitt auf neuer Seite den Abschnitt verdeutlicht. 7. Abschnittbeginn mit Kapitälchen (mit oder ohne Versalien) Der Abschnitt ist eindeutig vom Absatz abgehoben, auch auf einer neuen Seite. Wie viele Wörter in Kapitälchen gesetzt werden hängt von Wortlänge und Sinnzusammenhang ab. 8. Abschnittbeginn mit Initial (mit oder ohne Einzug) Die Abschnitt-Initialen können in der Grundschrift oder in einer kontrastierenden Schrift, im Grundschriftgrad, zum Beispiel halbfett, größer, mit oder ohne Einzug gesetzt werden. Sie müssen deutlich sein, dürfen aber nicht dominieren und nicht den Eindruck von Kapitelinitialen erwecken. 196
197 Typografie Lesetypografie - Gliedern und Auszeichnen 9. Abschnittbeginn ausgerückt Der Unterschied von Absatz und Abschnitt ist immer sichtbar. Weitere Möglichkeiten Absätze zu kennzeichnen 10. Ausrücken statt einziehen Bei kurzen Wörtern droht Absturzgefahr. Ist nur sinnvoll, wenn genügend Platz vorhanden ist. 11. Ausgangszeile nach rechts gerückt Sehr ungewohntes Satzbild, nur für spezielle Texte geeignet. 12. Reißverschluss-Einzug Der neue Absatz beginnt mit einem Einzug, der dem Ende der Ausgangszeile entspricht. Ist die Ausgangszeile zu lang, beginnt der Absatz mit einem Standard-Einzug. 13. Weiße Binnenfläche statt neuer Zeile Ist die Ausgangszeile voll beginnt die neue Zeile mit einem Einzug in Größe der Binnenfläche, ist die vorherige Ausgangszeile nicht voll (in Größe der Binnenfläche), beginnt der neue Absatz stumpf. 14. Initial statt neuer Zeile Der neue Absatz ist durch ein halbfettes oder fettes Initial im Grundschriftgrad gekennzeichnet, in gleicher oder anderer Schriftart. 15. Kombination von weißer Binnenfläche und Initial Verstärkte Akzentuierung des Absatzbeginns. Bei wird die Außenform der Kolumne fester, die Binnenstruktur reicher als bei der normalen Kolumne. (siehe Lesetypografie S ) Auszeichnungen Integrierte Auszeichnungen bemerkt der Leser erst, wenn er an die entsprechende Stelle kommt. Kursive und Kapitälchen fügen sich in den Grauwert der Umgebung ein. Aktive Auszeichnungen sieht man auf den ersten Blick. Halbfette Schrift und Unterstreichungen springen ins Auge. Integrierte Auszeichnungen Kursive Werden bei Texten für lineares Lesen eingesetzt, z. B. in der Belletristik. Zum Beispiel für Ausrufe, leichte Betonungen, Namen und Begriffe, zitierte Worte oder Sätze. Die Kursive ist bei den meisten Schriftsätzen etwas langsamer zu lesen als die geradestehende Antiqua. Kursiv ist nicht gleich kursiv: Bei der Walbaum passt sie sich in Charakter und Grauwert der Antiqua in hohem Maße an. Die Bembo-Kursive fügt sich unauffällig in die geradestehende Umgebung ein. Die fast aufrechte, sehr eng laufende Kursive der Joanna hat das ursprüngliche Eigenleben der Kursiven behalten. Die kursive der Helvetica ist keine echte Kursive, sondern als schräggestellte Aufrechte konzipiert. Bei der Quay Sans erhält sie die typischen Kursiv-Merkmale, auch bei einer serifenlosen Schrift. 197
198 Typografie Lesetypografie - Gliedern und Auszeichnen Kapitälchen Werden für Hervorhebungen benutzt, die es festzuhalten gilt, z. B. Eigennamen, Begriffe, Schiffsnamen, Bauwerke oder auch zur Wiedergabe von Inschriften oder ähnlichem. Sie erfordern deutlich größere Aufmerksamkeit. Kapitälchen müssen bei fast allen Schriften etwas gesperrt werden. Elektronisch verkleinerte Versalien ergeben kranke, dürre Buchstaben. Aktive Auszeichnungen Fett Unterstreichung Rasterunterlegung Folgende Varianten sind denkbar: Fette bei einer normalen Grundschrift Halbfette Schrift bei einer leichten Grundschrift Verstärkung durch eine weitere Auszeichnungsstufe: halbfett und kursiv Halbfette Versalien Extremer Kontrast innerhalb der Schriftfamilie: Schmalhalbfette Negative aktive Auszeichnung durch eine leichte Schrift im kräftigen Umfeld, normale Schrift in fetter Grundschrift Varianten: Eine dem Schriftbild angepasste Linienstärke. Zu feine Linien verbinden sich nicht mit dem Schriftbild; sie wirken wie ein Schnitt. Je fetter die Unterstreichung, desto lauter die Auszeichnung. Eine feine farbige Unterstreichung signalisiert Raffinement und Präzision. Die fette farbige Unterstreichung aktiviert im Sinne von Zeitungs- Schlagzeilen. Der Kontrast muss groß genug sein, damit das Wort nicht zusammengedrängt wird. Eine farbige Unterlegung darf nicht zu dunkel sein, ebenfalls aufgrund des Kontrastes zur Schrift. Farbe Varianten: Zurückhaltende Auszeichnung durch Farbe bei einer normalen Schrift Aktivere Auszeichnung durch Farbe und Fette Siehe auch oben bei Unterstreichung und Rasterunterlegung Weitere Auszeichnungen Je nach Wirkung kann es sich hier um integrierte oder aktive Auszeichnungen handeln. Sperrung ist eine schwer zu bewältigende Auszeichnungsform, auf die sich nur Meistertypografen einlassen sollten. Im dichten Umfeld ist die Sperrung eine eher aktive Auszeichnung. Versalien Halbfett müssen, um lesbar zu bleiben, meist etwas gesperrt werden. Es gibt bei einigen Schriftarten halbfette Auszeichnungen, die so dezent sind, dass sie für eine aktive Auszeichnung ungeeignet sind. 198
199 Typografie Lesetypografie - Gliedern und Auszeichnen Schriftmischung sollte nur wohlüberlegt eingesetzt werden. Beispiele: Veränderung der Nur Schriftkenner werden den Unterschied feststellen. Schriftform bei annähernd gleichem Grauwert Veränderung der Eindeutige Auszeichnung Schriftform bei Veränderung des Grauwerts Schmallaufender halbfetter Schnitt einer zeichnet extrem stark aus. fremden Schriftart Auszeichnung durch eine verwandte Schrift ist stilistisch unentschieden. Pinselschrift kontrastiert zur ruhigen Umgebung wie ein Jahrmarktruf. Weitere Beispiele siehe S. 137 ff. Ausgleich von Versalien Wortbild- Neutralisierung Wortbild- Rhythmisierung Wortbild- Rhythmisierung durch Versal-Ausgleich, z. B. durch Verkleinerung der Versalien im Fließtext. Wörter in nicht ausgeglichenem Versalsatz sind störende Holpersteine im Lesefluss. durch Sperrung. Distanziert sich durch die Helligkeit vom Umfeld. Es entsteht keine Wortbild-Individualität. [Lesezeichen, nicht verstanden, Was meint der Autor mit Wortbild-Individualität?] durch engen Satz. Dies drängt sich vor das Umfeld. Bei mehreren kompress gesetzten Zeilen können ornamental-dekorative Wirkungen erzeugt werden. Auszeichnung größerer Textmengen Kleinerer Grad Textpassagen mit kleinerem Schriftgrad bei gleicher Zeilenbreite werden schlechter lesbar. Bei z. B. zweispaltigem Umbruch tritt dieses Problem nicht mehr auf. Kursiver Schnitt Die meisten Kursivschriften haben einen ausgeprägten individuellen Charakter, der den Text beeinflusst. Sind wohl geeignet für Briefzitate, jedoch weniger für wissenschaftliche Arbeiten. Einzug Eindeutige Abhebung kürzerer Textpassagen. Geht der Einzug über mehrere Seiten, geht die Abhebung verloren. Dies kann durch eine Kopflinie in Satzspiegelbreite ausgeglichen werden. Einzug auf beiden Seiteten geht, eine Kopflinie über die Satzspiegelbreite, die den Vergleich von Auch diese Form der Auszeichnung benötigt, wenn sie über mehrere Sei- Einzug und voller Breite liefert. Strichstärken Manche Schriftfamilien verfügen über minimal magere oder fettere Auszeichnung der Grundschrift. Dieses Verfahren setzt allerdings sorgfältige Satzproben voraus und verlangt einen hohe Produktionsqualität, damit der Unterschied der Strichstärken nicht durch Belichtungs- oder Kopiedifferenzen verlorengeht. Farbe Das verlangt eine kräftige Schrift mit geringen Unterschieden der Strichstärke und eine sorgfältige Abstimmung des Farbtones, der weder durchfallen noch sich vordrängen darf, sich vom Schwarz des Haupttextes deutlich genug unterscheiden muss und nicht flimmern darf. Schriftmischung Da Laien dies oft nicht wahrnehmen, muss dafür gesorgt werden, dass 199
200 Typografie Lesetypografie - Gliedern und Auszeichnen Fußnoten sich nicht nur der Charakter, sondern auch der Grauwert der anderen Schrift von der Grundschrift abhebt. Die Notenziffern innerhalb des Haupttextes müssen zurückhaltend erscheinen, als ein Angebot, das man nicht wahrnehmen muss. Unten dagegen vor der Fußnote müssen diese deutlich in Erscheinung treten. Heute sind die Notenziffern i. d. R. Versalziffern in der Grundschrift. Es können auch Mediävalziffern funktionieren. Die hochgestellten Ziffern müssen von den zugehörigen Buchstaben einen ausreichenden Abstand haben. Auch nach kursiven oder halbfetten Wörtern ist die Notenziffer wieder normal und aufrecht (Lesetypografie, S. 154 ff) Pagina und lebender Kolumnentitel Die Pagina wird auch toter Kolumnentitel genannt. Bei Gebrauchsbüchern darf diese Pagina nur oben stehen, um diese schnell aufzufinden. Der Stand der Pagina soll eindeutig klären, ob diese zum Satzspiegel gehört oder nicht. Steht sie unterhalb des Satzspiegels, sollte ihr Abstand zur letzten Zeile nicht weniger als eine Leerzeile betragen. Lebender (Seitentitel) und toter Kolumnentitel (Seitenzahl) sollen den Leser zur gesuchten Textstelle führen. Diese Kolumnentitel würden daher nie im Bund stehen. I. d. R. steht auf der linken Seite die übergeordnete, auf der rechten Seite die untergeordnete Überschrift Weitere Auszeichnungen Legenden innerhalb der Kolumne Bildlegenden sollen sich, um Verwechslung auszuschließen, immer eindeutig von der Grundschrift unterscheiden. Der Abstand zwischen Legende und Haupttext kann meist wegen unterschiedlicher Bildgrößen und unterschiedlicher Zeilenzahl der Legenden nicht gleichmäßig sein der einheitliche Abstand zwischen Bild und Legende hat Vorrang er muss jedoch so hoch gewählt werden, dass die Legende sich eindeutig vom Text abhebt. Linien Strichstärke, Abstand zum Text, Stil sind vorwiegend relevant. Kopflinie, Fuß, indifferente Trennung (Linie genau in der Mitte zwischen den Absätzen) sind die hauptsächlichen Abstand-Möglichkeiten. Linien und Text müssen zueinander passen: Aufgrund dessen ist es angebracht die stilgerechte, also historisch korrekte, Komposition zu kennen, um die Freiheit zu besitzen, gegen die Regeln zu verstoßen, um eine neue Spannung zu erzeugen (siehe Lesetypografie, S. 147). Untergliederung von Textgruppen Manchmal sind Untergliederungen gewünscht, die weniger als eine Zwischenüberschrift und stärker als eine bloße Abschnitt-Leerzeile trennen. Sternchen, fette Punkte und Linien sind die klassischen Untergliederungen. Kästen und Unterlegungen Linienrahmen, (farbige) Rasterunterlegung, Schmuckfarben sind hier zu beachten. Beim Linienrahmen muss die Linienstärke mit der Strichstärke der Schrift abgestimmt werden. Zu schwache Linien wirken schmerzhaft spitz, zu starke dagegen wie ein Trauerrand (Lesetypografie, S. 150) Gedichte im Prosatext Meistens wird es richtig sein, ein etwas durchscheinendes Papier zu wählen, damit die Gegenseite das Gedicht einzubinden hilft (Lesetypografie, S. 152) Marginalien Marginalien sind aktiver als Fußnoten und sollten nicht überlesen werden. Sie beginnen i. d. R. auf der Höhe der Bezugszeile, sind aber nicht unbedingt auf dem Grundlinienraster, vor allem, wenn sie 200
201 Typografie Lesetypografie - Überschriften einen kleineren Schriftgrad besitzen. Marginalien werden immer im Flattersatz gesetzt (Lesetypografie, S. 162) Griffregister, gestürzte Zeilen, gedrehte Seiten Griffregister können gedruckt oder gestanzt werden. (Lesetypografie, S. 164) Überschriften Überschriften haben in erster Linie eine gliedernde Funktion. Zugleich haben sie eine ästhetische Funktion. Die meisten Bücher mit [ ] dekorativ angelegter Typografie sehen schon nach wenigen Jahren alt aus, unabhängig von der Stilrichtung. Überschriften müssen sinngerecht gebrochen werden. Trennungen sind nur erlaubt, wenn die Wortteile für sich bestehen können. Überschriften werden nicht mit dem Blocksatz auf volle Satzbreite ausgetrieben. Die Überschriften-Hierarchie muss immer eindeutig sein. Was ist bei Überschriften noch zu beachten: Wirkung und Gewicht Differenzieren (Überschriften-Hierarchie, Zeilenabstände) (Lesetypografie, S. 180) Systematisierung (bei wissenschaftlichen Werken) (Lesetypografie, S. 182) Überschrift-Benummerung nach DIN 1421 (Die vierte Stufe ist erfahrungsgemäß die äußerste Grenze.) (Lesetypografie, S. 183) Überschriften am Rand (Bei Marginal-Überschriften muss dies durch Schrift, Größe und Typografie eindeutig aufgelöst sein, damit es keine Randnotiz ist.) (Lesetypografie, S. 186) [Lesezeichen, einscannen, Lesetypografie, S. 187] Kapitelnummern und Initialen Kapitelnummer oder Abschnittnummern können zusammen mit der Pagina als reizvolles, stilprägendes Gestaltungsmittel eingesetzt werden. Initialen haben eine gliedernde und schmückende Funktion. Aus detailtypografischer Sicht ist hierbei zweierlei wichtig: die Linksachse bei der geklärt werden muss, ob Serifen ganz oder teilweise freigestellt werden sollen; der Abstand vom Initial zur Fortsetzung, durch den der Zusammenhang nicht zerrissen werden darf. Überschrift und Motto Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Mottos kann keine Systematik entworfen werden. Flattersatz ist fast immer angebracht. Es muss vorab geklärt werden, ob das Motto sich formal zur Überschrift oder zum Text orientieren soll. (Lesetypografie, S. 190) Lemmata (Lexikon-Stichwörter) (Lesetypografie, S. 192) Umbruch Der Leser darf nicht irritiert, gestört oder abgelenkt werden. Wann hat der Plan, das Schema Vorrang und wann darf abgewichen werden? Beispiel: Es heißt, bei Überschriften müssen Treppen vermieden werden. Warum? Weil aktive Formen auffallen und vom Lesen ablenken. Doch bei z. B. aktiver Typografie kann gewünscht sein, dass die Überschrift dermaßen Aufmerksamkeit erregt. Hurenkind und Schusterjunge Hurenkinder (Ausgangszeilen am Kopf einer Seite) und Schusterjungen (Absatzbeginn am Fuß der Seite) verstoßen gegen das Ideal des identischen Seitenpaares. Hurenkinder stören den Lesefluss, 201
202 Typografie Lesetypografie - Verzeichnisse weshalb zu raten ist, diese zu beseitigen. Schusterjungen stören den Lesefluss nicht, im Gegenteil, sie leiten auf die nächste Seite weiter, deshalb sollten diese nur bei Büchern mit besonderem ästhetischen Anspruch entfernt werden. (Lesetypografie, S. 196) Abstände bei Kapitelüberschriften Es gibt drei Möglichkeiten: Die Abstände variieren mit der Länge der Überschrift; Die Abstände bleiben gleich, wobei die Textblöcke variieren; Der Textblock bleibt gleich, während die Überschriften auf optischer Mitte in einem Bereich platziert sind. (Lesetypografie, S. 198) Der Stand von Zwischenüberschriften Die Überschrift steht genau zwischen den Zeilen, aber nur wenn diese genauso groß ist wie die Grundschrift, sonst wirkt es so als würde die Überschrift zum vorherigen Absatz gehören. Die Überschrift hat davor 1 ½ und danach ½ Leerzeile. Geht es darüber hinaus, wirkt das Ganze oft zu luftig. I. d. R. müssen nach einer Zwischenüberschrift mindestens 3 Zeilen stehen, sonst kommt sie auf die neue Seite. Spitzkolumnen sind Ausgangszeilen eines Kapitelendes, wobei auf der nächsten/rechten Doppelseite eine Überschrift und der nächste Textblock folgt. Man nennt diese Ausgangszeilen Spitzkolumne, weil es in der Renaissance üblich war, diese letzten Zeilen spitz zulaufen zu lassen (Lesetypografie, S. 203). [Lesezeichen, Scannen Lesetypografie S. 203] Senkrechter Keil, tanzender Fuß Was ist wichtiger: das Dogma, dass alle Spalten gleich hoch sein müssen oder dass alle Abstände z. B. zwischen den Absätzen gleich sein müssen? Ein tanzender Fuß kann belebend wirken und gleiche Anstände zwischen den Absätzen haben Vorrang. Also die Regel Gleiches gleich behandeln kann sinngemäß umgangen werden (Lesetypografie, S. 206) Verzeichnisse Die Begriffe müssen schnell auffindbar sein (konsultierendes Lesen), die Binnenstruktur muss verständlich sein (differenzierende Typografie). Inhaltsverzeichnis Anmerkungen Literaturverzeichnis Register Wohin gehört des Inhaltsverzeichnis? Bei Büchern, die man nicht unbedingt von vorn nach hinten liest, gehört das Inhaltsverzeichnis nach vorn. Bei Büchern, die man durch liest, die zum Lesen einladen, gehört das Inhaltsverzeichnis ans Ende, falls überhaupt eines benötigt wird. Inhaltsverzeichnis Die Struktur muss schnell und unmissverständlich durchschaut werden können. Zugleich ist es ein typografischer Spiegel des Buches. Die Typografie des Inhaltsverzeichnisses lässt sich in fünf Grundtypen einteilen: 1. Die Breite kann auf den Satzspiegel bezogen sein. Der Abstand zu den rechtsbündigen Seitenzahlen darf nicht zu groß sein, sonst muss auspunktiert werden. 2. Die Seitenzahlen können direkt an die Zeilen angehängt und durch einen festen Abstand, einen Gedankenstrich usw. getrennt werden. 3. Die Seitenzahlen können vor die Zeilen gestellt werden. 4. Die Seitenzahlen können in eigenen Zeilen stehen, z. B. auf Mitte gesetzt. 202
203 Typografie Lesetypografie - Detailtypografie 5. Das Inhaltsverzeichnis kann fortlaufend im Flattersatz umgebrochen werden. Blickführung beim Inhaltsverzeichnis: Ist die Satzspiegelbreite zu breit, können sich die Seitenzahlen verlieren. Dem kann folgendermaßen abgeholfen werden: Schmalere Satzbreite oder typografische Hilfsmittel, wie z. B. Punkte, Linien usw. (Zu zweispaltigen Inhaltsverzeichnissen siehe Lesetypografie, S Zur Benummerung nach dem Dezimalsystem (DIN 1421) siehe Lesetypogafie, S. 218.) Anmerkungen Anmerkungen stehen entfernt vom Text, zu dem sie gehören im Gegensatz zu ihren Schwestern, den Fußnoten. Der Leser sucht sie gezielt auf, deshalb müssen sie besonders übersichtlich gestaltet sein. Zugleich sollen sie platzsparend sein. Die Zahlen müssen auf den ersten Blick erkennbar sein, weshalb kleine hochgestellte Ziffern ausscheiden. (Siehe Lesetypografie, S. 222) Literaturverzeichnis Die Benutzer sollten sich nicht auf die Entschlüsselung des Eintrages konzentrieren müssen, sondern die Substanz schnell erfassen können. (Siehe Lesetypografie, S. 224) Register dienen dem schnellen Suchen und Finden. Man nennt sie auch Index. (Siehe Lesetypografie, S. 226) Detailtypografie Zum Begriff Detailtypografie gehören alle Situationen der Begegnung von Buchstaben, Ziffern, Zeichen und dem weißen Raum dazwischen. Von Orthotypografie kann man in vielen Situationen sprechen, wenn es um richtig oder falsch geht. Die detailtypografischen Entscheidungen betreffen nicht nur das Abwägen von Schriftgröße, Laufweite, Satzbreite, Wortabstand und Zeilenabstand, sondern auch eine großen Anzahl von Einzelproblemen, die entweder per Programmierung oder durch Einzelentscheidungen gelöst werden müssen. Die Qualität einer Drucksache hängt in hohem Maße von der Durcharbeitung der Satzdetails ab Schrift, Zurichtung, Kerning Schriftdigitalisierung Ist der Übergang von den Rundungen in gerade Striche harmonisch oder unpassend hart? Sind Rundungen gleichmäßig oder unordentlich-vieleckig? Sind Details berücksichtigt? Nicht alle digitalisierten Schriften sind gut. [Lesezeichen, Scannen, Lesetypografie, S. 232] Schrift-Ausbau Welche Schnitte braucht man? Reichen Kursive und Halbfette? Oder braucht man auch Kapitälchen, leichte, fette Schrift? Breite oder schmale Schnitte? Sind alle notwendigen Sonderzeichen und Akzente vorhanden? Sind Mediävalziffern erwünscht? Gibt es Ligaturen? Hat man es mit sehr unterschiedlichen Schriftgrößen zu tun? Zu manchen Schriften gibt es mehrere Design-Größen. Zurichtung bedeutet: Die Festlegung der kleinen Weißräume vor und nach jedem Zeichen, die dafür sorgen, dass die Zeichen nicht aneinanderstoßen. Kerning Bei jeder Schrift gibt es Zeichen-Kombinationen, die auch bei guter Zurichtung zu eng oder zu weit sind. Den Zeichenpaar-Ausgleich nennt man Kerning. Sehr viele Schriften sind unvollständig oder schlecht gekernt. Berühren sich Zeichen? Das darf nicht sein. Das ist nicht nur schlecht, sondern auch falsch. Typische Kandidaten sind f), fä, (j und ähnliches. Sind, umgekehrt, Zeichenkombinationen wie Te zu eng gekernt? Sind die Interpunktionszeichen berücksichtigt und etwas spationiert? 203
204 Typografie Lesetypografie - Detailtypografie Laufweite und Weißräume Laufweite Vielen Schriften tut es gut, wenn man ihre kleineren Größen mit vergrößerter Laufweite setzt und ihre größeren Größen mit verringerter Laufweite. Die meisten klassischen Satzschriften wie Bembo, Garamond, Sabon, Baskerville, Walbaum etc. tut die Laufweitenveränderung in Lesegrößen gut. Wortzwischenräume und Trennungen Die Größe der Wortzwischenräume muss zur Schrift und zur Schriftgröße passen. Schmale Schrift braucht kleinere Wortabstände, entsprechend braucht breite Schrift größere Wortabstände. Bei großer Schrift sollte man den Wortzwischenraum meist verringern. Abkürzungen und Daten, die mit Abkürzungspunkt gesetzt werden, müssen mit einem Festabstand gesetzt werden Satzzeichen Abstände vor und nach Satzzeichen Wortabständen vor Interpunktionszeichen sind Stolpersteine beim Lesen und müssen getilgt werden. Anführungszeichen Im Deutschen sind drei Formen von Anführungszeichen korrekt: Anführung ;»Anführung«; «Anführung». Horizontale Striche Der kurze Strich - ist Trenn- und Bindestrich. Der lange Strich ist: Gedankenstrich, Bis-Strich, Streckenstrich, Spiegelstrich, Auslassungsstrich (siehe Lesetypografie, S. 236) Index und Exponent Man kann auch einen fetteren Schnitt verwenden, damit die kleinen Zahlen nicht durchfallen. Apostrophe haben mehr die Form einer hochgestellten, kleinen 9, nicht einer 6. Ligaturen Wenn die Schrift Ligaturen hat, üblich sind fi und fl, müssen sie auch angewandt werden. Ligaturen stehen nicht an Wortfugen, z. B. nicht in Kaufladen oder Schilfinsel. Sie werden auch nicht bei Vor- oder Nachsilben wie Auflage oder teuflisch gesetzt. An Trennfugen werden sie verwendet: Teflon. Fremdsprachen werden generell mit Ligaturen gesetzt Auszeichnungen Auszeichnungen Nachfolgenden Satzzeichen ebenfalls auszuzeichnen, ist meist am besten. Klammern oder Anführungszeichen sind jeweils entweder beide ausgezeichnet oder beide normal zu setzen. Schriftverzerrungen Kursive oder Fette, aber auch Outline- oder schattierte Schriften, dürfen nie elektronisch erzeugt werden, da dies hässlich ist und Belichtungsprobleme verursacht. Solche Entstellungen werden auch Faux-Schnitte genannt Trennungen und Lesbarkeit Es ist ein ewiges Dilemma: Gute Trennungen bewirken störende Löcher, enger Satz führt zu schlechten Trennungen. Beim Blocksatz gilt als Richtwert: vor der Trennung zwei Buchstaben, nach der Trennung drei Buchstaben. Beim Flattersatz: jeweils vier Buchstaben. (siehe Lesetypografie, S. 239) 204
205 Typografie Lesetypografie - Tabellen Tabellen (Siehe, Lesetypografie, S. 240 ff.); auch Stammtafeln Text und Bild Die Typografie soll dafür sorgen, dass die Wirkung der Bilder gesteigert wird. Die Mindestforderung ist, zu verhindern, dass Bilder sich gegenseitig stören. Sind die Bilder vorher nicht bekannt, gilt es ein Layout-Schema zu entwickeln, bei dem die Wechselwirkung der Bildinhalte und Bildgrößen durch die Schrift und die unbedruckten Flächen neutralisiert wird. Bilder im Satzspiegel [Lesezeichen, Scannen, Lesetypografie, S. 256] Abb. 253 Klassische Leseseite Bilder werden in den Satzspiegel integriert. Die Außenmaße der Bilder werden von den Maßen des Satzspiegels bestimmt. Die unbedruckte Fläche hat hierbei die Funktion eines Rahmens. Abb. 254 Einspaltiger Satzspiegel Die Breite kann bei nebeneinanderstehenden Bildern variieren. Muss die Höhe variieren, sollte diese eindeutig unterschieden sein. Abb. 255 Zweispaltiger Satzspiegel Bei zweispaltigem Satz kann die gesamte Satzbreite von den Bildern erreicht werden, indem sie entweder die Spaltenbreite übernehmen oder indem sie sich in der Breite selbstständig machen, um gemeinsam die Satzspiegelkanten zu erreichen. 205
206 Typografie Lesetypografie - Text und Bild Abb. 256 Zweispaltiger Satz mit unterschiedlich breiten Bildern Wenn bei zwei- oder mehrspaltigem Satz die Bildbreiten nicht der Breite der Textspalten entsprechen, muss dafür gesorgt werden, dass die Breitenunterschiede deutlich sind, weil sonst, wie bei der rechten Seite der Skizze, das negative Maßwerk der Zwischenschläge aus den Fugen gerät. Abb. 257 Bilder außerhalb des Satzspiegels Übernehmen die Bilder nicht die geschlossenen Kanten des Satzspiegels, können die Seiten lebendiger und lichter gestaltet werden. Die Möglichkeiten der Bildgrößen-Variation werden erweitert. Werden die Bilder mit größerem seitlichem Freiraum eingesetzt, wird es meistens nötig sein, den Abstand zwischen Text und Bild zu erweitern. Abb. 258 Bilder außerhalb des Satzspiegels im zweispaltigen Satz Durch die Symmetrie des zweispaltigen Satzes ist die Freiheit der Bildplatzierung etwas eingeschränkt. Wenn Bilder etwas schmaler oder breiter als der Satzspiegel sind, muss der Unterschied eindeutig bemessen sein, damit nicht der Eindruck eines Vermaßungs- Fehlers entsteht. 206
207 Typografie Lesetypografie - Text und Bild Beim zweiten Beispiel wurden die Bilder schmaler als die Spalten gehalten und nach außen gesetzt. Durch den so vergrößerten Zwischenschlag neben den Bildern ergibt sich zusammen mit den größeren Abständen über und unter den Bildern eine Art Passepartout (Umrahmung). Abb. 259 Dreispaltiger Satz/geschlossene Text- Bild-Seiten Der Idealfall ist die gleiche Proportion der Bilder. Der Typograf wird dann Schriftgröße und Zeilenabstand so gestalten, dass die Bilder mit den Zeilen Register halten. Bildunterkante entspricht der Schriftlinie und Bildoberkante der Versalhöhe. Der Abstand zwischen den Spalten resultiert aus dem Abstand übereinanderstehender Bilder. Liegen unterschiedlich proportionierte Bilder vor, kann nur noch deren Breite dem Raster angepasst werden. In jedem Fall ist eine Verschiebung des Zeilenregisters wegen des Durchscheinens zu vermeiden. Abb. 260 Diskrepanz der Bildflächengrößen Wenn bei einer dreispaltigen Konzeption die Spaltenbreite die Bildbreite diktiert und Bilder im Quer- und im Hochformat vorkommen, können sie nur in falschen Größenverhältnissen erscheinen. Gegenüber einem Hochformat auf Spaltenbreite kann ein Querformat über eine/zwei Spalten nur zu klein oder zu groß erscheinen. 207
208 Typografie Lesetypografie - Text und Bild Bei diesem Beispiel sind die Bildbreiten variabel gehalten. Damit nicht der Zufall waltet, können die Bildbreiten einem feineren Raster folgen. Abb. 261 Öffnung der Außenkontur durch unterschiedlich hohe Kolumnen. Abb. 262 Öffnung der geschlossenen Seite durch Bildbreiten, die nicht dem strengen Raster folgen. Um die Solidität der Gesamtkonstruktion willen ist es ratsam, die freien Bildbreiten einem eigenen feineren Raster zu unterwerfen, um zu verhindern, dass Bild- und Spaltenkanten unklar zueinander stehen. 208
209 Typografie Lesetypografie - Text und Bild Abb. 263 Geöffnete Text-Bild-Seite Entscheidend ist, wie der Text gelesen wird. Bei einem fortlaufenden Text würden weiße Fläche zwischen den Textpassagen zerstörend wirken. Die gleichen Bildgrößen und die gleiche Textmenge wie oben. Die weißen Restflächen sind mit dem Rand verbunden. Zusammen mit dem tanzenden Fuß hilft das, der Seite die Härte zu nehmen. Abb. 264 Freie Gestaltung In den meisten Fällen wird man auch bei freier Gestaltung dieser einem kleinteiligen Raster zugrunde legen, auch wenn man seine Gesetze nicht mehr sieht. Den drei Beispielen liegt eine Einteilung in 16 Einheiten zugrunde. 209
210 Typografie Lesetypografie - Text und Bild Abb. 265 Freie Gestaltung Das Gemeinsame der drei Seiten ist ihr schematischer Bezug zur Mitte. Die Vielfalt der freien Gestaltung ist unendlich und einer gegenwärtigen Mode unterworfen. Doch sollte hier immer die Vermittlung des Inhaltes im Vordergrund stehen. Typografie gegen Textund Bildinhalte ist immer schlechte Typografie. Abb. 266 Zwischenschlag Bei zwei- oder mehrspaltigen Konzeptionen spielen einerseits die Abstände innerhalb der Spalte und andererseits die Abstände zwischen den Spalten eine Rolle. 1. Der Abstand zwischen den Bildern und Bild und Text ist kleiner als der Zwischenschlag. Die Seite besteht aus zwei Teilen. 2. Die Abständen sind alle gleich. Es entsteht ein weißes Maßwerk und die Seite wird zur Einheit. 3. Durch den großen Zwischenschlag werden die beiden Spalten zu zwei unabhängigen Säulen. 4. Bildüberschneidungen von wenigen Millimetern oder Schriftberührungen von nur wenigen Zeilen beeinträchtigen durch die zufällige ungewollte Schachbrettwirkung die architektonische Klarheit der Seite. 5. Es ist meist besser, auf den unmittelbaren Text- Bild-Zusammenhang zu verzichten und klare Verhältnisse zu schaffen, etwa durch die Zusammenfassung einiger Bilder oder 6. durch eine eindeutige, bewusste Schachbrettlösung. 210
211 Typografie Lesetypografie - Bild mit Bild Bild und Legende Die Legenden müssen ebenso gut zu lesen sein wie der Haupttext, also sollte die Zeilenlänge Zeichen betragen. Blocksatz sollte nur bei mehrzeiligen Legenden verwendet werden. Bei sehr breiten Bildern sollte man auf einen zweispaltigen Satz zurückgreifen. (Lesetypografie, S. 268) Bildinhalt und Stand auf der Seite Die Platzierung von Bildern ist auch eine Sache ihres Inhaltes. Zum Beispiel sollte ein fliegendes Flugzeug nicht unten auf der Seite angebracht sein. Ebenso kann die Blickrichtung von Porträts entscheidend sein bei der Gestaltung des Layouts. (Lesetypografie, 272) Bild mit Bild Bilder führen kein Eigenleben, sie nehmen Bezug zur Nachbarschaft, vor allem zu den Bild-Nachbarn auf der Seite. Sollen Bilder repräsentieren, also für ihre Originale stehen, so wird man sie einzeln auf die Seite stellen. Sollen Bilder dokumentieren, worum es in dem Buch geht, werden meistens mehrere Bilder auf der Doppelseite stehen. Folgendes muss beachtet werden: Inhaltliche Bedeutung Qualität der Bildvorlagen Einteilung der Bildvorlagen in Muss-, Soll- und Kann-Bilder, um dem Typografen eine gewisse Freiheit der Gestaltung einzuräumen. Flächengrößen, Hell-Dunkel-Gewichtung, Bildaktivität (siehe Grundlagen der Gestaltung, Kapitel 1) Bildformat und Stand Die Dimensionen des Bildbandes werden von der Bedeutung der Bilder und von der Auffassung des Verlages Repräsentation oder Information bestimmt. Die Proportionen eines Bildbandes werden von den Proportionen der Bilder bestimmt und nicht von irgendwelchen Idealvorstellungen des Typografen. Wenn die Bilder ausdrücklich als Einzelbilder ohne Bezug aufeinander aufgefasst werden, wird man für ihren Stand eine für alle Seiten verbindliche Kopf- oder Fußlinie wählen. Haben die einzelnen Bilder jedoch einen Bezug zueinander, wird man sich vorbehalten, den Stand der Bilder variabel zu gestalten. Bildgewicht Gleiche Bildgrößen ergeben nicht unbedingt Gleichgewicht. Es ist auch wichtig, ob schwere, dunkle, starkfarbige Bilder über oder unter leichten, hellen, pastellfarbigen Bildern stehen (siehe Lesetypografie, S. 282). Flächenverhältnisse Abb. 267 Flächenverhältnisse Die bedruckten Bildflächen und die unbedruckten Papierflächen sind ungefähr gleich groß. Dadurch entsteht Langeweile, Spannungslosigkeit. 211
212 Typografie Lesetypografie - Bild mit Bild Die bedruckte Fläche ist links eindeutig kleiner als die unbedruckte Papierfläche der Doppelseite. Spannung entsteht. Ähnliches kann erreicht werden, wenn die Bildfläche größer ist als die restliche Papierfläche (rechte Seite). Unklare Verhältnisse. Die Flächen der Doppelseiten sind fast gleich groß und machen sich den Rang streitig. Geklärte Verhältnisse. Die Bildflächen sind in der Größe eindeutig unterschieden. Statische Bildflächenkomposition. Dynamische Bildflächenkomposition. Durch die Verkürzung der Bildgrößen entsteht eine Art Tiefenwirkung. 212
213 Typografie Lesetypografie - Bild mit Bild Die Bildkomposition entspricht der Lesegewohnheit. Die Doppelseite ist stabil. Die größte Bildfläche ist die erste (Gewichtung) und die letzte (Leserichtung) und schließt somit einen Betrachtungskreis. Die Seite ist instabil. Das größte Element ist erst zu sehen, wenn komplett umgeblättert wurde, außerdem springt das Auge immer wieder zur größten Fläche. Bildaktivität Abb. 268 Bildaktivität Auch der Inhalt entscheidet über die Bildwirkung. Steht das aktive Bild rechts, ergibt sich eine Art dramaturgischer Steigerung; man endet bei dem rechten Bild. Steht das ruhige Bild rechts, so wird seine Ru- 213
214 Typografie Lesetypografie - Bild mit Bild he immer vom aktiven Bild links gestört. Selbst bei einem Größenunterschied drängt sich das aktive Bild in den Blick. Erst bei extremen Größenunterschieden tritt das aktive Bild in den Hintergrund und verstärkt als Kontrapunkt die Ruhe des großen Bildes. Bildwechselwirkung Abb. 269 Bild-Wechselwirkung Auch die formale Beziehung der Bildinhalte zueinander kann entscheidend sein. Nah und fern. 1. Vorder-, Mittel- und Hintergrund, dies entspricht unserer Seherfahrung. Die Seite wirkt selbstverständlich. 2. Die Seite wirkt verwirrend. 3. Die Umkehrung der Seherfahrung kann interessant wirken. 214
215 Typografie Lesetypografie - Bild mit Bild Blickwinkel 1. Seherfahrung: Was von unten gesehen wird, steht oben usw. 2. Unten ist nah, oben ist fern: auch plausibel. 3. Keine Logik in der Reihenfolge erkennbar. Angeschnittene Bilder Abb. 270 Angeschnittene Bilder 1. Abbildungen von Kunstwerken dürfen nie beschnitten werden. Es würde ihre Komposition ändern. 2. Ein Bild das vom Passepartout der Seite eingerahmt wird ist präzise definiert. 3. Man kann denken, es ginge außerhalb der Seite linke und rechts weiter. 4. Neben- oder übereinanderstehende Bilder können sich durch die zufällig entstehenden Negativformen ungewollt zu neuen Bilderscheinungen ergänzen. Das stört die Lesbarkeit der Bilder, weil das Gehirn die Situation klären muss. 5. Es ist Sache des Typografen, solche Zufallsformen zu vermeiden, entweder durch veränderte Ausschnitte oder 6. durch große, klärende Abstände. 215
216 Typografie Lesetypografie - Bild mit Bild 216
217 Typografie Lesetypografie - Bild mit Bild Kopfgrößen Abb. 271 Kopfgrößen Die Seite wirkt unruhig oder lebendig, je nach Auffassung. Bei gleich groß erscheinenden Köpfen ist der ungefähre Augenabstand die sicherste Vergleichsgröße. Die Seite ist lebendiger und zugleich ruhiger, weil die Bildanordnung der Kopfgrößen- Entwicklung folgt. 217
218 Typografie Lesetypografie - Typografie und Illustration Leserichtung Abb. 272 Leserichtung 1. Die richtige Leserichtung sorgt für Klarheit. 2. Die umgekehrte Leserichtung irritiert. 3. Gespiegelte Bilder sehen aus wie ein rückwärts abgespulter Film. 4. Mildert das Dilemna von Entspricht wieder der Lesegewohnheit und ist die beste Lösung zu 3. Bildlogik Um die Logik der Bild-Anordnung richtig zu meistern, bedarf es schon der Kenntnis von Kamera- Einstellungen (siehe Lesetypografie, S. 296). Dramaturgie Die Bild-Dramaturgie ist nicht nur für den Illustrator oder Comiczeichner wichtig, sondern auch für den Typografen, der mit Fotos umgeht (Siehe Lesetypografie, S. 298) Typografie und Illustration Die Typografie kann die Illustration unterstützen, verstärken oder abschwächen. Wichtig sind: Schriftwahl Ist die Schrift in ihrem Grauwert hell und leicht oder dunkel und schwer? Wie aktiv ist ihre Formsprache? Schriftform und gezeichnete Form sprechen immer miteinander. Es gibt kein neutrales Verhalten. Wie hat der Illustrator den Text gelesen? 218
219 Typografie Detailtypografie - Der Titel und das ganze Buch Grundtypen der Illustration: satzspiegelintegrierte, satzspiegelunabhängige Illustration (Siehe Lesetypografie, S. 306) Illustration und Schrift (Siehe Lesetypografie, S. 308) Der Titel und das ganze Buch Schmutztitel, Seite 1 (Siehe Lesetypografie, S. 314) Impressum (Es darf nicht die durchscheinende Titelei stören, siehe Lesetypografie, S. 315) Innentitel (Siehe Lesetypografie, S. 316) Der Aufbau der Titelei (Siehe Lesetypografie, S. 320) 3.7 Detailtypografie Von Friedrich Forssman und Ralf de Jong Checkliste Schrift und Satz (Detailtypografie, S. 8) Ist die Schrift technisch geeignet? Ist die Schrift gut digitalisiert? Hat die Schrift die benötigten Schnitte und Zeichen? Wurden Schriftgrößen optisch überprüft? Wurde berücksichtigt, dass Schriften gleichen Namens, die von verschiedenen Herstellern kommen, verschieden aussehen können? Stimmt die Zurichtung? Stimmt das Kerning? Gelten besondere Satzregeln? Kommen Fremdsprachen vor? Die Schrift kann defekt oder unvollständig sein (z. B. prüft ATM Deluxe dies). Die Schrift kann im falschen Format vorliegen. Ist der Übergang von den Rundungen in gerade Striche harmonisch oder unpassend hart? Sind Rundungen gleichmäßig? Sind Details berücksichtigt? Kursive, Halbfette, Kapitälchen, leichte, fette, breite, schmale, Sonderzeichen, Akzente, Mediävalziffern, Ligaturen, Design-Größen Vor allem die Eignung für längere Texte in Leseschriftgrößen von 8 bis 11 Punkt schwankt stark. Zurichtung ist die Festlegung der kleinen Weißräume vor und nach jedem Zeichen. Den Zeichenpaar-Ausgleich nennt man Kerning. Berühren sich Zeichen? Sind Zeichenkombinationen zu eng gekernt, z. B. Te? Sind die Interpunktionen berücksichtigt und etwas spationiert? Für Schreibmaschinen- und Frakturschriften gibt es besondere Satzvorschriften. Gibt es die notwendigen Akzente in der Schrift? 219
220 Typografie Detailtypografie - Checkliste Schrift und Satz Gibt es Fußnoten oder Endnoten? Braucht die Schrift eine Veränderung der Laufweite? Stimmen die Voreinstellungen für die Wortzwischenräume und Trennungen? Sind die Wortzwischenräume bei großer Schrift zu groß? Passen Wortzwischenraum, Schriftgröße und Zeilenabstand zusammen? Stimmen die Voreinstellungen für die Flexiblen Leerzeichen? Stimmen die Abstände innerhalb von Abkürzungen und Daten? Stimmen die Abstände vor und nach den Satzzeichen? Haben die Anführungszeichen die richtige Form? Sind die richtigen horizontalen Striche verwendet worden? Stimmen die Index- und Exponenten- Einstellung? Haben die Apostrophe die richtige Form und Richtung? Sind Ligaturen korrekt verwendet? Dies sollte man vor der Übernahme in das Satzprogramm klären. Vielen Schriften tut es gut, wenn man ihre kleineren Größen mit vergrößerter Laufweite setzt und ihre größeren Größen mit verringerter Laufweite. Hilfreich ist eine Laufweiten-Tabelle. Die Größe der Wortzwischenräume muss zur Schrift und zur Schriftgröße passen. Bei großer Schrift sollte man den Wortzwischenraum meist verringern. Nur wenn der Weißraum zwischen den Zeilen das Auge gut führt und die Nachbarzeilen beim Lesen nicht dazwischenkommen, kann gute Lesbarkeit erzielt werden. In allen Satzprogrammen gibt es Festabstände, die auch im Blocksatz gleiche Größe halten. In InDesign ist das das sogenannte Viertelgeviert. z. B. und müssen mit einem verringerten Abstand gesetzt werden. Keine Wortabstände vor Interpunktionszeichen. Im Deutschen sind folgende Anführungszeichen üblich: Anführung ;»Anführung«; «Anführung» Kurzer Strich (Divis) Trenn- und Bindestrich Langer Strich Gedankenstrich Bis-Strich Streckenstrich Spiegelstrich Auslassungsstrich Exponenten und Indizes sind oft viel zu klein oder stehen falsch. Fußnotenziffern sollte man oft manuell etwas vom letzten Zeichen abrücken. Immer so. Mindestens fi und fl. Besser noch ff, ffi, ffl. 220
221 Typografie Detailtypografie - Checkliste für Autor und Redaktion Sind eventuelle Sonderzeichen korrekt gesetzt und nicht mit anderen Zeichen verwechselt worden? Auszeichnungen Nichts elektronisch verändert? Ist die Tabellenziffer 1 im Text zu weit? Weitere mögliche Mängel digitaler Manuskripte, z. B. verursacht durch OCR- Erfassung Vorsicht bei Satzkanten in stark unterschiedlichen Schriftgrößen Laufweite, Schrift und Drucktechnik z. B.,, <, >, (nicht das kleine x ) Nachfolgende Interpunktionszeichen werden grundsätzlich auch ausgezeichnet. Wird eine Anführung, Klammer etc. nicht ausgezeichnet, wird auch das Schlusszeichen nicht ausgezeichnet. Keine elektronische Erzeugung von z. B. Kapitälchen, Fette, schattierter Schrift etc. Solche falschen Schnitte nennt man auch Faux-Schnitte. Verbesserung erhält man durch proportionale Versalziffern oder Mediävalziffern. z. B. O durch Null oder 1 durch l Gerade bei großen Schriften fällt die Vor- und Nachbreite, der kleine unbedruckte Raum vor und nach dem eigentlichen Zeichen, auf. Offsetdruck, Rastertiefdruck, Laserdruck, Tintenstrahldruck, Fax etc Checkliste für Autor und Redaktion Gleiches gleich behandeln Abstände, Striche, Anführungen, Zitierweisen etc. Nicht gestalten Vorsicht bei Sonderzeichen Gibt es Fuß- oder Endnoten? Horizontale Striche Anführungszeichen und nichts von Hand eingeben, was der Rechner automatisch erzeugen kann. Am Anfang des Manuskriptes sollte ein Hinweis auf Sonderzeichen, Akzente aufgestellt werden. Werden Fußnoten seiten-, kapitel- oder bandweise numeriert? Welche Zeichen benutzt man dafür? Man unterscheidet Trenn-, Binde-, Gedanken-, Auslassungs-, Spiegel-, Streckenstrich Folgende Anführungen gibt es im Deutschen Französische»Anführungen«deutsch gesetzt Französische «Anführungen» französisch gesetzt Deutsche Anführungen 221
222 Typografie Detailtypografie - Schriftzeichen, Wort, Absatz, Kolumne Apostrophe/Akzente Nur so: Doppelte Wortzwischenräume Typischer Tippfehler Abstände Vor Interpunktionszeichen kein Zwischenraum, aber danach. Innerhalb von Abkürzungen oder Daten nur Festabstände Interpunktion auch kursiv (auch fett) Interpunktion wird nach einem kursiven Wort ebenfalls kursiv. Anführungen werden nur dann kursiv, wenn ihr gesamter Inhalt auch kursiv ist. Klammern werden nur im kursiven Umfeld kursiv, z. B. text (text) text. Tabulatoren für Tabellen Keine Leerzeichen, nicht mehrere Tabulatoren für einer Tabellenzelle verwenden. Position von Bildern angeben Schreibmaschinen-Unarten ablegen und OCR-Fehlerquellen bedenken Gibt man mit doppelten eckigen Klammern an. Z. B. O durch Null oder 1 durch ein kleines l Schriftzeichen, Wort, Absatz, Kolumne Schrift kann unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden Historie Ästhetik Technisch-funktionale Seite Anwendungsaspekt (fast der wichtigste Aspekt: Welche Schrift funktioniert für welchen Zweck besonders gut?) Ein Font enthält: Groß- und Kleinbuchstaben (Versalien und Kleinbuchstaben), Kapitälchen Satzzeichen Ziffern (Mediäval-, Tabellen- oder Versalziffern) Ligaturen, Akzentbuchstaben und Akzente Mathematische und physikalische Sonderzeichen Einige griechische Buchstaben (Alle Zeichen eines Fonts siehe Detailtypografie, S. 50) OpenType OpenType (OT) ist ein Metaformat, das Schriftdaten im True-Type-Format (TT) und Post-Script-Typ-1- Format (PS) enthalten kann, das man aber so komfortabel wie PS-Schriften anwendet. OpenType ist ein plattformübergreifendes Schriftformat. PS-Schriften können nur 256 Zeichen, OpenType können Zeichen enthalten. 222
223 Typografie Detailtypografie - Schriftzeichen, Wort, Absatz, Kolumne Unicode Damit die Zeichenvielfalt der OT-Technologie genutzt werden kann, entwickelt und verwaltet das Unicode-Konsortium ein verbindliches Codierungssystem. ASCII reicht hierfür bei weitem nicht aus. Die Schriftkontur Bei der Digitalisierung von Schriften können viele Fehler auftreten. Terminologie Abstrich Anstrich Abschluss eines nach unten geführten Striches, der entsteht, wenn die Feder, bevor sie vom Papier genommen wird, nach oben geführt wird. Ansatz zu einem Strich, an den keine Serife angesetzt ist. Arm Horizontaler Strich, der höchstens an einer Stelle auf einen vertikalen Strich trifft. Auge Die umschlossene Binnenform des e. Ist gleichzeitig auch eine Punze. Ausgang Ort, an dem ein Bogen oder eine Rundung sich vom Grundstrich trennt, in der Abfolge der Schreibbewegung. Bauch Binnenform Der an den Grundstrich des a angesetzte Bogen bildet den Bauch. 1. Niedriger Bauchansatz 2. Hoher Bauchansatz 3. (Nahezu) waagerechter Ansatz 4. Tropfenförmige Binnenform Ausgesparte Weißform. Auch Weißräume, die nicht vollständig umschlossen sind, werden als Binnenform bezeichnet. 223
224 Typografie Detailtypografie - Schriftzeichen, Wort, Absatz, Kolumne Bogen Bunze Duktus Eingang, Einlauf Gebogene Linie, die eine Binnenform umschließt. Ausnahme: Die untere Form des zweigeschossigen g bezeichnet man als Schlaufe. Siehe Punze Der Duktus einer Schrift bezeichnet den charakteristischen Wechsel zwischen dicken und dünnen Strichen. Vom handschriftlichen Duktus spricht man bei Bogenverläufen, die typisch für Schriften sind, die mit der Feder geschrieben werden. Duktus meint auch das Verhältnis zwischen weißen und schwarzen Flächen eines Buchstabens, das den Rhythmus einer Schrift ausmacht. Ort der Vereinigung des Bogens mit dem Grundstrich. Endstrich Fähnchen Siehe Serifen Angesetzter kurzer Strich, gerade oder gebogen, beim g und beim r. Fuß Strichende, das auf der Schriftlinie steht und nicht in einer beidseitigen Serife endet. Geschosse (1-, 2-, 3geschossig) Grundstrich Zum a und zum g gibt es jeweils zwei historisch begründete Formen: Das 1geschossige a steht neben dem 2geschossigen a; das 2geschossige g neben dem 3geschossigen g. Der Strich, von dem ausgehend der Buchstabe aufgebaut ist. Ein Buchstabe kann nur einen Grundstrich haben. Haarlinie Dünnste Linie bei Schriften unterschiedlicher Strichstärke. Kern Kontrast Kopf Neigungsachse Oberlänge Punze Querbalken Überhang eines Buchstabens Unterschied zwischen den dicksten und dem dünnsten Strich in einer Schrift. Ausformung der Oberlänge von Kleinbuchstaben, die über die x-höhe hinausragen. Bei Schriften mit wechselnder Strichstärke schwillt der Strich um eine Achse herum an und nimmt wieder ab. Diese Achse kann gar nicht wenig oder stark geneigt sein. Der Teil der Kleinbuchstaben, der über die x-höhe hinausragt. Umschlossene Binnenform. Horizontaler Strich, der zwei Teile eines Buchstabens verbindet. Querstrich Horizontaler Strich, der einen (vertikalen) Strich kreuzt. Rundung Gerundeter Strich, der keine Binnenform 224
225 Typografie Detailtypografie - Schriftzeichen, Wort, Absatz, Kolumne Schaft umschließt. Lang gestreckter vertikaler (oder annähernd vertikaler) Strich. Scheitel Oberes Extremum eines Bogens oder einer Rundung. Auch die Stelle des Zusammentreffens von zwei Schenkeln oder von Schaft und Schenkel bei A, N und M wird manchmal als Scheitel bezeichnet. Schenkel Schräg geführte Striche an A, K, k, M, N, W, w, Z, z. Schlaufe Untere Binnenform des 3geschossigen g. Schweif An den Bogen angesetzter Schwung des Q. Serife Endstriche: 1. Serifen, deren Stärke den Haarlinien der Schrift entspricht. 2. Serifen, deren Stärke dem Grundstrich entspricht. 3. Serifen, die keilförmig zulaufen. Jede dieser drei Formen gibt es mit einem 1. unvermittelten und 2. mit einem vermittelten Übergang vom Schaft zur Serife. Strichstärke Strichstärkenwechsel Tropfen Unterlänge x-höhe Bei Buchstaben mit gleicher Strichstärke, um optisch den Eindruck einer gleichbleibenden Strichstärke zu vermitteln, sind häufig geringe Strichstärkenunterschiede messbar. Man spricht von einer vermittelnden Strichstärke. Durch die Bewegung der (unterschiedlichen) Schreibfedern nimmt die Strichbreite in Rundungen auf charakteristische Weise zu und ab. Der Bogen des a und des c, die Rundung im f, die Fähnchen von g und r und die Unterlängen von j und y enden häufig in einer Tropfenform. Der Teil der Kleinbuchstaben, der unter die x-höhe hinausragt. Die x-höhe bezeichnet die Höhe der Kleinbuchstaben ohne Ober- und Unterlänge. Gemessen wird sie am Kleinbuchstaben x, der oben und unten einen geraden Abschluss hat Schriftfamilie Schriftschnitte Kursive Das entscheidende Merkmal ist der handschriftliche Duktus. Es gibt auch kaum oder gar nicht geneigte Kursive. Elektronisch kursivierte Schriften sind immer unbrauchbar. Das liegt auch daran, dass einige Buchstaben in der Kursiven andere Formen haben: Das kursive a hat meist keinen Bauch. Im kursiven e verschmelzen Rundung und Querbalken. Das kursive f hat eine Unterlänge. Das kursive g hat oft eine anders geformte Unterlänge. Geneigte Schriften bzw. oblique sind keine echten Kursiven, dennoch vom Schriftgestalter angepasst. Vorsicht bei kursiven Versalien, da sich die verspielten Formen nicht so gut zu Wort- 225
226 Typografie Detailtypografie - Schriftzeichen, Wort, Absatz, Kolumne Alternate Regular, Alternate Italic, Zierbuchstaben Ligaturen Kapitälchen Fetten und Breiten und Kombinationen daraus Display-Schriften Ornamente Offene Großbuchstaben Ziffernformen Ergängzungszeichensätze bildern zusammenfügen. Traditionell wird die Kursive für kurze Zitate, Ausdrücke in fremder Sprache und für Titel eingesetzt. Zu manchen Schriften gibt es alternative Buchstabenformen, zusätzliche Ligaturen und Schmuckelemente. Bei kursiven Schnitten werden solche Zeichen auch Zierbuchstaben, englisch swash, genannt. Zum Beispiel: ch, ck, fi, fl, ff, ft, ffi, ffl, fft, fä, fö, fü, gg, tt usw. Es gibt zusätzliche sehr auffällige Ligaturen, die man nur sehr sparsam einsetzen sollte (auf keinen Fall im Fließtext), z. B. ch, ck, ct, sh, sk, sl, sp, st, th. Kapitälchen haben eine größere Laufweite als Großbuchstaben. Ihre Strichstärke ist an die der Kleinbuchstaben angepasst. Auf keinen Fall dürfen deshalb verkleinerte Großbuchstaben verwendet werden. Für Serifen werden kaum extraschmale oder extrabreite Schriften angeboten. Für serifenlose Schriften wird häufig das ganze Programm entworfen. Digitale Schriften, die für den Einsatz in Lesegraden (8-12 pt) optimiert sind, sehen in den Schaugraden (ab 14 pt) selten gut aus. Typoschmuck, Rahmen und Linien, die zur Ausgangsschrift passen, werden gelegentlich auch digitalisiert. funktionieren nur in großen Schriften. Es handelt sich hierbei um Outlines. Versalziffern, Mediävalziffern, Kapitälchenziffern Z. B. mathematischer Satz, Fremdsprachensatz, phonetische Zeichen Die Bezeichnung der verschiedenen Schriftschnitte einer Schriftfamilie unterliegen keiner Konvention. Schriften, die ein Hersteller als fett verkauft, findet der andere vielleicht nur halbfett. Schriftbezeichnungen innerhalb der Schriftfamilie Deutsch Englisch Französisch Fetten leicht, extramager extra light, thin extra maigre mager light maigre normal, Buch roman, regular, book normal halbfett semi-bold, medium, demi demi-gras fett bold gras extrafett, ultra black, heavy, ultra Breiten extraschmal extra condensed extra étroit 226
227 Typografie Detailtypografie - Wort, Absatz, Textkolumne schmal condensed étroit breit expanded large extrabreit Echte Kursive kursiv italic, oblique italique Unechte Kursive schräg sloped roman, oblique Kapitälchen Kapitälchen caps, small caps, SC, expert Alternative Buchstabenformen alternate, expert, swash (=kursiv) Titelschriften display, titling capitals, initials Mediävalziffern Mediävalziffern old style figures, OSF Versalziffern Versalziffern, Tabellenziffern lining figures, LF Schriftenhersteller Schriftenhersteller, siehe Detailtypografie, S. 65 Schriftsippe Eine Schriftsippe besteht aus mehreren Ausgangsschriften, die auf einer Schriftfamilie basieren. Verschiedene Linien einer weit verzweigten Schriftsippe sind z. B.: Ohne Serifen Mit einigen Serifen Mit Serifen Serifenbetont Monospace Eine serifenlose Monospace-Schrift usw Wort, Absatz, Textkolumne Wichtig sind hierbei: Ausgang Ausgangszeile Einzug Initial Satzbreite Der Weißraum am Ende einer Ausgangszeile. ist die letzte Zeile eines Absatzes. Durch den Einzug wird die erste Zeile eines neuen Absatzes gekennzeichnet. Großer Anfangsbuchstabe am Anfang einer Kolumne. bezeichnet die maximale Länge einer Zeile. Es sollten ca. 60 Anschläge sein Leerzeichen und Interpunktionen mitgezählt. 227
228 Typografie Detailtypografie - Wort, Absatz, Textkolumne Satzkante Wortabstände Zeilenabstand Die seitliche Begrenzung der Kolumne. Wortzwischenräume wird von einer Schriftlinie (Grundlinie) zur nächsten gemessen Die Doppelseite Eine Doppelseite kann folgende Elemente enthalten: Seitenformat Endgültige Seitengröße nach dem Beschnitt. Bundsteg Innenteil der Seite, wo die Seiten gebunden werden. Außensteg Außenrand der Seite, wo geblättert wird. Kopfsteg Oberer Rand der Seite. Fußsteg Unterer Rand der Seite Lebender/toter Kolumnentitel Zum Beispiel eine Seitenüberschrift zum schnellen Auffinden von Kapiteln, wie hier in diesem Buch oben Typografie - Detailtypografie Friedrich Forssman. Ein toter Kolumnentitel wäre über das gesamte Buch hin gleich, aber auch die Pagina ist tot. Pagina Seitennummerierung Kopflinie Linie zur Kennzeichnung der Satzbreite und zur Trennung von Grundtext und lebendem Kolumnentitel. Marginalien Anmerkungen, meist im Außensteg Fließtext auch Grundtext Fußnoten Tanzender Kolumnenfuß Fußlinie Satzspiegel Stege Zwischenschlag Absenkung Kolumnenlinie Meist im Fußsteg Wenn man speziell die Unterkante der Kolumnen frei handhabt, spart man sich viele Verrenkungen und typografische Entstellungen und die Seiten wirken offen und frisch. Gegensatz der Kopflinie Der Satzspiegel definiert das Verhältnis zwischen bedruckter und unbedruckter Fläche; er legt die Position jedes einzelnen Elementes auf der Seite fest. Man unterscheidet symmetrischen und asymmetrischen Satzspiegel. Die Weißräume an den Seitenrändern bezeichnet man als Stege. Weißraum zwischen den Kolumnen. Abstand von z. B. Überschriften zum vorherigen Absatz. dient der Trennung von Kolumnen im Zwischenschlag Registerhaltigkeit Durchscheinender Text und Bild stört, weshalb man sich bemüht Text und grafische Elemente auf Vorder- und Rückseite übereinanderzulegen. Man spricht von der Registerhaltigkeit der einzelnen Elemente. Steht der Druck nicht im Register, kann es dafür drei Gründe geben: Satzregister: Beim Entwurf wurde nicht auf Registerhaltigkeit geachtet. Druckregister: Vorder- und Rückseite wurden nicht genau übereinander gedruckt. Falzregister: Beim Binden wurden nicht präzise genug gefalzt. Auch Abbildungen sollten registerhaltig eingeplant werden: Ober- und Unterkante sind identisch mit Schriftlinien/Grundlinien Steht die Oberkante der Abbildung auf einer Höhe mit der x-höhe der Schrift und die Unterkante auf der Schriftlinie, so sind die Weißräume oben und unten identisch. 228
229 Typografie Detailtypografie - Wort, Absatz, Textkolumne Die Oberkante hält die Linie der Versalhöhe. Der obere Weißraum ist geringfügig kleiner als der untere Grundlinienraster Durch ein erzwungenes Grundlinienraster erzwingt man die Registerhaltigkeit, da der Text immer auf der gleichen Grundlinie gehalten wird. Einzeiliger Grundlinienraster ohne Einschub Das einfache Grundlinienraster sorgt für die Registerhaltigkeit. Einzeiliger Grundlinienraster, Einschub mit Grundlinienrasterbezug Der Einschub wird im Grundlinienraster erzwungen. Nachteil ist, dass der Abstand oben größer wirkt als unten. 229
230 Typografie Detailtypografie - Wort, Absatz, Textkolumne Einzeiliger Grundlinienraster, Einschub ohne Grundlinienrasterbezug Wenn der Einschub beim Umbuch an den Fuß der Seite zu stehen kommt, würde man die letzte Zeile auf eine Linie des Grundlinienrasters stellen. Der Zeilenabstand ist auf die Schriftgröße abgestimmt. Er ist nach oben und unten optisch in die Mitte gerückt. Halbzeilen-Register Für Einschübe kommt eine solche Größenproportion kaum in Frage, für Fußnoten oder Bildlegenden schon. Drittelzeilen-Register Schriftgröße und Zeilenabstände lassen sich in eine brauchbare Proportion bringen. Viertelzeilen-Register Ermöglicht eine gut lesbare Größe des Einschubs. 230
231 Typografie Detailtypografie - Wort, Absatz, Textkolumne Grundschrift-Register wieder aufnehmen? Man muss entscheiden, ob man nach dem Einschub wieder das Grundlinienraster aufnimmt oder nicht. Entweder kann man die Abstände oben und unten gleich groß machen oder man kann den Grundtext für das Durchscheinen registerhaltig machen beides zusammen geht nicht. Bei mehrspaltigem Satz sind Abweichungen vom Grundlinienraster deutlicher zu sehen. Einzeiliger Grundlinienraster ohne Einschub Der Umbruch ist hier unproblematisch. Einzeiliger Grundlinienraster, Einschub mit Grundlinienrasterbezug Erzwungenes Grundlinienraster für den Einschub trotz kleinerer Schriftgröße. Kein angepasster Zeilenabstand der kleineren Schriftgröße. Einzeiliger Grundlinienraster, Einschub ohne Grundlinienrasterbezug Wenn der Einschub beim Umbruch an den Fuß der Seite zu stehen kommt, würde man die letzte Zeile auf eine Linie des Grundlinienrasters stellen. Hier ist der Zeilenabstand der kleinen Schriftgröße gemäß. Im mehrspaltigen Satz muss vermieden werden, dass sich die Zeilen nur minimal in der Höhe unterscheiden. Beim Halbzeilen-Register ist die Abweichung um eine halbe Zeile zulässig. 231
232 Typografie Detailtypografie - Wort, Absatz, Textkolumne Halbzeilen-Register Hier sind nicht die Einschübe sondern die halben Leerzeilen für die Verschiebung verantwortlich. Hier ist die Verschiebung deutlich genug und stellt eine zulässige Lösung dar. Drittelzeilen-Register das Grundschriftregister ist wieder aufgenommen Wenn hier Einschubtext am Fuß der Kolumne steht, muss man für deutlich unterschiedliche Kolumnen höhen sorgen, um Abweichungen wie im nächsten Beispiel zu vermeiden. Drittelzeilen-Register das Grundschriftregister ist nicht wieder aufgenommen Die geringfügige Abweichung der Kolumnenhöhen um eine Drittelzeile ist unschön. In solchen Fällen vergrößert man die Unterschiedlichkeit künstlich, indem man die linke Kolumne eine Zeile niedriger oder die rechte eine Zeile höher macht. Grundlinienversatz Wenn einzelne Zeichen oder Wörter, aber auch Zeilen und ganze Absätze über oder unter die Grundschriftlinie gestellt werden sollen, arbeitet man mit Grundlinienversatz. Der Grundlinienversatz wird z. B. eingesetzt, um einzelne Zeichen anzupassen einzelne Wörter auszuzeichnen Weißräume über und unter zwischengeschobenen Zeilen optisch anzugleichen. Einzelne Zeichen anpassen Einzelne Wörter auszeichnen Weißräume angleichen Ein einzelnes Zeichen in einer anderen Größe als der Grundtext muss vertikal ausgerichtet werden. Andere Zeichen können in der gleichen Schriftgröße zu auffällig sein, z. B. Zum Beispiel die Hochstellung eines ganzen Wortes. Z. B. sind Einschübe in kleinerer Schriftgröße nicht genau in der Mitte ausgerichtet (oben und unten). 232
233 Typografie Detailtypografie - Das typografische Maßsystem Das typografische Maßsystem Das typografische Maßsystem entstand im Frankreich des 18. Jahrhunderts als Duodezimalsystem (12 pt sind ein Cicero). Fournier-Punkt Didot-Punkt Pica-point DTP-Punkt Der Fournier-Punkt (erste Hälfte des 18. Jahrhunderts) ist das erste typografische Maßsystem. Ein Punkt entsprach 1/864 Fuß Didot bezog seinen Didot-Punkt (zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts) auf den pied de roi Hermann Berthold stellte 1879 einen Bezug zwischen dem Didot- Punkt und dem metrischen System her wurde der Didot-Punkt neu festgelegt und neu auf das metrische System bezogen wurde der Pica-point für die nordamerik. Industrie definiert und eroberte über den Computersatz die Welt. Wer heute Punkt sagt oder pt schreibt, meint den Picapoint. 1 Fournier-Punkt entspricht ungefähr 0,34 mm. 12 Punkt sind ein Cicero. 1 Didot-Punkt entspricht ungefähr 0,376 mm. 12 Punkt sind ein Cicero. 1 Didot-Punkt (Berthold) entspricht genau 1/2660 Meter oder 0,376 mm. 12 Punkt sind ein Cicero, entspricht genau 4,476 mm. 1 neuer Didot-Punkt entspricht genau 0,375 mm. 12 Punkt sind ein Cicero, entspricht genau 4,5 mm. 1 Pica-point entspricht 0,0138 Inch oder ungefähr 0,352 mm. 12 Pica-point sind ein Cicero, entspricht 0,166 Inch oder ungefähr 4,21 mm. 1 Pica-point ist 1/72 Zoll. 1 Zoll ist ca. 2,54 mm. 1 Pica-point entspricht 0, mm 1 DTP-Punkt entspricht 0, mm Schriftgrad und Schriftgröße Schriftgrad ist ein Begriff aus dem Bleisatz, wird am Schriftkegel, dem Träger des Schriftbildes, gemessen. Es gibt erhebliche Unterschiede in der optischen Wahrnehmung und den technischen Anforderungen für den Druck bei sehr kleinen und sehr großen Schriften. Folglich unterscheiden sich die Zeichnungen für kleine und große Grade einer Schrift zum Teil sehr deutlich. Im Digitalsatz wird Schrift stufenlos vergrößert/verkleinert, wobei sie nur in einer bestimmten Größe ideal aussieht. Für wenige Schriften gibt es zwei Lösungsansätze: Designgrößen: Zum Beispiel die vier Designgrößen von Adobe Caption (6-8 pt), Regular (9-13 pt), Subhead (14-24 pt), Display (25-72 pt) Multiple Master [Lesezeichen, unklar] Digitale Schriften sind i. d. R. für die Verwendung in den mittleren Größen optimiert. Diese Größen heißen Lesegrade oder Brotschriftgrade Historische Bezeichnung der Schriftgrade Fournier- Punkt Didot-Punkt Pica-Point französisch französisch deutsch niederländisch englisch 3 pt - Diamant Brillant Microscoop Excelsior 4 pt - Sédanoise Diamant Diamant Brilliant 5 pt Parisienne Parisienne Perl Parel Pearl 6 pt Nonpareille Nonpareille Nonpareille Nonparel Nonpearl 7 pt Mignone Mignone Kolonel Kolonel Minion 7 ½ pt - Petit-texte - Brevier - 8 pt Petit-texte Gaillarde Petit Galjard Brevier 9 pt Gaillarde Petit romain Borgis Garmond Bourgeois 233
234 Typografie Detailtypografie - Das typografische Maßsystem 10 pt Petit romain Philosophie Korpus/Garmond Dessendiaan Long Primer 11 pt Philosophie Cicéro Rheinländer Mediaan Small Pica 12 pt Cicéro St. Augustin Cicero Augustijn Pica 14 pt St. Augustin Gros-texte Mittel Gr. Augustijn English 16 pt Gros-texte - Teria Tekst Columbian Die historischen Namen sollten nicht in Bezug auf Digitalsatz verwendet werden. Sie gelten nur für den Bleisatz, bei dem für die unterschiedlichen Grade extra Schriften gezeichnet werden. 234
235 Typografie Detailtypografie - Das typografische Maßsystem Das Typomaß Abb. 273 DTP-Typometer Das Typomaß bzw. Typometer wurde von Regina und Andreas Maxbauer entworfen und ist beim Verlag Hermann Schmidt Mainz erschienen (ISBN ). Es hat von links nach rechts folgende Skalen: 1. Zentimetermaß mit Halbmillimeter-Teilung 2. Schriftgrößen, Linienstärken zur Ermittlung der Schriftgrößen und von Linienstärken über 6 pt in DTP-Punkt. Für Linienstärken bis 6 pt gibt es die Vergleichslinien im unteren Teil. 3. Zeilenzähler für Zeilenabstand in pt und Zeilenanzahl. 4. Rasterzähler gibt die Rasterweite von gerastert gedruckten Flächen in Linien pro Inch und Linien pro Zentimeter an. 5. Zoll-/Inch-Skala für EDVgerechte Formulare und Briefpapiere sowie zum Auszählen von Typoskripten. 6. Normbriefbogen zur raschen Überprüfung von Briefbogenentwürfen mit Markierungen für die Fensterposition, die Falzmarke und die Lochmarke. 7. Zentimeterskala mit Vorlauf: Die diagonale Anlage der Zentimeterskala hilft gegen das Vermessen, der Vorlauf dient zum Ausmessen von Schnittmarken. 235
236 Typografie Detailtypografie - Schriftbearbeitung Das typografische Maßsystem in der Praxis Eine Schwierigkeit im Umgang mit DTP-Systemen liegt darin, dass die Abkürzung pt dreifach belegt ist: für Didot-Punkt im kontinentaleuropäischen Raum, für Pica-point im anglo-amerikanischen Raum, neuerdings für DTP-Punkt als Recheneinheit für weltweit vertriebene Software. Spricht man heute von pt, meint man üblicherweise den DTP-Punkt mit 0,352 mm. Die Abweichung zum Pica-point von 0,001 mm kann vernachlässigt werden. Da es im Digitalsatz keine extra gezeichneten Schriftgrade gibt, spricht man hier von Schriftgrößen. Abb. 274 Versalhöhe, Vertikalhöhe, x-höhe Versalhöhe Gemessen wird die Höhe der Großbuchstaben ohne Versal- Akzente, z. B. É. Vertikalhöhe (hp-höhe) Gemessen wird die maximale vertikale Ausdehnung (ohne Versal-Akzente) einschließlich Ober- und Unterlängen der Kleinbuchstaben. x-höhe Gemessen wird die Basishöhe der Kleinbuchstaben. Die Schriftgröße in Punkt hat bei digitalen Fonts ein sehr beschränkte Aussagekraft, da die tatsächliche Schriftgröße bei den unterschiedlichen Schriften stark variieren kann. Den optisch einheitlichen Eindruck unterschiedlicher Schriften erhält man nur, wenn man die Schriften anhand der x- Höhe vermisst. Da die Kleinbuchstaben das Schriftbild bestimmen (sie kommen am häufigsten ohne Ober- und Unterlängen vor), ist die Größe der Kleinbuchstaben für die Wahrnehmung der Schriftgröße entscheidend. Nicht nur die x-höhe beeinflusst die Wahrnehmung, auch die Strichstärk, der Strichstärkenkontrast innerhalb der Buchstaben und die Binnenräume tragen dazu bei Schriftbearbeitung Der Rhythmus einer Schrift wird bestimmt von der Zurichtung, dem Kerning und der Laufweite. 1. Zurichtung (Dicktenausgleich) Das Festlegen einer bestimmten Breite (Vor- und Nachbreite) für jedes Zeichen und das Positionieren des Zeichens innerhalb dieser Breite nennt man Zurichten. Ist die Zurichtung schlecht, sollte man die Finger von der Schrift lassen. Die Dickte (engl. Width ) bedeutet die Gesamtbreite des Zeichens, inklusive Vor- und Nachbreite. 2. Kerning Das Ausgleichen von Zeichenpaaren durch Eingabe eines Plus- oder Minus-Wertes, wodurch die jeweiligen zwei Zeichen auseinander oder zusammen gerückt werden, nennt man Kerning. 3. Laufweite Damit ist der generelle Buchstabenabstand gemeint: Haben die Buchstaben im Durchschnitt gesehen eher viel Abstand zueinander oder einen eher engen? Kleine Schriften eher weit halten, große Schrift eher eng! 236
237 Typografie Detailtypografie - Schriftbearbeitung 4. Randausgleich Durch kleinere Zeichen an beiden Rändern (z. B. - ) entstehen unruhige Kanten. Dem kann man durch einen Randausgleich entgegenwirken: Man legt für bestimmte Zeichen, z. B. für T,. oder -, bestimmte Werte fest, gemäß denen sie etwas über den linken oder rechten Rand hinausgeschoben werden. Insgesamt jedoch ist der Randausgleich verzichtbar, da nur gut gemachter Randausgleich schön ist, denn schlecht gemachter ist schlechter als gar keiner Zurichtung und Kerning Da ein hässliches, fleckiges und unausgeglichenes Satzbild auch durch schlechtes Kerning entstehen kann, sollt man das Kerning zur Kontrolle ausschalten. Zurichtung ist die Aufgabe des Schriftgestalters und des Schriftherstellers: Ist sie nicht gut, ist die Schrift nicht verwendbar. Kerning Das Kerning hat zwei Aufgaben: Das Ausgleichen von Buchstabenpaaren, z. B. Te, Vo, fh, gj etc. Das Spationieren von Interpunktionen. Wenn man in einer beliebigen Schrift folgende Musterzeile tippt Aufhalten (ja auf) Wolf? Torf Tell!; fährt. hat man einen raschen Überblick über das Kerning. Berühren sich fh, (j, f), f? und fä? Berühren sich f T trotz des Wortzwischenraums beinahe? Sind Wo, To und Te zu eng? Für das Kerning gibt es zwei Methoden: Man kernt die Schrift in einem Schriftbearbeitungsprogramm. Man kernt jeden einzelnen Fall von Hand. (siehe Detailtypografie, S. 97) Kerning mit Musterworten Folgende Aspekte sind beim Kerning zu beachten: Zeichen dürfen einander nicht berühren. Kleinbuchstaben-Kombinationen, aber wenn die Schrift gut zugerichtet ist, tragen leicht unterschiedliche Abstände zum Schriftrhythmus bei. Versalien und Kleinbuchstaben: Versalien mit viel Fleisch auf der rechten Seite, also etwas das T, erzeugen mit manchen nachfolgenden Buchstaben ein Loch. Zu weit ist besser als zu eng. Versal-Ausgleich: für Titel, Überschriften und sehr große Schrift kann nur individuell erfolgen. Schrift und Interpunktion mit automatischem Kerning. Anführungszeichen Satzzeichen: Bei der Kombination von Satzzeichen untereinander gilt die Faustregel Weit ist gut. Sonderzeichen (z. B. Währungs-, Paragraph-, Prozentzeichen) Ziffern und Zahlen 237
238 Typografie Detailtypografie - Schriftbearbeitung Die folgenden Musterzeilen sind dreigeteilt: Oben: ohne Kerning Mitte: mit Kerning des Schriftherstellers Unten: mit gutem Kerning Die wichtigsten Fälle sind durch einen seitlichen Strich markiert. Diese Musterwortliste kann von heruntergeladen werden. Zeichen dürfen einander nicht berühren fk-ligaturen können im Deutschen nicht angewandt werden, da sie immer an Wortfugen stehen. Die fl-ligatur darf nicht in Wortfugen angewandt werden. Das gleiche gilt für ff. Wo sie hingehört, muss sie auch gesetzt werden, aber nicht in Wortfugen. fi-ligatur ffi- und ffl-ligatur Das f berührt ohne gutes Kerning auch andere Kleinbuchstaben. Das kleine f darf auch keinen ä-, ü- oder ö- Punkt berühren. gf ist vor allem in kursiven Schriften ein Problem 238
239 Typografie Detailtypografie - Schriftbearbeitung ky, fr, ri, rt, etc. Das kleine v und das w wirken durch ihre überhängenden Formen bei vielen Kombinationen etwas weit. Hier sollte man unterschneiden aber nicht zu viel! Die erste Zeile ist ohne Kerning z weit, mit Kerning des Schriftherstellers zu eng. Wie der Vorgänger. ck und ch sehen in vielen Schriften besser aus, wenn man sie etwas enger stellt. Man kann sie als Logotypen, Doppelbuchstaben auffassen. Versalien und Kleinbuchstaben Versalien mit viel Fleisch auf der rechten Seite, also etwa das T mit seinem Überhang, erzeugen mit manchen nachfolgenden Buchstaben ein Loch. Es ist einer der häufigsten Mängel, dass kritische Kombinationen wie Te viel zu eng gestellt werden, ob weit enger als unkritische Kombinationen. Faustregel: Zu weit ist besser als eng. WZR = Wortzwischenraum Auch der Wortzwischenraum kann gekernt werden aber Vorsicht! Das mittlere Beispiel zeigt, wie die Worte T auf Tim durch das Engerstellen der Kombinationen f/wzr und WZR/T viel zu eng werden. Das gleiche gilt für f V, f W und f Y. 239
240 Typografie Detailtypografie - Schriftbearbeitung Té und Tö sind zu weit, Tä zu eng. Akzente wurden vom Schrifthersteller nicht gekernt. Man beachte in der mittleren Zeile die Kombination des f mit dem WZR, die zu eng ist. Wie beim Vorgänger beachte man f/wzr. Auch seltene Kombinationen sollte man kernen, wie Wr. WZR/Y wurde zu eng gekernt, Yq ignoriert 240
241 Typografie Detailtypografie - Schriftbearbeitung Versal-Ausgleich AT in der ersten Zeile reißt ein Loch, AY in der zweiten Zeile ist zu eng. Schrift und Interpunktion Doppelpunkte und Semikolons sind ohne Kerning zu eng. 241
242 Typografie Detailtypografie - Schriftbearbeitung Frage- und Ausrufezeichen sind viel zu eng. Das f berührt nachfolgende Interpunktionszeichen. Interpunktionszeichen untereinander. Auch Punkt und Komma dürfen nicht zu eng stehen. Bei Kombinationen mit f, r oder v sollte man sie unterschneiden. f) ist ein guter Prüfstein fürs Kerning. 242
243 Typografie Detailtypografie - Schriftbearbeitung (j Kombination mit eckigen Klammern und g, j, J, f Auf die Kombination f hat der Hersteller geachtet, auf die anderen nicht. Anführungszeichen «Diese» Form der Anführungszeichen bildet kleine Binnenräume, deshalb sieht sie etwas spationiert besser aus. Wenn Anführungen vor den Versalien mit Fleisch stehen, sollte der Abstand etwa verringert werden. 243
244 Typografie Detailtypografie - Schriftbearbeitung Einfache Anführungszeichen. Auch diese Anführungen sind an die Versalien mit Fleisch etwas heranzurücken. Nach Großbuchstaben mit Fleisch ist der Abstand etwas zu verringern. Gilt auch für die einfachen Anführungen. Deutsche Anführungszeichen Diese Anführungen, auch die einfachen, stehen meist zu eng am J, j und g Die löcher bildende Wirkung der Versalien mit viel Fleisch muss verringert werden. 244
245 Typografie Detailtypografie - Schriftbearbeitung Englische Anführungen Stehen Anführungen direkt vor oder nach dem Gedankenstrich, brauchen sie etwas Luft. Satzzeichen/Satzzeichen Bei der Kombination von Satzzeichen untereinander gilt die Faustregel: Weit ist gut Eingeklammerte Ausrufe- und Fragezeichen brauchen etwas Luft. Auslassungspunkte dürfen nicht zu eng sein, auch das nachfolgende Komma nicht. Auch Doppelpunkt oder Semikolon müssen etwas vom Dreipunkt abgerückt werden. 245
246 Typografie Detailtypografie - Schriftbearbeitung Das gleiche gilt für Frage- und Ausrufezeichen. Die Kombination Apostroph und Punkt oder Komma darf kein großes Loch reißen. Dreipunkt in runden oder eckigen Klammern dürfen nicht zu eng sein. (Hier war keine Korrektur notwendig.) Die vielen Kombination mit Anführungen und Interpunktionen 246
247 Typografie Detailtypografie - Schriftbearbeitung Komma oder Punkt nach Gedankenstrich werden etwas abgerückt. Das Divis wird unterschnitten, wenn Versalien mit viel Fleisch folgen. Der lange und der kurze Strich werden in der Kombination mit Ziffern spationiert. Wenn man die langen Striche in Kombination mit Text spationiert, sieht der Streckenstrich im Deutschen besser aus. Schrägstrich 247
248 Typografie Detailtypografie - Schriftbearbeitung Sonderzeichen Das Prozentzeichen wird etwas abgerückt, ebenso das Gradzeichen. Währungszeichen sind ohne Abstand zu eng mit WZR zu weit. Ebenso Paragraf- und Nummernzeichen Buchstaben und Ziffern Ziffern und Zahlen Uhrzeit-Angaben mit Doppelpunkt erfordern das Spationieren von Zahlen und Doppelpunkten. Mediävalziffern laufen oft etwas zu eng. 248
249 Typografie Detailtypografie - Schriftbearbeitung Zahlen mit Punkten und Kommas. Bei Versal- und Mediävalziffern macht man Punkt und Komma nach der 7 etwas enger bei Tabellenziffern nicht, denn die sollen präzise übereinander stehen. Manche Ziffern kommen den Klammern zu nahe. Manuelles Ausgleichen Schriften in Schaugrößen müssen manuell ausgeglichen werden, da die ungleichmäßige Verteilung der Lesegrößen hier für unwillkommene Unruhe sorgt. Im unbearbeiteten Versalsatz ergeben sich sehr unregelmäßige Buchstabenzwischenräume. Im unbearbeiteten Versalsatz ergeben sich sehr unregelmäßige Buchstabenzwischenräume. Hier wurde die Laufweite erhöht und dadurch die Buchstabenzwischenräume gleichmäßig erweitert. Manuell ausgeglichener Satz. Die Methode des manuellen Ausgleichs: Der größte Raum ist TT. Bevor mit dem Ausgleichen begonnen wird, muss dieser Zwischenraum sogar noch um 4 Einheiten erweitert werden. TT ist um 4 Einheiten erweitert worden. Die anderen Zwischenräume müssen an das TT angepasst werden. Man betrachtet immer Dreiergruppen. Die erste Dreitergruppe ist ATT, wobei das AT an das TT angepasst wird. Nachdem in der Dreiergruppe ATT das mittlere T optisch zentriert ist, wird der justierte Abstand AT Ausgangspunkt für die nächste Dreiergruppe, zu der von links das L hinzugezogen wird. Der Zwischenraum LA wird erweitert, bis das A in der optischen Mitte steht usw. 249
250 Typografie Detailtypografie - Schriftbearbeitung Räume zwischen gleichen Buchstabenpaaren müssen gleich behandelt werden. Hier wurde AT gleich gehandhabt. Sie kommt zweimal vor. Um zu prüfen, ob die Weißräume über das ganze Wortbild harmonieren, kann man den ersten Teil kopieren und ans Ende setzen. Hier scheinen die WZRe im Vergleich zum TT immer noch zu eng zu sein. Nun sind die Buchstabenzwischenräume etwas weiter. Durch Erweitern der WZRe bei Versalwörtern werden die unterschiedlichen Buchstabenzwischenräume unauffälliger. Bei größerer Schrift muss jedoch manuell ausgeglichen werden. Bei Kleinbuchstaben wird man nicht so gleichmäßige Ergebnisse erzielen wie bei Großbuchstaben. In großen Schriftgrößen neigen Kleinbuchstaben zu einem eher losen Zusammenhalt. Generell wird man also versuchen die BZRe zu reduzieren auch wenn damit Kombinationen wie hier das rw verhältnismäßig zu weit erscheinen. In großen Schriften wird man die WZRe meist verringern Laufweite Die Laufweiteneinstellung beeinflusst alle Abstände: Abstände zwischen Buchstaben zwischen Buchstaben und Satzzeichen Abstände zwischen Wörtern Einheit für die Laufweite ist i. d. R. ein Bruchteil des typografischen Gevierts. Laufweitenveränderung ist immer im Zusammenhang mit der Schriftgröße zu sehen: je kleiner die Schrift, desto größer die Laufweite. Laufweitenveränderung entspricht nicht dem Sperren: Ersteres ist für die meisten Schriften notwendig, letzteres ist eine typografische Auszeichnung. Die Laufweite kann positiv oder negativ sein. Die Fette hat Einfluss auf die Laufweite: bei fetten werden die Punzen proportional kleiner. Deswegen wirken die Abstände zwischen den Buchstaben in Relation zu den Binnenräumen größer, auch wenn sie absolut gleich bleiben. Bei kleinen Schriften muss die Laufweite oft erhöht werden, damit sie lesbar bleiben. 250
251 Typografie Detailtypografie - Weißräume Bei großen Schriften sollte die Laufweite reduziert werden. Die Buchstaben dürfen sich nicht berühren. Die Zwischenräume müssen im Verhältnis zu den Binnenräumen angepasst werden. Binnen- und Zwischenräume stehen in einem harmonischen Verhältnis zueinander. Gestürzte Textzeilen: Vertikale Textzeilen brauchen eine deutlich größere Laufweite als horizontale. Weiße Schrift auf dunklem Untergrund: Die Buchstabenbinnenräume und zwischenräume werden durch die hell scheinenden Schrifträume angegriffen und wirken dadurch kleiner, deshalb muss hier die Laufweite erhöht werden. Auch von der jeweiligen Drucktechnik und Papierart kann die Laufweite abhängen (siehe hierzu Detailtypografie, S. 115) Randausgleich Es gibt keine vollkommen geraden Satzkanten, weil z. B. Trennungsstriche oder das unterschiedliche Fleisch der Buchstaben kleine Löcher in die Kanten reißen. Beim Randausgleich schiebt man Zeichen mit viel Fleisch ein klein wenig nach außen, um dieser Unruhe entgegen zu wirken. Jedoch gilt hier das gleiche wie für das Kerning auch: Besser nichts tun, als zu viel tun! Hängende Satzzeichen (z. B. vollständig ausgerückte Anführungszeichen) kommen nur für wenige große Zeilen in Frage. Randausgleich in vier Steigerungsstufen Gedanken- und Trennstriche Punkt und Komma Versalien Kleinbuchstaben Sonderfälle: f, J, j. Die beiden Buchstaben J und j ragen mit ihrem Tropfen bei vielen Schriften weit über die Dickte hinaus, was am Zeilenanfang sehr auffällig ist. Das Gleiche gilt an der rechten Satzkante für das f. Bei großer Schrift und bei stark unterschiedlich großen Schriften müssen die Satzkanten besonders beachtet werden. Auch im zentrierten Satz können Satzkanten ausgerichtet werden, vor allem bei Interpunktionen an Zeilenende oder Zeilenanfang ist das wichtig, denn dann verschiebt sich die Zeile optisch nach links oder rechts Weißräume Innerhalb der Zeile gibt es folgende Arten von Abständen und Weißräumen: Wortzwischenräume häufigste Abstände müssen auf Schrift, Zeilenabstand und Schriftgröße abgestimmt werden. geschützte Wortzwischenräume muss zu den Weißräumen der Schrift passen: ein gedrängte Schrift braucht kleinere WZRs. als eine weit laufende. Bei großen Schriften (ab ca. 16 Punkt) verringert man die WZRs etwas. Der Zeilenabstand darf nicht so klein sein, dass die Wortabstände größer wirken als der Zeilenabstand. 251
252 Typografie Detailtypografie - Weißräume Den WZR sieht man sich am besten in Flattersatzzeilen an, da er hier immer den gleichen Abstand hat. Passt der WZR zur Schrift? Weit laufende Schriften brauchen weitere Abstände als eng laufende Schriften. Passt der Zeilenabstand zum WZR? Ist er zu klein, geht die Bandwirkung verloren, die das Auge führt. Nach kursiver Schrift macht man den WZR oft weiter. In Kombinationen wie m/wrz/w macht man ihn enger, in f/wzr/t weiter. [Lesezeichen, unklar] Das Flexible Leerzeichen Innerhalb von Abkürzungen, Daten etc. wird ein kleinerer Abstand benötigt. (In InDesign heißt dieser Abstand Viertelgeviert. Das Flexible Leerzeichen heißt so, weil man seine Größe selbst bestimmen kann. Man muss eine Breite wählen, die kleiner ist als der kleinste im Blocksatz erlaubte WZR. Das Geviert Das Geviert und seine Unterteilungen dienen als feste Leerzeichen Das ganze Geviert dient als größerer fester Weißraum, der im Blocksatz nicht verändert wird. Das Halbgeviert kann man in manchen Programmen so definieren, dass es die Breite einer Tabellenziffer hat, was beim Tabellensatz praktisch ist. Das manuelle Spationieren Meist vergrößert man Abstände in besonderen Zeichenkombinationen, bei Formatierungswechseln u. ä. Wenn das Satzprogramm über Formatierungs-Grenzen hinaus das Kerning nicht anwendet, muss man von Hand nachhelfen, etwa beim Übergang von der Kursiven auf die Normale oder bei Fußnotenzahlen oder bei seltenen Zeichenkombinationen, die beim Kerning nicht berücksichtigt wurden. Wortzwischenräume im Flattersatz Der Flattersatz sollte groß genug sein, damit der Flattersatz nicht aussieht wie missglückter Blocksatz. Die meisten Programme bieten folgende Voreinstellungen: Mindestgröße des WZRs Optimale Größe des WZRs Maximal Größe der WZRs Maximale Zahl aufeinander folgender Trennungen Minimale Silbengröße bei Trennungen Gekoppelte Wörter sollte man nur an der Koppelungsstelle und an eventuellen Wortfugen trennen: Milch-säure-Gärung. Oben 2/unten 3 ist sicher zu trennungsreich. Bewährt haben sich: Oben 3-, unten 4-buchstabige Wortteile Oben 4, unten 4 Oben 4, unten 5 Oben 5, unten 5 252
253 Typografie Detailtypografie - Zeilen- und Seitenumbruch Wortzwischenräume im Blocksatz Mindestens: 85 % des in der Schrift eingebauten WZRs. Optimal: 100 % Maximal: InDesign 130 % Maximale Zahl der Trennungen: unbegrenzt. Nach Schriftsetzer-Tradition sind mehr als drei Trennungen in Folge nicht erlaubt. Guten Satz muss man ohnehin auf Löcher und schlechte Trennungen absuchen. Minimale Silbenlänge: auf der oberen Zeile 2-, auf der unteren 3-buchstablige Flexibles Leerzeichen und Geviert (nochmal genauer) Das FL (auf ca. 25 % eingestellt) dient als Abstand in Abkürzungen, in Daten, zwischen Buchstaben und Satzzeichen wie Bis-Strich, Schrägstrich oder Prozentzeichen. Wie den WZR gibt es die festen Abstände meist in zwei Varianten: An den Abständen wird im Blocksatz am Zeilenende automatisch getrennt. An den Zeichen wird nicht getrennt. Das ganze Geviert kann man benutzen, wenn man einen festen Abstand braucht, der größer ist als ein WZR und im Blocksatz unveränderlich ist (Spitzmarken, Dezimalnummern in Überschriften, Seitenzahlen in nicht ausgetriebenen Inhaltsverzeichnissen u. ä.) wenn man es als DTP-Geviert definiert hat; dann hat es meistens die Breite von zwei Tabellenziffern Zeilen- und Seitenumbruch Trennungen Kommen häufiger vor im Blocksatz oder bei kurzen Zeilen als bei Flattersatz bzw. langen Zeilen. Trennungen stören den Lesefluss nicht; nur schlechte Trennungen können die sinngemäße Texterfassung erschweren. Das geschlossene Satzbild auf der einen Seite und ein intaktes Wortbild auf der anderen Seite werden gegeneinander abgewogen. Mehrere Trennungen Aufeinander folgende gleiche Trennungen Schöne Trennungen Unschöne Trennungen Namen Sinnentstellte Trennungen Neue Rechtschreibung Vor- und Nachname Mehrere Vornamen- Sind nicht erwünscht, aber zu dulden gegenüber einem löchrigen Satz Ziehen Aufmerksamkeit so stark auf sich, weshalb diese zu vermeiden sind. Richten sich nach Wortteilen (Wortbild) und nicht nach Sprechsilben. Stören zu sehr. Trennungen nur mit dem Anfangsbuchstaben müssen unbedingt vermieden werden. Für Namen sollte man eine schöne Trennfuge suchen. Darf man trennen, wenn der Vorname ausgeschrieben ist. Können im unvermeidlichen Falle getrennt werden. 253
254 Typografie Detailtypografie - Zeilen- und Seitenumbruch Initialen Namenspräfixe Titelpräfix Titelpostfix Namen mit Pädikaten von bleibt beim Nachnamen Kann im unvermeidlichen Falle vom Vornamen getrennt werden. Georg von Müggenburg M. A. darf nicht vollständig getrennt werden. Besser ist Müggen-burg M. A. Friedrich der Große darf ohne weiteres getrennt werden. Zahlen Ordnungszahlen Sollten nicht allein stehen: Friedrich Will-helm IV. Abkürzungen Am Ende einer Seite Mängel der automatischen Trennroutine Divis Datum Uhrzeit Einheiten Längere Zahlen Keine Trennung. Hinter einem ausgeschriebenen Monat kann getrennt werden. Keine Trennung. Zahlen werden nie von Einheiten getrennt. Dies gilt auch für ausgeschriebene Einheiten. Die Trennung ist nur unproblematisch, wenn auch die Zahl ausgeschrieben ist. Keine Trennung. Zwischen den Dreiergruppen gehört ein gfl. Mathematische Zeichen Bei einer Gleichung kann bei einem Relationszeichen (=, <, > usw.) getrennt werden. Automatische Trennungen an unerwünschten Stellen Vermeidung von automatischen Trennungen Das Divis als Koppelstrich Divis als Ergänzungsbindestrich Werden nie getrennt. Zwischen Abkürzungen gehört ein gfl. Zu den gebräuchlichsten Abkürzungen siehe Detailtypografie, S. 133 Wenn möglich nicht trennen. Auf gar keinen Fall sollte man trennen, wenn darauf eine oder mehrere Seiten folgen, die den Lesefluss unterbrechen, wie dies z. B. bei Bildbänden der Fall sein kann. Oft bei zusammengesetzten Hauptwörtern, Ligaturen, Umlauten und dem scharfen s. Niemals manuell einen Trennstrich eingeben. Die meisten Programme verfügen über einen weichen bzw. bedingten Trennstrich. Niemals einen manuellen Zeilenwechsel verwenden, sondern eine weichen Trennstrich vor dem Wort ein, das nicht getrennt werden soll. Bleibt immer in der oberen Zeile stehen (Trenn- oder Koppelstrich). F-16 sollte nicht getrennt werden. Dafür gibt es einen geschützten Bindestrich. Bleibt immer bei seinem Wort, z. B. Trenn-Rauhigkeiten und Widrigkeiten Schusterjungen und Hurenkinder Schusterjungen nennt man Zeilen am Kolumnenfuß, mit denen ein neuer Absatz beginnt. Hurenkinder heißen Zeilen, die einen Absatz beschließen und gleichzeitig als erste Zeile oben in einer neuen Textkolumne stehen. Schusterjungen sind heute weit gehend akzeptiert. Schusterjungen und Hurenkinder können aus zwei Gründen Unbehagen verursachen: Am Anfang oder am Ende der Textkolumne stehen zwei aufeinander folgende Zeilen, die beide nicht über die volle Satzbreite gehen (wenn der Beginn des neuen Absatzes eingezogen ist). Die Symmetrie der Doppelseite wird dadurch gestört. Der Absatz stellt eine vom Autor bestimmte Zäsur im Lesefluss dar. Wenn die inhaltliche Zäsur durch einen Absatz und die Unterbrechung im Lesefluss durch den Seitenwechsel einander knapp verfehlen, führt dies zu Irritation. 254
255 Typografie Detailtypografie - Zeilen- und Seitenumbruch Eine einzelne auslaufende Zeile ganz allein auf einer Seite ist nicht akzeptabel. Mindestens 3 Zeilen müssen auf einer Seite stehen. Das gilt vor allem auf linken Seiten. Umbruchbearbeitung bei umfangreichen Werken Um Schusterjungen und Hurenkinder zu vermeiden kann der Setzer: Eine oder mehrere Zeilen gewinnen, indem er in den vorhergehenden Absätzen den Wortabstand reduziert oder zusätzliche Trennungen zulässt (Einbringen). Eine oder mehrere zusätzliche Zeilen erzeugen, indem er die Wortabstände in den vorhergehenden Absätzen erhöht (Austreiben). An Stellen eingreifen, bei denen das Layout Leerzeilen vorsieht, z. B. bei Textabsenkungen am Kapitelanfang, bei Leerzeilen vor oder nach Zwischenüberschriften. Auf einer (Doppel-) Seite beide Textkolumnen um eine Zeile verlängern oder verkürzen, oder auch eine auslaufende Zeile unter dem Kolumnenfuß zulassen. Absatz wegfallen lassen, eine Textkürzung vornehmen, eine Tabelle oder eine Abbildung verkleinern, vergrößern oder an einen anderen Platz stellen. (Näheres siehe Detailtypografie, S. 136) Wortzwischenräume manuell bearbeiten [Lesezeichen, Tastenkombination in InDesign recherchieren] 255
256 Farbenlehre Physik - Zeilen- und Seitenumbruch 4 Farbenlehre 4.1 Physik Plato: Sehen besteht aus korpuskularen Sehstrahlen, die von den Augen auf die Objekte geworfen werden. Isaac Newton (17. Jh.): Licht besteht aus Partikeln. Er konnte jedoch einen Wellencharakter nicht ausschließen. Christopher Huygens: Licht besteht aus Impulswellen, die sich durch den Äther ausbreiten. Diese Auffassung wurde von Thomas Young 1801 experimentell bestätigt und später von Maxwell und Faraday ergänzt. 20. Jh.: Sowohl die Wellen- als auch die Korpuskulartheorie trifft für Licht zu. Licht besteht aus quantifizierten Wellen. Es ist sinnvoll, das Thema Licht in unterschiedlichen Sichtweisen zu beleuchten: als Erlebnisphänomen und als physikalische Größe. Die Energieteilchen, die von einem Atom ausgesandt werden, sind Photonen, die sich als Photonenschwarm ausbreiten. Je mehr Photonen vorhanden sind, die sich in der Art einer Perlenschnur geradlinig hintereinander fortbewegen, desto intensiver, also heller ist das Licht. Die Photonen, die von der Sonne ausgesandt werden, breiten sich jedoch nicht strahlenförmig, sondern als kugelförmige Wellenfront aus. Dabei wird die Dichte des Lichtes geringer, je weiter es sich von der Lichtquelle entfernt. Einen Sonderfall stellen Laserstrahlen dar, bei denen Licht gebündelt austritt. Isaac Newton: Weißes Licht kann in Farben zerlegt werden. Newton unterschied sieben Farbtöne: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo (fraglich) und Violett. Hinzu kommt der Magentabereich, der erst durch das Überlagern der beiden Spektralenden als Mischung aus Blau und Rot entsteht. Die Eigenschaft, bestimmte Anteile des auftreffenden Lichts zurückzuhalten und andere zurückzustrahlen, geht von Pigmenten aus, die in der Oberfläche eines Gegenstandes enthalten sind. 4.2 Farbensehen, Farbmetrik, Farbwahrnehmung Unser Auge empfindet elektromagnetische Schwingungen als Licht im Wellenlängenbereich zwischen 800 und 390 nm. Abb. 275 Kontinuierliches Spektrum 256
257 Farbenlehre Farbensehen, Farbmetrik, Farbwahrnehmung - Zeilen- und Seitenumbruch Rot mµ Orange mµ Gelb mµ Grün mµ Blau mµ Violett mµ Maximaler Empfindungsbereich der Farbrezeptoren Rotbereich (Rotrezeptor) nm Grünbereich (Grünrezeptor) Blaubereich (Blaurezeptor) nm nm Abb. 276 Farbzentrum des Gehirns Die Netzhaut ist ca. 5 qm groß und hat etwa lichtempfindliche Zellen (Sensoren). Nur Zellen (Zapfen) können die Farbinformation verarbeiten. Die anderen Zellen (Stäbchen) empfangen Helligkeitsinformationen. Der von der Netzhaus ausgehende Sehnerv (blinder Fleck) überträgt ca. 1,5 Mio. Informationseinheiten kontinuierlich an das Großhirn. Die Farbmetrik entwickelt Systeme zur quantitativen Erfassung und Kennzeichnung der Farbeindrücke (Farbvalenzen). Farbsehen ist ein subjektives Gefühl. Es besteht daher ein Wahrnehmungskonflikt zwischen Farbwirklichkeit (Auge) und Farbempfindung (Gehirn Seele). Der Wert einer Farbe kann nicht absolut definiert werden. Er ergibt sich aus dem Vergleich mit einer oder mehrerer Farben. Zum Beispiel wirkt Rot neben Violett hell und neben Geld dunkel oder neben Orange kalt und neben Grün warm. Lichtfarbenpaare, die zusammen Weiß ergeben, heißen Komplementärfarben (z. B. Orange + Blau = Weiß, Gelb + Violett = Weiß). [Lesezeichen, nicht verstanden] Absorption: ein Körper verschluckt Licht, elektromagnetische Energie wird in Wärme umgewandelt. Reflexion: Licht bzw. Teile davon werden zurückgeworfen. Beispiel: Weißes Licht fällt auf einen Körper. Durch seine physikalische Beschaffenheit werden die blauen und violetten Spektrumsanteile absorbiert, alle anderen reflektiert: Gelb, Orange, Rot, Grün. Nachdem die roten und grünen Anteile wieder Weiß ergeben, erscheint uns der Körper in der Farbe Gelborange. 257
258 Farbenlehre Farbmodelle - Zeilen- und Seitenumbruch 4.3 Farbmodelle Abb. 277 Additives und subtraktives Farbsystem Additives (physiologisches) Farbsystem Subtraktives (physikalisches) Farbsystem RGB Man nennt sie auch Lichtfarben. CMY Man nennt sie auch Körperfarben, da es sich um Farben handelt, die man anfassen kann, also z. B. Gegenstände, Malfarben etc. Autotypisches Farbsystem ist die Mischung der Farben im Druck, welche die additive und subtraktive vereinigt. Das remittierte Licht der nebeneinander liegenden Farbflächen mischt sic additiv im Auge (physiologisch), die übereinandergedruckten Flächenelemente mischen sich subtraktiv auf dem Bedruckstoff (physikalisch). [Lesezeichen, Vorlesungsskript, 86] Werden zwei Primärfarben zusammengebracht, so entstehen Sekundärfarben. Alle Sekundärfarben entstehen durch unterschiedliche Anteile von je zwei Primärfarben und behalten dadurch die volle Buntkraft. Erst durch das Zusammentreffen aller drei Primärfarben entstehen Tertiärfarben. 258
259 Farbenlehre Farbmodelle - Zeilen- und Seitenumbruch Abb. 278 Primär- und Sekundärfarben Abb. 279 Die ungleichmäßige Verteilung im Farbkreis 259
260 Farbenlehre Farbmodelle - Farbordnungssysteme Abb. 280 Modulationen nach Grau Der gesamte Bereich der Graumodulationen ist sehr umfangreich. Die Ergebnisse sind im Vergleich zu Weißmodulationen angenehmer und zurückhaltender. Bei Tonflächen im Mehrfarbendruck werden die Grautöne durch Aufrasterung erzielt. Jede Farbe hat ihr Komplementärfarbe. Komplementärfarben sind immer Farbenpaare. Werden sie ineinander gemischt, dann löschen sie sich gegenseitig aus. Dagegen steigern sie sich gegenseitig, wenn sie nebeneinander stehen. Komplementäre Farben ergeben einen sogenannten Simultankontrast. Wie viele Farben lassen sich unterscheiden? Das British Council of Color hat folgende Untersuchungsergebnisse erstellt: 1400 Blautöne, 1375 Brauntöne, 1000 Rottöne, 820 Grüntöne, 550 Orangetöne, 50 Grautöne, 360 Violetttöne, 12 Weißtöne. Man kann sich der Gesamtzahl der Farben auch dadurch annähern, dass man alle möglichen Mischungen berechnet. Dabei kann man von den 160 Farbtönen des Spektrums ausgehen und diese mit Weiß und mit Schwarz mischen. Auch bei großzügigem Überschlag kommt man auf Max unterscheidbare Farbtöne Farbordnungssysteme Auf einer zweidimensionalen Farbtafel können maximal drei Parameter auftreten, z. B. Abstufungen von Cyan, Gelb und Weiß. Beim dreidimensionalen Farbkörper sind es Max. vier Parameter: entweder die drei Primärfarben und Weiß oder je zwei Primärfarben plus Weiß, plus Schwarz. Da es keine Möglichkeit gibt, beide Systeme zu vereinigen, existieren beide Modelle gleichberechtigt nebeneinander. Fünf Parameter nach den fünf Grundfarben Gelb, Magenta, Cyan, Schwarz, Weiß können daher nicht anschaulich sondern nur tabellarisch dargestellt werden. Farbmischsysteme Itten, Hickethier, RGB, CMY Farbauswahlsysteme Indizierte Farben (Max. 256 werden aus einem Bild ausgewählt und in eine Farbtabelle übertragen) 260
261 Farbenlehre Farbmodelle - Farbordnungssysteme Farbmaßsysteme Sechsteiliger Farbkreis RGB und CMYK basieren auf der valenzmetrischen Messung von Farben. CIE-Normvalenzsystem, CIELAB-System, CIELUV-System ist das einfachste Farbordnungssystem. Magenta ist als einzige Grundfarbe nicht im Spektrum vertreten. Sie ist die additive Mischung aus den beiden Enden des Spektrums Blau und Rot. (siehe Abb.) siehe Abb. Das RGB-System ermöglicht keine absolute Farbkennzeichnung. Wie bei den als Druckfarben verwendeten subtraktiven Grundfarben CMY, sind herstellerbedingt unterschiedliche spektrale Werte vorhanden. Beispiele für RGB-Farbräume sind: srgb (standardrgb) CIE RGB (größerer RGB-Farbraum) PAL/SECAM Da ein Farbraum durch vier Grundfarben CMYK überbestimmt ist, muss bei jedem CMYK-Farbraum die Grundfarbe Schwarz definiert werden. Die eindeutigste Definition ergibt sich, enn keine Mischfarbe durch mehr als drei Grundfarben entsteht, nämlich entweder durch drei Buntfarben (Buntaufbau) oder durch zwei Buntfarben und Schwarz (Unbuntaufbau). Die CMYK-Farbräume hängen von den unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten von Papier und Druckbedingungen ab. 261
262 Farbenlehre Farbmodelle - Farbordnungssysteme CIE-Normvalenzsystem 1931, auch Schuhsohle genannt Definition der Farbe als Gesichtssinn Die subjektive Farbempfindung wurde durch eine Versuchsreihe mit verschiedenen Testpersonen auf allg. Farbmaßzahlen, den Farbvalenzen, zurückgeführt (Normalbeobachter). Farbvalenz ist die Bewertung eines Farbreizes durch die drei Empfindlichkeitsfunktionen des Auges. Die Farbmaßzahlen X, Y und Z dienen zur eindeutigen Kennzeichnung einer Farbvalenz. Die Normfarbwertanteile () kennzeichnen den geometrischen Farbort einer Farbe. Sie lassen sich einfach aus den Farbvalenzen errechnen. Da die Summe der Normspektralwertanteile 1 ist, genügen zwei Anteile zur Eintragung der Farbart als Farbort in die Farbtafel. Beschreibung Im Normfarbenraum sind alle sichtbaren Farben wiedergegeben. Die Spektralfarben (gesättigte Farben) liegen auf der unteren gekrümmten Außenlinie. Auf der unteren Geraden liegen die gesättigten Purpurfarben (additive Mischfarben aus Blau und Rot) Im Unbuntpunkt E (x, x, z = 0,33) steht senkrecht die Grauachse (Unbuntachse), Hellbezugswert Y = 0 : Schwarz, Y = 100 : Weiß Farbortbestimmung Farbton T: Lage der Außenlinie Sättigung S: Entfernung von der Außenlinie Helligkeit Y: Ebene im Farbkörper CIELAB-System MacAdam-Ellipsen Farben sind gleich; Ellipsen sind unterschiedlich groß (David L. MacAdam). Das CIELAB (1976) behebt diese Fehler (siehe Abb.) Beschreibung Im L*a*b*-Farbraum sind alle sichtbaren Farben wiedergegeben Die Abb. stellt das Innere des Farbenraums dar. Die gesättigten Farben (Spektral- und Purpurfarben) liegen auf der Außenlinie der mittleren Ebene (L* = 50) In der Mitte des Farbenraums steht senkrecht die Unbunt- bzw. Grauachse (a* = b* = 0 : Schwarz, L* = 100 : Weiß Farbortbestimmung Helligkeit L* (Luminanz): Ebene im Farbkörper Sättigung C* (Chroma): Entfernung vom Unbuntpunkt Farbton H* (Hue): Richtung vom Unbuntpunkt H* und C* werden auf zweierlei Arten beschrieben: Durch die Koordinaten a* und b* in der Farbebene Durch den Bunttonbeitrag H* ab (Bunttonwinkel h*, a* = 0, mathematisch positive Richtung) und den Bunheitsbeitrag C* ab. 262
263 Farbenlehre Physiologische Farben - Farbordnungssysteme 4.4 Physiologische Farben Goethe stellt die Beobachtung in den Mittelpunkt seiner Farbenlehre und unterstrich mit dem Begriff der physiologischen Farbe seine Einstellung, dass die Farbe primär ein Phänomen der menschlichen Wahrnehmung ist. Farben nebeneinander beeinflussen sich gegenseitig. Chevreul hat hierzu den Begriff Simultankontrast geprägt. Die Farbverschiebungen vollziehen sich in drei verschiedene Richtungen (und können kombiniert werden): 1. Verstärkte Farbunterschiede: Der jeweilige Abstand der Farben im Farbenkreis/Spektrum erscheint größer als bei isolierter Betrachtung. 2. Verstärkte Helligkeitsunterschiede 3. Verstärkte Sättigung Abb. 281 Farbverschiebungen durch unterschiedliches Umfeld 263
264 Farbenlehre Physiologische Farben - Farbordnungssysteme Abb. 282 Nachbilder nennt man Sukzessivkontrast Beim Versuch, das Kreuz in der Mitte zu fixieren, bewegen sich die Augen früher oder später. Dann entstehen wandernde Nachbilder in der Randzone. Manche Farben liegen weiter vor als andere. Ob eine Farbe sich nach vorne zu drängen scheint, hängt in besonderem Maße von ihrer Fähigkeit zur Aufmerksamkeitserregung ab. 264
265 Farbenlehre Physiologische Farben - Farbordnungssysteme Abb. 283 Farbräumlichkeit Abb. 284 Scheinbarer Farbverlauf Abb. 285 Scheinbare Farbbewegung 265
266 Farbenlehre Farbharmonien - Farbordnungssysteme Farben, die zwar gesehen werden, jedoch in der Vorlage nicht vorhanden sind, nennt man induzierte Farben. 4.5 Farbharmonien Abb. 286 Farbtonleiter entsprechend der Oktave in der Musik. Abb. 287 Farbharmonie durch Einbeziehung des gesamten Farbraums in systematischer Anordnung 266
267 Farbenlehre Farbharmonien - Farbordnungssysteme Goethe akzeptiert nur Farbzusammenstellungen, die im Farbenkreis gleichabständig zueinander stehen und möglichst viele unterschiedliche Farben enthalten. Farbpaare, die im Farbenkreis nicht aus dem komplementären Bereich stammen, bezeichnet er als charakterlos. Damit werden sichere Harmonien erreicht, jedoch sind auch stets die gleichen Ergebnisse prädestiniert. Farben, die untereinander eine oder mehrere Gemeinsamkeiten aufweisen, lassen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem harmonischen Gesamtbild zusammenbringen: Eine Farbe mit Modulationen Reihen zwischen zwei Farben Tafeln aus drei und vier Farben Farben gleicher Helligkeit Farben gleicher Sättigung Modulationsfamilien Abb. 288 Modulationsfamilien Acht bunte Farben werden in gleichen Stufen nach Schwarz, Grau und Weiß abgestuft. In der gleichen Modulationsreihe passen alle Farben in beliebiger Auswahl und Reihenfolge bestens zusammen. Abb. 289 Buntfarben 100 % + Schwarz 20 % Abb. 290 Buntfarben 100 % + Schwarz 40 % 267
268 Farbenlehre Farbharmonien - Farbordnungssysteme Abb. 291 Buntfarben 80 % Abb. 292 Buntfarben 80 % + Schwarz 20 % Abb. 293 Buntfarben 80 % + Schwarz 40 % Abb. 294 Buntfarben 60 % Abb. 295 Buntfarben 60 % + Schwarz 20 % 268
269 Farbenlehre Farbharmonien - Farbordnungssysteme Abb. 296 Buntfarben 60 % + Schwarz 40 % Abb. 297 Buntfarben 40 % Abb. 298 Buntfarben 40 % + Schwarz 20 % Abb. 299 Buntfarben 40 % + Schwarz 40 % Abb. 300 Buntfarben 20 % 269
270 Farbenlehre Farbwürfel - Beispiel der Farbbestimmung im Farbtetraeder Abb. 301 Buntfarben 20 % + Schwarz 20 % Abb. 302 Buntfarben 20 % + Schwarz 40 % 4.6 Farbwürfel Abb. 303 Farbwürfel Ton in Ton lässt sich SW ändern. 4.7 Küppers Farbtetraeder Beispiel der Farbbestimmung im Farbtetraeder 270
Gestaltgesetze der Wahrnehmung. DI (FH) Dr. Alexander Berzler
 DI (FH) Dr. Alexander Berzler Gestaltpsychologie Die Gestaltpsychologie wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts begründet. Die Wahrnehmung unserer Umwelt geschieht nach der Gestaltpsychologie durch die Wahrnehmung
DI (FH) Dr. Alexander Berzler Gestaltpsychologie Die Gestaltpsychologie wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts begründet. Die Wahrnehmung unserer Umwelt geschieht nach der Gestaltpsychologie durch die Wahrnehmung
Gestaltgesetze Figur-Grund-Beziehung
 Figur-Grund-Beziehung Die Wahrnehmung unserer Umwelt geschieht nach der Gestaltpsychologie durch die Wahrnehmung von Formen. Nur so kann die unbestimmte Komplexität der Sinneswahrnehmungen aufgelöst und
Figur-Grund-Beziehung Die Wahrnehmung unserer Umwelt geschieht nach der Gestaltpsychologie durch die Wahrnehmung von Formen. Nur so kann die unbestimmte Komplexität der Sinneswahrnehmungen aufgelöst und
Seite 1 von Kognition 1 Gestalt und grafische Gestaltung für GUIs
 Seite 1 von 6 5. Kognition 1 Gestalt und grafische Gestaltung für GUIs Wahrnehmung in der Gestaltpsychologie - Entstehung Anfang 20. Jhdt. - Gestalt-Qualitäten beeinflussen das Wahrnehmungserleben - Vertreter:
Seite 1 von 6 5. Kognition 1 Gestalt und grafische Gestaltung für GUIs Wahrnehmung in der Gestaltpsychologie - Entstehung Anfang 20. Jhdt. - Gestalt-Qualitäten beeinflussen das Wahrnehmungserleben - Vertreter:
Typografie und Layout \ Catrin Sieber \ Wintersem ester \ Hochschule für Künste Bremen \ Studiengang Digitale Medien \ Mediengestaltung \
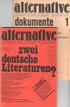 Typografie und Layout \ Catrin Sieber \ Wintersem ester 2005-06 \ Hochschule für Künste Bremen \ Studiengang Digitale Medien \ Mediengestaltung \ Medieninformatik Optische Grundlagen Typografie und Layout
Typografie und Layout \ Catrin Sieber \ Wintersem ester 2005-06 \ Hochschule für Künste Bremen \ Studiengang Digitale Medien \ Mediengestaltung \ Medieninformatik Optische Grundlagen Typografie und Layout
Einheit 2. Wahrnehmung
 Einheit 2 Wahrnehmung Wahrnehmung bezeichnet in der Psychologie und Physiologie die Summe der Schritte Aufnahme, Interpretation, Auswahl und Organisation von sensorischen Informationen. Es sind demnach
Einheit 2 Wahrnehmung Wahrnehmung bezeichnet in der Psychologie und Physiologie die Summe der Schritte Aufnahme, Interpretation, Auswahl und Organisation von sensorischen Informationen. Es sind demnach
1. Übung zu QuarkXPress 1.1 Format
 1. Übung zu QuarkXPress 1.1 Format - Format ist Basis jeglicher Gestaltung DIN A-Reihe - Ausgangsformat DIN A0 (841mm x 1189mm=1m 2, Seitenverhältnis 1 : 2 ) immer wieder an der langen Seite halbiert -
1. Übung zu QuarkXPress 1.1 Format - Format ist Basis jeglicher Gestaltung DIN A-Reihe - Ausgangsformat DIN A0 (841mm x 1189mm=1m 2, Seitenverhältnis 1 : 2 ) immer wieder an der langen Seite halbiert -
Schrift & Typografie I. DI (FH) Dr. Alexander Berzler
 Schrift & Typografie I DI (FH) Dr. Alexander Berzler Schrift & Typografie Theorie Der Ausdruck Typografie/Typographie geht zurück auf die Worte "typos" (Abdruck, Abbild, Form) und "graphein" (schreiben,
Schrift & Typografie I DI (FH) Dr. Alexander Berzler Schrift & Typografie Theorie Der Ausdruck Typografie/Typographie geht zurück auf die Worte "typos" (Abdruck, Abbild, Form) und "graphein" (schreiben,
Optische Täuschungen. physiologische, psychologische und physikalische Sicht
 Optische Täuschungen physiologische, psychologische und physikalische Sicht Wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung der ersten Staatsprüfung für das Lehramt Gymnasium Universität Leipzig Fakultät für Physik
Optische Täuschungen physiologische, psychologische und physikalische Sicht Wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung der ersten Staatsprüfung für das Lehramt Gymnasium Universität Leipzig Fakultät für Physik
Formwahrnehmung aus Schattierung. Von Vilayanur S. Ramachandran bearbeitet von Anna- Marisa Piontek
 Formwahrnehmung aus Schattierung Von Vilayanur S. Ramachandran bearbeitet von Anna- Marisa Piontek Wie sehen wir dreidimensional? Seherfahrung basiert auf zweidimensionalen Bildern, die auf Retina abgebildet
Formwahrnehmung aus Schattierung Von Vilayanur S. Ramachandran bearbeitet von Anna- Marisa Piontek Wie sehen wir dreidimensional? Seherfahrung basiert auf zweidimensionalen Bildern, die auf Retina abgebildet
Typografie. Griechisch typos (=Gestalt) und graphein (=schreiben) Die bewußte Verteilung von Schriftzeichen in einem vorgegebenen Raum
 Definition Typografie Griechisch typos (=Gestalt) und graphein (=schreiben) Die bewußte Verteilung von Schriftzeichen in einem vorgegebenen Raum Typografie ist Sinnvermittlung unter funktionellen und ästhetischen
Definition Typografie Griechisch typos (=Gestalt) und graphein (=schreiben) Die bewußte Verteilung von Schriftzeichen in einem vorgegebenen Raum Typografie ist Sinnvermittlung unter funktionellen und ästhetischen
1. Übung zu QuarkXPress 1.1 Format
 1. Übung zu QuarkXPress 1.1 Format - Format ist Basis jeglicher Gestaltung DIN A-Reihe - Ausgangsformat DIN A0 (841mm x 1189mm=1m 2, Seitenverhältnis 1 : 2 ) immer wieder an der langen Seite halbiert -
1. Übung zu QuarkXPress 1.1 Format - Format ist Basis jeglicher Gestaltung DIN A-Reihe - Ausgangsformat DIN A0 (841mm x 1189mm=1m 2, Seitenverhältnis 1 : 2 ) immer wieder an der langen Seite halbiert -
Gestaltgesetze. Grundlagen der Gestaltung. bbw Berlin Internet Grundlagen Seite 1 / 21
 bbw Berlin Internet Grundlagen Seite 1 / 21 Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile Die Gestaltgesetze dienen in der menschlichen Wahrnehmung der Raumaufteilung in Figur und (Hinter-)Grund. bbw Berlin
bbw Berlin Internet Grundlagen Seite 1 / 21 Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile Die Gestaltgesetze dienen in der menschlichen Wahrnehmung der Raumaufteilung in Figur und (Hinter-)Grund. bbw Berlin
Wahrnehmung und Kunst
 Wahrnehmung und Kunst Aus: Irvin Rock: Vom visuellen Reiz zum Sehen und Erkennen. Heidelberg, Berlin; Spektrum, Akadem. Verlag, 1998 Malerei kann auf einer zweidimensionalen Fläche die Illusion eines dreidimensionalen
Wahrnehmung und Kunst Aus: Irvin Rock: Vom visuellen Reiz zum Sehen und Erkennen. Heidelberg, Berlin; Spektrum, Akadem. Verlag, 1998 Malerei kann auf einer zweidimensionalen Fläche die Illusion eines dreidimensionalen
5. Optische Täuschungen
 5. Hat der Betrachter den Eindruck, es besteht ein Unterschied zwischen dem was er sieht und dem was er vor sich hat, spricht er von einer optischen Täuschung. So stellen optische Täuschungen die Ansicht
5. Hat der Betrachter den Eindruck, es besteht ein Unterschied zwischen dem was er sieht und dem was er vor sich hat, spricht er von einer optischen Täuschung. So stellen optische Täuschungen die Ansicht
Visuelle Bewegungswahrnehmung. Visuelle Wahrnehmung Dipl. Psych. Kai Hamburger
 Visuelle Bewegungswahrnehmung Seminar: Dozent: Referentin: Datum: Visuelle Wahrnehmung Dipl. Psych. Kai Hamburger Debora Palm 14.06.2004 Visuelle Bewegungswahrnehmung Einführung Verarbeitung von bewegten
Visuelle Bewegungswahrnehmung Seminar: Dozent: Referentin: Datum: Visuelle Wahrnehmung Dipl. Psych. Kai Hamburger Debora Palm 14.06.2004 Visuelle Bewegungswahrnehmung Einführung Verarbeitung von bewegten
Einführung in die Wahrnehmungspsychologie Optische Täuschungen
 180268 SE Didaktik des Psychologieunterrichts - eine praxisorientierte Anwendung Susanne Sturm, Martina Hörwein Einführung in die Wahrnehmungspsychologie Optische Täuschungen Wahrnehmung beruht auf Empfindungen,
180268 SE Didaktik des Psychologieunterrichts - eine praxisorientierte Anwendung Susanne Sturm, Martina Hörwein Einführung in die Wahrnehmungspsychologie Optische Täuschungen Wahrnehmung beruht auf Empfindungen,
Marlene Schnelle-Schneyder Sehen und Photographieren Von der Ästhetik zum Bild
 Marlene Schnelle-Schneyder Sehen und Photographieren Von der Ästhetik zum Bild Mit 297 Abbildungen Springer Inhaltsverzeichnis 1 Wahrnehmung und Bildmedien 1 1.1 Photographie und Bild 2 1.1.1 Der Status
Marlene Schnelle-Schneyder Sehen und Photographieren Von der Ästhetik zum Bild Mit 297 Abbildungen Springer Inhaltsverzeichnis 1 Wahrnehmung und Bildmedien 1 1.1 Photographie und Bild 2 1.1.1 Der Status
Optische Täuschungen Jacqueline Musil , A
 Optische Täuschungen Jacqueline Musil 0401823, A 190 445 299 Optische Täuschungen Wahrnehmungstäuschungen Gestaltpsychologie Optische Täuschungen / Visuelle Illusionen Gestaltpsychologie Die Gestalt (Das
Optische Täuschungen Jacqueline Musil 0401823, A 190 445 299 Optische Täuschungen Wahrnehmungstäuschungen Gestaltpsychologie Optische Täuschungen / Visuelle Illusionen Gestaltpsychologie Die Gestalt (Das
Die Grundlagen der Gestaltung Die Perspektive
 Gute Bildgestaltung in Theorie und Praxis Die Grundlagen der Gestaltung Die Perspektive Kaum mit einem anderen Wort wird, selbst von namhaften Autoren in der Fotografie, derart Schindluderei getrieben
Gute Bildgestaltung in Theorie und Praxis Die Grundlagen der Gestaltung Die Perspektive Kaum mit einem anderen Wort wird, selbst von namhaften Autoren in der Fotografie, derart Schindluderei getrieben
Dirk Zischka. Farbgestaltung
 Farbgestaltung Farbgestaltung Anmerkung: generell Geschmacksfrage, für die es keine verbindliche Regel gibt Ziel: Aufmerksamkeit erzielen Hilfsmittel: Farbe und Form Farbharmonien Farbkontraste Farbklänge
Farbgestaltung Farbgestaltung Anmerkung: generell Geschmacksfrage, für die es keine verbindliche Regel gibt Ziel: Aufmerksamkeit erzielen Hilfsmittel: Farbe und Form Farbharmonien Farbkontraste Farbklänge
KP Ludwig John. Layout + Gestaltwahrnehmung
 Zeit Literatur Nr. 49 Nov. 2008 Layout + Gestaltwahrnehmung Gestaltwahrnehmung Gestaltwahrnehmung Wahrnehmungssystem ist bestrebt, möglichst ökonomisch zu arbeiten. - gruppiert die Gesamtheit der einströmenden
Zeit Literatur Nr. 49 Nov. 2008 Layout + Gestaltwahrnehmung Gestaltwahrnehmung Gestaltwahrnehmung Wahrnehmungssystem ist bestrebt, möglichst ökonomisch zu arbeiten. - gruppiert die Gesamtheit der einströmenden
Kompendium der Mediengestaltung
 1.1 Kompendium der Mediengestaltung Abb. 1.1/1 Vakatseite Platz für Ideen, Platz für einen schönen Titel, oder gefällt er Ihnen etwa? 4 1. Gestaltung 1.1.1 Gestalten macht Spaß! Kreativ sein, etwas schaffen,
1.1 Kompendium der Mediengestaltung Abb. 1.1/1 Vakatseite Platz für Ideen, Platz für einen schönen Titel, oder gefällt er Ihnen etwa? 4 1. Gestaltung 1.1.1 Gestalten macht Spaß! Kreativ sein, etwas schaffen,
Optische Phänomene. Hier täuscht uns die Perspektive und die Gewohnheit. Der kleine Junge ist eigentlich genauso groß wie der ältere Herr.
 Optische Phänomene Der Strahlenförmige Verlauf lässt den linken Würfel kleiner erscheinen als den rechten. Der Effekt wurde von einigen Malern zu Beginn der Renaissance in Italien aufgegriffen um durch
Optische Phänomene Der Strahlenförmige Verlauf lässt den linken Würfel kleiner erscheinen als den rechten. Der Effekt wurde von einigen Malern zu Beginn der Renaissance in Italien aufgegriffen um durch
Überblick Designtheorie Web Web-Design
 Herzlich Willkommen Designtheorie Web Gestaltungselemente... Grundelemente Typografie Text Bild Farbe Bonneberg Kommunikation für Unternehmungen: Vorlesungsreihe SS 2009 FH Wolfenbüttel Mediendesign Gestaltungselemente
Herzlich Willkommen Designtheorie Web Gestaltungselemente... Grundelemente Typografie Text Bild Farbe Bonneberg Kommunikation für Unternehmungen: Vorlesungsreihe SS 2009 FH Wolfenbüttel Mediendesign Gestaltungselemente
8.Perspektive (oder Zentralprojektion)
 8.Perspektive (oder Zentralprojektion) In unseren bisherigen Vorlesungen haben wir uns einfachheitshalber mit Parallelprojektionen beschäftigt. Das menschliche Sehen (damit meinen wir immer das Sehen mit
8.Perspektive (oder Zentralprojektion) In unseren bisherigen Vorlesungen haben wir uns einfachheitshalber mit Parallelprojektionen beschäftigt. Das menschliche Sehen (damit meinen wir immer das Sehen mit
grundlagen rechnergestützter entwurf
 grundlagen rechnergestützter entwurf gestaltgesetze gestaltgesetze Gestaltgesetze Gestaltungsgesetze gestaltgesetze Was sind Gestaltgesetze? gestaltgesetze Gestaltgesetze können einen Hinweis darauf geben,
grundlagen rechnergestützter entwurf gestaltgesetze gestaltgesetze Gestaltgesetze Gestaltungsgesetze gestaltgesetze Was sind Gestaltgesetze? gestaltgesetze Gestaltgesetze können einen Hinweis darauf geben,
GERHARD ROTH WIE WIRD AUS ERFAHRUNG WISSEN?
 GERHARD ROTH INSTITUT FÜR HIRNFORSCHUNG UNIVERSITÄT BREMEN WIE WIRD AUS ERFAHRUNG WISSEN? INSTITUT FÜR HIRNFORSCHUNG UNIVERSITÄT BREMEN G. Roth, 2018 ERKENNTNISTHEORETISCHE GRUNDFRAGE Wie können wir Wissen,
GERHARD ROTH INSTITUT FÜR HIRNFORSCHUNG UNIVERSITÄT BREMEN WIE WIRD AUS ERFAHRUNG WISSEN? INSTITUT FÜR HIRNFORSCHUNG UNIVERSITÄT BREMEN G. Roth, 2018 ERKENNTNISTHEORETISCHE GRUNDFRAGE Wie können wir Wissen,
Ajdovic/Mühl Farbmodelle FARBMODELLE
 FARBMODELLE Grundlagen: Gegenstände, die von einer Lichtquelle beleuchtet werden, reflektieren und absorbieren jeweils einen Teil des Lichts. Dabei wird das von den Gegenständen reflektierte Licht vom
FARBMODELLE Grundlagen: Gegenstände, die von einer Lichtquelle beleuchtet werden, reflektieren und absorbieren jeweils einen Teil des Lichts. Dabei wird das von den Gegenständen reflektierte Licht vom
VL Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Woher weiß ich, was das ist? Objektwahrnehmung
 VL Wahrnehmung und Aufmerksamkeit Woher weiß ich, was das ist? Objektwahrnehmung Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oft hilft Verdeckung bei Erkennung. http://www.blelb.ch/deutsch/blelbspots/spot21/blelbspot21_de.htm
VL Wahrnehmung und Aufmerksamkeit Woher weiß ich, was das ist? Objektwahrnehmung Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oft hilft Verdeckung bei Erkennung. http://www.blelb.ch/deutsch/blelbspots/spot21/blelbspot21_de.htm
Die Wahrnehmung von Durchsichtigkeit. Referentin: Carina Kogel Seminar: Visuelle Wahrnehmung Dozent: Dr. Alexander C. Schütz
 Die Wahrnehmung von Durchsichtigkeit Referentin: Carina Kogel Seminar: Visuelle Wahrnehmung Dozent: Dr. Alexander C. Schütz Die Wahrnehmung von Durchsichtigkeit Ein Mosaik aus undurchsichtigen Farbflächen
Die Wahrnehmung von Durchsichtigkeit Referentin: Carina Kogel Seminar: Visuelle Wahrnehmung Dozent: Dr. Alexander C. Schütz Die Wahrnehmung von Durchsichtigkeit Ein Mosaik aus undurchsichtigen Farbflächen
EINFÜHRUNG GRAFIK 1 Von Elvira Stein
 EINFÜHRUNG GRAFIK 1 Von Elvira Stein / @elvirastein HALLO! Ich bin Elvira. Ich lebe und arbeite als Grafikerin und Illustratorin in Wien. Bitte stellt euch kurz vor. Was sind eure Erwartungen und Wünsche
EINFÜHRUNG GRAFIK 1 Von Elvira Stein / @elvirastein HALLO! Ich bin Elvira. Ich lebe und arbeite als Grafikerin und Illustratorin in Wien. Bitte stellt euch kurz vor. Was sind eure Erwartungen und Wünsche
Abstrakter Expressionismus. Willkommen
 Willkommen... in der grossen Familie derjenigen Künstler, die sich der abstrakten Malerei verschrieben haben. Du wirst berühmten Namen begegnen: Gorky, Pollock, Rothko, Newman, Klein. Diese Maler-Gruppe
Willkommen... in der grossen Familie derjenigen Künstler, die sich der abstrakten Malerei verschrieben haben. Du wirst berühmten Namen begegnen: Gorky, Pollock, Rothko, Newman, Klein. Diese Maler-Gruppe
Farblehre. Was ist Farbe und wie nehmen wir sie wahr? Licht und Farbempfindung. Die 8 Grundfarben. Additive Farbmischung. Subtraktive Farbmischung
 Farblehre Was ist Farbe und wie nehmen wir sie wahr? Licht und Farbempfindung Die 8 Grundfarben Additive Farbmischung Subtraktive Farbmischung Simultankontrast Harmonische Farbgestaltungen Farbkontrast
Farblehre Was ist Farbe und wie nehmen wir sie wahr? Licht und Farbempfindung Die 8 Grundfarben Additive Farbmischung Subtraktive Farbmischung Simultankontrast Harmonische Farbgestaltungen Farbkontrast
Biologische Psychologie I
 Biologische Psychologie I Kapitel 7 Mechanismen der Wahrnehmung, des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit Organisationsprinzipien eines sensorischen Systems: Primärer und sekundärer sensorischer Kortex
Biologische Psychologie I Kapitel 7 Mechanismen der Wahrnehmung, des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit Organisationsprinzipien eines sensorischen Systems: Primärer und sekundärer sensorischer Kortex
Wahrnehmung. Drei Ebenen der Forschung. Klassische Psychophysik. Gestaltpsychologie (strukturelle Psychophysik)
 Wahrnehmung Klassische Psychophysik Gestaltpsychologie (strukturelle Psychophysik) Kognitive Wahrnehmungspsychologie (korrelative Psychophysik) soziale Wahrnehmung Drei Ebenen der Forschung Phänomenale
Wahrnehmung Klassische Psychophysik Gestaltpsychologie (strukturelle Psychophysik) Kognitive Wahrnehmungspsychologie (korrelative Psychophysik) soziale Wahrnehmung Drei Ebenen der Forschung Phänomenale
Kapitel 6 Abstände. Buchstabenabstand Dickte und Laufweite
 Kapitel 6 Abstände Typografische Gestaltungsmittel sind nicht nur Buchstaben, Ziffern oder Linien sondern auch der freie Raum zwischen diesen Elementen. Die Abstände zwischen diesen Elementen haben eine
Kapitel 6 Abstände Typografische Gestaltungsmittel sind nicht nur Buchstaben, Ziffern oder Linien sondern auch der freie Raum zwischen diesen Elementen. Die Abstände zwischen diesen Elementen haben eine
Kapitel 1 Typografie/Schriftentwicklung
 Kapitel 1 Typografie/Schriftentwicklung Was ist Typografie eigentlich? "Wörtlich bedeutet Typografie das Schreiben mit Typen. Heute meint man grundsätzlich das Gestalten von Medien mittels Schrift und
Kapitel 1 Typografie/Schriftentwicklung Was ist Typografie eigentlich? "Wörtlich bedeutet Typografie das Schreiben mit Typen. Heute meint man grundsätzlich das Gestalten von Medien mittels Schrift und
Visuelle Wahrnehmung
 Visuelle Wahrnehmung Reizinformation aus der Umwelt Frage nach den Reizinformationen Wahrnehmung Vorwissen Frage nach den kognitiven Einflüssen Aktivität des Nervensystems Frage nach den physiologischen
Visuelle Wahrnehmung Reizinformation aus der Umwelt Frage nach den Reizinformationen Wahrnehmung Vorwissen Frage nach den kognitiven Einflüssen Aktivität des Nervensystems Frage nach den physiologischen
GruppeA B1GK. Die symmetrische Anordnung entsteht durch die Wiederholung gleicher Formen. Das kann mittels Reihung, Rotation oder spiegelbildlicher
 Ordnungssysteme Symmetrie/ Asymmetrie Symmetrie/ Asymmetrie Netz Reihung Rhythmuns Raster Die symmetrische Anordnung entsteht durch die Wiederholung gleicher Formen. Das kann mittels Reihung, Rotation
Ordnungssysteme Symmetrie/ Asymmetrie Symmetrie/ Asymmetrie Netz Reihung Rhythmuns Raster Die symmetrische Anordnung entsteht durch die Wiederholung gleicher Formen. Das kann mittels Reihung, Rotation
Farbentheorie. Die Wirkung der Farben
 Theorie Teil 2: Die Wirkung von Farben Agenda Teil 2: Die Wirkung der Farben: Relatives Farbensehen Farbentheorie Optische Phänomene Simultankontrast und Sukzessivkontrast Farben und Stimmung Die Wirkung
Theorie Teil 2: Die Wirkung von Farben Agenda Teil 2: Die Wirkung der Farben: Relatives Farbensehen Farbentheorie Optische Phänomene Simultankontrast und Sukzessivkontrast Farben und Stimmung Die Wirkung
Geometrisch-optische Täuschungen
 Prof. Dr. Gegenfurtner Geometrisch-optische Täuschungen Text von Barbara Gillam bearbeitet von Kathy Loh GLIEDERUNG. Vorstellung unterschiedlicher geometrisch-optischer Täuschunge. Mögliche Ursachen geometrisch
Prof. Dr. Gegenfurtner Geometrisch-optische Täuschungen Text von Barbara Gillam bearbeitet von Kathy Loh GLIEDERUNG. Vorstellung unterschiedlicher geometrisch-optischer Täuschunge. Mögliche Ursachen geometrisch
Colorcontex Zusammenhänge zwischen Farbe und textilem Material
 Colorcontex Zusammenhänge zwischen Farbe und textilem Material Zusammenfassung 2 2 2 Abstract Gruppierungen nach Eigenschaftspaaren Wirkung der Materialien Auswertung 3 4 5 6 7 8 9 10 Gelb Orange Rot Braun
Colorcontex Zusammenhänge zwischen Farbe und textilem Material Zusammenfassung 2 2 2 Abstract Gruppierungen nach Eigenschaftspaaren Wirkung der Materialien Auswertung 3 4 5 6 7 8 9 10 Gelb Orange Rot Braun
A K K O M M O D A T I O N
 biologie aktiv 4/Auge/Station 2/Lösung Welche Teile des Auges sind von außen sichtbar? Augenbraue, Augenlid, Wimpern, Pupille, Iris, Lederhaut, Hornhaut (durchsichtiger Bereich der Lederhaut) Leuchte nun
biologie aktiv 4/Auge/Station 2/Lösung Welche Teile des Auges sind von außen sichtbar? Augenbraue, Augenlid, Wimpern, Pupille, Iris, Lederhaut, Hornhaut (durchsichtiger Bereich der Lederhaut) Leuchte nun
Bildnerisches Gestalten
 Anzahl der Lektionen Bildungsziel Bildnerische Gestaltung ist Teil der Kultur. Sie visualisiert und verknüpft individuelle und gesellschaftliche Inhalte. Sie ist eine Form der Kommunikation und setzt sich
Anzahl der Lektionen Bildungsziel Bildnerische Gestaltung ist Teil der Kultur. Sie visualisiert und verknüpft individuelle und gesellschaftliche Inhalte. Sie ist eine Form der Kommunikation und setzt sich
Bildnerisches Gestalten 1. bis 9. Schuljahr: Umsetzungshilfe zu den Lehrplananpassungen Empfohlene Lehrmittel und Orientierungsarbeiten
 Bildnerisches Gestalten 1. bis 9. Schuljahr: Umsetzungshilfe zu den Lehrplananpassungen 2006. Empfohlene Lehrmittel und Orientierungsarbeiten Die Umsetzungshilfe umfasst die verbindlichen Grobziele der
Bildnerisches Gestalten 1. bis 9. Schuljahr: Umsetzungshilfe zu den Lehrplananpassungen 2006. Empfohlene Lehrmittel und Orientierungsarbeiten Die Umsetzungshilfe umfasst die verbindlichen Grobziele der
Die drei Komponenten Helligkeit, Farbton und Sättigung erlauben die Beschreibung von Farben.
 Farbkontraste Ein Farbkontrast ist wahrnehmbar, wenn im Vergleich zwischen zwei oder mehreren nebeneinander liegenden Farben deutlich erkennbare Unterschiede bestehen. Die drei Komponenten Helligkeit,
Farbkontraste Ein Farbkontrast ist wahrnehmbar, wenn im Vergleich zwischen zwei oder mehreren nebeneinander liegenden Farben deutlich erkennbare Unterschiede bestehen. Die drei Komponenten Helligkeit,
Die visuelle Wahrnehmung
 Die visuelle Wahrnehmung http://www.michaelbach.de/ot/index.html 09.01.2017 Franz Billmayer. Einführung in die Fachdidaktik Bildnerische Erziehung Winter 2016/2017 Die visuelle Wahrnehmung In BE geht es
Die visuelle Wahrnehmung http://www.michaelbach.de/ot/index.html 09.01.2017 Franz Billmayer. Einführung in die Fachdidaktik Bildnerische Erziehung Winter 2016/2017 Die visuelle Wahrnehmung In BE geht es
Die Zentralprojektion
 Perspektive Perspektivmodell (S. 1 von 6) / www.kunstbrowser.de Die Zentralprojektion Die Zentralprojektion eines Gegenstandes auf eine ebene Bildfläche ist das Grundprinzip, aus dem sich alle zentralperspektivischen
Perspektive Perspektivmodell (S. 1 von 6) / www.kunstbrowser.de Die Zentralprojektion Die Zentralprojektion eines Gegenstandes auf eine ebene Bildfläche ist das Grundprinzip, aus dem sich alle zentralperspektivischen
Bildgestaltung. Bilder lesen, erkennen und interpretieren. Ralf Turtschi
 Bildgestaltung Bilder lesen, erkennen und interpretieren Ralf Turtschi Agenturtschi In der Breiti 4, 8800 Thalwil, T +41 79 279 12 86 agenturtschi.ch, zeichen-setzen.ch Ralf Turtschi Typograf, Art Director,
Bildgestaltung Bilder lesen, erkennen und interpretieren Ralf Turtschi Agenturtschi In der Breiti 4, 8800 Thalwil, T +41 79 279 12 86 agenturtschi.ch, zeichen-setzen.ch Ralf Turtschi Typograf, Art Director,
Fotografieren mit der Digitalkamera
 Fotografieren mit der Digitalkamera 1 Zielsetzung Näher ran! Grundsätzlich sollte man sich bei jedem Bild überlegen, wozu man es aufnimmt: Familienfotos für kleine Ausdrucke? Bilder zum Verschicken? Produktfotos
Fotografieren mit der Digitalkamera 1 Zielsetzung Näher ran! Grundsätzlich sollte man sich bei jedem Bild überlegen, wozu man es aufnimmt: Familienfotos für kleine Ausdrucke? Bilder zum Verschicken? Produktfotos
Erklärung. Was sehen wir? Der Blick durch die Röhre
 Was sehen wir? Der Blick durch die Röhre Fixieren Sie durch die Röhre einen Gegenstand in der Ferne. Führen Sie dann, wie in der Abbildung gezeigt, ihre Hand an der Röhre entlang langsam in Richtung Auge.
Was sehen wir? Der Blick durch die Röhre Fixieren Sie durch die Röhre einen Gegenstand in der Ferne. Führen Sie dann, wie in der Abbildung gezeigt, ihre Hand an der Röhre entlang langsam in Richtung Auge.
Text-/Bild-Kombination
 Text-/Bild-Kombination Text-Bild- Kombination Bilder sind nicht mehr nur Sprachersatz, sondern haben auch eine kognitive Funktion in der Vermittlung. Text und Bild verhalten sich komplementär, d.h. sie
Text-/Bild-Kombination Text-Bild- Kombination Bilder sind nicht mehr nur Sprachersatz, sondern haben auch eine kognitive Funktion in der Vermittlung. Text und Bild verhalten sich komplementär, d.h. sie
Information und Produktion. Rolland Brunec Seminar Wissen
 Information und Produktion Rolland Brunec Seminar Wissen Einführung Informationssystem Einfluss des Internets auf Organisation Wissens-Ko-Produktion Informationssystem (IS) Soziotechnisches System Dient
Information und Produktion Rolland Brunec Seminar Wissen Einführung Informationssystem Einfluss des Internets auf Organisation Wissens-Ko-Produktion Informationssystem (IS) Soziotechnisches System Dient
Vorlesung 1. (April 11, 2008)
 Vorlesung 1. (April 11, 2008) Einführung: Visualisierung 1) eine Verbindung zwischen einem abstrakten (mathematischen) Objekt und einem Gegenstand der realen Welt 2) wesentliche Vorstufe der Interpretation
Vorlesung 1. (April 11, 2008) Einführung: Visualisierung 1) eine Verbindung zwischen einem abstrakten (mathematischen) Objekt und einem Gegenstand der realen Welt 2) wesentliche Vorstufe der Interpretation
Objekterkennung durch Vergleich von Farben. Videoanalyse Dr. Stephan Kopf HWS2007 Kapitel 5: Objekterkennung
 Objekterkennung durch Vergleich von Farben 48 Farbräume (I) Definitionen: Farbe: Sinnesempfindung (keine physikalische Eigenschaft), falls Licht einer bestimmten Wellenlänge auf die Netzhaut des Auges
Objekterkennung durch Vergleich von Farben 48 Farbräume (I) Definitionen: Farbe: Sinnesempfindung (keine physikalische Eigenschaft), falls Licht einer bestimmten Wellenlänge auf die Netzhaut des Auges
Hans Peter Willberg Friedrich Forssman Lesetypografie
 Hans Peter Willberg Friedrich Forssman Lesetypografie о» Verlag Hermann Schmidt Mainz 2010 4 Vorwort/Inhaltsverzeichnis Vorwort/Inhaltsverzeichnis Vorwort Als Hans Peter Willberg Buchgestaltung und studierte,
Hans Peter Willberg Friedrich Forssman Lesetypografie о» Verlag Hermann Schmidt Mainz 2010 4 Vorwort/Inhaltsverzeichnis Vorwort/Inhaltsverzeichnis Vorwort Als Hans Peter Willberg Buchgestaltung und studierte,
Die visuelle Wahrnehmung
 Die visuelle Wahrnehmung http://www.michaelbach.de/ot/index.html 18.01.2018 Franz Billmayer. Einführung in die Fachdidaktik Bildnerische Erziehung Winter 2017/2018 Farnsworth-Munsell 100 Hue Test gibt
Die visuelle Wahrnehmung http://www.michaelbach.de/ot/index.html 18.01.2018 Franz Billmayer. Einführung in die Fachdidaktik Bildnerische Erziehung Winter 2017/2018 Farnsworth-Munsell 100 Hue Test gibt
Interesse steuert die Wahrnehmung. Kommunikation gibt Informationen weiter.
 EINFÜHRUNG Interesse steuert die Wahrnehmung. Kommunikation gibt Informationen weiter. Die Gestaltung einzelner Inhalte und Aussagen muss so angepasst werden, um dem Gegenüber den Eindruck des Neuen und
EINFÜHRUNG Interesse steuert die Wahrnehmung. Kommunikation gibt Informationen weiter. Die Gestaltung einzelner Inhalte und Aussagen muss so angepasst werden, um dem Gegenüber den Eindruck des Neuen und
Die visuelle Wahrnehmung
 Die visuelle Wahrnehmung http://www.michaelbach.de/ot/index.html Die visuelle Wahrnehmung In BE geht es daneben auch um haptische, auditive und Bewegungswahrnehmung. Tradition aus dem Zeichenunterricht
Die visuelle Wahrnehmung http://www.michaelbach.de/ot/index.html Die visuelle Wahrnehmung In BE geht es daneben auch um haptische, auditive und Bewegungswahrnehmung. Tradition aus dem Zeichenunterricht
Semiotik Logoanalyse
 Semiotik Logoanalyse Die Xerox Corporation ist ein 1906 gegründetes Technologieund Dienstleistungsunternehmen im Dokumenten-Management- Bereich. Damals firmierte das Unternehmen als Haloid Company. Das
Semiotik Logoanalyse Die Xerox Corporation ist ein 1906 gegründetes Technologieund Dienstleistungsunternehmen im Dokumenten-Management- Bereich. Damals firmierte das Unternehmen als Haloid Company. Das
INHALT. (Alain Patrick Olivier / Annemarie Gethmann-Siefert)... XIII. Ästhetik
 EINLEITUNG: HEGELS VORLESUNGEN ZUR ÄSTHETIK ODER PHILOSOPHIE DER KUNST (Alain Patrick Olivier / Annemarie Gethmann-Siefert)... XIII ÄSTHETIK EINLEITUNG... 1 I. Umfang der Ästhetik. a, Verhältnis dieses
EINLEITUNG: HEGELS VORLESUNGEN ZUR ÄSTHETIK ODER PHILOSOPHIE DER KUNST (Alain Patrick Olivier / Annemarie Gethmann-Siefert)... XIII ÄSTHETIK EINLEITUNG... 1 I. Umfang der Ästhetik. a, Verhältnis dieses
#03 Kamera Praxis II. Technische & theoretische Grundlagen. >> Wahrnehmungstheorie >> Bildgestaltung >> Praktische Fertigkeiten
 #03 Kamera Praxis II Technische & theoretische Grundlagen >> Wahrnehmungstheorie >> Bildgestaltung >> Praktische Fertigkeiten Berlin, 4. Mai 2015 Wahrnehmungstheorie Kulturelle Prägung & Erfahrung Bedingt
#03 Kamera Praxis II Technische & theoretische Grundlagen >> Wahrnehmungstheorie >> Bildgestaltung >> Praktische Fertigkeiten Berlin, 4. Mai 2015 Wahrnehmungstheorie Kulturelle Prägung & Erfahrung Bedingt
Grundlagen des Kunstunterrichts
 Klaus Eid / Michael Langer / Hakon Ruprecht Grundlagen des Kunstunterrichts Eine Einführung in die kunstdidaktische Theorie und Praxis 5., überarbeitete und erweiterte Auflage 2000 Ferdinand Schöningh
Klaus Eid / Michael Langer / Hakon Ruprecht Grundlagen des Kunstunterrichts Eine Einführung in die kunstdidaktische Theorie und Praxis 5., überarbeitete und erweiterte Auflage 2000 Ferdinand Schöningh
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Grafisches Gestalten, Druck und Bleistifttechnik
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Grafisches Gestalten, Druck und Bleistifttechnik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de BESONDERHEITEN DES GRAFISCHEN
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Grafisches Gestalten, Druck und Bleistifttechnik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de BESONDERHEITEN DES GRAFISCHEN
Nervensystem Gliederung des Nervensystems der Wirbeltiere
 Nervensystem Gliederung des Nervensystems der Wirbeltiere Aufgaben Welche Aufgaben erfüllt das Nervensystem? - Welche Vorgänge laufen bei einer Reaktion ab? - Was ist das Ziel der Regulation? - Was ist
Nervensystem Gliederung des Nervensystems der Wirbeltiere Aufgaben Welche Aufgaben erfüllt das Nervensystem? - Welche Vorgänge laufen bei einer Reaktion ab? - Was ist das Ziel der Regulation? - Was ist
Ergonomisches UI Design. Das lass mal den Grafiker machen
 Ergonomisches UI Design Das lass mal den Grafiker machen Werbung Alexander Klein Senior Consultant bei BeOne Stuttgart GmbH Consulting für Prozesse, Engineering und IT http://www.beone-group.com Committer
Ergonomisches UI Design Das lass mal den Grafiker machen Werbung Alexander Klein Senior Consultant bei BeOne Stuttgart GmbH Consulting für Prozesse, Engineering und IT http://www.beone-group.com Committer
Gestaltpsychologie. Prof. Dr. Adrian Schwaninger 3. Prof. Dr. Adrian Schwaninger 4
 Grundlagen der Allgemeinen Psychologie: Wahrnehmungspsychologie Herbstsemester 2011 07.11.2011 (aktualisiert) Prof. Dr. Adrian Schwaninger Überblick Wahrnehmung: Sinnesorgane Prozesse und Grundprinzipien
Grundlagen der Allgemeinen Psychologie: Wahrnehmungspsychologie Herbstsemester 2011 07.11.2011 (aktualisiert) Prof. Dr. Adrian Schwaninger Überblick Wahrnehmung: Sinnesorgane Prozesse und Grundprinzipien
Arena Medien. Fotoguide
 Arena Medien Fotoguide 1 Inhaltsverzeichnis 1. Blende und Zeit... Seite 3 2. Format..Seite 5 3. Ausschnitt Seite 6 4. Kameraperspektive..Seite 7 5. Tiefenschärfe...Seite 9 6. Beleuchtung...Seite 11 2 Blende
Arena Medien Fotoguide 1 Inhaltsverzeichnis 1. Blende und Zeit... Seite 3 2. Format..Seite 5 3. Ausschnitt Seite 6 4. Kameraperspektive..Seite 7 5. Tiefenschärfe...Seite 9 6. Beleuchtung...Seite 11 2 Blende
Optische Halluzinationen - WAZ-Nachtforum -
 Optische Halluzinationen - - Optische Halluzinationen - - Dr. med. Matthias Elling, FEBO Leitender Oberarzt Universitäts-Augenklinik Donnerstag, 23. November 2017 Seite 2 Optische Halluzinationen Wahrnehmung
Optische Halluzinationen - - Optische Halluzinationen - - Dr. med. Matthias Elling, FEBO Leitender Oberarzt Universitäts-Augenklinik Donnerstag, 23. November 2017 Seite 2 Optische Halluzinationen Wahrnehmung
Grundkurs Grafik und Gestaltung
 Claudia Runk Grundkurs Grafik und Gestaltung Galileo Press Inhalt Vo rwo rt 15 1 Grundlagen der Gestaltung 1.1 Welche Druckerzeugnisse gibt es? 18 Variablen bei der Gestaltung 19 Erste Frage: Um welche
Claudia Runk Grundkurs Grafik und Gestaltung Galileo Press Inhalt Vo rwo rt 15 1 Grundlagen der Gestaltung 1.1 Welche Druckerzeugnisse gibt es? 18 Variablen bei der Gestaltung 19 Erste Frage: Um welche
Lernförderliche Faktoren und Rahmenbedingungen
 CHECKLISTE 1 Lernförderliche Faktoren und Rahmenbedingungen In der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung sollten folgende Aspekte reflektiert werden: die Veranstaltung bezüglich Didaktik und
CHECKLISTE 1 Lernförderliche Faktoren und Rahmenbedingungen In der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung sollten folgende Aspekte reflektiert werden: die Veranstaltung bezüglich Didaktik und
Die visuelle Wahrnehmung
 Die visuelle Wahrnehmung http://www.michaelbach.de/ot/index.html Mündliche Prüfungen Listen hängen aus Die visuelle Wahrnehmung In BE geht es daneben auch um haptische, auditive und Bewegungswahrnehmung.
Die visuelle Wahrnehmung http://www.michaelbach.de/ot/index.html Mündliche Prüfungen Listen hängen aus Die visuelle Wahrnehmung In BE geht es daneben auch um haptische, auditive und Bewegungswahrnehmung.
Vorlesung Prof. Dr. Adrian Schwaninger 165
 Vorlesung 7 2015 Prof. Dr. Adrian Schwaninger 165 Überblick Einleitung Psychophysik Wahrnehmung: Sinnesorgane Prozesse und Grundprinzipien Sehen Hören Propriozeption Tastsinn Geschmackssinn Geruchssinn
Vorlesung 7 2015 Prof. Dr. Adrian Schwaninger 165 Überblick Einleitung Psychophysik Wahrnehmung: Sinnesorgane Prozesse und Grundprinzipien Sehen Hören Propriozeption Tastsinn Geschmackssinn Geruchssinn
LMU München LFE Medieninformatik Mensch-Maschine Interaktion (Prof. Dr. Florian Alt) SS2016. Mensch-Maschine-Interaktion
 1 Mensch-Maschine-Interaktion Kapitel 2 - Wahrnehmung Sehsinn und visuelle Wahrnehmung Physiologie der visuellen Wahrnehmung Farbwahrnehmung Attentive und präattentive Wahrnehmung Gestaltgesetze Hörsinn
1 Mensch-Maschine-Interaktion Kapitel 2 - Wahrnehmung Sehsinn und visuelle Wahrnehmung Physiologie der visuellen Wahrnehmung Farbwahrnehmung Attentive und präattentive Wahrnehmung Gestaltgesetze Hörsinn
Licht und Farben. Andreas Spillner. Computergrafik, WS 2018/2019
 Licht und Farben Andreas Spillner Computergrafik, WS 2018/2019 Farbwahrnehmung des Menschen im Auge Das Verständnis, wie Farbeindrücke entstehen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Computergrafik. Der
Licht und Farben Andreas Spillner Computergrafik, WS 2018/2019 Farbwahrnehmung des Menschen im Auge Das Verständnis, wie Farbeindrücke entstehen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Computergrafik. Der
Farbtechnik und Raumgestaltung/EDV
 Abb. 1 Das RGB-Farbmodell Über die additive Farbmischung werden durch die 3 Grundfarben Rot, Grün und Blau alle Farben erzeugt. Im RGB Modell werden ihre Werte je von 0 bis 1 festgelegt. R = G = B = 1
Abb. 1 Das RGB-Farbmodell Über die additive Farbmischung werden durch die 3 Grundfarben Rot, Grün und Blau alle Farben erzeugt. Im RGB Modell werden ihre Werte je von 0 bis 1 festgelegt. R = G = B = 1
3. Zeichen und Schrift
 3. Zeichen und Schrift 3.1 Medien Zeichen, Text, Schrift 3.2 Mikro-Typografie: Zeichensätze 3.3 Makro-Typografie: Gestalten mit Schrift 3.4 Hypertext und HTML Link zu 3.1 3.3: http://papress.com/thinkingwithtype/
3. Zeichen und Schrift 3.1 Medien Zeichen, Text, Schrift 3.2 Mikro-Typografie: Zeichensätze 3.3 Makro-Typografie: Gestalten mit Schrift 3.4 Hypertext und HTML Link zu 3.1 3.3: http://papress.com/thinkingwithtype/
Versuche an verschiedenen Beispielen zu erklären, worauf die jeweilige optische Täuschung beruht.
 Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 6 Von den Leistungen der Sinnesorgane (P8013800) 6.5 Optische Täuschungen Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.10.2013 16:02:48 intertess (Version 13.06
Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 6 Von den Leistungen der Sinnesorgane (P8013800) 6.5 Optische Täuschungen Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.10.2013 16:02:48 intertess (Version 13.06
Das visuelle System. Das Sehen von Kanten: Das Sehen von Kanten ist eine trivial klingende, aber äußerst wichtige Funktion des visuellen Systems!
 Das Sehen von Kanten: Das Sehen von Kanten ist eine trivial klingende, aber äußerst wichtige Funktion des visuellen Systems! Kanten definieren die Ausdehnung und die Position von Objekten! Eine visuelle
Das Sehen von Kanten: Das Sehen von Kanten ist eine trivial klingende, aber äußerst wichtige Funktion des visuellen Systems! Kanten definieren die Ausdehnung und die Position von Objekten! Eine visuelle
Grundschraffur Metalle feste Stoffe Gase. Kunststoffe Naturstoffe Flüssigkeiten
 Anleitung für Schraffuren beim Zeichnen Die Bezeichnung Schraffur leitet sich von dem italienischen Verb sgraffiare ab, was übersetzt etwa soviel bedeutet wie kratzen und eine Vielzahl feiner, paralleler
Anleitung für Schraffuren beim Zeichnen Die Bezeichnung Schraffur leitet sich von dem italienischen Verb sgraffiare ab, was übersetzt etwa soviel bedeutet wie kratzen und eine Vielzahl feiner, paralleler
3. Zeichen und Schrift
 3. Zeichen und Schrift 3.1 Medien Zeichen, Text, Schrift 3.2 Mikro-Typografie: Zeichensätze 3.3 Makro-Typografie: Gestalten mit Schrift 3.4 Hypertext und HTML Link zu 3.1 3.3: http://papress.com/thinkingwithtype/
3. Zeichen und Schrift 3.1 Medien Zeichen, Text, Schrift 3.2 Mikro-Typografie: Zeichensätze 3.3 Makro-Typografie: Gestalten mit Schrift 3.4 Hypertext und HTML Link zu 3.1 3.3: http://papress.com/thinkingwithtype/
7.7 Auflösungsvermögen optischer Geräte und des Auges
 7.7 Auflösungsvermögen optischer Geräte und des Auges Beim morgendlichen Zeitung lesen kann ein gesundes menschliche Auge die Buchstaben des Textes einer Zeitung in 50cm Entfernung klar und deutlich wahrnehmen
7.7 Auflösungsvermögen optischer Geräte und des Auges Beim morgendlichen Zeitung lesen kann ein gesundes menschliche Auge die Buchstaben des Textes einer Zeitung in 50cm Entfernung klar und deutlich wahrnehmen
Analogie als Kern der Kognition
 17. Januar 2008 Betreuerin: Prof. Dr. Ute Schmid Professur für Angewandte Informatik / Kognitive Systeme Otto-Friedrich-Universität Bamberg Analogie von griechischen: ana(anˆ) auseinander, zusammen, wieder,
17. Januar 2008 Betreuerin: Prof. Dr. Ute Schmid Professur für Angewandte Informatik / Kognitive Systeme Otto-Friedrich-Universität Bamberg Analogie von griechischen: ana(anˆ) auseinander, zusammen, wieder,
Farbe in der Computergraphik
 Farbe in der Computergraphik 1 Hernieder ist der Sonnen Schein, die braune Nacht fällt stark herein. 2 Gliederung 1. Definition 2. Farbwahrnehmung 3. Farbtheorie 4. Zusammenfassung 5. Quellen 3 1. Definition
Farbe in der Computergraphik 1 Hernieder ist der Sonnen Schein, die braune Nacht fällt stark herein. 2 Gliederung 1. Definition 2. Farbwahrnehmung 3. Farbtheorie 4. Zusammenfassung 5. Quellen 3 1. Definition
Versuch einer Annäherung an den Begriff der Monade und an die Beziehung zwischen Seele und Körper in der Monadologie von Leibniz
 Versuch einer Annäherung an den Begriff der Monade und an die Beziehung zwischen Seele und Körper in der Monadologie von Leibniz Der Lernende versucht im ersten Teil zu verstehen, wie Leibniz die Monade
Versuch einer Annäherung an den Begriff der Monade und an die Beziehung zwischen Seele und Körper in der Monadologie von Leibniz Der Lernende versucht im ersten Teil zu verstehen, wie Leibniz die Monade
Souverän und einzigartig. Logo
 1 Souverän und einzigartig Logo 5 Das Quadrat 100% Cyan. Keine 3D-Effekte. Die Bildmarke Weiß auf 100 % Cyan. Die Wortmarke Reduziert auf das Wesentliche: Wir sind die Techniker. Konstruktion 6 TK-Logo
1 Souverän und einzigartig Logo 5 Das Quadrat 100% Cyan. Keine 3D-Effekte. Die Bildmarke Weiß auf 100 % Cyan. Die Wortmarke Reduziert auf das Wesentliche: Wir sind die Techniker. Konstruktion 6 TK-Logo
Ernst Mach: Über die Wirkung der räumlichen Verteilung des Lichtreizes auf die Netzhaut
 Seminar: Visuelle Wahrnehmung Datum: 8. November 2001 Referentin: Iris Skorka Dozent: Prof. Dr. Gegenfurtner Ernst Mach: Über die Wirkung der räumlichen Verteilung des Lichtreizes auf die Netzhaut 1. Überblick:
Seminar: Visuelle Wahrnehmung Datum: 8. November 2001 Referentin: Iris Skorka Dozent: Prof. Dr. Gegenfurtner Ernst Mach: Über die Wirkung der räumlichen Verteilung des Lichtreizes auf die Netzhaut 1. Überblick:
Eine Untersuchung zu Verstand und Vernunft
 Joachim Stiller Eine Untersuchung zu Verstand und Vernunft Eine Untersuchung Alle Rechte vorbehalten Eine Untersuchung zu Verstand und Vernunft Was ist der Unterschied zwischen Verstand und Vernunft? Zunächst
Joachim Stiller Eine Untersuchung zu Verstand und Vernunft Eine Untersuchung Alle Rechte vorbehalten Eine Untersuchung zu Verstand und Vernunft Was ist der Unterschied zwischen Verstand und Vernunft? Zunächst
3. Zeichen und Schrift
 3. Zeichen und Schrift 3.1 Medien Zeichen, Text, Schrift 3.2 Mikro-Typografie: Zeichensätze 3.3 Makro-Typografie: Gestalten mit Schrift 3.4 Hypertext und HTML Link zu 3.1 3.3: http://papress.com/thinkingwithtype/
3. Zeichen und Schrift 3.1 Medien Zeichen, Text, Schrift 3.2 Mikro-Typografie: Zeichensätze 3.3 Makro-Typografie: Gestalten mit Schrift 3.4 Hypertext und HTML Link zu 3.1 3.3: http://papress.com/thinkingwithtype/
Wahrnehmung ist ein komplexer, konstant stattfindender Prozess. Informationen mit unterschiedlichen Qualitäten werden permanent über die Sinnesorgane
 Wahrnehmung ist ein komplexer, konstant stattfindender Prozess. Informationen mit unterschiedlichen Qualitäten werden permanent über die Sinnesorgane aufgenommen, neuronal verarbeitet und bei bestimmten
Wahrnehmung ist ein komplexer, konstant stattfindender Prozess. Informationen mit unterschiedlichen Qualitäten werden permanent über die Sinnesorgane aufgenommen, neuronal verarbeitet und bei bestimmten
Daniel Leidenfrost. Hotel. Projektraum Viktor Bucher 2012
 Daniel Leidenfrost Hotel Projektraum Viktor Bucher DANIEL LEIDENFROST HOTEL Niedere Kunst erzählt einfache Dinge, wie zum Beispiel:,dies ist die Nacht. Hohe Kunst gibt das Gefühl der Nacht. Diese Form
Daniel Leidenfrost Hotel Projektraum Viktor Bucher DANIEL LEIDENFROST HOTEL Niedere Kunst erzählt einfache Dinge, wie zum Beispiel:,dies ist die Nacht. Hohe Kunst gibt das Gefühl der Nacht. Diese Form
Descartes, Dritte Meditation
 Descartes, Dritte Meditation 1. Gewissheiten: Ich bin ein denkendes Wesen; ich habe gewisse Bewusstseinsinhalte (Empfindungen, Einbildungen); diesen Bewusstseinsinhalten muss nichts außerhalb meines Geistes
Descartes, Dritte Meditation 1. Gewissheiten: Ich bin ein denkendes Wesen; ich habe gewisse Bewusstseinsinhalte (Empfindungen, Einbildungen); diesen Bewusstseinsinhalten muss nichts außerhalb meines Geistes
Visuelle Wahrnehmung. DI (FH) Dr. Alexander Berzler
 Visuelle Wahrnehmung DI (FH) Dr. Alexander Berzler Grundlagen der visuellen Wahrnehmung Wie funktioniert der Prozess des Sehens? Das Licht tritt zunächst durch die Cornea (Hornhaut) ein, durchquert das
Visuelle Wahrnehmung DI (FH) Dr. Alexander Berzler Grundlagen der visuellen Wahrnehmung Wie funktioniert der Prozess des Sehens? Das Licht tritt zunächst durch die Cornea (Hornhaut) ein, durchquert das
