Viola Küller (Autor) Versetzungsreduzierte AIN- und AIGaNSchichten als Basis für UV LEDs
|
|
|
- Irmgard Eberhardt
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Viola Küller (Autor) Versetzungsreduzierte AIN- und AIGaNSchichten als Basis für UV LEDs Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg 8, Göttingen, Germany Telefon: +49 (0) , Website:
2 1 Einführung Die in dieser Arbeit entwickelten Epitaxieschichten dienen in erster Linie als Basisschichten für die Herstellung von Leuchtdioden, die ultraviolettes Licht emittieren (UV LEDs). Ultraviolettes Licht kann in den verschiedensten Anwendungsgebieten eingesetzt werden. Die jeweilige Anwendung ist abhängig vom Spektralbereich der UV Strahlung. Der UV Spektralbereich liegt energetisch oberhalb des sichtbaren Lichts und wird unterteilt in UV-A ( nm), UV-B ( nm), UV-C ( nm) und Vakuum-UV ( nm). UV-A Licht wird beispielsweise zur Härtung von Lacken und Farben oder wegen der Anregung uoreszierender Stoffe für die Authenti zierung von Dokumenten verwendet. Auch im medizinischen Bereich gibt es Anwendungsgebiete: Mittels UV-B Strahlung kann Schuppen echte erfolgreich behandelt werden. Die keimtötende Wirkung von UV-C Strahlung (um 265 nm) lässt die Anwendung für Desinfektionssysteme, beispielsweise für die Wasserdesinfektion, zu. Desweiteren kann UV-C Licht in der Sensorik Anwendung nden. Viele der Anwendungen werden bis heute noch mit Quecksilberdampflampen als UV-Lichtquelle realisiert. Das enthaltene Quecksilber ist hochgiftig und die Lebensdauer dieser Lampen ist begrenzt. Die Entwicklung ef zienter halbleiterbasierter UV Leuchtdioden bietet eine interessante Alternative zu quecksilberhaltigen Lichtquellen und kann zu kleineren, robusteren und umweltfreundlicheren Geräten führen. Der Durchbruch in der Herstellung blauer LEDs und Laserdioden durch S. Nakamura führte zu einer rasanten Entwicklung von sichtbaren Lichtemittern [1]. Auch die Entwicklung von LEDs im Bereich des ultravioletten Lichts machte fortan rasante Fortschritte. So sind heutzutage UV-A LEDs etablierte Massenprodukte und mit optischen Ausgangsleistungen von 500 mw bei 700 ma mit Ef zienzen über 20 % kommerziell erhältlich. Auch LEDs im UV-B und UV-C Spektralbereich sind bereits verfügbar, allerdings zu einem sehr hohen Preis, mit geringen Lebensdauern und nicht als Massenprodukt. Die Ef zienzen liegen hier im einstelligen Prozentbereich, für tiefes UV sogar unterhalb 1 %. Die Leistungen, insbesondere der UV-B und UV-C LEDs, sind für die Anforderungen der meisten Anwendungen noch zu gering. Die für UV LEDs einsetzbaren direkten Halbleitermaterialien sind die Gruppe III-Nitride. Sie decken einen großen Spektralbereich ausgehend vom tiefen UV, über das gesamte Spektrum des sichtbaren Lichts bis hin zum infraroten Spektralbereich ab. Im Einzelnen entspricht das einer Emissionswellenlänge von 210 nm (AlN) über 365 nm (GaN) bis 1770 nm (InN). Für eine homoepitaktische Abscheidung von AlN und AlGaN sind bis heute Substrate nur in kleinen Mengen und Durchmessern erhältlich. In den Untersuchungen dieser Arbeit dient c-planarer Saphir als Substrat. Dieses ist ein für die LED Produktion in großen Mengen und Durchmessern verfügbares kommerziell erhältliches und preisgünstiges Material. Allerdings ergeben sich durch den Einsatz von Fremdsubstraten erhebliche Herausforderungen, beispielsweise durch die Entstehung von Verspannungen und einer hohen Versetzungsdichte im Ma- 1
3 2 Inhaltsverzeichnisnis terial. Die daraus folgenden Schwierigkeiten in der Materialabscheidung und -optimierung werden in dieser Arbeit beschrieben und diskutiert. Um die Ef zienz der UV LEDs zu erhöhen gibt es verschiedene Optimierungsmöglichkeiten. Beispielsweise kann mit einem geeigneten Design der aktiven Zone die Ladungsträgerinjektion in die aktive Zone gesteigert und Leckströme reduziert werden. Auch durch eine Optimierung der Dotierung, insbesondere eine Optimierung der p-leitfähigkeit, können die Bauelementeigenschaften positiv beein usst werden. Eine weitere Möglichkeit zur Steigerung der Ef- zienz ist die Erhöhung der Lichtextraktion aus dem Bauelement durch eine Strukturierung beziehungsweise eine bewusste Aufrauung der lichtextrahierenden Ober äche. Auch durch Optimierungen im Bereich der Prozessierung, beispielsweise die Wahl der Kontaktmaterialien, -formierungstemperaturen und -geometrie sind Ef zienzsteigerungen realisierbar. Der in dieser Arbeit verfolgte Ansatz ist die Leistungssteigerung durch eine Erhöhung der Kristallqualität und somit die Reduktion der Versetzungsdichte. Versetzungsreduzierte AlN- und AlGaN-Schichten sollen als Basisschichten für ef ziente UV LED Heterostrukturen entwickelt und eingesetzt werden. Die Auswirkungen der Versetzungreduktion auf die darauf abgeschiedenen Schichten werden gezeigt und diskutiert. Die versetzungsreduzierten Schichten bieten zudem auch Einsatzmöglichkeit als Basis für UV Laser zur Reduktion der Laserschwelle oder für solarblinde Photodetektoren zur Erhöhung der Lebensdauer und Emp ndlichkeit. In Kapitel 4 wird zunächst das Wachstum von AlN-Schichten auf Saphir untersucht. Die dabei entstehenden Schwierigkeiten werden beschrieben und Lösungsansätze vorgestellt. Es werden Substratvorbehandlungen optimiert und dadurch die Schraubenversetzungsdichte reduziert sowie die Entstehung von Inversionsdomänen unterdrückt. Eine weitere Reduktion der Versetzungsdichte wird in Kapitel 5 mit der Methode des epitaktischen lateralen Überwachsens mit AlN erreicht. Kapitel 6 gibt eine kurze Übersicht über das laterale Überwachsen mit ternärem AlGaN, allerdings wird dieser Ansatz aufgrund von Kompositionsinhomogenitäten und der Bildung von tafelbergförmigen Morphologiestörungen an den Koaleszenzfronten nicht weiterverfolgt. In Kapitel 7 wird die Abscheidung von AlGaN auf den versetzungsreduzierten AlN-Schichten aus Kapitel 5 diskutiert. Die charakteristischen strukturellen und optischen Eigenschaften dieser Schichten werden analysiert und diskutiert. Im letzten Kapitel werden die Auswirkungen der Versetzungs- und Verspannungsreduktion auf dotierte Schichten, Quanten lme und LED-Heterostrukturen ermittelt und die Eignung der entwickelten Basisschichten für UV LEDs wird nachgewiesen.
4 2 Grundlagen In diesem Kapitel soll zunächst eine kurze Übersicht über das verwendetete Materialsystem der Gruppe-III-Nitride und dessen besondere Eigenschaften gegeben werden. Insbesondere durch das heteroepitaktische Wachstum auf einem Fremdsubstrat entstehen spezielle Herausforderungen, die im Folgenden vorgestellt werden. 2.1 Materialsystem Gruppe III-Nitride könnenprinzipiell inderwurtzit-struktur, derzinkblende-struktur undder Steinsalz-Struktur kristallisieren. Unter Standardbedingungen ist nur die hexagonale Wurtzit- Struktur stabil. In dieser kann jedoch die Zinkblende-Struktur in Form von Stapelfehlern enthalten sein [2]. Die Wurtzit-Struktur besteht aus tetraedrisch angeordneten Atomen, die mittels kovalent-ionischer Bindungen miteinander verbunden sind. Abbildung 2.1 zeigt die Wurtzitstruktur in zwei verschiedenen Anordnungen. Die Richtung der positiven c-achse wird so de- niert, dass die vertikale Al-N-Bindung vom Al- zum N-Atom verläuft. Entlang der c-achse ist die Wurtzit-Struktur nicht inversionssymmetrisch [3]. Ist die Ober ächennormale die kristallogra sche c-richtung [0001], so ist der Kristall Al-polar. N-Polarität besteht, wenn die Ober ächennormale die -c-richtung [0001] ist. Inversionsdomänen werden Gebiete genannt, deren Polarität sich von der des umgebenen Materials unterscheidet. (a) Al-Polarität (b) N-Polarität Abbildung 2.1: Schematische Abbildung der Atomanordnung in der Wurtzitstruktur von AlN mit Alund N-Polarität. Für die Bezeichnung von Kristallebenen und -richtungen werden im Folgenden für das hexagonale Kristallsystem Bravaissche Indizes verwendet, die eine Schreibweise mit vier In- 3
5 4 2.1 Materialsystemem dizes erlauben. Analog zu Ref. [4] werden die Indizes für Kristall ächen h, k, i und l mit der Beziehung i = -(h+k) und für Richtungen û, ˆv, ˆt und ŵ mit der Beziehung ˆt=-(û+ˆv) verwendet. Flächen, also Netzebenen, werden in runden Klammern geschrieben (hkil) und Richtungen in eckigen Klammern [ûˆvˆtŵ]. Äquivalente Richtungen werden in spitzen Klammern < ûˆvˆtŵ > und äquvalente Ebenen in geschweiften Klammern {hkil} notiert. Die Notation eines negativen Indexes erfolgt mit einem Überstrich. In dieser Arbeit sollen Basisschichten für UV LEDs entwickelt werden, wofür insbesondere das System Al x Ga 1 x N optimiert wird. Dieses wird idealerweise auf Al x Ga 1 x N-Volumenkristallen abgeschieden. Für solch ein homoepitaktisches Wachstum stehen die dafür benötigten Substrate nur unzureichend zur Verfügung. Aufgrund des hohen Schmelzpunktes und des benötigten hohen Drucks können AlN und GaN nicht mit bekannten Methoden wie beispielsweise dem Czochralski Verfahren hergestellt werden [5], es müssen alternative Verfahren angewendet werden. Beispielsweise hat sich besonders für GaN das ammonothermale Verfahren [6,7] etabliert. Auch die Herstellung von dicken GaN-Schichten mittels Hydridgasphasenepitaxie (HVPE) auf Fremdsubstraten ermöglicht durch die erreichbaren hohen Wachstumsraten die Realisierung von Pseudo-Volumenkristallsubstraten zur weiteren Nitridepitaxie für optoelektronische Bauelemente [8]. Vorallem für AlN wurden Erfolge in der Herstellung von Einkristallen mittels des Sublimationsverfahrens erzielt [9 12]. Jedoch sind diese Substrate für eine industrielle UV LED Produktion bisher noch nicht einsetzbar, da sie nicht gleichzeitig mit großem Durchmesser, geringem Preis und in großen Mengen verfügbar sind. Somit werden in dieser Arbeit die Al x Ga 1 x N Basisschichten auf Fremdsubstraten abgeschieden. Hierfür werden preisgünstige 2 Saphirsubstrate (Al 2 O 3 ) verwendet, die in großen Stückzahlen kommerziell erhältlich sind. Die Basisschichten auf Saphir, die für ein anschließendes Wachstum verwendet werden können, werden im Folgenden auch Templates genannt. Mit der Heteroepitaxie ergeben sich besondere Eigenschaften und Herausforderungen, die durch die unterschiedlichen Materialeigenschaften hervorgerufen werden Kristallorientierung von Al x Ga 1 x N auf Saphir Die Kristallstruktur von Saphir ist rhomboedrisch [13] und gehört damit zum trigonalen Kristallsystem. Die geringste Gitterfehlanpassung zu den Nitriden mit Wurtzitstruktur ergibt sich, wenn diese um 30 verdreht auf dem Saphir nukleieren. Durch diese Verdrehung wird bespielsweise für AlN die Gitterfehlanpassung von % auf % reduziert [14]. Diese Verdrehung wurde bereits mehrfach in der Literatur beschrieben. Aufgrund der Rotationssymmetrie der Al x Ga 1 x N-Elementarzelle ist die De nition uneinheitlich, es wird von verschiedenen Verdrehungswinkeln, bespielsweise 30 [15 17] und 90 [18, 19] berichtet. In jeder der De nitionen liegt eine m-richtung des Saphirs parallel zu einer a-richtung des AlN. Um Richtung im Saphir Richtung im Al x Ga 1 x N [1210] [1010] [1010] [1210] Tabelle 2.1: Festlegung der Kristallrichtungsbeziehung zwischen Al x Ga 1 x N und Saphir.
6 2.1 Materialsystem 5 für diese Arbeit eine exakte Zuordnung und De nition der Kristallorientierungen zu erhalten, wird ein Verdrehungswinkel von 90 festgelegt. Die daraus folgende De nion der Kristallrichtungsbeziehungen ist in Tabelle 2.1 dargestellt. Abbildung 2.2 zeigt den (1012)-Re ex der Röntgenbeugungsmessung in der Drehung um die [0001]-Achse (Phi-Scan) von AlN und Saphir. Eine exakte Beschreibung des Messprinzips der Röntgenbeugung inklusive der verschiedenen Scanrichtungen ist in Ref. [20] zu nden. Das gemessene AlN/Saphir Template ist repräsentativ für die in dieser Arbeit beschriebenen AlN-Schichten auf Saphirsubstraten. Für AlN sind der hexagonalen Symmetrie entspechend sechs Re exe zu erkennnen. Diese liegen bei ca. 0, ±60, ±120. Die drei Re exe des trigonal symmetrischen Saphirs liegen bei -150, -30 und 90. Diese Re exanordnung bestätigt die Verdrehung um 30 ± n 60 (n=1,2,3,..) zwischen den Kristallstrukturen des Saphirsubstrats und der AlN-Schicht. Abbildung 2.2: Röntgenbeugungsmessung an einem AlN/Saphir Template bestehend aus dem Phi- Scan im (1012)-Re ex von AlN (schwarz) und Saphir (rot) Versetzungen Wegen der großen Gitterfehlanpassung zwischen AlN und Saphir führt die Heteroepitaxie von AlN zu hohen Versetzungsdichten [3]. Es wird zwischen zwei verschiedenen Arten von Versetzungen unterschieden: Basale Versetzungen und durchstoßende Versetzungen [15]. In dieser Arbeit werden nur durchstoßende Versetzungen (engl. threading dislocations ) behandelt, da diese die Ef zienz von LEDs negativ beein ussen können (Abschnitt 2.2).
7 6 2.1 Materialsystemem (a) Stufenversetzung (b) Schraubenversetzung Abbildung 2.3: Schematische Abbildung der Versetzungstypen mit den jeweiligen Burgersvektoren. Durchstoßende Versetzungen können als Stufen-, Schrauben,- und gemischte Versetzungen auftreten. Abbildung 2.3 zeigt eine schematische Abbildung einer Stufen- und einer Schraubenversetzung mit dem für die jeweilige Versetzung charakteristischen Burgersvektor b. Der Burgersvektor de niert den Versatz zwischen dem ungestörten und dem durch das Einbringen einer Versetzung gestörten Kristallgitter. Für reine Schraubenversetzungen liegt die Richtung des Burgersvektors parallel und für reine Stufenversetzungen senkrecht zur Versetzungslinienrichtung. Der Burgersvektor b s = <0001> de niert reine Schraubenversetzungen, der Burgersvektor b e =1/3<1120> de niert reine Stufenversetzungen und b g =1/3<1123> gemischte Versetzungen Verspannungen Im heteroepitaktischen System entstehen durch die Gitterfehlanpassung und unterschiedliche thermische Ausdehnungskoef zienten Verspannungen an der Grenz äche zwischen Substrat und Epitaxieschicht. Im Fall von sehr kleinen Gitterfehlanpassungen kann die aufwachsende Schicht sichandie Gitterkonstante des Substrats anpassen, sie wächst voll verspannt (pseudomorphes Wachstum). Nach Frank und van der Merwe [21] ist für pseudomorphes Wachstum bis zu einer bestimmten kritischen Schichtdicke die Verspannung homogen verteilt. Oberhalb dieser Dicke wird die Gitterfehlanpassung mit der Entstehung von Versetzungen ausgeglichen. Dieses Modell gilt für Fehlanpassungen von kleiner 7 % [22]. Matthews und Blakeslee beschreiben die Bildung von Versetzungen ab der kritischen Schichtdicke mit Hilfe eines Kräftegleichgewichts zwischen den Verspannungen von Gitterfehlanpassung und Versetzung bei der kritischen Schichtdicke [22]. Diese ist abhängig von den elastischen Materialkonstanten, der Gitterfehlanpassung und den Versetzungsparametern. Im Allgemeinen tritt eine tensile Verspannung auf, wenn die Gitterkonstante der aufwachsenden Schicht kleiner ist als die des Substrats. Ist die Gitterkonstante der Epitaxieschicht größer als die des Substrats, entsteht eine kompressive Verspannung in der Schicht. Beim Wachstum von AlN auf Saphir ist die Gitterfehlanpassung so hoch, dass die Epitaxieschicht zunächst sogenannte Nukleationskeime ausbildet, die im folgenden Wachstum zusammenwachsen (koaleszieren). Die tensile Verspannung während des AlN Wachstums kann mit dem Modell von Nix und Clemens [23] erklärt werden. Es wird hierfür angenommen, dass alle
8 2.2 UV LEDs 7 Nukleationskeime dieselbe Größe bei der Koaleszenz besitzen. Die während der Koaleszenz generierte Spannung ( ) 1 + ν (2γo γ k ) σ = E 1 ν d ist abhängig von den elastischen Materialkonstanten der Schicht, E und ν, den Ober ächenund Korngrenzenenergien γ o und γ k und der Nukleationskeimgröße d [23, 24]. Ist diese Spannung tensil, so wird sie ab einer bestimmten kritischen Schichtdicke durch die Bildung von Rissen in der Schicht abgebaut. Es gilt für die kritische Schichtdicke bezüglich der Rissbildung h r die Beziehung h r 1 σ 2. Die Berechnung der Schichtspannung in Abhängigkeit von der Änderung der Waferverkrümmung kann mit der Gleichung von Stoney [25] erfolgen: σ = E s d 2 s (k a k s ) 6 d a (1 ν s ) wobei E s das Young Modul und ν s das Poissonverhältnis vom Substratmaterial, d s die Saphirund d a die Epitaxieschichtdicke, k s die Verkrümmung vor und k a die Verkrümmung nach der Epitaxie ist. Die bisherige Beschreibungen bezogen sich auf die Verspannung während des Schichtwachstums. Desweiteren entstehen Verspannungen aufgrund der verschiedenen thermischen Ausdehnungkoef zienten von Saphir (α a = /K,α c = /K) und AlN (α a = /K,α c = /K) [26]. Dadurch kann beispielsweise der Wafer bei Wachstumstemperatur konkav verkrümmt (tensile Verspannung in der AlN Schicht) und nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur konvex verkrümmt (kompressive Verspannung in der AlN Schicht) sein. 2.2 UV LEDs Im Allgemeinen bestehen UV LEDs aus einer Basis- bzw. Pufferschicht, einer n-kontaktschicht, der aktiven Zone und einer p-kontaktschicht. Abbildung 2.4 zeigt schematisch den Aufbau einer LED. In der aktiven Zone be nden sich ein oder mehrere Quanten lme, d.h. einige Nanometer dünne Schichten, in denen Ladungsträger rekombinieren und Photonen generiert werden. Diese werden im Allgemeinen durch Barrieren, also dünnen Schichten aus einem Material mit größerer Bandlücke, voneinander getrennt, um die Ladungsträger in den Quanten lmen einzuschließen. Die n-leitfähigkeit der n-kontaktschicht wird üblicherweise durch das Einfügen von Gruppe IV Atome erreicht. Diese ersetzen ein Gruppe III Atom und wirkendort alselektronendonator. IndieserArbei werden für die n-dotierung Si-Fremdatome verwendet. Mit steigendem Al-Gehalt wird die Dotierung von AlGaN zunehmend schwieriger (Abschnitt 8.2.1). Die p-leitfähigkeit von Al x Ga 1 x N wird im Allgemeinen mittels Mg- Dotierung erreicht. Eine Untersuchung der p-dotierung ist jedoch nicht Bestandteil dieser Arbeit.
9 8 2.2 UV LEDs Abbildung 2.4: Schematische Abbildung des grundsätzlichen Aufbaus einer LED im Querschnitt (nicht maßstabsgetreu). In diesem Fall besteht die aktive Zone aus einer Dreifachquanten lmstruktur. Durch das Substrat emittierende LEDs benötigen für die jeweilige Emissionswellenlänge transparente Basis- und n-kontaktschichten. Diese Arbeit beschränkt sich auf die Optimierung der Basisschichten, die auf c-planaren Saphirsubstraten abgeschieden werden. Abbildung 2.5 zeigt die Transmission eines AlN/Saphir Templates. Ab ca. 210 nm ist das Template transparent. Die AlN-Schichten sind demnach für LEDs mit Emissionswellenlängen oberhalb von 210 nm einsetzbar. UV LED Heterostrukturen beziehungsweise Teilbereiche der Heterostruktur, wie beispielsweise die n-kontaktschicht oder Mehrfachquanten lme,werdenindieserarbeit auf verschiedenen Templates abgeschieden, um anhand der Heterostruktureigenschaften die Eignung der Templates für UV LEDs zu überprüfen. Abbildung 2.5: Normierte Transmission eines 580 nm dicken AlN/Saphir Templates in Abhängigkeit von der Wellenlänge. Die Messung erfolgte bei Raumtemperatur. Die deutlich erkennbaren Oszillationen entstehen durch Fabry-Perot-Interferenz an den Grenz ächen. Die LED-Ef zienz berechnet sich nach Ref. [27] folgendermaßen: Die Ef zienz der aktiven Zone ist de niert als Interne Quantenef zienz (IQE) und bezeichnet das Verhältnis zwischen der Anzahl der Photonen, die in der aktiven Zone pro Sekunde erzeugt werden und der Anzahl der in die aktive Zone pro Sekunde injizierten Elektronen: IQE = P int/(hν) I/e wobei P int die optische Leistung und I der Injektionsstrom ist. Aufgrund von Reabsorption und interner Totalre ektion können nicht alle generierten Photonen aus dem Halbleiter gelangen.
10 2.2 UV LEDs 9 Die Extraktionsef zienz ν extract beschreibt den Quotienten von Photonen in den freien Raum pro Sekunde und der Anzahl der generierten Photonen pro Sekunde mit η extract = P/(hν) P int /(hν) wobei P die Lichtleistung der LED im freien Raum ist. Die externe Quantenef zienz (EQE) ergibt sich aus η extract und der IQE EQE = IQE η extract und beschreibt den Anteil der von der LED pro Sekunde emittierten Photonen an der Anzahl pro Sekunde injizierter Elektronen. Die Ef zienz der LED ist dabei stark abhängig von der Versetzungsdichte des Templates. Die enthaltenen durchstoßenden Versetzungen können sich bis in die aktive Zone des Bauelements fortsetzen. Da an Versetzungen Ladungsträger nichtstrahlend rekombinieren können, wird durch die Existenz vieler Versetzungen die interne Quantenef zienz der Bauelemente stark reduziert. Abbildung 2.6 zeigt eine Simulation der internen Quantenef zienz einer bei 320 nm emittierenden UV LED in Abhängigkeit von der Versetzungsdichte des Materials 1. Abbildung 2.6: Simulation der IQE einer bei 320 nm emittierenden UV LED mit InAlGaN Mehrfachquanten lmen und einer Stromdichte von 100 A/cm 2 in Abhängigkeit von der Versetzungsdichte der aktiven Zone. Aus Ref. [28]. Für die Simulation wurde das Modell von Karpov et al. [29] angenommen. Bei einer Versetzungdichte von über cm 2 beträgt die IQE nur wenige Prozent. Mit sinkender Versetzungdichte steigt die Ef zienz erheblich an. Aufgrund der im Modell berücksichtigten Leckströme erreicht die IQE auch bei niedrigeren Versetzungsdichten (10 7 cm 2 ) keine 100 %. Aus der Simulation wird deutlich, dass eine Versetzungsreduktion, insbesondere im Bereich zwischen cm 2 und 10 8 cm 2 eine signi kante Steigerung der IQE bewirken kann. 1 Simulation von T. Kolbe, TU Berlin.
11 UV LEDs Im Allgemeinen liegen die Versetzungsdichten von heteroepitaktischen Al x Ga 1 x N-Schichten auf Saphirsubstraten über cm 2.Für die Realisierung ef zienter UV LEDs ist demnach eine Versetzungsreduktion um etwa zwei Größenordnungen erforderlich. Die Ef zienz ist aufgrund der verschiedenen verwendbaren Materialien zudem stark abhängig von der Emissionswellenlänge der LED. Werden für GaN-basierte LEDs im nahen UV noch EQE weit über 10 % erreicht [30], sinkt die Ef zienz unterhalb von 365 nm deutlich, da GaN das kurzwellige Licht absorbiert und nicht mehr als Basisschicht verwendet werden kann. So wird für AlN und AlGaN-basierte LEDs beispielsweise bei 330 nm eine EQE von 2.3 % erreicht [31], bei einer Emissionswellenlänge von 282 nm wird von einer EQE von 1.2 % berichtet [32]. Bei noch kürzeren Wellenlängen von 227 nm und 210 nm liegt die EQE bei 0.2 % [33, 34] und 10 4 % [35].
Sylvia Hagedorn (Autor) Hybrid-Gasphasenepitaxie zur Herstellung von Aluminiumgalliumnitrid
 Sylvia Hagedorn (Autor) Hybrid-Gasphasenepitaxie zur Herstellung von Aluminiumgalliumnitrid https://cuvillier.de/de/shop/publications/6966 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier,
Sylvia Hagedorn (Autor) Hybrid-Gasphasenepitaxie zur Herstellung von Aluminiumgalliumnitrid https://cuvillier.de/de/shop/publications/6966 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier,
Stephan Ulrich Schwaiger (Autor) Gasphasenepitaxie und Eigenschaften von nicht- und semipolaren GaN
 Stephan Ulrich Schwaiger (Autor) Gasphasenepitaxie und Eigenschaften von nicht- und semipolaren GaN https://cuvillier.de/de/shop/publications/354 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier,
Stephan Ulrich Schwaiger (Autor) Gasphasenepitaxie und Eigenschaften von nicht- und semipolaren GaN https://cuvillier.de/de/shop/publications/354 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier,
https://cuvillier.de/de/shop/publications/73
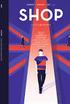 Stephan Meyer (Autor) Energieeffizienzsteigerung entlang der Supply Chain Entscheidungsmodell zur wertschöpfungskettenorientierten Emissionsminderung in Transformationsländern https://cuvillier.de/de/shop/publications/73
Stephan Meyer (Autor) Energieeffizienzsteigerung entlang der Supply Chain Entscheidungsmodell zur wertschöpfungskettenorientierten Emissionsminderung in Transformationsländern https://cuvillier.de/de/shop/publications/73
Praktikum Lasertechnik, Protokoll Versuch Halbleiter
 Praktikum Lasertechnik, Protokoll Versuch Halbleiter 16.06.2014 Ort: Laserlabor der Fachhochschule Aachen Campus Jülich Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Fragen zur Vorbereitung 2 3 Geräteliste 2 4 Messung
Praktikum Lasertechnik, Protokoll Versuch Halbleiter 16.06.2014 Ort: Laserlabor der Fachhochschule Aachen Campus Jülich Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Fragen zur Vorbereitung 2 3 Geräteliste 2 4 Messung
Fortgeschrittenenpraktikum: Ausarbeitung - Versuch 14 Optische Absorption Durchgeführt am 13. Juni 2002
 Fortgeschrittenenpraktikum: Ausarbeitung - Versuch 14 Optische Absorption Durchgeführt am 13. Juni 2002 30. Juli 2002 Gruppe 17 Christoph Moder 2234849 Michael Wack 2234088 Sebastian Mühlbauer 2218723
Fortgeschrittenenpraktikum: Ausarbeitung - Versuch 14 Optische Absorption Durchgeführt am 13. Juni 2002 30. Juli 2002 Gruppe 17 Christoph Moder 2234849 Michael Wack 2234088 Sebastian Mühlbauer 2218723
Tim Wernicke (Autor) Wachstum von nicht- und semipolaren InAIGaN- Heterostrukturen für hocheffiziente Lichtemitter
 Tim Wernicke (Autor) Wachstum von nicht- und semipolaren InAIGaN- Heterostrukturen für hocheffiziente Lichtemitter https://cuvillier.de/de/shop/publications/78 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette
Tim Wernicke (Autor) Wachstum von nicht- und semipolaren InAIGaN- Heterostrukturen für hocheffiziente Lichtemitter https://cuvillier.de/de/shop/publications/78 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette
Lichtemittierende Dioden (LED)
 @ Einführung in die optische Nachrichtentechnik LED/1 Lichtemittierende Dioden (LED) Lumineszenzdioden und Halbleiterlaser werden in der optischen Nachrichtentechnik überwiegend als Doppel-Heterostrukturdioden
@ Einführung in die optische Nachrichtentechnik LED/1 Lichtemittierende Dioden (LED) Lumineszenzdioden und Halbleiterlaser werden in der optischen Nachrichtentechnik überwiegend als Doppel-Heterostrukturdioden
Analyse struktureller Eigenschaften von GaN mittels hochauflösender Röntgenbeugung bei variabler Meßtemperatur. Claudia Roder
 Analyse struktureller Eigenschaften von GaN mittels hochauflösender Röntgenbeugung bei variabler Meßtemperatur Claudia Roder Universität Bremen 2007 Analyse struktureller Eigenschaften von GaN mittels
Analyse struktureller Eigenschaften von GaN mittels hochauflösender Röntgenbeugung bei variabler Meßtemperatur Claudia Roder Universität Bremen 2007 Analyse struktureller Eigenschaften von GaN mittels
Spektrale Eigenschaften von Halbleiterlasern (SPEK)
 C! C SPEK/ Spektrale Eigenschaften von Halbleiterlasern (SPEK) In diesem Kapitel werden die spektralen Eigenschaften von Halbleiterlasern behandelt. Die Spektren von index- und gewinngeführten Lasern (vergl.
C! C SPEK/ Spektrale Eigenschaften von Halbleiterlasern (SPEK) In diesem Kapitel werden die spektralen Eigenschaften von Halbleiterlasern behandelt. Die Spektren von index- und gewinngeführten Lasern (vergl.
2 Materialeigenschaften der III-V Nitride
 2 Materialeigenschaften der III-V Nitride 6 2 Materialeigenschaften der III-V Nitride 2.1 Kristallographische Eigenschaften Die Gruppe-III-Nitride GaN, InN, AlN und deren Verbindungen existieren in zwei
2 Materialeigenschaften der III-V Nitride 6 2 Materialeigenschaften der III-V Nitride 2.1 Kristallographische Eigenschaften Die Gruppe-III-Nitride GaN, InN, AlN und deren Verbindungen existieren in zwei
Ergänzung zur Berechnung der Zustandsdichte
 Ergänzung zur Berechnung der Zustandsdichte Dichte der Zustände im k-raum: 1 1 L g(k)= = = 3 V (2 π /L) π 2 k 3 Abb. III.5: Schema zur Berechnung der elektronischen Zustandsdichte Zustandsdichte Dichte
Ergänzung zur Berechnung der Zustandsdichte Dichte der Zustände im k-raum: 1 1 L g(k)= = = 3 V (2 π /L) π 2 k 3 Abb. III.5: Schema zur Berechnung der elektronischen Zustandsdichte Zustandsdichte Dichte
GaN-basierte LEDs: Physikalische Grundlagen und Bauelemente
 Ausgewählte Kapitel der Festkörperphysik GaN-basierte LEDs: Physikalische Grundlagen und Bauelemente Toni Sembdner Abstract: In dieser Ausarbeitung geht es um die grundlegende Funktionsweise von LEDs.
Ausgewählte Kapitel der Festkörperphysik GaN-basierte LEDs: Physikalische Grundlagen und Bauelemente Toni Sembdner Abstract: In dieser Ausarbeitung geht es um die grundlegende Funktionsweise von LEDs.
Atom-, Molekül- und Festkörperphysik
 Atom-, Molekül- und Festkörperphysik für LAK, SS 2013 Peter Puschnig basierend auf Unterlagen von Prof. Ulrich Hohenester 10. Vorlesung, 27. 6. 2013 Halbleiter, Halbleiter-Bauelemente Diode, Solarzelle,
Atom-, Molekül- und Festkörperphysik für LAK, SS 2013 Peter Puschnig basierend auf Unterlagen von Prof. Ulrich Hohenester 10. Vorlesung, 27. 6. 2013 Halbleiter, Halbleiter-Bauelemente Diode, Solarzelle,
Morphologie der epitaktischen CuGaSe 2 -Schichten
 Kapitel 4 Morphologie der epitaktischen CuGaSe 2 -Schichten Im Folgenden Kapitel wird die Morphologie der mit MOCVD gewachsenen epitaktischen CuGaSe 2 - Schichten auf GaAs dargestellt. Da für die Photolumineszenzmessungen
Kapitel 4 Morphologie der epitaktischen CuGaSe 2 -Schichten Im Folgenden Kapitel wird die Morphologie der mit MOCVD gewachsenen epitaktischen CuGaSe 2 - Schichten auf GaAs dargestellt. Da für die Photolumineszenzmessungen
Photodetektoren für Stehende-Welle-Interferometer.
 Photodetektoren für Stehende-Welle-Interferometer 1 Inhalt 1. Einleitung und Motivation 2. Anforderungen an Photodetektoren für ein SWI 3. Epitaxie von GaN- und InGaN-Nanoschichten 4. GaN- & InGaN-basierende
Photodetektoren für Stehende-Welle-Interferometer 1 Inhalt 1. Einleitung und Motivation 2. Anforderungen an Photodetektoren für ein SWI 3. Epitaxie von GaN- und InGaN-Nanoschichten 4. GaN- & InGaN-basierende
*DE A *
 *DE102007053297A120090319* (19) Bundesrepublik Deutschland Deutsches Patent- und Markenamt (10) DE 10 2007 053 297 A1 2009.03.19 (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: 10 2007 053 297.2 (22) Anmeldetag:
*DE102007053297A120090319* (19) Bundesrepublik Deutschland Deutsches Patent- und Markenamt (10) DE 10 2007 053 297 A1 2009.03.19 (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: 10 2007 053 297.2 (22) Anmeldetag:
Abiturprüfung Physik, Grundkurs
 Seite 1 von 6 Abiturprüfung 2010 Physik, Grundkurs Aufgabenstellung: Aufgabe: Energieniveaus im Quecksilberatom Das Bohr sche Atommodell war für die Entwicklung der Vorstellung über Atome von großer Bedeutung.
Seite 1 von 6 Abiturprüfung 2010 Physik, Grundkurs Aufgabenstellung: Aufgabe: Energieniveaus im Quecksilberatom Das Bohr sche Atommodell war für die Entwicklung der Vorstellung über Atome von großer Bedeutung.
Physikalisches Praktikum
 Physikalisches Praktikum MI2AB Prof. Ruckelshausen Versuch 3.6: Beugung am Gitter Inhaltsverzeichnis 1. Theorie Seite 1 2. Versuchsdurchführung Seite 2 2.1 Bestimmung des Gitters mit der kleinsten Gitterkonstanten
Physikalisches Praktikum MI2AB Prof. Ruckelshausen Versuch 3.6: Beugung am Gitter Inhaltsverzeichnis 1. Theorie Seite 1 2. Versuchsdurchführung Seite 2 2.1 Bestimmung des Gitters mit der kleinsten Gitterkonstanten
Wechselwirkung zwischen Licht und chemischen Verbindungen
 Photometer Zielbegriffe Photometrie. Gesetz v. Lambert-Beer, Metallkomplexe, Elektronenanregung, Flammenfärbung, Farbe Erläuterungen Die beiden Versuche des 4. Praktikumstages sollen Sie mit der Photometrie
Photometer Zielbegriffe Photometrie. Gesetz v. Lambert-Beer, Metallkomplexe, Elektronenanregung, Flammenfärbung, Farbe Erläuterungen Die beiden Versuche des 4. Praktikumstages sollen Sie mit der Photometrie
Korrelationsmethoden für hoch dynamische Zeitauflösung in der Foto- und Kathodolumineszenz
 CURANDO Abteilung Halbleiterphysik, Universität Ulm Korrelationsmethoden für hoch dynamische Zeitauflösung in der Foto- und Kathodolumineszenz UNIVERSITÄT ULM SCIENDO DOCENDO Rolf Freitag 2007-02-14 INHALTSVERZEICHNIS
CURANDO Abteilung Halbleiterphysik, Universität Ulm Korrelationsmethoden für hoch dynamische Zeitauflösung in der Foto- und Kathodolumineszenz UNIVERSITÄT ULM SCIENDO DOCENDO Rolf Freitag 2007-02-14 INHALTSVERZEICHNIS
Materialien für Festkörperlaser
 Fachhochschule Münster Fachbereich Physikalische Technik Inkohärente Lichtquellen 1 Inhalt Einleitung Materialien für Festkörperlaser Wirtskristall Aktive Ionen Wirtskristall + aktive Ionen Festkörperlaser
Fachhochschule Münster Fachbereich Physikalische Technik Inkohärente Lichtquellen 1 Inhalt Einleitung Materialien für Festkörperlaser Wirtskristall Aktive Ionen Wirtskristall + aktive Ionen Festkörperlaser
h-bestimmung mit LEDs
 Aufbau und Funktion der 13. März 2006 Inhalt Aufbau und Funktion der 1 Aufbau und Funktion der 2 sbeschreibung Inhalt Aufbau und Funktion der 1 Aufbau und Funktion der 2 sbeschreibung Aufbau und Funktion
Aufbau und Funktion der 13. März 2006 Inhalt Aufbau und Funktion der 1 Aufbau und Funktion der 2 sbeschreibung Inhalt Aufbau und Funktion der 1 Aufbau und Funktion der 2 sbeschreibung Aufbau und Funktion
Dirk Eßer (Autor) Ultraschalldiagnostik im Kopf- und Halsbereich (A- und B- Bild- Verfahren)
 Dirk Eßer (Autor) Ultraschalldiagnostik im Kopf- und Halsbereich (A- und B- Bild- Verfahren) https://cuvillier.de/de/shop/publications/885 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier,
Dirk Eßer (Autor) Ultraschalldiagnostik im Kopf- und Halsbereich (A- und B- Bild- Verfahren) https://cuvillier.de/de/shop/publications/885 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier,
Peter Iskra (Autor) Entwicklung von siliziumbasierten Transistoren für den Einsatz bei hohen Temperaturen in der Gassensorik
 Peter Iskra (Autor) Entwicklung von siliziumbasierten Transistoren für den Einsatz bei hohen Temperaturen in der Gassensorik https://cuvillier.de/de/shop/publications/89 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Peter Iskra (Autor) Entwicklung von siliziumbasierten Transistoren für den Einsatz bei hohen Temperaturen in der Gassensorik https://cuvillier.de/de/shop/publications/89 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
3 GaN Molekularstrahlepitaxie
 3 GaN Molekularstrahlepitaxie 18 3 GaN Molekularstrahlepitaxie Im folgenden werden die grundlegenden Eigenschaften MBE gewachsener GaN Proben und des MBE GaN Epitaxieprozesses gezeigt. Die Wachstumsbedingungen
3 GaN Molekularstrahlepitaxie 18 3 GaN Molekularstrahlepitaxie Im folgenden werden die grundlegenden Eigenschaften MBE gewachsener GaN Proben und des MBE GaN Epitaxieprozesses gezeigt. Die Wachstumsbedingungen
P 2 - Piezoelektrizität
 56 P2 Piezoelektrizität P 2 - Piezoelektrizität Ein Kristall, dessen Punktgruppe (Kristallklasse) kein Symmetriezentrum (Z) aufweist, kann prinzipiell piezoelektrisch sein Das heißt, der auf den Kristall
56 P2 Piezoelektrizität P 2 - Piezoelektrizität Ein Kristall, dessen Punktgruppe (Kristallklasse) kein Symmetriezentrum (Z) aufweist, kann prinzipiell piezoelektrisch sein Das heißt, der auf den Kristall
Wasseraufbereitung mit UV LEDs
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN Wasseraufbereitung mit UV LEDs Dorian Alden: 302568 Betreuer: Joachim Stellmach 06.07.2010 Inhalt Inhalt...2 1 Einführung...3 2 Wasserknappheit...3 3 Wasserdesinfektion...5
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN Wasseraufbereitung mit UV LEDs Dorian Alden: 302568 Betreuer: Joachim Stellmach 06.07.2010 Inhalt Inhalt...2 1 Einführung...3 2 Wasserknappheit...3 3 Wasserdesinfektion...5
Das große. Halbleiterlaser. Clicker-Quiz
 Das große Halbleiterlaser Clicker-Quiz Aufbau eines Lasers Was wird bei der Separate Confinement Heterostructure separat eingeschlossen? a) Elektronen und Löcher b) Ladungsträger und Photonen c) Dotieratome
Das große Halbleiterlaser Clicker-Quiz Aufbau eines Lasers Was wird bei der Separate Confinement Heterostructure separat eingeschlossen? a) Elektronen und Löcher b) Ladungsträger und Photonen c) Dotieratome
Quantenphysik in der Sekundarstufe I
 Quantenphysik in der Sekundarstufe I Atomphysik Dr. Holger Hauptmann Europa-Gymnasium Wörth holger.hauptmann@gmx.de Quantenphysik in der Sek I, Folie 1 Inhalt 1. Der Aufbau der Atome 2. Größe und Dichte
Quantenphysik in der Sekundarstufe I Atomphysik Dr. Holger Hauptmann Europa-Gymnasium Wörth holger.hauptmann@gmx.de Quantenphysik in der Sek I, Folie 1 Inhalt 1. Der Aufbau der Atome 2. Größe und Dichte
n-typ negative Spannung positive Spannung p-typ Halbleiter in Sperrrichtung Festk0203_ /26/2003
 Festk003_3 195 5/6/003 AlGaAs: grün GaN: blau, ultraviolett GaP(N): gelb Kombiniert man effiziente Leuchtdioden mit einem Resonator, kann man Halbleiterlaser herstellen. Die ffizienz kann durch die Verwendung
Festk003_3 195 5/6/003 AlGaAs: grün GaN: blau, ultraviolett GaP(N): gelb Kombiniert man effiziente Leuchtdioden mit einem Resonator, kann man Halbleiterlaser herstellen. Die ffizienz kann durch die Verwendung
9. GV: Atom- und Molekülspektren
 Physik Praktikum I: WS 2005/06 Protokoll zum Praktikum Dienstag, 25.10.05 9. GV: Atom- und Molekülspektren Protokollanten Jörg Mönnich Anton Friesen - Veranstalter Andreas Branding - 1 - Theorie Während
Physik Praktikum I: WS 2005/06 Protokoll zum Praktikum Dienstag, 25.10.05 9. GV: Atom- und Molekülspektren Protokollanten Jörg Mönnich Anton Friesen - Veranstalter Andreas Branding - 1 - Theorie Während
PEITING. Fluoreszenz-Experimente aus der Biologie mit modernen UV-LEDs. ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht
 ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht PEITING Fluoreszenz-Experimente aus der Biologie mit modernen UV-LEDs Oliver Debacher Schule: Jugend forscht 2015 Fluoreszenz-Experimente
ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht PEITING Fluoreszenz-Experimente aus der Biologie mit modernen UV-LEDs Oliver Debacher Schule: Jugend forscht 2015 Fluoreszenz-Experimente
Wärmestrahlung. Einfallende Strahlung = absorbierte Strahlung + reflektierte Strahlung
 Wärmestrahlung Gleichheit von Absorptions- und Emissionsgrad Zwei Flächen auf gleicher Temperatur T 1 stehen sich gegenüber. dunkelgrau hellgrau Der Wärmefluss durch Strahlung muss in beiden Richtungen
Wärmestrahlung Gleichheit von Absorptions- und Emissionsgrad Zwei Flächen auf gleicher Temperatur T 1 stehen sich gegenüber. dunkelgrau hellgrau Der Wärmefluss durch Strahlung muss in beiden Richtungen
GaN-Hydridgasphasenepitaxie (HVPE)
 GaN-Hydridgasphasenepitaxie (HVPE) SiC und GaN Materialien für Leistungs- und Optoelektronik 03.09. 14.09.2001, WE-Heraeus-Ferienkurs, BTU Cottbus Berlin Literatur: E. Richter Will Kleber Einführung in
GaN-Hydridgasphasenepitaxie (HVPE) SiC und GaN Materialien für Leistungs- und Optoelektronik 03.09. 14.09.2001, WE-Heraeus-Ferienkurs, BTU Cottbus Berlin Literatur: E. Richter Will Kleber Einführung in
Festkörperelektronik 2008 Übungsblatt 4
 Lichttechnisches Institut Universität Karlsruhe (TH) Prof. Dr. rer. nat. Uli Lemmer Dipl.-Phys. Alexander Colsmann Engesserstraße 13 76131 Karlsruhe Festkörperelektronik 4. Übungsblatt 12. Juni 2008 Die
Lichttechnisches Institut Universität Karlsruhe (TH) Prof. Dr. rer. nat. Uli Lemmer Dipl.-Phys. Alexander Colsmann Engesserstraße 13 76131 Karlsruhe Festkörperelektronik 4. Übungsblatt 12. Juni 2008 Die
Physikalisches Praktikum 3. Semester
 Torsten Leddig 30.November 2004 Mathias Arbeiter Betreuer: Dr.Hoppe Physikalisches Praktikum 3. Semester - Newtonsche Ringe - 1 1 Newtonsche Ringe: Aufgaben: Bestimmen Sie den Krümmungsradius R sowie den
Torsten Leddig 30.November 2004 Mathias Arbeiter Betreuer: Dr.Hoppe Physikalisches Praktikum 3. Semester - Newtonsche Ringe - 1 1 Newtonsche Ringe: Aufgaben: Bestimmen Sie den Krümmungsradius R sowie den
1 Kristallgitter und Kristallbaufehler 10 Punkte
 1 Kristallgitter und Kristallbaufehler 10 Punkte 1.1 Es gibt 7 Kristallsysteme, aus denen sich 14 Bravais-Typen ableiten lassen. Charakterisieren Sie die kubische, tetragonale, hexagonale und orthorhombische
1 Kristallgitter und Kristallbaufehler 10 Punkte 1.1 Es gibt 7 Kristallsysteme, aus denen sich 14 Bravais-Typen ableiten lassen. Charakterisieren Sie die kubische, tetragonale, hexagonale und orthorhombische
Lösung: a) b = 3, 08 m c) nein
 Phy GK13 Physik, BGL Aufgabe 1, Gitter 1 Senkrecht auf ein optisches Strichgitter mit 100 äquidistanten Spalten je 1 cm Gitterbreite fällt grünes monochromatisches Licht der Wellenlänge λ = 544 nm. Unter
Phy GK13 Physik, BGL Aufgabe 1, Gitter 1 Senkrecht auf ein optisches Strichgitter mit 100 äquidistanten Spalten je 1 cm Gitterbreite fällt grünes monochromatisches Licht der Wellenlänge λ = 544 nm. Unter
Thomas Zöller (Autor) Verbesserung des Auflösungsverhaltens von schwer löslichen schwachen Säuren durch feste Lösungen und Cyclodextrin- Komplexe
 Thomas Zöller (Autor) Verbesserung des Auflösungsverhaltens von schwer löslichen schwachen Säuren durch feste Lösungen und Cyclodextrin- Komplexe https://cuvillier.de/de/shop/publications/334 Copyright:
Thomas Zöller (Autor) Verbesserung des Auflösungsverhaltens von schwer löslichen schwachen Säuren durch feste Lösungen und Cyclodextrin- Komplexe https://cuvillier.de/de/shop/publications/334 Copyright:
5. Numerische Ergebnisse. 5.1. Vorbemerkungen
 5. Numerische Ergebnisse 52 5. Numerische Ergebnisse 5.1. Vorbemerkungen Soll das thermische Verhalten von Verglasungen simuliert werden, müssen alle das System beeinflussenden Wärmetransportmechanismen,
5. Numerische Ergebnisse 52 5. Numerische Ergebnisse 5.1. Vorbemerkungen Soll das thermische Verhalten von Verglasungen simuliert werden, müssen alle das System beeinflussenden Wärmetransportmechanismen,
11. Vorlesung
 Werkstoffmechanik SS0 Baither/Schmitz. Vorlesung.06.0 5.9 Versetzungsechselirkung Versetzungen sind im Allgemeinen umgeben von einem elastischen Spannungsfeld, über das die Versetzungen gegenseitig in
Werkstoffmechanik SS0 Baither/Schmitz. Vorlesung.06.0 5.9 Versetzungsechselirkung Versetzungen sind im Allgemeinen umgeben von einem elastischen Spannungsfeld, über das die Versetzungen gegenseitig in
Wasseraufbereitung mit UV LEDs. Seminarvortrag SS 2008 Katrin Sedlmeier Betreuer: Joachim Stellmach
 Wasseraufbereitung mit UV LEDs Seminarvortrag SS 2008 Katrin Sedlmeier Betreuer: Joachim Stellmach Inhaltsverzeichnis 1 Motivation 2 2 Wasserdesinfektion mit UV Strahlung 2 2.1 Wieso UV Strahlung?........................
Wasseraufbereitung mit UV LEDs Seminarvortrag SS 2008 Katrin Sedlmeier Betreuer: Joachim Stellmach Inhaltsverzeichnis 1 Motivation 2 2 Wasserdesinfektion mit UV Strahlung 2 2.1 Wieso UV Strahlung?........................
Die Abbildung zeigt eine handelsübliche Röntgenröhre
 Die Röntgenstrahlung Historische Fakten: 1895 entdeckte Röntgen beim Experimentieren mit einer Gasentladungsröhre, dass fluoreszierende Kristalle außerhalb der Röhre zum Leuchten angeregt wurden, obwohl
Die Röntgenstrahlung Historische Fakten: 1895 entdeckte Röntgen beim Experimentieren mit einer Gasentladungsröhre, dass fluoreszierende Kristalle außerhalb der Röhre zum Leuchten angeregt wurden, obwohl
Grundpraktikum A A2 Franck-Hertz-Versuch
 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Institut für Physik Grundpraktikum A A2 Franck-Hertz-Versuch 30.06.2017 Studenten: Tim Will Betreuer: Raum: J. NEW14-2.01 Messplatz: 2 INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Institut für Physik Grundpraktikum A A2 Franck-Hertz-Versuch 30.06.2017 Studenten: Tim Will Betreuer: Raum: J. NEW14-2.01 Messplatz: 2 INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS
Abiturprüfung Physik, Leistungskurs
 Seite 1 von 8 Abiturprüfung 2010 Physik, Leistungskurs Aufgabenstellung: Aufgabe: Energieniveaus im Quecksilberatom Das Bohr sche Atommodell war für die Entwicklung der Vorstellung über Atome von großer
Seite 1 von 8 Abiturprüfung 2010 Physik, Leistungskurs Aufgabenstellung: Aufgabe: Energieniveaus im Quecksilberatom Das Bohr sche Atommodell war für die Entwicklung der Vorstellung über Atome von großer
Abiturprüfung Physik, Grundkurs
 Seite 1 von 7 Abiturprüfung 2011 Physik, Grundkurs Aufgabenstellung: Aufgabe 1: Der Doppelspalt 1.1 Interferenzen bei Licht In einem ersten Experiment untersucht man Interferenzen von sichtbarem Licht,
Seite 1 von 7 Abiturprüfung 2011 Physik, Grundkurs Aufgabenstellung: Aufgabe 1: Der Doppelspalt 1.1 Interferenzen bei Licht In einem ersten Experiment untersucht man Interferenzen von sichtbarem Licht,
Dennis P. Büch. os/led_throwies.jpg
 Dennis P. Büch http://blog.karotte.org/uploads/fot os/led_throwies.jpg Kurzer historischer Hintergrund Funktionsweise Aufbau Bauformen Dennis- P. Büch 1 Kurzer historischer Hintergrund Funktionsweise Aufbau
Dennis P. Büch http://blog.karotte.org/uploads/fot os/led_throwies.jpg Kurzer historischer Hintergrund Funktionsweise Aufbau Bauformen Dennis- P. Büch 1 Kurzer historischer Hintergrund Funktionsweise Aufbau
Hochortsaufgelöste elektro-optische Charakterisierung von InGaN/GaN LED-Strukturen
 Hochortsaufgelöste elektro-optische Charakterisierung von InGaN/GaN LED-Strukturen DISSERTATION zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) der Naturwissenschaftlichen Fakultät
Hochortsaufgelöste elektro-optische Charakterisierung von InGaN/GaN LED-Strukturen DISSERTATION zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) der Naturwissenschaftlichen Fakultät
Über die Molekularstrahlepitaxie von In x Ga 1-x N Heterostrukturen und deren optische Charakterisierung
 Über die Molekularstrahlepitaxie von In x Ga 1-x N Heterostrukturen und deren optische Charakterisierung Dissertation Andreas Graber JUSTUS-LIEBIG- UNIVERSITÄT GIESSEN Über die Molekularstrahlepitaxie
Über die Molekularstrahlepitaxie von In x Ga 1-x N Heterostrukturen und deren optische Charakterisierung Dissertation Andreas Graber JUSTUS-LIEBIG- UNIVERSITÄT GIESSEN Über die Molekularstrahlepitaxie
Wiederholung: Epitaxie
 Wiederholung: Epitaxie Epitaxie ist die Herstellung von Schichten, welche in grossen Bereichen einkristallin sind Homoepitaxie: Substratmeterial = Schichtmaterial Heteroepitaxie: Substratmaterial Schichtmaterial
Wiederholung: Epitaxie Epitaxie ist die Herstellung von Schichten, welche in grossen Bereichen einkristallin sind Homoepitaxie: Substratmeterial = Schichtmaterial Heteroepitaxie: Substratmaterial Schichtmaterial
Auswertung. oberhalb der Laserschwelle unterhalb der Laserschwelle Spannung U in V. Abbildung 1: Kennlinie der Laserdiode
 Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum Lumineszenz Auswertung Armin Burgmeier Robert Schittny 1 Laserdiode 1.1 Kennlinie Wir haben die Kennlinie der Laserdiode aufgenommen, zunächst überhalb der Laserschwelle
Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum Lumineszenz Auswertung Armin Burgmeier Robert Schittny 1 Laserdiode 1.1 Kennlinie Wir haben die Kennlinie der Laserdiode aufgenommen, zunächst überhalb der Laserschwelle
FLUID- LICHTLEITER FÜR MAXIMALEN LICHTDURCHSATZ.
 FLUID- LICHTLEITER FÜR MAXIMALEN LICHTDURCHSATZ www.lumatec.de FLUID-LICHTLEITER SIND EINE PERFEKTE ALTERNATIVE ZU GEBÜNDELTEN QUARZGLASFASERN Flüssigkeitsgefüllte Lichtwellenleiter haben unübersehbare
FLUID- LICHTLEITER FÜR MAXIMALEN LICHTDURCHSATZ www.lumatec.de FLUID-LICHTLEITER SIND EINE PERFEKTE ALTERNATIVE ZU GEBÜNDELTEN QUARZGLASFASERN Flüssigkeitsgefüllte Lichtwellenleiter haben unübersehbare
Physik 4 Praktikum Auswertung PVM
 Physik 4 Praktikum Auswertung PVM Von J.W, I.G. 2014 Seite 1. Kurzfassung......... 2 2. Theorie.......... 2 2.1. Solarzelle......... 2 2.2. PV-Modul......... 2 2.3. Schaltzeichen........ 2 2.4. Zu ermittelnde
Physik 4 Praktikum Auswertung PVM Von J.W, I.G. 2014 Seite 1. Kurzfassung......... 2 2. Theorie.......... 2 2.1. Solarzelle......... 2 2.2. PV-Modul......... 2 2.3. Schaltzeichen........ 2 2.4. Zu ermittelnde
Thema 1: Prozessoptimierung nitridbasierter Sensoren. Problem: Parasitäre Strompfade in der AlGaN-Schicht Ansatz: Ansatz der Bachelorarbeit:
 Thema 1: Prozessoptimierung nitridbasierter Sensoren Konventionelles Design: Projekt: Herstellung sensitiver Gas- und Flüssigkeitsdetektoren auf GaN-Basis. Problem: Parasitäre Strompfade in der AlGaN-Schicht
Thema 1: Prozessoptimierung nitridbasierter Sensoren Konventionelles Design: Projekt: Herstellung sensitiver Gas- und Flüssigkeitsdetektoren auf GaN-Basis. Problem: Parasitäre Strompfade in der AlGaN-Schicht
Versuch: h-bestimmung mit Leuchtdioden
 Lehrer-/Dozentenblatt Gedruckt: 22.08.207 2:35:42 P4800 Versuch: h-bestimmung mit Leuchtdioden Aufgabe und Material Lehrerinformationen Zusätzliche Informationen Das plancksche Wirkungsquantum h ist eine
Lehrer-/Dozentenblatt Gedruckt: 22.08.207 2:35:42 P4800 Versuch: h-bestimmung mit Leuchtdioden Aufgabe und Material Lehrerinformationen Zusätzliche Informationen Das plancksche Wirkungsquantum h ist eine
Hallwachs-Experiment. Bestrahlung einer geladenen Zinkplatte mit dem Licht einer Quecksilberdampflampe
 Hallwachs-Experiment Bestrahlung einer geladenen Zinkplatte mit dem Licht einer Quecksilberdampflampe 20.09.2012 Skizziere das Experiment Notiere und Interpretiere die Beobachtungen Photoeffekt Bestrahlt
Hallwachs-Experiment Bestrahlung einer geladenen Zinkplatte mit dem Licht einer Quecksilberdampflampe 20.09.2012 Skizziere das Experiment Notiere und Interpretiere die Beobachtungen Photoeffekt Bestrahlt
Einfaches Spektroskop aus alltäglichen Gegenständen
 Illumina-Chemie.de - Artikel Physik aus alltäglichen Gegenständen Im Folgenden wird der Bau eines sehr einfachen Spektroskops aus alltäglichen Dingen erläutert. Es dient zur Untersuchung von Licht im sichtbaren
Illumina-Chemie.de - Artikel Physik aus alltäglichen Gegenständen Im Folgenden wird der Bau eines sehr einfachen Spektroskops aus alltäglichen Dingen erläutert. Es dient zur Untersuchung von Licht im sichtbaren
Einige Anwendungsfelder im Überblick:
 www.lumimax.de en kommen immer dann Einsatz, wenn Materialien Leuchten angeregt werden sollen. Die Anregungswellenlänge ist dabei abhängig von dem verwendeten mittel, kann sich aber im kompletten Spektrum
www.lumimax.de en kommen immer dann Einsatz, wenn Materialien Leuchten angeregt werden sollen. Die Anregungswellenlänge ist dabei abhängig von dem verwendeten mittel, kann sich aber im kompletten Spektrum
Inkohärente Lichtquellen
 Inkohärente Lichtquellen M. Sc. Chemieingenieurwesen / Photonik 15. Juli 2015 Prof. Dr. T. Jüstel Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges und der Endergebnisse.
Inkohärente Lichtquellen M. Sc. Chemieingenieurwesen / Photonik 15. Juli 2015 Prof. Dr. T. Jüstel Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges und der Endergebnisse.
Fluoreszenzlampenl. René Riedel. Bettina Haves
 Leuchtstoffe in Fluoreszenzlampenl René Riedel Bettina Haves Inhalt 1) Fluoreszenzlampen 2) Fluoreszenz 3) Geschichte der Leuchtstoffe 4) Leuchtstoffe in Fluoreszenzlampen 5) Weitere Anwendungsbereiche
Leuchtstoffe in Fluoreszenzlampenl René Riedel Bettina Haves Inhalt 1) Fluoreszenzlampen 2) Fluoreszenz 3) Geschichte der Leuchtstoffe 4) Leuchtstoffe in Fluoreszenzlampen 5) Weitere Anwendungsbereiche
Polymer LEDs. Inkohärente Lichtquellen SS11. Oliver Thom
 Polymer LEDs Inkohärente Lichtquellen SS11 Oliver Thom Übersicht Einführung Materialien Funktionsweise der PLEDs Herstellung Vor- /Nachteile Anwendungen Übersicht Einführung Materialien Funktionsweise
Polymer LEDs Inkohärente Lichtquellen SS11 Oliver Thom Übersicht Einführung Materialien Funktionsweise der PLEDs Herstellung Vor- /Nachteile Anwendungen Übersicht Einführung Materialien Funktionsweise
32. n oder p? (Ü) Sie müssen die Dotierung in einem unbekannten Halbleiterplättchen bestimmen.
 Lichttechnisches Institut Universität Karlsruhe Prof. Dr. rer. nat. Uli Lemmer / Dipl.-Ing. Felix Glöckler Kaiserstrasse 12 76131 Karlsruhe Festkörperelektronik 6. Übungsblatt 13. Juli 2006 Möglicher Abgabetermin:
Lichttechnisches Institut Universität Karlsruhe Prof. Dr. rer. nat. Uli Lemmer / Dipl.-Ing. Felix Glöckler Kaiserstrasse 12 76131 Karlsruhe Festkörperelektronik 6. Übungsblatt 13. Juli 2006 Möglicher Abgabetermin:
V. Optik in Halbleiterbauelementen
 V.1: Einführung V. Optik in Halbleiterbauelementen 1. Kontakt 1. 3.. 1. Kontakt Abb. VI.1: Spontane Emission an einem pn-übergang Rekombination in der LED: - statistisch auftretender Prozess - Energie
V.1: Einführung V. Optik in Halbleiterbauelementen 1. Kontakt 1. 3.. 1. Kontakt Abb. VI.1: Spontane Emission an einem pn-übergang Rekombination in der LED: - statistisch auftretender Prozess - Energie
Struktur von Festkörpern
 Struktur von Festkörpern Wir wollen uns zunächst mit der Struktur von Festkörpern, daß heißt mit der Geometrie in der sie vorliegen beschäftigen Kovalent gebundene Festkörper haben wir bereits in Form
Struktur von Festkörpern Wir wollen uns zunächst mit der Struktur von Festkörpern, daß heißt mit der Geometrie in der sie vorliegen beschäftigen Kovalent gebundene Festkörper haben wir bereits in Form
Quantenphysik in der Sekundarstufe I
 Quantenphysik in der Sekundarstufe I Atome und Atomhülle Quantenphysik in der Sek I, Folie 1 Inhalt Voraussetzungen 1. Der Aufbau der Atome 2. Größe und Dichte der Atomhülle 3. Die verschiedenen Zustände
Quantenphysik in der Sekundarstufe I Atome und Atomhülle Quantenphysik in der Sek I, Folie 1 Inhalt Voraussetzungen 1. Der Aufbau der Atome 2. Größe und Dichte der Atomhülle 3. Die verschiedenen Zustände
Fluoreszenz. Abb. 1: Möglicher Versuchsaufbau
 Fluoreszenz Abb. 1: Möglicher Versuchsaufbau Geräteliste: UV-Lampe Geldscheintester, Schwarzlicht-Leuchtstofflampe, Halogenlampe, UV- Bandpass, Granulat mit fluoreszierendem Farbstoff, Fluoreszenzproben,
Fluoreszenz Abb. 1: Möglicher Versuchsaufbau Geräteliste: UV-Lampe Geldscheintester, Schwarzlicht-Leuchtstofflampe, Halogenlampe, UV- Bandpass, Granulat mit fluoreszierendem Farbstoff, Fluoreszenzproben,
Lösungen: 2. Übung zur Vorlesung Optoelektronik I
 Gerken/Lemmer SS 2004 Lösungen: 2. Übung zur Vorlesung Optoelektronik I Aufgabe 3: Berechnung von Wellenleitermoden (a) Um die Wellenleitermoden der gegebenen Struktur zu finden, plotten wir die Amplitude
Gerken/Lemmer SS 2004 Lösungen: 2. Übung zur Vorlesung Optoelektronik I Aufgabe 3: Berechnung von Wellenleitermoden (a) Um die Wellenleitermoden der gegebenen Struktur zu finden, plotten wir die Amplitude
Strukturelle Charakterisierung von Gruppe-III-Nitriden mit Hilfe der hochauflösenden Röntgenbeugung
 Strukturelle Charakterisierung von Gruppe-III-Nitriden mit Hilfe der hochauflösenden Röntgenbeugung von Verena Kirchner Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Naturwissenschaften
Strukturelle Charakterisierung von Gruppe-III-Nitriden mit Hilfe der hochauflösenden Röntgenbeugung von Verena Kirchner Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Naturwissenschaften
Aufgabe 1: Kristallstrukturuntersuchungen
 Aufgabe 1: Kristallstrukturuntersuchungen Röntgenstrahlung entsteht in unserem Gerät durch das Auftreffen hochenergetischer Elektronen auf eine Molybdän-Anode (Abbildung 1). Im Spektrum der Strahlung (Abbildung
Aufgabe 1: Kristallstrukturuntersuchungen Röntgenstrahlung entsteht in unserem Gerät durch das Auftreffen hochenergetischer Elektronen auf eine Molybdän-Anode (Abbildung 1). Im Spektrum der Strahlung (Abbildung
Vom Molekül zum Material. Thema heute: Halbleiter: Licht Lampen Leuchtdioden
 Vorlesung Anorganische Chemie V-A Vom Molekül zum Material Thema heute: Halbleiter: Licht Lampen Leuchtdioden 1 A 2 A Absolute Dunkelheit 3 Absolute Dunkelheit 4 Allgemeine Definition: Licht Licht ist
Vorlesung Anorganische Chemie V-A Vom Molekül zum Material Thema heute: Halbleiter: Licht Lampen Leuchtdioden 1 A 2 A Absolute Dunkelheit 3 Absolute Dunkelheit 4 Allgemeine Definition: Licht Licht ist
FLUID- LICHTLEITER FÜR MAXIMALEN LICHTDURCHSATZ.
 FLUID- LICHTLEITER FÜR MAXIMALEN LICHTDURCHSATZ www.lumatec.de EINE GENIALE IDEE UNZÄHLIGE ANWENDUNGEN Unsere Lichtleiter erhalten Sie mit verschiedenen aktiven Durchmessern und Uantelungen. Wir liefern
FLUID- LICHTLEITER FÜR MAXIMALEN LICHTDURCHSATZ www.lumatec.de EINE GENIALE IDEE UNZÄHLIGE ANWENDUNGEN Unsere Lichtleiter erhalten Sie mit verschiedenen aktiven Durchmessern und Uantelungen. Wir liefern
Festkörperelektronik 2008 Übungsblatt 5
 Lichttechnisches Institut Universität Karlsruhe (TH) Prof. Dr. rer. nat. Uli Lemmer Dipl.-Phys. Alexander Colsmann Engesserstraße 13 76131 Karlsruhe Festkörperelektronik 5. Übungsblatt 26. Juni 2008 Die
Lichttechnisches Institut Universität Karlsruhe (TH) Prof. Dr. rer. nat. Uli Lemmer Dipl.-Phys. Alexander Colsmann Engesserstraße 13 76131 Karlsruhe Festkörperelektronik 5. Übungsblatt 26. Juni 2008 Die
Technologische Aspekte (theoretische Grundlagen des Verfahrens) 5
 Kapitel5 Technologische Aspekte (theoretische Grundlagen des Verfahrens) 5 5.1 Technische Baugruppen an Offsetmaschinen und deren Funktion im UV-Offsetdruck Thomas Walther In diesem Kapitel wird die UV-Ausstattung
Kapitel5 Technologische Aspekte (theoretische Grundlagen des Verfahrens) 5 5.1 Technische Baugruppen an Offsetmaschinen und deren Funktion im UV-Offsetdruck Thomas Walther In diesem Kapitel wird die UV-Ausstattung
Wafer Grundlage der ICs
 Wafer Grundlage der ICs Gliederung Was ist ein Wafer? Material und Verwendung Herstellung Größe und Ausbeute Quellen Was ist ein Wafer? Ein Wafer ist eine flache, runde Scheibe mit einer Dicke von 1mm
Wafer Grundlage der ICs Gliederung Was ist ein Wafer? Material und Verwendung Herstellung Größe und Ausbeute Quellen Was ist ein Wafer? Ein Wafer ist eine flache, runde Scheibe mit einer Dicke von 1mm
Zentralabitur 2011 Physik Schülermaterial Aufgabe I ga Bearbeitungszeit: 220 min
 Thema: Eigenschaften von Licht Gegenstand der Aufgabe 1 ist die Untersuchung von Licht nach Durchlaufen von Luft bzw. Wasser mit Hilfe eines optischen Gitters. Während in der Aufgabe 2 der äußere lichtelektrische
Thema: Eigenschaften von Licht Gegenstand der Aufgabe 1 ist die Untersuchung von Licht nach Durchlaufen von Luft bzw. Wasser mit Hilfe eines optischen Gitters. Während in der Aufgabe 2 der äußere lichtelektrische
Übersicht über die Vorlesung
 Übersicht über die Vorlesung OE 3.1 I. Einleitung II. Physikalische Grundlagen der Optoelektronik III. Herstellungstechnologien III.1 Epitaxie III.2 Halbleiterquantenstrukturen IV. Halbleiterleuchtdioden
Übersicht über die Vorlesung OE 3.1 I. Einleitung II. Physikalische Grundlagen der Optoelektronik III. Herstellungstechnologien III.1 Epitaxie III.2 Halbleiterquantenstrukturen IV. Halbleiterleuchtdioden
Einfluss der Lumineszenzmechanismen und der elektrischen Kontakte auf die Effizienz von InGaN Leuchtdioden
 Einfluss der Lumineszenzmechanismen und der elektrischen Kontakte auf die Effizienz von InGaN Leuchtdioden Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Fakultät für Mathematik und Physik der Albert-Ludwigs-Universität
Einfluss der Lumineszenzmechanismen und der elektrischen Kontakte auf die Effizienz von InGaN Leuchtdioden Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Fakultät für Mathematik und Physik der Albert-Ludwigs-Universität
Festkörperelektronik 2008 Übungsblatt 6
 Lichttechnisches Institut Universität Karlsruhe (TH) Prof. Dr. rer. nat. Uli Lemmer Dipl.-Phys. Alexander Colsmann Engesserstraße 13 76131 Karlsruhe Festkörperelektronik 6. Übungsblatt 10. Juli 2008 Die
Lichttechnisches Institut Universität Karlsruhe (TH) Prof. Dr. rer. nat. Uli Lemmer Dipl.-Phys. Alexander Colsmann Engesserstraße 13 76131 Karlsruhe Festkörperelektronik 6. Übungsblatt 10. Juli 2008 Die
Solarzellen der 3. Generation
 Solarzellen der 3. Generation Karen Forberich i-meet: institute Materials for Electronics and Energy Technology FAU Erlangen-Nürnberg Erlangen, 7.April 2016 Motivation Motivation Inhalt Wie funktioniert
Solarzellen der 3. Generation Karen Forberich i-meet: institute Materials for Electronics and Energy Technology FAU Erlangen-Nürnberg Erlangen, 7.April 2016 Motivation Motivation Inhalt Wie funktioniert
Elemente optischer Netze
 Vieweg+TeubnerPLUS Zusatzinformationen zu Medien des Vieweg+Teubner Verlags Elemente optischer Netze Grundlagen und Praxis der optischen Datenübertragung Erscheinungsjahr 2011 2. Auflage Kapitel 5 Bilder
Vieweg+TeubnerPLUS Zusatzinformationen zu Medien des Vieweg+Teubner Verlags Elemente optischer Netze Grundlagen und Praxis der optischen Datenübertragung Erscheinungsjahr 2011 2. Auflage Kapitel 5 Bilder
5 Elektronenübergänge im Festkörper
 5 Elektronenübergänge im Festkörper 5.1 Übersicht und Lernziele Übersicht Die Bindung in einem Molekül erfolgt durch gemeinsame Elektronenpaare, die jeweils zwei Atomen angehören (Atombindung, Elektronenpaarbindung).
5 Elektronenübergänge im Festkörper 5.1 Übersicht und Lernziele Übersicht Die Bindung in einem Molekül erfolgt durch gemeinsame Elektronenpaare, die jeweils zwei Atomen angehören (Atombindung, Elektronenpaarbindung).
verschiedener Lichtquellen
 Praktikum Materialwissenschaften I Spektrometer und optische Eigenschaften verschiedener Lichtquellen 10. Januar 2008 Versuchsbetreuer: Oliver Ottinger Gruppe 8: Jonathan Griebel (j.griebel@gmx.net ) Andreas
Praktikum Materialwissenschaften I Spektrometer und optische Eigenschaften verschiedener Lichtquellen 10. Januar 2008 Versuchsbetreuer: Oliver Ottinger Gruppe 8: Jonathan Griebel (j.griebel@gmx.net ) Andreas
Auswertung. D07: Photoeffekt
 Auswertung zum Versuch D07: Photoeffekt Alexander Fufaev Partner: Jule Heier Gruppe 434 1 Einleitung In diesem Versuch geht es darum, den Photoeffekt auf verschiedene Weisen zu untersuchen. In Versuchsteil
Auswertung zum Versuch D07: Photoeffekt Alexander Fufaev Partner: Jule Heier Gruppe 434 1 Einleitung In diesem Versuch geht es darum, den Photoeffekt auf verschiedene Weisen zu untersuchen. In Versuchsteil
Physik und Sensorik. Photodetektoren. Chemnitz 8. Oktober 2017 Prof. Dr. Uli Schwarz
 Photodetektoren Optische Sensoren Z.B. Transmission durch Gewebe Lichtquelle Gewebe Photodetektor Verstärker Bildquelle: http://www2.hs-esslingen.de/~johiller/pulsoximetrie/pics/po06.jpg 2 Photodetektoren
Photodetektoren Optische Sensoren Z.B. Transmission durch Gewebe Lichtquelle Gewebe Photodetektor Verstärker Bildquelle: http://www2.hs-esslingen.de/~johiller/pulsoximetrie/pics/po06.jpg 2 Photodetektoren
Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik Laborpraktikum Elektronische Bauelemente Prof. M. Hoffmann
 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik Laborpraktikum Elektronische Bauelemente Prof. M. Hoffmann Photoleitung in Halbleitern Studiengang: Set: Teilnehmer: Platz: Datum: Zielstellung Ermittlung
Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik Laborpraktikum Elektronische Bauelemente Prof. M. Hoffmann Photoleitung in Halbleitern Studiengang: Set: Teilnehmer: Platz: Datum: Zielstellung Ermittlung
Die Silizium - Solarzelle
 Die Silizium - Solarzelle 1. Prinzip einer Solarzelle Die einer Solarzelle besteht darin, Lichtenergie in elektrische Energie umzuwandeln. Die entscheidende Rolle bei diesem Vorgang spielen Elektronen
Die Silizium - Solarzelle 1. Prinzip einer Solarzelle Die einer Solarzelle besteht darin, Lichtenergie in elektrische Energie umzuwandeln. Die entscheidende Rolle bei diesem Vorgang spielen Elektronen
Michael Hoßfeld (Autor) Klassifikationssystem für Prägebildaufnahmen von Münzen
 Michael Hoßfeld (Autor) Klassifikationssystem für Prägebildaufnahmen von Münzen https://cuvillier.de/de/shop/publications/2100 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg
Michael Hoßfeld (Autor) Klassifikationssystem für Prägebildaufnahmen von Münzen https://cuvillier.de/de/shop/publications/2100 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg
Variation der Verspannung optischer dünner Schichten abgeschieden mit DIBD
 Variation der Verspannung optischer dünner Schichten abgeschieden mit DIBD I.-M. Eichentopf, C. Bundesmann, S. Mändl, H. Neumann e.v., Permoserstraße15, Leipzig, D-04318, Germany 1 Gliederung Motivation
Variation der Verspannung optischer dünner Schichten abgeschieden mit DIBD I.-M. Eichentopf, C. Bundesmann, S. Mändl, H. Neumann e.v., Permoserstraße15, Leipzig, D-04318, Germany 1 Gliederung Motivation
CV-Messungen an geätzten epitaktisch gewachsenen Schichten
 Technik Björn Hoffmann CV-Messungen an geätzten epitaktisch gewachsenen Schichten Diplomarbeit Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 4 2 Der Ga-As-Kristall 6 2.1 Kristallstruktur.......................... 6
Technik Björn Hoffmann CV-Messungen an geätzten epitaktisch gewachsenen Schichten Diplomarbeit Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 4 2 Der Ga-As-Kristall 6 2.1 Kristallstruktur.......................... 6
Wellen und Dipolstrahlung
 Wellen und Dipolstrahlung Florian Hrubesch 25. März 2010 Inhaltsverzeichnis 1 Photoeffekt 1 2 Comptoneffekt 3 3 Bragg Streuung 4 4 Strahlungsgesetze 5 1 Photoeffekt Der Photoeffekt wurde erstmals 1839
Wellen und Dipolstrahlung Florian Hrubesch 25. März 2010 Inhaltsverzeichnis 1 Photoeffekt 1 2 Comptoneffekt 3 3 Bragg Streuung 4 4 Strahlungsgesetze 5 1 Photoeffekt Der Photoeffekt wurde erstmals 1839
Züchtung von Volumenkristallen aus Halbleitern großer Bandlücke aus der Gasphase am Beispiel AlN
 Züchtung von Volumenkristallen aus Halbleitern großer Bandlücke aus der Gasphase am Beispiel AlN Matthias Bickermann und Institut für Chemie der Technischen Universität Berlin Vortrag im Materialforum
Züchtung von Volumenkristallen aus Halbleitern großer Bandlücke aus der Gasphase am Beispiel AlN Matthias Bickermann und Institut für Chemie der Technischen Universität Berlin Vortrag im Materialforum
Club Apollo 13, 14. Wettbewerb Aufgabe 1.
 Club Apollo 13, 14. Wettbewerb Aufgabe 1. (1) a) Grundlagenteil: Basteln und Experimentieren Wir haben den Versuchsaufbau entsprechend der Versuchsanleitung aufgebaut. Den Aufbau sowie die Phase des Bauens
Club Apollo 13, 14. Wettbewerb Aufgabe 1. (1) a) Grundlagenteil: Basteln und Experimentieren Wir haben den Versuchsaufbau entsprechend der Versuchsanleitung aufgebaut. Den Aufbau sowie die Phase des Bauens
LED -Licht. Technik, Vor- und Nachteile, Marktangebot. Autor: Dipl. Phys. Klaus Wandel
 LED -Licht Technik, Vor- und Nachteile, Marktangebot Autor: Dipl. Phys. Klaus Wandel 1 LED Grundlagen und Technik (1) LED Licht emittierende Diode (engl. light-emitting diode) besteht aus Halbleiter- Materialien
LED -Licht Technik, Vor- und Nachteile, Marktangebot Autor: Dipl. Phys. Klaus Wandel 1 LED Grundlagen und Technik (1) LED Licht emittierende Diode (engl. light-emitting diode) besteht aus Halbleiter- Materialien
Frank-Hertz-Versuch. Praktikumsversuch am Gruppe: 18. Thomas Himmelbauer Daniel Weiss
 Frank-Hertz-Versuch Praktikumsversuch am 13.04.2011 Gruppe: 18 Thomas Himmelbauer Daniel Weiss Abgegeben am: 04.04.2011 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Versuchsaufbau 2 3 Vorbemerkungen 2 3.1 Vermutlicher
Frank-Hertz-Versuch Praktikumsversuch am 13.04.2011 Gruppe: 18 Thomas Himmelbauer Daniel Weiss Abgegeben am: 04.04.2011 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Versuchsaufbau 2 3 Vorbemerkungen 2 3.1 Vermutlicher
Die chemische Bindung
 Die chemische Bindung Die Valenz-Bond Theorie Molekülorbitale Die Bänder Theorie der Festkörper bei einer ionischen Bindung bildet bildet sich ein Dipol aus ('Übertragung von Elektronen') Eine kovalente
Die chemische Bindung Die Valenz-Bond Theorie Molekülorbitale Die Bänder Theorie der Festkörper bei einer ionischen Bindung bildet bildet sich ein Dipol aus ('Übertragung von Elektronen') Eine kovalente
5 Elektronengas-Modell und Polyene
 5.1 Übersicht und Lernziele Übersicht Im vorherigen Kapitel haben Sie gelernt, das Elektronengas-Modell am Beispiel der Cyanin-Farbstoffe anzuwenden. Sie konnten überprüfen, dass die Berechnungen für die
5.1 Übersicht und Lernziele Übersicht Im vorherigen Kapitel haben Sie gelernt, das Elektronengas-Modell am Beispiel der Cyanin-Farbstoffe anzuwenden. Sie konnten überprüfen, dass die Berechnungen für die
Ein Beitrag zu Dünnschichtsolarzellen auf der Basis von Cu(In, Ga)Se 2
 1. Seminarvortrag Graduiertenkolleg 1 Seminarvortrag Graduiertenkolleg Neue Hochleistungswerkstoffe für effiziente Energienutzung Ein Beitrag zu Dünnschichtsolarzellen auf der Basis von Cu(In, Ga)Se 2
1. Seminarvortrag Graduiertenkolleg 1 Seminarvortrag Graduiertenkolleg Neue Hochleistungswerkstoffe für effiziente Energienutzung Ein Beitrag zu Dünnschichtsolarzellen auf der Basis von Cu(In, Ga)Se 2
dp E [W m -2 ] da 1 von 9
![dp E [W m -2 ] da 1 von 9 dp E [W m -2 ] da 1 von 9](/thumbs/76/73794510.jpg) 1 von 9 ANHANG B zur Verordnung optische Strahlung Kohärente optische Strahlung (LASER) Definitionen, Expositionsgrenzwerte, Ermittlung und Beurteilung nach Klassen für Laser Definitionen Kohärente Strahlung
1 von 9 ANHANG B zur Verordnung optische Strahlung Kohärente optische Strahlung (LASER) Definitionen, Expositionsgrenzwerte, Ermittlung und Beurteilung nach Klassen für Laser Definitionen Kohärente Strahlung
Farb- und Mehrkanalsensoren in erweiterter CMOS-Technologie
 Farb- und Mehrkanalsensoren in erweiterter CMOS-Technologie Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS Am Wolfsmantel 33, 91058 Erlangen Stephan Junger, Nanko Verwaal, Wladimir Tschekalinskij,
Farb- und Mehrkanalsensoren in erweiterter CMOS-Technologie Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS Am Wolfsmantel 33, 91058 Erlangen Stephan Junger, Nanko Verwaal, Wladimir Tschekalinskij,
