Skript Produktentstehung WS 2000/2001 Prof. Dr. Broßmann. Einordnung und Ziel der Vorlesung, Vorlesungsumfang sowie Vorlesungsaufbau
|
|
|
- Maja Graf
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 1.Einführung Einordnung und Ziel der Vorlesung, Vorlesungsumfang sowie Vorlesungsaufbau 2. Vorgehen bei Produktentstehung 2.1 Kreativitätstechniken Kreativitätstechniken allgemein K-Methoden eignen sich: -Ideenbildung -Zerlegung eines Problems in Teilfunktionen Zwei K-Methoden: -intuitiv (drei verschiedene Methoden) -systematisch (Morphol. Matrix) Klassische intuitive K-Methoden 1) Brainstorming 6-10 Teilnehmer arbeiten ca. 30 min zusammen Vorbereitung: Regeln: Ergebnis: - Moderator bestimmen (Schreiber) - kein großer hierarchischer Unterschied der Teilnehmer - breit gestreutes Fachwissen - zwanglose Atmosphäre schaffen - Kritik verboten - Ideen anderer aufnehmen, weiterentwickeln - Ideen aufschreiben viele ungeprüfte Lösungsvorschläge 2) Brainwriting, Methode Teilnehmer, 3 Lösungsvorschläge in 5 min Vorbereitung: -genaue Definition und Analyse des Problems Arbeitsblatt in Form einer Matrix erstellen Lv P1 P2 P x x x Seite 1 von 29
2 Regeln: Ergebnis: - für Ruhe im Raum sorgen - gut lesbar schreiben - Ideen anderer aufnehmen, weiterentwickeln 108 ungeprüfte Lösungen 3) Synektik (z.b. Bionik) Durch Analogien Abstand zum Problem schaffen. Max. 10 Teilnehmer der unterschiedlichen Fachrichtungen arbeiten mehrere Stunden zusammen. Vorbereitung: Regeln: Ergebnis: keine Analogien z.b. in der Natur suchen (z.b. Delphin -> Strömungstechnik, Baum -> Kerbwirkung) 1 guter Lösungsvorschlag 2.2 Arbeitsschritte nach VDI 2222 Hierarchie Planen Konzipieren siehe Umdruck 3 Prüfung! Entwerfen Ausarbeiten 2.3 Vorgehensweise an einem Beispiel (Umdrucke 4-7) Pflichtenheft: Aufgabenstellung muss umfassend und vollständig geklärt werden Fragestellung: - Welchen Zweck muss Produkt erfüllen? - Welche Eigenschaften muss Produkt haben? - Welche Forderungen muss Produkt erfüllen? - Welche Eigenschaften darf Produkt nicht erfüllen? - Welche Wünsche soll Produkt erfüllen? - Welches Kostenziel ist vorgesehen? - Welche Normen müssen erfüllt werden? Seite 2 von 29
3 Konzipieren: Tannenbaumstruktur Gesamtfunktion Teilfunktion 1 Teilfunktion 2 Teilfunktion 3 Lösungsprinzip 1 LP2 LP3 LP1 LP2 LP3 LP1 LP2 LP3 Prinzipkombination 1 PK2 PK3 aussichtsreichste PK muss ausgewählt werden (Wertanalyse) Finden von Lösungsprinzipien (Morphologische Matrix) Lösungsprinzipien Teilfunktionen TF1 Gehäuse verbinden LP1 LP2 LP3 verschrauben verkleben Schnappverschluss (stecken) TF2??? Prüfung TF3??? TF4??? Lösungsprinzipien in MM skizzieren und/oder verbalisieren Variation der Lösungsprinzipien Seite 3 von 29
4 3. Normung 3.1 Normung allgemein Durch Normen werden einheitliche Abmessungen, Größenstufungen, Qualitäten und Vorschriften festgelegt. Vorteile der Normung: - verringert Typenzahl - erleichtert Lagerhaltung - verbilligt Herstellung - hebt Güte - erhöht Sicherheit international: ISO national: DIN nationale Richtlinien: VDE, VDI 3.2 Normzahlen, Normmaße, Baureihen Die Stufung von Größen (Längen, Flächen, Spannungen...) erfolgt durch geometrische Reihe Normzahlen oder Normmaße a*q 0 ; a*q 1 ; a*q 2 ;...; a*q n Die Stufung entsteht, indem man die Zwischenbereiche der Zehnerpotenzen (1, 10, ) konstant aufteilt. Der Stufensprung heißt q. Für beliebige Stufen erhält man q n = n 10 n = Anzahl der Aufteilungsintervalle n + 1 = Anzahl der Typen 1 I? I? I? I? I 10 genormte Aufteilungsintervalle: n = 5, 10, 20, 40 Grundreihen R5, R10, R20, R40 In der E-technik wird die internationale E-Reihe festgelegt: n = 6, 12, 24, 48 Seite 4 von 29
5 3.3 Normprofile, Normteile Profile: T-Profil: Doppel-T-Profil: I Winkel-Profil: U-Profil: Normteile: siehe Vorlesung Einteilung von Verbindungen von Produktkomponenten Verbindung lösbar bedingt lösbar unlösbar mittelbar unmittelbar stoffschlüssig formschlüssig kraftschlüssig 4. Produktkomponenten stoffschlüssig verbinden 4.1 Schweißverbindung (Diffusion) In E-Technik Pressschweißen (Druck + Erwärmung) unmittelbar, unlösbar, stoffschlüssiges Verfahren FKT: - Kräfte und Momente übertragen - Lagesicherung (drehfest, axialfest) ermöglichen Vorteile: Kleine Bauteilmassen, kurze Herstellzeit, hohe Festigkeit, große zulässige Betriebstemperaturen Nachteile: hohe innere Spannungen ( Risse, Deformation, Verwerfungen) Seite 5 von 29
6 Schweißverfahren: - Punktschweißen: Herstellung von einzelnen Verbindungsstellen, Blechdicke 0,02-6mm, es entstehen q Krater und Narben, Einzel- und Massenfertigung - Buckelschweißen: Bleche mit Buckel versehen, großflächige Elektroden pressen Bleche zusammen, Vorverformung wird eingeebnet, Massenfertigung - Nahtschweißen: Durchgehende Nähte, Blechdicke bis 3mm, Serienfertigung - Stumpfschweißen: siehe Umdruck 9 - Kondensatorimpulsschweißen: Genaue Dosierung der Schweißenergie, geeignet für kleine Teile aus schwer schweißbarem Material -Induktionspressschweißen: Hochfrequenzinduktionsspule erzeugt Schweißtemperatur, alle Metalle und Legierungen sowie Glas- und Kunststoffschweißung - Ultraschallschweißen: Hochfrequente mechanische Schwingungen erzeugen Reibungswärme, Verbindung unterschiedlicher Metalle - Elektronenstrahlschweißen: Schmelzschweißverfahren, Hochvakuum, Elektronenstrahldurchmesser max. 0,2mm, kleine Schmelzzone, schweißempfindliche Werkstoffe können geschweißt werden (z.b. Wolfram, Tantal, Beryllium, Titan) Gestaltung: siehe Umdruck 9, 10 Berechnung: keine Berechnung nötig! 4.2 Lötverbindung Diffusion + Adhäsion Weichlöten: < 450 C, Lote: Zinn, Blei, Antimon,... Hartlöten: > 450ºC, Lote: Zink, Kupfer mittelbar, unlösbar bis bedingt lösbar, stoffschlüssige Verbindung FKT: - Kräfte und Momente übertragen - Lagesicherung ermöglichen - Bauteile elektrisch verbinden Vorteile: niedrige Arbeitstemperatur, keine Wärmespannungen Nachteile: geringere Festigkeit, geringere Betriebstemperaturen, höhere Kosten Lötverfahren: siehe Umdruck 10 Seite 6 von 29
7 Gestaltung: siehe Umdruck 11 Berechnung: Lötverbindungen sollen nur auf Abscherung beansprucht werden 4.3 Klebverbindung Adhäsion, nach Vorbehandlung (Reinigen, Aufrauhen) Synthetische Kleber: - Polyuhrethan: Geeignet für feste, chem. resistente Verbindung - Epoxydharz: Metallklebungen, Aushärtung kalt oder warm - Phenolharz: Zugabe von Härter, kalt- und warmaushärtend mittelbare, unlösbare, stoffschlüssige Verbindung FKT: - Kräfte und Momente übertragen - Lagesicherung ermöglichen Vorteile: Verminderte Bauteilgewichte, keine Erwärmung, Verbundkonstruktionen möglich zwischen metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen Nachteile: Festigkeitseinbußen durch Altern (Verspröden), geringe Temperaturschwankung Gestaltung: ähnlich Löten Übung: Zwei Bleche der Dicke s = 1,5mm, Breite b = 100mm sollen mit Zinklot gelötet werden. a) Wie groß darf die Kraft F auf Abscheren sein? b) Kann die gleiche Belastung auch durch Kleben mit warm härtendem Epoxydharz erreicht werden? a) Löten: F löt = b * l Ü * τ α / s F b = 100mm l Ü = * s = 5 * s = 7,5mm τ Bl = 120N/mm 2 Zinklot Seite 7 von 29
8 s F = = 3 Sicherheitsfaktor F Löt = 30000N b) Kleben: F = A * τ BK / s F F = (100mm * 18,75mm * 27,5N/mm 2 ) / 3 = 17187,5 N 4.4 Einschmelzen siehe Umdruck Einkitten Verbindung durch Adhäsion mittelbare, unlösbare, stoffschlüssige Verbindung Vorteile: Teile können große Herstelltoleranzen aufweisen; günstig bei Verbindungen von Metall und Glas (Keramik) Nachteil: Kitt schwindet und altert 5. Produktkomponenten formschlüssig verbinden 5.1 Nietverbinden Nieten dient zum Verbinden von Blechen. Heute verdrängt durch Schweißen, Löten, Kleben. mittelbar/unmittelbar, unlösbar, formschlüssig FKT: - Kräfte übertragen - Lagesicherung ermöglichen Gestaltung: siehe Umdruck 13, 14 Berechnung: siehe Umdruck 14 Bezeichnung: Halbrundniet DIN660-3x20- AlMg3F23 Formnorm Stoffnorm 3: Durchmesser, 20: Länge Seite 8 von 29
9 5.2 Stift- und Bolzenverbindung Zylinderstifte mit größerem Durchmesser werden Bolzen genannt mittelbar, bedingt lösbar, formschlüssig FKT: - Kräfte und Momente übertagen - Lagesicherung ermöglichen (drehfest, axialfest) - Bauteile gelenkig verbinden Stift- und Bolzenarten: siehe Umdruck 14 Gestaltung: siehe Umdruck 15 Bezeichnung: Bolzen DIN h11x100- St50 10: Durchmesser, h: Passung, 100: Länge Bolzenverbindung: Gabelgelenk mit Bolzen Berechnung: M = D * A * R eh / 2 Die auf Seite 15 oben links skizzierte Querstiftverbindung soll berechnet werden. Wellendurchmesser D = 20mm, Zylinderstift DIN7-5m6x40-St50 R effst50 = 290N/mm 2 (siehe Umdruck Mechanik) Moment = 26572Nmm Wie groß ist das übertragbare Moment bei schwellender Beanspruchung (= Belastungsfall II) M = (20mm * 2π*5 2 /4 * 290N/mm 2 * 0,7) / (2 * 3) = 26572Nmm 5.3 Passfederverbindung Prüfung! Welle - Nabe - Verbindung mittelbar, lösbar, formschlüssig FKT: - (Dreh-)Momente übertragen - Lagesicherung drehfest ermöglichen Seite 9 von 29
10 Gestaltung: siehe Umdruck 16 Bezeichnung: Passfeder DIN x8x60- ST60 10: Breite, 8: Höhe, 60: Länge 5.4 Spreizverbindung Verbindung, die durch federnde Verformung der Produktkomponenten entsteht Mittelbare, lösbare, formschlüssige Verbindung FKT: - Kräfte (axial) übertragen - Lagesicherung (axial) ermöglichen Gestaltung: siehe Umdruck 16 Zäher, federnder Werkstoff 5.5 Verbinden durch Bördeln, Sicken, Lappen und Schränken Bördeln: Verbinden von röhrenförmigen Außenteilen mit scheibenförmigen Innenteilen Sicken: Rohrverbindung durch plastisches Eindrücken einer Ringnut mit Sicken Lappen: Verbindung durch Ineinanderstecken von Gehäusehälften Schränken: siehe Lappen 5.6 Einbetten Verbindung von Metallkomponenten (Wellen) mit Kunststoff-Komponenten (Zahnräder) Unmittelbare, unlösbare, formschlüssige Verbindung FKT: - Kräfte und Momente übertragen - Lagesicherung ermöglichen Seite 10 von 29
11 6. Produktkomponenten kraftschlüssig verbinden 6.1 Pressverbindung Verbindung beruht auf Reibung zwischen Komponenten a) Einpressen: Übermaß der Bauteile zueinander b) Verpressen: nachträgliches Verformen der Bohrung 6.2 Schraubverbindung Häufigste Verbindungsart mit Gewinde abgewinkelte schiefe Ebene α u p α: Steigungswinkel p: Gewindesteigung = 2*π*r * tan α u: Gewindeumfang mittelbare, lösbare, kraftschlüssige Verbindung FKT: - Kräfte und Momente übertragen - Bewegungen wandeln (Rotation in Translation) a) Befestigungsschraube - Soll sich unter Längskraft nicht lösen selbsthemmend Spitzgewinde kleine Steigung bzw. kleiner Steigungswinkel Flankenwinkel 60º Seite 11 von 29
12 - Genormt metrische ISO-Gewinde DIN13/14: Flankenwinkel 60º Steigungswinkel 3,5º Bezeichnung M3 M: metrisch, 3: Nenndurchmesser - Genormtes metrisches Feingewinde kleinere Steigung erhöhte Sicherheit gegen Lösen Feinste Längenmessung möglich (Mikrometerschraube) Bezeichnung M3x0,35 M: metrisch, 3: Nenndurchmesser, 0,35: p - Sonderformen Rundgewinde: Elektrogewinde (DIN40400) für Lampensockel (Fassungen), Nenndurchmesser 27mm Ein Gewinde zentriert nicht! zentriert: relative Lage zweier Komponenten darf sich nach Demontage und Wiedermontage nicht ändern. b) Bewegungsschrauben - Soll sich unter Längskraft bewegen nicht selbsthemmend Trapezgewinde große Steigung (großer Steigungswinkel) Flankenwinkel klein (30º) Bezeichnung: Trapezgewinde DIN 103,22x5 22: Nenndurchmesser, 5: p Festigkeitsklasse: Seite 12 von 29
13 z. B : R m = 8 * 100N/mm 2 ; Zugfestigkeit 8: R p0,2 = 8 * 8 * 10 = 640N/mm 2 ; Fließgrenze Gestaltung: siehe Umdruck 19 Muttern: siehe Umdruck 19 Prüfung: 3 Schraubensicherungen Federscheibe etc.! Siehe Umdruck 20! Gestaltungsübung: Durchsteckschraube soll Blech in einem dickwandigen Gehäuse mit Gewinde befestigen! (Sackloch) + Schraubensicherung Berechnung: a) 2 Stahlbleche (Blechdicke s = 5mm) werden mit drei Durchsteckschrauben DIN verschraubt (jede Schraube trägt gleich viel) Welche Schraubengröße ist vorzusehen bei F g = 180N µ St/St = 0,1; R m = 400N/mm 2 A s = F L / (0,3 * R m * 3) = F q / (µ * 0,3 * R m * 3) = 5mm 2 ablesen in Tabelle: A s = 5,03mm 2 M3 b) Wie groß darf die max. Längskraft F L werden? F L = F q / (µ * 3) = 603N Seite 13 von 29
14 7. Leitende Produktkomponenten stoff- oder kraftschlüssig verbinden 7.1 Lötverbindung siehe Kapitel Mechanische Verbindungen mittelbare, lösbare, kraftschlüssige Verbindung FKT: - Energie oder Information leiten/übertragen - Kontakte sicher und verlustfrei verbinden Verfahren: - Quetsch- oder Crimpverbindung - Klemmverbindung Schraubklemmverbindung Federklemmverbindung Klemmhülsen - Steckverbindung - Wickelverfahren (wire wrap) 8. Produktkomponenten elastisch (federnd) verbinden Elastische Eigenschaften eines Werkstoffs werden ausgenutzt. Anwendungen: - Speicherelement (Energiespeicher, Uhrfeder) - Messelemente (federnde Zeiger Drehspulmessgerät) - Schwingungselemente (Frequenzmesser) - Ruheelement (federnde Haltekontakte) - Lagerelement (Mikroskoptische) Mittelbare, lösbare, kraftschlüssige Verbindung. FKT: - Energie speichern - Kontakte verbinden - Beweglichkeit ermöglichen Seite 14 von 29
15 8.1 Metallische Federn σ b : - Gerade Biegefeder: Blattfeder mit rechteckigem oder rundem Querschnitt - Gekrümmte Biegefeder: Platzsparend, Klemmfeder für leicht lösbare Verbindungen (Sicherungen) - Spiralfeder: Abgewinkelte Federlänge l = n*π*(r 1 +r 2 ) n: Windungszahl - Drehfeder: Abgewinkelte Federlänge l = n*π)*d + a + r Τ t : - Gerade Torsionsfeder: Torsionsband mit rechteckigem oder rundem Querschnitt - Gewundene Torsionsfeder = Schraubenfeder Belastung = Zug / Druck Beanspruchung = Torsion! Prüfung - Tellerfedern: Geringer Federweg, durch Kombination alle Federkennlinien realisierbar, geringe Einbauhöhe Metallische Federn haben lineare Federkennlinien! (Hook sches Gesetz) 8.2 Nichtmetallische Federn Gummifedern haben keine linearen Federkennlinien Hook gilt nicht kein E-Modul Der Modul bei Gummifedern hängt von der Härte ab Shorehärte Seite 15 von 29
16 8.3 Federkennlinien und Federschaltungen -Federkraft-Federweg-Diagramm = Kennlinie - Federschaltung: Reihenschaltung: Parallelschaltung: F = F 1 = F 2 F = F 1 + F 2 Voraussetzung: Jochbewegung parallel s gesamt = s 1 + s 2 s ges = s 1 + s 2 1/D ges = 1/D 1 + 1/D 2 D ges = D 1 + D 2 Weichere Feder Härtere Feder Seite 16 von 29
17 Beispiel: Gesucht: Federberechnung: Die im Umdruck dargestellte schwellend belastende Drehfeder (n = 4,5, D = 8mm, a = r = 15mm, d = 2mm) a) Die Federkonstante b) Die Federkraft F, wenn der Drehwinkel ϕ 12,5 betragen soll c) Der Festigkeitsnachweis, wenn die Drehfeder aus kaltgezogenen Federstahl aus R m = 1600N/mm 2 besteht a) c = (π*d 4 * E st ) / (64 * l) abgewickelte Länge l = R * n * D + a + r = 143,1mm c = 1152,6Nmm b) Federkraft bei ϕ = 12,5 ϕ (Bogen) = (F * r) / c F = (ϕ (Bogen) * c) / r c) Festigkeitsnachweis ϕ (Bogen) <= (2 * l * σ Bzul ) / (E st * d *K b ) ϕ (Bogen) <= 0,222 12,5 ϕ (Bogen) = 0,218 σ Bzul : schwellend! = II (0,75 * R m ) / S D K b : (Diagramm) D/d = 8mm / 2mm = 4 R m = 1600 N/mm 2, S D = = 3 σ Bzul = 400 N/mm 2 9. Mit Produktkomponenten Momente und Querkräfte übertragen (Achsen und Wellen) 9.1 Achsen Achsen werden nicht angetrieben. Achsen stehen im Allgemeinen still (Vorderachse beim Fahrrad). Ausnahmen möglich Radachse bei Eisenbahnwaggon. Achsen haben kleine Längen und große Durchmesser, d. h. l ~ d Achsen werden durch Querkräfte (Schubspannungen) beansprucht, weniger durch Biegemomente (Biegespannungen). Torsionsspannungen treten nicht auf. Gestaltung: siehe Umdruck 28 Seite 17 von 29
18 9.2 Wellen Wellen werden angetrieben. Wellen laufen immer um. Wellen haben eine viel größere Bauteillänge als Bauteildurchmesser, d. h. l >> d. Wellen werden durch Biegemomente (Biegespannungen) und durch Torsionsmomente (Torsionsspannungen) beansprucht, weniger durch Querkräfte (Schubspannungen). Gestaltung: siehe Umdruck 29. abhängig von Belastung und Funktion Rotierende Körper müssen leicht montierbar sein. Anschläge durch Absätze, Sicherungsringe oder Stellschrauben realisieren.! Skizze! Passungssitze nur so lang wie erforderlich! Schroffe und scharfkantige Querschnittsübergänge vermeiden (Kerbwirkung). Kerben möglichst nicht im gefährdeten Querschnitt. Bei Welle-Nabe-Verbindung 15-30% größeren Durchmesser wählen. Kleinere rotierende Körper fliegend und größere nur zwischen Lagerstellung lagern. (fliegend: auch außerhalb der Lagerstellen) Gestaltungsübung: Gesucht: Eine Seilrolle für das Skalenseil eines elektronischen Gerätes ist im Abstand a = 20mm an einem Halteblech (2) der Wandstärke 2mm zu befestigen Jeweils 2 Lösungen für die Befestigung am Blech und für die Halterung der Seilrolle Welle-Nabe-Verbindung Stifte, Passfeder, Einbetten, Pressen, Schrauben, (Löt- Klebverbindung) Wellendichtungen Bei Gleitlagerungen: a) schleifende Dichtungen: (Reibungsverluste) - Filzringdichtung - Rundringe (Gummi) Seite 18 von 29
19 b) berührungsfreie Dichtungen: - Spaltdichtung - Spaltdichtung mit Ölrückführung (nur für eine Drehrichtung) - Labyrinthdichtung (Montage!, Kosten) - Fliehkraftdichtungen Bei Wälzlagerungen: a) schleifende Dichtungen - Nilosringe - Filzringe - Stoffbuchsen (nachstellbar) - Radialdichtringe (Simmerringe) b) berührungsfreie Dichtungen - Spaltdichtung 10. Produktkomponenten lagern 10.1 Hydrodynamische bzw. hydrostatische Gleitlagerung Problem: Reibung Festkörperreibung Mischreibung Flüssigkeitsreibung Hydrodynamisches Lager: Schmierfilm wird selbsttätig über Keilreibung erzeugt. Festkörperreibung Mischreibung Flüssigkeitsreibung großer Verschleiß und Reibung Seite 19 von 29
20 - Stiebeckdiagramm Hydrostatische Lager: Ölfilm in Ruhelage über Pumpen aufgebaut Lagerbuchsen und Lagerzapfen Werkstoffpaarung: Welle hart Buchse weich (Verschleiß) Gestaltung: siehe Umdruck 30, 31 Berechnungsbeispiel: Die Lagerkraft für einen Lagerzapfen aus Stahl (R eh = 300 N/mm 2 ) beträgt F = 1000N a) Wie groß ist der Mindestdurchmesser d min d min = (32 * F * a) / (π * σ Bzul ) 1/3 a b/2 in Feinwerktechnik b/d 1, b d, a d / 2 d min 2 = (32 * F * d) / (π * σ Bzul ) d = ( (32 * F) / (2π * σ Bzul ) ) 1/2 σ Bzul = 1,4 * R eh / s F s F = z. B. s F = 3 σ Bzul = 140 N/mm 2 d = 6,03mm gewählt d = 6,5mm Seite 20 von 29
21 b) Welchen Lagerbuchsenwerkstoff wählen Sie? ρ Zul = F / (b * d) = 1000N / 6,5 2 mm 2 = 23,7N/mm Wälzlager Nur Rollreibungsverluste Vorteile: Geringere Reibung und geringere Erwärmung, Übertragung von Radial- und Axialkräften gleichzeitig, kurze axiale Baulänge, (Normteile), geringe Wartung und geringer Schmierverbrauch Nachteile: Größerer Bohrungsdurchmesser im Gehäuse, geräuschvoller Lauf, stoßempfindlich (bei Lagerungen die lange stehen nie Wälzlager), hoher Preis Aufbau von Wälzlagern - Innenring (sitzt auf Welle) - Wälzlager (Kugel, Zylinderrolle, Nadeln, Kegelrollen) - Käfig (hält Wälzkörper auf Abstand) - Außenring (sitzt auf Gehäuse) Wälzlagereinbau Wegen Wärmedehnungen, Einbau und Herstelltoleranzen müssen Einbauregeln beachtet werden. Seite 21 von 29
22 a) Fest-Los-Lagerung (1 Lager fest auf Welle und im Gehäuse, 2. Lager nur fest auf Welle oder im Gehäuse) unabhängig von Wärmedehnung b) Angestellte Lagerung: abhängig von Wärmedehnung der Welle bzw. Gehäuse X-Anstellung: Gehäusedehnung größer als Wellendehnung O-Anstellung: Wellendehnung größer als Gehäusedehnung c) Schwimmende Lagerung - unabhängig von Wärmedehnung - nicht genau definiert - billige Lösung Gestaltung: Rote Kreuze müssen durch konstruktive Maßnahmen ersetzt werden. Innenring und Welle: - Wellenmutter - Scheibe und Schraube - Spreizelement - Wellenabsätze Seite 22 von 29
23 - Naben bzw. Büchsen Außenring und Gehäuse: - Gehäusedeckel - Gehäusemutter - Gehäuseabsätze - Spreizelemente Seite 23 von 29
24 10.3 Sonderlager Steinlager, Spitzenlager, Schneidenlager (Pendelbewegung), Federlager, Luftlager Siehe Umdruck 35, Produktkomponenten führen (bewegen) Translationsbewegung 11.1 Gleitführungen Sie bestehen aus Führungsbahn und geführtem Teil Beide werden formschlüssig verbunden geschlossene Führungen kraftschlüssig verbunden offene Führungen Funktion: Produktkomponenten geradlinig führen Gestaltung: siehe Umdruck Wälzführungen Wälzkörper befinden sich zwischen geführtem Teil und Führungsbahn Funktion: Produktkomponenten reibungsarm führen (translatorisch) Gestaltung: siehe Umdruck 37 Wälzkörperführung: Wälzkörper bewegen sich mit Problem: Führungsbahnlänge l und Führungsweg s Rollenführung: Wälzkörper ortsfeste Rollen L und s unabhängig 11.3 Federführungen geringe Translationswege 12. Rotierende Produktkomponenten drehfest verbinden (Welle-Welle-Verbindung = Kupplung) Seite 24 von 29
25 12.1 Feste (starre) Kupplung Wellenenden dürfen keine Abweichungen aufweisen! Funktion: Wellen starr verbinden Drehmoment von Welle zu Welle übertragen 12.2 Ausgleichskupplungen Lageabweichungen werden ausgeglichen Seite 25 von 29
26 Gestaltungsübungen: Seite 26 von 29
27 Seite 27 von 29
28 Inhaltsverzeichnis: 1.Einführung Vorgehen bei Produktentstehung Kreativitätstechniken Arbeitsschritte nach VDI Normung Normung allgemein Normzahlen, Normmaße, Baureihen Normprofile, Normteile Produktkomponenten stoffschlüssig verbinden Schweißverbindung (Diffusion) Lötverbindung Klebverbindung Einschmelzen Einkitten Produktkomponenten formschlüssig verbinden Nietverbinden Stift- und Bolzenverbindung Passfederverbindung Spreizverbindung Verbinden durch Bördeln, Sicken, Lappen und Schränken Einbetten Produktkomponenten kraftschlüssig verbinden Pressverbindung Schraubverbindung Leitende Produktkomponenten stoff- oder kraftschlüssig verbinden Lötverbindung Mechanische Verbindungen Produktkomponenten elastisch (federnd) verbinden Metallische Federn Nichtmetallische Federn Federkennlinien und Federschaltungen Mit Produktkomponenten Momente und Querkräfte übertragen Achsen Wellen Welle-Nabe-Verbindung Wellendichtungen Produktkomponenten lagern Hydrodynamische bzw. hydrostatische Gleitlagerung Lagerbuchsen und Lagerzapfen Wälzlager Aufbau von Wälzlagern Wälzlagereinbau Sonderlager Siehe Umdruck 35, Produktkomponenten führen (bewegen) Gleitführungen Wälzführungen Federführungen Rotierende Produktkomponenten drehfest verbinden...24 Seite 28 von 29
29 12.1 Feste (starre) Kupplung Ausgleichskupplungen...25 Gestaltungsübungen:...26 Seite 29 von 29
Grundlagen der Konstruktion
 Grundlagen der Konstruktion Elektronik Elektrotechnik Feinwerktechnik Herausgegeben von Werner Krause 7., stark bearbeitete Auflage mit 348 Bildern und 67 Tabellen Carl Hanser Verlag München Wien Inhaltsverzeichnis
Grundlagen der Konstruktion Elektronik Elektrotechnik Feinwerktechnik Herausgegeben von Werner Krause 7., stark bearbeitete Auflage mit 348 Bildern und 67 Tabellen Carl Hanser Verlag München Wien Inhaltsverzeichnis
tgt HP 1982/83-2: Getriebewelle
 tgt HP 198/83-: Getriebewelle Die Getriebewelle wird über das Zahnrad 3 mit einem Drehmoment M d 70 Nm angetrieben; über das Zahnrad werden 70% dieses Drehmoments abgeleitet. Die Welle ist in den Lagern
tgt HP 198/83-: Getriebewelle Die Getriebewelle wird über das Zahnrad 3 mit einem Drehmoment M d 70 Nm angetrieben; über das Zahnrad werden 70% dieses Drehmoments abgeleitet. Die Welle ist in den Lagern
Inhaltsverzeichnis. 1 Grundlagen... 1
 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen................................ 1 1.1 Definition der Maschinenelemente................. 1 1.2 Konstruieren............................. 1 1.2.1 Definition des Begriffs Konstruieren.............
Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen................................ 1 1.1 Definition der Maschinenelemente................. 1 1.2 Konstruieren............................. 1 1.2.1 Definition des Begriffs Konstruieren.............
Vorlesung Stift- und Bolzenverbindungen
 Vorlesung Stift- und Bolzenverbindungen Übersicht Ausführungen und Anwendung Sicherungselemente Tragfähigkeit 1 Gliederung 1. Einführung 2. Stiftverbindungen 3. Bolzenverbindungen 4. Dimensionierung und
Vorlesung Stift- und Bolzenverbindungen Übersicht Ausführungen und Anwendung Sicherungselemente Tragfähigkeit 1 Gliederung 1. Einführung 2. Stiftverbindungen 3. Bolzenverbindungen 4. Dimensionierung und
Maschinenelemente. Horst Haberhauer Ferdinand Bodenstein. Gestaltung, Berechnung, Anwendung. Springer. 12., neu bearbeitete und ergänzte Auflage
 Horst Haberhauer Ferdinand Bodenstein Maschinenelemente Gestaltung, Berechnung, Anwendung 12., neu bearbeitete und ergänzte Auflage Mit 517 Abbildungen und 116 Tabellen Springer 1 Grundlagen 1 1.1 Definition
Horst Haberhauer Ferdinand Bodenstein Maschinenelemente Gestaltung, Berechnung, Anwendung 12., neu bearbeitete und ergänzte Auflage Mit 517 Abbildungen und 116 Tabellen Springer 1 Grundlagen 1 1.1 Definition
Inhaltsverzeichnis. 1 Grundlagen... 1
 1 Grundlagen................................ 1 1.1 Definition der Maschinenelemente................. 1 1.2 Konstruieren............................. 1 1.2.1 Definition des Begriffs Konstruieren.............
1 Grundlagen................................ 1 1.1 Definition der Maschinenelemente................. 1 1.2 Konstruieren............................. 1 1.2.1 Definition des Begriffs Konstruieren.............
Technisches Zeichnen. Susanna Labisch Christian Weber. Intensiv und effektiv lernen und üben. 2., überarbeitete Auflage
 Susanna Labisch Christian Weber Technisches Zeichnen Intensiv und effektiv lernen und üben 2., überarbeitete Auflage Mit 296 Abbildungen und 55 Tabellen Viewegs Fachbücher der Technik a Vieweg V1L Inhaltsverzeichnis
Susanna Labisch Christian Weber Technisches Zeichnen Intensiv und effektiv lernen und üben 2., überarbeitete Auflage Mit 296 Abbildungen und 55 Tabellen Viewegs Fachbücher der Technik a Vieweg V1L Inhaltsverzeichnis
Technisches Zeichnen
 Viewegs Fachbücher der Technik Technisches Zeichnen Intensiv und effektiv lernen und üben von Susanna Labisch, Christian Weber 1. Auflage Technisches Zeichnen Labisch / Weber schnell und portofrei erhältlich
Viewegs Fachbücher der Technik Technisches Zeichnen Intensiv und effektiv lernen und üben von Susanna Labisch, Christian Weber 1. Auflage Technisches Zeichnen Labisch / Weber schnell und portofrei erhältlich
Maschinenelemente 1. von Hubert Hinzen. Oldenbourg Verlag München Wien
 Maschinenelemente 1 von Hubert Hinzen Oldenbourg Verlag München Wien Inhalt 1 Grundlagen der Dimensionierung metallischer Bauteile 1 1.1 Das grundsätzliche Problem der Bauteildimensionierung 1 1.2 Quasistatische
Maschinenelemente 1 von Hubert Hinzen Oldenbourg Verlag München Wien Inhalt 1 Grundlagen der Dimensionierung metallischer Bauteile 1 1.1 Das grundsätzliche Problem der Bauteildimensionierung 1 1.2 Quasistatische
Grundlagen p. 1 Definition der Maschinenelemente p. 1 Konstruieren p. 1 Definition des Begriffs Konstruieren p. 1 Konstruktionsprozeß p.
 Grundlagen p. 1 Definition der Maschinenelemente p. 1 Konstruieren p. 1 Definition des Begriffs Konstruieren p. 1 Konstruktionsprozeß p. 2 Rechnerunterstütztes Konstruieren p. 5 Das Gestalten p. 6 Funktions-
Grundlagen p. 1 Definition der Maschinenelemente p. 1 Konstruieren p. 1 Definition des Begriffs Konstruieren p. 1 Konstruktionsprozeß p. 2 Rechnerunterstütztes Konstruieren p. 5 Das Gestalten p. 6 Funktions-
Horst Haberhauer Ferdinand Bodenstein+ Maschinenelemente. Gestaltung, Berechnung, Anwendung. 17., bearbeitete Auflage. 4 l Springer Vieweg
 Horst Haberhauer Ferdinand Bodenstein+ Maschinenelemente Gestaltung, Berechnung, Anwendung 17, bearbeitete Auflage 4 l Springer Vieweg Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen l 11 Definition der Maschinenelemente
Horst Haberhauer Ferdinand Bodenstein+ Maschinenelemente Gestaltung, Berechnung, Anwendung 17, bearbeitete Auflage 4 l Springer Vieweg Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen l 11 Definition der Maschinenelemente
:30 bis 11:00 Uhr (1,5 Stunden)
 Maschinenelemente FACHPRÜFUNG MASCHINENELEMENTE I 10.03.2006-9:30 bis 11:00 Uhr (1,5 Stunden) Bearbeiter: Matr.-Nr. : Umfang: Maschinenelemente I (78 Punkte) Σ = 78 Punkte Die Klausur ist bestanden, wenn
Maschinenelemente FACHPRÜFUNG MASCHINENELEMENTE I 10.03.2006-9:30 bis 11:00 Uhr (1,5 Stunden) Bearbeiter: Matr.-Nr. : Umfang: Maschinenelemente I (78 Punkte) Σ = 78 Punkte Die Klausur ist bestanden, wenn
5. Auflage Juni Berufsbildung. Modul Fügetechnik. Inhaltsverzeichnis Lösbare Verbindungen 7 Nicht lösbare Verbindungen 31. Art. Nr.
 5. Auflage Juni 2014 Modul Fügetechnik Art. Nr. 2407 Inhaltsverzeichnis Lösbare Verbindungen 7 Nicht lösbare Verbindungen 31 Fügetechnik Inhaltsverzeichnis Lösbare Verbindungen Einteilung...7 Schraubenverbindungen...9
5. Auflage Juni 2014 Modul Fügetechnik Art. Nr. 2407 Inhaltsverzeichnis Lösbare Verbindungen 7 Nicht lösbare Verbindungen 31 Fügetechnik Inhaltsverzeichnis Lösbare Verbindungen Einteilung...7 Schraubenverbindungen...9
Maschinenelemente 1. von Prof. Dr. Hubert Hinzen 3., überarbeitete Auflage. Oldenbourg Verlag München
 Maschinenelemente 1 von Prof. Dr. Hubert Hinzen 3., überarbeitete Auflage Oldenbourg Verlag München Inhalt Vorwort Einleitung Literatur XI XIII XVIII 0 Grundlagen der Festigkeitslehre 1 0.1 Normalspannung
Maschinenelemente 1 von Prof. Dr. Hubert Hinzen 3., überarbeitete Auflage Oldenbourg Verlag München Inhalt Vorwort Einleitung Literatur XI XIII XVIII 0 Grundlagen der Festigkeitslehre 1 0.1 Normalspannung
Kapitel 2 Normen, Toleranzen, Passungen und Oberflächen 49
 Inhaltsverzeichnis Zum Geleit 13 Kapitel 1 Maschinenelemente und Konstruktion 15 1.1 Einführung Formulierung der konstruktiven Aufgabe............... 16 1.2 Ausgewählte Beispiele technischer Systeme........................
Inhaltsverzeichnis Zum Geleit 13 Kapitel 1 Maschinenelemente und Konstruktion 15 1.1 Einführung Formulierung der konstruktiven Aufgabe............... 16 1.2 Ausgewählte Beispiele technischer Systeme........................
1 Schraubenberechnung
 1 Schraubenberechnung Eine Dehnschraubenverbindung (Taillenschraube!) wird mit einem einfachen Drehmomentschlüssel angezogen. Damit soll eine Vorspannkraft F V = 60 kn erreicht werden. Durch Schwankungen
1 Schraubenberechnung Eine Dehnschraubenverbindung (Taillenschraube!) wird mit einem einfachen Drehmomentschlüssel angezogen. Damit soll eine Vorspannkraft F V = 60 kn erreicht werden. Durch Schwankungen
Bewegliche Verbindung. Feste Verbindung. Kraftübertragung. Kraftschlüssig. Stoffschlüssig (Bild) Kraftschlüssig (Bild) Stoffschlüssig.
 Bewegliche Verbindung Lösbare Verbindung Unlösbare Verbindung Feste Verbindung Kraftübertragung Stoffschlüssig Formschlüssig Kraftschlüssig Elemente genau kennen heisst Stoffschlüssig Formschlüssig Kraftschlüssig
Bewegliche Verbindung Lösbare Verbindung Unlösbare Verbindung Feste Verbindung Kraftübertragung Stoffschlüssig Formschlüssig Kraftschlüssig Elemente genau kennen heisst Stoffschlüssig Formschlüssig Kraftschlüssig
Name. Vorname. Legi-Nr. Ermüdungsfestigkeit Welle-Nabe-Verbindung L/2
 Dimensionieren Prof. Dr. K. Wegener ame Vorname Legi-r. Zusatzübung 1: Passfederverbindung Voraussetzungen F F Flächenpressung zwischen Bauteilen M Last Ermüdungsfestigkeit Welle-abe-Verbindung F/ L/ F/
Dimensionieren Prof. Dr. K. Wegener ame Vorname Legi-r. Zusatzübung 1: Passfederverbindung Voraussetzungen F F Flächenpressung zwischen Bauteilen M Last Ermüdungsfestigkeit Welle-abe-Verbindung F/ L/ F/
KONSTRUKTIONSLEHRE Prof. Dr.-Ing. M. Reichle. Federn. DHBW-STUTTGART Studiengang Mechatronik. df ds. df ds
 Blatt. ederkennlinie Die ederkennlinie gibt die Abhängigkeit zwischen Belastung (Kraft, Moment) und Verformung (Weg, Winkel) an. Man unterscheidet drei grundsätzlich unterschiedliche Verhaltensweisen mit
Blatt. ederkennlinie Die ederkennlinie gibt die Abhängigkeit zwischen Belastung (Kraft, Moment) und Verformung (Weg, Winkel) an. Man unterscheidet drei grundsätzlich unterschiedliche Verhaltensweisen mit
Basiswissen Maschinenelemente
 Basiswissen Maschinenelemente von Prof. Dr. Hubert Hinzen Oldenbourg Verlag München Inhalt Vorwort Einleitung V XIII Literatur 15 0 Grundlagen der Festigkeitslehre 1 0.1 Normalspannung 2 0.1.1 Zug und
Basiswissen Maschinenelemente von Prof. Dr. Hubert Hinzen Oldenbourg Verlag München Inhalt Vorwort Einleitung V XIII Literatur 15 0 Grundlagen der Festigkeitslehre 1 0.1 Normalspannung 2 0.1.1 Zug und
Prof. Dr. G. Knauer Dipl.-Ing. W. Wieser
 Fachhochschule München Fachbereich 03 Maschinenbau Prof. Dr. G. Knauer Dipl.-Ing. W. Wieser Teil II: Berechnungen Die Skizze zeigt eine Seiltrommel. 1 Die Seiltrommel (2) wird über das Zahnrad (1) angetrieben.
Fachhochschule München Fachbereich 03 Maschinenbau Prof. Dr. G. Knauer Dipl.-Ing. W. Wieser Teil II: Berechnungen Die Skizze zeigt eine Seiltrommel. 1 Die Seiltrommel (2) wird über das Zahnrad (1) angetrieben.
Kapitel 1 Maschinenelemente und Konstruktion Einleitung 11. Kapitel 2 Normen, Toleranzen, Passungen und Oberflächen 15
 Kapitel 1 Maschinenelemente und Konstruktion Einleitung 11 Kapitel 2 Normen, Toleranzen, Passungen und Oberflächen 15 Kapitel 3 Grundlagen der Festigkeitslehre 29 3.1 Ermittlung von Lasten und Beanspruchungen......................
Kapitel 1 Maschinenelemente und Konstruktion Einleitung 11 Kapitel 2 Normen, Toleranzen, Passungen und Oberflächen 15 Kapitel 3 Grundlagen der Festigkeitslehre 29 3.1 Ermittlung von Lasten und Beanspruchungen......................
Vorlesung Maschinenelemente und Mechatronik II
 TUD-MB MM II Die neue Maschinenelemente- Lehre Prof. Dr.-Ing. H. Birkhofer Prof. Dr.-Ing. R. Nordmann Vorlesung Maschinenelemente und Mechatronik II GEBEOP.CDR Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. H. Birkhofer Produktentwicklung
TUD-MB MM II Die neue Maschinenelemente- Lehre Prof. Dr.-Ing. H. Birkhofer Prof. Dr.-Ing. R. Nordmann Vorlesung Maschinenelemente und Mechatronik II GEBEOP.CDR Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. H. Birkhofer Produktentwicklung
Für die folgenden Querschnitte sind jeweils die Sicherheiten gegen bleibende Verformung und Dauerbruch nach DIN 743 zu ermitteln.
 6 Achsen und Wellen 6.1 Typische Querschnitte Für die folgenden Querschnitte sind jeweils die Sicherheiten gegen bleibende Verformung und Dauerbruch nach DIN 743 zu ermitteln. 1. Wellenabsatz Abbildung
6 Achsen und Wellen 6.1 Typische Querschnitte Für die folgenden Querschnitte sind jeweils die Sicherheiten gegen bleibende Verformung und Dauerbruch nach DIN 743 zu ermitteln. 1. Wellenabsatz Abbildung
Inhaltsverzeichnis VII. 1 Einleitung Was ist das Technische Zeichnen? Wozu eine Normung? Zur Vorgehensweise...
 VII 1 Einleitung... 1 1.1 Was ist das Technische Zeichnen?... 1 1.2 Wozu eine Normung?... 2 1.3 Zur Vorgehensweise... 3 2 Erstellung einer Technischen Zeichnung... 4 2.1 Arbeitsmittel... 4 2.1.1 Zeichengeräte...
VII 1 Einleitung... 1 1.1 Was ist das Technische Zeichnen?... 1 1.2 Wozu eine Normung?... 2 1.3 Zur Vorgehensweise... 3 2 Erstellung einer Technischen Zeichnung... 4 2.1 Arbeitsmittel... 4 2.1.1 Zeichengeräte...
5 Festigkeitslehre. Inneres Kräftesystem und Beanspruchungsarten
 116 5 Festigkeitslehre Inneres Kräftesystem und Beanspruchungsarten 651 Ein Drehmeißel ist nach Skizze eingespannt und durch die Schnittkraft F s = 12 kn belastet. Die Abmessungen betragen l = 40 mm, b
116 5 Festigkeitslehre Inneres Kräftesystem und Beanspruchungsarten 651 Ein Drehmeißel ist nach Skizze eingespannt und durch die Schnittkraft F s = 12 kn belastet. Die Abmessungen betragen l = 40 mm, b
FÜGEN - Press- und Schnappverbindungen. für die Werkmeister-Schule. 2. Semester2015. vorgelegt von. Daniel Permoser
 FÜGEN - Press- und Schnappverbindungen für die Werkmeister-Schule 2. Semester2015 vorgelegt von Daniel Permoser am 24. Juni 2015 Erstprüfer/in: Zweitprüfer/in: Daniel Permoser MALAUN STEPHAN Kurzfassung
FÜGEN - Press- und Schnappverbindungen für die Werkmeister-Schule 2. Semester2015 vorgelegt von Daniel Permoser am 24. Juni 2015 Erstprüfer/in: Zweitprüfer/in: Daniel Permoser MALAUN STEPHAN Kurzfassung
Maschinen- und Konstruktionselemente 2
 W. Steinhilper R. Röper Maschinen- und Konstruktionselemente 2 Verbindungselemente Vierte Auflage Mit 190 Abbildungen Q«Springer Inhaltsverzeichnis 5 Verbindungselemente und -verfahren 1 5.1 Formschlüssige
W. Steinhilper R. Röper Maschinen- und Konstruktionselemente 2 Verbindungselemente Vierte Auflage Mit 190 Abbildungen Q«Springer Inhaltsverzeichnis 5 Verbindungselemente und -verfahren 1 5.1 Formschlüssige
Inhaltsverzeichnis VII. 1 Einleitung Was ist das Technische Zeichnen? Wozu eine Normung? Zur Vorgehensweise...
 VII 1 Einleitung... 1 1.1 Was ist das Technische Zeichnen?... 1 1.2 Wozu eine Normung?... 2 1.3 Zur Vorgehensweise... 3 2 Erstellung einer Technischen Zeichnung... 4 2.1 Arbeitsmittel... 4 2.1.1 Zeichengeräte...
VII 1 Einleitung... 1 1.1 Was ist das Technische Zeichnen?... 1 1.2 Wozu eine Normung?... 2 1.3 Zur Vorgehensweise... 3 2 Erstellung einer Technischen Zeichnung... 4 2.1 Arbeitsmittel... 4 2.1.1 Zeichengeräte...
Die wichtigsten Gewindearten im Überblick
 Die wichtigsten Gewindearten im Überblick In Fahrzeugen, Thermostaten oder auch mechanischen Uhren ist es zu finden Das Gewinde. Es wurde schon etwa 200 Jahre v. Chr. erfunden und ist heute noch genau
Die wichtigsten Gewindearten im Überblick In Fahrzeugen, Thermostaten oder auch mechanischen Uhren ist es zu finden Das Gewinde. Es wurde schon etwa 200 Jahre v. Chr. erfunden und ist heute noch genau
Auf einen Blick. Über den Autor... 7 Einleitung... 19
 Auf einen Blick Über den Autor.... 7 Einleitung.... 19 Teil I: Was Maschinenelemente können.... 23 Kapitel 1: Maschinen und Maschinenelemente... 25 Kapitel 2: Aufgabenteilung macht stark: Die funktionale
Auf einen Blick Über den Autor.... 7 Einleitung.... 19 Teil I: Was Maschinenelemente können.... 23 Kapitel 1: Maschinen und Maschinenelemente... 25 Kapitel 2: Aufgabenteilung macht stark: Die funktionale
Konstruktions-/Zeichenaufgabe 4M WS 02/03
 Konstruktions-/Zeichenaufgabe 4M WS 02/03 Konstruieren einer Spindellagerung für eine Tischfräse Technische Daten der Tischfräse: Antriebsleistung: Nenndrehzahl: Spindellänge: 6,3 KW 3000 Umdrehungen /
Konstruktions-/Zeichenaufgabe 4M WS 02/03 Konstruieren einer Spindellagerung für eine Tischfräse Technische Daten der Tischfräse: Antriebsleistung: Nenndrehzahl: Spindellänge: 6,3 KW 3000 Umdrehungen /
1 Einleitung Was ist das Technische Zeichnen? Wozu eine Normung? Zur Vorgehensweise... 3
 VII 1 Einleitung... 1 1.1 Was ist das Technische Zeichnen?... 1 1.2 Wozu eine Normung?... 2 1.3 Zur Vorgehensweise... 3 2 Erstellung einer Technischen Zeichnung... 4 2.1 Arbeitsmittel... 4 2.1.1 Zeichengeräte...
VII 1 Einleitung... 1 1.1 Was ist das Technische Zeichnen?... 1 1.2 Wozu eine Normung?... 2 1.3 Zur Vorgehensweise... 3 2 Erstellung einer Technischen Zeichnung... 4 2.1 Arbeitsmittel... 4 2.1.1 Zeichengeräte...
Vorwort Einleitung XIII Literatur XV Grundlagen der Mechanik Achsen, Wellen, Betriebsfestigkeit
 Vorwort Einleitung Literatur V XIII 0 Grundlagen der Mechanik 1 0.1 Grundlagen der Statik... 1 0.1.1 Kraft und Gleichgewicht der Kräfte... 1 0.1.2 Moment und Gleichgewicht der Momente... 5 0.2 Grundlagen
Vorwort Einleitung Literatur V XIII 0 Grundlagen der Mechanik 1 0.1 Grundlagen der Statik... 1 0.1.1 Kraft und Gleichgewicht der Kräfte... 1 0.1.2 Moment und Gleichgewicht der Momente... 5 0.2 Grundlagen
:00 bis 10:30 Uhr (1,5 Stunden) Die Klausur ist bestanden, wenn mindestens 24 Punkte erreicht wurden.
 Maschinenelemente FACHPRÜFUNG MASCHINENELEMENTE I 16.08.007-9:00 bis 10:30 Uhr (1,5 Stunden) Bearbeiter: Matr.-Nr. : Umfang: Maschinenelemente I Σ = 60 Punkte Die Klausur ist bestanden, wenn mindestens
Maschinenelemente FACHPRÜFUNG MASCHINENELEMENTE I 16.08.007-9:00 bis 10:30 Uhr (1,5 Stunden) Bearbeiter: Matr.-Nr. : Umfang: Maschinenelemente I Σ = 60 Punkte Die Klausur ist bestanden, wenn mindestens
tgt HP 1993/94-1: Getriebewelle
 tgt HP 1993/94-1: Getriebewelle l 1 45 mm l 2 35 mm l 3 60 mm l 4 210 mm F 1 700 N F 2 850 N F 3 1300 N An der unmaßstäblich skizzierten Getriebewelle aus E295 sind folgende Teilaufgaben zu lösen: Teilaufgaben:
tgt HP 1993/94-1: Getriebewelle l 1 45 mm l 2 35 mm l 3 60 mm l 4 210 mm F 1 700 N F 2 850 N F 3 1300 N An der unmaßstäblich skizzierten Getriebewelle aus E295 sind folgende Teilaufgaben zu lösen: Teilaufgaben:
tgt HP 1987/88-2: Kranbrücke
 tgt HP 1987/88-2: Kranbrücke Zum Verladen schwerer Werkstücke plant ein Betrieb den Bau der skizzierten Krananlage. F L 20 kn (Lastgewicht) F G 2 kn (angenommenes Eigengewicht des Tragbalkens, im Punkt
tgt HP 1987/88-2: Kranbrücke Zum Verladen schwerer Werkstücke plant ein Betrieb den Bau der skizzierten Krananlage. F L 20 kn (Lastgewicht) F G 2 kn (angenommenes Eigengewicht des Tragbalkens, im Punkt
Ressourcen Hinweise/Bemerkungen Behandelt Datum/Visum Lösbare Verbindungen Einteilung, Eigenschaften
 80 Lektionen 1. Sem. Lösbare Verbindungen Einteilung, Eigenschaften 2 L Die gebräuchlichsten Maschinenelemente in Verbindungselemente, Tragelemente und Übertragungselemente einteilen Wirkungsweise 2 L
80 Lektionen 1. Sem. Lösbare Verbindungen Einteilung, Eigenschaften 2 L Die gebräuchlichsten Maschinenelemente in Verbindungselemente, Tragelemente und Übertragungselemente einteilen Wirkungsweise 2 L
Hubert Hinzen. Basiswissen. Maschinenelemente. 2. Auflage DE GRUYTER OLDENBOURG
 Hubert Hinzen Basiswissen Maschinenelemente 2. Auflage DE GRUYTER OLDENBOURG Inhalt Vorwort Einleitung Literatur V XIII XV 0 Grundlagen der Mechanik 1 0.1 Grundlagen der Statik 1 0.1.1 Kraft und Gleichgewicht
Hubert Hinzen Basiswissen Maschinenelemente 2. Auflage DE GRUYTER OLDENBOURG Inhalt Vorwort Einleitung Literatur V XIII XV 0 Grundlagen der Mechanik 1 0.1 Grundlagen der Statik 1 0.1.1 Kraft und Gleichgewicht
Technisches Zeichnen. 4 l Springer Vieweg. Selbstständig lernen und effektiv üben. Susanna Labisch Christian Weber
 Susanna Labisch Christian Weber Technisches Zeichnen Selbstständig lernen und effektiv üben 4., überarbeitete und erweiterte Auflage 4 l Springer Vieweg Hardware Schnittstellen VII Inhaltsverzeichnis 1
Susanna Labisch Christian Weber Technisches Zeichnen Selbstständig lernen und effektiv üben 4., überarbeitete und erweiterte Auflage 4 l Springer Vieweg Hardware Schnittstellen VII Inhaltsverzeichnis 1
Maschinenelemente Tabellen und Formelsammlung
 Maschinenelemente Tabellen und Formelsammlung Berthold Schlecht Higher Education München Harlow Amsterdam Madrid Boston San Francisco Don Mills Mexico City Sydney a part of Pearson plc worldwide Maschinenelemente
Maschinenelemente Tabellen und Formelsammlung Berthold Schlecht Higher Education München Harlow Amsterdam Madrid Boston San Francisco Don Mills Mexico City Sydney a part of Pearson plc worldwide Maschinenelemente
Vorlesung Nietverbindungen
 Vorlesung Nietverbindungen Übersicht Ausführungen und Anwendung Tragfähigkeit 1 Gliederung 1. Einführung 2. Anwendung und Eigenschaften 3. Dimensionierung und Gestaltung von Nietverbindungen 4. Festigkeitsnachweis
Vorlesung Nietverbindungen Übersicht Ausführungen und Anwendung Tragfähigkeit 1 Gliederung 1. Einführung 2. Anwendung und Eigenschaften 3. Dimensionierung und Gestaltung von Nietverbindungen 4. Festigkeitsnachweis
Ressourcen Hinweise/Bemerkungen Behandelt Datum/Visum Lösbare Verbindungen Einteilung, Eigenschaften
 1. Sem. Lösbare Verbindungen Einteilung, Eigenschaften 2 L Die gebräuchlichsten Maschinenelemente in Verbindungselemente, Tragelemente und Übertragungselemente einteilen Wirkungsweise 2 L Lösbare und nicht
1. Sem. Lösbare Verbindungen Einteilung, Eigenschaften 2 L Die gebräuchlichsten Maschinenelemente in Verbindungselemente, Tragelemente und Übertragungselemente einteilen Wirkungsweise 2 L Lösbare und nicht
Technisches Zeichnen. Susanna Labisch Christian Weber
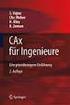 Susanna Labisch Christian Weber Technisches Zeichnen Selbstständig lernen und effektiv üben 3., überarbeitete Auflage Mit 329 Abbildungen und 59 Tabellen STUDIUM VIEWEG+ TEUBNER VII Inhaltsverzeichnis
Susanna Labisch Christian Weber Technisches Zeichnen Selbstständig lernen und effektiv üben 3., überarbeitete Auflage Mit 329 Abbildungen und 59 Tabellen STUDIUM VIEWEG+ TEUBNER VII Inhaltsverzeichnis
3) Welche Festigkeitsnachweise müssen bei der Auslegung von Verzahnungen erbracht werden? Zahnfußfestigkeit
 Musterlösung Fragenteil SoSe 6 ) ennen Sie jeweils Beispiele für Form und Stoffschlüssige Verbindungen Formschluss: Bolzen und Stifte, ietverbindungen, Passfeder, Stoffschluss: Schweißverbindungen, Lötverbindungen
Musterlösung Fragenteil SoSe 6 ) ennen Sie jeweils Beispiele für Form und Stoffschlüssige Verbindungen Formschluss: Bolzen und Stifte, ietverbindungen, Passfeder, Stoffschluss: Schweißverbindungen, Lötverbindungen
tgt HP 1993/94-1: Getriebewelle
 tgt HP 1993/94-1: Getriebewelle l 1 45 mm l 2 35 mm l 3 60 mm l 4 210 mm F 1 700 N F 2 850 N F 3 1300 N An der unmaßstäblich skizzierten Getriebewelle aus E295 sind folgende Teilaufgaben zu lösen: Teilaufgaben:
tgt HP 1993/94-1: Getriebewelle l 1 45 mm l 2 35 mm l 3 60 mm l 4 210 mm F 1 700 N F 2 850 N F 3 1300 N An der unmaßstäblich skizzierten Getriebewelle aus E295 sind folgende Teilaufgaben zu lösen: Teilaufgaben:
Maschinenelemente. Hermann Roloff / Wilhelm Matek. Normung Berechnung Gestaltung. Teil I. Mit 132 Bildern und 27 Tabellen
 Hermann Roloff / Wilhelm Matek Maschinenelemente Normung Berechnung Gestaltung Teil I Mit 132 Bildern und 27 Tabellen FRIEDE. VIEWEG & SOHN BEAUNSCHWEIG 1963 A. Allgemeine Grundlagen 1. Grundbegriffe und
Hermann Roloff / Wilhelm Matek Maschinenelemente Normung Berechnung Gestaltung Teil I Mit 132 Bildern und 27 Tabellen FRIEDE. VIEWEG & SOHN BEAUNSCHWEIG 1963 A. Allgemeine Grundlagen 1. Grundbegriffe und
10. März :00 bis 10:30 Uhr (90 Minuten) Umfang: Σ = 60 Punkte Die Klausur ist bestanden, wenn mindestens 24 Punkte erreicht wurden.
 FACHPRÜFUNG Fachbereich MASCHINENELEMENTE I 10. März 2010-09:00 bis 10:30 Uhr (90 Minuten) Umfang: Σ = 60 Punkte Die Klausur ist bestanden, wenn mindestens 24 Punkte erreicht wurden. Hinweise zur Bearbeitung:
FACHPRÜFUNG Fachbereich MASCHINENELEMENTE I 10. März 2010-09:00 bis 10:30 Uhr (90 Minuten) Umfang: Σ = 60 Punkte Die Klausur ist bestanden, wenn mindestens 24 Punkte erreicht wurden. Hinweise zur Bearbeitung:
tgt HP 2005/06-2: Exzenterantrieb
 tgt HP 2005/06-2: Exzenterantrieb Der Exzenter wird über eine Welle, die mit einem Getriebe und Motor verbunden ist, angetrieben. Die Kraft wird über Tellerstößel und Stange übertragen, an deren oberen
tgt HP 2005/06-2: Exzenterantrieb Der Exzenter wird über eine Welle, die mit einem Getriebe und Motor verbunden ist, angetrieben. Die Kraft wird über Tellerstößel und Stange übertragen, an deren oberen
Klawitter, Strache, Szalwicki
 Klawitter, Strache, Szalwicki Maschinenelemente 1 SoSe 2014 Klausur Punkte: Gesamtnote: 23.06.2014 S.1/7 Bearbeitungszeit: 90 Minuten Zugelassene Hilfsmittel: R/M Formelsammlung Auflage: R/M Tabellenbuch
Klawitter, Strache, Szalwicki Maschinenelemente 1 SoSe 2014 Klausur Punkte: Gesamtnote: 23.06.2014 S.1/7 Bearbeitungszeit: 90 Minuten Zugelassene Hilfsmittel: R/M Formelsammlung Auflage: R/M Tabellenbuch
Rheinische Fachhochschule Köln
 Rheinische Fachhochschule Köln Matrikel-Nr. Nachname Dozent Ianniello Semester Klausur Datum Fach Urteil BM4 II, SS11 K2 Jan 12 Kinetik+Kinematik Genehmigte Hilfsmittel: Ergebnis: Punkte Taschenrechner
Rheinische Fachhochschule Köln Matrikel-Nr. Nachname Dozent Ianniello Semester Klausur Datum Fach Urteil BM4 II, SS11 K2 Jan 12 Kinetik+Kinematik Genehmigte Hilfsmittel: Ergebnis: Punkte Taschenrechner
17 Elastische Federn Schraubenfedern Schraubendruckfedern
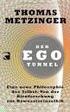 301 17 Elastische Federn Von ideal-elastischen Federn wird gesprochen, wenn die zugeführte Arbeit zu 100% in potenzielle Energie verwandelt wird (der Anteil der in Wärme übergehenden mechanischen Arbeit
301 17 Elastische Federn Von ideal-elastischen Federn wird gesprochen, wenn die zugeführte Arbeit zu 100% in potenzielle Energie verwandelt wird (der Anteil der in Wärme übergehenden mechanischen Arbeit
Institut für Maschinenelemente und Konstruktionstechnik Klausur KT1 (alt KT2) SS 2011 Dr.-Ing. S. Umbach I
 Klausur KT1 (alt KT) SS 011 Dr.-Ing. S. Umbach I 30.08.011 Name, Vorname: Unterschrift: Matrikel- Nr.: Klausurbedingungen: Zugelassene Hilfsmittel sind dokumentenechtes Schreibzeug und Taschenrechner.
Klausur KT1 (alt KT) SS 011 Dr.-Ing. S. Umbach I 30.08.011 Name, Vorname: Unterschrift: Matrikel- Nr.: Klausurbedingungen: Zugelassene Hilfsmittel sind dokumentenechtes Schreibzeug und Taschenrechner.
Maschinen- und Konstruktionselemente 3
 W. Steinhilper R. Röper Maschinen- und Konstruktionselemente 3 Elastische Elemente, Federn Achsen und Wellen Dichtungstechnik Reibung, Schmierung, Lagerungen Zweite Auflage Mit 275 Abbildungen und 43 Tabellen
W. Steinhilper R. Röper Maschinen- und Konstruktionselemente 3 Elastische Elemente, Federn Achsen und Wellen Dichtungstechnik Reibung, Schmierung, Lagerungen Zweite Auflage Mit 275 Abbildungen und 43 Tabellen
Vorbesprechung zur Übung 2
 WS 09/10 Vorbesrechung zur Übung 2 Berechnung von Verbindungselementen Teil 1, am 08.12.09 (MB) / 16.12.09 (LB): 1. Allgemeiner Teil, Einführung zu Verbindungselementen Poweroint- Präsentation Überblick/Inhalt:
WS 09/10 Vorbesrechung zur Übung 2 Berechnung von Verbindungselementen Teil 1, am 08.12.09 (MB) / 16.12.09 (LB): 1. Allgemeiner Teil, Einführung zu Verbindungselementen Poweroint- Präsentation Überblick/Inhalt:
Springer-Lehrbuch. Maschinenelemente. Gestaltung, Berechnung, Anwendung. Bearbeitet von Horst Haberhauer, Ferdinand Bodenstein
 Springer-Lehrbuch Maschinenelemente Gestaltung, Berechnung, Anwendung Bearbeitet von Horst Haberhauer, Ferdinand Bodenstein Neuausgabe 2008. Taschenbuch. XII, 648 S. Paperback ISBN 978 3 540 68611 8 Format
Springer-Lehrbuch Maschinenelemente Gestaltung, Berechnung, Anwendung Bearbeitet von Horst Haberhauer, Ferdinand Bodenstein Neuausgabe 2008. Taschenbuch. XII, 648 S. Paperback ISBN 978 3 540 68611 8 Format
tgt HP 2007/08-5: Krabbenkutter
 tgt HP 2007/08-5: Krabbenkutter Zum Fang von Krabben werden die Ausleger in die Waagrechte gebracht. Die Fanggeschirre werden zum Meeresboden abgesenkt. Nach Beendigung des Fanges werden die Ausleger in
tgt HP 2007/08-5: Krabbenkutter Zum Fang von Krabben werden die Ausleger in die Waagrechte gebracht. Die Fanggeschirre werden zum Meeresboden abgesenkt. Nach Beendigung des Fanges werden die Ausleger in
Institut für Maschinenelemente und Konstruktionstechnik Klausur KT1 (alt KT2) WS 2010/11 Dr.-Ing. S. Umbach
 Name, Vorname: Matrikel- Nr.: Unterschrift: Klausurbedingungen: Zugelassene Hilfsmittel sind dokumentenechtes Schreibzeug und Taschenrechner. Die Bearbeitungszeit beträgt 120 Minuten. Ein Täuschungsversuch
Name, Vorname: Matrikel- Nr.: Unterschrift: Klausurbedingungen: Zugelassene Hilfsmittel sind dokumentenechtes Schreibzeug und Taschenrechner. Die Bearbeitungszeit beträgt 120 Minuten. Ein Täuschungsversuch
Konstruktionselemente des Maschinenbaus 1
 Springer-Lehrbuch Konstruktionselemente des Maschinenbaus 1 Grundlagen der Berechnung und Gestaltung von Maschinenelementen Bearbeitet von Albert Albers, Bernd Sauer, Ludger Deters, Jörg Feldhusen, Erhard
Springer-Lehrbuch Konstruktionselemente des Maschinenbaus 1 Grundlagen der Berechnung und Gestaltung von Maschinenelementen Bearbeitet von Albert Albers, Bernd Sauer, Ludger Deters, Jörg Feldhusen, Erhard
Welche 3 Anwendungen von Stiftverbindungen unterscheidet man? Welche Formen von Stiften unterscheidet man? Welche Stifte sind rüttelsicher? Begründe.
 Welche Formen von Stiften unterscheidet man? Welche 3 Anwendungen von Stiftverbindungen unterscheidet man? Welche Stifte sind rüttelsicher? Begründe. Warum sind Zylinder- und Kegelstiftverbindungen teuer?
Welche Formen von Stiften unterscheidet man? Welche 3 Anwendungen von Stiftverbindungen unterscheidet man? Welche Stifte sind rüttelsicher? Begründe. Warum sind Zylinder- und Kegelstiftverbindungen teuer?
Auflage Ihres R/M Tabellenbuches: Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner, R/M Formelsammlung und Tabellenbuch und
 Dr.-Ing. Lindner Prof. Dr.-Ing. Strache Dipl.-Ing. Szalwicki Maschinenelemente 1 WS 2011 Klausur Teil 1: Punkte Klausur Teil 2: Punkte Gesamtpunkte: Punkte Gesamtnote: 13.01.12 90 min S.1/6 Name: Auflage
Dr.-Ing. Lindner Prof. Dr.-Ing. Strache Dipl.-Ing. Szalwicki Maschinenelemente 1 WS 2011 Klausur Teil 1: Punkte Klausur Teil 2: Punkte Gesamtpunkte: Punkte Gesamtnote: 13.01.12 90 min S.1/6 Name: Auflage
2. Löten 2.1. a) die Lötfläche ist ausreichend, τ a = 1,67 N/mm 2 < τ a zul = 30 N/mm 2 b) Länge 11 mm 2.2. a) 12 kn b) hartgelötet 2.3.
 Lösungen zu Übungen Feinwerktechnische Konstruktion - V.04 Seite 7 2. Löten 2.. a) die Lötfläche ist ausreichend, τ a =,67 N/mm 2 < τ a zul = 30 N/mm 2 b) Länge mm 2.2. a) 2 kn b) hartgelötet 2.3. 2.4.
Lösungen zu Übungen Feinwerktechnische Konstruktion - V.04 Seite 7 2. Löten 2.. a) die Lötfläche ist ausreichend, τ a =,67 N/mm 2 < τ a zul = 30 N/mm 2 b) Länge mm 2.2. a) 2 kn b) hartgelötet 2.3. 2.4.
tgtm HP 2012/13-1: Hebevorrichtung
 tgtm HP 01/13-1: Hebevorrichtung (Pflichtaufgabe) Die dargestellte Hebevorrichtung ist an den Punkten A und D an einer Wand zu befestigen. Der Träger wird dabei mit Hilfe einer Stange im Punkt B waagerecht
tgtm HP 01/13-1: Hebevorrichtung (Pflichtaufgabe) Die dargestellte Hebevorrichtung ist an den Punkten A und D an einer Wand zu befestigen. Der Träger wird dabei mit Hilfe einer Stange im Punkt B waagerecht
technische Zeichnungen Werkstück- und Maschinenelemente Thomas Gläser, M.Eng.
 technische Zeichnungen Werkstück- und Maschinenelemente Thomas Gläser, M.Eng. Agenda 1. Zentrierbohrungen 2. Butzen 3. Freistiche 4. Rändel 5. Gewinde und Schraubenverbindungen 6. Gewindeausläufe 7. Gewindefreistiche
technische Zeichnungen Werkstück- und Maschinenelemente Thomas Gläser, M.Eng. Agenda 1. Zentrierbohrungen 2. Butzen 3. Freistiche 4. Rändel 5. Gewinde und Schraubenverbindungen 6. Gewindeausläufe 7. Gewindefreistiche
Übung 10: Verbindungstechnik
 Ausgabe: 02.12.2015 Übung 10: Verbindungstechnik Einleitung und Lernziele Der Einsatz effizienter Verbindungstechnologien ist für die Realisierung komplexer Leichtbaustrukturen von grosser Bedeutung. Diese
Ausgabe: 02.12.2015 Übung 10: Verbindungstechnik Einleitung und Lernziele Der Einsatz effizienter Verbindungstechnologien ist für die Realisierung komplexer Leichtbaustrukturen von grosser Bedeutung. Diese
Aufgabe: Punkte: Ist der Einsatzstahl 16MnCr5 im einsatzgehärteten Zustand schweißgeeignet? (kurze Begründung!)
 FH München Fachbereich 03 Diplom-Vorprüfung Maschinenelemente SS 2005 15. Juli 2005 Prof. Dr.-Ing. H. Löw Prof. Dr.-Ing. G. Knauer Dipl.-Ing. W. Wieser Name: Vorname:.. Semester:. Verwendetes Buch:. Auflage:..
FH München Fachbereich 03 Diplom-Vorprüfung Maschinenelemente SS 2005 15. Juli 2005 Prof. Dr.-Ing. H. Löw Prof. Dr.-Ing. G. Knauer Dipl.-Ing. W. Wieser Name: Vorname:.. Semester:. Verwendetes Buch:. Auflage:..
:00 bis 10:30 Uhr (1,5 Stunden) Die Klausur ist bestanden, wenn mindestens 24 Punkte erreicht wurden.
 Maschinenelemente CHPRÜUNG MSCHNENELEMENTE 1.03.007-9:00 bis 10:30 Uhr (1,5 Stunden) Bearbeiter: Matr.-Nr. : Umfang: Maschinenelemente Σ = 60 Punkte Die Klausur ist bestanden, wenn mindestens 4 Punkte
Maschinenelemente CHPRÜUNG MSCHNENELEMENTE 1.03.007-9:00 bis 10:30 Uhr (1,5 Stunden) Bearbeiter: Matr.-Nr. : Umfang: Maschinenelemente Σ = 60 Punkte Die Klausur ist bestanden, wenn mindestens 4 Punkte
tgt HP 1995/96-2: Säulenschwenkkran
 tgt HP 1995/96-2: Säulenschwenkkran Der skizzierte Säulenschwenkkran darf maximal mit der Kraft F L belastet werden. Die Eigengewichtskraft des Schwenkarms mit Hubeinrichtung und Schwenkwerk beträgt F
tgt HP 1995/96-2: Säulenschwenkkran Der skizzierte Säulenschwenkkran darf maximal mit der Kraft F L belastet werden. Die Eigengewichtskraft des Schwenkarms mit Hubeinrichtung und Schwenkwerk beträgt F
Rheinische Fachhochschule Köln
 Rheinische Fachhochschule Köln Matrikel-Nr. Nachname Dozent Ianniello Semester Klausur Datum BP I, S K5 Genehmigte Hilfsmittel: Fach Urteil Technische Mechanik Ergebnis: Punkte Taschenrechner Literatur
Rheinische Fachhochschule Köln Matrikel-Nr. Nachname Dozent Ianniello Semester Klausur Datum BP I, S K5 Genehmigte Hilfsmittel: Fach Urteil Technische Mechanik Ergebnis: Punkte Taschenrechner Literatur
Welle-Nabe- Verbindungen
 Welle-Nabe- Verbindungen Passfeder Keilwelle Zahnwelle Polygonwelle Vorgespannt - Formschlüssig Keilverbindung Stirnzahn Kreiskeil Kraftschlüssig http://www.unterrichtmaterialien.123finden.net/?did2=32680
Welle-Nabe- Verbindungen Passfeder Keilwelle Zahnwelle Polygonwelle Vorgespannt - Formschlüssig Keilverbindung Stirnzahn Kreiskeil Kraftschlüssig http://www.unterrichtmaterialien.123finden.net/?did2=32680
MASCHINENELEMENTE DAS FACHWISSEN DES TECHNIKERS GESTALTUNG UND BERECHNUNG CARL HANSER VERLAG MÜNCHEN 1965
 i DAS FACHWISSEN DES TECHNIKERS OBEBING. KARL-HEINZ DECREE MASCHINENELEMENTE GESTALTUNG UND BERECHNUNG Mit 432 Bildern und 136 Tafeln 2., überarbeitete Auflage CARL HANSER VERLAG MÜNCHEN 1965 Inhaltsverzeichnis
i DAS FACHWISSEN DES TECHNIKERS OBEBING. KARL-HEINZ DECREE MASCHINENELEMENTE GESTALTUNG UND BERECHNUNG Mit 432 Bildern und 136 Tafeln 2., überarbeitete Auflage CARL HANSER VERLAG MÜNCHEN 1965 Inhaltsverzeichnis
Vorbesprechung Übung 3a: Wälzlagerung
 Vorbesprechung Übung 3a: Wälzlagerung Januar 2009 Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebebau (FZG) Institutsleitung: Prof. Dr.-Ing. Vortrag: Dipl.-Ing. Alexander Monz Übung 3a 1/42 Gliederung der Vorbesprechung
Vorbesprechung Übung 3a: Wälzlagerung Januar 2009 Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebebau (FZG) Institutsleitung: Prof. Dr.-Ing. Vortrag: Dipl.-Ing. Alexander Monz Übung 3a 1/42 Gliederung der Vorbesprechung
Eine Verringerung der Vorspannkraft führt zum Lockern der Verbindung!
 estigkeit von Schraubenverbindungen 5. Schritt: Bestimmung des Vorspannkraftverlustes durch Setzen Vorspannkraftänderungen Die Vorspannkraft V einer Schraube kann sich gegenüber der Montagevorspannkraft
estigkeit von Schraubenverbindungen 5. Schritt: Bestimmung des Vorspannkraftverlustes durch Setzen Vorspannkraftänderungen Die Vorspannkraft V einer Schraube kann sich gegenüber der Montagevorspannkraft
Maschinenelemente 1 WS 2013/14 Klausur Punkte: Gesamtnote:
 Klawitter, Szalwicki Maschinenelemente 1 WS 2013/14 Klausur Punkte: Gesamtnote: 14.01.2014 S.1/7 Bearbeitungszeit: 90 Minuten Zugelassene Hilfsmittel: R/M Formelsammlung Auflage: R/M Tabellenbuch Auflage:
Klawitter, Szalwicki Maschinenelemente 1 WS 2013/14 Klausur Punkte: Gesamtnote: 14.01.2014 S.1/7 Bearbeitungszeit: 90 Minuten Zugelassene Hilfsmittel: R/M Formelsammlung Auflage: R/M Tabellenbuch Auflage:
tgt HP 1981/82-1: Spannen beim Fräsen
 tgt HP 1981/8-1: Spannen beim Fräsen Zum Spannen von größeren Werkstücken verwendet man Spanneisen. Teilaufgaben: 1 Welche Spannkraft F Sp ist erforderlich, um das Werkstück gegen ein Verschieben mit der
tgt HP 1981/8-1: Spannen beim Fräsen Zum Spannen von größeren Werkstücken verwendet man Spanneisen. Teilaufgaben: 1 Welche Spannkraft F Sp ist erforderlich, um das Werkstück gegen ein Verschieben mit der
Empfehlung / Anleitung für die Modellierung von Gewinden im SLS-Verfahren Kunststoff
 Empfehlung / Anleitung für die Modellierung von Gewinden im SLS-Verfahren Kunststoff Metrische ISO-Gewinde DIN 13 Rohrgewinde DIN ISO 228-1 Die Modellierung der Gewinde erfolgt nach Norm (N) oder nach
Empfehlung / Anleitung für die Modellierung von Gewinden im SLS-Verfahren Kunststoff Metrische ISO-Gewinde DIN 13 Rohrgewinde DIN ISO 228-1 Die Modellierung der Gewinde erfolgt nach Norm (N) oder nach
Inhaltsverzeichnis VII. 1 Einleitung Was ist das Technische Zeichnen? Wozu eine Normung? Zur Vorgehensweise...
 VII Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 1 1.1 Was ist das Technische Zeichnen?... 1 1.2 Wozu eine Normung?... 2 1.3 Zur Vorgehensweise... 3 2 Erstellung einer Technischen Zeichnung... 4 2.1 Arbeitsmittel...
VII Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 1 1.1 Was ist das Technische Zeichnen?... 1 1.2 Wozu eine Normung?... 2 1.3 Zur Vorgehensweise... 3 2 Erstellung einer Technischen Zeichnung... 4 2.1 Arbeitsmittel...
ARBEITSPROGRAMM. Konstrukteur, Polymechaniker E. Erstellt: durch Th. Steiger Überarbeitung: durch Kontrolle/Freigabe: durch
 Version 2.0 1/6 Semester 3 120 KPF4.1.1 Einteilung, Eigenschaften Lösbare 2 Die gebräuchlichsten Maschinenelemente in Verbindungselemente, Tragelemente und Übertragungselemente einteilen KPF4.1.2 Wirkungsweise
Version 2.0 1/6 Semester 3 120 KPF4.1.1 Einteilung, Eigenschaften Lösbare 2 Die gebräuchlichsten Maschinenelemente in Verbindungselemente, Tragelemente und Übertragungselemente einteilen KPF4.1.2 Wirkungsweise
:00 bis 10:30 Uhr (1,5 Stunden)
 Maschinenelemente Prof. r.-ng. B. Künne CHPRÜUNG MSCHNENELEMENTE 1.03.007-9:00 bis 10:30 Uhr (1,5 Stunden) Bearbeiter: Matr.-Nr. : Umfang: Maschinenelemente Σ = 60 Punkte ie Klausur ist bestanden, wenn
Maschinenelemente Prof. r.-ng. B. Künne CHPRÜUNG MSCHNENELEMENTE 1.03.007-9:00 bis 10:30 Uhr (1,5 Stunden) Bearbeiter: Matr.-Nr. : Umfang: Maschinenelemente Σ = 60 Punkte ie Klausur ist bestanden, wenn
tgt HP 1994/95-2: Holzkreissäge
 Abmessungen: l 1 5 mm l 50 mm l 3 50 mm d R1 80 mm d R 50 mm d S 300 mm Teilaufgaben: 1 Ermitteln Sie die Schnittgeschwindigkeit bei einem Riemenschlupf von einem Prozent. Der Motor hat eine Drehzahl von
Abmessungen: l 1 5 mm l 50 mm l 3 50 mm d R1 80 mm d R 50 mm d S 300 mm Teilaufgaben: 1 Ermitteln Sie die Schnittgeschwindigkeit bei einem Riemenschlupf von einem Prozent. Der Motor hat eine Drehzahl von
tgt HP 1987/88-1: Drehschwenktisch für Schweißarbeiten
 tgt HP 1987/88-1: Drehschwenktisch für Schweißarbeiten maximales Werkstückgewicht Gewichtskraft des Tischoberteiles Geiwchtskraft des Tischunterteiles F G1 = 18 kn F G = 6 kn F G3 = 8 kn Mit einem Drehschwenktisch
tgt HP 1987/88-1: Drehschwenktisch für Schweißarbeiten maximales Werkstückgewicht Gewichtskraft des Tischoberteiles Geiwchtskraft des Tischunterteiles F G1 = 18 kn F G = 6 kn F G3 = 8 kn Mit einem Drehschwenktisch
tgt HP 2010/11-1: Flugzeug
 tgt HP 010/11-1: Flugzeug Teilaufgaben: 1 Von dem abgebildeten Kleinflugzeug sind folgende Daten bekannt: Daten: Masse des Motors m1 90,kg Masse des Flugzeugs m 40,kg l1 1350,mm l 150,mm l3 3300,mm l4
tgt HP 010/11-1: Flugzeug Teilaufgaben: 1 Von dem abgebildeten Kleinflugzeug sind folgende Daten bekannt: Daten: Masse des Motors m1 90,kg Masse des Flugzeugs m 40,kg l1 1350,mm l 150,mm l3 3300,mm l4
1.Kräfte, Fachwerk. 14,7 kn. Bestimmen Sie mit Hilfe des Sinussatzes die Stabkraft F1. 20 kn
 1.Kräfte, Fachwerk # Aufgaben Antw. P. Ein Wandkran wird durch eine Masse m mit F G über eine feste Rolle belastet. 1 Die beiden Stäbe sind Rohre mit einem Durchmesser-Verhältnis d/d = λ = 0,8. Die zulässige
1.Kräfte, Fachwerk # Aufgaben Antw. P. Ein Wandkran wird durch eine Masse m mit F G über eine feste Rolle belastet. 1 Die beiden Stäbe sind Rohre mit einem Durchmesser-Verhältnis d/d = λ = 0,8. Die zulässige
2 Toleranzen, Passungen, Oberflächenbeschaffenheit
 2 4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2 Toleranzen, Passungen, Oberflächenbeschaffenheit Für folgende Zusammenbaubeispiele ist je eine geeignete ISO-Passung zwischen Außenund Innenteil (Bohrung und Welle) für das System
2 4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2 Toleranzen, Passungen, Oberflächenbeschaffenheit Für folgende Zusammenbaubeispiele ist je eine geeignete ISO-Passung zwischen Außenund Innenteil (Bohrung und Welle) für das System
Klocke stärkt sein Portfolio. im Bereich. Welle-Nabe-Verbindung
 Klocke stärkt sein Portfolio im Bereich Welle-Nabe-Verbindung Um Drehmomente und Leistungen von einer Welle auf eine rotierende Nabe zu übertragen, ist höchste Präzision und Rundlaufgenauigkeit gefordert.
Klocke stärkt sein Portfolio im Bereich Welle-Nabe-Verbindung Um Drehmomente und Leistungen von einer Welle auf eine rotierende Nabe zu übertragen, ist höchste Präzision und Rundlaufgenauigkeit gefordert.
7) Hier nagt nicht der Zahn der Zeit
 7) Hier nagt nicht der Zahn der Zeit A) Verbindungstechnik bei Verschleißschutzanwendungen Jürgen Spätling, TeCe Technical Ceramics GmbH & Co. KG, Selb Die Folien finden Sie ab Seite 290. Gliederung Einleitung
7) Hier nagt nicht der Zahn der Zeit A) Verbindungstechnik bei Verschleißschutzanwendungen Jürgen Spätling, TeCe Technical Ceramics GmbH & Co. KG, Selb Die Folien finden Sie ab Seite 290. Gliederung Einleitung
Belastung, Beanspruchung, Festigkeit, Sicherheit
 Institut für Konstruktions- und Antriebstechnik Professur Maschinenelemente Prof. Dr.-Ing. P. Tenberge Über 100 Fragen zur Prüfungsvorbereitung im Fach Maschinenelemente Belastung, Beanspruchung, Festigkeit,
Institut für Konstruktions- und Antriebstechnik Professur Maschinenelemente Prof. Dr.-Ing. P. Tenberge Über 100 Fragen zur Prüfungsvorbereitung im Fach Maschinenelemente Belastung, Beanspruchung, Festigkeit,
Zylinderrollenlager. Zylinderrollenlager. Definition und Eigenschaften. Baureihen. Definition
 Definition und Eigenschaften Definition Die haben eine hervorragende Aufnahmefähigkeit von kurzfristigen Überlastungen und Stößen. Sie ermöglichen einen sehr einfachen Einbau durch separat montierbare
Definition und Eigenschaften Definition Die haben eine hervorragende Aufnahmefähigkeit von kurzfristigen Überlastungen und Stößen. Sie ermöglichen einen sehr einfachen Einbau durch separat montierbare
Maschinenelemente Gestaltung und Berechnung
 Maschinenelemente Gestaltung und Berechnung von Karl-Heinz JDecker mit 660 Bildern, 226 Tabellen und 155 Berechnungsbeispielen 8., vollständig neu bearbeitete Auflage Carl Hanser Verlag München Wien Inhaltsverzeichnis
Maschinenelemente Gestaltung und Berechnung von Karl-Heinz JDecker mit 660 Bildern, 226 Tabellen und 155 Berechnungsbeispielen 8., vollständig neu bearbeitete Auflage Carl Hanser Verlag München Wien Inhaltsverzeichnis
tgt HP 2016/17-1: PKW-Anhänger
 tgt HP 016/17-1: PKW-Anhänger Beim Transport besonders langer Holzbretter bleibt, wie in der Zeichnung dargestellt, die Ladeklappe des PKW- Anhängers in horizontaler Stellung. Sie wird hierzu beidseitig
tgt HP 016/17-1: PKW-Anhänger Beim Transport besonders langer Holzbretter bleibt, wie in der Zeichnung dargestellt, die Ladeklappe des PKW- Anhängers in horizontaler Stellung. Sie wird hierzu beidseitig
Für den erforderlichen Wellendurchmesser bei Torsionsbeanspruchung gilt:
 Dimensionierung einer Passfederverbindung Zu dimensionieren ist die unten dargestellte Passfederverbindung. Das schwellend zu übertragende Drehmoment beträgt. Die Nabe sei aus EN-GJL-200, die Welle aus
Dimensionierung einer Passfederverbindung Zu dimensionieren ist die unten dargestellte Passfederverbindung. Das schwellend zu übertragende Drehmoment beträgt. Die Nabe sei aus EN-GJL-200, die Welle aus
Biegung
 2. Biegung Wie die Normalkraft resultiert auch das Biegemoment aus einer Normalspannung. Das Koordinatensystem des Balkens wird so gewählt, dass die Flächenschwerpunkte der Querschnitte auf der x-achse
2. Biegung Wie die Normalkraft resultiert auch das Biegemoment aus einer Normalspannung. Das Koordinatensystem des Balkens wird so gewählt, dass die Flächenschwerpunkte der Querschnitte auf der x-achse
Martin Fingerhut / Hannes Mautz /7
 Martin Fingerhut / Hannes Mautz 005 1/7 Hochfahren einer Welle: I RED =M AN M LAST = M AN M LAST M AN M LAST =const. 0 t I hoch RED wobei M LAST = P N und I RED=I M I S I exz I exz =m e Kräfte am Ritzel:
Martin Fingerhut / Hannes Mautz 005 1/7 Hochfahren einer Welle: I RED =M AN M LAST = M AN M LAST M AN M LAST =const. 0 t I hoch RED wobei M LAST = P N und I RED=I M I S I exz I exz =m e Kräfte am Ritzel:
tgtm HP 2017/18-1: Holzrückeschlepper
 Holzrückeschlepper: F G1 40 kn in S1 Abmessungen: l 1 800 mm Holzstämme: F G 70 kn in S l 3800 mm Ladekran: F G3 5 kn in S3 l 3 4500 mm l 4 6000 mm 1 Holzrückeschlepper 1.1 Machen Sie den vollbeladenen
Holzrückeschlepper: F G1 40 kn in S1 Abmessungen: l 1 800 mm Holzstämme: F G 70 kn in S l 3800 mm Ladekran: F G3 5 kn in S3 l 3 4500 mm l 4 6000 mm 1 Holzrückeschlepper 1.1 Machen Sie den vollbeladenen
