Martin Leutzsch Was passt und was nicht (Vom alten Mantel und vom neuen Wein) (Mk 2,21f.; Mt 9,16f.; Lk 5,36-39; EvThom 47)
|
|
|
- Gerd Becker
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Martin Leutzsch Was passt und was nicht (Vom alten Mantel und vom neuen Wein) (Mk 2,21f.; Mt 9,16f.; Lk 5,36-39; EvThom 47) Mk 2,21f. (21) Kein Mensch näht einen Flicken ungewalkten Tuches auf einen alten Mantel. Sonst reißt das Füllstück von ihm ab, das neue vom alten, und der Riss wird schlimmer. (22) Und kein Mensch füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst wird der Wein die Schläuche sprengen, und der Wein und die Schläuche werden ruiniert. Sondern: neuen Wein in neue Schläuche. Sprachlich-narrative Analyse (Bildlichkeit) Die Worte vom alten Mantel und vom neuen Wein bilden in Mk 2,18-22 den mittleren und letzten Teil einer Antwort Jesu auf eine Anfrage von SchülerInnen des Täufers (Anhängerinnen des Täufers: Mt 21,32; vgl. Mk 1,5) und der pharisäischen Bewegung (Pharisäerinnen: msota 3,4), weshalb Jesu SchülerInnen (Frauen: Mk 15,40f. u. a.) nicht fasten. (Für den ersten Teil von Jesu Antwort, Mk 2,19f., verweise ich auf den Beitrag von Vorname, Nachname, Seiten.) Die Fastenfrage Mk 2,18-22 steht in Mk 2,1-3,6 im Kontext einer Folge von Beziehungskonstellationen, in denen Aspekte der Praxis Jesu und seiner SchülerInnen von Angehörigen verschiedener anderer jüdischer Gruppierungen befragt, zum Teil auch kritisiert werden. Eingerahmt wird die Fastenfrage von zwei Abschnitten, in denen es ums Essen geht (Mk 2,15-17 und 2,23-28). Formal sind die beiden Worte Mk 2,21.22 weitgehend parallel gebaut: Mit dem verallgemeinernden niemand eingeleitet, wird jeweils ein Verhalten beschrieben. Dieses Verhalten ist unsinnig, wie im anschließenden, mit andernfalls eingeleiteten Satz durch die Beschreibung der eintretenden Schädigung und der ruinösen Folgen des zuvor benannten absurden Verhaltens erläutert wird. Die Wiederholung der Satzstruktur von V. 21 und des Kontrastes alt neu in V. 22a.b hat verstärkenden Effekt. V. 22c ergänzt und kontrastiert die Folgen des unsinnigen Handelns mit der Beschreibung von oder dem Appell zu sinnvollem Handeln. Da ein Verb fehlt, kann V. 22c ebenso gut als Aussage wie als Aufforderung verstanden werden. Dass die beiden durch Präsens- und Futurformen zeit- und situationsunabhängig formulierten Doppelsätze keine Küfer- und Schneider-Regeln meinen, macht nur der Zusammenhang klar (Lohmeyer 1963, 61): Die metaphorische Beantwortung der Fastenfrage durch Jesus V. 19f. hatte begründet, weshalb seine AnhängerInnen jetzt nicht, aber später fasten werden. Diese Begründung wird mit Hilfe zweier weiterer Parabeln verstärkt. V. 21 und 22 beantworten die Frage von V. 18, indem sie zugleich V. 19f. erläutern (Berger 1984, 47). Gemeinsam ist den drei Parabeln V , dass sie in der Sphäre des Hauses, Haushalts bzw. der Hauswirtschaft angesiedelt sind. Die Handlungen, die in V. 21a und V. 22a beschrieben werden, gelten als solche, die von keiner vernünftigen Person vollzogen werden. Auch formal Sätze mit der Einleitung niemand finden sich auch in Mt 6,24; Lk 11,33; 2Tim 2,4-6 handelt es sich hier um Parabeln, die Unsinniges oder Unmögliches nennen (Berger 1984, 45f.). Die Hörenden werden eingeladen, gedanklich zwei Situationen durchzuspielen, um durch Vergegenwärtigung der schädlichen Folgen die jeweils beschriebenen Handlungen als
2 kontraproduktiv zu erkennen: Wer verursacht schon gern vermeidbare Verluste? Bei unsachgemäßer Behandlung wird im ersten Fall ein altes Gut (Mantel) unbrauchbar gemacht, im zweiten Fall ein neues (Wein) und ein altes (Schläuche) zugleich. Die nahe liegende positive Folgerung, zueinander Passendes zusammenzubringen, wird in V. 22c ausdrücklich artikuliert. Sozialgeschichtliche Analyse (Bildspendender Bereich) Mantel, Wein und Weinschlauch sind Gegenstände, die im antiken Mittelmeerraum der Sicherung der Grundbedürfnisse (Leutzsch 2005, 10-13) Kleidung und Nahrung dienen. Das himation, ein den ganzen Körper bedeckendes Obergewand, gab es status- und funktionsbezogen in verschiedenen Ausführungen (Krauss 1910, ; Dalman 1937, ; Ben-David 1974, 310f.; Hamel 1989, 60-62; Kolb 1973). Die einheimische jüdische Textilproduktion war in geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung überwiegend so aufgeteilt, dass Spinnen als weibliche, Weben (auch Mantelweben) als männliche Domäne galt (Peskowitz 1997, bes ; Hearon/Wire 2002; Krauss 1910, ; Archer 1990, ; Safrai 1994, ; Philon, De animalibus 18). Auf den eigenen Haushalt beschränkt war Walken eine überwiegend weibliche, als Erwerbstätigkeit eine überwiegend männliche Tätigkeit (Krauss 1910, ; Leutzsch 1998, 496 Anm. 464). Der Mantel diente zur Verhüllung des Körpers und zur Wärmung des Leibes (auch in der Nacht). Er war das letzte Kleidungsstück, das man hergab (eher teilten sich zwei einen Mantel, indem sie ihn abwechselnd nutzten, mbb 1,6; Krauss 1910, 134), und auch dann nur in äußerster materieller Not oder in extremer Notlage (Lk 6,29; Mt 24,18). In Israel konnte der Mantel zwar gepfändet werden, musste aber den Bettelarmen zeitweise zur Nutzung überlassen werden (Ex 22,25f.; Dtn 24,12f.; Sifre Dtn 277; MidrTanch B Mischpatim 9). Der Mantel wurde wie Kleidung überhaupt wertgeschätzt (Kraus 1910, 129f.) und fungierte auch als Statussymbol (Leutzsch 2005, 18-22). Weite Teile der Bevölkerung trugen und reparierten ihre Kleidung, so lange es ging (Hamel 1989, f.; zum Flicken: Dalman 1937, 183f.). Nichts wurde ohne Grund weggeworfen, und noch das Weggeworfene fand Verwertung (MacMullen 1976, 14). Wein gehörte zusammen mit Getreide und Öl zu den drei landwirtschaftlichen Haupterzeugnissen des antiken jüdischen Palästina (Krauss 1911, ; Dalman 1935, ; Ben-David 1974, ; Safrai 1994, Reg. sv wine; Albright 1980). Mit Wasser vermischt getrunken, befriedigte Wein zusammen mit Brot und Öl das Grundbedürfnis der Nahrung (Hamel 1989, 22). Wein wurde außer in Krügen auch in Schläuchen aufbewahrt und transportiert (Wetstenius 1751, 360f.; Dalman 1942, 245). Für den ungegorenen jungen Wein mussten sie neu und haltbar sein. Neuer Wein stammte vom laufenden Jahr, bereits der vorjährige wurde als alt bezeichnet (Dalman 1935, 372). In Wertschätzung und Geschmack wurde alter Wein dem neuen vorgezogen (Sir 9,10; Wetstenius 1751, 689f.; dort zu korrigieren: Pindar, Ol. 9,48f. [dazu Caduff 1986, 80f.]). Wie für die Reparatur des Mantels gilt auch für die geeignete Aufbewahrung des Weins die Sorgsamkeit im Umgang mit den knappen Ressourcen: Antike Wirtschaft war Subsistenzwirtschaft; die erreichbaren und vorstellbaren Güter galten als begrenzt (Leutzsch 1996, 24). Was vorhanden ist, durfte daher nicht unnötig vergeudet werden, weder von Ansässigen noch von Menschen unterwegs (auf Reisende bezieht die in Mk 2,21f. benannten Realien Ebner 1998, ). Analyse des Bedeutungshintergrundes (Bildfeldtradition)
3 Die Vielfalt der Metaphorik und Symbolik des Gewandes (Kehl 1978), des Weins (Freude, Zorn, Lehre) und des Schlauchs (Ijob 13,28 LXX) ist zu unspezifisch, um als relevanter Bedeutungshintergrund für die beiden Parabeln benannt zu werden. Abstrakt gesprochen, geht es in beiden Fällen um Prozeduren und Folgen des Zusammenbringens von nicht Zusammenpassendem. Das widerspricht einem grundlegenden Prinzip des Denkens, Wertens und Handelns in antiken Gesellschaften, wonach Gleiches zu Gleichem, Passendes zu Passendem gehört oder gehören soll. Im antiken Griechenland findet sich das Prinzip Gleiches zu Gleichem in Erkenntnistheorie und Naturphilosophie, Ernährungslehre und Medizin, Politik und Freundschaftsethik (Müller 1965; Leutzsch 1998, 462 Anm. 242) und im Recht (zur Talion vgl. Mühl 1963, ). In der biblischen Welt begegnet Gleiches zu Gleichem weisheitlich als Ratschlag und Erfahrungsmitteilung, als Erwartungshorizont für Tun und Ergehen (Freuling 2004; z. B. Mk 4,24f.; Mt 5,7; 6,12) und in der Justiz (Daube 1947). Zusammenfassende Auslegung (Deutungshorizonte) Für das Verständnis von Mk 2,21f. ist entscheidend, dass es sich um den Teil einer Antwort auf eine bestimmte Frage handelt. Die Frage (V. 18) bezieht sich auf einen Unterschied in der Frömmigkeitspraxis dreier jüdischer Gruppierungen. Die Entscheidung, die der jeweiligen Frömmigkeitspraxis zugrunde liegt, ist bereits gefallen. Gefragt wird nach der Begründung. Anders als in der anschließenden Debatte V erfolgt die Begründung nicht durch Bezugnahme auf die Schrift, sondern wie unmittelbar zuvor in V durch Evidenz heischende bildliche Rede. Das hier in Rede stehende Fasten bezieht sich nicht auf eine (von der Torah nur für den Versöhnungstag vorgeschriebene) kollektive oder auf eine individuelle Verhaltenserwartung. Es geht um ein für bestimmte religiöse Gruppenidentitäten (Täuferkreis, pharisäische Bewegung) wichtiges Ritual. Gegenüber bis heute dominierenden Auslegungsrichtungen betone ich (unter Aufnahme der Kritik von Schellong 1985; auch Flusser 1987): Die Praxis der beiden in V. 18 genannten beiden Gruppierungen ist nicht generalisierend mit dem Judentum zur Zeit Jesu gleichzusetzen, wie auch Jesu Antwort schon aus historischen Gründen nicht die Position des (weder zur Zeit Jesu noch zur Zeit des Mk dem Judentum gegenüberstehenden) Christentums formulieren kann. Und das Nicht-Fasten der AnhängerInnen Jesu kann nicht als eine Abgrenzung oder Überwindung von traditioneller jüdischer Frömmigkeitspraxis verstanden werden: Die Täuferbewegung war erst kurz vor der Jesusbewegung entstanden. Angesichts der Vielzahl religiöser Lebensentwürfe im Judentum des ersten Jahrhunderts kann auch die pharisäische Position nicht verallgemeinert werden (Alexander 1983, 245 mit n. 11). Die Voraussetzungen der gängigen Auslegung dass Jesu Wirksamkeit in den Evangelien in der Kategorie des Neuen verstanden werden solle, dass das Neue das Höherwertige sei und dass es zur Abgrenzung diene scheitern daran, dass in V. 21 das Alte, in V. 22 das Neue und das Alte bewahrt werden sollen. Das bedeutet, daß der Gegensatz von neu und alt zum immanenten Bestand der Beispiele gehört und nicht zur externen Nutzanwendung (Schellong 1985, 114). Die Pointe ist: Chaque chose à sa place (Schellong 1985, 113). Für die SchülerInnen Jesu (im Blick in V. 19f.) geht es um die rechte Zeit des Fastens oder Nicht-Fastens, und die ist von der Ab- oder Anwesenheit des Bräutigams abhängig. Aspekte der Parallelüberlieferung und Wirkungsgeschichte Mk 2,21f. war eine Antwort an Angehörige der Täufer- und der pharisäischen Bewegung. Im Mt (9,14) befragen JohannesschülerInnen Jesus. Im Lk (5,33) ist das Subjekt der Frage nicht
4 genannt, ein Rückbezug auf die PharisäerInnen und ihre Schriftgelehrten (Lk 5,30) möglich. Diese Differenz hat die Auslegung seit der Antike beschäftigt (Cremer 1970). Die Bergrede (Mt 6,16-18) setzt voraus, dass deren AdressatInnen fasten. Schon von daher ist Mt 9,16f. nicht als grundsätzliche Absage an eine Fastenpraxis zu verstehen. Wie in Mk 2,21f. wird zueinander Passendes auf die Zeit des Fastens bzw. Nicht-Fastens bezogen. Im Kontext des gesamten Mt gibt es eine weitere Zusammenstellung von Altem und Neuem (als Materialbasis des der Jesusbewegung angehörenden Schriftgelehrten) in Mt 13,52 (Jones 1995, 367 n. 68). Mk 2,21f. und Mt 9,16f. schließen unmittelbar an das Bildwort von der Hochzeit an, Lk 5,36 bringt einen Neueinsatz innerhalb der Antwort Jesu: Lk 5,36-39: (36) Er sagte eine Parabel zu ihnen: Niemand näht Stücke von einem neuen Mantel auf einen alten Mantel; sonst zerschneidet er ja den neuen und der Flicken vom neuen Mantel wird zum alten nicht passen. (37) Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche; sonst wird der neue Wein ja die Schläuche sprengen, und er fließt heraus, und die Schläuche werden ruiniert. (39) Sondern neuer Wein ist in neue Schläuche zu füllen. (39) Und niemand, der alten trinkt, will neuen. Es heißt ja [oder: Denn er sagt]: Der alte ist gut. In V. 36 wird eine andere Form absurden Verhaltens beschrieben als bei Mk und Mt: Nicht nur ein Mantel, sondern zwei werden zerstört, wenn aus einem Kleidungsstück ein Flicken erst herausgeschnitten wird. V. 39 artikuliert über Mk und Mt hinaus in Übereinstimmung mit antiken Geschmacksurteilen (Dupont 1963) eine ausdrücklich höhere Wertung des alten Weins. In EvThom 47 (dazu Schrage 1964, ) sind konkrete AdressatInnen Jesu nicht genannt; vom gesamten EvThom her liegen die SchülerInnen als Hörende nahe. Das Jesuswort ist hier abgekoppelt von der Frage nach der Fastenpraxis. Es beginnt mit zwei Feststellungen von Unmöglichem (die zweite ist eine Parallele zu Mt 6,24 / Lk 16,13) und fährt dann fort: EvThom 47: Niemand trinkt alten Wein und hat gleich darauf Lust, neuen Wein zu trinken. Neuer Wein wird nicht in alte Schläuche gefüllt, damit sie nicht bersten. Auch wird alter Wein nicht in einen neuen Schlauch gefüllt, um ihn nicht zu ruinieren. Ein alter Flicken wird nicht auf ein neues Kleidungsstück genäht ein Riss würde entstehen. Im NT ist Mk 2,21f. parr Teil einer innerjüdischen Debatte. In der christlichen Auslegung dominieren seit dem zweiten Jahrhundert Auslegungen, die insbesondere das (zum Sprichwort gewordene; Schulze ed. 1860, 143) Wein-Schlauch-Wort als Kontrast zwischen Christentum und Judentum umdeuten (Material bei Cremer 1967): Das Alte wird auf das Alte Testament, die Synagoge, das Gesetz bezogen, das Neue auf das Evangelium, die Kirche, den Glauben (Markion laut Tertullian, Adversus Marcionem 3,15; Späteres bei Fonck 1909, 262). Daneben gibt es seit dem Ende des vierten Jahrhunderts die Deutung, dass die mit dem alten Wein und den alten Schläuchen gleichgesetzten Schüler Christi das von ihnen im neuen Bund erwartete Fasten jetzt, zu Beginn der Nachfolge, noch nicht ertragen (Johannes Chrysostomos, hom. in Mt 30,4; Späteres bei Fonck 1909, 262). Abgekoppelt von der Fastenfrage, wird seit dem 19. Jahrhundert unter Rückgriff auf Mk 2,21f. das Christentum mit dem Neuen identifiziert und dem Judentum als dem Alten gegenübergestellt (Fichte 1971, 535 mit Anm. ***; Hegel: Hamacher ed. 1978, 389) und das Neue als Revolution gedeutet (Heine 1976, 598; Marx/Engels 1977, 229; Gutzkow 1875, 335; Levinas 1998, 22). Dabei steht die im 18. Jahrhundert aufkommende Konstruktion Jesu als eines politischen oder kulturellen Revolutionärs im Hintergrund. Sören Kierkegaard lässt einen Geistlichen fragen, wozu Jesus davon rede, daß man keinen neuen Flicken auf ein altes Kleid setzen kann, ein Wort, das immer das Feldgeschrei jeder Revolution ist, denn darin liegt ja, daß man das Bestehende nicht anerkennen will, sondern daß man es weghaben will, statt
5 sich dem Bestehenden anzuschließen, und es zu verbessern, wenn man ein Reformator ist, oder es zu seiner höchsten Entwicklung zu bringen, wenn man der Verheißene ist. (Kierkegaard 1977, 85) Eine Kritik an der dominierenden Deutungstradition impliziert Hermann Hesse, wenn er in einer Gegenüberstellung von Theologie als Wissenschaft und Theologie als Kunst formuliert: immer haben die Wissenschaftlichen über den neuen Schläuchen den alten Wein versäumt (Hesse 1970, 43). Literatur zum Weiterlesen Flusser, David, Mögen Sie etwa lieber neuen Wein? In: ders., Entdeckungen im Neuen Testament 1: Jesusworte und ihre Überlieferung. Neukirchen-Vluyn 1987, Schellong, Dieter, Was heißt: Neuer Wein in neue Schläuche? In: Einwürfe 2 (1985)
6 Literatur Albright, Jimmy L. (1980) Wine in the biblical world: its economic, social, and religious implications for New Testament interpretation. Ph. D. diss. Southwestern Baptist Theological Seminary Alexander, Philip S. (1983) Rabbinic Judaism and the New Testament. In: ZNW 74, Archer, Léonie J. (1990) Her Price is Beyond Rubies. The Jewish Woman in Graeco-Roman Palestine. (JSOTS 60). Sheffield Ben-David, Arye (1974) Talmudische Ökonomie. Die Wirtschaft des jüdischen Palästina zur Zeit der Mischna und des Talmud I. Hildesheim/New York Berger, Klaus (1984) Formgeschichte des Neuen Testaments. Heidelberg Caduff, Gian Andrea (1986) Antike Sintflutsagen. (Hypomnemata 82). Göttingen Cremer, Franz Gerhard (1967) Lukanisches Sondergut zum Fastenstreitgespräch. Lk 5,33-39 im Urteil der patristischen und scholastischen Exegese. In: TThZ 76, (1970) Zum Problem der verschiedenen Sprecher im Fastenstreitgespräch (Mk 2,18 parr). Ein Blick in die Kommentare der Patristik und Scholastik. In: Patrick Granfield/Josef A. Jungmann eds., Kyriakon. Festschrift Johannes Quasten. Bd. 1. Münster 1970, Dalman, Gustaf (1935) Arbeit und Sitte in Palästina IV: Brot, Öl und Wein. Gütersloh --- (1937) Arbeit und Sitte in Palästina V: Webstoff, Spinnen, Weben, Kleidung. Gütersloh --- (1942) Arbeit und Sitte in Palästina VII: Das Haus, Hühnerzucht, Taubenzucht, Bienenzucht. Gütersloh Daube, David (1947) Lex Talionis. In: ders., Studies in Biblical Law. Cambridge Dupont, Jacques (1963) Vin vieux, vin nouveau (Luc 3,39). In: CBQ 15, Ebner, Martin (1998) Jesus ein Weisheitslehrer? Synoptische Weisheitslogien im Traditionsprozeß. (HBS 15). Freiburg/Basel/Wien/Barcelona/Rom/New York Fichte, Johann Gottlieb (1971) Werke IV. Zur Rechts- und Sittenlehre II. Berlin Flusser, David (1987) Mögen Sie etwa lieber neuen Wein? In: ders., Entdeckungen im Neuen Testament 1: Jesusworte und ihre Überlieferung. Neukirchen-Vluyn Fonck, Leopold (1909) Die Parabeln des Herrn im Evangelium. (Christus, Lux mundi III/1). Innsbruck 3. Aufl. Freuling, Georg (2004) Wer eine Grube gräbt... Der Tun-Ergehen-Zusammenhang und sein Wandel in der alttestamentlichen Weisheitsliteratur. (WMANT 102). Neukirchen-Vluyn Gutzkow, Karl (1875) Rückblicke auf mein Leben. Berlin Hamacher, Werner ed. (1978) Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Der Geist des Christentums. Schriften Mit bislang unveröffentlichten Texten. (Ullstein 3360). Frankfurt/Berlin/Wien Hamel, Gildas (1990) Poverty and Charity in Roman Palestine, First Three Centuries C.E. (University of California Publications, Near Eastern Studies 23). Berkeley/Los Angeles/Oxford Hearon, Holly/Wire, Antoinette Clark (2002) Women s Work in the Realm of God (Mt 13.33; Lk 13,20,21; Gos. Thom. 96; Mt ; Lk ; Gos. Thom. 36). In: Mary Ann Beavis ed., The Lost Coin: Parables on Women, Work and Wisdom. New York Heine, Heinrich (1976) Sämtliche Schriften in zwölf Bänden 3: (RH 220/3). München/Wien Hesse, Hermann (1970) Gesammelte Werke 2: Unterm Rad. Diesseits. Frankfurt Jones, Ivor Harold (1995) The Matthean Parables: A Literary and Historical Commentary. (SupplNovTest 80). Leiden/New York/Köln Kehl, Alois (1978) Gewand (der Seele). In: RAC 10, Kierkegaard, Sören (1977) Einübung im Christentum. Zwei kurze ethisch-religiöse Abhandlungen. Das Buch Adler oder Der Begriff des Auserwählten. (dtv 6080). München
7 Kolb, Frank (1973) Römische Mäntel: paenula, lacerna, µανδύνη. In: MDAI (R) 80, Krauss, Samuel (1910) Talmudische Archäologie I. Leipzig --- (1911) Talmudische Archäologie II. Leipzig Leutzsch, Martin (1996) Liebe und Gerechtigkeit im Neuen Testament. In: Ulfrid Kleinert/Martin Leutzsch/Harald Wagner, Herausforderung neue Armut. Motive und Konzepte sozialer Arbeit. Leipzig (1998) Hirt des Hermas. In: Ulrich H. J. Körtner/Martin Leutzsch, Schriften des Urchristentums III: Papiasfragmente. Hirt des Hermas. Darmstadt (2005) Grundbedürfnis und Statussymbol: Kleidung im Neuen Testament. In: Ansgar Köb/Peter Riedel eds., Kleidung und Repräsentation in Antike und Mittelalter. (MittelalterStudien 7). München [erschienen 2006], 9-32 Levinas, Emmanuel (1998) Vom Sakralen zum Heiligen. Fünf neue Talmud-Lesungen. Frankfurt Lohmeyer, Ernst (1963) Das Evangelium des Markus. (KEK I/2). Göttingen 7. Aufl. MacMullen, Ramsay (1976) Roman Social Relations. 50 B.C. to A.D New Haven/London 2. Aufl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (1977) Werke. Ergänzungsband: Schriften, Manuskripte, Briefe bis Zweiter Teil. Berlin Mühl, Max (1963) Untersuchungen zur altorientalischen und althellenischen Gesetzgebung. (Klio Beiheft 29). Aalen 2. Aufl. Müller, Carl Werner (1965) Gleiches zu Gleichem. Ein Prinzip frühgriechischen Denkens. (KPhSt 31). Wiesbaden Peskowitz, Miriam B. (1997) Spinning Fantasies: Rabbis, Gender, and History. (Contraversions 9). Berkeley/Los Angeles/London Safrai, Ze ev (1994) The Economy of Raman Palestine. London/New York Schellong, Dieter (1985) Was heißt: Neuer Wein in neue Schläuche? In: Einwürfe 2, Schrage, Wolfgang (1964) Das Verhältnis des Thomas-Evangeliums zur synoptischen Tradition und zu den koptischen Evangelienübersetzungen. Zugleich ein Beitrag zur gnostischen Synoptikerdeutung. (BZNW 29). Berlin Schulze, Carl ed. (1860) Die biblischen Sprichwörter der deutschen Sprache. Göttingen Wetstenius, Joannes Jacobus (1751) Η ΚΑΙΝΗ ΙΑΘΗΚΗ. Novum Testamentum Graecum (...). Tomus I. Continens quatuor Evangelia. Amstelaedami
Was passt und was nicht (Vom alten Mantel und vom neuen Wein) Mk 2,21f. (Mt 9,16f. / Lk 5,36-39/ EvThom 47,3-5)
 Gt 08020 / p. 287 / 28.9.2007 Was passt und was nicht (Vom alten Mantel und vom neuen Wein) Mk 2,21f. (Mt 9,16f. / Lk 5,36-39/ EvThom 47,3-5) (21a) Kein Mensch näht einen Flicken ungewalkten Tuches auf
Gt 08020 / p. 287 / 28.9.2007 Was passt und was nicht (Vom alten Mantel und vom neuen Wein) Mk 2,21f. (Mt 9,16f. / Lk 5,36-39/ EvThom 47,3-5) (21a) Kein Mensch näht einen Flicken ungewalkten Tuches auf
Inhaltsverzeichnis Seite I
 Inhaltsverzeichnis Seite I NEUES TESTAMENT (Kurstyp 1) Vorwort Inhaltsverzeichnis 1. Der Weg der Schriftwerdung S. 1 1.1 Die Bibel als Heilige Schrift 1.2 Inspiration und Kanon apokryphe Schriften S. 3
Inhaltsverzeichnis Seite I NEUES TESTAMENT (Kurstyp 1) Vorwort Inhaltsverzeichnis 1. Der Weg der Schriftwerdung S. 1 1.1 Die Bibel als Heilige Schrift 1.2 Inspiration und Kanon apokryphe Schriften S. 3
1. Staatsexamen (LPO I) Klausurenthemen: Neues Testament
 1. Staatsexamen (LPO I) Klausurenthemen: Neues Testament Herbst 1999 1 Grundzüge der Ethik Jesu. Mt 5,43 48 ist zu übersetzen und zu erläutern! Auferstehung Christi und Auferstehung der Toten bei Paulus.
1. Staatsexamen (LPO I) Klausurenthemen: Neues Testament Herbst 1999 1 Grundzüge der Ethik Jesu. Mt 5,43 48 ist zu übersetzen und zu erläutern! Auferstehung Christi und Auferstehung der Toten bei Paulus.
1. Staatsexamen (LPO I), nicht vertieft Klausurthemen: Neues Testament
 1. Staatsexamen (LPO I), nicht vertieft Klausurthemen: Neues Testament Herbst 2005 Die Gleichnisse Jesu Stellen Sie das so genannte Messiasgeheimnis bei Markus dar! Als Ausgangspunkt kann Markus 9,9 10
1. Staatsexamen (LPO I), nicht vertieft Klausurthemen: Neues Testament Herbst 2005 Die Gleichnisse Jesu Stellen Sie das so genannte Messiasgeheimnis bei Markus dar! Als Ausgangspunkt kann Markus 9,9 10
Inhalt. Erster Teil Zugänge zum Neuen Testament 15. Wege der Schriftauslegung. Söding, Thomas Wege der Schriftauslegung 1998
 Erster Teil Zugänge zum Neuen Testament 15 1. Die Kunst der Exegese 16 2. Das Schriftverständnis der Exegese 21 a) Das Neue Testament als Sammlung literarischer Texte 23 b) Das Neue Testament als geschichtliches
Erster Teil Zugänge zum Neuen Testament 15 1. Die Kunst der Exegese 16 2. Das Schriftverständnis der Exegese 21 a) Das Neue Testament als Sammlung literarischer Texte 23 b) Das Neue Testament als geschichtliches
Die Religion der ersten Christen
 Gerd Theißen Die Religion der ersten Christen Eine Theorie des Urchristentums Wissenschaftliche Buchgesellschaft Inhalt Vorwort 13 1 Einleitung: Das Programm einer Theorie der urchristlichen Religion 17
Gerd Theißen Die Religion der ersten Christen Eine Theorie des Urchristentums Wissenschaftliche Buchgesellschaft Inhalt Vorwort 13 1 Einleitung: Das Programm einer Theorie der urchristlichen Religion 17
Standards Thema Jesus Christus Inhalte Kompetenzen. Zeit und Umwelt Jesu, Leiden u. Sterben (Mk 14;15)
 Standards Thema Jesus Christus Inhalte Kompetenzen -können Grundzüge der Botschaft Jesu in ihrem historischen und systematischen Zusammenhang erläutern -kennen ausgewählte Texte der Botschaft Jesu vom
Standards Thema Jesus Christus Inhalte Kompetenzen -können Grundzüge der Botschaft Jesu in ihrem historischen und systematischen Zusammenhang erläutern -kennen ausgewählte Texte der Botschaft Jesu vom
Arbeitsbuch zur Exegese des Neuen Testaments
 Wolfgang Fenske Arbeitsbuch zur Exegese des Neuen Testaments Ein Proseminar Chr. Kaiser Gütersloher Verlagshaus Inhalt I. Einleitung 1. Warum befassen wir uns mit dem Neuen Testament? 13 2. Historisch-kritische
Wolfgang Fenske Arbeitsbuch zur Exegese des Neuen Testaments Ein Proseminar Chr. Kaiser Gütersloher Verlagshaus Inhalt I. Einleitung 1. Warum befassen wir uns mit dem Neuen Testament? 13 2. Historisch-kritische
Die Weisheit hat ihr Haus gebaut
 Silvia Schroer Die Weisheit hat ihr Haus gebaut Studien zur Gestalt der Sophia in den biblischen Schriften Matthias-Grünewald-Verlag Mainz Inhalt Vorwort 9 I. Weisheit auf dem Weg der Gerechtigkeit (Spr
Silvia Schroer Die Weisheit hat ihr Haus gebaut Studien zur Gestalt der Sophia in den biblischen Schriften Matthias-Grünewald-Verlag Mainz Inhalt Vorwort 9 I. Weisheit auf dem Weg der Gerechtigkeit (Spr
Das eine Evangelium, die vier Evangelien und ihre Autoren
 Das eine Evangelium, die vier Evangelien und ihre Autoren Situation der christlichen Gemeinde(n) in den ersten Jahrzehnten nach Jesu Tod und Auferweckung: Versammlung in Häusern (cf. Obergeschoss ) Elemente
Das eine Evangelium, die vier Evangelien und ihre Autoren Situation der christlichen Gemeinde(n) in den ersten Jahrzehnten nach Jesu Tod und Auferweckung: Versammlung in Häusern (cf. Obergeschoss ) Elemente
Wie Gott seine Gemeinde baut!
 Wir sind und bleiben eine Baustelle! Dabei geht es immer in erster Linie um Menschen. Unser Gemeindebau ist bestimmt von unserer Atmosphäre, unserer Kultur (Theologie) als Gemeinde! Neuer Wein in alten
Wir sind und bleiben eine Baustelle! Dabei geht es immer in erster Linie um Menschen. Unser Gemeindebau ist bestimmt von unserer Atmosphäre, unserer Kultur (Theologie) als Gemeinde! Neuer Wein in alten
I. Teil: Eine Einführung in drei Schritten
 Inhalt Ein Wort zuvor............................ 11 I. Teil: Eine Einführung in drei Schritten 1. Ein bekanntes Bild und seine fragwürdige biblische Grundlage... 15 2. Was vom Verhältnis der Testamente
Inhalt Ein Wort zuvor............................ 11 I. Teil: Eine Einführung in drei Schritten 1. Ein bekanntes Bild und seine fragwürdige biblische Grundlage... 15 2. Was vom Verhältnis der Testamente
Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments II: Die Evangelien und die Apostelgeschichte
 LMU, Abteilung Biblische Theologie www.kaththeol.uni-muenchen.de/einrichtungen/lehrstuehle/bibl_einleitung/index.html Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments II: Die Evangelien und die Apostelgeschichte
LMU, Abteilung Biblische Theologie www.kaththeol.uni-muenchen.de/einrichtungen/lehrstuehle/bibl_einleitung/index.html Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments II: Die Evangelien und die Apostelgeschichte
Der Brief an die Hebräer
 Martin Karrer Der Brief an die Hebräer Kapitel 5,11-13,25 Gütersloher Verlagshaus Inhalt Vorwort 11 Literatur 397 Ausgewählte Kommentare 13 Ausgewählte Monographien und Aufsätze 13 Kommentar 5,11-6,20
Martin Karrer Der Brief an die Hebräer Kapitel 5,11-13,25 Gütersloher Verlagshaus Inhalt Vorwort 11 Literatur 397 Ausgewählte Kommentare 13 Ausgewählte Monographien und Aufsätze 13 Kommentar 5,11-6,20
Neutestamentliches Arbeitsbuch für Religionspädagogen
 Ulrich Becker Friedrich Johannsen Harry Noormann Neutestamentliches Arbeitsbuch für Religionspädagogen Dritte, überarbeitete und erweiterte Auflage Verlag W. Kohlhammer Inhalt Vorwort 11 1 Vom Wort zur
Ulrich Becker Friedrich Johannsen Harry Noormann Neutestamentliches Arbeitsbuch für Religionspädagogen Dritte, überarbeitete und erweiterte Auflage Verlag W. Kohlhammer Inhalt Vorwort 11 1 Vom Wort zur
Entstehung der Evangelien Lukas, Matthäus und Johannes
 Entstehung der Evangelien Lukas, Matthäus und Johannes Entstehung der synoptischen Evangelien (Schema 3) _ 50 LXX Worte des Erzahl Über Paulus-Briefe Herrn lieferung _ 60 _ 70 _ 80 Sg. Mt Markus Lukas
Entstehung der Evangelien Lukas, Matthäus und Johannes Entstehung der synoptischen Evangelien (Schema 3) _ 50 LXX Worte des Erzahl Über Paulus-Briefe Herrn lieferung _ 60 _ 70 _ 80 Sg. Mt Markus Lukas
Ulrich HJ. Körtner. Einführung in die theologische Hermeneutik
 Ulrich HJ. Körtner Einführung in die theologische Hermeneutik Inhalt Vorwort 9 I. Theologie als hermeneutische Wissenschaft 11 1. Was ist Hermeneutik? 11 a) Die Fragenach der Frage, auf die die Hermeneutik
Ulrich HJ. Körtner Einführung in die theologische Hermeneutik Inhalt Vorwort 9 I. Theologie als hermeneutische Wissenschaft 11 1. Was ist Hermeneutik? 11 a) Die Fragenach der Frage, auf die die Hermeneutik
Klasse 5. - können erklären, dass die Bibel für Christinnen und Christen Heilige Schrift ist und damit besondere Bedeutung hat
 Klasse 5 Themenfelder Angestrebte Kompetenzen Bemerkungen Ich Du Wir BIBEL - kennen ihre MitschülerInnen besser - können darüber reflektieren, dass die Mitglieder einer Gruppe verschiedenen Begabungen
Klasse 5 Themenfelder Angestrebte Kompetenzen Bemerkungen Ich Du Wir BIBEL - kennen ihre MitschülerInnen besser - können darüber reflektieren, dass die Mitglieder einer Gruppe verschiedenen Begabungen
Symbol: Weg/Fußspuren. Was mir heilig ist
 2017/18 September Anfangsgottesdienst Oktober Erntedank Kompetenz 1 Das eigene Selbstund Wertverständnis sowie den persönlichen Glauben wahrnehmen und im Gespräch zum Ausdruck bringen. Lebensfragen 9 Andere
2017/18 September Anfangsgottesdienst Oktober Erntedank Kompetenz 1 Das eigene Selbstund Wertverständnis sowie den persönlichen Glauben wahrnehmen und im Gespräch zum Ausdruck bringen. Lebensfragen 9 Andere
Gleichnisse im Religionsunterricht. Biblische Texte im kompetenzorientierten Religionsunterricht einsetzen II
 Gleichnisse im Religionsunterricht Biblische Texte im kompetenzorientierten Religionsunterricht einsetzen II Gleichnisse im Horizont der Symboldidaktik Die Gleichnisse sind vor allem auch von exemplarischer
Gleichnisse im Religionsunterricht Biblische Texte im kompetenzorientierten Religionsunterricht einsetzen II Gleichnisse im Horizont der Symboldidaktik Die Gleichnisse sind vor allem auch von exemplarischer
Inhaltsverzeichnis. Vorwort zur 2. Auflage Vorwort 15. TEIL I. Einführendes 17. TEIL II. Textgeschichte Textkritik 29
 Inhaltsverzeichnis Vorwort zur 2. Auflage...13 Vorwort 15 TEIL I. Einführendes 17 1. Über die Begrifflichkeiten 17 1.1. Der Ausdruck Neues Testament 18 1.2. Die Einleitungswissenschaft...20 1.2.1. Die
Inhaltsverzeichnis Vorwort zur 2. Auflage...13 Vorwort 15 TEIL I. Einführendes 17 1. Über die Begrifflichkeiten 17 1.1. Der Ausdruck Neues Testament 18 1.2. Die Einleitungswissenschaft...20 1.2.1. Die
Katholische Theologie
 Katholische Theologie Modul 1: Einführungs- und Grundlagenmodul Turnus Arbeitsauf- 14 jährlich 10 420 2 Beispiele gelebter Religion und gelebten Glaubens, Biblische Grundlagen, Geschichte der Kirche und
Katholische Theologie Modul 1: Einführungs- und Grundlagenmodul Turnus Arbeitsauf- 14 jährlich 10 420 2 Beispiele gelebter Religion und gelebten Glaubens, Biblische Grundlagen, Geschichte der Kirche und
Die Geschichte der synoptischen Tradition
 Rudolf Bultmann Die Geschichte der synoptischen Tradition Forschungen zur Religion und Literatur des AT und NT Vandenhoeck & Ruprecht Dem Andenken Wilhelm Heitmüllers Die Geschichte der synoptischen Tradition
Rudolf Bultmann Die Geschichte der synoptischen Tradition Forschungen zur Religion und Literatur des AT und NT Vandenhoeck & Ruprecht Dem Andenken Wilhelm Heitmüllers Die Geschichte der synoptischen Tradition
Christliche Sozialethik und Moraltheologie
 CLEMENS BREUER Christliche Sozialethik und Moraltheologie Eine Auseinandersetzung mit den Grundlagen zweier Disziplinen und die Frage ihrer Eigenständigkeit 2003 Ferdinand Schöningh Paderborn München Wien
CLEMENS BREUER Christliche Sozialethik und Moraltheologie Eine Auseinandersetzung mit den Grundlagen zweier Disziplinen und die Frage ihrer Eigenständigkeit 2003 Ferdinand Schöningh Paderborn München Wien
STÄDTISCHES GYMNASIUM OLPE Kernlehrplan Kath. Religionslehre Sek II Qualifikationsphase 1
 Unterrichtsvorhaben I: Thema: Biblische Gottesbilder: Die Gottesbilder der Exoduserzählung Inhaltsfelder: IF 1: Der Mensch in christlicher Perspektive IF 2: Christliche Antworten auf die Gottesfrage Inhaltliche
Unterrichtsvorhaben I: Thema: Biblische Gottesbilder: Die Gottesbilder der Exoduserzählung Inhaltsfelder: IF 1: Der Mensch in christlicher Perspektive IF 2: Christliche Antworten auf die Gottesfrage Inhaltliche
Kurze Einleitung zum Buch Sacharja
 Geisteswissenschaft David Jäggi Kurze Einleitung zum Buch Sacharja Der Versuch einer bibeltreuen Annäherung an den Propheten Studienarbeit Werkstatt für Gemeindeaufbau Akademie für Leiterschaft in Zusammenarbeit
Geisteswissenschaft David Jäggi Kurze Einleitung zum Buch Sacharja Der Versuch einer bibeltreuen Annäherung an den Propheten Studienarbeit Werkstatt für Gemeindeaufbau Akademie für Leiterschaft in Zusammenarbeit
Maria Magdalena. Ihre Stellung im frühen Christentum
 Geisteswissenschaft Sandra Arff Maria Magdalena. Ihre Stellung im frühen Christentum Examensarbeit Maria Magdalena- Ihre Stellung im frühen Christentum Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung
Geisteswissenschaft Sandra Arff Maria Magdalena. Ihre Stellung im frühen Christentum Examensarbeit Maria Magdalena- Ihre Stellung im frühen Christentum Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Einführungsphase. Unterrichtsvorhaben: Der Mensch in christlicher Perspektive
 Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Einführungsphase Unterrichtsvorhaben: Der Mensch in christlicher Perspektive Inhaltliche Schwerpunkte Der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes (Was
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Einführungsphase Unterrichtsvorhaben: Der Mensch in christlicher Perspektive Inhaltliche Schwerpunkte Der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes (Was
DIE SITTLICHE BOTSCHAFT DES NEUEN TESTAMENTS
 HERDERS THEOLOGISCHER KOMMENTAR ZUM NEUEN TESTAMENT Herausgegeben von Alfred Wikenhauser t Anton Vögtle, Rudolf Schnackenburg SUPPLEMENTBAND I DIE SITTLICHE BOTSCHAFT DES NEUEN TESTAMENTS ERSTER BAND Von
HERDERS THEOLOGISCHER KOMMENTAR ZUM NEUEN TESTAMENT Herausgegeben von Alfred Wikenhauser t Anton Vögtle, Rudolf Schnackenburg SUPPLEMENTBAND I DIE SITTLICHE BOTSCHAFT DES NEUEN TESTAMENTS ERSTER BAND Von
Theologische Aufnahmeprüfung. Klausurthemen: Neues Testament
 Theologische Aufnahmeprüfung Klausurthemen: Neues Testament Theologische Aufnahmeprüfung 2000/II 1 Matthäus 1,18 21 ist zu übersetzen und zu exegesieren. Die Geburt Jesu nach Matthäus und Lukas. Apokalypse
Theologische Aufnahmeprüfung Klausurthemen: Neues Testament Theologische Aufnahmeprüfung 2000/II 1 Matthäus 1,18 21 ist zu übersetzen und zu exegesieren. Die Geburt Jesu nach Matthäus und Lukas. Apokalypse
Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog
 Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog 50 Jahre "Nostra aetate": Vorgeschichte, Kommentar, Rezeption von Dr. Andreas Renz 1. Auflage Kohlhammer 2014 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de
Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog 50 Jahre "Nostra aetate": Vorgeschichte, Kommentar, Rezeption von Dr. Andreas Renz 1. Auflage Kohlhammer 2014 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de
LIZENTIAT KATHOLISCHE THEOLOGIE STUDIENDOKUMENTATION VON HERR/FRAU THEOLOGISCHE GRUNDLEGUNG
 LIZENTIAT KATHOLISCHE THEOLOGIE STUDIENDOKUMENTATION VON HERR/FRAU THEOLOGISCHE GRUNDLEGUNG KTH-000 Basismodul : Einführung in die Theologie aus biblischer Sicht Einleitung in das AT Bibelkunde AT 3 Einleitung
LIZENTIAT KATHOLISCHE THEOLOGIE STUDIENDOKUMENTATION VON HERR/FRAU THEOLOGISCHE GRUNDLEGUNG KTH-000 Basismodul : Einführung in die Theologie aus biblischer Sicht Einleitung in das AT Bibelkunde AT 3 Einleitung
Fachcurriculum Ev. Religion (G8) JKG Weil Standards 6. Bildungsplan Bildungsstandards für
 Bildungsplan 2004 Bildungsstandards für Endfassung Fachcurriculum Standards 6 Johannes-Kepler-Gymnasium Weil der Stadt 1 Stand 01.05.2006 Themen Kompetenzen und Standards Mögliche Methoden Klasse 5 Sozialverhalten
Bildungsplan 2004 Bildungsstandards für Endfassung Fachcurriculum Standards 6 Johannes-Kepler-Gymnasium Weil der Stadt 1 Stand 01.05.2006 Themen Kompetenzen und Standards Mögliche Methoden Klasse 5 Sozialverhalten
Drei monotheistische Religionen ein Gott?
 Drei monotheistische Religionen ein Gott? Vorlesung und Seminar an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, 2.12.2010 Martin Hailer, Universität Erlangen Gliederung des Vorlesungsteils, 45 min. 1. Eine
Drei monotheistische Religionen ein Gott? Vorlesung und Seminar an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, 2.12.2010 Martin Hailer, Universität Erlangen Gliederung des Vorlesungsteils, 45 min. 1. Eine
5.Klasse Übergreifende Kompetenzen Personale Kompetenz Kommunikative. Religiöse. Methodenkompetenz
 - Schulspezifisches Fachcurriculum Ev. Religion, Klassenstufen 5 und 6, Max Planck Gymnasium Böblingen 5.Klasse Übergreifende en Personale Kommunikative Soziale Religiöse Die Schülerinnen und Schüler können
- Schulspezifisches Fachcurriculum Ev. Religion, Klassenstufen 5 und 6, Max Planck Gymnasium Böblingen 5.Klasse Übergreifende en Personale Kommunikative Soziale Religiöse Die Schülerinnen und Schüler können
Die Sondergutgleichnisse im Lukasevangelium
 Geisteswissenschaft Rieke Kurzeia Die Sondergutgleichnisse im Lukasevangelium Examensarbeit Technische Universität Braunschweig Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Grund-,
Geisteswissenschaft Rieke Kurzeia Die Sondergutgleichnisse im Lukasevangelium Examensarbeit Technische Universität Braunschweig Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Grund-,
Christologische Auslegung des AT s WAS KÖNNEN UND SOLLEN WIR VOM NEUEN TESTAMENT LERNEN?
 Christologische Auslegung des AT s WAS KÖNNEN UND SOLLEN WIR VOM NEUEN TESTAMENT LERNEN? Hermeneutik = Weichenstellung 2 www.invest-in-bavaria.com Fakten 3 Ca. 300 direkte Zitate aus dem AT im NT Ca. 10%
Christologische Auslegung des AT s WAS KÖNNEN UND SOLLEN WIR VOM NEUEN TESTAMENT LERNEN? Hermeneutik = Weichenstellung 2 www.invest-in-bavaria.com Fakten 3 Ca. 300 direkte Zitate aus dem AT im NT Ca. 10%
EKK Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament
 EKK Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament Begründet von Eduard Schweizer und Rudolf Schnackenburg Herausgegeben von Knut Backhaus, Christine Gerber, Thomas Söding und Samuel Vollenweider
EKK Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament Begründet von Eduard Schweizer und Rudolf Schnackenburg Herausgegeben von Knut Backhaus, Christine Gerber, Thomas Söding und Samuel Vollenweider
Modulhandbuch Ev. Theologie Bachelor Nebenfach
 handbuch Ev. Theologie Bachelor Nebenfach name 5.01 Biblische Theologie: Grundlagen der Bibelwissenschaften Art des Fähigkeit Orientierung im Kanon der biblischen Schriften Fähigkeit hermeneutischen Reflexion
handbuch Ev. Theologie Bachelor Nebenfach name 5.01 Biblische Theologie: Grundlagen der Bibelwissenschaften Art des Fähigkeit Orientierung im Kanon der biblischen Schriften Fähigkeit hermeneutischen Reflexion
Herzlich willkommen! Bibel. - Abend. Heute: Thora, Bibel und Koran im Vergleich
 Herzlich willkommen! Bibel. - Abend Die Bibel auf den Punkt gebracht. Die Bibel im Mittelpunkt. 60 Minuten biblischer Lehre, ansprechend und anschaulich vorgetragen. Immer dienstags 19:00-20:00 Uhr, alle
Herzlich willkommen! Bibel. - Abend Die Bibel auf den Punkt gebracht. Die Bibel im Mittelpunkt. 60 Minuten biblischer Lehre, ansprechend und anschaulich vorgetragen. Immer dienstags 19:00-20:00 Uhr, alle
Das Neue Testament in der Orthodoxen Kirche
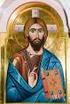 Lehr- und Studienbücher Orthodoxe Theologie Band 1 Konstantinos Nikolakopoulos Das Neue Testament in der Orthodoxen Kirche Grundlegende Fragen einer Einführung in das Neue Testament - - - - - - - - - -
Lehr- und Studienbücher Orthodoxe Theologie Band 1 Konstantinos Nikolakopoulos Das Neue Testament in der Orthodoxen Kirche Grundlegende Fragen einer Einführung in das Neue Testament - - - - - - - - - -
Das Reich. Marienheide, Mai 2011 Werner Mücher
 Das Reich Gottes Marienheide, Mai 2011 Werner Mücher Das Reich Gottes ist prinzipiell dasselbe wie das Reich der Himmel Reich Gottes antwortet auf die Frage: Wem gehört das Reich? Reich der Himmel antwortet
Das Reich Gottes Marienheide, Mai 2011 Werner Mücher Das Reich Gottes ist prinzipiell dasselbe wie das Reich der Himmel Reich Gottes antwortet auf die Frage: Wem gehört das Reich? Reich der Himmel antwortet
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn
 Geisteswissenschaft Margarete Berger Das Gleichnis vom verlorenen Sohn Eine Parabel von religionspolitischer Brisanz? Studienarbeit 1 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Fachbereich 2 Katholisch-Theologische
Geisteswissenschaft Margarete Berger Das Gleichnis vom verlorenen Sohn Eine Parabel von religionspolitischer Brisanz? Studienarbeit 1 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Fachbereich 2 Katholisch-Theologische
Karl Barth als Theologe der Neuzeit
 Stefan Holtmann Karl Barth als Theologe der Neuzeit Studien zur kritischen Deutung seiner Theologie Vandenhoeck & Ruprecht Inhalt Vorwort 9 Einleitung 1. Karl Barth als Theologe der Neuzeit - Facetten
Stefan Holtmann Karl Barth als Theologe der Neuzeit Studien zur kritischen Deutung seiner Theologie Vandenhoeck & Ruprecht Inhalt Vorwort 9 Einleitung 1. Karl Barth als Theologe der Neuzeit - Facetten
Grundinformation Theologische Ethik
 Grundinformation Theologische Ethik Bearbeitet von Wolfgang Lienemann 1. Auflage 2008. Taschenbuch. 319 S. Paperback ISBN 978 3 8252 3138 5 Format (B x L): 15 x 21,5 cm Gewicht: 425 g Weitere Fachgebiete
Grundinformation Theologische Ethik Bearbeitet von Wolfgang Lienemann 1. Auflage 2008. Taschenbuch. 319 S. Paperback ISBN 978 3 8252 3138 5 Format (B x L): 15 x 21,5 cm Gewicht: 425 g Weitere Fachgebiete
Curriculum Religion. Klasse 5 / 6. Wer bin ich? verschiedene Lebensformen, unterschiedliche Religionen, gelebte Vielfalt Cybermobbing
 Curriculum Religion Wesentliches Ziel des Religionsunterrichts am Ebert-Gymnasium ist, dass sich Schülerinnen und Schüler aus der Perspektive des eigenen Glaubens bzw. der eigenen Weltanschauung mit anderen
Curriculum Religion Wesentliches Ziel des Religionsunterrichts am Ebert-Gymnasium ist, dass sich Schülerinnen und Schüler aus der Perspektive des eigenen Glaubens bzw. der eigenen Weltanschauung mit anderen
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, Hamburg Ders., Vorlesungen über die Philosophie der Religon, Band 1, Stuttgart 1965
 Arbeitsbibliographie Literatur Hegel Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, Hamburg 1952 Ders., Vorlesungen über die Philosophie der Religon, Band 1, Stuttgart 1965 Ders., Vorlesungen
Arbeitsbibliographie Literatur Hegel Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, Hamburg 1952 Ders., Vorlesungen über die Philosophie der Religon, Band 1, Stuttgart 1965 Ders., Vorlesungen
Übersicht: schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre
 Übersicht: schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre Jahrgang Inhaltsfelder Kompetenzen 5 / 6 1 Ankommen hier sein Ich sein - Gemeinschaft erleben - Einzigartigkeit erfahren -Orientierung finden
Übersicht: schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre Jahrgang Inhaltsfelder Kompetenzen 5 / 6 1 Ankommen hier sein Ich sein - Gemeinschaft erleben - Einzigartigkeit erfahren -Orientierung finden
Veranstaltungen. Wintersemester. Biblische Theologie
 Veranstaltungen Die nachfolgende, rechtlich nicht verbindliche Tabelle bietet einen nach Fächern gegliederten Überblick über die in jedem Winter- bzw. Sommersemester angebotenen Veranstaltungen. In der
Veranstaltungen Die nachfolgende, rechtlich nicht verbindliche Tabelle bietet einen nach Fächern gegliederten Überblick über die in jedem Winter- bzw. Sommersemester angebotenen Veranstaltungen. In der
Qualifikationsphase (Q1) Auf der Suche nach Orientierung im Glauben und im Zweifel
 Unterrichtsvorhaben 1 Thema: Woran kann ich glauben? Christliche Antworten auf die Gottesfrage als Angebote Inhaltsfelder: IF 2: Christliche Antworten auf die Gottesfrage IF 1: Der Mensch in christlicher
Unterrichtsvorhaben 1 Thema: Woran kann ich glauben? Christliche Antworten auf die Gottesfrage als Angebote Inhaltsfelder: IF 2: Christliche Antworten auf die Gottesfrage IF 1: Der Mensch in christlicher
Fachschaft Kath. Religion. Schuleigenes Curriculum für die Klassen 5 und 6
 Fachschaft Schuleigenes Curriculum für die 18. Mai 2004 Kompetenz Pflichtinhalte Bemerkungen Die Schüler können. - Bibelstellen auffinden und nachschlagen - in Grundzügen die Entstehung der biblischen
Fachschaft Schuleigenes Curriculum für die 18. Mai 2004 Kompetenz Pflichtinhalte Bemerkungen Die Schüler können. - Bibelstellen auffinden und nachschlagen - in Grundzügen die Entstehung der biblischen
Die Reformatoren und die Zukunft Israels. Die Reformatoren u. d. Israelfrage_sfweber
 Die Reformatoren und die Zukunft Israels 1 Die Reformatoren und die Zukunft Israels 2 Calvin und die Israelfrage Calvin u. d. Israelfrage_sfweber 3 Die geistige Verwandtschaft mit Augustin Aurelius Augustinus
Die Reformatoren und die Zukunft Israels 1 Die Reformatoren und die Zukunft Israels 2 Calvin und die Israelfrage Calvin u. d. Israelfrage_sfweber 3 Die geistige Verwandtschaft mit Augustin Aurelius Augustinus
Arbeitsfragen zum Johannesevangelium
 Geisteswissenschaft Rex-Oliver Funke Arbeitsfragen zum Johannesevangelium Studienarbeit Hausarbeit Neues Testament Arbeitsfragen zum Johannesevangelium Abgabetermin: 21.01.2012 1 Inhaltsverzeichnis 1.
Geisteswissenschaft Rex-Oliver Funke Arbeitsfragen zum Johannesevangelium Studienarbeit Hausarbeit Neues Testament Arbeitsfragen zum Johannesevangelium Abgabetermin: 21.01.2012 1 Inhaltsverzeichnis 1.
Die SuS können vom Umgang mit eigenen Erfahrungen von Freude und Glück, Gelingen und Scheitern, Leid und Tod, Schuld und Vergebung erzählen.
 Die SuS können vom Umgang mit eigenen Erfahrungen von Freude und Glück, Gelingen und Scheitern, Leid und Tod, Schuld und Vergebung erzählen. 3.2.1 (1) Mensch Kl. 3/4 Die SuS können biblische (z.b. Jakob
Die SuS können vom Umgang mit eigenen Erfahrungen von Freude und Glück, Gelingen und Scheitern, Leid und Tod, Schuld und Vergebung erzählen. 3.2.1 (1) Mensch Kl. 3/4 Die SuS können biblische (z.b. Jakob
Österreichische Biblische Studien 42. Jesus Didáskalos
 Österreichische Biblische Studien 42 Jesus Didáskalos Studien zu Jesus als Lehrer bei den Synoptikern und im Rahmen der antiken Kultur- und Sozialgeschichte Bearbeitet von Veronika Tropper 1. Auflage 2012.
Österreichische Biblische Studien 42 Jesus Didáskalos Studien zu Jesus als Lehrer bei den Synoptikern und im Rahmen der antiken Kultur- und Sozialgeschichte Bearbeitet von Veronika Tropper 1. Auflage 2012.
Missio Dei. Mission aus dem Wesen Gottes
 Thomas Schirrmacher Missio Dei Mission aus dem Wesen Gottes Komplementäre Dogmatik Reihe 2 VTR / RVB Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
Thomas Schirrmacher Missio Dei Mission aus dem Wesen Gottes Komplementäre Dogmatik Reihe 2 VTR / RVB Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
/ Paulus <Apostel>/ Briefe
 Neue zu in der UB Landau (2001-2012) nummer: 1 Muller, Peter Der Brief an Philemon Verfasserang. ubers. und erklart von Peter Muller Ausgabe 1. Aufl. dieser Auslegung Gottingen Vandenhoeck & Ruprecht Jahr
Neue zu in der UB Landau (2001-2012) nummer: 1 Muller, Peter Der Brief an Philemon Verfasserang. ubers. und erklart von Peter Muller Ausgabe 1. Aufl. dieser Auslegung Gottingen Vandenhoeck & Ruprecht Jahr
Theologie des Neuen Testaments
 Udo Schnelle Theologie des Neuen Testaments Vandenhoeck & Ruprecht Inhalt 1 Der Zugang: Theologie des Neuen Testaments als Sinnbildung. 15 1.1 Das Entstehen von Geschichte 17 1.2 Geschichte als Sinnbildung
Udo Schnelle Theologie des Neuen Testaments Vandenhoeck & Ruprecht Inhalt 1 Der Zugang: Theologie des Neuen Testaments als Sinnbildung. 15 1.1 Das Entstehen von Geschichte 17 1.2 Geschichte als Sinnbildung
Literatur zur Vorlesung Praktische Philosophie (1), Methodische Grundlagen:
 Literatur zur Vorlesung Praktische Philosophie (1), Methodische Grundlagen: Zur Phänomenologie Edmund Husserl. Cartesianische Meditationen. Eine Einleitung in die Phänomenologie. Hrsg. v. Elisabeth Ströker.
Literatur zur Vorlesung Praktische Philosophie (1), Methodische Grundlagen: Zur Phänomenologie Edmund Husserl. Cartesianische Meditationen. Eine Einleitung in die Phänomenologie. Hrsg. v. Elisabeth Ströker.
Kompetenzraster - Jahrgangsstufe 6: Mein Recht und das Recht der anderen. Gerechtigkeit und die neue Gerechtigkeit Jesu
 Kompetenzraster - Jahrgangsstufe 6: Mein Recht und das Recht der anderen. Gerechtigkeit und die neue Gerechtigkeit Jesu - Auf der Suche nach Konfliktlösungsmöglichkeiten Stand: 11.06.2015 Leitperspektiven
Kompetenzraster - Jahrgangsstufe 6: Mein Recht und das Recht der anderen. Gerechtigkeit und die neue Gerechtigkeit Jesu - Auf der Suche nach Konfliktlösungsmöglichkeiten Stand: 11.06.2015 Leitperspektiven
Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft
 Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft Teilband 2 Hans-Georg Gadamer I Heinrich. Fries Mythos und Wissenschaft Alois Halder / Wolf gang Welsch Kunst und Religion Max Seckler I Jakob J. Petuchowski
Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft Teilband 2 Hans-Georg Gadamer I Heinrich. Fries Mythos und Wissenschaft Alois Halder / Wolf gang Welsch Kunst und Religion Max Seckler I Jakob J. Petuchowski
Melito von Sardes: Passa-Homilie
 Geisteswissenschaft Magnus Kerkloh Melito von Sardes: Passa-Homilie Theologie der ältesten erhaltenen Osterpredigt des Christentums Studienarbeit Unterseminar: Ostern in der Alten Kirche SS 2000 Referat:
Geisteswissenschaft Magnus Kerkloh Melito von Sardes: Passa-Homilie Theologie der ältesten erhaltenen Osterpredigt des Christentums Studienarbeit Unterseminar: Ostern in der Alten Kirche SS 2000 Referat:
THEOLOGIE UND KIRCHENLEITUNG
 THEOLOGIE UND KIRCHENLEITUNG Festschrift für Peter Steinacker zum 60. Geburtstag herausgegeben von Hermann Deuser, Gesche Linde und Sigurd Rink N. G. ELWERT VERLAG MARBURG 2003 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort
THEOLOGIE UND KIRCHENLEITUNG Festschrift für Peter Steinacker zum 60. Geburtstag herausgegeben von Hermann Deuser, Gesche Linde und Sigurd Rink N. G. ELWERT VERLAG MARBURG 2003 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort
Lehrplan Katholische Religionslehre. Leitmotiv 5/6: Miteinander unterwegs von Gott geführt
 Klasse 5 Leitmotiv 5/6: Miteinander unterwegs von Gott geführt Bereiche Sprache der Religion Altes Testament Kirche und ihr Glaube Ethik/ Anthropologie Religion und Konfession Zielsetzungen/Perspektiven
Klasse 5 Leitmotiv 5/6: Miteinander unterwegs von Gott geführt Bereiche Sprache der Religion Altes Testament Kirche und ihr Glaube Ethik/ Anthropologie Religion und Konfession Zielsetzungen/Perspektiven
Institut für Evangelische Theologie Professur für Biblische Theologie Prof. Dr. M. Klinghardt. Angebote für Master Antike Kulturen.
 Institut für Evangelische Theologie Professur für Prof. Dr. M. Klinghardt Angebote für Master Antike Kulturen im SS 2017 Die vier Angebote von Prof. Dr. Klinghardt für Master Antike Kulturen (folgende
Institut für Evangelische Theologie Professur für Prof. Dr. M. Klinghardt Angebote für Master Antike Kulturen im SS 2017 Die vier Angebote von Prof. Dr. Klinghardt für Master Antike Kulturen (folgende
UE: Gleichnisse G 5/6
 UE: Gleichnisse G 5/6 - kennen mindestens drei Gleichnisse, - kennen das Gleichnis als typische Redeform Jesu, - wissen um die Naherwartung zur Zeit Jesu. - können die Struktur der Gleichnisse erläutern,
UE: Gleichnisse G 5/6 - kennen mindestens drei Gleichnisse, - kennen das Gleichnis als typische Redeform Jesu, - wissen um die Naherwartung zur Zeit Jesu. - können die Struktur der Gleichnisse erläutern,
2 von 6 Herbst 2005 a 1 Das synoptische Problem: Worin besteht es? Wie und mit welchen Argumenten wird es durch die Zwei-Quellen-Theorie gelöst? Welch
 Nicht vertieftes Studium der Katholischen Religionslehre Prüfungsthemen der letzten Jahre im Fach Biblische Einleitungswissenschaften und Theologie / Neues Testament Hinweis: n = LPO neu (von 2002); a
Nicht vertieftes Studium der Katholischen Religionslehre Prüfungsthemen der letzten Jahre im Fach Biblische Einleitungswissenschaften und Theologie / Neues Testament Hinweis: n = LPO neu (von 2002); a
Fach: Evangelische Religion Jahrgangsstufe: 9 Inhalt: Die Frage nach Gott
 Fach: Evangelische Religion Jahrgangsstufe: 9 Inhalt: Die Frage nach Gott Leitperspektive Inhaltsfeld Kompetenzen/ Abstufungen Inhaltsbezogene Kompetenzen* Zeit Fächerübergreifend/ - verbindend Christliche
Fach: Evangelische Religion Jahrgangsstufe: 9 Inhalt: Die Frage nach Gott Leitperspektive Inhaltsfeld Kompetenzen/ Abstufungen Inhaltsbezogene Kompetenzen* Zeit Fächerübergreifend/ - verbindend Christliche
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
 Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising: Predigt bei der Weihe der Ständigen Diakone 1 7. Oktober 2017, München, Dom zu unserer Lieben Frau veröffentlicht in: Diakon Anianus, 2018 Biblische
Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising: Predigt bei der Weihe der Ständigen Diakone 1 7. Oktober 2017, München, Dom zu unserer Lieben Frau veröffentlicht in: Diakon Anianus, 2018 Biblische
Unterrichtseinheit Inhaltsbezogene Kompetenzen Bemerkungen
 Curriculum Klasse 5 Unterrichtseinheit Inhaltsbezogene Kompetenzen Bemerkungen Ich und die Gruppe : sich mit den Fragen wer kann/will ich sein auseinandersetzen (3.1.1.1.) darstellen, wie sie und andere
Curriculum Klasse 5 Unterrichtseinheit Inhaltsbezogene Kompetenzen Bemerkungen Ich und die Gruppe : sich mit den Fragen wer kann/will ich sein auseinandersetzen (3.1.1.1.) darstellen, wie sie und andere
Theologie des Neuen Testaments
 Ulrich Wilckens Theologie des Neuen Testaments Band I: Geschichte der urchristlichen Theologie Teilband 2: Jesu Tod und Auferstehung und die Entstehung der Kirche aus Juden und Heiden Neukirchener Inhalt
Ulrich Wilckens Theologie des Neuen Testaments Band I: Geschichte der urchristlichen Theologie Teilband 2: Jesu Tod und Auferstehung und die Entstehung der Kirche aus Juden und Heiden Neukirchener Inhalt
Zusammenschau (Synopse) der alten und neuen Einheitsübersetzung
 Zusammenschau (Synopse) der alten und neuen Einheitsübersetzung EVANGELIUM NACH MARKUS Kapitel 2 Herausgeber: Bibelpastorale Arbeitsstelle HA Seelsorge in der Diözese Regensburg in Kooperation mit Diözesanstelle
Zusammenschau (Synopse) der alten und neuen Einheitsübersetzung EVANGELIUM NACH MARKUS Kapitel 2 Herausgeber: Bibelpastorale Arbeitsstelle HA Seelsorge in der Diözese Regensburg in Kooperation mit Diözesanstelle
Die Rückkehr der Zwölf und die Speisung der 5000
 Geisteswissenschaft Matthias Kaiser Die Rückkehr der Zwölf und die Speisung der 5000 Zur Perikope Mk 6,30-44 Studienarbeit Die Rückkehr der Zwölf und die Speisung der Fünftausend Eine Hausarbeit über
Geisteswissenschaft Matthias Kaiser Die Rückkehr der Zwölf und die Speisung der 5000 Zur Perikope Mk 6,30-44 Studienarbeit Die Rückkehr der Zwölf und die Speisung der Fünftausend Eine Hausarbeit über
Einführungsvorlesung. Wirtschafts- und Sozialgeschichte. PD Dr. Hannelore Putz
 Einführungsvorlesung Wirtschafts- und Sozialgeschichte PD Dr. Hannelore Putz Aufbau der Vorlesung Ein genuin interdisziplinäres Fach: die Wirtschaftsgeschichte Anmerkungen zur Sozialgeschichte Die Professur
Einführungsvorlesung Wirtschafts- und Sozialgeschichte PD Dr. Hannelore Putz Aufbau der Vorlesung Ein genuin interdisziplinäres Fach: die Wirtschaftsgeschichte Anmerkungen zur Sozialgeschichte Die Professur
Katholische Religionslehre Klasse 6
 Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für das Fach Katholische Religionslehre Klasse 6 Stand: September 2017 Unterrichtsvorhaben: Gleichnisse Inhaltliche Schwerpunkte ( Inhaltsfelder) IF1: Menschsein
Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für das Fach Katholische Religionslehre Klasse 6 Stand: September 2017 Unterrichtsvorhaben: Gleichnisse Inhaltliche Schwerpunkte ( Inhaltsfelder) IF1: Menschsein
Katholische Religionslehre, Schuleigener Lehrplan
 Clemens-Brentano-Gymnasium An der Kreuzkirche 7 48249 Dülmen Telefon 02594 4893 Telefax 02594 949908 sekretariat@cbg.duelmen.org schulleitung@cbg.duelmen.org cbg.duelmen.org Katholische Religionslehre,
Clemens-Brentano-Gymnasium An der Kreuzkirche 7 48249 Dülmen Telefon 02594 4893 Telefax 02594 949908 sekretariat@cbg.duelmen.org schulleitung@cbg.duelmen.org cbg.duelmen.org Katholische Religionslehre,
Evangelium Apostelgeschichte Christi Geburt Taufe Christi Verklärung Palmsonntag
 Das Evangelium ist der wichtigste Teil des Neuen Testaments. Es wurde von 4 Aposteln geschrieben: Matthäus (Abkürzung: Mt), Markus (Mk), Lukas (Lk), und Johannes (Joh). Die Apostelgeschichte (Apg) ist
Das Evangelium ist der wichtigste Teil des Neuen Testaments. Es wurde von 4 Aposteln geschrieben: Matthäus (Abkürzung: Mt), Markus (Mk), Lukas (Lk), und Johannes (Joh). Die Apostelgeschichte (Apg) ist
Mündliche Reifeprüfung im Fach Katholische Religion (RK) Beispiele für kompetenzorientierte Aufgabenstellungen
 Reifeprüfung NEU (AHS-Matura 2014) Mündliche Reifeprüfung im Fach Katholische Religion (RK) Beispiele für kompetenzorientierte Aufgabenstellungen Themenbereich 1 orientiert an den Lernzielen der 6. Klasse
Reifeprüfung NEU (AHS-Matura 2014) Mündliche Reifeprüfung im Fach Katholische Religion (RK) Beispiele für kompetenzorientierte Aufgabenstellungen Themenbereich 1 orientiert an den Lernzielen der 6. Klasse
Kelterfest, Mt 9,14-16 Feste fasten oder feste festen
 Kelterfest, 11.09.2016 Mt 9,14-16 Feste fasten oder feste festen Matthäus 9,14-16: 14 Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen: Warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten
Kelterfest, 11.09.2016 Mt 9,14-16 Feste fasten oder feste festen Matthäus 9,14-16: 14 Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen: Warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten
Philosophie des 19. Jahrhunderts. Emerich Coreth Peter Ehlen Josef Schmidt. Grundkurs Philosophie 9. Zweite, durchgesehene Auflage
 Emerich Coreth Peter Ehlen Josef Schmidt Philosophie des 19. Jahrhunderts Grundkurs Philosophie 9 Zweite, durchgesehene Auflage Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln Inhalt A. Von Kant zum Deutschen
Emerich Coreth Peter Ehlen Josef Schmidt Philosophie des 19. Jahrhunderts Grundkurs Philosophie 9 Zweite, durchgesehene Auflage Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln Inhalt A. Von Kant zum Deutschen
KMK. Rheinland-Pfalz EPA EPA. Bildungsstandards +Beispielaufgaben. Bildungsstandards +Beispielaufgaben. Lehrpläne. Erwartungshorizont Klasse
 KMK Rheinland-Pfalz EPA 13 EPA 12 11 Bildungsstandards +Beispielaufgaben 10 9 8 7 Bildungsstandards +Beispielaufgaben Erwartungshorizont Klasse 8 Lehrpläne 5-10 6 Erwartungshorizont Klasse 6 5 Allgemeine
KMK Rheinland-Pfalz EPA 13 EPA 12 11 Bildungsstandards +Beispielaufgaben 10 9 8 7 Bildungsstandards +Beispielaufgaben Erwartungshorizont Klasse 8 Lehrpläne 5-10 6 Erwartungshorizont Klasse 6 5 Allgemeine
Städtisches Gymnasium Olpe. Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre
 Städtisches Gymnasium Olpe Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Qualifikationsphase 1-1. Halbjahr Halbjahresthema: Gotteslehre / Theologie Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wie kann ich mit
Städtisches Gymnasium Olpe Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Qualifikationsphase 1-1. Halbjahr Halbjahresthema: Gotteslehre / Theologie Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wie kann ich mit
Wilfried Eisele / Christoph Schaefer / Hans-Ulrich Weidemann (Hg.) Aneignung durch Transformation
 www.claudia-wild.de: HBS_00074_Titelei [Druck-PDF]/08.03.2013/Seite 1 Wilfried Eisele / Christoph Schaefer / Hans-Ulrich Weidemann (Hg.) Aneignung durch Transformation www.claudia-wild.de: HBS_00074_Titelei
www.claudia-wild.de: HBS_00074_Titelei [Druck-PDF]/08.03.2013/Seite 1 Wilfried Eisele / Christoph Schaefer / Hans-Ulrich Weidemann (Hg.) Aneignung durch Transformation www.claudia-wild.de: HBS_00074_Titelei
Einleitung in das Neue Testament Grundlegung
 Einleitung in das Neue Testament Grundlegung Vorlesung Sommersemester 2013 1 Einführung A. Schwerpunkte urchristlicher Geschichte I. Die Voraussetzung: Das Wirken des Jesus von Nazareth 2 Die Botschaft
Einleitung in das Neue Testament Grundlegung Vorlesung Sommersemester 2013 1 Einführung A. Schwerpunkte urchristlicher Geschichte I. Die Voraussetzung: Das Wirken des Jesus von Nazareth 2 Die Botschaft
Die Verkündigung vom Reich Gottes und die Ethik Jesu
 Die Verkündigung vom Reich Gottes und die Ethik Jesu S. 74-93 WS 2012/13 STh Dogmatik 2 / Doris Strahm Vorlesung 5 / 1 Die Tora: Grundlage der Ethik Jesu (S. 74-77) Tora: hebr. Weisung Wegweisung, "Gesetz"
Die Verkündigung vom Reich Gottes und die Ethik Jesu S. 74-93 WS 2012/13 STh Dogmatik 2 / Doris Strahm Vorlesung 5 / 1 Die Tora: Grundlage der Ethik Jesu (S. 74-77) Tora: hebr. Weisung Wegweisung, "Gesetz"
Inhaltsverzeichnis. Abkürzungsverzeichnis. Vorwort. Vorwort zur 3. Auflage. TEIL I Ein eigener Weg zur Bibel 1. Einführung 1.
 V Abkürzungsverzeichnis Vorwort Vorwort zur 3. Auflage X XI XII TEIL I Ein eigener Weg zur Bibel 1 Einführung 1 Bewusstwerdung 4 1. Kapitel: Textwahrnehmung 6 1.1 Annäherung 6 1.1.1 Abgrenzung und Kontext
V Abkürzungsverzeichnis Vorwort Vorwort zur 3. Auflage X XI XII TEIL I Ein eigener Weg zur Bibel 1 Einführung 1 Bewusstwerdung 4 1. Kapitel: Textwahrnehmung 6 1.1 Annäherung 6 1.1.1 Abgrenzung und Kontext
KC Evangelische Religion Leitfrage: Nach dem Menschen fragen. Erwartete Kompetenzen. 1./2. Schuljahrgang 3./4 Schuljahrgang
 KC Evangelische Religion Leitfrage: Nach dem Menschen fragen Erwartete Kompetenzen 1./2. Schuljahrgang 3./4 Schuljahrgang nehmen Freude, Trauer, Angst, Wut und Geborgenheit als Erfahrungen menschlichen
KC Evangelische Religion Leitfrage: Nach dem Menschen fragen Erwartete Kompetenzen 1./2. Schuljahrgang 3./4 Schuljahrgang nehmen Freude, Trauer, Angst, Wut und Geborgenheit als Erfahrungen menschlichen
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule
 Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Titel des Autonomen Tutoriums: Der Begriff der Arbeit in den Ökonomisch-Philosophischen Manuskripten von Karl Marx
 Bewerbung Autonomes Tutorium für das Sommersemester 2017 am Fachbereich 08 Eingereicht von Laurien Simon Wüst (Studium von Philosophie, Politikwissenschaften und Soziologie, Mail: lauriensimon@gmx.de)
Bewerbung Autonomes Tutorium für das Sommersemester 2017 am Fachbereich 08 Eingereicht von Laurien Simon Wüst (Studium von Philosophie, Politikwissenschaften und Soziologie, Mail: lauriensimon@gmx.de)
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 6 Unterrichtsvorhaben: Die gute Nachricht breitet sich aus die frühe Kirche
 Unterrichtsvorhaben: Die gute Nachricht breitet sich aus die frühe Kirche Inhaltliche Schwerpunkte ( Inhaltsfelder): Anfänge der Kirche (IHF 5); Bildliches Sprechen von Gott (IHF 2) Lebensweltliche Relevanz:
Unterrichtsvorhaben: Die gute Nachricht breitet sich aus die frühe Kirche Inhaltliche Schwerpunkte ( Inhaltsfelder): Anfänge der Kirche (IHF 5); Bildliches Sprechen von Gott (IHF 2) Lebensweltliche Relevanz:
JAHRESPLANUNG Schulstufe 1
 JAHRESPLANUNG Schulstufe 1 INHALT / THEMEN Themenschwerpunkte Wer bin ich? Wer ich für andere bin LP / Kompetenzen 1 Das eigene Selbst- und Weltverständnis sowie den persönlichen Glauben wahrnehmen und
JAHRESPLANUNG Schulstufe 1 INHALT / THEMEN Themenschwerpunkte Wer bin ich? Wer ich für andere bin LP / Kompetenzen 1 Das eigene Selbst- und Weltverständnis sowie den persönlichen Glauben wahrnehmen und
Inhalt Einführung Altes Testament
 Inhalt Einführung Ulrich Volp: Menschlicher Tod als Thema der Theologie.. 1 1. Abgrenzung des Themas: Um welche Fragen geht es?. 1 2. Überblick über die Kapitel dieses Bandes... 3 3. Begriffsklärungen...
Inhalt Einführung Ulrich Volp: Menschlicher Tod als Thema der Theologie.. 1 1. Abgrenzung des Themas: Um welche Fragen geht es?. 1 2. Überblick über die Kapitel dieses Bandes... 3 3. Begriffsklärungen...
Werner Müller Bürgertum und Christentum
 Werner Müller Bürgertum und Christentum MÃ?ller, Werner BÃ?rgertum und Christentum 1982 digitalisiert durch: IDS Luzern Bürgertum und Christentum 7. Das Problem einer theologischen Fundamentalhermeneutik
Werner Müller Bürgertum und Christentum MÃ?ller, Werner BÃ?rgertum und Christentum 1982 digitalisiert durch: IDS Luzern Bürgertum und Christentum 7. Das Problem einer theologischen Fundamentalhermeneutik
Kern- und Schulcurriculum evangelische Religion Klasse 5/6. Stand Schuljahr 2009/10
 Kern- und Schulcurriculum evangelische Religion Klasse 5/6 Stand Schuljahr 2009/10 Übergreifende und übergeordnete Kompetenzen Unter dem Zuspruch und Anspruch es und im Blick auf entwicklungsgemäßes, ganzheitliches
Kern- und Schulcurriculum evangelische Religion Klasse 5/6 Stand Schuljahr 2009/10 Übergreifende und übergeordnete Kompetenzen Unter dem Zuspruch und Anspruch es und im Blick auf entwicklungsgemäßes, ganzheitliches
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Qualifikationsphase Unterrichtsvorhaben in Q1: Wer ist Jesus? Eine Einführung in die Christologie
 Unterrichtsvorhaben in Q1: Wer ist Jesus? Eine Einführung in die Christologie Inhaltliche Schwerpunkte ( Inhaltsfelder): Das Zeugnis vom Zuspruch und Anspruch Jesu Christi (IHF3) SK2, SK6 MK1, MK2, MK3,
Unterrichtsvorhaben in Q1: Wer ist Jesus? Eine Einführung in die Christologie Inhaltliche Schwerpunkte ( Inhaltsfelder): Das Zeugnis vom Zuspruch und Anspruch Jesu Christi (IHF3) SK2, SK6 MK1, MK2, MK3,
Interner Lehrplan: Kursthemen / Obligatorische Inhalte und Methoden der Fachschaft Katholische Religion am Gymnasium Zitadelle 2009/2010
 11/I Kann man angesichts Glauben und Wissen naturwissenschaftlicher Praxis des Glaubens Erkenntnisse heute Wirklichkeit der Kirche noch glauben? - Glauben und Wissen als Freiheit und Determinismus spezifische
11/I Kann man angesichts Glauben und Wissen naturwissenschaftlicher Praxis des Glaubens Erkenntnisse heute Wirklichkeit der Kirche noch glauben? - Glauben und Wissen als Freiheit und Determinismus spezifische
Schulinterner Arbeitsplan Jahrgang 11. Inhaltsbezogene Kompetenzen
 Schulinterner Arbeitsplan Jahrgang 11 Halbjahresthema: Religiöse Erfahrungen in der heutigen Welt Unterrichtssequenz 1: Ist Religion an Orte gebunden? Religion im Alltag erleben Kompetenzbereich: Mensch
Schulinterner Arbeitsplan Jahrgang 11 Halbjahresthema: Religiöse Erfahrungen in der heutigen Welt Unterrichtssequenz 1: Ist Religion an Orte gebunden? Religion im Alltag erleben Kompetenzbereich: Mensch
Verbindliche Zuordnung der prozessbezogenen und inhaltsbezogenen Kompetenzen für den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht in Jahrgang 6
 Verbindliche Zuordnung der prozessbezogenen und inhaltsbezogenen Kompetenzen für den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht in Jahrgang 6 Inhaltsbezogene Kompetenzbereiche: 1. Nach dem Menschen
Verbindliche Zuordnung der prozessbezogenen und inhaltsbezogenen Kompetenzen für den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht in Jahrgang 6 Inhaltsbezogene Kompetenzbereiche: 1. Nach dem Menschen
Predigt Die Berufung des Zolleinnehmers Levi 27 Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann
 Texte: Lukas 5,27-39 Autor: Hartmut Burghoff Predigt Die Berufung des Zolleinnehmers Levi 27 Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi.
Texte: Lukas 5,27-39 Autor: Hartmut Burghoff Predigt Die Berufung des Zolleinnehmers Levi 27 Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi.
