DIE COLUMBIA-KATASTROPHE: EINE ORGANISATIONSSOZIOLOGISCHE BETRACHTUNG
|
|
|
- Ulrich Bachmeier
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 DIE COLUMBIA-KATASTROPHE: EINE ORGANISATIONSSOZIOLOGISCHE BETRACHTUNG Bachelorarbeit im Studiengang Soziologie in der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld VERFASSER: Gregor Reimann Altenburgerstraße 33a Bamberg ERSTKORREKTOR: Dr. Sven Kette ZWEITKORREKTORIN: Prof. Dr. Veronika Tacke Alle Rechte beim Verfasser
2 Die Columbia-Katastrophe: Eine organisationssoziologische Betrachtung Die Columbia-Katastrophe: Eine organisationssoziologische Betrachtung 1 Einleitung 3 2 Die Columbia-Katastrophe: Ablauf, Hergang und Technik 5 3 Organisationstheorie, Entscheidungen und Prämissen 7 4 Entscheidungsprozesse vor der Columbia-Katastrophe Die Abweichung als Normalfall: Spezifikation und organisationale Praxis Normale Abweichungen und die Verschiebung eines Konditionalprogramms 14 5 Entscheidungsprozesse während der Columbia-Katastrophe 22 6 Organisationskultur als Entscheidungsprämisse 32 7 Resümee und Ausblick 35 8 Literaturverzeichnis 37
3 Einleitung 1 Einleitung Am 1. Februar 2003 zerbrach die Raumfähre Columbia bei der Rückkehr von ihrer 28. Mission STS gegen 9 Uhr Ortszeit am Himmel über Texas in einer Höhe von 63 Kilometern und einer Geschwindigkeit von Mach 18 beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Alle sieben Besatzungsmitglieder kamen dabei ums Leben. Die vorliegende Arbeit vertritt die These, dass im Fall der Columbia-Katastrophe nicht nur technische Ursachen für den Unfall verantwortlich waren, sondern darüber hinaus organisationale Faktoren zur Erklärung des Sachverhaltes berücksichtigt werden müssen. Hierbei soll der Fokus auf den Entscheidungsprozessen der Organisation liegen, wonach der Unfall nur den Endpunkt einer Reihe von Fehlentscheidungen markiert. Ziel soll es sein, zu belegen, dass die Ursachen weder individuell menschlicher noch allein technischer, sondern organisationaler bzw. systemischer Natur sind. In einem ersten Schritt sollen abrissartig Ablauf und Hergang der Katastrophe geschildert werden, um dem Leser einen Überblick über die Ereignisse, die am Tag des Unfalls stattfanden, und ein grundlegendes Verständnis der technischen Umstände zu gewähren. Um die These danach erhärten zu können, soll als theoretische Grundlage in Kapitel 3 zunächst die Organisationstheorie Niklas Luhmanns vorgestellt werden. Daher soll erst eine kurze Einführung in die Konzepte und Begriffe erfolgen, die später im Rahmen dieser Arbeit Anwendung finden. Hierbei sollen insbesondere die Entscheidungsprämissen als analytisches Werkzeug verwendet werden, um hieraus die Bedingungen für die zukünftigen Entscheidungen abzuleiten. Im darauf folgenden Abschnitt 4 sollen die Entscheidungsprozesse vor Columbia geschildert werden, um die Grundlagen, auf denen die Entscheidungen, die während der Mission getroffen wurden, aufzuzeigen. Der erste Teil beinhaltet eine allgemeine Hinleitung zum technischen Problem und dokumentiert die organisationale Praxis; der zweite soll den allmählichen Prozess der Entstehung einer Differenz zwischen dem ursprünglichen Programm und dem Organisationshandeln verdeutlichen. 1 STS: englische Abkürzung für Space-Transportation-System. Dieser Begriff bezeichnet die gesamten Komponenten: Orbiter, Feststoffraketen und Außentank. Zugleich handelt es sich in Verbindung mit einer Zahl um Missionbezeichnungen, die aber mit aufsteigender Nummerierung nicht zwingend die chronologische Abfolge widerspiegeln. 3
4 Einleitung Im 5. Kapitel werden die Prozesse, die im Zeitraum der Columbia-Mission abgelaufen sind, rekonstruiert. Herausgestellt werden soll, dass sie auf die in Abschnitt 4 geschilderten Prozesse zurückzuführen sind. Darüber hinaus soll eine erweiterte Untersuchung der Entscheidungsprämissen erfolgen und die rekursiven Entscheidungszusammenhänge innerhalb dieses Zeitraums sollen aufgezeigt werden. Das letzte Kapitel behandelt die Organisationskultur als unentscheidbare Entscheidungsprämisse. Hierbei soll es darum gehen, die bisher beobachteten Entscheidungszusammenhänge in den größeren Kontext der Geschichte der Organisation zu stellen, um den Erklärungsansatz zu erweitern und um ein vertieftes Verständnis der Entscheidungsprozesse zu erlangen. Grundlage der Arbeit ist der im August 2003 erschienene Abschlussbericht 2 der Untersuchungskommission 3, der sich auf knapp 250 Seiten mit den Ursachen der Katastrophe befasst. Anschließend folgt nun die Schilderung der technischen Umstände sowie des Ablaufs und Hergangs der Columbia-Katastrophe. 2 letzter Abruf am CAIB: englische Abkürzung für Columbia Accident Investigation Board. Deutsche Übersetzung: Untersuchungskommission. Es handelt sich dabei um die Untersuchungskommission, die sich mit den Unfallursachen der missglückten Columbia-Mission befasste. 4
5 Die Columbia-Katastrophe: Ablauf, Hergang und Technik 2 Die Columbia-Katastrophe: Ablauf, Hergang und Technik Orbiter und Außentank eines Spaceshuttles sind konstruktionsbedingt mit einer Art Zweibein verbunden. An dieser Verbindungsstelle befindet sich eine Rampe aus Schaumstoff, die die aerodynamischen Eigenschaften des Zweibeins verbessern und die Konstruktion von herabfallenden Teilen schützen soll. Die Oberfläche eines Spaceshuttles ist größtenteils mosaikartig durch einen Hitzeschild bedeckt. Dieser besteht aus rund einzelnen Hitzekacheln, u.a. aus RCC-Kacheln, 4 und ist für eine Raumfähre von existentieller Bedeutung: In der gesamten Landephase muss ein Spaceshuttle von 25-facher Schallgeschwindigkeit auf nur ca. 320 km/h abgebremst werden; dies wird erreicht, indem die Bewegungsenergie des Spaceshuttles in Wärmeenergie, die durch Reibung mit der Luft entsteht, umgesetzt wird. Dabei entstehen Temperaturen bis zu 1650 Grad Celsius, die vom Hitzeschild abgefangen werden müssen (vgl. CAIB 2003, S. 14). Bei +81 Sekunden nach dem Start des Columbia-Spaceshuttles hat sich nun die linke Schaumstofframpe gelöst und ist in die Vorderkante der linken Tragfläche eingeschlagen. Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre wurde dann festgestellt, dass vier Hitzesensoren, die in der linken Tragfläche angebracht sind, im Abstand von fünf Sekunden ausgefallen sind. Danach bemerkte die Bodenkontrolle, dass es zudem zu einem Druckverlust der Reifen des linken Fahrwerks kam. Kurz danach brach der Funkkontakt zwischen der Shuttle-Besatzung und der Bodenkontrolle ab und konnte nicht wieder hergestellt werden. Der Shuttle verglühte beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre (vgl. CAIB 2003, S. 38ff.). Die Untersuchungskommission sieht als wahrscheinlichstes Unfallszenario den folgenden Hergang: Dadurch dass beim Einschlag des Schaumstoffstücks der Hitzeschild durchbrochen wurde, konnten beim Eintritt in die Erdatmosphäre heiße Gase, die aufgrund von Reibung zwischen Atmosphäre und Shuttle entstehen, durch das Loch in die innere Struktur der Tragfläche gelangen. Das führte zu einem Schmelzen der Aluminiumkonstruktion der Tragfläche. Mit dem Verlust der Festigkeit kam es dann zum Herausbrechen von Teilen der Tragfläche, so dass die ganze aerodynamische Kon- 4 RCC: englische Abkürzung für Reenforced-Carbon-Carbon. Dabei handelt es sich um Kohlenfaserstoff verstärkten Kohlenstoff, der in Nase und Vorderkanten der Flügel als Hitzeschutz verwendet wird. 5
6 Die Columbia-Katastrophe: Ablauf, Hergang und Technik struktion des Shuttles gestört wurde. Dadurch konnte der Shuttle nicht im vorgesehenen Winkel Kurs halten, kam ins Trudeln und zerbrach (vgl. CAIB 2003, S ). Im Anschluss folgt eine kurze Einführung in die Begrifflichkeiten und Konzepte der Organisationstheorie Niklas Luhmanns. 6
7 Organisationstheorie, Entscheidungen und Prämissen 3 Organisationstheorie, Entscheidungen und Prämissen Niklas Luhmann definiert Organisationen als Sozialsysteme [ ], die aus Entscheidungen bestehen, und die Entscheidungen, aus denen sie bestehen, durch die Entscheidungen, aus denen sie bestehen, selbst anfertigen (Luhmann 1988, S. 166). Somit sind Organisationen ein rekursiv-geschlossenes, mit eigenen Entscheidungen auf eigene Entscheidungen bezugnehmendes System (Luhmann 1988, S. 166). Hierdurch wird die Bedeutung von Entscheidungen für Organisationen deutlich. Sie sind die basale Operation jeder Organisation ohne Entscheidungen gibt es keine Organisation. Was aber sind Entscheidungen genau? Durch einen kurzen Exkurs in die Klassische Entscheidungstheorie und deren Vergleich mit Luhmanns Verständnis von Entscheidungen kann diese Frage beantwortet werden. Grundsätzlich sind Entscheidungen die Vorstufe zur Handlung. Sie sind ein rein kognitiver Akt, bei dem versucht wird, das Resultat der Entscheidung zu antizipieren. Die Klassische Entscheidungstheorie unterstellt dem Entscheider ein vollständiges Wissen über Präferenzen, die in eine Rangfolge gebracht werden, über die Ziele der Entscheidung, die möglichen Alternativen und über alle Folgen und Nebenfolgen, wenn aus unterschiedlichen Entscheidungsalternativen eine ausgewählt wird. Man spricht in diesem Fall von einem individualistischen Entscheidungsbegriff, bei dem der Entscheider auf sich selbst bezogen und nach eigenen Motivationen handelnd eine Entscheidung trifft. Hierbei ist die sachliche Qualität der Alternativen, die diesen in einem kognitiven Akt zugeschrieben werden, ausschlaggebend für die Entscheidung. Insofern wird Entscheidungen dieser Art Rationalität unterstellt. Der Entscheider wählt anhand des Zweck oder Ziels und seiner persönlichen Präferenzen das zur Erreichung desselben optimale Mittel aus. Die Zeit spielt in dieser Betrachtungsweise von Entscheidungen keine Rolle, da die einzelnen Entscheidungskriterien feststehen, sobald eine Entscheidung ansteht. Ebenso wenig werden soziale Kriterien in einer solchen Entscheidung berücksichtigt, da das Individuum die Entscheidung für sich alleine nach seinen Präferenzen auf rein sachlicher Ebene trifft (vgl. March/ Simon 1976, S ). Bei Luhmann hingegen ist eine Entscheidung eine spezifische Form der Kommunikation, der ein völlig anderer Denkansatz als der Klassischen Entscheidungstheorie zu Grunde liegt. Um dies zu verstehen, muss man sich von der klassischen Vorstellung 7
8 Organisationstheorie, Entscheidungen und Prämissen über Entscheidungen lösen, die auf der Abfolge von Entscheidungsgelegenheiten und Entscheidung beruht. Ausgehend von der These, dass alle sozialen Systeme, also auch Organisationen, aus Kommunikationen und nur aus Kommunikationen bestehen (Luhmann 2006, S. 62), stellt sich im Anschluss an diese Grundannahme die Frage, welche spezifische Form von Kommunikation es ist, durch die Organisationen entstehen. Hierauf antwortet Luhmann, dass es die Kommunikation einer Entscheidung ist, also die Mitteilung einer Feststellung an die zweite Person. Dies allein ist jedoch nicht ausreichend, um die Kommunikation als Entscheidung zu bestimmen. Der Entscheider benötigt beim Entscheiden auch das Wissen um die Existenz von Alternativen, d.h. ihm muss im Vorfeld der Entscheidung bewusst sein, dass er so, aber auch anders entscheiden kann, denn nur die Alternative macht die Entscheidung zur Entscheidung (Luhmann 2006, S. 135). Diese Wahlmöglichkeiten entstehen jedoch nicht, wie in der Klassischen Entscheidungstheorie postuliert, auf der Ebene der Sachdimension, im Sinne eines Zweck-Mittel-Schemas, sondern in der Sozialdimension, in Form von Erwartungen, die von der zweiten Person (Alter) an den Entscheider (Ego) kommuniziert werden. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass die durch das Alter an das Ego gestellten Erwartungen nicht sachlicher, sondern sozialer Natur sind. Der Entscheider kann entweder eine Entscheidung treffen, die mit der Alters konform geht oder abweicht. Es sind die Erwartungen von Alter, die erst Wahlmöglichkeiten in den Entscheidungsprozess bringen. Die Paradoxie besteht nun darin, dass die Erwartungen, die Alter an Ego kommuniziert, einerseits erst Kontingenz erzeugen. Andererseits schränken sie die Situation soweit ein, dass überhaupt erst entschieden werden kann. Diese Reduktion von Kontingenz stellt somit eine Einschränkung als Ermöglichungsverhältnis dar. Begreift man Entscheidungen in dieser Form als Reaktion auf Erwartungen entsteht ein von der Klassischen Entscheidungstheorie fundamental abweichender Entscheidungsbegriff: Die zeitliche Richtungslogik des Entscheidungsprozesses ist gewissermaßen auf den Kopf gestellt; Entscheidungen entstehen nicht durch einen kognitiven Akt des Entscheidens, sondern durch die Zurechnung bzw. Zuschreibung einer Entscheidung durch ein Alter auf ein Ego. Dass eine Festlegung stattgefunden hat, wird erst retrospektiv in Form ihres Resultats der Entscheidung dadurch erkennbar, dass sie als solche vom Beobachter zugerechnet wird (vgl. Luhmann 2006, S. 138f.). 8
9 Organisationstheorie, Entscheidungen und Prämissen Vereinfacht formuliert, besteht der Wechsel darin, Entscheidungen ex post facto als Kommunikation zu betrachten bzw. zu denken, anstatt Intentionen, Präferenzen, etc. zu analysieren, um dann nach dem Zweck-Mittel-Schema auf eine rationale Entscheidung zu schließen. Gleichwohl spielt die Sachdimension in dieser Betrachtungsweise auch eine Rolle, denn ohne Sache, über die entschieden werden soll, kann keine Entscheidung getroffen und zugeschrieben werden. Darüber hinaus sind Sachhorizonte nicht völlig vom Entscheidungsprozess entkoppelt, jedoch bleibt die Sozialdimension die Primärorientierung für Ego oder anders formuliert: Wird man Entscheidungen durch die Festlegungen in der Sozialdimension [ ] definieren müssen (Kieserling 1994, S. 352). Die Frage, die sich im Anschluss stellt, ist: Was ist es, das aus Entscheidungen eine Organisation entstehen lässt, bzw. anders formuliert: Wie können Entscheidungen systembildend sein? Organisationen entstehen dann, wenn soziale Systeme rekursive Entscheidungszusammenhänge bilden und ihre eigene Autopoiesis darauf gründen (vgl. Luhmann 1988, S. 171). Innerhalb des Systems muss jedoch ersichtlich werden, was als Entscheidung des Systems gilt und dementsprechend, was nicht. Hierfür ist es notwendig zu wissen, wer Mitglied des Systems ist und in welchen Rollen diese Mitgliedschaft ausgeübt wird (Luhmann 1988, S. 171). Das System ist dann autopoietisch, wenn die Frage der Mitgliedschaft selbst schon vom System dargestellt und zugerechnet wird und sich Personen ständig wechselseitig Entscheidungen unterstellen. Für die Organisation ist es jedoch nicht nur wichtig, die Frage zu klären, wer entscheidet, sondern auch, worüber entschieden werden kann. Die Möglichkeiten der für eine Organisation relevanten und der durch sie selbst getroffenen und zulässigen Entscheidung muss limitiert sein. Erst durch diese Limitierung gelingt die Systembildung in Form der operativen Schließung seiner Grenzen und der Markierung einer Differenz von Innen und Außen. Durch das Ausschließen des Außen, bzw. der Umwelt, wird Komplexität als solche dahingehend reduziert, dass erst möglich wird, systeminterne Komplexität aufzubauen (vgl. Luhmann 2006, S. 222). Diese systeminterne Komplexität entsteht durch die Entscheidung über Entscheidungsprämissen. Bei diesen Prämissen handelt es sich um Grundlagen bzw. Voraussetzungen, die bei ihrer Anwendung auf Entscheidungen nur noch hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit für die anstehende Entscheidung, nicht mehr aber hinsichtlich ihrer 9
10 Organisationstheorie, Entscheidungen und Prämissen Wahrheit, geprüft werden. Es gibt drei Formen von entscheidbaren Entscheidungsprämissen: Zunächst fallen die Kommunikationswege auf, die beachtet werden müssen, damit Entscheidungen als solche innerhalb einer Organisation ihren bindenden Charakter erhalten. Hierbei kann man z.b. an den Dienstweg bei Kommunikationen von Personen auf unterschiedlichen hierarchischen Ebenen einer Organisation denken oder an die Kompetenz einer Person, eine Entscheidung als grundsätzlich bindend zu kommunizieren. Dann sind die Entscheidungsprogramme zu unterscheiden, bei denen es um die regulativen Bedingungen für richtiges (oder im anderen Fall: fehlerhaftes) Entscheiden (Luhmann 2006, S. 225) geht. Diese Programmierung von Entscheidungen liegt in zwei funktional äquivalenten, sich jedoch hinsichtlich ihres zeitlichen Richtungssinns unterscheidenden Varianten vor. Bei Routineprogrammen oder Konditionalprogrammen werden bestimmte Informationen als auslösendes Signal für die Wahl von bestimmten Kommunikationen festgelegt. Sie folgen dem Wenn-Dann-Schema, wobei der Zeitpunkt für die eingehende Information variabel ist, ihre Referenz liegt in der Vergangenheit. Bei Zweckprogrammen werden bestimmte Kommunikationen invariant gesetzt, um von dort her die relevanten Informationen ermitteln zu können. Sie folgen dem Zweck- Mittel-Schema; dem System werden Entscheidungsräume eröffnet, indem die flexiblen Zwecke durch unterschiedliche Kommunikationen des Systems erfüllt werden können (vgl. Luhmann 1968, S ). Die dritte Form von Entscheidungsprämissen, sind die Personen, die dem Entscheidungsbetrieb Körper und Geist, Reputation und persönliche Kontakte zur Verfügung stellen und dadurch teils ausweiten, teils einschränken, was entschieden werden kann (Luhmann 1981, S. 177); oder anders formuliert: Das Resultat einer Entscheidung ist davon abhängig, wer entscheidet. Neben entscheidbaren Entscheidungsprämissen gibt es auch unentscheidbare Entscheidungsprämissen. Dabei handelt es sich um Strukturen, die nicht auf die Entscheidungen des Systems zurückgeführt werden (Luhmann 2006, S. 145). Diese Art von Entscheidungsprämissen nennt Luhmann auch Organisationskultur. Sie sind in ihrer Entstehungsweise einerseits kontingent, da sie nur jeweils in konkreten Systemen und aufgrund der Operationen des Systems entstehen, andererseits werden sie inner- 10
11 Organisationstheorie, Entscheidungen und Prämissen halb des Systems nicht als kontingent behandelt, da sie von jedem Mitglied des Systems als selbstverständlich vorausgesetzt und akzeptiert werden (vgl. Luhmann 2006, S. 145). Ein weiterer Mechanismus, der systeminterne Komplexität erzeugt, ist Unsicherheitsabsorption. Unsicherheitsabsorption ist ein Entscheidungsprozess (Luhmann 2006, S. 186). Sie ist immer dann gegeben, wenn eine Entscheidung zur Grundlage einer späteren Entscheidung wird. D.h. es werden nicht die Informationen, die zu einer Entscheidung geführt haben, in den darauf folgenden Entscheidungsprozess weitergegeben, sondern, was einfließt, ist lediglich das Resultat des vorangegangenen Entscheidungsprozesses selbst. Nach Luhmann ergibt sich die organisatorische Unsicherheitsabsorption zwangsläufig daraus, dass eine Entscheidung eine andere informiert (Luhmann 2006, S. 189). Nachfolgend thematisiert der Text die Entscheidungsprozesse vor der Columbia- Katastrophe unter dem Beobachtungsschema der Entscheidungsprämissen bzw. -programme. 11
12 Entscheidungsprozesse vor der Columbia-Katastrophe 4 Entscheidungsprozesse vor der Columbia-Katastrophe 4.1 Die Abweichung als Normalfall: Spezifikation und organisationale Praxis Probleme mit kleineren Bruchstücken der Isolierung des Außentanks, die den Hitzeschild des Orbiters vornehmlich während des Aufstiegs beschädigen, sind fast so alt, wie das Shuttle-Programm selbst. Nach dem Erstflug eines Spaceshuttle-Systems im April 1981 STS-1 mussten mehr als 300 Kacheln des Hitzeschutzschildes (TPS) 5 aufgrund von Beschädigungen ausgetauscht werden. Fotodokumentarische Nachweise für das Abbrechen von Teilen des Isolierschaums als Ursache für die Beschädigung gibt es in 65 von 79 (d.h. 82 Prozent) der Missionen, bei denen Bilder und Videos während der Aufstiegsphase gemacht wurden. Im Durchschnitt wurden pro Mission 143 Beschädigungen festgestellt, mit durchschnittlich 31 Beschädigungen, die größer als 2,5 cm waren. Der Grund dafür, dass trotz der bekannten Probleme weiterhin der Isolierschaum benutzt werden musste, liegt darin, dass die verwendeten Treibstoffarten erst bei sehr geringen Temperaturen flüssig werden und sich ohne Isolierung Eis auf dem Außentank bilden würde, welches beim Start abbrechen und den Orbiter beschädigen könnte. Mit dem Wissen der Konstrukteure um die Schadensanfälligkeit des Hitzeschildes, bei dem unter Umständen ein leichter Druck mit dem Daumennagel ausreicht, um einen Abdruck zu hinterlassen, wurden die Anforderungen an die Gesamtkonstruktion, besonders im Hinblick auf den externen Treibstofftank, wie folgt spezifiziert: No debris shall emanate from [ ] the External Tank on the launch pad or during ascent except for such material which may result from normal thermal protection system recession due to ascent heating (CAIB 2003, S.122). Herausbrechen von sehr kleinen Stücken des Isolierschaums war also im ursprünglichen Design vorgesehen; der Toleranzbereich war jedoch verhältnismäßig gering. Allerdings konnte dieser Toleranzbereich in der Praxis nie eingehalten werden: Es brachen meistens Stücke des Isolierschaums heraus, die die maximal erlaubte Größe deutlich überschritten. 5 TPS: englische Abkürzung für Thermal-Protection-System. Deutsche Übersetzung: Hitzeschutzschild. 12
13 Entscheidungsprozesse vor der Columbia-Katastrophe Die Frage, die sich unweigerlich im Anschluss an diese Feststellung ergibt, ist: Warum hat die NASA trotz der bekannten Probleme und mit Wissen um die damit verbundenen Implikationen, die Bauweise des externen Tanks nicht dahingehend geändert, dass ein Verlust des Schaumstoffes innerhalb der technischen Spezifikationen und Anforderungen lag? Schließlich könnte man meinen, dass umso mehr Gelegenheiten bestanden hätten, die Gefahr zu erkennen und auszuräumen, je länger das Programm fortgesetzt wurde. Dies war jedoch nicht der Fall. Im Gegenteil: Aufgrund der zahlreichen erfolgreichen Missionen wurde immer mehr dazu übergegangen, das Abbrechen des Schaums als unwahrscheinlichen Faktor für die Gefährdung einer Mission anzusehen und als unvermeidbares Risiko hinzunehmen. Was ursprünglich als ernste Bedrohung für den Orbiter angesehen wurde, behandelte man zunehmend als ein Problem, das innerhalb des bekannten Spektrums lag und das es zu dokumentieren und berichten galt. Entsprechende Phänomene bezeichnet die NASA als In Family 6 -Ereignisse. Das Verständnis des Problems, ist jedoch bis heute (!) nicht gegeben, denn man weiß auch nach eingehender Untersuchung noch immer nicht, warum sich die Isolationsschicht vom Haupttank ablöst. Die folgenden Ausführungen beschreiben Fälle, die dieselbe physische Ursache, also das Abbrechen der Schaumstofframpe, aufweisen, die auch für den Absturz der Columbia verantwortlich waren. Die hierin gefällten Entscheidungen werden wiederum unter dem Beobachtungsschema der Programme betrachtet. 6 In Family: A reportable problem that was previously experienced, analyzed, and understood. Out of limits performance or discrepancies that have been previously experienced may be considered as infamily when specifically approved by the Space Shuttle Program or design project (CAIB 2003, S. 122). 13
14 Entscheidungsprozesse vor der Columbia-Katastrophe 4.2 Normale Abweichungen und die Verschiebung eines Konditionalprogramms Das Herausbrechen der Schaumstoff-Rampe konnte vor der Columbia-Mission in sechs weiteren Fällen dokumentiert werden, wobei zwei dieser Ereignisse erst durch die Arbeit der Untersuchungskommission nach Columbia entdeckt wurden (vgl. CAIB 2003, S. 123ff.). Der erste dieser Fälle trat bereits bei einer Challenger-Mission STS-7 im Jahr 1983 auf, bei dem ein 48x30 cm großes Bruchstück den externen Tank beschädigt hatte. Dieses Ereignis wurde als In-Flight-Anomaly 7 klassifiziert. Wenn ein Ereignis so eingestuft wird, bedeutet dies, dass vor dem nächsten Start eines Shuttles eine Arbeitsgruppe das Problem entweder beseitigen oder beweisen soll, dass weder System noch Besatzung gefährdet sind (vgl. CAIB 2003 S. 123). Im Bewertungsbericht zur Flugbereitschaft der darauf folgenden Mission wurde das Problem auf Grundlage der durchgeführten Reparaturarbeiten für gelöst und der Fall als abgeschlossen erklärt, obwohl die Ursache für die Beschädigungen mit keinem Wort erwähnt wurde. Der zweite Fall dieser Art ereignete sich während der Mission STS-32R im Januar Erneut kam es zu Beschädigungen und wiederum wurde das Problem als In- Flight-Anomaly klassifiziert, dem sich die Ingenieure annahmen, indem sie kleine Belüftungslöcher in den Schaumstoff bohrten, da sie vermuteten, dass in die Isolationsschicht eingeschlossene Gase für das Herausplatzen des Schaums verantwortlich waren. Im dritten Fall STS-50, der im Juni 1992 auftrat, wurde der Verlust des Schaums wiederum als Anomalie klassifiziert, wobei die mit der Untersuchung des Problems betrauten Instanzen zu unterschiedlichen Bewertungen desselben Sachverhaltes kamen: Einerseits wurde der Fall als Accepted-Risk 8 eingestuft, wonach der Fehler bekannt ist und seine Ursachen verstanden werden, dieser jedoch nicht vollständig ausgeräumt werden kann und ein erneutes Auftreten für unwahrscheinlich gehalten wird (vgl. CAIB 2003, S. 122); das Risiko des Problems sei demnach kalkulierbar und 7 IFAs are defined as any PRACA reportable problems occuring on flight hardware [...] that meet one of the following criteria: a. Problem that affects a Critcality [...] function or presents a flight hazard. b. Orbiter FSW discrepancy. c. [...] (NASA 2000, S. 3-2). 8 Accepted Risk: The threat associated with a specific circumstance is known and understood, cannot be completely eliminated, and the circumstance(s) producing that threat is considered unlikely to reoccur. Hence, the circumstance is fully known and is considered a tolerable threat to the conduct of a Shuttle mission (CAIB 2003, S.122). 14
15 Entscheidungsprozesse vor der Columbia-Katastrophe akzeptabel. Andererseits kam die zweite Projektgruppe zu dem Ergebnis, den Fehler als No Safety-of-Flight Issue 9 einzustufen, wonach keine Gefahr für Besatzung und Raumfahrzeug bestünde (vgl. CAIB 2003, S.122). Der vierte und fünfte Zwischenfall dieser Art blieb bis zur Untersuchung der Columbia-Katastrophe unentdeckt. Es wurde lediglich eine erhöhte Anzahl von Beschädigungen am Hitzeschutzschild registriert. Folglich wurde keine Klassifizierung vorgenommen, wodurch die normalerweise darauf folgenden Untersuchungen ausblieben. Der sechste und letzte Zwischenfall während STS-112 ereignete sich im Oktober 2002, also kurz vor dem schicksalhaften Flug der Columbia. Dabei wurde eine der Feststoffraketen durch den Einschlag eines ca. 4 dm³ großen Isolierschaumteils erheblich beschädigt. Videos und Bilder dokumentieren das Ereignis, trotzdem gibt es in den Gesprächsprotokollen der Besprechungen, die routinemäßig einem Start folgen, keinen Hinweis darauf, dass dieser Zwischenfall im Management thematisiert wurde. Dies ist insofern besonders beachtenswert, da die Feststoffraketen (Booster) zur Wiederverwendung vorgesehen sind, d.h. in der Startphase nach dem Ausbrennen abgeworfen und eingesammelt werden. Im Gegensatz dazu ist der Außentank nicht wieder verwertbar, was bedeutet, dass dieser nach seinem Ausbrennen in der Atmosphäre verglüht. Der Nachweis von Beschädigungen konnte in diesem Fall nur indirekt über das gesammelte Videomaterial erfolgen. Was die Feststoffraketen betrifft, wäre jedoch ein direkter Nachweis möglich gewesen. Bei den nach der Rückkehr von STS-112 folgenden Missionsnachbesprechungen schlug die Arbeitsgruppe Bildauswertung vor, das Abbrechen der Rampe als In- Flight-Anomaly zu klassifizieren. Dies wurde jedoch von den führenden Programm- Managern, Ron Dittemore und Linda Ham, abgelehnt. Stattdessen wurde beschlossen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Gründe für das Abbrechen aufzuklären und entsprechende korrektive Handlungsmaßnahmen vorzuschlagen. Für den Abschluss dieser Schritte wurde der 5. Dezember 2002 bestimmt obwohl die kurz darauf folgende Mission STS-113 für den 10. November 2002 angesetzt war und nicht genug Zeit war, den Fehler vor dem Start zu beheben. Im Nachhinein wurde der Abschlusstermin sogar hinter das geplante Rückkehrdatum von STS-107 im Januar 2003 verschoben. 9 No Safety-of-Flight Issue: The threat asscociated with a specific circumstance is known and understood and does not pose a threat to the crew and/ or vehicle (CAIB 2003, S. 122). 15
16 Entscheidungsprozesse vor der Columbia-Katastrophe Im Folgenden sollen die Entscheidungsprozesse, die sich in den dargestellten Vorgängen abspielten, mit Hilfe von Luhmanns Organisationstheorie analysiert werden: Betrachtet man nun diese Missionen hinsichtlich der Frage, wie die NASA im Falle der Probleme mit dem Isolierschaum vorgegangen ist, fällt zunächst einmal die programmatische Struktur ins Auge: Vorfälle, die von den ursprünglichen Spezifikationen des Shuttles abweichen, wurden als In-Flight-Anomaly klassifiziert und dokumentiert. Festgelegt wurde das für einen solchen Fall vorgesehene Verfahren durch das Problem Reporting and Corrective Action (PRACA) System Requirements 10. Dabei handelt es sich um eine NASA-interne Dienstvorschrift, in der die Dokumentation, Klassifizierung und Verantwortlichkeit etc. von zu berichtenden Anomalien bestimmt werden. Nach Luhmann entspricht dies somit einem Konditionalprogramm. Dieses ist einerseits umweltabhängig, andererseits invariant. Das bedeutet, dass das System Unregelmäßigkeiten in Regelmäßigkeiten übersetzt. Konkret: Auf keiner der Missionen hätte ein entsprechender Vorfall stattfinden müssen, das Programm PRACA hätte aber dennoch Bestand. Es tritt nur dann in Kraft, wenn ein entsprechender Input (= wenn) aus der Umwelt in das System gelangt. Der darauf folgende Output (= dann) ist regelmäßig und invariant (vgl. Luhmann 1968, S ). Diese Programmierung von Entscheidungen lässt im Prinzip wenig Ermessensspielraum für die Einstufung von und das Verfahren bei auftretenden Abweichungen von der ursprünglichen Spezifikation. Würde man diesen Umstand mit der Theorie Luhmanns fassen, so könnte man sagen, dass keine sekundäre Elastizität vorhanden ist, denn: Der Inhalt, der auf die eingehenden Informationen folgt, wird nicht offen gelassen, sondern hat als feste Entscheidungsregel Bestand (vgl. Luhmann 1968, S. 330). Für die NASA bedeutet dies, dass solange nicht mehr gestartet werden darf, bis die Ursachen des Problems ergründet und die Konstruktion so angepasst wurde, dass die Anomalie nicht erneut auftreten oder für ungefährlich erklärt werden kann. Gemäß des Konditionalprogramms PRACA wurde folgerichtig in den ersten beiden Fällen, in denen es zum Abbrechen der Rampe gekommen war, eine Sonderkommission mit der Bearbeitung des Vorgangs beauftragt letzter Abruf am
17 Entscheidungsprozesse vor der Columbia-Katastrophe Die voneinander abweichenden Bewertungen des Problems im dritten Fall beziehen sich vor allem auf die Einstufung des Risikopotentials des Vorfalls, wobei insbesondere die unterschiedlichen Bezeichnungen threat (Gefahr) und risk (Risiko) interessant sind. Diese Unterscheidung ist auch in den Definitionen zur Klassifizierung von Anomalien in NASAs PRACA wiederzufinden (vgl. CAIB 2003, S. 122). Zur Darstellung des Sachverhalts soll im Folgenden Luhmanns differenzierungstheoretische Perspektive von Risiko und Gefahr herangezogen werden: Luhmann nimmt eher eine beobachtungsgeleitete Unterscheidung vor, bei der hinsichtlich zukünftiger Schäden Unsicherheit angenommen wird. Von Risiko wird dann gesprochen, wenn zukünftiger Schaden als Folge einer Entscheidung betrachtet wird. Gefahr hingegen besteht dann, wenn der Schaden durch die Umwelt, also außerhalb des Systems, verursacht wird. Zentral ist folglich die Zurechnung: wenn Zurechnung, dann Risiko; wenn keine Zurechnung, dann Gefahr (vgl. Luhmann 1993, S. 137). Im Fall der Einstufung als Accepted Risk ist in dieser Hinsicht relevant, dass die Gefahr bekannt ist, ihre Ursachen nicht vollständig ausgeräumt werden können und ein Wiederauftreten für unwahrscheinlich gehalten wird. Somit werden Ereignisse dieser Art als tolerable threat to the conduct of a Shuttle mission (CAIB 2003, S. 122) angesehen. An dieser Stelle wird aus der Gefahr ein Risiko und zwar durch ihr Bekanntsein und die Entscheidung, die Gefahr als Risiko zu akzeptieren. Vom Standpunkt des Beobachters geschieht dies, sobald die Folgen derselben auf sie zugerechnet werden können. D.h. wäre diese Entscheidung nicht getroffen worden, bzw. nicht in dieser Form getroffen worden, oder wäre Kontingenz nicht auf diese Art fixiert worden, hätte es den Unfall vielleicht nie gegeben (vgl. Luhmann 2006, S. 273). Im zweiten Fall der Einstufung als No Safety-of-Flight Issue ist diese Differenzierung nicht möglich, da die Klassifizierung in sich schon wenig schlüssig, ja tautologisch, ist. Dort heißt es: The threat [ ] does not pose a threat to crew and/ or vehicle (CAIB 2003, S. 122). Abgesehen davon, dass die Klassifizierung des Problems in beiden Fällen falsch ist, da die Ursachen des Problems grundsätzlich bekannt sein müssten, kommt die Untersuchungskommission zu folgender Feststellung: Shuttle Program managers appear to have confused the notion of foam posing an accepted risk with foam not being an Safety-of-Flight Issue (CAIB 2003, S. 130). Die falsche Einordnung ist vermutlich auch auf die fehlerhafte Programmierung zurückzuführen, denn: Im Rahmen der Programme dürfte es diese Kategorisierung gar nicht geben, weil 17
18 Entscheidungsprozesse vor der Columbia-Katastrophe In-Flight-Anomalies prinzipiell eine Gefahr darstellen müssen, um überhaupt als solche klassifiziert zu werden was im zweiten Fall eindeutig geschah. Der sechste Fall STS-112, bei dem die aus Isolierschaum geformte Rampe abbrach, stellt einen Sonderfall dar. Hier wurde von den führenden Managern des Programms, Ron Dittemore (Vorsitzender des Missions-Managements) und Linda Ham (Stellvertretende Vorsitzende des Missions-Managements), entschieden, den Vorfall nicht wie sonst üblich als In-Flight-Anomaly zu klassifizieren, sondern man vereinbarte Maßnahmen zur Aufklärung der Ursachen. Die Untersuchungskommission vermutete als Hintergrund der Entscheidung zweckgeleitetes Handeln des Managements: Hätte es sich entschieden, entsprechend der Programme zu klassifizieren, hätte sich vermutlich die anstehende Mission STS- 113 verzögert, weil laut Vorschrift eine neue Mission erst dann starten darf, wenn die vorherige abgeschlossen ist; d.h. auch, dass alle technischen Mängel behoben sein müssen. Im Zuge dessen hätte sich der Abschluss der zweiten Ausbauphase der ISS, der auf 16 Monate später terminiert war, nicht mehr realisieren lassen. Eine Verzögerung hätte den ohnehin großen Zeitdruck weiter verschärft es waren innerhalb dieser 16 Monate zehn Flüge geplant. Die Erreichung dieses Ziels galt im Management jedoch als Meilenstein und es wurde als außerordentlich wichtig angesehen, die bestehenden Verträge mit den anderen Nationen einzuhalten offenbar sogar wichtiger als die Einhaltung systeminterner Dienstvorschriften und die Sicherheit der nächsten Mission. In Kauf genommen wurde dabei ein zusätzliches Risiko, das den Zweck verfolgt, die gesteckten Ziele zu erreichen. In diesem Fall wurde dem Konditionalprogramm ein Zweckprogramm übergestülpt, das mit Folgenverantwortung ausgestattet war (vgl. Luhmann 2006, S. 274). Dieser Befund lenkt den Blick auf die Umweltfaktoren, die die Entscheidung mitbeeinflusst haben. 11 Anzumerken ist hierbei außerdem, dass die Manager beider Missionen, STS-112 und STS-107, identisch waren. Dieser Umstand wird unter dem Gesichtspunkt der Entscheidungsprämisse Personal relevant. Insofern kann man schlussfolgern, dass sie sich mit den bei STS-112 getroffenen Entscheidung zugleich die Grundlagen für die anstehenden Entscheidungen der Mission STS-107 geschaffen haben. An dieser Stelle wird deutlich, dass in den Entscheidungsprozess der STS-107 nunmehr bereits zwei 11 Im Rahmen dieser Arbeit sollen die Umweltfaktoren nicht weiter ausgeführt werden. Näheres dazu: s. Kapitel 7. 18
19 Entscheidungsprozesse vor der Columbia-Katastrophe Entscheidungsprämissen aus der Mission STS-112 übernommen wurden, nämlich Programm und Personal. Unter der Annahme, dass Person A eine andere Entscheidung trifft als Person B bzw., dass die Entscheidungen, die eine Person trifft, in einem bestimmten Rahmen antizipiert werden können und in ihrem Ergebnis bedingt erwartbar sind, ist es ableitbar, dass von gleichen Personen in den gleichen Situationen ähnliche Entscheidungen getroffen werden. An dieser Stelle ist jedoch die Verschiebung in der Bewertung der einzelnen Fälle von Isolierschaumverlust und der damit einhergehenden Veränderung der anlaufenden Entscheidungsprogramme und zwar qua Entscheidung bemerkenswert. Was anfänglich als ernste Bedrohung für das Shuttlesystem und die Besatzung betrachtet wurde, entwickelte sich mit jeder geglückten Mission mehr und mehr zu einer Angelegenheit, die mit einem gewissen Wartungsaufwand, d.h. dem Austausch der Hitzeschutzkacheln, verbunden war. Die Abweichung von den Systemspezifikationen wurde zur Gewohnheit und das Gefahrenpotential dieser Ereignisse trat immer weiter in den Hintergrund und wurde immer mehr als geringes Risiko akzeptiert. Auf der Programmebene der Organisationen bedeutete die Entwicklung eine Verschiebung weg von einer routinemäßigen Beachtung und Bearbeitung des Problems, hin zu einem Konditionalprogramm, das diesen Ereignissen jegliches Gefährdungspotential abspricht. In der Annahme, dass das, was bis jetzt gut gegangen ist, auch in Zukunft gut gehen wird, wurde das Entscheidungsprogramm an die in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen angepasst. Insofern hat die Organisation gelernt und Komplexität wurde reduziert, indem Unsicherheit absorbiert wurde. Aber an dieser Stelle zeigt sich auch die Paradoxie des Mechanismus der Komplexitätsreduktion: Auf der einen Seite ist die Organisation darauf angewiesen, die Komplexität der Umwelt zu reduzieren und ein Komplexitätsgefälle zwischen sich und der Umwelt herzustellen daher ist der Mechanismus konstitutiv. Auf der anderen Seite birgt dieser auch unabsehbare Risiken, da zwangsläufig Informationen weggelassen, sprich selegiert, werden müssen. Wie hochselektiv dieser Lernprozess war, zeigt sich an einem weiteren Beispiel, das die Ereignisse der Columbia-Mission STS-107 vorausahnen lässt: Im Dezember 1988 auf der Atlantis Mission STS-27R wurde der Orbiter während des Aufstiegs von einem Trümmerteil von einer der SRBs 12 auf der Unterseite getroffen. Dieser Schaden wurde 12 SRB: englische Abkürzung für Solid Rocket Booster. Deutsche Übersetzung: Feststoffrakete. 19
20 Entscheidungsprozesse vor der Columbia-Katastrophe am darauf folgenden Tag im Orbit durch eine Kamera, die an einem Roboterarm befestigt wurde, untersucht. 13 Nach der Landung wurde die höchste jemals gemessene Anzahl an Beschädigungen des Hitzeschildes gemessen. Darüber hinaus war eine der Kacheln komplett abgeschlagen worden, der Hitzeschutz damit unvollständig. Ein Durchschmelzen der Aluminiumhülle an der jetzt ungeschützten Stelle beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre wäre wahrscheinlich gewesen Were it not for the thick aluminum plate [ ] a burn-through may have occured (CAIB 2003, S. 127) wenn sich an dieser Stelle nicht eine dicke Aluminiumplatte als Antennenabdeckung befunden hätte. Daraufhin wurde das Problem bearbeitet und der Vorgang abgeschlossen, indem das Design der Feststoffraketen geändert wurde, so dass von ihnen gemäß dem Konditionalprogramm PRACA keine Gefahr mehr ausgehen konnte. Hätte man sich an diesen Vorfall während der schicksalhaften Columbia-Mission STS-107 erinnert, wäre man vermutlich zu einer anderen Einschätzung des Gefahrenpotentials gekommen: Nämlich, dass Trümmerteile den Hitzeschild so schwer beschädigen können, dass es im schlimmsten Fall zum Verlust der Raumfähre kommen kann. Daran lässt sich erkennen, dass der Umgang mit den Trümmereinschlägen in das Spaceshuttle während der beiden Missionen sehr unterschiedlich war: So wurde die Crew im Fall STS-27R schon am zweiten Tag angewiesen, die Raumfähre nach möglichen Beschädigungen zu untersuchen; im Fall der Columbia-Mission wurde diese Anweisung nie gegeben. Vor diesem Hintergrund hat auch das CAIB der NASA ein lack of institutional memory (CAIB 2003, S. 127) bescheinigt. Aus Sicht der Programme ist dies ein erstaunlicher Befund, denn: Konditionalprogramme [ ] strukturieren [ ] das Gedächtnis des Systems. Sie entscheiden darüber, was aus der Fallpraxis des Systems erinnert wird und was vergessen werden kann (Luhmann 2006, S. 275). Allerdings wurden in diesem Fall für den Entscheidungsprozess gewichtige Informationen vergessen. Diese Beispiele zeigen auf, wie es zu Abweichungen von Routineprogrammen kommen kann. Im Moment ihres Entstehens waren die Entscheidungen aus Sicht der Organisation aufgrund der in der Praxis gemachten Erfahrungen rational. Dessen ungeachtet zeigt die retrospektive Betrachtung ihre fehlerhaften Grundlagen auf. Diese Voraussetzungen bilden in dem Sinne den Ausgangspunkt für die Entscheidungen, die 13 Dieser Roboterarm war für die Mission STS-107 nicht installiert worden. 20
21 Entscheidungsprozesse vor der Columbia-Katastrophe während der Columbia-Mission STS-107 getroffen wurden, so dass nach dem Mechanismus der Unsicherheitsabsorption nur die Entscheidungen selbst weitergegeben werden: also die Resultate, nicht die Grundlagen und somit nicht der Prozess. Nachdem an dieser Stelle die Beschreibung der Vorgänge und Entscheidungen, die vor der Columbia-Mission STS-107 stattgefunden haben, abgeschlossen ist und in einem theoretischen Rahmen eingefügt wurden, sollen im Folgenden die Geschehnisse während der Mission der Raumfähre Columbia beschrieben werden. Hierbei soll das Beobachtungsschema der Entscheidungsprogramme angewandt sowie weiter vertieft werden und um die Prämissen Personal und Kommunikationswege erweitert werden. Aufgezeigt werden soll, dass sich die Resultate der in 4.1 und 4.2 beschriebenen Prozesse in den folgenden Ausführungen niederschlagen. 21
22 Entscheidungsprozesse während der Columbia-Katastrophe 5 Entscheidungsprozesse während der Columbia-Katastrophe Die Columbia-Mission STS-107 startete am 16. Januar 2003, war auf 17 Tage angelegt und endete ohne Verzögerung am 01. Februar Bereits am zweiten Tag der Mission, am Freitag, den 17. Januar 2003, wurde von der Arbeitsgruppe 14, die mit der Sichtung und Auswertung des während der Startphase gemachten Videomaterials betraut war, festgestellt, dass der Orbiter von einem Objekt getroffen wurde. Festgestellt werden konnte auch, dass es sich um ein großes Objekt handelte, das die linke untere Flügelkante mit hoher Geschwindigkeit traf. Bei der Suche nach zusätzlichem Bildmaterial, um einen potentiellen Schaden besser erkennen zu können, zeigte sich, dass weitere Kameras, die den Start aufzeichnen, kein aufschlussreiches Bildmaterial liefern konnten. Von den fünf dafür vorgesehenen Kameras waren zwei aufgrund ihres Standortes nicht in der Lage, das Ereignis aufzuzeichnen. Eine der Kameras verlor die Columbia aus dem Blickfeld, eine weitere lieferte wegen einer schlecht gewarteten Linse nur unscharfe Bilder und die letzte nahm einen zu kleinen Ausschnitt des linken Flügels auf. Infolge des unzureichenden Bildmaterials entschloss sich die Arbeitsgruppe zusätzliche, bodengestützte Fotos der Columbia im Orbit zu beantragen. Außerdem wurden die vorhandenen Dokumente an alle relevanten Stellen der NASA und der bei ihr unter Vertrag stehenden Firmen weitergegeben. Nach dieser Eingabe reagierte das Management auf das Ereignis, das als Out of Family 15 klassifiziert wurde, indem Projektgruppen gebildet wurden, die eine detaillierte Analyse von Einschlagsgeschwindigkeit, Einschlagswinkel und kinetischer Energie erarbeiten sollten. Im Vergleich zu den vorherigen Missionen, bei denen ähnliche Ereignisse aufgetreten sind, weicht die Einordnung des Problems nach Luhmann auf Programmebene von den früheren Einstufungen ab. Out of Family -Ereignisse sind als Funktionen definiert, die außerhalb des erwarteten Leistungs- und Erfahrungsspektrums liegen. Zur Erinnerung: Bei STS-50 wurden ähnliche Probleme als Accepted Risk angesehen bzw. kam es auf Mission STS-112 nicht einmal zu einer Einstufung als In-Flight-Anomaly. Da- 14 Im Folgenden auch als Arbeitsgruppe Bildauswertung bezeichnet. Der Originaltitel lautet Intercenter Photo Working Group. 15 Out of Family: Operation or performance outside the expected performance range for a given parameter or which has not previously been experienced (CAIB 2003, S. 122). 22
23 Entscheidungsprozesse während der Columbia-Katastrophe raufhin hätte ein Programm anlaufen müssen, das dem Problem aufgrund seiner Neuartigkeit und Unbekanntheit entsprechende Aufmerksamkeit beimisst. Obwohl die Analyse das ganze Wochenende dauern sollte, kursierten bereits zu dieser Zeit unter Managern und Fachtechnikern s, die die allgemeine Ansicht belegen, dass das Stück Schaumstoff zu klein und zu langsam gewesen sei, um einen Schaden an den verstärkten Karbon-Kacheln, die an den Vorderkanten der Flügel angebracht sind, zu verursachen. An diesem Tag wurde schließlich vom Chef der Entwicklungsabteilung entschieden, die Analyse des Vorfalls auf den Montag nach dem Wochenende zu verschieben, obwohl unter einigen Technikern die Sorge bestand, dass der Orbiter beschädigt sein könnte. Im Arbeitsprotokoll, das bei jeder Schichtübergabe angefertigt wird, war unter der Kategorie Problem vermerkt: Debris impact on port wing edge appears to have originated at ET 16 fwd. bipod foam? if so, shouldn t be a problem (CAIB 2003, S. 142). An diesem Eintrag zeichnet sich ab, dass die Ingenieure begannen, sich an vorher gemachten Erfahrungen und Entscheidungen in ähnlichen Fällen zu orientieren. Obwohl laut der Klassifizierung Out of Family das Problem unbekannt war und außerhalb des erwarteten Leistungs- und Erfahrungsspektrums lag, rückt diese Formulierung das Problem eher in die Nähe einer In Family -Klassifizierung dem genauen Gegenteil also. Was vorliegt, ist nach Luhmann eine Abweichung von den Spezifikationen des ursprünglichen Programms als entscheidbare Entscheidungsprämisse auf formaler Ebene. Auf informaler Ebene, also den unentscheidbare Entscheidungsprämissen, könnte sich dieser Umstand als Rückgriff auf aus der Vergangenheit stammende, eingespielte Routinen durchsetzen. Am dritten und vierten Tag der Mission, dem Wochenende, erarbeiteten Ingenieure der Firma Boeing eine Schadensanalyse, obwohl dies durch das NASA-Management nicht angeordnet worden war. Ihre Schätzungen der Größe des Objekts beruhten auf der Auswertung des zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Videomaterials und stellten sich später als erstaunlich korrekt heraus. Um aus der angenommenen Größe, Geschwindigkeit und dem Einschlagswinkel den möglichen Schaden errechnen zu können, wurden die 16 ET: englische Abkürzung für External Tank. Deutsche Übersetzung: Außentank. 23
24 Entscheidungsprozesse während der Columbia-Katastrophe Daten in ein mathematisches Modell namens Crater übertragen. Crater wurde in den 80er Jahren entwickelt, um das Schadenspotential kleiner Objekte am Hitzeschutzschild der Unterseite abschätzen zu können. Ein zweiter, dem Crater-Programm ähnlicher, Algorithmus war dafür ausgelegt, Zerstörungen durch Objekte ähnlicher (geringer) Größe an den RCC-Kacheln zu berechnen. Aufgrund der voneinander abweichenden Ergebnisse beider Programme, wobei Crater eine deutlich höhere Beschädigung voraussagte, wurde das Programm als zu konservativ in der Schadensberechnung betrachtet. D.h. nach Ansicht der Ingenieure berechnete Crater einen zu großen Schaden. Das Datenmaterial, auf das Crater zurückgriff, legte allerdings Objekte zu Grunde, die ca. 400 Mal kleiner waren, als die Objektgröße, die die Boeing-Ingenieure nach Sichtung des Videomaterials errechnet hatten. Trotzdem kamen die Ingenieure zu dem Schluss, dass am Orbiter kein über das normale Maß hinausgehender Schaden entstanden sein konnte, da Crater erstens größere Beschädigungen voraussagte, als tatsächlich in der Vergangenheit aufgetreten waren und das Programm zweitens nicht die unterschiedliche Festigkeit der Hitzeschutzkacheln berücksichtigte, wobei davon ausgegangen wurde, dass sich die Einschlagsstelle an den deutlich härteren RCC-Kacheln befand. Diese Feststellung hätte jedoch einer Kenntnis der genauen Einschlagsstelle bedurft, die mit dem vorhandenen Bildmaterial nicht gewonnen werden konnte. Die Möglichkeit, dass Isolierschaum die Karbonkacheln durchschlagen könnte, wurde bei der Schadensanalyse nie ernsthaft in Erwägung gezogen, da die allgemeine Ansicht vorherrschte, dass lediglich sehr dichte Objekte wie z.b. Eis Derartiges anrichten könnten. So basierte auch der Algorithmus zur Berechnung von Schäden an den RCC- Kacheln nur auf Einschlägen kleiner Eisbrocken. Und obwohl einige Ingenieure mit den Berechnungsmethoden und Herleitungen der Analyse nicht einverstanden waren, erreichten die Zweifel und Unsicherheiten bezüglich der Analyse nie das höhere Management der Mission. Nach Luhmann können über Entscheidungsprämissen auch Kommunikationswege vorgeschrieben werden, die eingehalten werden müssen, wenn die Entscheidung als eine solche der Organisation Anerkennung finden soll (Luhmann 2006, S. 225). Offensichtlich liegt hier auf der Ebene der Kommunikationswege als entscheidbare Entscheidungsprämisse ein Defizit vor: Managers tendency to accept oppinions that agree with their own dams the flow of effective communications (CAIB 2003, S. 169). Da das 24
25 Entscheidungsprozesse während der Columbia-Katastrophe Management die Ansicht vertrat, dass die RCC-Kacheln nahezu unzerstörbar sind, wurde eine gegenteilige Meinung abgelehnt. Am fünften Tag der Mission wurde ein informelles Treffen der Arbeitsgruppe 17, die sich mit Beschädigungen durch Trümmereinschläge beschäftigte, einberufen. Darin vertreten waren Experten der NASA, United Space Alliance und Boeing. 18 Laut Vorschrift ist für den Fall eines Out of Family -Ereignisses vorgesehen, dass die Gruppe, die aus dem Zusammenschluss der verschiedenen Ingenieure hervorgeht, als Stabsstelle zum Missions-Management eingerichtet wird. Diese Arbeitsgruppe trägt normalerweise den Titel Tiger Team, besitzt festgelegte Kompetenzen sowie Verantwortlichkeiten und steht unter der Führung der beiden Programm-Manager. Stattdessen bekam die Arbeitsgruppe eine andere Bezeichnung Debris Assessment Team was zur Folge hatte, dass sie nicht an der eigentlich vorgesehen Position innerhalb der Organisation eingeordnet wurden und somit auch nicht die notwendigen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten besaßen. Folglich befanden sie sich in einem organisational limbo (CAIB 2003, S. 142), einem organisationalem Schwebezustand, ohne konkrete Anweisungen, außer dem Datum, zu dem ihr Abschlussbericht erwartet wurde. Aus Sicht der Entscheidungsprämissen lässt sich hieran zweierlei feststellen: Erstens wurde bezüglich der Programme gegen die üblichen Prozeduren verstoßen, was die Bildung und Einstufung der Arbeitsgruppe betraf. Zweitens wurden durch diese fehlerhafte Positionierung die Handlungskompetenzen des Teams stark eingeschränkt, was Einfluss auf die Hierarchien und Kommunikationswege hat. Wie später zu sehen sein wird, hatte diese strukturelle Eigenschaft erhebliche Auswirkungen auf die folgenden Entscheidungen. Ziel des Treffens der Arbeitsgruppe war zum einen bodengestütztes Bildmaterial zu beantragen, um den genauen Ort des Einschlags an der Raumfähre bestimmen zu können. Und zum anderen Experten vorangegangener Missionen in die Analyse miteinzubeziehen. In der zusammenfassenden , die die Arbeitsschwerpunkte des kommenden, formalen Treffens beinhaltete, schrieb der stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgruppe: the debris [ ] appears to be similar size as that seen in STS-112 (CAIB 2003, S. 146). 17 Im Folgenden auch als Arbeitsgruppe Trümmerschäden bezeichnet. Die englische Originalbezeichnung lautet Debris Assessment Team, abgekürzt DAT. 18 Unites Space Alliance und Boeing stehen als Zulieferer von Shuttle-Komponenten bei der NASA unter Vertrag. 25
Die Unentscheidbarkeit extensionaler Eigenschaften von Turingmaschinen: der Satz von Rice
 Die Unentscheidbarkeit extensionaler Eigenschaften von Turingmaschinen: der Satz von Rice Holger Arnold Dieser Text befasst sich mit der Frage, unter welchen Bedingungen das Problem, zu bestimmen, ob die
Die Unentscheidbarkeit extensionaler Eigenschaften von Turingmaschinen: der Satz von Rice Holger Arnold Dieser Text befasst sich mit der Frage, unter welchen Bedingungen das Problem, zu bestimmen, ob die
Recht als ein System der Kommunikation
 Vorlesung Rechtssoziologie HS 2012 Recht als ein System der Kommunikation Ass.-Prof. Dr. Michelle Cottier Juristische Fakultät Universität Basel Niklas Luhmann (1927-1998) Rechtssoziologie HS 2012 2 Niklas
Vorlesung Rechtssoziologie HS 2012 Recht als ein System der Kommunikation Ass.-Prof. Dr. Michelle Cottier Juristische Fakultät Universität Basel Niklas Luhmann (1927-1998) Rechtssoziologie HS 2012 2 Niklas
Recht als ein System der Kommunikation
 Vorlesung Rechtssoziologie HS 2012 Recht als ein System der Kommunikation Ass.-Prof. Dr. Michelle Cottier Juristische Fakultät Universität Basel Niklas Luhmann (1927-1998) Rechtssoziologie HS 2012 2 Niklas
Vorlesung Rechtssoziologie HS 2012 Recht als ein System der Kommunikation Ass.-Prof. Dr. Michelle Cottier Juristische Fakultät Universität Basel Niklas Luhmann (1927-1998) Rechtssoziologie HS 2012 2 Niklas
Die Paradoxie des Entscheidens. Professor Dr. Niklas Luhmann
 Die Paradoxie des Entscheidens Professor Dr. Niklas Luhmann Entscheidung Ratio vs Willkür Only those questions that are in principle undecidable, we can decide. - Heinz von Foerster Entscheidung - Konstruktion
Die Paradoxie des Entscheidens Professor Dr. Niklas Luhmann Entscheidung Ratio vs Willkür Only those questions that are in principle undecidable, we can decide. - Heinz von Foerster Entscheidung - Konstruktion
6 Zusammenfassung und Ausblick
 6 Zusammenfassung und Ausblick Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die Frage, wie das kulturgebundene Phänomen Ironie von einer Kultur in eine andere übertragen werden kann, ohne an Wirkung zu verlieren. Um
6 Zusammenfassung und Ausblick Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die Frage, wie das kulturgebundene Phänomen Ironie von einer Kultur in eine andere übertragen werden kann, ohne an Wirkung zu verlieren. Um
Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat?
 Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
Fragestellung Fragestellungen
 Fragestellung 107 7 Fragestellungen Im Fokus dieser Studie steht die Frage, welche Auswirkungen individualisierte Rückmeldungen über den aktuellen Cholesterin- und Blutdruckwert auf die Bewertung der eigenen
Fragestellung 107 7 Fragestellungen Im Fokus dieser Studie steht die Frage, welche Auswirkungen individualisierte Rückmeldungen über den aktuellen Cholesterin- und Blutdruckwert auf die Bewertung der eigenen
Schlusswort Einen wissenschaftlichen Text kann man schließen
 Schlusswort Einen wissenschaftlichen Text kann man schließen: mit einem Fazit (nach jedem größeren Kapitel des Hauptteils oder nur nach dem ganzen Hauptteil); mit Schlussfolgerungen; mit einem Fazit und
Schlusswort Einen wissenschaftlichen Text kann man schließen: mit einem Fazit (nach jedem größeren Kapitel des Hauptteils oder nur nach dem ganzen Hauptteil); mit Schlussfolgerungen; mit einem Fazit und
Grundlagen der Theoretischen Informatik Musterlösungen zu ausgewählten Übungsaufgaben
 Dieses Dokument soll mehr dazu dienen, Beispiele für die formal korrekt mathematische Bearbeitung von Aufgaben zu liefern, als konkrete Hinweise auf typische Klausuraufgaben zu liefern. Die hier gezeigten
Dieses Dokument soll mehr dazu dienen, Beispiele für die formal korrekt mathematische Bearbeitung von Aufgaben zu liefern, als konkrete Hinweise auf typische Klausuraufgaben zu liefern. Die hier gezeigten
Vorgehensweise bei der Erstellung. von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten)
 Leuphana Universität Lüneburg Institut für Bank-, Finanz- und Rechnungswesen Abt. Rechnungswesen und Steuerlehre Vorgehensweise bei der Erstellung von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten) I. Arbeitsschritte
Leuphana Universität Lüneburg Institut für Bank-, Finanz- und Rechnungswesen Abt. Rechnungswesen und Steuerlehre Vorgehensweise bei der Erstellung von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten) I. Arbeitsschritte
Verfeinerungen des Bayesianischen Nash Gleichgewichts
 Spieltheorie Sommersemester 007 Verfeinerungen des Bayesianischen Nash Gleichgewichts Das Bayesianische Nash Gleichgewicht für Spiele mit unvollständiger Information ist das Analogon zum Nash Gleichgewicht
Spieltheorie Sommersemester 007 Verfeinerungen des Bayesianischen Nash Gleichgewichts Das Bayesianische Nash Gleichgewicht für Spiele mit unvollständiger Information ist das Analogon zum Nash Gleichgewicht
Software Engineering. Ariane Flug 501! Fallstudie
 Martin Glinz Thomas Fritz Software Engineering Fallstudie Ariane Flug 501! 2005-2013 Martin Glinz. Alle Rechte vorbehalten. Speicherung und Wiedergabe für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch
Martin Glinz Thomas Fritz Software Engineering Fallstudie Ariane Flug 501! 2005-2013 Martin Glinz. Alle Rechte vorbehalten. Speicherung und Wiedergabe für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch
Die Reduktion Hilberts 10. Problem
 Die Reduktion Hilberts 10. Problem Prof. Dr. Berthold Vöcking Lehrstuhl Informatik 1 Algorithmen und Komplexität RWTH Aachen 8. November 2010 Berthold Vöcking, Informatik 1 () Vorlesung Berechenbarkeit
Die Reduktion Hilberts 10. Problem Prof. Dr. Berthold Vöcking Lehrstuhl Informatik 1 Algorithmen und Komplexität RWTH Aachen 8. November 2010 Berthold Vöcking, Informatik 1 () Vorlesung Berechenbarkeit
Fragen 1. Muss eine DTM ein Wort zu Ende gelesen haben, um es zu akzeptieren? a) Ja! b) Nein!
 4 Turingmaschinen Eingabeband nicht nur lesen, sondern auch schreiben kann und die zudem mit ihrem Lese-Schreib-Kopf (LSK) nach links und rechts gehen kann. Das Eingabeband ist zudem in beide Richtungen
4 Turingmaschinen Eingabeband nicht nur lesen, sondern auch schreiben kann und die zudem mit ihrem Lese-Schreib-Kopf (LSK) nach links und rechts gehen kann. Das Eingabeband ist zudem in beide Richtungen
[Hier klicken und Text eingeben] [Hier klicken und Text eingeben] Auftragsnummer: [Hier klicken und Text eingeben] Auftragnehmer:
![[Hier klicken und Text eingeben] [Hier klicken und Text eingeben] Auftragsnummer: [Hier klicken und Text eingeben] Auftragnehmer: [Hier klicken und Text eingeben] [Hier klicken und Text eingeben] Auftragsnummer: [Hier klicken und Text eingeben] Auftragnehmer:](/thumbs/70/63855048.jpg) Pflichtenheft Auftraggeber: Auftragsnummer: Auftragnehmer: Bearbeiter: Berlin, den (microtool GmbH, Berlin) Pflichtenheft Inhalt 1 Einleitung (Introduction) 3 1.1 Zielsetzung (Purpose) 3 1.2 Scope (Scope)
Pflichtenheft Auftraggeber: Auftragsnummer: Auftragnehmer: Bearbeiter: Berlin, den (microtool GmbH, Berlin) Pflichtenheft Inhalt 1 Einleitung (Introduction) 3 1.1 Zielsetzung (Purpose) 3 1.2 Scope (Scope)
...ein kleiner Auszug aus der Diplomarbeit
 ...ein kleiner Auszug aus der Diplomarbeit Weite Verbreitung im Rahmen der Kundenzufriedenheitsforschung hat das Konzept C/D Paradigma (Confirmation/Disconfirmation-Paradigm) erlangt und wird als Basismodell
...ein kleiner Auszug aus der Diplomarbeit Weite Verbreitung im Rahmen der Kundenzufriedenheitsforschung hat das Konzept C/D Paradigma (Confirmation/Disconfirmation-Paradigm) erlangt und wird als Basismodell
Reduktion / Hilberts 10. Problem
 Reduktion / Hilberts 10. Problem Prof. Dr. Berthold Vöcking Lehrstuhl Informatik 1 Algorithmen und Komplexität RWTH Aachen 9. November 2009 Berthold Vöcking, Informatik 1 () Vorlesung Berechenbarkeit und
Reduktion / Hilberts 10. Problem Prof. Dr. Berthold Vöcking Lehrstuhl Informatik 1 Algorithmen und Komplexität RWTH Aachen 9. November 2009 Berthold Vöcking, Informatik 1 () Vorlesung Berechenbarkeit und
Dokumenten-Nr.: Bewertung von Abweichungen, Fehlern und Mängeln 2/5
 Bewertung von Abweichungen, Fehlern und Mängeln 2/5 1 Zweck Ziel der Verfahrensanweisung ist es, bekannt gewordene, vermutete Abweichungen im Zusammenhang mit GMP-Inspektionen zu untersuchen und zu bewerten.
Bewertung von Abweichungen, Fehlern und Mängeln 2/5 1 Zweck Ziel der Verfahrensanweisung ist es, bekannt gewordene, vermutete Abweichungen im Zusammenhang mit GMP-Inspektionen zu untersuchen und zu bewerten.
1 Einführung. 2 Typ-0- und Typ-1-Sprachen. 3 Berechnungsmodelle. 4 Unentscheidbarkeit. 5 Unentscheidbare Probleme. 6 Komplexitätstheorie
 1 Einführung 2 Typ-0- und Typ-1-Sprachen 3 Berechnungsmodelle 4 Unentscheidbarkeit 5 Unentscheidbare Probleme 6 Komplexitätstheorie WS 11/12 155 Überblick Zunächst einmal definieren wir formal den Begriff
1 Einführung 2 Typ-0- und Typ-1-Sprachen 3 Berechnungsmodelle 4 Unentscheidbarkeit 5 Unentscheidbare Probleme 6 Komplexitätstheorie WS 11/12 155 Überblick Zunächst einmal definieren wir formal den Begriff
Soziale Kommunikation. Vorlesung Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Sommersemester 2011 PD Dr. phil. habil. Udo Thiedeke
 Vorlesung Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Sommersemester 2011 PD Dr. phil. habil. Udo Thiedeke 1) Handlung oder Kommunikation? 2) Differenzierung sozialer Systeme 3) Zusammenfassung 1) Handlung oder
Vorlesung Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Sommersemester 2011 PD Dr. phil. habil. Udo Thiedeke 1) Handlung oder Kommunikation? 2) Differenzierung sozialer Systeme 3) Zusammenfassung 1) Handlung oder
DQ S UL Management Systems Solutions
 Die ISO 9001:2008 Die wesentlichen Änderungen, Interpretationen und erste Erfahrungen Frank Graichen DQ S UL Management Systems Solutions Umstellungsregeln Veröffentlichung:14.November 2008 (englische
Die ISO 9001:2008 Die wesentlichen Änderungen, Interpretationen und erste Erfahrungen Frank Graichen DQ S UL Management Systems Solutions Umstellungsregeln Veröffentlichung:14.November 2008 (englische
Allgemeines Halteproblem Hilberts 10. Problem
 Allgemeines Halteproblem Hilberts 10. Problem Prof. Dr. Berthold Vöcking Lehrstuhl Informatik 1 Algorithmen und Komplexität RWTH Aachen November 2011 Berthold Vöcking, Informatik 1 () Vorlesung Berechenbarkeit
Allgemeines Halteproblem Hilberts 10. Problem Prof. Dr. Berthold Vöcking Lehrstuhl Informatik 1 Algorithmen und Komplexität RWTH Aachen November 2011 Berthold Vöcking, Informatik 1 () Vorlesung Berechenbarkeit
Universität Passau. Masterarbeit
 Universität Passau Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationales Management Prof. Dr. Carola Jungwirth Masterarbeit Optimierungsansätze innerhalb vertraglich festgelegter Geschäftsbeziehungen
Universität Passau Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationales Management Prof. Dr. Carola Jungwirth Masterarbeit Optimierungsansätze innerhalb vertraglich festgelegter Geschäftsbeziehungen
Apollo, Space Shuttle, Melissa und Google (Sommersemester 2006) 1/7
 Apollo, Space Shuttle, Melissa und Google (Sommersemester 2006) 1/7 Apollo, Spaceshuttle, Melissa und Google: Fallstudien in Verlässlichkeit und Computermissbrauch Das Space Shuttle (1972 81) Teil 4: Das
Apollo, Space Shuttle, Melissa und Google (Sommersemester 2006) 1/7 Apollo, Spaceshuttle, Melissa und Google: Fallstudien in Verlässlichkeit und Computermissbrauch Das Space Shuttle (1972 81) Teil 4: Das
 Fibonacci-Zahlen Schon vor 2000 Jahren befassten sich die Inder mit einer Zahlenfolge, die im modernen Europa auf den mittelalterlichen Gelehrten Leonardo Fibonacci aus Pisa zurückgeführt wird. Die nach
Fibonacci-Zahlen Schon vor 2000 Jahren befassten sich die Inder mit einer Zahlenfolge, die im modernen Europa auf den mittelalterlichen Gelehrten Leonardo Fibonacci aus Pisa zurückgeführt wird. Die nach
Statistik Testverfahren. Heinz Holling Günther Gediga. Bachelorstudium Psychologie. hogrefe.de
 rbu leh ch s plu psych Heinz Holling Günther Gediga hogrefe.de Bachelorstudium Psychologie Statistik Testverfahren 18 Kapitel 2 i.i.d.-annahme dem unabhängig. Es gilt also die i.i.d.-annahme (i.i.d = independent
rbu leh ch s plu psych Heinz Holling Günther Gediga hogrefe.de Bachelorstudium Psychologie Statistik Testverfahren 18 Kapitel 2 i.i.d.-annahme dem unabhängig. Es gilt also die i.i.d.-annahme (i.i.d = independent
Risikomanagement. Schaden
 management Eine sehr kurze Einführung 1 Physische Verletzung oder Schädigung der Gesundheit von Menschen oder Schädigung von Gütern oder der Umwelt 2 1 Gefährdung und Gefährdungssituation Gefährdung potentielle
management Eine sehr kurze Einführung 1 Physische Verletzung oder Schädigung der Gesundheit von Menschen oder Schädigung von Gütern oder der Umwelt 2 1 Gefährdung und Gefährdungssituation Gefährdung potentielle
1 Einleitung. Heute weiß man von allem den Preis, von nichts den Wert. Oscar Wilde
 1 Heute weiß man von allem den Preis, von nichts den Wert. Oscar Wilde 1 Einleitung 1.1 Zielsetzung und Vorgehensweise der Untersuchung Unternehmensbewertungen sind für verschiedene Anlässe im Leben eines
1 Heute weiß man von allem den Preis, von nichts den Wert. Oscar Wilde 1 Einleitung 1.1 Zielsetzung und Vorgehensweise der Untersuchung Unternehmensbewertungen sind für verschiedene Anlässe im Leben eines
4.3 Planung (Auszug ISO 14001:2004+Korr 2009) Die Organisation muss (ein) Verfahren einführen, verwirklichen und aufrechterhalten,
 4.3 Planung (Auszug ISO 14001:2004+Korr 2009) 4.3.1 Umweltaspekte Die Organisation muss (ein) Verfahren einführen, verwirklichen und aufrechterhalten, a) um jene Umweltaspekte ihrer Tätigkeiten, Produkte
4.3 Planung (Auszug ISO 14001:2004+Korr 2009) 4.3.1 Umweltaspekte Die Organisation muss (ein) Verfahren einführen, verwirklichen und aufrechterhalten, a) um jene Umweltaspekte ihrer Tätigkeiten, Produkte
Interpolation und Integration mit Polynomen
 Interpolation und Integration mit Polynomen Philipp Andrea Zardo Universität Kassel 23. Februar 2006 / Kassel Outline 1 Einleitung Was ist numerische Mathematik? Die eulersche e-funktion Ein Wurzelalgorithmus
Interpolation und Integration mit Polynomen Philipp Andrea Zardo Universität Kassel 23. Februar 2006 / Kassel Outline 1 Einleitung Was ist numerische Mathematik? Die eulersche e-funktion Ein Wurzelalgorithmus
Warum ist Ariane 5 beim Erstflug explodiert?
 Warum ist Ariane 5 beim Erstflug explodiert? Was geschah mit Flug 501? Software Engineering I Fallstudie Ariane Flug 501 1998 by Martin Glinz 1 Chronik der Ereignisse Die Software für das Trägheitsnavigationssystem
Warum ist Ariane 5 beim Erstflug explodiert? Was geschah mit Flug 501? Software Engineering I Fallstudie Ariane Flug 501 1998 by Martin Glinz 1 Chronik der Ereignisse Die Software für das Trägheitsnavigationssystem
Problemreduktion durch Transformation am Beispiel des. Erweiterten Euklidschen Algorithmus
 Problemreduktion durch Transformation am Beispiel des Erweiterten Euklidschen Algorithmus Wolfgang Windsteiger JKU Linz, A 4040 Linz, Austria Kurzfassung Transformation beschreibt im Wesentlichen die algorithmische
Problemreduktion durch Transformation am Beispiel des Erweiterten Euklidschen Algorithmus Wolfgang Windsteiger JKU Linz, A 4040 Linz, Austria Kurzfassung Transformation beschreibt im Wesentlichen die algorithmische
Vorkurs: Mathematik für Informatiker
 Vorkurs: Mathematik für Informatiker Teil 3 Wintersemester 2016/17 Steven Köhler mathe@stevenkoehler.de mathe.stevenkoehler.de 2 c 2016 Steven Köhler Wintersemester 2016/17 Inhaltsverzeichnis Teil 1 Teil
Vorkurs: Mathematik für Informatiker Teil 3 Wintersemester 2016/17 Steven Köhler mathe@stevenkoehler.de mathe.stevenkoehler.de 2 c 2016 Steven Köhler Wintersemester 2016/17 Inhaltsverzeichnis Teil 1 Teil
2.2.4 Logische Äquivalenz
 2.2.4 Logische Äquivalenz (I) Penélope raucht nicht und sie trinkt nicht. (II) Es ist nicht der Fall, dass Penélope raucht oder trinkt. Offenbar behaupten beide Aussagen denselben Sachverhalt, sie unterscheiden
2.2.4 Logische Äquivalenz (I) Penélope raucht nicht und sie trinkt nicht. (II) Es ist nicht der Fall, dass Penélope raucht oder trinkt. Offenbar behaupten beide Aussagen denselben Sachverhalt, sie unterscheiden
KAPITEL I EINLEITUNG
 KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,
KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,
Statische Spiele mit vollständiger Information
 Statische Spiele mit vollständiger Information Wir beginnen nun mit dem Aufbau unseres spieltheoretischen Methodenbaukastens, indem wir uns zunächst die einfachsten Spiele ansehen. In diesen Spielen handeln
Statische Spiele mit vollständiger Information Wir beginnen nun mit dem Aufbau unseres spieltheoretischen Methodenbaukastens, indem wir uns zunächst die einfachsten Spiele ansehen. In diesen Spielen handeln
Karin Hohmann. Unternehmens Excellence Modelle. Das EFQM-Modell. Diplomica Verlag
 Karin Hohmann Unternehmens Excellence Modelle Das EFQM-Modell Diplomica Verlag Karin Hohmann Unternehmens Excellence Modelle: Das EFQM-Modell ISBN: 978-3-8366-3036-8 Herstellung: Diplomica Verlag GmbH,
Karin Hohmann Unternehmens Excellence Modelle Das EFQM-Modell Diplomica Verlag Karin Hohmann Unternehmens Excellence Modelle: Das EFQM-Modell ISBN: 978-3-8366-3036-8 Herstellung: Diplomica Verlag GmbH,
7 Hypothesendiskussion
 7 287 Ausgehend von der Erörterung der theoretischen Grundlagen wissensintensiver Kooperationen320 wurden durch den Autor, in Verbindung mit einer Analyse und Darstellung der dem Einsatz aktiver Dokumente
7 287 Ausgehend von der Erörterung der theoretischen Grundlagen wissensintensiver Kooperationen320 wurden durch den Autor, in Verbindung mit einer Analyse und Darstellung der dem Einsatz aktiver Dokumente
Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse
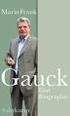 Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse These: Die organisatorische Vermittlung außenpolitischer Entscheidungen ist für die inhaltliche Ausgestaltung der Außenpolitik von Bedeutung
Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse These: Die organisatorische Vermittlung außenpolitischer Entscheidungen ist für die inhaltliche Ausgestaltung der Außenpolitik von Bedeutung
1. Februar 2003: COLUMBIA-Absturz - Die Katastrophe begann mit dem Start
 http://www.dlr.de 1. Februar 2003: COLUMBIA-Absturz - Die Katastrophe begann mit dem Start Der am 26. August 2003 veröffentlichte Bericht des Columbia Accident Investigation Board (CAIB) zog einen ersten
http://www.dlr.de 1. Februar 2003: COLUMBIA-Absturz - Die Katastrophe begann mit dem Start Der am 26. August 2003 veröffentlichte Bericht des Columbia Accident Investigation Board (CAIB) zog einen ersten
Statistische Tests (Signifikanztests)
 Statistische Tests (Signifikanztests) [testing statistical hypothesis] Prüfen und Bewerten von Hypothesen (Annahmen, Vermutungen) über die Verteilungen von Merkmalen in einer Grundgesamtheit (Population)
Statistische Tests (Signifikanztests) [testing statistical hypothesis] Prüfen und Bewerten von Hypothesen (Annahmen, Vermutungen) über die Verteilungen von Merkmalen in einer Grundgesamtheit (Population)
Auf der Suche nach dem Praktischen im Urteilen.
 Geisteswissenschaft Thomas Grunewald Auf der Suche nach dem Praktischen im Urteilen. Hannah Arendt und Kants Politische Philosophie. Studienarbeit Gliederung Seite 1. Einleitung 2 2. Eine politische Theorie
Geisteswissenschaft Thomas Grunewald Auf der Suche nach dem Praktischen im Urteilen. Hannah Arendt und Kants Politische Philosophie. Studienarbeit Gliederung Seite 1. Einleitung 2 2. Eine politische Theorie
zu überprüfen und zu präzisieren. Dabei stehen folgende Fragestellungen im Vordergrund:
 1. Einleitung Die Beschreibung und kritische Beurteilung von Alltagsargumentation wird durch das Wissen um häufig gebrauchte Denk- und Schlussmuster in einer Gesellschaft erleichtert. Abseits formal gültiger
1. Einleitung Die Beschreibung und kritische Beurteilung von Alltagsargumentation wird durch das Wissen um häufig gebrauchte Denk- und Schlussmuster in einer Gesellschaft erleichtert. Abseits formal gültiger
Sicherheitspsychologische Programme zur VISION ZERO
 Ein Beitrag zur neuen Präventionsstrategie der BG RCI Null Unfälle gesund arbeiten! Dipl.-Psych. Klaus Schubert Null Unfälle gesund arbeiten! Es geht: Einige Unternehmen erreichen lange unfallfreie Zeiten,
Ein Beitrag zur neuen Präventionsstrategie der BG RCI Null Unfälle gesund arbeiten! Dipl.-Psych. Klaus Schubert Null Unfälle gesund arbeiten! Es geht: Einige Unternehmen erreichen lange unfallfreie Zeiten,
Theoretische Informatik: Berechenbarkeit und Formale Sprachen
 Theoretische Informatik: Berechenbarkeit und Formale Sprachen Prof. Dr. F. Otto Fachbereich Elektrotechnik/Informatik, Universität Kassel 34109 Kassel, Germany E-mail: otto@theory.informatik.uni-kassel.de
Theoretische Informatik: Berechenbarkeit und Formale Sprachen Prof. Dr. F. Otto Fachbereich Elektrotechnik/Informatik, Universität Kassel 34109 Kassel, Germany E-mail: otto@theory.informatik.uni-kassel.de
An welchen wichtigsten Faktoren erkennt man, dass die Lösung des Problems die erwünschte Wirkung hat?
 An welchen wichtigsten Faktoren erkennt man, dass die Lösung des Problems die erwünschte Wirkung hat? - Das konkrete Problem wurde gelöst. Der Maßnahmenplan wurde eingehalten. - Die Regelungen greifen,
An welchen wichtigsten Faktoren erkennt man, dass die Lösung des Problems die erwünschte Wirkung hat? - Das konkrete Problem wurde gelöst. Der Maßnahmenplan wurde eingehalten. - Die Regelungen greifen,
Kompetenzen für eine digitale Souveränität Abschlussbericht
 Kompetenzen für eine digitale Souveränität Abschlussbericht Zentrale Ergebnisse der Online-Umfrage Kompetenzen für eine digitale Souveränität (Auswertung 1. Befragungswelle 20.01. 01.02.2017) Die aktuell
Kompetenzen für eine digitale Souveränität Abschlussbericht Zentrale Ergebnisse der Online-Umfrage Kompetenzen für eine digitale Souveränität (Auswertung 1. Befragungswelle 20.01. 01.02.2017) Die aktuell
Lineares Gleichungssystem - Vertiefung
 Lineares Gleichungssystem - Vertiefung Die Lösung Linearer Gleichungssysteme ist das "Gauß'sche Eliminationsverfahren" gut geeignet - schon erklärt unter Z02. Alternativ kann mit einem Matrixformalismus
Lineares Gleichungssystem - Vertiefung Die Lösung Linearer Gleichungssysteme ist das "Gauß'sche Eliminationsverfahren" gut geeignet - schon erklärt unter Z02. Alternativ kann mit einem Matrixformalismus
Formulierungshilfen für das wissenschaftliche Schreiben
 Formulierungshilfen für das wissenschaftliche Schreiben 1. Einleitendes Kapitel 1.1.1 Einen Text einleiten und zum Thema hinführen In der vorliegenden Arbeit geht es um... Schwerpunkt dieser Arbeit ist...
Formulierungshilfen für das wissenschaftliche Schreiben 1. Einleitendes Kapitel 1.1.1 Einen Text einleiten und zum Thema hinführen In der vorliegenden Arbeit geht es um... Schwerpunkt dieser Arbeit ist...
MATHEMATIQ. Der Newsletter der MathSIG (Interessensgruppe innerhalb der Mensa Österreich) Ausgabe 4.
 MATHEMATIQ Der Newsletter der MathSIG (Interessensgruppe innerhalb der Mensa Österreich) Ausgabe 4 http://www.hugi.scene.org/adok/mensa/mathsig/ Editorial Liebe Leserinnen und Leser! Dies ist die vierte
MATHEMATIQ Der Newsletter der MathSIG (Interessensgruppe innerhalb der Mensa Österreich) Ausgabe 4 http://www.hugi.scene.org/adok/mensa/mathsig/ Editorial Liebe Leserinnen und Leser! Dies ist die vierte
2-Grad-Ziel Grundlagen und Konsequenzen
 2-Grad-Ziel Grundlagen und Konsequenzen Warum soll die Erhöhung der mittleren globalen Temperatur gegenüber dem vorindustriellen Niveau gerade auf 2 Grad begrenzt werden? Welche Konsequenzen ergeben sich
2-Grad-Ziel Grundlagen und Konsequenzen Warum soll die Erhöhung der mittleren globalen Temperatur gegenüber dem vorindustriellen Niveau gerade auf 2 Grad begrenzt werden? Welche Konsequenzen ergeben sich
Der Labeling Approach
 Geisteswissenschaft Feryal Kor Der Labeling Approach Studienarbeit 1. Einleitung In jeglichen Gesellschaftsformen leben die unterschiedlichsten Individuen, welche vielfältige und unterschiedliche Verhaltensweisen
Geisteswissenschaft Feryal Kor Der Labeling Approach Studienarbeit 1. Einleitung In jeglichen Gesellschaftsformen leben die unterschiedlichsten Individuen, welche vielfältige und unterschiedliche Verhaltensweisen
Dienstliche Beurteilung: Berücksichtigung behinderungsbedingter Minderleistungen
 RECHT AKTUELL GKS-Rechtsanwalt Florian Hupperts informiert Beamte über aktuelle Probleme aus dem Beamten- und Disziplinarrecht Rechtsanwalt Florian Hupperts Dienstliche Beurteilung: Berücksichtigung behinderungsbedingter
RECHT AKTUELL GKS-Rechtsanwalt Florian Hupperts informiert Beamte über aktuelle Probleme aus dem Beamten- und Disziplinarrecht Rechtsanwalt Florian Hupperts Dienstliche Beurteilung: Berücksichtigung behinderungsbedingter
Items Einstellungen sportliches Engagement der Freundinnen und Freunde Frauen keinen Wenige / niemand meiner Freundinnen und Freunde sind der Meinung,
 9 Ergebnisse: Soziales Umfeld Freundinnen und Freunde 117 9 Freundinnen und Freunde Im folgenden Kapitel wird herausgearbeitet, wie die Schülerinnen und Studentinnen die Einstellungen und das Sportverhalten
9 Ergebnisse: Soziales Umfeld Freundinnen und Freunde 117 9 Freundinnen und Freunde Im folgenden Kapitel wird herausgearbeitet, wie die Schülerinnen und Studentinnen die Einstellungen und das Sportverhalten
Theoretische Informatik: Berechenbarkeit und Formale Sprachen
 Theoretische Informatik: Berechenbarkeit und Formale Sprachen Prof. Dr. F. Otto Fachbereich Elektrotechnik/Informatik, Universität Kassel 34109 Kassel, Germany E-mail: otto@theory.informatik.uni-kassel.de
Theoretische Informatik: Berechenbarkeit und Formale Sprachen Prof. Dr. F. Otto Fachbereich Elektrotechnik/Informatik, Universität Kassel 34109 Kassel, Germany E-mail: otto@theory.informatik.uni-kassel.de
Wissenschaftliche Definition von kultureller Differenz und Fremdheit
 Geisteswissenschaft Paul Peters Wissenschaftliche Definition von kultureller Differenz und Fremdheit Essay Europa Universität Viadrina Seminar: Interkulturalität vs. Multikulturalität Abgegeben von: Paul
Geisteswissenschaft Paul Peters Wissenschaftliche Definition von kultureller Differenz und Fremdheit Essay Europa Universität Viadrina Seminar: Interkulturalität vs. Multikulturalität Abgegeben von: Paul
Analytische Lösung algebraischer Gleichungen dritten und vierten Grades
 Analytische Lösung algebraischer Gleichungen dritten und vierten Grades Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 1 2 Gleichungen dritten Grades 3 3 Gleichungen vierten Grades 7 1 Einführung In diesem Skript werden
Analytische Lösung algebraischer Gleichungen dritten und vierten Grades Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 1 2 Gleichungen dritten Grades 3 3 Gleichungen vierten Grades 7 1 Einführung In diesem Skript werden
Requirements-Engineering Requirements-Engineering
 -Engineering Copyright Chr. Schaffer, Fachhochschule Hagenberg, MTD 1 Was ist ein Requirement? IEEE-Standard (IEEE-726 83) A condition or capability needed by a user to solve a problem or achieve an objective.
-Engineering Copyright Chr. Schaffer, Fachhochschule Hagenberg, MTD 1 Was ist ein Requirement? IEEE-Standard (IEEE-726 83) A condition or capability needed by a user to solve a problem or achieve an objective.
Software Engineering I Prof. Dr. Martin Glinz. Fallstudie: Ariane Flug 501. Universität Zürich Institut für Informatik
 Software Engineering I Prof. Dr. Martin Glinz Fallstudie: Ariane Flug 501 Universität Zürich Institut für Informatik Was geschah mit Flug 501? So hätte es aussehen sollen......und so sah es tatsächlich
Software Engineering I Prof. Dr. Martin Glinz Fallstudie: Ariane Flug 501 Universität Zürich Institut für Informatik Was geschah mit Flug 501? So hätte es aussehen sollen......und so sah es tatsächlich
Rhetorik und Sprachpraxis
 Rhetorik und Sprachpraxis 1 Rhetorik und Sprachpraxis 1 Strukturelle Gestaltung Die Strukturierung einer Rede gliedert einen Inhalt in seine thematischen Teilaspekte und gewichtet sie. Die Strukturierung
Rhetorik und Sprachpraxis 1 Rhetorik und Sprachpraxis 1 Strukturelle Gestaltung Die Strukturierung einer Rede gliedert einen Inhalt in seine thematischen Teilaspekte und gewichtet sie. Die Strukturierung
Value of Failure! Students Course! Modul 2: Was ist Scheitern?!
 Value of Failure Students Course Modul 2: Was ist Scheitern? Modul 2: Was ist Scheitern? Inhalt 1. Definitionen des Scheiterns 2. Gegenteil von Erfolg? 3. Produktives Scheitern Modul 2: Was ist Scheitern?
Value of Failure Students Course Modul 2: Was ist Scheitern? Modul 2: Was ist Scheitern? Inhalt 1. Definitionen des Scheiterns 2. Gegenteil von Erfolg? 3. Produktives Scheitern Modul 2: Was ist Scheitern?
Fehlgeschlagene Versuche zur Erklärung von Expansion des Universums und Urknall. Zchg. (a) Zchg. (b) Zchg. (c) Zchg. (d)
 Fehlgeschlagene Versuche zur Erklärung von Expansion des Universums und Urknall Grundlage : Simon Singh in "Big Bang" Abb. 67 / S.265 siehe Anhang Hubbles Beobachtungen ließen den Schluss zu, dass das
Fehlgeschlagene Versuche zur Erklärung von Expansion des Universums und Urknall Grundlage : Simon Singh in "Big Bang" Abb. 67 / S.265 siehe Anhang Hubbles Beobachtungen ließen den Schluss zu, dass das
Entscheidungen können nur kommuniziert werden, wenn auch die abgelehnten Möglichkeiten mitkommuniziert werden.
 Niklas Luhmann, Organisation als autopoietisches System oder: Wie ist Organisation möglich? 1. Organisationen im Rahmen der allgemeinen Systemtheorie 2. Organisationen als soziale Systeme, die sich aus
Niklas Luhmann, Organisation als autopoietisches System oder: Wie ist Organisation möglich? 1. Organisationen im Rahmen der allgemeinen Systemtheorie 2. Organisationen als soziale Systeme, die sich aus
} Symmetrieachse von A und B.
 5 Symmetrieachsen Seite 1 von 6 5 Symmetrieachsen Gleicher Abstand von zwei Punkten Betrachtet man zwei fest vorgegebene Punkte A und B, drängt sich im Zusammenhang mit dem Abstandsbegriff eine Frage auf,
5 Symmetrieachsen Seite 1 von 6 5 Symmetrieachsen Gleicher Abstand von zwei Punkten Betrachtet man zwei fest vorgegebene Punkte A und B, drängt sich im Zusammenhang mit dem Abstandsbegriff eine Frage auf,
Programmsteuerung mit PHP - if/else, elseif,switch
 Programmsteuerung mit PHP - if/else, elseif,switch Bei der Programmierung geht es meist vor allem darum festzulegen, welche Aktionen wie oft unter welchen Bedingungen ausgeführt werden sollen. Hierzu steht
Programmsteuerung mit PHP - if/else, elseif,switch Bei der Programmierung geht es meist vor allem darum festzulegen, welche Aktionen wie oft unter welchen Bedingungen ausgeführt werden sollen. Hierzu steht
Spieltheorie Teil 4. Tone Arnold. Universität des Saarlandes. 20. März 2008
 Spieltheorie Teil 4 Tone Arnold Universität des Saarlandes 20. März 2008 Tone Arnold (Universität des Saarlandes) Spieltheorie Teil 4 20. März 2008 1 / 64 Verfeinerungen des Nash GGs Das Perfekte Bayesianische
Spieltheorie Teil 4 Tone Arnold Universität des Saarlandes 20. März 2008 Tone Arnold (Universität des Saarlandes) Spieltheorie Teil 4 20. März 2008 1 / 64 Verfeinerungen des Nash GGs Das Perfekte Bayesianische
Vollständigkeit; Überabzählbarkeit und dichte Mengen) Als typisches Beispiel für die reellen Zahlen dient die kontinuierlich ablaufende Zeit.
 Kapitel 4 Reelle Zahlen 4.1 Die reellen Zahlen (Schranken von Mengen; Axiomatik; Anordnung; Vollständigkeit; Überabzählbarkeit und dichte Mengen) Als typisches Beispiel für die reellen Zahlen dient die
Kapitel 4 Reelle Zahlen 4.1 Die reellen Zahlen (Schranken von Mengen; Axiomatik; Anordnung; Vollständigkeit; Überabzählbarkeit und dichte Mengen) Als typisches Beispiel für die reellen Zahlen dient die
bzw. die Entscheidugen anderer Spieler (teilweise) beobachten Erweitert das Analysespektrum erheblich Beschreibung des Spiels (extensive Form)
 1 KAP 9. Dynamische Spiele Bisher: alle Spieler ziehen simultan bzw. können Aktionen der Gegenspieler nicht beobachten Nun: Dynamische Spiele Spieler können nacheinander ziehen bzw. die Entscheidugen anderer
1 KAP 9. Dynamische Spiele Bisher: alle Spieler ziehen simultan bzw. können Aktionen der Gegenspieler nicht beobachten Nun: Dynamische Spiele Spieler können nacheinander ziehen bzw. die Entscheidugen anderer
Testverfahren im Rahmen der Personalbeschaffung
 Wirtschaft Doris Herget Testverfahren im Rahmen der Personalbeschaffung Studienarbeit I. Inhaltsverzeichnis I. Inhaltsverzeichnis... II 1 Einleitung... 1 1.1 Einführung in die Thematik...1 1.2 Problemstellung
Wirtschaft Doris Herget Testverfahren im Rahmen der Personalbeschaffung Studienarbeit I. Inhaltsverzeichnis I. Inhaltsverzeichnis... II 1 Einleitung... 1 1.1 Einführung in die Thematik...1 1.2 Problemstellung
Accountability in Algorithmic. Decision Making.
 Accountability in Algorithmic Decision Making Vural Mert, Larcher Daniel 1. Juni 2016 Zusammenfassung Diese Seminararbeit gibt einen kurzen Überblick über die Algorithmische Entscheidungsfindung, deren
Accountability in Algorithmic Decision Making Vural Mert, Larcher Daniel 1. Juni 2016 Zusammenfassung Diese Seminararbeit gibt einen kurzen Überblick über die Algorithmische Entscheidungsfindung, deren
BGV A3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
 BGV A3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel Hinweis: Ab 1. Januar 2005 gilt die neue Bestellnummer BGV A3. 1 Geltungsbereich (1) Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für elektrische Anlagen und Betriebsmittel.
BGV A3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel Hinweis: Ab 1. Januar 2005 gilt die neue Bestellnummer BGV A3. 1 Geltungsbereich (1) Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für elektrische Anlagen und Betriebsmittel.
7.2 Conjoining Specifications
 Seminar: Spezifikation und Verifikation verteilter Systeme 7.2 Conjoining Specifications Teil 2: Das Kompositions-Theorem Dirk Fahland 1 TLA & Komposition in TLA Jede TLA-Formel Mi lässt sich in eine äquivalente
Seminar: Spezifikation und Verifikation verteilter Systeme 7.2 Conjoining Specifications Teil 2: Das Kompositions-Theorem Dirk Fahland 1 TLA & Komposition in TLA Jede TLA-Formel Mi lässt sich in eine äquivalente
Vororientierung zur Kurseinheit 7
 92 4 Berechnung linearer Netzwerke Vororientierung zur urseinheit 7 In diesem apitel wird Ihnen gezeigt, wie man aus linearen Zweipolen aufgebaute Netzwerke in systematischer Weise analysieren kann. Dazu
92 4 Berechnung linearer Netzwerke Vororientierung zur urseinheit 7 In diesem apitel wird Ihnen gezeigt, wie man aus linearen Zweipolen aufgebaute Netzwerke in systematischer Weise analysieren kann. Dazu
Spieltheorie. Winter 2013/14. Professor Dezsö Szalay. 2. Dynamische Spiele mit vollständiger Information
 Spieltheorie Winter 2013/14 Professor Dezsö Szalay 2. Dynamische Spiele mit vollständiger Information In Teil I haben wir Spiele betrachtet, in denen die Spieler gleichzeitig (oder zumindest in Unkenntnis
Spieltheorie Winter 2013/14 Professor Dezsö Szalay 2. Dynamische Spiele mit vollständiger Information In Teil I haben wir Spiele betrachtet, in denen die Spieler gleichzeitig (oder zumindest in Unkenntnis
Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern
 Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern Worum geht es in diesem Modul? Schätzer als Zufallsvariablen Vorbereitung einer Simulation Verteilung von P-Dach Empirische Lage- und Streuungsparameter zur
Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern Worum geht es in diesem Modul? Schätzer als Zufallsvariablen Vorbereitung einer Simulation Verteilung von P-Dach Empirische Lage- und Streuungsparameter zur
Das Pumping Lemma der regulären Sprachen
 Das Pumping Lemma der regulären Sprachen Frank Heitmann heitmann@informatik.uni-hamburg.de 1 Das Pumping Lemma Das Pumping Lemma der regulären Sprachen macht eine Aussage der Art wenn eine Sprache L regulär
Das Pumping Lemma der regulären Sprachen Frank Heitmann heitmann@informatik.uni-hamburg.de 1 Das Pumping Lemma Das Pumping Lemma der regulären Sprachen macht eine Aussage der Art wenn eine Sprache L regulär
Was Unterscheidungen und Ähnlichkeiten über deren Vergleichbarkeit verraten
 Readymade mit Selfie Was Unterscheidungen und Ähnlichkeiten über deren Vergleichbarkeit verraten Michael Kröger Tradition wird im Stil durch Abweichung respektiert Niklas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft,
Readymade mit Selfie Was Unterscheidungen und Ähnlichkeiten über deren Vergleichbarkeit verraten Michael Kröger Tradition wird im Stil durch Abweichung respektiert Niklas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft,
Rationalität und ökonomische Methode
 Thies Clausen Rationalität und ökonomische Methode mentis PADERBORN ÜBERBLICK I. Einleitung: Rationalität, Entscheidungstheorie und Sozialwissenschaften 1. Die ökonomische Methode in den Sozialwissenschaften
Thies Clausen Rationalität und ökonomische Methode mentis PADERBORN ÜBERBLICK I. Einleitung: Rationalität, Entscheidungstheorie und Sozialwissenschaften 1. Die ökonomische Methode in den Sozialwissenschaften
2 Definition der abstrakten Zielbedingung
 2 Definition der abstrakten Zielbedingung 2.1 Allgemeine Ausführungen Wie das Ausgangsbeispiel gezeigt hat, kommt der Definition des abstrakten Gestaltungsziels von Vermögensübertragungen bei der Gestaltungssuche
2 Definition der abstrakten Zielbedingung 2.1 Allgemeine Ausführungen Wie das Ausgangsbeispiel gezeigt hat, kommt der Definition des abstrakten Gestaltungsziels von Vermögensübertragungen bei der Gestaltungssuche
Diagnose einer Kraftwerksturbine
 Diagnose einer Kraftwerksturbine Dr. Patrick Bangert, algorithmica technologies GmbH Die Turbine ist der wichtigste Teil eines Kraftwerks. Der Betriebsausfall einer Turbine kann zu lang anhaltenden Betriebsstörungen
Diagnose einer Kraftwerksturbine Dr. Patrick Bangert, algorithmica technologies GmbH Die Turbine ist der wichtigste Teil eines Kraftwerks. Der Betriebsausfall einer Turbine kann zu lang anhaltenden Betriebsstörungen
b liegt zwischen a und c.
 2 DIE ANORDNUNGSAXIOME 5 (2.4) a, b, c R : (a < b 0 < c) ac < bc Monotoniegesetz der Multiplikation Bezeichnungen a > b : b < a (> wird gelesen: größer als ) a b : a < b oder a = b a b : a > b oder a =
2 DIE ANORDNUNGSAXIOME 5 (2.4) a, b, c R : (a < b 0 < c) ac < bc Monotoniegesetz der Multiplikation Bezeichnungen a > b : b < a (> wird gelesen: größer als ) a b : a < b oder a = b a b : a > b oder a =
Die amtliche Begründung zur HOAI 2009 beginnt mit folgendem Satz:
 Sehr geehrte Damen und Herren, Die amtliche Begründung zur HOAI 2009 beginnt mit folgendem Satz: Nach der Koalitionsvereinbarung vom 11. November 2005 soll die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Sehr geehrte Damen und Herren, Die amtliche Begründung zur HOAI 2009 beginnt mit folgendem Satz: Nach der Koalitionsvereinbarung vom 11. November 2005 soll die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Aufnahmeuntersuchung für Koi
 Aufnahmeuntersuchung für Koi Datum des Untersuchs: Date of examination: 1. Angaben zur Praxis / Tierarzt Vet details Name des Tierarztes Name of Vet Name der Praxis Name of practice Adresse Address Beruf
Aufnahmeuntersuchung für Koi Datum des Untersuchs: Date of examination: 1. Angaben zur Praxis / Tierarzt Vet details Name des Tierarztes Name of Vet Name der Praxis Name of practice Adresse Address Beruf
Mathem.Grundlagen der Computerlinguistik I, WS 2004/05, H. Leiß 1
 Mathem.Grundlagen der Computerlinguistik I, WS 2004/05, H. Leiß 1 1 Vorbemerkungen Mathematische Begriffe und Argumentationsweisen sind in vielen Fällen nötig, wo man über abstrakte Objekte sprechen und
Mathem.Grundlagen der Computerlinguistik I, WS 2004/05, H. Leiß 1 1 Vorbemerkungen Mathematische Begriffe und Argumentationsweisen sind in vielen Fällen nötig, wo man über abstrakte Objekte sprechen und
Hinweise zum Verfassen von Bachelor- und Masterarbeiten
 Hinweise zum Verfassen von Bachelor- und Masterarbeiten Allgemeine Hinweise - BSc und MSc Arbeiten folgen demselben Schema und unterscheiden sich lediglich im Umfang - Schrift 12 pt Times oder 11 pt Arial/Helvetica,
Hinweise zum Verfassen von Bachelor- und Masterarbeiten Allgemeine Hinweise - BSc und MSc Arbeiten folgen demselben Schema und unterscheiden sich lediglich im Umfang - Schrift 12 pt Times oder 11 pt Arial/Helvetica,
Ein gemeinsames Führungsverständnis aufbauen
 > Der Zweck und Ihr Nutzen Mit dem Bekenntnis zu einem einheitlichen Führungsverständnis ist beabsichtigt, das Führungsverhalten, das Erreichen der Unternehmensziele und die langfristige Unternehmenssicherung
> Der Zweck und Ihr Nutzen Mit dem Bekenntnis zu einem einheitlichen Führungsverständnis ist beabsichtigt, das Führungsverhalten, das Erreichen der Unternehmensziele und die langfristige Unternehmenssicherung
Space Shuttle Atlantis in 1/72
 !!! Neu von Revell!!! Space Shuttle Atlantis in 1/72 Das Großmodell noch einmal zum Ende der Shuttleflüge! Zum Ende der Shuttleflüge überrascht uns Revell mit dem Großmodell des Raumtransporters, bei dem
!!! Neu von Revell!!! Space Shuttle Atlantis in 1/72 Das Großmodell noch einmal zum Ende der Shuttleflüge! Zum Ende der Shuttleflüge überrascht uns Revell mit dem Großmodell des Raumtransporters, bei dem
Natürliche und ganze Zahlen
 Die ganze Welt ist Harmonie und Zahl. Pythagoras Natürliche und ganze Zahlen 1-E1 Richard Dedekind (1831-1916) war ein deutscher Mathematiker. Die Zahlen sind freie Schöpfungen des menschlichen Geistes,
Die ganze Welt ist Harmonie und Zahl. Pythagoras Natürliche und ganze Zahlen 1-E1 Richard Dedekind (1831-1916) war ein deutscher Mathematiker. Die Zahlen sind freie Schöpfungen des menschlichen Geistes,
1 AVL-Bäume. 1.1 Aufgabentyp. 1.2 Überblick. 1.3 Grundidee
 AVL-Bäume. Aufgabentyp Fügen Sie in einen anfangs leeren AVL Baum die folgenden Schlüssel ein:... Wenden Sie hierbei konsequent den Einfüge /Balancierungsalgorithmus an und dokumentieren Sie die ausgeführten
AVL-Bäume. Aufgabentyp Fügen Sie in einen anfangs leeren AVL Baum die folgenden Schlüssel ein:... Wenden Sie hierbei konsequent den Einfüge /Balancierungsalgorithmus an und dokumentieren Sie die ausgeführten
P, NP und NP -Vollständigkeit
 P, NP und NP -Vollständigkeit Mit der Turing-Maschine haben wir einen Formalismus kennengelernt, um über das Berechenbare nachdenken und argumentieren zu können. Wie unsere bisherigen Automatenmodelle
P, NP und NP -Vollständigkeit Mit der Turing-Maschine haben wir einen Formalismus kennengelernt, um über das Berechenbare nachdenken und argumentieren zu können. Wie unsere bisherigen Automatenmodelle
Phillips Kurve. Einführung in die Makroökonomie. 10. Mai 2012 SS Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Phillips Kurve 10.
 Phillips Kurve Einführung in die Makroökonomie SS 2012 10. Mai 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Phillips Kurve 10. Mai 2012 1 / 23 Hintergrund 1958 stellte A. W. Phillips die Inflationsrate
Phillips Kurve Einführung in die Makroökonomie SS 2012 10. Mai 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Phillips Kurve 10. Mai 2012 1 / 23 Hintergrund 1958 stellte A. W. Phillips die Inflationsrate
Konvergenz, Filter und der Satz von Tychonoff
 Abschnitt 4 Konvergenz, Filter und der Satz von Tychonoff In metrischen Räumen kann man topologische Begriffe wie Stetigkeit, Abschluss, Kompaktheit auch mit Hilfe von Konvergenz von Folgen charakterisieren.
Abschnitt 4 Konvergenz, Filter und der Satz von Tychonoff In metrischen Räumen kann man topologische Begriffe wie Stetigkeit, Abschluss, Kompaktheit auch mit Hilfe von Konvergenz von Folgen charakterisieren.
Einführung in die linearen Funktionen. Autor: Benedikt Menne
 Einführung in die linearen Funktionen Autor: Benedikt Menne Inhaltsverzeichnis Vorwort... 3 Allgemeine Definition... 3 3 Bestimmung der Steigung einer linearen Funktion... 4 3. Bestimmung der Steigung
Einführung in die linearen Funktionen Autor: Benedikt Menne Inhaltsverzeichnis Vorwort... 3 Allgemeine Definition... 3 3 Bestimmung der Steigung einer linearen Funktion... 4 3. Bestimmung der Steigung
Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Beweistechniken 1.1 Prädikatenlogik..................................... 1. Direkter Beweis.................................... 3 1.3 Indirekter Beweis....................................
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Beweistechniken 1.1 Prädikatenlogik..................................... 1. Direkter Beweis.................................... 3 1.3 Indirekter Beweis....................................
Einführung in die Theoretische Informatik
 Technische Universität München Fakultät für Informatik Prof. Tobias Nipkow, Ph.D. Sascha Böhme, Lars Noschinski Sommersemester 2011 Lösungsblatt 9 25. Juli 2011 Einführung in die Theoretische Informatik
Technische Universität München Fakultät für Informatik Prof. Tobias Nipkow, Ph.D. Sascha Böhme, Lars Noschinski Sommersemester 2011 Lösungsblatt 9 25. Juli 2011 Einführung in die Theoretische Informatik
Auf Biegen und Schieben
 0 Auf Biegen und Schieben Seite Auf Biegen und Schieben Modifikationen von Graphen durch Faktoren und Summanden Düsseldorf, den 7.06.0 Der bisher veröffentlichte Entwurf des Kernlehrplans für die Sekundarstufe
0 Auf Biegen und Schieben Seite Auf Biegen und Schieben Modifikationen von Graphen durch Faktoren und Summanden Düsseldorf, den 7.06.0 Der bisher veröffentlichte Entwurf des Kernlehrplans für die Sekundarstufe
das usa team Ziegenberger Weg Ober-Mörlen Tel Fax: mail: web:
 Problemanalyse das usa team Ziegenberger Weg 9 61239 Ober-Mörlen Tel. 06002 1559 Fax: 06002 460 mail: lohoff@dasusateam.de web: www.dasusateam.de 1 Problem-Analyse Entscheidungen! Probleme! Manchmal ist
Problemanalyse das usa team Ziegenberger Weg 9 61239 Ober-Mörlen Tel. 06002 1559 Fax: 06002 460 mail: lohoff@dasusateam.de web: www.dasusateam.de 1 Problem-Analyse Entscheidungen! Probleme! Manchmal ist
Multiplikationschip. Multiplikation. Beitrag zu "Werkstattunterricht Multiplikation" Allgemeine Didaktik - Seminar SS95. Oberwiesenstr.
 Informationsblatt für die Lehrkraft Multiplikation Multiplikationschip Beitrag zu "Werkstattunterricht Multiplikation" Allgemeine Didaktik - Seminar SS95 Autor: Ernesto Ruggiano Oberwiesenstr. 42 85 Zürich
Informationsblatt für die Lehrkraft Multiplikation Multiplikationschip Beitrag zu "Werkstattunterricht Multiplikation" Allgemeine Didaktik - Seminar SS95 Autor: Ernesto Ruggiano Oberwiesenstr. 42 85 Zürich
Die Erweiterung vom Satz des Pythagoras anhand der resultierenden Kraft FR
 Michael B. H. Middendorf 1 Die Erweiterung vom Satz des Pthagoras anhand der resultierenden Kraft FR Bei meinen Überlegungen als Maschinenbauer bzgl. eines Impulsantriebes, stieß ich auf das Problem, ständig
Michael B. H. Middendorf 1 Die Erweiterung vom Satz des Pthagoras anhand der resultierenden Kraft FR Bei meinen Überlegungen als Maschinenbauer bzgl. eines Impulsantriebes, stieß ich auf das Problem, ständig
