Biotechnologie Zell- und Gewebekulturtechniken
|
|
|
- Bertold Fuchs
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Biotechnologie Zell- und Gewebekulturtechniken LfL-Information
2 Impressum: Herausgeber: Redaktion: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) Vöttinger Straße 38, Freising-Weihenstephan Internet: Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung Am Gereuth 8, Freising-Weihenstephan Tel.: 08161/ Auflage März / 2006 Druck: Lerchl-Druck, Freising Schutzgebühr: 1,00 LfL
3 Biotechnologie Zell- und Gewebekulturtechniken Dr. Gert Daniel
4 4 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Einleitung Zell- und Gewebekulturtechniken Methoden zur Erweiterung genetischer Variabilität Antherenkultur Mikrosporenkultur Embryonenkultur Methoden zur Vermehrung und Erhaltung von Zuchtmaterial Meristemkultur Sprossspitzen- / Nodienkultur Züchtungsfortschritt durch Zell- und Gewebekultur Sortenzüchtung In vitro-vermehrung und in vitro-erhaltung von Pflanzen im Rahmen von Zuchtprogrammen...19
5 5 1 Einleitung Der Einsatz biotechnologischer Methoden (Zell- und Gewebekulturtechniken und gentechnologische Methoden) in der landwirtschaftlichen Pflanzenzüchtung verzeichnete in den letzten Jahren einen rasanten Aufschwung. Die Umsetzung der Ergebnisse aus der Grundlagenforschung in die angewandte Forschung und die praktische Anwendung der biotechnologischen Methoden sind bereits weitestgehend erfolgt. Am Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung der LfL wurden bereits 1981/82 erste Versuche zum Einsatz der Embryonenkultur in der Getreidezüchtung durchgeführt. In den folgenden Jahren wurden weitere Gewebekulturtechniken, die verschiedenen Methoden der Genomanalyse und des Gentransfers an der LfL etabliert. Mit dem Einsatz biotechnologischer Methoden im Rahmen der Pflanzenzüchtung befassen sich zur Zeit fünf Arbeitsgruppen: Gewebekulturtechniken (IPZ 1a) Genomanalyse (IPZ 1b) Gentransfer, GVO-Sicherheitsforschung (IPZ 1c) Zuchtmethodik und Biotechnologie Kartoffeln (IPZ 3b) Züchtungsforschung Hopfen (IPZ 5c) Schwerpunktmäßig werden folgende Fruchtarten mit biotechnologischen Methoden bearbeitet: Sommer- und Wintergerste Winterweizen Kartoffel Hopfen Heil- und Gewürzpflanzen Die vorliegende Zusammenstellung der Gewebekulturtechniken und deren Einsatz in der Pflanzenzüchtung soll den Stand der Arbeiten an der LfL aufzeigen. Zunächst ein kurzer Überblick über die konventionellen Methoden der Pflanzenzüchtung. Die Pflanzenzüchtung ist das wichtigste Instrument zur Veränderung von Pflanzen, um sie den sich ständig ändernden Bedürfnissen des Menschen anzupassen. Der Beginn der Pflanzenzüchtung liegt einige Jahrtausende zurück. Erst als die Menschen sesshaft wurden und Nahrungspflanzen anbauten, begannen sie mit der Auslese von Pflanzen, die für sie vorteilhafte Merkmale aufwiesen. Bevorzugt wurden Getreidepflanzen ausgelesen, bei denen die Körner fester in der Ähre saßen, da bei diesen Pflanzen weniger Körner bei der Ernte herausfielen und somit nicht als Nahrung verloren gingen. Die mit unterschiedlicher Intensität durchgeführte Auslesezüchtung führte zu den ersten Kulturpflanzen. Diese Züchtungsmethode verlor an Bedeutung, weil der Mensch anfing, Pflanzenmerkmale verschiedener Wuchstypen oder Herkünfte über Kreuzungen zu kombinieren. Mit der Entdeckung von Gregor Mendel ( ), dass Eigenschaften von Organismen durch Gene bestimmt werden, die bei der Verschmelzung von Ei- und Samenzellen der Elterpflanzen an die Nachkommen weitergegeben werden, war die Kombinationszüchtung geboren. Sie ist auch heute noch, trotz der Entwicklung anderer Zuchtmethoden, die vorherrschende Methode zur Schaffung genetischer Vielfalt.
6 6 Die biotechnologischen Methoden als Ergänzung und in Verbindung mit der konventionellen Pflanzenzüchtung werden in Abb. 1 dargestellt. Abb. 1: Schema zur klassischen Züchtung und Biotechnologie im Verbund 2 Zell- und Gewebekulturtechniken Zell- und Gewebekulturtechniken werden in der Pflanzenzüchtung zur Erweiterung der genetischen Variabilität (Genpool), insbesondere im Hinblick auf Resistenz- und Qualitätseigenschaften, und zur Vermehrung und Erhaltung von Zuchtmaterial eingesetzt. 2.1 Methoden zur Erweiterung genetischer Variabilität Antherenkultur Ziel der Antherenkultur ist die Erstellung von doppelhaploiden, reinerbigen Pflanzen ausgehend von heterozygotem Ausgangsmaterial (F1-Kreuzungen). Die Antherenkultur wird im folgenden am Beispiel der Erzeugung von doppelhaploiden Gerstenlinien behandelt. Nach erfolgter Kreuzung der beiden ausgewählten Eltern und der Gewinnung der dabei entstehenden Kreuzungskörner werden diese unter kontrollierten Bedingungen zu Spenderpflanzen herangezogen. Die Kreuzungskörner werden in Multitopfplatten in Torfsubstrat zum Keimen ausgesät und entwickeln sich innerhalb von ein bis zwei Wochen zu kleinen, einblättrigen Pflanzen. Bei Wintergerste werden die Pflanzen anschließend bei 4 C für acht Wochen vernalisiert (Simulation des Winters). Bei Wintergetreide ist die Vernalisation zur Umstimmung von der vegetativen zur generativen Entwicklungsphase, d.h. zur Blütenbil-
7 7 dung, erforderlich. Sommergerste erfordert zwar keine Vernalisation, aber zur besseren Bestockung der Pflanzen (Anlage mehrerer Halme mit Ähren) werden auch die Sommergersten einer vierwöchigen Kältebehandlung bei 4 C ausgesetzt. Nach erfolgter Kältebehandlung werden die Pflanzen zunächst bei 8 C (6 Wochen) und anschließend für 4-6 Wochen bei 16 C kultiviert, bevor sie im Gewächshaus bei C bis zur Gewinnung der Ähren zur Antherenentnahme kultiviert werden. Abb. 2: Schema zur Antherenkultur Der geeignete Zeitpunkt zur Ernte der Ähren und für die Antherenentnahme ist gegeben, wenn das Fahnenblatt voll entwickelt ist und die Blattscheide sich zu öffnen beginnt. Der Abstand vom Fahnenblatt zum obersten Nodium (Halmknoten) beträgt zu diesem Zeitpunkt zwischen 10 und 15 cm. Die Mikrosporen (unreife Pollenkörner) liegen zu diesem Zeitpunkt im mittleren bis späten Einkernstadium, kurz nach der Pollenmitose, vor. Eine genaue Bestimmung des Pollenstadiums (s. Abbildung 3) sollte vor Beginn des Ährenschneidens bei jedem Kreuzungsgenotyp vorgenommen werden, da sich die Mikrosporen unterschiedlich, abhängig vom Kreuzungsgenotyp, entwickeln können. Die geernteten Spenderähren werden unter sterilen Bedingungen (Reinluft-Werkbank) mit 70%-igem Alkohol oberflächendesinfiziert. Anschließend werden die Ähren aus der Blattscheide entnommen und in eine Hälfte einer geteilten Petrischale gelegt. In die andere Hälfte der Petrischale werden 2-3 ml destilliertes Wasser gegeben, um einem Vertrocknen der Ähren während der Kältevorbehandlung (3-4 Wochen bei 4 C) vorzubeugen. Nach erfolgter Kältevorbehandlung werden die jeweils drei Antheren pro Blütchen unter sterilen Bedingungen aus den einzelnen Blütchen entnommen und auf Induktionsmedium in Petrischalen übertragen. Die Petrischalen werden mit Folie verschlossen und in einem Kulturschrank bei C in Dunkelheit für 4-8 Wochen aufgestellt. Nach etwa 3-6 Wochen platzt die Antherenwand auf und entlässt die von den einzelnen Mikrosporen gebildeten Kalli (blumenkohlartige Zellhaufen) und Embryoide die zygotischen Embryonen ähnlich sehen. Im nächsten Kulturschritt werden die Kalli bzw. Embryoide auf Regenerationsmedium in größere Kulturgefäße umgesetzt. Unter Lichtbe-
8 8 dingungen (14 Stunden Tag/ 10 Stunden Nacht) regenerieren in weiteren 6-8 Wochen aus den Kalli und Embryoiden 2-3 blättrige Pflanzen. Pflanzen, die sich aus Mikrosporen entwickeln, besitzen nur den einfachen Chromosomensatz, sie sind haploid. Ihre vegetativen Zellen weisen nur den einfachen Chromosomensatz (2n=x=7) auf. Abb. 3: Schema zur Mikrosporenentwicklung bei Getreide Haploide Pflanzen können zwar Ähren bilden, aber die Geschlechtszellen der Blüten (Mikrosporen und Eizelle) können keine Reifeteilung durchlaufen und somit sind die Pflanzen steril, d.h. eine Kornbildung ist aufgrund fehlender Befruchtung der Eizelle nicht möglich. Eine Weiterverwendung der haploiden Pflanzen in der Züchtung wäre somit ausgeschlossen. Nach der Überführung der Pflanzen aus der in vitro Kultur in Erde und einer Kulturdauer von 3-4 Wochen im Gewächshaus werden die haploiden Pflanzen einer Colchizinbehandlung (Abb. 4) unterzogen. Colchizin ist das Gift der Herbstzeitlosen. Colchizin, ein Zellgift, bewirkt, dass während der Mitose (vegetative Zellteilung) zwar eine Verdoppelung der Chromosomen stattfindet, die Spindelbildung und Zellteilung jedoch unterbleiben. Die neugebildeten Zellen besitzen den identisch verdoppelten Chromosomensatz und bei weiteren Zellteilungen entwickeln sich Sprosse mit doppeltem Chromosomensatz. Die alten haploiden Sprosse sterben nach der Colchizinbehandlung ab und aus dem meristematischen Bereich der Wurzelkrone entwickeln sich neue doppelhaploide Sprosse, die den doppelten Chromosomensatz tragen. Die Pflanzen sind homozygot und fertil. Jede einzelne doppelhaploide Pflanze ist Ausgangspunkt einer Linie. Aufgrund der Homozygotie sind ihre Nachkommen identisch mit der doppelhaploiden Elterpflanze. Der Kornansatz der doppelhaploiden Pflanzen beschränkt sich, nach Aufregulierung des Chromosomensatzes durch Colchizinbehandlung, meist auf einige Körner pro Ähre. In der Regel ist daher vor einer Prüfung der Linie in Kleinparzellen eine Zwischenvermehrung erforderlich.
9 9 Abb. 4: Schema zur Colchizinbehandlung Abweichend von dem bisher aufgezeigten Verlauf der Antherenkultur können auch doppelhaploide Pflanzen regenerieren, bei denen der Chromosomensatz während der Regenerationsphase spontan verdoppelt wurde. Ähren dieser spontan doppelhaploiden Pflanzen zeigen eine nahezu normale Einkörnung, d.h. die Ähren sind voll eingekörnt. Das Auftreten von spontan doppelhaploiden Pflanzen wird stark vom Kreuzungsgenotyp und von den Anzuchtbedingungen der Spenderpflanzen und den in vitro-kulturbedingungen beeinflusst. Bei Gerste beträgt der Anteil spontan doppelhaploider Pflanzen, je nach Genotyp zwischen 50 und 90% bezogen auf die Anzahl regenerierter Pflanzen. (Bei Weizen ist der Anteil an spontan doppelhaploiden Pflanzen selten höher als 20%.). Die Antherenkultur wird an der LfL bei Sommer- und Wintergerste und Winterweizen eingesetzt. Die durchschnittlich erzielten Regenerationsraten (Pflanzen pro 100 Antheren) sind für die verschiedenen Getreidearten in Tab. 1 zusammengestellt. Tab. 1: Regenerationsraten bei Gerste und Weizen (Ergebnisse mit Zuchtmaterial) Kulturart Sommergerste Wintergerste Winterweizen * Anzahl Pflanzen pro 100 Antheren durchschnittliche Regenerationsrate* Min Max Der Einsatz der Antherenkultur im Rahmen von Zuchtprogrammen dient in erster Linie der Erstellung von Basiszuchtmaterial und der Erweiterung des Genpools im Bereich der Resistenz- und Qualitätszüchtung. Die Selektion erwünschter Genotypen wird durch die Homozygotie (Reinerbigkeit) der doppelhaploiden Pflanzen wesentlich erleichtert, da der Phänotyp der Pflanze unter den jeweils gegebenen Umwelten den Genotyp (Gesamtheit aller Gene eines Organismus) widerspiegelt.
10 10 In der Sortenzüchtung wird die Antherenkultur ebenfalls eingesetzt. In Deutschland sind bereits einige Sorten, die unter Nutzung der Antherenkultur geschaffen wurden, zugelassen. Antherenkulturbürtige, doppelhaploide Pflanzen werden auch zur Markerentwicklung in der Genomanalyse verwendet. Die Antherenkultur wird an der LfL auch in der Kartoffelzüchtung eingesetzt. Bei Kartoffel werden über die Antherenkultur aus tetraploiden Kartoffellinien (2n=4x=28) dihaploide Linien (2n=2x=24) erstellt, die anschließend über die Protoplastenfusion kombiniert werden können. Versuche an der LfL zur Antherenkultur bei Kartoffel haben gezeigt, dass ihr Einsatz zur Erzeugung von dihaploiden, trotz bisher geringerer Ausbeuten (unter 1% Regenerationsrate) eine Alternative zur Phureja Methode sein kann Mikrosporenkultur Die Mikrosporenkultur wurde 2004 an der LfL als Alternative zur Antherenkultur bei Gerste etabliert. Sie unterscheidet sich von der Antherenkultur insofern, dass bei ihr nicht die vollständigen Antheren auf Nährmedium kultiviert werden, sondern nur die aus den Antheren isolierten Mikrosporen. Eine Anthere enthält ca Mikrosporen. Die Spenderpflanzenanzucht, die Gewinnung der Spenderähren sowie die Kältevorbehandlung der Spenderähren wird in gleicher Weise wie in der Antherenkultur durchgeführt. In Abb. 5 wird der Ablauf der Mikrosporenkultur ab dem Zeitpunkt der Kältevorbehandlung schematisch dargestellt. Abb. 5: Schema zum Ablauf der Mikrosporenkultur Die Ährensegmente werden zur weiteren Zerkleinerung in einen Mixer (Blender) mit einem Zusatz von Mannitlösung gegeben und im Mixer dreimal zerkleinert und gemischt (geblendert). Nach dem ersten Blendern wird das Zellen-Mannitgemisch durch ein Sieb (100 µm) gefiltert und das Filtrat mit den Mikrosporen in einem autoklavierbaren Gefäß aufgefangen. Der im Sieb verbliebene Rest wird in zwei weiteren Durchgängen, nach Zugabe von weite-
11 11 rer Mannitlösung, in gleicher Art geblendert. Die im Filtrat aufgefangene Mikrosporenlösung wird anschließend bei 85 x g für 8 Minuten zentrifugiert. Anschließend wird der Überstand an Mannitlösung verworfen und das verbleibende Pellet, das tote, zerbrochene und lebende Mikrosporen enthält, mit 19%-iger Maltose aufgegossen und vorsichtig gemischt. In einem weiteren Schritt wird die erhaltene Maltose-Mikrosporenmischung mit einer 0,3 molaren Mannitlösung überschichtet. Bei der Überschichtung ist darauf zu achten, dass die Mannitlösung sehr vorsichtig einpipettiert wird, damit sich eine klare, saubere Trennschicht bilden kann. Nach einer weiteren Zentrifugation von 15 Minuten bei 85 x g bildet sich in der Mitte des Zentrifugenröhrchens eine deutlich sichtbare Bande, in der sich die lebenden, vitalen Mikrosporen gesammelt haben. Auf dem Boden des Zentrifugenröhrchens sammeln sich die toten Mikrosporen und Mikrosporenbruchstücke. Die Bande mit den lebenden Mikrosporen wird mit einer Pipette vorsichtig abgesaugt und nach Zugabe eines definierten Volumens von ml (definiertes Volumen ist für die spätere Berechnung der Mikrosporendichte erforderlich) einer 0,3 M Mannitlösung erneut bei 85 x g acht Minuten zentrifugiert. Durch die Zentrifugation wird ein Pellet mit lebenden Mikrosporen erhalten. Der Überstand wird vorsichtig abgegossen und dem Pellet anschließend das für die Mikrosporendichte ( Mikrosporen/ 0,1 ml) berechnete Volumen an flüssigem Induktionsmedium zugegeben. Mit einer sterilen Pipette wird diese Mischung aus Nährmedium und Mikrosporen in Petrischalen (d = 3 cm) auf Festmedium ausplattiert. Die Petrischalen werden mit Parafilm verschlossen und unter den gleichen Bedingungen wie bei der Antherenkultur kultiviert. Abb. 6: Beginnende Pflanzenregeneration in der Mikrosporenkultur Nach ca. einer Woche werden drei Tropfen pro Petrischale Flüssigmedium vorsichtig zugefüttert. Zu diesem Zeitpunkt sind unter dem Mikroskop erste Mikrosporenteilungen zu beobachten. Nach 2-3 Wochen, je nach Entwicklung der Mikrosporen, bilden sich sichtbare Kalli oder Embryoide. Diese werden mit dem vorhandnen Nährboden in größere Petrischalen (d = 6 cm) mit dem gleichen Medium übertragen und für weitere zwei Wochen kultiviert, bevor die Kalli/ Mikrosporen auf Regenerationsmedium in Kulturbecher umgesetzt werden. In Abbildung 7 wird die Entwicklung der Mikrosporen schematisch dargestellt.
12 12 Abb. 7: Schema zur Entwicklung von Mikrosporen in Pflanzen Ebenso wie in der Antherenkultur können in der Mikrosporenkultur sowohl haploide als auch doppelhaploide Pflanzen regenerieren. Haploide Pflanzen werden zur Erzeugung doppelhaploider Pflanzen in gleicher Weise wie bei der Antherenkultur mit Colchizin zur Verdoppelung des Chromosomensatzes behandelt. Erste Ergebnisse bei Verwendung von F1- Kreuzungsmaterial zeigen, dass die Ausbeute an haploiden/doppelhaploiden Pflanzen mit der Mikrosporenkultur deutlich höher ist verglichen mit der in der Antherenkultur erzielten Ausbeute. Ein Einfluss der Kreuzungsgenotypen auf die Regenerationsrate haploider/doppelhaploider Pflanzen pro Ähre ist auch bei der Mikrosporenkultur vorhanden. Von einem Kreuzungsgenotyp konnten von zehn Spenderähren (entspricht ca. 400 Antheren) mehrere hundert Pflanzen regeneriert werden. Die Mikrosporenkultur wird seit Anfang 2005 an der LfL in der praktischen Züchtung eingesetzt Embryonenkultur Die Embryonenkultur wird in der Getreidezüchtung in zwei Bereichen eingesetzt: 1. in der Kombinationszüchtung bei der Durchführung von weiten Kreuzungen und 2. in der Haploidiezüchtung zur Erzeugung von haploiden bzw. homozygoten doppelhaploiden Pflanzen. In der Kombinationszüchtung wird die Embryonenkultur zum Beispiel in der Weizenzüchtung mit dem Ziel eingesetzt, Resistenzgene aus Wildformen des Weizens in Kulturformen ( weite Kreuzung ) zu übertragen. In gleicher Weise wie bei der Kreuzung von adaptiertem Zuchtmaterial beginnt die weite Kreuzung mit der Anzucht der Kreuzungspartner. Im Fall einer weiten Kreuzung, zum Beispiel Einkreuzung einer Mehltauresistenz bei Weizen, dient die Kulturform (Triticum aestivum) als Mutterelter und die Wildform
13 13 (z.b. Triticum turgidum var. dicocoides, Resistenzträger) als Vaterelter. Nach der Bestäubung der Mutterpflanze werden, im Gegensatz zu Kreuzungen von adaptiertem Zuchtmaterial, Karyopsen gebildet, die einen Embryo enthalten, aber deren Endosperm (Nährgewebe) nur unzureichend ausgebildet ist oder aufgrund einer Unverträglichkeit zwischen Embryo und Nährgewebe die Versorgung des Embryos mit Nährstoffen nicht gewährleistet. Eine unzureichende Versorgung des Embryos mit Nährstoffen stört die Entwicklung des Embryos und der Embryo stirbt ab. Das Absterben des Embryos kann verhindert werden, wenn der gebildete Embryo im Alter von Tagen, bei einer Größe von ~ 2-5 mm, unter sterilen Bedingungen (Reinluftwerkbank) unter einem Stereomikroskop aus der Karyopse herauspräpariert und auf Nährmedium unter in vitro Bedingungen kultiviert wird. Der Kornansatz bei Abreife der embryobürtigen Pflanzen ist oft gering und hängt außer von der Vitalität der Pflanzen auch von der Verträglichkeit der Kreuzungspartner ab. Die Embryonenkultur ist kein neues Zuchtverfahren, sondern lediglich eine biotechnologische Methode, die im Rahmen der Kombinationszüchtung eingesetzt werden kann. Die Auswahl der Kreuzungspartner sowie die Selektion erwünschter Genotypen und deren Einbau in komplexe Zuchtprogramme bleibt in der Verantwortung des Züchters. In der Haploidiezüchtung wird die Embryonenkultur an der LfL bei Winterweizen seit 2004 routinemäßig zur Erstellung von haploiden/doppelhaploiden Pflanzen eingesetzt. Die Embryonenkultur im Rahmen der Haploidiezüchtung ist schematisch in Abb. 8 dargestellt. Abb. 8: Schema zur Weizen x Mais-Methode Anzucht der Spenderpflanzen bei Weizen Ausgehend von Kreuzungskörnern werden die Spenderpflanzen des Weizens herangezogen. Da es sich um Winterweizen handelt, werden die Pflanzen 1-2 Wochen nach der Keimung bei 4 C für 8 Wochen vernalisiert (Simulation des Winters s. Spenderpflanzenanzucht Antherenkultur). Nach erfolgter Vernalisation werden die Pflanzen für ca. 4 Wochen in einem Kulturraum bei 16 C kultiviert, sofern dies zur Synchronisation mit der Maisblüte erforder-
14 14 lich ist. Bis zur Bestäubung der Weizenähren mit Zuckermaispollen werden die Weizenpflanzen bei C im Gewächshaus kultiviert. Anzucht der Pollenspenderpflanzen bei Zuckermais Zuckermaiskörner werden zur Anzucht der Pollenspenderpflanzen ca. 10 Wochen vor der erwarteten Weizenblüte ausgesät und im Gewächshaus bei C herangezogen. Ein bis zwei Tage vor der Anthese (Reife und Schüttung der Pollen) der Weizenblütchen werden sie durch Entfernung der Antheren kastriert. Die kastrierten Ähren werden mit einer lichtdurchlässigen Pergamenttüte eingehüllt, um eine Bestäubung durch reife Weizenähren in der Nachbarschaft zu vermeiden. Zwei Tage nach der Kastration werden die Weizenblütchen mit frischem Zuckermaispollen bestäubt. Die bestäubten Ähren werden, um ein Austrocknen der Narbenfäden zu verhindern, wiederum mit Pergamenttüten eingehüllt. Durch die Befruchtung der Eizelle des Weizens mit Zuckermaispollen wird eine Zygote gebildet. Am nächsten Tag wird in den Halm der Weizenähre in das letzte obere Internodium mit einer Injektionsspritze eine Hormonlösung, bestehend aus Benzylaminopurin (20 mg/ l) und Dicamba (100 mg/l), injiziert. Die Hormonlösung unterstützt die Entwicklung der Zygote zum Embryo. Während den ersten Zellteilungen der Zygote werden die Chromosomen des Zuckermais eliminiert und bei Zellneubildung enthalten die Zellen des sich entwickelnden Embryos nur noch die Chromosomen des Weizens und sind haploid. Aufgrund unvollständiger Entwicklung von Nährgewebe (Endosperm) kann der Embryo nicht mit Nährstoffen versorgt werden und würde nach einiger Zeit absterben. Wird der Embryo jedoch innerhalb einer Zeitspanne von 14 bis 16 Tagen nach der Bestäubung der Weizenblüte aus der Karyopse präpariert und auf Nährmedium kultiviert (in vitro-kultur), regeneriert der Embryo zu einer haploiden Pflanze. Die regenerierten haploiden Pflanzen sind steril und werden, wie bei der Antherenkultur beschrieben, zur Verdoppelung des Chromosomensatzes einer Colchizinbehandlung unterzogen. Die mit der Weizen x Mais -Methode erzielten Regenerationsraten an haploiden Pflanzen pro Ähre liegen deutlich über den Regenerationsraten, die bei Weizen mit der Antherenkultur erhalten werden. Abb. 9 : Regenerierende Embryonen Zusammenfassung Zur Erweiterung der genetischen Variabilität, eine Voraussetzung für Fortschritte in der Resistenz- und Qualitätszüchtung, werden die Antherenkultur, die Mikrosporenkultur und die Embryokultur an der LfL erfolgreich eingesetzt. In der Gersten- und Weizenzüchtung zeichnet sich ab, dass die Antherenkultur zur Erzeugung von haploiden bzw. doppelhaploiden Pflanzen, durch die Mikrosporenkultur (Gerste) und die Weizen x Mais-Methode abgelöst wird. Der erforderliche höhere Arbeitsaufwand bei der Mikrosporenkultur und der Weizen x Mais-Methode gegenüber der Antherenkultur wird durch die höhere Regenerationsraten pro Ähre ausgeglichen. Die Produktionskosten pro doppelhaploider Pflanze verringern sich durch den Einsatz der Mikrosporenkultur und Weizen x Mais-Methode.
15 Methoden zur Vermehrung und Erhaltung von Zuchtmaterial Zur Vermehrung und Erhaltung stehen in der pflanzlichen Zell- und Gewebekultur die - Meristemkultur - die Sprossspitzen- und Nodienkultur - die Schnelle Vermehrung und - die in vitro Langzeitlagerung zur Verfügung Meristemkultur Meristeme sind teilungsfähige Zellverbände in den Wachstumszonen der Sprosse, Wurzeln und Seitenknospen (Abb. 10). Mit einer Größe von nur wenigen Millimetern sind sie sehr klein und ihre Inkulturnahme erweist sich meist als sehr schwierig. Abb. 10: Schema zur Meristemkultur Aus den meristematischen Zellen können in vitro vollständige Pflanzen regenerieren. Am häufigsten werden Meristeme der Sprossspitze und der Achselknospen zur Pflanzenregeneration kultiviert. Ein großer Vorteil der Meristemkultur besteht darin, dass die meristematischen Zellen grundsätzlich frei von Viren und Bakterien sind und deshalb zur Sanierung von krankheitsbefallenen Pflanzen genutzt werden können. Zunächst werden die Sprosse mit Natriumhypochlorid (5 %-ig) für 5-10 Minuten oberflächensterilisiert und anschließend dreimal mit destilliertem Wasser gespült. Im nächsten Schritt werden die Meristeme unter dem Binokular unter sterilen Bedingungen (Reinluft-Werkbank) aus den Sprossspitzen und Seitenknospen herauspräpariert und in Kulturröhrchen oder Petrischalen auf Nährmedium platziert. Zunächst wird in Dunkelheit bei C im Brutschrank kultiviert. Nach ca. 2-3 Wochen werden die bereits differenzierten Gewebe auf frischem Nährmedium in größeren Kulturgefäßen bei C unter Lichtbedingungen bis zur Regeneration von Pflanze weiter kultiviert.
16 16 Wird die Meristemkultur zur Sanierung von Krankheiten eingesetzt, können bereits die regenerierten Pflanzen auf Virus- und/oder Bakterienfreiheit getestet werden. Sind die Regenerate gesund kann über eine Nodalsegmentvermehrung eine große Anzahl identischer Pflanzen vermehrt werden. Im anderen Fall ist erneut eine Meristemkultur anzulegen. Gegebenenfalls kann dabei eine Wärmetherapie (35-38 C) der Spenderpflanze durchgeführt werden. Soweit erforderlich, werden die in vitro-regenerate zur Bewurzelung auf ein Medium mit speziellen Phytohormnen überführt und nach erfolgter Bewurzelung in Erdkultur pikiert und im Gewächshaus abgehärtet, bevor sie ins Freiland ausgepflanzt werden Sprossspitzen- / Nodienkultur Sprossspitzen- und Nodienkultur werden in erster Linie zur Vermehrung und Erhaltung von Zuchtmaterial eingesetzt. Ziel ist die identische vegetative Vermehrung von Pflanzen bei gleichzeitiger Erhaltung des Genotyps. Wie bereits bei der Meristemkultur angedeutet, können von den über die Meristemkultur regenerierten Pflanzen zur identischen Vermehrung Sprossspitzen- und Nodienkulturen angelegt werden. Abb. 11: Schema zur Sprossspitzen-/Nodienkultur Für die Anlage von Sprossspitzen- und Nodienkulturen, ohne Vorschaltung der Meristemkultur, ist es zunächst erforderlich, die Oberfläche der Triebe der Spenderpflanzen zu desinfizieren. Die Triebe werden hierzu, je nach Alter und Pflanzenart, unter Reinluftbedingungen ( Reinluft-Werkbank ) einer 5%-igen Natrium-Hypochloridlösung ausgesetzt und anschließend dreimal mit destilliertem Wasser gründlich gespült. Die Sprosse werden nachfolgend mit einem Skalpell in Sprossspitze und Sprossabschnitte mit Nodien (Gewebeteile mit Seitenknospenanlagen, Nodalsegmente) zerteilt. Die Sprossabschnitte mit einer Größe zwischen 1 3 cm, und die Sprossspitzen werden auf Vermehrungsmedium in größeren Kulturschalen bei C und Stundentag kultiviert. Aus dem Gewebe der Sprossspitzen und den Knospenanlagen regenerieren in einem Zeitraum von 4-5 Wochen Sprosse, die wiederum in Form von Nodalsegmenten weitervermehrt werden können. Sobald die gewünschte Anzahl an Regeneraten erreicht ist, werden die Re-
17 17 generate, soweit erforderlich, auf Bewurzelungsmedium kultiviert und nach erfolgter Wurzelbildung in Erdkultur überführt. Eine besondere Form der Nodienkultur stellt die in vitro-langzeitlagerung von Pflanzen dar. Nach der Regeneration von Sprossen und deren Vermehrung können Sprosskulturen unter Schwachlichtbedingungen und niedrigen Temperaturen (8-10 C) in vitro über längere Zeiträume (4-10 Monate) platzsparend und ohne Witterungseinflüsse kultiviert werden. Nach 4-10 Monaten werden die Pflanzen in vitro vermehrt und auf frisches Nährmedium überführt. Dieses Verfahren wird in der Erhaltungszüchtung von Zuchtmaterial eingesetzt. An der LfL werden Klone von Arnika-Elitepflanzen bereits 14 Jahre in der Langzeitlagerung erhalten. Zusammenfassung Die Meristemkultur nimmt als Ausgangspunkt in der vegetativen in vitro-vermehrung wertvollen Pflanzenmaterials und als Methode zur Sanierung virus- oder bakterienbefallener Pflanzen in der Erhaltungszüchtung einen wichtigen Platz ein. Die Sprossspitzen- und Nodienkultur als Verfahren zur in vitro-vermehrung von Pflanzen in großer Stückzahl hat sowohl im Vorfeld von Züchtungsprogrammen (Pflanzenmaterial für Polycross-Anlagen) als auch in der Erhaltungszüchtung ihren Platz. Die in vitro-langzeitlagerung, eine Form der Nodienkultur, ermöglicht es, wertvolle Elitepflanzen ohne Witterungseinflüsse bei geringem Platzbedarf über einen längeren Zeitraum ohne genetische Veränderung zu erhalten und bei Bedarf für Züchtungszwecke zur Verfügung zu stellen. Abb. 12: In vitro-langzeitlagerung von Arnica montana 3 Züchtungsfortschritt durch Zell- und Gewebekultur 3.1 Sortenzüchtung Die Entwicklung einer neuen Gersten- oder Weizensorte, ausgehend von der Ausgangskreuzung bis zur Sortenzulassung durch das Bundessortenamt, ist sehr langwierig. In der Regel vergehen Jahre bis das Produkt der Kreuzung als Sorte dem Landwirt zum Anbau
18 18 zur Verfügung steht. In Abb. 13 wird der konventionelle Zuchtgang und der Zuchtgang unter Einbeziehung der Haploidentechniken gegenübergestellt. Abb. 13: Vergleich konventionelle Züchtung und Züchtung unter Einbeziehung der Haploidentechniken. Durch den Einsatz der Antherenkultur und der Weizen x Mais-Methode kann die Entwicklung einer Sorte um zwei bis drei Jahre verkürzt werden. Im konventionellen Zuchtgang verzögert die mangelnde Ausgeglichenheit in den Nachkommenschaften, bedingt durch die fehlende 100%-ige Homozygotie, den Zeitraum bis zur Wertprüfung und Sortenzulassung. Eingebunden in die klassische Züchtung leisten die Antherenkultur und die Weizen x Mais-Methode einen wichtigen Beitrag zur schnelleren Entwicklung von resistenten, qualitativ hochwertigen und ertragreichen Sorten. Über Kooperationen zwischen dem Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung und mittelständischen bayerischen Züchtern finden die Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung auf kürzestem Weg Eingang in die Praxis. Abb. 14: Induktion Antherenkultur
19 3.2 In vitro-vermehrung und in vitro-erhaltung von Pflanzen im Rahmen von Zuchtprogrammen Die in vitro-vermehrung und in vitro-erhaltung von Pflanzen werden in der Züchtung bei Fremdbefruchtern zur Erzeugung von Klonpflanzen eingesetzt. Beispielhaft wird ihr Einsatz in der Züchtung von Arnica montana erläutert. Die Blüten von Arnica montana werden für die Herstellung von über 200 Arzneispezialitäten verwendet. Im Hinblick auf die strengen Qualitätsvorschriften der Pharmaindustrie entspricht die Qualität der Rohware aus Wildsammlungen oft nicht den Anforderungen. Daher bestand seitens der Pharmafirmen der Wunsch Rohware aus gezieltem Anbau zu erhalten. Die LfL (Arbeitsgruppe Heil- und Gewürzpflanzen, Prof. Dr. U. Bomme) begann daher 1984 Saatgut verschiedener Herkünfte im Feldanbau auf ihre Anbaueignung und die Zusammensetzung ihrer Inhaltsstoffe zu prüfen. Von geeigneten Herkünften wurden einzelne Elitepflanzen (Genotypen) selektiert und in vitro über Meristemkultur und Sprossspitzenkultur etabliert und in einem weiteren Schritt zu Pflanzen regeneriert. Anschließend wurden die in vitro-pflanzen unter aseptischen Bedingungen in größerer Stückzahl vermehrt. Die so erhaltenen Klone (durch vegetative Vermehrung erhaltene erbgleiche Pflanzen) der verschiedenen Elitepflanzen wurden in Leistungsprüfungen weiter geprüft. Im Folgenden wurden die besten Klone in einer Polycross-Anlage frei abblühend kombiniert und die Samen der einzelnen Pflanzen getrennt geerntet und im Folgejahr isoliert angebaut und zu Linien entwickelt. Die einzelnen Linien wurden im Hinblick auf Anbauwürdigkeit und Inhaltsstoffzusammensetzung selektiert. Eine dieser Linien wurde von der Bayerischen Pflanzenzuchtgesellschaft beim Bundessortenamt zur Sortenzulassung angemeldet und weltweit als erste Arnikasorte mit dem Namen Arbo 1998 zugelassen. Ohne Einbeziehung der in vitro- Techniken zur Schaffung des Klonmaterials hätte sich die Sortenentwicklung bei dem Fremdbefruchter Arnica montana um einige Jahre verlängert. Die wertvollsten Arnika- Klone werden seit 1991 in der in vitro-langzeitlagerung erhalten. 19 Abb. 15: Steriler Arbeitsplatz Abb. 16: Arnikapflanzen aus in vitro in Erde überführt
Züchtungsverfahren im Pflanzenbau -Ein Überblick-
 Seite 1 Züchtungsverfahren im Pflanzenbau -Ein Überblick- Unterrichtsleitfaden an der Technikerschule für Agrarwirtschaft Triesdorf 2013 Quellennachweis und weiterführende Links s. Text Herzlichen Dank
Seite 1 Züchtungsverfahren im Pflanzenbau -Ein Überblick- Unterrichtsleitfaden an der Technikerschule für Agrarwirtschaft Triesdorf 2013 Quellennachweis und weiterführende Links s. Text Herzlichen Dank
Praktische Rapszüchtung
 UNION ZUR FÖRDERUNG VON OEL- UND PROTEINPFLANZEN E. V. Praktische Rapszüchtung Ursprung Der Raps (Brassica napus) gehört zur Familie der Kreuzblütler und ist aus einer spontanen Kreuzung von Wildkohl (Brassica
UNION ZUR FÖRDERUNG VON OEL- UND PROTEINPFLANZEN E. V. Praktische Rapszüchtung Ursprung Der Raps (Brassica napus) gehört zur Familie der Kreuzblütler und ist aus einer spontanen Kreuzung von Wildkohl (Brassica
GenomeEditing. Neues Potential in der konvenpotenzial Landwirtschaft. KWS SAAT SE Dr. Jürgen Schweden KWS SAAT Einbeck, Oktober 2017
 Genome GenomeEditing Editing Neues Potential in der konvenpotenzial für eine nachhaltige tionellen Pflanzenzüchtung Landwirtschaft KWS SAAT SE Dr. Jürgen Schweden KWS SAAT SE 2017 Einbeck, 20. April Einbeck,
Genome GenomeEditing Editing Neues Potential in der konvenpotenzial für eine nachhaltige tionellen Pflanzenzüchtung Landwirtschaft KWS SAAT SE Dr. Jürgen Schweden KWS SAAT SE 2017 Einbeck, 20. April Einbeck,
Angewandte Forschung und private Pflanzenzüchtung
 Pflanzen züchten Zukunft sichern! Symposium zur Pflanzenzüchtung in Bayern Angewandte Forschung und private Pflanzenzüchtung Dr. Bernhard Saal Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft eg & Co KG Erdinger Straße
Pflanzen züchten Zukunft sichern! Symposium zur Pflanzenzüchtung in Bayern Angewandte Forschung und private Pflanzenzüchtung Dr. Bernhard Saal Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft eg & Co KG Erdinger Straße
110 Jahre Züchtungsforschung in Bayern
 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 110 Jahre Züchtungsforschung in Bayern Vor Gründung der Saatzucht Weihenstephan Die Agrarkrise um 1890 führt zur Gründung mehrerer staatlicher Agrarforschungseinrichtungen
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 110 Jahre Züchtungsforschung in Bayern Vor Gründung der Saatzucht Weihenstephan Die Agrarkrise um 1890 führt zur Gründung mehrerer staatlicher Agrarforschungseinrichtungen
Grundlagen der Vererbungslehre
 Grundlagen der Vererbungslehre Zucht und Fortpflanzung Unter Zucht verstehen wir die planvolle Verpaarung von Elterntieren, die sich in ihren Rassemerkmalen und Nutzleistungen ergänzen zur Verbesserung
Grundlagen der Vererbungslehre Zucht und Fortpflanzung Unter Zucht verstehen wir die planvolle Verpaarung von Elterntieren, die sich in ihren Rassemerkmalen und Nutzleistungen ergänzen zur Verbesserung
Mit leistungsstarker Genetik und Sortenvielfalt Spitzenerträge ernten. Dr. Joachim Moeser Produktmanagement Bioenergie SAATEN-UNION GmbH, Isernhagen
 Mit leistungsstarker Genetik und Sortenvielfalt Spitzenerträge ernten Dr. Joachim Moeser Produktmanagement Bioenergie SAATEN-UNION GmbH, Isernhagen Vortrags-Übersicht 1. Einführung in die moderne Pflanzenzüchtung
Mit leistungsstarker Genetik und Sortenvielfalt Spitzenerträge ernten Dr. Joachim Moeser Produktmanagement Bioenergie SAATEN-UNION GmbH, Isernhagen Vortrags-Übersicht 1. Einführung in die moderne Pflanzenzüchtung
FRAG DIE GERSTE. Das 1x1 der modernen Pflanzenforschung. Pflanzenzüchtung
 FRAG DIE GERSTE Das 1x1 der modernen Pflanzenforschung Pflanzenzüchtung Inhalt Pflanzenzüchtung FRAG DIE GERSTE Was ist Pflanzenzüchtung? Woher kommen unsere Kulturpflanzen? Warum brauchen wir überhaupt
FRAG DIE GERSTE Das 1x1 der modernen Pflanzenforschung Pflanzenzüchtung Inhalt Pflanzenzüchtung FRAG DIE GERSTE Was ist Pflanzenzüchtung? Woher kommen unsere Kulturpflanzen? Warum brauchen wir überhaupt
Gewebekultur bei Stevia rebaudiana Bertoni. Dominik Losert 8. Oktober 2014
 Gewebekultur bei Stevia rebaudiana Bertoni Dominik Losert 8. Oktober 2014 Inhaltsverzeichnis 1. Einführung 2. Material und Methoden 3. Ergebnisse 4. Schlussfolgerungen 5. Literatur 1. Einführung Ursprungsgebiet
Gewebekultur bei Stevia rebaudiana Bertoni Dominik Losert 8. Oktober 2014 Inhaltsverzeichnis 1. Einführung 2. Material und Methoden 3. Ergebnisse 4. Schlussfolgerungen 5. Literatur 1. Einführung Ursprungsgebiet
Was ist Original-Saatgut?
 Was ist Original-Saatgut? Das Label Original-Saatgut der Saatgut Austria bietet den Landwirten Sicherheit. Original-Saatgut ist zertifiziertes Saat- oder Pflanzengut. Garantiert Keimfähigkeit und Sortenreinheit
Was ist Original-Saatgut? Das Label Original-Saatgut der Saatgut Austria bietet den Landwirten Sicherheit. Original-Saatgut ist zertifiziertes Saat- oder Pflanzengut. Garantiert Keimfähigkeit und Sortenreinheit
Selektion. Allgemeines. Selektion bei Selbstbefruchtern. Einführende Beispiele Grundlagen Natürliche Selektion
 Selektion Allgemeines Einführende Beispiele Grundlagen Natürliche Selektion Selektion bei Selbstbefruchtern Spaltende Generationen nach einer Kreuzung Selektion auf mehrere Merkmale Selektionsentscheidungen
Selektion Allgemeines Einführende Beispiele Grundlagen Natürliche Selektion Selektion bei Selbstbefruchtern Spaltende Generationen nach einer Kreuzung Selektion auf mehrere Merkmale Selektionsentscheidungen
Grüne Gentechnik. Parlamentarischer Abend der Deutschen Forschungsgemeinschaft am 22. März 2010 in Berlin
 Grüne Gentechnik Parlamentarischer Abend der Deutschen Forschungsgemeinschaft am 22. März 2010 in Berlin Was bringt die Grüne Gentechnik in der Pflanzenzüchtung? Christian Jung, Universität Kiel Die Entwicklung
Grüne Gentechnik Parlamentarischer Abend der Deutschen Forschungsgemeinschaft am 22. März 2010 in Berlin Was bringt die Grüne Gentechnik in der Pflanzenzüchtung? Christian Jung, Universität Kiel Die Entwicklung
Validierung praxisrelevanter Marker für die Züchtung klimaangepasster und gesunder Gerstensorten
 Projektverbund Strategien zur Anpassung von Kulturpflanzen an den Klimawandel Validierung praxisrelevanter Marker für die Züchtung klimaangepasster und gesunder Gerstensorten Dr. Markus Herz Bayerische
Projektverbund Strategien zur Anpassung von Kulturpflanzen an den Klimawandel Validierung praxisrelevanter Marker für die Züchtung klimaangepasster und gesunder Gerstensorten Dr. Markus Herz Bayerische
Pflanzenzüchtung. Von der klassischen Züchtung bis zur Biotechnologie. LfL-Information
 Pflanzenzüchtung Von der klassischen Züchtung bis zur Biotechnologie LfL-Information Inhalt Biokraftwerk Pflanze 3 Bedeutung der Pflanzenzüchtung 5 Klassische Sortenzüchtung 7 Neue Züchtungsmethoden 9
Pflanzenzüchtung Von der klassischen Züchtung bis zur Biotechnologie LfL-Information Inhalt Biokraftwerk Pflanze 3 Bedeutung der Pflanzenzüchtung 5 Klassische Sortenzüchtung 7 Neue Züchtungsmethoden 9
Emmer und Einkorn. Stephanie Franck. PZO Pflanzenzucht Oberlimpurg
 4. Wintertagung Ökologischer Landbau Baden-Württemberg 10. März 2010 Emmer und Einkorn Stephanie Franck PZO Pflanzenzucht Oberlimpurg PRO INNO II Projekt: Sortenzüchtung von Einkorn und Emmer Teilprojekt:
4. Wintertagung Ökologischer Landbau Baden-Württemberg 10. März 2010 Emmer und Einkorn Stephanie Franck PZO Pflanzenzucht Oberlimpurg PRO INNO II Projekt: Sortenzüchtung von Einkorn und Emmer Teilprojekt:
Blattkrankheiten beim Mais Welche Möglichkeiten bietet die Züchtung? Dr. Susanne Groh, DuPont Pioneer, Forschungs- und Technologiezentrum Eschbach
 AGRONOMY-INFORMATIONEN Blattkrankheiten beim Mais Welche Möglichkeiten bietet die Züchtung? Dr. Susanne Groh, DuPont Pioneer, Forschungs- und Technologiezentrum Eschbach Blattkrankheiten können im Mais
AGRONOMY-INFORMATIONEN Blattkrankheiten beim Mais Welche Möglichkeiten bietet die Züchtung? Dr. Susanne Groh, DuPont Pioneer, Forschungs- und Technologiezentrum Eschbach Blattkrankheiten können im Mais
Grüne Gentechnik in Deutschland - ein Thema voller Emotionen -
 Grüne Gentechnik in Deutschland - ein Thema voller Emotionen - Jakob Opperer Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft bei den Münchner Wissenschaftstagen am 22. Oktober 2006 im AUDIMAX der LMU In der
Grüne Gentechnik in Deutschland - ein Thema voller Emotionen - Jakob Opperer Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft bei den Münchner Wissenschaftstagen am 22. Oktober 2006 im AUDIMAX der LMU In der
Zuchtmethoden und -erfolge in der Getreidezüchtung. Dr. Lorenz Hartl
 Zuchtmethoden und -erfolge in der Getreidezüchtung Dr. Lorenz Hartl Ertrag dt/ha 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Zuchtmethoden und -erfolge in der Getreidezüchtung Dr. Lorenz Hartl Ertrag dt/ha 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1 Regeln der Vererbung
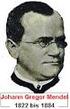 1 Regeln der Vererbung Natura Genetik 1 Regeln der Vererbung Lösungen zu den Aufgaben Seiten 6 7 1.1 Eltern geben genetisches Material weiter 1 Erstelle einen möglichen Karyogrammausschnitt für ein weiteres
1 Regeln der Vererbung Natura Genetik 1 Regeln der Vererbung Lösungen zu den Aufgaben Seiten 6 7 1.1 Eltern geben genetisches Material weiter 1 Erstelle einen möglichen Karyogrammausschnitt für ein weiteres
I. Allgemeine Pflanzenzüchtung
 I. Allgemeine Pflanzenzüchtung I. Allgemeine Pflanzenzüchtung 1. Ziele, Methoden und Erfolge der Pflanzenzüchtung Ziel der Pflanzenzüchtung ist die genetische Veränderung von Kulturpflanzen, um sie besser
I. Allgemeine Pflanzenzüchtung I. Allgemeine Pflanzenzüchtung 1. Ziele, Methoden und Erfolge der Pflanzenzüchtung Ziel der Pflanzenzüchtung ist die genetische Veränderung von Kulturpflanzen, um sie besser
Matthias Schwaiger EINIGE ASPEKTE DER IN-VITRO VERMEHRUNG VON PFLANZEN
 Matthias Schwaiger EINIGE ASPEKTE DER IN-VITRO VERMEHRUNG VON PFLANZEN Berlin, 26.08.2011 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 2 2 Gewebekulturtechniken... 3 2.1 Meristemkultur... 3 2.2 Organkultur... 3
Matthias Schwaiger EINIGE ASPEKTE DER IN-VITRO VERMEHRUNG VON PFLANZEN Berlin, 26.08.2011 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 2 2 Gewebekulturtechniken... 3 2.1 Meristemkultur... 3 2.2 Organkultur... 3
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Dr. Peter Doleschel Prof. Dr. Volker Mohler Dr. Joachim Eder, Dr. Christine Riedel, Adolf Kellermann, Dr. Markus Herz, Dr. Lorenz Hartl, Dr. Bianca Büttner,
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Dr. Peter Doleschel Prof. Dr. Volker Mohler Dr. Joachim Eder, Dr. Christine Riedel, Adolf Kellermann, Dr. Markus Herz, Dr. Lorenz Hartl, Dr. Bianca Büttner,
Risiken der Nutzung der sog. Grünen Gentechnologie
 Risiken der Nutzung der sog. Grünen Gentechnologie Inhaltsverzeichnis Transgene Pflanzen - Gentechnologische Methoden Markergene - Antibiotika-Selektionsmarker Nutzung gentechnisch veränderter Pflanzen
Risiken der Nutzung der sog. Grünen Gentechnologie Inhaltsverzeichnis Transgene Pflanzen - Gentechnologische Methoden Markergene - Antibiotika-Selektionsmarker Nutzung gentechnisch veränderter Pflanzen
Die Reform des Saat- und Pflanzgutrechts der EU
 1 Die Reform des Saat- und Pflanzgutrechts der EU - Ziele und Forderungen aus niedersächsischer Sicht - Dr. Cord Stoyke Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Gliederung 2 1. Einleitung 2. Pflanzenzucht
1 Die Reform des Saat- und Pflanzgutrechts der EU - Ziele und Forderungen aus niedersächsischer Sicht - Dr. Cord Stoyke Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Gliederung 2 1. Einleitung 2. Pflanzenzucht
Klimawandel & Co. Herausforderungen für die Züchtungsforschung in Deutschland
 Klimawandel & Co. Herausforderungen für die Züchtungsforschung in Deutschland Peter Wehling Institut für Züchtungsforschung an landwirtschaftlichen Kulturen Groß Lüsewitz Ertragspotenzial und Ertrag Ertragspotenzial
Klimawandel & Co. Herausforderungen für die Züchtungsforschung in Deutschland Peter Wehling Institut für Züchtungsforschung an landwirtschaftlichen Kulturen Groß Lüsewitz Ertragspotenzial und Ertrag Ertragspotenzial
Patente auf Pflanzen Wem gehört der Brokkoli?
 Patente auf Pflanzen Wem gehört der Brokkoli? Erhaltungsstrategien Sortenvielfalt heute und morgen SKEK-Fachtagung, 12. November 2009, Zollikofen Dr. Claudia Mund, Rechtsdienst Patente und Designs, Institut
Patente auf Pflanzen Wem gehört der Brokkoli? Erhaltungsstrategien Sortenvielfalt heute und morgen SKEK-Fachtagung, 12. November 2009, Zollikofen Dr. Claudia Mund, Rechtsdienst Patente und Designs, Institut
Klone sind die natürlichen vegetativen
 Die Selektion von steirischen Rebklonen Klone sind die natürlichen vegetativen Nachkommen einer über mehrere Jahre hinweg beobachteten und positiv beurteilten Einzelpflanze. Die Selektion steirischer Rebklone
Die Selektion von steirischen Rebklonen Klone sind die natürlichen vegetativen Nachkommen einer über mehrere Jahre hinweg beobachteten und positiv beurteilten Einzelpflanze. Die Selektion steirischer Rebklone
InnoPlanta Forum 2010 Grüne Biotechnologie ist weltweit Realität - Die Sicht eines Pflanzenzüchtungsunternehmens
 InnoPlanta Forum 2010 Grüne Biotechnologie ist weltweit Realität - Die Sicht eines Pflanzenzüchtungsunternehmens Philip von dem Bussche KWS SAAT AG Üplingen, 6. September 2010 Globale Herausforderungen
InnoPlanta Forum 2010 Grüne Biotechnologie ist weltweit Realität - Die Sicht eines Pflanzenzüchtungsunternehmens Philip von dem Bussche KWS SAAT AG Üplingen, 6. September 2010 Globale Herausforderungen
Pflanzenbiotechnologie
 Pflanzenbiotechnologie Praktikumsbericht vom 07.12.09 Labor SPF 4. Klasse Erstellt von Benjamin Baumann, 4Md 1 Einleitung Ziel dieses Praktikums ist es, wenige grundlegende Techniken der Pflanzenbiotechnologie
Pflanzenbiotechnologie Praktikumsbericht vom 07.12.09 Labor SPF 4. Klasse Erstellt von Benjamin Baumann, 4Md 1 Einleitung Ziel dieses Praktikums ist es, wenige grundlegende Techniken der Pflanzenbiotechnologie
Learn4Med. Ein Gen steuert die Haarfarbe einer Katze. Es gibt ein Allel (also eine Version) für ein schwarzes Fell und ein Allel für rote Haare.
 1. Mendelsche Regeln Bei Mendel ist ein Gen als Teil des Erbmaterials definiert, der für die Ausbildung eines bestimmten Merkmals verantwortlich ist. Gibt es für dieses Gen verschiedene Ausprägungen, nennt
1. Mendelsche Regeln Bei Mendel ist ein Gen als Teil des Erbmaterials definiert, der für die Ausbildung eines bestimmten Merkmals verantwortlich ist. Gibt es für dieses Gen verschiedene Ausprägungen, nennt
Pinschertage der OG Bonn Grundlagen der Zucht
 Pinschertage der OG Bonn 31.05. - 01.06.2008 Grundlagen der Zucht von Ralf Wiechmann Der Phänotyp Ist die Gesamtheit der wahrnehmbaren Merkmale eines Organismus. das äußere Erscheinungsbild das Aussehen,
Pinschertage der OG Bonn 31.05. - 01.06.2008 Grundlagen der Zucht von Ralf Wiechmann Der Phänotyp Ist die Gesamtheit der wahrnehmbaren Merkmale eines Organismus. das äußere Erscheinungsbild das Aussehen,
Saatgut-Projekt Äthiopien. Saatgutsektor stärken Lebensmittelversorgung verbessern
 Saatgut-Projekt Äthiopien Saatgutsektor stärken Lebensmittelversorgung verbessern Das KWS Saatgut- Projekt in Äthiopien Halbtrockenes Klima im Flachland, gemäßigtes Klima im Hochland. Die sehr unterschiedlichen
Saatgut-Projekt Äthiopien Saatgutsektor stärken Lebensmittelversorgung verbessern Das KWS Saatgut- Projekt in Äthiopien Halbtrockenes Klima im Flachland, gemäßigtes Klima im Hochland. Die sehr unterschiedlichen
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft. Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung
 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung Jahresbericht 2012 Impressum Herausgeber: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) Vöttinger Straße 38,
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung Jahresbericht 2012 Impressum Herausgeber: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) Vöttinger Straße 38,
Miscanthus-Anbautelegramm
 Miscanthus-Anbautelegramm Allgemein Miscanthus x giganteus stammt ursprünglich aus Asien und ist ein Hybrid aus Miscanthus sachariflorus und Miscanthus sinensis (siehe Fotos). Es bildet daher auch keine
Miscanthus-Anbautelegramm Allgemein Miscanthus x giganteus stammt ursprünglich aus Asien und ist ein Hybrid aus Miscanthus sachariflorus und Miscanthus sinensis (siehe Fotos). Es bildet daher auch keine
(Konventionelle) Züchtung für den biologischen Landbau in Österreich
 (Konventionelle) Züchtung für den biologischen Landbau in Österreich Franziska Löschenberger Saatzucht Donau GmbH&CoKG Zuchtstation Probstdorf (Konventionelle) Züchtung für den biologischen Landbau in
(Konventionelle) Züchtung für den biologischen Landbau in Österreich Franziska Löschenberger Saatzucht Donau GmbH&CoKG Zuchtstation Probstdorf (Konventionelle) Züchtung für den biologischen Landbau in
Artischocken 'Imperial Star F1' (öko) und 'JW 106 F1' mit guten Erträgen bereits im Pflanzjahr
 Versuche im deutschen Gartenbau 2013 Die Ergebnisse kurzgefasst Bei einem Sorten- und Kulturversuch mit Artischocken als Gemüse im versuchsbetrieb Bamberg der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und
Versuche im deutschen Gartenbau 2013 Die Ergebnisse kurzgefasst Bei einem Sorten- und Kulturversuch mit Artischocken als Gemüse im versuchsbetrieb Bamberg der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und
Antwort. Deutscher Bundestag Drucksache 14/6850. der Bundesregierung
 Deutscher Bundestag Drucksache 14/6850 14. Wahlperiode 31. 08. 2001 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulrike Flach, Ulrich Heinrich, Marita Sehn, weiterer Abgeordneter
Deutscher Bundestag Drucksache 14/6850 14. Wahlperiode 31. 08. 2001 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulrike Flach, Ulrich Heinrich, Marita Sehn, weiterer Abgeordneter
Teil II Richtlinien für den Pflanzenbau und die Tierhaltung in der Schweiz. 2.2 Pflanzenzüchtung und Vermehrung...
 1 Teil II Richtlinien für den Pflanzenbau und die Tierhaltung in der Schweiz 22 Pflanzenzüchtung und Vermehrung 221 Definitionen Pflanzenzüchtung Pflanzensorten Saatgut Pflanzenzüchtung: Unter Pflanzenzüchtung
1 Teil II Richtlinien für den Pflanzenbau und die Tierhaltung in der Schweiz 22 Pflanzenzüchtung und Vermehrung 221 Definitionen Pflanzenzüchtung Pflanzensorten Saatgut Pflanzenzüchtung: Unter Pflanzenzüchtung
Ackerbautag Wels. 26. Jänner DI Christian Krumphuber
 Ackerbautag Wels 26. Jänner 2017 DI Christian Krumphuber Entwicklungen, Markt, globales Umfeld, Pflanzenzüchtung 30.01.2017 /Folie 2 Weltgetreideproduktion seit 1999/2000 30.01.2017 /Folie 3 Maisproduktion
Ackerbautag Wels 26. Jänner 2017 DI Christian Krumphuber Entwicklungen, Markt, globales Umfeld, Pflanzenzüchtung 30.01.2017 /Folie 2 Weltgetreideproduktion seit 1999/2000 30.01.2017 /Folie 3 Maisproduktion
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft. Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung
 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung Jahresbericht 2010 Impressum Herausgeber: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) Vöttinger Straße 38,
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung Jahresbericht 2010 Impressum Herausgeber: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) Vöttinger Straße 38,
Umweltwissenschaften: Ökologie
 Umweltwissenschaften: Ökologie Atmung und Gärung Quelle der Graphik: http://de.wikipedia.org/wiki/zellatmung Atmung C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 >>> 6 CO 2 + 6 H 2 O [30 ATP] G = - 2870 kj /mol Milchsäure G. C
Umweltwissenschaften: Ökologie Atmung und Gärung Quelle der Graphik: http://de.wikipedia.org/wiki/zellatmung Atmung C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 >>> 6 CO 2 + 6 H 2 O [30 ATP] G = - 2870 kj /mol Milchsäure G. C
Klonierung beim Rind. Verfahren der Erstellung genetisch identischer Individuen
 Klonen Definition: Klonierung beim Rind Verfahren der Erstellung genetisch identischer Individuen Techniken der Klonierung von Säugern: Isolierung und Proliferation einzelner embryonaler Zellen (Blastomeren
Klonen Definition: Klonierung beim Rind Verfahren der Erstellung genetisch identischer Individuen Techniken der Klonierung von Säugern: Isolierung und Proliferation einzelner embryonaler Zellen (Blastomeren
silvaselect Hochwertige Vogelkirschen für die Forstwirtschaft
 silvaselect Hochwertige Vogelkirschen für die Forstwirtschaft Andreas Meier-Dinkel Beim Anbau der Vogelkirsche zur Produktion hochwertiger Sortimente für Furniere und Massivholzmöbel spielt die Wuchsform
silvaselect Hochwertige Vogelkirschen für die Forstwirtschaft Andreas Meier-Dinkel Beim Anbau der Vogelkirsche zur Produktion hochwertiger Sortimente für Furniere und Massivholzmöbel spielt die Wuchsform
Versuchsergebnisse aus Bayern 2013
 Versuchsergebnisse aus Bayern 2013 Sortenversuch HAFER Ertragsstruktur Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsämtern Herausgeber: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Versuchsergebnisse aus Bayern 2013 Sortenversuch HAFER Ertragsstruktur Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsämtern Herausgeber: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Gärtner. Zierpflanzenbau. Fachstufe 1 Lerngebiete 1 bis 6. Arbeitsheft. Birgit Langer, Claus Mackowiak, Christiane Schilpp
 Birgit Langer, Claus Mackowiak, Christiane Schilpp Herausgeberin: Birgit Langer Gärtner Zierpflanzenbau Fachstufe 1 Lerngebiete 1 bis 6 Arbeitsheft 1. Auflage Bestellnummer 22182 Haben Sie Anregungen oder
Birgit Langer, Claus Mackowiak, Christiane Schilpp Herausgeberin: Birgit Langer Gärtner Zierpflanzenbau Fachstufe 1 Lerngebiete 1 bis 6 Arbeitsheft 1. Auflage Bestellnummer 22182 Haben Sie Anregungen oder
Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in NRW Saerbeck, 29. April 2014
 Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in NRW Saerbeck, 29. April 2014 Norbert Erhardt, Landwirtschaftskammer NRW, Fachbereich Landbau und nachwachsende Rohstoffe Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen
Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in NRW Saerbeck, 29. April 2014 Norbert Erhardt, Landwirtschaftskammer NRW, Fachbereich Landbau und nachwachsende Rohstoffe Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen
Versuchsergebnisse aus Bayern 2003 bis 2005
 Versuchsergebnisse aus Bayern 2003 bis 2005 Spurenelementdüngung zu Winterweizen und Wintergerste Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsämtern und staatlichen Versuchsgütern
Versuchsergebnisse aus Bayern 2003 bis 2005 Spurenelementdüngung zu Winterweizen und Wintergerste Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsämtern und staatlichen Versuchsgütern
Diskrete dynamische Systeme in der Populationsgenetik Hofbauer J., und Sigmund K.: Evolutionary Games and Population Dynamics, Cambridge
 Diskrete dynamische Systeme in der Populationsgenetik Hofbauer J., und Sigmund K.: Evolutionary Games and Population Dynamics, Cambridge Dominik Urig Saarbrücken, den 10.01.2012 Inhaltsangabe 1 Biologische
Diskrete dynamische Systeme in der Populationsgenetik Hofbauer J., und Sigmund K.: Evolutionary Games and Population Dynamics, Cambridge Dominik Urig Saarbrücken, den 10.01.2012 Inhaltsangabe 1 Biologische
Weltweite Ernährungssicherheit durch eine starke Pflanzenzüchtung. Prof. em. Peter Stamp
 Weltweite Ernährungssicherheit durch eine starke Pflanzenzüchtung Prof. em. Peter Stamp Ernährungssicherheit ist essentiell. Vor 4400 Jahren: Ptah-Hotep, Weiser und Premierminister von Ägypten: Eine Gesellschaft
Weltweite Ernährungssicherheit durch eine starke Pflanzenzüchtung Prof. em. Peter Stamp Ernährungssicherheit ist essentiell. Vor 4400 Jahren: Ptah-Hotep, Weiser und Premierminister von Ägypten: Eine Gesellschaft
Klonen. Ein Wahnsinn der Menschheit oder einfach nur wissenschaftliche Spielerei?
 Klonen Ein Wahnsinn der Menschheit oder einfach nur wissenschaftliche Spielerei? Was ist Klonen? Das Klonieren setzt sich aus unterschiedlichen Verfahren und Techniken zusammen. Ziel aller Techniken ist
Klonen Ein Wahnsinn der Menschheit oder einfach nur wissenschaftliche Spielerei? Was ist Klonen? Das Klonieren setzt sich aus unterschiedlichen Verfahren und Techniken zusammen. Ziel aller Techniken ist
Frühjahrsanbau von Knoblauch nicht mit allen Sorten bzw. Herkünften möglich. 'Gardos' und 'Ljubasha' mit gutem Ertrag und großen Zehen.
 Die Ergebnisse kurzgefasst Bei einem Sortenversuch mit Knoblauch im Ökologischen Gemüsebauversuchsbetrieb Bamberg der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau hat sich gezeigt, dass das Stecken
Die Ergebnisse kurzgefasst Bei einem Sortenversuch mit Knoblauch im Ökologischen Gemüsebauversuchsbetrieb Bamberg der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau hat sich gezeigt, dass das Stecken
Grüne Gentechnologie Beispiel: Kartoffel
 Grüne Gentechnologie Beispiel: Kartoffel Inhalt 1. Gentechnisch veränderte (transgene) Pflanzen und drei Methoden der Herstellung transgener Pflanzen 2. Bedeutung von Antibiotika-Selektionsmarkern bei
Grüne Gentechnologie Beispiel: Kartoffel Inhalt 1. Gentechnisch veränderte (transgene) Pflanzen und drei Methoden der Herstellung transgener Pflanzen 2. Bedeutung von Antibiotika-Selektionsmarkern bei
Modul Biologische Grundlagen Kapitel I.2 Grundbegriffe der Genetik
 Frage Was sind Fachbegriffe zum Thema Grundbegriffe der Genetik? Antwort - Gene - Genotyp - Phänotyp - Genom - Dexoxyribonucleinsäure - Träger genetischer Information - Nukleotide - Basen - Peptid - Start-Codon
Frage Was sind Fachbegriffe zum Thema Grundbegriffe der Genetik? Antwort - Gene - Genotyp - Phänotyp - Genom - Dexoxyribonucleinsäure - Träger genetischer Information - Nukleotide - Basen - Peptid - Start-Codon
Linien oder Hybriden aus Sicht der Weizenzüchtung
 Linien oder Hybriden aus Sicht der Weizenzüchtung Saatguttagung Uelzen, 19.02.2015 Erhard Ebmeyer Hybridweizenzüchtung Frage: Wie macht man 1 Mio im Hybridweizen Saatgutgeschäft? Antwort: Man startet mit
Linien oder Hybriden aus Sicht der Weizenzüchtung Saatguttagung Uelzen, 19.02.2015 Erhard Ebmeyer Hybridweizenzüchtung Frage: Wie macht man 1 Mio im Hybridweizen Saatgutgeschäft? Antwort: Man startet mit
A1: Weizen anpflanzen Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/11 Arbeitsauftrag Die LP zeigt, wie man Weizen anpflanzt. Sie füllt ein Tontöpfchen oder Graniumkasten (im Boden sollte ein Loch vorhanden sein) mit Erde. Sie streut drei bis fünf Körner
Lehrerinformation 1/11 Arbeitsauftrag Die LP zeigt, wie man Weizen anpflanzt. Sie füllt ein Tontöpfchen oder Graniumkasten (im Boden sollte ein Loch vorhanden sein) mit Erde. Sie streut drei bis fünf Körner
Der Versuch im Bild. März 2008
 Der Versuch im Bild März 2008 Zaun aufstellen Ein Zaun stellt sicher, dass keine gentechnisch veränderten Pflanzen von Menschen oder Tieren verschleppt werden. Zudem wird der Versuch, welcher nur von eingewiesenen
Der Versuch im Bild März 2008 Zaun aufstellen Ein Zaun stellt sicher, dass keine gentechnisch veränderten Pflanzen von Menschen oder Tieren verschleppt werden. Zudem wird der Versuch, welcher nur von eingewiesenen
Thüringer Landesanstalt. für Landwirtschaft, Schwefelmangel bei Kulturpflanzen erkennen! Autor: Dr. W. Zorn. April Das Thüringer Ministerium
 Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Schwefelmangel bei Kulturpflanzen erkennen! Autor: Dr. W. Zorn April 2003 Das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt Schwefelmangel
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Schwefelmangel bei Kulturpflanzen erkennen! Autor: Dr. W. Zorn April 2003 Das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt Schwefelmangel
Die Zukunft der ökologischen Pflanzenzüchtung auf dem Feld oder im Labor?
 Die Zukunft der ökologischen Pflanzenzüchtung auf dem Feld oder im Labor? Klaus-Peter Wilbois Fulda, 15.11.2014 Schwindende Agro- Biodiversität Trends & Zahlen zur Agro-Biodiversität Seit Anfang des 20ten
Die Zukunft der ökologischen Pflanzenzüchtung auf dem Feld oder im Labor? Klaus-Peter Wilbois Fulda, 15.11.2014 Schwindende Agro- Biodiversität Trends & Zahlen zur Agro-Biodiversität Seit Anfang des 20ten
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ministerialdirektor Martin Neumeyer Symposium Pflanzenzüchtung Pflanzen züchten. Zukunft sichern 30. März 2012, München Es gilt das
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ministerialdirektor Martin Neumeyer Symposium Pflanzenzüchtung Pflanzen züchten. Zukunft sichern 30. März 2012, München Es gilt das
Station 1 Wozu brauchen wir Getreide? 6 6 6
 Station 1 Wozu brauchen wir Getreide? 6 6 6 1. Schaue dir das Bild genau an. Kreise alles ein, was mit Getreide zu tun hat. 2. Schreibe deine Ergebnisse auf. 21 Station 2 Heimische Gedreidearten 6 6 6
Station 1 Wozu brauchen wir Getreide? 6 6 6 1. Schaue dir das Bild genau an. Kreise alles ein, was mit Getreide zu tun hat. 2. Schreibe deine Ergebnisse auf. 21 Station 2 Heimische Gedreidearten 6 6 6
Grundlagen zur Vererbung von Eigenschaften und Fehlern
 Züchterversammlung 2009 Grundlagen zur Vererbung von Eigenschaften und Fehlern (nach: Genetik und Züchtungslehre, von Heinrich Binder, Dr. med. vet., Dozent für Tierzucht am Tierspital ZH) überarbeitet
Züchterversammlung 2009 Grundlagen zur Vererbung von Eigenschaften und Fehlern (nach: Genetik und Züchtungslehre, von Heinrich Binder, Dr. med. vet., Dozent für Tierzucht am Tierspital ZH) überarbeitet
Saatdichte-Versuch: Wintergerste Grangeneuve
 Kantonale Station für Tierproduktion und Pflanzenbau Versuchsbericht 2007 -Versuch: Wintergerste Grangeneuve 2006-2007 Grangeneuve, Juli 2007 Sandra Dougoud Landwirtschaftliches Institut Grangeneuve Kantonale
Kantonale Station für Tierproduktion und Pflanzenbau Versuchsbericht 2007 -Versuch: Wintergerste Grangeneuve 2006-2007 Grangeneuve, Juli 2007 Sandra Dougoud Landwirtschaftliches Institut Grangeneuve Kantonale
Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft
 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (PGRELV) vom 28. Oktober 2015 (Stand am 1. Januar 2018) Der Schweizerische
Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (PGRELV) vom 28. Oktober 2015 (Stand am 1. Januar 2018) Der Schweizerische
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung Jahresbericht 2004 Impressum: Herausgeber: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Vöttinger Straße
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung Jahresbericht 2004 Impressum: Herausgeber: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Vöttinger Straße
Eine Gurke ist eine Gurke ist eine Gurke!?
 Eine Gurke ist eine Gurke ist eine Gurke!? Von den Wurzeln unserer Landwirtschaft bis heute eine Geschichte von Vielfalt und Verlust von Maura Schnappauf Egal ob wir in Berlin, Bern oder Wien in den Supermarkt
Eine Gurke ist eine Gurke ist eine Gurke!? Von den Wurzeln unserer Landwirtschaft bis heute eine Geschichte von Vielfalt und Verlust von Maura Schnappauf Egal ob wir in Berlin, Bern oder Wien in den Supermarkt
Unabhängigkeit ist orange
 Zukunft ist orange Unabhängigkeit ist orange Weltweit steht die moderne Landwirtschaft vor gewaltigen Herausforderungen. Dazu gehören neben einer gesicherten Versorgung mit Nahrungsmitteln auch der zunehmende
Zukunft ist orange Unabhängigkeit ist orange Weltweit steht die moderne Landwirtschaft vor gewaltigen Herausforderungen. Dazu gehören neben einer gesicherten Versorgung mit Nahrungsmitteln auch der zunehmende
Teil I: Grundlagen. 1. Warum Soja? Warum Soja 1.
 Teil I: Grundlagen 1. Warum Soja? Die Sojabohne (Glycine max (L.) Merr.), häufig auch einfach als Soja bezeichnet, ist eine Kulturpflanze aus der Familie der Hülsenfrüchte (Leguminosae) und stammt aus
Teil I: Grundlagen 1. Warum Soja? Die Sojabohne (Glycine max (L.) Merr.), häufig auch einfach als Soja bezeichnet, ist eine Kulturpflanze aus der Familie der Hülsenfrüchte (Leguminosae) und stammt aus
1. Ziele, Methoden und Erfolge der Pflanzenzüchtung
 I. Allgemeine Pflanzenzüchtung 1. Ziele, Methoden und Erfolge der Pflanzenzüchtung Ziel der Pflanzenzüchtung ist die genetische Veränderung von Kulturpflanzen, um sie besser den Bedürfnissen des Menschen
I. Allgemeine Pflanzenzüchtung 1. Ziele, Methoden und Erfolge der Pflanzenzüchtung Ziel der Pflanzenzüchtung ist die genetische Veränderung von Kulturpflanzen, um sie besser den Bedürfnissen des Menschen
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
 1 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung Jahresbericht 2008 22 Impressum: Herausgeber: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) Vöttinger Straße
1 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung Jahresbericht 2008 22 Impressum: Herausgeber: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) Vöttinger Straße
Wissenswert. Crispr-Pflanzen: Manipuliert und gentechnikfrei zugleich Besuch bei Pflanzenzüchtern in Bonn. von Michael Lange
 Hessischer Rundfunk hr-info Redaktion: Dr. Regina Oehler Wissenswert Crispr-Pflanzen: Manipuliert und gentechnikfrei zugleich Besuch bei Pflanzenzüchtern in Bonn von Michael Lange Sprecher: Michael Lange
Hessischer Rundfunk hr-info Redaktion: Dr. Regina Oehler Wissenswert Crispr-Pflanzen: Manipuliert und gentechnikfrei zugleich Besuch bei Pflanzenzüchtern in Bonn von Michael Lange Sprecher: Michael Lange
Biologischer Abbau (Physiologie)
 Ö K O L O G I E Biologischer Abbau (Physiologie) Der biologische Abbau organischer Substrate (u.a. Kohlenhydrate) durch Enzyme oder Mikroorganismen dient zu folgendem: --- zelleigenes Material (u.a. Proteine)
Ö K O L O G I E Biologischer Abbau (Physiologie) Der biologische Abbau organischer Substrate (u.a. Kohlenhydrate) durch Enzyme oder Mikroorganismen dient zu folgendem: --- zelleigenes Material (u.a. Proteine)
FRAG DIE GERSTE. Das 1x1 der modernen Pflanzenforschung. Pflanzenzüchtung
 FRAG DIE GERSTE Das 1x1 der modernen Pflanzenforschung Pflanzenzüchtung Inhalt Pflanzenzüchtung FRAG DIE GERSTE Was ist Pflanzenzüchtung? Woher kommen unsere Kulturpflanzen? Warum brauchen wir überhaupt
FRAG DIE GERSTE Das 1x1 der modernen Pflanzenforschung Pflanzenzüchtung Inhalt Pflanzenzüchtung FRAG DIE GERSTE Was ist Pflanzenzüchtung? Woher kommen unsere Kulturpflanzen? Warum brauchen wir überhaupt
Versuchsergebnisse aus Bayern 2009 bis 2011
 Versuchsergebnisse aus Bayern 2009 bis 2011 Einfluss von stabilisierten N-Düngern auf den und die Qualität von Winterweizen Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft
Versuchsergebnisse aus Bayern 2009 bis 2011 Einfluss von stabilisierten N-Düngern auf den und die Qualität von Winterweizen Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft
Potenziale der Gentechnik bei Energiepflanzen
 Potenziale der Gentechnik bei Energiepflanzen F&E-Projekt gefördert vom BfN und BMU Dr. Markus Schorling, Dr. Susanne Stirn, Prof. Dr. Volker Beusmann Forschungsschwerpunkt Biotechnik, Gesellschaft und
Potenziale der Gentechnik bei Energiepflanzen F&E-Projekt gefördert vom BfN und BMU Dr. Markus Schorling, Dr. Susanne Stirn, Prof. Dr. Volker Beusmann Forschungsschwerpunkt Biotechnik, Gesellschaft und
-Generation sehen alle gleich aus (Uniformitätsregel). In der F 2. -Generation treten unterschiedliche Phänotypen auf (Spaltungsregel).
 Mendelsche Regeln 1 + 2 (1) Merkmale wie die Blütenfarbe können dominant-rezessiv oder intermediär vererbt werden. Bei einem intermediären Erbgang wird die Merkmalsausprägung von beiden Allelen (z. B.
Mendelsche Regeln 1 + 2 (1) Merkmale wie die Blütenfarbe können dominant-rezessiv oder intermediär vererbt werden. Bei einem intermediären Erbgang wird die Merkmalsausprägung von beiden Allelen (z. B.
Pflanzenzüchtung für den ökologischen Landbau (landwirtschaftliche Kulturen) was ist in der Pipeline?
 (landwirtschaftliche Kulturen) was ist in der Pipeline? Populationen: Zulassung im Moment nur möglich für Weizen, Gerste, Hafer und Mais. Leider nicht für andere Kulturen, z.b. Ackerbohnen, Roggen Aufteilung
(landwirtschaftliche Kulturen) was ist in der Pipeline? Populationen: Zulassung im Moment nur möglich für Weizen, Gerste, Hafer und Mais. Leider nicht für andere Kulturen, z.b. Ackerbohnen, Roggen Aufteilung
Die Medelschen Regeln
 Die Medelschen Regeln Der erste Wissenschaftler, der Gesetzmäßigkeiten bei der Vererbung fand und formulierte, war Johann Gregor Mendel Mendel machte zur Erforschung der Vererbung Versuche und beschränkte
Die Medelschen Regeln Der erste Wissenschaftler, der Gesetzmäßigkeiten bei der Vererbung fand und formulierte, war Johann Gregor Mendel Mendel machte zur Erforschung der Vererbung Versuche und beschränkte
Pflanzenzüchtungs-Strategien zur Klimaanpassung
 Von Starkregen bis Trockenheit - Anpassungsstrategien für die deutsche Landwirtschaft - Berlin 16. November 2017 Pflanzenzüchtungs-Strategien zur Klimaanpassung Hartmut Spieß Forschung & Züchtung Dottenfelderhof
Von Starkregen bis Trockenheit - Anpassungsstrategien für die deutsche Landwirtschaft - Berlin 16. November 2017 Pflanzenzüchtungs-Strategien zur Klimaanpassung Hartmut Spieß Forschung & Züchtung Dottenfelderhof
Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.v. Situation der Saatgutzüchtung in Deutschland
 Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.v. Situation der Saatgutzüchtung in Deutschland Stephanie Franck Vorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Pflanzenzüchter Gliederung 1. Pflanzenzüchtung in Deutschland
Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.v. Situation der Saatgutzüchtung in Deutschland Stephanie Franck Vorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Pflanzenzüchter Gliederung 1. Pflanzenzüchtung in Deutschland
Mikrobiologische Untersuchung von Lebensmittel
 Mikrobiologische Untersuchung von Lebensmittel DI Erich Ziegelwanger Inhalt Grundsätze - aseptisches Arbeiten Anlegen von Verdünnungsreihen Koch sches Gussplattenverfahren Spatelverfahren Auswertung Koch
Mikrobiologische Untersuchung von Lebensmittel DI Erich Ziegelwanger Inhalt Grundsätze - aseptisches Arbeiten Anlegen von Verdünnungsreihen Koch sches Gussplattenverfahren Spatelverfahren Auswertung Koch
Die Chromosomen sind im Zellkern immer paarweise vorhanden. In der menschlichen Zelle befinden sich 23 Chromosomenpaare. Diese bilden den diploiden
 Die Chromosomen Die Chromosomen sind Träger der Erbinformation. Unter dem Mikroskop erscheinen sie in verschiedenen Formen. Einmal als gekrümmte oder gedrungene Stäbchen, in deren Mitte sich eine Ein-schnürung
Die Chromosomen Die Chromosomen sind Träger der Erbinformation. Unter dem Mikroskop erscheinen sie in verschiedenen Formen. Einmal als gekrümmte oder gedrungene Stäbchen, in deren Mitte sich eine Ein-schnürung
Grüne Biotechnologie Deutschland am Scheideweg?
 Grüne Biotechnologie Deutschland am Scheideweg? InnoPlanta Forum 2009 07. September 2009, Üplingen Wolf von Rhade Gliederung 1. Organisation der privaten deutschen Pflanzenzüchtung 2. Gentechnik in der
Grüne Biotechnologie Deutschland am Scheideweg? InnoPlanta Forum 2009 07. September 2009, Üplingen Wolf von Rhade Gliederung 1. Organisation der privaten deutschen Pflanzenzüchtung 2. Gentechnik in der
Grundkenntnisse der Genetik
 Grundkenntnisse der Genetik VDH-Basiskurs 14./15. November 2015 in Kleinmachnow Helga Eichelberg Zelle Zellkern Chromosomen Gene Hund: 39 Chromosomenpaare Begriffspaare: dominant rezessiv homozygot - heterozygot
Grundkenntnisse der Genetik VDH-Basiskurs 14./15. November 2015 in Kleinmachnow Helga Eichelberg Zelle Zellkern Chromosomen Gene Hund: 39 Chromosomenpaare Begriffspaare: dominant rezessiv homozygot - heterozygot
Spiel 1: Spielerische Simulation der Hardy-Weinberg-Regel
 Spiel : Spielerische Simulation der Hardy-Weinberg-Regel Spielbrett, Box Genpool, Taschenrechner Wichtig! Das Spiel wird fünf Runden gespielt!. Ziehen Sie aus dem Genpool ohne Hinschauen insgesamt 54 Individuen.
Spiel : Spielerische Simulation der Hardy-Weinberg-Regel Spielbrett, Box Genpool, Taschenrechner Wichtig! Das Spiel wird fünf Runden gespielt!. Ziehen Sie aus dem Genpool ohne Hinschauen insgesamt 54 Individuen.
Versuchsergebnisse aus Bayern Ernte 2003 bis 2005
 Versuchsergebnisse aus Bayern Ernte 2003 bis 2005 Wirkung von Bodenhilfsstoffen und Pflanzenhilfsmitteln Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsämtern und staatlichen Versuchsgütern
Versuchsergebnisse aus Bayern Ernte 2003 bis 2005 Wirkung von Bodenhilfsstoffen und Pflanzenhilfsmitteln Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsämtern und staatlichen Versuchsgütern
VL Einführung in die Gentechnologie. Erwin R. Schmidt Institut für Molekulargenetik Vorlesung #
 VL Einführung in die Gentechnologie Erwin R. Schmidt Institut für Molekulargenetik Vorlesung #5 14. 05. 2013 PiggyBac-Transposon aus Trichoplusia ni (Schmetterling) funktioniert in einer großen Bandbreite
VL Einführung in die Gentechnologie Erwin R. Schmidt Institut für Molekulargenetik Vorlesung #5 14. 05. 2013 PiggyBac-Transposon aus Trichoplusia ni (Schmetterling) funktioniert in einer großen Bandbreite
Patente auf Pflanzen und Tiere, auf Saatgut und Lebensmittel beeinflussen den Markt
 Patente auf Pflanzen und Tiere, auf Saatgut und Lebensmittel beeinflussen den Markt März 2015 Dr. Christoph Then www.testbiotech.org www.no-patents-on-seeds.org Info@no-patents-on-seeds.org www.testbiotech.org
Patente auf Pflanzen und Tiere, auf Saatgut und Lebensmittel beeinflussen den Markt März 2015 Dr. Christoph Then www.testbiotech.org www.no-patents-on-seeds.org Info@no-patents-on-seeds.org www.testbiotech.org
Morphologische Studie zur Kreuzungsoptimierung
 Projektarbeit 13/14 Morphologische Studie zur Kreuzungsoptimierung bei Weizen Landbauschule Dottenfelderhof e. V. Landbauschüler: Scholz Betreuerin: Pregitzer Inhaltsverzeichnis Beweggründe Seite 1 Ziel
Projektarbeit 13/14 Morphologische Studie zur Kreuzungsoptimierung bei Weizen Landbauschule Dottenfelderhof e. V. Landbauschüler: Scholz Betreuerin: Pregitzer Inhaltsverzeichnis Beweggründe Seite 1 Ziel
Thema Gentechnologie. Erwin R. Schmidt Institut für Molekulargenetik Gentechnologische Sicherheitsforschung & Beratung
 Thema Gentechnologie Erwin R. Schmidt Institut für Molekulargenetik Gentechnologische Sicherheitsforschung & Beratung Die Genklonierung in Bakterien Vektor-DNA Spender-DNA Restriktionsenzym Rekombinante
Thema Gentechnologie Erwin R. Schmidt Institut für Molekulargenetik Gentechnologische Sicherheitsforschung & Beratung Die Genklonierung in Bakterien Vektor-DNA Spender-DNA Restriktionsenzym Rekombinante
Seite 2. Allgemeine Informationzu Basilikum. Kontakt. Vorwort. ingana Shop
 2., verb. Auflage Allgemeine Informationzu Basilikum Basilikum gehärt mit zu den beliebtesten Kräutern in der Küche, auf dem Balkon und im Garten. Es gibt eine Reihe von Sorten, die ganz nach Geschmack
2., verb. Auflage Allgemeine Informationzu Basilikum Basilikum gehärt mit zu den beliebtesten Kräutern in der Küche, auf dem Balkon und im Garten. Es gibt eine Reihe von Sorten, die ganz nach Geschmack
Ökologische Getreidezüchtung in Dänemark
 Ökologische Getreidezüchtung in Dänemark Naturland Ackerbautagung Würzburg 14. Januar 2016 Anders Borgen Die Bauern werden sich an die zugänglige Sorten anpassen Züchtungsziele heute definiert das Landwirtschaft
Ökologische Getreidezüchtung in Dänemark Naturland Ackerbautagung Würzburg 14. Januar 2016 Anders Borgen Die Bauern werden sich an die zugänglige Sorten anpassen Züchtungsziele heute definiert das Landwirtschaft
Evolution und Entwicklung
 Evolution und Entwicklung Wie aus einzelnen Zellen die Menschen wurden: Phylogenese Klassische Genetik: Mendel Moderne Genetik: Watson & Crick Wie aus einer einzigen Zelle ein Mensch wird: Ontogenese Vererbung
Evolution und Entwicklung Wie aus einzelnen Zellen die Menschen wurden: Phylogenese Klassische Genetik: Mendel Moderne Genetik: Watson & Crick Wie aus einer einzigen Zelle ein Mensch wird: Ontogenese Vererbung
Teilen 36 9 = 12 2 = 16 8 = 54 9 = 42 6 = 2 2 = = 72 8 = 2 1 = 63 7 = 9 1 = 48 6 = = = 7 7 = 70 7 = 32 8 = 27 9 = 80 8 = 6 3 = 7 1 =
 Multiplikation 4 2 2 2 3 3 3 3 4 1 2 2 3 6 9 2 2 0 6 4 1 2 0 6 2 0 7 3 3 1 3 2 3 8 7 2 4 4 6 2 3 1 7 3 4 0 1 2 2 0 8 2 2 1 0 2 1 0 4 3 4 9 9 2 1 2 0 3 4 5 6 2 4 4 8 2 1 7 9 5 3 1 0 3 Addition 4 5 5 2 3
Multiplikation 4 2 2 2 3 3 3 3 4 1 2 2 3 6 9 2 2 0 6 4 1 2 0 6 2 0 7 3 3 1 3 2 3 8 7 2 4 4 6 2 3 1 7 3 4 0 1 2 2 0 8 2 2 1 0 2 1 0 4 3 4 9 9 2 1 2 0 3 4 5 6 2 4 4 8 2 1 7 9 5 3 1 0 3 Addition 4 5 5 2 3
Transgen oder Nicht Transgen: Biotechnologie bei Pflanzen
 Transgen oder Nicht Transgen: Biotechnologie bei Pflanzen 10.000 Jahre Domestikation von Pflanzengenen Petra Bauer, Molekulare Pflanzenbiologie und Botanik http://www.uni-saarland.de/fak8/botanik/ Ernährung
Transgen oder Nicht Transgen: Biotechnologie bei Pflanzen 10.000 Jahre Domestikation von Pflanzengenen Petra Bauer, Molekulare Pflanzenbiologie und Botanik http://www.uni-saarland.de/fak8/botanik/ Ernährung
Stammzellenforschung Karina Köppl LK Biologie
 Stammzellenforschung Karina Köppl LK Biologie 1.Was sind Stammzellen? Reparaturreserve des Körpers undifferenzierte Zellen von Menschen und Tieren Stammzellen sind in der Lage, sich zu teilen und neue
Stammzellenforschung Karina Köppl LK Biologie 1.Was sind Stammzellen? Reparaturreserve des Körpers undifferenzierte Zellen von Menschen und Tieren Stammzellen sind in der Lage, sich zu teilen und neue
GENTECHNIK BEI PFLANZEN
 - 1 - GENTECHNIK BEI PFLANZEN 1. Grüne Gentechnik - was ist das? "Grüne Gentechnik" ist laut Gentechnik-Wörterbuch eine "umgangssprachliche Bezeichnung für gentechnische Forschung mit Pflanzen, während
- 1 - GENTECHNIK BEI PFLANZEN 1. Grüne Gentechnik - was ist das? "Grüne Gentechnik" ist laut Gentechnik-Wörterbuch eine "umgangssprachliche Bezeichnung für gentechnische Forschung mit Pflanzen, während
Warum werden Möhren und Erbsen schon im März gesät, Bohnen und Gurken aber erst im Mai?
 Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 2 Vom Keimen der Samen und Wachsen der Pflanzen (P800900) 2.5 Keimung und Jahreszeiten Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.0.203 5:2:3 intertess (Version
Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 2 Vom Keimen der Samen und Wachsen der Pflanzen (P800900) 2.5 Keimung und Jahreszeiten Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.0.203 5:2:3 intertess (Version
Die Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen für Ernährung und
 Ländlicher Raum 6/2004 1 Paul Freudenthaler Die Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft Pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft sind unwiederbringliche
Ländlicher Raum 6/2004 1 Paul Freudenthaler Die Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft Pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft sind unwiederbringliche
Einfluss von Schattierung und Temperatur auf den Vermehrungserfolg von Geranium macrorrhizum Spessart
 Die Ergebnisse kurzgefasst Da die Vermehrung von Geranium macrorrhizum Spessart bei späten Vermehrungsterminen im Herbst, die in der Praxis der Staudengärtner sehr häufig durchgeführt werden, nicht unproblematisch
Die Ergebnisse kurzgefasst Da die Vermehrung von Geranium macrorrhizum Spessart bei späten Vermehrungsterminen im Herbst, die in der Praxis der Staudengärtner sehr häufig durchgeführt werden, nicht unproblematisch
