Volkswirtschaftslehre
|
|
|
- Ingrid Messner
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Kapitel 2 Mikroökonomie 2.1 Vorbemerkung Nach diesen einführenden und zum auch Teil grundlegenden Darstellungen kommen wir im Folgenden zu den eigentlichen Inhalten der Volkswirtschaftslehre, die zunächst im Überblick dargestellt werden sollen. Üblicherweise wird die Volkswirtschaftslehre in drei Teilbereiche untergliedert, und zwar in die Wirtschaftstheorie, die Theorie der Wirtschaftspolitik und die Finanzwissenschaft. Volkswirtschaftslehre Wirtschaftstheorie Theorie der Wirtschaftspolitik Finanzwissenschaft Die Wirtschaftstheorie fragt nach allgemein gültigen Zusammenhängen des Wirtschaftslebens. Ihr Ziel besteht darin, generelle Ursache-Wirkungs-Beziehungen für die betrachteten Phänomene herauszuarbeiten. Einige typische Fragestellungen der Wirtschaftstheorie mögen dies verdeutlichen: Auf welche Faktoren ist Arbeitslosigkeit zurückzuführen? Wovon hängt die Nachfrage eines Haushaltes ab? Welche Faktoren entscheiden über die Preisbildung? Mit Hilfe der gefundenen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge können die wirtschaftlichen Phänomene erklärt werden. Ferner kann auf dieser Basis, wie wir bereits im einleitenden Teil gesehen haben, eine Prognose für die Zukunft getroffen werden. Wir wollen dies noch einmal an einem Beispiel verdeutlichen und greifen hierzu auf die sogenannte Quantitätstheorie zurück, die einen Ursache-Wirkungs- Zusammenhang zwischen der Geldmenge und dem Preisniveau beschreibt. Und P. Engelkamp, F. L. Sell, Einführung in die Volkswirtschaftslehre, DOI / _2, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
2 38 2 Mikroökonomie zwar besagt diese Theorie, dass mit steigender Geldmenge auch das Preisniveau ansteigt. Die Quantitätstheorie kann einerseits zur Erklärung beobachteter Inflation, einem Prozess anhaltender Preissteigerungen, herangezogen werden, und zwar dann, wenn gleichzeitig die Geldmenge gestiegen ist. Dabei entspricht das Geldmengenwachstum, wie wir bereits wissen, der Randbedingung, die zur Anwendung der Quantitätstheorie gegeben sein muss. Die Erklärung lautet dann, dass das Preisniveau gestiegen ist, weil die Geldmenge gewachsen ist. Zum anderen kann auf die Quantitätstheorie zur Prognose zurückgegriffen werden, und zwar dann, wenn bekannt ist, dass die Geldmenge etwa infolge einer steigenden Staatsverschuldung stärker erhöht werden soll als das Wachstum der Produktion, wenn also die zukünftigen Randbedingungen als bekannt vorausgesetzt werden können. In diesem Fall würde man unter Rückgriff auf die Quantitätstheorie prognostizieren, dass die geplante Geldmengenerhöhung eine Steigerung des Preisniveaus nach sich ziehen wird. Hierbei handelt es sich um eine bedingte Vorhersage, denn nur dann, wenn die Geldmenge tatsächlich erhöht wird, steigt auch das Preisniveau. Kommen wir damit zum zweiten Teilbereich der Volkswirtschaftslehre, der Theorie der Wirtschaftspolitik. Die Theorie der Wirtschaftspolitik zielt darauf ab, bestehende Zustände oder zu erwartende Entwicklungen, z.b. bezüglich der Rentenfinanzierung, im Sinne bestimmter Ziele zu verändern. Es geht also um die Gestaltung der wirtschaftlichen Wirklichkeit. Dabei sind die Ziele selbst, die mit den ergriffenen Maßnahmen erreicht werden sollen, für den Wissenschaftler vorgegeben; sie sind das Ergebnis der politischen Willensbildung und können wissenschaftlich nicht näher begründet werden. Der Wirtschaftspolitiker untersucht also nur, mit welchen Maßnahmen oder Mitteln bestimmte vorgegebene Ziele erreicht werden können. Gegenstand der Untersuchung sind somit sogenannte Ziel-Mittel-Relationen. Die Kenntnisse, die dabei für die Gestaltung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen benötigt werden, stammen aus der Wirtschaftstheorie. Denn die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge der Theorie sind dem Prinzip nach identisch mit den Ziel-Mittel-Relationen, auf denen die Wirtschaftspolitik aufbaut. Greifen wir zur Verdeutlichung noch einmal auf den quantitätstheoretischen Erklärungsansatz der Inflation zurück. Wenn aus der Wirtschaftstheorie bekannt ist, dass das Preisniveau von der Geldmenge abhängt, so kann die Wirtschaftspolitik, auf dieser Erkenntnis aufbauend, das Ziel einer Preisniveaustabilisierung durch eine entsprechende Steuerung der Geldmenge erreichen: Das Ziel entspricht der gewünschten Wirkung, gesucht ist die Ursache oder das Mittel, das diese Wirkung nach sich zieht, und das ist in diesem Fall die Kontrolle der Geldmenge. Die Aufgabe der Finanzwissenschaft schließlich besteht in der Erfassung und Analyse der Wirtschaftstätigkeit des Staates unter Einschluss sonstiger öffentlicher Verbände sowie der Hilfsfisci, also der staatlichen Sozialversicherungen. Dies bedeutet, dass alle Aktivitäten des Staates, die sich in den öffentlichen Einnahmen und Ausgaben, also im staatlichen Budget, niederschlagen, Gegenstand der Finanzwis-
3 2.1 Vorbemerkung 39 senschaft sind. Zum einen lässt sich die Sonderstellung der Finanzwissenschaft auf den enormen Umfang der öffentlichen Haushalte zurückführen; zum anderen hat der Einsatz finanzpolitischer Mittel zur Erreichung wirtschaftspolitischer Ziele insbesondere mit der von Keynes propagierten Globalsteuerung an Bedeutung zugenommen. Wir wollen uns im Rahmen dieser Einführung schwerpunktmäßig auf die Wirtschaftstheorie konzentrieren. Abschließend werden wir jedoch in gesonderten Kapiteln auf einige Grundfragen der Wirtschaftspolitik und der Finanzwissenschaft eingehen. Betrachtet man die Wirtschaftstheorie näher, so kann man auf einer ersten Ebene zwischen der Mikroökonomie auf der einen und der Makroökonomie auf der anderen Seite unterscheiden. Diese Unterscheidung entspricht dem Gliederungsprinzip dieser Einführung hinsichtlich der Kapitel 2 und 3. Wirtschaftstheorie Mikroökonomie Makroökonomie Während die Mikroökonomie am einzelwirtschaftlichen Verhalten, also am Verhalten der einzelnen Haushalte bzw. Unternehmungen ansetzt, besteht der Ansatzpunkt der Makroökonomie in der Betrachtung und Analyse volkswirtschaftlicher Aggregate. Volkswirtschaftliche Aggregate entstehen aus der Zusammenfassung von Einzel- oder Teilgrößen und können sich sowohl auf Wirtschaftseinheiten als auch auf ökonomische Aktivitäten beziehen. Einige Beispiele sollen den Unterschied zwischen mikro- und makroökonomischer Theorie oder Betrachtungsweise verdeutlichen: Typisch mikroökonomische Fragestellungen betreffen bspw. das Nachfrageverhalten eines einzelnen Haushalts etwa in Abhängigkeit vom Einkommen oder von den Preisen der einzelnen Güter oder das Angebotsverhalten einer einzelnen Unternehmung. Auch die Erklärung der Preisbildung für ein bestimmtes Gut auf der Basis der individuellen Entscheidungen von Haushalten und Unternehmen ist der Mikroökonomie zuzuordnen. Fragt man dagegen generell nach den Konsumausgaben aller Haushalte, also des gesamten Haushaltssektors, oder nach den Bestimmungsgründen der Produktion oder der Investitionen aller Unternehmungen, so befinden wir uns im Bereich der Makroökonomie. Ebenso gehört die Frage nach dem Durchschnitt aller Preise und ihrer Veränderung, also nach Preisniveau und Inflation, ins Gebiet der Makroökonomie. Weitere hochaggregierte Größen, mit denen sich die Makroökonomie beschäftigt, sind z.b. Beschäftigung und Arbeitslosigkeit, Konjunktur und Wachstum oder Volkseinkommen und Sozialprodukt.
4 40 2 Mikroökonomie So viel zu den Unterschieden zwischen der mikro- und der makroökonomischen Betrachtungsweise. Bevor wir uns als Erstes den mikroökonomischen Ansätzen näher zuwenden, zunächst ein kurzer Überblick über die verschiedenen Teilbereiche der Mikroökonomie. Mikroökonomische Theorie Spieltheorie (2.2) Haushaltstheorie (2.3) Unternehmenstheorie (2.4) Preistheorie (2.5) Wettbewerbstheorie (2.6) Die wichtigsten Teil- bzw. Kernbereiche der mikroökonomischen Theorie sind die Spieltheorie, die Haushaltstheorie, die Unternehmenstheorie, die Preistheorie und die Wettbewerbstheorie. Darüber hinaus zu nennen sind vor allem die Standorttheorie, die Allokationstheorie und (Teile der) Verteilungstheorie. Bei der Spieltheorie handelt es sich um einen formaltheoretischen Ansatz, der auf beliebige Entscheidungssituationen, also auch aber nicht ausschließlich auf wirtschaftliche Entscheidungen anwendbar ist. Im Rahmen dieser Einführung werden wir uns darauf beschränken, einige wichtige Teilbereiche der Spieltheorie vorzustellen, auf die bei bestimmten Fragestellungen der Preistheorie, vor allem aber im Rahmen späterer wirtschaftspolitischer sowie finanzwissenschaftlicher Überlegungen zurückgegriffen werden wird. Gegenstand der Haushaltstheorie, zum Teil auch verkürzend Konsumtheorie genannt, sind die Angebots- und Nachfrageentscheidungen der privaten Haushalte. Auf der Angebotsseite geht es um die Bereitstellung von Produktionsfaktoren, also vor allem um den Faktor Arbeit, und damit um die Erzielung von Einkommen. Auf der Nachfrageseite geht es einmal um die Frage, welcher Anteil des Einkommens gespart und welcher für den Kauf von Konsumgütern verausgabt werden soll; vor allem aber interessiert die Aufteilung der Konsumsumme für den Kauf der verschiedenen Konsumgüter. Da das erzielbare Einkommen zumindest kurzfristig durch den Haushalt kaum beeinflussbar ist die Ausbildung ist nur langfristig veränderbar, die Möglichkeiten zur Variation der Arbeitszeit, etwa in Form der Teilzeitbeschäftigung, sind in der Regel sehr begrenzt, steht im Rahmen der Haushaltstheorie die Einkommensverwendung im Vordergrund. Die Kernfrage, die die Haushaltstheorie zu beantworten sucht, bezieht sich dabei auf die vom Haushalt nachgefragten Gütermengen. Insbesondere interessiert die Frage, wie sich diese Nachfrage in Abhängigkeit von den Preisen der Güter verändert. Der nächste wichtige Teilbereich der Mikroökonomie ist die Unternehmenstheorie. Alternativ finden sich die Bezeichnungen Produktions- und Kostentheorie. Analog zur Haushaltstheorie besteht das Ziel der Unternehmenstheorie in der Erklärung des Angebots- und Nachfrageverhaltens der Unternehmung. In beiden Fällen bilden die produktionstheoretischen Zusammenhänge die Grundlage, auf der die weiteren
5 2.1 Vorbemerkung 41 Überlegungen aufbauen. Die zentralen Fragen, die bei der Analyse des Angebotsverhaltens im Vordergrund stehen, beziehen sich einmal auf die Bestimmung der optimalen, das heißt in der Regel der gewinnmaximalen Absatzmenge, zum anderen auf die Veränderung dieser Menge bei Variation des Absatzpreises. Stellt man nicht die Absatzseite, sondern den Beschaffungsmarkt in den Vordergrund, so richet sich das Interesse auf die Nachfrage der Unternehmung nach den Produktionsfaktoren, die zur Herstellung der Absatzgüter benötigt werden. Gefragt wird nach der optimalen, also wiederum in der Regel nach der gewinnmaximalen Faktornachfrage und nach der Veränderung dieser Nachfrage bei Variation der Faktorpreise. Wie wir noch sehen werden, sind beide Betrachtungen auf das Engste miteinander verknüpft. 28 Haushalts- und Unternehmenstheorie erklären also letztlich das Agieren der einzelnen Wirtschaftseinheiten am Markt. Dieses einzelwirtschaftliche Verhalten, welches im Rahmen der Haushalts- und Unternehmenstheorie analysiert wird, nimmt die Preistheorie als gegeben an. Auf der Basis des zuvor abgeleiteten Nachfrageund Angebotsverhaltens untersucht die Preistheorie zum einen das Zusammenspiel bzw. die Koordination der individuellen Entscheidungen am Markt, also den Prozess der marktlichen Abstimmung der Einzelpläne der verschiedenen Wirtschaftseinheiten, der im Zusammenhang mit den Steuerungsmechanismen der Klassik bereits angesprochen wurde. Zum anderen fragt die Preistheorie danach, welches Marktergebnis, das heißt welche Gleichgewichtslage von Preisen und Mengen, sich unter verschiedenen Marktbedingungen die Preistheorie spricht hier von Marktformen einstellt. 29 Da die Preistheorie bei ihren Analysen auf die Ergebnisse der Haushalts- und Unternehmenstheorie quasi als Vorstufe zurückgreift, können die Kernbereiche der Mikroökonomie auch in hierarchischer Form veranschaulicht werden. Preistheorie (Koordination/Marktergebnis) Haushaltstheorie Unternehmenstheorie (individuelle Marktentscheidungen) 28 Ob Fragen der Standortwahl (Standorttheorie) der Unternehmenstheorie zuzuordnen oder als eigenständige Theorie zu sehen sind, soll im Rahmen dieser Einführung nicht weiter diskutiert werden. 29 Da die partiellen Marktmodelle sowohl für den Güter- wie auch für den Faktormarkt gelten, liefert die Preistheorie damit zugleich die Grundlagen für die Analyse mikroökonomisch ausgerichteter Fragen der Verteilung, auf die im Rahmen dieser Einführung jedoch nicht gesondert eingegangen wird.
6 42 2 Mikroökonomie 2.2 Spieltheorie Inhalte und Bedeutung der Spieltheorie Mit der Spieltheorie, die aufgrund ihrer stetig gewachsenen Bedeutung mittlerweile auch als die Sprache der modernen Mikroökonomie bezeichnet wird, wollen wir unsere Betrachtungen beginnen. Die Spieltheorie beschäftigt sich mit dem Verhalten von rational handelnden und gewinnmaximierenden Akteuren (= Spielern) in bestimmten Entscheidungssituationen (= Spielen). Dabei bestimmen die eigene (konkrete) Wahl (= Strategie) aus einem Set von Handlungsoptionen und die Strategie der anderen Mitspieler das Ergebnis des Spiels, 30 das in der Regel in Geld- oder Nutzenwerten ausgedrückt wird. Sowohl die den Spielern zur Verfügung stehenden Strategien, als auch die Auszahlungen werden hierbei als exogen gegeben angenommen. Mit Hilfe der Spieltheorie lassen sich verschiedenste, in der Realität relevante, Entscheidungsprozesse und Koordinationsprobleme (bspw. auf Märkten) darstellen und analysieren, weshalb die Spieltheorie über die Zeit eine wichtige Rolle in den Wirtschaftswissenschaften eingenommen hat. Wir werden uns im Folgenden auf einige ausgewählte Konzepte der Spieltheorie, insbesondere das sogenannte Nash- Gleichgewicht (Nash-GG), beschränken, die für bestimmte Analysen im Rahmen der Preistheorie, vor allem aber für spezielle wirtschaftspolitische sowie finanzwissenschaftliche Fragestellungen benötigt werden Das Konzept des Nash-Gleichgewichts Das Konzept des Nash-GG geht zurück auf den US-amerikanischen Nobelpreisträger John Forbes Nash (*1928), der die Spieltheorie in den 1950er Jahren durch seine Überlegungen erweitert hat. Ein solches Gleichgewicht liegt immer dann vor, wenn in einem Zwei-Personen-Spiel jeder Spieler seine optimale Strategie gegeben die Strategie des anderen Spielers wählt. Wir wollen uns dieses Konzept anhand eines einfachen Beispiels klarmachen. Spieler 1 habe die beiden Strategien s 11 und s 12 zur Auswahl, Spieler 2 entsprechend die Strategien s 21 und s 22. Die Auszahlungskombinationen in der folgenden Matrix geben jeweils zuerst die Auszahlungen von Spieler 1 an, dann die Auszahlungen von Spieler 2. Bei der Strategien-Kombination (s 11,s 21 ) erhält Spieler 1 also bspw. eine Auszahlung in Höhe von 9, Spieler zwei eine Auszahlung in Höhe von 2: 30 Von der Entscheidungstheorie grenzt sich die Spieltheorie vor allem durch eben diese Interdependenz ab: Anders als bei der erstgenannten hängt bei der Spieltheorie das Ergebnis eines Individuums wie beschrieben nicht nur von den eigenen Entscheidungen ab, sondern auch von denen der weiteren situationsbedingt relevanten Akteure ( strategische Interaktion ).
7 2.2 Spieltheorie 43 s 21 s 22 s 11 (9,2) (2,1) s 12 (10,1) (3,0) Für die Bestimmung des Nash-GG vergleicht nun jeder Spieler seine Auszahlungen, um zu bestimmen, welche Strategie jeweils für ihn vorteilhaft wäre, unabhängig davon, wie sich der andere Spieler verhält. Das Nash-GG wird also durch die Methode der cell-by-cell-inspection (Technik: Suche eine höhere Auszahlung ) aufgespürt. Für Spieler 1 ist diese Überlegung durch die senkrechten Pfeile angedeutet, für Spieler 2 durch die waagrechten Pfeile, wobei diese jeweils zur höheren Auszahlung weisen und damit die Entscheidung des jeweiligen Spielers angeben. In Feldern, in denen sich Pfeilspitzen treffen, befinden sich Nash-GG des Spiels. In unserem Beispiel nur eines im Südwesten der Matrix bei der Auszahlungskombination (10,1), welche fett hervorgehoben ist. Von diesem Nash-GG aus hat keiner der Spieler einen Anreiz, von der gewählten Strategie abzuweichen. Etwas allgemeiner lassen sich diese Überlegungen schreiben als: a) (s 11,s 21 ) r 1 (s 21 )=s 12 kein Nash-GG Die beste Reaktion von Spieler 1 auf s 21 ist s 12. b) (s 11,s 22 ) r 2 (s 11 )=s 21 kein Nash-GG Die beste Reaktion von Spieler 2 auf s 11 ist s 21. c) (s 12,s 21 ) r 1 (s 12 )=s 12 Nash-GG Die beste Reaktion von Spieler 1 auf s 21 ist s 12. d) (s 12,s 22 ) r 2 (s 12 )=s 21 kein Nash-GG Die beste Reaktion von Spieler 2 auf s 12 ist s 21. Eine Reaktion bezieht sich hierbei demnach nicht auf eine konkret gewählt Antwort als Reaktion auf eine bereits erfolgte tatsächliche Wahl des Gegenspielers, sondern ist als eine wenn-dann -Entscheidung zu sehen: Wenn Spieler 1 Strategie s 11 wählen würde, dann wäre die beste Reaktion von Spieler 2 die Strategie s 21. Jeder Spieler muss Erwartungen bezüglich des Verhaltens des Gegenspielers machen. Ein Nash-GG liegt also dann und auch nur dann vor, wenn die gewählten Strategien die besten Antworten zu gegebenen Strategien der Mitspieler darstellen. wechselseitig beste Antworten sind. die Erwartungen aller Spieler erfüllen.
8 44 2 Mikroökonomie Es gibt aber auch Spiele mit mehreren (= multiplen) Nash-GG, die mithilfe derselben Überlegungen identifiziert werden können. Als klassisches Beispiel wird hier oft der so genannte Kampf der Geschlechter herangezogen: Mädchen (Spieler 1) und Junge (Spieler 2) treffen sich zufällig im Café und verlieben sich; Mädchen ist Eishockey-Fan und will heute Abend zum Spiel der Heimmannschaft; Junge ist Kinofan und will heute Abend in Skyfall ; Beide wollen sich noch heute Abend wieder treffen, vergessen aber in der Hektik auszumachen, wo (Eishockey oder Kino?); Mädchen zieht Eishockey vor, Junge Kino. Beide ziehen aber den gemeinsamen Abend vor. Somit stehen den beiden Spielern die Strategien s i1 (= zum Eishockey gehen) und s i2 (= ins Kino gehen) zur Verfügung, die in der bekannten Matrixform abgebildet werden können: Mädchen Junge s 21 Eishockey s 22 Kino s 11 Eishockey (3,1) (0,0) s 12 Kino (0,0) (1,3) Wie man sehen kann, existieren bei diesem Spiel zwei Nash-GG (in (s 11,s 21 ) und in (s 12,s 22 )), und es stellt sich die Frage, ob und wenn ja, welches der beiden realisiert wird. Zur Beantwortung dieser Frage gibt es unterschiedliche Lösungsansätze: 31 (i) (ii) Fokus-Punkt, d.h. eines der beiden Gleichgewichte ist plausibler; Spieler haben etwa gemeinsame Erfahrungen und, darauf basierend, gleiche Erwartungen. Ein Beispiel dafür wäre, dass Männer traditionell dominieren und damit der männliche Spieler das Gleichgewicht bestimmt beide gehen ins Kino (s 12,s 22 ). Gemischte Strategien 32 : Die Strategie wird durch Zufallsmechanismus etwa durch einen Münzwurf bestimmt. 31 Zu den an dieser Stelle behandelten Fragestellungen vgl. Morasch/Bartholomae/Wiens (2010). 32 Auf das Konzept der gemischten Strategien, das sich von den bisher immer verwendeten sogenannten reinen Strategien unterscheidet, soll im Rahmen dieser Einführung nicht weiter eingegangen werden.
9 2.2 Spieltheorie 45 Ein letztes Beispiel mit drei Strategien pro Spieler soll die Einführung in das Nash- GG abschließen: s 21 s 22 s 23 s 11 (0,0) (6,6) (2,2) s 12 (6,6) (8,8) (0, 2) s 13 (2,2) (2,0) (1,1) Für Spieler 1 gilt bspw., dass er, wenn Spieler 2 s 21 spielt, von der Strategie s 11 als Ausgangsstrategie aus in die zweite Zeile mit der Strategie s 12 ausweichen würde, da er hier eine höhere Auszahlung (6 > 0) erhalten würde. Auch Spieler 2 würde wegen der höheren Auszahlung von s 21 aus, im Falle von s 11 durch Spieler 1, in die zweite Spalte zu s 22 ausweichen (6 > 0). Aus der Sicht von Spieler 1 ist s 12, also die Strategie der zweiten Zeile, die einzige, von der aus in keine andere Zeile abgewichen wird, wenn Spieler 2 die Strategie s 22 wählt. Die Kombination (8,8) ist das einzige Nash-GG des Spiels. s 12 (s 22 ) ist die optimale Strategie zu der gegebenen optimalen Strategie des Mitspielers s 22 (s 12 ) Das Gefangenendilemma Ein zentrales und schon als klassisch zu bezeichnendes Spiel ist das sogenannte Gefangenendilemma. Gegeben ist hierbei die folgende Entscheidungssituation: Zwei Verdächtige befinden sind in Einzelhaft, beide werden schwerer Verbrechen bezichtigt, die aber nicht beweisbar sind (etwa durch Indizienkette). Zwar interessieren sich die Spieler ausschließlich für ihre eigene Situation, die Konsequenzen für den jeweils anderen spielen für ihr Verhalten somit keine Rolle, es liegt aber vollständige Information vor, d.h. die Strategien und möglichen Konsequenzen für den jeweils anderen sind bekannt. Beim anstehenden Verhör beim Staatsanwalt gibt es nun folgende potentiell mögliche Strategienkombinationen:
10 46 2 Mikroökonomie beide gestehen nicht: Strafe für beide wg. anderer Delikte (1 Jahr für beide) beide gestehen: (8 Jahre für beide) nur einer gesteht: (Nur 1/4 Jahr für den Geständigen, aber 10 Jahre für den nicht Geständigen) Dieses Entscheidungsproblem lässt sich auch in der so genannten extensiven Form, einem Ergebnis- oder Spielbaum, aus der Sicht des Delinquenten 2 darstellen. Dabei hat Delinquent 1 die Wahl im Punkt A, wodurch Delinquent 2 seine Wahl also entweder ausgehend von B oder C trifft. Die am rechten Rand des Ergebnisbaums stehenden Auszahlungen in Klammern beziehen sich dabei auf Delinquent 1. Wichtig ist an dieser Stelle, sich von der Darstellung an dieser Stelle nicht täuschen zu lassen: Es gilt weiterhin, dass die Entscheidungen simultan stattfinden. A gestehen nicht gestehen B gestehen nicht gestehen gestehen 8 Jahre (8 Jahre) 10 Jahre (1/4 Jahr) 1/4 Jahr (10 Jahre) C nicht gestehen 1 Jahr (1 Jahr) In dieser Situation gibt es imperfekte Informationen, auch wenn die Strategien, und damit die möglichen Auszahlungen des Gegners bekannt sind. Da die beiden Delinquenten demnach nicht wissen, wie sich der andere entscheidet, weiß im obigen Spielbaum der Delinquent 2 nicht, ob er sich vor seiner Entscheidung ( gestehen oder nicht gestehen ) im Knoten B oder C befindet. Allerdings gilt, dass, egal für welchen Weg (von A nach B oder von A nach C) sich Delinquent 1 entscheidet, sich Delinquent 2 durch ein eigenes Geständnis in jedem Fall besser stellt als durch Schweigen (8 < 10 und 1/4 < 1). Durch Vorausschauen und Rückschluss ermittelt
11
Volkswirtschaftslehre
 Kapitel 2 Mikroökonomie 2.1 Vorbemerkung Nach diesen einführenden und zum auch Teil grundlegenden Darstellungen kommen wir im Folgenden zu den eigentlichen Inhalten der Volkswirtschaftslehre, die zunächst
Kapitel 2 Mikroökonomie 2.1 Vorbemerkung Nach diesen einführenden und zum auch Teil grundlegenden Darstellungen kommen wir im Folgenden zu den eigentlichen Inhalten der Volkswirtschaftslehre, die zunächst
Universität Ulm SS 2007 Institut für Betriebswirtschaft Hellwig/Meuser Blatt 1
 Universität Ulm SS 2007 Institut für Betriebswirtschaft 24.04.2007 Hellwig/Meuser Blatt 1 Lösungen zu AVWL III Aufgabe 1 a) Hauptziel der Wirtschaftswissenschaften: Erforschung wirtschaftlicher Erscheinungen
Universität Ulm SS 2007 Institut für Betriebswirtschaft 24.04.2007 Hellwig/Meuser Blatt 1 Lösungen zu AVWL III Aufgabe 1 a) Hauptziel der Wirtschaftswissenschaften: Erforschung wirtschaftlicher Erscheinungen
Einführung in die VWL Teil 2
 Fernstudium Guide Einführung in die VWL Teil 2 Makroökonomie Version vom 24.02.2017 Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Fernstudium Guide 2008-2017 1 Einführung in die
Fernstudium Guide Einführung in die VWL Teil 2 Makroökonomie Version vom 24.02.2017 Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Fernstudium Guide 2008-2017 1 Einführung in die
Inhaltsverzeichnis Grundlagen...1 Mikroökonomie...19
 Inhaltsverzeichnis I Grundlagen...1 I.1 Gegenstand und Methoden der Volkswirtschaftslehre...1 Aufgabe 1: Alternative Methoden der ökonomischen Analyse...1 Aufgabe 2: Ökonomische Erklärungs- und Prognoseversuche...3
Inhaltsverzeichnis I Grundlagen...1 I.1 Gegenstand und Methoden der Volkswirtschaftslehre...1 Aufgabe 1: Alternative Methoden der ökonomischen Analyse...1 Aufgabe 2: Ökonomische Erklärungs- und Prognoseversuche...3
Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre
 6 Wie eine Volkswirtschaft funktioniert Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre Die Volkswirtschaftlehre (VWL) beschäftigt sich mit den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen eines Staates: der Volkswirtschaft.
6 Wie eine Volkswirtschaft funktioniert Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre Die Volkswirtschaftlehre (VWL) beschäftigt sich mit den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen eines Staates: der Volkswirtschaft.
Kapitel 1 Vorbemerkungen
 Kapitel 1 Vorbemerkungen Lekt. Dr. Irina-Marilena Ban Pearson Studium 2014 2014 Wirtschaftswissenshaften Betriebswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Mikroökonomie Makroökonomie Beschaffung Produktion
Kapitel 1 Vorbemerkungen Lekt. Dr. Irina-Marilena Ban Pearson Studium 2014 2014 Wirtschaftswissenshaften Betriebswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Mikroökonomie Makroökonomie Beschaffung Produktion
Anwendungen der Spieltheorie
 Mikroökonomie I Einführung in die Spieltheorie Universität Erfurt Wintersemester 08/09 Prof. Dr. Dittrich (Universität Erfurt) Spieltheorie Winter 1 / 28 Spieltheorie Die Spieltheorie modelliert strategisches
Mikroökonomie I Einführung in die Spieltheorie Universität Erfurt Wintersemester 08/09 Prof. Dr. Dittrich (Universität Erfurt) Spieltheorie Winter 1 / 28 Spieltheorie Die Spieltheorie modelliert strategisches
D Spieltheorie und oligopolistische Märkte
 D Spieltheorie und oligopolistische Märkte Verhaltensannahmen in der Markttheorie, die bisher analysiert wurden Konkurrenz: viele sehr kleine Wirtschaftssubjekte, die für sich genommen keinen Einfluss
D Spieltheorie und oligopolistische Märkte Verhaltensannahmen in der Markttheorie, die bisher analysiert wurden Konkurrenz: viele sehr kleine Wirtschaftssubjekte, die für sich genommen keinen Einfluss
Statische Spiele mit vollständiger Information
 Statische Spiele mit vollständiger Information Wir beginnen nun mit dem Aufbau unseres spieltheoretischen Methodenbaukastens, indem wir uns zunächst die einfachsten Spiele ansehen. In diesen Spielen handeln
Statische Spiele mit vollständiger Information Wir beginnen nun mit dem Aufbau unseres spieltheoretischen Methodenbaukastens, indem wir uns zunächst die einfachsten Spiele ansehen. In diesen Spielen handeln
Einführung 1. Einführung S. 14. Was versteht man unter dem Begriff Wirtschaft? Unter dem Begriff Wirtschaft verstehen wir
 Einführung 1 Was versteht man unter dem Begriff Wirtschaft? Unter dem Begriff Wirtschaft verstehen wir alles, was Menschen unternehmen, um ihre Bedürfnisse zu decken z.b. Bedürfnisse nach Nahrung, Wohnraum,
Einführung 1 Was versteht man unter dem Begriff Wirtschaft? Unter dem Begriff Wirtschaft verstehen wir alles, was Menschen unternehmen, um ihre Bedürfnisse zu decken z.b. Bedürfnisse nach Nahrung, Wohnraum,
Volkswirtschaftliche Grundlagen
 Themenbereich I: Volkswirtschaftliche Grundlagen 1 Volkswirtschaftliche Grundlagen Themenbereich I: Volkswirtschaftliche Grundlagen 2 Volkswirtschaftslehre Mikroökonomie Makroökonomie Wirtschaftspolitik
Themenbereich I: Volkswirtschaftliche Grundlagen 1 Volkswirtschaftliche Grundlagen Themenbereich I: Volkswirtschaftliche Grundlagen 2 Volkswirtschaftslehre Mikroökonomie Makroökonomie Wirtschaftspolitik
Aufgaben und Lösungen in der Volkswirtschaftslehre
 Friedrich L. Seil Silvio Kermer Aufgaben und Lösungen in der Volkswirtschaftslehre Arbeitsbuch zu Engelkamp/Sell Mit 109 Abbildungen Springer Inhaltsverzeichnis I Grundlagen 1 LI Gegenstand und Methoden
Friedrich L. Seil Silvio Kermer Aufgaben und Lösungen in der Volkswirtschaftslehre Arbeitsbuch zu Engelkamp/Sell Mit 109 Abbildungen Springer Inhaltsverzeichnis I Grundlagen 1 LI Gegenstand und Methoden
Wie verhalte ich mich bei einem Verhör und einer Mutprobe richtig?
 Wie verhalte ich mich bei einem Verhör und einer Mutprobe richtig? Ringvorlesung Technische Mathematik 10. November 2009 Inhaltsverzeichnis Das Gefangenendilemma 1 Das Gefangenendilemma 2 Situationsanalyse
Wie verhalte ich mich bei einem Verhör und einer Mutprobe richtig? Ringvorlesung Technische Mathematik 10. November 2009 Inhaltsverzeichnis Das Gefangenendilemma 1 Das Gefangenendilemma 2 Situationsanalyse
Inhalt. Wie eine Volkswirtschaft funktioniert 5. Wie Märkte funktionieren 31. Geld und Geldmarkt 49
 2 Inhalt Wie eine Volkswirtschaft funktioniert 5 Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre 6 Die drei Akteure: Haushalt, Unternehmen, Staat 8 Bedürfnisse, Bedarf und Knappheit 10 Maßstäbe wirtschaftlichen
2 Inhalt Wie eine Volkswirtschaft funktioniert 5 Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre 6 Die drei Akteure: Haushalt, Unternehmen, Staat 8 Bedürfnisse, Bedarf und Knappheit 10 Maßstäbe wirtschaftlichen
GRUNDZÜGE DER VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE I + II
 Prof. Dr. Wolfgang Filc WS 2005/06 GRUNDZÜGE DER VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE I + II Adressaten: Studierende im 1. Semester der BWL, VWL, Soziologie und Mathematik Zeit: Mittwoch, 14-16 Uhr und Donnerstag, 16-18
Prof. Dr. Wolfgang Filc WS 2005/06 GRUNDZÜGE DER VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE I + II Adressaten: Studierende im 1. Semester der BWL, VWL, Soziologie und Mathematik Zeit: Mittwoch, 14-16 Uhr und Donnerstag, 16-18
Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre
 6 Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre Die Volkswirtschaftlehre (VWL) beschäftigt sich mit den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen eines Staates: der Volkswirtschaft. Unter Volkswirtschaft versteht
6 Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre Die Volkswirtschaftlehre (VWL) beschäftigt sich mit den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen eines Staates: der Volkswirtschaft. Unter Volkswirtschaft versteht
Aufgaben und Lösungen in der Volkswirtschaftslehre
 Springer-Lehrbuch Aufgaben und Lösungen in der Volkswirtschaftslehre Arbeitsbuch zu Engelkamp/Sell, Einführung in die Volkswirtschaftslehre. von Friedrich L Sell, Silvio Kermer Neuausgabe Aufgaben und
Springer-Lehrbuch Aufgaben und Lösungen in der Volkswirtschaftslehre Arbeitsbuch zu Engelkamp/Sell, Einführung in die Volkswirtschaftslehre. von Friedrich L Sell, Silvio Kermer Neuausgabe Aufgaben und
Kurs. Kapitel 1: Einführung
 c Gerald J. Pruckner, JKU Linz Einführung 1 / 11 Kurs Ökonomische Entscheidungen und Märkte Kapitel 1: Einführung Gerald J. Pruckner Institut für Volkswirtschaftslehre, Wintersemester 2009 c Gerald J.
c Gerald J. Pruckner, JKU Linz Einführung 1 / 11 Kurs Ökonomische Entscheidungen und Märkte Kapitel 1: Einführung Gerald J. Pruckner Institut für Volkswirtschaftslehre, Wintersemester 2009 c Gerald J.
Modul 4.2. Studiengang Kommunaler Verwaltungsdienst Dozent: Dr. Lothar Barth Fachhochschule Köln
 Modul 4.2. Studiengang Kommunaler Verwaltungsdienst Dozent: Dr. Lothar Barth Fachhochschule Köln Hieber, Fritz; Öffentliche Betriebswirtschaftslehre; Verlag Wissenschaft und Praxis Schmidt, Hans-Jürgen;
Modul 4.2. Studiengang Kommunaler Verwaltungsdienst Dozent: Dr. Lothar Barth Fachhochschule Köln Hieber, Fritz; Öffentliche Betriebswirtschaftslehre; Verlag Wissenschaft und Praxis Schmidt, Hans-Jürgen;
Grundlagen und Nash Gleichgewichte in reinen Strategien
 Grundlagen und Nash Gleichgewichte in reinen Strategien Yves Breitmoser, EUV Frankfurt (Oder) Zahlen und Vektoren IR ist die Menge der reellen Zahlen IR + = r IR r 0 IR n ist die Menge aller Vektoren von
Grundlagen und Nash Gleichgewichte in reinen Strategien Yves Breitmoser, EUV Frankfurt (Oder) Zahlen und Vektoren IR ist die Menge der reellen Zahlen IR + = r IR r 0 IR n ist die Menge aller Vektoren von
Existenz eines Nash Gleichgewichts
 Existenz eines Nash Gleichgewichts Ei Existenztheorem: Wenn für ein Spiel = (N, S, u) gilt, dass (i) der Strategieraum S kompakt und konvex ist und (ii) die Auszahlungsfunktion u i (s) jedes Spielers stetig
Existenz eines Nash Gleichgewichts Ei Existenztheorem: Wenn für ein Spiel = (N, S, u) gilt, dass (i) der Strategieraum S kompakt und konvex ist und (ii) die Auszahlungsfunktion u i (s) jedes Spielers stetig
Spiele mit simultanen Spielzügen und reinen Strategien: Diskrete Strategien
 Kapitel 4 Spiele mit simultanen Spielzügen und reinen Strategien: Diskrete Strategien Einführung in die Spieltheorie Prof. Dr. Aleksander Berentsen 1 Teil 2 - Übersicht Teil 2 Sequentielle Spiele (Kapitel
Kapitel 4 Spiele mit simultanen Spielzügen und reinen Strategien: Diskrete Strategien Einführung in die Spieltheorie Prof. Dr. Aleksander Berentsen 1 Teil 2 - Übersicht Teil 2 Sequentielle Spiele (Kapitel
3.5 Mehrstufige Spiele und Teilspiel-perfektes Gleichgewicht
 3.5 Mehrstufige Spiele und Teilspiel-perfektes Gleichgewicht Von der spieltheoretischen Situation her gesehen war das Dixit-Modell von den vorangegangenen Modellen insoweit unterschiedlich, als hier eine
3.5 Mehrstufige Spiele und Teilspiel-perfektes Gleichgewicht Von der spieltheoretischen Situation her gesehen war das Dixit-Modell von den vorangegangenen Modellen insoweit unterschiedlich, als hier eine
Übung Kapitel
 Einführung in die Spieltheorie und Experimental Economics Übung Kapitel 4 28.09.205 Einführung in die Spieltheorie Prof. Dr. Aleksander Berentsen Aufgabe a) Dominante Strategie 2 l r o 2, 4, 0 u 6, 5 4,
Einführung in die Spieltheorie und Experimental Economics Übung Kapitel 4 28.09.205 Einführung in die Spieltheorie Prof. Dr. Aleksander Berentsen Aufgabe a) Dominante Strategie 2 l r o 2, 4, 0 u 6, 5 4,
AVWL I (Mikro) 5-31 Prof. Dr. K. Schmidt Spieler 1 Oben Unten Spieler 2 Links Rechts 1, 3 0, 1 2, 1 1, 0 Figur 5.4: Auszahlungsmatrix eines Spiels Wen
 AVWL I (Mikro) 5-30 Prof. Dr. K. Schmidt 5.7 Einfuhrung in die Spieltheorie Ein \Spiel" besteht aus: einer Menge von Spielern einer Menge von moglichen Strategien fur jeden Spieler, einer Auszahlungsfunktion,
AVWL I (Mikro) 5-30 Prof. Dr. K. Schmidt 5.7 Einfuhrung in die Spieltheorie Ein \Spiel" besteht aus: einer Menge von Spielern einer Menge von moglichen Strategien fur jeden Spieler, einer Auszahlungsfunktion,
Makroökonomik. Übung 3 - Das IS/LM-Modell
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany M.Sc. Filiz Bestepe Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2014/2015 Makroökonomik
Universität Ulm 89069 Ulm Germany M.Sc. Filiz Bestepe Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2014/2015 Makroökonomik
Thema 4: Das IS-LM-Modell. Zusammenfassung der beiden Modelle des Gütermarktes (IS) und des Geldmarktes (LM)
 Thema 4: Das IS-LM-Modell Zusammenfassung der beiden Modelle des Gütermarktes (IS) und des Geldmarktes (LM) Beide Modelle gelten - so wie das zusammenfassende Modell - für die kurze Frist 1 4.1 Gütermarkt
Thema 4: Das IS-LM-Modell Zusammenfassung der beiden Modelle des Gütermarktes (IS) und des Geldmarktes (LM) Beide Modelle gelten - so wie das zusammenfassende Modell - für die kurze Frist 1 4.1 Gütermarkt
Ich finde ja den Begriff»Volkswirtschaftslehre«etwas altertümlich. Wer sagt denn heutzutage
 Trim Size: 176mm x 240mm Beeker712274 c01.tex V2-8. Juli 2016 10:25 A.M. Page 25 Volkswirtschaftslehre und andere altertümliche Begriffe In diesem Kapitel Das Grundproblem: die Allokation Einteilung der
Trim Size: 176mm x 240mm Beeker712274 c01.tex V2-8. Juli 2016 10:25 A.M. Page 25 Volkswirtschaftslehre und andere altertümliche Begriffe In diesem Kapitel Das Grundproblem: die Allokation Einteilung der
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
 Prof. Dr. Fritz Unger Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre November 2015 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IM FERNSTUDIENGANG UNTERNEHMENSFÜHRUNG Modul 1 Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen 1.1
Prof. Dr. Fritz Unger Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre November 2015 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IM FERNSTUDIENGANG UNTERNEHMENSFÜHRUNG Modul 1 Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen 1.1
Volkswirtschaftliches Denken
 Volkswirtschaftliches Denken 2 Inhalt Die wissenschaftliche Methode Ökonomische Modelle - Das Kreislaufdiagramm - Die Produktionsmöglichkeitenkurve Positive und normative Aussagen der Ökonom als Wissenschaftler
Volkswirtschaftliches Denken 2 Inhalt Die wissenschaftliche Methode Ökonomische Modelle - Das Kreislaufdiagramm - Die Produktionsmöglichkeitenkurve Positive und normative Aussagen der Ökonom als Wissenschaftler
Einführung in die VWL Teil 3
 Fernstudium Guide Einführung in die VWL Teil 3 Version vom 21.02.2017 Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Fernstudium Guide 2008-2017 1 Einführung in die VWL Teil 1 Kapitel
Fernstudium Guide Einführung in die VWL Teil 3 Version vom 21.02.2017 Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Fernstudium Guide 2008-2017 1 Einführung in die VWL Teil 1 Kapitel
Arbeitsbuch Grundzüge der Volkswirtschaftslehre
 Marco Herrmann Arbeitsbuch Grundzüge der Volkswirtschaftslehre 4., überarbeitete und erweiterte Auflage 2012 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Inhaltsverzeichnis Vorwort zur 4. Auflage Vorwort zur 1.
Marco Herrmann Arbeitsbuch Grundzüge der Volkswirtschaftslehre 4., überarbeitete und erweiterte Auflage 2012 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Inhaltsverzeichnis Vorwort zur 4. Auflage Vorwort zur 1.
VWL A Grundlagen. Kapitel 1. Grundlagen
 Kapitel 1 Einleitung Dieses Kapitel führt in die der VWL ein. Dabei wir die Ökonomik als die Wissenschaft vom Umgang mit knappen Ressourcen (Knappheitsproblematik) vorgestellt. Des Weiteren werden die
Kapitel 1 Einleitung Dieses Kapitel führt in die der VWL ein. Dabei wir die Ökonomik als die Wissenschaft vom Umgang mit knappen Ressourcen (Knappheitsproblematik) vorgestellt. Des Weiteren werden die
Inhaltsverzeichnis. Teil I Einführung KAPITEL 2
 Inhaltsverzeichnis Teil I Einführung KAPITEL 1 WAS IST VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE? 1. Gegenstand der Volkswirtschaftslehre 4 2. Güterknappheit und Wohlfahrt 6 3. Das Koordinationsproblem 7 4. Methoden der Volkswirtschaftslehre
Inhaltsverzeichnis Teil I Einführung KAPITEL 1 WAS IST VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE? 1. Gegenstand der Volkswirtschaftslehre 4 2. Güterknappheit und Wohlfahrt 6 3. Das Koordinationsproblem 7 4. Methoden der Volkswirtschaftslehre
Ulrich Blum. Grundlagen der. Volkswirtschaftslehre DE GRUYTER OLDENBOURG
 Ulrich Blum Grundlagen der Volkswirtschaftslehre DE GRUYTER OLDENBOURG Inhaltsverzeichnis 1 Ökonomisches Denken 1 1.1 Einordnung der Wirtschaftswissenschaften 1 1.2 Denken und Begriffe in der Volkswirtschaft
Ulrich Blum Grundlagen der Volkswirtschaftslehre DE GRUYTER OLDENBOURG Inhaltsverzeichnis 1 Ökonomisches Denken 1 1.1 Einordnung der Wirtschaftswissenschaften 1 1.2 Denken und Begriffe in der Volkswirtschaft
Wirtschaft. Stephanie Schoenwetter. Das IS-LM-Modell. Annahmen, Funktionsweise und Kritik. Studienarbeit
 Wirtschaft Stephanie Schoenwetter Das IS-LM-Modell Annahmen, Funktionsweise und Kritik Studienarbeit Thema II Das IS-LM Modell Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 1. Die Welt von John Maynard Keynes...
Wirtschaft Stephanie Schoenwetter Das IS-LM-Modell Annahmen, Funktionsweise und Kritik Studienarbeit Thema II Das IS-LM Modell Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 1. Die Welt von John Maynard Keynes...
Makroökonomie 1. Skript: Teil 1
 Makroökonomie 1 Skript: Teil 1 Prof. Volker Wieland Prof. Volker Wieland - Makroökonomie 1 Einführung / 1 Übersicht I. Einführung Makroökonomische Denkweise und Kennzahlen II. Die Volkswirtschaft bei langfristiger
Makroökonomie 1 Skript: Teil 1 Prof. Volker Wieland Prof. Volker Wieland - Makroökonomie 1 Einführung / 1 Übersicht I. Einführung Makroökonomische Denkweise und Kennzahlen II. Die Volkswirtschaft bei langfristiger
Übung zu Mikroökonomik II
 Prof. Dr. G. Rübel SS 2005 Dr. H. Möller-de Beer Dipl.-Vw. E. Söbbeke Übung zu Mikroökonomik II Aufgabe 1: Eine gewinnmaximierende Unternehmung produziere ein Gut mit zwei kontinuierlich substituierbaren
Prof. Dr. G. Rübel SS 2005 Dr. H. Möller-de Beer Dipl.-Vw. E. Söbbeke Übung zu Mikroökonomik II Aufgabe 1: Eine gewinnmaximierende Unternehmung produziere ein Gut mit zwei kontinuierlich substituierbaren
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
 Dipl.-WiWi Kai Kohler Wintersemester 2006/2007 Institut für Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 03 Tel. 0731 50 24264 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Dipl.-WiWi Kai Kohler Wintersemester 2006/2007 Institut für Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 03 Tel. 0731 50 24264 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Spiele mit simultanen und sequentiellen Spielzügen
 Kapitel 6 Spiele mit simultanen und sequentiellen Spielzügen Einführung in die Spieltheorie Prof. Dr. Aleksander Berentsen 1 Teil 2 - Übersicht Teil 2 Sequentielle Spiele (Kapitel 3) Simultane Spiele Reine
Kapitel 6 Spiele mit simultanen und sequentiellen Spielzügen Einführung in die Spieltheorie Prof. Dr. Aleksander Berentsen 1 Teil 2 - Übersicht Teil 2 Sequentielle Spiele (Kapitel 3) Simultane Spiele Reine
Lösungshinweise zu den zusätzlichen Übungsaufgaben
 Lösungshinweise zu den zusätzlichen Übungsaufgaben Aufgabe Z.1 Als Gleichgewicht ergibt sich, mit Auszahlungsvektor 5, 5. Aufgabe Z. Spieler 1: Zentralbank mit reinen und diskreten Strategien 0 und 4.
Lösungshinweise zu den zusätzlichen Übungsaufgaben Aufgabe Z.1 Als Gleichgewicht ergibt sich, mit Auszahlungsvektor 5, 5. Aufgabe Z. Spieler 1: Zentralbank mit reinen und diskreten Strategien 0 und 4.
Makroökonomik. Mit vielen Fallstudien. Bearbeitet von Prof. N. Gregory Mankiw, Prof. Dr. rer. pol. habil. Klaus Dieter John
 Makroökonomik Mit vielen Fallstudien Bearbeitet von Prof. N. Gregory Mankiw, Prof. Dr. rer. pol. habil. Klaus Dieter John 6., überarbeitete und erweiterte Auflage 2011. Buch. XXIII, 752 S. Gebunden ISBN
Makroökonomik Mit vielen Fallstudien Bearbeitet von Prof. N. Gregory Mankiw, Prof. Dr. rer. pol. habil. Klaus Dieter John 6., überarbeitete und erweiterte Auflage 2011. Buch. XXIII, 752 S. Gebunden ISBN
Orientierungsphase Zwei-Fächer-Bachelor Politik (Profil Lehramt) Studienschwerpunkt Wirtschaft
 Orientierungsphase Zwei-Fächer-Bachelor Politik (Profil Lehramt) Studienschwerpunkt Wirtschaft Dr. Dagmar Sakowsky Department für Volkswirtschaftslehre Studienberatung WiSe 2012/2013 Studienschwerpunkt
Orientierungsphase Zwei-Fächer-Bachelor Politik (Profil Lehramt) Studienschwerpunkt Wirtschaft Dr. Dagmar Sakowsky Department für Volkswirtschaftslehre Studienberatung WiSe 2012/2013 Studienschwerpunkt
Spieltheorie mit. sozialwissenschaftlichen Anwendungen
 Friedel Bolle, Claudia Vogel Spieltheorie mit sozialwissenschaftlichen Anwendungen SS 2010 Strategische Züge 1. Einführung: Strategische Züge 2. Bedingungslose Züge 3. Bedingte Züge Drohung Versprechen
Friedel Bolle, Claudia Vogel Spieltheorie mit sozialwissenschaftlichen Anwendungen SS 2010 Strategische Züge 1. Einführung: Strategische Züge 2. Bedingungslose Züge 3. Bedingte Züge Drohung Versprechen
Spieltheorie mit. sozialwissenschaftlichen Anwendungen
 Friedel Bolle, Claudia Vogel Spieltheorie mit sozialwissenschaftlichen Anwendungen SS 2010 Simultane Spiele 1. Einführung: Spiele in Normalform Nash-Gleichgewicht Dominanz 2. Typen von Spielen Gefangenendilemma
Friedel Bolle, Claudia Vogel Spieltheorie mit sozialwissenschaftlichen Anwendungen SS 2010 Simultane Spiele 1. Einführung: Spiele in Normalform Nash-Gleichgewicht Dominanz 2. Typen von Spielen Gefangenendilemma
Orientierungsphase Zwei-Fächer-Bachelor Politikwissenschaft Studienschwerpunkt Wirtschaft
 Orientierungsphase Zwei-Fächer-Bachelor Politikwissenschaft Studienschwerpunkt Wirtschaft Dr. Dagmar Sakowsky Department für Volkswirtschaftslehre Studienberatung dsakows@uni-goettingen.de WiSe 2015/2016
Orientierungsphase Zwei-Fächer-Bachelor Politikwissenschaft Studienschwerpunkt Wirtschaft Dr. Dagmar Sakowsky Department für Volkswirtschaftslehre Studienberatung dsakows@uni-goettingen.de WiSe 2015/2016
Dominanzüberlegungen in einfachen Matrix Spielen (Reine Strategien)
 Dominanzüberlegungen in einfachen Matrix Spielen (Reine Strategien) Dominanzüberlegungen können beim Auffinden von Nash Gleichgewichten helfen Ein durch Dominanzüberlegungen ermitteltes Gleichgewicht ist
Dominanzüberlegungen in einfachen Matrix Spielen (Reine Strategien) Dominanzüberlegungen können beim Auffinden von Nash Gleichgewichten helfen Ein durch Dominanzüberlegungen ermitteltes Gleichgewicht ist
2. Grundzüge der Mikroökonomik Einführung in die Spieltheorie. Allgemeine Volkswirtschaftslehre. WiMa und andere (AVWL I) WS 2007/08
 2. Grundzüge der Mikroökonomik 2.10 Einführung in die Spieltheorie 1 Spieltheorie befasst sich mit strategischen Entscheidungssituationen, in denen die Ergebnisse von den Entscheidungen mehrerer Entscheidungsträger
2. Grundzüge der Mikroökonomik 2.10 Einführung in die Spieltheorie 1 Spieltheorie befasst sich mit strategischen Entscheidungssituationen, in denen die Ergebnisse von den Entscheidungen mehrerer Entscheidungsträger
UNIVERSITÄT HEIDELBERG ALFRED-WEBER-INSTITUT PROF. DR. AXEL DREHER
 UNIVERSITÄT HEIDELBERG ALFRED-WEBER-INSTITUT PROF. DR. AXEL DREHER Prof. Dr. Axel Dreher, AWI, Universität Heidelberg, Bergheimer Straße 58, D-69115 Heidelberg Wintersemester 2015/16 VL + Ü Makroökonomik
UNIVERSITÄT HEIDELBERG ALFRED-WEBER-INSTITUT PROF. DR. AXEL DREHER Prof. Dr. Axel Dreher, AWI, Universität Heidelberg, Bergheimer Straße 58, D-69115 Heidelberg Wintersemester 2015/16 VL + Ü Makroökonomik
Allgemeine Volkswirtschaftslehre für Betriebswirte
 Allgemeine Volkswirtschaftslehre für Betriebswirte Band 3 Geld, Konjunktur, Außenwirtschaft, Wirtschaftswachstum von Prof. Dr. Manfred O.E. Hennies BERLIN VERLAG Arno Spitz ALLGEMEINE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE
Allgemeine Volkswirtschaftslehre für Betriebswirte Band 3 Geld, Konjunktur, Außenwirtschaft, Wirtschaftswachstum von Prof. Dr. Manfred O.E. Hennies BERLIN VERLAG Arno Spitz ALLGEMEINE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE
Aktuelle Volkswirtschaftslehre
 Peter Eisenhut Aktuelle Volkswirtschaftslehre Ausgabe 2006/2007 Verlag Rüegger Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis 13 Tabellenverzeichnis 16 Teil I Einführung 17 1 Womit beschäftigt
Peter Eisenhut Aktuelle Volkswirtschaftslehre Ausgabe 2006/2007 Verlag Rüegger Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis 13 Tabellenverzeichnis 16 Teil I Einführung 17 1 Womit beschäftigt
Übung Grundzüge der VWL // Makroökonomie
 Übung Grundzüge der VWL // Makroökonomie Wintersemester 2011/2012 Thomas Domeratzki 27. Oktober 2011 VWL allgemein, worum geht es??? Wie funktioniert die Wirtschaft eines Landes? wie wird alles koordiniert?
Übung Grundzüge der VWL // Makroökonomie Wintersemester 2011/2012 Thomas Domeratzki 27. Oktober 2011 VWL allgemein, worum geht es??? Wie funktioniert die Wirtschaft eines Landes? wie wird alles koordiniert?
Wirtschafts- & Konjunkturpolitik Zusammenfassung
 ist die Summe aller planvollen Maßnahmen, mit denen der Staat (u. a.) regulierend und gestaltend in die Wirtschaft eingreift. Die beschäftigt sich mit den Spielregeln (Rahmenbedingungen), innerhalb derer
ist die Summe aller planvollen Maßnahmen, mit denen der Staat (u. a.) regulierend und gestaltend in die Wirtschaft eingreift. Die beschäftigt sich mit den Spielregeln (Rahmenbedingungen), innerhalb derer
Klausur Einführung in die VWL
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im WS 2014/15 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im WS 2014/15 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Grundzüge der. Einführung in die Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik. von. Dr. Hartwig Bartling. und. Dr. Franz Luzius
 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre Einführung in die Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik von Dr. Hartwig Bartling und Dr. Franz Luzius 17., verbesserte und ergänzte Auflage Verlag Franz Vahlen München
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre Einführung in die Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik von Dr. Hartwig Bartling und Dr. Franz Luzius 17., verbesserte und ergänzte Auflage Verlag Franz Vahlen München
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre
 Helmut Wienert Grundzüge der Volkswirtschaftslehre Band 2: Makroökonomie 2., aktualisierte und überarbeitete Auflage Verlag W. Kohlhammer Inhaltsverzeichnis Verzeichnis der Übersichten, Tabellen und Schaubilder
Helmut Wienert Grundzüge der Volkswirtschaftslehre Band 2: Makroökonomie 2., aktualisierte und überarbeitete Auflage Verlag W. Kohlhammer Inhaltsverzeichnis Verzeichnis der Übersichten, Tabellen und Schaubilder
Klausur Einführung in die VWL
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Finanzwissenschaft Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im SS 2012 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Finanzwissenschaft Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im SS 2012 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Spieltheorie. Winter 2013/14. Professor Dezsö Szalay. 2. Dynamische Spiele mit vollständiger Information
 Spieltheorie Winter 2013/14 Professor Dezsö Szalay 2. Dynamische Spiele mit vollständiger Information In Teil I haben wir Spiele betrachtet, in denen die Spieler gleichzeitig (oder zumindest in Unkenntnis
Spieltheorie Winter 2013/14 Professor Dezsö Szalay 2. Dynamische Spiele mit vollständiger Information In Teil I haben wir Spiele betrachtet, in denen die Spieler gleichzeitig (oder zumindest in Unkenntnis
2 Lösungskonzepte für statische Spiele bei vollständiger Information 29
 Lösungskonzepte für statische Spiele bei vollständiger Information 9.3 Nash-Gleichgewichte.3. Nash-GG: Grundkonzept. Definition Wir betrachten folgendes Beispiel und üben dabei die Methode der cellby-cell-inspection
Lösungskonzepte für statische Spiele bei vollständiger Information 9.3 Nash-Gleichgewichte.3. Nash-GG: Grundkonzept. Definition Wir betrachten folgendes Beispiel und üben dabei die Methode der cellby-cell-inspection
Daniel Krähmer, Lennestr. 43, 4. OG, rechts. WWW: Übungsleiter: Matthias Lang,
 1 SPIELTHEORIE Daniel Krähmer, Lennestr. 43, 4. OG, rechts. kraehmer@hcm.uni-bonn.de Sprechstunde: Mi, 13:30-14:30 Uhr WWW: http://www.wiwi.uni-bonn.de/kraehmer/ Übungsleiter: Matthias Lang, lang@uni-bonn.de
1 SPIELTHEORIE Daniel Krähmer, Lennestr. 43, 4. OG, rechts. kraehmer@hcm.uni-bonn.de Sprechstunde: Mi, 13:30-14:30 Uhr WWW: http://www.wiwi.uni-bonn.de/kraehmer/ Übungsleiter: Matthias Lang, lang@uni-bonn.de
Arbeitsbuch Grundzüge der Volkswirtschaftslehre
 Marco Herrmann Arbeitsbuch Grundzüge der Volkswirtschaftslehre Z., überarbeitete Auflage 2004 Schäffer-Poeschel Verlag Inhaltsverzeichnis Vorwort zur 2. Auflage... Vorwort zur 1. Auflage... V V Teil I
Marco Herrmann Arbeitsbuch Grundzüge der Volkswirtschaftslehre Z., überarbeitete Auflage 2004 Schäffer-Poeschel Verlag Inhaltsverzeichnis Vorwort zur 2. Auflage... Vorwort zur 1. Auflage... V V Teil I
Klausur Einführung in die VWL
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im WS 2013/14 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die VWL im WS 2013/14 HINWEIS: Es sind sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
9.4Teilspiel-perfekteGleichgewichte
 1 9.4Teilspiel-perfekteGleichgewichte In diesem Abschnitt werden wir, von einer Variation der Auszahlungsmatrix des vorangegangenen Abschnitts ausgehend, einige weitere Kritikpunkte an dem Cournot- Modellaufgreifen.DamitwerdenwirdannquasiautomatischzudemSelten'schenKonzept
1 9.4Teilspiel-perfekteGleichgewichte In diesem Abschnitt werden wir, von einer Variation der Auszahlungsmatrix des vorangegangenen Abschnitts ausgehend, einige weitere Kritikpunkte an dem Cournot- Modellaufgreifen.DamitwerdenwirdannquasiautomatischzudemSelten'schenKonzept
Skript zur Vorlesung Mikroökonomik II (WS 2009) Teil 3
 Skript zur Vorlesung Mikroökonomik II (WS 2009) Teil 3 PR 11.3.1: Intertemporale Preisdiskriminierung Def.: unterschiedliche Preise zu unterschiedlichen Zeitpunkten Entspricht PD 3. Grades Nur sinnvoll
Skript zur Vorlesung Mikroökonomik II (WS 2009) Teil 3 PR 11.3.1: Intertemporale Preisdiskriminierung Def.: unterschiedliche Preise zu unterschiedlichen Zeitpunkten Entspricht PD 3. Grades Nur sinnvoll
Skript zur Vorlesung Mikroökonomik II (WS 2009) Teil 4
 Skript zur Vorlesung Mikroökonomik II (WS 09) Teil 4 PR 13: Spieltheorie Weiterentwicklung der ökonomischen Theorie untersucht Situationen strategischen Verhaltens John von Neumann und Oskar Morgenstern
Skript zur Vorlesung Mikroökonomik II (WS 09) Teil 4 PR 13: Spieltheorie Weiterentwicklung der ökonomischen Theorie untersucht Situationen strategischen Verhaltens John von Neumann und Oskar Morgenstern
Volkswirtschaftslehre für Sozialwissenschaftler
 Holger Rogall Volkswirtschaftslehre für Sozialwissenschaftler Einführung in eine zukunftsfähige Wirtschaftslehre 2. Auflage 4ü Springer VS Inhalt Abkürzungsverzeichnis 17 Geleitwort 19 Vorwort zur 2. Auflage
Holger Rogall Volkswirtschaftslehre für Sozialwissenschaftler Einführung in eine zukunftsfähige Wirtschaftslehre 2. Auflage 4ü Springer VS Inhalt Abkürzungsverzeichnis 17 Geleitwort 19 Vorwort zur 2. Auflage
Teil 1: Statische Spiele mit vollständigen Informationen
 Teil 1: Statische Spiele mit vollständigen Informationen Kapitel 1: Grundlagen und Notation Literatur: Tadelis Chapter 3 Statisches Spiel In einem statischen Spiel...... werden die Auszahlungen durch die
Teil 1: Statische Spiele mit vollständigen Informationen Kapitel 1: Grundlagen und Notation Literatur: Tadelis Chapter 3 Statisches Spiel In einem statischen Spiel...... werden die Auszahlungen durch die
1.2 Abgrenzung der Bedürfnisse von Bedarf und Nachfrage Arten und Rangfolge der Bedürfnisse
 1 VOLKSWIRTSCHAFTLICHES UMFELD UND GRUNDLEGENDE ÖKONOMISCHE ZUSAMMENHÄNGE 1.1 Wirtschaftssubjekte im volkswirtschaftlichen Umfeld 1.1.1 Wirtschaftssubjekte Haushalt, Unternehmen und Staat Zusammenfassung
1 VOLKSWIRTSCHAFTLICHES UMFELD UND GRUNDLEGENDE ÖKONOMISCHE ZUSAMMENHÄNGE 1.1 Wirtschaftssubjekte im volkswirtschaftlichen Umfeld 1.1.1 Wirtschaftssubjekte Haushalt, Unternehmen und Staat Zusammenfassung
Seminararbeit zur Spieltheorie. Thema: Rationalisierbarkeit und Wissen
 Seminararbeit zur Spieltheorie Thema: Rationalisierbarkeit und Wissen Westfälische-Wilhelms-Universität Münster Mathematisches Institut Dozent: Prof. Dr. Löwe Verfasst von: Maximilian Mümken Sommersemester
Seminararbeit zur Spieltheorie Thema: Rationalisierbarkeit und Wissen Westfälische-Wilhelms-Universität Münster Mathematisches Institut Dozent: Prof. Dr. Löwe Verfasst von: Maximilian Mümken Sommersemester
Der Transmissionsmechanismus nach Keynes
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Sabrina Böck Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2007/2008
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Sabrina Böck Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2007/2008
UNIVERSITÄT HEIDELBERG ALFRED-WEBER-INSTITUT DR. ANDREAS FUCHS
 UNIVERSITÄT HEIDELBERG ALFRED-WEBER-INSTITUT DR. ANDREAS FUCHS Dr. Andreas Fuchs, AWI, Universität Heidelberg, Bergheimer Straße 58, D-69115 Heidelberg Wintersemester 2017/18 VL + Ü Makroökonomik Dr. Andreas
UNIVERSITÄT HEIDELBERG ALFRED-WEBER-INSTITUT DR. ANDREAS FUCHS Dr. Andreas Fuchs, AWI, Universität Heidelberg, Bergheimer Straße 58, D-69115 Heidelberg Wintersemester 2017/18 VL + Ü Makroökonomik Dr. Andreas
Der Transmissionsmechanismus nach Keynes
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-Kfm. Philipp Buss Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2013/2014
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-Kfm. Philipp Buss Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2013/2014
Teil 2: Dynamische Spiele mit vollständigen Informationen
 Teil : Dynamische Spiele mit vollständigen Informationen Kapitel 5: Grundsätzliches Literatur: Tadelis Chapter 7 Prof. Dr. Philipp Weinschenk, Lehrstuhl für Mikroökonomik, TU Kaiserslautern Kapitel 5.:
Teil : Dynamische Spiele mit vollständigen Informationen Kapitel 5: Grundsätzliches Literatur: Tadelis Chapter 7 Prof. Dr. Philipp Weinschenk, Lehrstuhl für Mikroökonomik, TU Kaiserslautern Kapitel 5.:
Makroökonomik. Gliederung. Fallstudie 1: Die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland
 2 Gliederung I. GRUNDLAGEN 1. Makroökonomik als Wissenschaft 1.1. Die zentralen Fragen Fallstudie 1: Die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 1.2. Ökonomische Denkweise 2. Empirische
2 Gliederung I. GRUNDLAGEN 1. Makroökonomik als Wissenschaft 1.1. Die zentralen Fragen Fallstudie 1: Die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 1.2. Ökonomische Denkweise 2. Empirische
BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL Fachbereich Wirtschaftswissenschaft. Klausuraufgaben
 Name: Vorname: Matr. Nr.: BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL Fachbereich Wirtschaftswissenschaft Klausuraufgaben Integrierter Studiengang Wirtschaftswissenschaft Vorprüfung Grundlagen der VWL I Makroökonomie
Name: Vorname: Matr. Nr.: BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL Fachbereich Wirtschaftswissenschaft Klausuraufgaben Integrierter Studiengang Wirtschaftswissenschaft Vorprüfung Grundlagen der VWL I Makroökonomie
Universität Trier. Volkswirtschaftslehre / Fachbereich IV Dr. Messerig-Funk
 Universität Trier SS 2009 Volkswirtschaftslehre / Fachbereich IV S. 1 Allgemeine Informationen Vorlesung: SS 2009 Einführung in die Volkswirtschaftslehre für JuristInnen und PolitologInnen II Montags von
Universität Trier SS 2009 Volkswirtschaftslehre / Fachbereich IV S. 1 Allgemeine Informationen Vorlesung: SS 2009 Einführung in die Volkswirtschaftslehre für JuristInnen und PolitologInnen II Montags von
E-Lehrbuch BWL einfach und schnell NACHFRAGE UND ANGEBOT
 E-Lehrbuch BWL einfach und schnell NACHFRAGE UND ANGEBOT Die Nachfragefunktion stellt den Zusammenhang zwischen nachgefragter Menge eines Gutes und dem Preis dieses Gutes dar. Merkmale der Nachfragekurve
E-Lehrbuch BWL einfach und schnell NACHFRAGE UND ANGEBOT Die Nachfragefunktion stellt den Zusammenhang zwischen nachgefragter Menge eines Gutes und dem Preis dieses Gutes dar. Merkmale der Nachfragekurve
Kapitel 6: Spiele mit simultanen und sequentiellen Spielzügen. Kapitel 6 1
 Kapitel 6: Spiele mit simultanen und sequentiellen Spielzügen Kapitel 6 Übersicht Teil Kapitel 5 Übersicht Teil Übersicht Einleitung Darstellung von simultanen Spielzügen in extensiver Form Normalform
Kapitel 6: Spiele mit simultanen und sequentiellen Spielzügen Kapitel 6 Übersicht Teil Kapitel 5 Übersicht Teil Übersicht Einleitung Darstellung von simultanen Spielzügen in extensiver Form Normalform
20 Etappe 1: Grundlegende Begriffe
 20 Etappe 1: Grundlegende Begriffe einem methodischen Gleichgewicht unterscheiden. In der Volkswirtschaftslehre wird von einem theoretischen Gleichgewicht gesprochen, wenn das Marktangebot mit der Marktnachfrage
20 Etappe 1: Grundlegende Begriffe einem methodischen Gleichgewicht unterscheiden. In der Volkswirtschaftslehre wird von einem theoretischen Gleichgewicht gesprochen, wenn das Marktangebot mit der Marktnachfrage
11. Übung Makroökonomischen Theorie
 11. Übung akroökonomischen Theorie Aufgabe 28 Es seien b = 0,35 und r = 0,1. Außerdem steht die monetäre Basis B = 1.200 zur Verfügung. Die Produktion in der Volkswirtschaft betrage Y = 4.000. Die Nachfrage
11. Übung akroökonomischen Theorie Aufgabe 28 Es seien b = 0,35 und r = 0,1. Außerdem steht die monetäre Basis B = 1.200 zur Verfügung. Die Produktion in der Volkswirtschaft betrage Y = 4.000. Die Nachfrage
1. Kapitel: Einführung in die Volkswirtschaftslehre Kapitel: Neoklassische MikroÖkonomie 11
 Inhalt 1. Kapitel: Einführung in die Volkswirtschaftslehre 1 2. Kapitel: Neoklassische MikroÖkonomie 11 2.1 Dogmengeschichtliche Einordnung 11 2.2 Das neoklassische Tauschmodell ohne Produktion 13 2.3
Inhalt 1. Kapitel: Einführung in die Volkswirtschaftslehre 1 2. Kapitel: Neoklassische MikroÖkonomie 11 2.1 Dogmengeschichtliche Einordnung 11 2.2 Das neoklassische Tauschmodell ohne Produktion 13 2.3
Strategisches Denken (Spieltheorie)
 Strategisches Denken (Spieltheorie) MB Spieltheorie Zentrales Werkzeug in Situationen interdependenter Entscheidungen Beispiel für strategische Situation: Sollte Adidas mehr für Werbung ausgeben? Dies
Strategisches Denken (Spieltheorie) MB Spieltheorie Zentrales Werkzeug in Situationen interdependenter Entscheidungen Beispiel für strategische Situation: Sollte Adidas mehr für Werbung ausgeben? Dies
Kapitel 1: Zehn volkswirtschaftlichen Regeln
 Kapitel 1: Zehn volkswirtschaftlichen Regeln Lernen, dass VWL von der Zuteilung knapper Ressourcen handelt. Einige der Zielkonflikte näher kennenlernen, denen Menschen gegenüberstehen. Die Bedeutung des
Kapitel 1: Zehn volkswirtschaftlichen Regeln Lernen, dass VWL von der Zuteilung knapper Ressourcen handelt. Einige der Zielkonflikte näher kennenlernen, denen Menschen gegenüberstehen. Die Bedeutung des
Konjunktur und Wachstum
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Christian Peukert Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2010/11
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Christian Peukert Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2010/11
Geschichte der Makroökonomie. (1) Keynes (1936): General Theory of employment, money and interest
 Geschichte der Makroökonomie (1) Keynes (1936): General Theory of employment, money and interest kein formales Modell Bedeutung der aggegierten Nachfrage: kurzfristig bestimmt Nachfrage das Produktionsniveau,
Geschichte der Makroökonomie (1) Keynes (1936): General Theory of employment, money and interest kein formales Modell Bedeutung der aggegierten Nachfrage: kurzfristig bestimmt Nachfrage das Produktionsniveau,
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre
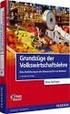 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre Einführung in die Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik von Dr. Hartwig Bartling Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre, Mainz und Dr. Franz Luzius Diplom-Volkswirt
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre Einführung in die Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik von Dr. Hartwig Bartling Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre, Mainz und Dr. Franz Luzius Diplom-Volkswirt
Allgemeine Volkswirtschaftslehre I. Übung 2 - Volkswirtschaftliche Regeln
 Dipl.-WiWi Kai Kohler Wintersemester 2005/2006 Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 03 Tel. 0731 50 24264 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Dipl.-WiWi Kai Kohler Wintersemester 2005/2006 Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 03 Tel. 0731 50 24264 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Zusammenfassung der Vorlesung 1 vom
 Zusammenfassung der Vorlesung 1 vom 19.10.2008 Gegenstand der Makroökonomik ist die Gesamtwirtschaft. Wichtige Indikatoren auf gesamtwirtschaftlicher Ebene sind die Entwicklung von Einkommen, Preisen und
Zusammenfassung der Vorlesung 1 vom 19.10.2008 Gegenstand der Makroökonomik ist die Gesamtwirtschaft. Wichtige Indikatoren auf gesamtwirtschaftlicher Ebene sind die Entwicklung von Einkommen, Preisen und
MATHE-BRIEF. März 2012 Nr. 23 SPIELTHEORIE
 MATHE-BRIEF März 2012 Nr. 23 Herausgegeben von der Österreichischen Mathematischen Gesellschaft http: // www.oemg.ac.at / Mathe Brief mathe brief@oemg.ac.at SPIELTHEORIE Die Spieltheorie beschäftigt sich
MATHE-BRIEF März 2012 Nr. 23 Herausgegeben von der Österreichischen Mathematischen Gesellschaft http: // www.oemg.ac.at / Mathe Brief mathe brief@oemg.ac.at SPIELTHEORIE Die Spieltheorie beschäftigt sich
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT Prüfungsfach: Teilgebiet: Volkswirtschaftslehre Einführung in die Spieltheorie Prüfungstermin: 03.02.2012 Zugelassene Hilfsmittel:
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT Prüfungsfach: Teilgebiet: Volkswirtschaftslehre Einführung in die Spieltheorie Prüfungstermin: 03.02.2012 Zugelassene Hilfsmittel:
Einführung in die Geldtheorie ebook
 Vahlens Kurzlehrbücher Einführung in die Geldtheorie ebook von Otmar Issing 14., wesentlich überarbeitete Auflage Einführung in die Geldtheorie ebook Issing schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de
Vahlens Kurzlehrbücher Einführung in die Geldtheorie ebook von Otmar Issing 14., wesentlich überarbeitete Auflage Einführung in die Geldtheorie ebook Issing schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de
bzw. die Entscheidugen anderer Spieler (teilweise) beobachten Erweitert das Analysespektrum erheblich Beschreibung des Spiels (extensive Form)
 1 KAP 9. Dynamische Spiele Bisher: alle Spieler ziehen simultan bzw. können Aktionen der Gegenspieler nicht beobachten Nun: Dynamische Spiele Spieler können nacheinander ziehen bzw. die Entscheidugen anderer
1 KAP 9. Dynamische Spiele Bisher: alle Spieler ziehen simultan bzw. können Aktionen der Gegenspieler nicht beobachten Nun: Dynamische Spiele Spieler können nacheinander ziehen bzw. die Entscheidugen anderer
1.2 Abgrenzung der Bedürfnisse von Bedarf und Nachfrage Arten und Rangfolge der Bedürfnisse
 1 VOLKSWIRTSCHAFTLICHES UMFELD UND GRUNDLEGENDE ÖKONOMISCHE ZUSAMMENHÄNGE 1.1 Wirtschaftssubjekte im volkswirtschaftlichen Umfeld 1.1.1 Wirtschaftssubjekte Haushalt, Unternehmen und Staat Zusammenfassung
1 VOLKSWIRTSCHAFTLICHES UMFELD UND GRUNDLEGENDE ÖKONOMISCHE ZUSAMMENHÄNGE 1.1 Wirtschaftssubjekte im volkswirtschaftlichen Umfeld 1.1.1 Wirtschaftssubjekte Haushalt, Unternehmen und Staat Zusammenfassung
Kapitel 6 Angebot, Nachfrage und wirtschaftspolitische Maßnahmen Preiskontrollen...124
 Teil I Einführung... Kapitel 1 Zehn volkswirtschaftliche Regeln... Wie Menschen Entscheidungen treffen... Wie Menschen zusammenwirken... Wie die Volkswirtschaft insgesamt funktioniert... Kapitel 2 Volkswirtschaftliches
Teil I Einführung... Kapitel 1 Zehn volkswirtschaftliche Regeln... Wie Menschen Entscheidungen treffen... Wie Menschen zusammenwirken... Wie die Volkswirtschaft insgesamt funktioniert... Kapitel 2 Volkswirtschaftliches
12. Übung Makroökonomischen Theorie
 12. Übung Makroökonomischen Theorie Quelle: Rittenbruch, Makroökonomie, 2000, S. 250. Aufgabe 32 Das IS LM Schemata bietet einen guten Ansatzpunkt, die unterschiedlichen Wirkungen von Änderungen im Gütermarkt
12. Übung Makroökonomischen Theorie Quelle: Rittenbruch, Makroökonomie, 2000, S. 250. Aufgabe 32 Das IS LM Schemata bietet einen guten Ansatzpunkt, die unterschiedlichen Wirkungen von Änderungen im Gütermarkt
NICHTKOOPERATIVE SPIELTHEORIE EINFÜHRUNG. Minimaxlösungen & Gleichgewichte
 NICHTKOOPERATIVE SPIELTHEORIE EINFÜHRUNG Minimaxlösungen & Gleichgewichte Spieltheorie Einführungsbeispiel Gefangenendilemma (Prisoner s Dilemma) Nicht kooperierende Spielteilnehmer Spieler Gefangener
NICHTKOOPERATIVE SPIELTHEORIE EINFÜHRUNG Minimaxlösungen & Gleichgewichte Spieltheorie Einführungsbeispiel Gefangenendilemma (Prisoner s Dilemma) Nicht kooperierende Spielteilnehmer Spieler Gefangener
KAP 1. Normalform Definition Ein Spiel G in Normalform (auch: Strategieform) besteht aus den folgenden 3 Elementen:
 1 KAP 1. Normalform Definition Ein Spiel G in Normalform (auch: Strategieform) besteht aus den folgenden 3 Elementen: 1. Einer Menge von Spielern i I = {1,..., i,...n} 2. Einem Strategienraum S i für jeden
1 KAP 1. Normalform Definition Ein Spiel G in Normalform (auch: Strategieform) besteht aus den folgenden 3 Elementen: 1. Einer Menge von Spielern i I = {1,..., i,...n} 2. Einem Strategienraum S i für jeden
Mikroökonomie 1. Einführung
 Mikroökonomie 1 Einführung 17.09.08 1 Plan der heutigen Vorlesung Was ist die Mikroökonomie Ablauf und Organisation der Lehrveranstaltung Was ist ein ökonomisches Modell? Das Marktmodell als zentrales
Mikroökonomie 1 Einführung 17.09.08 1 Plan der heutigen Vorlesung Was ist die Mikroökonomie Ablauf und Organisation der Lehrveranstaltung Was ist ein ökonomisches Modell? Das Marktmodell als zentrales
Fach Wirtschaft. Kursstufe (vierstündig) Schuleigenes Curriculum. Außerschulische Lernorte (Beispiele) und Methoden
 1. WIRTSCHAFTLICHES HANDELN IM SEKTOR HAUSHALT Knappheit als Grundlage wirtschaftlichen Handelns erkennen; das ökonomische Verhaltensmodell darlegen und die Begriffe Präferenzen und Restriktionen sachgerecht
1. WIRTSCHAFTLICHES HANDELN IM SEKTOR HAUSHALT Knappheit als Grundlage wirtschaftlichen Handelns erkennen; das ökonomische Verhaltensmodell darlegen und die Begriffe Präferenzen und Restriktionen sachgerecht
Ein Gleichnis für die moderne Volkswirtschaft Die Regel vom komparativen Vorteil Anwendungen des Prinzips vom komparativen Vorteil...
 Inhalt Teil I Einführung... 1 Kapitel 1 Zehn volkswirtschaftliche Regeln... 3 Wie Menschen Entscheidungen treffen... 4 Wie Menschen zusammenwirken... 10 Wie die Volkswirtschaft insgesamt funktioniert...
Inhalt Teil I Einführung... 1 Kapitel 1 Zehn volkswirtschaftliche Regeln... 3 Wie Menschen Entscheidungen treffen... 4 Wie Menschen zusammenwirken... 10 Wie die Volkswirtschaft insgesamt funktioniert...
