Aktueller Stand der Hüftendoprothetik mit proximalen knochensparenden Alloplastiken
|
|
|
- Sabine Gerber
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 1 Aus der Orthopädischen Abteilung des St. Marienkrankenhauses, Ludwigshafen (Chefarzt: Prof. Dr. med. M. Menge) - nach einem Vortrag in Baden-Baden 2003 Aktueller Stand der Hüftendoprothetik mit proximalen knochensparenden Alloplastiken Current Concepts of Hip Arthroplasty with Bone Preserving Femoral Implants Key Words: hip replacement aseptic loosening - bone preserving implants TPP TAP BHR Schlüsselwörter: Hüftprothese aseptische Lockerung - diaphysäre Fixation DSP ZAP BHR Summary: Purpose: Prognosis of total hip replacement seems to be excellent for elderly patients. In younger age the outcome is less favourable and early revision is more common. New concepts with better prognosis and preservation of bone stock for possible revisions were needed. Methods: Analysis of failure uncovers the physiological reaction of the proximal femur to stress shielding as the main problem. Implants avoiding bone remodelling caused by load sharing could be favourable to femoral prosthesis with diaphyseal fixation. In a prospective study the first 266 Thrust Plate Prosthesis (TPP) out of 931 (mean age 56,6 (27 78) years), 125 Traction Anchor Prosthesis (TAP) out of 152 (mean age 56,6 (30-73) years), and 215 Metal on Metal Resurfacing Arthroplasties (BHR and Cormet 2000) out of 434 (mean age 56,1 (28 71) years) outcome and complications were studied. Results: The outcome after TPP, TAP (10 years) and Resurfacing arthroplasty (4 years) are favourable to those of stemmed prosthesis and seem to validate the natural history of loosening. Even in consideration of the implant-related risks these implants had a better clinical result and should be preferred to implants with distal fixation. Revision to standard implants was technically simple. Zusammenfassung: Fragestellung: Während die Ergebnisse der konventionellen Endoprothetik beim älteren Patienten gute Ergebnisse zeitigen, bleiben für junge Patienten wegen der deutlich schlechteren Prognose Probleme. Insbesondere der Knochenverlust zum Zeitpunkt einer Revision rechtfertigt die Suche nach Implantaten mit besserem Knochenerhalt über die Zeit. Material und Methode: Die Analyse der aseptischen Lockerungen zeigt, daß die physiologische Anpassungsreaktion des Knochens auf eine unphysiolgische Lasteinleitung meist die primäre Ursache für das Einsetzen des Schadensfalles darstellt. Seit 1991 werden in unserer Abteilung routinemäßig Femurprothesen verwendet, die aufgrund der meta- oder epiphysären Lasteinleitung ein Stress- Shielding vermeiden. In einer prospektiven Studie wurden die ersten 266 Druckscheibenprothesen (DSP) von bis heute 931 (mittleres Alter bei der Operation: 56,6 (27-78) Jahre), 125 Zugankerprothesen (ZAP) von 152 (mittleres Alter: 56,6 (30-73) Jahre) und 234 Oberflächenersatzprothesen mit Metall-Metall-Paarung (BHR und Cormet 2000) von 434 (mittleres Alter 56,1 (28-72) Jahre) verfolgt. Ergebnisse: Im Verlauf über 10 Jahre (DSP und ZAP) bzw. über vier Jahre (Oberflächenersatz mit Metallpaarung nach McMinn) konnte die Bedeutung der knöchernen Anpassungsreaktionen als Hauptursache für die aseptische Lockerung wahrscheinlich gemacht werden. Die knochensparenden Femurimplantate haben sich in der Risikogruppe der jungen Patienten trotz der jeweiligen implantatbezogenen Komplikationsmöglichkeiten im klinischen Ergebnis wie auch in der Standfestigkeit bewährt.
2 2 Einleitung: Der Ersatz des Hüftgelenkes durch eine Endoprothese hat sich zu einem ungemein erfolgreichen Verfahren in der Orthopädie entwickelt. Derzeitige Techniken und Implantate ermöglichen den meist älteren Patienten eine ausreichende Funktionsdauer für die verbleibende Lebensspanne, so daß als Regel gelten kann, daß bei über 65-Jährigen nur etwa 5% noch einer Revision bedürfen. Der subjektive Erfolg des Gelenkersatzes ist ebenfalls meist gut, wenn auch nicht immer ausreichend. Die Ergebnisbewertung anhand von Punktesystemen zeigt gelegentlich eine nicht vollständige Rehabilitation, etwa in Form von früher Ermüdbarkeit, von Anlauf- oder Belastungsschmerzen oder einem nicht wieder vollständig normalisierten Gangbild, die Restbeschwerden sind meist allerdings gering und der Gewinn gegenüber dem vorherigen Zustand ist dramatisch. Mit der Operation wird der Zustand wesentlich gebessert, der Patient aber nicht geheilt. Mit der Linderung der früheren Beschwerden bleibt der Patient für den Rest seines Lebens Patient, denn die Statistiken zeigen, daß mit zunehmender Zeit die Lockerungsrate ansteigt, bei älteren langsamer, bei jüngeren Patienten allerdings dramatisch rascher. In der vielzitierten Schwedenstudie (Malchau et al. 1, werden für Patienten, die zum Zeitpunkt der Operation jünger als 55 Jahre alt waren, Revisionshäufigkeiten bis zu 30% innerhalb der ersten 10 Jahre genannt. Zementfreie Implantate haben die Prognose nicht wesentlich bessern können 1. Für die jungen Patienten erscheinen daher die bisherigen Konzepte nicht ausreichend. Zusätzlich erfahren wir eine Zunahme der Lebenserwartung und einen Anstieg des Anteils älterer Menschen in der Bevölkerung. Mobilität und Selbständigkeit im Alter gewinnen zunehmende Bedeutung. Die Suche nach neuen Konzepten vor allem für unter 65-jährige, aber auch für ältere Patienten mit noch langer Lebenserwartung erscheint damit ausreichend begründet. Die Analyse der Versagensfälle in der genannten Schwedenstudie nach Ursachen nennt die aseptische Lockerung mit über 75% an erster Stelle, Polyäthylenabrieb erscheint erst auf Platz acht der Liste. Auch wenn zum Zeitpunkt der Revision oft multiple Veränderungen an den Implantaten und den knöchernen Strukturen des Implantatlagers gefunden werden, lohnt sich doch die Frage, weshalb es trotz der ausgefeilten Operationstechniken, den optimierten Implantatgrößen und der Güte der verwendeten Materialien zu einer aseptischen Lockerung kommen kann und welche primäre Ursache für das Scheitern der dauerhaften Integration verantwortlich ist. Da zementfreie Schaftprothesen die Prognose nicht wesentlich verbessern, erscheint die sog. Partikelkrankheit durch Abriebprodukte weder als primäre noch als alleinige Ursache der Lockerung für wahrscheinlich. Verfügt man über regelmäßige Röntgenkontrollen des Gelenkes (wie es in den sog. Prothesenpässen vorgeschrieben wird 2 ), sind vor der klinisch apparenten Lockerung charakteristische Änderungen erkennbar. Von größter Bedeutung sind die natürlichen Reaktionsweisen des Knochens auf die veränderten mechanischen Bedingungen. In der Entwicklung der Endoprothetik des proximalen Femur ging aus technischen und biologischen Problematiken die Entwicklung vom Knorpelersatz ( Resurfacing ) zum proximalen Femurersatz mit Verankerung eines Prothesenstieles in der Femurdiaphyse. Ist es im Bereich der Mechanik durchaus praktikabel, bei Zerstörung von Verbindungen die gelenktragenden Strukturen durch Anschlußstücke zu ersetzen, kann dies im Bereich der knöchernen Strukturen zu Problemen führen. Knochen reagiert als lebendes Gewebe auf gesteigerte Druckbelastung mit Hypertrophie, auf Entlastung mit Atrophie. So folgt den geänderten Belastungsformen nach Einsetzen einer Hüftprothese sehr oft eine Strukturanpassung mit für die Prothetik ungünstigen Folgen: In den druckentlasteten Abschnitten wird der Knochen entsprechend dem Wolff schen Gesetz 3 atrophieren, in den Zonen des Lastüberganges von der Prothese auf den Knochen können
3 3 Anpassungshypertrophien beobachtet werden. Bereits 1973 berichteten Charnley und Cupic 4 über Resorptionen des Calcar bei 42,5% ihrer Hüftpatienten. Oh und Harris 5 wiesen den Verlust der natürlichen Last im proximalen Femur anhand von Messungen mit Dehnungsmessstreifen am Leichenfemur nach und empfahlen einen großen Prothesenkragen mit gutem Kontakt zum Calcar, der in ihren Versuchen etwa 30 bis 40% der Originallast wiederherstellen konnte. Eigene vergleichende Untersuchungen an sonst identischen Prothesen mit und ohne Kragen zeigten im Mittel bei den Kragenprothesen einen besseren Erhalt der proximalen knöchernen Strukturen als bei den kragenlosen, wobei allerdings der Effekt des Kragens nicht mit Sicherheit vorhersagbar war 6. Ein Kragen konnte den Knochenverlust verringern, oft war er aber wirkungslos. Dieser als Stress-Shielding bekannte Effekt birgt langfristig Gefahren für die Stabilität der Prothese: Das coxale Femurende mit den Trochanteren und den dazwischen liegenden Bereichen der Corticalis dient als Ansatzpunkt wesentlicher Anteile der hüftübergreifenden Muskulatur. Vermindern sich in diesem Bereich die Druckbelastungen durch den Kurzschluß der Last über den Prothesenstiel, wird physiologischerweise eine Anpassung an die neuen Bedingungen in Form einer Demineralisierung eintreten. Druckentlasteter Knochen wird weicher und elastischer, bei bestimmten Belastungsformen, wie etwa dem Aufstehen vom Sitzen oder dem Treppensteigen, verformt sich dieser weiche Zugknochen leichter und wird um die starre Prothese torquiert: Saumbildungen um den proximalen Prothesenschaft sind die Folge (Abbildungen links). Klinisch können sich die Reibungseffekte einer solchen teilgelockerten Prothese 7,8 als Impingement-Syndrom mit den berüchtigten Symptomen Oberschenkelschmerz, Anlaufschmerzen und Duchenne-Hinken manifestieren. Aber auch das Phänomen des Stielbruchs wird dadurch leicht erklärt: Die durch das Stress-Shielding (und bei zementierter Endoprothetik durch die Fremdkörperreaktion beschleunigte) fortschreitende Saumbildung nach distal erreicht dann irgendwann den Abschnitt des sich verjüngenden Prothesenstiels, dessen Querschnitt für die Wechsellast nicht mehr stabil genug ist. Als Folge treten die Stielbrüche auf. Nicht der Zement und der Zementdetritus waren die primäre Ursache für das Versagen der Endoprothese, sondern die biologische Strukturänderung des Knochens als Folge der geänderten biomechanischen Belastung. Bei zementierten Schäften führt zusätzlich die Bindegewebsreaktion auf Zementdetritus zu den katastrophalen Zerstörungen der Knochensubstanz, die die Revision extrem erschweren können (Abb. rechts). Aus welchen Gründen diese knöchernen Anpassungsveränderungen nicht gesetzmäßig bei jedem Patienten auftreten, ist unbekannt. Möglicherweise sind genetisch verankerte Reaktionsformen des individuellen Knochens dafür verantwortlich, so daß nur etwa in einem Drittel der Fälle auffallende klinische und radiologische Veränderungen im Sinne der Anpassungsreaktionen (Bone Remodelling) zu beobachten sind.
4 Zusammenfassend kann verkürzt formuliert werden, daß die aseptische Lockerung primär die physiologische Folge einer unphysiologischen Prothese darstellt. Als Folgerung sollte versucht werden, den Weg von den langen Stielen umzukehren und zu den proximalen Fixationsmethoden zurückzukehren. Knochensparende Alloplastiken? 4 In den letzten Jahren wurden zunehmend Femurimplantate eingeführt, deren herausragendes Merkmal im Sparen von Knochen, also der Verminderung des Resektatvolumens bestehen soll. Bei genauer Betrachtung spart allenfalls der Oberflächenersatz (Kappenprothese): Hier werden der ganze Schenkelhals und Teile des Hüftkopfes belassen und für den Fall eines notwendigen Wechsels bleibt das proximale Femur komplett erhalten. Der konstruktive Aufbau der anderen knochensparenden Prothesen mit Schenkelhals und Kugelkopf erfordert in der Regel die gleiche Resektionshöhe wie die der konventionellen Schaftprothesen. Da das Drehzentrum des natürlichen Hüftkopfes außerhalb der Pfanneneingangsebene liegt und alloplastischer Hüftkopf und Konus der Prothese den gleichen Raum beanspruchen wie entsprechende Abschnitte einer Standardprothese, führt ein Belassen eines Schenkelhalsstumpfes ohne Medialisierung des Rotatationszentrums unweigerlich zu einer Erhöhung des Offset und der Beinlänge. Lediglich der rudimentäre Stiel dieser Implantate reicht nicht soweit in den ohnehin knöchern nicht ausgefüllten Markraum unterhalb des Trochanter minor hinein, so daß die Last tatsächlich proximal in das Femur eingeleitet und die schädlichen Auswirkungen des Bone Remodel-
5 5 ling gemindert werden. Auch die häufig verwendete Bezeichnung Schenkelhalsprothese ist irreführend: Nicht der Schenkelhals wird endoprothetisch ersetzt, sondern der Hüftkopf; Teile des Schenkelhalses werden allerdings teilweise belassen und dienen neben der intertrochantären Femurregion zur Fixierung der Prothese. Besser wäre daher die Unterscheidung in epiphysär oder metaphysär fixierte Femurprothesen, um die Abgrenzung zu den eher diaphysär verankerten längerstieligen Schaftprothesen zu verdeutlichen. Wenn also, abgesehen von den erst in geringem Ausmaß wiederbelebten Kappenprothesen, Knochen nicht gespart wird: Warum die Diskussion um diese vermeintlich knochensparenden neuen Implantate? Im Grunde ist die Zielrichtung eine andere: Nicht der operationsbedingte Knochenverlust soll durch die sog. knochensparenden Schenkelhalsprothesen reduziert werden, sondern die normalen biomechanischen Gegebenheiten des proximalen Femur sollen erhalten bleiben. Für denjenigen, der Schlagworte bevorzugt, sollte es also heißen: Biomimetische Prothesen sind gefragt, solche also, die sich möglichst unauffällig in den physiologischen Kräftefluss des Hüftgelenkes einfügen und so die Biomechanik des Lastübergangs auf den proximalen Femur möglichst wenig verändern. Nach dem Scheitern der epiphysär fixierten Kappenprothese nach Wagner wurden verschiedene metaphysär verankerte Femurprothesen entwickelt. Dem ersten dieser Implantate, der Druckscheibenprothese von 1978, folgten in den letzten Jahren eine ganze Reihe weiterer metaphysärer Implantate: Zugankerprothese (ZAP), Cigar, Stemfree, Mayo, Cut oder CFP heißen die neuen Produkte, um nur die bekanntesten Formen zu nennen. Wir haben wegen nicht zufriedenstellender Ergebnisse nach Stielprothesen 1991 begonnen, Prothesentypen zu verwenden, die durch zwangsweise proximal lastübertragenden Konstruktionen das Stress-Shielding vermeiden sollen und können über 10- jährige Erfahrungen nach DSP und ZAP sowie über erste vierjährige Erfahrungen mit dem Oberflächenersatz nach McMinn berichten. Druckscheibenprothese nach Huggler und Jacob: Wenn man von lokalen Exoten, wie der Kappenprothese von Wiles oder der Kliefoth-Prothese absieht, war die erste Femurprothese mit metaphysärer Fixation die Druckscheibenprothese (DSP) nach Huggler und Jacob 9 (linkes Foto). Sie wurde bereits 1978 konzipiert, aber erst nach 15-jähriger Testphase ab 1993 zur allgemeinen Verwendung freigegeben. Die DSP besitzt keinen Stiel und der Lastübergang muß daher proximal erfolgen (Abb. unten). Über unsere Erfahrungen mit der DSP haben wir bereits wiederholt berichtet 10. Seit Anfang 1991 verfügen wir über 12-jährige Erfahrungen mit 931 Implantationen. Prospektiv wurden die ersten 266 Implantationen verfolgt, wobei das Durchschnittsalter dieser Gruppe bei 65,5 (27 78) Jahren lag. Im Wesentlichen haben sich die bereits veröffentlichten Ergebnisse nicht geändert und wir verwenden die DSP als Sonderimplantat für junge Patienten weiterhin mit gutem Erfolg. Hervorzuheben ist die gute Anwendbarkeit bei Deformitäten des proximalen Femur 10. Die 10-Jahres-Revisionsrate liegt unter der Lockerungsquote anderer Systeme für vergleichbare Risikogruppen und die Versorgungsqualität wird subjektiv als gut emp-
6 funden. Die DSP weist allerdings einige implantat-bedingte Probleme auf: So ist die Lernkurve für den Anwender sehr flach und bei seltenerer Anwendung wird die Gefahr einer nicht eintretenden knöchernen Integration der Prothese im metaphysären Femur größer. In unserer Abteilung fanden wir eine durchschnittliche Revisionsquote von 4,1%, was für ein Implantat in der Risikogruppe der jungen Patienten (s. Schwedenstudie) schon deswegen zu tolerieren ist, weil ein etwaiger Wechsel auf ein Standardimplantat problemlos möglich ist. Die meisten dieser Revisionen wurden nicht wegen einer Lockerung, sondern wegen einer nicht eingetretenen knöchernen Integration erforderlich. Allerdings konnten wir in der eigenen Abteilung auch nachweisen, daß bei erfahreneren Operateuren die Revisionsquote auf unter drei Prozent sinken kann, während Anfänger wesentlich häufiger mit dem Problem der nicht eintretenden sekundären (ossären) Integration konfrontiert werden. In der Aufklärung wird auf das Problem einer eventuell ausbleibenden knöchernen Integration hingewiesen und wir empfehlen die Druckscheibenprothese bei Patienten unter 65 Jahren als das Implantat vor der Prothese. Als weitere implantat-bedingte Nachteile sehen wir die seltenen Frakturen im distalen Schraubenloch der Lasche und vor allem die protrahierte Rehabilitationsdauer mit teilweise länger bestehenden Restbeschwerden: Ein Harris-Score von 90 Punkten und darüber wird im Mittel erst nach zwei Jahren erreicht (Abb. rechts). Bis dahin bestehen relativ häufig noch Restbeschwerden, die gemeinhin mit dem Schlagwort Laschenschmerz belegt werden: Untersucht man die Patienten genauer, handelt es sich meist um eine Insertionstendopathie am Trochanter major. Nur wenige Patienten verspüren einen umschriebenen Schmerz am Ort des meist nicht tastbaren Laschenkopfes. Zugankerprothese nach Nguyen: 6 Die Zugankerprothese (ZAP) verdankt ihre Entstehung der ursprünglich unzureichenden Größenauswahl der DSP. Insbesondere bei Hüftdysplasien sind der Schenkelhals und das proximale Femur oft so klein, daß die damals verfügbare kleinste Größe nicht eingesetzt werden konnte. Die ZAP entstand aus einer Ableitung unserer gekürzten Standardprothese vom Typ SI, die eine zentrale Bohrung durch den Konus und Prothesenkörper erhielt, durch die ein im Konus klemmfixierter Schraubbolzen mit einer durch die laterale Kortikalis über einen Zuganker gegengeschraubten
7 Schraubhülse primär stabil fixiert wurde. Eine distale Osteointegration sollte durch eine gestufte Beschichtung anfänglich mit Hydroxylapatit, später mit Titanplasmaspray, verhindert werden. Insgesamt wurden 152 ZAP bei Patienten mit einem Durchschnittsalter von 56,6 (30 73) Jahren eingesetzt. Auch hier haben wir bei den ersten 125 Patienten eine prospektive Studie durchgeführt 11. Das Röntgenbild zeigt eine ZAP 8 Jahre postoperativ, Die rechte Grafik stellt den Verlauf der klinischen Rehabilitation in Form des Harris-Scores dar. Trotz weitgehend identischer Ergebnisse wie nach Implantation der DSP haben wir die ZAP wieder weitgehend verlassen, nachdem kleinere Modelle der DSP verfügbar wurden, die konstruktionsgemäß weniger weit in den Markraum reichten und daher dem Ziel der nur metaphysären Fixation näher kamen. Andere metaphysäre Femurprothesen: 7 Verschiedene Neuentwicklungen wurden bereits erwähnt. Teilweise sind diese Implantate bereits wieder verschwunden, wie z.b. die StemFree-Prothese. Bei dieser zur DSP konkurrierenden Entwicklung sollte das Laschenproblem durch eine Versenkung des Kopfes des Schraubbolzens und der entsprechenden Aufnahme in der lateralen Lasche in das Femur verringert werden, die dazu notwendige schwächere Dimensionierung des Bolzens bereitete jedoch technische Probleme. Überraschend schnell wurde auch die Schenkelhalsprothese Cigar verlassen, nachdem anfangs viele positive Frühberichte veröffentlicht wurden. Offenbar bereitete die stabile spongiöse Fixation Schwierigkeiten, denn viele Implantate wurden varisch und in einem zu hohen Prozentsatz wurde über persistierende Schmerzen geklagt. Offizielle Angaben zum Grund des Rückzuges vom Markt sind nicht zu erhalten. Damit teilt dies Verfahren das Schicksal mit vielen Operationsmethoden, die zu ihrer Einführung Kongresse beherrschen und dann einfach verschwinden. Abgelöst wurde die Cigar durch die CUT 2000, eine ebenfalls metallspongiös strukturierte Kurzprothese, die allerdings keine laterale Durchbrechung der lateralen Corticalis mit Schraubenfixierung benötigt und daher in der Form eher der Mayo-Prothese ähnelt. Problematisch erscheint aber vor allem die zementfreie Fixation dieser kurzen Prothesen im spongiösen intertrochantären Femur: Öfter bleiben Schmerzzustände bestehen, so daß auch knöchern fest eingewachsene Prothesen revidiert werden müssen. Die weiteren Ergebnisse der Pilotkliniken und die Bestätigung durch unabhängige Anwender sollten abgewartet werden, bevor die breite Verwendung empfohlen werden kann. Auch die CFP- (collum femoris preserving) Prothese besitzt einen kurzen Stiel, soll aber vornehmlich im Schenkelhals festwerden und erscheint daher wegen des vergrößerten Offsets und der zwangsläufigen Beinverlängerung problematisch. Langzeitergebnisse stehen für diese Prothese ebenfalls noch aus. Die Mayo-Prothese nach Murray hat wie die DSP eine langjährige Pilotphase in der Entwicklerklinik hinter sich. Zwar sind die Funktionsergebnisse nach Harris aus dem Vertriebsprospekt (im Jahr 2003) kaum nachvollziehbar, aber in jüngster Zeit wurde über hervorragende Ergebnisse berichtet 12. Da Frühergebnisse schon oft täuschten, sollte der weitere Verlauf vor breiter Anwendung beobachtet werden. Eine neue Ableitung der DSP stellt die Spiron-Prothese dar, die ebenfalls den Erhalt eines Teiles oder gar des ganzen Schenkelhalses verlangt. Die möglichen Auswirkungen auf Offset und Bein-
8 länge wurden bereits erwähnt. Die erst zweijährigen Erfahrungen aus der Pilotklinik klingen erfolgversprechend 13. Für alle diese Prothesen gilt, daß eine Verwendung in besonderen Fällen unter Abwägung implantatbezogener Risiken gerechtfertigt erscheint, daß aber noch keine Daten vorliegen, die eine kritiklose breite Anwendung rechtfertigen würden und daß daher abgewogen werden muß, ob nicht doch die Verwendung eines Implantates mit bekannten Risiken vorzuziehen sei. Weitere Lösungsansätze mit Stiel und proximalen Strukturen zur Krafteinleitung sollen hier nur am Rand erwähnt werden: Als Übergang der reinen metaphysären Implantate zu den Stielprothesen seien der S-ROM- und der Merion-Schaft (Röntgenbild rechts) genannt. Renaissance des Oberflächenersatzes: Die Flucht nach vorne stellt die Wiedereinführung des tatsächlich knochensparenden Oberflächenersatzes am Hüftgelenk dar. Der Oberflächenersatz nach Wagner und der anderer Autoren mit Verwendung der Gleitpaarung Metall bzw. Keramik gegen PE scheiterte bereits sehr früh an der sog. Partikelkrankheit durch Fremdkörperreaktion nach PE-Abrieb 14. Der Abrieb stammte dabei zum größten Teil aus der PE- Zement-Grenzschicht der Pfanne (Abb. rechts). Eine Lösung des Problems könnte die Wiedereinführung der Metall-Metall-Artikulation (MoM) sein. 8 McMinn 15 begann 1991 mit der klinischen Erprobung und gab nach den positiven Erfahrungen der ersten Jahre das Implantat zur allgemeinen Verwendung frei. Wir haben 1999 die ersten Operationen durchgeführt können nach vier Jahren und 450 Implantationen von Oberflächenprothesen vom Typ BHR bzw. Cormet 2000 bei Patienten mit einem Durchschnittsalter von 56,1 (28 71) Jahren erste vorsichtige Schlüsse ziehen: Die schon bei der Wagner-Kappe gefürchteten Komplikationen der postoperativen Schenkelhalsfraktur und der deutlich selteneren Hüftkopfnekrose kommen naturgemäß unabhängig von der Metall-Metall-Gleitpaarung vor, wobei die Häufigkeiten dieser Versagensfälle mit ca. 1% bzw. 0,25% sowohl in der Aufklärung erwähnt wie auch im postoperativen Regime berücksichtigt werden sollten (kein Krafttraining innerhalb der ersten sechs Wochen!). Die Lockerungsrate der Pressfit-Pfanne gleicht derjenigen der zementfreien Mo-
9 delle im konventionellen Sektor. Auffällig waren in unserer Serie die schnelle Rehabilitation und eine hohe Funktionalität. Ein Harris- Score in unserem prospektiven Kollektiv von 90 Punkten wurde bereits nach sechs Monaten erreicht, so daß dieses Implantat in unserer Abteilung die anderen knochensparenden Prothesenmodelle anteilsmäßig bereits zurückgedrängt hat. Langzeiterfahrungen auf breiter Basis stehen aber noch aus, so daß auch diese Prothesen noch nicht als evidenzbasiert bezeichnet werden können. Zumindest die Kurzzeitergebnisse und die gute Revisionsfähigkeit lassen die implantatbedingten Risiken (Schenkelhalsfraktur, Hüftkopfnekrose, Metallabrieb, gelegentliches Quietschen im ersten postoperativen Jahr) bei jungen Patienten als vertretbar erscheinen, zumal ein Rückzug auf die metaphysär fixierten Prothesen immer noch möglich ist und so auch langfristig Versorgungsmöglichkeiten erhalten bleiben. Da das Verfahren nur die Oberflächen ersetzt und gesunde Knochenstrukturen erfordert, sind die Einsatzmöglichkeiten enger eingegrenzt als bei z. B. der DSP oder den anderen metaphysären Femurprothesen. Diskussion: 9 Die Ergebnisse nach DSP und ZAP dürfen nach über 10 jähriger Verwendung als gesichert gelten. Die Standzeiten können mit den veröffentlichten Daten zementfreier diaphysär fixierter Femurimplantate nicht ganz konkurrieren, da ein 10-Jahres-Überleben von 95% zwar in erfahrenen Abteilungen, aber wohl kaum bei nur gelegentlicher Anwendung erreicht werden kann. Würde man nur entsprechende Risikokollektive vergleichen, erscheinen die beiden Implantate aber schon deswegen konkurrenzfähig, weil ein eventuell notwendiger Wechsel leicht mit einem Standardimplantat durchgeführt werden kann. Insofern sollte bei unter 60-jährigen Patienten immer geprüft werden, ob die Gesamtprognose durch primären Einsatz einer metaphysären Prothese mit entsprechend gesicherter 10-Jahresprognose nicht doch sinnvoll ist: Der Einsatz der bewährten Standardprothese wird zumindest in das sicherere Alter verschoben. Sekundäre Lockerungen einer DSP durch das Bone Remodelling waren bei uns selten, so daß für die knöchern integrierten Prothesen mit einer langen Standzeit gerechnet werden kann. Nach 10 Jahren kamen eher die auch sonst zu beobachtenden Probleme, wie Pfannenverschleiß oder -lockerung, zur Beobachtung. Nachteilig ist auf jeden Fall die im Vergleich zu zementierten Prothesen längere Rehabilitationsphase, erkennbar an dem nur langsamen Anstieg des Harris-Hip-Scores. Aber auch zementfreie Stielprothesen weisen solche langen Rehabilitationsphasen auf, so daß wir bei unter 60-jährigen Patienten eigentlich keine Indikation für eine Stielprothese sehen und evidenzbasierte metaphysäre Femurprothesen auch weiterhin vorziehen werden. Die Mayo-Prothese weist eine ähnlich lange Erprobungsphase auf, so daß trotz der etwas unglücklichen Darstellung der klinischen Ergebnisse im Herstellerprospekt möglicherweise die Indikation ähnlich wie bei der DSP und der ZAP gesehen werden kann. Wir haben keine eigenen Erfahrungen mit diesem Implantat, so daß wir auch keine Empfehlungen aussprechen können. Zwar verständlich, aber noch nicht durch Resultate gestützt ist für uns der zunehmend vom Patienten geäußerte Wunsch nach einem Oberflächenersatz. Die Wagner-Cup wies nach sieben Jahren eine Revisionsquote von fast 50% auf, so daß eine gewisse Vorsicht trotz des Verzichts auf Polyäthylenkomponenten angebracht wäre. Die nach unserer Erfahrung etwas zu optimistischen Angaben des Autors über seine 10-Jahres-Erfahrungen mögen auf eine strengere Indikationsstellung beruhen,
10 10 werden allerdings durch das Gutachten des National Institute for Clinical Excellence 16 gestützt. Wir haben die alten Probleme der Schenkelhalsfraktur trotz peinlichem Vermeiden einer Kortikalisverletzung am Schenkelhals ( Notching ) und der sekundären Hüftkopfnekrose unter der Kappe erneut erfahren. Möglicherweise können durch eine sehr sorgfältige Patientenauswahl, eine entsprechend zurückhaltende Nachbehandlung und eine angepasste Rehabilitation diese Probleme umgangen werden. Metallabrieb tritt zwangsläufig in messbarer Weise auf, einige Patienten berichten auch über ein gelegentliches Quietschen, das allerdings meist innerhalb des ersten Jahres verschwindet. Die Untersuchungen an den McKee-Farrar- und Ring-Prothesen aus den 70-er Jahren haben keine erhöhte Morbidität durch Kobalt- oder Chrom-Ionen nachweisen können 17. Auffallend ist die schnelle Rehabilitation, eine allgemeine Eigenschaft von im Femurbereich zementierten Prothesen. In unserer Abteilung nimmt der Metall-Metall-Oberflächenersatz trotz noch fehlender Daten unabhängiger Anwender auf Wunsch der Patienten zunehmenden Raum ein und wir werden, wie bei der DSP und der ZAP, das prospektive Kollektiv weiter verfolgen und die Daten zu gegebener Zeit mitteilen. Literatur: 1 Malchau, M, P Herberts, P Södermann, A Oden: Prognosis of Total Hip Replacement. Handout at the 67th Annual Meeting of the AAOS, Orlando, Menge, M: Nachkontrollen nach Endoprothesenoperationen: Sinn und Aufgabe eines Endoprothesenpasses. Orthop. Praxis 26, 447-9, Wolff, J: Das Gesetz der Transformation der Knochen. Hirschwald, Berlin, Charnley, J, Z Cupic: The Nine and Ten Year Results of the Low-Friction Arthroplasty of the Hip. Clin Orthop 95, 9-25, Oh, I, WH Harris: Proximal Strain Distribution in the Loaded femur. JBJS 60-A, 75-85, Menge, M, C Storck: Zum Verhalten des Calcar femoris nach Implantation einer Prothese mit und ohne Kragen. In HG Willert, F Keuck (Hrsg.): Neuere Ergebnisse in der Osteologie. Springer, Stuttgart, 1989, Menge, M, B Maaz, U Textor: Design of Femoral Stem and Early Results of Cementless Hip Replacement: Comparison of Different Principles of Fixation. In: Buchhorn, GH und H-G Willert (Hrsg): Technical Principles, Design and Safety of Joint Implants. Hogrefe und Huber, Göttingen, 1994, Menge, M. B Maaz, B Lisiak: Komplikationen nach Implantation des zementfreien Titanschaftes nach ZWEYMÜLLER. Z. Orthop. 123, 648-9, Huggler, AH, HAC Jacob (Eds.): The Thrust Plate Hip Prosthesis. Springer, Berlin, Heidelberg, Menge, M: Acht Jahre Druckscheibenendoprothese eine mittelfristige Bewertung. Orthop. Praxis, 36, , Kern, C, M Menge: Die Zugankerprothese - vier Jahre klinische Erfahrungen. Orthop. Praxis 34, 401-3, Krüger, T, R Hube, W Hein: Das zementfreie Mayo-hip-System erste Erfahrungen mit einer proximalmulti-point Verankerung des Prothesenschaftes Birkenhauer: Spiron-Prothese. Pers. Mitteilung 14 Bell, RS, J Schatzker, VL Fornasier, SB Goodman: A Study of Implant Failure in the Wagner Resurfacing Arthroplasty. JBJS 67-A, , McMinn, D, R Treacy, K Lin, P Pynswent: Metal on Metal Surface Replacement of the hip. Clin Orthop 1996, NHS: Appraisal No. 44 des National Institute für Clinical Excellence Visuri, T, E Pukkala, P Paavolainen, EB Riska: Cancer Risk after metal on metal and polyethylene on metal total hip arthroplasty. Clin Orthop 1996, Suppl. 329, Der Autor dankt Herrn L. Knorn, Bonn, für die Anfertigung der Zeichnungen, Herrn PD Dr. Gruber für das Foto von Huggler und Jacob.
Schenkelhalsendoprothese
 Leitthema Orthopäde 2007 36:347 352 DOI 10.1007/s00132-007-1070-y Online publiziert: 30. März 2007 Springer Medizin Verlag 2007 C. Stukenborg-Colsman Orthopädische Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover
Leitthema Orthopäde 2007 36:347 352 DOI 10.1007/s00132-007-1070-y Online publiziert: 30. März 2007 Springer Medizin Verlag 2007 C. Stukenborg-Colsman Orthopädische Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover
SP-CL Anatomisch angepasstes Hüft-System, zementfrei
 SP-CL Anatomisch angepasstes Hüft-System, zementfrei +++ Verkaufsstart Februar 2015 +++ Verkaufsstart Februar 2015 +++ The most important advancement in total hip arthroplasty in the last 50 years has
SP-CL Anatomisch angepasstes Hüft-System, zementfrei +++ Verkaufsstart Februar 2015 +++ Verkaufsstart Februar 2015 +++ The most important advancement in total hip arthroplasty in the last 50 years has
Rund um das künstliche Hüftgelenk
 Rund um das künstliche Hüftgelenk Praxis für Orthopädie Dr. med. Karl Biedermann Facharzt FMH für orthopädische Chirurgie Central Horgen Seestrasse 126 CH 8810 Horgen Tel. 044 728 80 70 info@gelenkchirurgie.ch
Rund um das künstliche Hüftgelenk Praxis für Orthopädie Dr. med. Karl Biedermann Facharzt FMH für orthopädische Chirurgie Central Horgen Seestrasse 126 CH 8810 Horgen Tel. 044 728 80 70 info@gelenkchirurgie.ch
*smith&nephew. Patienteninformation. NANOS Kurzschaftendoprothese für die Hüfte
 *smith&nephew Patienteninformation NANOS Kurzschaftendoprothese für die Hüfte Was ist Arthrose? Arthrose bezeichnet den allmählichen Verschleiß der Gelenkoberflächen, d.h. die schützende Knorpelschicht
*smith&nephew Patienteninformation NANOS Kurzschaftendoprothese für die Hüfte Was ist Arthrose? Arthrose bezeichnet den allmählichen Verschleiß der Gelenkoberflächen, d.h. die schützende Knorpelschicht
Stellungnahme von Prof. Winter zur BHR = "McMinn-Prothese - Stand Mai 2016 EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung Friedrichshafen-Bodensee
 1 Herzlich Willkommen auf unserer Homepage und vielen Dank für Ihr Interesse! Die Einführung neuer orthopädisch-chirurgischer Techniken ist immer eine Herausforderung für die Gemeinschaft der orthopädischen
1 Herzlich Willkommen auf unserer Homepage und vielen Dank für Ihr Interesse! Die Einführung neuer orthopädisch-chirurgischer Techniken ist immer eine Herausforderung für die Gemeinschaft der orthopädischen
Philosophie und Ergebnisse des optimys Kurzschaftes
 Tops und Flops in der Orthopädie Philosophie und Ergebnisse des optimys Kurzschaftes ÖGO Symposium Velden, 21. 22.08.2015 22.08.2015 Dr. med. Karl Philipp Kutzner Wiesbaden Kurzschäfte im Joho OP TIME
Tops und Flops in der Orthopädie Philosophie und Ergebnisse des optimys Kurzschaftes ÖGO Symposium Velden, 21. 22.08.2015 22.08.2015 Dr. med. Karl Philipp Kutzner Wiesbaden Kurzschäfte im Joho OP TIME
Endoprothetik, Arthroskopische Operationen, Minimal-invasive Wirbelsäulenchirurgie, Fußchirurgie
 Endoprothetik, Arthroskopische Operationen, Minimal-invasive Wirbelsäulenchirurgie, Fußchirurgie Patienteninformation Das künstliche Hüftgelenk Allgemeines Das Hüftgelenk wird weltweit am häufigsten künstlich
Endoprothetik, Arthroskopische Operationen, Minimal-invasive Wirbelsäulenchirurgie, Fußchirurgie Patienteninformation Das künstliche Hüftgelenk Allgemeines Das Hüftgelenk wird weltweit am häufigsten künstlich
Warum einen Zahn ziehen, wenn man ihn auch überkronen kann
 Patienteninformation Oberflächenersatz am Hüftgelenk n. McMinn Der Oberflächenersatz am Hüftgelenk ist eine knochenschonende Alternative zur konventionellen Versorgung ihres Hüftleidens. Oberflächenersatz
Patienteninformation Oberflächenersatz am Hüftgelenk n. McMinn Der Oberflächenersatz am Hüftgelenk ist eine knochenschonende Alternative zur konventionellen Versorgung ihres Hüftleidens. Oberflächenersatz
Der interessante Fall: Standardchaos?
 AWMF-Arbeitskreis Ärzte und Juristen Tagung 15./16.11.2013 in Bremen Der interessante Fall: Standardchaos? Dr. iur. Volker Hertwig 1 Patientin: 67 Jahre alt Diagnose: Coxathrose rechts Therapie: Hüft-TEP
AWMF-Arbeitskreis Ärzte und Juristen Tagung 15./16.11.2013 in Bremen Der interessante Fall: Standardchaos? Dr. iur. Volker Hertwig 1 Patientin: 67 Jahre alt Diagnose: Coxathrose rechts Therapie: Hüft-TEP
z STANDARDENDOPROTHESE
 Hüftendoprothesen z 47 z STANDARDENDOPROTHESE Eine 67-jährige Patientin berichtet... Als ich zum ersten Mal Schmerzen in meinen Hüftgelenken hatte, war ich ungefähr 57 Jahre alt. Im Verlauf der dann folgenden
Hüftendoprothesen z 47 z STANDARDENDOPROTHESE Eine 67-jährige Patientin berichtet... Als ich zum ersten Mal Schmerzen in meinen Hüftgelenken hatte, war ich ungefähr 57 Jahre alt. Im Verlauf der dann folgenden
Einsatz von Hüft-Totalendoprothesen. Patienteninformation
 Einsatz von Hüft-Totalendoprothesen Patienteninformation Liebe Patientin, lieber Patient, seit Monaten, teilweise seit Jahren, klagen Sie über immer wiederkehrende Schmerzen im Hüftgelenk, wobei diese
Einsatz von Hüft-Totalendoprothesen Patienteninformation Liebe Patientin, lieber Patient, seit Monaten, teilweise seit Jahren, klagen Sie über immer wiederkehrende Schmerzen im Hüftgelenk, wobei diese
Das bionische Hüftendoprothesensystem J. Scholz, W. Thomas
 177 Das bionische Hüftendoprothesensystem J. Scholz, W. Thomas Bionische Systeme versuchen, Beobachtungen aus der Natur in technische Lösungen umzusetzen. Dieser Grundgedanke war auch bei der Konzeption
177 Das bionische Hüftendoprothesensystem J. Scholz, W. Thomas Bionische Systeme versuchen, Beobachtungen aus der Natur in technische Lösungen umzusetzen. Dieser Grundgedanke war auch bei der Konzeption
Standards moderner Hüftendoprothetik
 Standards moderner Hüftendoprothetik Stephanie Verhoeven Oberärztin in der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum Ruhr-Universität Bochum Coxarthrose
Standards moderner Hüftendoprothetik Stephanie Verhoeven Oberärztin in der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum Ruhr-Universität Bochum Coxarthrose
ist auch immer sinnvoll Die Indikation zur Endoprothese
 Das Mögliche M ist auch immer sinnvoll Die Indikation zur Endoprothese Matthias Zurstegge Orthopädische Klinik - Zentrum für f r Gelenkersatz Asklepios Stadtklinik Bad TölzT Das Mögliche M ist auch immer
Das Mögliche M ist auch immer sinnvoll Die Indikation zur Endoprothese Matthias Zurstegge Orthopädische Klinik - Zentrum für f r Gelenkersatz Asklepios Stadtklinik Bad TölzT Das Mögliche M ist auch immer
Es beginnt in der Leiste: Verschleiß des Hüftgelenks
 Es beginnt in der Leiste: Verschleiß des Hüftgelenks WAZ-Nachtforum Medizin, Bochum, 13. Oktober 2011 Prof. Dr. Rüdiger Smektala Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Universitätsklinikum ität ik
Es beginnt in der Leiste: Verschleiß des Hüftgelenks WAZ-Nachtforum Medizin, Bochum, 13. Oktober 2011 Prof. Dr. Rüdiger Smektala Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Universitätsklinikum ität ik
Definition. Zeichnung: Hella Maren Thun, Grafik-Designerin Typische Ursachen
 Definition Der Oberschenkelknochen besteht aus vier Anteilen: dem Kniegelenk, dem Schaft, dem Hals und dem Kopf, der zusammen mit dem Beckenknochen das Hüftgelenk bildet. Bei einem Oberschenkelhalsbruch
Definition Der Oberschenkelknochen besteht aus vier Anteilen: dem Kniegelenk, dem Schaft, dem Hals und dem Kopf, der zusammen mit dem Beckenknochen das Hüftgelenk bildet. Bei einem Oberschenkelhalsbruch
Was ist ein Kniegelenkersatz? Abb.: Gesundes Kniegelenk
 Was ist ein Kniegelenkersatz? Aufbau des Kniegelenks. Abb.: Gesundes Kniegelenk Wenn wir gehen, uns strecken oder beugen, ist unser größtes Gelenk aktiv das Kniegelenk. Es stellt die bewegliche Verbindung
Was ist ein Kniegelenkersatz? Aufbau des Kniegelenks. Abb.: Gesundes Kniegelenk Wenn wir gehen, uns strecken oder beugen, ist unser größtes Gelenk aktiv das Kniegelenk. Es stellt die bewegliche Verbindung
Information zu Ihrer Hüft-Operation. Kurzschaft
 Information zu Ihrer Hüft-Operation Kurzschaft Wie funktioniert unsere Hüfte? Das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk und das zweitgrößte Gelenk im menschlichen Körper. Der Oberschenkel - knochen und das Becken
Information zu Ihrer Hüft-Operation Kurzschaft Wie funktioniert unsere Hüfte? Das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk und das zweitgrößte Gelenk im menschlichen Körper. Der Oberschenkel - knochen und das Becken
Die Hüftprothese Warum? Wann? Wie? Und danach?
 Die Hüftprothese Warum? Wann? Wie? Und danach? Wann wird die Indikation zur Hüftprothese gestellt? Die Implantation einer Hüftprothese ist heute ein Routineeingriff. Ihnen wurde geraten, sich ein künstliches
Die Hüftprothese Warum? Wann? Wie? Und danach? Wann wird die Indikation zur Hüftprothese gestellt? Die Implantation einer Hüftprothese ist heute ein Routineeingriff. Ihnen wurde geraten, sich ein künstliches
Das künstliche Hüftgelenk
 Traumatologisch- Orthopädisches Zentrum West des St. Elisabeth Krankenhauses Geilenkirchen Das künstliche Hüftgelenk Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, Dr. med. Achim Dohmen, Chefarzt der Klinik
Traumatologisch- Orthopädisches Zentrum West des St. Elisabeth Krankenhauses Geilenkirchen Das künstliche Hüftgelenk Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, Dr. med. Achim Dohmen, Chefarzt der Klinik
Orthopädengemeinschaft Amberg-Sulzbach
 Hüft-TEP Hüft-Total-Endo-Prothese Ersatz des abgenützten oder funktionsgestörten Hüftgelenkes Hüftgelenkarthrose Künstliches Hüftgelenk Lieber Patient/in, sie leiden an einer Hüftgelenkarthrose. Hierbei
Hüft-TEP Hüft-Total-Endo-Prothese Ersatz des abgenützten oder funktionsgestörten Hüftgelenkes Hüftgelenkarthrose Künstliches Hüftgelenk Lieber Patient/in, sie leiden an einer Hüftgelenkarthrose. Hierbei
Hüfttotalprothesen. Prof. Dr. med. K. A. Siebenrock. Universitätsklinik für Orthopädische Chirurgie & Traumatologie Inselspital Bern
 Hüfttotalprothesen! Prof. Dr. med. K. A. Siebenrock Universitätsklinik für Orthopädische Chirurgie & Traumatologie Inselspital Bern Kontakt: klaus.siebenrock@insel.ch Zukunft Demographie in Europa Anteil
Hüfttotalprothesen! Prof. Dr. med. K. A. Siebenrock Universitätsklinik für Orthopädische Chirurgie & Traumatologie Inselspital Bern Kontakt: klaus.siebenrock@insel.ch Zukunft Demographie in Europa Anteil
Hüftgelenkersatz (Hüft-TEP) Individuelle Versorgung durch die richtige Implantatwahl
 Orthopädische Universitätsklinik Essen Klinik und Poliklinik für Orthopädie u. Evangelisches Krankenhaus Werden Direktor Prof. Dr. med. F. A. Löer Fachinformation: Hüftgelenkersatz (Hüft-TEP) Individuelle
Orthopädische Universitätsklinik Essen Klinik und Poliklinik für Orthopädie u. Evangelisches Krankenhaus Werden Direktor Prof. Dr. med. F. A. Löer Fachinformation: Hüftgelenkersatz (Hüft-TEP) Individuelle
Zurück in ein aktives Leben
 Zurück in ein aktives Leben Der künstliche Hüftgelenkersatz Erstinformation Die gesunde Hüfte Die Hüfte verbindet den Oberschenkelknochen mit der Hüftpfanne im Beckenknochen. Der Hüftkopf am oberen Ende
Zurück in ein aktives Leben Der künstliche Hüftgelenkersatz Erstinformation Die gesunde Hüfte Die Hüfte verbindet den Oberschenkelknochen mit der Hüftpfanne im Beckenknochen. Der Hüftkopf am oberen Ende
Gelenkersatz bei der Coxarthrose des jungen Patienten
 Gelenkersatz bei der Coxarthrose des jungen Patienten Akhil P. Verheyden Ortenauklinikum Lahr - Ettenheim Klinik für Unfall- Orthopädische- und Wirbelsäulenchirurgie Zur Ergänzung Bexis Unterlagen Zimmer
Gelenkersatz bei der Coxarthrose des jungen Patienten Akhil P. Verheyden Ortenauklinikum Lahr - Ettenheim Klinik für Unfall- Orthopädische- und Wirbelsäulenchirurgie Zur Ergänzung Bexis Unterlagen Zimmer
Das neue Hüftgelenk. Hinweise und Tipps für Patienten KLINIKUM WESTFALEN
 KLINIKUM WESTFALEN Das neue Hüftgelenk Hinweise und Tipps für Patienten Klinikum Westfalen GmbH Knappschaftskrankenhaus Dortmund www.klinikum-westfalen.de Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
KLINIKUM WESTFALEN Das neue Hüftgelenk Hinweise und Tipps für Patienten Klinikum Westfalen GmbH Knappschaftskrankenhaus Dortmund www.klinikum-westfalen.de Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
Langzeitergebnisse mit dem zementfreien Link Hüftprothesensystem Rippenschaft L. Bause, H. Thabe
 Langzeitergebnisse mit dem zementfreien Link Hüftprothesensystem Rippenschaft L. Bause, H. Thabe 241 Die Langzeitkomplikationen der zementierten Hüftendoprothetik und die Verschiebung der Indikationsgrenzen
Langzeitergebnisse mit dem zementfreien Link Hüftprothesensystem Rippenschaft L. Bause, H. Thabe 241 Die Langzeitkomplikationen der zementierten Hüftendoprothetik und die Verschiebung der Indikationsgrenzen
Die individuelle Hüfte CT3D-A G. Aldinger, P. R. Aldinger
 247 Die individuelle Hüfte CT3D-A G. Aldinger, P. R. Aldinger In der Hüftendoprothetik ist die Anzahl der Hüftschäfte nahezu unüberschaubar. Es werden unterschiedlichste Verankerungsarten diskutiert, die
247 Die individuelle Hüfte CT3D-A G. Aldinger, P. R. Aldinger In der Hüftendoprothetik ist die Anzahl der Hüftschäfte nahezu unüberschaubar. Es werden unterschiedlichste Verankerungsarten diskutiert, die
Komplexe Kniechirurgie 2012, München
 Sitzung 3: Fallbeispiele H. Graichen Asklepios Orthopedic Clinic Lindenlohe Sylt Barmbek (Hamburg) Falkenstein Ini Hannover Lindenlohe Patient 1 Anamnese: 84jährige Frau, Vor 14 Jahren Knie-TEP, lange
Sitzung 3: Fallbeispiele H. Graichen Asklepios Orthopedic Clinic Lindenlohe Sylt Barmbek (Hamburg) Falkenstein Ini Hannover Lindenlohe Patient 1 Anamnese: 84jährige Frau, Vor 14 Jahren Knie-TEP, lange
Gesicherte Indikation, Aufklärung, Vorbereitung, Dokumentation
 Gesicherte Indikation, Aufklärung, Vorbereitung, Dokumentation Dietmar Pierre König IQN 63. Fortbildungsveranstaltung - Hüftendoprothetik Primärendoprothetik - Anamnese - Klinische Untersuchung - Labordiagnostik
Gesicherte Indikation, Aufklärung, Vorbereitung, Dokumentation Dietmar Pierre König IQN 63. Fortbildungsveranstaltung - Hüftendoprothetik Primärendoprothetik - Anamnese - Klinische Untersuchung - Labordiagnostik
Prof. Dr. med. E. Winter Hüftprothesen-Wechsel-OP - Stand 2010 2220102009
 Seite 1 In Deutschland werden pro Jahr ca. 180.000 künstliche Hüftgelenke implantiert. Die Langzeit-Haltbarkeit der modernen Hüft-Prothesensysteme und die Zufriedenheit der betroffenen Patienten sind jeweils
Seite 1 In Deutschland werden pro Jahr ca. 180.000 künstliche Hüftgelenke implantiert. Die Langzeit-Haltbarkeit der modernen Hüft-Prothesensysteme und die Zufriedenheit der betroffenen Patienten sind jeweils
2. Jahreskongress der Deutschen Kniegesellschaft November 2013, Hamburg
 Klinikum rechts der Isar 2. Jahreskongress der Deutschen Kniegesellschaft 29. 30. November 2013, Hamburg Periprothetische Frakturen des Kniegelenkes Indikationen zum Knie TEP-Wechsel R. von Eisenhart-Rothe,
Klinikum rechts der Isar 2. Jahreskongress der Deutschen Kniegesellschaft 29. 30. November 2013, Hamburg Periprothetische Frakturen des Kniegelenkes Indikationen zum Knie TEP-Wechsel R. von Eisenhart-Rothe,
Case-Report K. Perner
 421 Case-Report K. Perner Fall 1: Als Folge einer OS-Fraktur in der Jugend kam es beim Patienten zu einer bajonettförmigen Deformierung des rechten Femurs im proximalen Drittel. Die daraus resultierende
421 Case-Report K. Perner Fall 1: Als Folge einer OS-Fraktur in der Jugend kam es beim Patienten zu einer bajonettförmigen Deformierung des rechten Femurs im proximalen Drittel. Die daraus resultierende
Prof. Dr. med. E. Winter / BHR = McMinn-Prothese / Stand Nov. 2012 1
 Prof. Dr. med. E. Winter / BHR = McMinn-Prothese / Stand Nov. 2012 1 Schaftbasierte Hüftendoprothesen (z.b. Bicontact, Zweymüller und CLS ) zeigen sehr gute Standzeiten > 90% nach 15-20 Jahren. Jedoch:
Prof. Dr. med. E. Winter / BHR = McMinn-Prothese / Stand Nov. 2012 1 Schaftbasierte Hüftendoprothesen (z.b. Bicontact, Zweymüller und CLS ) zeigen sehr gute Standzeiten > 90% nach 15-20 Jahren. Jedoch:
der Größen ein großer Schritt nach vorne. Die durchschnittliche Oberflächenrauigkeit wurde von 1 auf 5 µm angehoben.
 Die konsekutive ausschließliche Verwendung eines rechteckigen Geradschaftes bei Primärimplantation. Minimum 10-Jahres-Ergebnisse. M. Steindl, K. Zweymüller 305 Im Jahre 1979 wurde die 1. Generation der
Die konsekutive ausschließliche Verwendung eines rechteckigen Geradschaftes bei Primärimplantation. Minimum 10-Jahres-Ergebnisse. M. Steindl, K. Zweymüller 305 Im Jahre 1979 wurde die 1. Generation der
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Langfristige Ergebnisse der Druckscheibenprothese
 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Lehrstuhl für Orthopädie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf Klinikum Bad Bramstedt Direktor: Prof. Dr. med. Wolfgang Rüther Langfristige Ergebnisse der Druckscheibenprothese
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Lehrstuhl für Orthopädie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf Klinikum Bad Bramstedt Direktor: Prof. Dr. med. Wolfgang Rüther Langfristige Ergebnisse der Druckscheibenprothese
Die gesunde Hüfte. Hüftgelenkverschleiß - Individuelle Hüftgelenkprothese - Kurzschaftprothese - Prothese im höheren Lebensalter
 In der Chirurgischen Klinik des St. Martinus Hospitals wird der Schwerpunkt Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie angeboten. Dazu zählt ein umfassendes Spektrum an endoprothetischen Eingriffen. Hierbei
In der Chirurgischen Klinik des St. Martinus Hospitals wird der Schwerpunkt Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie angeboten. Dazu zählt ein umfassendes Spektrum an endoprothetischen Eingriffen. Hierbei
Erfahrungsbericht über 2 Jahre Anwendung des Kurzschafts Optimys
 180 WISSENSCHAFT / RESEARCH Originalarbeit / Original Article S. Mai 1, D. Bosson 2, W. Hein 3, N. Helmy 4, J. Pfeil 5, W. E. Siebert 1 Erfahrungsbericht über 2 Jahre Anwendung des Kurzschafts Optimys
180 WISSENSCHAFT / RESEARCH Originalarbeit / Original Article S. Mai 1, D. Bosson 2, W. Hein 3, N. Helmy 4, J. Pfeil 5, W. E. Siebert 1 Erfahrungsbericht über 2 Jahre Anwendung des Kurzschafts Optimys
Standards in der Knieendoprothetik
 Standards in der Knieendoprothetik Dr. Lukas Niggemann Ltd. Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum Ruhr-Universität Bochum Gonarthrose
Standards in der Knieendoprothetik Dr. Lukas Niggemann Ltd. Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum Ruhr-Universität Bochum Gonarthrose
Der Oberschenkelhalsbruch
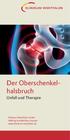 KLINIKUM WESTFALEN Der Oberschenkelhalsbruch Unfall und Therapie Klinikum Westfalen GmbH Hellmig-Krankenhaus Kamen www.klinikum-westfalen.de Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, ich freue mich
KLINIKUM WESTFALEN Der Oberschenkelhalsbruch Unfall und Therapie Klinikum Westfalen GmbH Hellmig-Krankenhaus Kamen www.klinikum-westfalen.de Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, ich freue mich
REVISION HTEP Prinzipien. ÖGO Ausbildungsseminar Endoprothetik
 REVISION HTEP Prinzipien ÖGO Ausbildungsseminar Endoprothetik 17.-18.11.2010 REVISION HTEP - Allgemein Statistik: USA; 2005 208.600 HTEPs/Jahr 2030 572.000 HTEPs/Jahr 52% unter 65 Jahren USA; 2005 40.800
REVISION HTEP Prinzipien ÖGO Ausbildungsseminar Endoprothetik 17.-18.11.2010 REVISION HTEP - Allgemein Statistik: USA; 2005 208.600 HTEPs/Jahr 2030 572.000 HTEPs/Jahr 52% unter 65 Jahren USA; 2005 40.800
Die anatomische Rekonstruktion des Hüftgelenks: ein Vergleich von Kurz- und Standardschaft
 46 Die anatomische Rekonstruktion des Hüftgelenks: ein Vergleich von Kurz- und Standardschaft Anatomic Reconstruction of Hip Joint Biomechanics: Conventional vs. Short-Stem Prosthesis Autoren C. Ries 1,
46 Die anatomische Rekonstruktion des Hüftgelenks: ein Vergleich von Kurz- und Standardschaft Anatomic Reconstruction of Hip Joint Biomechanics: Conventional vs. Short-Stem Prosthesis Autoren C. Ries 1,
Wenn die Hüfte schmerzt..
 Wenn die Hüfte schmerzt.. von der Spreizhose bis zur Hüftprothese Dr. W. Cordier Chefarzt der Orthopädischen Klinik St. Josef - Wuppertal - Zentrum für Orthopädie und Rheumatologie Spreizhose Hüftprothese
Wenn die Hüfte schmerzt.. von der Spreizhose bis zur Hüftprothese Dr. W. Cordier Chefarzt der Orthopädischen Klinik St. Josef - Wuppertal - Zentrum für Orthopädie und Rheumatologie Spreizhose Hüftprothese
HÜFTENDOPROTHETIK PATIENTENINFORMATION ENDOPROTHETIKZENTRUM AM ST. MARIEN-HOSPITAL HAMM. Ein Unternehmen der
 ENDOPROTHETIKZENTRUM AM ST. MARIEN-HOSPITAL HAMM HÜFTENDOPROTHETIK PATIENTENINFORMATION Ein Unternehmen der www.marienhospital-hamm.de KATH. ST.-JOHANNES GESELLSCHAFT DORTMUND ggmbh Kranken- und Pflegeeinrichtungen
ENDOPROTHETIKZENTRUM AM ST. MARIEN-HOSPITAL HAMM HÜFTENDOPROTHETIK PATIENTENINFORMATION Ein Unternehmen der www.marienhospital-hamm.de KATH. ST.-JOHANNES GESELLSCHAFT DORTMUND ggmbh Kranken- und Pflegeeinrichtungen
BoneMaster. Nano-kristalline HA-Beschichtung
 BoneMaster Nano-kristalline HA-Beschichtung BoneMaster Von der Natur inspiriert BoneMaster ist eine hochentwickelte, biomimetische Beschichtungtechnologie (1), die das Einwachsverhalten von zementfreien
BoneMaster Nano-kristalline HA-Beschichtung BoneMaster Von der Natur inspiriert BoneMaster ist eine hochentwickelte, biomimetische Beschichtungtechnologie (1), die das Einwachsverhalten von zementfreien
KORREKTUR DER BEINACHSE ZUR BALANCIERUNG DER BELASTUNG BEI ÜBERLASTUNG DER INNENSEITE AM KNIEGELENK
 KORREKTUR DER BEINACHSE ZUR BALANCIERUNG DER BELASTUNG BEI ÜBERLASTUNG DER INNENSEITE AM KNIEGELENK SYMPTOME Sie spüren schon seit längerem Ihr Kniegelenk nach grösseren Belastungen. Das orthopädische
KORREKTUR DER BEINACHSE ZUR BALANCIERUNG DER BELASTUNG BEI ÜBERLASTUNG DER INNENSEITE AM KNIEGELENK SYMPTOME Sie spüren schon seit längerem Ihr Kniegelenk nach grösseren Belastungen. Das orthopädische
Zementiert oder zementfrei
 ORTHOPÄDISCHE UNIVERSITÄTSKLINIK OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG MEDIZINISCHE FAKULTÄT Direktor: Prof. Dr. med. H.W. Neumann Zementiert oder zementfrei Medizinische und/oder ökonomische Aspekte?
ORTHOPÄDISCHE UNIVERSITÄTSKLINIK OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG MEDIZINISCHE FAKULTÄT Direktor: Prof. Dr. med. H.W. Neumann Zementiert oder zementfrei Medizinische und/oder ökonomische Aspekte?
Definition. Entsprechend der Anatomie des Oberarms kann der Bruch folgende vier Knochenanteile betreffen: = Schultergelenkanteil des Oberarms
 Definition Die proximale Humerusfraktur ist ein Bruch des schulternahen Oberarmknochens, der häufig bei älteren Patienten mit Osteoporose diagnostiziert wird. Entsprechend der Anatomie des Oberarms kann
Definition Die proximale Humerusfraktur ist ein Bruch des schulternahen Oberarmknochens, der häufig bei älteren Patienten mit Osteoporose diagnostiziert wird. Entsprechend der Anatomie des Oberarms kann
Knie-Totalendoprothesen- Erstimplantation und Knie-Endoprothesenwechsel und - komponentenwechsel. S. Kirschner
 Knie-Totalendoprothesen- Erstimplantation und Knie-Endoprothesenwechsel und - komponentenwechsel S. Kirschner Ergebnisse in Qualitätsindikatoren Knietotalendoprothesen-Erstimplantation Knieendoprothesenwechsel
Knie-Totalendoprothesen- Erstimplantation und Knie-Endoprothesenwechsel und - komponentenwechsel S. Kirschner Ergebnisse in Qualitätsindikatoren Knietotalendoprothesen-Erstimplantation Knieendoprothesenwechsel
Der zementierte anatomische OPTAN-Schaft Jahre Nachuntersuchung
 Unfallchirurgisch-Orthopädische Klinik Stadtklinik Baden-Baden Ltd.Arzt:Prof.Dr.L.Rabenseifner Der zementierte anatomische OPTAN-Schaft -1-55 Jahre Nachuntersuchung - Anatomische Voraussetzungen Anatomische
Unfallchirurgisch-Orthopädische Klinik Stadtklinik Baden-Baden Ltd.Arzt:Prof.Dr.L.Rabenseifner Der zementierte anatomische OPTAN-Schaft -1-55 Jahre Nachuntersuchung - Anatomische Voraussetzungen Anatomische
Zurück in ein. Der künstliche Kniegelenkersatz Erstinformation
 Zurück in ein akt ives Leben Der künstliche Kniegelenkersatz Erstinformation Das gesunde Knie Das Knie verbindet den Oberschenkel- mit dem Schienbeinknochen. Die sich zugewandten Enden der beiden Knochen
Zurück in ein akt ives Leben Der künstliche Kniegelenkersatz Erstinformation Das gesunde Knie Das Knie verbindet den Oberschenkel- mit dem Schienbeinknochen. Die sich zugewandten Enden der beiden Knochen
Muskuloskelettale Konsequenzen von erheblichem Übergewicht
 Muskuloskelettale Konsequenzen von erheblichem Übergewicht 6. Arthrosetag der Deutschen Rheumaliga DKOU-Kongress,Berlin, 28.-31.10.2014 F. Botero Einleitung Body-mass-Index (BMI) = Gewicht (kg) Körpergröße
Muskuloskelettale Konsequenzen von erheblichem Übergewicht 6. Arthrosetag der Deutschen Rheumaliga DKOU-Kongress,Berlin, 28.-31.10.2014 F. Botero Einleitung Body-mass-Index (BMI) = Gewicht (kg) Körpergröße
HÜFTKONZEPT FÜR DEN VORDEREN, MINIMALINVASIVEN ZUGANG
 HÜFTKONZEPT FÜR DEN VORDEREN, MINIMALINVASIVEN ZUGANG KONZEPT Kombination schonendster Operationstechnik mit modernster Lagerungshilfe Minimalinvasiver, anteriorer Zugang unter Verwendung des RotexTable
HÜFTKONZEPT FÜR DEN VORDEREN, MINIMALINVASIVEN ZUGANG KONZEPT Kombination schonendster Operationstechnik mit modernster Lagerungshilfe Minimalinvasiver, anteriorer Zugang unter Verwendung des RotexTable
MEDIAN Orthopädische Klinik Braunfels
 Qualitätspartner der PKV PARTNER Privaten der Verband Krankenversicherung e.v. I L A TÄT U & EIGENDARSTELLUNG DES HAUSES: MEDIAN Orthopädische Klinik Braunfels Fachklinik für Orthopädie und Orthopädische
Qualitätspartner der PKV PARTNER Privaten der Verband Krankenversicherung e.v. I L A TÄT U & EIGENDARSTELLUNG DES HAUSES: MEDIAN Orthopädische Klinik Braunfels Fachklinik für Orthopädie und Orthopädische
Evidence-based Medicine (EBM) der Vorderen. Kreuzband Rekonstruktion. Indikation, Technik, Rehabilitation
 Evidence-based Medicine (EBM) der Vorderen Kreuzband Rekonstruktion - Indikation, Technik, Rehabilitation Zusammenfassung des gleichlautenden Vortrags im Rahmen des Ausbildungsseminars Sportorthopädie
Evidence-based Medicine (EBM) der Vorderen Kreuzband Rekonstruktion - Indikation, Technik, Rehabilitation Zusammenfassung des gleichlautenden Vortrags im Rahmen des Ausbildungsseminars Sportorthopädie
Operation Wann ist eine Operation angezeigt? Welche Optionen hat der Patient? b) Das künstliche Hüft-Gelenk
 Operation Wann ist eine Operation angezeigt? Welche Optionen hat der Patient? b) Das künstliche Hüft-Gelenk Dr. med. Frank Klufmöller Breitenbachplatz 21 Rüdesheimer Str. 43 14195 Berlin 14197 Berlin 030
Operation Wann ist eine Operation angezeigt? Welche Optionen hat der Patient? b) Das künstliche Hüft-Gelenk Dr. med. Frank Klufmöller Breitenbachplatz 21 Rüdesheimer Str. 43 14195 Berlin 14197 Berlin 030
KAPITEL 8 VON12. Rehabilitation. Der erste Tag:
 Der erste Tag: Rehabilitation Versuchen Sie, sich im Bett aufzurichten und bewegen Sie die Beine, wie es Ihnen gezeigt wurde, um den Kreislauf zu aktivieren. Am Vormittag wird ein Physiotherapeut mit Ihnen
Der erste Tag: Rehabilitation Versuchen Sie, sich im Bett aufzurichten und bewegen Sie die Beine, wie es Ihnen gezeigt wurde, um den Kreislauf zu aktivieren. Am Vormittag wird ein Physiotherapeut mit Ihnen
Klinische und radiologische Langzeitergebnisse mit dem zementfreien Zweymüller-Alloclassic Schaft A. Grübl, C. Chiari, M. Gruber
 Klinische und radiologische Langzeitergebnisse mit dem zementfreien Zweymüller-Alloclassic Schaft A. Grübl, C. Chiari, M. Gruber 299 Die Entwicklung des rechteckigen Geradschafts nach Zweymüller begann
Klinische und radiologische Langzeitergebnisse mit dem zementfreien Zweymüller-Alloclassic Schaft A. Grübl, C. Chiari, M. Gruber 299 Die Entwicklung des rechteckigen Geradschafts nach Zweymüller begann
Mobil das Leben genießen
 Mobil das Leben genießen Die Hüfte eine Problemzone im höheren Alter: Erkrankungen und Verletzungen im Hüftbereich stellen ein großes Problem bei älter werdenden Menschen dar. Natürliche Abnützungserscheinungen
Mobil das Leben genießen Die Hüfte eine Problemzone im höheren Alter: Erkrankungen und Verletzungen im Hüftbereich stellen ein großes Problem bei älter werdenden Menschen dar. Natürliche Abnützungserscheinungen
Femoroacetabuläres Impingement
 Femoroacetabuläres Impingement 1. Einführung 2. Krankheitsbilder 3. Anatomie 4. Leistenschmerz 5. FAI Femoroacetabuläres Impingement 5.1 Formen 5.1.1 Cam - Impingement 5.1.2 Pincer - Impingement 5.2 Ursachen
Femoroacetabuläres Impingement 1. Einführung 2. Krankheitsbilder 3. Anatomie 4. Leistenschmerz 5. FAI Femoroacetabuläres Impingement 5.1 Formen 5.1.1 Cam - Impingement 5.1.2 Pincer - Impingement 5.2 Ursachen
"7. Berliner Arthrose-Informationstag"
 "7. Berliner Arthrose-Informationstag" Hüftprothese Wann und Welche für Wen? Dr. med. Johannes Michels Montag, 29. März 2010 von 18:00 bis ca. 20:00 Uhr im Ludwig Erhard Haus Fasanenstr. 85, 10623 Berlin
"7. Berliner Arthrose-Informationstag" Hüftprothese Wann und Welche für Wen? Dr. med. Johannes Michels Montag, 29. März 2010 von 18:00 bis ca. 20:00 Uhr im Ludwig Erhard Haus Fasanenstr. 85, 10623 Berlin
Patienteninformation. Ihr neues Hüftgelenk
 Patienteninformation Ihr neues Hüftgelenk Inhalt dieser Broschüre Der Aufbau des Hüftgelenke s 4 Gründe für den Hüftgelenke rsatz 5 Das künstliche Hüftgelenk 7 Die Operation 9 Nachbehandlung und mögli
Patienteninformation Ihr neues Hüftgelenk Inhalt dieser Broschüre Der Aufbau des Hüftgelenke s 4 Gründe für den Hüftgelenke rsatz 5 Das künstliche Hüftgelenk 7 Die Operation 9 Nachbehandlung und mögli
NANOS Kurzschaftprothese P. Ettinger
 211 NANOS Kurzschaftprothese P. Ettinger Die totale Hüftendoprothetik (HTEP) wird seit etwa Anfang 1950 durchgeführt. So stellte bereits 1959 Sir John Charnley fest, dass eine metallische Femurkomponente
211 NANOS Kurzschaftprothese P. Ettinger Die totale Hüftendoprothetik (HTEP) wird seit etwa Anfang 1950 durchgeführt. So stellte bereits 1959 Sir John Charnley fest, dass eine metallische Femurkomponente
Das künstliche Hüftgelenk
 Das künstliche Hüftgelenk Orthopädie Untere Extremitäten Liebe Patientin, lieber Patient Die Hüfttotalprothese zur Behandlung der schmerzhaften Hüftarthrose ist eine der erfolgreichsten Operationen. Vor
Das künstliche Hüftgelenk Orthopädie Untere Extremitäten Liebe Patientin, lieber Patient Die Hüfttotalprothese zur Behandlung der schmerzhaften Hüftarthrose ist eine der erfolgreichsten Operationen. Vor
Sport nach großen Gelenkeingriffen Rehabilitation und Prävention von Kreuzbandrissen. 20. Pauwels-Symposium
 20. Pauwels-Symposium Sport nach großen Gelenkeingriffen Rehabilitation und Prävention von Kreuzbandrissen Freitag, 6. November 2015 Konferenzzentrum der AGIT, Aachen Liebe Kolleginnen und Kollegen, verbesserte
20. Pauwels-Symposium Sport nach großen Gelenkeingriffen Rehabilitation und Prävention von Kreuzbandrissen Freitag, 6. November 2015 Konferenzzentrum der AGIT, Aachen Liebe Kolleginnen und Kollegen, verbesserte
Lukas Niggemann. Arthrosetag Lebensqualität im Zentrum ärztlicher Überlegungen Moderne Endoprothetik des Kniegelenkes
 Knie-Totalendoprothese Lebensqualität im Zentrum ärztlicher Überlegungen Moderne Endoprothetik des Kniegelenkes Arthrosetag 2011 Lukas Niggemann Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie Universitätsklinikum
Knie-Totalendoprothese Lebensqualität im Zentrum ärztlicher Überlegungen Moderne Endoprothetik des Kniegelenkes Arthrosetag 2011 Lukas Niggemann Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie Universitätsklinikum
Navigierte Endoprothetik an Hüfte und Kniegelenk
 Was gibt es Neues: Navigiertes Operieren in der Unfallchirurgie Trauma Berufskrankh 2009 11[Suppl 1]:44 48 DOI 10.1007/s10039-008-1426-5 Online publiziert: 25. Februar 2009 Springer Medizin Verlag 2009
Was gibt es Neues: Navigiertes Operieren in der Unfallchirurgie Trauma Berufskrankh 2009 11[Suppl 1]:44 48 DOI 10.1007/s10039-008-1426-5 Online publiziert: 25. Februar 2009 Springer Medizin Verlag 2009
Künstlicher Hüftgelenksersatz
 Künstlicher Hüftgelenksersatz Künstlicher Hüftgelenksersatz Was ist eine Hüftgelenk-Arthrose? Das Hüftgelenk ist eine bewegliche Verbindung zwischen dem Becken- und dem Oberschenkelknochen. Die am Gelenk
Künstlicher Hüftgelenksersatz Künstlicher Hüftgelenksersatz Was ist eine Hüftgelenk-Arthrose? Das Hüftgelenk ist eine bewegliche Verbindung zwischen dem Becken- und dem Oberschenkelknochen. Die am Gelenk
Optimierungspotentiale für das Einwachsverhalten lasttragender Implantate in Knochengewebe
 Optimierungspotentiale für das Einwachsverhalten lasttragender Implantate in Knochengewebe Eine strukturierte, biomechanische Analyse regenerativer und adaptiver Fähigkeiten des Knochens Von Thomas S.
Optimierungspotentiale für das Einwachsverhalten lasttragender Implantate in Knochengewebe Eine strukturierte, biomechanische Analyse regenerativer und adaptiver Fähigkeiten des Knochens Von Thomas S.
Minimal-invasive Chirurgie und Gelenkersatz
 Minimal-invasive Chirurgie und Gelenkersatz Viele chirurgische Eingriffe können heute durch kleine Schnitte ( Knopfloch-Techniken ) durchgeführt werden; neben kosmetischen Vorteilen resultieren meist kürzere
Minimal-invasive Chirurgie und Gelenkersatz Viele chirurgische Eingriffe können heute durch kleine Schnitte ( Knopfloch-Techniken ) durchgeführt werden; neben kosmetischen Vorteilen resultieren meist kürzere
Das künstliche. Hüftgelenk. Patienten-Informations-Broschüre.
 Das künstliche Hüftgelenk Patienten-Informations-Broschüre www.mein-gelenkersatz.com www.orthopaedie-leitner.at www.kh-herzjesu.at Editorial Liebe Leserin, lieber Leser Diese Broschüre wurde für Patienten,
Das künstliche Hüftgelenk Patienten-Informations-Broschüre www.mein-gelenkersatz.com www.orthopaedie-leitner.at www.kh-herzjesu.at Editorial Liebe Leserin, lieber Leser Diese Broschüre wurde für Patienten,
Umstellungsosteotomien an der kindlichen Hüfte
 7. OP AN Pflegetag & 12. Steri Fach Forum, Klinikum Großhadern, 15. März 2016 Umstellungsosteotomien an der kindlichen Hüfte unter besonderer Berücksichtigung der Beckenosteotomien Instrumentarium Knochengrundsieb
7. OP AN Pflegetag & 12. Steri Fach Forum, Klinikum Großhadern, 15. März 2016 Umstellungsosteotomien an der kindlichen Hüfte unter besonderer Berücksichtigung der Beckenosteotomien Instrumentarium Knochengrundsieb
Knochenstruktur und Alter - zwei wichtige Faktoren in der Osteoporose-Therapie
 Knochenstruktur und Alter - zwei wichtige Faktoren in der Osteoporose-Therapie Dr. Ortrun Stenglein-Gröschel Orthopädin, Osteologin DVO Osteologisches Schwerpunktzentrum Coburg (Deutschland) Der Anteil
Knochenstruktur und Alter - zwei wichtige Faktoren in der Osteoporose-Therapie Dr. Ortrun Stenglein-Gröschel Orthopädin, Osteologin DVO Osteologisches Schwerpunktzentrum Coburg (Deutschland) Der Anteil
Fitmore Hüftschaft. Produktinformation. Inspiriert von der individuellen Anatomie
 Fitmore Hüftschaft Produktinformation Inspiriert von der individuellen Anatomie 2 Fitmore Hüftschaft Produktinformation Haftungsausschluss Diese Broschüre richtet sich ausschließlich an Ärzte und dient
Fitmore Hüftschaft Produktinformation Inspiriert von der individuellen Anatomie 2 Fitmore Hüftschaft Produktinformation Haftungsausschluss Diese Broschüre richtet sich ausschließlich an Ärzte und dient
Das künstliche Kniegelenk
 Das künstliche Kniegelenk M. Vonderschmitt 17. Juni 2009 Das künstliche Kniegelenk Erstoperation Wechseloperation Umwandlungsoperation Komplikationsmanagement Fragen? Das künstliche Kniegelenk Angesichts
Das künstliche Kniegelenk M. Vonderschmitt 17. Juni 2009 Das künstliche Kniegelenk Erstoperation Wechseloperation Umwandlungsoperation Komplikationsmanagement Fragen? Das künstliche Kniegelenk Angesichts
Langzeitergebnisse mit dem Corail -Schaft basierend auf den Erfahrungen der Artro-Gruppe über einen Zeitraum von 15 Jahren J-P.
 Langzeitergebnisse mit dem Corail -Schaft basierend auf den Erfahrungen der Artro-Gruppe über einen Zeitraum von 15 Jahren J-P. VidaIain 283 Vor 15 Jahren wurde der Corail -Schaft zum ersten Mal implantiert.
Langzeitergebnisse mit dem Corail -Schaft basierend auf den Erfahrungen der Artro-Gruppe über einen Zeitraum von 15 Jahren J-P. VidaIain 283 Vor 15 Jahren wurde der Corail -Schaft zum ersten Mal implantiert.
Das künstliche Kniegelenk: Schlitten- oder Totalendoprothese
 Das künstliche Kniegelenk: Schlitten- oder Totalendoprothese PD Dr. med. Lutz Arne Müller Zeitlicher Ablauf Knieprothese 4-6 Wochen vor Operation: Aufklärung Orthopäde / Terminfestlegung 2 Wochen vor Operation:
Das künstliche Kniegelenk: Schlitten- oder Totalendoprothese PD Dr. med. Lutz Arne Müller Zeitlicher Ablauf Knieprothese 4-6 Wochen vor Operation: Aufklärung Orthopäde / Terminfestlegung 2 Wochen vor Operation:
Vertebroplastie, Kyphoplastie und Lordoplastie
 Vertebroplastie, Kyphoplastie und Lordoplastie Allgemeines Mit zunehmendem Alter werden die Wirbelkörper brüchiger. Dabei kann es bereits bei geringer Krafteinwirkung wie brüskes Absitzen zum Bruch eines
Vertebroplastie, Kyphoplastie und Lordoplastie Allgemeines Mit zunehmendem Alter werden die Wirbelkörper brüchiger. Dabei kann es bereits bei geringer Krafteinwirkung wie brüskes Absitzen zum Bruch eines
In Fehlstellung verheilter femoraler Slope nach distaler Femurfraktur Gelenkersatz versus Gelenkerhalt
 In Fehlstellung verheilter femoraler Slope nach distaler Femurfraktur Gelenkersatz versus Gelenkerhalt N. Südkamp, M. Feucht Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Femoraler Slope...? Femoraler Slope
In Fehlstellung verheilter femoraler Slope nach distaler Femurfraktur Gelenkersatz versus Gelenkerhalt N. Südkamp, M. Feucht Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Femoraler Slope...? Femoraler Slope
Die navigierte Knieprothese!! AkadeMI 25. Mai 2016! Dr. md. Lukas G. LOREZ!
 Die navigierte Knieprothese!! AkadeMI 25. Mai 2016! Dr. md. Lukas G. LOREZ! Knieprothese! Knie, Arthrose, Alternativen zur Prothese! Was ist eine Knieprothese! Was für Prothesen gibt es! Geschichte der
Die navigierte Knieprothese!! AkadeMI 25. Mai 2016! Dr. md. Lukas G. LOREZ! Knieprothese! Knie, Arthrose, Alternativen zur Prothese! Was ist eine Knieprothese! Was für Prothesen gibt es! Geschichte der
SCHÖNE ZÄHNE. Lebensqualität mit Zahnimplantaten 1
 SCHÖNE ZÄHNE Lebensqualität mit Zahnimplantaten 1 1 Lebensqualität mit Zahnimplantaten bezieht sich auf eine höhere Lebensqualität mit einem Zahnimplantat im Vergleich zu keiner Behandlung. Awad M.A et
SCHÖNE ZÄHNE Lebensqualität mit Zahnimplantaten 1 1 Lebensqualität mit Zahnimplantaten bezieht sich auf eine höhere Lebensqualität mit einem Zahnimplantat im Vergleich zu keiner Behandlung. Awad M.A et
Endoprothetik Gelenkersatzoperationen
 Asklepios Klinik Barmbek Unfall-, Wiederherstellungs- u. Orthopädische Chirurgie Rübenkamp 220-22291 Hamburg Tel.: (0 40) 18 18-82 28 21 Fax: (0 40) 18 18-82 28 29 unfallchirurgie.barmbek@asklepios.com
Asklepios Klinik Barmbek Unfall-, Wiederherstellungs- u. Orthopädische Chirurgie Rübenkamp 220-22291 Hamburg Tel.: (0 40) 18 18-82 28 21 Fax: (0 40) 18 18-82 28 29 unfallchirurgie.barmbek@asklepios.com
Wiederum wurde ein Elfenbeinimplantat 1922 von Hey-Groves verwendet, der erstmals einen Hüftkopf ersetzte.
 3 2 Grundlagen der Hüftprothetik 2.1 Historie Den ersten Versuch, ein künstliches Gelenk zu implantieren unternahm 1890 der Berliner Chirurg Themistocles Gluck. Er versuchte Kniegelenksendoprothesen aus
3 2 Grundlagen der Hüftprothetik 2.1 Historie Den ersten Versuch, ein künstliches Gelenk zu implantieren unternahm 1890 der Berliner Chirurg Themistocles Gluck. Er versuchte Kniegelenksendoprothesen aus
www.orthopaedie-mv.de Susanne Fröhlich Moskau 06.04.07
 www.orthopaedie-mv.de Susanne Fröhlich Moskau 06.04.07 Spektrum Endoprothetik (Hüfte,Knie) Sportorthopädie Wirbelsäule (konservativ, operativ) Kinderorthopädie Tumoren Forschung (Implantatentwicklung,
www.orthopaedie-mv.de Susanne Fröhlich Moskau 06.04.07 Spektrum Endoprothetik (Hüfte,Knie) Sportorthopädie Wirbelsäule (konservativ, operativ) Kinderorthopädie Tumoren Forschung (Implantatentwicklung,
Hammerzehe/Krallenzehe
 Hammerzehe/Krallenzehe Der Hammerzeh und der Krallenzeh sind häufige Zehenfehlstellungen. Typische Symptome sind krumme Zehen und schmerzhafte Druckpunkte am ganzen Fuß, sowie Hühneraugen. Oft treten Hammerzehen
Hammerzehe/Krallenzehe Der Hammerzeh und der Krallenzeh sind häufige Zehenfehlstellungen. Typische Symptome sind krumme Zehen und schmerzhafte Druckpunkte am ganzen Fuß, sowie Hühneraugen. Oft treten Hammerzehen
Hüftgelenksdysplasie des Hundes
 Hüftgelenksdysplasie des Hundes Mein Hund soll eine Hüftgelenksdysplasie haben, obwohl er nicht lahmt? Kann das richtig sein? Bei der Hüftgelenksdysplasie (HD) handelt es sich um eine Deformierung des
Hüftgelenksdysplasie des Hundes Mein Hund soll eine Hüftgelenksdysplasie haben, obwohl er nicht lahmt? Kann das richtig sein? Bei der Hüftgelenksdysplasie (HD) handelt es sich um eine Deformierung des
Mit. Technologie. Operationstechnik
 Mit Technologie Operationstechnik 2 Optimierte Implantatgeometrie Weiterentwicklung der bewährten TRI-LOCK -Technologie. Die erste Generation des TRI-LOCK-Schafts wurde 1981 eingeführt. Das Implantat war
Mit Technologie Operationstechnik 2 Optimierte Implantatgeometrie Weiterentwicklung der bewährten TRI-LOCK -Technologie. Die erste Generation des TRI-LOCK-Schafts wurde 1981 eingeführt. Das Implantat war
Hüftschäfte zementiert - zementfrei
 Frankfurter Orthopädie Symposium Hüftschäfte zementiert - zementfrei Grundlagen epi-, meta-, diaphysäre Verankerung 4. - 5. 11. 2005 Frankfurt a. M. Abstracts Orthopädische Universitätsklinik Frankfurt
Frankfurter Orthopädie Symposium Hüftschäfte zementiert - zementfrei Grundlagen epi-, meta-, diaphysäre Verankerung 4. - 5. 11. 2005 Frankfurt a. M. Abstracts Orthopädische Universitätsklinik Frankfurt
MESSUNG DER ERGEBNISQUALITÄT AUSSAGEFÄHIGKEIT VON ROUTINEDATEN VS. SPEZIFISCHE ERHEBUNGSINSTRUMENTE T. KOSTUJ
 MESSUNG DER ERGEBNISQUALITÄT AUSSAGEFÄHIGKEIT VON ROUTINEDATEN VS. SPEZIFISCHE ERHEBUNGSINSTRUMENTE T. KOSTUJ Thesen: 1. Die Erfassung der Ergebnisqualität mittels Krankenkassenabrechnungsdaten ist grundsätzlich
MESSUNG DER ERGEBNISQUALITÄT AUSSAGEFÄHIGKEIT VON ROUTINEDATEN VS. SPEZIFISCHE ERHEBUNGSINSTRUMENTE T. KOSTUJ Thesen: 1. Die Erfassung der Ergebnisqualität mittels Krankenkassenabrechnungsdaten ist grundsätzlich
Aspirin auch bei Typ-2-Diabetikern nur gezielt zur Sekundärprävention einsetzen
 Neue Erkenntnisse zur Prävention von Gefäßerkrankungen: Aspirin auch bei Typ-2-Diabetikern nur gezielt zur Sekundärprävention einsetzen Bochum (3. August 2009) Herzinfarkt und Schlaganfall sind eine häufige
Neue Erkenntnisse zur Prävention von Gefäßerkrankungen: Aspirin auch bei Typ-2-Diabetikern nur gezielt zur Sekundärprävention einsetzen Bochum (3. August 2009) Herzinfarkt und Schlaganfall sind eine häufige
Erwachsenenhüfte. D. Kohn
 1 von 11 31.05.2014 15:43 Erwachsenenhüfte D. Kohn Zum Verständnis des Hüftgelenks ist eine Wiederholung der Anatomie erforderlich (Begriffe: Facies lunata, Fossa acetabuli, Ligamentum capitis femoris,
1 von 11 31.05.2014 15:43 Erwachsenenhüfte D. Kohn Zum Verständnis des Hüftgelenks ist eine Wiederholung der Anatomie erforderlich (Begriffe: Facies lunata, Fossa acetabuli, Ligamentum capitis femoris,
Navigation - Klinische Ergebnisse
 AE-Kurs Knie Ofterschwang Pleser M, Wörsdörfer O. Klinikum Fulda gag A. Gesamtergebnisse Fulda B. Navitrack TM -Multicenterstudie (Teilergebnisse Fulda) C. Ergebnisse: randomisierte Studie zum Einfluss
AE-Kurs Knie Ofterschwang Pleser M, Wörsdörfer O. Klinikum Fulda gag A. Gesamtergebnisse Fulda B. Navitrack TM -Multicenterstudie (Teilergebnisse Fulda) C. Ergebnisse: randomisierte Studie zum Einfluss
Erwachsenenhüfte. D. Kohn
 Erwachsenenhüfte D. Kohn Zum Verständnis des Hüftgelenks ist eine Wiederholung der Anatomie erforderlich (Begriffe: Facies lunata, Fossa acetabuli, Ligamentum capitis femoris, Calcar femoris; CCD-Winkel,
Erwachsenenhüfte D. Kohn Zum Verständnis des Hüftgelenks ist eine Wiederholung der Anatomie erforderlich (Begriffe: Facies lunata, Fossa acetabuli, Ligamentum capitis femoris, Calcar femoris; CCD-Winkel,
Hüftpfanne mit modernsten Gleitpaarungen Produktübersicht
 Trinity Hüftpfanne mit modernsten Gleitpaarungen Produktübersicht Trinity Leistung Vielseitigkeit Technologie Das Trinity Hüftpfanne mit modernsten Gleitpaarungen bietet Chirurgen eine breitgefächerte
Trinity Hüftpfanne mit modernsten Gleitpaarungen Produktübersicht Trinity Leistung Vielseitigkeit Technologie Das Trinity Hüftpfanne mit modernsten Gleitpaarungen bietet Chirurgen eine breitgefächerte
