Das Badische. Zwischen Alemannisch und Fränkisch
|
|
|
- Hertha Schulze
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 MASARYK-UNIVERSITÄT PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT INSTITUT FÜR GERMANISTIK, NORDISTIK UND NEDERLANDISTIK DEUTSCHE SPRACHE UND LITERATUR DENISA KIČMEROVÁ Das Badische. Zwischen Alemannisch und Fränkisch BACHELORARBEIT BETREUER: KLAUS OTTO SCHNELZER, M.A. BRÜNN
2 Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbständig und nur mit Hilfe der angegeben Quellen verfasst habe. Brünn, den 27. Juni Denisa Kičmerová 2
3 Danksagung: An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Betreuer Klaus Otto Schnelzer, M.A. für seine wertvollen Ratschläge, Bemerkungen und Motivation während der Anfertigung dieser Bachelorarbeit bedanken. Ebenfalls möchte ich mich bei meinem Freund und meinen Eltern für ihre emotionale Unterstützung bedanken. 3
4 Inhaltsverzeichnis I. EINLEITUNG... 6 II. THEORETISCHER TEIL Definition der Fachtermini Dialekt und Mundart im Kontrast Dialekt und Standardsprache im Kontrast Kriterien der Dialekt- und Standardspracheverwendung Linguistische Kriterien Deutsche Dialekte Die Hauptgliederung deutscher Dialekte Die Zweite Lautverschiebung Dialekträume in Baden-Württemberg Badisch: Was bedeutet das? Alemannisch Die räumliche Gliederung des alemannischen Sprachraums Alemannen Schwaben Südfränkisch III. PRAKTISCHER TEIL Phonetische Charakteristika Vokalismus Die Neuhochdeutsche Diphthongierung Die Neuhochdeutsche Monophthongierung Realisierung des mhd. /ei/ Realisierung von mhd. /ou/ Konsonantismus Konsonantentilgung Fränkische Spirantisierung: Frikativierung von zwischenvokal. /b/ K-Verschiebung S-Palatalisierung Morphologische Charakteristika Die Artikeluntersuchung und Methode Problematik der Analyse
5 5.2 Die Artikel im Alemannischen Kasusnivellierung im Alemannischen Der definite Artikel im Nominativ und Akkusativ Der definite Artikel im Dativ Der indefinite Artikel im Nominativ und Akkusativ Der indefinite Artikel im Dativ Die Artikel im Südfränkischen Der definite Artikel im Nominativ und Akkusativ Der definite Artikel im Dativ Der indefinite Artikel Direkter Vergleich Alemannisch vs. Südfränkisch Präteritumschwund E-Apokope: Relevante Ursache des Präteritumschwunds Kurzverben im Alemannischen Verbverdopplung im Alemannischen Einheitsplural Lexikalische Charakteristika Ausgewählte Lexeme IV. FAZIT V. QUELLENVERZEICHNIS VI. ANHANG
6 I. EINLEITUNG Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem alemannischen und südfränkischen Dialekt in Baden-Württemberg. Dieses Bundesland bietet ein heterogenes Bild an unterschiedlichen Dialektlandschaften. Unter den Einwohnern in Baden ist der Begriff Alemannisch und Südfränkisch aber nicht üblich. Sie bezeichnen ihre Mundart Badisch. Wie das mit diesen unterschiedlichen Benennungen der in Baden-Württemberg gesprochenen Dialekte steht, werde ich im theoretischen Teil meiner Bachelorarbeit beantworten. Die Suche nach dem Ursprung des Alemannischen wird mich weit in die Geschichte führen, als die Alemannen die Römer zurückdrängten und ihr Gebiet gegen die Franken im Norden ausgrenzten. Der alemannische Sprachrau, der sich nicht nur auf deutschem Boden erstreckt, wird anhand der wichtigsten Isoglossen in regionale Varietäten verteilt und durch die Bausteine der Sprachentwicklung wie z.b. die Zweite Lautverschiebung beschrieben. Diese Bachelorarbeit ist nicht streng in einen theoretischen und praktischen Teil geteilt, vielmehr wird die Theorie immer durch darauffolgende praktische Beispiele und Analysen begleitet. Für die praktischen Beobachtungen habe ich ein berühmtes und in verschiedene Sprachen und Dialekte übersetztes Buch ausgewählt: Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry, in den Dialektversionen: Dr chlei Prinz" auf Badisch-Alemannisch, übersetzt von A. Olbert und De kloine Prinz" auf Badisch-Südfränkisch, übersetzt von W. Sauer. Am Beispiel dieser Buchübersetzungen werde ich unterschiedliche phonetische, morphologische und lexikalische Merkmale beider Dialekte vorstellen. Ich werde beobachten, wie sich das Schreibverhalten der Dialektautoren gestaltet. Der alemannische Dialekt, in dem die alemannische Autorin schreibt, wird näher bestimmt. Denn wie man später feststellen wird, ist die Bezeichnung Alemannisch, und auch trotz der Erweiterung Badisch, ein viel zu breiter Begriff, der mehrere Dialekte vertreten kann. Es wird interessant sein herauszufinden, ob man anhand des Schreibverhaltens im Dialekt die genaue Dialektlandschaft bestimmen kann. Im phonetischen Bereich werde ich die wichtigsten Veränderungen im Vokalismus und Konsonantismus vorstellen und werde anhand der dialektologischen Karten prüfen, ob das Schreibverhalten der Autoren der Theorie entspricht. Aus dem morphologischen Bereich 6
7 werde ich ausgewählte Phänomene skizzieren, die für eine bestimmte dialektologische Landschaft wichtig sind (z.b. Kurzverben, Verbverdopplung, Präteritumschwund, Einheitsplural) Den umfangreichsten Beitrag des morphologischen Bereichs stellt die Artikeluntersuchung in beiden Buchversionen dar, die sehr präzise und detailliert im Vergleich mit dem Französischen und Standarddeutschen durchgeführt wird. Zu dieser Analyse befinden sich im Anhang Belege, die diese ergänzen. Der lexikologische Teil meiner Arbeit umfasst ausgewählte lexikalische Besonderheiten vor allem aus der alemannischen Buchversion, im Kontrast mit den verwendeten Lexemen im Südfränkischen. Diese werden, wenn nötig, etymologisch belegt. II. THEORETISCHER TEIL 1 Definition der Fachtermini In diesem Kapitel werden Begriffe Dialekt, Mundart und Standardsprache behandelt. Dieses Kapitel soll außerdem den Verwendungsbereich des Dialekts von der Standardsprache ausgrenzen. 1.1 Dialekt und Mundart im Kontrast Die Beziehung zwischen den Begriffen Dialekt und Mundart muss näher bestimmt werden. Der Ausdruck Mundart war als Ersatz des aus dem Lateinischen entlehnten Wortes Dialekt (lat. dialectus) gedacht. Dieser Versuch der Eindeutschung stammt von Philipp von Zesen (1640) (vgl. Patocka 2008: S ). Zu dieser Zeit hat man noch einen Unterschied zwischen den Begriffen Dialekt und Mundart verstanden. Der Dialekt war tendenziell für die Großformen (Stammesmundarten) einsetzbar. Die Mundart war eine kleinere Einheit bzw. eine innerhalb eines Dialektgebiets unterscheidbare Sprechweise (vgl. Besch u.a. 1982: S. 443). In der Dialektologie heutzutage werden diese zwei Ausdrücke synonym verwendet und der Unterschied liegt lediglich am individuellen Verständnis. Laut Patocka (2008) verbinden die sprachwissenschaftlichen Laien mit der Mundart die Mundartdichtung bzw. einen gehoben Stil. Den Dialekt hingegen als die heimische Sprechweise (vgl. Patocka 2008: S. 13). 7
8 Fälschlicherweise werden von Laien manchmal die Begriffe Akzent und Dialekt verwechselt. Der Akzent betrifft lediglich die Aussprache bzw. den phonologischen Bereich. 1.2 Dialekt und Standardsprache im Kontrast Die Begriffe Dialekt und Standardsprache fungieren als Gegensätze und können als solche einfacher charakterisiert werden. Anstatt von unterschiedlichen Definitionen in Lexika hebt Patocka (2008) einen direkten Vergleich bestimmter Kriterien im Kontrast von Löffler (2003) hervor. Anhand dieser Kriterien kann man die Begriffe Dialekt und Standardsprache bzw. Hochsprache effektiv kontrastieren und verstehen. Patocka (2008) spricht von der Hochsprache, Spiekermann (2008) verwendet den Begriff Standardsprache. Es handelt sich um synonymische Begriffe, die noch andere Alternativen wie z.b. Schriftsprache, Einheitssprache oder Literaturdeutsch erlauben (vgl. Spiekermann 2008: S.24) Kriterien der Dialekt- und Standardspracheverwendung a) Verwendungsbereich: Der Dialekt wird tendenziell mündlich in familiären Angelegenheiten bevorzugt; die Standardsprache hingegen in der Öffentlichkeit mündlich als auch schriftlich (vgl. Patocka 2008: S. 15, zit. n. Löffler 2003). b) Sprachbenutzer: Patocka (2008) kritisiert Löfflers Abgrenzung des Dialekts als wäre er die Sprache der Ungebildeten (Bauern, Handwerker, Personen mit geringer Schulbildung). Patocka betont, dass diese Grobkategorisierung (Dialekt in der Unterschicht, Hochsprache in der Mittel- und Oberschicht) durchaus nicht ganz falsch ist, aber darf nicht verabsolutiert werden (vgl. Patocka 2008: S ). c) Räumliche Erstreckung: Dialekte sind an ein bestimmtes Gebiet gebunden und landschaftspezifisch. Die Standardsprache hat eine überdachende Funktion, sie gilt als überregional und unbegrenzt (vgl. Patocka 2008: S. 17, zit. n. Löffler 2003). d) Kommunikative Reichweite: Da die Dialekte an ein bestimmtes Gebiet gebunden sind, ist die kommunikative Reichweite nicht hoch. Eine problemlose Verständigung ist nur im engeren Raum möglich. Die Standradsprache hingegen ist ein optimales Verständigungsmedium und weist einen großen Verständigungsradius aus (vgl. Patocka 2008: S , zit. n. Löffler 2003) 8
9 e) Sprachgeschichtliche Entstehung: Zu diesem Kriterium muss ein weiteres Thema Mittelhochdeutsch als Protosystem angesprochen werden. Die Dialekte lassen sich nämlich ohne regulierende Eingriffe als Weiterentwicklung eines Protosystems charakterisieren (vgl. Patocka 2008: S. 19). Für das Hochdeutsche stellt das Mittelhochdeutsche ein Protosystem (d.h. ein zeitlich vorgelagertes Sprachsystem) dar. Bestimmte Mundarten haben sich aus diesem Protosystem kontinuierlich entwickelt (vgl. Patocka 2008: S ). Dadurch sind die hochdeutschen Dialekte konservativer als die Standardsprache zu bezeichnen, da sie näher und unmittelbarer am Protosystem Mittelhochdeutsch liegen (vgl. Patocka 2008: S. 20). Patocka (2008) betont, dass hier das Wort konservativ nicht bedeutet, dass die Dialekte etwa mhd. Zustände bewahrt haben, sondern nur im Sinne der Entfernung zum Protosystem an ihm näher liegen. Die Standardsprache hat kein solches Protosystem, sondern mehrere frühneuzeitliche regionale Varietäten aus denen sich die Gestalt des uns bekannten hochsprachlichen System zusammensetzt. (Patocka 2008: S. 19) Linguistische Kriterien Früher waren Dialekte in der Dialektologie als defekt dargestellt. Patocka (2008) führt dazu die Charakteristik von Löffler an. Dieser Ansatz wird von den Dialektologen nicht mehr vertreten, da er die Unterlegenheit des dialektalen Systems suggeriert. Löffler hat sich von dieser Definition distanziert (vgl. Patocka 2008: S. 20). Frühere Beschreibung von Dialekt und Standardsprache: a) Dialekt: Die Besetzung grammatischer Ebenen nicht vollständig. Im Alemannischen fehlen z.b. das Präteritum, der Genitiv und auch die Akkusativmarkierung bei Maskulina. Der Wortschatz wird reduziert, die Syntax vereinfacht. Komplizierte Satzkonstruktionen mit logischen Verknüpfungen sind nicht möglich (vgl. Patocka 2008: S , zit. n. Löffler). b) Standardsprache: Es gibt ein maximales Inventar aller grammatischen Kategorien. Das Tempussystem ist vollständig vertreten. Die Syntax ist vielfältig mit 9
10 vielen Möglichkeiten für weitere logische Verknüpfungen ausgebaut (vgl. Patocka 2008: S , zit. n. Löffler). Patocka (2008) stellt J. Goossens (1997) These vor, die für die Linguistik adäquater zur Beschreibung des Dialekts ist. Sehr kurz zusammenfasst: diese These geht davon aus, dass es zwischen der Standardsprache und dem Dialekt Zwischenstufen sprachlicher Varietäten gibt. Der Wechsel zwischen diesen Varietäten wird anhand bestimmter Anzahl an Transformationsregeln realisiert. Dadurch ergeben sich weitere Begriffe wie: Basisdialekt, Verkehrsdialekt und Umgangssprache, die aber in meiner Bachelorarbeit nicht weiter behandelt werden. Wichtig für dieses Kapitel ist die Feststellung, dass Dialekte aus linguistischer Sicht nicht als defekt dargestellt werden sollten, obwohl dies noch in der Schule oft der Fall (vgl. Patocka 2008: S ). 2 Deutsche Dialekte An der deutschen Sprache haben mich schon immer der Reichtum an Wörtern und die Ausdrucksmöglichkeiten fasziniert. Für die sprachliche Vielfalt des Deutschen sorgen zweifellos die deutschen Dialekte, die nicht nur in jedem Bundesland sondern auch in jeder Stadt, sogar in manchen Dörfern, eine eigene Art und Stil haben. Insofern finde ich es hochinteressant, aber auch wichtig für einen Germanisten, sich mit bestimmten Dialekten vertraut zu machen. Bevor ich zu meinem Interessengebiet komme, also zur dialektalen Landschaft in Baden-Württemberg, möchte ich kurz die Gliederung deutscher Dialektgebiete vorstellen. 2.1 Die Hauptgliederung deutscher Dialekte Die deutsche Sprache gehört zum germanischen Zweig, der zur Familie der indoeuropäischen Sprachen fällt. Das Hochdeutsche bildete sich im Unterschied zu den restlichen germanischen Sprachen durch die Zweite Lautverschiebung heraus. 10
11 2.1.1 Die Zweite Lautverschiebung Dieses Lautgesetz spaltete das Ahd. von den anderen germanischen Sprachen ab. Der Kern war die Veränderung des Konsonantensystems. Aus Plosiven /p/, /t/ und /k/ wurden /pf/, /ts/ und /kx/, z.b. engl. Apple vs. hochdt. Apfel (vgl. Nübling u.a. 2010: S. 26). Dieser Prozess hat vermutlich in der Völkerwanderungszeit am Ende des 5. Jahrhunderts angefangen und breitete sich vom Süden im Alpengebiet bis in den Norden zu der Düsseldorf-Kassel-Wittenberg-Linie bis zu Berlin aus. Diese obere Grenze des Vorrückens wird als Benrather-Linie bezeichnet (vgl. Schwerdt 2000: S. 283). Sie trennt das Hochdeutsche vom Niederdeutschen (vgl. Schwerdt 2000: S. 28). Es handelt sich um ein wichtiges Isoglossenbündel, das aus mehreren Isoglossen besteht. Im Rahmen des Konsonantenwandels kann die Dorp-Dorf-Linie und Appel-Apfel-Linie genannt werden. Diese Grenzlinien bilden zusammen den sog. Rheinischen Fächer (vgl. Nübling u.a. 2010: S. 28). Die Zweite Lautverschiebung wurde nur in den oberdeutschen Dialekten vollständig durchgeführt, im Mitteldeutschen nur teilweise. In Richtung Norden schwächte die Lautverschiebung in Folge der großen Distanz und natürlichen Schranken ab (vgl. Schwerdt 2000: S. 283). In welcher Mundart die Zweite Lautverschiebung angefangen hat, ist ungeklärt. Manche Forscher wenden sich dem Alemannischen zu, Bairisch wird ebenfalls in Betracht gezogen. Mehrheitlich wird die Meinung vertreten, dass die Zweite Lautverschiebung oberdeutschen Ursprunges sei (vgl. Schwerdt 2000: S ). Aufgrund der Zweiten Lautverschiebung werden deutsche Dialekte in drei Gruppen aufgeteilt: 1. oberdeutsche Dialekte 2. mitteldeutsche Dialekte Hochdeutsch 3. niederdeutsche Dialekte Der Begriff Hochdeutsch im Sinne einer Sprachfamilie umfasst die mittel- und oberdeutschen Dialekte. Diese unterscheiden sich vom Niederdeutschen durch die vollständig oder teilweise durchgeführte Zweite Lautverschiebung. Das Oberdeutsche gliedert sich weiter in: Ostfränkisch, Alemannisch, Bairisch und Süd(rhein)fränkisch. Die 11
12 Appel-Apfel-Linie oder auch Speyerer-Linie genannt, trennt das Mitteldeutsche von den oberdeutschen Dialekten (vgl. Paul 1998: S. 166). 3 Dialekträume in Baden-Württemberg Baden-Württemberg ist das drittgrößte Bundesland Deutschlands und bietet ein sehr heterogenes Bild der da gesprochenen Dialekte. Diese Landschaft ist ein schönes Beispiel für die dialektale Vielfalt innerhalb eines Bundeslandes vom Fränkischen im Norden bis zu allen regionalen Varietäten des Alemannischen im Westen und Süden. Das Fränkische in Baden-Württemberg zerfällt in: Ostfränkisch, Südfränkisch und Rheinfränkisch. Das Südfränkische ist der größte fränkische Dialektraum in Baden- Württemberg, bei den restlichen (Ostfränkisch, Rheinfränkisch) handelt es sich nur um kleinere Gebiete, die sich großenteils in den benachbarten Bundesländern erstrecken und nur teils in Gebiete Baden-Württembergs reichen. Südfränkisch und Ostfränkisch fallen unter den oberdeutschen Raum. Das Rheinfränkische zählt schon zum Mitteldeutschen (vgl. Spiekermann 2008: S. 60). Der alemannische Teil nimmt die restliche Fläche des Landes ein: Oberrheinalemannisch, Südalemannisch, Schwäbisch und Bodenseealemannisch. Am anschaulichsten wird die Gliederung in der Abbildung von Steger/Jakob (1983). 12
13 (Abbildung 1.: Einteilung der Dialekte in Baden-Württemberg. Entnommen aus Spiekermann 2008, von Steger/Jakob 1983) 3.1 Badisch: Was bedeutet das? Obwohl Badener den Begriff Badisch als Bezeichnung für ihre Mundart benutzen, kennt die Sprachwissenschaft keine Definition von Badisch als Dialekt. Der Online DUDEN definiert Badisch als: Baden, die Badener betreffend; aus Baden stammend. Das Glottonym Badisch ist in der Alltagssprache im Grunde ein falsch verwendeter Begriff. Badisch benennt lediglich einen historischen politischen Raum. Alles, was aus Baden stammt, kann man als Badisch bezeichnen, z.b. badisches Essen, badische Bräuche. Auf diese Weise müsste dies auch mit der Sprache funktionieren: *die badische Mundart. Der Stolperstein ist aber, dass die Dialektologie schon andere gut begründete Dialektnamen vergeben hat, die sich noch auf die alten Stämme der Franken und Alemannen beziehen (siehe Kapitel 3.2.2). Rein theoretisch, wenn sich Badisch als eine Definition einer Mundart in der Zukunft etabliert hätte, würde Badisch durch die Auflistung weiterer Dialekte ergänzt werden müssen: Südfränkisch, Oberrheinalemannisch, Bodenseealemannisch, Südalemannisch, denn diese sind die tatsächlichen Dialekte, die in der Region Baden gesprochen werden. Die Region Baden umfasst also zwei Dialektfamilien: Alemannisch und Fränkisch bzw. wie der Titel meiner Bachelorarbeit angedeutet hat: Das Badische. Zwischen Alemannisch und Fränkisch. 13
14 Das Glottonym Badisch wird überraschenderweise auch in den Übersetzungen von Der kleine Prinz verwendet: De kloine Prinz (Badisch-Südfränkisch) und Dr chlei Prinz (Badisch-Alemannisch). In diesem Fall musste Badisch weiter ergänzt werden, um zu verstehen, was für ein Badisch die Autoren meinen. Die Definition Südfränkisch reicht aus, um die Mundart zu bestimmen. Der südfränkische Raum in Baden ist nicht groß. Die Ergänzung Alemannisch ist aber nicht ausreichend. Schreibt die Autorin Adelheid Olbert Oberrheinalemannisch, Bodenseealemannisch oder Südalemannisch? Dies werde ich versuchen, herauszufinden. 3.2 Alemannisch Das Alemannische nimmt also fast ganz Baden-Württemberg ein. Die alemannische Mundart geht jedoch über die deutschen Grenzen hinaus. Man spricht Alemannisch in der deutschen Schweiz, in Liechtenstein, in Österreich (Vorarlberg) und in Frankreich (Elsass). Dieser Dialekt ist trotz der einheitlichen Bezeichnung nicht homogen, sondern gliedert sich weiter in Teildialekte, die sich durch bestimmte Merkmale unterscheiden. Über die offizielle Gliederung herrscht jedoch keine Einheit. Den alemannischen Raum kann man anhand von bestimmten Kriterien so unterschiedlich unterteilen, dass eine einheitliche Gliederung kaum möglich ist (vgl. Patocka 2008: S. 101) Die räumliche Gliederung des alemannischen Sprachraums Wie schon erwähnt wurde, kann man den alemannischen Sprachraum unterschiedlich unterteilen. Ich habe eine Einteilung ausgewählt, die für mein Interessengebiet vorteilhaft ist. Diese Gliederung betrifft nur die alemannischen Dialekte in Baden-Württemberg. Diese Gliederung stammt von Maurer (vgl. Spiekerman 2008: S.59, zit.n. Maurer 1942:185 ff.) 1. Oberrheinalemannisch 2. Schwäbisch 3. Südalemannisch 4. Bodenseealemannisch Die alemannischen Teildialekte werden in fünf Ländern gesprochen. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht gibt es allerdings keine Grenzen. Alle alemannischen Dialekte bilden also ein Dialektkontinuum. Das bedeutet, dass je zwei benachbarte Dialekte 14
15 wechselseitig verständlich sind und unabhängig von den Grenzen ineinander übergehen (vgl. Barbour/Stevenson 1998: S. 314). Zwischen den Hauptmundarten bilden sich Übergangsmundarten (vgl. Abb. 1. Steger/Jakob). So kann es zu keiner abrupten Grenze zwischen zwei Dialekten kommen. Aus diesem Grund sind manche Städte dialektologisch schwer definierbar (z.b. Schwäbisch Hall, ursprünglich ostfränkisch Hohenlohisch), da hier die schwäbisch-fränkische Grenze verläuft (vgl. Spiekermann 2008: S. 59). Die Grenzen zwischen zwei Dialekten unterschiedlicher Gruppen heißen Isoglossen. Für den alemannischen Sprachraum bilden zwei Isoglossen die Grundlage: die Schwarzwaldschranke und die Sundgau-Bodensee-Schranke. a) Die Schwarzwaldschranke Die Schwarzwaldschranke bildet die Dialektgrenze zwischen dem Schwäbischen und Oberrheinalemannischen. Das Gebirge Schwarzwald stellt eine natürliche Grenze zwischen zwei Gebieten dar. Der dichte Wald, Berge und tiefe Täler waren im Mittelalter ein Hindernis, so dass der Austausch zwischen dem östlichen und westlichen Teil nur in geringem Maße erfolgen konnte (vgl. Bohnenberger 1953: S , Kunze/Schrambke u.a. 1993: S. 149). Durch den fehlenden Kontakt sind sprachliche Unterschiede entstanden. Zum Beispiel bewahrt das Schwäbische die mhd. Langvokale /î, û, iu/ während im Oberrheinalemannischen die neuhochdeutsche Diphthongierung durchgeführt wurde (siehe Kapitel 4.1). Zum Beispiel mhd. zît: schwäbisch /tseit/ vs. Oberrheinalemannisch /tsiit/ (vgl. Spiekermann 2008: S. 60). Der schwäbische Dialekt bewahrt außerdem auch die mhd. Langvokale /ê, ô, œ/: Schnee, /ʃnae/ vs. /ʃnee/ und senkt die Monophthonge /i, u, y/ vor Nasal: Kind, /kend/ (vgl. Spiekermann 2008 S. 61). Die Schwarzwaldschranke wird bis heute als eine stabile Dialektgrenze angesehen. b) Die Sundgau-Bodensee-Schranke Diese Isoglosse trennt das Südalemannische vom nördlichen Teil alemannischer Dialekte. Die Bezeichnung Sundgau-Bodensee-Schranke wurde 1943 von Maurer eingeführt und galt lange Zeit als umstritten. Selbst Maurer äußerte sich skeptisch über diese Linienziehung, da diese Schranke vielmehr eine breite Übergangszone bildet (vgl. 15
16 Seidelmann 2004: S. 481, zit. n. Maurer 1942). Aufgrund dieses problematischen Gebiets wurde der Begriff Bodenseealemannisch von H. Steger in Raumgliederung der Mundarten 1950 zuerst erwähnt und hat seitdem für die Gliederung des Alemannischen in Deutschland Eingang in die Literatur gefunden (vgl. Seidelmann 2004: S. 481). Ein wichtiges Merkmal dieser Übergangslandschaft ist vor allem die Verschiebung /k/ zu [x], z.b. südalemannisch [kxɔpf] vs. nordalemannisch [kɔpf]. Spiekermann (2008) verwendet hierfür den Begriff Nordalemannisch um gegen die südlichen Landschaften sinnvoll kontrastieren zu können. Nordalemannisch ist allerdings kein fester Begriff und Spiekermann (2008) versteht darunter alle alemannischen Teildialekte nördlich der Sundgau- Bodensee-Schranke. Die Sundgau-Bodensee-Schranke dient teils, ähnlich wie die Schwarzwaldschranke, als eine Diphthongierungsisoglosse (vgl. Spiekermann 2008: S. 61). Oberhalb dieser Isoglosse im Schwäbischen wurde die neuhochdeutsche Diphthongierung durchgeführt. Im obigen Abschnitt habe ich eine der Gliederungsmöglichkeiten und die wichtigste Isoglossen des alemannischen Sprachraums vorgestellt. Um den Ursprung des Alemannischen zu verstehen, ist ein kurzer Blick in die Geschichte notwendig Alemannen Allemands, Alemanes und so ähnlich werden Deutschen in den meisten in romanischen Ländern genannt. Unter dieser Bezeichnung wird aber nicht der Stamm der Alemannen verstanden, sondern Deutsche als eine Nation. Wer waren also die Alemannen und wie hat sich ihre Sprache gebildet? Die Bezeichnung Alemannen kam im 3. Jahrhundert zum ersten Mal in den römischen Quellen zum Vorschein. Ob die Alemannen zur Zeit ihrer Benennung schon ein bewusstes Volk waren, also aus einer Ethnie bestanden und sich durch ihre gemeinsame einheitliche Sprache und Kultur bezeichneten, ist nicht überliefert. Es gibt kein Eigenzeugnis der Alemannen in der Frühzeit. Aus diesem Grund kann man nur vom Fremdzeugnis der Römer ausgehen (vgl. Geuenich 1997: S ). Den römischen Schriftstellern nach waren die Alemannen germanische Stämme, die zwischen Rhein und Limes siedelten. Die Römer benötigten eine Sammelbezeichnung für die 16
17 germanischen Eindringlinge nach dem Fall der Limes im Jahre 259/60 (vgl. Geuenich 1997: S. 19). Hinter der ursprünglichen Bezeichnung Alamanni versteckt sich eine ganz einfache Übersetzung für ʽalle Männerʼ. Aufgrund archäologischer Funde geht man davon aus, dass die Alemannen dem Stamm der Sueben gleichzusetzen sind (vgl. Geuenich 1997: S ). Die Sueben siedelten im Norden an der Elbe, von daher auch Elbgermanen genannt. Von den meisten Forschern wird angenommen, dass die Sueben über einen längeren Zeitraum von der Elbe bis an den Oberrhein vorgedrungen sind und diese Menschengruppen später von den Römern als Alemannen bezeichnet wurden (vgl. Geuenich 1997: S. 17). Diese germanischen Stämme bildeten keinen einzigen Stamm. Die größten Gruppen waren Alemannen und Schwaben. Diese vermischten sich im Kampf gegen die Goten miteinander, so dass ihre Namen später synonym verwendet wurden (vgl. Weinhold 1863: S. 3). Für meine Arbeit ist es nicht weiter wichtig, nach der Herkunft der Alemannen zu forschen, auch wenn die Geschichte hier zahlreiche Themen zu behandeln bietet. Interessant für mich ist allerdings noch die synonyme Verwendung von Alemannen und Sueben (bzw. Schwaben) Schwaben Als Schwaben bezeichnet man heutzutage diejenigen Menschen, die im schwäbischen Dialektgebiet aufgewachsen sind. Die Hauptstadt Baden-Württembergs Stuttgart liegt im schwäbischen Raum. Man spricht dort Schwäbisch. Den heutigen Schwaben mag das nicht gefallen, aber aus sprachwissenschaftlicher Sicht gehört das Schwäbische zu den alemannischen Dialekten bzw. Schwäbisch unterscheidet sich vom Rest des alemannischen Sprachraums vor allem durch die nhd. Diphthongierung (vgl. Paul 1998: S. 171, Kunze 1993: S ). Die im Grunde falsche Einteilung Schwäbisch und Alemannisch ist heute landläufig üblich (vgl. Kunze u.a. 1993: S. 31). Die gegenseitige Rivalität von Schwaben (Württembergern) und Badenern ist in Baden-Württemberg bekannt. Durch Anekdoten und vor allem unter den Fußball-Fans wird diese Rivalität weitergepflegt. Die Ursache dieses Streites reicht weit in die Geschichte zurück; wird aber im Rahmen meiner Bachelorarbeit nicht detailliert besprochen. Seitdem die Franken die Alemannen um die Mitte des 1. Jh. zurückgedrängt hatten und die fränkischalemannische Stammesgrenze entstand, war der südwestdeutsche Raum nie politisch geeinigt. Im 8. Jh. wurde der Rest des alemannischen Herzogtums beseitigt, und das Gebiet 17
18 zersplitterte sich in zahlreiche Grafschaften und das Herzogturm Schwaben. Der Südweststaat Baden-Württemberg entstand erst 1952 (vgl. Gönner/Haselier 1975: S. 1-3, 127). Der Name Schwaben geht auf den germanischen Stamm der Sueben zurück. Wie ich im obigen Abschnitt erwähnt habe, wurden die Sueben und Alemannen als verwandte Stämme bzw. als ein großer Stammesbund betrachtet (vgl. Weinhold 1863: S. 3). Die Wissenschaft muss sich in diesem Falle ausschließlich auf archäologische Funde beziehen, da aus dieser Zeit keine Zeugnisse bewahrt sind. Die archäologische Forschung verglich die Graben und Bestattungsarten. Diese waren oben an der Elbe sowie unten im Süden sehr ähnlich (vgl. Geuenich 1998: S. 227). Aus historischen Quellen ist die Gleichsetzung von Sueben und Alemannen erst seit dem 6. Jahrhundert bekannt (vgl. Koller 1998: S. 215). Der Begriff Alemannisch als Glottonym geriet in Vergessenheit. Als Demonyme wie auch als Toponyme waren Alemannen und Sueben (Schwaben) vermutlich niemals Synonyme. Das Wiederbeleben des Alemannischen gelang erst dem deutschen Schriftsteller Johann Peter Hebel in seinem Werk Alemannische Gedichte im 19. Jahrhundert, das er aber vor allem seinen Landsleuten in Baden widmete. Durch diese Einschränkung veranlasste er die bis heute gültige Unterscheidung zwischen den Alemannen am Oberrhein, den Alemannen in der Nordschweiz und den Schwaben in Württemberg (vgl. Geuenich 1997: S. 13, Kunze u.a. 1993: S. 29). 3.2 Südfränkisch Südfränkisch ist der einzige Dialekt in Baden-Württemberg, der keine alemannische Grundlage hat, sondern die fränkische. Diese zwei Elemente vermischen sich aber in dieser Gegend, so dass diese Landschaft großenteils eine Übergangszone zwischen Alemannisch und Fränkisch darstellt (vgl. Spiekermann 2008: S. 60, zit. n. Wiesinger 1983). Die fränkischalemannische Grenze ist 250 km lang und erstreckt sich von Hasselberg bei Bayern bis zum Elsass (vgl. Ruoff 1992: S. 17). Leider gibt es sehr wenig Literatur zum Südfränkischen als Dialekt. Um das Südfränkische zu untersuchen, müsste man sich mit dem ganzen fränkischen Sprachraum auseinandersetzen und das Südfränkische von anderen rein fränkischen Dialekten abgrenzen. Da das Südfränkische aber vieles mit dem Alemannischen teilt, werde ich 18
19 Südfränkisch nicht mit dem Fränkischen vergleichen. Wie ich schon berichtet habe, ist das Glottonym Badisch eine Verbindung zweier Dialektfamilien. Ich werde also Südfränkisch im Rahmen der Untersuchung des alemannischen Sprachraums mit diesen Dialekten kontrastieren. An dieser Stelle möchte ich zum praktischen Teil meiner Arbeit übergehen, in dem zwei Übersetzungen von der kleine Prinz mithilfe bestimmter Charakteristika verglichen werden. III. PRAKTISCHER TEIL 4 Phonetische Charakteristika 4.1 Vokalismus In folgendem Abschnitt werde ich mit dem Kartenband zu phonetischphonologischen Untersuchungen von Wiesinger (1970) und den Karten von Schwarz (2015) arbeiten. Die mhd. Formen entnehme ich dem Grimms Online Wörterbuch. Die praktischen Beispiele aus den Buchübersetzungen De kloine Prinz (Badisch-Südfränkisch) und dr chlei Prinz (Badisch-Alemannisch) führe ich zu jedem phonologischen Phänomen an. Anhand Schwarzs und Wiesingers Untersuchungen kann das Schreibverhalten beider Autoren im Dialekt analysiert werden. Ich werde die phonologische Schrift verwenden, denn die Beispiele sind phonologisch in den Karten verzeichnet. Außerdem sind die Vokalunterschiede sehr fein und können manchmal nur durch die phonologische Schrift differenziert werden. Die Einzelbelege und andere Ungenauigkeiten werden im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt Die Neuhochdeutsche Diphthongierung Die sog. neuhochdeutsche Diphthongierung hat im 12. Jahrhundert im bairischösterreichischen Dialektgebiet angefangen. Ihre Ausbreitung erstreckt sich über die oberdeutschen bis in die mittelhochdeutschen Dialekte hinaus. Der Lautwandelprozess betrifft die langen Oberzungenvokale mhd. /î/, /û/ und /iu/, die zu nhd. /ai/, /au/ und /oi/ realisiert wurden. Das Niederdeutsche bleibt von der Entwicklung völlig unbetroffen, der alemannische Sprachraum großenteils ebenso. Einzig das Schwäbische weist die nhd. 19
20 a) Realisierung von mhd. /î/ Diphthongierung auf und unterscheidet sich dadurch von den anderen alemannischen Teildialekten (vgl. Schwarz 2015: S. 51). Die Schwarzwaldschranke bzw. die Diphthongierungsisoglosse teilt Baden- Württemberg auf zwei Seiten auf. Auf der nördlichen Seite kann man die Durchführung der nhd. Diphthongierung im Schwäbischen und Südfränkischen beobachten. Durch den Vergleich zweier Karten bin ich zu folgenden Ergebnissen gekommen: Das Südfränkische verhält sich im Fall der Realisierung des mhd. /î/ standardmäßig wie das Standarddeutsche, z.b. [tsaɪt]. In einem anderen Beispiel ist es jedoch innovativ mit dem Diphthong [ɔɪ]. Das Alemannische bleibt in der Realisierung des mhd. /î/ mit Ausnahme des Schwäbischen konservativ, im Sinne näher am Protosystem Mhd. liegend. Der mhd. Monophthong /î/ bleibt erhalten. Das Schwäbische setzt hier den Diphthong /ei/ durch. Tabelle 1. Realisierung von mhd. /î/ Nhd. Mhd. Südfränkisch Oberrheinaleman., Bodenseealemannisch Schwäbisch Form Form Südalemannisch Zeit zît [tsaɪt] [tsiːt], [tsit] [tsiːt] [tseɪt], [tsaɪt] gleich glîch [glaɪ], [glɔɪ] [gli:], [gliç] [gli:], [gliç] [gleɪ], [glaɪ] (vgl. Beispiele Schwarz 2015: S. 86, 68) Badisch-Südfränkisch [ ] s wär Zeit" Badisch-Alemannisch Mit der Zit hani di chlei [.]" Es ist wichtig zwischen dem alten mhd. /ai/ <heim> und dem neuem aus dem mhd. /î/ entstandenen /ai/ <Zeit> zu unterscheiden. Um diesen Unterschied zu sehen verweise ich auf das Kapitel
21 b) Realisierung von mhd. /û/ (Beispiel Schwarz 2015: S. 94) Badisch-Südfränkisch War wie e Haus[ ]" Badisch-Alemannisch Wie ne Hus gsi [ ]" c) Realisierung von mhd. /iu/ Das Südfränkische entwickelt sich wie das Standarddeutsche zum Diphthong. Das Alemannische bleibt beim Monophthong. Die Beispiele aus den Übersetzungen Der kleine Prinz" sind konsequent mit der Theorie. Tabelle 2. Realisierung von mhd. /û/ Nhd. Mhd. Südfränkisch Oberrheinaleman., Bodenseealemannisch Schwäbisch Form Form Südalemannisch Haus hûs [hɔʊs], [haʊs] [huːs], [hus] [huːs], [hus] [hɔʊs] Das Südfränkische tendiert zum Standarddeutschen. Schwäbisch ist an dialektale Varietäten sehr reich und am innovativsten. Die restlichen alemannischen Dialekte verhalten sich hier konservativ. Es gibt eine Inkonsequenz zwischen dem Schreibverhalten des südfränkischen Autoren und den Angaben aus Schwarzs (2015) Karten. Hier würde man die Schreibweise hoit im Dialektbuch erwarten. Der Diphthong /oi/ ist allerdings schon als Graphem <oi> für den Diphthong /ei/ <klein> besetzt, z.b. südfränkisch: kloin, oiner. Es scheint hier also einen feinen Ausspracheunterschied zu geben, der aber nicht im geschriebenen Text genau erfasst werden kann. Tabelle 3. Realisierung von mhd. /iu/ Nhd. Mhd. Südfränkisch Oberrheinaleman., Bodenseealemannisch Schwäbisch Form Form Südalemannisch heute hiute [hɔɪt] [hɪt] / [hyt] [hɪt], [hyt] [hɔɪt], [haɪt], [huɪt] (vgl. Schwarz 2015: S.229) Badisch-Südfränkisch Heit Owed komm i dortnaa." Badisch-Alemannisch Ich chumm hüt z Obe dörthie" 21
22 Zusammenfassend lässt sich über beide Dialekte Alemannisch und Südfränkisch behaupten: Alle regionalen alemannischen Varietäten weisen den Erhalt der mhd. Monophthonge /î/ und /û/ auf. Das Schwäbische bildet eine Ausnahme und ist durch unterschiedliche Diphthonge vertreten. Das Südfränkische hat die nhd. Diphthongierung durchgeführt und es tendiert stark zum Standarddeutschen. Relevant ist die Feststellung: Bei der nhd. Diphthongierung bleibt das Alemannische beim Monophthong, das Südfränkische und Schwäbische sind diphthongisch realisiert. Schwäbisch scheint am innovativsten zu sein, da es von der Standarsprache als auch von dem Mhd. abweicht Die Neuhochdeutsche Monophthongierung Dieser Lautwandelprozess betrifft mhd. Diphthonge /uo/ und /ie/, die zu [u:] bzw. [i:] monophthongiert wurden. Sein Anfang ist im Mitteldeutschen im 11.Jahrhundert datiert. Die oberdeutschen Dialekte sind von dieser Entwicklung nicht erfasst. In der Untersuchung von Schwarz (2015), der sich detailliert mit dem Lautwandel im Alemannischen auseinandersetzt, ergibt sich Folgendes: Im ganzen alemannischen Raum gilt tendenziell die diphthongische Realisierung, also /ue/ und /ie/. Hingegen im Südfränkischen bildet der Monophthong die dialektale Basis (vgl. Schwarz 2015:S. 343). a) Monophthongierung von mhd. /uo/ Tabelle 4. Realisierung von mhd. /uo/ Nhd. Mhd. Südfränkisch Oberrheinaleman., Bodenseealemanisch Schwäbisch Form Form Südalemannisch gut guot [guːt] [guət] [guət] [guət] (vgl. Beispiel Schwarz 2015: S.346) Badisch-Südfränkisch [ ] wenn d Vulkane gut kehrt sin [...]" Badisch-Alemannisch [ ]sich das guet vorstelle chönne." b) Monophthongierung von mhd. /ie/ Die südfränkische Form ist mit dem Standarddeutschen vergleichbar und bildet einen Monophthong, bei den alemannischen Teildialekten bleibt der Diphthong beibehalten. 22
23 (vgl. Beispiel Schwarz 2015: S.358) Badisch-Südfränkisch Was spielt er denn am libschde?" Badisch-Alemannisch Was spielt er am liebste?" Realisierung des mhd. /ei/ Der mhd. Diphthong /ei/ ist lautsystematisch dem Langvokal /î/ gleichzusetzen (Schwarz 2015: S. 223). Im folgenden Abschnitt möchte ich beobachten, ob sich diese Diphthonge genauso wie die Langvokale /î/ und /û/ entwickelt haben. Diese Entwicklung kann nicht mehr einfach anhand von der Schwarzwaldschranke erklärt werden. In vorherigen Ausführungen konnte man sich auf diese Isoglosse stützen, da sie sehr schön die Varianten voneinander trennte. Die mhd. /ei/-realisierung ist komplizierter. Die Gebiete sind nicht fließend und werden durch kleinere Räume mit unterschiedlichen Diphthongen unterbrochen. Tabelle 6. Realisierung von mhd. /ei/ Nhd. Form Mhd. Form Südfränkisch Heim heim [haɪm], [hɔɪm] Oberrheinaleman., Südalemannisch [haɪm],[heɪm], [he(:)m] Tabelle 5. Realisierung von mhd. /ie/ Nhd. Mhd. Südfränkisch Oberrheinaleman., Bodenseealemannisch Schwäbisch Form Form Südalemannisch lieb liep [liːp] [liəp] [liəp] [liəp] Bodenseealemannisch [hɔm], [haɪm] Schwäbisch [hɔɐm], [hɔɪm] ( vgl. Beispiel Schwarz 2015: S. 180) Die Tabelle zeigt, dass die Realisierung des alten /ei/ <heim> dem neuen /ei/ <Zeit> im Südfränkischen gleicht. Es findet also ein Phonemzusammenfall wie im Standarddeutschen statt. Ich muss allerdings erwähnen, dass sehr kleine Gebiete im Südfränkischen die Form [hɔɪm] realisiert haben. Dies passierte auch mit dem mhd. glîch > südfr. /gloi/. Das mhd. /î/ ist im Oberrhein-, Bodensee- und Südalemannischen als Monophthong /i/ beibehalten. 23
24 Im Beispiel aus dem südfränkischen Dialektbuch kann man zwei unterschiedliche Schreibweisen der Wortwurzel heim beobachten. Das finde ich interessant, allerdings stimmt das immerhin mit der Tabelle überein. Badisch-Südfränkisch Geheimnis" dehoim" Badisch-Alemannisch Gheimnis" deheim" Realisierung von mhd. /ou/ Der mhd. Diphthong /ou/ wird im Südfränkischen monophthongisch realisiert. In allen alemannischen Dialekten hingegen diphthongisch. Tabelle 7. Realisierung von mhd. /ou/ Nhd. Mhd. Südfränkisch Oberrheinaleman., Bodenseealemannisch Schwäbisch Form Form Südalemannisch Frau frouwe [fraː] [fraʊ],[frɔɪ], [frɔɪ] [fraʊ], [froʊ] [fraʊ] (vgl. Schwarz 2015: S.229) Im Dialektbuch gibt es kein einziges Mal das Lexem Frau. Deswegen habe ich ein anderes Beispiel ausgesucht, nämlich mhd. boum. Schwarz (2015) führt zu diesem Lexem keine Untersuchung durch. Ich nehme aber an, dass es sich um den gleichen Diphthong handelt. Das Südfränkische bildet einen langen Monophthong. Diesen markiert der Autor durch die Verdoppelung des Vokals /a/. Sehr schön sichtbar ist dieses Phänomen auch am Verb glauben, mhd. gelouben. Mhd. /ou/ wird zum Monophthong im Südfränkischen, das Alemannische hingegen behält den Diphthong bzw. hier im Dialektbuch die standardsprachliche Schreibung. Badisch-Südfränkisch Unner dem Apfelbaam. Des glaawe dir net! Badisch-Alemannisch Unter dem Öpfelbaum. Du glaubsch [ ] 4.2 Konsonantismus Nach dem ich verschiedene Vokalrealisierungen vorgestellt habe, möchte ich ein Kapitel den Konsonanten widmen, denn auch diese sind für beide Dialekte sehr wichtig zu untersuchen. Es finden zahlreiche Tilgungen, Verschiebungen, Frikativierungen und 24
25 Velarisierungen statt. Ich werde in diesem Fall mit den Karten von Streck (2012) arbeiten. Ich ziehe wieder einen Vergleich mit den mhd. Wortformen, denn diese sind für die weitere Entwicklung der Konsonanten relevant. Anders als bei den Vokalen wird das Gebiet sehr unterschiedlich und unregelmäßig aufgeteilt. Ich werde jedoch die gleiche Tabelle wie bei den Vokalen konstruieren um nicht durcheinanderzukommen. Die Beispiele aus den Dialektbüchern sollen mir helfen einerseits den richtigen alemannischen Teildialekt der alemannischen Version zu bestimmen und weitere Merkmale beider Dialekte (Südfränkisch, Alemannisch) in Kontrast zu stellen. Da es in der folgenden Untersuchung nicht um die genaue Aussprachefeinheiten (wie bei den Vokalen) geht, werde ich auf die phonologische Transkription verzichten und ähnlich wie Streck (2012) den Schwerpunkt nur auf die Verwendung der Konsonanten legen. Die Realisierung von Vokalen bleibt in diesem Kapitel außer Acht Konsonantentilgung a) Ch-Tilgung Wann und ob überhaupt /ch/ getilgt wird, hängt vom bestimmten Lexem ab. Die Entscheidungsrolle dabei spielt die mhd. Form. Je nachdem ob die nhd. Wortform auf das mhd. /ch/ <glich>, mhd. /ht/ <naht> oder mhd. /hs/ <wahsen> geht, wird das /ch/ getilgt oder beibehalten (vgl. Streck 2012: S. 45). Tabelle 8. Ch-Tilgung Nhd. Mhd. Südfränkisch Oberrheinaleman., Bodenseealem. Schwäbisch Form Form Südalemannisch 1 gleich glîch glei,gloi glich, glii, glei glii, glei glii, glei 2 Nacht naht Na(a)cht Na(a)cht Na(a)cht, Naat Na(a)cht, Naat 3 wachsen wahsen wachse wachse wachse waase (vgl. Beispiele Streck 2012: S. 49, S.52, S. 70) 25
26 Im Südfränkischen wird /ch/ nur im Auslaut getilgt. Im Alemannischen ist die ch- Tilgung sehr unregelmäßig aufgeteilt. Meine Hypothese im Laufe meines Schreibens ist mittlerweile, dass die Autorin der alemannischen Version aus dem Gebiet Oberrheinalemannisch oder Südalemannisch stammen muss. Denn nur da wird /ch/ nicht getilgt und sie verwendet im Dialektbuch die Form glich. Zur Veranschaulichung führe ich zu jedem Phänomen Beispiele aus den Dialektbüchern: Originaltext: 1. Ihr gleicht meiner Rose gar nicht, ihr seid noch nichts. 2. Die Nacht war hereingebrochen. 3. Aber der Strauch hörte bald auf zu wachsen Badisch-Südfränkisch: 1. Er isch glei in Träne ausbroche. 2. S war Nacht worre. 3. Awwer der kloine Busch hat ball uffgheert zu wachse [...] Badisch-Alemannisch: 1. Dir sehnt minere Rose überhaupt nit glich. 2. S isch scho Nacht worde. 3. Aber das Hürstli isch bald nimme wachse [...] (Beispiele aus der kleine Prinz" dr chlei Prinz" de kloine Prinz") b) D-Tilgung Die Tilgung von /d/ in Baden-Württemberg ist sehr Positions- und Raumabhängig. Ob /d/ im Auslaut getilgt wird, entscheidet meistens die Tatsache, ob der alte oder neue Auslaut vorliegt. Zu dieser Problematik führe ich eine kurze Erklärung an. Neuer (sekundärer) Auslaut befindet sich in Wörtern, in denen die e-apokope eingesetzt wurde. Übersichtlich wird es am folgenden Beispiel: Sg. Hund, Pl. Hunde > e-apokope im Pl. eingesetzt > *Pl. Hund > d-tilgung > Sg. Hund aber *Pl. Hunn (Beispiel aus Elsass). Zum neuen Auslaut gehört allerdings auch das Wort bald. Hier 26
27 handelt es sich jedoch um die e-apokope aus dem mhd. balde (vgl. Streck 2012: S ). Bei dem alten (absoluten) Auslaut wie in Wörtern (Kind, Hand, Wind) ist die d- Tilgung am wenigsten verbreitet. Ausgerechnet die fränkisch-alemannische Sprachgrenze, die für meine Arbeit von großer Bedeutung ist, weist die d-tilgung auch im absoluten Auslaut auf (vgl. Streck 2012: S ). Tabelle 9. Ch-Tilgung Nhd. Form 1 (wir) sind Mhd. Südfränkisch Oberrheinaleman., Bodenseealemannisch Schwäbisch Form Südalemannisch sin sin/sen sin/ sii sind seine/seie 2 bald balde ball ball bald bald 3 Kind kint (gen. kindes) Kinn/kind Kind/Keid/King/Chi nd chind Kind/kiid (vgl. Karten von Streck 2012: S. 84, S.96, S. 98, S. 115) Beispiele: Originaltext: 1. Wir sind Rosen. 2. Aber der Strauch hörte bald auf zu wachsen [ ]. 3. Sg.: dem Kind widmen, Pl.: Liebe Kinder! Badisch-Südfränkisch: 1. Mir sin Rose. 2. Awwer der kloine Busch hat ball uffgheert zu wachse[ ]. 3. Sg.: Dem Kind widme, Pl:. Ihr Kinner! Badisch-Alemannisch: 1. Mir sin Rose. 2. Aber das Hürstli isch bald nimme wachse [...]. 3. Sg.: Dem Chind widme, Pl.: Liebi Chinder! (Beispiele aus der kleine Prinz" dr chlei Prinz" de kloine Prinz") 27
28 c) N-Tilgung Die n-tilgung ist vor allem für die Untersuchung des alemannischen Sprachraums von großer Bedeutung, denn sie ist im Alemannischen sehr verbreitet. Die n-tilgung kommt sowohl im Hauptakzent als auch im Nebenakzent vor. N-Tilgung im Hauptakzent Die silbenfinale n-tilgung ist bei den häufig verwendeten Wörtern wie bin, Mann, mein, neun, schon oder Wein sowie bei manchen Artikeln ein, klein, den typisch. /N/ wird auch in bestimmten Präpositionen oder Präfixen getilgt z.b. an und von oder bei der Negationspartikel nein. Wenn das silbenfinale /n/ getilgt wird, wird der ursprünglich kurze Vokal gedehnt. Auf diese Weise wird die Tilgung kompensiert (vgl. Streck 2012: S ). Im Hauptakzent unterscheidet man noch separat die n-tilgung vor Frikativ z.b. fünf, hanf, wünschen. Dieses Phänomen wird als Staubsches Gesetz nach Friedrich Staub bezeichnet (vgl. Streck 2012: S. 137). Staub beschreibt in diesem Gesetz nicht nur das Verhalten der Konsonanten, sondern betont eben auch die Eigenschaften des vorangegangenen Vokals, dieser wird gedehnt oder diphthongiert (vgl. Siebenhaar 2000: S. 113). N-Tilgung im Nebenakzent Hierzu gehören Lexeme, die auf en enden. Somit betrifft die Tilgung die ganzen Infinitive 1. und 3. Person Plural und natürlich viele andere Wörter wie z.b. eben, oben, Leben. Dieses Phänomen ist nicht nur fürs Alemannische typisch, sondern auch die Standardaussprache tendiert dazu, die auslautenden /n/ auszulassen. Die n-tilgung ist sehr variabel. Ich versuche trotzdem eine Tabelle zu konstruieren um zu zeigen, ob sich das Südfränkische und Alemannische anders verhalten. Nicht alle Beispiellexeme von Streck konnten in der klein Prinz gefunden werden, in diesem Fall ersetzte ich sie mit anderen Wörtern, die das gleiche Phänomen aufweisen. 28
29 Tabelle 10. Ch-Tilgung Nhd. Form Mhd. Form Südfränkisch Oberrheinalem., Südalemannisch 1 Wein wîn wei wii win (Mittelbaden) 2 schon schône scho, schu schun (Mittelbaden) schu, scho 3 Mann man Mann Mann (West) Maa (Süden) 4 Neun niun nei niin (West), nii (Ost) Bodenseealemannisch wei scho Maa nüün (West), nüü (Ost) Schwäbisch wei schau Maa nei (vgl. Beispiele Streck 2012: S. 165) Für das Lexem Wein und schon ist es ganz eindeutig ausgefallen: Nur ein kleiner geschlossener Raum in Mittelbaden weist den n-erhalt auf: win, schun. Dies kann auf das Elsässische zurückgeführt werden, dass sich noch hinter der Grenzen auswirkt (vgl. Streck 2012: S. 140). An diesem Beispiel erlaube ich mir noch einen kurzen Blick zurück zum Vokalismus. In den Lexemen Wein und neun geht das Südfränkische wie Standarddeutsch diphthongisch vor, aber mit der n-tilgung im Auslaut. Das Schwäbische realisiert auch einen Diphthong. Alle anderen alemannischen Teildialekte bleiben beim Monophthong. Die n-tilgung verhält sich sehr unregelmäßig. Wenn man aber zusammenfassend alle Gebiete nach der Fläche beobachten, kann man behaupten, dass die n-tilgung überwiegend durchgeführt wird. Sowohl im Südfränkischen, als auch im Alemannischen. Den Beispielen aus dem kleinen Prinzen stimmen die meisten Belege mit der Tabelle überein. Eine einzige Ausnahme ist das Lexem neun im Südfränkischen, das laut Schwarz (2012) als nei realisiert wird, der südfränkische Autor schreibt aber standardsprachlich neun. 29
30 Beispiele: Originaltext: 1. Um vier Uhr werde ich mich schon aufregen [ ]. 2. Weniger ernsthaft als die Additionen eines dicken, roten Mannes? 3. Neunhunderttausend. Badisch-Südfränkisch: 1. Um viere bin i dann scho ganz uffgregt [ ]. 2. Isch des net wichdicher wie d Zammezählerei von eme digge rode Mann? 3. Neunhunnertdausend. Badisch-Alemannisch: 1. Am vieri bini drno scho ganz ufgregt [ ]. 2. Isch das nit wichtiger wie die Zemmezerei vome dicke rote Ma? 3. Nünhunderttausig. (Beispiele aus der kleine Prinz" dr chlei Prinz" de kloine Prinz") Fränkische Spirantisierung: Frikativierung von zwischenvokalischem /b/ Ein schönes Beispiel dafür wie zwei Dialektgruppen in einem Bundesland bzw. in der Region Baden aufeinandertreffen. Die fränkische Spirantisierung bzw. Frikativierung von zwischenvokalisch /b/ ist für alle fränkischen Teildialekte typisch. Die Lenisplosive /b/, /d/ und /g/ werden in der intervokalischen Position zu Frikativen abgeschwächt. Die Verbreitung dieses Phänomens reicht bis in den alemannischen Raum. Betroffen ist dann vor allem das Oberrheinalemannische, das ins Südfränkische übergeht (vgl. Streck 2012: S. 197, Steger/ Löffler 1994: S ). Mein Untersuchungsgebiet, Baden Württemberg, wird durch dieses Phänomen auf den Westen und Osten verteilt. Das Schwäbische wurde von diesem Prozess nicht erfasst. Die Schwarzwaldschranke und die Sundgau-Bodensee-Schranke können zur Ausgrenzung der Verbreitung dieses Phänomens im Alemannischen dienen. Daraus ergibt sich, dass der westliche Streifen Baden-Württembergs Frikative realisiert, der Südosten bleibt bei Plosiv (vgl. Streck 2012: S. 197). 30
31 Durch die Analyse zweier Dialektbücher habe ich festgestellt, dass die Frikativierung von /b/ durchaus eine sehr frequente Erscheinung im Südfränkischen ist. Es wäre umständlich eine Tabelle zu konstruieren, da auf jeder Seite des Buches unendlich viele Beispiele zu dieser Erscheinung gefunden werden können. Südfränkisch: (Ich) habe > hawwe, Leben > Lewe, aber > awwer, über > iwwer. Alemannisch: In der alemannischen Version kann man dieses Phänomen nicht finden, die gleichen Beispiele werden im Alemannischen mit dem Plosiv realisiert K-Verschiebung Für den alemannischen Sprachraum stellt die k-verschiebung eine sehr wichtige Nord vs. Süd Grenze dar. Plosiv /k/ wird dabei zum Frikativ /ch/ verschoben. Die Grenzlinie wurde von F. Maurer genannt und heißt, wie schon mehrmals erwähnt, die Sundgau- Bodensee-Schranke. Sie verläuft vom Bodensee horizontal bis zu der deutsch-französischen Grenze. Im Norden bleibt das /k/ beibehalten, im Süden wird zum /ch/ verschoben (vgl. Streck 2012: S. 2017). Zu diesem Phänomen ist die Analyse beider Dialektbücher ganz einfach durchzuführen. Das Südfränkische realisiert den Plosiv /k/, die alemannische Autorin schreibt den Frikativ /ch/. Zu diesem Phänomen ein paar Beispiele aus der alemannischen Version: chleine, Chind, Chrieg, Chopf, choo. Die k-verschiebung ist für mich aufschlussreich, da ich dadurch den Dialekt der alemannischen Autorin besser bestimmen kann. In Frage kommen nur die regionalen Varietäten unter der Sundgau-Bodensee-Schranke, also: Südalemannisch oder Bodenseealemannisch S-Palatalisierung Eine für alle drei Dialektgruppen (Schwäbisch, Südfränkisch, Alemannisch) in Baden- Württemberg sehr typische Angelegenheit, die man als Nicht-Dialektsprecher gleich bemerkt, ist das velare /s/ das in den Dialekten zu palatalem [ʃ] vor den Plosiven /p/ und /t/ ausgesprochen wird. Im Gegensatz zum Standarddeutschen wird [ʃ] in den Verbindungen /sp/ und /st/ nicht nur im Silbenanlaut realisiert, sondern auch im Inlaut. Dieses Merkmal ist für mich insofern spannend, als es sowohl für alle alemannischen als auch für die fränkischen 31
32 Dialekte im Norden Badens gilt und somit eine baden-württembergerische Spezialität ist (vgl. Spiekermann 2008: S. 69). 1 An den Beispielen hat sich eine Inkongruenz zwischen der Theorie und der Praxis gezeigt. Überraschenderweise verwendet die alemannische Autorin das palatale [ʃ] bzw. geschrieben /sch/ nur in den Verben 2.P.Sg.: du muesch, du suechsch, du hesch, weisch usw. In diesen Wortformen muss es im Mhd. das Phonem /t/ im Auslaut gegeben haben, das aber durch die t-tilgung verschwunden ist. Diese Formen blieben trotzdem mit dem palatalen <sch> im Auslaut. In den anderen Lexemen wie z.b. Fenster und fast verwendet sie die standardsprachliche Schreibung Fenster, fast. Dies widerspricht der oben eingeführten Theorie, die sich auf Spiekermanns wissenschaftliche Untersuchung als auch auf die SSA- Daten (Südwestdeutscher Sprachatlas) und letztendlich auf meine alltägliche Erfahrung aus Baden stützt. Der südfränkische Autor verwendet das Graphem <sch> übereinstimmend mit der Theorie konsequent. Sowohl in der 2.P.Sg du hasch, suchsch, weisch als auch in anderen Lexemen, z.b. Fenschder, Aschdronom, Pischdol, Angscht, fascht, Knoschp, Ernschthafd. 5 Morphologische Charakteristika 5.1 Die Artikeluntersuchung und Methode Der detaillierten Artikeluntersuchung möchte ich ein Kapitel widmen. Das Ziel der Analyse ist eine Übersicht der verwendeten Artikelformen in beiden Buchversionen (Alemannisch, Südfränkisch) zu gewinnen. Ich habe alle Artikelformen in ausgewählten Abschnitten in der alemannischen Version notiert. Das gleiche habe ich in jeder Version des Buches durchgeführt, also im Südfränkischen, Standarddeutschen und Französischen. Dadurch ist eine Tabelle der verwendeten Formen in der alemannischen und südfränkischen Version im Vergleich mit dem Standarddeutschen entstanden. Nachträglich habe ich die französische Übersetzung hinzugefügt, die eine Rolle bei dem definiten Artikel spielen wird. 1 Es gibt auch einige Belege aus dem Bairischen, die in bestimmten Lexemen die Palatalisierung aufweisen. Bis zur Linie Mainz-Darmstadt wird in der Pfalz ebenfalls palatalisiert. (vgl. Spiekermann 2008) 32
33 Ich möchte noch darauf aufmerksam machen, dass die von mir konstruierten Tabellen ausschließlich Formen aus den Dialektbüchern der kleine Prinz enthalten. Sie geben also keinerlei allgemeine gesamtalemannische oder fränkische Erscheinungen wieder, sondern vielmehr das Schreibverhalten beider Dialektautoren. Ist die Verteilung unterschiedlicher gekürzten und vollen Artikelformen inkonsequent oder kann sie durch eine phonologische, stilistische oder kontextabhängige Regel geklärt werden? Problematik der Analyse Bei der Analyse bin ich auf mehrere Unklarheiten und Probleme gestoßen, die diese erschwert haben. Zuerst muss die Übersetzungsfreiheit der Dialektautoren in Rücksicht genommen werden. Nicht alle Sätze werden im Alemannischen gleich wie im Südfränkischen widergegeben. Die Suche nach der gleichen Stelle war dadurch beeinträchtigt. Im Extremfall hat der ganze Ausdruck gefehlt und wenn es die entsprechenden Stellen in beiden Dialekten gab, waren sie nicht in der standardsprachlichen Version zu finden. Zweitens muss die Tendenz zu klitischen Formen im Alemannischen betont werden, da die Suche nach einer nicht-klitischen Form das Durchlesen des ganzen Buches erforderte und ohne zufriedenstellende Ergebnisse blieb. Weitere Komplikationen ergaben sich bei den Versuchen zu erklären, wie sich die Verteilung unterschiedlich gekürzter Artikelformen verhält. Dies konnte ich nur mit einigen Hypothesen argumentieren. 5.2 Die Artikel im Alemannischen Sowohl bestimmte als auch unbestimmte Artikel werden im Alemannischen gekürzt. Bei den definiten Artikeln geschieht dies im Anlaut der Vollform (bei Neutra) oder im Auslaut (bei Maskulina und Feminina). Das Ergebnis der Kürzung ist dann ein Formenzusammenfall (Synkretismus). Zum Beispiel fällt die Aussprache von der und die zusammen (vgl. Spiekermann 2008: S. 83). Bei den indefiniten Artikeln zeigt sich der Synkretismus im Nominativ und Akkusativ für alle Genera. Durch die Reduktion entsteht dann laut Spiekermanns Untersuchungen die Form <e> oder <a> für alle Genera im Nominativ und Akkusativ. Da Spiekermann (2008) eine sehr ausführliche Untersuchung zum Regionalstandard in Baden-Württemberg durchführt, möchte ich noch eine seiner Anmerkungen hervorheben: 33
34 Es gibt also eine standardsprachliche Vollform <eine>, eine Kurzform in der Standardsprache < ne> und letztendlich die dialektale Kurzform <e> oder <a>. Man kann also sehen, dass es auch in der Standardsprache üblich ist indefinite Artikel zu verkürzen. In den Dialekten ist die Abkürzung dann noch ausgeprägter (Spiekermann 2008: S. 82) Kasusnivellierung im Alemannischen a) Zusammenfall von Nominativ und Akkusativ Im Alemannischen ist die Akkusativmarkierung beim indefiniten als auch beim definiten Artikel verschwunden. Dieser Prozess ist seit dem 16. Jahrhundert bekannt (vgl. Seiler 2003: S. 224). Seiler (2003) fasst Meyers (1967) Untersuchungen zusammen: der Akkusativ-Artikel hat sich dem Nominativ-Artikel angeglichen. In meiner eigenen Analyse werde ich später zwei Formen für Maskulina feststellen: <dr> und <dä>. In der südlichen und westlichen dr-landschaft [der Deutschschweiz], wo der Nominativ-Artikel sein charakteristisches Merkmal, das auslautende r, bewahrt, hat sich der Akkusativ-Artikel nach dem Nominativ angeglichen. (Seiler 2003: S. 224, zitiert nach Meyer 1967, S. 56f.) Für den Akkusativ wird im Alemannischen also die Form <dr> verwendet. Die Verwendung der Form <dä> für beide Kasus könnte genau umgekehrt durch den n-schwund in <den> erklärt werden (vgl. Seiler 2003: S. 224, zitiert nach Meyer 1967, S. 56f). Es ist für mich nicht weiterhin wichtig, wie es dazu kam und welche Form welcher angeglichen wurde. Relevant für meine Untersuchung ist die Tatsache, dass der Nominativ und Akkusativ bei Maskulina morphologisch ausgeglichen wurden. b) Wegfall des Genitivs Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod (Bastian Sick). Im Alemannischen ist der Genitiv als Kategorie aus dem Paradigma völlig verschwunden. Der Dativschwund ist in den meisten deutschen Dialekten üblich (vgl. Fleischer/Schallert 2011: S ). Der Genitiv wird durch andere Kasus ersetzt oder es wird eine neue Konstruktion gebildet. Am häufigsten wird er durch den Dativ ersetzt. Zum Beispiel durch den possessiven Dativ oder durch die von- Periphrase. Zu diesem Phänomen füge ich zwei Beispiele aus beiden Buchübersetzungen 34
35 hinzu. Alemannisch: Uffem chleine Prinz sim Planet [ ]." Südfränkisch: Uff em kloine Prinz seim Planet [ ]." Der definite Artikel im Nominativ und Akkusativ Zuerst werde ich den Nominativ bzw. Akkusativ behandeln. Die alemannische Autorin verwendet: a) <dr> und <dä> für Maskulina b) <d> und <die> für Feminina c) <s> und <das> für Neutra Bei Maskulina habe ich keinen einzigen Beleg einer Vollform gefunden. Die Verteilung von <die> oder <d> bei Feminina, <dä> oder <dr> bei Maskulina und <das> oder <s> bei Neutra muss analysiert werden. a) Die Formen <dä> und <dr> bei Maskulina Die alemannische Autorin verwendet die Form <dr> öfter als die Form <dä>. Dies habe ich statistisch untersucht. An zufällig ausgewählten Seiten habe ich Belege für beide Formen zusammengezählt. Das Ergebnis: auf 10 Seiten (18, 19, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 68, 69) fand ich 41 Belege für <dr> und nur 12 Belege für <dä>. Dazu kommt noch der Name der Hauptfigur, die immer als dr chlei Prinz erscheint und aus meiner statistischen Untersuchung rausgenommen wurde. Wenn ich diese mitzählen sollte, würde die Frequenz von <dr> noch wesentlich steigen. Wie sich diese Verteilung regelt, ist nicht möglich hundertprozentig zu klären. Daneben kommt auch eine inkonsequente Verteilung in Frage, wenn kein funktionierendes Prinzip erfasst werden kann. Ich führe ein paar Beispiele an, die ein Muster der Verteilung aufweisen. Eine kurze Einführung in die Handlung ist notwendig. Der kleine Prinz begegnet auf verschiedenen Planeten neuen Menschen. In jedem Kapitel wird eine neue Person beschrieben (z.b. der König, Geschäftsmann, Säufer usw.), mit der der kleine Prinz einen Dialog anfängt. Nach dem Muster wird die neue Figur unterschiedlich vorgestellt und am Anfang immer durch einen indefiniten Artikel eingeführt, gefolgt von der Form <dä>. 35
36 Beispiele: 1. Uffem erste het e König gwohnt. Dä König isch in [ ]. Später im Dialog: [ ] het dr König gruefe. Dr König het nüt druf gseit. 2. Uffem zweite Planet het e ganz ibildete Ma gwohnt. Au, luegemol do, do chunnt mi ein go bsueche, wo mi bewundert, het dä ibildete Ma gseit. Später im Dialog: Dr Ibildete het [ ]. 3. Uffem nächste Planet het ein gwohnt, wo suft. Dä Bsuech isch ganz churz gsi. [ ] het er dä Trinker gfrogt. Dä isch in aller Rueh [ ]. Später im Dialog: het dr Trinker gseit. 4. Dr vierte Planet he ime Gschäftsma ghört. Dä Ma isch [ ]. Später im Dialog: Dr Gschäftsma het [ ]. 5. Dr fünfte Planet isch ganz eigeartig gsi [ ]. Dr chlei Prinz het sich überhaupt nit vorstelle chönne was [ ] uffeme Planet ohni Hus [ ] guet si sott. Doch er het sich gseit: Vielleicht spinnt dä Ma e wenig. Aber er spinnt weniger als dr König, dr Trinker, dr Gschäftsma [ ]. Später im Dialog: [ ] het dr Laterneanzünder gseit. 6. Dr sechste Planet isch zehmol so groß gsi. Uf dem het e alte Ma gwohnt. Wo chunnscht her? Het dä alt Ma gfrogt. Später im Dialog: [ ] het dr alt Ma gseit. (Beispiele entnommen aus dr chlei Prinz") Die Form <dä> besitzt vermutlich eine hinweisende Funktion bzw. eine anaphorische Referenz, die emphatisch eingesetzt wird. Im Standarddeutschen würde man diese Form durch dieser ersetzen. Aber in der standardsprachlichen Version gleicht <dä> der Form dieser nicht immer. Aus den obigen Beispielsätzen entspricht statistisch die Form <dä> der Form dieser zu 37% (8 Beispiele für <dä>, davon nur 3 entsprechen dieser). Die alemannische Autorin verwendet also die emphatische Artikelform <dä> öfter, als die Autoren der standarddeutschen Version. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dialektautorin aus dem französischen Original und nicht aus der deutschen Standardsprache übersetzt hat. 36
37 Aus diesem Grund habe ich das Französische ebenfalls unter die Lupe genommen und die definiten emphatischen Artikel ce, cet, cette, ces untersucht. Die gleichen Stellen habe ich wieder in allen Buchversionen miteinander verglichen. Die Belege befinden sich im Anhang. Ich habe festgestellt, dass die Form <dä> im Alemannischen einen emphatischen definiten Artikel darstellt. Dies hat sich im Co-Text an verschiedenen Beispielen gezeigt. Im Vergleich mit der standardsprachlichen deutschen Version hat sich zu 37% bestätigt, dass die Form <dä> als Übersetzung für dieser fungiert. Der Vergleich mit dem Französischen hat die Hypothese befestigt, dass die Form <dä> als definiter emphatischer Artikel eingesetzt wird. Aufschlussreich ist der Beleg Nr. 24. Belege Nr. 28 bis 31 zeigen, dass der emphatische alemannische Artikel auch da auftritt, wo er nicht erforderlich ist, also die Übersetzung ihn nicht verlangt. Somit ist eine endgültige Bewertung schwierig. Im Mhd. diente der ursprüngliche emphatische definite Artikel dër, diu, daʒ als bestimmter Artikel. Die deiktische und anaphorische Funktion hat mit dem häufigen Gebrauch abgenommen, ist im Mhd. aber noch nicht völlig verschwunden. Dadurch entwickelten sich die ursprünglichen emphatischen definiten Artikel zum definiten Artikel (vgl. Paul 1998: S. 224). Der Rückblick ins Mhd. unterstützt meine Hypothese. b) Die Formen <d> und <die> bei Feminina Ich habe vorhin schon bei Maskulina ein funktionierendes Prinzip entlarvt. Ich habe versucht dieses auch an Neutra und Feminina anzuwenden, mit der Hoffnung es sei genauso zu erklären. Es hat in den meisten Fällen funktioniert. Ich habe einige Belege gefunden, die dieses Muster aufweisen, also: standardsprachlich. diese = aleman. die und standardsprachlich die = d aleman. Siehe Belege Nr. 7, 11-13, 34, 36. c) Die Formen <s> und <das> bei Neutra Die Verteilung der Vollform <das> und der Kurzform <s> scheint auch den definiten emphatischen Artikel darzustellen. Laut dieser Hypothese ist die alemannische Artikelvollform definit und emphatisch. Dies zeigt sich auch in Belegen Nr. 2, 6, 15, 33, 35. Wie ich schon bei Maskulina herausgefunden habe, könnten die Vollformen <die> und <das> den definiten emphatischen Artikel darstellen. Diese Emphase ist aber im Alemannischen vermutlich nicht so stark wie im Standarddeutschen ausgeprägt. Dies könnte 37
38 auch erklären, warum die Dialektautorin öfter den definiten emphatischen Artikel verwendet, aber im Standarddeutschen dieser nicht eingesetzt wird. Siehe Belege Nr d) Die Formen <d> und <die> im Plural Die Formen <d> und seltener die Vollform <die> sind die einzigen gefundenen Formen in der alemannischen Version. Auch hier kann die oben eingeführte Hypothese eingesetzt werden. Die Vollform <die> als def. emphatischer Artikel. Siehe Beleg Nr Der definite Artikel im Dativ Aus der deutschen Standardsprache ist die Klitisierung mancher Artikel mit bestimmten Präpositionen üblich z.b. fürs, zum. Im Alemannischen verbinden sich alle Artikel im Dativ mit der vorausgegangenen Präposition zu einer unauflöslichen Einheit. Die klitischen Formen bilden in der alemannischen Version die Mehrheit aller Dativkasus. Aus diesem Grund war es problematisch einen freien Dativ ausfindig zu machen. Der definite Artikel bildet eine enklitische Form folgendermaßen: nach Vokal bei Mask./ Neutr. {-m}, nach Konsonant {-em}. Bei Feminina nach Vokal {-r}, nach Konsonant {- dr}. Der definite Artikel im freien Dativ entsteht durch den Wegfall des Anlautdentals /em/ (vgl. Nübling 1993: S. 101). a) Der Dativ bei Maskulina und Neutra Die Artikelformen im Dativ entsprechen teilweise Nüblings Theorie, z.b. uffem Planet, im Chopf, wegenem Sand, mitem Chopf, em Seil (Beispiele aus dr chlei Prinz"). Ich habe aber auch Belege für nicht-klitisierte Artikelformen gefunden, in denen die Vollform beibehalten bleibt: Unter dem Öpfelbaum, uf dem Planet, dem Stern (Beispiele aus dr chlei Prinz"). Ich habe diese Erscheinung mit der standardsprachlichen Übersetzung verglichen. Es hat sich gezeigt, dass in manchen Fällen das alemannische <dem> der standardsprachlichen Form diesem entspricht, z.b.: aleman. uf dem Planet vs. Standarddt. auf diesem Planeten, aleman. in dem Moment vs. Standarddt. in diesem Augenblick, aleman. an dem Morge vs. Standarddt. an diesem Morgen. Wie es bei Nom./Akk. Mask. der Fall war, ist diese Regel nicht für alle Lexeme gültig. Es ist aber zu vermuten, dass die alemannische Form <dem> den definiten emphatischen Artikel darstellt. 38
39 b) Der Dativ bei Feminina Der Dativ bei Feminina gestaltet sich in der alemannischen Version anders. Bei dem definiten Artikel kommen nicht-klitische Formen vor, z.b. wege dr Seilwinde, in dr Sahara, vor dr ganze Welt, uf dr Erde, mit dere Schlange, in dere Nacht, vo dere Mur, in der Sahara, mit der Zit. (Beispiele aus dr chlei Prinz"). Es gibt also die Form <dr> wie bei Maskulina, Nom./Akk., die Form <dere> und die Vollform <der>. Auch hier ist fraglich, wie sich diese Verteilung verhält. Bei <dere> bietet sich wieder der definite emphatische Artikel an. Im Vergleich mit der standardsprachlichen Übersetzung konnte ich leider nicht genug Belege finden, die diese Hypothese völlig bestätigen würden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die alemannische Autorin mit <dere> tatsächlich einen definiten emphatischen Artikel meint. Den Kontext würde es in den von mir angeführten Beispielen nicht stören. hundertprozentig klären. Siehe Beleg Nr. 34. Ob es dem wirklich so ist, kann ich nicht c) Der Dativ im Plural Für den Plural ist die Form <de> und <dene> gebräuchlich. Die Form <de> ist durch den n-schwund begründbar, z.b: Dr Chrieg zwische de Schof und de Rose. Die Form <dene> stellt den definiten emphatischen Artikel vor. Siehe Belege Nr Der indefinite Artikel im Nominativ und Akkusativ Beim indefiniten Artikel war meine Analyse durch gleiche Formen im Nom./Akk. für alle Genera wesentlich erleichtert. a) Die Formen <ne> und <e> für alle Genera Im Nom./Akk. aller Genera kommen zwei indefinite Artikelformen vor: <e> und <ne>. Zuerst habe ich mich auf den Co-Text konzentriert. Ich war der Meinung, dass es daran liegt, ob ein Zahlwort vorliegt oder der Artikel betont wird. Allerdings hat sich dies nicht bestätigt. Die Regel war einfacher, als ich gedacht habe: Die Verteilung von den Artikelformen <ne> und <e> hängt vom vorausgegangenen Laut ab. Dieser Regel nach liegt dann <ne> nach einem Vokal und <e> nach einem Konsonanten vor. Zur Veranschaulichung belege ich meine Hypothese mit einigen Beispielen für alle Genera. 39
40 Mask.: Numme du würsch e Stern ha [ ] (S. 87). Chumm, mer gön go ne Brunne sueche[ ](S. 77). S isch doch verruckt, in dr unerdlich große Wiesti einfach druflos e Brunne go sueche (S. 77). S isch guet, wemme ne Fründ gha het [ ] (S. 76) Fem.: Wenn du ne Blueme gern hesch [ ] (S. 89). Neutr.: Ich bruch e Schof, mol mer e Schof (S. 14). Das Wasser isch nit numme ne normal Getränk gsi (S. 80). (Beispiele aus "dr chlei Prinz") Der indefinite Artikel im Dativ Der indefinite Artikel im Dativ kommt in unterschiedlichen Formen vor. Die Mehrheit der Formen ist wie beim def. Artikel klitisch. Es wurden Formen wie: vonere (von einer), uffeme (auf einem), ame (an einem), usseme (aus einem) gefunden. Nübling (1993) führt kombinatorische Allomorphe für indef. Artikel auf: {eme}, {emene}, {re}, {ere}. Bei der Form {emene} handelt es sich um eine ältere Form, die durch die kürzere {eme} allmählich ersetzt wird. Interessanterweise ist der def. Artikel in der indef. Form markiert bzw. der indef. Artikel unterscheidet sich durch das zusätzliche {e} im Auslaut (vgl. Nübling 1993: S. 102). Die meisten Beispiele aus dem Dialektbuch (uffeme Planet, ame schöne Morge, vonere Rose usw.) entsprechen der Theorie von Nübling (1993). Die alemannische Autorin verwendet aber noch eine andere Form bei Mask. und Neutr. : <ime>. Die Form <ime> ist durch die Verbindung der Präp. <in> + Allomorph {me} erklärbar: ime Buech. Seltsamerweise gibt es diese Form auch in der nicht-klitischen Verwendung: Dr vierte Planet het ime Gschäftsma ghört. Wenn ich ime General dr Befehl gebt." Diese Erscheinung ist ein Thema für eine ganze wissenschaftliche Arbeit: Seiler (2003) behandelt eine ähnliche Problematik in seinem Buch Präpositionale Dativmarkierung im Oberdeutschen." Aus meiner Analyse der alemannischen Version Dr chlei Prinz ergeben sich folgende Tabellen mit dem indef. und def. Artikel. Sg. und Pl. Diese Formen stammen ausschließlich aus dem untersuchten Material. 40
41 Tabelle 11. Artikel Sg. im Alemannischen Kasus Form + def Sg. def Sg. Mask. Fem. Neutr. Mask. Fem. Neutr. Nom. Nichtklitisch dr, dä d,die s,das e,ne e,ne e,ne Emphatisch dä die das x x x Dat. Nichtklitisch em, dem dr, dere, der em, dem eme, ime ere eme, ime Klitisch =em x =em =eme =ere =eme Emphatisch dem dere dem x x x Akk. Nichtklitisch dr/dä d/die s/das e/ne e/ne e/ne Emphatisch dä die das x x x Tabelle 12. Artikel Pl. im Alemannischen Kasus Form + def Pl. -def Pl. Nom. Dat. Akk. Nicht-klitisch d, die Ø Emphatisch die Ø Nicht-klitisch de Ø Emphatisch dene Ø Nicht-klitisch d, die Ø Emphatisch die Ø 41
42 5.3 Die Artikel im Südfränkischen Der definite Artikel im Nominativ und Akkusativ In der südfränkischen Version habe ich folgende def. Artikel gefunden: <de>, <den> und <der> für Maskulina, <s> und <des> für Neutra, <d>und <die> für Feminina und <d> für Plural. a) Formen <de>, <der> für Maskulina und <s>, <des> für Neutra im Nominativ Beide Genera sind im Buch durch zwei Formen vertreten: eine Kurzform und eine Vollform (bei Neutr. mit Vokalwechsel). Die Verwendungsfrequenz scheint nach dem groben durchlesen relativ ausgeglichen zu sein. Warum vor manchen Nomen die Kurzform und vor manchen die Vollform erscheint, ist nicht möglich hundertprozentig zu klären. Eine phonetische Begründung ist nicht plausibel, zumindest wenn man die darauffolgenden Laute betrachtet: der Planet, de Beweis, de Aschderoid. Die Hypothese, dass die Vollform Neutr. <des> und Mask. <der> einen definiten emphatischen Artikel darstellt, ist in vielen Fällen sehr wahrscheinlich. Folgende Beispiele gleich am Anfang des Buches können diese Hypothese unterstützen. Standardsprache: Ich bitte die Kinder um Verzeihung, dass ich dieses Buch einem Erwachsenen widme.[ ]. Dieser Erwachsene kann alles verstehen [ ]. Dieser Erwachsene wohnt in Frankreich [ ]. [ ] will ich dieses Buch dem Kinde widmen [ ]. Südfränkisch: Ihr Kinner! Nemmt mer s net iwwel, dass i des Buch do eme Erwachsene gwidmet hab. Der kann alles verstehe [ ]. Der wohnt in Frankreich [ ].will i des Buch gern dem Kind widme. (Beispiele aus de kloine Prinz" und dr chlei Prinz") Alle emphatischen definiten Artikel sind im Südfränkischen mit der Vollform <der> und <des> besetzt. Dieses Muster funktioniert in einigen weiteren Beispiele gut: südfr. der Vorschlag vs. Standardspr. dieser Vorschlag, aber leider nicht in allen Fällen. Im Prinzip funktioniert die Verteilung gleich wie im Alemannischen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die 42
43 Vollformen also eine emphatische Markierung aufweisen. In der französischen Übersetzung hat sich diese Regel bestätigt. Siehe im Anhang Belege Nr. 1, 5, 18, 19, 24, 25, 28. b) Formen <de>, <den> für Maskulina im Akkusativ Anders als im Alemannischen wird im Südfränkischen der Akk. Mask. markiert. Die Unterscheidung vom Nom. und Akk. ist nur bei der Vollform <den> möglich. Bei der Form <de> fallen beide Kasus in der Aussprache wieder zusammen. Die Verteilung dieser Formen könnte man genauso wie im obigen Abschnitt erklären. Also: die Vollform emphatisch markiert, die Kurzform nur definit ohne Emphase. Belege Nr. 8, 9, 26. c) Die Form <d> für Feminina im Nominativ/Akkusativ Unkompliziert zu untersuchen war die Artikelform fem. Nom./ Akk. In allen Belegen die Kurzform <d>, lediglich in einem Beleg die Vollform <die>, die einmal als Übersetzung des def. emphatischen Artikel funktioniert hat. In den anderen Belegen ist aber im Unterschied zum Alemannisch keine Regel gefunden worden. Ich vermute, dass der def. emphatische Artikel bei Feminina im Südfränkisch gar nicht verwendet wird. Dies beweisen Belege Nr. 11, 13, 17, 36. In anderen Übersetzungen (Alemannisch, Deutsch, Französisch) war der def. emphatische Artikel eingesetzt, im Südfränkischen seltsamerweise nicht. d) Die Form <d> im Plural Hierzu habe ich nur die Form <d>gefunden Der definite Artikel im Dativ a) Formen <em> und <dem> bei Mask. und Neutr. Das Südfränkische stimmt mit dem Alemannischen mit einem einzigen Unterschied überein: das Südfränkische bildet fast keine klitischen Formen. Aus meiner Recherche ein Einzelbeleg: Uffm Planet. In anderen Belegen aber nicht-klitisch: uf em Planet. Die Verteilung von <dem> und <em> stimmt in Belegen Nr. 10, 21, 35 mit meiner Hypothese überein. Die Vollform wird vermutlich als def. emphatischer Artikel verwendet. 43
44 b) Formen <de>, <dere> bei Fem. Mit dere Schlange, mit dere Verabredung, in de Hand. (Beispiele De kloine Prinz") Die Verteilung kann durch die in obigen Abschnitten erwähnte Hypothese begründet werden. Die Kurzform ist nicht emphatisch markiert, die Form <dere> kann wiederum an vielen Stellen als ein abgeschwächter def. emphatischer Artikel verstanden werden. Als abgeschwächt bezeichne ich ihn, da er in den Dialektbüchern verwendet wird, auch wenn es die Übersetzung nicht verlangt. c) Plural Formen <de>, <denne> Gleich wie im Alemannischen: die Form <denne> stellt den def. emphatischen Artikel vor Der indefinite Artikel Die indef. Artikeformen sind leichter zu untersuchen, denn sie im Südfränkischen in keinen Doppelformen auftreten. Der Akk. und Nom. wird nicht unterschieden. a) Mask. Form <en> b) Neutr. Form <e> c) Fem. Form <e> Im Dativ gibt es zwei Formen <eme> und <ere> wie im Alemannischen. Der südfränkische Dialektautor verwendet allerdings keine klitischen Formen. 44
45 Tabelle 13 Artikel Sg. im Südfränkischen Kasus Form + def Sg. def Sg. Mask. Fem. Neutr. Mask. Fem. Neutr. Nom. de, der d,die s, des en e e Emphatisch der d, die des x x x Dat. em de, dere em eme ere eme Emphatisch dem dere dem x x x Akk. Nichtklitisch Nichtklitisch Nichtklitisch de/den d/die s/des en e e Emphatisch den d, die des x x x Tabelle Nr. 14 Artikel Pl. im Südfränkischen Kasus Form + def Pl. -def Pl. Nom. Dat. Akk. Nicht-klitisch d Ø Emphatisch d Ø Nicht-klitisch de Ø Emphatisch dene Ø Nicht-klitisch d Ø Emphatisch d Ø 5.4 Direkter Vergleich Alemannisch vs. Südfränkisch 45
46 Im direkten Vergleich zeigt sich, dass beide Dialektautoren in der Artikelverteilung sehr ähnlich vorgehen. Der Hauptunterschied ist der Akkusativ, der im Alemannischen nicht markiert wird. Im Südfränkischen wird er wie in der Standardsprache durch den Suffix {-en} markiert. In der Kurzform <de> ist er aber auch nicht vom Nominativ unterscheidbar. Der definite emphatische Artikel ist im Alemannischen durch die Vollformen Sg. und Pl. für alle Genera vertreten. Im Südfränkischen funktioniert dieses Prinzip nur teilweise. Bei Maskulina und Neutra ist zu vermuten, dass <des> und <der> den def. emphatischen Artikel darstellen. Bei Feminina hat diese Hypothese in den meisten Fällen nicht funktioniert. Genauso wie im Plural, in dem im Südfränkischen nur die Form <d> vertreten ist. Im Alemannischen ist die Vollform im Plural emphatisch markiert. a) Der definite Artikel Maskulin Feminin Neutrum Plural Alem. Südfr. Alem. Südfr. Alem. Südfr. Alem. Südfr. Nom. dr,dä de, der d, die d s, das s, des d, die d emphatisch dä der die die, d das des die d Dat. em, em, dr de em, dem em, de de dem dem dem emphatisch dem dem dere dere dem dem dene denne Akk. dr,dä de, den d,die d s, das s, des d, die d emphatisch dä den die d das des die d b) Der indefinite Artikel Maskulin Feminin Neutrum Plural Alem. Südfr. Alem. Südfr. Alem. Südfr. Alem. Südfr. Nom. e, ne en e, ne e e, ne e Ø Ø Dat. ime, eme eme ere ere ime, eme eme Ø Ø Akk. e, ne en e, ne e e, ne e Ø Ø 46
47 5.5 Präteritumschwund Gemäß Nübling (2000) ist der Präteritumschwund eine der markantesten morphologischen Entwicklungen im Alemannischen. Darunter versteht man das Verschwinden des Präteritums aus dem Sprachgebrauch und sein Ersatz durch die Perfektperiphrase (vgl. Nübling 2010: S ). Im Ahd. galt das Perfekt noch nicht als ein eigenständiges Tempus, sondern hatte eine starke aspektuelle Prägung. Durch die Perfektform markierte man die Resultativität der Handlung, die sich bis in die Gegenwart auswirkt (Nübling 2010: S.253). Auf diese Weise konnten ahd. imperfekte Verben durch das Präfix {gi-} zu perfektiven umgewandelt werden. Zuletzt betraf diese Entwicklung auch perfektive Verben wie z.b. treffen, bringen oder finden. Im Frnhd. hat sich das Präfix {ge-} für die Bildung des Partizip II etabliert (vgl. Nübling 2010: S ). Im Mhd. wurde die Perfektperiphrase schon als ein Tempus verstanden und der Gegenwartsbezug ist durch einen Vergangenheitsbezug ersetzt worden. Am Beispiel des Englischen kann man die Beziehung des Perfekts zur Gegenwart übersichtlich skizzieren. *I have seen her yesterday ist nicht grammatisch richtig, weil das Lexem yesterday eben schon die Vergangenheit markiert. Das Perfekt im Englischen hat immer noch den Gegenwartsbezug, z.b. I have known her for some time. Im Kontrast ist der Satz Ich habe sie gestern gesehen korrekt, da das Deutsche diesen Gegenwartsbezug beim Perfekt verloren hat (vgl. Beispiele Nübling 2010: S. 253). Abschließend ist also festzustellen, dass es im ganzen oberdeutschen Raum keine synthetischen Präteritalformen mehr gibt. Dieses Phänomen gilt also für beide untersuchte Dialekte: Alemannisch und Südfränkisch. Die synthetischen Präteritalformen von sein sind meistens nicht gebräuchlich. Es gibt allerdings Gebiete, in denen diese Formen zugelassen sind, z.b. das Südfränkische. Die Isoglosse für den Formenschwund verläuft durch das Mitteldeutsche. Dieser Prozess ist nicht abgeschlossen und weitet sich in den Norden aus E-Apokope: Relevante Ursache des Präteritumschwunds Der Präteritumschwund wurde höchstwahrscheinlich durch die e-apokope in oberdeutschen Dialekten ausgelöst. Unter zahlreichen Thesen zu den möglichen Ursachen des Präteritumschwunds scheint diese für die Dialektforschung am plausibelsten zu sein. Diese These betont Schwächen des Präteritums uns ist rein aus der phonologischen Sicht 47
48 begründbar. Im Alemannischen findet die e-apokope in der 1. und 3.P, Sg., Prät. statt: Er machte > er macht_. Dadurch kommt es zu einem Tempuszusammenfall zwischen Präsens und Präteritum. Um diese Formen voreinander unterscheiden zu können, wurde das Präteritum durch die Perfektperiphrase ersetzt. Das Verbreitungsgebiet des Präteritumschwunds entspricht dabei der Verbreitung der e-apokope und die These ist somit sinnvoll begründet (vgl. Nübling 2010: S. 254). Weitere Thesen machen im Gegensatz zu der schon skizzierten die Stärken des Perfekts zum Gegenstand (Perfektexpansion). Alle Pro und Kontra für verschiedene Thesen können im Rahmen meiner Bachelorarbeit nicht behandelt werden (vgl. zum Bairischen Schnelzer 2008). Alle Präteritalformen treten in der alemannischen Version nur in der Perfektperiphrase auf. Im Südfränkischen wird auch nur der Perfekt verwendet (auch die Form hatte als hab ghet), aber mit einer Ausnahme: das Verb sein. Alemannisch Woni sechs Johr alt gsi bi [ ] vs. Südfränkisch Wie i sechs Johr alt war [ ]. (Beispiele aus dr chlei Prinz" und "de kloine Prinz") 5.6 Kurzverben im Alemannischen Der Präteritumschwund wirkte sich auch auf die Syntax. Es fällt sofort auf, dass es sprachökonomisch nicht das Sinnvollste ist alle Präterita durch die Perfektperiphrase zu ersetzen. Im Prinzip steht dann eine einsilbige synthetische Form einer vier- bis fünfsilbigen analytischen Form gegenüber, z.b.: er sprach vs. er hat gesprochen (vgl. Nübling 2000: S. 225). Um diese umständlichen Phrasen zu minimieren, hat das Alemannische sog. Kurzverben realisiert. Es treten starke Reduktionen, Assimilationen und Kontraktionen auf. Nübling betont, dass es sich dabei um keinen Zufall sondern um ein funktionierendes Prinzip handelt, z.b. Ich habe gegeben i ha ggä, wir haben gesehen mir hän gse, wir sind gekommen mir sind cho, wir kamen mir sind cho (vgl. Beispiele Nübling 2000: S. 227). Die Partizip-II-Formen sind in Analogie zum Infinitiv entstanden. Die Infinitivform sy ist aus dem mhd. sîn entstanden, d.h. die nhd. Diphthongierung wurde nicht durchgeführt. Im Alemannischen sind die Infinitive um den Auslaut {-n} gekürzt, z.b. ha, sy. 48
49 Das Präfix {ge-} wird reduziert und assimiliert an das folgende Element. Phonemabhängig assimiliert das Präfix {ge-} total oder partiell (Nübling 2000: S. 226). a) Progressive Assimilation (Kontaktfortisierung) tritt ein, wenn ein Plosiv folgt z.b. gebacken > pache. b) Eine regressive Assimilation findet statt, wenn ein stimmloses Sonorant folgt z.b. gehabt > gha oder gewesen > gsy/ksy. (vgl. Nübling 2000: S. 226) Die folgende Theorie und Beispiele beziehen sich auf schweizerdeutsche Dialekte. Diese Formen wurden aber auch in dr chlei Prinz (Badisch-Alemannisch) gefunden. Die Perfektauxiliare haben ebenfalls reduzierte Minimalformen. Diese sind einsilbig und phonotaktisch einfach (Nübling 2000: S. 226). Infinitiv haben/sein ha sy Präsens Sg. ha, hesch, hesch bi, bisch, isch Präsens Pl. hän(d) sin(d) Part.Perf. gha gsy (Tabelle aus: Nübling 2000: S. 226, Figur 5) Im Ganzen und Großen kann man an folgenden Beispielen sehen, dass das Alemannische sprachökonomisch umgegangen ist und die Perfektpriphrase minimalisiert hat. Diese Minimalformen sind mit den nhd. Präterita von der Länge her vergleichbar. Die Realisierung der Kurzverben im Alemannischen gilt nicht nur für die Perfektperiphrase. Wenn man sich zum Beispiel die schweizerdt. Grammatik anschaut, sind die Kurzverben als eigene Verbgruppe gelistet. Zu dieser Gruppe gehören dann insgesamt 13 Kurzverben: gaa (goo) gehen', staa (stoo) stehen', schlaa (schloo) schlagen', afaa (afoo) anfangen', laa (loo) lassen', haa haben', syy sein', tue tun', gsee sehen', zie ziehen', choo kommen', gëë geben', nëë nehmen' (vgl. Nübling 1995: S. 166). Nübling (1995) zieht einen Vergleich mit dem Schwedischen. Da ich selber ein Seminar im Schwedischen abgelegt habe, konnte ich es nicht unbemerkt lassen, dass die alemannischen Kurzverben dem Schwedischen sehr ähneln. Zum Beispiel: gaa vs. gå, staa vs. stå. 49
50 Prototypisches Paradigma (schweizerdt. gaa) Infinitiv haben/sein Präsens Sg. Präsens Pl. Part.Perf. Konjunktiv: gaa i gaa(n) du gaasch er gaat mir/ir/si gönd ggange göng Imperativ: gang! (Tabelle aus: Nübling 1995: S. 168) Die alemannischen Kurzverben gaa und staa gehören zu den alten Mi-Verben. Das Suffix {-mi} markierte im Urindogermanischen die 1. Sg. Präs.: *ghe-mi. Daraus entwickelte sich lautgesetzlich ahd. gam, mhd. gan und alemannisch gaa/goo. Neben den alten Kurzverben gibt es im Alemannischen jedoch eine innovative junge Gruppe. Dazu gehören Verben: gää/gee geben', nää/nee nehmen', koo/chaa/choo kommen'. Die unterschiedlichen Realisierungen sind auf die Dialektunterschiede zwischen Basel und Zürich zurückzuführen. Diese Kontraktionen sollen am Ende des 13. Jh. begonnen haben (vgl. Nübling 1995: S. 171). Weiter werde ich mich mit anderen Verben nicht befassen. Wichtig für meine Arbeit ist die Tatsache, dass manche alemannische Kurzverben ihr Ursprung im Urindogermanischen haben und eine andere Gruppe sich sehr innovativ entwickelt hat. Das Alemannische ist in dieser Hinsicht innovativ und konservativ zugleich Verbverdopplung im Alemannischen Das verdoppelte Verb ist ein weiteres Phänomen, das im Alemannischen sofort auffällt und mit den Kurzverben zusammenhängt. Betroffen sind vier Verben: goo gehen', choo kommen', loo lassen' und aafoo anfangen' In der Kombination eines diesen Verben und eines nachfolgenden Infinitivs verdoppelt sich das Kurzverb. Dabei bleibt das erste Kurzverb in der finiten Form, das zweite in der infiniten Form und dann folgt noch der Infinit des zweiten Verbs z.b. I gang go schaffe (ich gehe gehen arbeiten), Ich werde arbeiten.' Die Kurzverben haben sich nicht nur verdoppelt, sondern stellen also ein besonderes alemannisches Tempus vor. Die Verben goo 50
51 und choo markieren eine unmittelbare Zukunft. Nübling (1995) betont die semantische Leere des finiten Hilfsverbs, wodurch die Wiederaufnahme des Vollverbs genötigt wird (vgl. Nübling 1995: S. 173). In der alemannischen Version dr chlei Prinz kann man die doppelten Verben finden, z.b.: Dr chlei Prinz isch gange go d Rose anluege. Der kleine Prinz ging, die Rosen wiederzusehen'. Dieses Phänomen ist in der südfränkischen Version nicht vertreten. 5.7 Einheitsplural Unter dem Begriff Einheitsplural ist die Aufhebung der Personendifferenzierung in der 1., 2., 3. P. Pl. Ind. Präs. Akt. zu verstehen. In westlichen Varietäten des Alemannischen wird diese Form durch das Allomorph {e}, im Schwäbischen durch {et} oder {at} gebildet (vgl. Besch u.a. 1983: S. 1171, S. 283, S. 323). Spiekermann (2008) schreibt: Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen dem Südfränkischen und dem Alemannischen ist die morphologische Markierung der 3. Person Plural als <e> bzw. <et>. In diesem Zitat entgeht mir aber, was der Autor eigentlich ausdrücken wollte. Das Seltsame ist vor allem, dass Spiekermann (2008) nur die 3. P. Pl. als ein Unterscheidungsmerkmal erwähnt, Besch u.a. (1983) aber über den Einheitsplural in allen Personen berichtet. Kunze (1993) erwähnt die Linie mähe/mähet, die das Alemannische auf den Westen und Osten verteilt. Laut dieser Isoglosse müsste dann östlich in allen Personen Pl. das Suffix {-et} und westlich das Suffix {-e} vorkommen (vgl. Kunze 1993: S. 27). Ich versuche dies an den Beispielen aus den Dialektbüchern zu prüfen, dabei gehören beide untersuchte Dialekte dem westlichen Teil, also der Form {-e} an. Alemannische Version: 1.P. Pl.: Mir schwätze jetz scho ein Monat mitenander." 2.P. Pl: Do chönnet der ich vorstelle [ ]." 3.P.Pl: Wenn sie emol verreise, chönne sie das bruche [ ]." 51
52 Südfränkische Version: 1.P. Pl.: Mir redde scho en ganze Monat midenanner." 2.P. Pl: Do kennt eich vorstelle [ ]." 3.P. Pl: Wenn die emol verreise [ ]." (Beispiele aus Dr chlei Prinz" und de kloine Prinz") Beide Dialektautoren unterscheiden die 2. P. Pl. durch das Suffix {-(e)t}, wie in der Standarsprache. Die 1. und 2. Person enden zwar auf {-e}, dies könnte aber durch die n- Tilgung begründet werden. Der Einheitsplural wird also in der Dialektologie beschrieben, aber in diesen Dialektbüchern nicht vollzogen. Welche Gründe dazu die Autoren geführt haben, ist nicht möglich zu beantworten. 6 Lexikalische Charakteristika Da die Lexik eines Dialekts sehr umfangreich ist, ist ihre allgemeine Beschreibung für den ganzen alemannischen und südfränkischen Raum im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Im folgenden Kapitel werde ich mich nur auf lexikalische Besonderheiten aus beiden Dialektbüchern konzentrieren und ein paar von diesen vorstellen. Anschließend werde ich ihre Bedeutung in verschiedenen Lexika suchen. Unter einer Besonderheit verstehe ich ein Lexem, das im Text für einen Nicht-Dialektsprecher unverständlich ist. Manchmal entstehen diese Wörter durch Kontraktionen, Vokalwechsel, verschiedene Tilgungen usw. Die Lexeme, die diese komplizierte Entwicklung durchlaufen haben und sich sehr von dem Standarddeutschen unterschieden, sind meistens im Dialektwörterbuch verzeichnet (z.b. öbber). Es gibt auch dialektspezifische Lexeme, die anderswo nicht bekannt sind (z.b. Rüngli), diese sind ebenfalls im Dialektwörterbuch zu suchen. Für mein untersuchtes Gebiet sind vor allem Das alemannische Wörterbuch und Das badische Wörterbuch von Bedeutung. Neben diesen existiert auch Das schwäbische Wörterbuch, Wörterbuch elsässischer Mundarten u.a., bis zu den kleineren Wörterbüchern, die z.b. die Mundart einer Stadt beschreiben. 52
53 6.1 Ausgewählte Lexeme a) Aleman. öbber, öbbis vs. südfr. jemand, ebbes [ ] wenn öbber sonigi findet. Aber öbbis Ernsthafts isch nit grad. Das isch wirklich zue öbbis guet. (Dr chlei Prinz, Alemannisch) Um diesen Ausdruck zu verstehen, reichen die allgemeinen Regeln zum Vokalismus und Konsonantismus nicht aus. Zur Bedeutung dieses Wortes musste ich im alemannischen Wörterbuch recherchieren. Ebber, öbber, öpper, eäpper irgendwer, jemand, ebbis, eppis, eäppis, öbbis, öppis etwas, irgendetwas (vgl. Alemann. Wörterbuch Post/Scheer-Nahor 2009: S. 83). Diese Lexeme sind verdunkelte Komposita aus mhd. ete-wa, ete-wer, ete-was, die die oberdeutsche Lautentwicklung /tw/ > /pp, bb/ durchlaufen haben (vgl. Post/Scheer- Nahor 2009: S. 83). Die unterschiedlichen Formen sind für regionale Varietäten spezifisch. Die ö-haltige Form öbber ist lediglich im Südwesten zwischen Lörrach und Müllheim verbreitet. Diese Feststellung könnte die Frage beantworten, woher die alemannische Autorin stammt, bzw. in welcher regionalen Varietät des Alemannischen sie schreibt. Laut folgender Karte müsste sie auf Südalemannisch schreiben. Dafür spricht übrigens auch die Verschiebung /k/ zu /ch/, die nur südlich der Sundgau-Bodensee-Schranke durchgeführt wurde. (Abbildung 2. Alemannisches Wörterbuch Post/Scheer-Nahor: S. 83) 53
54 In der südfränkischen Buchversion kommt das Lexem öbber als standardsprachlich jemand vor und nicht die Form iäme/eäme, die laut Karte zu erwarten wäre. Interessanterweise gilt das nicht für das Wort etwas. Dieses wird im Südfränkischen als ebbes übersetzt. b) Hürst/Hürstli [ ] dass d Affebrotbäum keini Hürst sin. [ ] aber das Hürstli istsch bald nimme gwachse [ ]." (Dr chlei Prinz, Alemannisch) Ein weiteres Wort, das im Buch ohne Dialektkenntnisse unverständlich ist. Im alemannischen Wörterbuch ist dieses Lexem als Hurscht eingetragen, Pl. Hürscht Strauch, Hecke, Gebüsch, aus mhd. hurst (vgl. Alemann. Wörterbuch Post/Scheer-Nahor: S. 162). Das Lexem Hürstli ist durch die Diminutivendung {-li} entstanden. Dieses Lexem sieht dem standarddeutschen Horst Raubvogelnest ähnlich. Das Wort Horst hat sich aus dem ahd. hurst, mhd. hurst Gebüsch, Gestrüpp, Hecke entwickelt. Das ist sehr interessant, denn dies bedeutet, dass das Lexem Hurscht im Alemannischehn (vermutlich durch die s- Palatalisierung im Auslaut entstanden) die mhd. Bedeutung bewahrt hat. Im Standarddeutschen hat sich die Bedeutung verschoben deutschen Sprache). (vgl. Digitales Wörterbuch der Im Südfränkischen befindet sich dieser Ausdruck nicht, er wird als Busch übersetzt. Im Standarddeutschen erscheint dieses Lexem als Strauch. c) Rüngli Noneme Rüngli het dr chlei Prinz gseit. (Dr chlei Prinz, Alemannisch) Im alemannischen Wörterbuch als Rung Augenblick, Weile verzeichnet (S. 271). Die Form Rüngli ist ähnlich wie Hürstli durch die Diminutivendung {-li} entstanden. Es handelt sich um eine ablautende Bildung *Rung zu ringen (wie Schwung zu schwingen), mit der noch im Schweizerischen bezeugten Grundbedeutung kurze Bewegung (vgl. Badisches Wörterbuch: S. 371). Dieses Lexem ist weder in der südfränkischen noch in der standardsprachlichen Version vertreten. 54
55 d) Numme [ ] und jetzt hani numme ne ganz gwöhnlichi Rose. (Dr chlei Prinz, Alemannisch) Auch dieser Ausdruck war für mich unverständlich, er konnte aber durch die häufige Verwendung im Kontext geklärt werden. In der Übersetzung nur, bloß. Dies geht auf mhd. niwan zurück. Daraus entwickelte sich die alemannische Form mit Übergang des /w/ in /m/ niuman, [ ], numma, numme (vgl. Grimms Wörterbuch Online; Alemannisches Wörterbuch Post/Scheer-Nahor: S. 241). Die Form numme macht den Eindruck, als ob es sich um zwei verschmolzene Lexeme handeln würde, etwa wie nicht mehr, nur mehr. Dies hab ich in der deutschen Übersetzung geprüft. Es hat sich bestätigt, dass numme nur in der Bedeutung nur, bloß im Alemannischen auftritt. Dies geht auch aus weiteren Beispielen hervor: [...] isch numme ne Hülle. Numme d Chinder [...]. Außerdem ist die alemannische Übersetzung für nicht mehr nimme, z.b. Sie wüsse nimme. Das Südfränkische ersetzt diese Form durch standardsprachlich bloß. e) Aleman. nüt, nit vs. südfr. nix, net Alemannisch: [ ] het aber nüt gseh. [ ] nit wichtig. (Dr chlei Prinz) Südfränkisch: Des isch net mei Schuld. Des macht nix. (De kloine Prinz) Diese Lexeme sind im Kontext als nichts und nicht verständlich. Allein die Form nüt nichts könnte Probleme beim Verstehen bereiten. Dieses Lexem nimmt ebenfalls unterschiedliche Formen im Rahmen des Alemannischen an z.b. ned, net, nid, it, nid, niit, nüd. Diese Formen sind aus dem mhd. Genitiv nihtes entstanden (vgl. Grimms Wörterbuch Online). Die alemannische Autorin verwendet die Form nüt, die laut folgender Karte nur im Südwesten verwendet wird. Die Negationspartikel nicht entwickelt sich durch die ch-tilgung zu nit im Alemannischen und zu net im Südfränkischen. Die südfränkische Form nix ist dem Standarddeutschen näher als die alemannische Form nüt. 55
56 (Abbildung 3: Alemannisches Wörterbuch Post/Scheer-Nahor: S. 238) f) Arg Alemannisch: Du bisch arg net [ ]. (Dr chlei Prinz) Südfränkisch: Arg bees, arg wichdig [ ]. (De kloine Prinz) Dieses Wort ist nicht im Dialektwörterbuch verzeichnet. Bei Arg handelt es sich um einen gehobenen Ausdruck des Standarddeutschen; wird allerdings nicht überall in Deutschland so oft verwendet wie im Alemannischen und Südfränkischen. Das Lexem ist im Online DUDEN eingetragen als: 1. (gehoben veraltet) von böser, niederträchtiger Gesinnung [erfüllt]; niederträchtig, böse 2. (landschaftlich) schlimm, übel; unangenehm 3. (landschaftlich, österreichisch, schweizerisch, auch gehoben) [unangenehm] groß, stark, heftig 4. (landschaftlich) sehr, überaus Nr. 3 weist auf die Verwendung im Alemannischen hin. Das Lexem kommt in beiden Dialektbüchern in der Funktion von sehr (also als Gradpartikel) häufig vor. Für eine adjektivische oder adverbiale Verwendung könnte ich keine Belege finden, obwohl ich aus 56
57 der alltäglichen Erfahrung mit den Dialektsprechern weiß, dass arg im Sinne krass verwendet wird. g) Luege Er het umgluegt, het aber nüt gseh [ ]. (Dr chlei Prinz, Alemannisch) Hier handelt es sich um ein Verb mit der Bedeutung anschauen, nachsehen, umschauen (vgl. Alemann. Wörterbuch Post/Scheer-Nahor: S. 33, 208), das in der Standardsprache nicht etabliert ist. Zu der Etymologie des Verbs luege musste ich im englischen etymologischen Wörterbuch suchen: From West Germanic *lokjan (source also of Old Saxon lokon "see, look, spy," Middle Dutch loeken "to look, Old High German luogen, German dialectal lugen "to look out" (Etymology Dictionary Online: etymonline.com). Im Südfränkischen existiert diese Form nicht, sie ist durch das umgangssprachliche Lexem gucken vertreten, z.b. ich hab genau naaguckt." h) Hüllt vs. heilt Alemannisch: Sie het nämlich nit welle, dass er sieht, wie sie hüllt." Südfränkisch: Sie wollt nämlich net, dass er sieht, wie sie heilt." Die Bedeutung des Verbs im Beispielsatz muss sinnvollerweise weinen sein, nicht heulen im Sinne von laut weinen. Daran sieht man, dass die Bedeutung von hülle sich nicht mit standarddt. heulen deckt. Im Alemannischen gibt es unterschiedliche Verben für weinen, z.b. hile, briäge, briäle (vgl. Alemann. Wörterbuch Post/Scheer-Nahor: S ). Laut dem aleman. Wörterbuch müsste diese Form im Südfränkischen hile heißen. Der Autor verwendet aber die Form heile, anders als erwartet mit /ei/ statt /oi/ bzw. <eu>. Diese könnte mit dem standarddt. Lexem heilen verwechselt werden. 57
58 (Abbildung 4: Alemannisches Wörterbuch Post/Scheer-Nahor: S. 153) Abschließend lässt sich zur alemannischen und südfränkischen Lexik Folgendes behaupten: Das Südfränkische ist einfacher als das Alemannische zu verstehen, denn es gibt weniger vom Standard abweichende Lexeme, zum Beispiel erscheint alemannisch Hürstli im Südfränkischen als Busch, alemannisch öbber als jemand, alemannisch numme als bloß (aber alemannisch öbbis vs. südfränkisch ebbes). Das Südfränkische hat zwar wenige Wörter, die auf ihre Bedeutung hin untersucht werden müssen, ist für mich aber trotzdem anstrengender zu lesen: Die meisten Lexeme erscheinen durch die Abbildung der Laute graphisch fremd, vor allem im Konsonantismus. Dazu möchte ich noch einmal die fränkische Frikativierung erwähnen (siehe 4.2.2), also die Lautentwicklung /b/ > /w/. Da der Konsonant /b/ sehr häufig vorkommt, muss man sich an das ständige /w/ gewöhnen z.b. i bin stehe bliwwe geblieben, selwer selber, Owed Abend, Ärwet Arbeit, gewwe geben. Dazu werden noch Vokaländerungen realisiert, die die Lexeme von der Standardsprache weiter entfernen. Die häufigen Konsonanten-, Vokaländerungen und Assimilationen gestalten das Südfränkische graphematisch schwierig. Weitere Beispiele: natürlich: /ü/ >/ie/, /t/ > /d/: nadierlich Wüste: /ü/ > /ie/, /st/ > /scht/, /t/ > /d/: Wieschde Tasche /t/>/d/, e-tilgung: Dasch 58
DEUTSCHE MUNDARTKUNDE
 DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN VeröflFentlichungen des Instituts für deutsche Sprache und Literatur 25 V. M. SCHIRMUNSKI DEUTSCHE MUNDARTKUNDE Vergleichende Laut- und Formenlehre der deutschen
DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN VeröflFentlichungen des Instituts für deutsche Sprache und Literatur 25 V. M. SCHIRMUNSKI DEUTSCHE MUNDARTKUNDE Vergleichende Laut- und Formenlehre der deutschen
WS 2016/ Sprachgeschichte und Dialektologie
 Sprachgeschichte und Dialektologie 1. Was ist Sprachgeschichte? Die Geschichte einer Sprache ist die Gesamtheit von ( ) zufälligen, nicht zielgerichteten (will sagen: auf eben diese Veränderung selbst
Sprachgeschichte und Dialektologie 1. Was ist Sprachgeschichte? Die Geschichte einer Sprache ist die Gesamtheit von ( ) zufälligen, nicht zielgerichteten (will sagen: auf eben diese Veränderung selbst
DEUTSCHE DIALEKTOLOGIE. Prof. Nicole Nau, UAM 2016 Zweite Vorlesung,
 DEUTSCHE DIALEKTOLOGIE Prof. Nicole Nau, UAM 2016 Zweite Vorlesung, 03.03.2016 Fragen des Tages Wie und wann fing die deusche Dialektologie an? Was sind die Wenker-Sätze und wo findet man sie? Was unterscheidet
DEUTSCHE DIALEKTOLOGIE Prof. Nicole Nau, UAM 2016 Zweite Vorlesung, 03.03.2016 Fragen des Tages Wie und wann fing die deusche Dialektologie an? Was sind die Wenker-Sätze und wo findet man sie? Was unterscheidet
Lautwandel. als Thema im Deutschunterricht. Universität zu Köln Sprachgeschichte und Schule WS 2016/17
 Lautwandel als Thema im Deutschunterricht Universität zu Köln Sprachgeschichte und Schule WS 2016/17 Referenten: Julian Kallfaß, Carina Kohnen, Marina Hambach & Annika Huijbregts Übersicht Teil Ⅰ: Theoretische
Lautwandel als Thema im Deutschunterricht Universität zu Köln Sprachgeschichte und Schule WS 2016/17 Referenten: Julian Kallfaß, Carina Kohnen, Marina Hambach & Annika Huijbregts Übersicht Teil Ⅰ: Theoretische
1. Von welchem berühmten Philologen stammen die Begriffe/Termini Althochdeutsch und Mittelhochdeutsch?
 Arbeitsblatt zu Waterman, A History of the German Language With Special Reference to the Cultural and Social Forces that Shaped the Standard Literary Language (revised edition 1976, reprinted Prospect
Arbeitsblatt zu Waterman, A History of the German Language With Special Reference to the Cultural and Social Forces that Shaped the Standard Literary Language (revised edition 1976, reprinted Prospect
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT ABKÜRZUNGEN UND ZEICHEN... 19
 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT... 13 ABKÜRZUNGEN UND ZEICHEN... 19 EINLEITUNG... 23 E 1 Geografische Lage... 23 E 2 Besiedlung im Laufe der Geschichte... 24 E 3 Der Name Laurein bzw. Lafreng... 26 E 4 Laureiner
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT... 13 ABKÜRZUNGEN UND ZEICHEN... 19 EINLEITUNG... 23 E 1 Geografische Lage... 23 E 2 Besiedlung im Laufe der Geschichte... 24 E 3 Der Name Laurein bzw. Lafreng... 26 E 4 Laureiner
Grundkurs Linguistik. Dialekte & Sprachwandel Kathi Sternke
 Grundkurs Linguistik Dialekte & Sprachwandel 17.12.2015 Kathi Sternke ksternke@phil.hhu.de Ich komme mit den Dialekten da her - und muss euch sagen- Es weihnachtet heute sehr! 2 3 Tassen Wo würdet ihr
Grundkurs Linguistik Dialekte & Sprachwandel 17.12.2015 Kathi Sternke ksternke@phil.hhu.de Ich komme mit den Dialekten da her - und muss euch sagen- Es weihnachtet heute sehr! 2 3 Tassen Wo würdet ihr
Sprachliche Akkommodation und soziale Integration
 Birgit Barden / Beate Großkopf und soziale Integration Sächsische Übersiedler und Übersiedlerinnen im rhein- / moselfränkischen und alemannischen Sprachraum MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN 1998 Vorwort Abkürzungen
Birgit Barden / Beate Großkopf und soziale Integration Sächsische Übersiedler und Übersiedlerinnen im rhein- / moselfränkischen und alemannischen Sprachraum MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN 1998 Vorwort Abkürzungen
Der mittelschwäbische Dialekt am Beispiel der Urbacher Mundart
 Der mittelschwäbische Dialekt am Beispiel der Urbacher Mundart von Jochen Müller 1. Auflage Der mittelschwäbische Dialekt am Beispiel der Urbacher Mundart Müller schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de
Der mittelschwäbische Dialekt am Beispiel der Urbacher Mundart von Jochen Müller 1. Auflage Der mittelschwäbische Dialekt am Beispiel der Urbacher Mundart Müller schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de
Der Oberdeutsche Präteritumschwund
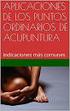 Germanistik Nadja Groß Der Oberdeutsche Präteritumschwund Zur Beobachtung einer sich verstärkenden Veränderung unseres Tempussystems Studienarbeit INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung... 1 2. Zwei Vergangenheits-Tempora:
Germanistik Nadja Groß Der Oberdeutsche Präteritumschwund Zur Beobachtung einer sich verstärkenden Veränderung unseres Tempussystems Studienarbeit INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung... 1 2. Zwei Vergangenheits-Tempora:
Inhalt. Vorwort Verbreitung und Gliederung des Deutschen Transkription 3. A Die Standardaussprache in Deutschland 3
 Vorwort V Verbreitung und Gliederung des Deutschen i Transkription 3 A Die Standardaussprache in Deutschland 3 1 Standardaussprache - Begriff und Funktionen 6 2 Geschichte, Grundsätze und Methoden der
Vorwort V Verbreitung und Gliederung des Deutschen i Transkription 3 A Die Standardaussprache in Deutschland 3 1 Standardaussprache - Begriff und Funktionen 6 2 Geschichte, Grundsätze und Methoden der
Variation im Deutschen
 Stephen Barbour/Patrick Stevenson Variation im Deutschen Soziolinguistische Perspektiven Übersetzt aus dem Englischen von Konstanze Gebel w DE G Walter de Gruyter Berlin New York 1998 Inhalt Vorwort Abkürzungsverzeichnis
Stephen Barbour/Patrick Stevenson Variation im Deutschen Soziolinguistische Perspektiven Übersetzt aus dem Englischen von Konstanze Gebel w DE G Walter de Gruyter Berlin New York 1998 Inhalt Vorwort Abkürzungsverzeichnis
Vom Urgermanischen zum Neuhochdeutschen
 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Vom Urgermanischen zum Neuhochdeutschen Eine historische Phonologie
2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Vom Urgermanischen zum Neuhochdeutschen Eine historische Phonologie
Sprachliche Variation Variation im Standard
 Sprachliche Variation Variation im Standard Beat Siebenhaar 1 Variation von Substandardvarietäten Diglossie Kontinuum 2 Nach Löffler (2004): Abschiedsvorlesung und ergänzt Dialektale Variation Wiesinger
Sprachliche Variation Variation im Standard Beat Siebenhaar 1 Variation von Substandardvarietäten Diglossie Kontinuum 2 Nach Löffler (2004): Abschiedsvorlesung und ergänzt Dialektale Variation Wiesinger
Beat Siebenhaar! 1962/69! Duden, Aussprachewörterbuch (1. Auflage 1962).!
 Beat Siebenhaar! Einführung in Phonetik & Phonologie! Normierung der Standardlautung! Bühnenhochlautung! 1898! Siebs, Deutsche Bühnenaussprache.! gemäßigte Hochlautung! 1962/69! Duden, Aussprachewörterbuch
Beat Siebenhaar! Einführung in Phonetik & Phonologie! Normierung der Standardlautung! Bühnenhochlautung! 1898! Siebs, Deutsche Bühnenaussprache.! gemäßigte Hochlautung! 1962/69! Duden, Aussprachewörterbuch
7 Geografie der Aussprache (Dialektologie)
 7 Geografie der Aussprache (Dialektologie) Die Dialektologie (auch,areallinguistik genannt) befasst sich mit den landschaftlich gebundenen Sondersprachen, die in einem Sprachgebiet neben einer allgemeinen
7 Geografie der Aussprache (Dialektologie) Die Dialektologie (auch,areallinguistik genannt) befasst sich mit den landschaftlich gebundenen Sondersprachen, die in einem Sprachgebiet neben einer allgemeinen
DEUTSCHE DIALEKTOLOGIE. Prof. Nicole Nau, UAM 2016 Erste Vorlesung,
 DEUTSCHE DIALEKTOLOGIE Prof. Nicole Nau, UAM 2016 Erste Vorlesung, 25.02.2016 Fragen des Tages Was ist Dialekt? Was erforscht die Dialektologie? Warum ist das wichtig? Welche Dialekte hat das Deutsche?
DEUTSCHE DIALEKTOLOGIE Prof. Nicole Nau, UAM 2016 Erste Vorlesung, 25.02.2016 Fragen des Tages Was ist Dialekt? Was erforscht die Dialektologie? Warum ist das wichtig? Welche Dialekte hat das Deutsche?
Entstehung des Althochdeutschen und der deutschen Dialekte
 Vu Thi Thu An Fremdsprachenhochschule VNU Hanoi 1. Einleitung Jede Sprache verändert sich im Laufe der Zeit. Es ist Gegenstand des Fachs Sprachgeschichte, diesen Prozess genau zu untersuchen und dadurch
Vu Thi Thu An Fremdsprachenhochschule VNU Hanoi 1. Einleitung Jede Sprache verändert sich im Laufe der Zeit. Es ist Gegenstand des Fachs Sprachgeschichte, diesen Prozess genau zu untersuchen und dadurch
Mittelhochdeutsche i Grammatik
 Mittelhochdeutsche i Grammatik von Helmut de Boor und Roswitha Wisniewski " i Zehnte Auflage Jiurchgesehen in Zusammenarbeit mit Helmut Beifuss i 'er- g wde G I 1998 i Walter de Gruyter Berlin New York
Mittelhochdeutsche i Grammatik von Helmut de Boor und Roswitha Wisniewski " i Zehnte Auflage Jiurchgesehen in Zusammenarbeit mit Helmut Beifuss i 'er- g wde G I 1998 i Walter de Gruyter Berlin New York
Das hessische Dialektbuch
 Hans Friebertshäuser Das hessische Dialektbuch Verlag C.H.Beck München Inhalt Vorwort... ' 11 Abkürzungen und Symbole 15 Zur Schreibung der Dialektlaute 16 Einleitung 19 1. Zur Mundart allgemein 19 a)
Hans Friebertshäuser Das hessische Dialektbuch Verlag C.H.Beck München Inhalt Vorwort... ' 11 Abkürzungen und Symbole 15 Zur Schreibung der Dialektlaute 16 Einleitung 19 1. Zur Mundart allgemein 19 a)
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT...17 I TEXTTEIL VORBEMERKUNGEN ZUM SPRACHWISSENSCHAFTLICHEN TEIL...19
 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT...17 I TEXTTEIL...19 1 VORBEMERKUNGEN ZUM SPRACHWISSENSCHAFTLICHEN TEIL...19 2 EINFÜHRUNG... 21 2.1 Vorbemerkungen zum Thema Regionalsprachgeschichte... 21 2.1.1 Bisherige Ansätze
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT...17 I TEXTTEIL...19 1 VORBEMERKUNGEN ZUM SPRACHWISSENSCHAFTLICHEN TEIL...19 2 EINFÜHRUNG... 21 2.1 Vorbemerkungen zum Thema Regionalsprachgeschichte... 21 2.1.1 Bisherige Ansätze
Nomen Akkusativ. Inhaltsverzeichnis. Allgemeines. Der Akkusativ im Deutschen
 Nomen Akkusativ Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 2 Der Akkusativ im Deutschen 3 Der Akkusativ im Englischen 4 Der Akkusativ im Ungarischen ( akkusatívus oder tárgyeset ) 4.1 Die Bildung 5 Quelle Allgemeines
Nomen Akkusativ Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 2 Der Akkusativ im Deutschen 3 Der Akkusativ im Englischen 4 Der Akkusativ im Ungarischen ( akkusatívus oder tárgyeset ) 4.1 Die Bildung 5 Quelle Allgemeines
Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache Handout I.
 Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache Handout I. 1. Verändert sich die Sprache überhaupt? Strukturalistische Auffassung (Ferdinand de Saussure): Nur durch gezielte Untersuchungen sichtbar, weil der
Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache Handout I. 1. Verändert sich die Sprache überhaupt? Strukturalistische Auffassung (Ferdinand de Saussure): Nur durch gezielte Untersuchungen sichtbar, weil der
Leitung Prof. Dr. Petra M. Vogel. Mitarbeiterinnen Petra Solau-Riebel/Carolin Baumann.
 Siegerländer Sprachatlas Universität Siegen Fakultät I: Philosophische Fakultät Adolf-Reichwein-Str. 2 57068 Siegen Leitung Prof. Dr. Petra M. Vogel Mitarbeiterinnen Petra Solau-Riebel/Carolin Baumann
Siegerländer Sprachatlas Universität Siegen Fakultät I: Philosophische Fakultät Adolf-Reichwein-Str. 2 57068 Siegen Leitung Prof. Dr. Petra M. Vogel Mitarbeiterinnen Petra Solau-Riebel/Carolin Baumann
Geschichte der deutschen Sprache
 ll tue Im Sclftmidlß Geschichte der deutschen Sprache Ein Lehrbuch für das germanistische Studium 8., völlig überarbeitete Auflage, erarbeitet unter der Leitung von Helmut Langner und Norbert Richard Wolf
ll tue Im Sclftmidlß Geschichte der deutschen Sprache Ein Lehrbuch für das germanistische Studium 8., völlig überarbeitete Auflage, erarbeitet unter der Leitung von Helmut Langner und Norbert Richard Wolf
Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat?
 Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT... 5 INHALTSVERZEICHNIS... 7 ABBILDUNGSVERZEICHNIS TABELLENVERZEICHNIS... 15
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS VORWORT... 5 INHALTSVERZEICHNIS... 7 ABBILDUNGSVERZEICHNIS... 13 TABELLENVERZEICHNIS... 15 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS... 17 Fachspezifische Abkürzungen...
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS VORWORT... 5 INHALTSVERZEICHNIS... 7 ABBILDUNGSVERZEICHNIS... 13 TABELLENVERZEICHNIS... 15 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS... 17 Fachspezifische Abkürzungen...
Deutsch lernen leicht gemacht mit verwandten Wörtern
 Deutsch lernen leicht gemacht mit verwandten Wörtern Inhaltsverzeichnis 1. Verwandte Wörter (Info für Kursleiter/in)... 2 2. Aufgaben zum Plakat Verwandte Wörter... 3 3. Lösungen... 7 Plakat: Verwandte
Deutsch lernen leicht gemacht mit verwandten Wörtern Inhaltsverzeichnis 1. Verwandte Wörter (Info für Kursleiter/in)... 2 2. Aufgaben zum Plakat Verwandte Wörter... 3 3. Lösungen... 7 Plakat: Verwandte
Herbst 14 Thema 3 Teil II
 Herbst 14 Thema 3 Teil II Erklärungen von Lautgesetzen neuhochdeutsche Monophthongierung: spontaner Lautwandel: Diphthonge Monophthonge (Langvokale), diachrone Ebene, ab dem 11. bzw. 12. Jhd., in manchen
Herbst 14 Thema 3 Teil II Erklärungen von Lautgesetzen neuhochdeutsche Monophthongierung: spontaner Lautwandel: Diphthonge Monophthonge (Langvokale), diachrone Ebene, ab dem 11. bzw. 12. Jhd., in manchen
Transkript-Merkmal-Analysen. Leitfaden für den Inhalt von Hausarbeiten und mündlichen Prüfungen
 Transkript-Merkmal-Analysen Leitfaden für den Inhalt von Hausarbeiten und mündlichen Prüfungen 1. Transkript-/Text-Merkmal-Analyse Am Anfang Ihrer Arbeit sollten Sie eine Transkript-Merkmal-Analyse bzw.
Transkript-Merkmal-Analysen Leitfaden für den Inhalt von Hausarbeiten und mündlichen Prüfungen 1. Transkript-/Text-Merkmal-Analyse Am Anfang Ihrer Arbeit sollten Sie eine Transkript-Merkmal-Analyse bzw.
Aufnahmeprüfung BM 2010 - Deutsch
 Name... Vorname... Prüfungsgruppe... Aufnahmeprüfung BM 2010 - Deutsch Zeit Hilfsmittel 90 Minuten Für jede Teilaufgabe geben wir als Orientierungshilfe eine Richtzeit vor. Duden Band 1, während der ganzen
Name... Vorname... Prüfungsgruppe... Aufnahmeprüfung BM 2010 - Deutsch Zeit Hilfsmittel 90 Minuten Für jede Teilaufgabe geben wir als Orientierungshilfe eine Richtzeit vor. Duden Band 1, während der ganzen
BEGRÜNDEN. Sagen, warum etwas so ist. Wortschatzkiste
 BEGRÜNDEN Sagen, warum etwas so ist. Der Begriff/ Vorgang/ Hintergrund/Verlauf/Prozess/ der Text/ der Versuch/Verfasser Die Ursache/Grundlage/Aussage/Bedeutung/Struktur/Erklärung/ die Formel/ die Quelle
BEGRÜNDEN Sagen, warum etwas so ist. Der Begriff/ Vorgang/ Hintergrund/Verlauf/Prozess/ der Text/ der Versuch/Verfasser Die Ursache/Grundlage/Aussage/Bedeutung/Struktur/Erklärung/ die Formel/ die Quelle
Wortbildung und Wortbildungswandel
 Germanistik Kira Wieler Wortbildung und Wortbildungswandel Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 2 2 Wortbildung... 2 2.1 Morphologische Grundbegriffe... 2 2.2 Arten der Wortbildung... 3 2.3
Germanistik Kira Wieler Wortbildung und Wortbildungswandel Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 2 2 Wortbildung... 2 2.1 Morphologische Grundbegriffe... 2 2.2 Arten der Wortbildung... 3 2.3
allensbacher berichte
 allensbacher berichte Institut für Demoskopie Allensbach 2008 / Nr. 4 AUCH AUSSERHALB VON BAYERN WIRD BAYERISCH GERN GEHÖRT Die beliebtesten und unbeliebtesten Dialekte Von allen Dialekten, die in Deutschland
allensbacher berichte Institut für Demoskopie Allensbach 2008 / Nr. 4 AUCH AUSSERHALB VON BAYERN WIRD BAYERISCH GERN GEHÖRT Die beliebtesten und unbeliebtesten Dialekte Von allen Dialekten, die in Deutschland
Teil Methodische Überlegungen Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17
 Inhaltsverzeichnis Dysgrammatismus EINLEITUNG Teil 1... 9 A Phänomen des Dysgrammatismus... 13 Methodische Überlegungen... 15 Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17 B Die Sprachstörung Dysgrammatismus...
Inhaltsverzeichnis Dysgrammatismus EINLEITUNG Teil 1... 9 A Phänomen des Dysgrammatismus... 13 Methodische Überlegungen... 15 Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17 B Die Sprachstörung Dysgrammatismus...
Sprachnormenwandel im geschriebenen Deutsch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert
 VitDovalil Sprachnormenwandel im geschriebenen Deutsch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert Die Entwicklung in ausgesuchten Bereichen der Grammatik PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften 0. Vorwort.
VitDovalil Sprachnormenwandel im geschriebenen Deutsch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert Die Entwicklung in ausgesuchten Bereichen der Grammatik PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften 0. Vorwort.
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS
 Döi Erdäpflsuppn is dick Dialektwörter erforschen Jahrgangsstufen 3/4 Fach Benötigtes Material Deutsch Mundartlied Döi Erdäpflsuppn is dick, z. B. als geschriebener Text mit Melodie oder als Hörbeispiel
Döi Erdäpflsuppn is dick Dialektwörter erforschen Jahrgangsstufen 3/4 Fach Benötigtes Material Deutsch Mundartlied Döi Erdäpflsuppn is dick, z. B. als geschriebener Text mit Melodie oder als Hörbeispiel
Auf gut Badisch: Der Tod des Dialekts. Carly Lesoski und Connor McPartland. Academic Year in Freiburg. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
 RUNNING HEAD: AUF GUT BADISCH Auf gut Badisch: Der Tod des Dialekts Carly Lesoski und Connor McPartland Academic Year in Freiburg Albert-Ludwigs-Universität Freiburg AUF GUT BADISCH 2 Abstrakt Wie viele
RUNNING HEAD: AUF GUT BADISCH Auf gut Badisch: Der Tod des Dialekts Carly Lesoski und Connor McPartland Academic Year in Freiburg Albert-Ludwigs-Universität Freiburg AUF GUT BADISCH 2 Abstrakt Wie viele
Partikeln im gesprochenen Deutsch
 Germanistik Philipp Schaan Partikeln im gesprochenen Deutsch Bachelorarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Definition der Wortart 'Partikel'... 3 3. Der Weg der Wortart 'Partikel' in der Duden-Grammatik...
Germanistik Philipp Schaan Partikeln im gesprochenen Deutsch Bachelorarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Definition der Wortart 'Partikel'... 3 3. Der Weg der Wortart 'Partikel' in der Duden-Grammatik...
Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft
 Ferdinand de Saussure Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft Herausgegeben von Charles Bally und Albert Sechehaye unter Mitwirkung von Albert Riedlinger Übersetzt von Herman Lommel 3. Auflage Mit
Ferdinand de Saussure Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft Herausgegeben von Charles Bally und Albert Sechehaye unter Mitwirkung von Albert Riedlinger Übersetzt von Herman Lommel 3. Auflage Mit
NORWEGISCHE SPRACHGESCHICHTE
 NORWEGISCHE SPRACHGESCHICHTE VON DIDRIK ARUP SEIP BEARBEITET UND ERWEITERT VON LAURITS SALTVEIT w DE G WALTER DE GRUYTER BERLIN NEW YORK 1971 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort XIII Einleitung: Nordisch und Germanisch
NORWEGISCHE SPRACHGESCHICHTE VON DIDRIK ARUP SEIP BEARBEITET UND ERWEITERT VON LAURITS SALTVEIT w DE G WALTER DE GRUYTER BERLIN NEW YORK 1971 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort XIII Einleitung: Nordisch und Germanisch
1. Gruppen. 1. Gruppen 7
 1. Gruppen 7 1. Gruppen Wie schon in der Einleitung erläutert wollen wir uns in dieser Vorlesung mit Mengen beschäftigen, auf denen algebraische Verknüpfungen mit gewissen Eigenschaften definiert sind.
1. Gruppen 7 1. Gruppen Wie schon in der Einleitung erläutert wollen wir uns in dieser Vorlesung mit Mengen beschäftigen, auf denen algebraische Verknüpfungen mit gewissen Eigenschaften definiert sind.
ALTFRANZÖSISCH ENTSTEHUNG UND CHARAKTERISTIK
 LOTHAR WOLF WERNER HUPKA ALTFRANZÖSISCH ENTSTEHUNG UND CHARAKTERISTIK EINE EINFÜHRUNG 1981 WISSENSCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT DARMSTADT INHALTSVERZEICHNIS Vorwort Zeichen und Abkürzungen IX XI I. Zum historischen
LOTHAR WOLF WERNER HUPKA ALTFRANZÖSISCH ENTSTEHUNG UND CHARAKTERISTIK EINE EINFÜHRUNG 1981 WISSENSCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT DARMSTADT INHALTSVERZEICHNIS Vorwort Zeichen und Abkürzungen IX XI I. Zum historischen
Die Bedeutungsrelation Synonymie im Französischen
 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Sommersemester 2012 Seminar: Wortschatz formal und inhaltlich (Französisch) Seminarleiterin: Nora Wirtz M.A. Referentin: Vanessa Almeida Silva Datum: 26.04.2012 Die
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Sommersemester 2012 Seminar: Wortschatz formal und inhaltlich (Französisch) Seminarleiterin: Nora Wirtz M.A. Referentin: Vanessa Almeida Silva Datum: 26.04.2012 Die
Morphologische Merkmale. Merkmale Merkmale in der Linguistik Merkmale in der Morpholgie Morphologische Typologie Morphologische Modelle
 Morphologische Merkmale Merkmale Merkmale in der Linguistik Merkmale in der Morpholgie Morphologische Typologie Morphologische Modelle Merkmale Das Wort 'Merkmal' ' bedeutet im Prinzip soviel wie 'Eigenschaft'
Morphologische Merkmale Merkmale Merkmale in der Linguistik Merkmale in der Morpholgie Morphologische Typologie Morphologische Modelle Merkmale Das Wort 'Merkmal' ' bedeutet im Prinzip soviel wie 'Eigenschaft'
Allgemeines zum Verfassen der Einleitung
 Allgemeines zum Verfassen der Einleitung Nach: Charbel, Ariane. Schnell und einfach zur Diplomarbeit. Eco, Umberto. Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Martin, Doris. Erfolgreich texten!
Allgemeines zum Verfassen der Einleitung Nach: Charbel, Ariane. Schnell und einfach zur Diplomarbeit. Eco, Umberto. Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Martin, Doris. Erfolgreich texten!
Deutsche Sprachlandschaften
 Deutsche Sprachlandschaften Trotz der vereinheitlichenden Wirkung der Medien auf den Gebrauch der deutschen Sprache und steigender Mobilität der Bevölkerung sind regional gefärbte Sprechweisen in Deutschland
Deutsche Sprachlandschaften Trotz der vereinheitlichenden Wirkung der Medien auf den Gebrauch der deutschen Sprache und steigender Mobilität der Bevölkerung sind regional gefärbte Sprechweisen in Deutschland
Ästhetik ist die Theorie der ästhetischen Erfahrung, der ästhetischen Gegenstände und der ästhetischen Eigenschaften.
 16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
Funktionaler Analphabetismus in der Bundesrepublik Deutschland
 Medien Andrea Harings Funktionaler Analphabetismus in der Bundesrepublik Deutschland Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 1 2. Analphabetismus... 2 2.1 Begriffsbestimmung... 2 2.2 Ausmaß...
Medien Andrea Harings Funktionaler Analphabetismus in der Bundesrepublik Deutschland Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 1 2. Analphabetismus... 2 2.1 Begriffsbestimmung... 2 2.2 Ausmaß...
Spickzettel zum Materialpaket: Anlautbilder für DaZ Seite 1 von 5
 Spickzettel zum Materialpaket: Anlautbilder für DaZ Seite 1 von 5 Spickzettel Anlautbilder für DaZ In diesem Spickzettel findet ihr zusätzliche Informationen zum Materialpaket Anlautbilder für DaZ. Insbesondere
Spickzettel zum Materialpaket: Anlautbilder für DaZ Seite 1 von 5 Spickzettel Anlautbilder für DaZ In diesem Spickzettel findet ihr zusätzliche Informationen zum Materialpaket Anlautbilder für DaZ. Insbesondere
Was ich nie wieder in einer Arbeit lesen will! (Ganz gleich, ob in einer Hausarbeit oder kleineren Ausarbeitung.)
 Was ich nie wieder in einer Arbeit lesen will! (Ganz gleich, ob in einer Hausarbeit oder kleineren Ausarbeitung.) 1. Damit bringt von Aue zum Ausdruck, dass. Das ist falsch! von Aue ist kein Nachname (sondern
Was ich nie wieder in einer Arbeit lesen will! (Ganz gleich, ob in einer Hausarbeit oder kleineren Ausarbeitung.) 1. Damit bringt von Aue zum Ausdruck, dass. Das ist falsch! von Aue ist kein Nachname (sondern
2 Laut-Buchstabe-Bezsehongen des Deutschen Vokale Konsonanten Äffrikaten und ähnliche Konsonantenverbindungen 18
 Afbbildungsverzeichnis Einführung 1 ix l Theoretische Grundlagen 3 1 Transkription und das IPA 5 1.1 IPA-Laetschriftzeichen zur normativen Transkription standardsprachlicher Äußerungen des Deutschen 9
Afbbildungsverzeichnis Einführung 1 ix l Theoretische Grundlagen 3 1 Transkription und das IPA 5 1.1 IPA-Laetschriftzeichen zur normativen Transkription standardsprachlicher Äußerungen des Deutschen 9
1 Das Geschlecht der Substantive
 1 Das Geschlecht der Substantive NEU Im Deutschen erkennst du das Geschlecht (Genus) der Substantive am Artikel: der (maskulin), die (feminin) und das (neutral). Das Russische kennt zwar keinen Artikel,
1 Das Geschlecht der Substantive NEU Im Deutschen erkennst du das Geschlecht (Genus) der Substantive am Artikel: der (maskulin), die (feminin) und das (neutral). Das Russische kennt zwar keinen Artikel,
Verbreitungsgebiet der dt. Sprache 1910
 Sprachliche Variation Sprachgeographie Beat Siebenhaar Verbreitungsgebiet der dt. Sprache 1910 http://de.wikipedia.org/wiki/bild:historisches_deutsches_sprachgebiet.png Verbreitungsgebiet der dt. Sprache
Sprachliche Variation Sprachgeographie Beat Siebenhaar Verbreitungsgebiet der dt. Sprache 1910 http://de.wikipedia.org/wiki/bild:historisches_deutsches_sprachgebiet.png Verbreitungsgebiet der dt. Sprache
Grundkurs Linguistik - Morphologie
 Grundkurs Linguistik - Jens Fleischhauer fleischhauer@phil.uni-duesseldorf.de Heinrich-Heine Universität Düsseldorf; Abteilung für Allgemeine Sprachwissenschaft 10.11.2016; WS 2016/2017 1 / 21 Jens Fleischhauer
Grundkurs Linguistik - Jens Fleischhauer fleischhauer@phil.uni-duesseldorf.de Heinrich-Heine Universität Düsseldorf; Abteilung für Allgemeine Sprachwissenschaft 10.11.2016; WS 2016/2017 1 / 21 Jens Fleischhauer
Universität Bielefeld Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft. (Hall, Kapitel 2.1; Clark & Yallop, Chapter )
 Universität Bielefeld Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft Phonetik k Phonologie Phonologie (Hall, Kapitel 2.1; Clark & Yallop, Chapter 4.1-4.3) christian.ebert@uni-bielefeld.de Phonologie
Universität Bielefeld Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft Phonetik k Phonologie Phonologie (Hall, Kapitel 2.1; Clark & Yallop, Chapter 4.1-4.3) christian.ebert@uni-bielefeld.de Phonologie
Freiburger Papiere zur Germanistischen Linguistik FRAGL 34 Objektive und subjektive Dialektgrenzen am Beispiel von Villingen und Schwenningen
 Freiburger Papiere zur Germanistischen Linguistik FRAGL 34 Objektive und subjektive Dialektgrenzen am Beispiel von Villingen und Schwenningen Autor: Julian Ging E-Mail: julianging@yahoo.com Abstract: In
Freiburger Papiere zur Germanistischen Linguistik FRAGL 34 Objektive und subjektive Dialektgrenzen am Beispiel von Villingen und Schwenningen Autor: Julian Ging E-Mail: julianging@yahoo.com Abstract: In
Kontrastive Analyse: Finnisch - Deutsch
 Sprachen Eva Meyer Kontrastive Analyse: Finnisch - Deutsch Studienarbeit Inhalt 1. Einleitung... 2 2. Allgemeines zum Finnischen... 3 3. Das Vokalsystem des Finnischen... 4 4. Das Konsonantensystem des
Sprachen Eva Meyer Kontrastive Analyse: Finnisch - Deutsch Studienarbeit Inhalt 1. Einleitung... 2 2. Allgemeines zum Finnischen... 3 3. Das Vokalsystem des Finnischen... 4 4. Das Konsonantensystem des
FRÜHNEUHOCHDEUTSCHE GRAMMATIK
 OSKAR REICHMANN, KLAUS-PETER WEGERA (HRSG.) FRÜHNEUHOCHDEUTSCHE GRAMMATIK von ROBERT PETER EBERT, OSKAR REICHMANN, HANS-JOACHIM SOLMS UND KLAUS-PETER WEGERA MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN 1993 INHALT Verzeichnis
OSKAR REICHMANN, KLAUS-PETER WEGERA (HRSG.) FRÜHNEUHOCHDEUTSCHE GRAMMATIK von ROBERT PETER EBERT, OSKAR REICHMANN, HANS-JOACHIM SOLMS UND KLAUS-PETER WEGERA MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN 1993 INHALT Verzeichnis
12. Hat der Buchdruck die deutsche Sprache verändert?
 Inhalt Einleitung 11 Sprachgeschichte und Sprachwandel 13 1. Seit wann wird Deutsch gesprochen? 13 2. Gibt es im heutigen Deutschen noch Spuren des Indogermanischen und des Germanischen? 14 3. Seit wann
Inhalt Einleitung 11 Sprachgeschichte und Sprachwandel 13 1. Seit wann wird Deutsch gesprochen? 13 2. Gibt es im heutigen Deutschen noch Spuren des Indogermanischen und des Germanischen? 14 3. Seit wann
ALTENGLISCHE GRAMMATIK,
 KARL BRUNNER ALTENGLISCHE GRAMMATIK, NACH DER ANGELSÄCHSISCHEN GRAMMATIK VON EDUARD SIEVERS DRITTE, NEUBEARBEITETE AUFLAGE MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN 1965 INHALT (Die eingeklammerten Zahlen beziehen
KARL BRUNNER ALTENGLISCHE GRAMMATIK, NACH DER ANGELSÄCHSISCHEN GRAMMATIK VON EDUARD SIEVERS DRITTE, NEUBEARBEITETE AUFLAGE MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN 1965 INHALT (Die eingeklammerten Zahlen beziehen
Bevor alle Deutschlehrer jetzt losschreien: Ahh, das geht nicht! Der Genitiv gehört zur deutschen Sprache! - Ja! Ihr habt Recht!
 1 Inhalt Vorwort... 2 Erklärung der Symbole:... 3 Genitiv in Nomen-Nomen-Konstruktionen... 4 Genitiv nach bestimmten Verben... 4 Verwendung nach Präpositionen... 6 Adjektive mit Genitiv... 10 Vorwort Bevor
1 Inhalt Vorwort... 2 Erklärung der Symbole:... 3 Genitiv in Nomen-Nomen-Konstruktionen... 4 Genitiv nach bestimmten Verben... 4 Verwendung nach Präpositionen... 6 Adjektive mit Genitiv... 10 Vorwort Bevor
Der Status der Einheit Wort im Französischen
 Sprachen Rainer Kohlhaupt Der Status der Einheit Wort im Französischen Studienarbeit Der Status der Einheit Wort im Französischen von Rainer Kohlhaupt Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Verschiedene
Sprachen Rainer Kohlhaupt Der Status der Einheit Wort im Französischen Studienarbeit Der Status der Einheit Wort im Französischen von Rainer Kohlhaupt Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Verschiedene
VARIATION, SPRACHLICHE
 VARIATION, SPRACHLICHE 0. Mit der Vorstellung von deutscher Sprache verbindet sich oft der Gedanke von etwas Einheitlichem, Feststehendem, klar Umrissenem. Man denkt, es gäbe irgendwie die deutsche Sprache",
VARIATION, SPRACHLICHE 0. Mit der Vorstellung von deutscher Sprache verbindet sich oft der Gedanke von etwas Einheitlichem, Feststehendem, klar Umrissenem. Man denkt, es gäbe irgendwie die deutsche Sprache",
7 Gültigkeit und logische Form von Argumenten
 7 Gültigkeit und logische Form von Argumenten Zwischenresümee 1. Logik ist ein grundlegender Teil der Lehre vom richtigen Argumentieren. 2. Speziell geht es der Logik um einen spezifischen Aspekt der Güte
7 Gültigkeit und logische Form von Argumenten Zwischenresümee 1. Logik ist ein grundlegender Teil der Lehre vom richtigen Argumentieren. 2. Speziell geht es der Logik um einen spezifischen Aspekt der Güte
Beschreibung von Versmassen
 Beschreibung von Versmassen Teil 1: In dieser Arbeitsreihe lernst du nicht, wie man ein Metrum herausfinden kann (das wird vorausgesetzt), sondern nur, wie man ein schon bekanntes Metrum beschreiben und
Beschreibung von Versmassen Teil 1: In dieser Arbeitsreihe lernst du nicht, wie man ein Metrum herausfinden kann (das wird vorausgesetzt), sondern nur, wie man ein schon bekanntes Metrum beschreiben und
2 Wie stehen Dialekt und Hochdeutsch zueinander? 17
 2 Wie stehen Dialekt und Hochdeutsch zueinander? 17 den zu werden, weshalb er sich immer wieder erkundigte, wo man was wie sagte, damit er stets die Ausdrücke verwenden konnte, die am weitesten verbreitet
2 Wie stehen Dialekt und Hochdeutsch zueinander? 17 den zu werden, weshalb er sich immer wieder erkundigte, wo man was wie sagte, damit er stets die Ausdrücke verwenden konnte, die am weitesten verbreitet
Internationalismen bei den Elementen der Chemie
 Internationalismen bei den Elementen der Chemie Takako Yoneyama 1. Einleitung Die Abkürzungszeichen der chemischen Elemente, z.b. Cu oder H, sind auf der ganzen Welt gleich. Aber sind auch die Bezeichnungen
Internationalismen bei den Elementen der Chemie Takako Yoneyama 1. Einleitung Die Abkürzungszeichen der chemischen Elemente, z.b. Cu oder H, sind auf der ganzen Welt gleich. Aber sind auch die Bezeichnungen
Rost, D. H. & Schilling. S. (1999). Was ist Begabung? In Hessisches Kultusministerium (Hrsg.), Hilfe, mein Kind ist hochbegabt!
 Rost, D. H. & Schilling. S. (1999). Was ist Begabung? In Hessisches Kultusministerium (Hrsg.), Hilfe, mein Kind ist hochbegabt! Förderung von besonderen Begabungen in Hessen. Heft 1: Grundlagen (S. 6 9).
Rost, D. H. & Schilling. S. (1999). Was ist Begabung? In Hessisches Kultusministerium (Hrsg.), Hilfe, mein Kind ist hochbegabt! Förderung von besonderen Begabungen in Hessen. Heft 1: Grundlagen (S. 6 9).
Kulturelle Vielfalt. Posten 1 Vier Sprachen eine Einheit
 Lehrerinformation 1/5 Vier Sprachen eine Einheit Arbeitsauftrag Die einzelnen Posten geben unterschiedliche methodische und didaktische Schwerpunkte und Arbeitsweisen vor. Die genauen Arbeiten sind auf
Lehrerinformation 1/5 Vier Sprachen eine Einheit Arbeitsauftrag Die einzelnen Posten geben unterschiedliche methodische und didaktische Schwerpunkte und Arbeitsweisen vor. Die genauen Arbeiten sind auf
Lesekompetenz fördern
 Beispiel für die Anwendung der 5-Schritte-Methode in der Volksschule Die 5-Schritte-Methode hilft Schülerinnen und Schülern, unterschiedlichste Texte sinnerfassend zu lesen und zu verstehen. Sie erleichtert
Beispiel für die Anwendung der 5-Schritte-Methode in der Volksschule Die 5-Schritte-Methode hilft Schülerinnen und Schülern, unterschiedlichste Texte sinnerfassend zu lesen und zu verstehen. Sie erleichtert
Das magnetische Feld. Kapitel Lernziele zum Kapitel 7
 Kapitel 7 Das magnetische Feld 7.1 Lernziele zum Kapitel 7 Ich kann das theoretische Konzept des Magnetfeldes an einem einfachen Beispiel erläutern (z.b. Ausrichtung von Kompassnadeln in der Nähe eines
Kapitel 7 Das magnetische Feld 7.1 Lernziele zum Kapitel 7 Ich kann das theoretische Konzept des Magnetfeldes an einem einfachen Beispiel erläutern (z.b. Ausrichtung von Kompassnadeln in der Nähe eines
Schriftliche Prüfung B1
 Aufbau und Ablauf der Prüfung Schriftliche Prüfung B1 Du musst bei der schriftlichen Prüfung einen persönlichen oder formellen Brief mit ca. 100-150 Wörtern schreiben, und dabei auf einen Brief, eine E-Mail,
Aufbau und Ablauf der Prüfung Schriftliche Prüfung B1 Du musst bei der schriftlichen Prüfung einen persönlichen oder formellen Brief mit ca. 100-150 Wörtern schreiben, und dabei auf einen Brief, eine E-Mail,
Varietäten und Register der deutschen Sprache
 Klaus Otto Schnelzer, M.A. Varietäten und Register der deutschen Sprache Masaryk-Universität Brünn Institut für Germanistik, Nordistik und Nederlandistik Frühjahrssemester 2012 Di, 2. April 2013 Was sind
Klaus Otto Schnelzer, M.A. Varietäten und Register der deutschen Sprache Masaryk-Universität Brünn Institut für Germanistik, Nordistik und Nederlandistik Frühjahrssemester 2012 Di, 2. April 2013 Was sind
1. Musterlösung zu Mathematik für Informatiker I, WS 2003/04
 1 Musterlösung zu Mathematik für Informatiker I, WS 2003/04 MICHAEL NÜSKEN, KATHRIN TOFALL & SUSANNE URBAN Aufgabe 11 (Aussagenlogik und natürliche Sprache) (9 Punkte) (1) Prüfe, ob folgenden Aussagen
1 Musterlösung zu Mathematik für Informatiker I, WS 2003/04 MICHAEL NÜSKEN, KATHRIN TOFALL & SUSANNE URBAN Aufgabe 11 (Aussagenlogik und natürliche Sprache) (9 Punkte) (1) Prüfe, ob folgenden Aussagen
Inhaltsverzeichnis. Vorwort
 Vorwort I Längsschnittstudien 13 1. Gesprochene Sprache 15 1.1. Überblick über den Gesamtablauf 15 1.2. Prinzipielle Raumgebundenheit gesprochener Sprache. Oder: Wie kommt es zu Dialektvielfalt? 16 1.3.
Vorwort I Längsschnittstudien 13 1. Gesprochene Sprache 15 1.1. Überblick über den Gesamtablauf 15 1.2. Prinzipielle Raumgebundenheit gesprochener Sprache. Oder: Wie kommt es zu Dialektvielfalt? 16 1.3.
Phonetische Transkription des Deutschen
 Beate Rues/ Beate Redecker Evelyn Koch/Uta Wallraff Adrian P. Simpson Phonetische Transkription des Deutschen Ein Arbeitsbuch 2., überarbeitete und ergänzte Auflage Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis
Beate Rues/ Beate Redecker Evelyn Koch/Uta Wallraff Adrian P. Simpson Phonetische Transkription des Deutschen Ein Arbeitsbuch 2., überarbeitete und ergänzte Auflage Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis
Regional Variation and Edges: Glottal Stop Epenthesis and Dissimilation in Standard and Southern Varieties of German Birgit Alber (2001)
 Regional Variation and Edges: Glottal Stop Epenthesis and Dissimilation in Standard and Southern Varieties of German Birgit Alber (2001) Seminar: Optimalitätstheorie Dozent: P. Gallmann Referenten: Anne-Marie
Regional Variation and Edges: Glottal Stop Epenthesis and Dissimilation in Standard and Southern Varieties of German Birgit Alber (2001) Seminar: Optimalitätstheorie Dozent: P. Gallmann Referenten: Anne-Marie
Beschreibung von Diagrammen, Tabellen und Grafiken zur Prüfungsvorbereitung auf das Zertifikat Deutsch
 Beschreibung von Diagrammen, Tabellen und Grafiken zur Prüfungsvorbereitung auf das Zertifikat Deutsch Einleitung: Was ist der Titel oder Inhalt der Grafik? Das Diagramm zeigt... Die Grafik stellt... dar.
Beschreibung von Diagrammen, Tabellen und Grafiken zur Prüfungsvorbereitung auf das Zertifikat Deutsch Einleitung: Was ist der Titel oder Inhalt der Grafik? Das Diagramm zeigt... Die Grafik stellt... dar.
Franken im 10. Jahrhundert - ein Stammesherzogtum?
 Geschichte Christin Köhne Franken im 10. Jahrhundert - ein Stammesherzogtum? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 1) Kriterien für ein Stammesherzogtum... 3 2) Die Bedeutung des Titels dux
Geschichte Christin Köhne Franken im 10. Jahrhundert - ein Stammesherzogtum? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 1) Kriterien für ein Stammesherzogtum... 3 2) Die Bedeutung des Titels dux
Lesen und Schreiben bei mehrsprachigen Kindern
 Raffaele De Rosa Lesen und Schreiben bei mehrsprachigen Kindern Raffaele De Rosa Lesen und Schreiben bei mehrsprachigen Kindern Theoretische und praktische Ansätze mit konkreten Beispielen Haupt Verlag
Raffaele De Rosa Lesen und Schreiben bei mehrsprachigen Kindern Raffaele De Rosa Lesen und Schreiben bei mehrsprachigen Kindern Theoretische und praktische Ansätze mit konkreten Beispielen Haupt Verlag
DIE NORDFRIESISCHE MUNDART DER BÖKINGHARDE
 DIE NORDFRIESISCHE MUNDART DER BÖKINGHARDE ZU EINER STRUKTURELL-DIALEKTOLOGISCHEN DEFINITION DER BEGRIFFE 'HAUPT-', 'UNTER-' UND 'DORFMUNDART' MIT DREI ABBILDUNGEN UND 109 KARTEN VON ALASTAIR G. H. WALKER
DIE NORDFRIESISCHE MUNDART DER BÖKINGHARDE ZU EINER STRUKTURELL-DIALEKTOLOGISCHEN DEFINITION DER BEGRIFFE 'HAUPT-', 'UNTER-' UND 'DORFMUNDART' MIT DREI ABBILDUNGEN UND 109 KARTEN VON ALASTAIR G. H. WALKER
Mengenlehre und vollständige Induktion
 Fachschaft MathPhys Heidelberg Mengenlehre und vollständige Induktion Vladislav Olkhovskiy Vorkurs 018 Inhaltsverzeichnis 1 Motivation 1 Mengen.1 Grundbegriffe.................................. Kostruktionen
Fachschaft MathPhys Heidelberg Mengenlehre und vollständige Induktion Vladislav Olkhovskiy Vorkurs 018 Inhaltsverzeichnis 1 Motivation 1 Mengen.1 Grundbegriffe.................................. Kostruktionen
Distribution Dieser Begriff bezieht sich nicht nur auf morphologische Einheiten, sondern ist z.b. auch auf <Phoneme anwendbar.
 Distribution Dieser Begriff bezieht sich nicht nur auf morphologische Einheiten, sondern ist z.b. auch auf
Distribution Dieser Begriff bezieht sich nicht nur auf morphologische Einheiten, sondern ist z.b. auch auf
Wort. nicht flektierbar. flektierbar. nach Person, Numerus, Modus, Tempus, Genus verbi flektiert. nach Genus, Kasus, Numerus flektiert
 Wort flektierbar nicht flektierbar nach Person, Numerus, Modus, Tempus, Genus verbi flektiert genufest nach Genus, Kasus, Numerus flektiert genusveränderlich komparierbar nicht komparierbar Verb Substantiv
Wort flektierbar nicht flektierbar nach Person, Numerus, Modus, Tempus, Genus verbi flektiert genufest nach Genus, Kasus, Numerus flektiert genusveränderlich komparierbar nicht komparierbar Verb Substantiv
Helmut Genaust: Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennam en
 Helmut Genaust: Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennam en Helmut Genaust Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen Birkhäuser Verlag Basel und Stuttgart CIP-Kurztitelaufnahme
Helmut Genaust: Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennam en Helmut Genaust Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen Birkhäuser Verlag Basel und Stuttgart CIP-Kurztitelaufnahme
Historiolinguistik I. Sebastian Bernhardt, Nils Burghardt und Florian Neuner
 Historiolinguistik I Sebastian Bernhardt, Nils Burghardt und Florian Neuner 15.04.2005 Historizität von Sprache Was wandelt sich in der Sprache? ? X A B A.1 A.2 Zeit Sprachstufe A Sprachstufe B Machtwechsel
Historiolinguistik I Sebastian Bernhardt, Nils Burghardt und Florian Neuner 15.04.2005 Historizität von Sprache Was wandelt sich in der Sprache? ? X A B A.1 A.2 Zeit Sprachstufe A Sprachstufe B Machtwechsel
Aufnahmeprüfung Deutsch 2011 Kaufmännische Berufsmaturität
 Name... Vorname... Nummer... Aufnahmeprüfung 2011 Kaufmännische Berufsmaturität Zeit 60 Minuten Hilfsmittel keine Bewertung Teil A Textverständnis Textproduktion erreichte Punktzahl von 44 Teil B Grammatik
Name... Vorname... Nummer... Aufnahmeprüfung 2011 Kaufmännische Berufsmaturität Zeit 60 Minuten Hilfsmittel keine Bewertung Teil A Textverständnis Textproduktion erreichte Punktzahl von 44 Teil B Grammatik
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: "Wissen, wer der Babo ist!" Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: "Wissen, wer der Babo ist!" Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de I Mündlich kommunizieren Beitrag 22 Jugendsprache
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: "Wissen, wer der Babo ist!" Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de I Mündlich kommunizieren Beitrag 22 Jugendsprache
Meint die zeitlich regelmäßige Wiederkehr von Ereignissen. Im Rahmen von auditiven Phänomenen Schallereignisse
 Die Unterscheidung zwische akzent- und silbenzählenden Sprachen Zentraler Begriff: Isochronie Meint die zeitlich regelmäßige Wiederkehr von Ereignissen Im Rahmen von auditiven Phänomenen Schallereignisse
Die Unterscheidung zwische akzent- und silbenzählenden Sprachen Zentraler Begriff: Isochronie Meint die zeitlich regelmäßige Wiederkehr von Ereignissen Im Rahmen von auditiven Phänomenen Schallereignisse
Ein Problem diskutieren und sich einigen Darauf kommt es an
 Ein Problem diskutieren und sich einigen Darauf kommt es an Stellen Sie zuerst den Sachverhalt dar Sagen Sie dann Ihre Meinung Gehen Sie auf die Argumentation Ihres Gesprächspartners ein Reagieren Sie
Ein Problem diskutieren und sich einigen Darauf kommt es an Stellen Sie zuerst den Sachverhalt dar Sagen Sie dann Ihre Meinung Gehen Sie auf die Argumentation Ihres Gesprächspartners ein Reagieren Sie
Hast du Fragen? Begleitmaterial Station 5. Ziel: Idee und Hintergrund. Kompetenzen. Fragen rund um das Thema Sprachen
 Begleitmaterial Station 5 Hast du Fragen? Ziel: Fragen rund um das Thema Sprachen Idee und Hintergrund Sprache und Sprachen sind für viele Lebensbereiche der Menschen von enormer Wichtigkeit. Es stellen
Begleitmaterial Station 5 Hast du Fragen? Ziel: Fragen rund um das Thema Sprachen Idee und Hintergrund Sprache und Sprachen sind für viele Lebensbereiche der Menschen von enormer Wichtigkeit. Es stellen
Einführung in das Mittelhochdeutsche
 De Gruyter Studium Einführung in das Mittelhochdeutsche Bearbeitet von Thordis Hennings überarbeitet 2012. Taschenbuch. X, 254 S. Paperback ISBN 978 3 11 025958 2 Format (B x L): 15,5 x 23 cm Gewicht:
De Gruyter Studium Einführung in das Mittelhochdeutsche Bearbeitet von Thordis Hennings überarbeitet 2012. Taschenbuch. X, 254 S. Paperback ISBN 978 3 11 025958 2 Format (B x L): 15,5 x 23 cm Gewicht:
1. Gruppen. 1. Gruppen 7
 1. Gruppen 7 1. Gruppen Wie schon in der Einleitung erläutert wollen wir uns in dieser Vorlesung mit Mengen beschäftigen, auf denen algebraische Verknüpfungen mit gewissen Eigenschaften definiert sind.
1. Gruppen 7 1. Gruppen Wie schon in der Einleitung erläutert wollen wir uns in dieser Vorlesung mit Mengen beschäftigen, auf denen algebraische Verknüpfungen mit gewissen Eigenschaften definiert sind.
Der deutsch-polnische Sprachkontakt in Oberschlesien am Beispiel der Gegend von Oberglogau
 Daniela Pelka Der deutsch-polnische Sprachkontakt in Oberschlesien am Beispiel der Gegend von Oberglogau tra/o Inhalt EINFUHRUNG 11 I THEORETISCHER TEIL 15 1 Geschichte des deutsch-polnischen Sprachkontaktes
Daniela Pelka Der deutsch-polnische Sprachkontakt in Oberschlesien am Beispiel der Gegend von Oberglogau tra/o Inhalt EINFUHRUNG 11 I THEORETISCHER TEIL 15 1 Geschichte des deutsch-polnischen Sprachkontaktes
Die Familiennamen in der Gemeinde Hutthurm im Vergleich zu den Familiennamen in der Gemeinde Stadthagen-Nienstädt
 Germanistik Monika Straßer geb. Rinesch Die Familiennamen in der Gemeinde Hutthurm im Vergleich zu den Familiennamen in der Gemeinde Stadthagen-Nienstädt Examensarbeit Universität Passau Philosophische
Germanistik Monika Straßer geb. Rinesch Die Familiennamen in der Gemeinde Hutthurm im Vergleich zu den Familiennamen in der Gemeinde Stadthagen-Nienstädt Examensarbeit Universität Passau Philosophische
Am Anfang war das Wort!
 Am Anfang war das Wort! Was ist Morphologie? Der Begriff Morphologie wurde 1796 von Johann Wolfgang von Goethe in einer Tagebuchaufzeichnung für eine neue Wissenschaft geprägt,, die sich mit den Gestaltungsgesetzen
Am Anfang war das Wort! Was ist Morphologie? Der Begriff Morphologie wurde 1796 von Johann Wolfgang von Goethe in einer Tagebuchaufzeichnung für eine neue Wissenschaft geprägt,, die sich mit den Gestaltungsgesetzen
AVS - M 01. Nr. Veranstaltungen SWS LP A Pflichtbereich 1 Einführung in die Phonetik & Phonologie Einführung in die Morphologie und Syntax 2 5
 AVS - M 01 1. Name des Moduls: Basismodul I: Grundlagen und Methoden der AVS 2. Fachgebiet / Verantwortlich: Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft/ 3. Inhalte / Lehrziele Die Studierenden werden
AVS - M 01 1. Name des Moduls: Basismodul I: Grundlagen und Methoden der AVS 2. Fachgebiet / Verantwortlich: Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft/ 3. Inhalte / Lehrziele Die Studierenden werden
Aufgabe 2 1) Langvokale [i:] <ie>, <i>, <ich>, <ieh> Liebe, Igel, ihn, Vieh [y:], [ø:], [ɛ:], [u:]
![Aufgabe 2 1) Langvokale [i:] <ie>, <i>, <ich>, <ieh> Liebe, Igel, ihn, Vieh [y:], [ø:], [ɛ:], [u:] Aufgabe 2 1) Langvokale [i:] <ie>, <i>, <ich>, <ieh> Liebe, Igel, ihn, Vieh [y:], [ø:], [ɛ:], [u:]](/thumbs/61/45477553.jpg) Aufgabe 1 Artikualtionsart Artikulationsort Stimmton [Ɂ] Plosiv glottal stimmlos [ʀ] Vibrant uvular stimmhaft [ʃ] Frikativ postalveolar stimmlos [ɡ] Plosiv velar stimmhaft [z] Frikativ alveolar stimmhaft
Aufgabe 1 Artikualtionsart Artikulationsort Stimmton [Ɂ] Plosiv glottal stimmlos [ʀ] Vibrant uvular stimmhaft [ʃ] Frikativ postalveolar stimmlos [ɡ] Plosiv velar stimmhaft [z] Frikativ alveolar stimmhaft
