1 Absinkende Wahlbereitschaft - Warum? 2 Verschiedene Erklärungsansätze der Wahlforschung
|
|
|
- Marta Rothbauer
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 1 Absinkende Wahlbereitschaft - Warum? 1 An der Bundestagswahl 1987, der letzten Bundestagswahl vor der deutsch - deutschen Vereinigung, beteiligten sich 84,4 % der über 40 Mio. Wahl-berechtigten. Obwohl die Wahlbeteiligung in Deutschland im internationalen Vergleich noch immer recht hoch ist, hat sie nach Spitzenwerten über 90 % in den 70er Jahren seit Anfang der 80er Jahre kontinuierlich abgenommen. Sie erreichte in den 90er Jahren bei Landtagsund Bundestagswahlen in manchen Altersgruppen nunmehr ca. 50 %. Da drängt sich die Frage auf: warum? Auf dieses Problem und das der Wechselwahl möchte ich in den folgenden Kapiteln etwas näher eingehen und mit Hilfe verschiedener Erklärungsmodelle Deutungsmöglichkeiten aufzeigen. 2 Verschiedene Erklärungsansätze der Wahlforschung 2.1 Begriffsklärung Wahlforschung beschäftigt sich unter verschiedensten Aspekten mit dem Phänomen der Wahl, der allgemeinsten und einfachsten Form politischer Partizipation und der Grundvoraussetzung moderner Demokratie. Analysen des Wahlrechts, des Wahlprozesses, des Wahlsystems stehen aus der Sicht der Rechts- und Poltikwissenschaft im Vordergrund. Dabei geht es um die Ausgestaltung der Wahlrechtsgrundsätze, um Probleme des Parteienwettbewerbs, des Wahlkampfes, der Finanzierung und Kosten des Wahlprozesses, um das Wahlsystem und seine Auswirkungen auf die politische Machtverteilung, weiterhin um die Analyse von Einstellungen, Verhaltensmustern und Motiven des einzelnen Wählers bei der Politischen / Wahl - Soziologie und der Politischen Psychologie. Dieser Zweig der Wahlforschung stellt die Frage: Wer wählte wen / was warum? Im engeren Sinne meint die Wahlforschung die Analyse des Wähler-verhaltens. In diesem wahlsoziologischen Verständnis befaßt sie sich mit der Beschreibung, Erklärung und Prognose individueller
2 2 Wählerentscheidung, der Verteilung der Partei-, Kandidaten-, Sachpräferenzen in der Wählerschaft als Ganzem wie in politisch relevanten sozialen, kulturellen, territorialen (Sub-) Einheiten in der Wählerschaft. Untersucht werden strukurelle Bestimmungsfaktoren wie die Gesellschaftsstruktur, die Verankerung des Wählers in seinen Primär- und Sekundärwelten sowie die sozialen und kulturellen Milieus. Außerdem spielen die situativen Bestimmungsfaktoren in die Untersuchung mit ein. Dazu gehören die Bedingungen des Parteien-wettbewerbs, der Wahlkampf usw. Zu den Persönlichkeitsfaktoren werden dauerhafte, im Sozialisationsprozeß erworbene Einstellungen, Normen, Verhaltensmuster u.a. gesellschaftliche Wertorientierungen, Partei-identifikation, gezählt. In den nachfolgenden Kapiteln versuche ich den Erklärungsansatz der Columbia School, der Michigan School und der Theorie des rationalen Wählers etwas näher zu beleuchten. 2.2 Columbia School Lazarsfeld suchte ein mikrosoziologisches Modell zu entwickeln und manche sind der Meinung, damit habe die eigentliche Wahlsoziologie erst begonnen. Seine Arbeit hat bis heute eine Leitfunktion. Dieses Erklärungsmodell geht auf die Beobachtung zurück, daß in Gebieten unterschiedlicher Sozial-struktur verschiedene Parteien unterschiedlich erfolgreich sind. In der Studie The People`s Choice (1944) formulierten Lazarsfeld, Berelson, Gaudet einen Erklärungsansatz, welcher den Zusammenhang zwi-schen Wählerverhalten und dessen sozialstruktureller Verankerung sowie der Milieubindung thematisiert. Das Design der Arbeit, eine als sechswelliges Panel angelegte Studie war zunächst auf die Wirkung der Massenmedien im Wahlkampf und den Meinungsbildungsprozeß ausgerichtet. Doch schon bald erkannten Lazarsfeld et al., daß die meisten Wähler über langfristige Parteienloyalitäten verfügen. Somit stand die Wahlentscheidung schon vor dem Wahlkampf fest und nur noch eine kleine Gruppe pendelte zwischen den Parteien oder Kandidaten. Zur Erklärung dieses Phänomens
3 3 zogen sie unabhängige Variablen heran, wie den sozioökonomischen Status, die Religionszugehörigkeit, Alter und Wohngegend, aus denen sie den Index of Political Predisposition (IPP) bildeten: Je stärker sich die ver-schiedenen Gruppenmitgliedschaften des einzelnen im Sinne politischer Homogenität decken, je geringer die Wirkung gegenläufiger Einflüsse, desto wahrscheinlicher geht die Wahlentscheidung in die durch die Gruppennormen vorgegebene Richtung. Verhaltensinstabilität, Apathie und Wechselwahl hingegen erklärt man mit "Cross pressure" - Situationen, denen der Wähler z. B. durch die Zugehörigkeit zu verschiedenen und politisch gegensätzlichen Organi-sationen ausgesetzt ist. Lazarsfeld bemerkte in seiner Arbeit: A person thinks, politically, as he is socially. Social characteristics determine political preference. 2.3 Michigan School Dem sozialpsychologischen Ansatz der Michigan School geht es hingegen um den Wechsel von Parteipräferenzen und um Ursachen kurzfristiger Abweichungen vom traditionellen Wählerverhalten. Die Forscher um Campbell und Converse, die als erste Umfragen im Rahmen einer nationalen, repräsentativen Stichprobe durchführten, sehen den Wähler in einem psychologischen Spannungsverhältnis zwischen seiner Parteibindung und seiner Beurteilung der aktuellen Politik sowie der Rolle, die die Parteien und ihre für den jeweiligen Wähler wichtigen Kandidaten in ihr spielen. Im Gegensatz zur Columbia School scheint die Wahlentscheidung eher individuell ausgeprägt als ein logisches Produkt sozialer Gruppenmerkmale zu sein: Voting is in the end an act of individuals, and the motives for this act must be sought in psychological forces on individual human beings. Den Einfluß der Sozialstruktur wird als nur mittelbar über den Umweg politischer Einstellungen ( attitudes ) gesehen. Diese beeinflußten die Ent-wicklung einer mehr oder weniger starken Parteiidentifikation ( party identification ) eine langfristig stabile, affektive Bindung an eine Partei, die im Prozeß der politischen Sozialisation, meist schon in der Jugend in
4 4 Familie und Schule, erworben und die umso stabiler wird, je häufiger man sich in der Zeit bei Wahlen mit der Partei identifiziert. Die Parteiidentifikation trage dazu bei, daß der Wahlberechtigte politische Informationen gefiltert wahr-nehme, Kandidaten und Sachaussagen seiner Partei grundsätzlich positiver bewerte und so im Normalfall ( normal vote ) für diese Partei und ihre Kandidaten stimme. Der langfristigen Parteibindung und Berechenbarkeit des Wahlverhaltens können kurzfristige Einflüsse entgegenwirken, unter denen die Forscher aus Ann Arbor die Kandidaten- und die Problemorientierung verstehen. Dabei gelang der Michigan School der Nachweis, daß das Wahlverhalten umso konstanter war, je besser die langfristige Partei-identifikation und die kurzfristige Kandidaten- und Problemorientierung übereinstimmten. 2.4 Der Rationale Wähler In der Downschen Theorie gibt es zwei Arten von Akteuren: Wähler und Parteien. Die erste Annahme geht davon aus, daß das Ziel der Partei darin besteht, Wahlen zu gewinnen, weshalb sie Programme entwickeln, die ihnen helfen sollen, Wählerstimmen zu häufen. Die Parteien müssen demzufolge die Präferenzen der Wähler berücksichtigen, wenn sie ihre Stimmen maximieren wollen. Die zweite Annahme ist die, daß sich die Wähler rational verhalten, d. h. durch ihre Wahlentscheidung ihren politischen Nutzen zu vergrößern versuchen. Ein Wähler verhält sich dann rational, wenn er für die Partei stimmt, von der er glaubt, daß sie am ehesten seine individuellen Ziele zu realisieren vermag. Ganz anders als Lazarsfeld und Campbell geht Downs vor, der zuerst das Problem der Wahlbeteiligung sieht. Er fragte sich, was den Wahlberechtigten dazu bewegt, Zeit und Energie zur Stimmabgabe aufzuwenden und folgerte, dieser müsse einen persönlichen Nutzen durch das von ihm gewünschte Ergebnis der Wahl erwarten. Sein Modell ist Teil einer umfassenden Verhaltenstheorie und abgeleitet aus wirtschaftlichen Marktmodellen mit ihren Kosten- Nutzen- Analysen. Diese gehen davon aus, daß Individuen in einer gegebenen Situation diejenige Verhaltensalternative wählen, von der sie den größten Nutzen erwarten:
5 5 Nach dem sogenannten Eigennutz - Axiom postuliert Downs die Annahme..., daß jeder Bürger seine Stimme der Partei gibt, die ihm seiner Überzeugung nach mehr Vorteile bringen wird als andere. Der rationale Wähler beteiligt sich also Downs zufolge nur dann an der Wahl, wenn der durch die Stimmabgabe erwartete Gewinn die dadurch entstehenden Kosten übersteigt. Kosten sind Zeit und Energie für die Stimmabgabe sowie das vorherige Einholen von Informationen. 3 Nichtwähler und Wechselwähler als Form des Wahlverhaltens 3.1 Begriffsklärung Die begrifflichen Mißverständnisse wird man am ehesten dann vermeiden können, wenn man von einer rein formalen Definition ausgeht und als Wechselwähler nur diejenigen Wähler bezeichnet, die an zwei aufeinanderfol-genden und vergleichbaren Wahlen wahlberechtigt waren, teilgenommen und ihre Stimme für verschiedene Parteien abgegeben haben. Nur bei solchen Parteiwechslern handelt es sich um Wechselwähler. Allein eine derart enge Definition schafft die notwendige Klarheit, da sie die erforderliche Abgrenzung gestaltet gegenüber dem Stammwähler, der bei beiden oder auch mehreren Wahlen seine Parteipräferenz beibehält, dem floating voter, zu dem die angelsächsische Wahlforschung nicht allein den Wechselwähler, sondern alle unentschlossenen, schwankenden Wähler zählt, die zwischen zwei Wahlen und insbesondere während des Wahlkampfes keine feste und stabile Parteipräferenz äußern. Bei Nichtwählern ist zwischen ständiger, sporadischer, zufälliger (durch unvorhersehbare Verhinderung am Wahltag), systemischer (die Teilnahme auf rationaler, die Nichtteilnahme auf nachrangiger, lokaler oder regionaler Systemebene), politisch- konjunktureller Nichtwahl zu unterscheiden. Nichtwähler gehören nicht in die Kategorie der Wechselwähler. Bei
6 6 bewußter Wahlenthaltung aus politisch aktuellen Motiven kann es sich bestenfalls um eine Vorstufe zum Parteiwechsel handeln, sofern es dann bei der nächsten Wahl tatsächlich zum Wechsel der Parteipräferenz kommt. Die tatsächlichen Nichtwähler sind Dauernichtwähler und gelegentliche Nichtwähler. Die Dauernichtwähler machen in den Städten bis zu 6 % der Wahlberechtigten aus. In kleineren Gemeinden mit einem gesellschaftlichen Wahlzwang, der fast zur Wahlpflicht werden kann, ist der Anteil der Dauer-nichtwähler ohne Zweifel niedriger. Zu Dauernichtwählern gehören u. a. Anhänger von Religionsgemeinschaften, die politische Aktivität aus Glaubensgründen ablehnen, so z. B. die Zeugen Jehovas. Allein diese Religionsgemeinschaft trägt zur Zahl der Dauernichtwähler mit etwa 1 % der Wahlberechtigten bei. Gelegentliche Nichtwähler sind es aus Protest oder aus Gleichgültigkeit gegenüber einer bestimmten Wahl (konjunktureller Nichtwähler) oder aus Zufallsgründen, die ihre Teilnahme an der Wahl unmöglich machen. 3.2 Columbia School Der Stammwähler Bevor ich den Wechselwähler betrachte, möchte ich noch einmal näher auf den Stammwähler eingehen. Tatsache ist, je homogener das Umfeld und die Milieus, je stärker die Gruppenbindung, desto konstanter das Wahlverhalten, desto früher und endgültiger die Wahlentscheidung und desto größer wohl auch die Neigung zur Stimmabgabe: The more interest and the fewer conflicting pressures a person had, the more he tended to decide once and for all early in the game and never change his mind thereafter. Dieser Prototyp des Stammwählers habe seine ausgeprägten Parteibindungen erwor-ben vor allem durch politische Sozialisation und Kommunikation mit Mei-nungsführern, verstärkt und immer wieder aktualisiert durch soziale
7 7 Kontrolle in Form von Gruppendruck, Anpassung an die Bedürfnisse und Wünsche der nächsten Umgebung und durch die Tendenz des einzelnen, mit seiner Familie, seinen Freunden und Arbeitskollegen in einem möglichst spannungsfreien Verhältnis zu leben. Unterstützt werde die soziale Determi-nierung des politischen Verhaltens durch die Tendenz zur selektiven Medien-nutzung und einseitigen Wahrnehmung und Verarbeitung politischer Informationen Der Wechselwähler Dieser Erklärungsansatz nimmt im wesentlichen konstantes Wahlverhalten an, während divergentes oder wechselndes Wahlverhalten von ihm nicht abgedeckt wird. Man geht davon aus, daß die Wahrscheinlichkeit des Wechsels umso größer wird, je heterogener die umwelt- und / oder medienvermittelten Informationen sind, die auf den Wähler einströmen. Wer sich mit solchen cross pressures konfrontiert und in verschiedene Richtungen gedrängt sieht, neige laut Lazarsfeld und seinen Mitarbeitern dazu, den Konflikt durch nachlassendes politisches Interesse herunter-zuspielen, die Entscheidung zu verschieben. Volatiles, also ein öfter wechselndes Wahlverhalten, wird anhand der Hypothese abgeleitet, daß die Intensität der Parteibindung davon abhängig sei, ob das Individuum homogenen oder divergierenden Einflüssen unterliege. Eine Verhaltens-änderung wird dann wahrscheinlich, wenn der soziale Kontext verlassen wird oder innerhalb des Kontextes unterschiedliche, widersprüchliche Meinungen vorhanden sind. Eine cross pressure - Situation ist ein Sonderfall, der bereits von Georg Simmel (1917) formulierten Theorie von den sich überschneidenden sozia-len Kreisen. Als Folge der cross pressure - Situation tendieren die Wäh-ler verstärkt dazu, ihre politischen Orientierungen und auch ihr Wahlver-halten zu ändern. Empirisch wurden bei Personen, die sich unter cross pressure befinden, ein inkonsistenteres Wahlverhalten, deutlich geringeres politisches Interesse und eine niedrigere Wahlbeteiligung als Merkmale fest-gestellt. Zur Typologisierung der Wechselwähler führten Lazarsfeld et al. folgende Begriffe ein: Crystallizers und Waverers. Erst
8 8 genannte bezeichnen Wähler, die zu Beginn der Befragung noch ohne Entscheidung waren und sich später einer Partei zuwandten. Weiterhin wird noch in Waverers unterschieden. Diese Gruppe kennzeichnet Wähler, die zwischenzeitlich zu einer anderen Partei neigten, aber am Ende doch wieder zu der Partei tendierten, die sie am Anfang angaben. Bei den Waverers fand noch eine Binnendifferenzierung nach indecision waverers, party waverers und party changers statt, die die unterschiedlichen Verlaufsformen der Wahlentscheidung genauer beschreibt Wahlenthaltung nach soziologischen Aspekten Die Sozialstruktur gibt wichtige Hinweise zur Beleuchtung des Phänomens Wahlenthaltung. Auskunft erteilt sie allerdings nur über die Prädisposition, die Neigung zur Wahlbeteiligung. Ob es in einer konkreten Situation dann zur Stimmabgabe kommt, hängt auch mit anderen, vornehmlich politischen Faktoren zusammen. Die neu zugezogene, 19- jährige, alleinstehende, ungelernte Arbeiterin ohne Schulabschluß, ohne Bindung an Kirche, Gewerkschaft oder Vereine ist nicht zwangsläufig eine Nichtwählerin! Man kann lediglich davon ausgehen, daß ihre Reizschwelle für die Entscheidung zur Stimmabgabe höher liegt als beim verheirateten 50 - jährigen Beamten mit vier Kindern, starker Kirchenbindung und aktiver Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr. Das heißt, es bedarf wahrscheinlich größerer politischer Reize, um sie an einem bestimmten Wahltag zum Urnengang zu bewegen. Lassen wir einmal das Geschlecht beiseite, denn das Wahlverhalten von Mann und Frau verläuft bezüglich der Beteiligung parallel. Viel wichtiger er-scheint es da, das Alter näher zu betrachten, denn es wurde festgestellt, daß die Beteiligung mit dem Alter stetig zunimmt, sie erreicht ihren Gipfel zwi-schen 50 und 70 Jahren und fällt dann relativ schnell wieder ab. Demnach ist eine zunehmende Ausprägung festzustellen, nach der besonders junge und auch alte Menschen eine überdurchschnittlich hohe Neigung zur Wahlenthaltung besitzen. Nicht Politikverdrossenheit oder Distanz zum politischen System sondern vielmehr scheint es die fast logische Folge des Wertewandels zu sein. Dazu kommt ein geringeres
9 9 politisches Interesse. Das Absinken der Beteiligungswerte bei den über 70- jährigen ist insbesondere auf die zunehmende Gebrechlichkeit und Vereinsamung vieler alter Menschen zurückzuführen, die wiederum zu einem nachlassendem Interesse an der Politik beitragen. Im Hinblick auf den Zusammenhang von Konfession und Wahlbeteiligung ist heute weniger die Unterscheidung zwischen katholischem und protes-tantischem Wahleifer als vielmehr die zwischen dem von Konfessionslosen und Angehörigen einer Konfession relevant. Je stärker die Kirchenbindung, desto positiver die Auswirkungen auf die Neigung zur Stimmabgabe. Dabei wirken die Katholische und die Protestantische Kirche als Wahlhelfer : einerseits propagieren sie die Wahlbeteiligungsnorm und unterstützen deren Verinnerlichung und andererseits tragen sie in Form entsprechender Milieus zur Stabilisierung von persönlichen Bindungen bei. Der soziale Status weist stärkere Zusammenhänge mit der Wahlbeteiligung auf als die Faktoren Geschlecht, Alter und Konfession. Dabei gilt: Je niedriger der soziale Status der Wahlberechtigten, desto niedriger, ihre Nei-gung zur Stimmabgabe. Die eifrigsten Wähler sind Beamte, höhere Ange-stellte und Selbständige. Deutlich stärker zur Wahlenthaltung neigen einfache Angestellte und Arbeiter sowie tendenziell die nicht Erwerbstätigen. Einer der Gründe für die stärkere Neigung der einfachen Leute zur Wahl-enthaltung scheint die vor allem bei den Arbeitern ausgesprochen negative subjektive Einschätzung des politischen Geschehens zu sein. Abschließend ist nur noch zu sagen, daß das Konzept der Columbia School wenig hilfreich ist bei der Suche nach Gründen für Wechsel- und Nichtwahl. Vielmehr betont es eher die stabilen Elemente des Wahlverhaltens. 3.3 Michigan School Konstantes und wechselndes Wählerverhalten Es gelang der Michigan School der Nachweis, daß das Wahlverhalten um
10 10 so konstanter war, je besser die langfristige Parteiidentifikation und die langfristige Kandidaten- und Problemorientierung übereinstimmten. Konflikte treten auf, sobald dies nicht der Fall ist - die cross pressures können dann für Wahlenthaltung und Wechselwahl sorgen. Parteiidentifikation effektiver Parteibindung und aktueller Politik (normal vote versus actual vote). Bezugspunkt des Wählverhaltens sind nicht die sozialen Gruppen und sozio- kulturellen Milieus, sondern die Partei, mit der man sich identifiziert, als Langzeitfaktor sowie die Einstellung zu Kandidaten und zu Issues als politische Kurzzeiteinflüsse. Im Sozialisationsprozeß erworben und durch Wahlen immer wieder aktualisiert, wirkt die Parteiidentifikation dabei wie ein Filter, der Wahrnehmung und Bewertung politischer Themen und Ereignisse strukturiert. Wähler mit starker Parteiidentifikation machen sich die Sachpo-sitionen ihrer Partei eher zu eigen als die der Konkurrenz und sie schätzen die Kandidaten ihrer Partei, deutlich positiver ein als die Mitbewerber an-derer Parteien. Erklärt werden diese Zusammenhänge üblicherweise mit den psychologischen Konzepten von selektiver Wahrnehmung und kognitiver Dissonanz: Konsonanz führt zu konstantem Wählerverhalten, Dissonanzen bewirken wechselndes Wählerverhalten, kurzfristige Abweichungen wie langfristige Umorientierungen in den politischen Einstellungen und Verhaltensmustern der Wähler. Makropolitisch bildet die Parteiidentifikation eine wichtige Voraussetzung politischer Stabilität Die Nichtwahl Die individuelle Wählerentscheidung kann aus der Sicht des Ann Arbor - Modells als eine Funktion gegenwärtiger und vergangener Ereignisse ange-sehen werden oder genauer, als eine Resultate aus dem Zusammenspiel von vorgängiger Erfahrung und subjektiver Situationsdeutung. Die subjektive Interpretation sozialökonomischer Faktoren ist demzufolge wichtiger für das Verhalten als deren objektive Beschaffenheit, die Identifikation mit einer so-zialen Gruppe bedeutsamer als die tatsächliche Gruppenmitgliedschaft.
11 11 Von großer, ja ausschlaggebender Bedeutung für die konkrete Wahlent-scheidung ist neben den kurzfristig wirksamen Faktoren der Kandidaten und Problemorientierung die Parteiidentifikation, worunter eine für gewöhnlich länger andauernde, gefühlsmäßig tief verankerte Bindung des einzelnen an eine bestimmte Partei zu verstehen ist. Daraus resultierend, ist die Wahr-scheinlichkeit der Nichtwahl gegeben, je schwächer die Identifikation für eine Partei ausfällt. Obwohl längerfristige Einstellungen durch kurzfristige über-lagert werden, ist das Beispiel der Bundestagswahlen 1980 und 1987 Beweis dafür, daß sich Wähler trotz Parteiloyalitäten eher dazu entscheiden nicht zu wählen als eine Partei an die Macht zu bringen, die zwar nicht erste Wahl wäre, aber dennoch das geringere Übel. Wahlkampfthemen wie auch die Kandidatenbeurteilung sind Kriterien nach denen sich der Wähler richtet. Zwei Beispiele für derartige cross pressures aus der Bundesrepublik seien hier genannt: Bei der Bundestagswahl 1980 enthielten sich viele Frauen, die sonst immer die Union gewählt hatten, weil ihnen der Kanzlerkandidat Strauß mißfiel; bei der Bundestagswahl 1987 flohen viele mit der Regierungspolitik unzufriedene Landwirte, die nicht bereit waren, eine andere Partei als die sonst von ihnen bevorzugte Union zu wählen, ebenfalls in die Enthaltung. Die Begründer des sozialpsychologischen Modells sprechen davon, daß der Bürger bei jedem Urnengang zwei Wahlentscheidungen treffe - die, ob er wählt, und wem er seine Stimme gibt. 3.4 Der Rationale Wähler Die Normalwahl Nach Downs fällt der Wähler seine Wahlentscheidung, indem er den Nutzen ermittelt, den ihm jede der in Betracht kommenden konkurrierenden Parteien brächte, wenn sie an die Regierung gelangen würde. Um festzustellen, welche Partei dies ist, stellt er für die Parteien ein Nutzendifferential auf und schätzt die Kosten des Wählens und die Anzahl der Personen, die sich seiner Erwartung nach an der Wahl beteiligen werden.
12 12 Der Wähler trifft eine Entscheidung, indem er die erwartenden künftigen Leistungen der konkurrie-renden Parteien vergleicht. Er überlegt, was die Parteien tun würden, wenn sie an der Regierung wären. Um eine Vorstellung darüber zu haben, was eine Parteien der Zukunft tun wird, vergleicht der Wähler das, was die Regie-rungspartei in der abgelaufenen Legislaturperiode in seinen Augen getan hat, mit dem, was seiner Meinung nach die Oppositionsparteien getan hätten, wenn sie an der Regierung gewesen wären. In der Regel wählt er die Partei, von deren Regierungstätigkeit er sich den größten Vorteil verspricht. Hat die präferierte Partei keine Chance, alleine die Wahl zu gewinnen, so zieht der rationale Wähler unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit in Betracht, für eine andere Partei als die bevorzugte zu stimmen, um somit zu verhindern, daß eine abgelehnte Partei an die Macht kommt. Die Entscheidung, ob der Wähler an die Wahlurne tritt oder nicht, erfolgt von Wahl zu Wahl auf`s neue. Kosten und Nutzen werden gegeneinander abgewägt. Ausschließlich kurzfristige Motive sind dafür maßgebend, der Wahlberechtigte verfügt also in keinster Hinsicht über Parteiloyalitäten oder Eingrenzungen durch sein Milieu etc Wechselwähler und Nichtwähler Aufgrund des Umstandes, daß die individuellen Präferenzen der Wähler in der Regel stabiler sind als die Restriktionen, werden in der rationalistischen Theorie des Wählerverhaltens daher Wandlungen im politischen Verhalten durch Änderungen der Restriktionen, insbesondere der wahrgenommenen Verschiebungen der Parteipositionen, erklärt. Das Wahlverhalten der Downschen Theorie geht auf die Behauptung zurück, daß das Wählen mit Kosten verbunden ist. Übersteigen die Kosten die Erträge aus der Wahlbeteiligung, werden viele Bürger, die Anhänger von Parteien sind, zur Stimmenthaltung veranlaßt. Nichtwahl wird demnach erklärbarer als Wechselwahl, denn nach den Kosten- Nutzen- Überlegungen wird Nichtwahl dadurch gerechtfertigt, daß die Kosten den Nutzen übersteigt - nämlich die gewünschte Vertretung legitimiert zu haben. Bei der Wechsel-wahl hingegen werden die Kosten nicht minimiert, denn der Wahlberechtigte nimmt immer noch die Last des Wählens auf sich, ob er
13 13 davon einen höheren Nutzen erlangt, ist strittig, denn hohe Wahlbeteiligung oder wechselndes Wählerverhalten ist mit diesem Modell nicht zu erklären, die Stimmabgabe erscheint als irrationaler Akt, da die zu erwartenden persönlichen Vorteile durch den Wahlsieg einer Partei oder eines Kandidaten sich in der Regel in Grenzen halten. Niemand dürfte sich an Wahlen beteiligen, der rationale, lo-gische Wähler wäre ein Nichtwähler! Nur mit Einfügen des Begriffs Bürgerpflicht wäre eine Wahlbeteiligung erklärbar. Deshalb werde ich vor-rangig auf den Begriff des Nichtwählers eingehen. Nichtwahl resultiert also, wie schon erwähnt, aus dem Abwägen von Kosten und Nutzen. Gleichen sich z. B. die Aktionen und Programme sämt-licher Parteien, so resultiert seine Entscheidung aufgrund des Erwartungs-wertes, ob ein Wandel mehr Nutzen einbringen würde als kein Wandel. Der Prozentsatz derer, die sich der Stimme enthalten, ist unter den Bürgern mit niedrigerem Einkommen höher als unter den Bürgern mit hohem Einkommen. Dafür gibt es zwei Gründe. Da es für die Ärmeren schwieriger ist, die Kosten des Wählens aufzubringen, sind höhere Erträge erforderlich, um sie zur Beteiligung an einer Wahl zu bewegen. Und da sie die Informa-tionskosten weniger leicht tragen können, haben sie weniger Daten und sind weniger sicher in ihren politischen Entscheidungen, daher diskutieren sie die Erträge aus der Wahlbeteiligung stärker. 4 Kritikpunkte Viele kritisierten die Modelle wie die Columbia School, die Michigan School und die Theorie des Rationalen Wählers. Betonte der eine die indivi-duelle Seite zu sehr, so war es bei einem anderen das Fehlen von Erklärungs-ansätzen für bestimmtes Wählerverhalten. Allein mit cross pressure - Situationen wurde der Versuch unternommen, Nichtwahl und wechselndes Wahlverhalten im Erklärungsansatz der Columbia School zu verdeutlichen. Das liegt sicher vor allem daran, daß die meisten Theorien auf empirischen Beobachtungen basieren und im Laufe der Zeit sich
14 14 Einstellungen und auch Gründe für entsprechendes Wählerverhalten änderten. Somit ergibt zwar eine Kombination aus ihnen sichere Ergebnisse, aber es stellt sich auch die Frage: Sind sie überhaupt noch zeitgemäß? Deshalb arbeitet die heutige Wahlforschung mit zwei verschiedenen Modellen. Das sozialstrukturelle Modell geht von den mehr oder weniger flexiblen Sozialstrukturen aus. Das Marktmodell sieht die Wählerschaft, zunächst ohne Rücksicht auf ihre innere Strukturierung, als eine Art Markt, auf dem mehrere, zumindest zwei Anbieter um Stimmen werben.
Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft 9. Vorlesung 15. Dezember Politische Kommunikation 2: Wahlen
 Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft 9. Vorlesung 15. Dezember 2009 Politische Kommunikation 2: Wahlen 1 2 Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft 9. Vorlesung 15. Dezember 2009
Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft 9. Vorlesung 15. Dezember 2009 Politische Kommunikation 2: Wahlen 1 2 Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft 9. Vorlesung 15. Dezember 2009
Der sozialpsychologische Ansatz
 VL Wahl- und Einstellungsforschung 1 2 3 4 Letzte Woche: Soziologische Ansätze Zentrale Konzepte: Normen/Erwartungen und Konflikte Mikrosoziologischer Ansatz Geringes politisches Interesse (Meinungsführer)
VL Wahl- und Einstellungsforschung 1 2 3 4 Letzte Woche: Soziologische Ansätze Zentrale Konzepte: Normen/Erwartungen und Konflikte Mikrosoziologischer Ansatz Geringes politisches Interesse (Meinungsführer)
Wahlverhalten in der Bundesrepublik. Politische Soziologie der Bundesrepublik
 Wahlverhalten in der Bundesrepublik Politische Soziologie der Bundesrepublik Wiederholung/Überblick Soziologische Ansätze Der mikrosoziologische Ansatz Der makro-soziologische Ansatz Der sozial-psychologische
Wahlverhalten in der Bundesrepublik Politische Soziologie der Bundesrepublik Wiederholung/Überblick Soziologische Ansätze Der mikrosoziologische Ansatz Der makro-soziologische Ansatz Der sozial-psychologische
Das Medianwählermodell
 Das Medianwählermodell Ökonomische Theorie der Politik A.4.1 Das Medianwählermodell untersucht Entscheidungen, die auf Grundlage der Mehrheitsregel in einer repräsentativen Demokratie gefällt werden 2
Das Medianwählermodell Ökonomische Theorie der Politik A.4.1 Das Medianwählermodell untersucht Entscheidungen, die auf Grundlage der Mehrheitsregel in einer repräsentativen Demokratie gefällt werden 2
Universität Mannheim. Lehrstuhl für Vergleichende Politische Verhaltensforschung
 Universität Mannheim Lehrstuhl für Vergleichende Politische Verhaltensforschung 1 EINFÜHRUNG geht seltener wählen Sinkende Wahlbeteiligung seit den 1980er Jahren Deutliche Beteiligungsunterschiede zwischen
Universität Mannheim Lehrstuhl für Vergleichende Politische Verhaltensforschung 1 EINFÜHRUNG geht seltener wählen Sinkende Wahlbeteiligung seit den 1980er Jahren Deutliche Beteiligungsunterschiede zwischen
Das Politische System Deutschlands
 Das Politische System Deutschlands Prof. Dr. Robert Kaiser Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft Geschwister-Scholl-Institut Fünfte Sitzung: Wahlrecht, Wahlsystem und Wahlverhalten Pflichtvorlesung
Das Politische System Deutschlands Prof. Dr. Robert Kaiser Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft Geschwister-Scholl-Institut Fünfte Sitzung: Wahlrecht, Wahlsystem und Wahlverhalten Pflichtvorlesung
Wählerverhalten in der Demokratie
 Studienkurs Politikwissenschaft Oscar W. Gabriel Bettina Westle Wählerverhalten in der Demokratie Eine Einführung Nomos 3533 Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage Böhlau Verlag Wien Köln Weimar Verlag Barbara
Studienkurs Politikwissenschaft Oscar W. Gabriel Bettina Westle Wählerverhalten in der Demokratie Eine Einführung Nomos 3533 Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage Böhlau Verlag Wien Köln Weimar Verlag Barbara
Demografischer Wandel und politische Beteiligung älterer Menschen: Bleibt alles beim Alten?
 Demografischer Wandel und politische Beteiligung älterer Menschen: Bleibt alles beim Alten? Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kommunalpolitischer Brückenschlag 19.09.2015 Dr. Sven Stadtmüller Forschungszentrum
Demografischer Wandel und politische Beteiligung älterer Menschen: Bleibt alles beim Alten? Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kommunalpolitischer Brückenschlag 19.09.2015 Dr. Sven Stadtmüller Forschungszentrum
Ost-West-Unterschiede im Wahlverhalten. VL Wahl- und Einstellungsforschung
 Ost-West-Unterschiede im Wahlverhalten VL Wahl- und Einstellungsforschung Letzte Woche: Wechselwahl Wechselwähler ändern ihr Verhalten zwischen zwei Wahlen Wichtiger, aber nicht einziger Einfluß auf wechselnde
Ost-West-Unterschiede im Wahlverhalten VL Wahl- und Einstellungsforschung Letzte Woche: Wechselwahl Wechselwähler ändern ihr Verhalten zwischen zwei Wahlen Wichtiger, aber nicht einziger Einfluß auf wechselnde
Einführung. Wahlforschung
 Einführung Wahlforschung Outline Formalia Formalia Wahlforschung Einführung (1/15) Studien-/Modulleistungen Für alle: Diskussion, Referat, Vorbereitung auf jede Sitzung mit der angegebenen Literatur Regelmäßige,
Einführung Wahlforschung Outline Formalia Formalia Wahlforschung Einführung (1/15) Studien-/Modulleistungen Für alle: Diskussion, Referat, Vorbereitung auf jede Sitzung mit der angegebenen Literatur Regelmäßige,
POLITISCHE EINSTELLUNGEN VON TÜRKISCHSTÄMMIGEN MIGRANTEN IN HAMBURG
 POLITISCHE EINSTELLUNGEN VON TÜRKISCHSTÄMMIGEN MIGRANTEN IN HAMBURG Eine empirische Untersuchung Diese Studie wurde von ABH/Institut für Soziobilitättsforschung gefördet Dr. phil. Mustafa Acar 2011 1.
POLITISCHE EINSTELLUNGEN VON TÜRKISCHSTÄMMIGEN MIGRANTEN IN HAMBURG Eine empirische Untersuchung Diese Studie wurde von ABH/Institut für Soziobilitättsforschung gefördet Dr. phil. Mustafa Acar 2011 1.
Ausgewählte Ergebnisse aus der Studie von GMS im Auftrag der Hanns-Seidel-Stiftung vom Frühjahr 2016
 Ausgabe vom 15. Juli 2016 8/2016 Wahl und Nichtwahl Ausgewählte Ergebnisse aus der Studie von GMS im Auftrag der Hanns-Seidel-Stiftung vom Frühjahr 2016 Gerhard Hirscher /// Eine repräsentative Umfrage
Ausgabe vom 15. Juli 2016 8/2016 Wahl und Nichtwahl Ausgewählte Ergebnisse aus der Studie von GMS im Auftrag der Hanns-Seidel-Stiftung vom Frühjahr 2016 Gerhard Hirscher /// Eine repräsentative Umfrage
Viola Neu Die Bundestagswahl 2013 Analyse einer Umfrage. 1. Die Anhängerschaften der Parteien
 Viola Neu Die Bundestagswahl 2013 Analyse einer Umfrage 1. Die Anhängerschaften der Parteien Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat zwischen dem 23. September und dem 07. Oktober 2013 mit TNS Emnid eine telefonische
Viola Neu Die Bundestagswahl 2013 Analyse einer Umfrage 1. Die Anhängerschaften der Parteien Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat zwischen dem 23. September und dem 07. Oktober 2013 mit TNS Emnid eine telefonische
VL Wahl- und Einstellungsforschung. Medien und Wahlverhalten
 VL Wahl- und Einstellungsforschung Medien und Wahlverhalten Letzte Woche: Wahl der Neuen Rechtsparteien (rechtsradikale/rechtspopulistische Parteien) Zuwanderung/ethnische Konflikte als dominante Themen
VL Wahl- und Einstellungsforschung Medien und Wahlverhalten Letzte Woche: Wahl der Neuen Rechtsparteien (rechtsradikale/rechtspopulistische Parteien) Zuwanderung/ethnische Konflikte als dominante Themen
VL Wahl- und Einstellungsforschung. Medien und Wahlverhalten
 VL Wahl- und Einstellungsforschung Medien und Wahlverhalten 1 2 3 Letzte Woche: Wahl der Neuen Rechtsparteien (rechtsradikale/rechtspopulistische Parteien) Zuwanderung/ethnische Konflikte als dominante
VL Wahl- und Einstellungsforschung Medien und Wahlverhalten 1 2 3 Letzte Woche: Wahl der Neuen Rechtsparteien (rechtsradikale/rechtspopulistische Parteien) Zuwanderung/ethnische Konflikte als dominante
Online-Anhang. Instruktionen für die Probanden
 Online-Anhang. Instruktionen für die Probanden Bildschirm 1 Bei dem folgenden Experiment handelt es sich um ein Experiment zur Wahlentscheidung. Es geht hierbei nicht um reale Parteien, die Sie kennen,
Online-Anhang. Instruktionen für die Probanden Bildschirm 1 Bei dem folgenden Experiment handelt es sich um ein Experiment zur Wahlentscheidung. Es geht hierbei nicht um reale Parteien, die Sie kennen,
Online-Anhang zum Beitrag in Politische Vierteljahresschrift (PVS), 53. Jg., 3/2012, S jüngere Befragte (18-35)
 Deutschland auf dem Weg in die Rentner-Demokratie? Eine empirische Untersuchung altersspezifischer Einstellungsunterschiede und ihrer Bedeutung für das Wahlverhalten auf Basis einer aktuellen Bevölkerungsumfrage
Deutschland auf dem Weg in die Rentner-Demokratie? Eine empirische Untersuchung altersspezifischer Einstellungsunterschiede und ihrer Bedeutung für das Wahlverhalten auf Basis einer aktuellen Bevölkerungsumfrage
Aufbau einer Rede. 3. Zweite Rede eröffnende Regierung - (gegebenenfalls Erläuterung zum Antrag) - Rebuttal - Weitere Pro-Argumente erklären
 Aufbau einer Rede 1. Erste Rede eröffnende Regierung - Wofür steht unser Team? - Erklärung Status Quo (Ist-Zustand) - Erklärung des Ziels (Soll-Zustand) - Antrag erklären (Was möchten wir mit welchen Ausnahmen
Aufbau einer Rede 1. Erste Rede eröffnende Regierung - Wofür steht unser Team? - Erklärung Status Quo (Ist-Zustand) - Erklärung des Ziels (Soll-Zustand) - Antrag erklären (Was möchten wir mit welchen Ausnahmen
Wahrnehmung und Bewertung der Ukraine-Krise und Meinungen zu Wirtschaftssanktionen gegen Russland
 Wahrnehmung und Bewertung der Ukraine-Krise und Meinungen zu Wirtschaftssanktionen gegen Russland 11. August 2014 q4561/30373 Le, Gü Max-Beer-Str. 2/4 10119 Berlin Telefon: (0 30) 6 28 82-0 Inhaltsverzeichnis
Wahrnehmung und Bewertung der Ukraine-Krise und Meinungen zu Wirtschaftssanktionen gegen Russland 11. August 2014 q4561/30373 Le, Gü Max-Beer-Str. 2/4 10119 Berlin Telefon: (0 30) 6 28 82-0 Inhaltsverzeichnis
Abkürzungen der Kantone 13 Abkürzungen der Schweizer Parteien 15
 5 Abkürzungen der Kantone 13 Abkürzungen der Schweizer Parteien 15 Einleitung und Überblick 17 Adrian Vatter und Markus Freitag 1. Einleitung 17 2. Politische Koalitionen, Wahlergebnisse und Parteiensysteme
5 Abkürzungen der Kantone 13 Abkürzungen der Schweizer Parteien 15 Einleitung und Überblick 17 Adrian Vatter und Markus Freitag 1. Einleitung 17 2. Politische Koalitionen, Wahlergebnisse und Parteiensysteme
FORSCHUNGSTELEGRAMM 10/2009
 FORSCHUNGSTELEGRAMM 10/2009 Peter Zellmann / Sonja Mayrhofer IFT Institut für Freizeit- und Tourismusforschung Neues Arbeitszeit/Gehaltsmodell? Weniger Verdienst für mehr Freizeit für viele eine Alternative
FORSCHUNGSTELEGRAMM 10/2009 Peter Zellmann / Sonja Mayrhofer IFT Institut für Freizeit- und Tourismusforschung Neues Arbeitszeit/Gehaltsmodell? Weniger Verdienst für mehr Freizeit für viele eine Alternative
DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR.
 Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR. Meyer, J. W. und R. L. Jepperson 2005. Die "Akteure"
Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR. Meyer, J. W. und R. L. Jepperson 2005. Die "Akteure"
ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Luxembourg (German)
 ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Luxembourg (German) FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. Geschlecht [1] Männlich [2] Weiblich
ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Luxembourg (German) FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. Geschlecht [1] Männlich [2] Weiblich
Maria Springenberg-Eich Kassel, 25. April Ist die politische Kultur im Umbruch? Eine Antwort in vier Thesen
 Maria Springenberg-Eich Kassel, 25. April 2016 Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung NRW Ist die politische Kultur im Umbruch? Eine Antwort in vier Thesen zum Kongress "Wut, Protest und Volkes
Maria Springenberg-Eich Kassel, 25. April 2016 Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung NRW Ist die politische Kultur im Umbruch? Eine Antwort in vier Thesen zum Kongress "Wut, Protest und Volkes
Bis heute: Überblick Einheit Literatur lesen. 2. Introspektion. 3. Thema definieren und eingrenzen. Untersuchungsproblem.
 Bis heute: 1. Literatur lesen 2. Introspektion 3. Thema definieren und eingrenzen 1 Seite (pro Gruppe) zusammenfassen und abgeben Folie 1 Überblick Einheit 2 Untersuchungsproblem Problemstellung Fragestellungen
Bis heute: 1. Literatur lesen 2. Introspektion 3. Thema definieren und eingrenzen 1 Seite (pro Gruppe) zusammenfassen und abgeben Folie 1 Überblick Einheit 2 Untersuchungsproblem Problemstellung Fragestellungen
Wer wählt wen? Kommunales Wahlverhalten am Beispiel einer Großstadt
 Wer wählt wen? Kommunales Wahlverhalten am Beispiel einer Großstadt Wesseling, 21. März 2009 Thorsten Faas, M.Sc. Lehrstuhl für Politische Wissenschaft I Universität Mannheim Email: Thorsten.Faas@uni-mannheim.de
Wer wählt wen? Kommunales Wahlverhalten am Beispiel einer Großstadt Wesseling, 21. März 2009 Thorsten Faas, M.Sc. Lehrstuhl für Politische Wissenschaft I Universität Mannheim Email: Thorsten.Faas@uni-mannheim.de
Die Parteien und das Wählerherz
 Studie: Die Parteien und das Wählerherz Auftraggeber: Abteilung Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie der Universität Leipzig Durchführung: Meinungsforschungsinstitut USUMA Berlin Befragungszeitraum:
Studie: Die Parteien und das Wählerherz Auftraggeber: Abteilung Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie der Universität Leipzig Durchführung: Meinungsforschungsinstitut USUMA Berlin Befragungszeitraum:
Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen
 Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen Hintergrund Videospiele stellen die in ihnen handelnden Figuren häufig stereotyp
Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen Hintergrund Videospiele stellen die in ihnen handelnden Figuren häufig stereotyp
Rasmus Beckmann, M.A. Universität zu Köln. Liberalismus. Lehrstuhl für Internationale Politik und Außenpolitik Prof. Dr.
 Rasmus Beckmann, M.A. Liberalismus Lehrstuhl für Internationale Politik und Außenpolitik Prof. Dr. Thomas Jäger Leitfragen 1. Nennen Sie drei theoretische Perspektiven zur Analyse der internationalen Beziehungen?
Rasmus Beckmann, M.A. Liberalismus Lehrstuhl für Internationale Politik und Außenpolitik Prof. Dr. Thomas Jäger Leitfragen 1. Nennen Sie drei theoretische Perspektiven zur Analyse der internationalen Beziehungen?
Bivariate Analyseverfahren
 Bivariate Analyseverfahren Bivariate Verfahren beschäftigen sich mit dem Zusammenhang zwischen zwei Variablen Beispiel: Konservatismus/Alter Zusammenhangsmaße beschreiben die Stärke eines Zusammenhangs
Bivariate Analyseverfahren Bivariate Verfahren beschäftigen sich mit dem Zusammenhang zwischen zwei Variablen Beispiel: Konservatismus/Alter Zusammenhangsmaße beschreiben die Stärke eines Zusammenhangs
Management - Strategische Unternehmensführung
 Inhalt der Vorlesung 1. Gegenstand der BWL und Betriebswirtschaftliche Funktionen 2. Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsprogramme 3. Entscheidungen als Grundelemente der BWL 4. Rahmenbedingungen wirtschaftlichen
Inhalt der Vorlesung 1. Gegenstand der BWL und Betriebswirtschaftliche Funktionen 2. Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsprogramme 3. Entscheidungen als Grundelemente der BWL 4. Rahmenbedingungen wirtschaftlichen
Statistik Testverfahren. Heinz Holling Günther Gediga. Bachelorstudium Psychologie. hogrefe.de
 rbu leh ch s plu psych Heinz Holling Günther Gediga hogrefe.de Bachelorstudium Psychologie Statistik Testverfahren 18 Kapitel 2 i.i.d.-annahme dem unabhängig. Es gilt also die i.i.d.-annahme (i.i.d = independent
rbu leh ch s plu psych Heinz Holling Günther Gediga hogrefe.de Bachelorstudium Psychologie Statistik Testverfahren 18 Kapitel 2 i.i.d.-annahme dem unabhängig. Es gilt also die i.i.d.-annahme (i.i.d = independent
2. Theoretische Grundlagen der Sozialstrukturanalyse
 2. Theoretische Grundlagen der Sozialstrukturanalyse 2.1. Sozialstruktur und soziale Ungleichheit - Soziologie ist eine Wissenschaft, die kollektive (agreggierte) soziale Phänomene beschreiben und erklären
2. Theoretische Grundlagen der Sozialstrukturanalyse 2.1. Sozialstruktur und soziale Ungleichheit - Soziologie ist eine Wissenschaft, die kollektive (agreggierte) soziale Phänomene beschreiben und erklären
Wandel des Wahlverhaltens. Das deutsche Parteiensystem und die Krise der politischen Repräsentation
 Geisteswissenschaft Sebastian Krätzig Wandel des Wahlverhaltens. Das deutsche Parteiensystem und die Krise der politischen Repräsentation Am Beispiel der FDP und der Piratenpartei Masterarbeit Gottfried
Geisteswissenschaft Sebastian Krätzig Wandel des Wahlverhaltens. Das deutsche Parteiensystem und die Krise der politischen Repräsentation Am Beispiel der FDP und der Piratenpartei Masterarbeit Gottfried
Mikrofundierung des soziologischen Neo-Institutionalismus und weiterführende Arbeiten
 Mikrofundierung des soziologischen Neo-Institutionalismus und weiterführende Arbeiten Themenbereich 5: Performance Measurement in Organisationen Perspektiven des soziologischen Neo-Institutionalismus Referent:
Mikrofundierung des soziologischen Neo-Institutionalismus und weiterführende Arbeiten Themenbereich 5: Performance Measurement in Organisationen Perspektiven des soziologischen Neo-Institutionalismus Referent:
Religionsmonitor 2013
 Religionsmonitor 2013 verstehen was verbindet Religiosität im internationalen Vergleich Religionsmonitor 2013 verstehen was verbindet Religiosität im internationalen Vergleich Kontakt Stephan Vopel Director
Religionsmonitor 2013 verstehen was verbindet Religiosität im internationalen Vergleich Religionsmonitor 2013 verstehen was verbindet Religiosität im internationalen Vergleich Kontakt Stephan Vopel Director
Sicherheitswahrnehmungen im 21. Jahrhundert. Eine Einführung. Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jörg Albrecht
 Sicherheitswahrnehmungen im 21. Jahrhundert Eine Einführung Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jörg Albrecht 1 Sicherheit 2009 Einleitung Ausgangspunkt Stellung der Sicherheit in modernen Gesellschaften Risiko, Gefahr
Sicherheitswahrnehmungen im 21. Jahrhundert Eine Einführung Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jörg Albrecht 1 Sicherheit 2009 Einleitung Ausgangspunkt Stellung der Sicherheit in modernen Gesellschaften Risiko, Gefahr
Gerechtigkeit in Partnerschaften
 Gerechtigkeit in Partnerschaften Distributive Gerechtigkeit Gliederung Grundlagen der Equity-Theorie Merkmale intimer Beziehungen Matching-Hypothese Messmethoden und probleme Empirische Überprüfung Aufteilung
Gerechtigkeit in Partnerschaften Distributive Gerechtigkeit Gliederung Grundlagen der Equity-Theorie Merkmale intimer Beziehungen Matching-Hypothese Messmethoden und probleme Empirische Überprüfung Aufteilung
EINSTELLUNGEN ZUR FREIHEIT IN RUSSLAND 2016
 ZUR FREIHEIT IN RUSSLAND 2016 Russische Bürger zu individueller Freiheit, Staat und Gesellschaft... Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage (Computer Assisted Telephone Interview) in der Bevölkerung der
ZUR FREIHEIT IN RUSSLAND 2016 Russische Bürger zu individueller Freiheit, Staat und Gesellschaft... Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage (Computer Assisted Telephone Interview) in der Bevölkerung der
Stabilität und Veränderung psychologischer Aspekte im höheren Erwachsenenalter. Dr. Stefanie Becker
 Stabilität und Veränderung psychologischer Aspekte im höheren Erwachsenenalter Dr. Stefanie Becker Stiftungsgastdozentur der Universität des 3. Lebensalters, Frankfurt, im Sommersemester 2007 Themen der
Stabilität und Veränderung psychologischer Aspekte im höheren Erwachsenenalter Dr. Stefanie Becker Stiftungsgastdozentur der Universität des 3. Lebensalters, Frankfurt, im Sommersemester 2007 Themen der
Schauen Sie mit den Augen der Anderen die die Macht definitiv haben und ausüben und fragen SIE SICH ernsthaft
 Schauen Sie mit den Augen der Anderen die die Macht definitiv haben und ausüben und fragen SIE SICH ernsthaft Was ist die offensichtliche leicht zu erkennende Realität: Wer bestimmt seit 1990 was in Deutschland
Schauen Sie mit den Augen der Anderen die die Macht definitiv haben und ausüben und fragen SIE SICH ernsthaft Was ist die offensichtliche leicht zu erkennende Realität: Wer bestimmt seit 1990 was in Deutschland
Analyse Volksbefragung Wehrpflicht 2013
 Analyse Volksbefragung Wehrpflicht 2013 SORA/ISA im Auftrag des ORF 52,4 Prozent der Stimmberechtigten haben am 20. Jänner 2013 an der ersten bundesweiten Volksbefragung in Österreich teilgenommen. 40,3
Analyse Volksbefragung Wehrpflicht 2013 SORA/ISA im Auftrag des ORF 52,4 Prozent der Stimmberechtigten haben am 20. Jänner 2013 an der ersten bundesweiten Volksbefragung in Österreich teilgenommen. 40,3
Nur jeder zweite Wahlberechtigte benennt entscheidende Stimme für Mandatsverteilung richtig
 Wahlsystem: Wählen ohne Wissen? Nur jeder zweite Wahlberechtigte benennt entscheidende Stimme für Mandatsverteilung richtig Heiko Gothe / April 203 Bei der Landtagswahl in Niedersachsen im Januar 203 war
Wahlsystem: Wählen ohne Wissen? Nur jeder zweite Wahlberechtigte benennt entscheidende Stimme für Mandatsverteilung richtig Heiko Gothe / April 203 Bei der Landtagswahl in Niedersachsen im Januar 203 war
Lebenswerte Gesellschaft
 Thomas Bulmahn Lebenswerte Gesellschaft Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit im Urteil der Bürger Westdeutscher Verlag Inhalt 1 Einleitung....... 13 1.1 Hintergrund: Die lebenswerte Gesellschaft 13 1.2
Thomas Bulmahn Lebenswerte Gesellschaft Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit im Urteil der Bürger Westdeutscher Verlag Inhalt 1 Einleitung....... 13 1.1 Hintergrund: Die lebenswerte Gesellschaft 13 1.2
Statistischer Infodienst
 3. März 6 Statistischer Infodienst Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung www.freiburg.de/statistik Erste Ergebnisse aus der Repräsentativen Wahlstatistik für die Landtagswahl 6 in Freiburg
3. März 6 Statistischer Infodienst Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung www.freiburg.de/statistik Erste Ergebnisse aus der Repräsentativen Wahlstatistik für die Landtagswahl 6 in Freiburg
Das Wahlverhalten der Baden-Württembergerinnen. im langfristigen Vergleich. Land, Kommunen. Elisabeth Glück
 Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 2/2016 Land, Kommunen Wahlverhalten in Baden-Württemberg im langfristigen Vergleich Elisabeth Glück Seit 1952 wird die Zusammensetzung des baden-württembergischen
Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 2/2016 Land, Kommunen Wahlverhalten in Baden-Württemberg im langfristigen Vergleich Elisabeth Glück Seit 1952 wird die Zusammensetzung des baden-württembergischen
Richard M. Hare: Alles egal? Richard M. Hare
 Richard M. Hare: Alles egal? Richard M. Hare *1919 Bristol während des 2. Weltkriegs mehr als drei Jahre in japanischer Kriegsgefangenschaft 1947 Abschluss seines Studiums in Philosophie und Altphilologie
Richard M. Hare: Alles egal? Richard M. Hare *1919 Bristol während des 2. Weltkriegs mehr als drei Jahre in japanischer Kriegsgefangenschaft 1947 Abschluss seines Studiums in Philosophie und Altphilologie
Statische Spiele mit vollständiger Information
 Statische Spiele mit vollständiger Information Wir beginnen nun mit dem Aufbau unseres spieltheoretischen Methodenbaukastens, indem wir uns zunächst die einfachsten Spiele ansehen. In diesen Spielen handeln
Statische Spiele mit vollständiger Information Wir beginnen nun mit dem Aufbau unseres spieltheoretischen Methodenbaukastens, indem wir uns zunächst die einfachsten Spiele ansehen. In diesen Spielen handeln
Kriterien für die Beschreibung, Beurteilung und Entwicklung von Modellen der Eucharistiekatechese. Indikatoren
 Kriterien für die Beschreibung, Beurteilung und Entwicklung von Modellen der Eucharistiekatechese Vorbemerkung Der folgende Raster stellt eine Auswahl von Kriterien dar, welche auf dem Hintergrund des
Kriterien für die Beschreibung, Beurteilung und Entwicklung von Modellen der Eucharistiekatechese Vorbemerkung Der folgende Raster stellt eine Auswahl von Kriterien dar, welche auf dem Hintergrund des
Macht die BILD Dir Deine Meinung?
 Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum-Verlag 31 Macht die BILD Dir Deine Meinung? Eine theoretisch-empirische Analyse zum Einfluss der Bild-Zeitung auf politische Einstellungen und Verhaltensabsichten
Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum-Verlag 31 Macht die BILD Dir Deine Meinung? Eine theoretisch-empirische Analyse zum Einfluss der Bild-Zeitung auf politische Einstellungen und Verhaltensabsichten
In: Schmitt-Beck, Rüdiger (Hrsg.), Wählen in Deutschland, Sonderheft 45 der Politischen Vierteljahresschrift (PVS), Baden-Baden: Nomos 2012.
 Personalisierte Kandidatenstrategien und Wahlentscheidungen für Direktkandidaten im deutschen Mischwahlsystem: Die Persönlichkeitswahl in Wahlkreisen als interaktiver Prozess Thomas Gschwend / Thomas Zittel
Personalisierte Kandidatenstrategien und Wahlentscheidungen für Direktkandidaten im deutschen Mischwahlsystem: Die Persönlichkeitswahl in Wahlkreisen als interaktiver Prozess Thomas Gschwend / Thomas Zittel
Carl von Clausewitz: Vom Kriege. 1. Buch: Über die Natur des Krieges
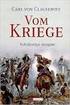 Carl von Clausewitz: Vom Kriege 1. Buch: Über die Natur des Krieges Gliederung: Einleitung Handlungstheorie Restrektionen Außenpolitik Einleitung Carl von Clausewitz geb. 1780 in Berg Sohn bürgerlicher
Carl von Clausewitz: Vom Kriege 1. Buch: Über die Natur des Krieges Gliederung: Einleitung Handlungstheorie Restrektionen Außenpolitik Einleitung Carl von Clausewitz geb. 1780 in Berg Sohn bürgerlicher
Resümee und pädagogische Konsequenzen
 Resümee und pädagogische Konsequenzen (Jürgen Fritz, Tanja Witting, Shahieda Ibrahim, Heike Esser) Welche Spiele vom Spieler gewählt werden und welche inhaltlichen Aspekte von ihm wahrgenommen werden und
Resümee und pädagogische Konsequenzen (Jürgen Fritz, Tanja Witting, Shahieda Ibrahim, Heike Esser) Welche Spiele vom Spieler gewählt werden und welche inhaltlichen Aspekte von ihm wahrgenommen werden und
Nichtwähler Motive (in Prozent, "trifft sehr zu")
 Fragestellung im Wortlaut - Nichtwähler-Motive Es gibt verschiedene Gründe, nicht zur Wahl zu gehen. Treffen folgende Gründe für Sie persönlich sehr, ziemlich, wenig oder gar nicht zu trifft sehr zu 1)
Fragestellung im Wortlaut - Nichtwähler-Motive Es gibt verschiedene Gründe, nicht zur Wahl zu gehen. Treffen folgende Gründe für Sie persönlich sehr, ziemlich, wenig oder gar nicht zu trifft sehr zu 1)
Begriffe der Friedens- und Konfliktforschung : Konflikt & Gewalt
 Begriffe der Friedens- und Konfliktforschung : Konflikt & Gewalt Vorlesung zur Einführung in die Friedensund Konfliktforschung Prof. Dr. Inhalt der Vorlesung Gewaltbegriff Bedeutungsgehalt Debatte um den
Begriffe der Friedens- und Konfliktforschung : Konflikt & Gewalt Vorlesung zur Einführung in die Friedensund Konfliktforschung Prof. Dr. Inhalt der Vorlesung Gewaltbegriff Bedeutungsgehalt Debatte um den
Bürgerbeteiligung und Direkte Demokratie in Baden-Württemberg
 Forschungsprojekt Bürgerbeteiligung und Direkte Demokratie in Baden-Württemberg Ergebnisse der Telefonbefragung 13 Prof. Dr. Thorsten Faas Institut für Politikwissenschaft Universität Mainz Prof. Dr. Rüdiger
Forschungsprojekt Bürgerbeteiligung und Direkte Demokratie in Baden-Württemberg Ergebnisse der Telefonbefragung 13 Prof. Dr. Thorsten Faas Institut für Politikwissenschaft Universität Mainz Prof. Dr. Rüdiger
Bjarne Reuter Außenseiterkonstruktion - en som hodder, buster-trilogi
 Sprachen Tim Christophersen Bjarne Reuter Außenseiterkonstruktion - en som hodder, buster-trilogi Studienarbeit INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG... 3 2 WAS IST EIN AUßENSEITER?... 3 3 REUTERS AUßENSEITERKONSTRUKTION...
Sprachen Tim Christophersen Bjarne Reuter Außenseiterkonstruktion - en som hodder, buster-trilogi Studienarbeit INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG... 3 2 WAS IST EIN AUßENSEITER?... 3 3 REUTERS AUßENSEITERKONSTRUKTION...
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE & SOZIALISATION. Mädchenschachpatent 2015 in Nußloch Referentin: Melanie Ohme
 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE & SOZIALISATION 1 Mädchenschachpatent 2015 in Nußloch Referentin: Melanie Ohme ÜBERSICHT Entwicklungspsychologie Einführung Faktoren der Entwicklung Geschlechterunterschiede Diskussionen
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE & SOZIALISATION 1 Mädchenschachpatent 2015 in Nußloch Referentin: Melanie Ohme ÜBERSICHT Entwicklungspsychologie Einführung Faktoren der Entwicklung Geschlechterunterschiede Diskussionen
Einkommen, Mobilität und individuelle Präferenzen für Umverteilung
 Christian Pfarr Einkommen, Mobilität und individuelle Präferenzen für Umverteilung Ein Discrete-Choice-Experiment Mohr Siebeck Inhaltsverzeichnis Vorwort Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis
Christian Pfarr Einkommen, Mobilität und individuelle Präferenzen für Umverteilung Ein Discrete-Choice-Experiment Mohr Siebeck Inhaltsverzeichnis Vorwort Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis
Germany ISSP Social Inequality III Questionnaire
 Germany ISSP 1999 - Social Inequality III Questionnaire Bürger aus 35 Ländern sagen ihre Meinung zum Thema: Soziale Gerechtigkeit Internationale Sozialwissenschaftliche Umfrage 2000 Listen-Nr. Lfd. Nr.
Germany ISSP 1999 - Social Inequality III Questionnaire Bürger aus 35 Ländern sagen ihre Meinung zum Thema: Soziale Gerechtigkeit Internationale Sozialwissenschaftliche Umfrage 2000 Listen-Nr. Lfd. Nr.
Geschichte der Makroökonomie. (1) Keynes (1936): General Theory of employment, money and interest
 Geschichte der Makroökonomie (1) Keynes (1936): General Theory of employment, money and interest kein formales Modell Bedeutung der aggegierten Nachfrage: kurzfristig bestimmt Nachfrage das Produktionsniveau,
Geschichte der Makroökonomie (1) Keynes (1936): General Theory of employment, money and interest kein formales Modell Bedeutung der aggegierten Nachfrage: kurzfristig bestimmt Nachfrage das Produktionsniveau,
Wähler und Nichtwähler zu Beginn des Wahljahres 2013 in Deutschland
 und zu Beginn des Wahljahres 2013 in Deutschland 14. Februar 2013 q2762/27727 Gü/Le Max-Beer-Str. 2/4 10119 Berlin Telefon: (0 30) 6 28 82-0 Inhaltsverzeichnis Problemstellung und Datengrundlage 2 1. Die
und zu Beginn des Wahljahres 2013 in Deutschland 14. Februar 2013 q2762/27727 Gü/Le Max-Beer-Str. 2/4 10119 Berlin Telefon: (0 30) 6 28 82-0 Inhaltsverzeichnis Problemstellung und Datengrundlage 2 1. Die
Harold-Hurwitz-Survey (Berlin-BUS) 1997
 Harold-Hurwitz-Survey (Berlin-BUS) 1997 Materialien für die Pressekonferenz am 25. April 1997 Kontakt: Manfred Güllner Prof. Dr. Oskar Niedermayer Dr. Richard Stöss Vorsitzender der Deutschen Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft
Harold-Hurwitz-Survey (Berlin-BUS) 1997 Materialien für die Pressekonferenz am 25. April 1997 Kontakt: Manfred Güllner Prof. Dr. Oskar Niedermayer Dr. Richard Stöss Vorsitzender der Deutschen Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft
Grundkurs I Einführung in die Politikwissenschaft 8. Vorlesung 08. Dezember Politische Kommunikation 1: Medien
 Politische Kommunikation 1: Medien 1 2 Politikwissenschaft und Medien Im Rahmen einer Interpretation des politischen Prozesses der Interessenartikulation, Interessenaggregation, Meinungsbildung und Entscheidungsfindung
Politische Kommunikation 1: Medien 1 2 Politikwissenschaft und Medien Im Rahmen einer Interpretation des politischen Prozesses der Interessenartikulation, Interessenaggregation, Meinungsbildung und Entscheidungsfindung
Psychotherapie der Depression
 Psychotherapie der Depression Dr. med. Benedikt Buse, Luzern Luzerner Bündnis gegen Depression, Vortrag 5.Mai 2009 Wertvolle Hypothesen zur Entstehung/Aufrechterhaltung der Depression (1) Wenige positive
Psychotherapie der Depression Dr. med. Benedikt Buse, Luzern Luzerner Bündnis gegen Depression, Vortrag 5.Mai 2009 Wertvolle Hypothesen zur Entstehung/Aufrechterhaltung der Depression (1) Wenige positive
Ergebnisse der Studie Die Parteien und ihre Anhänger (Prof. Brähler, Prof. Kruse):
 Ergebnisse der Studie Die Parteien und ihre Anhänger (Prof. Brähler, Prof. Kruse): Rechtsextreme Anhänger oft arbeitslos Meiste Arbeitslose sind Nichtwähler Rechtsextreme Parteien haben den größten Anteil
Ergebnisse der Studie Die Parteien und ihre Anhänger (Prof. Brähler, Prof. Kruse): Rechtsextreme Anhänger oft arbeitslos Meiste Arbeitslose sind Nichtwähler Rechtsextreme Parteien haben den größten Anteil
Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren?
 Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
NIÖ Kap III: Neue Politische Ökonomie
 NIÖ Kap III: Neue Politische Ökonomie 1 / 23 III.II.1 Modell der Umverteilung w i Präferenzfunktion des Wählers i c i privater Konsum des Wählers i H( ) konkave und steigende Funktion g Ausgaben für öffentliches
NIÖ Kap III: Neue Politische Ökonomie 1 / 23 III.II.1 Modell der Umverteilung w i Präferenzfunktion des Wählers i c i privater Konsum des Wählers i H( ) konkave und steigende Funktion g Ausgaben für öffentliches
Globalisierung und soziale Ungleichheit. Einführung in das Thema
 Globalisierung und soziale Ungleichheit Einführung in das Thema Gliederung 1. Was verbinden Soziologen mit dem Begriff Globalisierung? 2. Gliederung des Seminars 3. Teilnahmevoraussetzungen 4. Leistungsnachweise
Globalisierung und soziale Ungleichheit Einführung in das Thema Gliederung 1. Was verbinden Soziologen mit dem Begriff Globalisierung? 2. Gliederung des Seminars 3. Teilnahmevoraussetzungen 4. Leistungsnachweise
Wissenschaftstheoretische Grundlagen
 Wissenschaftstheoretische Grundlagen Wissenschaftstheorie: Lehre von der Vorgehensweise bei der wissenschaftlichen Tätigkeit (Methodologie) Wissenschaftstheorie ist der Sammelbegriff für alle metawissenschaftlichen
Wissenschaftstheoretische Grundlagen Wissenschaftstheorie: Lehre von der Vorgehensweise bei der wissenschaftlichen Tätigkeit (Methodologie) Wissenschaftstheorie ist der Sammelbegriff für alle metawissenschaftlichen
Wahlanalyse Europawahl 2009
 Wahlanalyse Europawahl 2009 ISA/SORA im Auftrag des ORF Europawahlen in Österreich Tabelle: Ergebnisse der Wahlen zum Europaparlament in Österreich 1996 1999 2004 2009 * SPÖ 29,15 31,71 33,33 23,5 ÖVP
Wahlanalyse Europawahl 2009 ISA/SORA im Auftrag des ORF Europawahlen in Österreich Tabelle: Ergebnisse der Wahlen zum Europaparlament in Österreich 1996 1999 2004 2009 * SPÖ 29,15 31,71 33,33 23,5 ÖVP
Wissenschaftliche Definition von kultureller Differenz und Fremdheit
 Geisteswissenschaft Paul Peters Wissenschaftliche Definition von kultureller Differenz und Fremdheit Essay Europa Universität Viadrina Seminar: Interkulturalität vs. Multikulturalität Abgegeben von: Paul
Geisteswissenschaft Paul Peters Wissenschaftliche Definition von kultureller Differenz und Fremdheit Essay Europa Universität Viadrina Seminar: Interkulturalität vs. Multikulturalität Abgegeben von: Paul
Der Sozialisationsfaktor in der Erklärung der Autoritären Persönlichkeit
 Geisteswissenschaft Daniel Lois Der Sozialisationsfaktor in der Erklärung der Autoritären Persönlichkeit Studienarbeit Institut für Soziologie RWTH Aachen Der Sozialisationsfaktor in der Erklärung der
Geisteswissenschaft Daniel Lois Der Sozialisationsfaktor in der Erklärung der Autoritären Persönlichkeit Studienarbeit Institut für Soziologie RWTH Aachen Der Sozialisationsfaktor in der Erklärung der
Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zur Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele 2024
 Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zur Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele 2024 November 2015 q5600.01/32438 Rd, Le forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer
Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zur Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele 2024 November 2015 q5600.01/32438 Rd, Le forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer
Unterschiede in der Lesemotivation bei Jungen und Mädchen in der Grundschule
 Pädagogik Larissa Drewa Unterschiede in der Lesemotivation bei Jungen und Mädchen in der Grundschule Examensarbeit Unterschiede in der Lesemotivation bei Jungen und Mädchen in der Grundschule Schriftliche
Pädagogik Larissa Drewa Unterschiede in der Lesemotivation bei Jungen und Mädchen in der Grundschule Examensarbeit Unterschiede in der Lesemotivation bei Jungen und Mädchen in der Grundschule Schriftliche
Wie sieht ein wertvolles Leben für Sie aus, was treibt Sie dahin? Seite 12
 Wie sieht ein wertvolles Leben für Sie aus, was treibt Sie dahin? Seite 12 Wenn Sie etwas einschränkt, ist es eher Schuld, Angst oder der Entzug von Zuneigung, und wie gehen Sie damit um? Seite 16 Welchen
Wie sieht ein wertvolles Leben für Sie aus, was treibt Sie dahin? Seite 12 Wenn Sie etwas einschränkt, ist es eher Schuld, Angst oder der Entzug von Zuneigung, und wie gehen Sie damit um? Seite 16 Welchen
Was entscheidet Kommunalwahlen?
 SEITENBLICK KOMMUNALWAHLEN Was entscheidet Kommunalwahlen? Zu den Faktoren des Wahlverhaltens in den Städten und Gemeinden FLORENS MAYER Geboren 1986 in Würzburg, Altstipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung,
SEITENBLICK KOMMUNALWAHLEN Was entscheidet Kommunalwahlen? Zu den Faktoren des Wahlverhaltens in den Städten und Gemeinden FLORENS MAYER Geboren 1986 in Würzburg, Altstipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung,
Politischer Wettbewerb und rapide Wechsel in der Familienpolitik
 Politischer Wettbewerb und rapide Wechsel in der Familienpolitik Agnes Blome Tagung Rapide Politikwechsel, Humboldt-Universität zu Berlin 16.-17.Mai 2013 Motivation und Fragestellung Deutschland lange
Politischer Wettbewerb und rapide Wechsel in der Familienpolitik Agnes Blome Tagung Rapide Politikwechsel, Humboldt-Universität zu Berlin 16.-17.Mai 2013 Motivation und Fragestellung Deutschland lange
Kapitel 6: Wahlen. Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Berichtigen Sie falsche Aussagen.
 Seite 1 von 7 Dual-Choice Fragen Kapitel 6: Wahlen Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Berichtigen Sie falsche Aussagen. 1. In Autokratien dienen Wahlen vor allem dem Wettbewerb um politische
Seite 1 von 7 Dual-Choice Fragen Kapitel 6: Wahlen Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Berichtigen Sie falsche Aussagen. 1. In Autokratien dienen Wahlen vor allem dem Wettbewerb um politische
Das Parteiensystem der USA - Ein Überblick
 Politik Nils Müller Das Parteiensystem der USA - Ein Überblick Studienarbeit Helmut-Schmidt-Universität Herbsttrimester 2008 Universität der Bundeswehr Hamburg B.A.-Studiengang Politikwissenschaft Vetopunkte
Politik Nils Müller Das Parteiensystem der USA - Ein Überblick Studienarbeit Helmut-Schmidt-Universität Herbsttrimester 2008 Universität der Bundeswehr Hamburg B.A.-Studiengang Politikwissenschaft Vetopunkte
Wahlen wie man sie organisieren kann und wann sie als demokratisch gelten können eine Lernaufgabe
 SW EF XX.XX.XXXX Wahlen wie man sie organisieren kann und wann sie als demokratisch gelten können eine Lernaufgabe Ihr habt euch ja schon als Experten für ratsuchende junge Menschen in Ägypten betätigt,
SW EF XX.XX.XXXX Wahlen wie man sie organisieren kann und wann sie als demokratisch gelten können eine Lernaufgabe Ihr habt euch ja schon als Experten für ratsuchende junge Menschen in Ägypten betätigt,
3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung
 Fragestellung und Hypothesen 62 3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung In der vorliegenden Arbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 1. Existieren Geschlechtsunterschiede in der
Fragestellung und Hypothesen 62 3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung In der vorliegenden Arbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 1. Existieren Geschlechtsunterschiede in der
Was sind Zusammenhangsmaße?
 Was sind Zusammenhangsmaße? Zusammenhangsmaße beschreiben einen Zusammenhang zwischen zwei Variablen Beispiele für Zusammenhänge: Arbeiter wählen häufiger die SPD als andere Gruppen Hochgebildete vertreten
Was sind Zusammenhangsmaße? Zusammenhangsmaße beschreiben einen Zusammenhang zwischen zwei Variablen Beispiele für Zusammenhänge: Arbeiter wählen häufiger die SPD als andere Gruppen Hochgebildete vertreten
Die Bundestagswahl 2013: Wahlverhalten und Parteiensystem
 Die Bundestagswahl 213: Wahlverhalten und Parteiensystem Vortrag, Stiftung Demokratie Saarland September 213 Erklärung des Wahlverhaltens Parteibindung Sachthemenorientierungen Kandidatenorientierungen
Die Bundestagswahl 213: Wahlverhalten und Parteiensystem Vortrag, Stiftung Demokratie Saarland September 213 Erklärung des Wahlverhaltens Parteibindung Sachthemenorientierungen Kandidatenorientierungen
Katja Stamer (Autor) Ehrenamt Management Impulse und praktische Hilfestellungen zur Förderung des Ehrenamtes in Sportvereinen
 Katja Stamer (Autor) Ehrenamt Management Impulse und praktische Hilfestellungen zur Förderung des Ehrenamtes in Sportvereinen https://cuvillier.de/de/shop/publications/6637 Copyright: Cuvillier Verlag,
Katja Stamer (Autor) Ehrenamt Management Impulse und praktische Hilfestellungen zur Förderung des Ehrenamtes in Sportvereinen https://cuvillier.de/de/shop/publications/6637 Copyright: Cuvillier Verlag,
Bürgerbeteiligung und Direkte Demokratie in Baden-Württemberg
 Ergebnisse der Telefonbefragung der Studie Bürgerbeteiligung und Direkte Demokratie in Baden-Württemberg Prof. Dr. Thorsten Faas Bereich Methoden der empirischen Politikforschung Johannes Gutenberg-Universität
Ergebnisse der Telefonbefragung der Studie Bürgerbeteiligung und Direkte Demokratie in Baden-Württemberg Prof. Dr. Thorsten Faas Bereich Methoden der empirischen Politikforschung Johannes Gutenberg-Universität
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
 Prof. Dr. Fritz Unger Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre November 2015 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IM FERNSTUDIENGANG UNTERNEHMENSFÜHRUNG Modul 1 Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen 1.1
Prof. Dr. Fritz Unger Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre November 2015 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IM FERNSTUDIENGANG UNTERNEHMENSFÜHRUNG Modul 1 Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen 1.1
Stärkenorientiertes Führen
 Alexander Groth Stärkenorientiertes Führen Inhalt Vorwort 6 1. Stärkenorientiertes Führen lohnt sich 8 Was die Gehirnforscher sagen 9 Was sich durch stärkenorientiertes Führen erreichen lässt 12 Wie die
Alexander Groth Stärkenorientiertes Führen Inhalt Vorwort 6 1. Stärkenorientiertes Führen lohnt sich 8 Was die Gehirnforscher sagen 9 Was sich durch stärkenorientiertes Führen erreichen lässt 12 Wie die
1 Kommunikation aus psychologischer Sicht
 Jeder von Ihnen wird schon einmal mit der Aussage konfrontiert worden sein, dass wir in einem besonderen Zeitalter leben, dem Kommunikationszeitalter. Damit wird üblicherweise abgehoben auf den sich ständig
Jeder von Ihnen wird schon einmal mit der Aussage konfrontiert worden sein, dass wir in einem besonderen Zeitalter leben, dem Kommunikationszeitalter. Damit wird üblicherweise abgehoben auf den sich ständig
Mehr Demokratie = Weniger Gleichheit?
 Mehr Demokratie = Weniger Gleichheit? Mainz, 5. September 2012 Prof. Dr. Thorsten Faas Johannes Gutenberg-Universität Mainz E-Mail: Thorsten.Faas@uni-mainz.de I Ein Beispiel II Demokratie und Beteiligung
Mehr Demokratie = Weniger Gleichheit? Mainz, 5. September 2012 Prof. Dr. Thorsten Faas Johannes Gutenberg-Universität Mainz E-Mail: Thorsten.Faas@uni-mainz.de I Ein Beispiel II Demokratie und Beteiligung
Individualisierung bei Max Weber. Steffi Sager und Ulrike Wöhl
 Individualisierung bei Max Weber Steffi Sager und Ulrike Wöhl Gliederung 1. Einleitung 2. Das soziale Handeln 3. Werthaftigkeit und Sinnhaftigkeit des Handelns 4. Die Orientierung am Anderen 5. Zusammenwirken
Individualisierung bei Max Weber Steffi Sager und Ulrike Wöhl Gliederung 1. Einleitung 2. Das soziale Handeln 3. Werthaftigkeit und Sinnhaftigkeit des Handelns 4. Die Orientierung am Anderen 5. Zusammenwirken
Lehrforschungsprojekt Webpräsentation zur Hausarbeit
 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Institut für Sozialwissenschaften Bereich Soziologie Sommersemester 2014 Seminar: Referent: Sören Lemmrich Seminarleiterin: Dipl.-Soz. Saskia Maria Fuchs Datum:
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Institut für Sozialwissenschaften Bereich Soziologie Sommersemester 2014 Seminar: Referent: Sören Lemmrich Seminarleiterin: Dipl.-Soz. Saskia Maria Fuchs Datum:
Prof. Manfred Güllner. Einstellungen und Einschätzungen der Bundesbürger zur Energieversorgung in Deutschland
 Prof. Manfred Güllner Einstellungen und Einschätzungen der Bundesbürger zur Energieversorgung in Deutschland Generelle Einstellungen der Deutschen zur Technik Zur Technik und zum technischen Fortschritt
Prof. Manfred Güllner Einstellungen und Einschätzungen der Bundesbürger zur Energieversorgung in Deutschland Generelle Einstellungen der Deutschen zur Technik Zur Technik und zum technischen Fortschritt
das Wählerherz 2014 Aus dem Projekt Die Mitte-Studien der Universität Leipzig Meinungsforschungsinstitut USUMA Berlin
 Studie: Die Parteien und das Wählerherz 2014 Aus dem Projekt Die Mitte-Studien der Universität Leipzig Auftraggeber: Abteilung Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie der Universität Leipzig
Studie: Die Parteien und das Wählerherz 2014 Aus dem Projekt Die Mitte-Studien der Universität Leipzig Auftraggeber: Abteilung Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie der Universität Leipzig
F e h l z e i t e n. Umgang mit betrieblichen Fehlzeiten von Prof. Dr. Guido Tolksdorf
 F e h l z e i t e n Umgang mit betrieblichen Fehlzeiten von Prof. Dr. Guido Tolksdorf Fehlzeiten-Differenzierung Die Vielzahl von Fehlzeiten (Arbeitszeiten ohne Wertschöpfung) lässt sich unterscheiden
F e h l z e i t e n Umgang mit betrieblichen Fehlzeiten von Prof. Dr. Guido Tolksdorf Fehlzeiten-Differenzierung Die Vielzahl von Fehlzeiten (Arbeitszeiten ohne Wertschöpfung) lässt sich unterscheiden
1. Was ist Sozialkunde? Sozialkunde: Die Darstellung und Beschreibung der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse eines Landes
 Leitfragen: 1.Was ist Sozialkunde? 2.Was kommt auf die Schülerin zu? 3.Welchen Nutzen hat sie davon? 4.Welche Voraussetzungen sind wichtig? 5. Was ist Sozialkunde nicht? 1. Was ist Sozialkunde? Sozialkunde:
Leitfragen: 1.Was ist Sozialkunde? 2.Was kommt auf die Schülerin zu? 3.Welchen Nutzen hat sie davon? 4.Welche Voraussetzungen sind wichtig? 5. Was ist Sozialkunde nicht? 1. Was ist Sozialkunde? Sozialkunde:
Spenden ja engagieren nein Eine Analyse der kroatischen Zivilgesellschaft
 Spenden ja engagieren nein Eine Analyse der kroatischen Zivilgesellschaft von Svenja Groth, Praktikantin im KAS-Büro Zagreb Wir sind auf dem richtigen Weg hin zu einer aktiven Zivilgesellschaft, aber es
Spenden ja engagieren nein Eine Analyse der kroatischen Zivilgesellschaft von Svenja Groth, Praktikantin im KAS-Büro Zagreb Wir sind auf dem richtigen Weg hin zu einer aktiven Zivilgesellschaft, aber es
Sozialwissenschaftliche Konflikttheorien
 Sozialwissenschaftliche Konflikttheorien Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2006/07 Kernbereich der Friedens- und Konfliktforschung K o n f l i k t a n a l y s e & K o n f
Sozialwissenschaftliche Konflikttheorien Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2006/07 Kernbereich der Friedens- und Konfliktforschung K o n f l i k t a n a l y s e & K o n f
Einführung in Problematik und Zielsetzung soziologischer Theorien
 Fabian Karsch Lehrstuhl für Soziologie. PS: Einführung in soziologische Theorien, 23.10.2006 Einführung in Problematik und Zielsetzung soziologischer Theorien Was ist eine Theorie? Eine Theorie ist ein
Fabian Karsch Lehrstuhl für Soziologie. PS: Einführung in soziologische Theorien, 23.10.2006 Einführung in Problematik und Zielsetzung soziologischer Theorien Was ist eine Theorie? Eine Theorie ist ein
180425 PS Experimente im Psychologieunterricht ( 57.1.9)
 Elisabeth Turek, 0200350, A 190 299 482 MMag. Margarete Pökl 180425 PS Experimente im Psychologieunterricht ( 57.1.9) Gruppe D: Erleben, Verhalten, Handeln GRUPPENDRUCK (nach Solomon Asch, 1956) 1 EXPERIMENTE
Elisabeth Turek, 0200350, A 190 299 482 MMag. Margarete Pökl 180425 PS Experimente im Psychologieunterricht ( 57.1.9) Gruppe D: Erleben, Verhalten, Handeln GRUPPENDRUCK (nach Solomon Asch, 1956) 1 EXPERIMENTE
