Marke hui, Werbung pfui?
|
|
|
- Elizabeth Lehmann
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 NEUE PERSPEKTIVEN FÜR KOMMUNIK ATION UND MARKEN THEMA Krankenhaus Editorial KUNDE ARZT: KUNDE PATIENT: Einweiser im Fokus Service ist Trumpf Stammkundschaft ist wichtig, nicht nur in der Gastronomie. Deshalb tun Kliniken gut daran, ihre einweisenden Ärzte professionell zu betreuen. Seite 4 Wenn aus Patienten Kunden werden, ändert sich vieles. Denn Patienten wollen nur behandelt, aber Kunden auch umworben werden. Seite 14 Marke hui, Werbung pfui? Dirk Popp, Managing Partner, Pleon Dresden Werbung ist im deutschen Gesundheitswesen eine heikle Sache: Ärztliches Standesrecht und Heilmittelwerbegesetz setzen den Kreativen enge Schranken. Doch oft ist schon eine starke Marke die beste Werbung. Gesundheit! Zugegeben, lieber Leser wir haben etwas länger gebraucht als geplant. Aber es hat sich gelohnt: Doppelt so dick und hoffentlich mit doppeltem Lesevergnügen setzt sich das neue Heft mit dem Thema Krankenhaus in kommunikativer Hinsicht auseinander. Wie explosiv das Thema in der Öffentlichkeit werden kann, haben die ÄrzteStreiks im letzten Jahr gezeigt. Und wie vielschichtig und spannend Klinikkommunikation ist, wird Ihnen dieses Heft facettenreich, unterhaltsam und informativ vor Augen führen. Denn mit Blick auf die zunehmende Ökonomisierung des Gesundheitswesens gewinnen Themen wie Patientenkommunikation, Einweisermarketing, Krankenhauswerbung und Sponsorenkonzepte massiv an Bedeutung. Kliniken müssen härter um ihre Patienten kämpfen, ein adäquates Image aufbauen und pflegen und dabei wirtschaftlich arbeiten. Klar, dass solche Ansätze im einst staatlich alimentierten Krankenhausbetrieb oft einer Kulturrevolution gleichkommen. Doch die großen privaten Betreiber haben vorgemacht, wie moderne Klinikkommunikation funktionieren kann und längst haben viele öffentliche Häuser die Zeichen der Zeit erkannt und setzen immer stärker auf Kommunikation. Aber selbst das ist noch keine Garantie für den Erfolg, denn das Geschäft mit der Gesundheit ist voll von Unwägbarkeiten und politischen Sprengstoffs. Fazit: Hier sind Experten gefragt! In diesem Sinne Wollte eine Entziehungsklinik in Deutschland Werbung machen, hätte sie ein Problem. Denn für die Behandlung von Suchtkrankheiten mit Ausnahme der Nikotinsucht darf in Deutschland außerhalb von Fachkreisen nicht geworben werden, sagt das Heilmittelwerbegesetz in Paragraf 12. Selbst Koryphäen vom Schlage eines Ferdinand Sauerbruch müssten da für ihre Klinik in den sauren Apfel der Werbebeschränkung beißen: Zwar dürfte der Name des Professors genannt werden und mit Einschränkungen auch die Hauptindikationsgebiete des Krankenhauses. Beim Konterfei des milde lächelnden Chefs wird s aber schon schwieriger. In Schlips und Kragen: ja; im blütenreinen Kittel: nein. Denn mit der bildlichen Darstellung von Personen in der Berufskleidung oder bei der Ausübung der Tätigkeit von Angehörigen der Heilberufe darf nicht geworben werden. Ebenso wenig mit der bildlichen Darstellung von Krankheiten, mit allgemein nicht verständlichen Fachbegriffen oder mit Anzeigen, die Ängste bei Patienten wecken könnten (siehe Checkliste). Dass diese Beschränkungen eine sinnvolle Intention haben, zumeist den Schutz des Patienten und seiner Persönlichkeitsrechte, darf zweifellos vorausgesetzt werden. Dennoch sind die Bestimmungen teilweise skurril und kommen in manchen Bereichen einem Werbeverbot gleich, zumal seit April 2006 auch die Schönheitschirurgen ihre bis dato liberaleren Werbeprivilegien abgeben mussten. Werbeeinschränkung als Feigenblatt Betrachtet man die Dinge bei Licht, gibt es eigentlich keinen Grund, über die Einschränkungen des Heilmittelwerbegesetzes zu lamentieren. Sicher, es unterstellt der Gesundheitsindustrie latent ein Bedürfnis, seine Produkte marktschreierisch anpreisen und dabei mit Bildern gruseliger Krankheiten einerseits und adretter Krankenschwestern andererseits werben zu wollen. Das mag unerfreulich sein, ist aber in der Praxis kaum der Rede wert. Denn wo müsste eine Krankenhauswerbung im klassischen Sinne ansetzen? Ganz klar: beim Konsumenten. Und in wessen Händen liegt im deutschen Gesundheitswesen die Entscheidungshoheit über die Krankenhauswahl? Viel eher in den Händen von Ärzten, Therapeuten oder Krankenkassen als in denen der Patienten. Somit erübrigt sich die reine Patientenwerbung ohnehin fast von selbst und ein Gutteil der Relevanz des Heilmittelwerbegesetzes gleich mit, denn in Fachkreisen gelten ganz andere Regelungen. P O m r a d d n i l B on i t k A e ß o r G nur von * ab ust Mai bis Aug * inkl. 3 Tage Liegezeit, 3 Mahlzeiten am Tag, 24-Stunden-Service und Besuchszeit von 14 bis 17 Uhr. Einzelzimmerzuschlag 300 Euro (je nach Kassenlage) Geschäftsführender Partner und Gesundheitsmarktexperte von Pleon Dresden. Die Spezialisierung eines Hauses, die Reduzierung von Betten, ein Neubau all das hat mit Profilierung zu tun und trägt zur Markenbildung bei. Es gibt also keine Frage, ob man Marketing macht oder nicht, sondern nur, ob man es gut oder schlecht macht. Natürlich hat das Gesetz in anderen Facetten durchaus seine Berechtigung. Doch neben dem intendierten Patientenschutz machen sich vielfach Entscheider in den Kliniken das Gesetz für eigene Zwecke zunutze. Gleichsam als Feigenblatt soll es vielfach Unvermögen oder Desinteresse in Sachen Marketing bedecken: Werbung? Das dürfen wir doch gar nicht! Dass sich diese Art Ignoranz mittelfristig rächen wird, ist eine Sache. Die andere ist, dass im Gesundheitsmarkt jedes Krankenhaus Marketing betreibt freiwillig oder unfreiwillig. Es muss den Entscheidern klar sein, dass jede größere Entscheidung in einer Klinik Einfluss auf die aktuelle Position im Markt hat, sagt Dirk Popp, Versprochen ist versprochen Wer sich für die Option gutes Marketing entscheidet, muss sich allerdings der weit reichenden Konsequenzen bewusst sein, die dieser Schritt mit sich bringt. Denn der Aufbau einer Klinikmarke zieht sich durch alle Geschäftsbereiche eines Krankenhauses. Die Entwicklung einer Marke beginnt immer mit einer gründlichen Intern- und Externanalyse, so Popp. In dieser Phase ermitteln wir, wo die Mitarbeiter und die Öffentlichkeit das jeweilige Haus sehen. Oft liegen Welten dazwischen und die objektiv nachvollziehbare Position findet sich dann irgendwo in der Mitte. Das Markenteam wird dann aus den Ergebnissen der Befragungen ein Markenprofil erarbeiten, das Stärken und Schwächen der Klinik berücksichtigt und mögliche Markenpotenziale für das Haus zusammenfasst. Markenwerte können etwa Begriffe wie Kompetenz oder Servicequalität sein, die dann faktisch durch so genannte Markenprodukte inhaltlich greifbar werden. Das können bekannte Spezialisten und medizinische Koryphäen sein, ein traditionsreicher Name oder besondere Therapien und hoch spezialisierte medizinische Ausrüstung. Weiter auf Seite 2
2 2 Markenbildung ist ein Qualitätsversprechen Interview mit Prof. Detlef Steinhausen, Wirtschaftswissenschaftler an der FH Münster. Prof. Detlef Steinhausen, Wirtschaftswissenschaftler an der FH Münster. Der Markt hat sich zum Käufermarkt gewandelt. Viele Jahrzehnte waren Marketing und Markenbildung für deutsche Kliniken kaum ein Thema. Warum ist das heute anders? Der Markt hat sich nun auch im Klinikbereich vom Anbietermarkt zum Käufermarkt gewandelt der Kunde rückt in den Mittelpunkt, weil er die Macht hat zu entscheiden. Und weil wir in Deutschland mehr Betten haben, als wir brauchen, gewinnt am Ende der, der es durch gutes Marketing schafft, seine Betten zu belegen. Was sagen Sie Klinikchefs, die meinen: Unsere beste (und einzige) Werbung ist unsere Versorgungsqualität.? Ich sage: Das ist völlig richtig, aber das müssen die Leute auch wissen. Die Patienten müssen informiert werden und das passiert nicht immer ausreichend. Dabei darf man ja zum Beispiel über die Internetseite informieren, was man alles anbietet, man kann in Fachzeitschriften publizieren oder einen Tag der offenen Tür veranstalten es geht schon eine ganze Menge. Dazu kommen noch die Qualitätsberichte, die für Fachkreise und Krankenkassen interessant sind und professionell aufbereitet auch für Patienten. Aber macht eine gute Informationspolitik auch gleich eine erfolgreiche Markenstrategie aus? Markenbildung ist ein Qualitätsversprechen und das muss überall eingehalten werden. Das erreicht man zum Beispiel dadurch, dass die Einweiser entsprechend informiert werden und das Qualitätsversprechen deutlich gemacht wird. Bei den Patienten funktioniert das eher über Mundpropaganda: Wenn diese in der Klinik besucht werden, müssen auch die Besucher wahrnehmen, dass die Qualität rundherum stimmt. Haben es Krankenhäuser schwerer als andere Unternehmen, ihre Leistung zu vermarkten? Andere Unternehmen suchen Stammkunden bei Krankenhäusern ist das natürlich der falsche Weg. Bei einer guten Klinik sollen die Patienten ja gerade nicht ständig wiederkommen. Aber letztlich sind die Häuser doch in der gleichen Situation: Sie bewegen sich am Markt mit vielen Mitbewerbern und möchten ihre Dienstleistung an den Patienten bringen. Daneben sollten sie beim Marketing auch eine neue Zielgruppe ins Auge fassen: zukünftige Mitarbeiter. Denn inzwischen haben die Kliniken wieder ein Problem mit dem Personalmarketing: Vor 15 Jahren sprachen wir von einer Ärzteschwemme und heute suchen sich die Ärzte wieder aus, wo sie hingehen. Und natürlich schauen die zuerst auf die Internetseite. Wenn die nichts taugt, kann das neben Patienten auch potenzielle Bewerber schnell verschrecken. Checkliste: Bei der Klinikwerbung außerhalb von Fachkreisen gelten laut Heilmittelwerbegesetz unter anderem folgende Tabus: irreführende Werbebotschaften die Darstellung individueller Krankengeschichten Abbildung von Personen in Berufskleidung bildliche Darstellung von Krankheiten Fachtermini, die nicht bereits zum üblichen Sprachgebrauch zählen Anzeigeninhalte, die Angstgefühle schüren Anzeigen, die nicht deutlich als solche erkennbar sind Dank- oder Anerkennungsschreiben, etwa von geheilten Patienten Verleitung oder Hilfe zur Selbstdiagnose und -behandlung Hinweise auf diverse schwerwiegende Leiden Fortsetzung von Seite 1 Aus der Summe dieser Parameter ergibt sich der Spielraum für ein anzustrebendes Image, das eine Marke transportieren soll. Tatsächlich ist hier Differenzierung gefragt, denn ob sich eine kleinere Klinik in der Provinz hightechmäßig tatsächlich mit einer Uniklinik messen könnte, ist zweifelhaft. Dafür könnte der ländliche David den Goliath wahrscheinlich mit anderen Qualitäten ausstechen sei es die ruhige Lage am Waldrand, eine familiäre Atmosphäre oder besonderer Komfort der Zimmer. Solche herausragenden Punkte gilt es bei der Markenfindung zu etablieren, weil sonst die Beliebigkeit droht. Allerdings müssen sie auch authentisch und glaubhaft sein, sonst droht die Lächerlichkeit im Kreis der Mitarbeiter und Patienten, weil sich Realität und Markenfassade zu sehr unterscheiden. Denn eine Marke ist eben viel mehr als ein buntes Logo auf dem Briefkopf und ein gut gemeintes Faltblatt für die Patienten. Sie ist immer auch ein Qualitätsversprechen, weiß Professor Detlef Steinhausen, Wirtschaftswissenschaftler an der FH Münster (siehe Interview). Und jedes Kind weiß, dass man seine Versprechen besser einhält oder unglaubwürdig wird. Gemeinsam geht es besser Weil Glaubwürdigkeit nach der Versorgungsqualität zum wichtigsten Kapital eines Krankenhauses zählt, muss hier auch die Hauptarbeit geleistet werden. Dirk Popp weiß aus der Praxis, dass die interne Kommunikation den Bärenanteil bei der Entwicklung einer Krankenhaus- Marke ausmacht. Denn Ärzte, Pflegemitarbeiter und selbst Servicekräfte müssen die zentrale Markenaussage ihrer Klinik kennen und aktiv mittragen, damit das Markenversprechen mit Leben gefüllt wird. Sie können ein neues Image nicht von oben verordnen, sondern müssen den Beteiligten auf allen Ebenen wieder und wieder erklären, dass eine gemeinsam gelebte Marke gut für das Haus, die Organisation und auch für die eigene Arbeit ist. Gerade bei großen Universitätsklinika sei dieser Prozess extrem aufwendig, weil praktisch jeder Klinikchef und Institutsleiter überzeugt werden müsse, dass die Markenentwicklung tatsächlich ein Schritt nach vorn ist. Es müssen Detailfragen geregelt werden, etwa welches Briefpapier die Ärzte benutzen, die vom Krankenhaus bezahlt, aber bei der Universität angestellt sind. Hunderte solcher Fragen stellen sich bei einer Markenentwicklung und erst wenn sie intern geklärt sind, kann die Marke auch nach außen strahlen und ihren Zweck erfüllen: ein einheitliches und positives Bild zu vermitteln. Diese Einheit braucht im Detail natürlich auch Differenzierung, wenn es um die Ansprache der verschiedenen Zielgruppen geht: Die Befindlichkeiten und Ängste müssen hier jeweils berücksichtigt werden, damit die Art und Weise der Kommunikation die Integrität der Marke unterstützt. Ein neu erworbenes High-Tech-Medizin- Ein Image lässt sich nicht verordnen. Dirk Popp, Pleon Dresden gerät muss Patienten anders kommuniziert werden als einweisenden Ärzten oder Krankenkassen. Erstere denken dabei vielleicht an kalte Apparatemedizin, die Zuweiser freuen sich möglicherweise über tolle Therapiemöglichkeiten und die Kasse denkt zuerst an steigende Kosten. Schon dieses Beispiel zeigt, wie wichtig zielgruppengerechte Kommunikation ist und auch dabei hilft eine klar umrissene Markenstruktur. Als gutes Beispiel für gelungenen Markenaufbau im Klinikbereich gilt seit langem die amerikanische Mayo Clinic, die in dieser Hinsicht internationaler Vorreiter war. In Deutschland ist etwa der Auftritt der privaten Helios-Kette als vorbildlich zu bewerten und auch einige Universitätskliniken ziehen inzwischen nach. Doch vielfach liegt hier und im kommunalen Bereich noch vieles im Argen. Detlef Steinhausen hat vor vier Jahren die Internetauftritte von über 200 Kliniken systematisch verglichen und teils erhebliche strukturelle und gestalterische Defizite festgestellt. Vieles ist inzwischen besser geworden, aber einige Häuser haben bis heute nicht begriffen, welches Potenzial sie durch fehlende oder schlampig gemachte Onlineauftritte verschenken. Eine nachlässig gepflegte oder unaktuelle Website ist heutzutage eine denkbar schlechte Werbung. Eine gute hingegen kostet nicht die Welt, informiert im Vorfeld über das Haus und ist eine ganz legale Werbung. Sofern keine Krankenschwestern im Kittel abgebildet sind.
3 3 Operation geglückt? Ein Jahr nach dem großen Ärztestreik scheint an den Unikliniken wieder Normalität zu herrschen. Doch der Tarifabschluss der Ärzte wird seine Folgen erst langfristig zeigen. Drei Thesen zu den Folgen des Streiks. Da haben Frank Ulrich Montgomery und der Marburger Bund noch mal Glück gehabt. Erst nach Ende des dreimonatigen Ärztestreiks fragten die Blätter der Republik besorgt, ob der Tod einer Herzkranken in Göttingen im Ausstand begründet liegen könnte. Ein einziger großer Fall in drei Monaten: nicht auszudenken, wenn jede Streikwoche von solchen Meldungen begleitet worden wäre. Es hätte schlimmer kommen können für die Ärzte und ihre Anliegen. Man darf sicher sein, dass ganze Horden von Journalisten darauf angesetzt waren, enttäuschte Patienten, tragische Todesfälle, verantwortungslose Ärzte ausfindig zu machen. Was sie fanden, waren zumeist verständnisvolle Patienten und eine Öffentlichkeit, die sich in ihrer großen Mehrheit hinter die Ärzte stellte. Das war nicht selbstverständlich bei der Länge des Streiks. Oder bei Montgomerys Forderung nach 30 Prozent mehr Lohn, die jedem Arbeiter oder Angestellten in der Neidrepublik Deutschland wie Hohn hätte vorkommen müssen. Oder angesichts der medialen Scharmützel, die sich Montgomery für den Marburger Bund mit Hartmut Möllring lieferte, dem Verhandlungsführer der Länder. Ein Shoot-out zweier gleichalter Herren, die als eitel beschrieben wurden und unnachgiebig, die mal miteinander sprachen und mal nicht, aber meist abfällig über einander. Und die ihre eigentlichen Ziele nur schwer verhehlen konnten: Auf der einen Seite den Marburger Bund als Klientelgewerkschaft zu etablieren, auf der anderen die Ärzte so lange hinzuhalten, bis der ver.di-abschluss ja, auch die Klinikangestellten waren seit Februar 2006 im Streik unter Dach und Fach ist und die Ärzte so streikmüde sind, dass sie ihn akzeptieren. So richtig gewonnen haben beide dabei nicht. Aber was heißt das weitgehend fruchtlose Hin und Her für die Kliniken? Zu fragen wäre, was die Öffentlichkeit während des Streiks so alles über die Zustände an den Unikliniken erfahren durfte. In drei groben Strichen sah das Bild so aus: Dort arbeiten zumeist unterbezahlte junge Ärzte, die sich nach über 30 Stunden Dienst am Stück gerade noch in den OP schleppen können. Sie werden von ihren selbstherrlichen Chefärzten geknechtet, die das große Geld einstreichen. Und für Forschung bleibt ihnen sowieso keine Zeit mehr. Hat der Streik daran etwas geändert? Ja. Die Assistenzärzte bekommen mehr Geld, dürfen maximal 24 Stunden am Stück arbeiten und bekommen drei Tage Weiterbildung bezahlt. Organisatorisch blieb in den Kliniken jedoch fast alles beim Alten. Der Streik, auch als Aufschrei gegen zu viel Bürokratie und zu wenig Zeit für Patienten gedacht, wurde letztlich auf seine monetären Ziele verengt. So weiß die Öffentlichkeit jetzt, dass das Einstiegsgehalt für einen jungen Arzt oder eine junge Ärztin bei Euro (West) bzw Euro (Ost) liegt und damit 60 Prozent über dem deutschen Durchschnittslohn. Doch selbst die Klagen der Nachwuchsmediziner, man könne damit schlechterdings keine Familie ernähren, blieben in den Meinungs- und Leserbriefspalten erstaunlicherweise unkommentiert. Die Ärzte und die Uniklinika scheinen also tatsächlich Glück gehabt zu haben mit dem Streik. Das lag zum einen an der Notversorgung, die fast tadellos klappte. Zum anderen aber auch daran, dass Hartmut Möllring schnell zum medialen Buhmann wurde. Oder dass wirklich niemand von einem übermüdeten Arzt operiert werden möchte. Oder dass die Deutschen nach wie vor die Gesundheit als höchstes Gut einschätzen, das auch ordentlich bezahlt werden sollte. Solange es nicht an den eigenen Geldbeutel geht. Oder ans eigene Klinikum. Es darf bezweifelt werden, dass das Glück auch langfristig anhält. Drei Thesen zu möglichen Folgen des Streiks für die Uniklinika. Szenario 1 Der Streik verschärft, was er eigentlich ändern wollte. Zu den gestiegenen Personalkosten (fünf bis zehn Millionen Euro pro Jahr pro Uniklinikum) und Einnahmeausfällen durch die Gesundheitsreform und DRGs (mehr als 100 Millionen Euro insgesamt) kommt die gestiegene Mehrwertsteuer, was eine weitere Effizienzsteigerung in den Krankenhäusern erfordert. Die selbst permanent defizitären Krankenkassen haben bereits angekündigt, nicht mehr Geld zahlen zu wollen. Die Politik wird einen weiteren Anstieg der Kassenbeiträge zudem verhindern wollen. Die möglichen Folgen: noch kürzere Liegezeiten für die Patienten, mehr Patienten pro Arzt oder betriebsbedingte Entlassungen, wie sie beispielsweise die LMU in München oder die Uniklinik Mainz bereits angekündigt haben. Es ist nicht zu erwarten, dass diese geräuschlos über die Bühne gehen. Zumal es dabei sicher nicht nur Ärzte treffen wird, sondern auch Pflegepersonal. Dessen Verständnis dafür wird sich nach dem tariflichen Alleingang des Marburger Bundes in Grenzen halten. Szenario 2 Der Stellenwert der Uniklinika sinkt. Unterbezahlte, übermüdete Jungmediziner am OP-Tisch: Dieses Bild dürfte sich in den Streikmonaten vielen Patienten eingebrannt haben. Es bleibt abzuwarten, ob es Bestand in den Köpfen haben wird. Zum Zweiten könnte den Unikliniken der Nimbus der Unersetzbarkeit verloren gegangen sein. Während des Streiks nahm in München beispielsweise die Belegung der städtischen Kliniken um sechs Prozent zu mit hoher Wahrscheinlichkeit Patienten, die nicht länger auf ihre OP am Uniklinikum warten wollten bzw. von niedergelassenen Ärzten dorthin überwiesen wurden. Auch konfessionelle und private Krankenhäuser profitierten vom Streik. Inwieweit der Wechsel zum Wettbewerb dauerhaft ist, bleibt abzuwarten. Sicher scheint: Bei Patienten wie niedergelassenen Ärzten muss wieder verstärkt um Vertrauen geworben werden besonders für Leistungen, die kein Alleinstellungsmerkmal der Uniklinika sind. Diese Frage werden sich auch die Länder stellen, die ihre Uniklinika jährlich mit Millionen subventionieren. Szenario 3 Der Umbau des Gesundheitssystems beschleunigt sich weiter. Glaubt man den Prognosen des Essener Wirtschaftsforschungsinstituts RWI und der Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young, werden bis 2010 zehn Prozent, bis 2020 sogar ein Viertel der momentan rund deutschen Kliniken geschlossen. Dabei wird es nicht vorrangig die Uniklinika als Anbieter von Hochleistungsmedizin treffen, jedoch können auch sie sich angesichts der maroden öffentlichen Haushalte keine roten Zahlen leisten, um nicht in Existenzgefahr zu geraten. Die deutschen Uniklinika müssen sich deshalb noch wesentlich stärker profilieren, ihre internen Abläufe weiter optimieren und ihr Angebot der Nachfrage besser anpassen. Das heißt im Klartext: Trotz aller Kritik aus der Ärzteschaft müssen die Klinika künftig noch betriebswirtschaftlicher denken. Zudem wird die ambulante Patientenversorgung weiter stark zunehmen, was die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten wichtiger denn je macht. Fazit: Der Streik könnte also mehr verändern an den Kliniken als die Arbeitsbedingungen für die Ärzte. Dies der internen wie der externen Öffentlichkeit zu vermitteln, wird die Herausforderung der nächsten Jahre. Dafür braucht man mehr als nur Glück.
4 4 Unter Kollegen Auch wenn sich immer mehr Patienten selbst über das Krankenhaus ihrer Wahl informieren die meisten Entscheidungen für oder gegen eine Klinik treffen nach wie vor die behandelnden Ärzte. Deshalb sind die einweisenden Mediziner die wichtigsten Stammkunden der Krankenhäuser und sollten entsprechend gepflegt werden. Guter Service und ein professionelles Informationsmanagement stehen dabei besonders hoch im Kurs. Der Weg ins Krankenhaus ist für die meisten Patienten ziemlich unspektakulär. Ohne Blaulicht und Tatü führt er in der Regel durch das Sprechzimmer des Hausarztes oder eines Spezialisten. Und wenn die Diagnose eine stationäre Behandlung erfordert, wird hier auch täglich tausendfach die Entscheidung über die Auswahl der Klinik getroffen; meist mit dem Patienten zusammen, aber immer beeinflusst von der Erfahrung und der Präferenz des Mediziners. Kein Wunder, dass sich mit dem steigenden Wettbewerbsdruck der letzten Jahre auch immer mehr Marketingaktivitäten auf die niedergelassenen Ärzte richten mit dem Ziel, die Weichenstellung über wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg des eigenen Hauses positiv zu befördern. Mit Geld wäre dies zwar denkbar, aber im Gegensatz zur vermögenden Pharmabranche müssen sich die Kliniken mit geldwerten Wohltaten zurückhalten, denn sie hängen an den gleichen Geldtöpfen wie die Ärzte selbst und das Geld darin wird von Jahr zu Jahr knapper. So kommt es, dass beispielsweise Einweisungspauschalen von Kliniken für die Ärzte eine große Ausnahme sind. Ohnehin wäre diese Art des Marketings moralisch zumindest fragwürdig und würde in breiter Anwendung wohl zu einem bizarren Wettlauf der Prämien führen, ohne dass den Patienten damit geholfen wäre. So gesehen ist die knappe Finanzlage im Gesundheitswesen vorteilhaft und eine Herausforderung für die Häuser, durch andere Anreize die Bindungen zu den einweisenden Ärzten herzustellen und zu pflegen. Commitment für gutes Miteinander Für die Strategieplaner der BBDO Consulting ist deshalb Commitment der Dreh- und Angelpunkt des Einweisermarketings. Diese vertrauensvolle Bindung des Arztes an eine Klinik gilt es herzustellen und gegebenenfalls zu pflegen; möglichst zu geringen Kosten. Die Basis der Commitment-Analyse sind Faktoren wie Anbieter-Image, Zuweiser-Involvement oder Wettbewerbsalternativen und diese leisten mehr als eine reine Zufriedenheitsbefragung. Es geht letztlich darum, das zukünftige Verhalten der Einweiser bestimmen zu können, sagt Patrick Geus, Senior Consultant und Gesundheitsexperte bei BBDO Consulting in München. Dabei wird die Verbundenheit der In vielen Häusern fehlt einfach das Verständnis für ein modernes Einweisermarketing. Patrick Geus, Senior Consultant und Gesundheitsexperte bei BBDO Consulting in München Zuweiser im Relevanzbereich einer Klinik per Telefonbefragung erhoben. Der Mix aus geschlossenen und offenen Fragen erlaubt einerseits eine Einteilung der Ärzte in vier Gruppen jeweils in stark überzeugte und wechselbereite Einweiser des eigenen Hauses und der Mitbewerber. Diese vier Commitment-Segmente reichen aus, um zu sehen, welche meiner Einweiser in hohem Maße gebunden sind. Dafür muss ich bestenfalls noch Stützungsmaßnahmen ergreifen und kann das Gros meiner Marketing- Ressourcen auf die beiden kritischen, weil wechselbereiten Gruppen des eigenen Hauses und der Wettbewerber konzentrieren, sagt Geus. Über die Art der notwendigen Maßnahmen geben dann die Ergebnisse der offenen Fragen Aufschluss. In den meisten Fällen hängt es nach Ansicht des Experten Geus an Kommunikationsdefiziten im weitesten Sinne. Unser Eindruck ist der, dass die Branche in diesen Dingen noch immer ganz am Anfang steht. Wenn man sich wundert, wie wenig -Verkehr in den Krankenhäusern stattfindet, muss man wissen, dass sich vielfach vier Ärzte und sieben Schwestern einen PC auf der Station teilen müssen, der oft noch auf einem technologischen Standard von vor 15 Jahren basiert. Da können Sie erleben, dass ein Arzt, der nur ein paar s abrufen will, sich erst komplett ausloggen, dann den Rechner herunterfahren und wieder starten muss. Dabei ließen sich allein über ein Mindestmaß an moderner Technik einige der häufigsten Probleme lösen und die Kommunikation mit dem Einweiser viel unkomplizierter gestalten. Daneben zielen die Wünsche oft auf ganz banale Dinge, die häufig mit einer Verbesserung der Organisationsstrukturen zu beheben wären. Es fehlt den einweisenden Ärzten vielfach an ganz simplen Informations- und Abstimmungsprozessen: Die Patientenpapiere kommen zu spät aus der Klinik, der Arzt weiß nicht, was mit seinem Patienten geschieht oder wann er etwa entlassen wird, sagt Patrick Geus. Es fehle dazu einfach bei vielen Häusern jedes Verständnis eines modernen Einweisermarketings oder es erschöpft sich in einem der gefürchteten Vorträge, zu denen Einweiser in die Klinik eingeladen werden. Gerade in den größeren Städten funktioniert das kaum noch, weiß Geus. Viel sinnvoller wäre es etwa, spezielle Internetseiten für Einweiser mit Online-Überweisungsformularen oder Ähnlichem anzubieten. Solche Lösungen gibt es ja längst, aber sie werden viel zu wenig eingesetzt. Hightech für perfekte Kommunikation Wie unterschiedlich erfolgreiches Zuweisermarketing in der Praxis aussehen kann, zeigen die Beispiele der Evangelischen Stiftung Augusta Bochum und der Ostseeklinik Damp. Beide Häuser sind Preisträger des Marketingpreises des Fachblattes Krankenhaus Umschau, der in diesem Jahr für Projekte im Zuweisermarketing ausgelobt war. In Bochum setzt man vor allem auf eine hoch integrierte Internet-Plattform, über die einweisende Ärzte optimal in die Krankenhausbehandlung ihrer Patienten eingebunden werden. Die Teilnahme am Zuweiserportal ist für die teilnehmenden Ärzte kostenlos und setzt keine zusätzliche technische Ausstattung voraus, zumindest wenn man einen PC mit Onlinezugang als Standard betrachtet. Davon profitieren die Mediziner schon im Vorfeld, denn der Patientenpfad beginnt für uns nicht erst im Krankenhaus, sondern bereits vor der Aufnahme des Patienten, sagt Ulrich Froese, Geschäftsführer der Evangelischen Stiftung Augusta in Bochum. Die ein-
5 5 Der Weg zum Einweiser ist nicht immer geradlinig, aber meistens führt ein professionelles Kommunikationskonzept für diese Stammkunden zum Erfolg. Transparenz und Service sind dabei die wichtigsten Schlagworte. weisenden Ärzte können über das Webportal schnell und bequem Kontakt zu unserem Krankenhaus aufnehmen, sei es durch Versenden einer oder nur durch Herausfinden des richtigen Ansprechpartners, um dann telefonisch mit ihm Kontakt aufzunehmen. Das allein macht freilich noch kein Zuweiserportal aus und wäre sogar über eine normale Internetpräsenz realisierbar. Spannend wird es für die Zuweiser dort, wo sie sich aktuell über den Behandlungsstatus ihrer Patienten in der Klinik informieren können. Die Ärzte können den gesamten Behandlungsverlauf ihres Patienten in unserem Haus immer aktuell nachvollziehen. Jeder von uns in unserem Krankenhausinformationssystem freigegebene Befund steht automatisch im Webportal für den niedergelassenen Arzt zur Verfügung. Nach der Entlassung sind alle relevanten Informationen für die Weiterbehandlung ersichtlich und die optimale Weiterbehandlung gesichert. Das Warten auf den Entlassungsbericht ist damit vorbei. Derzeit wird das Webportal noch weiter ausgebaut, so dass auch das Krankenhaus online Vorbefunde von den Niedergelassenen erhalten kann, damit teure Doppeluntersuchungen nur noch in begründeten Ausnahmefällen nötig werden. Wir verfolgen mit dem Webportal mehrere Ziele, erklärt Froese. 1. Verbesserung der Kommunikation und verbesserten Service für den einweisenden Arzt. 2. Optimierung des gesamten Behandlungsprozesses für den Patienten und damit auch direkten Nutzen für den Patienten. 3. Nutzung des Mediums Webportal insbesondere für die Leistungserfassung im Rahmen von integrierter Versorgung. Da das Webportal auf einer gesicherten Plattform läuft, können hierüber regelrechte Fachdiskussionen und Konferenzen über den weiteren Behandlungsweg eines Patienten geführt werden und dies jeweils mit Einsichtnahme in die Patientenakte. Der Geschäftsführer freut sich über die sehr positive Resonanz der niedergelassenen Ärzte, die inzwischen sogar eigene Vorschläge zum weiteren Ausbau des Webportals machen und selbst neue Kollegen zur Teilnahme motivieren. Persönlich erreichbar und gut organisiert In Damp an der Ostsee führt auch kein Weg an moderner Technik vorbei, aber der Ansatz des Zuweisermarketings setzt hier seit 2004 sehr stark auf persönliche Kontakte und serviceorientierte Organisation. Mit rund Endoprothesen-Versorgungen pro Jahr ist die Orthopädie ein wesentlicher Schwerpunkt der Ostseeklinik Damp. Am Anfang standen umfangreiche Befragungen von Patienten und kooperierenden Ärzten, die vor allem Kommunikationsdefizite und organisatorische Schwächen aufzeigten. Gerade in der Kommunikation zwischen niedergelassenem Arzt und Kliniker kommt es immer wieder zu Reibungen. Der niedergelassene Arzt fühlt sich nicht akzeptiert von der mächtigen Klinik, der Krankenhausarzt hat keine Zeit für den niedergelassenen Arzt, beschreibt Ostseeklinik-Geschäftsführer Michael Jürgensen die üblichen Befindlichkeiten. Aus diesem Grund haben wir in unser Konzept eine hauptamtliche Praxisbetreuung integriert. Eine Außendienstmitarbeiterin überbrückt die Schnittstelle zwischen Klinik und niedergelassenem Arzt. Sie ist permanent erreichbar, schult auch Arzthelferinnen, organisiert gemeinsame Veranstaltungen und löst insgesamt sämtliche Kommunikationsprobleme zwischen den Beteiligten. Daneben waren natürlich auch zahlreiche praktische Probleme zu lösen: Die niedergelassenen Mediziner bemängelten etwa zu spät geschickte Entlassungsberichte, mangelhafte Kontakte zu den Klinikärzten oder die fehlende Abstimmung von Vor- und Nachbehandlung. Deshalb sind nun die Chefarztsekretariate im Regelfall bis Uhr erreichbar, es gibt gemeinsame Vortragsabende für Patienten und darüber hinaus werden regelmäßig Zuweiser zu Treffen im kleinen Kreis geladen, etwa zusammen mit Geschäftsführer Jürgensen. Der Erfolg auch dieser Zuweiserkampagne kann sich sehen lassen: Über 150 Vertragsärzte sind derzeit auf der Website der Ostseeklinik aufgeführt, etwa 10 Prozent davon kamen durch die Zuweiser-Initiative neu dazu. Für Jürgensen gibt es damit allerdings noch keinen Grund, die Hände in den Schoß zu legen. In den nächsten Monaten wollen wir zusätzliche vertrauensbildende Maßnahmen etablieren etwa die feste telefonische Erreichbarkeit der Klinikärzte und die Anpassung der Sekretariatszeiten an die Sprechstunden der niedergelassenen Ärzte. Diese werden auch die Möglichkeit erhalten, gemeinsame Visiten mitzugehen und in Zukunft soll ein abgestimmter Entlassungskurzbrief spätestens eine Woche nach Entlassung des Patienten beim behandelnden Arzt sein. Es zeigt sich, dass erfolgreiches Einweisermarketing nicht primär eine Frage des Geldes ist. Vielmehr sind kluge Strategien gefragt, die den Ärzten die Zusammenarbeit erleichtern und letztlich auch die Klinik entlasten. Ein Blick für die Bedürfnisse der Niedergelassenen, ein klärendes Gespräch und Korrekturen bei der internen Organisation können schon viel bewirken, sofern sie einem stringenten Konzept folgen. Allerdings muss man es auch wollen und verstanden haben, welch wichtiges Kapital zufriedene Einweiser sind. BEYOND COMMUNICATIONS Pleon ist zweimal Agentur des Jahres*und zum dritten Mal in Folge die beliebteste Kommunikationsagentur von Europas Top-Entscheidern**. Wir danken allen, die dazu beigetragen haben! * PR-Report Award in Gold, PR-Agentur des Jahres 2006 European Sabre Award in Gold, German Consultancy of the Year 2006 **news aktuell PR-Trendmonitor 2007
6 6 Ideen machen sympathisch Dass PR immer wichtiger wird, dämmert inzwischen den meisten Klinikbetreibern, doch besonders kleinere Häuser der Allgemeinversorgung ohne erkennbare Spezialisierung tun sich damit oft schwer. Dabei lässt sich schon mit geringen Mitteln eine profitable Öffentlichkeitswirkung realisieren wenn die Strategie stimmt. Marketing das ist doch nur etwas für die Großen. Solche oder ähnliche Vorbehalte kann man aus den Chefetagen vieler Kliniken hören, die nicht zu den namhaften Ketten oder Universitätsklinika gehören. Die Wahrheit ist: Gerade kleine Häuser können mit geschicktem Marketing eine Menge erreichen und Patienten auf vielfältige Weise an sich binden. Oft genügt schon eine nette Idee, die gut umgesetzt wird. Das Klinikum Nürnberg hat beispielsweise mit dem Internetportal eine großartige Plattform für Kinder geschaffen, die sich für Medizin interessieren oder die etwas über das Krankenhaus und ihre Behandlung erfahren wollen. Mit Onlineforum, Spielen und kindgerechten Antworten auf viele Fragen versucht das Portal, den Kindern Berührungsängste zu nehmen. Gleiches gilt für den Kli-Ki-Tag, der zweimal im Jahr im Klinikum Krankenhaus zum Anfassen für die Kids verspricht. Beim Thema Das Wunder der Atmung lernen sie etwa, wie viel Luft in die Lunge passt, was der Notarzt macht, wenn ein Kind nicht mehr atmet, und so weiter. Ist das Kinderkram? Natürlich! Und ganz nebenbei gutes Marketing zum Nachmachen, weil es unaufdringlich Kompetenz vermittelt, Vertrauen aufbaut und langfristig eine stabile Patientenbindung herstellt. Kinder als Türöffner Ohnehin sind Kinder nicht der schlechteste Weg, sich zu profilieren gerade bei Kliniken der Allgemeinversorgung. Wem es etwa gelingt, werdende Familien in der aufregenden Zeit einer Geburt zu ihrer Zufriedenheit zu versorgen, der verschafft sich ein gutes Standing bei mindestens drei Personen. Dabei ist natürlich die medizinische und soziale Betreuung von größter Bedeutung. Aber diese Kompetenz muss auch kommuniziert werden. Zwar passiert das gerade bei der Auswahl der Geburtsklinik vielfach durch Mund-zu-Mund-Propaganda, aber die kann durchaus praktisch unterstützt werden. Beispielhaft kann man das bei der privaten Schweizer Hirslanden-Gruppe sehen, die einerseits online mit ein optisch wie inhaltlich gelungenes Portal aufgebaut hat, das werdende Eltern bestens informiert und unterhält. Dazu haben die Schweizer zusammen mit einem Designer-Team den Baby-Bag entwickeln lassen, eine wirklich praktische und hochwertige Tasche mit Platz für alles, was Eltern mit Kleinkindern so bei sich haben müssen. Den Baby-Bag bekommen die Mütter geschenkt, die bei Hirslanden entbinden. Sie erhalten damit ein exklusives Utensil, das für mehr Gesprächsstoff in der Krabbelgruppe sorgt als die üblichen Werbegeschenke der Babysalbenhersteller und Kinderbreiköche. Doch natürlich kosten solche Aktionen Geld, das viele Kliniken schlicht nicht haben oder besser in medizinisch relevante Investitionen stecken. Das ist verständlich, oft auch vernünftig und muss dennoch keinen Verzicht auf aktives Marketing bedeuten. Mit einer durchdachten Medienstrategie können sich finanzschwache Häuser fast zum Nulltarif profilieren mit freundlicher Unterstützung der lokalen und regionalen Medien. Medienpräsenz fürs Profil Ein wichtiges Kapital ist dabei die Tatsache, dass Gesundheitsthemen mehr denn je den Trend bestimmen. Was liegt da für die Journaille näher, als die Fachleute der Region zu befragen? An denen ist es nun, sich bereitzuhalten, sich aktiv anzubieten und präsent zu sein. Das funktioniert nicht von heute auf morgen und muss zuerst von der Geschäftsführung mit der notwendigen Priorität versehen und intern kommuniziert werden. Ein Journalist, der sich mehrfach abgespeist oder vertröstet fühlt, hat kein Problem, bei seiner nächsten Recherche eine 30 oder 300 Kilometer entfernte Klinik anzurufen, die seine Wünsche ernster nimmt. Daher ist es wichtig, dass ein gut vernetzter und erreichbarer Ansprechpartner die Vermittlung von Anfragen übernimmt, um alle Beteiligten möglichst ohne Umwege zufriedenzustellen. Ist das Bewusstsein für die Zusammenarbeit mit den Medien erst einmal verankert, kann sich die öffentliche Wahrnehmung eigentlich nur noch Die beiden Comicfiguren sind die Stars auf Die Klinikum-Kinderakademie ist ein Teil des kinderfreundlichen Konzeptes des Nürnberger Klinikums und wird von vielen weiteren Aktionen für Kinder und Familien begleitet. Das schafft Wissen um die Gesundheit und Verständnis für Abläufe im Krankenhaus. verbessern. Wenn die Oberärzte regelmäßig Gesundheits-Kolumnen für die Wochenendbeilage des Regionalblattes verfassen, empfiehlt sich ein Krankenhaus als kompetenter Partner in medizinischen Fragen. Ist der örtliche Klinikchef zweimal im Jahr in einem Telefonforum der Zeitung mit von der Partie, schafft das Vertrauen und verringert Berührungsängste. Äußert sich die Krankenhaus-Geschäftsführung von Zeit zu Zeit öffentlich zu gesundheitspolitischen Fragen und erklärt die Folgen für die Patienten, impliziert das Verständnis für die Belange der Menschen. Was braucht die moderne Mutter? Mit dieser Fragestellung im Kopf wurde bei Hirslanden der erfolgreiche Baby-Bag konzipiert. Alle diese Beispiele sind Puzzlesteine einer sinnvollen Medienarbeit zum gegenseitigen Vorteil und müssen freilich zum Umfeld der Kliniken passen, wie auch zu den agierenden Personen. Zu bedenken ist, dass durch diese mittelbare Kommunikation nur eine begrenzte Steuerung der Informationsflüsse möglich ist der Journalist entscheidet im Endeffekt und das kann im Einzelfall auch ungute Abhängigkeiten mit sich bringen. Deshalb sollte unbedingt ein Konzept für strategische Kommunikation erstellt werden, das genau den Rahmen und die Prioritäten für das jeweilige Haus klärt. Und das gilt im Übrigen für alle Marketing-Aktivitäten: Ohne professionelle Planung können sie leicht nach hinten losgehen oder zumindest wirkungslos verpuffen. Events für den direkten Kontakt Wer lieber unmittelbar mit zukünftigen Patienten in Kontakt kommen will, muss sich etwas einfallen lassen. Das Evangelische Krankenhaus Bergisch Gladbach setzt beispielsweise seit einigen Jahren erfolgreich auf ein Messekonzept. Regelmäßig veranstaltet die Klinik eine regionale Gesundheitsmesse mit vielen Experten für jedermann, die sich wachsender Beliebtheit erfreut. Ersatzweise bieten sich auch Aktionen wie Tage der offenen Tür an, öffentliche Medizinvorträge oder die Klinikpräsenz auf Stadtfesten und regionalen Events. Doch ganz unabhängig davon, welcher Marketingmix für ein Krankenhaus der beste ist: Ganz ohne geht es mittelfristig sicher nicht. Durch die wachsende Mobilität und das steigende Qualitätsbewusstsein der Menschen ist praktisch keine Klinik mehr ohne Konkurrenz, so abgeschieden sie mit ihrem Einzugsbereich auch liegen mag. Jedes Haus, das mittelfristig überleben möchte, muss sich über seine Positionierung Gedanken machen und den Draht zu den Patienten suchen und pflegen. Im Vorteil ist im Endeffekt das Krankenhaus, das sich in der öffentlichen Wahrnehmung als vertrauenswürdiger und kompetenter Gesundheitsdienstleister profilieren kann. Und dafür muss man sich einfach wichtigmachen im positiven Sinne. Denn Gesundheit ist auch für die meisten Menschen das Wichtigste.
7 7 Keine Privatsache Die Privatisierung von öffentlichen Krankenhäusern ist immer eine heikle Sache zumindest aus kommunikativer Sicht. Zwei Fachleute berichten von ihren Erfahrungen aus der Praxis und zeigen die kritischen Phasen von Privatisierungsprojekten auf. Wenn es an die Privatisierung öffentlicher Kliniken geht, wird es politisch. Das hat sich bei den Uniklinika in Gießen und Marburg gezeigt und auch bei vielen kleineren regionalen Häusern. Schnell entstehen aus Befindlichkeiten Gerüchte und daraus Behauptungen, die im schlimmsten Fall sogar ein eigentlich wünschenswertes Privatisierungsprojekt scheitern lassen können. It s the communication, stupid! könnte man provokant deklamieren, aber es geht natürlich auch sachlicher: Der Erfolg einer Klinikprivatisierung hängt zu 40 bis 50 Prozent von der Kommunikation ab, schätzt Thomas Rieger, der für die Sachsen LB schon mehrere Klinikprivatisierungen mitbetreut hat. Der Grund: Man muss und sollte auf drei Ebenen kommunizieren: intern auf der Entscheiderebene, intern bei der Belegschaft und extern für die Öffentlichkeit, weil jeder Steuerzahler letztlich auch Gesellschafter eines kommunalen Krankenhauses ist. Dabei gehört perfektes Timing zur Grundvoraussetzung des Erfolgs, denn jedes Projekt durchläuft mehrere grundverschiedene Kommunikationsphasen von absoluter Diskretion bis hin zu größtmöglicher Transparenz. Zuhören, schweigen, sprechen Diskretion nach außen Offenheit nach innen: Von diesem Motto sollten erste Gespräche zwischen potenziellen Käufern und Verkäufern geprägt sein. Der Kreis der Beteiligten bleibt naturgemäß klein. So wird man sich in Ruhe über die gemeinsamen Ziele einig, in denen es meist um die langfristige Sicherung oder Verbesserung der medizinischen Versorgung im Landkreis geht und die Entlastung der Kommune, die sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren möchte, weiß Verhandlungsexperte Rieger. Liegt ein belastbares Angebot vor, ist es an der Zeit, alle politischen Entscheidungsträger umfassend zu informieren, damit sie sich eine fundierte Meinung bilden können, die sie dann auch vor ihren Wählern vertreten im persönlichen Gespräch und bei öffentlichen Auftritten. Thomas Rieger rät hier zu großer Transparenz: Sie müssen genau wissen, was die Vor- und Nachteile der Privatisierung sind, denn wo es Vorteile gibt, sind in der Regel eben auch Nachteile. Das muss man ihnen offen darlegen und sie dann aber auch in die Pflicht nehmen, eine Entscheidung zu treffen. In dieser Phase muss es mit der Diskretion vorbei sein, um kein Gefühl der Heimlichtuerei zu provozieren. Denn neue Strukturen bedürfen zunächst der Akzeptanz, weiß Dr. Reinhard Schwarz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Klinikkette Sana. Es gilt, die Mehrwerte und Chancen von Veränderungen zu kommunizieren. Diese Positionierungsarbeit beginnt bei politischen Entscheidern, Journalisten als öffentlichen Meinungsbildnern, aber auch intern bei der Klinikverwaltung, den Klinikärzten, dem Pflegepersonal und Betriebsräten. Dazu gehören Hintergrundgespräche ebenso wie breit angelegte Infoveranstaltungen oder Presseaktivitäten. Ist diese kommunikative Standardversorgung im Gange, müssen die Verantwortlichen vor allem eines: zuhören. Denn statt wohlfeile State- ments zu verlesen, müssen sie die möglichen Befürchtungen und Fehlinformationen bei den Menschen erkennen. Dass es sich dabei oft nur um bizarre Missverständnisse handelt, hat Thomas Rieger mehrfach erlebt. Wir haben gehört, dass manche Bürger meinten, dass nach der Privatisierung des Krankenhauses nur noch Privatpatienten behandelt werden. Oder: Die Privaten sind nur auf Gewinn aus nach dem Motto: Die Patienten werden blutend entlassen. Vieles davon lässt sich in einer Pressemitteilung und bei einem öffentlichen Auftritt des Klinikchefs aufklären, ohne der Angelegenheit zu viel Gewicht zu geben. Der kann auch sachlich aufklären und argumentieren, dass die Gewinnorientierung eines Investors der Qualität eher zuträglich ist. Schließlich sei der gewinnorientierte Betreiber daran interessiert, seine Kunden zu behalten und langfristig zufriedenzustellen. Internkommunikation auf Hochtouren Neben Politik und Öffentlichkeit bedarf im Privatisierungsprozess vor allem die Belegschaft besonderer kommunikativer Zuwendung. Die Befürchtung, dass eine Privatisierung Entlassungen oder schlechtere Entlohnung mit sich bringt, steht fast automatisch im Raum. Hier kommt die Aufgabe der Unternehmenskommunikation zum Tragen, potenzielle Defizite bezüglich der Akzeptanz von Veränderungen zu identifizieren, sagt Sana-Chef Schwarz. Die gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen ein Gegensteuern und einen emotionalen Vorsprung im Management-Prozess. Erfahrungswerte zeigen, dass ohne kommunikative Steuerung die veränderungshemmende Wirkung häufig überwiegt. Gut präpariert wäre hier eine Mitarbeiterversammlung oder ein Treffen von Betriebsrat und Geschäftsführung anzustreben, bei der belastbare Zahlen auf den Tisch kommen. Denn vielfach zeigt sich, dass es im Regelfall zu einer Differenzierung bei der Entlohnung kommt, die Ärzte und jüngere Arbeitnehmer vielfach besser dastehen läßt, als es nach BAT der Fall wäre. Und eine Belegschaft ohne Sorgen kann in der Öffentlichkeit ein wertvoller Multiplikator zum Vorteil des Privatisierungsprojektes sein. Und natürlich sollten auch Kostenträger und einweisende Ärzte im Kommunikationskonzept berücksichtigt werden. Vor allem, wenn die Unterstützung im eigenen Haus fehlt, stehen die Chancen für einen Erfolg ungleich schlechter, besonders wenn weder intern noch extern eine klare Linie der Privatisierungsziele erkennbar ist. Droht gar ein Bürgerentscheid über das Vorhaben, wird es kritisch, denn dann müssen die Bürger einen sehr komplexen Fall entscheiden, ohne die nötige Detailund Fachkenntnis zu haben, sagt Thomas Rieger von der Sachsen LB. Es gibt nur sehr wenige Fälle in Deutschland, bei denen eine Privatisierung trotz Bürgerentscheid gut über die Bühne gegangen ist. Solche unkontrollierbaren Situationen sind daher möglichst zu vermeiden, denn hinter dem Umbau der Kliniklandschaft stehen strategische Transaktionen, die ein tief greifendes Veränderungsmanagement nach sich ziehen, weiß Richard Schwarz und betont: Die Kommunikation nach innen und außen flankiert die Management-Prozesse von Klinikträgern. Der Kommunikationsbedarf ist ausgesprochen hoch. Deshalb empfiehlt Thomas Rieger aus seiner Erfahrung, in das Beraterkonsortium nicht nur Rechtsexperten und M&A-Spezialisten zu berufen, sondern auch einen Kommunikationsfachmann. Sonst steht man am Ende des Tages vor einem Scherbenhaufen und hat ein Ergebnis, das eigentlich niemand wollte.
8 8 Griff nach den Sternen Als Wegweiser für Patienten wurden die Qualitätsberichte der Krankenhäuser 2004 gepriesen, doch genau das ist die Pflichtveröffentlichung bis heute nicht. Mehrere Ranking-Projekte stoßen nun erfolgreich in diese Marktlücke. Die Kliniken tun gut daran, jetzt mit dabei zu sein und Transparenz zu beweisen. Es ist ein Dilemma: Einerseits zählt die Gesundheit vielen als höchstes Gut. Andererseits lässt sich ausgerechnet dieses Gut qualitativ nur sehr schwer fassen: Was ist eine schwere Krankheit? Ab wann ist man wieder ganz gesund? Oder unheilbar krank? Diese Fragen kann man kaum selbst für sich beantworten, geschweige denn für andere. Auch deshalb wächst das Bedürfnis nach einfachen Antworten auf die Frage: Welches Krankenhaus ist das beste? Das Projekt Qualitätsbericht entstand mit dem politischen Willen, die Leistungen der Krankenhäuser für Patienten transparent und vergleichbar zu machen. Allerdings konnten die ersten Berichte für das Jahr 2004 diese Hoffnungen nicht erfüllen. Die vielstimmige Kritik war sich weitgehend einig, dass die Publikationen den Patienten die Auswahl eines geeigneten Krankenhauses keineswegs erleichtern. Der Gemeinsame Bundesausschuss ging auf diese Einwände ein und legte zusätzliche Anforderungen für die zweite Generation der Berichte fest: Die Krankenhäuser müssen künftig auch Daten zur Behandlungsqualität veröffentlichen. Hierzu wurden 27 Qualitätsindikatoren ausgewählt, die ohnehin der Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung (BQS) zu melden sind. Das Spektrum reicht von Zahlen zu postoperativen Komplikationen beim Einsetzen von Knie- Totalendoprothesen bis zum Geschehen im Kreißsaal. Im letztgenannten Fall sollen die Krankenhäuser unter anderem melden, wie häufig ein Kinderarzt bei Frühgeburten anwesend ist. Darüber hinaus müssen die Kliniken über die verfügbare Geräteaustattung sowie nicht-medizinische Serviceangebote informieren. Dennoch bleibt zu befürchten, dass die Berichte auch zukünftig ihr Ziel verfehlen. Denn Laien wird es auch mit diesen Zahlen kaum möglich sein, verwertbare Rückschlüsse zur tatsächlichen Behandlungsqualität zu ziehen (siehe auch Kommentar). Allein die Krankenkassen können sich mit den Zahlensammlungen ein noch genaueres Bild machen als vorher mit ihren Patientendaten. Zwar gibt es Kliniken, die neben den Pflicht werten bereits in den vergangenen Jahren auch BQS-Zahlen veröffentlicht haben. Allerdings meist nur bei positiven Ergebnissen, was die Daten mangels Vergleichsmöglichkeiten praktisch wertlos macht. Diagnose der Rankings Kein Wunder, dass Rankings und Hitlisten, die eine Topten der besten Krankenhäuser versprechen, bei den Patienten in spe heiß begehrt sind. Viel lieber begäbe man sich in die Hände eines Fünf-Sterne-Chirurgen als unters Messer eines Quacksalbers mit nur zwei Rankingsternchen. Doch funktioniert so ein vergleichender Ansatz wie im legendären Gourmetführer Guide Michelin auch als Guide Médecin? Die Verbraucherzentrale Hamburg hat den Test gemacht und 2006 die Onlineportale getestet, die den Patienten zum besten Krankenhaus weisen wollen. Allerdings stimmt das so nicht ganz, denn Christoph Kranich, Leiter der Studie, hat den Titel Wie finde ich das richtige Krankenhaus? ganz bewusst gewählt. Das beste Krankenhaus ist möglicherweise für jeden Patienten ein anderes, sagt Kranich. Wir haben deshalb in unserem Test untersucht, mit welchen Portalen der Patient eine reale Chance hat, das für ihn richtige Haus zu finden. Die Bewertungskriterien der Verbraucherschützer sehen bei der Krankenhauswahl durch den Patienten meist drei oder vier Bereiche im Vordergrund. Zuerst stehen die fachliche Eignung der Klinik und die verfügbare Behandlungsqualität im Vordergrund. Dann kommen Erreichbarkeit und nicht zuletzt die Hotelqualität hinzu Sauberkeit bis hin zur Freundlichkeit der Mitarbeiter. Spezielle Angebote wie ein gen Mekka gewandter Gebetsraum für Muslime oder die Versorgung mit koscheren Speisen sind ebenfalls von Interesse. Bei der Bewertung dieser Kriterien ist es wichtig zu wissen, dass jeder Patient deren Bedeutung anders bewertet, erklärt Verbraucherschützer Kranich. Ein älterer Patient mit einer häufigen, leicht behandelbaren Krankheit wird eher auf die Nähe zum Wohnort achten, während eine ausgefallene Diagnose eher die Suche nach einem speziell dafür qualifizierten Krankenhaus erfordert. Andere Patienten bewerten die Servicequalität höher als die medizinische Qualität, die sie als Laien kaum beurteilen können. Deshalb führten die Prüfer die Gewichtungsmöglichkeit als zusätzliches Testkriterium ein, die ebenso wie Bedienbarkeit, Barrierefreiheit, Unabhängigkeit sowie Verständlichkeit und Vollständigkeit in die Bewertungsergebnisse einflossen (siehe Kasten). Offenheit bringt Punkte Einer der Sieger bei den Verbraucherschützern ist das Portal des Klinikführers Rhein-Ruhr, das auch als Buch vom Initiativkreis Ruhrgebiet herausgegeben wird. Die erste Ausgabe 2005/2006 verkaufte binnen einer Woche mal, die Ausgabe 2007/2008 ist derzeit in Vorbereitung. Nach Angabe von Projektleiterin Annekatrin Sonn waren die Qualitätsberichte für einige Ba- Die Spitzengruppe der Online-Klinikrankings Bestes und vollständiges Portal sowie gute Kombinationsmöglichkeiten bei den Suchkriterien. Einheitliche Informationsseiten zu einzelnen Krankenhäusern und direkter Vergleich zu anderen Häusern. Transparenter Umgang mit den Suchkriterien, die jederzeit sichtbar bleiben und verändert werden können. Einheitlich gestaltete Seiten, übersichtlich aufgebaut, geben einen guten Überblick. Auch nach Service, Behandlungsmethoden und ansatzweise nach Qualitätsdimensionen kann gesucht werden. Das patientenfreundlichste Portal im Test mit den meisten Informationen über die Behandlungsqualität. Es bietet viele Informationen schnell und übersichtlich. Eine Ausweitung auf ganz Deutschland wäre wünschenswert. Hier kann man ein Bild des menschlichen Körpers anklicken und findet die zugehörigen Krankheiten sowie Krankenhäuser mit dem entsprechenden Schwerpunkt. Dadurch ist dieses Portal für medizinische Laien sehr einfach zu bedienen. Mit gut Krankenhäusern ist es jedoch nicht ganz vollständig. Das Portal enthält umfangreiche Informationen zu Gesundheits- und Krankheitsthemen. Beiräte stehen für die Richtigkeit der Informationen. Quelle: Broschüre Wie finde ich das richtige Krankenhaus? der Verbraucherzentrale Hamburg. Nähere Informationen und Bestellung unter
9 9 sisdaten wie Angaben zu Personal, Bettenzahlen oder Anzahl von Eingriffen und Therapien nützlich, aber für die Einschätzung der Qualität waren viel umfangreichere Daten nötig. Die Qualität medizinischer Versorgung ist zu komplex, um schlicht unter dem Begriff Ranking gefasst zu werden, denn klinische Leistungen bestehen ja aus einer Vielzahl von Einzelaspekten: Jede Klinik und jede Fachabteilung hat schließlich ihre besonderen Stärken entwickelt, sagt Annekatrin Sonn. Entscheidend für einen seriösen Vergleich klinischer Versorgungsleistungen sei es daher, möglichst viele Einzelaspekte zu erfassen und für Patienten einsehbar zu machen. Alle nötigen Daten müssen dafür in den Krankenhäusern auf Basis einer einheitlichen Methodik erhoben werden. Deshalb basiert der Klinikvergleich auf vier Säulen: Neben der Einschätzung entlassener Patienten konnten alle niedergelassenen Ärzte im Ruhrgebiet ihre Empfehlung abgeben. Außerdem wurde für jeweils drei ausgewählte Eingriffe pro Fachbereich die jährliche Häufigkeit durch die Behandlungsqualitätsdaten der BQS ergänzt. Das ist aufwendig, aber nur so ist ein fairer Vergleich klinischer Leistungen möglich, sagt Expertin Sonn. Für die Buchversion des Klinik-Führers wurden die erhobenen Rohdaten in eine leicht verständliche Punktsystematik überführt, in der Internetversion sind zusätzlich per Expertenauswertung auch die zugrunde liegende Rohdaten einzusehen. Ebenfalls viel beachtet war die Übersicht der Berliner Kliniken, die der Tagesspiegel im Mai als Serie veröffentlichte. Der Redakteur Ingo Bach hat das aufwendige Projekt federführend betreut. Unser Ziel war es, aus den Qualitätsberichten die Informationen über die Berliner Kliniken herauszuziehen, mit denen auch Patienten etwas anfangen und Qualität vergleichen können, sagt Bach aber genau das sei mit den Qualitätsberichten praktisch unmöglich. Außerdem würde die nebulöse Vorschrift einer allgemeinverständlichen Sprache im Qualitätsbericht von vielen missachtet oder sehr unterschiedlich interpretiert. Deshalb basiert die Untersuchung nun auf einer Umfrage unter mehr als niedergelassenen Ärzten, die für bestimmte Behandlungen ihre bevorzugten Kliniken genannt haben und den Daten der Bundesgeschäftsstelle für Qualitätssicherung (BQS). An diese Institution müssen Kliniken beispielsweise Fallzahlen und Komplikationen melden und bekommen einen anonymisierten Bericht, der zeigt, wo sie im Deutschland-Vergleich liegen. Der größte Aufwand in der fünfmonatigen Vorbereitungszeit bestand darin, die Kliniken zu überzeugen, dass sich die Veröffentlichung dieser bisher nicht öffentlichen BQS-Zahlen für sie lohnt, sagt Ingo Bach im Rückblick auf die Premiere im Jahr Im Dialog räumte Bach den Kliniken die Möglichkeit ein, ihre Zahlen im Bedarfsfall zu kommentieren was die Sache für den Patienten letztlich viel informativer machte. Die Berliner DRK-Kliniken, die zu Anfang recht skeptisch waren, präsentieren heute einzelne Ergebnisse des Rankings auf ihrer Homepage. Obwohl Ingo Bach eigentlich lieber von einer Übersicht als von einem Ranking spricht wir können und dürfen letztlich keine Kliniken empfehlen. Dennoch schaffen die Zahlen natürlich Vergleichbarkeit und damit das, was ein mündiger Patient braucht. Journalist Bach sieht deshalb künftig die Kliniken im Vorteil, die ihre Daten transparent machen, und glaubt kaum, dass sich einzelne Häuser diesem Trend langfristig entziehen. Hier in Berlin gibt es über 70 Kliniken: Da geht es auch bei solchen Übersichten ganz klar um Marktanteile. Mitmachen lohnt sich Es deutet sich an, dass die Klinikvergleiche künftig noch viel wichtiger für Patienten und Einweiser werden. Vor allem Kliniken, die auf planbare Eingriffe spezialisiert sind, etwa in Orthopädie, plastischer Chirurgie oder auch Onkologie, sollten sich dieses Mittels bedienen. Das erfordert freilich ein vertrauensvolles Geben und Nehmen, denn der Umgang mit den sensiblen Qualitätsdaten ist heikel. Seriosität heißt in diesem Fall auch, dass schlichte Ein-bis-Fünf- Sterne-Wertungen dem komplexen Thema Gesundheitsversorgung kaum Rechnung tragen und bestenfalls für die Servicequalität eines Hauses verwendet werden können. Methodisch einwandfreie und strukturell durchdachte Vergleiche können hingegen vieles leichter machen. Noch hängen wir in Sachen Rankings 15 Jahre hinterher, resümiert Thomas Isenberg, Leiter des Gesundheitsreferats des Bundesverbands der Verbraucherzentralen in Berlin. Er bemängelt, dass Fragen wie die Servicequalität oder Erreichbarkeit der Ärzte in den Qualitätsberichten bisher keine Rolle spielten, obwohl auch solche Aspekte viel mit der Versorgungsqualität zu tun haben. Das Nächste, was zu wissen nötig wäre: Was geschieht mit den Patienten, die aus der Klinik entlassen werden? Ist die anschließende Reha-Versorgung gut? Wie sieht es auf dem gesamten Versorgungsweg des Patienten aus, der noch nicht erfasst wird? Hier wartet auch auf die Rankings und Vergleichslisten noch viel Arbeit, die sich aber lohnen wird. Es ist einfach sehr wichtig, die Qualitätssicherung als Leitplanke zur zunehmenden Ökonomisierung im Gesundheitswesen auszubauen um der Patienten willen. Wenn man über Sinn und Erfolg der Qualitätsberichte diskutieren möchte, müssen die ersten beiden Fragen lauten: Was ist das Ziel einer solchen Veröffentlichung und was macht deren Qualität aus? Für die Antwort auf die erste Frage genügt ein Blick ins entsprechende Gesetz, das den Zweck der Qualitätsberichte festlegt: Er soll in erster Linie die Patienten über die Qualität einer Klinik informieren und eine Entscheidungshilfe sein. Die 2004er Berichte haben sofern sie sich an die gesetzlichen Vorgaben hielten dieses Ziel komplett verfehlt. Nun folgte der Gemeinsame Bundesausschuss (G- BA) den Forderungen von Patientenverbänden und Verbraucherschützern: Die Kliniken sind verpflichtet, in der zweiten Generation der Strukturierten Qualitätsberichte eine Auswahl der nach einheitlichen Vorgaben der Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung erhobenen Zahlen zu veröffentlichen. Neben den 27 Qualitätsindikatoren zu zehn Leistungsbereichen, die für alle Einrichtungen Pflicht sind, kommen acht weitere hinzu, deren Veröffentlichung der G-BA empfiehlt. Wir müssen die Bedürfnisse der Patienten endlich ernst nehmen. Dr. Maria Eberlein-Gonska leitet den Zentralbereich Qualitätsmanagement im Dresdner Universitätsklinikum Carl Gustav Carus und ist seit März 2007 Vorsitzende der Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der Gesundheitsversorgung e.v. (GQMG). Die Qualitätsmanagerin beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Thema der Veröffentlichungen von Kennzahlen für verschiedene Zielgruppen und damit auch mit dem Qualitätsbericht. Diese neue Regelung ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Jedoch trübt eine ganze Reihe an Problemen die neu gewonnene Transparenz: Bis auf eine Ausnahme beschränkt sich die Liste der veröffentlichbaren Daten auf chirurgische Eingriffe. Die Ergebnisqualität konservativer Behandlungen bleibt also ausgeblendet. Auch methodische Probleme werfen einen Schatten auf die neu gewonnene Transparenz: Die für den Laien eindeutig erscheinenden Zahlen geben nicht zwingend ein tatsächliches Bild der geleisteten Versorgungsqualität wieder. Häuser der Maximalversorgung mit einem hohen Anteil besonders schwer erkrankter beziehungsweise betagter, multimorbider Patienten sind mit dem höheren Risiko an Komplikationen praktisch verbrannt, wenn sie diese Situation nicht gut verständlich darlegen können. Dieses Beispiel zeigt, dass eine flächendeckend organisierte Veröffentlichung von Qualitätsdaten nicht automatisch für eine gute Orientierung sorgt. Das gilt erst recht nicht für Patienten: Damit sie die Berichte wirklich nutzen können, bedarf es in vielen Fällen eines interpretierenden Vergleichs. In welcher Form dieser erfolgen kann, wurde bisher nicht diskutiert. Denkbar wären regionale Verbünde der Klinikführer Rhein-Ruhr ist ein Beispiel für eine solche Initiative. Doch selbst diese zusätzlichen Publikationen können nur eine Facette im Informationsund Kommunikationsprozess sein, der ohnehin primär von einem intensiven Arzt-Patienten-Verhältnis geprägt sein sollte. Eine hilfreiche Ergänzung zum Qualitätsbericht könnte eine Art Leseanleitung sein. Sie hilft den Kliniken, ihre Daten sinnvoll und verständlich aufzubereiten und den aufgeklärten und mündigen Patienten mit Informationen zu bedienen. Allein durch die Gesetze des Marktes käme damit ein Wettbewerb um gute Zahlen in den Qualitätsberichten in Gang, der mittelfristig einen Beitrag zur Verbesserung der Versorgungsqualität in den Kliniken leisten könnte. Und nichts anderes sollte die Intention von Qualitätsmanagement sein, verknüpft mit dem Anspruch, über die tatsächlich erbrachte Qualität zu informieren. Dies betrifft in erster Linie den Patienten und auch Angehörige, niedergelassene Ärzte sowie weitere Leistungsanbieter im stationären und ambulanten Bereich bis hin zur interessierten Bevölkerung.
10 10 Ein Klinikum zeigt Gesicht Die Uniklinik Köln geht in die Offensive: Mit der ersten groß angelegten Imagekampagne präsentierte sich das Klinikum mit Plakaten unübersehbar in der ganzen Stadt und im eigenen Haus. Im Ergebnis des vorangegangenen Markenbildungsprozesses machte es damit nicht nur das neue Corporate Design bekannt, sondern setzte zugleich neue Maßstäbe in der Krankenhauswerbung. Was haben Nivea, Coca-Cola und Adidas gemeinsam? Alle drei Namen erzeugen beim Verbraucher sofort ein klares Vorstellungsbild aus Qualität, Nutzen, Optik und persönlicher Erfahrung so, wie es nur starke Marken können. Doch welche Vorstellungen weckt die Uniklinik Köln bei ihren Zielgruppen? Und welche sollte sie wecken? Antworten dazu gab es viele: Fast jede Klinik und jeder Fachbereich hatte eine eigene Meinung zum Thema wie auch ein individuelles Erscheinungsbild mit eigenständigem Signet und entsprechend gestalteten Eigenpublikationen. Keine gute Basis für ein klares, einprägsames Bild für ein Klinikum als Ganzes, fand Dr. Jörg Blattmann, kaufmännischer Direktor der Uniklinik Köln: Im neuen Markenprofil haben wir deshalb all das konzentriert, was unser Haus klinikübergreifend auszeichnet. Vier zentrale Werte Exzellenz, Fortschritt, Verantwortung und Erfolg beschreiben heute die Kompetenzbereiche der Uniklinik. Diese inhaltliche Basis erarbeitete ein Team von 30 Klinikmitarbeitern aus 20 unterschiedlichen Gesicht zeigen! UNIKLINIK KÖLN Werbung für die eigenen Fähigkeiten Nach einer aufwendigen Überzeugungsarbeit innerhalb der Uniklinik mit Informationsveranstaltungen, Seminaren und Workshops war das Fundament für den Weg an die Öffentlichkeit gelegt. Lautete das Motto intern Gesicht zeigen!, hieß der Claim für die Externkampagne schlicht Gesundheit!. Zu einem brisanten Zeitpunkt nach den Klinikstreiks im Sommer galt es zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, wie Jörg Blattmann es formuliert, nach dem Streik wieder Präsenz zu zeigen und das Ergebnis unseres CD- und Markenprozesses zu präsentieren. Entsprechend penibel bereiteten die Kölner eine Kampagne vor, wie sie zuvor kein deutsches Krankenhaus realisiert hatte: 100 Großflächenplakate, 96 Citylight-Poster, 70 Megalights, 30 Traffic-Boards, Anzeigen und ein Onlinespecial im Internet sorgten für eine unübersehbare Präsenz in Köln. Diesem Erfolg war eine intensive rechtliche Prüfung vorausgegangen, denn bekanntlich sind die Werbemöglichkeiten im Gesundheitswesen durch den Gesetzgeber stark eingeschränkt. Nachdem die Juristen grünes Licht gegeben hatten, war der Weg frei für eine ganz besondere Imagekampagne, die alle überraschte und viele überzeugte. Die Strategie hinter der Kampagne Gesundheit! erlaubte es der Uniklinik Köln, nach dem Streik auf eine positive Art Präsenz zu zeigen und die Patienten davon zu überzeugen, dass die Uniklinik ein hundertprozentig verlässliches Haus ist, in dem die Qualität der Behandlung an erster Stelle steht. Außerdem wurde die Kampagne natürlich genutzt, um das neue Gesicht und das weiterentwickelte Signet des Hauses in den Köpfen der Kölner zu verankern und die Bekanntheit weiter zu verbessern. Dr. Jörg Blattmann ist sich sicher: Das unkonventionelle Denken und der Mut, Neuland zu betreten, haben sich für die Uniklinik Köln rentiert. Die überregionale und fast durchweg positive Berichterstattung der Presse würdigte das Engagement der Kölner als einzigartige Aktion voller Sympathie, Charme und Zeitgeist. Interne Kampagne. Auf der jährlich stattfindenden After-Work-Party wurde das neue Logo auch intern bekannt gemacht. Plakate forderten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uniklinik Köln auf, Gesicht zu zeigen. Eintrittskarte waren Buttons mit dem Kampagnenmotiv Gesundheit. Externe Kampagne. An Bussen, auf Großflächenplakaten, Citylights, Megalights, auf Anzeigen und im Internet machte die Uniklinik Werbung in eigener Sache. Gesundheit! lautete die Botschaft und versicherte die Kölner der Tatsache, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uniklinik Köln hundertprozentig für sie da sind. Bereichen des Hauses. Der Markenwert Exzellenz steht dabei für die medizinische und der Wert Fortschritt für die wissenschaftliche Kompetenz. Verantwortung beschreibt die menschliche Komponente und Erfolg den ökonomischen Anspruch. Ziel der Markenarbeit war es, intern und extern ein attraktives, zukunftsfähiges und dabei glaubwürdiges Klinikbild zu schaffen. Der erste Schritt führte dabei in die einzelnen Kliniken und zu den Mitarbeitern: Sie mussten als Erste überzeugt werden, dass eine tragfähige Dachmarke ein Gewinn für die einzelnen Häuser ist. Schließlich sind die Mitarbeiter und Wissenschaftler wichtige Multiplikatoren, um die Markenwerte glaubwürdig zu transportieren zu Patienten, Einweisern, Mitarbeitern, Wissenschaftlern und Studenten, Krankenkassen und Verbänden. Und natürlich sind die Markenwerte die Grundlage des neuen Corporate Designs, das anschließend entwickelt wurde. Eine Chance, das eigene Bild zu formen Das Ziel des neuen Corporate Designs war die Entwicklung eines belastbaren Images in der Öffentlichkeit erweitertes Re-Design lautete das Zauberwort. Damit wurde der Rahmen für das neue Erscheinungsbild der Uniklinik Köln abgesteckt: Logo, Typographie, Farben, Formate, Papiere wurden auf den Prüfstand gestellt und für ein überzeugendes visuelles Gesamtbild neu interpretiert. Dieser Wandel hatte ganz bewusst einen sichtbar neuen Auftritt im Blick, eine deutliche, auch für Außenstehende erkennbare Veränderung. Die aktive Fortentwicklung der eigenen Marke verstand man bei der Uniklinik Köln als Chance, das eigene Bild selbst zu formen und nicht wie bisher der fremdgesteuerten Dynamik von Öffentlichkeit oder Medien zu überlassen. Wir haben in diesem Prozess gelernt, so Blattmann, dass unsere fachlichen Leistungen nicht nur überzeugen, sondern auch überzeugend kommuniziert werden müssen.
11 11 1x volltanken, 2x Silikon, bitte... Der Medizintourismus ist zu einem einträglichen Wirtschaftszweig geworden zumindest in den grenznahen Gebieten Tschechiens und Polens. Ratlos schauen deutsche Mediziner zu und träumen derweil von den Petrodollars der Ölscheichs. Die bekommen allerdings nur wenige, und wie lange, ist ohnehin fraglich. Vielleicht sollten die begehrlichen Blicke ja in die Schweiz wandern, oder man wartet einfach ab. Denn die Preise im Osten steigen schon wieder. Kerstin Sauer hat den klaren Durchblick: Für 900 Euro ließ sie sich in Usti nad Labem, Tschechien, die Augen lasern. Bei einem deutschen Spezialisten wäre die Behandlung dreimal so teuer gewesen. Die Empfehlung hatte ich von meinem Augenarzt, der gebürtiger Tscheche ist, sagt Kerstin Sauer und hat inzwischen schon drei Kolleginnen an die tschechischen Ärzte vermittelt. Allerdings steigen die Preise dort aufgrund der hohen Nachfrage: Wer heute ohne Brille scharf sehen will, zahlt inzwischen Euro für die Behandlung und muss sich in eine Warteschlange einordnen. Medizintourismus ist also offenbar eine Wachstumsbranche: Die östlichen Nachbarn Tschechien, Ungarn, Polen locken nicht mehr nur mit billigen Zigaretten und Schnaps, sondern auch mit medizinischen Schnäppchen. Wie viele Deutsche sich hier behandeln lassen, weiß niemand ganz genau. Aber zumindest in grenznahen Gebieten dürften die Kassen klingen. Dabei könnte das deutsche Gesundheitssystem solche Geldspritzen gut gebrauchen. Doch für einheimische Patienten zählt der hoch gelobte Medizinstandort Deutschland kaum: Der Preise wegen reisen sie lieber gen Osten, um einen netten Urlaub mit einer billigen Behandlung zu verbinden. Beispiel Zähne: Ein Vollimplantat kostet hier zwischen und Euro, in Polen oder Tschechien aber nur zwischen und Euro. In Ungarn sind bei Behandlungen Einsparungen zwischen 50 und 70 Prozent möglich. Solche Angebote verkaufen sich prächtig, wenn Kliniken, Reiseveranstalter, Freunde oder Familienangehörige den Patienten eine simple Rechnung präsentieren: Behandlung plus Urlaub zusammen sind preiswerter als die Eingriffe zu Hause. So wird der Zahnarztstuhl vom Marterpfahl zum Schnäppchenparadies. Keine Angst vor Marketing! Das Problem ist einfach, dass sich medizinische Leistung allein schlecht verkauft, sagt Monika Rulle, Juniorprofessorin für Gesundheitstourismus an der Universität Greifswald. Trotzdem entziehen sich Kliniken und Ärzte oft dem Marketing. Weite Kreise im öffentlichen Gesundheitssektor sehen Marketing irrtümlich als Luxus oder als kontraproduktiv an und nicht als cleveres Effizienzsteigerungs-Programm, sagt Gerhard F. Riegl, Leiter des Augsburger Institutes für Management im Gesundheitsdienst. Viele Kliniken und Praxen hätten auch Angst vor einer Folge des Marketings. Denn es könnte zu einem Ansturm auf die Institutionen kommen, mit dem die Logistik durcheinandergerät und das Personal überfordert ist. Einige Kliniken haben es trotzdem versucht. Erfolgreich. So hat sich das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf auf die Behandlung von Menschen aus dem arabischen Raum spezialisiert. Mit einer Station, auf der das Personal fremde Sprachen versteht, auf der es einen Gebetsraum und zur Religion passendes Essen gibt. Zum Wohlfühlprogramm gehören dort auch arabische Zeitschriften und Fernsehsender. Für uns ist mit diesen Patienten ein neuer Markt entstanden, sagt Mathias Goyen, Leiter der Unternehmenskommunikation des Krankenhauses. 600 internationale Patienten werden pro Jahr betreut. Das bringt einen Umsatz von 4 Millionen Euro. Immerhin ein Prozent des Gesamtumsatzes. Allerdings wird dieser Trend schätzungsweise nur fünf bis sechs Jahre andauern. Dann seien die Krankenhäuser in den Ländern selbst für solche Eingriffe ausgerüstet. Bis dahin aber reisen ganze Familien nach Deutschland. Der Patient genießt Luxus im Krankenhaus, Kind und Kegel werden in noblen Hotels untergebracht und verbringen ihre Zeit mit Shopping und Sightseeing. Die Stadt Hamburg profitiert davon. Im Jahr werden in Hamburg beispielsweise 30 Privatjets gewartet, während die Eigentümer in der Klinik sind, so Mathias Goyen. Doch nicht nur Scheichs sollen sich auf den Weg in deutsche Krankenhäuser machen. Auch gut betuchte Bürgerschichten und Beamte aus dem arabischen Raum gehören zur gewünschten Klientel. Die deutschen Medizinanbieter nutzen beispielsweise die Arab Health, die zweitgrößte Medizinmesse der Welt, um Kontakte aufzubauen. Anzeigen in Fachjournalen machen auf den deutschen Medizinstandort aufmerksam, Ärzte aus Hamburg operieren für einige Zeit vor Ort, gewinnen so weiter an Ansehen. Für uns ist die Zusammenarbeit mit Konsulaten und Botschaften sehr wichtig, da viele Leute sich dorthin wenden, wenn sie Hilfe brauchen, sagt Mathias Goyen. Für das Hamburger Krankenhaus läuft das Geschäft. Aber: Oft steht der Aufwand für Weiterbildung und Umbauten gerade in kleineren deutschen Krankenhäusern in keinem Verhältnis zu dem, was hinterher dabei rauskommt, sagt Monika Rulle. Deshalb, so sagen verschiedene Studien, lassen sich gerade mal zwischen 0,3 und 2,7 Prozent ausländische Patienten in Deutschland behandeln. Insgesamt ist es aber momentan noch kein Boomgeschäft, sagt Hans-Jörg Freese, Sprecher der Bundesärztekammer. Wir bekommen von den Kliniken immer wieder zu hören, dass die Behandlung ausländischer Touristen eher ein Zubrot ist. Billigklinik unter Palmen Andere Länder zeigen, wie es geht. Die Lateinamerikaner verdienen mit behandlungswilligen Amerikanern etwa sechs Milliarden Dollar. Indien erwartet bis 2012 einen Umsatz von einer Milliarde Euro. Die asiatischen Länder ziehen nach. So wurden im Jahr 2003 in Thailand bereits mehr als ausländische Patienten versorgt. Tendenz steigend. Auch Kuba rüstet sich. Angebote für Hartwährungszahler gibt es wie Sand am kubanischen Strand. Vor allem für Augen- und Hautkrankheiten stehen Spezialisten bereit, genau wie für Schönheitsoperationen. Flyer in Bars, Restaurants oder an Rezeptionen machen normale Badetouristen auf die medizinischen Fertigkeiten der Kubaner aufmerksam. Oft reagieren die Ausländer und reisen kurze Zeit später zurück, um sich dann operieren zu lassen. Besonders clever: Unter dem Dach von Cubanacan Turismo y Salud sind beispielsweise Krankenhäuser, Apotheken und Spezialkliniken vereint. Um es ganz einfach zu haben, gehört gleich noch Kubas größte Hotelkette dazu; wie hier gegenseitig vermittelt wird, liegt auf der Hand. Unterstützung kam auch von prominenter In Deutschland lassen sich gerade mal zwischen 0,3 und 2,7 Prozent ausländische Patienten behandeln. Seite. Fußballstar Diego Maradona ließ sich auf Kuba behandeln. Die Regierung berief eine Pressekonferenz ein, Diego überschlug sich in seiner Rede vor Begeisterung, viele ließen sich davon anstecken und später auf der Karibikinsel behandeln. Kliniken in Deutschland verlassen sich dagegen nicht auf Stars, Sternchen und Flyer, sondern setzen auf professionelle Patienten-Vermittlungsagenturen. Davon gibt es einige in Deutschland, die unter anderem versuchen, die rund 15 Millionen Russen zu erreichen, die sich eine medizinische Behandlung im Ausland leisten können. Wegen langer OP-Wartelisten auf der Insel suchen auch immer mehr Briten medizinischen Beistand in Germany. Ein großer Markt ist außerdem Nigeria, sagt Kathrin Pensold von der Vermittlungsagentur German Medicine Net. Auch aus Indien und Nepal haben wir schon Patienten vermittelt. Hier geht es weniger um preiswerte Behandlungen. Es hat verstärkt damit zu tun, dass spezielle und aufwendige medizinische Versorgungen in diesen Ländern oft nicht möglich sind, so Kathrin Pensold. Aber auch andere Möglichkeiten des Medizintourismus bieten sich an. So kooperiert die Universität Kiel beispielsweise mit norwegischen Krankenhäusern. Operationen, für die in Skandinavien die Experten fehlen, werden in Deutschland durchgeführt. Oder: Mit Hilfe des Stuttgarter Universitätsklinikums wird in Dubai ein Lehrkrankenhaus betrieben. Deutsche Ärzte arbeiten dort ein halbes Jahr oder länger und bilden ihre Kollegen aus, im Gegenzug werden Kranke, die wegen unzureichender Diagnose- und Therapieeinrichtungen nicht behandelt werden können, nach Stuttgart geschickt. Die Kliniken in Aachen verzeichnen viele Patienten aus dem nahen Holland. Dort sinkt die Zahl der Ärzte. Und: Eine Schweizer Versicherung schickt ihre Patienten ganz bewusst nach Deutschland. Denn hier ist der Einsatz einer künstlichen Hüfte etwa um Euro preiswerter, eine Bypass-Operation sogar um Euro günstiger als im Heimatland. Die Schweizer hoffen mit dieser Arbeitsweise ihr Gesundheitssystem zu sanieren. Und loben die deutsche Medizin und die deutschen Ärzte in hohen Tönen. Wie diese Kontakte zustande kamen, behalten die Schweizer dann aber doch lieber für sich. Für sie zählt nur eins: die deutschen Angebote nutzen, genau so, wie die Deutschen die Angebote in Tschechien nutzen.
12 12 Vorsicht, Krise! Wenn Krankenhäuser und Hospitäler durch innere oder äußere Einflüsse in kritische Situationen geraten, gilt es schnell, sicher und sachkundig zu reagieren. Ein belastbares Konzept für die Krisenkommunikation sollte deshalb so selbstverständlich für jede Klinik sein wie Tupfer, Schere, Spritze. Plötzlich ist sie da keiner hat sie vorhergesehen oder gewollt: die Krise, der Worst Case, die Katastrophe. Der Tag ist noch jung und schon grüßen die übergroßen Lettern der Schlagzeilen. Verschwundener Patient lag tagelang tot im Technikraum! Chirurg mit Hepatitis B soll 44 Patienten operiert haben. Infusion verwechselt Baby stirbt in Uniklinikum. Gesundheit ist ein hohes Gut und entsprechend groß das Medieninteresse, wenn es um Fehler, Skandale und Unglücke geht. Das Bestiarium der Krisenursachen kann so vielfältig wie Frankensteins Werkzeugkoffer sein und keine Krise gleicht der anderen. Die häufigsten Auslöser sind erfahrungsgemäß Unfälle, Kunstfehler und menschliches Versagen. Aber auch systematisches Fehlverhalten im Management, Unzufriedenheit unter Mitarbeitern oder Sabotage gehören dazu, wie auch Finanzkrisen in Kliniken, Unglücke, Havarien. In all dem steckt der Keim der Krise. Gut beraten sind die Kliniken, die neben einem technischen Notfallplan auch einen für die Kommunikation in der Schublade haben. Denn auf den Publicity-GAU sind nur die wenigsten Krankenhäuser und Kliniken vorbereitet. Selbst eine systematische Öffentlichkeitsarbeit gibt es in vielen Hospitälern praktisch nicht. Dabei zeigt die Erfahrung: Ist die schlechte Nachricht erst einmal auf dem Informationsmarkt, kann man selbst mit Fakten und Expertensicht nur bedingt gegensteuern. Bad news are good news. Sicher ist, dass negative Schlagzeilen und andere Krisensituationen weit reichende Folgen für Krankenhäuser und Kliniken haben können. Der gute Ruf, das über lange Jahre aufgebaute Vertrauen der Öffentlichkeit und die Loyalität der Mitarbeiter können darunter leiden und langfristig Schaden nehmen: Rückgang der Patientenzahlen, sinkende Mitarbeitermotivation, Entschuldigungsanzeigen, Entschädigungen et cetera, et cetera. Jetzt helfen keine neuen Logos mehr, auch nicht Lippenbekenntnisse oder eine schnelle Spendenaktion für einen guten Zweck. Zielführender und wirtschaftlich sinnvoller wäre die rechtzeitige Investition in ein belastbares Krisen- Managementkonzept gewesen. Denn vor allem im Gesundheitswesen gilt: Wer sich auf Krisen nicht vorbereitet, handelt fahrlässig. Krisenbewusstsein schärfen Professionelles Kommunikationsmanagement bewältigt und bearbeitet Krisen so, dass Imageschäden minimiert oder ganz vermieden werden. Zudem federt kontinuierliche Medienarbeit die Auswirkungen von Krisen ab, indem sie einen Vertrauensvorschuss in der Öffentlichkeit aufbaut und das ist eminent wichtig. Denn Journalisten reagieren in ihrem Bestreben nach Aktualität und Exklusivität besonders schnell und gern auf ein krisenfähiges Gerücht. Ihr Geschäft mit Informationen ist knallhart und geht in aller Regel zu Lasten der betroffenen Kliniken. Ein erster schwieriger Schritt zur aktiven Krisenkommunikation ist der Umdenkprozess im Unternehmen Krankenhaus. Will sagen: Im Klinikum muss ein Gefühl für die eigenen Schwächen entstehen und ein Gefühl für die Empfindlichkeiten seiner gesellschaftlichen Umgebung. Das Zauberwort heißt dabei Prävention: Der Krisenjob beginnt nicht erst, wenn die Krise eingetreten ist, sondern lange zuvor. Sie wird damit zu einer Fortsetzung des Alltäglichen freilich in einer besonders extremen Situation. Hierfür gibt es verschiedene Maßnahmen, die ergriffen werden können (siehe Kasten). Kommunikation ein Produktivfaktor Zwar ist jede Krise einmalig, dennoch lassen sich meist typische Verlaufsmuster erkennen. Durch reaktionsschnelle, offene und vertrauensvolle Kommunikation ist man jedoch in der Lage, die aufgetretenen Probleme zu steuern sowie die Intensität und Dauer in ihren Auswirkungen abzuschwächen. Da wäre als Erstes die überraschende Variante zu nennen. Sie trifft das Haus wie aus heiterem Himmel. Der Skandal: Mehrere Angestellte der Klinik haben Medikamente gestohlen, verkauft und sich mit dem Geld in Richtung Malediven aufgemacht. In einem solchen Fall ist schnellstmögliche Aufklärung gefordert. Das Klinikum muss nach außen zeigen, dass die Aufklärung, sei es mit oder ohne Staatsanwaltschaft und Polizei, erste Priorität besitzt und massiv betrieben wird. Natürlich dürfen in dieser Situation bei den Schuldigen auch Köpfe rollen. Ein Blick in die Zukunft ist durchaus erlaubt. So etwas darf und wird es in Zukunft nicht mehr geben! Noch unliebsamer ist die Variante schleichender Verlauf. Tritt sie zutage, bedeutet das richtig Ärger. Denn sie bedeutet nichts anderes, als dass bereits seit Jahren etwas in dieser Klinik zum Himmel stank und Kontrollmechanismen nicht gegriffen haben. Eine mögliche Schlagzeile könnte hier lauten: Patienten zu unerlaubten Medikamentenexperimenten missbraucht, und die stereotype wie nutzlose Antwort der Verantwortlichen: Davon war uns nichts bekannt. Hier sollte offensiv reagiert werden, und zwar mit höchster Transparenz. Kliniken, Krankenhäuser oder Hospitäler sollten gegenüber Journalisten eine aktive Rolle einnehmen. Kurze und knappe Maßnahmen, die zur Vorbereitung auf Krisen wichtig sind: Einrichtung eines Krisenstabes mit klarer Zuweisung von Kompetenzen (z. B. Definition von Sprecherrollen) Regelmäßige Schulung der Mitglieder des Krisenstabes insbesondere Mediatraining von Vorstand, Unternehmensleitung, Kommunikationsverantwortlichen Erstellen eines Krisen-Handbuches unter anderem mit Anschrift, Telefon, Telefax, von Krisenstab, Vorstand, Unternehmensführung, Partnern, Behörden, Verbänden etc., Detailplanung aller Kommunikationsschritte, unternehmensinternes Krisenablaufschema Ausarbeitung eines Argumentariums als verbindliche Sprachregelung inklusive Hinweisen zum Umgang mit Journalisten, Behörden, Partnern etc. Aufbau und Aktualisierung eines Presseverteilers regional, überregional Aufbau und Pflege eines Netzwerkes an Medienkontakten Erstellen einer Krisen-Website die bei Bedarf online gestellt werden kann - als Informationsquelle für Journalisten Stand-by-Pressemappe mit Basistexten, Factsheets, Statements zur Information im Krisenfall dann jeweils Ergänzung um aktuellen Text Die Karten gehören schonungslos offen auf den Tisch. Wer durchs Feuer gehen muss, tut dies am besten schnell und zielgerichtet. Wer stehen bleibt und abwartet, verbrennt sich unter Garantie die Finger die Geschichte wird zur Never-ending-Story. Die dritte Form ist die wiederkehrende Krise. Sie muss nicht unbedingt unheimlich wuchtig erscheinen. Spart sich das Gesundheitssystem zu Tode?, wäre eine klassische Frage für diesen Fall. Ein Abebben der Diskussion heißt hier nicht, dass die Krise überstanden, sondern nur, dass sie durch eine Ruhephase unterbrochen ist. Keine Krise kann und wird man jemals aussitzen können. Dennoch gilt langfristig: Genauso wie jede Krise einmalig ist, genauso spricht irgendwann kein Mensch mehr darüber und die Journalisten stürzen sich auf das nächste Thema, den nächsten Skandal, die nächste Krise. Kommunikation in der Krise Ist die Krise da, heißt es die Ärmel hochkrempeln und schnell handeln nicht nur für die Haustechnik, sondern vor allem für die Kommunikationsverantwortlichen. Ein Pressesprecher oder der Krisenstab muss dabei unbedingt die Form wahren: Die eigene Sicht der Dinge darf nicht dominant sein, man muss auch mit anderen Meinungen rechnen und diese mitdenken. Der Zoff ist ohnehin vorprogrammiert. Auf gar keinen Fall sollte man überhaupt nicht reagieren, sich an Spekulationen beteiligen, in irgendeiner Form flapsig reagieren, den Vorfall ins Lächerliche ziehen oder andere beschuldigen. Ehrlichkeit ist das Gebot der Stunde. Auch oder gerade in der Krise sollten sich Krankenhäuser des gesamten Instrumentariums erfolgreicher PR-Arbeit sowie der Mithilfe durch Agenturen bedienen. Die wichtigsten Multiplikatoren sind dabei die Mitarbeiter und die Journalisten. Sie sollten immer up to date sein, denn sie sind in der Lage, aus dem Elefanten wieder eine Mücke zu machen. Kaum ein Krankenhaus oder Klinikum besitzt die Manpower und Erfahrung, die umfangreichen Maßnahmen im Krisenfall erfolgreich umzusetzen, das Tagesgeschäft setzt schließlich andere Prioritäten. Es ist daher sinnvoll, sich professionelle Hilfe von außen zu holen. Damit sind kleinere und größere Kliniken in der Lage, selbst schwierigste Situationen zu bewältigen. Ein Fall, der kurz schildern soll, wie Kommunikation professionell ablaufen kann geschah im August Ein privat geleitetes Klinikum in Nordrhein-Westfalen war in die Kritik geraten, sich Schnitzer in der Pflege zu erlauben. Es gebe Fehldiagnosen, reichlich Organisationspannen und keine ausreichende Personaldecke. Klinikleitung, Ärzte und Pressesprecherin agierten offensiv, gestanden Fehler ein und versprachen, die Missstände umgehend zu beseitigen. In internen Sitzungen mit Ärztekammer und Gesundheitsamt wurden innerhalb von 14 Tagen die Fehler analysiert und beseitigt. Den Mitarbeiterbrief verteilten die Krankenhaus-Oberen persönlich an die Angestellten und nach knapp vier Wochen sprach kaum jemand mehr von einer Krise. Denn es gilt: Jede Krise mag zuerst eine Gefahr sein. Zugleich ist sie aber auch die Chance, Strukturen zu ändern, Fehlerquellen zu beseitigen und so gestärkt aus der Krise hervorzugehen nicht zuletzt, um auf die nächste kritische Situation vorbereitet zu sein.
13 13 Die Stunde der Sponsoren Gute Drähte zur Politik sicherten den Kliniken über Jahrzehnte hinweg ihr Auskommen. Doch seit diese Basis mit jeder Gesundheitsreform stärker bröckelt, sind neue Konzepte gefragt. So könnten etwa private Spender die Finanzprobleme der Kliniken lösen helfen. Sofern man sie gewinnen kann. In Amerika sind privat gestiftete oder kofinanzierte Gesundheitsprojekte keine Seltenheit. Die renommierte Betty-Ford-Klinik in Kalifornien geht auf eine Initiative der ehemaligen First Lady an der Seite von Gerald Ford zurück. John D. Rockefeller soll bis zu seinem Tod im Jahr 1937 eine Summe von damals sagenhaften 550 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke, vielfach auch für medizinische Forschung, ausgegeben haben. Und die Stiftung von Melinda und Bill Gates investiert gar Milliardenbeträge in medizinische Projekte auf der ganzen Welt. Professionalität tut Not In Deutschland war das medizinisch ambitionierte Mäzenatentum lange Jahre kaum der Rede wert. Auch, weil die staatlich alimentierten Kliniken es schlichtweg nicht nötig hatten. Ein paar Gesundheitsreformen später hat sich das grundlegend geändert. Am Universitätsklinikum Heidelberg erkannte man frühzeitig, wie wichtig eine professionelle Spendenwerbung ist. Eine Initiative von Professoren und Sponsoren rief die Heidelberger Stiftung Chirurgie ins Leben, um die anstehenden Probleme langfristig zu lösen. Der geplante Neubau der Chirurgischen Klinik ist das neueste Förderprojekt unserer Stiftung, sagt deren Geschäftsführerin Susanne Leist. Weil Krankenkassen und Staat immer weniger Mittel zur Verfügung stellen, ist so ein Projekt nur durch Eigeninitiative möglich. Gelänge es uns, die Hälfte der erforderlichen Baukosten, also rund 145 Millionen Euro, durch Spenden zu finanzieren, wäre das Land Baden- Württemberg bereit, vorzeitig die noch fehlende zweite Hälfte beizusteuern. Neben diesem Mammutprojekt finanziert die Stiftung, die bislang über Euro eingeworben hat, auch kleinere Forschungsprojekte und fördert jährlich zwei Jungmediziner durch das Lautenschläger-Ausbildungsstipendium, das durch Manfred Lautenschläger, den Aufsichtsratsvorsitzenden der MLP AG, finanziert wird. Der Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung hat sich schon mehrfach als Großspender für das Universitätsklinikum engagiert und unterstützte beispielsweise den Neubau der zukünftigen Angelika-Lautenschläger-Kinderklinik mit 13,8 Millionen Euro. Mäzene sind begehrt, aber knapp Ambitionierte Großspender wie Lautenschläger sind der Traum jeder Klinik. Entsprechend heikel ist es, die Mäzene zu gewinnen und zu halten. Denn auch wenn Publicity nicht das vordergründige Ziel der Spender ist, so dürfen sie doch zu Recht eine angemessene Würdigung ihres Einsatzes und des finanziellen Engagements erwarten. Für VIP-Spender heißt das, dass sie beispielsweise über einen gut erreichbaren Ansprechpartner immer auf dem neuesten Stand gehalten werden, möglichst auch vor der Öffentlichkeit. Erwähnt eine Klinik ihre Sponsoren in einem angemessenen Umfeld, kann das sich das auch positiv auf weitere potenzielle Spender auswirken. Denn dass immer mehr Vermögende sich für die Allgemeinheit engagieren möchten, ist abzusehen. Die Berliner Stiftung Charité konnte sich etwa über eine Fünf-Millionen-Spende der BMW- Miteignerin Johanna Quandt freuen. Die Stiftung will helfen, den Wandel der Charité vom klassischen Uniklinikum zu einem dynamischen Unternehmen mit Mehrnutzen für Patienten, Ärzte und Forscher voranzutreiben, begründete Johanna Quandt ihre Spende. Auch der SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp zieht es vor, seinen Wohlstand zu teilen. Über seine milliardenschwere Dietmar-Hopp-Stiftung fördert er seit zehn Jahren zahlreiche Projekte mit über 75 Millionen Euro, unter anderem mit einer 1,2-Millionen-Euro-Spende für ein Ultraschallgerät und einen Magnetresonanz-Tomographen in der Heidelberger Universitäts-Kinderklinik. Hopp sagt dazu: Unabhängigkeit bedeutet für mich, dass ich meine innere Überzeugung ausleben kann und meiner sozialen Verpflichtung nachkomme, der sich wie ich meine jeder Wohlhabende stellen muss. Doch solch große Achtungserfolge kommen fast nie aus heiterem Himmel. Sie erfordern entweder eine konzentrierte Spendenwerbung oder zumindest eine ambitionierte PR-Arbeit, die für die Bedürfnisse und Ambitionen einer Klinik eine breite Öffentlichkeit schafft. Weil die Zahl der Spender begrenzt ist und die Begehrlichkeiten vielfältig sind, muss zuerst ein begeisterungswürdiges Projekt vorhanden sein, für das sich ein Engagement gefühlsmäßig lohnt und die Rendite in Form von allgemeinem Nutzen groß ist. Ist eine große Projektidee in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen, kann auch die gezielte Spendenwerbung ein Erfolg werden. Und dabei gilt es, nicht nur nach den Millionen-Mäzenen zu schielen. Tragfähige Konzepte sind gefragt Natürlich suchen wir den Kontakt zu möglichen Großspendern, vor allem in der Region. Aber ein Großteil unserer Bemühungen zielt auch auf unsere Patienten, sagt Susanne Leist. Privatpatienten der Chirurgischen Klinik werden nach ihrem stationären Aufenthalt über die Stiftung informiert und erfreulich viele Patienten spenden aus Dankbarkeit für die medizinische Versorgung und weil sie sich für die nachfolgende Generation bessere Therapiemöglichkeiten erhoffen. Inzwischen hat sich der Erfolg der Heidelberger Stiftung herumgesprochen und Susanne Leist gab inzwischen schon mehreren Kliniken Starthilfe für eigene Initiativen zur Spendenwerbung. Ohnehin erstarkt der Deutschen Bürgersinn nicht nur bei den oberen Zehntausend. Das beweist das ambitionierte Projekt KUNO: Kinder-Uni-Klinik Ostbayern. Unter dem Motto Wir bauen unsere Kinderklinik selbst sammelt das Uniklinikum Regensburg seit 2003 sehr erfolgreich für einen Anbau an die bestehende Kinderklinik, in dem dann die erste Kinderklinik der höchsten Versorgungsstufe für Ostbayern entstehen soll. Von den erforderlichen 27 Millionen Euro sind inzwischen fast sieben Millionen zusammengekommen, womit der erste Bauabschnitt beginnen konnte. Darüber hinaus wurden Planungsleistungen im Wert von über Euro von den ausführenden Firmen kostenfrei erbracht und aus Konzerten, Versteigerungen und anderen Benefiz-Veranstaltungen kommen immer neue Erträge hinzu. Solche Erfolge machen Nachahmer neugierig. Deshalb werden in Zukunft die Kliniken die Nase vorn haben, die rechtzeitig mit tragfähigen Konzepten um private Sponsorengelder werben und potente Spender langfristig an sich binden. Das Heidelberger Uniklinikum hat eine praktikable Variante für die eigenen Gegebenheiten entwickelt: Mit einer fest angestellten Verantwortlichen wird die Spendenarbeit im eigenen Haus konsequent betrieben, vorrangig bei Privatpatienten. Flankierend wirbt die Heidelberger Stiftung um potente Einzelsponsoren, die bei Großspenden auch einen gewissen Publicity-Ertrag verzeichnen können, etwa durch die Namensgebung einer neuen Klinik. Ganz anders die Regensburger Idee: Hier wird bewusst auf breites Engagement und das Eigeninteresse der Bevölkerung am Kinderklinikprojekt gesetzt. Entsprechend sind die Events und Aktionen ausgerichtet und erfolgreich. Die Beispiele zeigen, dass es neben einer begeisternden Idee auch Mitarbeiter geben muss, die sich nicht nur so nebenbei um die Spendenwerbung kümmern. Gerade Großspender wollen angemessen betreut sein: auch nach der Spende. Je dicker der Scheck, desto größer ist das Interesse am Fortgang des Projektes. Dazu gehören auch die regelmäßige Medienpräsenz und eine möglichst wahrnehmbare Publikation der Erfolge und Fortschritte. Denn die Zeit läuft und die Verteilungskämpfe haben längst begonnen.
14 14 Wer bei der Einlieferung in die Klinik nicht schon bewusstlos war, tappte früher Eingecheckt statt eingeliefert trotzdem oft im Dunkeln: Weiße Halbgötter verwirrten die Patienten mit unverständlichem Kauderwelsch. Die von der Operation Geschwächten irrten planlos durch dunkle Klinikflure. Unfreundliche Schwestern servierten geschmacksneutrales Weichgekochtes auf abgestoßenen Tabletts. Und wer seinen Arzt oder Apotheker fragen wollte, konnte meistens lange warten. Hilflos ergab sich der Kranke im kargen Vierbettzimmer seinem Schicksal oder er wurde schon aus purer Verzweiflung gesund! So schlimm wird es in Zukunft wohl nicht mehr werden, denn der Patient gewinnt an Gewicht zumindest in den Kalkulationen der Krankenhäuser. In Zeiten von Zuzahlungen und den Individuellen Gesundheitsleistungen in der Fachsprache kurz IGeL genannt wissen sie, dass sie den Patienten nicht nur gesund machen, sondern auch noch gut behandeln sollten. Denn seine Meinung zählt als Konsument und Multiplikator. Neuland Patientenkommunikation Trotzdem war die Patientenkommunikation vor allem in den Krankenhäusern lange ein Im Krankenhaus der Zukunft werden Kranke zu Klienten. Mit einiger Verspätung wenden sich nun die Marketingstrategen auch der eigentlichen Zielgruppe zu: den Patienten.
15 15 vernachlässigtes Feld. Die Mängellisten der Experten sind dementsprechend lang: Noch im Jahr 2005 hatte längst nicht jedes Krankenhaus einen eigenen Webauftritt. Und wer sich doch ins Netz wagte, verbreitete dort nicht nur Information: Wo der Patient nach Orientierung, Aufklärung und Rat suchte, stieß er in vielen Fällen auf ein kommunikatives Chaos: Schlechtes Layout, schlechte Bilder, schlechter Text lautet die Kritik von Spezialisten und Patienten. Benutzerfreundliche Menüführung, für Laien verständliche Aufbereitung, einfache Standards wie Anfahrtsskizzen oder Sprechzeiten? Oftmals völlige Fehlanzeige! Wer krank ist, hat eh keine Wahl, wo der Blinddarm schmerzt, muss operiert werden so die unzeitgemäße Denke vieler Ärzte und Klinikbetreiber. So wundert es auch kaum, dass der allererste deutsche Fachkongress zum Thema Patientenkommunikation erst im Januar 2006 stattfand. Und trotzdem gleich eine große Resonanz auslöste: 250 Teilnehmer aus der Praxis, der Wissenschaft, von Universitäten und Patientenverbänden diskutierten zwei Tage lang in Berlin über eine effektivere Ansprache der Zielgruppe. Ein Folgekongress ist in Planung, gerade die Kliniken nähmen die Patienten zunehmend ernst, heißt es von Seiten der Veranstalter. Die Patienten können sich also auf bessere Zeiten freuen, kaum eine Klinik wird ihre Interessen in Zukunft ignorieren können. Je nach Größe, Ausrichtung und Philosophie des Krankenhauses werden dabei unterschiedliche Wege beschritten. Doch ohne überzeugendes Fischen im Netz wird es in Zukunft wohl kaum gehen. Viele Kliniken basteln an neuen Internetauftritten oder haben den Relaunch gerade hinter sich. Wie zum Beispiel das Uniklinikum Erlangen, das in verschiedenen Studien und Rankings regelmäßig für seinen Webauftritt gelobt wird. Wo früher 22 Kliniken eigenbrötlerisch und mehr oder weniger erfolgreich an ihrem Onlineauftritt strickten, gibt es nun einen einheitlichen Auftritt der gesamten Einrichtung. Und ein anwenderfreundliches und kostenfreies Content-Management-System, das es dem medizinischen Personal erlaubt, die Seiten selbst zu füllen und zu pflegen mit einigem Erfolg: In einer Studie der Universität Bonn aus dem Jahr 2005 landete der Internetauftritt der Erlanger Gynäkologen und HNO-Spezialisten souverän auf Platz eins. Diesen belegten die Franken auch im Oktober 2005 beim erstmals von Novartis Pharma ausgeschriebenen Wettbewerb Deutschlands Beste Klinik-Website mit dem Auftritt der Strahlenklinik: nicht zuletzt wegen ihres guten Serviceangebotes für die Patienten. So übersetzt dort ein ausführliches Glossar auch medizinische Fachbegriffe wie Abdomen ( Bauch, Unterleib ) oder Zystitis ( Blasenentzündung ) in verständliches Allerweltsdeutsch. Doch die Seiten füllen sich natürlich nicht von selbst, für einen guten Webauftritt müssen auch die medizinischen Experten mitziehen. Doch in Erlangen ist man inzwischen der Meinung, dass der Weg zum Patienten vor allem auch über den Datenhighway führt. Schon seit August 2003 gibt es dort einen Onlineredakteur in der Pressestelle und auch die Ärzte haben den Wert des Webs inzwischen begriffen: Aufgrund unserer neuen Website bekommen wir sicherlich dreimal so viele Patienten aus dem Norden Deutschlands, aus der Schweiz und Österreich, sagt Dr. Klaus Bumm von der HNO-Klinik. Auch Marion Büchler, in der Medizinischen Klinik 1 verantwortlich für die Internetseiten, beobachtet einen starken Anstieg der Patientenanfragen, die sich gezielt auf Angebote und Informationen im Internetauftritt beziehen. Fernseharzt am Krankenbett Doch mit dem Werben im Web ist es für die Kliniken noch lange nicht getan: Vor allem während des Aufenthalts sehnt sich der moderne Patient nach Fürsorge, Orientierung und Ablenkung. Immer mehr Häuser setzen inzwischen auf Patientenfernsehen und schlagen so scheinbar zwei Fliegen mit einer Klappe. Der Gast kann Wartezeiten mit Unterhaltungsprogrammen überbrücken. Image- und Informationsfilme erklären Operations- und Behandlungsmethoden, stellen Klinikpersonal und Kantine vor. Im Katholischen Klinikum Mainz, wo das KIK-TV seit September 2005 auf Sendung ist, hat man damit gute Erfahrungen gemacht. Wir stellen das Haus, die Kliniken und das Personal vor. Wer neu ist, kennt die Ärzte dann schon aus dem Fernsehen, sagt Jürgen Will, Leiter des Verwaltungsmanagements des Klinikums. Vom Fernsehen übers individuelle Spielfilmprogramm zum Intranet theoretisch und technisch ist bei Patientenunterhaltung und -aufklärung auch in der Liegelage alles denkbar. Doch die Budgets sind eng geschnürt. Nicht alles, was machbar ist, ist auch möglich: Wir wollen die Patienten ja in erster Linie nicht unterhalten, sondern betreuen und behandeln, sagt Markus Lesch, Pressesprecher der Uniklinik Köln. Statt TV-Programm und Hochglanzzeitung bekommt hier jeder einen so genannten Casemanager zugeteilt, der von der Aufnahme bis zur Entlassung und sogar darüber hinaus Behandlung und Bedürfnisse der Patienten organisiert. In so einem großen Haus fühlen sich die Menschen verloren und überfordert. Jetzt haben sie immer einen persönlichen Ansprechpartner, der für Orientierung sorgt und alle Fäden in der Hand hält, sagt Lesch. Der Vorteil für die Klinik: Die Patienten seien zufriedener, Ärzte und Pfleger würden entlastet, doppelte Untersuchungen vermieden und am Ende werde Geld gespart! Knigge für Krankenhäuser Auf die persönliche Rundumbetreuung setzt seit Mai dieses Jahres auch der Gesundheitspark Bad Gottleuba. Hier heißen die Patienten längst Gäste, fünf persönliche Betreuer kümmern sich während des Aufenthalts um sie, vier Mitarbeiterinnen erfüllen im Service-Center auch telefonisch Sonderwünsche fernab der Medizin: Viele Gäste haben ganz persönliche Fragen und wollen beispielsweise wissen, ob ihr Lieblingstisch im Speisesaal noch frei ist, sagt Sandra Mettai, Leiterin des Service-Centers. Auch beim privaten Klinikunternehmen Asklepios setzt man vor allem auf Teamgeist und höfliche Umgangsformen. Als führend in Sachen Patientenkommunikation gilt dort die orthopädische Klinik Hohwald in der Oberlausitz. Nicht zuletzt der luxuriöse Schlüssel von 30 Ärzten auf 105 Belegbetten beschert den Sachsen immer wieder die Noten gut und sehr gut bei den regelmäßig durchgeführten Patientenumfragen. Stefan Härtel, seit 1998 Geschäftsführer, glaubt das Erfolgsgeheimnis zu kennen: Ein ansprechender Webauftritt, ausführliche und verständliche Flyer, luxuriöse Zimmer all das ist für uns Standard, aber kann die menschliche Kommunikation nicht ersetzen. Seine Mitarbeiter müssen deshalb nicht nur über exzellente Zeugnisse, sondern auch über eine gute Kinderstube verfügen. Gerade bei der Patientenkommunikation bringt schon die Beachtung simpler Umgangsformen eine Menge, sagt Härtel. Dass Sozialkompetenz zur Medizin gehört und der Patient ein Mensch und nicht nur ein Meniskus ist, hat sich sogar bis in die Hörsäle der Universitäten herumgesprochen. So setzt der Reformstudiengang Medizin an der Charité schon von Beginn an auf Patientenbegegnungen und bekommt dafür gute Noten. Ein anderes Projekt des größten europäischen Krankenhauses ist dagegen scheinbar nicht ganz aufgegangen: Die Charité-Collection mit Jacken, Uhren und Handtüchern ließen die Patienten meist links liegen. Zum Shoppen kommt dann eben doch keiner ins Krankenhaus. Geschmackvoll genesen Interview Der zunehmende Wettbewerb auf dem Gesundheitsmarkt hat auch bei den Bauplanern zu einem Umdenken geführt: Ein angenehmes Ambiente kann, so die neue Überzeugung, Patienten leichter in die Klinik locken als der beste Flyer. Schrecklich, geschmacklos das sind noch die netteren Beschreibungen vieler Krankenhäuser. Ästhetik sah lange anders aus: Anonyme Funktionsbauten schossen bis vor ein paar Jahren haltlos in die Höhe, an Hässlichkeit und Pragmatismus nur noch übertroffen von den Wohnsilos am Mümmelmannsberg und den Neubauten in Marzahn. Dass Masse nicht immer gleich Klasse ist, der Patient zunehmend auch als Klient gesehen werden muss das alles ist inzwischen bekannt. Oft bleiben, so sagen Studien, störende Einrichtungsdetails den Patienten sogar stärker in Erinnerung als Wartezeiten oder schrullige Ärzte. Verstärkt versuchen Klinikbetreiber nun, auch die Architektur für sich sprechen zu lassen, nicht nur mit medizinischer Kompetenz, sondern auch mit Mahagoni um die Behandlungsbedürftigen zu werben. Die Baubranche im Gesundheitssektor boomt. Vor allem im Bereich jenseits der Akutmedizin wird der Wohlfühlfaktor für viele Patienten zunehmend zum Entscheidungskriterium. Viel zu tun also für die Bauherren und Architekten. Und für Deutschlands Expertin Nummer eins: Christine Nickl-Weller. Die 1951 geborene Bayerin leitet seit 2004 das einzige deutschsprachige Fachgebiet Entwerfen für Krankenhäuser und Bauten des Gesundheitswesens an der Technischen Universität Berlin. Zusammen mit ihrem Mann leitet sie außerdem das international auf Gesundheitsbauten spezialisierte Architektenbüro Nickl & Partner in München und berät Kliniken in der ganzen Welt. Im Sommer erscheint ihr gemeinsames Buch: Krankenhausarchitektur für die Zukunft. Kinderklinik Weiden. Viel Licht, warme Materialien und angenehme Farben dominieren den Klinikbereich und schaffen eine Atmosphäre, die vom typischen Krankenhausflair weit entfernt ist. Daneben ist die Gestaltung besonders kindegercht und auf die Bedürfnisse der jungen Patienten ausgerichtet. Frau Nickl-Weller, wie sieht das Krankenhaus der Zukunft aus? Hell, lichtdurchflutet und freundlich. Mit warmem Material wie Holz statt Linoleum. Tageslicht statt Neonröhren. Auch im Krankenhaus sollte eine Atmosphäre herrschen, in der sich der Patient wohl fühlen kann. Mich haben zum Beispiel die Zuschnitte der Zimmer immer gestört: sehr tiefe, schmale Räume mit bis zu vier Betten hintereinander. Das klingt nach einer guten Raumausnutzung und zum Wohlfühlen wird man ja auch nicht eingeliefert. Was ist das Problem? Im Krankenhaus sind die Patienten sowieso in einer Ausnahmesituation. Diese wird im Moment durch die Architektur noch verstärkt. Zum Beispiel sind die Schränke oft an einer Wand aufgestellt. Wer ganz hinten am Fenster liegt und ängstlich ist, muss sich ständig sorgen, ob jemand in seinen Sachen wühlt. Das ist eine psychische Belastung. Welche architektonischen Trends sehen Sie noch, durch die sich moderne Kliniken von der Konkurrenz abheben und auch bei den Patienten punkten können? Der Arzt sollte zum Patienten kommen und nicht umgekehrt. So geschieht es schon jetzt in Kinderkliniken. Es ist wichtig, die Wege zu verkürzen und Kompetenzen zu bündeln und auch die Bereiche Krankheit und Gesundheit stärker zu trennen. Ein Beispiel: Ich baue gerade die Uniklinik in Hamburg-Eppendorf um, eine riesige Anlage im Pavillonstil. Hier wird es nun ein Kompetenzzentrum für die chirurgischen Kliniken geben. Auf einer anderen, separaten Ebene findet der Patient Läden und Shops, die Apotheke und die Kirche. Hier kann er sich auch mal zerstreuen und entspannen und wird nicht ständig mit seinem Leiden konfrontiert. Ein Krankenhausarchitekt sollte also nicht nur die klinischen Abläufe, sondern auch die Patienten im Blick haben? Auf jeden Fall. Das Gesundheitssystem hat sich sehr verändert. Die Liegezeiten im Intensivbereich verkürzen sich, die großen Bettenzahlen werden in Zukunft wohl nicht mehr gebraucht. In den ersten Tagen nach einer Herz-OP ist einem das Ambiente sicher egal, später kann ein sinnvoll und schön gestaltetes Zimmer die Stimmung heben. Das nehmen auch die Patienten wahr. Hier wird eine angenehme Architektur durchaus zum Wettbewerbsvorteil. Nicht jede Klinik kann neu bauen wie kann man auch mit kleineren architektonischen Mitteln die Situation verbessern? Ein angenehmes Licht ist meiner Meinung nach zentral. Bisher wurde auch in den Patientenzimmern das Licht nur auf die Untersuchungen ausgelegt. Aber zum Lesen reicht doch eine kleine Lampe. Und was spricht dagegen, freundliche Farben zu verwenden oder eine fröhliche Motivtapete? Oder ein separates Esszimmer für die mobilen Patienten einzuplanen? Eine Nacht im Krankenzimmer kostet so viel wie im Luxushotel da kann man als Patient schon etwas erwarten. Und das wird er in Zukunft auch.
16 16 Saugen, Schwester. Die Zahlen, Herr Doktor... Hinterm Horizont Die Fernsehärzte auf deutschen Kanälen sind In deutschen Arztserien dürfen Ärzte noch immer Halbgötter sein, schon ein halbes Jahrhundert lang. Die wahren Blut-, Schweiß- und Tupfergeschichten kommen aus Übersee und treffen seltsamerweise auch die deutsche Realität recht gut. mehr als 40 Stunden pro Woche auf Sendung. Auch dabei zeigt sich, wie weit TV und Realität auseinanderklaffen: Welcher Arzt hat schon eine 40-Stunden-Woche? Die erste Arztserie überhaupt lief natürlich in Amerika begründete die Serie Medic das Genre der medical dramas im US-TV. Gleich zu Beginn löste Medic heftige Diskussionen aus, weil zum ersten Mal Operationen und Geburten auf der Mattscheibe zu sehen waren. Monoton klickt das Pulsmessgerät. Tupfer. Noch ein Tupfer. Saugen, Schwester. Mehr saugen, sprach Professor Brinkmann ruhig, aber bestimmt. Von der Patientin sah man nur den adrett gescheitelten Kopf. An den Tupfern klebte etwas Blut. An Brinkmanns Gummihandschuhen nicht. So schön war Fernsehen einmal. So schön war die Schwarzwaldklinik im malerischen Glottertal. Im wahren Leben gehen die Ärzte auf die Straße, um gegen die Arbeitsbedingungen an deutschen Kliniken zu protestieren. Im deutschen Fernsehen werden die Patienten unterdessen gewohnt perfekt versorgt und zwar von Lichtgestalten wie Professor Brinkmann: entspannt und fachlich ausgezeichnet, ethisch einwandfrei, freundlich und einfühlsam. Beispiele aus dem Fernsehalltag: Wie ist die Anamnese?, fragt der Oberarzt seinen Kollegen in der ARD-Arztsoap In aller Freundschaft und starrt auf die Röntgenbilder einer Mittvierzigerin. Wenn uns nichts einfällt, müssen wir ihr Bein amputieren, antwortet der. Aber die Frau steht noch mitten im Leben, ruft daraufhin entsetzt die behandelnde Ärztin. Und weil das nicht von der Hand zu weisen ist, wird das Bein gerettet, durch einen komplizierten Bypass, den die Drehbuchschreiber wohl auch gleich an der medizinischen Realität vorbei gelegt haben. Natürlich sind die deutschen Fernsehdoktoren nicht nur fachlich top, sondern emotional erstaunlich auf Zack. Die Ärzte von Alphateam Lebensretter im OP (Sat.1) haben in einer Folge nicht nur ausreichend Zeit, alle Patienten zu heilen, sondern auch eine Geburtstagsparty für den Assistenzarzt zu inszenieren und zwei Geschwister zu versöhnen, von denen die eine erblindete, weil die andere zu schnell fuhr. Respekt! Aber nicht nur die emotionalen Fähigkeiten deutscher TV-Ärzte lassen uns staunen. Auch ihr Arbeitsumfeld wirkt inzwischen fast surreal und ist tatsächlich wohl nur noch im Fernsehen präsent. Chefarzt Brinkmann sah man nie stundenlang am Computer Patientendaten eintippen oder nach 24-Stunden-Schichten erschöpft nach Hause schleichen. Für den einzelnen Patienten nahm sich Brinkmann so viel Zeit, wie ein moderner Klinikarzt für 20 Kranke zur Verfügung hat. In Alphateam ist die Notaufnahme nachts personell recht luxuriös ausgestattet, irgendein Medizinmann ist immer da, wenn wieder ein schwerer Fall hereingerollt wird. Und auch das Labor scheint stets besetzt. Fernsehmediziner streiken nicht. Dienstverweigerung gibt es beim deutschen TV-Arzt bestenfalls aus tief emotionalen Gründen. In der ARD-Alpenklinik flüchtet der attraktive Chirurg Dr. Guth nomen est omen aus Berlin ins salzburgische Lofer, weil ihm der Bruder unterm Skalpell wegstarb. Kunstfehler, glaubt Dr. Guth und will sich für immer vom OP- Tisch zurückziehen. Gottlob überwindet er das Trauma rasch vor malerischer Bergkulisse und auch der Kunstfehler war natürlich keiner. Der Doktor war nicht schuld. Die Heiligsprechung der deutschen TV-Ärzte begann in den fünfziger Jahren, lange bevor wir Papst waren. Ob Sauerbruch, das war mein Leben, Roman eines Frauenarztes (beide 1954) oder Der Arzt von Stalingrad (1958): Stets ist der Arzt ein männlicher Heilsbringer in Weiß bei den Frauen erfolgreich, der Heimat verbunden. Daran ändert sich wenig, als in den Sechzigern die ersten TV-Serien gedreht werden. Landarzt Dr. Brock praktiziert von 1967 an in der Lüneburger Heide, 1968 wird dann im Hamburger Hafenkrankenhaus operiert. Schließlich kommt 1985 die Schwarzwaldklinik, Blaupause für Serien wie Der Landarzt und Der Bergdoktor. Hoffnung auf mehr Wirklichkeitsnähe keimte, als in den Neunzigern die erfolgreiche US-Serie ER Emergency Room nach Deutschland kam. Hier war die Notaufnahme hektisch, und es passierten Fehler. Hier starben nicht nur Patienten, sondern auch Ärzte. In der achten Staffel erlag der beliebte Dr. Greene einem Hirntumor. Wie Greene an seiner Unfähigkeit verzweifelte, sich selbst zu heilen, gehört zu den Höhepunkten des Genres. Auch filmisch schlug ER eine neue Richtung ein: rasche Schnitte, schnelle Schwenks, realistische OP-Aufnahmen mit der Handkamera. In deutsche Serien floss dieser neue Zugang nur oberflächlich ein. Zwar bemühten sich die Macher von Alphateam um eine ähnliche Erzählweise wie bei ER und zeigten, wie Chirurgen an Organen herumschneiden und dabei fluchen. Doch blieb der Arzt auch hier letztlich frei von Fehlern. Der Versuch, Humor in deutsche Fernsehkrankenhäuser zu bringen, scheiterte. Während die US-Serie Scrubs das Genre ironisch und geistvoll aufs Korn nahm, kalauerte sich bei RTL Nikola um Sinn und Verstand. Amerika ist da zwei Schritte voraus. Die Serie Grey s Anatomy kombiniert Realismus mit dem Zungenschlag von Sex and the City und schafft es so, dass die Geschichte um eine junge Ärztin und ihre Affäre mit dem Chefarzt nicht ausgelutscht wirkt. Im Glottertal wären die beiden längst verheiratet. Im Glottertal hätte es auch nie gemeine Ärzte gegeben. Der Gipfel an Menschenfeindlichkeit heißt hier Hildegard und ist Oberschwester, das restliche Personal ist auch unter Stress ununterbrochen freundlich. Ganz anders das Arzt- Patienten-Verhältnis in der preisgekrönten US- Serie Dr. House, die seit einiger Zeit auch in Deutschland läuft. Dort schnauzt Diagnostik- Koryphäe Gregory House die wartenden Patienten schon mal an: In Ihrem Fall könnte die Behandlung auch ein Affe übernehmen. Das wirft die Frage auf, was der Samstagsabend- Schimpanse Charlie in seiner Freizeit außerhalb der ZDF-Tierarztpraxis macht. Vielleicht Drehbücher schreiben? Für Menschenarztserien? Die deutsche Arztserie schlechthin war Die Schwarzwaldklinik. Ab 1985 wurden im Glottertal insgesamt sechs Serienstaffeln produziert mit 73 Folgen und zwei abendfüllenden Filmen. Als teuerste Arztserie gilt die amerikanische Produktion Emergency Room. Mit 10 Millionen Dollar Herstellungskosten verschlang bereits 1997 jede Folge so viel wie etwa 1700 Klinikärzte im Monat verdienen. Die derzeit beliebteste Arztserie im deutschen Fernsehen heißt In aller Freundschaft und hat jede Woche fast 6 Millionen Zuschauer. Die höchste Einschaltquote unter den deutschen Arztserien geht auf das Konto von Prof. Dr. Brinkmann: 1985 kurz nach dem Start des Privatfernsehens bannte seine Schwarzwaldklinik bis zu 28 Millionen Deutsche vor den Fernsehern und fegte die Straßen der Republik leer. Impressum Dresdner:Horizonte ist die Zeitung der Pleon GmbH, Dresden. Sie erscheint dreimal im Jahr und ist kostenlos. Herausgeber: Pleon Dresden, Dirk Popp (V.i.S.d.P.) Redaktion: Erik Braunreuther (Ltg.), Claudia Dietz, Johannes Honsell, Mathias Menzel, Maren Soehring, Ivette Wagner, Stefan Wiltzhaus Grafik: Michael Doerwald (Ltg.), Juliane Trinckauf Redaktionsadresse: Pleon Dresden, Goetheallee 23, Dresden, Tel , Fax redaktion@dresdner-horizonte.de Redaktionsschluss: Juli 2007 Lektorat: KorrekturService Sand, Landsberg a. Lech, Tel Druck: ELBTAL-Gruppe Druckerei & Kartonagen Kahle GmbH; Wir danken der Elbtal Druckerei, und dem KorrekturService Sand für die freundliche Unterstützung. Bildnachweis: getty, Hirslanden, istockphoto, Müller-Naumann, mev, Meyer, photocase, pixelquelle, plainpicture, Pleon, Steinhausen, sxc, Uniklinik Köln. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos übernehmen wir keine Haftung. Pleon im Internet:
Das Leitbild vom Verein WIR
 Das Leitbild vom Verein WIR Dieses Zeichen ist ein Gütesiegel. Texte mit diesem Gütesiegel sind leicht verständlich. Leicht Lesen gibt es in drei Stufen. B1: leicht verständlich A2: noch leichter verständlich
Das Leitbild vom Verein WIR Dieses Zeichen ist ein Gütesiegel. Texte mit diesem Gütesiegel sind leicht verständlich. Leicht Lesen gibt es in drei Stufen. B1: leicht verständlich A2: noch leichter verständlich
Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut wird, dass sie für sich selbst sprechen können Von Susanne Göbel und Josef Ströbl
 Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut Von Susanne Göbel und Josef Ströbl Die Ideen der Persönlichen Zukunftsplanung stammen aus Nordamerika. Dort werden Zukunftsplanungen schon
Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut Von Susanne Göbel und Josef Ströbl Die Ideen der Persönlichen Zukunftsplanung stammen aus Nordamerika. Dort werden Zukunftsplanungen schon
Leitbild. für Jedermensch in leicht verständlicher Sprache
 Leitbild für Jedermensch in leicht verständlicher Sprache Unser Leitbild Was wir erreichen wollen und was uns dabei wichtig ist! Einleitung Was ist ein Leitbild? Jede Firma hat ein Leitbild. Im Leitbild
Leitbild für Jedermensch in leicht verständlicher Sprache Unser Leitbild Was wir erreichen wollen und was uns dabei wichtig ist! Einleitung Was ist ein Leitbild? Jede Firma hat ein Leitbild. Im Leitbild
DER SELBST-CHECK FÜR IHR PROJEKT
 DER SELBST-CHECK FÜR IHR PROJEKT In 30 Fragen und 5 Tipps zum erfolgreichen Projekt! Beantworten Sie die wichtigsten Fragen rund um Ihr Projekt für Ihren Erfolg und für Ihre Unterstützer. IHR LEITFADEN
DER SELBST-CHECK FÜR IHR PROJEKT In 30 Fragen und 5 Tipps zum erfolgreichen Projekt! Beantworten Sie die wichtigsten Fragen rund um Ihr Projekt für Ihren Erfolg und für Ihre Unterstützer. IHR LEITFADEN
Pflegende Angehörige Online Ihre Plattform im Internet
 Pflegende Angehörige Online Ihre Plattform im Internet Wissen Wichtiges Wissen rund um Pflege Unterstützung Professionelle Beratung Austausch und Kontakt Erfahrungen & Rat mit anderen Angehörigen austauschen
Pflegende Angehörige Online Ihre Plattform im Internet Wissen Wichtiges Wissen rund um Pflege Unterstützung Professionelle Beratung Austausch und Kontakt Erfahrungen & Rat mit anderen Angehörigen austauschen
Eva Douma: Die Vorteile und Nachteile der Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit
 Eva Douma: Die Vorteile und Nachteile der Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit Frau Dr. Eva Douma ist Organisations-Beraterin in Frankfurt am Main Das ist eine Zusammen-Fassung des Vortrages: Busines
Eva Douma: Die Vorteile und Nachteile der Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit Frau Dr. Eva Douma ist Organisations-Beraterin in Frankfurt am Main Das ist eine Zusammen-Fassung des Vortrages: Busines
Alle gehören dazu. Vorwort
 Alle gehören dazu Alle sollen zusammen Sport machen können. In diesem Text steht: Wie wir dafür sorgen wollen. Wir sind: Der Deutsche Olympische Sport-Bund und die Deutsche Sport-Jugend. Zu uns gehören
Alle gehören dazu Alle sollen zusammen Sport machen können. In diesem Text steht: Wie wir dafür sorgen wollen. Wir sind: Der Deutsche Olympische Sport-Bund und die Deutsche Sport-Jugend. Zu uns gehören
Welches Übersetzungsbüro passt zu mir?
 1 Welches Übersetzungsbüro passt zu mir? 2 9 Kriterien für Ihre Suche mit Checkliste! Wenn Sie auf der Suche nach einem passenden Übersetzungsbüro das Internet befragen, werden Sie ganz schnell feststellen,
1 Welches Übersetzungsbüro passt zu mir? 2 9 Kriterien für Ihre Suche mit Checkliste! Wenn Sie auf der Suche nach einem passenden Übersetzungsbüro das Internet befragen, werden Sie ganz schnell feststellen,
Papa - was ist American Dream?
 Papa - was ist American Dream? Das heißt Amerikanischer Traum. Ja, das weiß ich, aber was heißt das? Der [wpseo]amerikanische Traum[/wpseo] heißt, dass jeder Mensch allein durch harte Arbeit und Willenskraft
Papa - was ist American Dream? Das heißt Amerikanischer Traum. Ja, das weiß ich, aber was heißt das? Der [wpseo]amerikanische Traum[/wpseo] heißt, dass jeder Mensch allein durch harte Arbeit und Willenskraft
40-Tage-Wunder- Kurs. Umarme, was Du nicht ändern kannst.
 40-Tage-Wunder- Kurs Umarme, was Du nicht ändern kannst. Das sagt Wikipedia: Als Wunder (griechisch thauma) gilt umgangssprachlich ein Ereignis, dessen Zustandekommen man sich nicht erklären kann, so dass
40-Tage-Wunder- Kurs Umarme, was Du nicht ändern kannst. Das sagt Wikipedia: Als Wunder (griechisch thauma) gilt umgangssprachlich ein Ereignis, dessen Zustandekommen man sich nicht erklären kann, so dass
Leit-Bild. Elbe-Werkstätten GmbH und. PIER Service & Consulting GmbH. Mit Menschen erfolgreich
 Leit-Bild Elbe-Werkstätten GmbH und PIER Service & Consulting GmbH Mit Menschen erfolgreich Vorwort zu dem Leit-Bild Was ist ein Leit-Bild? Ein Leit-Bild sind wichtige Regeln. Nach diesen Regeln arbeiten
Leit-Bild Elbe-Werkstätten GmbH und PIER Service & Consulting GmbH Mit Menschen erfolgreich Vorwort zu dem Leit-Bild Was ist ein Leit-Bild? Ein Leit-Bild sind wichtige Regeln. Nach diesen Regeln arbeiten
Vertrauen in Medien und politische Kommunikation die Meinung der Bürger
 Vortrag Vertrauen in Medien und politische Kommunikation die Meinung der Bürger Christian Spahr, Leiter Medienprogramm Südosteuropa Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich
Vortrag Vertrauen in Medien und politische Kommunikation die Meinung der Bürger Christian Spahr, Leiter Medienprogramm Südosteuropa Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich
Erklärung zu den Internet-Seiten von www.bmas.de
 Erklärung zu den Internet-Seiten von www.bmas.de Herzlich willkommen! Sie sind auf der Internet-Seite vom Bundes-Ministerium für Arbeit und Soziales. Die Abkürzung ist: BMAS. Darum heißt die Seite auch
Erklärung zu den Internet-Seiten von www.bmas.de Herzlich willkommen! Sie sind auf der Internet-Seite vom Bundes-Ministerium für Arbeit und Soziales. Die Abkürzung ist: BMAS. Darum heißt die Seite auch
Pro Jahr werden rund 38 Millionen Patienten ambulant und stationär in unseren Krankenhäusern behandelt, statistisch also fast jeder zweite Deutsche.
 Pro Jahr werden rund 38 Millionen Patienten ambulant und stationär in unseren Krankenhäusern behandelt, statistisch also fast jeder zweite Deutsche. Sie können auf die medizinische und pflegerische Qualität
Pro Jahr werden rund 38 Millionen Patienten ambulant und stationär in unseren Krankenhäusern behandelt, statistisch also fast jeder zweite Deutsche. Sie können auf die medizinische und pflegerische Qualität
infach Geld FBV Ihr Weg zum finanzellen Erfolg Florian Mock
 infach Ihr Weg zum finanzellen Erfolg Geld Florian Mock FBV Die Grundlagen für finanziellen Erfolg Denn Sie müssten anschließend wieder vom Gehaltskonto Rückzahlungen in Höhe der Entnahmen vornehmen, um
infach Ihr Weg zum finanzellen Erfolg Geld Florian Mock FBV Die Grundlagen für finanziellen Erfolg Denn Sie müssten anschließend wieder vom Gehaltskonto Rückzahlungen in Höhe der Entnahmen vornehmen, um
Studieren- Erklärungen und Tipps
 Studieren- Erklärungen und Tipps Es gibt Berufe, die man nicht lernen kann, sondern für die man ein Studium machen muss. Das ist zum Beispiel so wenn man Arzt oder Lehrer werden möchte. Hat ihr Kind das
Studieren- Erklärungen und Tipps Es gibt Berufe, die man nicht lernen kann, sondern für die man ein Studium machen muss. Das ist zum Beispiel so wenn man Arzt oder Lehrer werden möchte. Hat ihr Kind das
-> Wir können bei Ihnen alle Behandlungen mit aufwendigen Maßnahmen, Spezialgeräten und hochwertigen Materialien, entsprechend den Kriterien
 Behandlungen auf Chip-Karte oder Rechnung? Seit dem 01.07.1999 haben leider nur noch die Freiwillig Versicherten in der Gesetzlichen Krankenkasse das Recht, sich bei ihrem Arzt und Zahnarzt als "Privatpatient"
Behandlungen auf Chip-Karte oder Rechnung? Seit dem 01.07.1999 haben leider nur noch die Freiwillig Versicherten in der Gesetzlichen Krankenkasse das Recht, sich bei ihrem Arzt und Zahnarzt als "Privatpatient"
Die Post hat eine Umfrage gemacht
 Die Post hat eine Umfrage gemacht Bei der Umfrage ging es um das Thema: Inklusion Die Post hat Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung gefragt: Wie zufrieden sie in dieser Gesellschaft sind.
Die Post hat eine Umfrage gemacht Bei der Umfrage ging es um das Thema: Inklusion Die Post hat Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung gefragt: Wie zufrieden sie in dieser Gesellschaft sind.
B: bei mir war es ja die X, die hat schon lange probiert mich dahin zu kriegen, aber es hat eine Weile gedauert.
 A: Ja, guten Tag und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, das Interview mit mir zu machen. Es geht darum, dass viele schwerhörige Menschen die Tendenz haben sich zurück zu ziehen und es für uns
A: Ja, guten Tag und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, das Interview mit mir zu machen. Es geht darum, dass viele schwerhörige Menschen die Tendenz haben sich zurück zu ziehen und es für uns
Gründe für fehlende Vorsorgemaßnahmen gegen Krankheit
 Gründe für fehlende Vorsorgemaßnahmen gegen Krankheit politische Lage verlassen sich auf Familie persönliche, finanzielle Lage meinen, sich Vorsorge leisten zu können meinen, sie seien zu alt nicht mit
Gründe für fehlende Vorsorgemaßnahmen gegen Krankheit politische Lage verlassen sich auf Familie persönliche, finanzielle Lage meinen, sich Vorsorge leisten zu können meinen, sie seien zu alt nicht mit
Qualitätsbedingungen schulischer Inklusion für Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung
 Forschungsprojekt: Qualitätsbedingungen schulischer Inklusion für Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung Leichte Sprache Autoren: Reinhard Lelgemann Jelena
Forschungsprojekt: Qualitätsbedingungen schulischer Inklusion für Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung Leichte Sprache Autoren: Reinhard Lelgemann Jelena
Darum geht es in diesem Heft
 Die Hilfe für Menschen mit Demenz von der Allianz für Menschen mit Demenz in Leichter Sprache Darum geht es in diesem Heft Viele Menschen in Deutschland haben Demenz. Das ist eine Krankheit vom Gehirn.
Die Hilfe für Menschen mit Demenz von der Allianz für Menschen mit Demenz in Leichter Sprache Darum geht es in diesem Heft Viele Menschen in Deutschland haben Demenz. Das ist eine Krankheit vom Gehirn.
Die Invaliden-Versicherung ändert sich
 Die Invaliden-Versicherung ändert sich 1 Erklärung Die Invaliden-Versicherung ist für invalide Personen. Invalid bedeutet: Eine Person kann einige Sachen nicht machen. Wegen einer Krankheit. Wegen einem
Die Invaliden-Versicherung ändert sich 1 Erklärung Die Invaliden-Versicherung ist für invalide Personen. Invalid bedeutet: Eine Person kann einige Sachen nicht machen. Wegen einer Krankheit. Wegen einem
Welchen Weg nimmt Ihr Vermögen. Unsere Leistung zu Ihrer Privaten Vermögensplanung. Wir machen aus Zahlen Werte
 Welchen Weg nimmt Ihr Vermögen Unsere Leistung zu Ihrer Privaten Vermögensplanung Wir machen aus Zahlen Werte Ihre Fragen Ich schwimme irgendwie in meinen Finanzen, ich weiß nicht so genau wo ich stehe
Welchen Weg nimmt Ihr Vermögen Unsere Leistung zu Ihrer Privaten Vermögensplanung Wir machen aus Zahlen Werte Ihre Fragen Ich schwimme irgendwie in meinen Finanzen, ich weiß nicht so genau wo ich stehe
Der BeB und die Diakonie Deutschland fordern: Gesundheit und Reha müssen besser werden. So ist es jetzt:
 Der BeB und die Diakonie Deutschland fordern: Gesundheit und Reha müssen besser werden So ist es jetzt: Valuing people Menschen mit Behinderung müssen öfter zum Arzt gehen als Menschen ohne Behinderung.
Der BeB und die Diakonie Deutschland fordern: Gesundheit und Reha müssen besser werden So ist es jetzt: Valuing people Menschen mit Behinderung müssen öfter zum Arzt gehen als Menschen ohne Behinderung.
REGELN REICHTUMS RICHARD TEMPLAR AUTOR DES INTERNATIONALEN BESTSELLERS DIE REGELN DES LEBENS
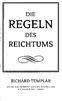 REGELN REICHTUMS RICHARD TEMPLAR AUTOR DES INTERNATIONALEN BESTSELLERS DIE REGELN DES LEBENS INHALT 10 DANKSAGUNG 12 EINLEITUNG 18 DENKEN WIE DIE REICHEN 20 REGEL i: Jeder darf reich werden - ohne Einschränkung
REGELN REICHTUMS RICHARD TEMPLAR AUTOR DES INTERNATIONALEN BESTSELLERS DIE REGELN DES LEBENS INHALT 10 DANKSAGUNG 12 EINLEITUNG 18 DENKEN WIE DIE REICHEN 20 REGEL i: Jeder darf reich werden - ohne Einschränkung
Mehr Transparenz für optimalen Durchblick. Mit dem TÜV Rheinland Prüfzeichen.
 Mehr Transparenz für optimalen Durchblick. Mit dem TÜV Rheinland Prüfzeichen. Immer schon ein gutes Zeichen. Das TÜV Rheinland Prüfzeichen. Es steht für Sicherheit und Qualität. Bei Herstellern, Handel
Mehr Transparenz für optimalen Durchblick. Mit dem TÜV Rheinland Prüfzeichen. Immer schon ein gutes Zeichen. Das TÜV Rheinland Prüfzeichen. Es steht für Sicherheit und Qualität. Bei Herstellern, Handel
Ihr Weg in die Suchmaschinen
 Ihr Weg in die Suchmaschinen Suchmaschinenoptimierung Durch Suchmaschinenoptimierung kann man eine höhere Platzierung von Homepages in den Ergebnislisten von Suchmaschinen erreichen und somit mehr Besucher
Ihr Weg in die Suchmaschinen Suchmaschinenoptimierung Durch Suchmaschinenoptimierung kann man eine höhere Platzierung von Homepages in den Ergebnislisten von Suchmaschinen erreichen und somit mehr Besucher
Informationen zum Ambulant Betreuten Wohnen in leichter Sprache
 Informationen zum Ambulant Betreuten Wohnen in leichter Sprache Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Siegen - Wittgenstein/ Olpe 1 Diese Information hat geschrieben: Arbeiterwohlfahrt Stephanie Schür Koblenzer
Informationen zum Ambulant Betreuten Wohnen in leichter Sprache Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Siegen - Wittgenstein/ Olpe 1 Diese Information hat geschrieben: Arbeiterwohlfahrt Stephanie Schür Koblenzer
Was ist Sozial-Raum-Orientierung?
 Was ist Sozial-Raum-Orientierung? Dr. Wolfgang Hinte Universität Duisburg-Essen Institut für Stadt-Entwicklung und Sozial-Raum-Orientierte Arbeit Das ist eine Zusammen-Fassung des Vortrages: Sozialräume
Was ist Sozial-Raum-Orientierung? Dr. Wolfgang Hinte Universität Duisburg-Essen Institut für Stadt-Entwicklung und Sozial-Raum-Orientierte Arbeit Das ist eine Zusammen-Fassung des Vortrages: Sozialräume
Also heißt es einmal mehr, immer eine eigene Meinungen bilden, nicht beeinflussen lassen, niemals von anderen irgend eine Meinung aufdrängen lassen.
 Seite 1 von 5 Wirtschaft, Finanzen und IT Computer und Technologie Internetseiten Übersichtlich alle verfügbaren Internetseiten von wirfinit. de und darüber hinaus, weitere empfehlenswerte Internetseiten
Seite 1 von 5 Wirtschaft, Finanzen und IT Computer und Technologie Internetseiten Übersichtlich alle verfügbaren Internetseiten von wirfinit. de und darüber hinaus, weitere empfehlenswerte Internetseiten
Traditionelle Suchmaschinenoptimierung (SEO)
 Traditionelle Suchmaschinenoptimierung (SEO) Mit der stetig voranschreitenden Veränderung des World Wide Web haben sich vor allem auch das Surfverhalten der User und deren Einfluss stark verändert. Täglich
Traditionelle Suchmaschinenoptimierung (SEO) Mit der stetig voranschreitenden Veränderung des World Wide Web haben sich vor allem auch das Surfverhalten der User und deren Einfluss stark verändert. Täglich
Herzlich Willkommen beim Webinar: Was verkaufen wir eigentlich?
 Herzlich Willkommen beim Webinar: Was verkaufen wir eigentlich? Was verkaufen wir eigentlich? Provokativ gefragt! Ein Hotel Marketing Konzept Was ist das? Keine Webseite, kein SEO, kein Paket,. Was verkaufen
Herzlich Willkommen beim Webinar: Was verkaufen wir eigentlich? Was verkaufen wir eigentlich? Provokativ gefragt! Ein Hotel Marketing Konzept Was ist das? Keine Webseite, kein SEO, kein Paket,. Was verkaufen
Das Persönliche Budget in verständlicher Sprache
 Das Persönliche Budget in verständlicher Sprache Das Persönliche Budget mehr Selbstbestimmung, mehr Selbstständigkeit, mehr Selbstbewusstsein! Dieser Text soll den behinderten Menschen in Westfalen-Lippe,
Das Persönliche Budget in verständlicher Sprache Das Persönliche Budget mehr Selbstbestimmung, mehr Selbstständigkeit, mehr Selbstbewusstsein! Dieser Text soll den behinderten Menschen in Westfalen-Lippe,
effektweit VertriebsKlima
 effektweit VertriebsKlima Energie 2/2015 ZusammenFassend - Gas ist deutlich stärker umkämpft als Strom Rahmenbedingungen Im Wesentlichen bleiben die Erwartungen bezüglich der Rahmenbedingungen im Vergleich
effektweit VertriebsKlima Energie 2/2015 ZusammenFassend - Gas ist deutlich stärker umkämpft als Strom Rahmenbedingungen Im Wesentlichen bleiben die Erwartungen bezüglich der Rahmenbedingungen im Vergleich
Dies fällt oft deshalb schwerer, da der Angehörige ja von früher gewohnt war, dass der Demenzkranke funktioniert. Was also kann oder soll man tun?
 Alle Menschen brauchen einen sinnstiftenden Alltag. Dies gilt auch für Demenz Erkrankte. Oft versuchen sie zum Leidwesen ihrer Umgebung ihren nach ihrer Meinung sinnigen Tätigkeiten nach zu gehen. Von
Alle Menschen brauchen einen sinnstiftenden Alltag. Dies gilt auch für Demenz Erkrankte. Oft versuchen sie zum Leidwesen ihrer Umgebung ihren nach ihrer Meinung sinnigen Tätigkeiten nach zu gehen. Von
Die fünf Grundschritte zur erfolgreichen Unternehmenswebsite
 [Bindungsorientierte Medienkommunikation] Die fünf Grundschritte zur erfolgreichen Unternehmenswebsite die kaum jemand macht* *Wer sie macht, hat den Vorsprung TEKNIEPE.COMMUNICATION Ulrich Tekniepe Erfolgreiche
[Bindungsorientierte Medienkommunikation] Die fünf Grundschritte zur erfolgreichen Unternehmenswebsite die kaum jemand macht* *Wer sie macht, hat den Vorsprung TEKNIEPE.COMMUNICATION Ulrich Tekniepe Erfolgreiche
Rohstoffanalyse - COT Daten - Gold, Fleischmärkte, Orangensaft, Crude Oil, US Zinsen, S&P500 - KW 07/2009
 MikeC.Kock Rohstoffanalyse - COT Daten - Gold, Fleischmärkte, Orangensaft, Crude Oil, US Zinsen, S&P500 - KW 07/2009 Zwei Märkte stehen seit Wochen im Mittelpunkt aller Marktteilnehmer? Gold und Crude
MikeC.Kock Rohstoffanalyse - COT Daten - Gold, Fleischmärkte, Orangensaft, Crude Oil, US Zinsen, S&P500 - KW 07/2009 Zwei Märkte stehen seit Wochen im Mittelpunkt aller Marktteilnehmer? Gold und Crude
r? akle m n ilie ob Imm
 das kann man doch alleine erledigen dann schau ich doch einfach in die Zeitung oder ins Internet, gebe eine Anzeige auf, und dann läuft das doch. Mit viel Glück finde ich einen Käufer, Verkäufer, einen
das kann man doch alleine erledigen dann schau ich doch einfach in die Zeitung oder ins Internet, gebe eine Anzeige auf, und dann läuft das doch. Mit viel Glück finde ich einen Käufer, Verkäufer, einen
Qualität und Verlässlichkeit Das verstehen die Deutschen unter Geschäftsmoral!
 Beitrag: 1:43 Minuten Anmoderationsvorschlag: Unseriöse Internetanbieter, falsch deklarierte Lebensmittel oder die jüngsten ADAC-Skandale. Solche Fälle mit einer doch eher fragwürdigen Geschäftsmoral gibt
Beitrag: 1:43 Minuten Anmoderationsvorschlag: Unseriöse Internetanbieter, falsch deklarierte Lebensmittel oder die jüngsten ADAC-Skandale. Solche Fälle mit einer doch eher fragwürdigen Geschäftsmoral gibt
50 Fragen, um Dir das Rauchen abzugewöhnen 1/6
 50 Fragen, um Dir das Rauchen abzugewöhnen 1/6 Name:....................................... Datum:............... Dieser Fragebogen kann und wird Dir dabei helfen, in Zukunft ohne Zigaretten auszukommen
50 Fragen, um Dir das Rauchen abzugewöhnen 1/6 Name:....................................... Datum:............... Dieser Fragebogen kann und wird Dir dabei helfen, in Zukunft ohne Zigaretten auszukommen
ÜBERGABE DER OPERATIVEN GESCHÄFTSFÜHRUNG VON MARC BRUNNER AN DOMINIK NYFFENEGGER
 GOOD NEWS VON USP ÜBERGABE DER OPERATIVEN GESCHÄFTSFÜHRUNG VON MARC BRUNNER AN DOMINIK NYFFENEGGER In den vergangenen vierzehn Jahren haben wir mit USP Partner AG eine der bedeutendsten Marketingagenturen
GOOD NEWS VON USP ÜBERGABE DER OPERATIVEN GESCHÄFTSFÜHRUNG VON MARC BRUNNER AN DOMINIK NYFFENEGGER In den vergangenen vierzehn Jahren haben wir mit USP Partner AG eine der bedeutendsten Marketingagenturen
Das Thema von diesem Text ist: Geld-Verwaltung für Menschen mit Lernschwierigkeiten
 Das Thema von diesem Text ist: Geld-Verwaltung für Menschen mit Lernschwierigkeiten Dieser Text ist von Monika Rauchberger. Monika Rauchberger ist die Projekt-Leiterin von Wibs. Wibs ist eine Beratungs-Stelle
Das Thema von diesem Text ist: Geld-Verwaltung für Menschen mit Lernschwierigkeiten Dieser Text ist von Monika Rauchberger. Monika Rauchberger ist die Projekt-Leiterin von Wibs. Wibs ist eine Beratungs-Stelle
PIERAU PLANUNG GESELLSCHAFT FÜR UNTERNEHMENSBERATUNG
 Übersicht Wer ist? Was macht anders? Wir denken langfristig. Wir individualisieren. Wir sind unabhängig. Wir realisieren. Wir bieten Erfahrung. Für wen arbeitet? Pierau Planung ist eine Gesellschaft für
Übersicht Wer ist? Was macht anders? Wir denken langfristig. Wir individualisieren. Wir sind unabhängig. Wir realisieren. Wir bieten Erfahrung. Für wen arbeitet? Pierau Planung ist eine Gesellschaft für
Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Verständnisfragen. Was bedeutet Mediation für Sie?
 Bearbeitungsstand:10.01.2007 07:09, Seite 1 von 6 Mediation verstehen Viele reden über Mediation. Das machen wir doch schon immer so! behaupten sie. Tatsächlich sind die Vorstellungen von dem, was Mediation
Bearbeitungsstand:10.01.2007 07:09, Seite 1 von 6 Mediation verstehen Viele reden über Mediation. Das machen wir doch schon immer so! behaupten sie. Tatsächlich sind die Vorstellungen von dem, was Mediation
Robert Günther Versicherungsmakler
 Robert Günther Versicherungsmakler Bewertung: Sehr hoch Schwerpunkte: Private Krankenversicherung Altersvorsorge Berufsunfähigkeit Krankenzusatzversicherung betriebliche Altersvorsorge Gewerbeversicherung
Robert Günther Versicherungsmakler Bewertung: Sehr hoch Schwerpunkte: Private Krankenversicherung Altersvorsorge Berufsunfähigkeit Krankenzusatzversicherung betriebliche Altersvorsorge Gewerbeversicherung
Wie oft soll ich essen?
 Wie oft soll ich essen? Wie sollen Sie sich als Diabetiker am besten ernähren? Gesunde Ernährung für Menschen mit Diabetes unterscheidet sich nicht von gesunder Ernährung für andere Menschen. Es gibt nichts,
Wie oft soll ich essen? Wie sollen Sie sich als Diabetiker am besten ernähren? Gesunde Ernährung für Menschen mit Diabetes unterscheidet sich nicht von gesunder Ernährung für andere Menschen. Es gibt nichts,
Workshop: Wie ich mein Handikap verbessere erfolgreich Leben mit Multiple Sklerose!
 INTEGRA 7.-9.Mai 2014 Gernot Morgenfurt - Weissensee/Kärnten lebe seit Anfang der 90iger mit MS habe in 2002 eine SHG (Multiple Sklerose) gegründet und möchte viele Menschen zu einer etwas anderen Sichtweise
INTEGRA 7.-9.Mai 2014 Gernot Morgenfurt - Weissensee/Kärnten lebe seit Anfang der 90iger mit MS habe in 2002 eine SHG (Multiple Sklerose) gegründet und möchte viele Menschen zu einer etwas anderen Sichtweise
DAVID: und David vom Deutschlandlabor. Wir beantworten Fragen zu Deutschland und den Deutschen.
 Das Deutschlandlabor Folge 09: Auto Manuskript Die Deutschen sind bekannt dafür, dass sie ihre Autos lieben. Doch wie sehr lieben sie ihre Autos wirklich, und hat wirklich jeder in Deutschland ein eigenes
Das Deutschlandlabor Folge 09: Auto Manuskript Die Deutschen sind bekannt dafür, dass sie ihre Autos lieben. Doch wie sehr lieben sie ihre Autos wirklich, und hat wirklich jeder in Deutschland ein eigenes
Tag der Seltenen Erkrankungen Aktionstag im Uniklinikum Aachen
 Tag der Seltenen Erkrankungen Aktionstag im Uniklinikum Aachen Am 28. Februar 2015 hatten wir den Tag der seltenen Erkrankungen. Die Deutsche GBS Initiative e.v. hatte an diesem Tag die Gelegenheit, zusammen
Tag der Seltenen Erkrankungen Aktionstag im Uniklinikum Aachen Am 28. Februar 2015 hatten wir den Tag der seltenen Erkrankungen. Die Deutsche GBS Initiative e.v. hatte an diesem Tag die Gelegenheit, zusammen
Die Bundes-Zentrale für politische Bildung stellt sich vor
 Die Bundes-Zentrale für politische Bildung stellt sich vor Die Bundes-Zentrale für politische Bildung stellt sich vor Deutschland ist ein demokratisches Land. Das heißt: Die Menschen in Deutschland können
Die Bundes-Zentrale für politische Bildung stellt sich vor Die Bundes-Zentrale für politische Bildung stellt sich vor Deutschland ist ein demokratisches Land. Das heißt: Die Menschen in Deutschland können
Fragebogen zur Mitarbeiterzufriedenheit in Rehabilitationskliniken
 Name der Klinik Fragebogen zur Mitarbeiterheit in Rehabilitationskliniken Sie werden im Fragebogen zu verschieden Bereichen befragt, die Ihren Arbeitsalltag bestimmen. Bitte beantworten Sie die Fragen
Name der Klinik Fragebogen zur Mitarbeiterheit in Rehabilitationskliniken Sie werden im Fragebogen zu verschieden Bereichen befragt, die Ihren Arbeitsalltag bestimmen. Bitte beantworten Sie die Fragen
ALEMÃO. Text 1. Lernen, lernen, lernen
 ALEMÃO Text 1 Lernen, lernen, lernen Der Mai ist für viele deutsche Jugendliche keine schöne Zeit. Denn dann müssen sie in vielen Bundesländern die Abiturprüfungen schreiben. Das heiβt: lernen, lernen,
ALEMÃO Text 1 Lernen, lernen, lernen Der Mai ist für viele deutsche Jugendliche keine schöne Zeit. Denn dann müssen sie in vielen Bundesländern die Abiturprüfungen schreiben. Das heiβt: lernen, lernen,
Der nachhaltigere Anbieter sollte den Auftrag kriegen Interview mit Klaus-Peter Tiedtke, Direktor des Beschaffungsamtes des Bundes
 Der nachhaltigere Anbieter sollte den Auftrag kriegen Interview mit Klaus-Peter Tiedtke, Direktor des Beschaffungsamtes des Bundes Der öffentliche Einkaufskorb soll nach dem Willen der Bundesregierung
Der nachhaltigere Anbieter sollte den Auftrag kriegen Interview mit Klaus-Peter Tiedtke, Direktor des Beschaffungsamtes des Bundes Der öffentliche Einkaufskorb soll nach dem Willen der Bundesregierung
Was meinen die Leute eigentlich mit: Grexit?
 Was meinen die Leute eigentlich mit: Grexit? Grexit sind eigentlich 2 Wörter. 1. Griechenland 2. Exit Exit ist ein englisches Wort. Es bedeutet: Ausgang. Aber was haben diese 2 Sachen mit-einander zu tun?
Was meinen die Leute eigentlich mit: Grexit? Grexit sind eigentlich 2 Wörter. 1. Griechenland 2. Exit Exit ist ein englisches Wort. Es bedeutet: Ausgang. Aber was haben diese 2 Sachen mit-einander zu tun?
Wir machen uns stark! Parlament der Ausgegrenzten 20.-22.9.2013
 Wir machen uns stark! Parlament der Ausgegrenzten 20.-22.9.2013 Die Armutskonferenz Einladung zum Parlament der Ausgegrenzten 20.-22. September 2013 Was ist das Parlament der Ausgegrenzten? Das Parlament
Wir machen uns stark! Parlament der Ausgegrenzten 20.-22.9.2013 Die Armutskonferenz Einladung zum Parlament der Ausgegrenzten 20.-22. September 2013 Was ist das Parlament der Ausgegrenzten? Das Parlament
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren
 Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Wie wirksam wird Ihr Controlling kommuniziert?
 Unternehmenssteuerung auf dem Prüfstand Wie wirksam wird Ihr Controlling kommuniziert? Performance durch strategiekonforme und wirksame Controllingkommunikation steigern INHALT Editorial Seite 3 Wurden
Unternehmenssteuerung auf dem Prüfstand Wie wirksam wird Ihr Controlling kommuniziert? Performance durch strategiekonforme und wirksame Controllingkommunikation steigern INHALT Editorial Seite 3 Wurden
Wir sind für Sie da. Unser Gesundheitsangebot: Unterstützung im Umgang mit Ihrer Depression
 Wir sind für Sie da Unser Gesundheitsangebot: Unterstützung im Umgang mit Ihrer Depression Wir nehmen uns Zeit für Sie und helfen Ihnen Depressionen lassen sich heute meist gut behandeln. Häufig ist es
Wir sind für Sie da Unser Gesundheitsangebot: Unterstützung im Umgang mit Ihrer Depression Wir nehmen uns Zeit für Sie und helfen Ihnen Depressionen lassen sich heute meist gut behandeln. Häufig ist es
Lassen Sie sich entdecken!
 Digital Marketing Agentur für B2B Unternehmen EXPERTISE ONLINE MARKETING IM B2B Lassen Sie sich entdecken! EINE GANZHEITLICHE ONLINE MARKETING STRATEGIE BRINGT SIE NACHHALTIG IN DEN FOKUS IHRER ZIELKUNDEN.
Digital Marketing Agentur für B2B Unternehmen EXPERTISE ONLINE MARKETING IM B2B Lassen Sie sich entdecken! EINE GANZHEITLICHE ONLINE MARKETING STRATEGIE BRINGT SIE NACHHALTIG IN DEN FOKUS IHRER ZIELKUNDEN.
1. Was ihr in dieser Anleitung
 Leseprobe 1. Was ihr in dieser Anleitung erfahren könnt 2 Liebe Musiker, in diesem PDF erhaltet ihr eine Anleitung, wie ihr eure Musik online kostenlos per Werbevideo bewerben könnt, ohne dabei Geld für
Leseprobe 1. Was ihr in dieser Anleitung erfahren könnt 2 Liebe Musiker, in diesem PDF erhaltet ihr eine Anleitung, wie ihr eure Musik online kostenlos per Werbevideo bewerben könnt, ohne dabei Geld für
Briefing-Leitfaden. 1. Hier geht s um Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung: Was soll beworben werden?
 Leonhardstraße 62 86415 Mering Tel. 0 82 33 / 73 62-84, Fax -85 Briefing-Leitfaden tigertexte@gmx.de www.federkunst.de Der Leitfaden dient als Hilfe, um alle wichtigen Informationen zu sammeln und zu ordnen.
Leonhardstraße 62 86415 Mering Tel. 0 82 33 / 73 62-84, Fax -85 Briefing-Leitfaden tigertexte@gmx.de www.federkunst.de Der Leitfaden dient als Hilfe, um alle wichtigen Informationen zu sammeln und zu ordnen.
Erst Lesen dann Kaufen
 Erst Lesen dann Kaufen ebook Das Geheimnis des Geld verdienens Wenn am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist - so geht s den meisten Leuten. Sind Sie in Ihrem Job zufrieden - oder würden Sie lieber
Erst Lesen dann Kaufen ebook Das Geheimnis des Geld verdienens Wenn am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist - so geht s den meisten Leuten. Sind Sie in Ihrem Job zufrieden - oder würden Sie lieber
Ich will im Krankenhaus eine V.I.P.-Behandlung. Die Kranken-Zusatzversicherung V.I.P. stationär.
 Ich will im Krankenhaus eine V.I.P.-Behandlung. Die Kranken-Zusatzversicherung V.I.P. stationär. NAME: Daniela Fontara WOHNORT: Bonn ZIEL: Behandlung nach Maß PRODUKT: V.I.P. Tarife stationär Wie kann
Ich will im Krankenhaus eine V.I.P.-Behandlung. Die Kranken-Zusatzversicherung V.I.P. stationär. NAME: Daniela Fontara WOHNORT: Bonn ZIEL: Behandlung nach Maß PRODUKT: V.I.P. Tarife stationär Wie kann
Sicher durch das Studium. Unsere Angebote für Studenten
 Sicher durch das Studium Unsere Angebote für Studenten Starke Leistungen AUSGEZEICHNET! FOCUS-MONEY Im Vergleich von 95 gesetzlichen Krankenkassen wurde die TK zum achten Mal in Folge Gesamtsieger. Einen
Sicher durch das Studium Unsere Angebote für Studenten Starke Leistungen AUSGEZEICHNET! FOCUS-MONEY Im Vergleich von 95 gesetzlichen Krankenkassen wurde die TK zum achten Mal in Folge Gesamtsieger. Einen
Gutes Leben was ist das?
 Lukas Bayer Jahrgangsstufe 12 Im Hirschgarten 1 67435 Neustadt Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Landwehrstraße22 67433 Neustadt a. d. Weinstraße Gutes Leben was ist das? Gutes Leben für alle was genau ist das
Lukas Bayer Jahrgangsstufe 12 Im Hirschgarten 1 67435 Neustadt Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Landwehrstraße22 67433 Neustadt a. d. Weinstraße Gutes Leben was ist das? Gutes Leben für alle was genau ist das
Hohe Leistung, tiefe Prämie. Michèle Bowley, Geschäftsleiterin «Gsünder Basel»
 «Wer das HMO- Ärztenetzwerk wählt, bleibt auch in Sachen Gesundheit am Ball» Michèle Bowley, Geschäftsleiterin «Gsünder Basel» Hohe Leistung, tiefe Prämie. Michèle Bowley ist Geschäftsleiterin von «Gsünder
«Wer das HMO- Ärztenetzwerk wählt, bleibt auch in Sachen Gesundheit am Ball» Michèle Bowley, Geschäftsleiterin «Gsünder Basel» Hohe Leistung, tiefe Prämie. Michèle Bowley ist Geschäftsleiterin von «Gsünder
Catherina Lange, Heimbeiräte und Werkstatträte-Tagung, November 2013 1
 Catherina Lange, Heimbeiräte und Werkstatträte-Tagung, November 2013 1 Darum geht es heute: Was ist das Persönliche Geld? Was kann man damit alles machen? Wie hoch ist es? Wo kann man das Persönliche Geld
Catherina Lange, Heimbeiräte und Werkstatträte-Tagung, November 2013 1 Darum geht es heute: Was ist das Persönliche Geld? Was kann man damit alles machen? Wie hoch ist es? Wo kann man das Persönliche Geld
Gesundheitsbarometer 2009. Verbraucherbefragung zur Qualität der Gesundheitsversorgung in Deutschland
 Gesundheitsbarometer 2009 Verbraucherbefragung zur Qualität der Gesundheitsversorgung in Deutschland Das Design der Studie Telefonische Befragung durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut (Valid Research,
Gesundheitsbarometer 2009 Verbraucherbefragung zur Qualität der Gesundheitsversorgung in Deutschland Das Design der Studie Telefonische Befragung durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut (Valid Research,
SHG INVEST DAS SOLLTEN SIE UNBEDINGT. lesen, bevor Sie selbst verkaufen...
 DAS SOLLTEN SIE UNBEDINGT lesen, bevor Sie selbst verkaufen... Bevor Sie mit uns über Ihre Immobilie reden, sprechen wir mit Ihnen über unser diskretes Verkaufsmarketing. Wir sind der Meinung, dass Sie
DAS SOLLTEN SIE UNBEDINGT lesen, bevor Sie selbst verkaufen... Bevor Sie mit uns über Ihre Immobilie reden, sprechen wir mit Ihnen über unser diskretes Verkaufsmarketing. Wir sind der Meinung, dass Sie
Und im Bereich Lernschwächen kommen sie, wenn sie merken, das Kind hat Probleme beim Rechnen oder Lesen und Schreiben.
 5.e. PDF zur Hördatei und Herr Kennedy zum Thema: Unsere Erfahrungen in der Kennedy-Schule Teil 2 Herr Kennedy, Sie haben eine Nachhilfeschule in der schwerpunktmäßig an Lernschwächen wie Lese-Rechtschreibschwäche,
5.e. PDF zur Hördatei und Herr Kennedy zum Thema: Unsere Erfahrungen in der Kennedy-Schule Teil 2 Herr Kennedy, Sie haben eine Nachhilfeschule in der schwerpunktmäßig an Lernschwächen wie Lese-Rechtschreibschwäche,
Projektmanagement in der Spieleentwicklung
 Projektmanagement in der Spieleentwicklung Inhalt 1. Warum brauche ich ein Projekt-Management? 2. Die Charaktere des Projektmanagement - Mastermind - Producer - Projektleiter 3. Schnittstellen definieren
Projektmanagement in der Spieleentwicklung Inhalt 1. Warum brauche ich ein Projekt-Management? 2. Die Charaktere des Projektmanagement - Mastermind - Producer - Projektleiter 3. Schnittstellen definieren
micura Pflegedienste München Ost
 In Kooperation mit: 2 PFLEGE UND BETREUUNG ZUHAUSE Ein Gemeinschaftsunternehmen der DKV Pflegedienste & Residenzen GmbH und dem Praxisverbund GmbH München Süd-Ost Der Gesetzgeber wünscht eine engere Verzahnung
In Kooperation mit: 2 PFLEGE UND BETREUUNG ZUHAUSE Ein Gemeinschaftsunternehmen der DKV Pflegedienste & Residenzen GmbH und dem Praxisverbund GmbH München Süd-Ost Der Gesetzgeber wünscht eine engere Verzahnung
geben. Die Wahrscheinlichkeit von 100% ist hier demnach nur der Gehen wir einmal davon aus, dass die von uns angenommenen
 geben. Die Wahrscheinlichkeit von 100% ist hier demnach nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Gehen wir einmal davon aus, dass die von uns angenommenen 70% im Beispiel exakt berechnet sind. Was würde
geben. Die Wahrscheinlichkeit von 100% ist hier demnach nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Gehen wir einmal davon aus, dass die von uns angenommenen 70% im Beispiel exakt berechnet sind. Was würde
Kaufkräftige Zielgruppen gewinnen
 Kaufkräftige Zielgruppen gewinnen Wie Sie Besucher auf Ihre Webseite locken, die hochgradig an Ihrem Angebot interessiert sind 2014 David Unzicker, alle Rechte vorbehalten Hallo, mein Name ist David Unzicker
Kaufkräftige Zielgruppen gewinnen Wie Sie Besucher auf Ihre Webseite locken, die hochgradig an Ihrem Angebot interessiert sind 2014 David Unzicker, alle Rechte vorbehalten Hallo, mein Name ist David Unzicker
Ist Fernsehen schädlich für die eigene Meinung oder fördert es unabhängig zu denken?
 UErörterung zu dem Thema Ist Fernsehen schädlich für die eigene Meinung oder fördert es unabhängig zu denken? 2000 by christoph hoffmann Seite I Gliederung 1. In zu großen Mengen ist alles schädlich. 2.
UErörterung zu dem Thema Ist Fernsehen schädlich für die eigene Meinung oder fördert es unabhängig zu denken? 2000 by christoph hoffmann Seite I Gliederung 1. In zu großen Mengen ist alles schädlich. 2.
Vorgestellt von Hans-Dieter Stubben. BVW GmbH: Partner des Bundes-Versorgungs-Werk der Wirtschaft und der Selbständigen e.v.
 Der Investitionsoptimierer Vorgestellt von Hans-Dieter Stubben BVW GmbH: Partner des Bundes-Versorgungs-Werk der Wirtschaft und der Selbständigen e.v. Der Investitionsoptimierer ist die Antwort an die
Der Investitionsoptimierer Vorgestellt von Hans-Dieter Stubben BVW GmbH: Partner des Bundes-Versorgungs-Werk der Wirtschaft und der Selbständigen e.v. Der Investitionsoptimierer ist die Antwort an die
Die sechs häufigsten Fehler
 Die sechs häufigsten Fehler Broschüre 06 ... hätte ich das gewusst, hätte ich es anders gemacht! Gerade zum Anfang des Verkaufsprozesses passieren die meisten Fehler. Das wollen Sie bestimmt nicht irgendwann
Die sechs häufigsten Fehler Broschüre 06 ... hätte ich das gewusst, hätte ich es anders gemacht! Gerade zum Anfang des Verkaufsprozesses passieren die meisten Fehler. Das wollen Sie bestimmt nicht irgendwann
Qualitätsversprechen. 10 Versprechen, auf die Sie sich verlassen können. Geprüfte Qualität
 10 Qualitätsversprechen 10 Versprechen, auf die Sie sich verlassen können Geprüfte Qualität Liebe Kundin, lieber Kunde, "Ausgezeichnete Qualität ist der Maßstab für unsere Leistungen." (Aus unserem Leitbild)
10 Qualitätsversprechen 10 Versprechen, auf die Sie sich verlassen können Geprüfte Qualität Liebe Kundin, lieber Kunde, "Ausgezeichnete Qualität ist der Maßstab für unsere Leistungen." (Aus unserem Leitbild)
Was wir gut und wichtig finden
 Was wir gut und wichtig finden Ethische Grundaussagen in Leichter Sprache 1 Was wir gut und wichtig finden Ethische Grundaussagen in Leichter Sprache 2 Zuallererst Die Vereinten Nationen haben eine Vereinbarung
Was wir gut und wichtig finden Ethische Grundaussagen in Leichter Sprache 1 Was wir gut und wichtig finden Ethische Grundaussagen in Leichter Sprache 2 Zuallererst Die Vereinten Nationen haben eine Vereinbarung
Mobile Intranet in Unternehmen
 Mobile Intranet in Unternehmen Ergebnisse einer Umfrage unter Intranet Verantwortlichen aexea GmbH - communication. content. consulting Augustenstraße 15 70178 Stuttgart Tel: 0711 87035490 Mobile Intranet
Mobile Intranet in Unternehmen Ergebnisse einer Umfrage unter Intranet Verantwortlichen aexea GmbH - communication. content. consulting Augustenstraße 15 70178 Stuttgart Tel: 0711 87035490 Mobile Intranet
Informationen zum Thema Datensicherheit
 Gesundheitskarte AKTUELL Informationen zum Thema Datensicherheit Das medizinische Wissen und damit auch die medizinische Behandlung werden immer spezialisierter. Eine wachsende Zahl von Spezialisten sorgt
Gesundheitskarte AKTUELL Informationen zum Thema Datensicherheit Das medizinische Wissen und damit auch die medizinische Behandlung werden immer spezialisierter. Eine wachsende Zahl von Spezialisten sorgt
Hinweise in Leichter Sprache zum Vertrag über das Betreute Wohnen
 Hinweise in Leichter Sprache zum Vertrag über das Betreute Wohnen Sie möchten im Betreuten Wohnen leben. Dafür müssen Sie einen Vertrag abschließen. Und Sie müssen den Vertrag unterschreiben. Das steht
Hinweise in Leichter Sprache zum Vertrag über das Betreute Wohnen Sie möchten im Betreuten Wohnen leben. Dafür müssen Sie einen Vertrag abschließen. Und Sie müssen den Vertrag unterschreiben. Das steht
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung: EFRE im Bundes-Land Brandenburg vom Jahr 2014 bis für das Jahr 2020 in Leichter Sprache
 Für Ihre Zukunft! Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung: EFRE im Bundes-Land Brandenburg vom Jahr 2014 bis für das Jahr 2020 in Leichter Sprache 1 Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung: EFRE
Für Ihre Zukunft! Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung: EFRE im Bundes-Land Brandenburg vom Jahr 2014 bis für das Jahr 2020 in Leichter Sprache 1 Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung: EFRE
1. Fabrikatshändlerkongress. Schlussworte Robert Rademacher
 Robert Rademacher Präsident Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe - Zentralverband - 1. Fabrikatshändlerkongress Schlussworte Robert Rademacher 24. Oktober 2008 Frankfurt Es gilt das gesprochene Wort Meine sehr
Robert Rademacher Präsident Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe - Zentralverband - 1. Fabrikatshändlerkongress Schlussworte Robert Rademacher 24. Oktober 2008 Frankfurt Es gilt das gesprochene Wort Meine sehr
Agile Enterprise Development. Sind Sie bereit für den nächsten Schritt?
 Agile Enterprise Development Sind Sie bereit für den nächsten Schritt? Steigern Sie noch immer die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens alleine durch Kostensenkung? Im Projektportfolio steckt das Potenzial
Agile Enterprise Development Sind Sie bereit für den nächsten Schritt? Steigern Sie noch immer die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens alleine durch Kostensenkung? Im Projektportfolio steckt das Potenzial
Geld Verdienen im Internet leicht gemacht
 Geld Verdienen im Internet leicht gemacht Hallo, Sie haben sich dieses E-book wahrscheinlich herunter geladen, weil Sie gerne lernen würden wie sie im Internet Geld verdienen können, oder? Denn genau das
Geld Verdienen im Internet leicht gemacht Hallo, Sie haben sich dieses E-book wahrscheinlich herunter geladen, weil Sie gerne lernen würden wie sie im Internet Geld verdienen können, oder? Denn genau das
Wichtige Forderungen für ein Bundes-Teilhabe-Gesetz
 Wichtige Forderungen für ein Bundes-Teilhabe-Gesetz Die Parteien CDU, die SPD und die CSU haben versprochen: Es wird ein Bundes-Teilhabe-Gesetz geben. Bis jetzt gibt es das Gesetz noch nicht. Das dauert
Wichtige Forderungen für ein Bundes-Teilhabe-Gesetz Die Parteien CDU, die SPD und die CSU haben versprochen: Es wird ein Bundes-Teilhabe-Gesetz geben. Bis jetzt gibt es das Gesetz noch nicht. Das dauert
Gesprächsführung für Sicherheitsbeauftragte Gesetzliche Unfallversicherung
 Ihre Unfallversicherung informiert Gesprächsführung für Sicherheitsbeauftragte Gesetzliche Unfallversicherung Weshalb Gesprächsführung für Sicherheitsbeauftragte? 1 Als Sicherheitsbeauftragter haben Sie
Ihre Unfallversicherung informiert Gesprächsführung für Sicherheitsbeauftragte Gesetzliche Unfallversicherung Weshalb Gesprächsführung für Sicherheitsbeauftragte? 1 Als Sicherheitsbeauftragter haben Sie
Wie Sie in sieben Schritten Online- Beratungskompetenz aufbauen
 22 Einleitung: Online-Beratung und Online-Verkauf als Zukunftschance Online-Beratung und Online-Verkauf ist ein Geschäft wie viele andere. Wer es nicht mit Herzblut und Leidenschaft betreibt, wird scheitern.
22 Einleitung: Online-Beratung und Online-Verkauf als Zukunftschance Online-Beratung und Online-Verkauf ist ein Geschäft wie viele andere. Wer es nicht mit Herzblut und Leidenschaft betreibt, wird scheitern.
Auswertung. Mitarbeiterbefragung zum Leistungsangebot Klinischer Sozialarbeit am Universitätsklinikum Münster
 Auswertung Mitarbeiterbefragung zum Leistungsangebot Klinischer Sozialarbeit am Universitätsklinikum Münster Universitätsklinikum Münster Domagkstraße 5 48149 Münster Telefon: 02 51 83-5 81 17 Fax: 02
Auswertung Mitarbeiterbefragung zum Leistungsangebot Klinischer Sozialarbeit am Universitätsklinikum Münster Universitätsklinikum Münster Domagkstraße 5 48149 Münster Telefon: 02 51 83-5 81 17 Fax: 02
Jojo sucht das Glück - 3 Folge 23: Der Verdacht
 Übung 1: Auf der Suche nach Edelweiß-Technik Jojo will endlich herausfinden, was Lukas zu verbergen hat. Sie findet eine Spur auf seinem Computer. Jetzt braucht Jojo jemanden, der ihr hilft. Schau dir
Übung 1: Auf der Suche nach Edelweiß-Technik Jojo will endlich herausfinden, was Lukas zu verbergen hat. Sie findet eine Spur auf seinem Computer. Jetzt braucht Jojo jemanden, der ihr hilft. Schau dir
Affiliate Marketing Schnellstart Seite 1
 Affiliate Marketing Schnellstart Seite 1 Inhaltsangabe Einführung...3 Gewinnbringende Nischen auswählen...4 Brainstorming...4 Mögliche Profitabilität prüfen...6 Stichwortsuche...7 Traffic und Marketing...9
Affiliate Marketing Schnellstart Seite 1 Inhaltsangabe Einführung...3 Gewinnbringende Nischen auswählen...4 Brainstorming...4 Mögliche Profitabilität prüfen...6 Stichwortsuche...7 Traffic und Marketing...9
Social-CRM (SCRM) im Überblick
 Social-CRM (SCRM) im Überblick In der heutigen Zeit ist es kaum vorstellbar ohne Kommunikationsplattformen wie Facebook, Google, Twitter und LinkedIn auszukommen. Dies betrifft nicht nur Privatpersonen
Social-CRM (SCRM) im Überblick In der heutigen Zeit ist es kaum vorstellbar ohne Kommunikationsplattformen wie Facebook, Google, Twitter und LinkedIn auszukommen. Dies betrifft nicht nur Privatpersonen
Nicht über uns ohne uns
 Nicht über uns ohne uns Das bedeutet: Es soll nichts über Menschen mit Behinderung entschieden werden, wenn sie nicht mit dabei sind. Dieser Text ist in leicht verständlicher Sprache geschrieben. Die Parteien
Nicht über uns ohne uns Das bedeutet: Es soll nichts über Menschen mit Behinderung entschieden werden, wenn sie nicht mit dabei sind. Dieser Text ist in leicht verständlicher Sprache geschrieben. Die Parteien
Für ein lückenloses Lächeln. Zahnersatz-Zusatzversicherung für gesetzlich Krankenversicherte. www.zahnzusatzversicherungen-vergleichen.
 Zahnersatz-Zusatzversicherung für gesetzlich Krankenversicherte Für ein lückenloses Lächeln. NÜRNBERGER Zahnersatz-Zusatzversicherung Damit Ihnen nichts fehlt, braucht es manchmal mehr...... etwa wenn
Zahnersatz-Zusatzversicherung für gesetzlich Krankenversicherte Für ein lückenloses Lächeln. NÜRNBERGER Zahnersatz-Zusatzversicherung Damit Ihnen nichts fehlt, braucht es manchmal mehr...... etwa wenn
Kreativ visualisieren
 Kreativ visualisieren Haben Sie schon einmal etwas von sogenannten»sich selbst erfüllenden Prophezeiungen«gehört? Damit ist gemeint, dass ein Ereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt, wenn wir uns
Kreativ visualisieren Haben Sie schon einmal etwas von sogenannten»sich selbst erfüllenden Prophezeiungen«gehört? Damit ist gemeint, dass ein Ereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt, wenn wir uns
GEHEN SIE ZUR NÄCHSTEN SEITE.
 Seite 1 1. TEIL Das Telefon klingelt. Sie antworten. Die Stimme am Telefon: Guten Tag! Hier ist das Forschungsinstitut FLOP. Haben Sie etwas Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten? Wie denn? Am Telefon?
Seite 1 1. TEIL Das Telefon klingelt. Sie antworten. Die Stimme am Telefon: Guten Tag! Hier ist das Forschungsinstitut FLOP. Haben Sie etwas Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten? Wie denn? Am Telefon?
Predigt Salvenmoser: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe.
 Predigt Salvenmoser: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Vor einigen Tagen habe ich folgende Meldung in der örtlichen Presse gelesen: Blacky Fuchsberger will ohne Frau nicht leben. Der Entertainer
Predigt Salvenmoser: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Vor einigen Tagen habe ich folgende Meldung in der örtlichen Presse gelesen: Blacky Fuchsberger will ohne Frau nicht leben. Der Entertainer
Achten Sie auf Spaß: es handelt sich dabei um wissenschaftliche Daten
 Tipp 1 Achten Sie auf Spaß: es handelt sich dabei um wissenschaftliche Daten Spaß zu haben ist nicht dumm oder frivol, sondern gibt wichtige Hinweise, die Sie zu Ihren Begabungen führen. Stellen Sie fest,
Tipp 1 Achten Sie auf Spaß: es handelt sich dabei um wissenschaftliche Daten Spaß zu haben ist nicht dumm oder frivol, sondern gibt wichtige Hinweise, die Sie zu Ihren Begabungen führen. Stellen Sie fest,
