Herausgegeben von Horst Biermann und Lutz Krüger. Moderne Methoden der Werkstoffprüfung
|
|
|
- Linda Raske
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Herausgegeben von Horst Biermann und Lutz Krüger Moderne Methoden der Werkstoffprüfung
2
3 Herausgegeben von Horst Biermann und Lutz Krüger Moderne Methoden der Werkstoffprüfung
4 Beachten Sie bitte auch weitere interessante Titel zu diesem Thema Lange, G. (Hrsg) Systematische Beurteilung technischer Schadensfälle 6. Auflage 2014 Print ISBN: Oettel, H., Schumann, H. (Hrsg) Metallografie Mit einer Einführung in die Keramografie, 15. Auflage 2011 Print ISBN: Bertolini, L., Elsener, B., Pedeferri, P., Redaelli, E., Polder, R.B. Corrosion of Steel in Concrete Prevention, Diagnosis, Repair, 2. Auflage 2013 Print ISBN: Sharma, S.K. (Hrsg) Green Corrosion Chemistry and Engineering Opportunities and Challenges with a Foreword by Nabuk Okon Eddy 2012 Print ISBN: Callister, W.D., Rethwisch, D.G. Materialwissenschaften und Werkstofftechnik Eine Einführung Worch,H.,Pompe,W.,Schatt,W.(Hrsg) Werkstoffwissenschaft 10. Auflage 2011 Print ISBN: Krzyzanowski, M., Beynon, J.H., Farrugia, D.C. Oxide Scale Behavior in High Temperature Metal Processing 2010 Print ISBN: Christ, H. Ermüdungsverhalten metallischer Werkstoffe 2. Auflage 2009 Print ISBN: Print ISBN:
5 Herausgegeben von Horst Biermann und Lutz Krüger Moderne Methoden der Werkstoffprüfung
6 Herausgegeben von Horst Biermann Institut für Werkstofftechnik Gustav-Zeuner-Str. 5 Lutz Krüger Institut für Werkstofftechnik Gustav-Zeuner-Str. 5 Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Boschstr. 12, Weinheim, Germany Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind. Umschlaggestaltung Adam Design, Weinheim Typesetting le-tex publishing services GmbH, Leipzig Druck und Bindung betz-druck GmbH, Darmstadt Print ISBN epdf ISBN epub ISBN Mobi ISBN obook ISBN Gedruckt auf säurefreiem Papier
7 V Inhaltsverzeichnis Vorwort XI Beitragsautoren XIII 1 BruchmechanischesVerhalten unterquasistatischer und dynamischer Beanspruchung 1 L. Krüger, P. Trubitz und S. Henschel 1.1 Einleitung Grundlagen Konzept der linear-elastischen Bruchmechanik Konzepte der Fließbruchmechanik Bruchzähigkeitsverhalten im spröd-duktilen Übergangsbereich das Master-Curve-Konzept Bruchmechanisches Verhalten unter hohen Beanspruchungsraten Experimentelle Bestimmung bruchmechanischer Kennwerte Probenformen, Probenvorbereitung Quasistatische Beanspruchung Dynamische Beanspruchung 29 Literatur 49 2 Kennwertermittlung bei zyklischem Langrisswachstum 53 S. Henkel und H. Biermann 2.1 Einführung Grundlagen Probenformen Kompaktzugprobe (CT-Probe) Einseitig gekerbte Biegeprobe (SENB-Probe) Plattenförmige Proben (CCT-Probe, SENT-Probe, ESET-Probe) Versuchsführung Risslängenbestimmung Optische Methoden Elastische Compliance-Messung Elektropotenzialmethode 67
8 VI Inhaltsverzeichnis Markerload-Technik Versuchsauswertung Ermittlung des Schwellenwertes Glättung der Messwerte Parameter der Paris-Erdogan-Gleichung Anpassung von kontinuierlichen Funktionen Statistik Zusammenfassung und Ausblick 78 Literatur 79 3 Ermüdung bei sehr hohen Lastspielzahlen (VHCF) 83 A. Weidner, D. Krewerth und H. Biermann 3.1 Einführung Werkstoffverhalten im VHCF-Bereich Typ I-Werkstoffe Typ II-Werkstoffe Gerätetechnik und Analyseverfahren Ultraschallprüftechnik Frequenzanalyse Nichtlinearitätsparameter Thermografie Fraktografie Aktuelle Forschungsergebnisse Aluminiumguss AlSi7Mg Stahlguss G-42CrMo Austenitischer Stahlguss G-X5CrNiMoNb Gusseisen mit Kugelgraphit und Graphitentartungen Zusammenfassung und Ausblick 115 Literatur Mehrachsige Werkstoffeigenschaften 121 S.Henkel,D.Kulawinski,S.AckermannundH.Biermann 4.1 Einleitung Planar-biaxiale Prüfung Konzepte für die Gestaltung von kreuzförmigen Proben Probengeometrie Ermittlung des tragenden Querschnittes und der Spannungen bei planar-biaxialer Prüfung Beispiele für die Bestimmung des mehrachsigen mechanischen Verhaltens Ermittlung statischer Fließkurven an Kreuzproben Zyklische LCF-Beanspruchung bei Raumtemperatur Zyklische Hochtemperaturermüdung Rissbahnkurven unter zyklischer Beanspruchung Ausblick 148 Literatur 150
9 Inhaltsverzeichnis VII 5 Thermomechanische Ermüdung 159 R. Kolmorgen und H. Biermann 5.1 Einleitung Experimentelle Vorgehensweise Versuchsführung Zyklusformen Probenformen Auswertung Lebensdauervorhersage Empirische Schadensparameter Bruchmechanische Vorgehensweise Eigene Untersuchungen Prüfaufbau Kesselstahl 16Mo Duplexstahl Lebensdauervorhersage am Beispiel des Duplexstahles Literatur DynamischeWerkstoffprüfung 181 D. Ehinger und L. Krüger 6.1 Einleitung Experimentelle Methoden Servohydraulische Prüfmaschinen Fallwerksaufbauten Pendelschlagwerke Rotationsschlagwerke Hopkinsonaufbauten Messkette und Messtechnik Werkstoffverhalten als Funktion von Temperatur und Dehnrate Modellgesetze Werkstoffbeispiele Experimentelle Ergebnisse Anwendung von empirischen und metallphysikalisch basierten Modellgesetzen 205 Literatur Moderne Methoden der Rasterelektronenmikroskopie 217 A. Weidner und H. Biermann 7.1 Einleitung Feldemissions-Rasterelektronenmikroskopie Wechselwirkung Elektronenstrahl-Materie Kontrastarten Sekundärelektronenkontrast (SE) Rückstreuelektronenkontrast (BSE) Der Electron Channelling-Kontrast zur Abbildung von Gitterdefekten 227
10 VIII Inhaltsverzeichnis Transmissionselektronenkontrast (t-sem) Analytische Verfahren der Rasterelektronenmikroskopie Energiedispersive Röntgenspektroskopie Rückstreuelektronenbeugung (EBSD) Kombinierte Anwendung von Rückstreuelektronenbeugung und energiedispersiver Röntgenspektroskopie Möglichkeiten zur in situ-charakterisierung im Rasterelektronenmikroskop Anwendungsbeispiele kombinierter abbildenderund analytischer Verfahren der Rasterelektronenmikroskopie Abbildung von Versetzungsanordnungen nach zyklischer Beanspruchung Abbildung einzelner Gitterdefekte Kombination von ECCI mit in situ-verformung interrupted monitoring Zusammenfassung und Ausblick 250 Literatur Röntgendiffraktometrie 255 D. Rafaja 8.1 WechselwirkungderRöntgenstrahlen mit der Materie Elastische Streuung der Röntgenstrahlen an Elektronen Interferenz der elastisch gestreuten Röntgenstrahlen Röntgenbeugung an defektfreien kristallinen Materialien Der Strukturfaktor Die Laue-Bedingungen und die Bragg-Gleichung Effekt der Kristallgröße Röntgenbeugung an mehreren Kristalliten Einfluss der Mikrostrukturdefekte auf das Röntgendiffraktogramm Punktdefekte Mikrodehnung Versetzungen Planare Defekte Turbostratische Kristallstrukturdefekte Instrumentelle Verbreiterung der Beugungslinien 293 Literatur Nanoindentierungsprüfung 299 M. Göken 9.1 Einleitung Von derklassischen Härteprüfung zur Nanoindentierungsprüfung Grenzen der klassischen Härteprüfung Tiefenregistrierende Härteprüfung Nanoindentierung Gerätetechnik, Indenterformen Kontaktmechanik 308
11 Inhaltsverzeichnis IX Kontaktmechanik (Vom Hertz schen Kontakt zu Sneddons Kontaktmodell) Die Oliver-Pharr-Methode Bestimmung der Fließspannung Der Constraint-Faktor Nanoindentierungen bei kleinen Lasten Phänomene und Anwendungen Anisotropie und Pile-up Diskontinuitäten in den Kraft-Eindringkurven Das Pop-in- Verhalten Einfluss von Eigenspannungen Größeneffekte Der Indentation-Size-Effect Anwendungsbeipiele (Biomaterialien, Superlegierungen, Korngrenzen) Neuere Nanoindentierungsmethoden jenseits von Härte und Elastizitätsmodul Dehnratenempfindlichkeit Hochtemperaturmessungen Indentierungskriechen 343 Literatur Röntgen-Tomografie 353 H. Berek, J. Hubálková und C.G. Aneziris 10.1 Übersicht Grundlagen der Röntgen-Tomografie Prinzip Kontrastentstehung und Abbildungsfehler In-situ-Untersuchungstechniken Quantitative Gefügeanalyse Anwendungsbeispiele Labor-Röntgen-Tomograf In-situ-Druckverformungseinrichtung In-situ-Verformung von MMC-Schäumen In-situ-Verformung von MMC-Wabenkörpern Schaumkeramik-Filter für die Metallschmelzefiltration Tauchausgussdüsen Salzbohrkerne Schaumglas Ausblick 381 Literatur Elektrochemische Korrosion 387 M. Mandel und L. Krüger 11.1 Einleitung Korrosionsarten Einflussfaktoren 388
12 X Inhaltsverzeichnis 11.4 Elektrochemische Grundlagen Ausgewählte Korrosionsprüfverfahren Potenziodynamische Polarisation Elektrochemische Impedanz-Spektroskopie Potenziodynamische Polarisation Bimetallkorrosion Dauertauchversuch Korrosionsprüfung unter wechselnden klimatischen Bedingungen 406 Literatur Verschleiß 415 R. Franke 12.1 Werkstoffwissenschaftliche Grundlagen Einführung Der Systemcharakter tribologischer Vorgänge Elemente und Wirkfaktoren eines tribologischen Systems Grundlagen der Reibung Grundlagen des Verschleißes Werkstoffe Auswahlkriterien Randschichten Auswahlkriterien Oberflächenbeschichtungen Randschichtumwandlungen Tribologische Prüfverfahren Messgrößen für tribologische Systeme Messgrößen für die Kontaktbedingungen Messgrößen für die Reibung Messgrößen für den Verschleiß Anwendungsbeispiel 439 Literatur 444 Sachverzeichnis 447
13 XI Vorwort In den vergangenen Jahren hat die Materialwissenschaft und Werkstofftechnik eine sehr dynamische Entwicklung erlebt, in der viele neue Prüf- und Analysemethoden nun auch auf standardisiertem Niveau betrieben werden. Daher ist es aktuell von hohem Interesse, diese Methoden für fortgeschrittene Studenten und junge Wissenschaftler aufzuarbeiten und diese in die Lage zu versetzen, sich zu den modernen Methoden einen Überblick zu verschaffen. Das Buch wendet sich daher an den Kreis von Master-Studenten und Doktoranden sowie Post-Docs, um ihnen einen Überblick über die Möglichkeiten und eine erste Einarbeitung in diese Methoden zu ermöglichen. Angesprochen werden Wissenschaftler in Industrie und Forschungseinrichtungen 1. der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 2. des werkstofftechnischen Maschinenbaus und 3. der materialwissenschaftlichen Bereiche der Physik, sowie 4. des Wirtschaftsingenieurwesens mit werkstofftechnischer Vertiefung. Das Lehrbuch Moderne Methoden der Werkstoffprüfung führt auf wissenschaftlichanspruchsvollemniveau in ausgewählte Techniken der Werkstoff- und Materialprüfung insbesondere metallischer Werkstoffe ein. Im Fokus stehen hierbei die Verfahren zur Ermittlung von mechanischen und bruchmechanischen Eigenschaften unter den in der Anwendung auftretenden Beanspruchungsformen sowie die analytischen Methoden der Prüfung verformter, metallischer Werkstoffe zur Aufklärung von Struktur-Eigenschafts-Beziehungen. Weiterhin werden exemplarisch die Bereiche der Korrosion und des Verschleißes behandelt, die aufgrund ihrer vielfältigen Einflüsse als Systembeanspruchungen angesehen werden müssen, sodass es hier keine einfachen Kennwerte gibt. In den einzelnen Kapiteln werden jeweils für den Einsteiger die Grundlagen der Methoden vorgestellt. Danach folgen Darstellungen der modernen Prüf- bzw. Analysetechniken sowie Anwendungsbeispiele aus der aktuellen Forschungsarbeit, wobei es sich überwiegend um experimentelle Werkstoffe handelt. Die Kapitel werden jeweils auch mit Hinweisen auf die Fachliteratur ergänzt, um die Vertiefung durch weiterführendes Literaturstudium zu ermöglichen.
14 XII Vorwort Daher wird bewusst darauf verzichtet, die Standard-Verfahren, die in den etablierten Lehrbüchern der Werkstofftechnik und -prüfung in ausreichender Zahl bereits beschrieben sind, zu behandeln. Dabei erhebt das Buch auch nicht den Anspruch, die jeweiligen Methoden vollumfänglich zu beschreiben, hierfür wird auf die umfangreiche Spezialliteratur sowie auf die einschlägigen Prüfvorschriften und Normen verwiesen. Freiberg, September 2014 Horst Biermann, Lutz Krüger
15 XIII Beitragsautoren S. Ackermann Institut für Werkstofftechnik Gustav-Zeuner-Str. 5 C.G. Aneziris TU Bergakdemie Freiberg Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik Agricolastr. 17 H. Berek Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik Agricolastr. 17 H. Biermann Institut für Werkstofftechnik Gustav-Zeuner-Str. 5 D. Ehinger Institut für Werkstofftechnik Gustav-Zeuner-Str. 5 R. Franke IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH Wilhelmine-Reichard-Ring Dresden M. Göken Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Dept. Werkstoffwissenschaften Lehrstuhl I Allgemeine Werkstoffeigenschaften Martensstr Erlangen S. Henkel Institut für Werkstofftechnik Gustav-Zeuner-Str. 5
16 XIV Beitragsautoren S. Henschel Institut für Werkstofftechnik Gustav-Zeuner-Str. 5 J. Hubálková Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik Agricolastr. 17 R. Kolmorgen Institut für Werkstofftechnik Gustav-Zeuner-Str. 5 D. Krewerth Institut für Werkstofftechnik Gustav-Zeuner-Str. 5 L. Krüger Institut für Werkstofftechnik Gustav-Zeuner-Str. 5 D. Kulawinski Institut für Werkstofftechnik Gustav-Zeuner-Str. 5 M. Mandel Institut für Werkstofftechnik Gustav-Zeuner-Str. 5 D. Rafaja Institut für Werkstoffwissenschaft Gustav-Zeuner-Str. 5 P. Trubitz Institut für Werkstofftechnik Gustav-Zeuner-Str. 5 A. Weidner Institut für Werkstofftechnik Gustav-Zeuner-Str. 5
17 1 1 Bruchmechanisches Verhalten unter quasistatischer und dynamischer Beanspruchung L. Krüger, P. Trubitz und S. Henschel 1.1 Einleitung Im allgemeinen Maschinenbau werden Konstruktionen zunächst nach klassischen Festigkeitskriterien ausgelegt. Abbildung 1.1 zeigt an einer auf Zug beanspruchten Komponente, dass in einer Beanspruchungsanalyse die wirkenden Spannungen (Beanspruchung: vorhandene Spannung σ vorh ) ermittelt werden. Durch die experimentell zu bestimmenden Werkstoffkennwerte wird die Beanspruchbarkeit (zulässige Spannung σ zul ) charakterisiert. Für das gewählte Beispiel eines glatten, allmählich auf Zug beanspruchten Bauteils ergibt sich die Beanspruchungsgröße als σ vorh = F A. Die Bewertung bezüglich der Sicherheit des Bauteils, sich nicht plastisch zu verformen oder zu brechen, erfolgt über einen Vergleich der Beanspruchungsgröße mit der experimentell zu ermittelnden Beanspruchbarkeit. Mit σ vorh σ zul ist der Festigkeitsnachweis erbracht. Sind plastische Verformungen (Bauteildeformationen) unzulässig, dienen die Streckgrenze R e oder die 0,2 %-Dehngrenze R p0,2 als Werkstoffkennwert. Ist eine plastische Verformung zulässig und nur der Bruch des Bauteils auszuschließen, wird die Zugfestigkeit R m herangezogen. In der Praxis kann es jedoch zur Abweichung von den im Beispiel dargestellten idealisierten Beanspruchungsbedingungen kommen. Lokale Überlastungen durch Fehler in der Lastannahme, Eigenspannungen, stoß- bzw. schlagartige Beanspruchungen oder Kerben und Risse sind oft nicht auszuschließen. In der Folge kann die vorhandene Spannung deutlich höher als zunächst angenommen sein, wenn sich beispielsweise Last- und Ei- Moderne Methoden der Werkstoffprüfung, Erste Auflage. Horst Biermann und Lutz Krüger (Hrsg). 2015WILEY-VCHVerlagGmbH & Co. KGaA. Published2015 bywiley-vchverlaggmbh & Co. KGaA.
18 2 1 Bruchmechanisches Verhalten unter quasistatischer und dynamischer Beanspruchung Äußere Belastung F Abmessungen A K Sicherheitsbeiwert S wirkende Spannung σ vorh = F/A Beanspruchung Festigkeitsbedingung σ vorh σ zul σ vorh σ max = F/A zulässige Spannung σ zul = K/S N mm 2, MPa Beanspruchbarkeit σ zul = K/S S > 1 A F B eine äußere statische Zugbeanspruchung S Sicherheitsbeiwert, berücksichtigt Unsicherheiten in der Lastannahme (z. B. Überbeanspruchung) in der Spannungsberechnung (z. B. Eigenspannungen) in der Kennwertermittlung bzw. -veränderung durch Zeit, Temperatur, Neutronenbestrahlung u. a. Beanspruchungseinflüsse Abb. 1.1 Ablaufschema für die Festigkeitsberechnung am Beispiel einer quasistatisch zugbeanspruchten Komponente. genspannungen überlagern. Weiterhin können Spannungsspitzen existieren, welche die berechneten und als homogen angenommenen vorhandenen Spannungen deutlich übersteigen. Die im Nennspannungsnachweis übliche Forderung nach einem homogenen beanspruchten Querschnitt stimmt weiterhin oft nicht mit der Realität überein. In Bauteilen treten u. a. Lunker, Poren, Einschlüsse, Seigerungen oder Risse auf. Die Risse können durch die Fertigung (z. B. Schweiß-, Härte-, Schleif- oder Warmrisse) oder betriebsbedingt (z. B. Ermüdung oder Korrosion) entstehen. Dadurch erhöht sich die Kerbwirkung und es treten Spannungsspitzen auf. Die Frage ist, wie der Werkstoff auf diese Überbeanspruchungen reagiert. Eine besondere Gefahr für das Bauteil geht von Sprödbrüchen aus. Durch die Behinderung der Werkstoffplastifizierung ist der Abbau der Spannungskonzentrationen durch plastische Verformung stark eingeschränkt. Es treten meist verformungsarme Trennbrüche auf. Die instabile Rissausbreitung findet in BruchteilenvonSekundenstatt.InTab.1.1sindEinflussgrößen,derenWirkungund entsprechende Werkstoffaspekte zusammengefasst. Der Bewertung der Zähigkeit kommt eine große Bedeutung zu. Unter Zähigkeit wird die Fähigkeit des Werkstoffes verstanden, unter sprödbruchfördernden Beanspruchungen des Bauteils die Überbeanspruchungen (Spannungsspitzen) durch örtliche plastische Verformung abzubauen. Typische Prüfverfahren zur Bewertung der Zähigkeit kombinieren mehrere sprödbruchfördernde Bedingungen. Dementsprechend werden für das Übergangstemperaturkonzept im Kerbschlagbiegeversuch (engl. Charpy pendulum
19 1.1 Einleitung 3 Tab. 1.1 Sprödbruchfördernde Bedingungen. Einflussgrößen Wirkungsweise Werkstoffaspekte Konstruktive Gestaltung Fertigung Beanspruchungsbedingungen Umgebungsbedingungen Werkstoffgefüge Dehnungsbehinderung (engl. constraint) durch Kerben oder große Bauteilquerschnitte (mehrachsiger Spannungszustand) Oberflächenfehler und Anrisse durch Schweißen, Härten, Schleifen, Ausbildung komplexer Eigenspannungszustände schlagartige Krafteinwirkung, mehrachsiger Spannungszustand tiefe Temperaturen, Spannungsrisskorrosion, Neutronenversprödung Grobkorn, Ausscheidungen an Korngrenzen, Alterung, Verunreinigungen, nichtmetallische Einschlüsse Streckgrenze R e bzw. 0,2 %-Dehngrenze R p0,2 Kerbwirkung Streckgrenze R e bzw. 0,2 %-Dehngrenze R p0,2 T R e bzw. R p0,2, Kerbwirkung, Elektrolytwirkung Verformbarkeit impact test) [1] zur Bestimmung der Übergangstemperatur T t (Temperatur beim Übergang vom (duktilen) Verformungsbruch zum Sprödbruch; früher als TÜ bezeichnet) mehrere gekerbte Proben bei unterschiedlichen Prüftemperaturen schlagartig beansprucht und die verbrauchte Schlagenergie (z. B. KV, KU) bestimmt. Kennwerte des Kerbschlagbiegeversuchs sind Bestandteil sehr vieler Normen bzw. Materialdatenblätter. Sie dienen für bestimmte Werkstoffzustände als Qualitätskriterium, welche sich im praktischen Einsatzfall bereits bewährt haben. Der entscheidende Nachteil dieses Prüfverfahrens ist, dass die Kennwerte (z. B. KV, KV-T-Kurve, T t ) nicht zur Bauteilauslegung herangezogen werden können, da alle Ergebnisse nur für die jeweiligen Prüfbedingungen (Probengröße, Beanspruchungsgeschwindigkeit, Kerbung, Temperatur) gültig sind. Mit der Einführung des instrumentierten Kerbschlagbiegeversuchs [2] erhält man über die globale Energiebetrachtung hinausgehend detailliertere Informationen zum Versagenshergang. Aus dem gemessenen Kraft-Durchbiegungs-Verlauf lassen sich charakteristische Werte für das Verformungs- und Schädigungsverhalten (z. B. die Fließkraft F gy, die Kräfte für die Initiierung F iu und Arretierung F a des Spaltbruches) entnehmen (Abb. 1.2). Wie schon beim nicht instrumentierten Kerbschlagbiegeversuch sind diese Kennwerte nicht zur Bauteilauslegung geeignet.
20 4 1 Bruchmechanisches Verhalten unter quasistatischer und dynamischer Beanspruchung Abb. 1.2 Kraft-Durchbiegungs-Kurve (schematisch) und kennzeichnende Kräfte des instrumentierten Kerbschlagbiegeversuchs. Um die Übertragbarkeit der Ergebnisse einer dynamischen Beanspruchung auf Bauteile zu ermöglichen, werden im Grenztemperaturkonzept Proben in Bauteildicke mit scharfen Kerben verwendet. Durch die Analyse des temperaturabhängigen Verhaltens werden Grenztemperaturen (z. B. gegen Risseinleitung/-auslösung bzw. Rissauffang, s. Tab. 1.2) ermittelt. Weit verbreitet ist u. a. der Fallgewichtsversuch nach Batelle (engl. drop weight tear test, DWTT) [3], bei dem eine Risseinleitungstemperatur T i (i = Initiierung) ermittelt wird. Aus dem Bruchbild der gekerbten Biegeprobe (Dicke 8 20 mm) wird die (Grenz)Temperatur T G oder 50 % T G ermittelt, bei welcher der nichtkristalline Bruchanteil 50 % bzw. 85 % beträgt. 85 % Prüfverfahren basierend auf dem Rissauffangkonzept (z. B. Fallgewichtsversuch nach Pellini sowie Robertson-Test) dienen der Ermittlung einer Grenztemperatur, bei der ein sich instabil ausbreitender Riss gestoppt wird. Im Fallgewichtsversuch nach Pellini (engl. drop weight test, DWT) [4, 5] wird eine mm dicke Drei-Punkt-Biegeprobe schlagartig bis zur 0,2 %-Dehngrenze durchgebogen. Auf der Zugseite befindet sich eine gekerbte spröde Einlagenschweißraupe, in der unter schlagartiger Belastung ein Sprödbruch ausgelöst wird. Als Grenztemperatur (engl. nil-ductility transition temperature, NDT-Temperatur) gilt die Prüftemperatur, bei der die Probe den sich instabil ausbreitenden Riss nicht auffangen konnte, während bei zwei weiteren Proben und um 5 K höherer Prüftemperatur in beiden Fällen der Riss aufgefangen wird. Die NDT-Temperatur kann über die Temperaturabhängigkeit der im instrumentierten Kerbschlagbiegeversuch bestimmten Rissauffangkraft F a abgeschätzt werden [6, 7]. In einer Variante des Robertson-Versuches [8 10] wird ausgehend von einem unterkühlten Bereich ein instabil wachsender Riss in einer unter Zugspannung stehenden Platte ausgelöst. Da die Gegenseite der Platte erwärmt ist, läuft der Riss in Bereiche mit zunehmender Plastizität. Es wird die Temperatur (Crack Arrest Temperature, CAT) ermittelt, bei welcher der Riss gestoppt wird. Die Grenztemperaturen dienen zur Abschätzung einer minimalen Einsatztemperatur rissfreier Bauteile. Es kann jedoch keine Auslegung von Bauteilen mit
21 1.1 Einleitung 5 Tab. 1.2 Varianten des Grenztemperaturkonzepts. Rissauslösungskonzept Bewertung der Sprödbruchsicherheit durch Vermeidung der instabilen Rissausbreitung DWTT (Drop Weight Tear Test) Grenztemperaturen T G 50 %, T G 85 % Bewertung des Rissausbreitungswiderstandes von Grobblechen, Schmiedestücken und Schweißverbindungen Rissauffangkonzept Vermögen des Werkstoffes, einen sich mit hoher Geschwindigkeit im Bauteil instabil ausbreitenden Riss vor der Zerstörung aufzufangen DWT (Drop Weight Test, Pellini-Versuch) Nil-Ductility Transition (NDT)-Temperatur Robertson-Test Crack Arrest Temperature (CAT) (Rissauffangtemperatur) rissartigen Fehlern bei dynamischer Beanspruchung durchgeführt werden. Diese Zielstellung verfolgt die Bruchmechanik bei dynamischer Beanspruchung. Sowohl das Übergangs- als auch das Grenztemperaturkonzept erlauben keine Bauteilauslegung, da Bruchvorgänge festigkeits- und zähigkeitskontrolliert ablaufen. Während die klassische Vorgehensweise des Festigkeitsnachweises den tragenden Querschnitt als homogen (d. h. fehlerfrei ohne Poren, Lunker, Risse etc.) annimmt, treten in der Praxis Fehler in Form von Rissen bzw. rissähnlichen Spannungskonzentrationsstellen (engl. stress raisers) auf, welche oftmals den Ausgangspunkt für das Werkstoff- bzw. Bauteilversagen darstellen. Diese Fehler können bereits bei der Fertigung entstehen, werden jedoch nicht gefunden, da sie in der Fehlergröße unterhalb der Nachweisgrenze der zerstörungsfreien Prüfverfahren liegen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass sich rissartige Defektstellen erst während der Verwendung des Bauteils unter Wirkung korrosiver, thermischer und/oder zyklischer Beanspruchungen bilden. Durch die Bruchmechanik soll die Bruchsicherheit von Bauteilen (Bauteilintegrität) unter Einbeziehung von Rissen oder rissähnlichen Spannungskonzentrationsstellen gewährleistet werden (Abb. 1.3). Es besteht ein quantitativer Zusammenhang zwischen der Belastung des Bauteils bzw. der Bauteilbeanspruchung, der Größe eines Risses oder einer rissartigen Spannungskonzentrationsstelle und der Werkstoffkenngröße, definiert als Werkstoffwiderstand gegen Risseinleitung oder Rissausbreitung. Die Bewertung des Werkstoffwiderstandes gegen Risseinleitung bzw. Rissinitiierung und Rissausbreitung kann unter statischer, dynamischer (schlagartiger) und zyklischer Beanspruchung erfolgen. Das Vermögen des Werkstoffes, einen
22 6 1 Bruchmechanisches Verhalten unter quasistatischer und dynamischer Beanspruchung Bauteilbeanspruchung statisch dynamisch zyklisch Werkstoffwiderstand (Bruchzähigkeit) instabile Rissausbreitung Sprödbruch LEBM stabile Rissausbreitung Verformungsbruch FBM Fehlergröße Herstellungs- und/oder beanspruchungsbedingte Risse oder rissähnliche Spannungskonzentrationsstellen, wie z. B. Lunker, Poren, Gasblasen Seigerungszonen Risse (Warmrisse, Spannungsrisse) schweißtechnisch bedingte Fehler Abb. 1.3 Prinzip des bruchmechanischen Sicherheitskonzeptes. Das bruchmechanische Dreieck, LEBM linear-elastische Bruchmechanik, FBM Fließbruchmechanik (modifiziert nach [11]). Riss aufzufangen (auch Rissarretierung, engl. crack arrest), kann unter statischen und dynamischen Beanspruchungen geprüft werden. Dadurch eröffnen sich für die Bruchmechanik die folgenden Anwendungsgebiete: Bruchmechanische Bauteilauslegung unter Einbeziehung zulässiger, nicht vermeidbarer Rissgrößen oder rissähnlicher Spannungskonzentrationsstellen. Die zulässige Spannung σ zul wird über die Bruchzähigkeit bestimmt. Bruchmechanische Nachrechnung konventionell ausgelegter Bauteile. Bewertung der Bruchsicherheit und Lebensdauer bei Annahme möglicher Risse oder rissartiger Spannungskonzentrationsstellen. Die sichere, d. h. zulässige Fehlergröße a zul wird ermittelt. Analyse von Schadensfällenund Ableitung von Maßnahmen für die zukünftige Schadensverhütung. Werkstoffentwicklung und -optimierung. 1.2 Grundlagen In Abhängigkeit von dem Vermögen des Werkstoffes, lokale Spannungsüberhöhungen durch plastische Verformungen abbauen zu können und der Größe der sich ausbildenden plastischen Zone in der Umgebung der Rissspitze existieren unterschiedliche Konzepte der Bruchmechanik. Üblicherweise wird in die linear-elastische Bruchmechanik (LEBM), die LEBM mit Kleinbereichsfließen und die Fließbruchmechanik (FBM) unterschieden. Bei Versagen eines rissbehafteten
23 1.2 Grundlagen 7 Rissbildung Bauteil (Probe) mit Riss Risseinleitung Rissausbreitung Arretierter Riss 7 instabil 1 stabil Sprödbruch Zähbruch Abb. 1.4 Möglichkeiten der Rissausbreitung (nach [10]). 5 allmähliches Risswachstum Schwingbruch Kriechbruch Spannungsrisskorrosion Bauteils durch plastische Instabilität kann die Bruchsicherheit mithilfe der plastischen Grenzlast abgeschätzt werden. Weitere Konzepte beschreiben den Rissfortschritt aufgrund zyklischer, thermischer und/oder korrosiver Beanspruchung. In der Bruchdynamik werden Beanspruchungssituationen, in denen Risse bei sehr hohen Belastungsraten initiiert werden, sowie das Ausbreitungs- und das Auffangverhalten schnell wachsender Risse betrachtet. In Abb. 1.4 sind unterschiedliche Möglichkeiten der Rissausbreitung und sich ergebende Versagenswege schematisch dargestellt [10]. Neben den drei Grundvarianten des instabilen, stabilen und allmählichen Risswachstums sind auch Wechsel im Rissausbreitungsmechanismus möglich. Beispielsweise kann ein sich zunächst stabil ausbreitender Riss beim Erreichen einer kritischen Rissgröße in die instabile Rissausbreitung und schließlich in den finalen Sprödbruch übergehen ( - - ). In einem anderen Fall wird der sich zwischenzeitlich instabil ausbreitende Riss aufgefangen bzw. arretiert ( ) Konzept der linear-elastischen Bruchmechanik In der linear-elastischen Bruchmechanik (LEBM) stehen zwei Konzepte zur Beschreibung des Werkstoffverhaltens vor der Rissspitze zur Verfügung: Spannungsverteilung vor der Rissspitze (Spannungsintensitätskonzept) und Energiebilanz bei der Rissausbreitung (Energiekonzept). Zur bruchmechanischen Bewertung hochfester und dabei relativ spröder Konstruktionswerkstoffe hat sich in der Praxis das Spannungsintensitätskonzept, auch K-Konzept genannt, durchgesetzt, welches nachfolgend näher erläutert wird.
24 8 1 Bruchmechanisches Verhalten unter quasistatischer und dynamischer Beanspruchung y σ z 2a W x B σ y B φ σ x r x σ y σ z Rissfront a z (a) σ (b) σ Abb. 1.5 Innenriss im Zugspannungsfeld gemäß dem Rissmodell von Griffith. (a) Unendlich ausgedehnte Platte mit durchgehendem Mittelriss; (b) Volumenelement mit Spannungskomponenten an der Rissspitze (modifiziert nach [10]). Tab. 1.3 Einfluss derproben-bzw.bauteildicke B auf die Spannungs- und Dehnungsverteilung vor der Rissspitze. B : Ebener Dehnungszustand (EDZ) ε z = 0, σ z = ν(σ z + σ y ) (ν Poisson sche Konstante) B : Ebener Spannungszustand (ESZ) σ z = 0, ε z = ν (E(σ x + σ y )), (E Elastizitätsmodul) Williams-Irwin-Gleichung [12]: bei φ = 0: σ x = σ y = σ πa 2πr Die Ausbildung eines mehrachsigen Spannungszustandes vor der Rissspitze in einer zugbeanspruchten Platte wird von der Verformungsbehinderung in z- Richtung in Abhängigkeit von der Plattendicke bzw. Bauteildicke B bestimmt (Abb. 1.5). In dünnen Platten bzw. dünnwandigen Bauteilen wird die Dehnung in z- Richtung nicht oder nur geringfügig behindert. Es wirkt der ebene Spannungszustand (ESZ). In dicken Platten bzw. dickwandigen Bauteilen wird die Dehnung in z-richtung behindert und ein dreiachsiger Spannungszustand erzeugt. Folglich liegt der ebene Dehnungszustand (EDZ) vor (Tab. 1.3). Der Betrag von σ z hängt von der Verformungsbehinderung in z-richtung ab. Für einen homogenen, isotropen und gleichmäßig zugbeanspruchten Körper, welcher einen durchgehenden Innenriss der Länge 2a aufweist (Abb. 1.5), wird das an der Rissspitze vorhandene Spannungsfeld unter den Voraussetzungen eines linear-elastischen Werkstoffverhaltens und r a < B, W mit der von Wes-
25 1.2 Grundlagen 9 Modus I Modus II Modus III F F y x z F F y x z F F y x z Abb. 1.6 Drei grundlegende Beanspruchungsarten eines Risses (Rissöffnungsmodi): Modus I (einfache Rissöffnung), Modus II (Längsscherung), Modus III (Querscherung) (modifiziert nach [10]). tergaard [13] vorgeschlagenen Spannungsfunktion beschrieben: σ ij = K 2πr f ij (φ). (1.1) σ ij sind die Spannungen in einem durch die Polarkoordinaten r und φ festgelegten Volumenelement vor der Rissspitze. Demzufolge steigen die Spannungen mit Annäherung an die Rissspitze proportional zu r 1 2 an und erreichen für den Fall r 0 einen unendlich hohen Wert (= Singularität des Spannungszustandes). Die Abhängigkeit von φ wird durch die dimensionslosen Funktionen f ij wiedergegeben. Nach Irwin [14] liegt für eine im Vergleich zur Rissgröße unendlich große Platte mit elastischem Werkstoffverhalten Sprödbruchgefahr vor, wenn ein kritischer Wert erreicht bzw. überschritten wird. Darauf basierend wird der Betrag der Spannungskomponenten σ x und σ y vor der Rissspitze durch den Spannungsintensitätsfaktor K beschrieben: K = σ πa. (1.2) Bestimmt von der Lage des Risses zur Beanspruchungsrichtung und der möglichen Relativbewegung der Rissoberflächen werden drei Rissöffnungsmodi bzw. die Spannungsintensitätsfaktoren K I, K II und K III unterschieden (Abb. 1.6). Modus I stellt die häufigste Beanspruchungsart dar. Er umfasst alle Normalbeanspruchungen, welche ein symmetrisches Öffnen des Risses bewirken. Es ist zudem der gefährlichste Versagensfall, sodass in der Praxis oft zunächst das Risswiderstandsverhalten unter diesen Bedingungen untersucht wird. Treten die grundlegenden Rissbeanspruchungsarten in Kombination auf, so wird dies mit Mixed-Mode-Beanspruchung bezeichnet. Für endlich ausgedehnte Platten bzw. Bauteilgeometrien, die dem Rissöffnungsmodus I unterliegen, berechnet sich der Spannungsintensitätsfaktor K I wie folgt: K I = σ πa f. (1.3) K I ist die bruchmechanische Beanspruchungsgröße, welche die Beanspruchung des Werkstoffes vor der Rissspitze charakterisiert. σ und a charakterisieren die
26 10 1 Bruchmechanisches Verhalten unter quasistatischer und dynamischer Beanspruchung ESZ Mischzustand EDZ K c max kritischer Spannungsintensitätsfaktor K, Q K c K Ic s B 2 K I Bauteildicke B B c = 2,5( Re ) Abb. 1.7 Einfluss der Platten- bzw. Bauteildicke B auf den kritischen Spannungsintensitätsfaktor K c für den Rissöffnungsmodus I, schematische Veränderung des Versagensbildesin Abhängigkeitvon B mit Übergang vom Scherbruch (ESZ) zum Normalspannungsbruch (EDZ); s kennzeichnet die Breite der Scherlippen (modifiziert nach [10]). wirkende Spannung, bezogen auf den ungeschwächten Querschnitt sowie die Risslänge. Der Geometriefaktor f ist eine Korrekturfunktion und berücksichtigt die Rissform, die Rissart sowie die Bauteilgeometrie (abhängig vom (a W )- Verhältnis). Die K-Faktoren sind abhängig von der Rissöffnungsart und können mithilfe von elastizitätstheoretischen und numerischen Verfahren sowie experimentellen Methoden ermittelt werden. Eine Zusammenfassung von K-Lösungen für zahlreiche Beanspruchungssituationen wird in Nachschlagewerken gegeben [15, 16]. Zur Bewertung der Sicherheit gegen Bruch eines mechanisch beanspruchten, rissbehafteten Bauteils wird die berechnete Beanspruchungsgröße K I mit dem experimentell bestimmten bruchmechanischen Werkstoffkennwert K Ic (auch als kritischer Spannungsintensitätsfaktor oder Bruchzähigkeit bezeichnet) verglichen: K I = σ K Ic Sprödbruch πa f < K Ic Sprödbruchsicherheit bei statischer (1.4) Beanspruchung. Die Bruchzähigkeit K Q bzw. K c ist im K-Konzept bei Wirkung des ebenen Spannungszustandes (ESZ) oder bei Mischzuständen aus ESZ und ebenem Dehnungszustand (EDZ) von der Platten- bzw. Bauteildicke B abhängig (Abb. 1.7). Erst beim Erreichen bzw. Überschreiten einer vom Werkstoff abhängigen Mindestbauteildicke B c stellt sich der untere Grenzwert K Ic (geometrieunabhängig) ein und die Bedingungen des EDZ sind erfüllt. Für zahlreiche hochfeste und dennoch duktile Werkstoffe, wie sie im Kraftwerks-, Stahl- und Maschinenbau eingesetzt werden, findet vor der beanspruchten Rissspitze Kleinbereichsfließen (engl. small scale yielding) statt. Die Größe der plastischen Zone r pl bildet sich über die Plattendicke B aufgrund der Wirkung
27 1.2 Grundlagen 11 σ Probenmitte Oberfläche ESZ Oberfläche y z B r pl Rissspitze x W Hundeknochen EDZ σ Abb. 1.8 Modell der plastischen Zone beim Kleinbereichsfließen in einem dickwandigen Bauteil (modifiziert nach [17, 18]). des ebenen Spannungszustandes (ESZ) an der Oberfläche und des ebenen Dehnungszustandes (EDZ) in der Probenmitte aus. Folglich ähnelt die Form der plastischen Zone einem Hundeknochen, beschrieben durch das gleichnamige Dogbone-model (Abb. 1.8). 3D-FEM-Berechnungen haben jedoch gezeigt, dass die tatsächliche Form und Größe der plastischen Zone von dieser Modellvorstellung abweichen [10]. Mit Kenntnis der Streckgrenze R e bzw. der 0,2 %-Dehngrenze R p0,2 und der Poisson schen Konstante ν des Werkstoffes lässt sich die Größe der plastischen Zone im Ligament abschätzen [10]: ( KI ) 2 (1.5) r pl = 1 2π R e für den ebenen Spannungszustand (ESZ) und ( KI ) 2 (1 2ν) 2 (1.6) r pl = 1 2π R e für den ebenen Dehnungszustand (EDZ). Demnach ergibt sich die effektive Risslänge a eff aus der Ausgangsrisslänge a 0 und dem Radius der plastischen Zone r pl : a eff = a 0 + r pl. (1.7) Unter der Voraussetzung, dass die plastische Zone im Vergleich zu den Bauteildimensionen deutlich kleiner ist (d. h. r pl W, B), berechnet sich der effektive Spannungsintensitätsfaktor im Rissöffnungsmodus I, K Ieff,wiefolgt: K Ieff = σ ( aeff ) πa eff f. (1.8) W
28 12 1 Bruchmechanisches Verhalten unter quasistatischer und dynamischer Beanspruchung Die Erweiterung der LEBM auf das Kleinbereichsfließen setzt voraus, dass die Vorgänge in der plastischen Zone eindeutig von der umgebenden K-dominierten Region bestimmt werden Konzepte der Fließbruchmechanik Sind die Forderungen nach Kleinheit der plastischen Zone vor der Rissspitze nicht mehr erfüllt, tritt ein sich über mehrere Stadien erstreckendes duktiles Bruchverhalten ein. Dies wird mit der Fließbruchmechanik (FBM) beschrieben.in metallischen Werkstoffen werden Gleitvorgänge in der plastischen Zone beobachtet, die zu einer Abstumpfung und Vorwölbung der Rissspitze, dem crack tip blunting, und der Ausbildung der sog. Stretchzone, der Bildung von Poren bzw. Hohlräumen und deren Zusammenschluss führen, ehe die eigentliche stabile Rissausbreitung einsetzt (Abb. 1.9). Bei hochzähen Stählen kann die Ausbildung von Mehrfachstretchzonen beobachtet werden. Rissabstumpfungsgerade Risswiderstandskurve J-Integral, CTOD J i, δ i stabile Rissausbreitung Stretchzone Gewaltbruch Riss SZB C SZH C Rissspitze SZB C SZH C = kritische Stretchzonenhöhe SZB C = kritische Stretchzonenbreite Rissausbreitung Δa Entstehen der Stretchzone 3. Lastzunahme δ i Entstehen von Hohlräumen vor der Rissspitze Zusammenwachsen der Hohlräume und Risseinleitung, Bildung der Stretchzone abgeschlossen SZH C SZB C 6. Stabile Rissausbreitung Δa Abb. 1.9 Risswiderstandskurve mit den Veränderungen an der Rissspitze sowie schematische Darstellung der Stretchzone an der Rissspitze (modifiziert nach [10]).
29 1.2 Grundlagen 13 Das duktile Werkstoffverhalten und die ablaufenden Schädigungsmechanismen werden in den fließbruchmechanischen Konzepten CTOD- und J-Integral- Konzept sowie bei der entsprechenden Kennwertbestimmung berücksichtigt. Das von Wells [19] entwickelte CTOD (engl. crack tip opening displacement)- Konzept definiert eine Rissspitzenöffnung δ nach dem Dugdale-Modell: δ = 8R ea πe ln sec ( π 2 ) σ R e mit der Streckgrenze R e. Approximiert nach σ R e < 0,6 gilt (1.9) δ = πσ2 a ER e. (1.10) Das Bruchsicherheitskriterium ist erfüllt, wenn δ Bauteil < δ c gilt. δ c ist der experimentell zu ermittelnde Werkstoffwiderstand und entspricht dem Beginn der stabilen Rissausbreitung bei duktilem Werkstoffverhalten. δ c wird auch als kritische Rissspitzenöffnung bezeichnet. Zur Erweiterung der Fließbruchmechanik und zur Abbildung eines nichtlinear-elastischen Werkstoffverhaltens führten Cherepanov [20] und Rice [21] das energiebasierte J-Integral-Konzept ein. Das J-Integral dient analog zum Spannungsintensitätsfaktor K der linear-elastischen Bruchmechanik als wesentlicher Kennwert zur Beschreibung des Spannungs- und Verschiebungsfeldes an der Rissspitze. Diese Beschreibung erfolgt weitgehend unabhängig vom Integrationsweg, sodass auch größere Fließbereiche vor der Rissspitze betrachtet werden können. Das J-Integral charakterisiert dabei die Änderung der potenziellen Energie bzw. Formänderungsenergie du vor der sich bildenden Rissfläche da = B da [22] bzw. vereinfacht bei einer Rissverlängerung da [21] (engl.strain energy). J = du da = 1 du B da Nach Rice, Paris und Merkle [23] gilt als Näherungslösung: (1.11) U J = η B(W a 0 ). (1.12) η ist von der Probengeometrie und der Belastungsart abhängig. Da die Vorgänge in Umgebung der plastischen Zone nun von einer J-dominanten Region bestimmt werden, lautet das Bruchsicherheitskriterium J Bauteil < J c. Hierbei charakterisiert J c den experimentell zu ermittelnden Werkstoffwiderstand gegen Risseinleitung bzw. den Beginn der stabilen Rissausbreitung bei duktilem Werkstoffverhalten. Ausgehend von einer kleinen plastischen Zone um die Rissspitze und einer reinen Modus I-Beanspruchung gelten die Zusammenhänge [10]: J I = K 2 I E (1.13)
30 14 1 Bruchmechanisches Verhalten unter quasistatischer und dynamischer Beanspruchung für den ESZ und für den EDZ. J I = K 2 I (1 ν2 ) E (1.14) Bruchzähigkeitsverhalten im spröd-duktilen Übergangsbereich dasmaster-curve-konzept Für Stähle mit kubisch-raumzentriertem Gittertyp ist ein ausgeprägtes Übergangsverhalten der Kerbschlagarbeit und der Bruchzähigkeit mit der Prüftemperatur bekannt. In der Tieflage findet spaltflächige Rissausbreitung und in der Hochlage duktile Rissausbreitung statt. Im unteren spröd-duktilen Übergangsbereich versagt der Werkstoff nach unterschiedlichen Beträgen der Plastifizierung desligamentes(w a 0 ). Im oberen Übergangsbereich wirken beide Bruchmechanismen. Zunächst bildet sich eine plastische Zone aus und nach einer duktilen Rissinitiierung sowie stabilem Rissfortschritt setzt der instabile Spaltbruch ein. Dieser Übergangsbereich ist durch eine deutlich höhere Streuung der Zähigkeitskennwerte gekennzeichnet. In der Tieflage tritt Spaltbruch auf und die Bruchzähigkeit K Ic des Werkstoffes wird üblicherweise nach entsprechenden Prüfnormen wie z. B. der ASTM E399 [24] bestimmt. Die Einleitung der spaltflächigen Rissausbreitung ist ein spannungskontrollierter Prozess. Lokale Spannungen und Dehnungen führen zu einem Aufstau von Versetzungen an Korngrenzen oder Karbiden, sodass sich ein gebildeter Mikroriss mit hoher Geschwindigkeit ausbreitet. Weiterhin wird in der Tieflage der Spaltbruch an mehreren Schwachstellen des Gefüges initiiert. Mit zunehmender Temperatur sind größere, einzelne Schwachstellen im Werkstoff für die Auslösung eines Spaltbruches notwendig [25] (Abb. 1.10). Da technische Werkstoffe immer Gefügeinhomogenitäten aufweisen, werden die Initiierung des Spaltbruches und der makroskopische Sprödbruch als statistischerprozessbetrachtet, deraus einemweakest-link-modell und einem statisti- spröd-duktiler Übergang Tieflage Rissausbreitung Abb Typische Bruchflächen von angerissenen Proben mit Unterschieden im Bruchverhalten (modifiziert nach [25]).
Herausgegeben von Horst Biermann und Lutz Krüger. Moderne Methoden der Werkstoffprüfung
 Herausgegeben von Horst Biermann und Lutz Krüger Moderne Methoden der Werkstoffprüfung Herausgegeben von Horst Biermann und Lutz Krüger Moderne Methoden der Werkstoffprüfung Beachten Sie bitte auch weitere
Herausgegeben von Horst Biermann und Lutz Krüger Moderne Methoden der Werkstoffprüfung Herausgegeben von Horst Biermann und Lutz Krüger Moderne Methoden der Werkstoffprüfung Beachten Sie bitte auch weitere
1 Bruchmechanisches Verhalten unter quasistatischer und dynamischer Beanspruchung
 1 1 Bruchmechanisches Verhalten unter quasistatischer und dynamischer Beanspruchung L.Krüger,P.TrubitzundS.Henschel 1.1 Einleitung Im allgemeinen Maschinenbau werden Konstruktionen zunächst nach klassischen
1 1 Bruchmechanisches Verhalten unter quasistatischer und dynamischer Beanspruchung L.Krüger,P.TrubitzundS.Henschel 1.1 Einleitung Im allgemeinen Maschinenbau werden Konstruktionen zunächst nach klassischen
Grundlagen der Bruchmechanik
 Grundlagen der Bruchmechanik H.-J. Christ Institut für Werkstofftechnik Universität Siegen 1. Einführung 2. Grundbegriffe und Konzepte der Linear- Elastischen Bruchmechanik 3. Beschreibung der Ermüdungsrissausbreitung
Grundlagen der Bruchmechanik H.-J. Christ Institut für Werkstofftechnik Universität Siegen 1. Einführung 2. Grundbegriffe und Konzepte der Linear- Elastischen Bruchmechanik 3. Beschreibung der Ermüdungsrissausbreitung
FVK Kontrollfragen. 2. Nennen Sie aus werkstofftechnischer Sicht mögliche Versagensarten.
 Institut für Werkstofftechnik Metallische Werkstoffe Prof. Dr.-Ing. Berthold Scholtes FVK Kontrollfragen Abschnitt 1 1. Erläutern Sie den Zusammenhang zwischen Werkstoff, Fertigung, konstruktiver Gestaltung,
Institut für Werkstofftechnik Metallische Werkstoffe Prof. Dr.-Ing. Berthold Scholtes FVK Kontrollfragen Abschnitt 1 1. Erläutern Sie den Zusammenhang zwischen Werkstoff, Fertigung, konstruktiver Gestaltung,
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg
 TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg GRUNDLAGEN SEKUNDARSTUFE I Modul: Versuch: Mechanische Werkstoffeigenschaften
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg GRUNDLAGEN SEKUNDARSTUFE I Modul: Versuch: Mechanische Werkstoffeigenschaften
Prof. Dr. Martina Zimmermann Schadensanalyse MB. Vorlesung Schadensanalyse. Risse und Fraktographie Teil 1
 Vorlesung Schadensanalyse Risse und Fraktographie Teil 1 Brucharten Darstellung von Bruchspezifikationen in perspektivischen Skizzen Brucharten Mechanisch bedingte Risse und Brüche Gewaltbruch Schwingbruch
Vorlesung Schadensanalyse Risse und Fraktographie Teil 1 Brucharten Darstellung von Bruchspezifikationen in perspektivischen Skizzen Brucharten Mechanisch bedingte Risse und Brüche Gewaltbruch Schwingbruch
Werkstofftechnik. Praktikum Bruchverhalten/Kerbschlagbiegversuch
 Werkstofftechnik Praktikum Bruchverhalten/Kerbschlagbiegversuch Inhalt: 1. Grundsätzliches zur Dimensionierung von Bauteilen 2. Sprödbruchfördernde Bedingungen 2.1. Werkstoffverhalten bei hoher Verformungsgeschwindigkeit
Werkstofftechnik Praktikum Bruchverhalten/Kerbschlagbiegversuch Inhalt: 1. Grundsätzliches zur Dimensionierung von Bauteilen 2. Sprödbruchfördernde Bedingungen 2.1. Werkstoffverhalten bei hoher Verformungsgeschwindigkeit
Masterprüfung. Werkstofftechnik der Stähle
 Masterprüfung Werkstofftechnik der Stähle 31.03.2016 Name: Matrikelnummer: Unterschrift: Aufgabe Punkte: Erreichte Punkte: 1 7 2 6 3 10 4 7.5 5 6 6 3 7 4 8 5 9 7 10 3.5 11 8 12 8 13 8 14 8 15 5 16 4 Punkte
Masterprüfung Werkstofftechnik der Stähle 31.03.2016 Name: Matrikelnummer: Unterschrift: Aufgabe Punkte: Erreichte Punkte: 1 7 2 6 3 10 4 7.5 5 6 6 3 7 4 8 5 9 7 10 3.5 11 8 12 8 13 8 14 8 15 5 16 4 Punkte
Werkstofftechnik. Wolfgang Seidel. Werkstoffe - Eigenschaften - Prüfung - Anwendung ISBN Leseprobe
 Werkstofftechnik Wolfgang Seidel Werkstoffe - Eigenschaften - Prüfung - Anwendung ISBN 3-446-22900-0 Leseprobe Weitere Informationen oder Bestellungen unter http://www.hanser.de/3-446-22900-0 sowie im
Werkstofftechnik Wolfgang Seidel Werkstoffe - Eigenschaften - Prüfung - Anwendung ISBN 3-446-22900-0 Leseprobe Weitere Informationen oder Bestellungen unter http://www.hanser.de/3-446-22900-0 sowie im
Werkstofftechnik. Entstehen aus den Folgen einer ungeeigneten Behandlung bei der Herstellung, wie bei der Urformung, Umformung oder Wärmebehandlung.
 Einflussbereich Werkstoff Die Eigenschaften des Werkstoffes bestimmen die Eigenschaften des Bauteiles gegenüber den Betriebsbeanspruchungen und damit die Lebensdauer. Die Betriebsbeanspruchungen, wie stoßartig,
Einflussbereich Werkstoff Die Eigenschaften des Werkstoffes bestimmen die Eigenschaften des Bauteiles gegenüber den Betriebsbeanspruchungen und damit die Lebensdauer. Die Betriebsbeanspruchungen, wie stoßartig,
Leseprobe. Wolfgang W. Seidel, Frank Hahn. Werkstofftechnik. Werkstoffe - Eigenschaften - Prüfung - Anwendung ISBN:
 Leseprobe Wolfgang W. Seidel, rank Hahn Werkstofftechnik Werkstoffe - Eigenschaften - Prüfung - Anwendung ISBN: 978-3-446-43073-0 Weitere Informationen oder Bestellungen unter http://www.hanser.de/978-3-446-43073-0
Leseprobe Wolfgang W. Seidel, rank Hahn Werkstofftechnik Werkstoffe - Eigenschaften - Prüfung - Anwendung ISBN: 978-3-446-43073-0 Weitere Informationen oder Bestellungen unter http://www.hanser.de/978-3-446-43073-0
Einsatz von höherfesten unlegierten Gusseisensorten in Windenergie-Getrieben
 Artikel Einsatz von höherfesten unlegierten Gusseisensorten in Windenergie-Getrieben verfasst von Dipl.-Ing. Steffen Schreiber und Dipl.-Ing. Fabio Pollicino Germanischer Lloyd WindEnergie GmbH Abteilung
Artikel Einsatz von höherfesten unlegierten Gusseisensorten in Windenergie-Getrieben verfasst von Dipl.-Ing. Steffen Schreiber und Dipl.-Ing. Fabio Pollicino Germanischer Lloyd WindEnergie GmbH Abteilung
Masterprüfung Werkstofftechnik der Stähle
 Name: Masterprüfung Werkstofftechnik der Stähle 26.03.2015 Matrikelnummer: Unterschrift: Aufgabe Maximalanzahl an Punkten: Punkte erreicht: Punkte nach Einsicht (nur zusätzliche Punkte) 1 5 2 9 3 4 4 10
Name: Masterprüfung Werkstofftechnik der Stähle 26.03.2015 Matrikelnummer: Unterschrift: Aufgabe Maximalanzahl an Punkten: Punkte erreicht: Punkte nach Einsicht (nur zusätzliche Punkte) 1 5 2 9 3 4 4 10
Prof. Dr. Martina Zimmermann Schadensanalyse WW. Vorlesung Schadensanalyse. Bewertung von Rissen in Bauteilen
 Vorlesung Schadensanalyse Bewertung von Rissen in Bauteilen Allgemein: Untersuchungsverfahren Mechanische Prüfung Härteprüfung statische Festigkeitsprüfung Festigkeitsprüfung bei schlagartiger Beanspruchung
Vorlesung Schadensanalyse Bewertung von Rissen in Bauteilen Allgemein: Untersuchungsverfahren Mechanische Prüfung Härteprüfung statische Festigkeitsprüfung Festigkeitsprüfung bei schlagartiger Beanspruchung
Zugversuch - Metalle nach DIN EN ISO
 WT-Praktikum-Zugversuch-Metalle.doc 1 1. Grundlagen 1.1. Zweck dieses Versuchs Im Zugversuch nach DIN EN ISO 689-1 (DIN EN 1) an Proben mit konstanten Querschnitten über die Prüflänge, wird das Werkstoffverhalten
WT-Praktikum-Zugversuch-Metalle.doc 1 1. Grundlagen 1.1. Zweck dieses Versuchs Im Zugversuch nach DIN EN ISO 689-1 (DIN EN 1) an Proben mit konstanten Querschnitten über die Prüflänge, wird das Werkstoffverhalten
Während der Klausur stehen die Assistenten für Fragen zur Verfügung. Erreichte Punkte: Punkte:
 RHEINISCH- WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN Institut für Eisenhüttenkunde Diplomprüfung Vertiefungsfach A "Werkstoffwissenschaften Stahl" der Studienrichtung Metallische Werkstoffe des Masterstudienganges
RHEINISCH- WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN Institut für Eisenhüttenkunde Diplomprüfung Vertiefungsfach A "Werkstoffwissenschaften Stahl" der Studienrichtung Metallische Werkstoffe des Masterstudienganges
Master-/ Diplomprüfung. Vertiefungsfach I "Werkstofftechnik der Stähle" Vertiefungsfach I "Werkstoffwissenschaften Stahl" am
 Institut für Eisenhüttenkunde Departmend of Ferrous Metallurgy Name: Master-/ Diplomprüfung Vertiefungsfach I "Werkstofftechnik der Stähle" Vertiefungsfach I "Werkstoffwissenschaften Stahl" am 25.02.2014
Institut für Eisenhüttenkunde Departmend of Ferrous Metallurgy Name: Master-/ Diplomprüfung Vertiefungsfach I "Werkstofftechnik der Stähle" Vertiefungsfach I "Werkstoffwissenschaften Stahl" am 25.02.2014
Schadensanalyse in der Industrie
 Schadensanalyse in der Industrie Dr. Maren Kraack, LOM GmbH LOM GmbH Inhalt Theorie Schadensanalyse Schadensaufnahme Beschreibung der Arbeitsschritte Beispiele Was muss man wissen? Rissausgang Ort der
Schadensanalyse in der Industrie Dr. Maren Kraack, LOM GmbH LOM GmbH Inhalt Theorie Schadensanalyse Schadensaufnahme Beschreibung der Arbeitsschritte Beispiele Was muss man wissen? Rissausgang Ort der
5 Mechanische Eigenschaften
 5 Mechanische Eigenschaften 5.1 Mechanische Beanspruchung und Elastizität 5.1 Frage 5.1.1: Kennzeichnen Sie qualitativ die Art der Beanspruchung des Werkstoffes unter folgenden Betriebsbedingungen: a)
5 Mechanische Eigenschaften 5.1 Mechanische Beanspruchung und Elastizität 5.1 Frage 5.1.1: Kennzeichnen Sie qualitativ die Art der Beanspruchung des Werkstoffes unter folgenden Betriebsbedingungen: a)
Betriebsfestigkeit und Bruchmechanik
 Betriebsfestigkeit und Bruchmechanik Vorlesung / Übung Vorlesung 1 Aufgabenkatalog zur Prüfung am 20.07. und 10.08.2017 1.1) Ordnen Sie den Begriff Betriebsfestigkeit ein und nennen Sie wesentliche Merkmale!
Betriebsfestigkeit und Bruchmechanik Vorlesung / Übung Vorlesung 1 Aufgabenkatalog zur Prüfung am 20.07. und 10.08.2017 1.1) Ordnen Sie den Begriff Betriebsfestigkeit ein und nennen Sie wesentliche Merkmale!
Mindest-Radaufstandsbreite bzw. Mindestbreite der Spurkranzkuppe
 Bearbeitungsstand: März 24 Ausgabe: Mai 26 Anhang 4 Mindest-Radaufstandsbreite bzw. Mindestbreite der Spurkranzkuppe Die Ermittlung der Mindest-Radaufstandsbreite bzw. der Mindestbreite der Spurkranzkuppe
Bearbeitungsstand: März 24 Ausgabe: Mai 26 Anhang 4 Mindest-Radaufstandsbreite bzw. Mindestbreite der Spurkranzkuppe Die Ermittlung der Mindest-Radaufstandsbreite bzw. der Mindestbreite der Spurkranzkuppe
4. Werkstoffeigenschaften. 4.1 Mechanische Eigenschaften
 4. Werkstoffeigenschaften 4.1 Mechanische Eigenschaften Die mechanischen Eigenschaften kennzeichnen das Verhalten von Werkstoffen gegenüber äußeren Beanspruchungen. Es können im allg. 3 Stadien der Verformung
4. Werkstoffeigenschaften 4.1 Mechanische Eigenschaften Die mechanischen Eigenschaften kennzeichnen das Verhalten von Werkstoffen gegenüber äußeren Beanspruchungen. Es können im allg. 3 Stadien der Verformung
1 Die elastischen Konstanten 10 Punkte
 1 Die elastischen Konstanten 10 Punkte 1.1 Ein Würfel wird einachsig unter Zug belastet. a) Definieren Sie durch Verwendung einer Skizze den Begriff der Spannung und der Dehnung. b) Der Würfel werde im
1 Die elastischen Konstanten 10 Punkte 1.1 Ein Würfel wird einachsig unter Zug belastet. a) Definieren Sie durch Verwendung einer Skizze den Begriff der Spannung und der Dehnung. b) Der Würfel werde im
Biegung
 2. Biegung Wie die Normalkraft resultiert auch das Biegemoment aus einer Normalspannung. Das Koordinatensystem des Balkens wird so gewählt, dass die Flächenschwerpunkte der Querschnitte auf der x-achse
2. Biegung Wie die Normalkraft resultiert auch das Biegemoment aus einer Normalspannung. Das Koordinatensystem des Balkens wird so gewählt, dass die Flächenschwerpunkte der Querschnitte auf der x-achse
1. Zug und Druck in Stäben
 1. Zug und Druck in Stäben Stäbe sind Bauteile, deren Querschnittsabmessungen klein gegenüber ihrer änge sind: D Sie werden nur in ihrer ängsrichtung auf Zug oder Druck belastet. D Prof. Dr. Wandinger
1. Zug und Druck in Stäben Stäbe sind Bauteile, deren Querschnittsabmessungen klein gegenüber ihrer änge sind: D Sie werden nur in ihrer ängsrichtung auf Zug oder Druck belastet. D Prof. Dr. Wandinger
Mechanische Prüfverfahren
 1. Grundlagen Das Ziel der Werkstoffprüfung ist die eindeutige Beschreibung eines Werkstoffes beziehungsweise eines Bauteiles hinsichtlich seiner Eigenschaften. Dabei liefert die Untersuchung von Werkstoffen
1. Grundlagen Das Ziel der Werkstoffprüfung ist die eindeutige Beschreibung eines Werkstoffes beziehungsweise eines Bauteiles hinsichtlich seiner Eigenschaften. Dabei liefert die Untersuchung von Werkstoffen
FEM-Modellbildung und -Berechnung von Kehlnähten
 FEM-Modellbildung und -Berechnung von Kehlnähten 1. Problemstellung und Lösungskonzept Die wesentliche Schwierigkeit bei der Berechnung einer Kehlnaht ist die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Geometrie
FEM-Modellbildung und -Berechnung von Kehlnähten 1. Problemstellung und Lösungskonzept Die wesentliche Schwierigkeit bei der Berechnung einer Kehlnaht ist die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Geometrie
CARL HANSER VERLAG. Burkhard Heine. Werkstoffprüfung Ermittlung von Werkstoffeigenschaften
 CARL HANSER VERLAG Burkhard Heine Werkstoffprüfung Ermittlung von Werkstoffeigenschaften 3-446-22284-7 www.hanser.de Inhaltsverzeichnis 1 Strahlung und Wellen.................................. 13 1.1 Elektronenstrahlung................................
CARL HANSER VERLAG Burkhard Heine Werkstoffprüfung Ermittlung von Werkstoffeigenschaften 3-446-22284-7 www.hanser.de Inhaltsverzeichnis 1 Strahlung und Wellen.................................. 13 1.1 Elektronenstrahlung................................
Werkstoffprüfung. Ermittlung der Eigenschaften metallischer. Burkhard Heine. Werkstoffe. 3., aktualisierte Auflage. Fachbuchverlag Leipzig
 Burkhard Heine Werkstoffprüfung Ermittlung der Eigenschaften metallischer Werkstoffe 3., aktualisierte Auflage mit 363 Bildern und zahlreichen Tabellen Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag Kristallstruktur
Burkhard Heine Werkstoffprüfung Ermittlung der Eigenschaften metallischer Werkstoffe 3., aktualisierte Auflage mit 363 Bildern und zahlreichen Tabellen Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag Kristallstruktur
12 2 Grundbelastungsarten
 2.1 Zug 11 Der Elastizitätsmodul kann als diejenige Spannung interpretiert werden, die erforderlich ist, um den Probestab auf das Doppelte seiner Länge gegenüber dem unbelasteten Zustand zu dehnen. In
2.1 Zug 11 Der Elastizitätsmodul kann als diejenige Spannung interpretiert werden, die erforderlich ist, um den Probestab auf das Doppelte seiner Länge gegenüber dem unbelasteten Zustand zu dehnen. In
Zugversuch. 1. Einleitung, Aufgabenstellung. 2. Grundlagen. Werkstoffwissenschaftliches Grundpraktikum Versuch vom 11. Mai 2009
 Werkstoffwissenschaftliches Grundpraktikum Versuch vom 11. Mai 29 Zugversuch Gruppe 3 Protokoll: Simon Kumm Mitarbeiter: Philipp Kaller, Paul Rossi 1. Einleitung, Aufgabenstellung Im Zugversuch sollen
Werkstoffwissenschaftliches Grundpraktikum Versuch vom 11. Mai 29 Zugversuch Gruppe 3 Protokoll: Simon Kumm Mitarbeiter: Philipp Kaller, Paul Rossi 1. Einleitung, Aufgabenstellung Im Zugversuch sollen
Berechnungsmethodik zur Beurteilung von mechatronischen Bauteilen unter großen Temperaturschwankungen
 Schriftenreihe des Fachgebiets für Mechatronik mit dem Schwerpunkt Fahrzeuge 17 / 01 Patrick Obermann Berechnungsmethodik zur Beurteilung von mechatronischen Bauteilen unter großen Temperaturschwankungen
Schriftenreihe des Fachgebiets für Mechatronik mit dem Schwerpunkt Fahrzeuge 17 / 01 Patrick Obermann Berechnungsmethodik zur Beurteilung von mechatronischen Bauteilen unter großen Temperaturschwankungen
Instrumentierte Pendelschlagprüfung an Kunststoffen
 Prüfen mit Verstand Instrumentierte Pendelschlagprüfung an Kunststoffen Agenda Pendelschlagprüfung Grundlagen Versuche / Prüfserien Zusammenfassung 2 Pendelschlagprüfung Grundlagen Zwick bietet ein vollständiges
Prüfen mit Verstand Instrumentierte Pendelschlagprüfung an Kunststoffen Agenda Pendelschlagprüfung Grundlagen Versuche / Prüfserien Zusammenfassung 2 Pendelschlagprüfung Grundlagen Zwick bietet ein vollständiges
Zugversuch - Metalle nach DIN EN 10002
 WT-Praktikum-Verbundstudium-Versuch1-Zugversuch-Metalle 1 1. Grundlagen 1.1. Zweck dieses Versuchs Im Zugversuch nach DIN EN 1 an Proben mit konstanten Querschnitten über die Prüflänge, wird das Werkstoffverhalten
WT-Praktikum-Verbundstudium-Versuch1-Zugversuch-Metalle 1 1. Grundlagen 1.1. Zweck dieses Versuchs Im Zugversuch nach DIN EN 1 an Proben mit konstanten Querschnitten über die Prüflänge, wird das Werkstoffverhalten
HANDOUT. Vorlesung: Keramik-Grundlagen. Gefüge und Mechanische Eigenschaften keramischer Werkstoffe
 Materialwissenschaft und Werkstofftechnik an der Universität des Saarlandes HANDOUT Vorlesung: Keramik-Grundlagen Gefüge und Mechanische Eigenschaften keramischer Werkstoffe Leitsatz: 17.12.2015 "Die begrenzte
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik an der Universität des Saarlandes HANDOUT Vorlesung: Keramik-Grundlagen Gefüge und Mechanische Eigenschaften keramischer Werkstoffe Leitsatz: 17.12.2015 "Die begrenzte
Die Big Five und ihre Auswirkungen auf das Gründungsverhalten
 Nadine Schlabes Die Big Five und ihre Auswirkungen auf das Gründungsverhalten Eine konzeptionelle Studie Bachelorarbeit Schlabes, Nadine: Die Big Five und ihre Auswirkungen auf das Gründungsverhalten.
Nadine Schlabes Die Big Five und ihre Auswirkungen auf das Gründungsverhalten Eine konzeptionelle Studie Bachelorarbeit Schlabes, Nadine: Die Big Five und ihre Auswirkungen auf das Gründungsverhalten.
HANDOUT. Vorlesung: Glas-Grundlagen. Mechanische Eigenschaften
 Materialwissenschaft und Werkstofftechnik an der Universität des Saarlandes HANDOUT Vorlesung: Glas-Grundlagen Mechanische Eigenschaften Leitsatz: 02.06.2016 "Die große Schwankungsbreite der erreichten
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik an der Universität des Saarlandes HANDOUT Vorlesung: Glas-Grundlagen Mechanische Eigenschaften Leitsatz: 02.06.2016 "Die große Schwankungsbreite der erreichten
Zugversuch. Carsten Meyer. Raum 110. Telefon: Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau
 Carsten Meyer c.meyer@iwm.rwth-aachen.de Raum 110 Telefon: 80-95255 F F S 0 σ F S 0 äußere Kraft Spannung ( innere Kraft ) Jeder noch so kleine Teil des Querschnittes überträgt einen noch so kleinen Teil
Carsten Meyer c.meyer@iwm.rwth-aachen.de Raum 110 Telefon: 80-95255 F F S 0 σ F S 0 äußere Kraft Spannung ( innere Kraft ) Jeder noch so kleine Teil des Querschnittes überträgt einen noch so kleinen Teil
5.6 Richtungsindizes Die Atomanordnung in Die Diclite von Festkörpern Einführung Elastizitätsrrioduln vor1 Kristallen
 Inhaltsverzeichnis Vorwort zur deutschen Ausgabe... 4.4 Feste und flüssige Aggregatzustände Allgemeine Einführung... 4.5 Interatomare Kräfte... Begleitmaterialien... Atomanordnung in Festkörpern 1 Konstruktionswerkstoffeund
Inhaltsverzeichnis Vorwort zur deutschen Ausgabe... 4.4 Feste und flüssige Aggregatzustände Allgemeine Einführung... 4.5 Interatomare Kräfte... Begleitmaterialien... Atomanordnung in Festkörpern 1 Konstruktionswerkstoffeund
Kapitalbedarfs- und Liquiditätsplanung bei einer Existenzgründung
 Wirtschaft Christian Jüngling Kapitalbedarfs- und Liquiditätsplanung bei einer Existenzgründung Ein Modell zu Darstellung der Einflussgrößen und ihrer Interdependenzen Diplomarbeit Bibliografische Information
Wirtschaft Christian Jüngling Kapitalbedarfs- und Liquiditätsplanung bei einer Existenzgründung Ein Modell zu Darstellung der Einflussgrößen und ihrer Interdependenzen Diplomarbeit Bibliografische Information
Otto Forster Thomas Szymczak. Übungsbuch zur Analysis 2
 Otto Forster Thomas Szymczak Übungsbuch zur Analysis 2 Otto Forster Thomas Szymczak Übungsbuch zur Analysis 2 Aufgaben und Lösungen 6., aktualisierte Auflage STUDIUM Bibliografische Information der Deutschen
Otto Forster Thomas Szymczak Übungsbuch zur Analysis 2 Otto Forster Thomas Szymczak Übungsbuch zur Analysis 2 Aufgaben und Lösungen 6., aktualisierte Auflage STUDIUM Bibliografische Information der Deutschen
Fazit aus Struktur und Bindung:
 Fazit aus Struktur und Bindung: Im Vergleich zu Metallen weisen Keramiken komplexere Strukturen auf In der Regel besitzen diese Strukturen eine geringere Symmetrie => weniger Gleitebenen, höhere Bindungsenergie
Fazit aus Struktur und Bindung: Im Vergleich zu Metallen weisen Keramiken komplexere Strukturen auf In der Regel besitzen diese Strukturen eine geringere Symmetrie => weniger Gleitebenen, höhere Bindungsenergie
Imperfektionen und Stabilität. M. Neumeister Institut für Leichtbau, Universität der Bundeswehr München
 Imperfektionen und Stabilität M. Neumeister Institut für Leichtbau, Universität der Bundeswehr München Gliederung Problemstellung Sandwichbauweise mit geschlossenen Deckhäuten Sandwichbauweise mit offenen
Imperfektionen und Stabilität M. Neumeister Institut für Leichtbau, Universität der Bundeswehr München Gliederung Problemstellung Sandwichbauweise mit geschlossenen Deckhäuten Sandwichbauweise mit offenen
Gerätetechnisches Praktikum: Leichtbau
 Gerätetechnisches Praktikum: Leichtbau LEICHTBAUPROFILE Universität der Bundeswehr München Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik Institut für Leichtbau Prof.Dr.-Ing. H. Rapp Stand: 14. Januar 2011 Gerätetechnisches
Gerätetechnisches Praktikum: Leichtbau LEICHTBAUPROFILE Universität der Bundeswehr München Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik Institut für Leichtbau Prof.Dr.-Ing. H. Rapp Stand: 14. Januar 2011 Gerätetechnisches
Informatik. Christian Kuhn. Web 2.0. Auswirkungen auf internetbasierte Geschäftsmodelle. Diplomarbeit
 Informatik Christian Kuhn Web 2.0 Auswirkungen auf internetbasierte Geschäftsmodelle Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen
Informatik Christian Kuhn Web 2.0 Auswirkungen auf internetbasierte Geschäftsmodelle Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen
Masterprüfung. Werkstofftechnik der Stähle. am
 Institut für Eisenhüttenkunde Departmend of Ferrous Metallurgy Masterprüfung Werkstofftechnik der Stähle am 24.02.2015 Name: Matrikelnummer: Unterschrift: Aufgabe Maximal erreichbare Punkte: 1 7 2 6 3
Institut für Eisenhüttenkunde Departmend of Ferrous Metallurgy Masterprüfung Werkstofftechnik der Stähle am 24.02.2015 Name: Matrikelnummer: Unterschrift: Aufgabe Maximal erreichbare Punkte: 1 7 2 6 3
Biaxiale Prüfung für Leichtbaustrukturen
 www.dlr.de Folie 1 > J. Schneider, M. Besel 04.12.2012 Biaxiale Prüfung für Leichtbaustrukturen Werkstoff-Kolloquium 2012 J. Schneider, M. Besel, C. Sick, J. Schwinn www.dlr.de Folie 2 > J. Schneider,
www.dlr.de Folie 1 > J. Schneider, M. Besel 04.12.2012 Biaxiale Prüfung für Leichtbaustrukturen Werkstoff-Kolloquium 2012 J. Schneider, M. Besel, C. Sick, J. Schwinn www.dlr.de Folie 2 > J. Schneider,
Tragverhalten von hybriden Systemen in Leichtbauweise mit Gipswerkstoffplatten
 Karsten Tichelmann Tragverhalten von hybriden Systemen in Leichtbauweise mit Gipswerkstoffplatten Unter Berücksichtigung des Verbundverhaltens stiftförmiger Verbindungsmittel KÖLNER WISSENSCHAFTSVERLAG
Karsten Tichelmann Tragverhalten von hybriden Systemen in Leichtbauweise mit Gipswerkstoffplatten Unter Berücksichtigung des Verbundverhaltens stiftförmiger Verbindungsmittel KÖLNER WISSENSCHAFTSVERLAG
Diplomarbeit BESTSELLER. Eva-Maria Matzker. Einrichtungen des Gesundheitswesens strategisch steuern. Anwendung der Balanced Scorecard
 Diplomarbeit BESTSELLER Eva-Maria Matzker Einrichtungen des Gesundheitswesens strategisch steuern Anwendung der Balanced Scorecard Matzker, Eva-Maria: Einrichtungen des Gesundheitswesens strategisch steuern
Diplomarbeit BESTSELLER Eva-Maria Matzker Einrichtungen des Gesundheitswesens strategisch steuern Anwendung der Balanced Scorecard Matzker, Eva-Maria: Einrichtungen des Gesundheitswesens strategisch steuern
Kundenzufriedenheit im Mittelstand
 Wirtschaft Daniel Schallmo Kundenzufriedenheit im Mittelstand Grundlagen, methodisches Vorgehen bei der Messung und Lösungsvorschläge, dargestellt am Beispiel der Kienzer GmbH Diplomarbeit Bibliografische
Wirtschaft Daniel Schallmo Kundenzufriedenheit im Mittelstand Grundlagen, methodisches Vorgehen bei der Messung und Lösungsvorschläge, dargestellt am Beispiel der Kienzer GmbH Diplomarbeit Bibliografische
Matthias Moßburger. Analysis in Dimension 1
 Matthias Moßburger Analysis in Dimension 1 Matthias Moßburger Analysis in Dimension1 Eine ausführliche Erklärung grundlegender Zusammenhänge STUDIUM Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Matthias Moßburger Analysis in Dimension 1 Matthias Moßburger Analysis in Dimension1 Eine ausführliche Erklärung grundlegender Zusammenhänge STUDIUM Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Entwicklung eines Marknagels für den Humerus
 Medizin Eric Bartsch Entwicklung eines Marknagels für den Humerus Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Medizin Eric Bartsch Entwicklung eines Marknagels für den Humerus Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Prof. Dr. Martina Zimmermann Schadensanalyse WW. Vorlesung Schadensanalyse. Schäden durch thermische Beanspruchung
 Vorlesung Schadensanalyse Schäden durch thermische Beanspruchung Risse durch thermische Beanspruchung Eigenes Thema! Schweißrisse Kriechbrüche Heißrisse Thermisch bedingte Risse und Brüche Wärmeschockrisse
Vorlesung Schadensanalyse Schäden durch thermische Beanspruchung Risse durch thermische Beanspruchung Eigenes Thema! Schweißrisse Kriechbrüche Heißrisse Thermisch bedingte Risse und Brüche Wärmeschockrisse
Dissertation. Doktor-Ingenieur. Dipl.-Ing. Dirk Bergmannshoff
 Das Instabilitätsverhalten zug-/scherbeanspruchter Risse bei Variation des Belastungspfades Dissertation zur Erlangung des Grades Doktor-Ingenieur der Fakultät für Maschinenbau der Ruhr-Universität Bochum
Das Instabilitätsverhalten zug-/scherbeanspruchter Risse bei Variation des Belastungspfades Dissertation zur Erlangung des Grades Doktor-Ingenieur der Fakultät für Maschinenbau der Ruhr-Universität Bochum
Usability Analyse des Internetauftritts der Firma MAFI Transport-Systeme GmbH
 Wirtschaft Markus Hartmann Usability Analyse des Internetauftritts der Firma MAFI Transport-Systeme GmbH Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information
Wirtschaft Markus Hartmann Usability Analyse des Internetauftritts der Firma MAFI Transport-Systeme GmbH Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information
Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel I Grundlagen. WS 2009/2010 Kapitel 1.0
 Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel I Grundlagen WS 2009/2010 Kapitel 1.0 Grundlagen Probenmittelwerte ohne MU Akzeptanzbereich Probe 1 und 2 liegen im Akzeptanzbereich Sie sind damit akzeptiert! Probe
Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel I Grundlagen WS 2009/2010 Kapitel 1.0 Grundlagen Probenmittelwerte ohne MU Akzeptanzbereich Probe 1 und 2 liegen im Akzeptanzbereich Sie sind damit akzeptiert! Probe
Roland Lachmayer Rene Bastian Lippert Thomas Fahlbusch Herausgeber. 3D-Druck beleuchtet. Additive Manufacturing auf dem Weg in die Anwendung
 3D-Druck beleuchtet Roland Lachmayer Rene Bastian Lippert Thomas Fahlbusch Herausgeber 3D-Druck beleuchtet Additive Manufacturing auf dem Weg in die Anwendung Herausgeber Roland Lachmayer Institut f.
3D-Druck beleuchtet Roland Lachmayer Rene Bastian Lippert Thomas Fahlbusch Herausgeber 3D-Druck beleuchtet Additive Manufacturing auf dem Weg in die Anwendung Herausgeber Roland Lachmayer Institut f.
Thomas Köhler. Das Selbst im Netz
 Thomas Köhler Das Selbst im Netz Thomas Köhler Das Selbst im Netz Die Konstruktion sozialer Identität in der computervermittelten Kommunikation Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH Bibliografische Information
Thomas Köhler Das Selbst im Netz Thomas Köhler Das Selbst im Netz Die Konstruktion sozialer Identität in der computervermittelten Kommunikation Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH Bibliografische Information
Waveletanalyse von EEG-Zeitreihen
 Naturwissenschaft Heiko Hansen Waveletanalyse von EEG-Zeitreihen Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Naturwissenschaft Heiko Hansen Waveletanalyse von EEG-Zeitreihen Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter, Genußrechtskapital und nachrangige Verbindlichkeiten als haftendes Eigenkapital von Kreditinstituten
 Wirtschaft Markus Stang Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter, Genußrechtskapital und nachrangige Verbindlichkeiten als haftendes Eigenkapital von Kreditinstituten Vergleichende Darstellung sowie kritische
Wirtschaft Markus Stang Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter, Genußrechtskapital und nachrangige Verbindlichkeiten als haftendes Eigenkapital von Kreditinstituten Vergleichende Darstellung sowie kritische
Abbau und Stabilität von Eigenspannungen in geschweißten Stählen unter quasi-statischer und zyklischer Belastung
 Institut für Füge- und Abbau und Stabilität von Eigenspannungen in geschweißten Stählen unter quasi-statischer und zyklischer Belastung Majid Farajian, Thomas Nitschke-Pagel, Klaus Dilger Unklarheiten
Institut für Füge- und Abbau und Stabilität von Eigenspannungen in geschweißten Stählen unter quasi-statischer und zyklischer Belastung Majid Farajian, Thomas Nitschke-Pagel, Klaus Dilger Unklarheiten
Mechanische Spannung und Elastizität
 Mechanische Spannung und Elastizität Wirken unterschiedliche Kräfte auf einen ausgedehnten Körper an unterschiedlichen Orten, dann erfährt der Körper eine mechanische Spannung. F 1 F Wir definieren die
Mechanische Spannung und Elastizität Wirken unterschiedliche Kräfte auf einen ausgedehnten Körper an unterschiedlichen Orten, dann erfährt der Körper eine mechanische Spannung. F 1 F Wir definieren die
Usability-Engineering in der Medizintechnik
 Usability-Engineering in der Medizintechnik Claus Backhaus Usability-Engineering in der Medizintechnik Grundlagen Methoden Beispiele 1 C Dr.-Ing. Claus Backhaus Neuer Kamp 1 20359 Hamburg c-backhaus@t-online.de
Usability-Engineering in der Medizintechnik Claus Backhaus Usability-Engineering in der Medizintechnik Grundlagen Methoden Beispiele 1 C Dr.-Ing. Claus Backhaus Neuer Kamp 1 20359 Hamburg c-backhaus@t-online.de
William K. Frankena. Ethik. Eine analytische Einführung 6. Auflage
 Ethik Eine analytische Einführung 6. Auflage Ethik Ethik Eine analytische Einführung 6. Auflage Herausgegeben und übersetzt von Norbert Hoerster Ann Arbor, USA Die Originalausgabe ist erschienen unter
Ethik Eine analytische Einführung 6. Auflage Ethik Ethik Eine analytische Einführung 6. Auflage Herausgegeben und übersetzt von Norbert Hoerster Ann Arbor, USA Die Originalausgabe ist erschienen unter
Spannungs-Dehnungskurven
 HVAT Metalle Paul H. Kamm Tillmann R. Neu Technische Universität Berlin - Fakultät für Prozesswissenschaften Institut für Werkstoffwissenschaften und -technologien FG Metallische Werkstoffe 01. Juli 2009
HVAT Metalle Paul H. Kamm Tillmann R. Neu Technische Universität Berlin - Fakultät für Prozesswissenschaften Institut für Werkstoffwissenschaften und -technologien FG Metallische Werkstoffe 01. Juli 2009
Entwicklung einer Versuchsmethodik für Untersuchungen zum Tieftemperatureinsatz von Schrauben. Dipl.-Ing. Melanie Stephan
 Entwicklung einer Versuchsmethodik für Untersuchungen zum Tieftemperatureinsatz von Schrauben Dipl.-Ing. Melanie Stephan 1 Problemstellung In vielen Bereichen der Technik, wie z. B. in der Windenergie-,
Entwicklung einer Versuchsmethodik für Untersuchungen zum Tieftemperatureinsatz von Schrauben Dipl.-Ing. Melanie Stephan 1 Problemstellung In vielen Bereichen der Technik, wie z. B. in der Windenergie-,
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
Spätes Bietverhalten bei ebay-auktionen
 Wirtschaft Christina Simon Spätes Bietverhalten bei ebay-auktionen Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Wirtschaft Christina Simon Spätes Bietverhalten bei ebay-auktionen Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Personalbeschaffung in KMU vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung
 Bachelorarbeit Kerstin Lüdecke Personalbeschaffung in KMU vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung Die Gewinnung von Fach- und Führungskräften durch einen Nachwuchsführungskräfte-Pool Bachelor
Bachelorarbeit Kerstin Lüdecke Personalbeschaffung in KMU vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung Die Gewinnung von Fach- und Führungskräften durch einen Nachwuchsführungskräfte-Pool Bachelor
Kennzahlen des Unternehmenswertorientierten Controllings
 Emanuel Beiser Kennzahlen des Unternehmenswertorientierten Controllings Shareholder Value vs. Stakeholder Value Bachelorarbeit BACHELOR + MASTER Publishing Beiser, Emanuel: Kennzahlen des Unternehmenswertorientierten
Emanuel Beiser Kennzahlen des Unternehmenswertorientierten Controllings Shareholder Value vs. Stakeholder Value Bachelorarbeit BACHELOR + MASTER Publishing Beiser, Emanuel: Kennzahlen des Unternehmenswertorientierten
Simulation von pressgehärtetem Stahl mit *MAT_GURSON_JC
 Simulation von pressgehärtetem Stahl mit *MAT_GURSON_JC www.opel.com Reinhard Müller, Adam Opel GmbH Silvia Schmitt, TU Darmstadt Mit steigender Fließgrenze bzw. Zugfestigkeit abnehmende Bruchdehnung Motivation
Simulation von pressgehärtetem Stahl mit *MAT_GURSON_JC www.opel.com Reinhard Müller, Adam Opel GmbH Silvia Schmitt, TU Darmstadt Mit steigender Fließgrenze bzw. Zugfestigkeit abnehmende Bruchdehnung Motivation
Elastizität und Torsion
 INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Elastizität und Torsion 1 Einleitung Ein Flachstab, der an den
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Elastizität und Torsion 1 Einleitung Ein Flachstab, der an den
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
Frost- bzw. Frost-Taumittel-Widerstand von Beton
 Technik Carsten Flohr Frost- bzw. Frost-Taumittel-Widerstand von Beton Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Technik Carsten Flohr Frost- bzw. Frost-Taumittel-Widerstand von Beton Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Studienbücher zur Kommunikationsund Medienwissenschaft
 Studienbücher zur Kommunikationsund Medienwissenschaft Herausgegeben von G. Bentele, Leipzig, Deutschland H.-B. Brosius, München, Deutschland O. Jarren, Zürich, Schweiz Herausgeber und Verlag streben mit
Studienbücher zur Kommunikationsund Medienwissenschaft Herausgegeben von G. Bentele, Leipzig, Deutschland H.-B. Brosius, München, Deutschland O. Jarren, Zürich, Schweiz Herausgeber und Verlag streben mit
Plastische Verformung. Belastungsdiagramm. Physikalische Grundlagen der zahnärztlichen Materialkunde 8. Mechanische Eigenschaften 2.
 Elastische Verformung auf dem atomaren Niveau uswirkung der Gitterdefekte, Korngröße? Physikalische Grundlagen der zahnärztlichen Materialkunde 8. Mechanische Eigenschaften 2. Die elastischen Eigenschaften
Elastische Verformung auf dem atomaren Niveau uswirkung der Gitterdefekte, Korngröße? Physikalische Grundlagen der zahnärztlichen Materialkunde 8. Mechanische Eigenschaften 2. Die elastischen Eigenschaften
Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung
 Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung Herbert Wittel Dieter Jannasch Joachim Voßiek Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung 13., überarbeitete Auflage Herbert Wittel Reutlingen, Deutschland
Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung Herbert Wittel Dieter Jannasch Joachim Voßiek Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung 13., überarbeitete Auflage Herbert Wittel Reutlingen, Deutschland
Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
 Erhard Cramer Udo Kamps Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik Eine Einführung für Studierende der Informatik, der Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften 4. Auflage Springer-Lehrbuch
Erhard Cramer Udo Kamps Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik Eine Einführung für Studierende der Informatik, der Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften 4. Auflage Springer-Lehrbuch
Gerd Czycholl. Theoretische Festkörperphysik Band 1. Grundlagen: Phononen und Elektronen in Kristallen 4. Auflage
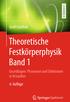 Theoretische Festkörperphysik Band 1 Grundlagen: Phononen und Elektronen in Kristallen 4. Auflage Theoretische Festkörperphysik Band 1 Theoretische Festkörperphysik Band 1 Grundlagen: Phononen und Elektronen
Theoretische Festkörperphysik Band 1 Grundlagen: Phononen und Elektronen in Kristallen 4. Auflage Theoretische Festkörperphysik Band 1 Theoretische Festkörperphysik Band 1 Grundlagen: Phononen und Elektronen
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten
 Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten Parameteridentifikation für Materialmodelle zur Simulation von Klebstoffverbindungen Motivation Kleben als Schlüsseltechnologie in Verbindungstechnik Fahrzeugindustrie
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten Parameteridentifikation für Materialmodelle zur Simulation von Klebstoffverbindungen Motivation Kleben als Schlüsseltechnologie in Verbindungstechnik Fahrzeugindustrie
SAXSIM Saxon Simulation Meeting 2015
 SAXSIM Saxon Simulation Meeting 2015 Bruchmechanische Bewertung von Bauteilen Peter Hübner, Uwe Mahn Fakultät Maschinenbau, Hochschule Mittweida, Deutschland Kurzfassung: Bauteile mit Rissen können mit
SAXSIM Saxon Simulation Meeting 2015 Bruchmechanische Bewertung von Bauteilen Peter Hübner, Uwe Mahn Fakultät Maschinenbau, Hochschule Mittweida, Deutschland Kurzfassung: Bauteile mit Rissen können mit
Zugversuch. Der Zugversuch gehört zu den bedeutendsten Versuchen, um die wichtigsten mechanischen Eigenschaften von Werkstoffen zu ermitteln.
 Name: Matthias Jasch Matrikelnummer: 2402774 Mitarbeiter: Mirjam und Rahel Eisele Gruppennummer: 7 Versuchsdatum: 26. Mai 2009 Betreuer: Vera Barucha Zugversuch 1 Einleitung Der Zugversuch gehört zu den
Name: Matthias Jasch Matrikelnummer: 2402774 Mitarbeiter: Mirjam und Rahel Eisele Gruppennummer: 7 Versuchsdatum: 26. Mai 2009 Betreuer: Vera Barucha Zugversuch 1 Einleitung Der Zugversuch gehört zu den
Enfluss von Eigenspannungen auf das Verhalten von Fehlern in Schweißverbindungen
 Enfluss von Eigenspannungen auf das Verhalten von Fehlern in Schweißverbindungen Dieter Siegele Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik, Freiburg Festkolloquium anlässlich des 75. Geburtstags von Professor
Enfluss von Eigenspannungen auf das Verhalten von Fehlern in Schweißverbindungen Dieter Siegele Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik, Freiburg Festkolloquium anlässlich des 75. Geburtstags von Professor
Der Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung
 Isolde Menig Der Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung Bachelorarbeit Menig, Isolde: Der Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung. Hamburg,
Isolde Menig Der Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung Bachelorarbeit Menig, Isolde: Der Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung. Hamburg,
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
 Geschichte Claudia Sandke Der Lebensborn Eine Darstellung der Aktivitäten des Lebensborn e.v. im Kontext der nationalsozialistischen Rassenideologie Magisterarbeit Bibliografische Information der Deutschen
Geschichte Claudia Sandke Der Lebensborn Eine Darstellung der Aktivitäten des Lebensborn e.v. im Kontext der nationalsozialistischen Rassenideologie Magisterarbeit Bibliografische Information der Deutschen
Sicherheitsaspekte kryptographischer Verfahren beim Homebanking
 Naturwissenschaft Lars Nöbel Sicherheitsaspekte kryptographischer Verfahren beim Homebanking Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen
Naturwissenschaft Lars Nöbel Sicherheitsaspekte kryptographischer Verfahren beim Homebanking Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen
Video-Marketing mit YouTube
 Video-Marketing mit YouTube Christoph Seehaus Video-Marketing mit YouTube Video-Kampagnen strategisch planen und erfolgreich managen Christoph Seehaus Hamburg Deutschland ISBN 978-3-658-10256-2 DOI 10.1007/978-3-658-10257-9
Video-Marketing mit YouTube Christoph Seehaus Video-Marketing mit YouTube Video-Kampagnen strategisch planen und erfolgreich managen Christoph Seehaus Hamburg Deutschland ISBN 978-3-658-10256-2 DOI 10.1007/978-3-658-10257-9
Material Facts. Dualphasen-Stähle. Complexphasen-Stähle
 ultralights by voestalpine Dualphasen-Stähle Complexphasen-Stähle Stand März 2017 Material Facts Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Advanced High Strength Steels (=ahss)
ultralights by voestalpine Dualphasen-Stähle Complexphasen-Stähle Stand März 2017 Material Facts Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Advanced High Strength Steels (=ahss)
Die Balanced Scorecard als Instrument des strategischen Managements aus Sicht eines mittelständischen Logistikunternehmens
 Wirtschaft Peter Helsper Die Balanced Scorecard als Instrument des strategischen Managements aus Sicht eines mittelständischen Logistikunternehmens Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen
Wirtschaft Peter Helsper Die Balanced Scorecard als Instrument des strategischen Managements aus Sicht eines mittelständischen Logistikunternehmens Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen
Praktikum Materialwissenschaft II. Zugversuch
 Praktikum Materialwissenschaft II Zugversuch Gruppe 8 André Schwöbel 132837 Jörg Schließer 141598 Maximilian Fries 147149 e-mail: a.schwoebel@gmail.com Betreuer: Herr Lehmann 5.12.27 Inhaltsverzeichnis
Praktikum Materialwissenschaft II Zugversuch Gruppe 8 André Schwöbel 132837 Jörg Schließer 141598 Maximilian Fries 147149 e-mail: a.schwoebel@gmail.com Betreuer: Herr Lehmann 5.12.27 Inhaltsverzeichnis
Neue Bibliothek der Sozialwissenschaften
 Neue Bibliothek der Sozialwissenschaften Herausgegeben von J. Rössel, Zürich, Schweiz U. Schimank, Bremen, Deutschland G. Vobruba, Leipzig, Deutschland Die Neue Bibliothek der Sozialwissenschaften versammelt
Neue Bibliothek der Sozialwissenschaften Herausgegeben von J. Rössel, Zürich, Schweiz U. Schimank, Bremen, Deutschland G. Vobruba, Leipzig, Deutschland Die Neue Bibliothek der Sozialwissenschaften versammelt
Finanzierung von Public Private Partnership Projekten
 Wirtschaft Christian Borusiak Finanzierung von Public Private Partnership Projekten Risikoverteilung und -bewertung bei Projektfinanzierung und Forfaitierung Diplomarbeit Bibliografische Information der
Wirtschaft Christian Borusiak Finanzierung von Public Private Partnership Projekten Risikoverteilung und -bewertung bei Projektfinanzierung und Forfaitierung Diplomarbeit Bibliografische Information der
FEM-Festigkeitsnachweis / Baustahl S235 Strukturspannung in einer Schweißnaht
 Seite 1 von 10 FEM-Festigkeitsnachweis / Baustahl S235 Strukturspannung in einer Schweißnaht Inhaltsverzeichnis Seite 1. Problemstellung 2 2. Parameter und Konstanten 3 3. Statischer Festigkeitsnachweis
Seite 1 von 10 FEM-Festigkeitsnachweis / Baustahl S235 Strukturspannung in einer Schweißnaht Inhaltsverzeichnis Seite 1. Problemstellung 2 2. Parameter und Konstanten 3 3. Statischer Festigkeitsnachweis
1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte
 1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte 1.1 Werkstoffe werden in verschiedene Klassen und die dazugehörigen Untergruppen eingeteilt. Ordnen Sie folgende Werkstoffe in ihre spezifischen Gruppen: Stahl Holz
1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte 1.1 Werkstoffe werden in verschiedene Klassen und die dazugehörigen Untergruppen eingeteilt. Ordnen Sie folgende Werkstoffe in ihre spezifischen Gruppen: Stahl Holz
SPD als lernende Organisation
 Wirtschaft Thomas Schalski-Seehann SPD als lernende Organisation Eine kritische Analyse der Personal- und Organisationsentwicklung in Parteien Masterarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Wirtschaft Thomas Schalski-Seehann SPD als lernende Organisation Eine kritische Analyse der Personal- und Organisationsentwicklung in Parteien Masterarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
E.Hornbogen H.Warlimont. Metalle. Struktur und Eigenschaften der Metalle und Legierungen. 5., neu bearbeitete Auflage. Mit 281 Abbildungen.
 E.Hornbogen H.Warlimont Metalle Struktur und Eigenschaften der Metalle und Legierungen 5., neu bearbeitete Auflage Mit 281 Abbildungen ö Springer Inhaltsverzeichnis Vorwort V 1 Allgemeiner Überblick 1
E.Hornbogen H.Warlimont Metalle Struktur und Eigenschaften der Metalle und Legierungen 5., neu bearbeitete Auflage Mit 281 Abbildungen ö Springer Inhaltsverzeichnis Vorwort V 1 Allgemeiner Überblick 1
Vorwort. 1 Druckgusslegierungen und ihre Eigenschaften 3. 1.1 Aluminiumdruckgusslegierungen 4. 1.2 Magnesiumdruckgusslegierungen 8
 Inhaltsverzeichnis IX Inhaltsverzeichnis Vorwort Einleitung V XXIII 1 Druckgusslegierungen und ihre Eigenschaften 3 1.1 Aluminiumdruckgusslegierungen 4 1.2 Magnesiumdruckgusslegierungen 8 1.3 Kupferdruckgusslegierungen
Inhaltsverzeichnis IX Inhaltsverzeichnis Vorwort Einleitung V XXIII 1 Druckgusslegierungen und ihre Eigenschaften 3 1.1 Aluminiumdruckgusslegierungen 4 1.2 Magnesiumdruckgusslegierungen 8 1.3 Kupferdruckgusslegierungen
Grosskammer-Rasterelektronenmikroskopie Neue Dimensionen in der Materialforschung und Schadensanalyse
 DGZfP-Jahrestagung 2007 - Vortrag 59 Grosskammer-Rasterelektronenmikroskopie Neue Dimensionen in der Materialforschung und Schadensanalyse M. Göken, R. Nolte, H.W. Höppel Institut für Zentralinstitut für
DGZfP-Jahrestagung 2007 - Vortrag 59 Grosskammer-Rasterelektronenmikroskopie Neue Dimensionen in der Materialforschung und Schadensanalyse M. Göken, R. Nolte, H.W. Höppel Institut für Zentralinstitut für
Das Unerwartete managen
 Karl E. Weick / Kathleen Sutcliffe Das Unerwartete managen Wie Unternehmen aus Extremsituationen lernen 3., vollständig überarbeitete Auflage Aus dem Amerikanischen von Sabine Burkhardt und Maren Klostermann
Karl E. Weick / Kathleen Sutcliffe Das Unerwartete managen Wie Unternehmen aus Extremsituationen lernen 3., vollständig überarbeitete Auflage Aus dem Amerikanischen von Sabine Burkhardt und Maren Klostermann
