Erika Steinbach am Ziel S. 4
|
|
|
- Alexa Ziegler
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Nr. 1-2/2010 (91) - K EURO ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCH-POLNISCHE VERSTÄNDIGUNG 200 Jahre Chopin S. 23 Erika Steinbach am Ziel S. 4 1
2 EDITORIAL POLITIK Liebe Leserinnen und Leser, heimlich, still und leise ging im vergangenen Jahr ein Jubiläum an uns vorüber. Unsere Zeitschrift POLEN und wir wurde 25 Jahre alt. Aber wir gestehen, wir hatten andere Probleme als zu feiern. Der Spendenaufruf in der letzten Ausgabe hat es gezeigt. Aber Sie haben uns geholfen, die Zeitschrift weiter am Leben zu erhalten. Und dann hat es zum Jahreswechsel einen weiteren Bruch gegeben. Wulf Schade, dreizehn Jahre lang verantwortlicher Redakteur dieser Zeitschrift, hat sich von dieser Funktion verabschiedet. Alle Überredungskünste haben nicht geholfen. Ich möchte ihm für diese lange und intensive Arbeit danken. Er hat die inhaltliche Qualität unseres Blattes maßgeblich beeinflusst und dafür gesorgt, daß wir aufmerksam beobachtet werden. Und ich freue mich, daß Wulf Schade weiterhin als Redaktionsmitglied mitarbeiten wird. Vor 25 Jahren hatte ich das Konzept und den Titel für diese Zeitschrift entwickelt und sie dann bis 1992 geleitet. Jetzt habe ich mich dazu entschlossen, zumindest vorübergehend die Leitung wieder zu übernehmen, weil mir dieses Projekt am Herzen liegt und weil die Reaktionen von Ihnen, unseren Lesern, so eindeutig für den Erhalt der Zeitschrift sind. Natürlich kommen wir in dieser Ausgabe am Thema Erika Steinbach nicht vorbei. Dabei wird meines Erachtens einiges in den Medien falsch beachtet. Nicht Erika Steinbach war das Problem, sondern ihre Inhalte. Und so hat Westerwelle es tatsächlich geschafft, den Namen Steinbach aus der Liste zu streichen, aber ihr gleichzeitig mehr Bedeutung für ihre Problematischen Positionen verschafft. In unserem Heft finden Sie dazu eine deutsche und eine polnische Stimme. Ach ja, und da war ja noch ein Jubiläum. Vor 20 Jahren nahm ich als Gast in Berlin an der Gründung der Gesellschaft für gute Nachbarschaft zu Polen teil. Zweieinhalb Jahre später fand die Fusion mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland statt, die Gesellschaft für gute Nachbarschaft wurde der Regionalverband für Berlin und die ostdeutschen Bundesländer. Das vielfältige Angebot des Jubilars in Berlin verdient Beachtung. Eine Folge des Wechsels in der Redaktionsleitung und den im letzten Heft angesprochenen Finanzierungsproblemen war, daß Sie die Ausgabe 4/2009 mit Verspätung erst im Dezember erhielten, und wir jetzt mit einer erweiterten Doppelnummer erscheinen. Die nächste Ausgabe wird dann zum 1. Juli erscheinen. Wir hoffen, Sie sind auch weiterhin mit uns zufrieden. Und, bitte, werben Sie neue Abonnenten. Damit wir lange weitermachen können. Ihr Karl Forster In dieser Ausgabe lesen Sie unter anderem: Ausweichmanöver S. 3 Erika am Ziel S. 4 Übergangene Fragen S. 6 Entschädigung gefordert S Januar im Bundestag S. 11 Gegen Rassismus im Stadion S. 15 Stille Wiedergutmachung S. 16 Gay-Szene entdeckt Polen S Jahre Gute Nachbarschaft S Jahre Chopin S. 22 Polska fast forward S. 26 Buchbesprechung S. 30 Theatr Studio Berlin S. 33 Neues Grab für Kopernikus S. 34 Wichtige Adressen: Geschäftsführung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der BRD e.v.: Manfred Feustel, Im Freihof 3, Hünxe, T: 02858/ 7137, Fax: 02858/ 7945 Unsere Gesellschaft im Internet: dpg-brd@polen-news.de Redaktion POLEN und wir: Karl Forster, Riesaer Str. 18, Berlin Telefon: 030/ , redaktion.puw@polen-news.de Gesellschaft für gute Nachbarschaft zu Polen: c/o Klaus-Ulrich Göttner Moldaustr. 21, Berlin, Fax: vorstand@gutenachbarn.de Deutsch-Polnische Gesellschaft Bielefeld e.v.: Theodor-Hürth-Str. 1, Bielefeld, Tel.: , info@dpg-bielefeld.de, DEUTSCH-POLNISCHE GESELLSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND E.V. 1. Vorsitzender: Prof. Dr. Christoph Koch, Sprachwissenschaftler, Berlin Stellv. Vorsitzender: Dr. Friedrich Leidinger, Psychiater, Hürth Vorstand: Henryk Dechnik, Lehrer, Düsseldorf - Manfred Feustel, Steuerberater, Hünxe - Karl Forster, Journalist, Berlin - Dr. Egon Knapp, Arzt, Schwetzingen - Dr. Holger Politt, Gesellschaftswissenschaftler, Warschau - Wulf Schade, Slawist, Bochum - Christiane Thoms, Polonistin, Berlin Beirat: Armin Clauss - Horst Eisel - Prof. Dr. sc. Heinrich Fink - Prof. Dr. Gerhard Fischer - Dr. Franz von Hammerstein - Christoph Heubner - Witold Kaminski - Dr. Piotr Łysakowski - Hans- Richard Nevermann - Eckart Spoo Anschrift: Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland e.v., c/o Manfred Feustel, Im Freihof 3, Hünxe Tel.: 02858/7137, Fax: 02858/7945 IMPRESSUM: Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung ISSN K 6045 Heft 1-2/2010, 26. Jahrgang (Nr. 92) Verlag u. Herausgeber: Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland e.v. Redaktion: Karl Forster (Verantwortlich), Dr. Friedrich Leidinger, Holger Politt, Wulf Schade Redaktionsbüro: POLEN und wir Karl Forster, Riesaer Str. 18, Berlin, Tel.: redaktion.puw@polen-news.de Layout: Karl Forster Druck: Offsetdruckerei Holge Wende Berlin Aboverwaltung: Manfred Feustel, Im Freihof 3, Hünxe, Fax: 02858/7945 Bezugspreis: Einzelheft 3,00, Jahres-Abonnement 12. Inkl. Versand, Auslands-Abos 10,00 zzgl. Versandkosten, Mitglieder der Deutsch- Polnischen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland e.v. und der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Bielefeld e.v. erhalten "Polen und wir" im Rahmen ihrer Mitgliedschaft Kontoverbindung: Postbank Essen, Konto BLZ Namentlich gekennzeichnete Beiträge stimmen nicht immer mit der Meinung der Redaktion oder der Herausgeberin überein. Für unverlangt eingesandte Manusskripte oder Fotos wird keine Haftung übernommen. Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 31. Mai 2010 Titelbild: Chopin-Denkmal in Warschau - Foto: Hans Kumpf Polen im Jahr der Präsidentschaftswahlen Ausweichmanöver Rolle des Präsidentenamtes wird diskutiert Von Holger Politt Im Herbst 2010 wählen Polens Bürger einen neuen Staatspräsidenten. Oder den amtierenden, wenn es anders kommen sollte als in aktuellen Umfragen ablesbar. Noch Anfang des Jahres glaubte Polens Öffentlichkeit, es werde zu einem Duell zwischen Lech Kaczyński, dem Amtsinhaber, und Donald Tusk, dem Ministerpräsidenten, kommen. Also zu einer Neuauflage des spannenden Wahlkampfes aus dem Jahre 2005, als Lech Kaczyński den lange Zeit als Favorit geltenden Tusk auf der Ziellinie noch abfing und für viele überraschend in den Präsidentenpalast einzog. Wäre es zu diesem neu aufgelegten Duell gekommen, ginge Tusk dieses Mal als ein noch viel größerer Favorit ins Rennen. Er hätte die Wahl durchaus bereits im ersten Wahlgang gewinnen können, was bisher nur Aleksander Kwaśniewski 2000 bei seiner Wiederwahl gelang. Eine Gefahr, dass Lech Kaczyński im Endspurt mit der sozialen Karte und der überraschenden Offerte einer überhaupt neuen Republik (2005 der Vierten ) ihn wieder abfangen könnte, hat kaum bestanden. Bleibe Ministerpräsident Dennoch zog Tusk im Januar 2010 mit der Ankündigung sich aus dem Rennen, er bleibe Ministerpräsident und wolle versuchen, im Herbst 2011 die Regierungspartei PO erneut zum Wahlsieg zu führen. Dabei fielen Worte, in denen das Präsidentenamt eher als eine Institution der Repräsentation und der Posten des Regierungschefs als der des mit Abstand einflussreichsten Politikers im Lande beschrieben wurden. Das mag schon so sein, verblüfft aber dennoch in einem Lande, in dem der Staatspräsident vom Volk direkt gewählt wird und den Posten des Regierungschefs bislang noch niemand länger als vier Jahre hielt. Donald Tusk ist gerade einmal zweieinhalb Jahre im Amt, tauscht also die Aussicht auf ein im Lande hoch angesehenes und verlässliches politisches Amt mit der Machtoption, die viele Unwägbarkeiten in sich birgt. Wer in Warschau vor der Kanzlei des Staatspräsidenten steht, kann gut ermessen, dass dieses Amt mehr als nur repräsentativer Funktion ist. Immerhin steht der höchsten Person im Staate ein Apparat zur Verfügung, mit dem sie die wichtigsten Regierungsposten gewissermaßen parallel besetzen kann, also beispielsweise jemanden für innere Angelegenheiten oder einen andern für Außen- oder Europapolitik. Diese Staatsbeamten werden Minister genannt, ganz so wie die eigentlichen Regierungsmitglieder. Damit ist dem Staatspräsidenten die Möglichkeit gegeben, kompetent und gut beraten in den wichtigsten laufenden politischen Angelegenheiten, so er es für angebracht hält, mitzusprechen. Die bisherigen Präsidenten nutzten das weidlich, ließen auch nicht locker, als etwa eigene politische Optionen am Regierungshebel saßen. Allein Lech Kaczyński war in den ersten beiden Jahren seines Amtes tunlichst darauf bedacht, seinem Zwillingsbruder Jarosław von Amts wegen nicht in die Quere zu kommen. Fast degradierte er das hohe Amt zu einer bloßen Verlängerung der PiS-geführten Regierung. Ramponierten Ruf aufpoliert Damals gab kaum noch ein Beobachter ihm überhaupt die Chance, 2010 aussichtsreich um die Wiederwahl zu kämpfen. Denn einen Stellvertreter seines Zwillingsbruders hätten die Wahlbürger Polens ganz gewiss nicht noch einmal ins Amt berufen. Doch in den zurückliegenden zwei Jahren gelang es der Kanzlei, den ramponierten Ruf aufzupolieren, wenngleich sie von den Glanzzeiten eines Wałęsas und eines Kwaśniewskis weit entfernt blieb. Aber immerhin. Und keiner half dem Präsidenten so, aus dem Schatten des PiS-Vorsitzenden herauszukommen und eigenes Profil zu gewinnen, wie Ministerpräsident Tusk, dem seit 2007 Paroli zu bieten ist. Denn Tusks PO eilt der politischen Konkurrenz meilenweit voraus, hat Anfang des Jahres nach zwei Regierungsjahren und dem europaweiten Krisenjahr 2009 stabile Umfragewerte, die um die 50% schwanken, soviel wie noch nie eine Partei im Lande seit 1990 hatte. PiS kann zwar stabil auf Werte um die 25% herum verweisen, aber das ist eben nur die Hälfte des Zuspruchs der eifersüchtig beargwöhnten Konkurrenz. Was PiS noch hinzusetzen kann, ist eben das Amt des Staatspräsidenten, das man in dieser Form auch nach dem Wahltage zu gerne behalten möchte. Duell PO gegen PiS Tusk entschied, auf die Kandidatur zu verzichten, als sich abzuzeichnen begann, dass auch andere PO-Kandidaten in der Lage sein könnten, im Herbst das Amt zu nehmen. Und in der Tat zeichnet sich bereits jetzt ab, dass außer dem noch zu bestimmenden PO-Kandidaten und dem Amtsinhaber kaum jemand ernsthafte Chancen besitzt, in den zweiten Wahlgang einzuziehen. Die Zuspitzung zwischen PO und PiS aus dem Jahre 2005 wiederholt sich, aber auf einem für PiS sehr viel ungünstigerem Niveau. Ministerpräsident Tusk rechnet zudem fest damit, dass am Wahltage die Wähler sich auch ein wenig für die PO entscheiden, was dem PO-Kandidaten den entscheidenden Vorsprung sichern sollte. Dennoch traf Tusks ungewöhnlicher Schritt auch auf kritische Stimmen, die dem Argument, das Präsidentenamt vereine im Unterschied zum Ministerrat zu wenig Machtkompetenz, nicht folgen möchten. In erster Linie wurde herausgestrichen, dass Tusk ungern seinen Parteivorsitz aufgeben möchte, was bei einer erfolgreichen Kandidatur zwingend erforderlich wäre. Ein wenig, so die Kritiker, mag da die schlechte Erfahrung der SLD eine Rolle spielen, die letztlich mittelfristig den Weggang des ins Amt scheidenden Kwaśniewski und die daraufhin immer offensichtlicher werdenden Streitigkeiten ums Erbe trotz komfortabler Umfrage- und Wahlergebnisse nur sehr angeschlagen überlebte. Rolle in Partei und Regierung stärken Tusk, so der erfahrene Kwaśniewski kurz nach der Entscheidung, habe sich für das nackte Kalkül entschieden: Würde er ins Präsidentenamt weichen, bekäme PiS im parlamentarischen Rennen womöglich neuen, vielleicht sogar unverhofft kräftigen Aufwind. Da das Amt gegen Lech Kaczyński sowieso geholt werde, scheint es so ratsam, die Position in der Partei und in der Regierung zu stärken, um den einzig verbliebenen Konkurrenten in die Schranken zu weisen. Was, so der ehemalige Präsident, Tusk nicht auf der Rechnung habe, ist der Bonus des Amtsinhabers, der in den Umfragen noch nicht wirke. 2 POLEN und wir 1-2/2010 POLEN und wir 1-2/2010 3
3 POLITIK POLITIK Kommentar der polnischen Zeitung POLITYKA Erika am Ziel Erika Steinbach verwirklicht ihr Lebensziel Von Wawrzyniec Smoczyński Sie ist weder der Dämon des Revanchismus, der Polen in Schrecken versetzt, noch die unbedeutende Verbandsfunktionärin, für die man sie in Deutschland hält. Erika Steinbach ist eine versierte Politikerin, die die Regierungskoalition in Berlin entzweit hat. Sie sagt, dass sie die Erinnerung an 15 Millionen Deutsche repräsentiere, und wiederholt häufig, dass jede dritte deutsche Familie von der Wunde der Vertreibung gezeichnet sei. Hochgewachsen, elegant, immer in bunten Jacketts und stark geschminkt. Kühl, ruhig und resolut. Die Inszenierung ihrer Medienauftritte beherrscht sie bis zur Perfektion das Fernsehen zeigt sie mit Bundeskanzlern und Präsidenten, am Rednerpult stehend oder allein vor einem Wald von Mikrofonen, ganz die wichtige Politikerin. Sie klingt sicherer und ist eloquenter und überzeugender als Angela Merkel. Jahrelang war dieses Erscheinungsbild eine mediale Täuschung. Die Deutschen zerbrechen sich den Kopf, wie Steinbach in Polen eine so große Karriere machen konnte, während sie in Deutschland lange Zeit fast unbekannt blieb. Jenseits der Oder gilt der Bund der Vertriebenen (BdV) als ein Relikt der Vergangenheit, eine einst einflussreiche, heute aber marginale Rentnerorganisation. Umso größer war die Überraschung, als dessen Chefin im November letzten Jahres die Regierungskoalition entzweite und im Dezember der Kanzlerin aus der eigenen Partei ein Ultimatum stellte. Im Januar prophezeite man ihren Sturz, indessen wächst sie heute zum Symbol der Spaltung in der Christdemokratie heran. BdV-Chefin wurde sie Zwei Jahre später verkündete sie ihr Lebensprojekt : die Errichtung eines Zentrums gegen Vertreibungen, das die Geschichte und das Leid der Vertriebenen dokumentieren soll. Das Vorhaben löste auf der Stelle Proteste in Polen und Tschechien aus, dafür wurde es von den Christdemokraten aufgegriffen, für die der BdV traditionell politische Sympathien hegt. Auf die Stimmen der Vertriebenen spekulierend, nahm die CDU/CSU bereits im Jahre 2002 Steinbachs Projekt in ihr Programm auf. Als Merkel drei Jahre später die Wahlen gewann, wurde im Koalitionsprogramm mit der SPD festgehalten, man wolle ein sichtbares Zeichen setzen, um ( ) an das Unrecht der Vertreibungen zu erinnern. Das Projekt wurde jedoch auf Eis gelegt in Polen kam die PiS an die Macht, und Merkel wollte keinen weiteren Vorwand für den Vorwurf liefern, Deutschland schreibe die Geschichte um. Steinbach sorgte jedoch dafür, dass ihr Projekt nicht in Vergessenheit geriet. Buchstäblich am Tag nach dem Wahlsieg der PO 2007 gab Merkel bekannt, die große Koalition habe sich über die Form des Sichtbaren Zeichens verständigt. Sie kündigte die Gründung einer staatlichen Stiftung Flucht Vertreibung Versöhnung an, deren Aufgabe die Errichtung eines Dokumentationsund Ausstellungszentrums in Berlin sei. Das Ganze wurde in das Deutsche Historische Museum einbezogen, um Verdächtigungen Erika Steinbachs Verzicht stärkt die Vertriebenen, titelte die Braunschweiger Zeitung und machte deutlich, dass der unsaubere Deal mit unakzeptablen Zugeständnissen an den BdV erkauft wurde. zu vermeiden, die Institution werde Revisionismus betreiben. Als Sitz des Sichtbaren Zeichens wurden zwei Stockwerke eines Gebäudes unweit des Potsdamer Platzes vorgesehen. Die neue polnische Regierung wurde vor Erika Steinbach bei einer Rede im Deutschen Bundestag.. Foto Deutscher Bundestag / Lichtblick/Achim Melde eine vollendete Tatsache gestellt, doch im Februar 2008 kam Staatsminister Bernd Neumann nach Warschau, um Władysław Bartoszewski, dem frisch ernannten Beauftragten des Ministerpräsidenten für den internationalen Dialog, das Konzept darzulegen. Da der polnischen Seite daran lag, die Beziehungen zu Deutschland auf ein neues Fundament zu stellen, erklärte sie gegenüber dem Projekt freundliche Neutralität, stellte aber eine Bedingung: Erika Steinbach dürfe keinen Sitz in den Aufsichtsgremien des Sichtbaren Zeichens erhalten. Im Dezember 2008 rief der Bundestag die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung ins Leben und setzte einen 13köpfigen Beirat an dessen Spitze, dem Vertreter des Parlaments, der Regierung, der Kirchen und jüdischen Organisationen sowie des Bundes der Vertriebenen angehören jeder nach vorheriger Billigung der Bundesregierung. Der BdV erhielt drei Sitze. Der BdV hatte bereits im April 2008 beschlossen, Steinbach zu benennen. Im Februar letzten Jahres teilte Merkel Tusk mit, es sei ihr nicht gelungen, den BdV von diesem Vorhaben abzubringen, und bat um einen Besuch von Bartoszewski in Berlin. Sie versicherte ihm persönlich, dass die Regierung Steinbachs Kandidatur nicht vor den Wahlen im September prüfen werde. Der BdV veröffentlichte die Nominierung tags darauf, und Bartoszewski, offenkundig enttäuscht über Merkels Zaudern, ging zur medialen Attacke über. Über Deutsche, die die polnischen Vorbehalte gegen Steinbach nicht verstehen, sagte er, dass sie sie sich dumm stellen, danach stellte er fest, dass nur Idioten Steinbach unterstützen und dass die BdV-Chefin sich so für Verhandlungen mit Polen eignet, wie ein überzeugter Antisemit für Verhandlungen mit Jerusalem. In Deutschland wurden diese Worte mit Verblüffung aufgenommen, zumal in der Christdemokratie, bei der Bartoszewski hohes Ansehen genoss. Anfang März 2009 zog der Bund der Vertriebenen selbst die Kandidatur seiner Chefin zurück, teilte aber gleichzeitig mit, sie nach den Wahlen erneut anzumelden, wenn es keine Sozialdemokraten mehr in der Koalition geben werde. In Polen tönte man trotzdem von einem Triumph Bartoszewskis, obwohl in Deutschland Steinbach als Siegerin aus dieser Auseinandersetzung hervorging. Dank der Attacke wurde sie in Deutschland allgemein bekannt, sie avancierte von einer Provokateurin zu einem Opfer der polnischen Regierung, und mit ihr sympathisierende Politiker verhehlten diese Tatsache nicht mehr. Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) nahm sie mit einem Offenen Brief in Schutz, in dem er zunächst Bartoszewski rituell seinen Respekt bekundete, ihn dann für den Stil der Polemik scharf tadelte und zum Schluss erklärte, er schätze Erika Steinbachs Engagement für Erinnerung und Versöhnung. Auch die Deutschen haben nämlich ein Problem mit den Vertriebenen allerdings nicht mit ihrer Chefin, sondern mit dem Gefühl, den Menschen, deren Schicksal nie angemessen gedacht wurde, etwas schuldig zu sein. Dazu kam es, weil die deutschen Opfer des Krieges lange ein Tabu umgab, aber wegen des Revanchismus des BdV selbst und seiner Weigerung, mit den Nazis in den eigenen Reihen abzurechnen. Aus polnischer Perspektive fällt es schwer, darin ein Ruhmesblatt zu sehen, doch Steinbach hat den Bund der Vertriebenen zivilisiert: Sie distanzierte sich von den Eigentumsansprüchen der Preußischen Treuhand und erklärte nicht mehr, Polen sei schuld an den Aussiedlungen. Bartoszewskis scharfe Attacke wurde somit als ungerecht empfunden, zudem weckte der ruppige Stil Assoziationen an die Regierungszeit der PiS. In der Presse meldeten sich Stimmen, dass Polen deshalb so heftig reagiere, weil es das dunkle Kapitel der Aussiedlungen in der eigenen Geschichte verschweigen wolle. Im November wurde aus dem deutschpolnischen Streit um Steinbach ein Krach Die Debatte zwischen Westerwelle und Steinbach war anlass für ein kabarettistisches Streitgespräch, bei dem Matthias Richling in beide Rollen schlüpfte. Als Aussenminister Westerwelle zeigte er dabei POLEN und wir als Informationsquelle. Eine gute Idee. Schließlich könnte es beiden nicht schaden, sich in POLEN und wir zu informieren. Karl Forster innerhalb der Bundesregierung. Der Bund der Vertriebenen hatte damit gerechnet, dass die neue christdemokratisch-liberale Koalition keine Schwierigkeiten mit der Bestätigung seiner Kandidatin haben würde. Unterdessen machte sich der FDP-Chef und neue Außenminister Guido Westerwelle zu seinem ersten Besuch nach Warschau auf, wo er sein Veto gegen Steinbach bekanntgab. In Polen wurde diese Erklärung mit Befriedigung aufgenommen, doch in Deutschland prasselte ein Gewitter auf Westerwelle nieder. Die ehrwürdige Frankfurter Allgemeine Zeitung beschuldigte den Minister, sich zum Diener polnischer Interessen zu machen, und in der Koalition brach ein offener Konflikt zwischen der FDP und der bayerischen CSU aus, einer von mehreren, die der neuen Regierung den Start vermasselten. Den ganzen November über wartete man darauf, dass Merkel mit der Faust auf den Tisch haut, doch die Bundeskanzlerin schwieg, vielleicht, weil sie sich über das Schisma in ihrer eigenen Partei im Klaren war. Die Christdemokratie hatte bei den Wahlen weniger Stimmen erzielt, als erwartet; den Sieg hatte ihr im Grunde genommen Westerwelle beschert, denn ohne das Rekordergebnis der FDP hätte die jetzige Koalition keine Mehrheit zusammenbekommen. Der rechte Flügel der CDU und die konservative CSU begriffen, dass sie aufs Abstellgleis geschoben werden, daher standen sie, als Westerwelle Steinbach blockierte, wie ein Mann hinter ihr, um die Bundeskanzlerin zu zwingen, sich auf ihre Seite zu schlagen. Die BdV-Chefin spielte unterdessen va banque. Nicht nur zog sie sich nach dem Einspruch von Westerwelle, immerhin dem Vizekanzler und Vorsitzenden einer Koalitionspartei, nicht zurück, sondern sie räumte der Regierung im Dezember mit der Drohung, wenn man sie nicht in den Rat einziehen lasse, werde der Bund der Vertriebenen gerichtlich dagegen vorgehen, eine Bedenkzeit ein. Merkel ignorierte das Ultimatum, dafür nutzten aber die Medien die Bedenkzeit und fragten, mit welchem Recht eine Abgeordnete die Bundesregierung erpresse, die obendrein noch von einer Kanzlerin aus derselben Partei geführt wird. Doch Steinbach sah als erste ein, dass sie den Bogen überspannt hatte, und präsentierte Anfang Januar großmütig die Bedingungen für ihren Verzicht: mehr Plätze für den BdV im Stiftungsrat, die Abschaffung des Regierungsvetos, die Befreiung des Sichtbaren Zeichens von der Kuratel des Deutschen Historischen Museums und die Überlassung des gesamten Gebäudes in Berlin für das Zentrum, statt lediglich zweier Stockwerke. Derzeit suchen die Koalitionspartner nach einem Kompromissangebot, aber alle wissen, dass die BdV-Chefin keine Almosen annimmt. Für die christdemokratischen Konservativen ist sie bereits ein Symbol; zu ihrem Vortrag im nordrheinwestfälischen Landtag erschienen letzte Woche tausend Personen. Erika Steinbachs Einfluss auf das Sichtbare Zeichen ist bereits garantiert. Direktor der Stiftung Flucht, Vertreibung, Ver- 4 POLEN und wir 1-2/2010 POLEN und wir 1-2/2010 5
4 POLITIK POLITIK söhnung wurde der von ihr nominierte Kandidat [Prof. Dr. Manfred Kittel, Anm. d. Red.], und die Zusammensetzung des wissenschaftlichen Beirats deckt sich weitgehend mit der Liste der Berater des Zentrums gegen Vertreibungen, einer privaten Stiftung des BdV (das ist einer der Gründe, weswegen der Historiker Prof. Tomasz Szarota von der Polnischen Akademie der Wissenschaften nach der ersten Sitzung aus dem Beirat austrat). Im Gegenzug für ihren Verzicht bemüht sich Steinbach jetzt darum, noch größeren Einfluss für den Bund der Vertriebenen herauszuschinden. Alles weist darauf hin, dass an Stelle eines kleinen privaten Zentrums eine zwar formal unabhängige, in der Praxis jedoch von der BdV-Chefin ferngesteuerte staatliche Institution mit erheblich größerem Budget entstehen wird. Nach zehn Jahren Streit macht das in Berlin für niemanden mehr einen besonderen Unterschied, die Politiker wollen so schnell wie möglich zu wichtigeren Aufgaben übergehen. Einige Jahre zu spät Die polnischen Regierenden, nach Władysław Bartoszewskis Husarenritt klüger geworden, schweigen diesmal. Doch diese Taktik kommt einige Jahre zu spät. Heute kann man nur darüber spekulieren, wie die Karriere von Erika Steinbach verlaufen wäre, wenn sich nicht eine polnische Regierung nach der anderen auf die Bekämpfung ihrer Person konzentriert hätte. Die BdV-Chefin hat gelernt, die Register der polnischen Ängste vor Deutschland zu ziehen, so wie sie heute das deutsche Schuldgefühl gegenüber den Vertriebenen und den wiederauflebenden Nationalstolz ausspielt. Deshalb wird ihre Nominierung für das Sichtbare Zeichen von 54 Prozent der jungen Deutschen unterstützt, und in der Gesamtbevölkerung gibt es fast ebenso viele Befürworter ihres Standpunkts im Streit mit Westerwelle (34 Prozent) wie Gegner (38 Prozent). Wenn die Polen ihren Einfluss jahrelang überschätzt haben, dann haben die Deutschen ihr Talent ganz offensichtlich unterschätzt. Währenddessen verwirklichte Steinbach ihr Lebensprojekt. Übersetzung: Silke Lent. Der Originaltext erschien in der Polityka vom Den Artikel entnahmen wir mit freundlicher Genehmigung der Rubrik Polityka auf Deutsch im Internet-Portal Point. Der Deutsch-Polnische Kalender. Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit Übergangene Fragen Erika Steinbach - Streit um das»sichtbare Zeichen«Von Renate Hennecke Wie das Dogma vom Unrecht der Vertreibung die ernsthafte Auseinandersetzung mit den historischen Fakten verhindert, schilderte die Autorin in einem Beitrag mit der Tageszeitung Junge Welt, den wir hier dokumentieren. Erika Steinbach hat als Preis dafür, dass sie sich nicht als dritte Vertreterin des»bundes der Vertriebenen«(BdV) für den Stiftungsrat des Berliner Vertreibungszentrums benennen lässt, eine Revision des Stiftungsgesetzes vom Dezember 2008 verlangt, auf dessen Grundlage diese Einrichtung geschaffen werden soll: Sie will ein größeres Zentrum, und es soll aus Steuermitteln finanziert, aber unter Federführung des BdV und ohne staatliche Kontrolle realisiert und betrieben werden. So sah es auch ihr Konzept für ein»zentrum gegen Vertreibungen«vor, das sie im Jahr 2000 vorstellte und das 2002 vom Bundestag abgelehnt wurde. Die Dreistigkeit der BdV-Präsidentin hat in deutschnationalen Kreisen Zustimmung gefunden, ansonsten aber rundum Empörung ausgelöst. Plötzlich berichten die Medien über Steinbach nicht nur, dass sie 1991 gegen den deutsch-polnischen Grenzvertrag gestimmt und sich damit in Polen unbeliebt gemacht hat. Aktuell kommen sogar Stimmen zu Wort, die in Steinbachs Positionen auch ein Problem für die deutsche Gesellschaft sehen. So wurde das gegenüber der Frankfurter Rundschau geäußerte Urteil des Historikers Heinrich August Winkler, Steinbach habe ein»national-apologetisches Geschichtsverständnis«, von anderen Medien aufgegriffen und weitergetragen, ebenso die zutreffende Einschätzung der SPD-Politikerin Gesine Schwan, für Steinbach sei»nicht der Nationalsozialismus die Ursache der Vertreibung, sondern nur der Anlass für Polen gewesen, den lange gehegten Wunsch zu verwirklichen, die Deutschen aus dem Land zu vertreiben«(beide Äußerungen zuerst in der FR vom ). Endlich wird auch der Anspruch des BdV, zwei Millionen Mitglieder zu haben und 15 Millionen»Vertriebene«zu repräsentieren, nicht mehr als unantastbare Wahrheit hingenommen. Das ist gut so. Steinbach böse, Stiftungsgesetz gut? Die Empörung über Steinbach verleitet gleichzeitig zu dem Umkehrschluss, das von der BdV-Chefin angegriffene Stiftungsgesetz müsse verteidigt werden. So erhält es unverdientes Lob als angeblich gut durchdachtes, sorgfältig austariertes und mit Polen abgestimmtes Kunstwerk, dessen filigrane Struktur nicht mehr angetastet werden dürfe. Die Konstruktion der Stiftung»Flucht, Vertreibung, Versöhnung«als unselbständige Stiftung unter dem Dach des Deutschen Historischen Museums und die Kontrolle der Zusammensetzung des Stiftungsrates durch die Bundesregierung werden als Garantie dafür genommen, dass in dem künftigen Zentrum keine»unhaltbaren geschichtspolitischen Umdeutungen«à la Steinbach vertreten werden. Woher dieser Optimismus? Die Oberaufsicht soll Merkels Kulturstaatsminister Bernd Neumann führen, und als Gründungsdirektor ist Manfred Kittel berufen. Der Professor für Neue und Neueste Geschichte an der Universität Regensburg und Mitarbeiter des Münchner Instituts für Zeitgeschichte hängt am Mythos des»deutschen Ostens«. Zudem vertritt er die Auffassung, dass nicht nur an der Vertreibung, sondern auch am Zweiten Weltkrieg und überhaupt an Hitler die Tschechen schuld seien: Es sei richtig, erklärte er laut Sudetendeutscher Zeitung vom 7. März 2008 wörtlich in einem Vortrag bei der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL), dass»von der verweigerten Selbstbestimmung am 4. März 1919 (als es in verschiedenen Städten der neu gegründeten Tschechoslowakei zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und sudetendeutschen Anschlussbefürwortern kam R.H.) eine Spur zu den Geschehnissen von 1933, 1938 und 1945, bis hin also zur Vertreibung der Deutschen«führe. Wäre den Sudetendeutschen 1918/19 nicht die»selbstbestimmung«(d.h. der Anschluss an Österreich und mit diesem zusammen an das Deutsche Reich) verwehrt worden, wäre, zitiert die Sudetendeutsche Zeitung Kittel weiter,»die deutsche und europäische Geschichte ganz anders verlaufen«. Denn, so fasst das Organ der SL Kittels weitere Ausführungen zusammen,»die von den Nazis propagierte völkische Idee habe nur deshalb so großen Zulauf gefunden, weil es nach 1918 so viele Auslandsdeutsche gegeben habe«. Mit solchen Positionen bleibt Kittel wahrlich nicht hinter Steinbach zurück. Kulturstaatsminister Neumann hält nichtsdestotrotz Kittel für den optimalen Gründungsdirektor des»sichtbaren Zeichens«und rühmte ihn bei der Bekanntgabe seiner Berufung als»besonders erfahrene Persönlichkeit für diese Aufgabe«mit»ausgewiesene(r) Sachkenntnis und Erfahrung bei der Thematik Flucht und Vertreibung«. Politische Ausrichtung Nach derzeitigem Stand soll dem»sichtbaren Zeichen«eine Fläche von 2000 Quadratmetern im Berliner Deutschlandhaus zur Verfügung stehen. Steinbach wünscht, dass das Projekt auf die gesamte Fläche des Deutschlandhauses ausgedehnt wird. Nur so sei es möglich,»siedlungsgeschichte, Vertreibungsschicksale und Integration der deutschen Vertriebenen sowie deren Dokumentation adäquat darstellen zu können und zugleich ausreichend Raum für das Schicksal auch anderer Vertriebener zur Verfügung zu haben«. Erika Steinbach irrt. Es liegt nicht an mangelnder Fläche, dass eine adäquate Darstellung nicht möglich ist. Es liegt an der politischen Ausrichtung des Projekts. Das»sichtbare Zeichen«soll ausdrücklich errichtet werden, um»an das Unrecht von Vertreibungen zu erinnern«. Über diese Vorgabe sind sich Erika Steinbach, Bernd Neumann und Manfred Kittel völlig einig. Das Dogma vom»unrecht der Vertreibung«verhindert jedoch schon seit 65 Jahren eine adäquate und ergebnisoffene Untersuchung der Vorgänge und der jeweiligen Verantwortlichkeiten. Die möglichen Ergebnisse könnten ja die gängige Sicht der Dinge erheblich verändern, die bisherigen Schuldzuweisungen könnten sich als unzutreffend erweisen, und das Dogma könnte ins Wanken geraten. Unbeantwortet blieben infolgedessen so naheliegende Fragen wie: Wie viele»vertriebene«, wie viele»flüchtlinge«, wie viele»umsiedler«gab es eigentlich? (Die Angaben in der Literatur schwanken zwischen fünf und mehr als 20 Millionen.) Aus welchen unterschiedlichen Gruppen setzten sich diese Millionen zusammen? Wie groß waren die verschiedenen Gruppen? Wie viele Deutsche oder Deutschstämmige verließen vor Kriegsende aus eigenem Entschluss ihre Heimat? Wie viele wurden von den Nazis zwangsevakuiert? Für wie viele bedeuteten die Bedingungen der Evakuierung den Tod? Wie viele Menschen wurden in den besetzten Gebieten von Wehrmacht, SS etc. als Kollaborateure rekrutiert und beim Rückzug zum Mitkommen gezwungen? Wie viele wurden nach Kriegsende aufgrund des Potsdamer Abkommens unter der Kontrolle der Alliierten umgesiedelt? Wie viele»vertriebene«à la Steinbach gibt es: Wehrmachtsoldaten und ihre Familien, die aus den besetzten Ländern in ihre Heimat»vertrieben«wurden? Wie viele deutschstämmige Bewohner osteuropäischer Länder wurden, wie z.b. Bundespräsident Köhlers Familie, im Zuge der Kolonialisierungspolitik des Naziregimes in besetzte Regionen umgesiedelt und bei der Befreiung aus den okkupierten Wohnungen und Höfen wieder vertrieben? Wie viele Wehrmachtsoldaten aus den früheren Ostprovinzen des Reiches oder den besetzten Ländern setzten sich von der Ostfront direkt in den Westen ab? Wie viele Nazifunktionäre machten sich davon, um ihrer Bestrafung zu entgehen? Wie viele Menschen aus den besetzten Ländern meldeten sich als»vertriebene«, weil sie mit den Nazis kollaboriert hatten und befürchteten, bei einer Rückkehr bestraft zu werden? Welche Probleme treten bei der statistischen Erfassung der»vertriebenen«auf? Trifft es zu, dass aufgrund der bisher üblichen Zählung mittels Bevölkerungsbilanzen selbst Holocaust-Opfer, in den Konzentrationslagern der Nazis Ermordete und bei Schanzarbeiten in den zu»festungen«erklärten Städten Ungekommene als»vertreibungsopfer«gezählt werden (wie es z.b. der polnische Autor Stanislaw Schimitzek in seinem Buch»Vertreibungsverluste? Westdeutsche Zahlenspiele«schon 1966 darlegte)? Ist es richtig, dass sogenannte Aussiedler, die lange nach dem Krieg aus eigenem Entschluss in die BRD gekommen sind, ebenfalls unter die offizielle Definition der»vertriebenen«fallen? Welchen Anteil an der Gesamtzahl hat diese Gruppe? Schon die Vielzahl der Fragen gibt eine Vorstellung davon, wie wenig die immer gleichen Bilder, die uns zum Stichwort»Flucht und Vertreibung«präsentiert werden, der Heterogenität des tatsächlichen Geschehens gerecht werden. Sie erzählen immer nur ganz bestimmte, immer gleiche Geschichten und sparen alle anderen aus. Jedoch muss, wenn von»unrecht«die Rede ist, die politische, rechtliche und moralische Beurteilung und die Untersuchung der Verantwortlichkeiten so konkret und so differenziert erfolgen, wie es die Vielfalt der Geschichten verlangt. Allgemeine Sätze wie»sie flohen vor dem Vormarsch der Roten Armee«erklären gar nichts, sie vernebeln nur. Und dass der Spruch»Jede Vertreibung, egal was vorausging, ist Unrecht«Unsinn ist, liegt auf der Hand. Oder will jemand behaupten, die Vertreibung der Familie von Frau Steinbach aus Polen sei ebensolches Unrecht wie die Vertreibung der deutschen Juden aus Deutschland? Wer war wofür verantwortlich? Der BdV hat all diese Fragen in den 52 Jahren seiner Existenz nicht beantwortet, sie nicht einmal gestellt. Und auch das»sichtbare Zeichen«wird sie nicht stellen. Bei seiner Gestaltung soll die Ausstellung»Flucht, Vertreibung, Integration«zugrunde gelegt werden, die 2005/06 vom Bonner Haus der Geschichte der BRD erstellt und im Sommer 2006 parallel zu der BdV-Ausstellung»Erzwungene Wege«im Deutschen Historischen Museum in Berlin gezeigt wurde. Diese Ausstellung hat sich um die genannten Fragen auch nicht ansatzweise gekümmert. Sie bediente die gängigen Klischees von der Flucht vor der Roten Armee, stellte die deutsche Wehrmacht als Freund und Helfer der Wilhelm-Gustloff-Passagiere dar (statt den Wahnsinn anzuprangern, dass Flüchtlinge auf Schiffen transportiert wurden, die gleichzeitig dem Truppentransport dienten), präsentierte unzulässige Gleichsetzungen, bemäkelte die Bodenreform und die Zuteilung von Neubauernstellen an Umsiedler in der SBZ/DDR und bejubelte die Integration von Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen in der BRD als eine, wenngleich mit Anfangsschwierigkeiten behaftete, große Erfolgsgeschichte. Aus der gesamten Debatte ausgespart bleiben auch alle Fragen nach den konkreten Verantwortlichkeiten: Warum musste denn überhaupt die Rote Armee im Januar/Februar 1945 noch eine große Offensive einleiten? Warum hatte die deutsche Armee nicht schon längst kapituliert, die Kämpfe beendet und eine kampflose Besetzung ermöglicht, die den alliierten Truppen riesige Verluste erspart hätte und für die deutsche Zivilbevölkerung mit weit weniger Schrecknissen verbunden gewesen wäre? 6 POLEN und wir 1-2/2010 POLEN und wir 1-2/2010 7
5 POLITIK Warum und durch wen wurden zahlreiche Städte wie Königsberg und Breslau, Gdingen und Danzig, zu»festungen«erklärt, die»bis zum Äußersten verteidigt«werden müssten? In welchem Umfang musste die Zivilbevölkerung sich an der»verteidigung bis zum Äußersten«(z.B. durch Schanzarbeiten und Ähnliches) beteiligen? Welche Folgen hatte das? Wer musste in den»festungen«bleiben, wer durfte die Städte verlassen, wer wurde zum Verlassen gezwungen? Wie lief die von den Nazis befohlene und teilweise durch Waffengewalt oder durch Entzug der Lebensmittelkarten erzwungene Evakuierung konkret ab? Wer befahl, wer organisierte sie? Welche Rolle spielte die deutsche Wehrmacht? Schützte sie die Fliehenden oder behinderte sie die Flucht? Mit welchem Recht werden die Opfer des Evakuierungswahnsinns und der Verteidigung der»festungen«als»vertreibungsverluste«klassifiziert und der Roten Armee oder Polen angelastet? Wie erfolgte die Umsiedlung unter Kontrolle der Alliierten? Wie unterschied sie sich z.b. von der Evakuierung durch die Nazis? Bezeichnenderweise bemüht sich die Ausstellung nicht einmal um die Beantwortung der Frage, warum die Alliierten die Umsiedlung der außerhalb der neuen deutschen Grenzen verbliebenen Deutschen und Deutschstämmigen für notwendig hielten und in Potsdam beschlossen. Dabei ist doch diese Frage für die Beurteilung dieses Teils der damaligen Geschehnisse von zentraler Bedeutung. Mehr noch: Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ohne eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Motivation der Alliierten möglich sein soll,»die nationalsozialistische Expansions- und Vernichtungspolitik als Ursache von Flucht und Vertreibung während und nach dem Zweiten Weltkrieg«darzustellen, wie es Bernd Neumanns Konzept für das»sichtbare Zeichen«ja immerhin vorsieht (allerdings mit Schlupfloch: davor steht das Wörtchen»auch«). Hier stoßen wir auf einen grundlegenden Widerspruch: Die Zweckbestimmung des Erinnerns an das»unrecht der Vertreibung«verhindert, dass die notwendigen konkreten Fragen nach dem Wer, Was, Warum gestellt werden, und dies wiederum verhindert, dass der Zusammenhang zwischen der Expansions- und Vernichtungspolitik der Nazis einerseits und der Umsiedlung andererseits wirklich begreifbar wird. Denn es geht ja nicht einfach um das Bekenntnis, dass während der NS-Zeit von Deutschen und in deutschem Namen schlimmste Verbrechen begangen wurden. Dieses Bekenntnis ist heute wohlfeil und geht auch Frau Steinbach mittlerweile locker von den Lippen. Gern zusammen mit Sätzen wie diesem:»wer sagt, wegen Hitler muss man Verständnis für die Vertreibungen haben, der folgt dem Prinzip der sizilianischen Blutrache.«Rachegefühle auf seiten der drangsalierten und gequälten Menschen in den besetzt gewesenen Ländern sind zweifellos verständlich. Aber die Alliierten in Potsdam waren keine Runde von Rächern, sondern Politiker. Nach der Niederwerfung des»großdeutschen Reiches«sahen sie sich vor die Aufgabe einer Neuordnung Europas, insbesondere Osteuropas, und der Festlegung der deutschen Ostgrenzen gestellt. Sie wussten, dass Deutschland die nach dem Ersten Weltkrieg festgelegten Grenzen im Osten nie anerkannt und stets nach ihrer Revision getrachtet hatte. Sie mussten Bedingungen schaffen, die so gut wie irgend möglich garantierten, dass sich die soeben erlebte Katastrophe nie wiederholen würde. Sie hatten keinen Grund zu der Annahme, dass mit dem»dritten Reich«auch der deutsche Expansionsdrang nach Osten unwiderruflich untergegangen wäre und keinerlei Gefahr eines Wiederauflebens bestünde, bei dem auch die deutschen Minderheiten wieder eine unheilvolle Rolle hätten spielen können. Denn dem»dritten Reich«waren ja ein Kaiserreich und eine Weimarer Republik vorangegangen, an deren Ostpolitik die Nazis hatten anknüpfen können, um sie in nie für möglich gehaltener Konsequenz auf die äußerste Spitze zu treiben. Die breite Akzeptanz dafür war möglich, weil die völkische Ideologie seit Generationen in den Köpfen der deutschen Bevölkerung verankert worden war. Man mag diskutieren, ob die Alliierten für dieses Problem die optimale Lösung fanden. In der deutschen Debatte wird jedoch negiert, dass es ein solches Problem überhaupt gab. Notwendige Diskussion Fast könnte man es bewundernswert nennen, wie gut es den politischen Kreisen, die sich für ein Vertreibungszentrum stark machen, gelingt, diesen ganzen Themenbereich aus der Diskussion herauszuhalten. Wem ist schon bewusst, dass bis 1918 Polen zwischen dem Deutschen Reich, dem Habsburger und dem Russischen Reich aufgeteilt war? Wer denkt im Zusammenhang mit»flucht und Vertreibung«daran, dass schon der Außenminister der Weimarer Republik 1925 in Locarno nicht bereit war, die 1918 festgelegte deutsch-polnische Grenze anzuerkennen? Wer weiß etwas über die zahlreichen Organisationen des Volkstumskampfes mit dem Ziel eines Großdeutschen Reiches über die Alldeutsche Partei des Georg Ritter von Schönerer ( )und den Alldeutschen Verband, über den Deutschen Schulverein und den Verein für das Deutschtum im Ausland, über die Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei, die 1903 im nordböhmischen Reichenberg gegründet wurde und Hitler wichtige Elemente seines Programms lieferte, über die Sudetendeutsche Heimatfront des Konrad Henlein und die Sudetendeutschen Freikorps, die bewaffnet gegen die Tschechoslowakei kämpften und an deren Destabilisierung und Zerschlagung beteiligt waren? Und wer macht sich Gedanken darüber, dass völkische Ideen bis heute in unserer Gesellschaft virulent sind und von vielen als selbstverständlich akzeptiert werden sei es die Funktion des deutschen Staates als Schutzmacht für alle»deutschen«auf der Welt, egal welchen Staates Bürger sie sind; sei es die Vorstellung, dass Europa aus einer Vielzahl von Regionen zusammengesetzt sei, von denen jede die gottgegebene»heimat«einer bestimmten Volksgruppe sei. Zugegeben, das Thema ist komplex und nicht ohne weiteres zu durchschauen. Aber die Diskussion darüber muss geführt werden. Das geplante Vertreibungszentrum soll angeblich der Versöhnung dienen. Schon seine bisherige Geschichte zeigt, dass es dazu nicht geeignet ist. Das liegt nicht allein an Erika Steinbach. Ohne kritische Aufarbeitung der deutschen Ostpolitik seit Kaisers Zeiten und ohne klare Absage an diese Tradition wird das polnische und tschechische Misstrauen gegenüber Deutschland bleiben. Diese Aufarbeitung kann nicht in Form eines Vertreibungszentrums stattfinden, in dem fertige Klischees präsentiert werden. Dafür ist eine lebendige Auseinandersetzung ohne Vorgaben im Stile von»jede Vertreibung ist Unrecht«notwendig. Erika Steinbach ist eine Zumutung aber das Problem geht weit über sie hinaus. Renate Hennecke ist verantwortliche Redakteurin der Deutsch-Tschechischen Nachrichten ( Spurensuche Ausstellung über NS-Zwangsarbeit in der Lokhalle Eine Ausstellung mit dem Titel»Auf der Spur europäischer Zwangsarbeit. Südniedersachsen «wurde Anfang des Jahres in Göttingen gezeigt. Sie verknüpfte die Lebensgeschichten polnischer, niederländischer und italienischer Zwangsarbeitender und wurde unter Beteiligung von Wissenschaftlern aus diesen Ländern erarbeitet. Angehörige aus mindestens 16 Nationen leisteten während des Zweiten Weltkriegs in Südniedersachsen Zwangsarbeit. Im Mai 1944 befanden sich offiziell 8091 ausländische Arbeitskräfte im Bereich des Arbeitsamtes Göttingen und im Bereich des Arbeitsamtes Northeim. Die Göttinger Geschichtswerkstatt geht sogar von bis Zwangsarbeitenden im Gebiet der heutigen Landkreise Northeim und Göttingen aus.»die ausländischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter arbeiteten in nahezu allen denkbaren Wirtschaftsbereichen«, erläutert der Göttinger Kulturwissenschaftler Günther Siedbürger.»Sie wurden in Gaststätten und Hotels, Bäckereien, kirchlichen Einrichtungen, Kommunen und Privathaushalten eingesetzt.«die Ausstellung zeigte in dreizehn thematischen Stationen das Ausmaß und die Vielfältigkeit von Zwangsarbeit am regionalen Beispiel Südniedersachsen. Im Mittelpunkt standen die Biografien ehemaliger Zwangsarbeitender aus fünf europäischen Ländern. Die Ausstellung war interaktiv und multimedial. Neben Texten, Bildern und historischen Dokumenten zeigte sie in Schubladen und Vitrinenfenstern Objekte, die mit dem Thema verbunden sind. Multimediastationen stellten weitere Dokumente zur Verfügung. In zahlreichen lebensgeschichtlichen Filminterviews berichteten ehemalige Zwangsarbeiter anschaulich von ihren Erfahrungen. Lisa Grow, Historikerin der Göttinger Geschichtswerkstatt:»Während der einjährigen Vorbereitungszeit haben wir intensiv mit Partnern aus Polen, Italien und den Niederlanden zusammengearbeitet«. Auch die Fachhochschule Hannover und die Universitäten Hannover und Erlangen- Nürnberg beteiligten sich an den Vorbereitungen. Bahn will erneut von Polen-Transporten profitieren 500 Millionen Euro verdient Polnische Nazi-Opfer fordern humanitäre Hilfe Von Karl Forster Die Deutsche Bahn AG will ihren Tätigkeitsbereich auf Polen ausdehnen, und bewirbt sich um lukrative Strecken. Das brachte die Zeiten in Erinnerung, als deutsche Eisenbahnzüge schon einmal auf polnischen Strecken operierten, Soldaten nach und von der Front brachte, Zwangsarbeiter in den Westen transportierte und Häftlinge in die KZs und Vernichtungslager verschleppten. Zwei der größten Opfer-Organisationen, der "Polnische Verband ehemaliger politischer Häftlinge der Hitler-Gefängnisse und -Konzentrationslager" und die "Gesellschaft der vom Dritten Reich geschädigten Polen" machten auf einer Pressekonferenz auf diese Geschichte aufmerksam und appellierten an den Vorstand der Deutschen Bahn, die auf dem polnischen Markt Gewinne machen möchte, sich an finanzieller Hilfe für die Nazi-Opfer zu beteiligen. "Die deutschen Bahnen wollen bei uns verdienen, doch sie haben im besetzten Polen sehr viel verdient", erklärte Stanislaw Zalewski, Vorsitzender des "Polnischen Verbandes ehemaliger politischer Häftlinge der Hitler-Gefängnisse und -Konzentrationslager". Jetzt soll, so Zalewski, die Bahn eine angemessene Summe für humanitäre Hilfe für die ehemaligen Gefangenen und Zwangsarbeiter leisten. Die Organisation "Zug der Erinnerung" hatte kürzlich errechnet, dass die deutschen Bahnen an den Deportationen der Polen während des Zweiten Weltkrieges umgerechnet auf heutige Verhältnisse eine halbe Milliarde Euro verdient haben. Die Bahnen verdienten an den Transporten in die Konzentrationslager und bei Umsiedlungen. In einer Expertise der Organisation wurden die Gefangenentransporte von der örtlichen Verwaltung in den besetzten Gebieten bzw. von der SS bezahlt, die dieses Geld zuvor ihren Opfern geraubt hatte. "Dies war eine makabre Prozedur, und ich hoffe, dass die Bahnen endlich ihre Opfer entschädigen", erklärte Hans-Rüdiger Minow vom Zug der Erinnerung gegenüber polnischen Medien. Zalewski, dessen Verband heute noch rund 7000 Mitglieder zählt, rechnet mit keinen großen Entschädigungen der Deutschen Bahn: "Es liegt uns an einer humanitären und sozialen Hilfe, um Medikamente, ärztliche Versorgung und Heizung bezahlen oder anderen Bedarf decken zu können". Allerdings schließen die beiden Verbände, sollte die Deutsche Bahn kein Entgegenkommen zeigen, Sammelklagen gegen den Konzern nicht aus. "Die Opfer des Dritten Reiches sollen ihre Rechte einfordern", kommentiert der Berliner Rechtsanwalt Stefan Hambura, der polnische Geschädigte vertritt, die Situation. Die Deutsche Bahn erklärte im Zusammenhang mit der Expertise des Zug der Erinnerungen, sie sei keine Rechtsnachfolgerin der Reichsbahn. Doch polnische Medien wiesen inzwischen darauf hin, dass der deutsche Konzern auf dem Vermögen der Reichsbahn aufgebaut wurde und beispielsweise auch Millionen für die Feierlichkeiten zum 175. Gründungstag der deutschen Eisenbahn ausgeben wird. Bald Zugverbindung nach Kołobrzeg POLITIK Zwischen Deutschland und Polen sollen bald mehr Regionalzüge rollen. Die polnische PKP Intercity und DB Regio, die Nahverkehrssparte der Deutschen Bahn, planen grenzüberschreitende Regionalverkehre zwischen Deutschland und Polen. Die erste Verbindung dieser neuen Kooperation zwischen Berlin und dem 290 Kilometer entfernten Ostseebad Kolobrzeg(Kolberg) soll im zweiten Quartal dieses Jahres starten. Kolberg war bis 1945 ein bekanntes See-, Sole- und Moorbad mit vielen Gästen vorwiegend aus Berlin und den östlichen Teilen Deutschlands. Bislang war allerdings Kolobrzeg nur per Auto oder Bus erreichbar. Lediglich ein Sonderzug im eingleisigen Verkehr fuhr vor einigen Jahren als Promotionaktion in das Ostseebad. kfo. 8 POLEN und wir 1-2/2010 POLEN und wir 1-2/2010 9
6 POLITIK Vielen Dank Unter dem Titel Die Krise hat auch uns erreicht hatten wir in der letzten Ausgabe um Ihre Hilfe gebeten. Steigende Preise für Herstellung Versand und krisenbedingt rückläufige Abonnentenzahlen haben die Zeitschrift in eine akute Notlage gebracht. Wir hatten versprochen, alle Spender (ausgenommen wer ausdrücklich nicht genannt werden wollte) zu veröffentlichen, allerdings ohne die Höhe der Spende. Bis zum Redaktionsschluß erreichten uns folgende Spenden: Dr. Gerhard Baader Armin Clauss Ernst Durkin Magdalena Eckhardt Otto Fabritius Horst Grabe Werner Guttmann Sabine Hage Dr. Eilo Hildebrandt Holger Höhmann Anna Jouravel Hertbert Konetzny Karl Kwietzinski Eberhard Langen Klaus Leith Dr. Georg Maraun Karl - Horst Marquart Jan Michalczyk Wolfgang Ridder Christa Ridder Prof. Dr. Diether Roderich-Reinsch Peter Römer Renate Rosenau Kurt Schmucker Marion Schneider Jürgen Scholz Hansi Willuweit Noch einmal herzlichen Dank. Sie können uns auch weiterhin mit Spenden unterstützen. Unser Konto: Nr , bei Postbank Essen, BLZ: Polen startet Auschwitz-Seite auf Facebook Könnte keinen geeigneteren Weg geben, um Jugend aufzuklären Die polnischen Behörden wollen das Internet stärker dazu nutzen, die jüngere Generation über die Verbrechen des Nazi- Regimes und den Horror des Holocaust aufzuklären. Um dieses ehrenvolle Ziel zu erreichen, hat die Verwaltung des bekannten ehemaligen Konzentrationslagerkomplexes in Auschwitz nun eine eigene Seite auf dem Online-Community-Portal Facebook eingerichtet. Dort finden Interessierte zahlreiche Neuigkeiten und Hintergrundinformationen rund um die mittlerweile in ein staatliches polnisches Museum verwandelte Gedenkstätte, die Angaben der polnischen Verwaltung zufolge jährlich von mehreren Mio. Menschen aus der ganzen Welt besucht wird und zu einem Mahnmal der Grausamkeit der NS- Herrschaft während des Zweiten Weltkriegs geworden ist. Wir sind stets darum bemüht, neue Wege ausfindig zu machen, um die Menschen zu erreichen. In der heutigen Welt ist das Internet eines der effektivsten Werkzeuge zur Erreichung dieses Ziels, erklärt Pawel Sawicki, Beamter im Dienst des Museums in Auschwitz, gegenüber der BBC. Nachdem man erst vor wenigen Monaten zusätzlich zur Museums-Homepage einen eigenen Kanal auf der Video- Plattform YouTube gestartet habe, sei nun eben Facebook an der Reihe. Millionen von Menschen nutzen Facebook. Wenn es unsere Mission ist, die heutige Jugend zu verantwortungsvollen Bürgern der gegenwärtigen Welt zu erziehen, könnte es keinen geeigneteren Ansatz geben, als auf Tools zu setzen, die die Menschen auch selbst gerne verwenden, fasst Sawicki die Beweggründe für die Errichtung der Auschwitz-Seite auf dem Portal zusammen. Die Facebook-Seite wird Interessierten einen Ort zur Diskussion bieten, den es auf der offiziellen Homepage der Gedenkstätte in der Form nicht gibt, erläutert Sawicki. Dass es dabei auch zu Übergriffen einzelner Nutzer kommen könnte, die diese Möglichkeit dazu missbrauchen, um rassistisches bzw. antisemitisches Gedankengut zu verbreiten, ist man sich bei der Museumsverwaltung durchaus bewusst. Hier soll zwar ein Ort des Diskurses entstehen. Natürlich werden wir es aber nicht zulassen, dass das Gedenken der Opfer und dieser Stätte in den Schmutz gezogen wird, betont Sawicki. Bislang sei das Ganze aber noch eher als Experiment einzustufen. Wir werden sehen, wie die Leute reagieren, so der Auschwitz-Beamte. pressetext (pte) Sie sind noch kein regelmäßiger Leser unserer Zeitschrift: das sollte sich ändern. Für nur 12 Euro pro Jahr erhalten Sie vier Ausgaben der Zeitschrift POLEN und wir frei Haus. Sie erhalten interessante Hintergrundinformationen zu den deutsch-polnischen Beziehungen und unterstützen damit die Arbeit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland e.v. Bestellungen an: Polen und wir - c/o Manfred Feustel, Im Freihof 3, Hünxe. Fax: oder per mail abo-puw@polen-news.de Prof. Felix Tych sprach zum 27. Januar vor dem Deutschen Bundestag Die Niedertracht der einen machte den Heldenmut der anderen zunichte Holocaust hat die niedrigsten Instinkte freigesetzt Dr. Felix Tych, ein polnischer Historiker, der sich unüblicher Weise mit Rosa-Luxemburg sehr beschäftigte, wurde in den 90er Jahren Direktor des Jüdischen Historischen Instituts Warschau und entwickelte es zu einem eindrucksvollen archivalischen und musealen Zentrum. Am Tag der Opfer des Nationalsozialismus war er einer der beiden Festredner im Deutschen Bundestag. In der Öffentlichkeit ging seine Rede jedoch weitgehend unter hinter der umstrittenen Rede des israelischen Präsidenten Shimon Peres. Deshalb dokumentieren wir hier die Rede Tychs. Ich bedanke mich für die Einladung, in der heutigen Gedenkstunde zu Ihnen zu sprechen. Es ist für mich eine große Ehre und für jemand, der überlebt hat, ist es eine besondere Genugtuung. Als Deutschland den Krieg begann, war ich zehn. Am 1. September 1939 sollte mein 5. Schuljahr beginnen. Doch bis zum Ende der deutschen Besatzung ging ich nicht mehr zur Schule. Das Dritte Reich hatte mit jüdischen Kindern anderes vor. Wir wohnten damals in Radomsko, einer kleinen Industriestadt, 60 km von der deutschen Grenze entfernt. Mein Vater, ein technischer Autodidakt, besaß eine kleine Fabrik für Baubeschläge. Von den Einwohnern der Stadt war ein Drittel jüdisch. Heute wohnt dort kein einziger Jude mehr. Am dritten Kriegstag rückte die Wehrmacht ein. Als erstes plünderten Mannschaften wie Offiziere jüdische Läden. Gestapo- und SS-Männer nahmen Juden auf der Straße fest oder holten sie aus den Häusern, um sie zu schikanieren. Sie hatten nichts dagegen, dass polnische Passanten ihnen dabei zusahen. Vermutlich lag ihnen sogar an diesen Zuschauern. Am 20. Dezember musste die jüdische Bevölkerung ohne Vorankündigung der deutschen Behörden sofort in einen kleinen Teil der Stadt umziehen, der seitdem bei der Bevölkerung Getto hieß. Es hatte weder Mauern noch Zäune, nur deutsche oder polnische Polizisten standen an der Gettogrenze. Auf Schildern wurde davor gewarnt, es unerlaubt zu betreten oder zu verlassen. Wir mussten unsere Wohnung innerhalb weniger Stundenräumen und zogen in ein Holzhaus am Gettorand. Mit knapp 12 Quadratmetern in einer Dachkammer mussten meine Eltern, drei meiner Geschwister und ich fortan auskommen. Fast alle Gettobewohner lebten im Elend. Männer zwischen 16 und 55 Jahren hatten unentgeltlich schwere Zwangsarbeit zu leisten, welche die deutschen Behörden Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus im Deutschen Bundestag. Feliks Tych, ehemaliger Direktor des Jüdischen Historischen Instituts, bei seiner Rede. Foto: Deutscher Bundestag/Lichtblick/Achim Melde. für sie erfanden. Im Sommer 1940 starben während einer Typhusepidemie Hunderte von Menschen. Meinem rational denkenden Vater kam gar nicht in den Sinn, dass wachsender Terror und zunehmende Schikanen gegenüber Juden schließlich mit deren Vernichtung enden könnten. Dies schien ihm unvorstellbar, weil gänzlich irrational und im Widerspruch zu Deutschlands Interessen, POLITIK das doch Krieg führte und Arbeitskräfte brauchte. Er erinnerte sich noch an die weit weniger brutale deutsche Besatzung im 1.Weltkrieg. So habe ich ihn oft sagen hören: "Hitler hin, Hitler her, aber die Deutschen sind kein Volk von Mördern!" Was er in den letzten Minuten seines Lebens in Treblinka dachte, werde ich niemals erfahren, Anfang September 1942 gingen im Radomsker Getto Gerüchte um, es stände eine große Aktion bevor. Wie die meisten dachten auch meine Eltern dabei an eine Art Pogrom oder große Menschenjagd, um Arbeitslager aufzufüllen. Sie beschlossen daher, mich, den Jüngsten, besser zu meiner 15 Jahre älteren Schwester zu schicken, die in Warschau lebte. Sie hatte noch im Juli, vor der großen Deportation, mit Mann und zweijährigem Sohn aus dem Getto auf die sog. arische Seite flüchten können. Polnische Arbeitskollegen meines Schwagers hatten für alle drei "arische Papiere", eine Unterkunft und für ihn sogar eine Arbeit in ihrem Architekturbüro besorgt. Bei ihnen sollte ich die geheimnisvolle Aktion abwarten und wenn sich alles beruhigt hätte, wieder zurückkommen. Ende September musste ich mich heimlich aus dem Getto zu einem polnischen Arbeiter stehlen, der früher in der Fabrik meines Vaters gearbeitet hatte. Er brachte mich noch am selben Tag mit dem Zug nach Warschau. Als ich mich von meinen Eltern verabschiedete, dachte ich keinen Moment daran, dass ich sie zum letzten Mal sehen könnte. In Warschau fand mein Schwager bald über eine Arbeitskollegin eine Frau die mich aufnehmen wollte - trotz der Todesstrafe, die im besetzten Polen ihr samt ihrer Familie drohte, wenn sie einem Juden half. Sie hieß Wanda Koszutska und hatte selbst zwei kleine Kinder. Vor dem Krieg war sie Gymnasiallehrerin gewesen, und arbeitete nun als Küchenhilfe in einer polnischen Betriebskantine. Bevor sie endgültig zusagte, wollte sie mich sehen. Ich erinnere mich an die ersten Worte, die ich von ihr hörte: "Ja, er sieht doch gut aus." "Gut aussehen" hieß damals in meinem Fall, nicht anders auszusehen als ein durchschnittliches pol- 10 POLEN und wir 1-2/2010 POLEN und wir 1-2/
7 POLITIK POLITIK nisches Kind. Meine blonden Haare und hellen Augen boten mir und meinen Rettern größere Überlebenschancen. Wanda konnte mich nicht verstecken und so musste ich für ihre Nachbarn als ein Familienangehöriger existieren. Ich wurde ihnen als Sohn ihrer verstorbenen Schwester vorgestellt. Mein Schwager versah mich mit einer falschen Geburtsurkunde und einem falschen Schulausweis. Meine Schwester verschwieg mir bis ans Kriegsende, dass unsere Eltern nicht mehr lebten. Wenn ich nach ihnen fragte, bekam ich zur Antwort: "Wir wissen nicht, wohin die Deutschen sie gebracht haben." Sie wollte mir nicht die Hoffnung nehmen. Erst nach dem Krieg erfuhr ich, was nach meiner Flucht in Radomsko passiert war. Am 9. und 12. Oktober hatte die SS die Gettoinsassen nach Treblinka deportiert. Das geheimnisvolle Wort Aktion erwies sich als Teil des Kryptonyms "Aktion Reinhardt" für die Ausführung des Befehls, alle Juden im Generalgouvernement zu ermorden. So starben meine Eltern, mein ältester Bruder, seine Frau und ihr vierjähriges Kind und meine Schwester mit einem dreijährigen Kind. Ihr Mann war schon früher als politischer Häftling in Auschwitz umgekommen; dort starben auch meine älteste Schwester, ihr Mann und ihre siebenjährige Tochter. Einen anderen erwachsenen Bruder, der sich in Warschau auf die arische Seite gerettet hatte, erschoss die Gestapo im Herbst 1943 in den Ruinen des Warschauer Gettos. Ein polnischer Schulkamerad, dem er auf der Straße begegnet war, hatte ihn denunziert. Die Niedertracht der einen machte den Heldenmut der anderen zunichte. Auch Wanda hütete das Geheimnis vom Tod meiner Nächsten. Sie kümmerte sich um mein seelisches Gleichgewicht, meine Erziehung und meine Lektüre - die polnische Untergrundpresse eingeschlossen. Mit Schulbüchern aus der Vorkriegszeit holte ich selbst oder mit ihrer Hilfe das versäumte Lernpensum nach. Ich verbrachte viel Zeit in der Stadt; denn Wanda meinte zu Recht, das ließe Nachbarn erst gar keinen Verdacht schöpfen. Den Aufstand im Warschauer Getto beobachtete ich mit zusammengebissenen Zähnen von der polnischen Seite der Mauer aus. Den Krieg überstanden wir hungernd in gemeinsam geteilter Armut. Mehrmals war ich dem Tod nur um Haaresbreite entgangen. Gerettet hatte mich vor allem eine Kette von guten, mutigen Menschen wie Wanda, wie der polnische Arbeiter, der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus im Deutschen Bundestag. Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert, (3.v.re), und Gäste. V.li: Jens Böhrnsen, Bundesratspräsident, Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin, Eva Köhler, Bundespräsident Horst Köhler, Shimon Peres, Staatspräsident von Israel, Präsident Lammert, Feliks Tych, Zeitzeuge und ehemaliger Direktor des Jüdischen Historischen Instituts von Warschau, und Hans-Jürgen Papier, Bundesverfassungsgerichtspräsident. Foto: Deutscher Bundestag/Lichtblick/Achim Melde. mich aus Radomsko nach Warschau brachte, wie die Kollegen meines Schwagers oder viele andere mehr. Als Yad Vashem 18 Jahre nach dem Krieg eine Medaille für all jene stiftete, die Juden während des Holocaust gerettet hatten, konnte ich meine Ziehmutter lange nicht dazu bewegen, die Auszeichnung anzunehmen. Ihrer Ansicht nach hatte sie nur das getan, was jeder anständige Mensch hätte tun sollen. Erst nach dem Krieg konnte ich - wie alle anderen Überlebenden auch - das wahre Ausmaß der Katastrophe erkennen. Wer überlebt hatte, stand vor der schwierigen Entscheidung, was er mit dem Leben anfangen, wohin er gehen und ob er in Polen bleiben sollte. Hunderte von Dokumente berichten von den Tragödien derer, die versuchten, ein neues Leben zu beginnen. Der klägliche Rest der polnischen Juden, der in deutschen Konzentrationslagern, bei Sklavenarbeit, bei den Partisanen, in Bunkern im Wald, in Verstecken oder mit einer Notidentität überlebt hatte, lenkte größtenteils die ersten Schritte in die Heimat; hauptsächlich, um festzustellen, ob jemand aus der Familie überlebt hatte, mitunter auch in der Hoffnung auf eine Rückkehr ins eigene Haus oder auf die Rückgabe von Hab und Gut, das man notgedrungen bei nicht jüdischen Nachbarn hinterlassen hatte. Für die meisten Überlebenden war diese Rückkehr eine Verlängerung der traumatischen Kriegsjahre. Im Allgemeinen erfuhren sie, dass niemand von ihren Angehörigen mehr lebte, und selten empfingen ihre alten Nachbarn sie mit offenen Armen. In der Regel waren diese unangenehm überrascht, dass jemand zurückkehrte, und in kleineren Städten oder Dörfern endete das nicht selten mit einem Meuchelmord, um fremdes Eigentum nicht zurückgeben zu müssen. Die Walze des Holocaust hatte ihre unverkennbaren Spuren hinterlassen: Die moralischen Normen großer Bevölkerungsgruppen wurden bedenklich deformiert. Besonders sichtbar war dies dort, wo Juden im Beisein der christlichen Ortsbevölkerung erschossen oder deportiert wurden - was in den Kleinstädten und Dörfern die Regel war. Alle Polen wussten, dass die SS die Juden in den Tod schickte. Selbst im deutsch besetzten Polen, wo auch die polnische Bevölkerung insgesamt gewaltige Verluste an Leib und Leben erlitt, machte sie örtlich die Jagd auf Juden mit. Im Sommer 1941 fand in einer Region, die kurz zuvor noch sowjetisch besetzt gewesen war, der erste Massenmord an polnischen Juden statt. Gestapo und Einsatzgruppen hatten ihn angeregt, aber ausgeführt hatten ihn polnische Nachbarn der Opfer. Ich spreche von der Serie blutiger Pogrome in der nordostpolnischen Kleinstadt Jedwabne und über 30 umliegenden Ortschaften. In Polen retteten etwa Menschen in Stadt und Land unter Einsatz ihres Lebens mindestens Juden, aber gleichzeitig fanden sich Menschen, die Juden, welche sich versteckt hatten, denunzierten oder der Polizei übergaben. Der Holocaust hat in Teilen der Bevölkerung die niedrigsten Instinkte freigesetzt und sie in der Überzeugung bestärkt, dass man Juden immer ungestraft ermorden könne. In Polen, in Ungarn und der Slowakei fanden nach dem Krieg Pogrome statt, in denen Überlebende des Holocaust zu dessen verspäteten Opfern wurden. In ihren Dimensionen sind diese Vorfälle selbstverständlich nicht mit der sog. Endlösung der Judenfrage zu vergleichen. Allein die Tatsache, dass so etwas nach dem Holocaustgeschehen konnte, löste einen Schock und Panik aus. In Polen führte das zwischen 1945 und 1950 zu einem Exodus der meisten Juden.. Die Jahrzehnte lang tabuisierten oder beschwiegenen Fragen, die sich aus den langfristigen Folgen des Zweiten Weltkriegs und den verqueren polnisch-jüdischen Beziehungen ergaben, haben mich schließlich vor drei Jahren veranlasst, im Jüdischen Historischen Institut Warschau ein interdisziplinäres Forschungsprojekt zu beginnen. Ich bin glücklich, dass ich hierfür unter der mittleren und jungen polnischen Forschergeneration 28 Partner und Partnerinnen an fünf polnischen Universitäten und vier renommierten Forschungsinstituten gefunden habe. Unsere Ergebnisse werden noch in diesem Jahr gedruckt in einer polnischen und einer englischen Fassung erscheinen. In den ersten 50 Jahren nach dem Holocaust wurde dieser in Europa fast ausschließlich als deutscher Völkermord wahrgenommen, was für eine Reihe von Ländern sehr bequem war. Dort wurde das Thema Jahrzehnte lang freiwillig tabuisiert oder marginalisiert. Keine staatliche Zensur war nötig. Seit den 1990er Jahren wird dieser Prof. Feliks Tych am im Interview mit dem Parlamentsfernsehen des Bundestages im Gespräch mit Moderator Sebastian Przyrowski. Foto: Deutscher Bundestag photothek/thomas Trutschel Unschuldsmythos in der historischen Forschung zunehmend in Frage gestellt. Als die Holocaustforschung intensiviert wurde, stand aber weiterhin eine ganze Armee von Hofhistorikern zur Verteidigung der "nationalem Ehre" bereit. Inzwischen sehen immer mehr Historiker das Beschweigen als probates Mittel zur Geschichtsfälschung als unvereinbar mit ihrem Berufsethos an und präsentieren auch bittere Wahrheiten über Kriegs- und Nachkriegsgeschichte. Eine integrierte Sichtweise auf den Holocaust, die auch seine Nachkriegsfolgen mit einbezieht, hat immer noch so gut wie keinen Anklang gefunden. In vielen Holocaustmuseen brechen die Ausstellungen in der Regel mit Fotos von befreiten Lagern, von Leichenbergen und menschlichen Skeletten ab. Das Äußerste ist noch der Nürnberger Prozess. Und damit ist die Sache erledigt. Denselben Vorwurf muss man auch sehr vielen Schulbüchern machen. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass fast in jedem europäischen Land, in dem die nationalsozialistischen Deutschen ihr Projekt zur Ausrottung der Juden verwirklichten, ein Teil der einheimischen Bevölkerung so oder anders in den Völkermord verwickelt war: sei es als Täter, als Retter und als den Tätern geneigte Zuschauer oder sei es nur als Profiteure, die sich selbst die Hände nicht schmutzig machten, und vor allem als Gleichgültige. Außer auf das Dritte Reich traf das in sehr unterschiedlichem Maße auf mindestens 13 europäische Länder zu: auf sechs verbündete und sieben besetzte. Im verbündeten Rumänien, wo die Hälfte der jüdischen Bevölkerung ermordet wurde, geschah das mit vereinten Kräften von Rumänen, Deutschen, Ukrainern und Ungarn. Die Bulgaren opferten nur die Juden aus ihren Besatzungsgebieten in Thrakien, Mazedonien und im Kosovo. In Ungarn wurden Juden zunächst in eigener Regie ermordet, doch die größte Opfergruppe von über Menschen schickte man in die Gaskammern von Auschwitz-Birkenau. Dorthin deportierten auch Italien, die Slowakei, Norwegen und andere Länder ihre jüdischen Staatsbürger. Diese Kooperation des Dritten Reichs mit seinen Verbündeten und der willfährigen Polizei in den meisten besetzten Ländern war charakteristisch für das deutsche Völkermord-Projekt. Die Polizei in Frankreich, Holland oder Belgien stellte auf deutschen Befehl die Transporte in die Todeslager zusammen, die die SS sich gebaut hatte und verwaltete. In anderen besetzten Ländern, wie in Litauen, Lettland, Estland oder der Ukraine wurden die Juden nicht allein von Einsatzgruppen ermordet, sondern auch von spontan mit deutscher Billigung entstandenen Freiwilligen-Milizen der Ortsbevölkerung. Aus dem Baltikum und der Ukraine kamen auch die Hilfswilligen, die der SS bei der Deportation aus den Ghettos im besetzten Polen halfen. Viele dieser Hiwis dienten in allen Vernichtungszentren, die die SS im Generalgouvernement hatte errichten lassen. In Bełżec, Sobibór und Treblinka überstieg die Anzahl dieser Helfershelfer die der SS-Lagerbesatzung um ein Vielfaches. Nichts kann das Dritte Reich von der Verantwortung für den Holocaust freisprechen, dem die Nürnberger Gesetze den Weg bahnten. Aber es gibt auch keinen Grund, die Regierungen Ungarns, Rumäniens, der Slowakei, Bulgariens oder Kroatiens, die diese Gesetze nachahmten, in der Erzählung über den Holocaust auszusparen. Die Rezeption des Holocaust, mit dem ein moralischer Gattungsbruch vorliegt, bleibt solange unvollständig und verzerrt, solange eine europäische Komplizenschaft beim deutschen Staatsverbrechen, das hier in Berlin geplant und von hier aus gelenkt wurde, nicht Bestandteil des europäischen historischen Bewusstseins ist.. 12 POLEN und wir 1-2/2010 POLEN und wir 1-2/
8 POLITIK Betrachtet es als Warnung Felix Tych sprach in Berlin mit Jugendlichen "Vergesst nicht, was gewesen ist - und betrachtet es als Warnung!" Der Holocaust-Überlebende und polnische Historiker Prof. Dr. Feliks Tych sagte am Mittwoch, 27. Januar 2010, in einem Gespräch mit Jugendlichen, die Verantwortung der heutigen und kommenden Generationen sei es vor allem, das Wissen über den Holocaust weiterzugeben. Tych hatte zuvor als Gastredner in der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages für die Opfer des Nationalsozialismus seine eigenen Erlebnisse in den Kriegsjahren im besetzten Polen geschildert. Feliks Tych, der 1929 als Kind jüdischer Eltern in Warschau geboren wurde, hatte dabei auch eine europäische Aufarbeitung des Holocausts angemahnt. Im Anschluss hatte der Historiker, der zwölf Jahre das Jüdische Historische Institut in Warschau leitete und sich bis heute für Aufklärung über nationalsozialistischen Völkermord einsetzt, eine Verabredung, die ihm besonders am Herzen lag: Zusammen mit Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert traf er 80 Jugendliche - vorwiegend aus Deutschland und Polen, aber auch aus Frankreich, Russland, den USA und Österreich - zu einem Gespräch über den Holocaust. Moderiert wurde die Diskussionsrunde von Prof. Dr. Gesine Schwan, der ehemaligen Beauftragten der Bundesregierung für die deutsch-polnischen Beziehungen. Jugendbegegnung Viele Fragen hatten die Jugendlichen mit im Gepäck, als sie im Jakob-Kaiser-Haus des Bundestages eintrafen. Die 18- bis 24- Jährigen waren erst spät am Abend zuvor als Teilnehmer einer Jugendbegegnung, die der Bundestag bereits zum 14. Mal anlässlich des Holocaust-Gedenktages organisiert hatte, aus Warschau zurückkehrt. Dort hatten sie sich dem schwierigen Erbe der deutsch-polnischen Geschichte gestellt, hatten verschiedene Archive und Museen besucht, Zeitzeugen gesprochen und auch das Vernichtungslager Treblinka gesehen, wo nordöstlich der polnischen Hauptstadt schätzungsweise mehr als eine Million Menschen, darunter polnische Juden wie die Eltern von Feliks Tych, von den Nationalsozialisten ermordet wurden. So vielfältig die Eindrücke, die die jungen Menschen dort gewonnen hatten, so vielfältig waren auch die Fragen, die sie dem Zeitzeugen Tych und dem Politiker Lammert stellen wollten: Große Fragen etwa nach Mitschuld und Verantwortung kamen zur Sprache - aber auch kleine, konkrete. So wollte etwa eine der Teilnehmerinnen schüchtern von Tych wissen, was für ihn persönlich heute Treblinka sei - ein Denkmal? Die Antwort des Überlebenden: "Für mich ist es vor allem ein Friedhof." Wichtig war den Jugendlichen die Frage, welche Verantwortung Deutschland heute für das Gedenken an den Holocaust trägt. Bundestagspräsident Lammert ließ keinen Zweifel daran: "Erinnerungskultur ist ganz klar eine Aufgabe, die der Staat nicht an die Gesellschaft abschieben kann." Staatliche Aufgabe Wenn aber die Gesellschaft das Interesse verliere, dann könne auch der Staat dies nicht kompensieren, gab Lammert zu bedenken. "Das eine geht nicht ohne das andere. Erinnerung ist beides - eine staatliche und gesellschaftliche Aufgabe." Immer wieder meldeten sich die Jugendli- Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus im Deutschen Bundestag. Hier diskutieren Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert, CDU/CSU, (re), Gesine Schwan, (mitte), und der Zeitzeuge und ehemalige Direktor des Jüdischen Historischen Instituts, Feliks Tych, (li), mit Jugendlichen über das Thema: Krieg, Besatzung, Völkermord - Polen nach dem deutschen Überfall Foto Rolf Schulten chen in den folgenden eineinhalb Stunden zu Wort. Der über 80-jährige Tych zeigte dennoch keinerlei Ermüdungserscheinungen. Als sich dann der Parlamentspräsident in Richtung Bundestag zur Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zum Afghanistan-Einsatz verabschiedet hatte und Moderatorin Schwan behutsam das Ende der Diskussion einleiten wollte, wehrte Tych ab: "Nein, nein, lassen Sie nur, mich interessieren die Fragen dieser jungen Leute!" So wollte dann zum Schluss eine der Jugendlichen wissen, was Tych von der heutigen Generation erwarte: "Was wünschen Sie sich konkret von uns?" Der Angesprochene dachte nicht lange nach: Eigentlich ginge es ihm gar nicht so sehr um die Frage der Verantwortung. Wichtiger sei ihm vor allem eines: "Ihr müsst über den Holocaust wissen." Was damals geschehen sei, dürfe nicht vergessen werden. "Und betrachtet es als Warnung", fügte Tych hinzu. Antisemitismus, auch dem islamischen Antisemitismus, müsse mit Wachsamkeit begegnet werden. Keineswegs dürfe er geduldet werden: "Zu diesem zivilisatorischen Code müssen sich die Menschen bekennen." Originalquelle des Dokuments: textarchiv/2010/ _kw04_diskussion_tych/index.html Gegen Rassismus im Fußballstadion Polnische Antifa-Aktivisten wollen bis zur EM 2012 die Stadien-Kultur in ihrem Land verändern und dokumentieren deshalb rechtsextremistisch motivierte Gewalt Von n-ost-korrespondent Marcin Rogoziński In Polen und der Ukraine laufen die Vorbereitungen für die Fußball-EM 2012 auf Hochtouren. Auch um eine friedliche, faire Atmosphäre während der Europameisterschaften machen sich die Veranstalter bereits große Sorgen. Denn die Stimmung auf den Tribünen während der Liga-Spiele ist alles andere als freundlich. Antisemitismus ist Bestandteil der polnischen Stadien-Kultur, sagt Marcin Kornak, Vorsitzender der Vereinigung Nigdy Wiecej ( Nie wieder ). Zusammen mit polnischen und ukrainischen Behörden sowie der UEFA will sie gegen Rassismus im Stadion kämpfen im Zentrum für Rassismus-Überwachung in Osteuropa. Posen (n-ost) Er wurde von Fans seiner eigenen Mannschaft attackiert, sagt Pape Samba Ba. Der Mittelfeldspieler aus dem Senegal ist in der vergangenen Saison auf dem Weg zum Training des Erstligisten Odra Opole (Oppeln) von unbekannten Männer angegriffen worden. Er konnte sich verteidigen und kam mit einem blauen Auge davon. Die Polizei nahm die Täter fest. Einer von ihnen hatte wenige Wochen zuvor schon einmal den Fußballprofi niedergeschlagen. Polen hat mit Rassismus im Fußball ein Problem, sagt Pape Samba Ba. Er meint damit nicht nur Übergriffe auf der Straße, sondern auch verbale Beleidigungen. An die Affen -Rufe und andere rassistische Beleidigungen, sogar an den Bananenhagel, hat er sich in der polnischen Extra-Liga schon gewöhnt. UEFA zeigt sich besorgt Pape Samba Ba kann sich eine ähnliche Stimmung während der Europameisterschaften überhaupt nicht vorstellen. Auch die UEFA zeigt sich wegen des Rassismus in polnischen Stadien besorgt. Die Zentrale in Genf will in Zusammenarbeit mit den polnischen und ukrainischen Fußball- Behörden (PZPN) in drei Jahren die rassistisch motivierten Vorfälle und Straftaten im Fußball eliminieren. Dieses Ziel soll in Zusammenarbeit mit der antifaschistischen Vereinigung Nigdy Wiecej ( Nie wieder ) umgesetzt werden. Die Antifa-Aktivisten offizielle UEFA-Partner koordinieren die Zusammenarbeit im Zentrum für Rassismus-Überwachung in Osteuropa. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns, sagt Jacek Purski, Koordinator im Beobachtungszentrum. Rassismus im Fußball ist ein sehr großes Problem. Polen hebt sich dabei negativ von anderen EU- Ländern ab. Braunes Buch Deshalb versuchen die Aktivisten von Nigdy Wiecej, alle Vorfälle im Braunen Buch zu registrieren. Fast jede Woche kämen neue Eintragungen hinzu: Laut Nigdy Wiecej handelt es sich dabei um das Aufhängen von Transparenten und Fahnen mit fremdenfeindlichen Inhalten, um beleidigende Rufe und Gewaltattacken wie Bananenwürfe. Die Übergriffe werden meist von gewaltbereiten Neonazi-Gruppen provoziert. Auch Fußballer beteiligen sich nicht selten an rassistischen Hetzen. Polnischer Fußballverband: Wir haben verschlafen POLITIK Der polnische Fußball-Verband will nun und mit Nigdy Wiecej eng zusammenarbeiten. Wir haben verschlafen, gibt ein PZPN-Sprecher zu. Mit Hilfe von Antifa organisierte der Verband Veranstaltungen, Info-Kampagnen, Bildungsaktionen. Die UEFA-Regel Zero tolerance gelte auch in polnischen Stadien. Die Klubs wurden aufgerufen, rassistisch motivierte Vorfälle sofort zu bestrafen. Nur wenige kamen dem Aufruf nach. Als in südpolnischen Kielce Fans rassistische Parolen gegen schwarze Spieler skandierten, konnten die Täter identifiziert, dem Staatsanwalt vorgeführt und mit einem lebenslangen Stadionverbot belegt werden. Nachdem Ende 2007 eine Gruppe von Skinheads in Danzig Rudolf Hess skandiert und Bananen gegen schwarze Spieler geschleudert hatte, konnte das Gericht nur einen Täter identifizieren und zu zwei Jahre Haft auf Bewährung verurteilen. Für einen Banner, der einen eingebürgerten Nationalspieler aus Brasilien beleidigte, musste die Mannschaft lediglich rund Euro Strafe zahlen und eine Partie ohne Publikum spielen. Diese Art von Ahndung sind jedoch nur Einzelfälle. Die überwiegende Mehrheit der Mannschaften spielt das Problem herunter oder sieht gar keins, sagt Purski. Fehlt es an Schwarzen, werden Juden zum Ziel der Attacken. Antisemitismus ist Bestandteil der polnischen Stadien-Kultur, sagt Marcin Kornak, Chef von Nigdy Wiecej. Auf judenfeindliche Exzesse folge in Polen meist keine Reaktion. Nach einem Spiel in Krakau riefen die Fußballer des polnischen Fußballmeisters Wisla zusammen mit den Fans etwas über Scheißjuden, die in einen Ofen fahren. Die Polizei übergab die Videoaufnahmen der Staatsanwaltschaft. Weil sich das Lied nicht an Juden, sondern an Mitglieder anderer Mannschaften richtete, wurden die Ermittlungen aufgegeben. Im polnischen Liga-Vokabular wird das Wort Jude als Schimpfwort verwendet. Vor gut einem Jahr zog ein Fußballer von LKS Lodz ein Trikot an mit einer Aufschrift, die zum Mord an Juden aufrief. Es ging um die verfeindete Mannschaft Widzew Lodz. Nach drei Wochen Straf- Pause spielte der antisemitische Fußballer wieder mit. In der Ukraine ist die Atmosphäre nicht besser. Die beiden Austragungsländer müssen vor der EM für eine bessere Stimmung sorgen. Pape Samba Ba bleibt skeptisch. Purski glaubt, die Organisatoren hätten keine andere Wahl und müssen Rassismus aus den Stadien rauskicken. 14 POLEN und wir 1-2/2010 POLEN und wir 1-2/
9 REPORTAGE Die stille Wiedergutmachung Seit Eckehart Ruthenberg von der Nazi-Vergangenheit seines Vaters erfuhr, adoptierte er Dutzende fast vergessene jüdische Friedhöfe in Polen. Von Marcin Rogoziński Zielona Góra (n-ost) Er hat in Ortsregistern gesucht und Kirchgänger vor dem Gottesdienst befragt, doch erst am Stammtisch erfuhr Eckehard Ruthenberg (66), wo sich der jüdische Friedhof von Krzeszyce (Krietsch) befindet. Auf einer Karte der ehemaligen deutschen Gebiete in Polen hat Ruthenberg rund 600 Begräbnisstätten markiert. In drei Jahren hat er 50 jüdische Friedhöfe freigelegt, mit selbst gebauten Werkzeugen. Der Grabstein, den er in Krietsch findet, liegt nur fausttief. Eckehart entfernt keuchend Grasbüschel und Wurzeln mit einer Hacke. Danach kniet er nieder und fegt die Tafel mit einer Bürste frei. Unter dem Sand tauchen deutsche Inschriften auf. Hier ruht in Ruh Martin Borck, geb. 1827, gest Mit einem selbst konstruierten Hebel versucht der Berliner die Tafel auf die andere, hebräisch beschriftete Seite umzuwuchten. Ab 1850 mussten die Grabsteine in Preußen zweisprachig sein. Ähnliche Werkzeuge haben die alten Ägypter beim Pyramidenbau verwendet, sagt Eckehart und drückt mit seinem ganzen Körpergewicht auf den Hebel. Viel Mühe kostete ihn die Suche nach Die Suche nach verlassenen Grabsteinen ist anstrengend. Eckehart Ruthenberg auf dem Friedhof in Krzeszce. Fotos: Marcin Rogoziński dem Friedhof. Auf den Landkarten aus der Vorkriegszeit war er nicht markiert. Auch im unentbehrlichen Kommunalen Auskunftsbuch, einem Ortsregister von 1914, das die Glaubenszugehörigkeit der Einwohner berücksichtigt: kein Wort zur jüdischen Gemeinde in Krietsch. An einem Sonntag stellte er sich vor die Kirche und fragte die zur Messe eilenden Menschen danach. In Lipiany (Lippehne) und Dobiegniew (Woldenberg) halfen die Gemeindemitglieder bei der Suche. In Krietsch haben sie nur ratlos mit den Achseln gezuckt. Eckehart ging also in eine Bierstube und wartete solange am Tisch, bis sich ein älterer Mann doch an seine Kindheit und die Gedenksteine im Wald erinnerte. Sie lägen an der Straße nach Skwierzyna (Schwerin), rund zwei Kilometer vom Dorf entfernt. Der Brief des Vaters Ein Vierteljahrhundert lang schon sucht Ruthenberg nach jüdischen Spuren. Er fing Mitte der 80er-Jahre an, als ihm das DDR- Regime Verkauf und Ausstellung seiner Kunstwerke verbot. Eckehart, Absolvent der Ost-Berliner Kunsthochschule, verlor seine Arbeit, gewann aber viel Freizeit. Vor lauter Langeweile habe ich mit der Suche nach jüdischen Friedhöfen begonnen, sagt Eckehart heute halb im Scherz. Doch der wahre Grund ist ein anderer: das Verhältnis zu seinem Vater, der sich während der Nazi-Zeit mit Rassenbiologie beschäftigt hat. Es war das Jahr Doktor Martin Ruthenberg starb, und die Familie musste sein Arbeitszimmer im Institut für Pflanzenzucht der Berliner Humboldt-Universität ausräumen. Als Eckehart die Papiere durchblätterte, stieß er auf einen Brief, den der Vater seiner Frau von der Ost-Front geschickt hatte. Liebe Heilwieg, begann das Schreiben, das am 19. März 1942 in Nowomoskowsk verfasst worden war. Die letzten drei Tage waren so schrecklich, dass ich darüber nicht schreiben kann. Im väterlichen Kabinett beschloss der Sohn zu erfahren, welche Ereignisse seinen Vater damals so stark erschüttert hatten. Unter dem Datum 19. März 1942 notierte Simon Wiesenthal in seiner Vernichtungschronik : Die Nazis treiben 400 Juden aus Nowomoskowsk in der Russischen Sowjetrepublik zusammen und erschießen sie in einer Sandgrube in der Nähe der Stadt, am anderen Ufer des Flusses Samara. Angesichts des Verbrechens in Babyn Jar bei Kiew, wo innerhalb von zwei Tagen über Juden mit Maschinengewehren erschossen wurden, fand das Massaker von Nowomoskowsk keine Beachtung. Um schnell und effektiv Menschen liquidieren zu können, rief die SS Wehrmacht-Soldaten um Hilfe. War unter den Verbrechern von Nowomoskowsk auch Feldwebel Martin Ruthenberg? Sieben Jahre lang studierte Eckehart die Archivdokumente, fand aber keine Belege für die Teilnahme des Feldwebels Ruthenberg an den Hinrichtungen jüdischer Zivilisten. Dafür habe ich entsetzliche Fakten aus der Vorkriegszeit entdeckt, von denen die Familie keine Ahnung hatte, sagt Eckehart. Niemand von den Verwandten wusste, dass sich Martin Ruthenberg während des naturwissenschaftlichen Studiums an der Universität in Greifswald mit Rassenbiologie beschäftigt hatte. In der Freizeit trieb er als Mitglied einer studentischen Nazi-Verbindung kommunistische Versammlungen auseinander. Im Unterricht arbeitete er tüchtig an der Konstruktion des deutschen Blutes. Das wussten auch die Rassenhygiene-Professoren zu schätzen und nahmen Martin in ihre wissenschaftlichen Reihen auf. Er verschaffte sich dadurch einen unbeschränkten Zugang zu Laboratorien, in denen an Menschen experimentiert wurde. Die Doktorarbeit schrieb er über die Vererbung von Eigenschaften. Der Kriegsausbruch setzte jedoch seiner wissenschaftlichen Karriere ein abruptes Ende. Der frisch gebackene Doktor wurde zum Nationalsozialistischen Kraftfahrkorps (NSKK) einberufen, der für Transporte zuständig war. Er zog durch Polen und die Ukraine, und einige Wochen nach der Verfassung des Briefes in Nowomoskowsk wurde er von der Ostfront abberufen. Als seine Kameraden die sechs Monate währende Belagerung Stalingrads begannen, bezog Martin einen Schreibtisch im Rasseninstitut in Riga-Kleistenhof. Den Posten in Lettland verdankte er einem Kollegen von der Universität in Greifswald. Das ersparte dem früheren Kommilitonen die Stalingrad- Hölle und ermöglichte ihm die Beschäftigung damit, womit sich Dr. Ruthenberg auskannte: dem Zuordnen der Lettland- Deutschen zu bestimmten Volksgruppen. Ende 1942 fuhr Martin zum Urlaub nach Hause in Greifswald. Neun Monate später kam Eckehart zur Welt. Der Vater habe unentwegt Disziplin und Gehorsam verlangt. Eckehart erinnert sich an ständige Streitereien; er habe die Regeln nicht akzeptieren können. Schließlich schmiss ihn der Vater heraus. Er war 21 und in den folgenden vier Jahrzehnten, bis zu Martins Tod, hatten Vater und Sohn keinen Kontakt. Durch die Suche nach verlassenen Friedhöfen habe ich mich indirekt dem Vater widersetzt, den ich mit dem autoritären Staat gleichgesetzt habe, vermutet Eckehart. Grabsteine für den Straßenbau 2006 beschloss Ruthenberg, jenseits von Oder und Neiße weiterzumachen. Er fing in Cedynia (Zehden) an. Auf einem verwahrlosten Friedhof legte er sechs Grabmale frei. Dann fuhr er nach Trzcinsko (Schönfließ). Danach waren Moryń (Mohrin), Chojna (Königsberg), Dębno (Neudamm) oder Boleszkowice (Fürstenwalde) an der Reihe, insgesamt zwölf an der deutsch-polnischen Grenze liegende Ortschaften. Ein Jahr danach suchte er drei Monate lag im Lebuser Land. Er entdeckte dutzende Grabsteine, allein in Torzym (Sternberg) waren es 20. Das unermüdliche Hochwuchten der Tafeln wirkte sich negativ auf seine Gesundheit aus. Auf dem Heimweg fiel er in Ohnmacht und landete im Krankenhaus. Seit dieser Zeit macht er häufiger Pausen und isst regelmäßig. Nur das Schlafen im Auto konnte er sich nicht abgewöhnen, immer umgeben von Stechern, Hebeln und Messgeräten. Hier war einst ein jüdischer Friedhof, sagt Andrzej Kirmiel und deutet auf die Umgehungstraße bei Międzyrzecz (Meseritz) Richtung Schwerin. Die Straße führt geradewegs über den Friedhofshügel. Kirmiel, Historiker und Gründer der Lebuser Stiftung Judaika, erforscht seit mehreren Jahren die jüdische Vergangenheit in den ehemals deutschen Gebieten Polens. Er sagt, die Geschichte des Friedhofs in Meseritz sei charakteristisch für die übrigen 600 jüdischen Begräbnisstätten, die von REPORTAGE Eckehart Ruthenberg entziffert Grabinschriften auf dem Friedhof in Trzciel (Tirschtiegel) den Polen zerstört wurden. Gleich nach Kriegsende erweiterte man auf Kosten des Friedhofes die Landkreisstraße nach Schwerin. Die Arbeiter benutzten die Grabsteine als Unterlage für den Asphalt. Während der Bauarbeiten wurde der Kies vom Friedhof erst heimlich entnommen, dann ganz offiziell verwendet. Mit dem Sand aus der Kiesgrube schüttete man einen öffentlichen Strand auf, am nahgelegenen See Głębokie. Im Sand wurden menschliche Knochen entdeckt, die beseitigt wurden, berichtete ein Zeuge dem Historiker. Die Steinmetze bestückten ihre Werkstätten mit den Marmor- und Granitblöcken vom Friedhofshügel. Kirmiel fand eine Preisliste für die ehemals deutschen Grabsteine mit amtlich festgesetzten Quoten. Die einheimische Bevölkerung bediente sich ebenfalls am kostenlosen Baumaterial vom 700 Jahre alten Grabfeld. Bis heute kann man auf privaten Grundstü- 16 POLEN und wir 1-2/2010 POLEN und wir 1-2/
10 REPORTAGE GESELLSCHAFT cken, auf Gehwegen oder an Haussockeln Elemente finden, die von geplünderten Grabtafeln stammen. Die Mehrheit der Friedhöfe existiert seit Anfang der 70er Jahren nicht mehr. Damals kamen vermehrt deutsche Touristen aus der DDR über Oder und Neiße nach Polen. Der unbefriedigende Zustand von Friedhöfen ist eine heikle Sache und ruft unfreundliche, allerdings richtige Bemerkungen seitens der Touristen hervor, alarmierten damals die kommunalen Behörden im Lebuser Land die Kreisräte in einem Schreiben. Also beschlossen die Lokalbehörden, das Problem auf ihre Weise zu lösen. Nämlich in dem sie etliche jüdische, aber auch evangelische und katholische Ruhestätten planieren ließen. Der seit 1280 existierende Friedhof in Głogów (Glogau) wurde beseitigt. An seiner Stelle entstand eine Plattenbausiedlung. Auf dem Kirkut in Słubice (ehem. Frankfurt/Oder) lagen namhafte Rabbiner begraben, darunter Theomin, der die jüdischen Speisegesetze modernisierte. Trotzdem ließen die Behörden das Gelände einebnen. Anfang der 90er Jahre wurde das Grundstück an einen Investor verkauft, der ein Hotel inklusive Bordell einrichtete. Nach Protesten aus aller Welt wurde es geschlossen und abgerissen. Die Einwohner von Słubice und Frankfurt stifteten 1999 eine Gedenktafel. Ein Abdruck auf Seidenpapier Eckehart bedeckt den Grabstein von Martin Borck mit einem dünnen, weißen Seidenpapier und streut mitgebrachten Eichensand darauf. Er reibt die Sandkörner in das Papier. Nach kurzer Zeit bildet sich die ganze Tafel mit ihren Inschriften auf dem Seidenpapier ab. Der Berliner verewigt auf diese Art und Weise alle von ihm entdeckten Grabmale. Das Seidenpapier wird zusammengerollt gelagert wie die Thora. Eckehart wird nie erfahren, wer Martin Borck aus dem brandenburgischen Krietsch war. Eckehart hat keine Zeit, sich in die Vergangenheit der Toten zu vertiefen. Er zählt nicht einmal die freigelegten Tafeln. Er wandte sich mehrmals an wissenschaftliche und jüdische Institutionen in Deutschland, aber niemand hatte Interesse, sich im Ausland zu engagieren. Und für die meisten polnischen Forscher fängt die Geschichte der wiedergewonnenen Gebiete erst 1945 an. Auch das gerade im Bau befindliche Museum der Geschichte der polnischen Juden wird sich nicht mit Vergangenheit Eckehart Ruthenberg kniet an der Grabtafel von Martin Borck in Krzeszce. der preußischen Bürger im heutigen Gebiet Polens auseinandersetzen. Waisenkinder Die verlassenen Friedhöfe sind wie die Waisenkinder, sagt Eckehardt. Ich kümmere mich um sie. Eckehart Ruthenberg sagt, in all den Jahren keinerlei Feindschaft oder Antisemitismus verspürt zu haben. Trotzdem will er nicht, dass die Menschen die von ihm freigelegten Tafeln zu Gesicht bekommen: Denn wenn sie niemandem ins Auge fallen, bleiben sie länger da. Aus dem Friedhof in Boleszkowice wurden neulich zehn Tafeln entwendet. In Trzciel (Tirschtiegel) kippten unbekannte Täter einige Mahnmale zu Bode, ebenso in Schwerin. Doch Eckeharts Kräfte und Finanzen reichen nur für zwei Reisen nach Polen pro Monat aus. Er ist sich dessen bewusst, dass er es nicht schaffen wird, alle jüdischen Grabsteine in West-Polen freizulegen. Bevor seine eigene Grabtafel steht, will er sich einen Traum erfüllen: einen in Polen entdeckten jüdischen Friedhof umzäunen. Die Recherche zu diesem Text wurde gefördert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Die Gay-Szene entdeckt Polen Spektakuläre Ausstellung in Warschau rührt an einem Tabu Im Sommer 2010 wird sich in der polnischen Hauptstadt Warszawa (Warschau) die europäische Gay-Szene versammeln. Erstmals wird dann die EuroPride, das wichtigste Festival von Schwulen und Lesben, in einem Land Mittel- und Osteuropas stattfinden. Zeitgleich dürfte eine Ausstellung im Warschauer Nationalmuseum für Aufmerksamkeit sorgen: Unter dem Titel Homo Ars Erotica soll dort von Juni bis September eine umfangreiche Schau mit homoerotischer Kunst von der Antike bis zur Gegenwart gezeigt werden. Zur Zeit präsentiert die renommierte Galerie Zachęta die Ausstellung Gender Check mit bemerkenswerten Arbeiten osteuropäischer Künstler. Unter seinem neuen Direktor, dem Kunstprofessor Piotr Piotrowski, möchte sich das Warschauer Nationalmuseum stärker in die öffentlichen Debatten einbringen. Für diesen Sommer bereitet sie eine große Ausstellung vor, der die öffentliche Aufmerksamkeit im In- und Ausland gewiss sein dürfte. Homo Ars Erotica will homoerotische Kunst von der Antike bis zur Gegenwart zeigen. Drei Schwerpunkte soll die Ausstellung haben: die Darstellung homoerotischer Themen in der Vergangenheit, angefangen von Skulpturen und Darstellungen aus der Antike, Kunstwerke aus Polen sowie zeitgenössische Arbeiten aus anderen Ländern Mittel- und Osteuropas. Zu sehen sind beispielsweise Werke des transsexuellen ungarischen Malers El Kazovskij oder des jungen polnischen Künstlers Karol Radziszewski. Die Ausstellung wird vom 11. Juni bis zum 5. September 2010 gezeigt. Schon seit März kann man in der renommierten Staatlichen Kunstgalerie Zachęta in Warschau künstlerische Arbeiten bewundern, die die Rolle der Geschlechter thematisieren. Die Ausstellung Gender Check ist zurzeit in Wien zu sehen und wird danach in Warschau gezeigt werden. Für sie wurden rund 400 Arbeiten von Künstlern aus 24 Staaten in Mittel- und Osteuropa ausgewählt, die von den 1960er Jahren bis heute entstanden sind. Zu verfolgen ist, wie sich weibliche und männliche Rollenbilder und der Umgang mit der Sexualität vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändert haben. Die Ausstellung ist bis zum 19. Juni in Warschau zu sehen. Ich bin davon überzeugt, dass diese beiden Ausstellungen die Stadt verändern werden, meint Museumsdirektor Prof. Piotrkowski in einem Interview. Er möchte mit den Mitteln der Kunst die Diskussion über den Umgang mit sexuellen Minderheiten im Land befördern. Genügend Stoff für Diskussionen dürfte auch ein anderes Großereignis bieten, das im Juli in Warschau stattfindet: Die EuroPride Diese zählt zu den größten Veranstaltungen für Schwule, Lesben und Transsexuelle und wird jedes Jahr in einem anderen europäischen Land veranstaltet. Bei den traditionellen Paraden, mit denen an den Christopher Street Day erinnert wird, nahmen in den vergangenen Jahren jeweils mehrere Hunderttausend Menschen teil. So viele dürften es in Warschau nicht werden. Als dort 2001 zum ersten Mal Homosexuelle eine Gleichheitsparade veranstalteten, kamen rund 300 Menschen, in den Folgejahren wurden es einige Tausend, die sich zum Teil wüsten Anfeindungen von Gegendemonstranten ausgesetzt sahen. Die EPOA, die Dachorganisation der Euro- Pride, will jetzt ein starkes Signal nicht nur an Polen, sondern an alle osteuropäische Länder senden, in welchen Pride-Organisatoren mit schwerwiegenden Problemen bei der Organisation von Prides konfrontiert sind. In Warschau wurde in den letzten Jahren immer wieder versucht, die Gay- Pride zu verbieten. Selbst der ehemalige Bürgermeister und nunmehrige Staatspräsident Lech Kaczynski sprach sich gegen die Paraden aus und wurde deshalb bereits vom Europäischen Gerichtshof wegen der Verletzung grundlegender Menschenrechte verurteilt. Durch die EuroPride 2010 erhoffen sich die Veranstalter der Parade zusätzliche Impulse. Der bunte Umzug auf dem Warschauer Königsweg wird der Höhepunkt der Aktivitäten sein, die vom 9. bis 18. Juli in Warschau stattfinden. Geplant sind in diesem Zusammenhang auch ein Filmfestival, Ausstellungen, Konzerte und Konferenzen. Die Veranstaltung will auch ein Zeichen der weiteren Normalisierung im Umgang mit Homosexuellen in Polen sein. Längst hat sich nicht nur in Warschau, sondern auch in anderen polnischen Städten ein Netzwerk aus Kneipen, Clubs und Läden für die schwul-lesbische Community gebildet. Weitere Informationen: (Nationalmuseum) (Galerie Zachęta) (Adressen aus der schwullesbischen Community -nur auf Polnisch) (Tourismusamt) EU Gerichtshof gegen Polen Auch homosexuelle Paare müssen in Polen im Erb- und im Mietrecht gleich behandelt werden, wenn de facto eine Beziehung bestanden habe. Das entschied nun der Europäische Gerichtshof Geklagt hatte ein Mann aus Stettin, der nach dem Tod seines Lebenspartners das Mietrecht für die gemeinsame Wohnung nicht übernehmen durfte, obwohl er mit diesem 9 Jahre lang bis zu dessen Tod im Jahr 1998 eine Beziehung führte und zusammen lebte. Sowohl die Wohnung als auch das Vermögen des Verstorbenen sollte mangels Testament dem polnischen Staat zufallen Polen wurde wegen Verletzung des Artikels 14 (Verbot der Diskriminierung) und Artikel 8 (Recht auf Wahrung des Privat- und Familienlebens) verurteilt. Auch wenn der Staat offiziell die Verbindung zwischen gleichgeschlechtlichen Personen nicht anerkennt, so würde diese doch de facto sehr wohl bestehen. 18 POLEN und wir 1-2/2010 POLEN und wir 1-2/
11 NACHBARSCHAFT NACHBARSCHAFT Zwanzig Jahre Gesellschaft für gute Nachbarschaft zu Polen Breites Bürgerschaftliches Engagement Von Werner Stenzel Im Sommer dieses Jahres wird die Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland e.v. 60 Jahre alt. Sie wurde 1950 in Düsseldorf als Hellmut-von-Gerlach-Gesellschaft neu gegründet, nachdem ein Jahr zuvor zwei Deutsche Staaten entstanden und die erste Hellmut-von-Gerlach-Gesellschaft, 1948 in Berlin gegründet, nun ihren Sitz in der DDR hatte. Bereits 1953 beendete diese Gesellschaft in der DDR ihre formale Existenz. Vor genau 20 Jahren, in den letzten Monaten der DDR, entstand eine neue Gesellschaft. Unser Autor Werner Stenzel war Gründungsmitglied. Am 28. April 1990 gründeten etwa 100 Teilnehmer einer Versammlung im damaligen polnischen Kultur- und Informationszentrum die Gesellschaft für gute Nachbarschaft zu Polen, um Ergebnisse und Leistungen in den Beziehungen zwischen der DDR und der Volksrepublik Polen zu bewahren und die möglichst breite öffentliche Förderung gutnachbarschaftlicher deutsch-polnischer Kontakte fortzuführen. Mit diesem Entschluss nutzten die Gründungsmitglieder eine Chance, um in einem demokratischen Prozess dem grenzüberschreitenden Zusammenwirken durch ihre persönlichen Bindungen und Aktivitäten neue Impulse im Rahmen der Veränderungen in beiden Ländern zu geben. 20 Jahre sind in der Geschichte auch in bewegten Zeiten wenig, im Leben eines Menschen aber ein gewichtiger Zeitabschnitt. Deshalb sollte ein Vergleich von Soll und Haben gezogen werden. Gelebte Nachbarschaft Im Sommer des vergangenen Jahres haben 25 Frauen und Männer in dem Buch Gelebte Nachbarschaft Bilanz ihres Verhältnisses zu Polen, ihrer Lebenszeit gezogen. Das Wesentliche: sie sind mit ihrer Person den Intentionen, die sie im Gründungsaufruf der Gesellschaft vereinigten, treu geblieben. Sie haben Errungenes im Neubeginn des friedlichen Zusammenlebens beider Völker mit der gemeinsamen Grenze an Oder und Neiße nie in Frage gestellt und in den Alltagssituationen des Zusammenlebens der Bürger die besten humanistischen Traditionen Achtung, Würde und gegenseitige Akzeptanz verwirklicht. Eine Voraussetzung dafür war von Anbeginn der Meinungsaustausch über die Geschichte, die Entwicklung und die kulturellen Leistungen in beiden Ländern. Es waren Menschen, die als Fachleute, als Studenten, als Intellektuelle polnische Partner kennen lernten, nicht selten gemeinsame Familien gegründet hatten, oder in Städten und Dörfern des heutigen Polens ihre Kindheit verbrachten, die dieses Versprechen einlösten, und es gab nicht wenige, die in der DDR geschaffene Spielräume von Städtepartnerschaften, Jugend-, Schüler- und Lehreraustauschen, Urlaubsaufenthalten und anderes mehr für die Entwicklung familiärer Freundschaften nutzten, die bis zum heutigen Tage Bestand haben. Sie waren mit Herz und Verstand dabei und haben so manches Mal teils objektiv, teils subjektiv begründete Hürden überwunden. Sie lächeln über das heutige Gerede von der sogenannten verordneten Freundschaft, haben sie es doch anders erlebt und sich da sie es so wollten - um die Herstellung lebendiger Kontakten zu polnischen Freunden bemüht. Stammtisch Es gäbe vieles zu berichten, was von Mitgliedern der Gesellschaft oft mühevoll, allein durch guten Willen in ausschließlich ehrenamtlicher Arbeit auf den Weg gebracht wurde. Dabei denke ich an die vielen Informationsveranstaltungen über Polen ebenso wie an persönliche Bürgerbegegnungen. Zu erwähnen wären die traditionellen Stammtische zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen, zu aktuellen Fragen, die Ausstellungen, zum Beispiel von Gemälden oder Grafiken polnischer Künstler, Literaturabende und Theaterbesuche. Sehr positiv ist die Zusammenarbeit mit dem Verband der Warschauer Aufständischen bei der Vorbereitung von Expositionen zu Jahrestagen des Warschauer Aufstandes oder die Unterstützung durch den Verteidigungsattache der polnischen Botschaft zu Jahrestagen des Beginns des 2. Weltkrieges über den großen Anteil Polens an der Befreiung der Völker Europas vom Hitlerfaschismus. Ein Teil meines Herzens Hervorzuheben ist die Übersetzung und Edition des Tagebuches von Wanda Przybylska Ein Teil meines Herzens Tagbuch von und Lesungen daraus mit Zeitzeugen. Treue Wegbegleiter waren für uns die Veit-Stoß-Stiftung zur Bewahrung polnisch-deutschen Kulturerbes (heute die Bürgergesellschaft Haus Polen ) und der Allpolnische Klub für Polnisch-Deutsche Nachbarschaft in Warschau. Diese Verbindungen vermitteln neue Beziehungen, die über unsere Gesellschaft hinausreichten und den deutsch-polnischen Dialog förderten. Sie ermöglichten aktuelle Informationen über Tendenzen im gesellschaftlichen Leben Polens, seiner Wirtschaft und Kultur in Berlin. Die Förderung von Schul- bzw. Städtepartnerschaften (unter anderem von Berlin-Lichtenberg mit dem Bezirk Białołęka von Warschau) wurde ein gegenseitiger Gewinn. Noch heute werden im Internet die Ergebnisse eines gemeinsam mit dem Verband für Internationale Politik und Völkerrecht durchgeführten Workshops zum 50. Jahrestag des Görlitzer Abkommens (2000) sehr häufig angeklickt. Rad- und Wandertouren Seit dem Jahre 1993 sind die Rad- und Wandertouren der guten Nachbarschaft sowie die Pilzwanderungen mit unseren Freunden vom Landsportbund Gorzów wichtiger und beliebter Teil unseres Mitgliederlebens. Dabei ging es nicht nur darum, in unverbrauchter Natur und auf guten Straßen Rad zu fahren. Die Teilnehmer der Touren erinnern sich gern an den Empfang vor dem Rathaus in Warschau und die Besuche in Kraków, Wrocław oder Poznań. Sie gedachten gemeinsam der Kämpfe um die Seelower Höhen und bei der Gedenkveranstaltung auf dem Soldatenfriedhof in Siekierki zum 60. Jahrestag des Beginns der Oder- Offensive, wo sowjetische und polnische Truppen in opferreicher Schlacht zuerst die Oder überquert haben, und sie ehrten die Verteidiger der Post von Gdansk, die den deutschen Okkupanten heldenhaft Widerstand leisteten. Ausführliche Aussprachen über den Eintritt Polens in die EU gab es mit den Stadt- präsidenten in Gorzów und anderen Orts mit Repräsentanten des öffentlichen Lebens. Monat für Monat eine Veranstaltung einschließlich der mit Friedensgesellschaften durchzuführen, von denen noch die Rede sein wird, ist eine Leistung. Das Wichtigste bei allen Projekten ist es, Beziehungen zwischen den Menschen zu fördern. Und für uns ist es Lohn der Mühe zu sehen, wie aus Neugier Sympathie und Freundschaft wachsen, mit der Perspektive sich zu verselbständigen, d.h., dass Mitglieder und Sympathisanten von sich aus Sprachkurse, Radtouren oder Literaturabende ohne Beschlüsse und Weisungen organisieren. Eine lohnenswerte Aufgabe wäre es, polnische Partner zu gewinnen, die aus ihrer Sicht deutsch-polnische Annäherungen beschreiben. Ständige Partner und Förderer unserer Aktivitäten sind die Botschaft der Republik Polen, das Polnische Kulturinstitut und das Zentrum für historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Berlin. Die Gründer unserer Gesellschaft sind in Ehren ergraut, und obwohl nicht alle ihre Pläne reiften, könnte man meinen, die Aufgaben sind erfüllt. Alles ist in Ordnung. Die bilateralen staatlichen Beziehungen sind augenscheinlich normal. Und wer heute, aus welchem Grunde auch immer nach Polen möchte, fährt oder wandert einfach darauf los. Gemeinsame Aufgabe bleibt Es bleibt eine gemeinsame große Aufgabe: der Frieden als Grundlage guter Nachbarschaft ist in einer globalisierten Welt unteilbar. Gegenwärtig soll ein Geschichtsbild nach dem Verständnis des Bundes der Vertriebenen (BdV) vermittelt werden. Deutschland soll als Folge des Zweiten Weltkrieges eine Opferrolle zugewiesen werden, welche die am polnischen Volk begangenen Verbrechen relativiert. Es wird ein Heimatgefühl angesprochen, ohne auf die Ursachen und die Schuldigen von Flucht und Vertreibung hinzuweisen. Krieg das ist auch heute die Hauptursache von Flüchtlingsströmen - in Pakistan, in der Sahara und wo auch immer auf der Erde. Ein Blick auf die Väter des BdV lässt von Frau Steinbach keine Aufklärung erwarten. Aktive Nazis standen Pate, wie der faschistische Volkstumsforscher Theodor Oberländer, der SS-Hauptsturmführer Waldemar Kraft, oder der Blutrichter im besetzten Polen Hans Krüger, um nur einige Beispiele zu nennen. Erinnerung an die Opfer Die Erinnerung an den Widerstand, an das Leiden und Sterben polnischer Häftlinge im Konzentrationslager Sachsenhausen ist für uns eine langjährige Tradition. Jeweils am 9. November gedenken wir gemeinsam mit dem Sachsenhausen-Komitee der Opfer der ersten Massenexekution polnischer Häftlinge. Aktiv haben Mitglieder unserer Gesellschaft die Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen in den Bezirken Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf von Berlin über polnische Zwangsarbeiter organisiert und in Gesprächen Berichte dieser Zeitzeugen über ihr Leben in dieser Zeit dokumentiert. Beizutragen zur Stärkung der Friedensbewegung der Bürger und zur Entlarvung des Geheimnisses über die Entstehung von Kriegen wird nötiger denn je. Mit den Freunden der Friedensglockengesellschaft treffen wir uns jährlich zum Gedenken an die Opfer von Hiroshima und Nagasaki sowie am Deutsch-Polnischen Ehrenmal im Berliner Friedrichshain zur Erinnerung an den Beginn des 2. Weltkrieges und den opferreichen Kampf der Sowjetunion, Polens und deutscher Antifaschisten bis zum Sieg über den Faschismus. Aktiv wirken wir beim Kuratorium Friedensfahrt mit und knüpfen Verbindung zu Bike for Peace and New Energies e.v.. Anlässlich des 70. Jahrestages des deutschen Überfalls auf Polen haben wir gemeinsam mit der Berliner Gesellschaft für Faschismus- und Weltkriegsforschung e.v. ein Symposium durchgeführt. Der deutsche Einfluss auf die ökonomische Entwicklung, auf das Bildungswesen, auf die Presse waren es, neben den bekannten Auslandorganisationen, die den Weg zum Überfall vorbereiteten. Die Geschichte mahnt uns, wachsam zu sein und uns nicht den Blick trüben zu lassen durch die gemeinsame Zugehörigkeit beider Länder zur EU und zur Nato. In dieser Richtung Partner in der Republik Polen zu systematischer Zusammenarbeit zu gewinnen, ist eine wichtige Aufgabe. Regionalgesellschaft 20 Jahre Gesellschaft für gute Nachbarschaft sind auch Jahre der erfolgreichen Zugehörigkeit und Mitgliedschaft in der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der BRD e.v:, deren Regionalorganisation wir sind. Eine nicht einfache Sache, weil beide Gesellschaften zwar ein gemeinsames Anliegen vereint, aber doch verschiedene Wirkungsmöglichkeiten bestehen. Es bleibt ein Unterschied, ob versucht wird, im grenznahen Raum an Oder und Neiße Zusammenarbeit zu gestalten, oder am Rhein deutsch-polnisches Zusammenwirken zu realisieren. Der Weg zu langfristiger Aufgabenstellung als Synthese von öffentlicher Einmischung in den gesellschaftlichen Diskurs und Bürgerbegegnungen, sei es bei Sport und Erholung, muss noch gefunden werden. Gemeinsam haben wir dabei den großen Vorteil, die Zeitschrift Polen und Wir zu publizieren. Eine solche Gesellschaft, wie unsere gemeinsame, wäre auch in der Lage, beständige Kontakte zu anderen deutsch-polnischen Vereinigungen in Respekt und Toleranz zu pflegen. Um nicht zu leugnende Leistungen bewahren zu können, ist die Gewinnung neuer Mitglieder lebensnotwendig, die sich als Teilnehmer eines demokratischen Prozesses auch die nötigen Aufgaben stellen. Das ist kompliziert in einer Welt, in der die Menschen, insbesondere die Jugend mehr denn je für sich eine Perspektive und den Weg in die Zukunft sucht, da geistige Werte dem Augenblick, dem Event geopfert werden und allein das Geld regieren soll. Aber der Mensch ist ein geselliges Wesen. Er sucht Zusammengehörigkeit. Das beweisen auch die Veranstaltrungen unserer Gesellschaft. Jetzt geht es um individuelle Arbeit, um im persönlichen Gespräch das Verständnis zu entwickeln, Erreichtes als Fortschritt zu begreifen, der weitergeführt werden muss. Bruno-Schultz-Radtouren Im November 2009 ist Bruno Schultz, Gründungsmitglied der Gesellschaft für gute Nachbarschaft zu Polen, verstorben. (sh. Bericht in der letzten Ausgabe von POLEN und wir) Seit 1967 hat er sich stets für ein gutnachbarschaftliches deutsch-polnisches Zusammenwirken eingesetzt. Für sein unermüdliches Engagement wurde er mit dem Kavalierskreuz des Verdienstordens der Republik Polen ausgezeichnet. Er war Ehrenbürger von Opole und wurde mit der Eintragung in das Goldene Buch der Stadt Potsdam geehrt. Ihm zu Ehren werden die Radtouren der Gesellschaft künftig als Bruno-Schultz-Radtouren der guten Nachbarschaft zu Polen durchgeführt. 20 POLEN und wir 1-2/2010 POLEN und wir 1-2/
12 KULTUR KULTUR Es war der 22. Februar oder der 1. März Kult um Kultur - Polen feiert seinen Nationalkomponisten Vor 200 Jahren wurde Fryderyk alias Frédéric Chopin geboren Von Hans Kumpf In Polen wird er ohnehin tagtäglich voller Stolz als der große Nationalkomponist gefeiert, aber Anno Domini 2010 gerät dort zum absoluten Jubeljahr für Fryderyk alias Frédéric Chopin. Vor zweihundert Jahren, 1810, wurde Fryderyk Franciszek Chopin im Landgut Żelazowa Wola, fünfzig Kilometer westlich von Warschau, geboren. Über den genauen Tag, an dem das Musikgenie das Licht der Welt erblickte, kursieren unterschiedliche Angaben. Chopin nannte selbst stets den 1. März, alte offiziöse Quellen sprechen vielmehr vom 22. Februar und geben gar als Uhrzeit 18 Uhr an... Flexibel und kulant geht das im riesigen Warschauer Theater-Komplex residierende Nationale Chopin-Institut mit der Kontroverse um: Man feiert, wie mir die Öffentlichkeitsarbeiterin Kinga Majchrzak auf Chopin-Büste in Valldemossa gezielte Anfrage hin sagte, ab dem 22. Februar eine starke Woche lang aber doch höchst intensiv am 1. März. Ganz am Rande bemerkt: Meine polnische Schwiegermutter begann 120 Jahre nach Chopin mit ihrem Erdendasein, und da soll die amtliche Beurkundung auch nicht unbedingt mit dem Tagesfakt übereinstimmen. Die polnischen Behörden nahmen es angeblich nicht immer so genau. Andererseits: Vom New-Orleans-Trompeter Louis Armstrong weiß die Jazzwelt definitiv von dessen vielfach verübter Schummelei mit seinem Geburtsdatum - dem markanten 4. Juli 1900 (der erste amerikanische Unabhängigkeitsfeiertag des neuen Jahrhunderts). Am 1. März 2010 also steigt dann - mit der argentinischen Pianistin (und berühmten Chopin-Wettbewerbs-Jurorin) Martha Argerich als prominentester Solistin - in der stattlichen Staatsoper vom Teatr Wielki pompös der höchstoffizielle Auftakt zu unzähligen Veranstaltungen, wobei geflissentlich eingeräumt wird, dass im Frühjahr die zu erwartende ungemütliche Witterung wohl nicht übermäßig viele KulTouristen nach Polen zu locken vermag. Ganz gezielt wird übrigens die Kundschaft aus Japan umworben. Trubel im Geburtsdorf Żelazowa Wola Chopins Vater Nicolas kam im Alter von 16 Jahren von Lothringen gen Polen, wo er sich alsbald zunächst beim Kleinadel - als Französischlehrer verdingte. Aus der 1806 geschlossenen Ehe mit Justyna Krzyżanowska gingen insgesamt vier Kinder hervor. Noch im Geburtsjahr des einzigen Stammhalters zog die Familie nach Warschau um, wo der Papa eine bessere Anstellung an einem Lyzeum erhielt. Zum Festjahr hat sich Żelazowa Wola besonders herausgeputzt: Das eingeschossige weiße Geburtshaus, idyllisch in einem kleinen Park gelegen und von vielen Büsten des Nationalhelden umgeben, wurde als Museum und Konzertplatz renoviert, und neue Bauten für den zu erwartenden Besucherandrang entstanden. Jeder in Polen kennt diese Pilgerstätte zumindest von der 1,55-Złoty-Serienbriefmarke. Recht mühsam ist es freilich, von der Hauptstadt aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln an die geheiligte Stätte zu gelangen: Bummelzug zum verschlafenen Bahnhof Sochaczew und dann Bus, falls einer zur rechten Zeit fährt. Schneller und teurer ist da ein Taxi, wobei die Ausstellung einer Quittung für die zehn Minuten Fahrt umgerechnet ein Euro Mehrkosten verursachen kann. Der kleine Laden mit Chopin-Memorabilia und sonstigem mehr und minder musikalischem Nippes darf sich nun auf ein kräftiges Umsatz- Plus freuen. Bildchen vom verblichenen polnischen Papst werden dort ebenfalls feilgeboten. Falls der geneigt Chopin-Fan in der Nähe nächtigen will, steht in sechs Kilometer Entfernung das (nur) dreisternige Chopin Hotel Restauracja samt Free Internet zur Verfügung. Chopin pauschal Vielleicht ist es da doch zweckmäßiger, man bucht Chopin ganz einfach pauschal. Das noble Reisebüro Mazurkas Travel hat längst das berühmte im Warschauer Łazienki-Park postierte Chopin-Denkmal als Signet auf den goldfarben lackierten Bussen placiert und empfiehlt sich eloquent für die internationale Bildungsbürgerschaft. Direktor Andrzej Hulewicz fürchtet aber, dass diese in Zeiten der Wirtschaftskrise doch nicht so zahlreich ins Geburtsland des romantischen Tonsetzers strömen könnte. Umfangreiche Programmpakete hat er für August geschnürt, wo in Polens Metropole das dritte Festival Chopin und sein Europa steigen wird. Im Oktober hängt er sich an den Internationalen Chopin- Wettbewerb an, beglückt seine werten Gäste zudem auch hier mit eigens für sie organisierten Konzerten im intimen Rahmen. Ein Trip nach Żelazowa Wola ist jeweils inklusive, und natürlich folgt der Touristen-Tross in Warschau sorgfältig den Spuren Chopins: Seine Wohnquartiere, seine Bildungsstätten, seine Auftrittsorte. Heilige Hallen allenthalben. Relikte und Replikate Mit viel Aufwand wird noch das im prächtigen Ostrogski-Palast untergebrachte Muzeum Chopina restauriert. Die feierliche Eröffnung ist auf den 1. März (und nicht etwa auf den 22. Februar ) terminiert. Auf vier Stockwerken kann man dem Lebens-, Schaffens- und Reiseweg des komponierenden Pianisten folgen, unterstützt nunmehr durch eine zeitgemäße multi-mediale Aufbereitung. Über 80 Millionen Złoty, also rund 20 Millionen Euro, kostet dieser musikalische Spaß. Gehören zu den dort präsentierten 7000 Exponaten Gedenkstätte in Valldemossa Fotos: H. Kumpf wenigstens etliche Original-Dokumente, so ist der Salonik Chopinów nur mit Replikaten ausgestattet (man darf auch in diesem Zusammenhang nie vergessen, dass Hitler- Deutschland in Polen nicht nur unzählige Menschen und Gebäude, sondern auch unwiederbringliche Kulturgüter vernichtete). In einem doch ziemlich schwierig aufzufindenden Raum der gegenüber der Universität gelegenen Kunstakademie sind vor allem ein runder Esstisch und ein historischer Flügel zu sehen. Ab 1827 wohnte die Familie Chopin in diesem Quartier, dem ehemaligen Krasinski-Palais an der Straße namens Krakauer Vorstadt (Krakowskie Przedmieście), also zwischen der Flaniermeile Nowy Swiat ( Neue Welt ) und dem rotfarbenen Königsschloss. Es braucht kein Festjahr, jeden Tag wird in Polen Chopin gefeiert. Da kann es sein, dass auf der kurzzeitig für den gemeinen Straßenverkehr abgesperrten Nowy Swiat ein kulturelles Straßenfest stattfindet, ein junger Pianist in die Flügeltasten greift und liebliche Melodien hervorzaubert: Mazurken, Walzer, Nocturnes, Préludes, Balladen, Etüden. Fryderyk Chopin transformierte ja viele Volksmusiken seiner geliebten Heimat zur Kunstmusik. Kostenlos lauscht die Laufkundschaft, hält inne und findet in der Hektik mal kurz Ruhe und Erbauung. Nicht weniger andächtig hören sich kunstbeflissene Familien mit Kind und Kegel die sommersonntäglichen Recitals im Botanischen Garten an. Da kann es vorkommen, dass so altgediente Chopin-Koryphäen wie Lidia Grychtołowna in behaglicher Atmosphäre freiluftig live konzertieren. Zum Massenvergnügen gedeihen schon seit fünf Jahrzehnten die beiden Sonntagskonzerte im großzügigen Łazienki-Park am berühmten Chopin-Monument. Von einem weißen Baldachin vor eventuellem Regen geschützt, harrt da ein fernöstlicher Kawai- Flügel auf abendländische Musik. Punkt 12 und 16 Uhr beginnen zwischen Mai und September die Darbietungen. Wahrlich als geadelt fühlen darf sich, wer hier bei den vom polnischen Ölkonzern Orlen gesponserten Events auftreten kann, sei es die auch in der Zeitgenössischen Musik tätige - Joanna Ławrynowicz, Professor Tadeusz Chmielewski oder die chinesische Polin Krystyna Man Li-Szczepancka. Aber es muss nicht unbedingt historisch und authentisch sein. Als Warschau Mitte Mai 2009 eine Nacht der Museen erlebte, wurde an Ort und Stelle sozusagen unter den entrückt in die Ferne schweifenden Augen des metallenen Chopins nach einem klassischen Vorspiel lautstark gerockt ( Rock Loves Chopin Project ) und auch subtil gejazzt. Als swingender und über Chopin-Material elegant improvisierender Solopianist erwies sich hier Leszek Możdżer. Schon im Juli 1997 gab mir der 1972 geborene Jazzer in seinem Wohnort Sopot Auskunft über sein Faible für Chopin: Seine Musik fasziniert durch die enge Verzahnung und Vernetzung von Melodik, Harmonik und Rhythmik. Am meisten mag ich ein Stück, in dem ich originalen Chopin, nämlich das Präludium As-Dur, mit dem Jazz-Thema My Secret Love kombiniert habe. Außerdem denke ich, dass die Etüde Ges-Dur op. 25 Nr. 9 sich sehr reizvoll mit einem Blues verbinden lässt. Play Chopin Leszek Możdżer war nicht der erste polnische Pianist, der eine CD ausschließlich mit verjazztem Chopin aufnahm. Andrzej Jagodzinksi, eigentlich ein studierter Waldhornist, war da 1994 bei Polonia Records schneller. Platten des Franzosen Jacques Loussier, der seit einem halben Jahrhundert mit Play Bach weltweit für Furore sorgt, im Jahre 2002 im Warschauer Sheraton-Hotel auftrat und zwei Jahre später auf einem österreichischen Label summa summarum 21 swingende Nocturnes herausbrachte, kannte er damals. Doch Jagodzinski fängt bei seinen Adaptionen sofort mit der Jazz-Komponente an, - falls er etwas absolut Notengetreues braucht, bringt er den namhaften Klassik- Chopin-Wein Zum Chopin-Jubiläum hat die Pfalzweinwerbung zusammen mit dem Polnischen Generalkonsulat Köln eine Sonderedition Pfälzer Weine aufgelegt. Die Pfalz spielt in der polnischen Geschichte eine besondere Rolle. Beim Marsch auf das Hambacher Schloß 1832 war eine große polnische Delegation dabei. Das Hambacher Fest ist heute noch Unterrichtsstoff in Polen. Der 2009er Riesling vom Weingut Georg Naegele in Hambach und der 2008er Spätburgunder vom Weingut Darting in Bad Dürkheim werden als Chopin-Weine im Jubiläumsjahr bei zahlreichen Veranstaltungen in Deutschland präsentiert. Tastenvirtuosen Janusz Olejniczak mit ins Spiel. Zwölf Monate vor den Jubelfeiern hatte Andrzej Jagodzinski nur einen einzigen Chopin-Termin in seinem Terminkalender stehen: 5. März 2010, Paris. Chopin ist für den 1953 Geborenen eine Herzensangelegenheit: Das ist die Musik, mit der ich verwurzelt bin. Ich lebte dort, wo auch Chopin lebte. Ich war oft und lange in dem Gebäude, wo er seine Musikausbildung erhielt. Es musste eben Chopin sein, etwas anderes gab es für mich nicht. Verständlich, wenn Musiker unterschiedlichster Couleur danach trachten, vom Chopin-Kuchen ein habhaftes Stück abschneiden zu können. Zurückhaltend ist da jedoch der Trompeter Tomasz Stańko, in Polen fortwährend zum Jazzmusiker des Jahres gewählt: 2006 improvisierte ich 22 POLEN und wir 1-2/2010 POLEN und wir 1-2/
13 KULTUR bei dem Festival Chopin in Europa mit dem japanischen Pianisten Makoto Ozone über eine Art von Chopin, das war ein interessanter Gig. Jetzt wollen mich Leute überreden, wieder etwas zu machen. Aber es ist sehr schwierig, eine Verbindung zwischen meiner Art von Improvisation und Chopin-Musik herzustellen. Einige Balladen und Nocturnes könnten sich dafür zur Not wohl noch eignen. Chopin Shopping Salzburg macht es längst vor mit Mozart lassen sich Mäuse machen. Nun heißt es erst recht in Polen, musikfrei Chopin shoppen. Die hochprozentigen Freunde können sich ans extra teuren Chopin-Wodka mit edel gestalteten Flaschen laben, die Antialkoholiker nehmen mit dem Chopin- Tee (ceylonesischer Earl Grey mit Orangen- Aroma) vorlieb samt adäquater Chopinteetasse. Pralinee-Dosen im Silber-Design inklusive eingeprägtem Chopin-Monument bietet seit Jahren die edle Konfiserie-Firma Wedel an. Aschenbecher, Uhren, Gläser und Porzellan nichts ist vor der kitschigen Vermarktung sicher. Weltweit musste Chopin ohnehin seinen Namen hergeben für Katzen, Pferde, Türdrücker, Sessel, und Hundehalsbänder. Kaum eine polnische Kommune, durch die nicht eine Ulica Chopina, eine Chopin-Straße, führt. Und jeder Warschau-Flieger landet ohnehin bei Chopin auf dem Fryderyk-Chopin-Airport. Falls der Gast dann in ein hauptstädtisches Hotel der Mercure-Kette eincheckt, bleibt er auch hier namentlich dem Heros treu. Ein Herz für Polen Franzose oder Pole? Jedenfalls hat Fryderyk, der kurz vor dem Aufstand gegen die besatzerischen Russen 1830 sein geliebtes Geburtsland für immer verließ, sein Herz platonisch an Polen verloren und sein wahrhaftiges Herz nach seinem Tode in Warschau beisetzen lassen. Die Heiligkreuzkirche und da besonders eine Säule mit dem eingemauerten Organ - dient so erst recht als Publikumsmagnet. Der Tastenvirtuose Chopin hatte ja selbst nie ein klavierloses Werk komponiert - schon gar nicht eine Symphonie, Oper, Oratorium oder Messe. Am 17. Oktober 2010, seinem Todestag (1849), findet in dem Gotteshaus die Aufführung des Requiems von Wolfgang Amadeus Mozart, den der Pole besonders verehrte, statt. Der herzlose Chopin wurde indes in seiner neuen Wahlheimat und Sterbestadt Paris beerdigt, auf dem Promi-Friedhof Père Lachaise, in dem nun auch Georges Bizet, Edith Piaf und Jim Morrison ruhen. Ein Trost für ihn: Kein Trauerzug mit einer Blaskapelle im Tross, die permanent und penetrant seinen berühmten Trauermarsch aus der Klaviersonate Nr. 2 intonierte (so wie es später in Moskau tote rote Kreml- Herrscher erleben mussten ). Wie heute vermutet wird, ist Chopin 39-jährig einer Mukoviszidose-Erkrankung erlegen. Krank fern der Heimat Von Gesundheit war Fryderyk Chopin nie gesegnet. Nach der Wunderkindzeit plagten den talentierten Teenager schon langwierige Lungenprobleme. Der 16-Jährige weilte so vier Wochen lang im tschechischen Marienbad (Mariánské Lázně). Dies bringt dem schmucken Kurort heutzutage neben kultureller Wertschätzung noch merkantilen Gewinn: Chopin-Ausstellung im Chopin-Haus, Chopin-Gedenkstein, Chopin-Festival. Auch Mallorca wirbt ausgiebig mit Federico Chopin, obgleich der dortige Winteraufenthalt 1838/39 für ihn und seine Lebensgefährtin George Sand im Horror endete und der Musiker die damals tourismusfreie Insel noch kränker verließ als bei seiner Ankunft. Das Jahr 2010 hat die gegenwärtige Balearenregierung in einer Kabinettssitzung zum Chopin-Jahr ausgerufen und verbindet diese Aktion mit der Propaganda-Lüge, der Meister aus Polen habe auf Mallorca seine Tuberkulose auskuriert. Freilich: Noch zwei Monate vor dem großen Geburtsjubiläum waren selbst in dem Gebirgsort Valldemossa, in welchem Chopin hauste, noch keine Hinweise auf die anstehenden 200er-Feierlichkeiten zu finden Fehlanzeige bei einer Anfrage im örtlichen Fremdenverkehrsbüro. George Sand berichtet in ihrer Autobiographie "Histoire de ma vie" (Die Geschichte meines Lebens) von einem Prélude, welches Chopin "an einem scheußlichen Regenabend einfiel, und das einem das Herz schwer macht". Alleingelassen in der Kartause Valldemossa hatte der Komponist geradezu psychopathisch Todesängste ausgestanden. Die Schriftstellerin erklärte ihrem Freund, man könne in dem Werk wirklich "Tropfen hören, die auf das Dach fielen". Doch Frédéric Chopin wurde ärgerlich, als sie ihm eine derart simple Verklanglichung unterstellte. Das Des-Dur-Prélude, die Nummer 15 aus Opus 28, beginnt auf der Tonika mit einem abwärts geführten Quartsextakkord mit den Tönen "f", "des" und "as", die Punktierung verleiht dem Dreitonmotiv eine markant heitere Note. Von der lieblichen Melodie, die im weiteren Verlauf etliche Wiederholungen und Sequenzierungen erfährt und sich in Achtelketten auflöst, wird das Ohr zunächst in den Bann gezogen. Überhören mag man dabei die steten Repetitionen des Tones 'as' in der linken Hand. Im nach cis-moll modulierten Mittelteil mutiert die gleiche schwarze Taste - als enharmonisches Wechselspiel - zu 'gis'. In dieser "finsteren" Passage ertönt in tiefer Basslage dann gravitätisch Choralhaftes, um letztendlich wieder bei der abschließenden Reprise das Anfangsthema flüchtig zu zitieren. Bis zum vorletzten Takt pocht ohn Unterlass im Achtelrhythmus der Ton 'as'. Zumindest ein polnischer Spielfilm zeigt dramatisch, wie der physisch und psychisch angeschlagene Chopin bei Gewitter und Sturm dieses Regentropfen-Prélude in der vormaligen Klosterzelle regelrecht in die Klaviertasten donnert. Europäische Größe Multikulti ist Fryderyk alias Frédéric Chopin in seiner Familie aufgewachsen. So bereitete es ihm keine Schwierigkeit, sich 1831 im Land seiner Vatersprache endgültig niederzulassen. Als er zuvor in Wien gastierte, hatte Chopin die Nachricht von der blutigen Niederschlagung des polnischen Aufstands durch das russische Zarenegime erreicht. Anstatt bei diesen Turbulenzen nach Warschau zurückzukehren, reiste er über München und Stuttgart (wo er die zornige Revolutionsetüde, Etüde c- moll, op. 10, Nr. 12, komponiert haben soll).nach Paris. Dort avancierte er alsbald in Konkurrenz zu Franz Liszt - zum verzückenden Star an einheimischen Pleyel-Pianos, komponierte und unterrichtete. Weniger bekannt als sein Winter auf Mallorca ist der Trip des schwerkranken Frederick nach England und Schottland Mitte 1848, also ein Jahr vor seinem Tod, als dessen Ursache damals Tuberculose diagnostiziert wurde. Die europäische Anerkennung ihres musikalischen Nationalhelden erfüllt die Polen aller Gesellschaftsklassen noch heute mit Genugtuung. Nicht nur in der Kulturelite, auch beim gemeinen Volk scheint in unserer Zeit der dirigierende Komponist Krzysztof Penderecki (Jahrgang 1933) eine ähnliche Spitzenposition einzunehmen, erst recht, nachdem dieser von geräuschhaften Experimenten zur lieblichen C-Dur konvertierte. film POLSKA Filmfestival des polnischen Films in Berlin filmpolska, das größte Festival des polnischen Films in Deutschland, findet dieses Jahr zum 5. Mal in Berlin statt. Vom 15. bis zum 21. April werden in den Hackesche Höfe Kinos, in den Neuen Kant Kinos, im Zeughauskino des Deutschen Historischen Museums, im Kino Arsenal, im Filmmuseum Potsdam, im Kino FSK, im Club der polnischen Versager und im Filmclub K-18 fast hundert Filme gezeigt. Das Festival umfasst die gesamte Palette polnischer Filmkunst: neueste Spiel- und Dokumentarfilme, Studenten- und Off-Filme, eine Filmreihe zur Kamerakunst sowie eine Retrospektive des Opus-Filmstudios und eine Retrospektive anlässlich des 30. Jubiläums der Gründung der Solidarność. Die Filmvorführungen werden zudem begleitet von einem Regieworkshop Bis an die Schmerzgrenze unter der Leitung von Marcin Koszałka sowie von Diskussionen und Treffen mit Filmemachern. Die fünfte Ausgabe von FilmPOLSKA präsentiert folgende Filmreihen: Neues Polnisches Kino Spielfilme bilden den Kern des Festivals filmpolska. In dieser Reihe werden junge Filme aus Polen präsentiert. Neben Blockbustern und preisgekrönten Filmen werden auch Low-Budget-Produktionen und Werke des unabhängigen Kinos zu sehen sein. Um der Aufbruchstimmung des Polnischen Kinos zu entsprechen, liegt der Schwerpunkt in diesem Jahr bei den jungen Talenten, u.a.: Paweł Borowski (Zero), Katarzyna Rosłaniec (Galerianki/Shopping Girls), Xawery Żuławski (Wojna Polsko-Ruska/ Schneeweiß und Russenrot), Jacek Borcuch (Wszystko co kocham/alles was ich liebe), Borys Lankosz (Rewers/Die Kehrseite), Bartek Konopka (Królik po Berlińsku/Rabbits a la Berlin), Marcin Koszałka (Do Bólu/ Bis an die Schmerzgrenze). Dokumentarfilme Der polnische Dokumentarfilm repräsentiert seit Jahrzehnten das höchste Niveau gesellschaftlicher Reflexion, historisches Bewusstsein und die Kraft des künstlerischen Ausdrucks. Mit dieser Reihe möchte filmpolska die wichtigsten Entwicklungen dieses Genres in Polen vorstellen und zeigt eine kleine Werkschau der letzen zwei Jahre. Zu sehen sein werden Filme wie Chemotherapie von Paweł Łoziński (Gewinner des Prix Europa 2009), Do Bólu/Bis an die Schmerzgrenze von Marcin Koszałka (Goldene Taube Leipzig 2009), Poste Restante von Marcel Łoziński (Europäische Filmpreis 2009) und Królik po Berlińsku/ Rabbits a la Berlin (Oscar-Nominierung 2010). Kurz- und Studentenfilme Das Kurzfilmprogramm der berühmten polnischen Filmhochschulen in Łódź (PWSTFiTV), in Katowice (WRiTV) und in Warschau (Andrzej Wajda Master School of Film Directing) zeigt Werke junger Nachwuchsregisseure. Retrospektive Opus Filme Opus Film zählt zu den bekanntesten polnischen Produktionsfirmen und produzierte zahlreiche weltweit preisgekrönte Filme junger Regisseure. Mit Edi, Wiedergewonnen und Moja krew seien an dieser Stelle nur ein paar wenige Beispiele genannt. Filmreihe Solidarność im Film Anlässlich des Jubiläums der Solidarność- Bewegung, die sich 1980 in Polen gründete und eine Ereigniskette im kommunistischen Europa auslöste, die letztendlich zur politischen Wende 1989 führte, widmet filmpolska diesem Thema eine eigene Filmreihe. Gezeigt werden 14 Spiel- und Dokumentarfilme, die einen umfassenden Einblick in Polens Geschichte der 1970er und 1980er Jahre geben. Darunter sind Werke von Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Kazimierz Kutz und Marcel Łoziński. Der Botschafter der Republik Polen in Berlin Marek Prawda wird die Filmreihe gemeinsam mit Kazimierz Kutz eröffnen. Kamerakunst Kameramänner und frauen stehen oftmals im Schatten der Aufmerksamkeit für Schauspieler und Regisseure, dabei hat die Kameraarbeit einen beträchtlichen Anteil an der Entstehung des Werkes. filmpolska würdigt diese Leistungen mit einer eigenen Filmreihe. Seit Jahrzehnten gehören polnische Kameramänner und Kamerafrauen zur cineastischen Weltklasse. Sławomir Idziak, KULTUR Jacek Petrycki, Witold und Piotr Sobociński, Janusz Kamiński oder Paweł Edelman sorgen nicht nur für den hervorragenden Ruf der Bilder im polnischen Film, sondern gehören auch zur internationalen Weltklasse. Zu Gast ist in diesem Jahr Sławomir Idziak, der neben den Werken Kieślowskis und Krzysztof Zanussis auch Hollywood-Megaproduktionen wie Black Hawk Down, King Arthur und Harry Potter und der Orden des Phönix seine Handschrift verliehen hat. Der zweite Gast dieser Reihe ist ein junge Wilder : Marcin Koszałka ist nicht nur ein hervorragender Kameramann, sondern auch ein schonungsloser Erzähler im Dokumentarfilm. Koszałka wird in diesem Jahr ebenfalls den Filmworkshop leiten. Programm ab April unter: Deutschpolnische Landkarte Die interaktive Deutsch-Polnische Landkarte (Mapa Polsko-Niemiecka) ist das jüngste Internetprojekt der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Die Landkarte ging am 4. Januar 2010 online. Auf ihr findet man gegenwärtig rund 200 Institutionen in Deutschland und Polen, die sich u. a. kulturell, wissenschaftlich und gesellschaftlich herausragend für den deutsch-polnischen Dialog einsetzen. Auch große international bedeutende Mittlerorganisationen, wie das ifa, das Goethe Institut oder das Adam Miczkiewicz-Institut sind auf der Landkarte zu finden. Die zweisprachige interaktive Landkarte ist ein praktisches und innovatives Tool, das einen schnellen Überblick über die Akteure, Institutionen bzw. Projekte verschafft und diese kurz vorstellt. Der Nutzer kann anhand fünf Filtern bzw. sechs Kategorien ein Suchprofil erstellen. Er kann zwischen Deutschland, Polen bzw. Berlin und Warschau wählen oder sich alles anzeigen lassen. Um die Suche zu erleichtern hat die Landkarte sechs Kategorien. Die Kategorie herausragende SdpZ-Projekte, stellt rund 50 Projekte vor, die von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit seit 1991 gefördert worden sind POLEN und wir 1-2/2010 POLEN und wir 1-2/
14 REPORTAGE REPORTAGE MetroPolen - Polska fast forward Phänomen: Beschleunigung ist überall Von Anna Leidinger In Potsdam organisierten Studenten eine interdisziplinäre Tagung zum Phänomen der Beschleunigung in Polen und stellten dabei fest: Beschleunigung ist überall. Das senffarbene Gebäude in der Potsdamer Innenstadt wird bald abgerissen. Es könnte auch in Warschau, Baku oder Sofia stehen. Auf zierlichen Säulen unter denen mal eine Ladenpassage Platz gefunden hat, ruht ein schwerer Klotz, der immer noch die Potsdamer Fachhochschule beherbergt. Doch bald wird die FH Potsdam umziehen müssen. Nicht so die benachbarte Nikolaikirche auf dem Platz der Einheit; sie ist nach längeren Sanierungsarbeiten wieder geöffnet und zieht viele Touristen an. Überhaupt strahlt Potsdam in seinen schönsten Farben, der Schneematsch kann der Stadt Friedrichs des Großen auch heute nicht viel anhaben an diesem Mittwoch im Februar. Thomas Dorniak, Student der Polonistik an der Universität Potsdam hat diesen Ort bewusst gewählt. Zusammen mit einigen Kommilitonen plante er eine Tagung zu einem Thema, das so aktuell und allumfassend ist, dass bei vielen Besuchern ein Aha-Effekt einsetzte. Es geht um Beschleunigung. Es scheint fast ein Allgemeinplatz zu sein, dass alles immer schneller wird. In allen Bereichen des Lebens funktionieren Dinge heute schneller, als noch vor 30 Jahren. Mobilität, Kommunikation, Arbeitsmarktverhalten. Wir schreiben keine Briefe, sondern s, manche von uns twittern und halten so ihre Follower in Echtzeit auf dem Laufenden. Wir haben keinen festen Beruf mehr, sondern wir arbeiten zurzeit an einem Projekt. Nachdem Thomas Dorniak im Herbst ein Interview mit dem Jenaer Soziologen und Beschleunigungsforscher Hartmut Rosa geführt hatte, war für ihn klar, dass dieser Prozess noch komprimierter in den so genannten Transformationsländern passiert. Was in Westeuropa mehr als doppelt so lange dauerte, passiert jenseits der Oder im Zeitraffer. Beschleunigung in der Nussschale sozusagen. Deshalb auch der Titel: MetroPOLEN. Polska fast forward. Als hätte nach 1990 jemand auf eine Taste gedrückt und das ganze Land vorgespult. So muss es dem kleinen Tomek gegangen sein, als er im Jahre jährig zusammen mit seinen Eltern von Polen in die Nähe von Frankfurt am Main zog. Thomas Dorniak beschreibt seine Faszination für Rolltreppen und volle Ladenregale und auch, wie er sich bei Besuchen bei seiner polnischen Großmutter freute, wenn vor dem Haus ein Bauer mit einem Pferdekarren vorbeifuhr. Ich wunderte mich, warum es so schöne Dinge in meiner neuen Heimat nicht gab, erzählt er in seinem Einführungsvortrag. Fährt man heute nach Polen, sieht man zwar auch noch einige Pferdewagen, die Städte jedoch setzen alles daran, um ihr Gesicht dem Londons, Hongkongs oder wenigstens Frankfurt am Main anzupassen. Uwe Rada, Redakteur bei der taz, ist fast ein bisschen schadenfroh, als er von der optischen Kluft zwischen Shopping Mall und dem direkt daneben liegenden Warschauer Hauptbahnhof erzählt. Er nimmt die Tagungsteilnehmer in fünf Etappen auf eine fast poetische Reise zwischen Beschleunigung und Stillstand mit. Von Biobauern am östlichen Oderufer erzählt er und von der Entwicklung des Jarmark Europa, dem berühmten Bazar am Warschauer Weichselufer. Doch er stellt auch fest: Wie immer in der Geschichte wandern die Menschen immer noch nach Westen, weil sie dort den Reichtum vermuten. Das Kapital aber, das wandert nach Osten, wie die Hochhäuser in den polnischen Metropolen zeigen. Rada berichtet von der Mobilität und belässt es dabei nicht beim vielbesungenen Berlin-Warszawa-Express, mit dem einige Teilnehmer auch an diesem Tag angereist sind. Der RE1 fährt die Mitarbeiter und Studenten der Europa-Universität Viadrina Frankfurt / Oder in 50 Minuten nach Berlin Mitte und wird zum Brain Train. durch den Metropolitan Corridor, wie Karl Schlögel die Verbindung von Metropolen nennt, die mehr miteinander zu tun haben, als mit den Peripherien, von denen sie umgeben werden. (Enttäuschend fiel dagegen der Vortrag von Prof. Bogdan Koszel von der Adam- Mickiewicz-Universiät Poznań aus. Die rein deskriptive Erläuterung der Entwicklung der polnischen Parteienlandschaft warf mit Abkürzungen um sich, die nur einem aufmerksamen Polenkenner ein Begriff sein dürften. Was das ganze mit Beschleunigung zu tun hat, wurde in seinem Referat nicht deutlich. Eine kleine Analyse erlaubte sich der Posener Professor dann doch noch: Es gibt in Polen keine starke Linke. Es ist nicht gut für ein Land, wenn es keine linke Bewegung gibt. Sprachs und verschwand gen Słubice, dem Zwilling von Frankfurt/ Oder, um dort einen weiteren Vortrag zu halten.) Plötzlich rumort es in den Reihen der Zuschauer. Besonders der weibliche Teil des Publikums gerät in Verzückung, als Yoshi Ikuta und Sören Gundermann auf die Bühne kommen. Jazzmisja heißt ihre Zwei-Mann-Band, die aber viel mehr als zwei Instrumente bedient. Die beiden Polnisch-Studenten sind an ihrer Fakultät eine Ausnahme. Keiner von ihnen hat eine polnische Mutter oder einen polnischen Vater. Dennoch singen die beiden auf polnisch, was wunderschön und manchmal gerade wegen eines leichten deutschen Akzents hinreißend klingt. Ihre Texte und ihr Humor aber sind derart absurd und somit so sehr polnisch, wie der Kult-Film Seksmisja, der natürlich in ihrem Namen mitschwingt. Nie ma w Warszawie dobrej musztardy / Es gibt in Warschau keinen guten Senf ist der Refrain eines der Lieder. Doch die Dozentinnen, die ihnen die Sprache beigebracht haben warten eigentlich alle auf das Lied des verliebten Küchenmeisters / Piosenka zakochanego kucharza und singen laufhals mit, als Yoshi und Sören es endlich spielen und eine Edelstahl-Thermosflasche zum Musikinstrument umfunktioniert wird. Kirche vs. Shopping Mall Seit ziemlich genau tausend Jahren sind die Polen katholisch. Ungefähr genausolange strömen sie Sonntags in die Kirchen. Zwei unterschiedliche Bilder zeichnen Arnold Bartetzky und Agnieszka Gąsior vom Geisteswissenschaftlichen Zentrum Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig. Während Bartetzky erzählt, wie die unendlichen Öffnungszeiten der Shoppingmalls in Polen dazu führen, dass polnische Familien am Sonntag lieber den Familienausflug ins Einkaufszentrum als in die Kirche machen, zeigt Agnieszka Gąsior Fotografien von überdimensionalen Monumenten der Marienverehrung in Polen. Licheń in der Nähe von Konin ist ein Dorf mit wenigen hundert Einwohnern, in dem die katholische Kirche das größte Gotteshaus Polens gebaut hat, laut Aussagen der Architektin in Anlehnung an den Petersdom in Rom und altägyptische Architektur. Ganze Berufszweige organisieren Kaffefahrten oder Pilgerfahren nicht nur nach Częstochowa, sondern eben auch in neu errichtete Orte der Marienverehrung, die im polnischen Katholizismus bekanntlich einen hohen Stellenwert hat. Wem gehört die Stadt? Ein riesiger Plattenbau in einer polnischen Stadt in der Sylvesternacht 1999/2000. Der Künstler Paweł Althammer hat die Bewohner des Hauses überredet, bei einem Kunstprojekt mitzumachen. Sie beleuchten ihre Fenster nach Anweisung des Künstlers so, dass die Fassade des Hauses eine riesige 2000 darstellt. Es ist Konzeptkunst mit einer politischen Idee dahinter. Es ist eine alte Idee von Nachbarschaft und Gemeinschaftsgefühl, die in Polen momentan sehr verzerrt wird. Arnold Bartetzky ist durch Polen gereist und hat sie fotografiert, die gated communities, von denen es in Warschau mehrere 100 gibt, in Berlin höchstens einige wenige. Über 80 Prozent der befragten Polen gaben in einer Umfrage an, sie würden gern in einer solchen Wohnanlage leben. Gated communities sind umzäunte, von privaten Sicherheitsdiensten bewachte Wohngebiete, die aus öffentlichem Raum wie Straßen oder Höfen privaten Wohnraum machen. Sie sollen ihren Bewohnern das Gefühl der Sicherheit geben, aber auch den Menschen jenseits der bewachten Einfahrt zeigen, wie reich man ist. Wer es sich leisten kann, zieht zum Beispiel in die pastellfarbenen Wohnhäuser am Warschauer Stadtrand, die Nutzer eines Internetforums als viktiorianisch bezeichnet haben. Viktorianisch klingt westlich, klingt elegant, klingt teuer. Und weil jeder, egal auf welchem Niveau, zeigen will, dass er mehr hat als andere, beginnen nun auch die Bewohner der Plattenbauhochhäuser, ihre Parkplätze einzuzäunen um Bettler und Obdachlose von ihren Hauseingängen fernzuhalten. Die unsanierten Plattenbauten, verkommen derweil zu sozialen Brennpunkten. Wo früher der Professor Tür an Tür mit dem Bauarbeiter gewohnt hat, wohnt heute niemand mehr so gerne. Die Zerstückelung der Gesellschaft ist in Polen anders konnotiert als in anderen Ländern. Das jahrhunderte Fehlen einer Staatlichkeit hat eine besondere Identifikation mit Sprache und Religion als gemeinsamen topos bei den Polen hervorgerufen. Museen auf polnischem Boden unter fremder Herrschaft fungierten als materialisierte Erinnerung im Ausgleich für die fehlende Staatlichkeit. Das erste Nationalmuseum war ein so genanntes Residenzmuseum, errichtet 1801 im damals preußischen Puławy von der polnischen Adeligen Izabela Czartoryska. Es ist eines von vielen Nationalmuseen im heutigen Polen, erzählt Karoline Kaluza, die am Goethe-Institut Warschau die Musealisierung in Polen untersucht. Polen erlebe seit 2004, dem 60. Jahrestag des Warschauer Aufstands nicht nur eine Politisierung der Museumslandschaft, sondern auch einen wahrhaften Museumsboom und eine neue Vielfalt in der Musealisierung. Nicht überall kann man die Folgen der Beschleunigung so greifbar aufzeigen, wie am Beispiel der Stadtentwicklung oder politisch konnotierten Bauwerken. Birgit Krehl, Literaturwissenschaftlerin an der Universität Potsdam schafft es trotzdem, obwohl der Gegenstand ihres Vortrages Die Krise der Lyrik ist. Was hat das denn jetzt mit Beschleunigung zu tun? Krehl erinnert das Publikum an den Nobelpreis für Literatur, der im letzten Jahr an Herta Müller ging: Sofort wurden alle ihre Erzählungen neu aufgelegt. Aber Müllers Gedichte? Die verstauben weiter in den Regalen der Bibiliotheken. Die Narrative sei das Paradigma der Postmoderne geworden, sagte der Romanist Hugo Friedrich einmal. Die Dichter der Moderne haben ihre Epoche noch gefeiert als Renaissance, gerade in Polen, wo die Vertreter der Krakauer Avantgarde Anfang des 20. Jahrhunderts neue Visionen der Lyrik veröffentlichten. Doch funktioniert Lyrik nur noch, wenn sie fragmentiert ist? Haben wir überhaupt noch Zeit für Gedichte? Das Lesen eines lyrischen Textes funktioniert auf anderen Ebenen als das Lesen von Prosa. Man zeichnet viele Dinge mit den Gedanken nach, man verknüpft Symbole eigenständig mit den eigenen Erfahrungen. Es geht bei Lyrik eben nicht um die Aufnahme und Weitergabe von Informationen. Birgit Krehl nimmt die Zuhörer mit in die Welt der modernen Lyrik von Marcin Świetlicki, geb Hier finden wir Dialoge, zeitliche Bestimmungen und andere Aspekte, die eigentlich in narrative Texte gehören. In Dichter wie Świetlicki setzt Krehl ihre Hoffnungen, denn: Ich bin skeptisch, aber nicht pessimistisch, sagt sie, die Krise der Lyrik ist zu überwinden, wenn wir Lyrik als moderne Lyrik verstehen. Kleingeldprinzessin Moderne Lyrik könnte man auch in den Texten der Liedermacherin Dota Kehr finden. Kehr, alias Die Kleingeldprinzessin lockt am Ende der Veranstaltung noch mehr Publikum in das Schaufenster der FH Potsdam. In ihren Texten singt sie von klebrigen Sekunden und man kann bei ihrer schönen Stimme gleich ein bisschen entschleunigen. Einige Frauen tanzen, Thomas Dorniak gönnt sich ein Bier, ein polnisches, zu Feier des Tages. Die Studenten der Universität Warschau, die von den Potsdamern eingeladen wurden, hatten auf deutsches Bier gehofft, verraten sie. Aber sie sind beeindruckt, wie ein Student neben Klausuren und Bachelor-Stress eine Tagung organisiert hat. Sie wollen jetzt auch eine Tagung machen. Über Beschleunigung in Deutschland. 26 POLEN und wir 1-2/2010 POLEN und wir 1-2/
15 28 29
16 BUCH BUCH Vom Junker zum Bürger Zur Person und zum Wirken des Demokraten und Pazifisten Hellmut von Gerlach Von Friedrich Leidinger Dass dem Verbrennen von Menschen in Deutschland das Verbrennen von Büchern und Ideen vorausging, ist vielfach bekannt. Aber man möchte doch erschrecken, wie nachhaltig dieses nationalsozialistische Autodafé gewesen ist, wie viele der damals symbolisch verbrannten Denker und Dichter für dauernd aus der deutschen Öffentlichkeit und der kollektiven Erinnerung verschwunden, oder höchstens einem kleinen Club Eingeweihter bekannt sind. Zu letzteren ist der 1866 im schlesischen Mönchmotschelnitz als Sohn eines Gutsbesitzers geborene Hellmut von Gerlach zu zählen, der in seinem Leben eine bemerkenswerte Wandlung vom konservativ-antisemitischen Beamten zum pazifistischen und demokratischen Schriftsteller und Journalisten und zum antifaschistischen Kämpfer vollzog. Er starb vor 75 Jahren, am 1. August 1935 im Pariser Exil. An von Gerlach und seine politischen Ideen zu erinnern ist nicht nur dem Respekt vor dem Leben und Wirken des Verfolgten sondern gewiss auch der fortdauernden Brisanz und Aktualität seiner Ideen geschuldet. Diese Schuld wenigstens ein Stück abzutragen und dabei intellektuellen und politischen Gewinn für die Gegenwart zu schöpfen ist die Absicht hinter dem jetzt erschienenen Sammelband Vom Junker zum Bürger Hellmut von Gerlach Demokrat und Pazifist in Kaiserreich und Republik, herausgegeben vom Berliner Sprachwissenschaftler Christoph Koch. Der Band vereinigt die Vorträge einer unter dem gleichen Titel im Sommer 2007 veranstalteten wissenschaftlichen Tagung der Freien Universität Berlin, an der die Deutsch-Polnische Gesellschaft als Mitveranstalter und Initiator erheblichen Anteil hatte. Weitere Mitveranstalter waren die Deutsche Friedensgesellschaft und die Internationale Liga für Menschenrechte, die beide von Gerlach als einen ihrer Gründer aufführen. Von Gerlach entstammte dem Milieu demokratiefeindlicher Aristokraten, Offiziere und konservativer Bürger, den tragenden Säulen der in die operettenhafte Fassade eines Kaiserreichs gekleideten und Deutsches Reich genannten Militärdiktatur von 1871, und engagierte sich im Kreis um den reaktionären und antisemitischen Berliner Hofprediger Adolf Stoecker. Er schloss sich in der Provinz der Nationalsozialen Partei Friedrich Naumanns an, der heute als Stammvater des politischen Liberalismus in mannigfacher Weise vereinnahmt wird, und erwarb als politische und publizistische Plattform die Hessische Landeszeitung. In einem jahrelangen schmerzlichen Prozess entfremdete er sich seinen bisherigen politischen Freunden aus dem adeligen und konservativ-bürgerlichen Milieu und engagierte sich ab 1910 in der pazifistischen Bewegung. Da hatte sich der ehemalige Parteigänger des Ancien Regime längst für die Seite der Demokratie und der Revolution entschieden. Es blieb nicht der einzige Bruch in seinem Leben, aber wohl der meist beachtete. Von da an hafteten ihm in seiner zweiten politischen Karriere Attribute wie: ein adeliger Renegat, das schwarze Schaf, der ekle Auswurf eines sonst so angesehenen Geschlechts an. Ein kurzes Intermezzo als Unterstaatssekretär im preußischen Innenministerium erlaubte ihm tiefere Einblicke in das deutsch-polnische Verhältnis und ließ ihn für seine Normalisierung eintreten. Dass diese Angelegenheit mehr als nur episodischen Charakter in seinem Leben hatte, dass er vielmehr dem deutsch-polnischen Verhältnis eine Schlüsselrolle für den Frieden in Europa zusprach, war der Grund, warum die erste bürgerliche Vereinigung, die nach 1945 im besetzten Deutschland für die Verwirklichung der Ziele von Gerlachs eintrat, die Deutsch-Polnische Gesellschaft der BRD, sich zunächst den Namen von Gerlachs gab, bis ihr dieser durch Mitglieder der Familie entzogen wurde. Er redigierte die linksliberale Welt am Montag und ab 1932 für den verhafteten Carl von Ossietzky die Weltbühne. In völliger Gewissheit des Schicksals, das ihm die Nazis und ihre Hintermänner zugedacht hatten, flüchtete er im März 1933 über Österreich nach Frankreich und lebte bis zu seinem Tod 1935 in Paris. Allerdings enthält der Lebenslauf von Gerlachs mehr Substanz als die bloße Geschichte des Orientierungswandels seines Helden von rechts nach links so der Titel eines autobiographischen Buches. Er erstreckt sich über die denkbar gegensätzlichsten politischen Ordnungen der neuzeitlichen europäischen Gesellschaften, er verkörpert eine aus eigenem Antrieb und unter großen Mühen errungene demokratische Grundhaltung von höchster Authentizität, er berührt wie der Lauf eines Zuges die verschiedenen geschichtlichen Stationen, auf denen jeweils Weichenstellungen auf dem Weg in die großen Katastrophen der Epoche erfolgten. Das Studium dieses Weges widerlegt die gern kolportierte Legende vom Untergang der Weimarer Demokratie durch Extremisten und Radikale und verweist auf das notorische Versagen der demokratischen Kräfte, vor allem der bürgerlichen Mitte, die die Revolution von 1918 nicht akzeptierten und schließlich mit den Kräften der Reaktion und des Faschismus gemeinsame Sache machten. Von Gerlachs Leben als liberaler Politiker und Publizist zeigt, wie es anders hätte gehen können, an welchen Stellen die Weichenstellungen für die Fahrt in den Abgrund erfolgte, bzw. wo die Hinwendung zu Freiheit und Demokratie unterblieb. Wissenschaftliche Untersuchungen zur Frage, wie der Nationalsozialismus hätte verhindert werden können, sind bisher nur fragmentarisch vorhanden, groß ist der Forschungsbedarf. Daher liefert das Buch auch keine umfassenden Darstellungen sondern eher Skizzen, Teilaspekte und Anregungen für weitere Forschungen. Die Beiträge des Buches sind inhaltlich und formal höchst unterschiedlich Aufsätze zur Ideologie- und Politikgeschichte der deutschen Bourgeoisie im Jahrhundert nach 1848, biographische Facetten, Memoiren und journalistische Hinweise zur fortdauernden Aktualität von Gerlachs. Das Grundmotiv, das in allen Beiträgen mitschwingt, ist das Scheitern: das Scheitern des wortgewaltigen Pazifisten und Demokraten von Gerlach, das Scheitern der bürgerlichliberalen Parteien angesichts der Herausforderung der frühen Industriegesellschaft, das Scheitern der pazifistischen Kräfte vor 1914, einen Weltkrieg zu verhindern, das Scheitern der Revolution von 1918 und das Scheitern von Gerlachs beim Versuch, nach 1918 einen friedlichen Ausgleich mit Polen als Voraussetzung für gute Nachbarschaft herzustellen, das Scheitern des Kampfes für Republik und Demokratie als Alternative zum heraufziehenden deutschen Faschismus und schließlich das Scheitern des Neubeginns, der ein Fortleben des Ungeistes in Staat und Gesellschaft nicht unterbinden konnte. Einen guten Überblick über die vielfältigen Verflechtungen des politischen und publizistischen Wirkens von Gerlachs bietet Hans-Jürgen Bömelburgs Skizze zur Konstruktion einer noch ungeschriebenen Biographie. Sie findet eine reizvolle Ergänzung durch die biographische Studie Michael Quettings über Milly Zirker, Freundin und Weggefährtin von Gerlachs, und Vorkämpferin für Demokratie, Völkerverständigung und Frieden. Einen eingehenden Blick auf die Geschichte des Liberalismus in Deutschland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts werfen Ludwig Elm und Karl Heinrich Pohl. Karl Holl untersucht die Entwicklung von Gerlachs zum demokratischen Pazifisten und sein Eintreten für Freundschaft zum Erbfeind Frankreich, Wolfgang Wippermann beschäftigt sich mit der Gerlachschen Kritik an der unter dem Namen Hakatismus bekannten Germanisierungspolitik Preußens gegenüber Polen. Die deutsche bzw. preußische Polenpolitik und damit das Engagement von Gerlachs für das deutsch-polnische Verhältnis steht im Mittelpunkt der Beiträge Przemyslaw Hausers und Krzysztof Rzepas, Antisemitismus und die Weimarer Linke ist Gegenstand des Beitrags Mario Keßlers. Persönliche Reminiszenzen und Kommentare zu Leben und Werk von Gerlachs von so unterschiedlichen Autoren wie Susanne Böhme-Kuby, Karol Rose, Jörg Wollenberg oder Eckart Spoo runden das Bild ab. Mit dem Aufsatz über den Pazifisten und Pädagogen Friedrich Wilhelm Foerster, laut von Gerlach der bestgehasste Mann Deutschlands, bringt Helmut Donat die Figur eines bemerkenswerten Zeitgenossen von Gerlachs in Erinnerung. In formaler wie inhaltlicher Hinsicht aus dem Rahmen fällt der Aufsatz des Herausgebers Christoph Koch: Er nimmt mit fast einhundert Buchseiten ein Viertel des Buchumfangs ein und beschreibt in akribischer Quellenanalyse, wie der Geist des Reiches gegen den schon der Demokrat und Antifaschist von Gerlach bis zum letzten Atemzug kämpfte - sich nach dessen Untergang in die Metaphysik und von dort höchst konkret und wirksam in die Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichtes flüchtete. Diese zeitgenössische Fortsetzung des Kyffhäuser-Mythos ist eine spannende Lektüre, und sie lehrt den interessierten Leser, wessen Geistes Kind unsere Republik ist, welche als erster deutscher Staat in der Geschichte den Namen Deutschland trägt. Die sorgfältig ausgewählten Autoren und die von ihnen bearbeiteten Themen sowie die zahlreichen Literatur- und Quellenverweise stehen für die Qualität des Buches, das sowohl von Studenten und Wissenschaftlern, als auch von interessierten Bürgern mit großem persönlichen Gewinn gelesen werden wird. Vom Junker zum Bürger: Hellmut von Gerlach Demokrat und Pazifist in Kaiserreich und Republik (Broschiert) von Christoph Koch (Herausgeber) Broschiert: 442 Seiten Verlag: Meidenbauer; 1. Auflage ISBN: Preis: EUR 59,90 Rezension in anderen Medien: [...] durchweg informativ und sehr anregend. Alles fügt sich zu einem sorgsam erarbeiteten lesenswerten Buch, das problembewusst und überzeugend Wandlungen ebenso erkennen lässt wie gewonnene Beständigkeit friedenspolitischer Positionen, die Vielfalt und Differenziertheit des Pazifismus wie auch seine Schwierigkeiten in einem von politischen Parteien eng gesetzten Rahmen, nicht zuletzt die Vorteile einer aus engstirniger Polarisierung befreiten Gesellschaftskritik. (Ossietzky) Sąsiedzi/ Nachbarn Deutsche Motive in polnischer Gegenwartskunst Zwei Jahre nach der ersten Edition der Ausstellung Nachbarn Deutsche Motive in zeitgenössischer polnischer Kunst im Jahr 2007 in Hamburg wagen die Ausstellungsmacher einen Blick auf die andere Seite der Medaille. Die deutsche Kultur, aber auch ihr Fehlen im Zusammenhang mit Motiven des II. Weltkrieges, ist ein Thema, welches polnische Künstler oft aufgreifen. Die geographische Nähe beider Länder brachte eine Faszination für den Westen. Man kann jedoch kaum von beiderseitigem Interesse sprechen. Auf der Suche nach deutschen Künstlern, die sich von Polen inspirieren ließen, stießen die Ausstellungsmacher zuerst auf eine große Leere. Doch die letzten Jahre haben gezeigt, dass das Interesse am östlichen Nachbarn wächst, und so wurden erstaunlicherweise nicht bloß Stereotypen, sondern vor allem durchdringende Beobachtungen zum Ausgangspunkt künstlerischer Arbeiten. Die ausgewählten Werke wurden unterteilt nach solchen, die unmittelbar die polnisch-deutsche Nachbarschaft, und die mit ihr verbundenen Probleme und Möglichkeiten thematisieren, nach sozialkritischen, die sich mit Stereotypen auseinandersetzen, sowie die einfach illustrativen. Die Ausstellung Sąsiedzi/Nachbarn. Deutsche Motive in polnischer Gegenwartskunst zeigt nicht nur das Ausmaß der Unterlassung, des Aufgebens, das die polnische nationale Identiät bestimmt, sondern gleichzeitg die Versuche, diesen Zustand zu verarbeiten. Nur solch eine Verarbeitung im großen Umfang kann eine authentische, gute Nachbarschaft ermöglichen Der zweite Teil des Projekts ist die Ausstellung Sąsiedzi/Nachbarn. Polnische Motive in deutscher Gegenwartskunst und ist vom 16. April Mai 2010 in der Städtischen Galerie Danzig Galerie Günter Grass zu sehen. 30 POLEN und wir 1-2/2010 POLEN und wir 1-2/
17 KULTUR Im Polnischen Institut in Berlin: Polnische Malerei aus der Sammlung Marx Sasnal, Rogalski, Bujnowski, Lipski Polnische Kunst aus der Sammlung Marx ist noch bis zum 28. Mai im Polnischen Kulturinstitut in Berlin zu sehen. Die hochkarätige Sammlung Marx gehört zu den wichtigsten Werkensembles zeitgenössischer Kunst, die bis heute in europäischen Museen Ihresgleichen sucht. Der Kunstmäzen Dr. Erich Marx hat seit den 1960er Jahren nach und nach museumswerte Kunstwerke zusammengetragen und sich dabei anfangs vor allem auf sechs Künstler konzentriert: Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Cy Twombly, Joseph Beuys und Anselm Kiefer bekam die Sammlung Marx ihren ständigen Ausstellungsort im Hamburger Bahnhof, dem Museum für Gegenwartskunst in Berlin. Vor etwa vier Jahren begann der Sammler sich auch für zeitgenössische Kunst aus Polen zu interessieren. Zu seinen Beständen gehören inzwischen Werke von Wilhelm Sasnal, Zbigniew Rogalski, Rafał Bujnowski und Roman Lipski. Er konnte auch seine Freunde dafür begeistern, so u.a. Dr. Giuseppe Vita. Aus der Privatsammlung von Andreas Pucher aus Stuttgart stammt auch eines der Werke. Die polnische Kunst gehört inzwischen wie selbstverständlich zur internationalen Kunstszene und wird auf dem Kunstmarkt und unter Sammlern hoch gehandelt. Wilhelm Sasnal, Zbigniew Rogalski, Rafał Bujnowski und Roman Lipski sind Künstler der jungen Generation, die den polnischen und internationalen Kunstmarkt seit Jahren dominiert. Ihre Werke sind vorwiegend gegenständlich auch wenn alle vier Künstler aus unterschiedlichen Inspirationsquellen schöpfen. Ihre Werke sind u.a. in der Ausstellung in Berlin zu sehen. Wilhelm Sasnal (geb. 1972) studierte an der Kunstakademie in Kraków gewann er den Vincent van Gogh Biennial Award for Contemporary Art. Er lebt und arbeitet in Warschau. Zbigniew Rogalski (geb. 1974) studierte Malerei an der Kunstakademie in Poznań. In den Jahren bildete er gemeinsam mit Hubert Czerepok das Künst- Wilhelm Sasnal: Untitled (Hidden Couple,) 2003 Öl auf Leinwand, 147,5 x 147,5 x 5 cm lerduo Magisters. Seit 2006 arbeitet er künstlerisch mit Michał Budny zusammen. Er lebt und arbeitet in Warschau. Rafał Bujnowski (geb. 1974) studierte Architektur an der Technischen Hochschule in Kraków und anschließend Grafik an der Kunstakademie in Kraków. Er war Mitbegründer der Künstlergruppe Ładnie gewann er den internationalen Kunstpreis Europas Zukunft. Er lebt und arbeitet in Kraków. Roman Lipski (geb. 1969) emigrierte 1989 nach Deutschland und lebt und arbeitet seitdem in Berlin. Er reist immer wieder an die Orte seiner Kindheit zurück. Die Fotografien und die Erinnerungen, die er mit nach Berlin nimmt, lässt er in dunkle Landschaften zerfließen. Weitere Veranstaltungen: Dorota Terakowska: Im Kokon Deutsche Buchpremiere Lesung und moderiertes Gespräch , 19 Uhr, Berliner Stadtbibliothek Breite Straße 30-36,10178 Berlin Der erschütternde Roman über das Schicksal eines Down-Syndrom-Kindes liegt nun in deutscher Sprache vor. Über weite Teile geschrieben aus der Sicht des behinderten Kindes eröffnet er völlig neue Sichtweisen auf eine Ehe, die durch die Geburt des Down-Babies auf eine harte Bewährungsprobe gestellt wird, als auch auf die unaussprechbare innere Welt, in die das Kind immer wieder entflieht: Die Welt der immerwährenden Schöpfung, deren Teil es mehr und mehr zu werden scheint... In Ganze Tage - Ganze Nächte biett ein Puzzle von zufälligen Begegnungen und Gedankenaustausch Einblick in die Gedanken junger Menschen. Foto: Teatr Studio Internationale Theaterwerkstatt Teatr Studio Deutsch-Polnisches Theaterprojekt wird sechs Jahre alt Von Karl Forster Sechs Jahre ist ja beileibe kein großes rundes Jubiläum. Aber für ein solches Theaterprojekt doch eine beachtliche Zeit. Es war quasi ein kultureller Beitrag zum kurz bevorstehenden EU-Beitritt Polens, als am 28. Februar 2004 das Theater mit der Premiere des Stückes Die weiße Ehe von Tadeusz Różewicz in der Übersetzung von Henryk Bereska eröffnet wurde. Różewicz und Bereska standen ohnehin quasi Paten für das neue Theater, dessen Eltern Janina Szarek, die polnische Schauspielerin und Regisseurin und Prof. Olav Münzberg, Schriftsteller und Kunstund Kulturwissenschaftler, sind. Das Besondere an dem Theater ist die Kombination mit der Transformschauspielschule. In dieser bereits 1999 gegründeten, staatlich anerkannten Schauspielschule hat der Trägerverein Internationale Theater Werkstatt (ITW) wird in einem kulturpolitischen Dialog von deutschen und vor allem polnischen Theaterleuten Kulturen und Mentalitäten aus beiden Ländern zu reflektieren. Das Theater das aus der Schauspielschule entstand, bietet den Schauspielschülern die Möglichkeit, ihr Erarbeitetes gleich in professioneller Weise zu präsentieren. Dabei ist das Teatr Studio eine besondere Form des polnischen Theaters, wo der Mensch und die Darstellung des Schauspielers im Mittelpunkt stehen und wo das Publikum näher an das Geschehen rückt. Eine Form, die unkonventioneller, provokanter, suchender, ursprünglicher und wahrhaftiger ist. (ITW) Janina Szarek studierte am weltberühmten Krakauer STU Theater. Anschließend war sie am Teatr Spólczesny und am Teatr Polski in Wrocław engagiert. Daneben war sie schon damals auch in London und Berlin tätig. Seit 1981 lebt sie in Berlin, wo sie unter anderem an der Berliner Volksbühne tätig war aber auch Film- und Fernsehrollen annahm. Als Pädagogin und Regisseurin war sie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, der Filmhochschule Konrad Wolf und an der Freien Universität tätig. Prof. Olav Münzberg war unter anderem in den 80er Jahren Vorsitzender der Neuen Gesellschaft für Literatur, später Vorsitzender des Verbandes deutscher Schriftsteller (VS) Berlin. An der Universität der Künste Berlin ist er als Honorarprofessor für Kunst- und Kulturwissenschaft tätig. KULTUR Das sechsjährige Bestehen feierte das Teatr Studio mit einem langen Abend. Zu Beginn wurde die beeindruckende Diplominszenierung 2009 der Schauspielschule Ganze Tage - Ganze Nächte des franzäsischen Dramatikers und Drehbuchautors Xaviere Durringer aufgeführt. Mit minimalen Requisiten und quasi ohne Bühnenbild wurde in Fragmenten, Geschichtsteilen ein Puzzle von zufälligen Begegnungen erzählt, in denen sich Menschen Splitter ihrer Gedanken über die Suche nach Liebe, Lust und der Gier nach Leben austauschen. Dass das Stück ursprünglich auf dem Erfahrungshintergrund der Banlieue von Paris von dem Autor entwickelt wurde, ist eigentlich kaum noch zu merken. Es könnte genauso vor dem Bahnhof Zoo in Berlin oder am Münchner Hauptbahnhof spiel, wo sich Menschen für Sekunden begegnen, aber oft ein Blick oder eine kleine Bemerkung beim Gegenüber die unterschiedlichsten Eindrücke hinterlassen. Der Aufführung folgte ein kleiner Jubiläumsempfang in dem auf die Geschichte des Theaters, vor allem aber auf die zahlreichen Förderer und Unterstützer eingegangen wurde. Eine Spätvorstellung ergänzte dann das Theatererlebnis in besonderer Weise. Parallel zur Ausstrahlung im polnischen Fernsehen wurde an diesem Abend die Deutschlandpremiere des Dokumentarfilms Gliwickie lata Tadeusza Różewica (Gleiwitzer Jahre von Tadeusz Różewicz) der Theaterhistorikerin Maria Dębicz und des Filmemachers Krzysztof Korwin Piotrowski aufgeführt. In beeindruckenden Bildern, die erfreulich wenig von dem heute üblichen hektischen Schnitt zeigen, wird einfühlsam, verbunden mit historischen Aufnahmen, das Leben des bedeutenden polnischen Lyrikers und Dramatikers vor allem der 50er und 60er Jahre geschildert. Als besonders angenehm fiel auf, daß Różewicz in seinen Erzählpassagen nicht Objekt von Film und Regisseur wird, sondern auch seine Kommentare mit in den Film einfließen. Różewicz, mit vielen Preisen geehrt und von Freunden und Kollegen eigentlich längst als Anwärter für den Literaturnobelpreis gesehen, war schon in den 60er Jahren in Westberlin am Schillertheater und fast zur gleichen Zeit in der DDR als Theaterautor entdeckt worden. Der 88jährige plant übrigens für den Sommer 2010 einen Besuch im Teatr Studio in Berlin. 32 POLEN und wir 1-2/2010 POLEN und wir 1-2/
18 POLEN KONFERENZ Ein neues Grab für Kopernikus Frombork feiert 2010 zwei runde Geburtstage Gleich zwei runde Geburtstage feiert die Kleinstadt Frombork (Frauenburg) im Nordosten Polens 2010: den 700. Jahrestag der Stadtgründung und das 750-jährige Bestehen des ermländischen Domkapitels. Mitten in die Jubiläumsfeierlichkeiten fällt das neuerliche Begräbnis des weltberühmten Astronomen Nikolaus Kopernikus, der Jahrzehnte lang im Dom von Frauenburg tätig war. Er erhält dort am 22. Mai 2010 seine letzte Ruhestätte. Nikolaus Kopernikus, der in Polen Mikołaj Kopernik heißt, wurde am 19. Februar 1473 in Toruń (Thorn) geboren und starb am 24. Mai 1543 in Frauenburg. Er war lange Zeit Domherr in Frauenburg und wurde dort auch beigesetzt, seine Grabstätte war aber bis vor Kurzem nicht bekannt. Bei Grabungen im Dom fand man 2005 einen Schädel und Knochen, die Kopernikus zugeordnet wurden. Doch erst drei Jahre später brachten DNA-Untersuchungen Gewissheit. Zum Vergleich dienten Haare, die man in einem Buch des berühmten Gelehrten gefunden hatte. Nun sollen die sterblichen Überreste von Kopernikus am 22. Mai 2010 bei einer feierlichen Zeremonie erneut im Dom beigesetzt werden. Seine letzte Ruhestätte soll er in einem Grabmal aus schwarzem Granit unter einem Altar des Domes finden. Kopernikus war nach dem frühen Tod seiner Eltern in der Obhut seines Onkels, des ermländischen Fürstbischofs Lukas Watzenrode aufgewachsen. Ihm hatte es Kopernikus zu verdanken, dass er nach seinen Studien in Krakau und Bologna eine Stelle beim Domkapitel in Frauenburg erhielt. Kopernikus selbst bezeichnete den kleinen Ort am Frischen Haff einmal als hintersten Winkel der Welt. Hier wirkte er mit kurzen Unterbrechungen fast vier Jahrzehnte lang in der Verwaltung, war nebenbei als Arzt tätig und widmete sich ausgiebig seinen astronomischen Studien. Erstmals vertrat Kopernikus bereits 1509 in kleinem Kreis seine Theorie, dass sich die Erde um die Sonne dreht und dabei auch um die eigene Achse rotiert. Um Gründlichkeit bemüht und von Zweifeln geplagt, veröffentlichte er erst 34 Jahre später diese für die damalige Zeit revolutionäre Theorie in seinem Hauptwerk De Revolutionibus Orbium Coelestium. Die zweite Beerdigung des berühmten Astronomen fällt in die Zeit des 750-jährigen Jubiläums des Domkapitels. Dieses war 1260 in der Nachbarstadt Braniewo (Braunsberg) gegründet und 1284 nach Frauenburg verlegt worden. Hier entstand von 1329 bis 1388 die Kathedrale auf dem Domhügel, die bis heute das Wahrzeichen der Stadt ist. Das Ermland genoss lange Zeit eine weitgehende politische Autonomie. Der Fürstbischof war dort nicht nur das geistige, sondern auch das weltliche Oberhaupt. Das endete erst, als Preußen nach der ersten polnischen Teilung 1772 das Ermland annektierte. Es war darauf hin nur noch eine Diözese, wurde aber 1992 zum Erzbistum erhoben. In Frombork feiert man 2010 auch den 700. Jahrestag der Verleihung der Stadtrechte. Die Hauptfeiern vom 28. bis 30. Mai beginnen mit einer Inszenierung des Einzugs von Kopernikus in der Stadt. Sieben Torten zum 700. Geburtstag werden am 8. Juli auf dem Marktplatz den Bewohnern und Gästen präsentiert. Zu den traditionellen Kulturereignissen gehört der Orgelsommer in der Kathedrale vom 27. Juni bis zum 29. August. Immer sonntags um 14 Uhr treten international bekannte Orgelspieler an der für ihren Klang berühmten Domorgel auf. Die zweite Bernstein-Biennale mit der Ausstellung von Schmuckstücken findet vom 3. bis 28. Juli im Kopernikus-Museum auf dem Domhügel statt. Frombork ist heute eine Kleinstadt mit Einwohnern, die durch ihre Lage am Frischen Haff und am Rande des Landschaftsschutzgebietes der Elbinger Höhen einen hohen Freizeitwert besitzt. Schiffe der Weißen Flotte verkehren von hier nach Elbląg (Elbing) oder in den Ferienort Krynica Morska (Kahlberg) auf der Frischen Nehrung. In Frombork selbst gibt es ein nach Kopernikus benanntes Mittelklassehotel. Größte Attraktion des Ortes ist der Domhügel mit der Kathedrale und dem Kopernikus-Museum. Infos über die Stadt unter und zum Museum auf dem Domhügel unter Auskünfte über Reisen nach Polen erteilt auch das Polnische Fremdenverkehrsamt in Berlin, Neues Denkmal in Częstochowa Erinnerung an ermordete jüdische Einwohner Der polnische Wallfahrtsort Częstochowa (Tschenstochau) erinnert jetzt an seine ermordeten jüdischen Bürger. In unmittelbarer Nähe des berühmten Marienheiligtums, an der Stelle des ehemaligen Umschlagplatzes, von dem aus die SS jüdische Menschen in die KZs verschleppte, wurde jetzt eine Skulptur des polnisch/israelischen Künstlers Samuel Willenberg eingeweiht. Der 1923 in Częstochowa geborene Willenberg war ins Vernichtungslager Treblinka verschleppt worden, wo er bei der Selektion der Deportierten vorgab, Maurer zu sein. So wurde er als Arbeitshäftling registriert, während die restlichen Deportierten seines Transportes sofort in die Gaskammern geschickt wurden. Am 2. August 1943 organisierten Häftlinge des Lagers unter ihnen auch Willenberg den Aufstand von Treblinka, um eine Massenflucht zu ermöglichen. Willenberg gelang es tatsächlich, zu entkommen und erreichte Warschau, wo er bis zu Kriegsende an der Seite einer polnischen Untergrundarmee gegen die Deutschen beim Warschauer Aufstand kämpfte emigrierte er nach Israel wobei er seine polnische Staatsangehörigkeit verlor. In Israel war er 40 Jahre im Entwicklungsministerium tätig. Erst als Pensionist begann er mit seiner künstlerischen Arbeit. Das Kunstwerk des 86-jährigen, dessen Vater als bekannter Synagogenmaler für die Innenausstattung der Tschenstochauer Synagoge verantwortlich zeichnete, zeigt geborstene Mauern, einen aus Schienen geformten Davidstern und Grablichter. Zeitgleich wurde eine neue Gedenktafel aufgestellt. Sie erinnert an die Tschenstochauer Juden, die während der deutschen Okkupation in der Fabrik des deutschen Rüstungskonzerns HASAG (Hugo Schneider AG) Zwangsarbeit leisten mussten. Zuvor befand sich hier, in der Nähe des Hauptbahnhofes, die Textilfabrik des französischen Unternehmens Peltzer et fils. In Tschenstochau lebten bis zum Zweiten Weltkrieg rund Juden. Die meisten von ihnen wurden im Konzentrationslager Majdanek ermordet. Infos: Programm Samstag, 24. April Uhr Eröffnung und Begrüßung: Cornelia Kerth und Prof. Heinrich Fink, Bundesvorsitzende der VVN-BdA 13:30-15:30 Uhr Eine grundlegende Neubewertung der Geschichte Europas im 20. Jh. ist notwendig - Einspruch! Michel Vanderborght, Präsident der FIR: Die Erfahrung des gemeinsamen Kampfes gegen den Faschismus gehört zu den Grundlagen der Europäischen Einigung Judith Demba, Mitarbeiterin Büro MdEP Jürgen Klute: Totalitarismusdoktrin als programmatische Grundlage für Europa? Dr. Thomas Lutz, Gedenkstättenreferat Topographie des Terrors: Der 23. August Thesen zum europäischen Gedenktag für alle Opfer von Diktaturen und Totalitarismen Prof. Wolfgang Wippermann: Faschismus Moderation: Dr. Ulrich Schneider 16:00-18:00 Uhr Wir trauern um alle Opfer, weil wir gerecht gegen alle Völker sein wollen, auch gegen unser eigenes. - Einspruch! Prof. Moshe Zuckermann: Ideologie des Vergleichs Prof. Kurt Pätzold: Erst Instrument - dann Opfer. Von den Ursachen zu den Wirkungen Dr. Holger Politt: Der polnische Blick auf Flucht und Vertreibung Moderation: Prof. Heinrich Fink ab 20 Uhr Konzert Esther, Edna und Joram Bejarano und die Microphone Mafia Sonntag, 25. April :00-11:00 Uhr Von einer verbrecherischen Geschichte der Gebirgstruppen zu sprechen ist historisch falsch - Einspruch! Rosario Bentivegna, ehem. Angehöriger des italienischen antifaschistischen Widerstandes: Widerstand war notwendig. Individuelle Verantwortung, bewaffneter Widerstand und Racheaktionen der Nazis Hannes Heer, Historiker: Die Rolle der Wehrmacht im 2. Weltkrieg: Der Krieg heiligt die Mittel Ulrich Sander, Bundessprecher VVN-BdA: In Tradition von Mittenwald zum Hindukusch Moderation: Cornelia Kerth 11:30-13:30 Uhr... die politische und historische Aufarbeitung diktatorischer Herrschaft in Deutschtand zwischen 1933 und Einspruch! Dr. Detlef Garbe, Direktor KZ-Gedenkstätte Neuengamme: Authentische Orte und Geschichtspolitik Rosel Vadehra-Jonas: KZ-Gedenkstätten sind Erinnerungsorte der Überlebenden Dr. Peter Fischer, Vertreter des Zentralrats der Juden in Gedenkstättenangelegenheiten: Die Position des Zentralrats der Juden zur Gedenkstättenpolitik Silvio Peritore, Zentralrat Deutscher Sinti und Roma: Erinnern, gedenken, Zukunft gestalten Moderation: Dr. Susanne Willems 13:30 Uhr Schlusswort: Adam König, Überlebender der KZs Sachsenhausen, Auschwitz, Buchenwald-Dora. Tagungsort: Kinosaal und Audimax der Humboldt-Universität zu Berlin, Unter den Linden Berlin Information und Anmeldung unter: 34 POLEN und wir 1-2/2010 POLEN und wir 1-2/
19 K 6045 DPAG Pressepost Entgelt bezahlt Verlag Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland c/o Manfred Feustel im Freihof 3, Hünxe Liebe Leserin, lieber Leser Wenn an dieser Stelle kein Versandetiket klebt, sind Sie vielleicht noch kein Abonnent unserer Zeitschrift. Das sollte sich ändern. Für nur 12 Euro pro Jahr erhalten Sie POLEN und wir frei haus. Bestellung an nebenstehende Anschrift. Das Polnisch-Deutsche Bildungswerk GERMANITAS (= lat. Brüderlichkeit) in Rzeszów organisiert TANDEMSPRACHKURS DEUTSCH-POLNISCH für Lehrkräfte und Multiplikator/-innen des Jugendaustauschs Bereits seit 14 Jahren veranstaltet Germanitas deutsch-polnische Sommersprachkurse im Tandemverfahren. Schon das siebte Mal sind unsere Zielgruppe deutsche und polnische Lehrer/-innen und Multiplikator/-innen des Jugend-, Sport- und Kulturaustauschs. Diese Maßnahmen werden vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW) unterstützt. Nachdem in den letzten Jahren Nordpolen (Masuren und Pommern) als Programmort diente, haben wir uns für 2010 entschlossen, das Riesengebirge und dort den Ort Karpacz (Krummhügel) auszuwählen, denn in diesem Jahr soll Schlesien im Zentrum unseres Kultur- und Besichtigungsprogramms stehen. Dies ist eine sehr interessante und naturschöne Region in Polens Südwesten, die zu Bergwanderungen einlädt und mit einem reichhaltigen, kulturgeschichtlichen Angebot aufwartet. TERMIN: ORT: Pension Pegaz, 600 Meter entfernt vom Sessellift auf Schneekoppe, Anschrift, Karpacz, Karkonoska 17 UNTERKUNFT: Pension (2 Gebäude) im oberen Teil des Ortes, auf dem Wanderweg zur Schneekoppe, 2- Bettzimmer mit Bad, TV, Telefon, Konferenzraum, Essraum und Bar, Solarium, Billard, Möglichkeit der Physiotherapie KURSGEBÜHR: ca 450 Euro (abhängig vom Euro-Kurs und vorbehaltlich der Förderung durch das DPJW). IM PREIS INBEGRIFFEN: 80 Std. (à 45 Min.) bei erfahrenen Sprachdozenten, Unterbringung in Zweibettzimmern, VP, Vortrags-, Kultur- und Besichtigungsprogramm TEILNEHMER: Maximal 27 deutsche und 27 polnische Teilnehmende, 6 Lektor/-innen aus Polen und Deutschland, Kursleiterin ist Marta Jakubowicz-Pisarek ANREISE: : Bus ab Jelenia Góra (Hirschberg) Über individuelle Anreisemöglichkeiten wird noch zusätzlich informiert. KULTUR- UND AUSFLUGSPROGRAMM: Wanderungen, zwei Ausflüge ( Auf den Spuren der Burgen, Schlösser, Herrenhäuser im Hirschberger Tal, Jelenia Gora (Hirschberg), Cieplice ((Warmbrunn), Gerhard-Hauptmann Museum, Vorträge über die Kultur und Geschichte Schlesiens Verantwortlich für die Organisation und das Programm ist: Marta Jakubowicz-Pisarek Tel: +48/ , mobil: , marta-pisarek@wp.pl 36
Leseprobe aus: ISBN: Mehr Informationen zum Buch finden Sie auf
 Leseprobe aus: ISBN: 978-3-644-00129-9 Mehr Informationen zum Buch finden Sie auf www.rowohlt.de. Bin ich denn schon rechts? Wie rechts bin ich eigentlich? In Deutschland ist es laut geworden, seit die
Leseprobe aus: ISBN: 978-3-644-00129-9 Mehr Informationen zum Buch finden Sie auf www.rowohlt.de. Bin ich denn schon rechts? Wie rechts bin ich eigentlich? In Deutschland ist es laut geworden, seit die
Wie Angela Merkel Wahl-Kampf macht
 Hier geht es zum Wörter-Buch: https://www.taz.de/!5417537/ Wie Angela Merkel Wahl-Kampf macht Angela Merkel muss endlich sagen, welche Themen ihr bei der Bundestags-Wahl wichtig sind! Dieser Text ist ein
Hier geht es zum Wörter-Buch: https://www.taz.de/!5417537/ Wie Angela Merkel Wahl-Kampf macht Angela Merkel muss endlich sagen, welche Themen ihr bei der Bundestags-Wahl wichtig sind! Dieser Text ist ein
Deutschland Das Politische System. Die Bundesrepublik ist ein freiheitlichdemokratischer
 Deutschland Das Politische System Die Bundesrepublik ist ein freiheitlichdemokratischer Rechtsstaat. 16 Bundesländer Die Bundesrepublik ist ein föderativer Staat, d.h. sie setzt sich aus Länder zusammen.
Deutschland Das Politische System Die Bundesrepublik ist ein freiheitlichdemokratischer Rechtsstaat. 16 Bundesländer Die Bundesrepublik ist ein föderativer Staat, d.h. sie setzt sich aus Länder zusammen.
Informieren und Erinnern: die Euthanasie-Verbrechen und die Tiergarten-Straße 4 in Berlin
 Wörterbuch Manche Wörter sind in diesem Text unterstrichen. Zum Beispiel das Wort Euthanasie. Die unterstrichenen Wörter werden am Ende des Textes in einem Wörterbuch erklärt. 1 Informieren und Erinnern:
Wörterbuch Manche Wörter sind in diesem Text unterstrichen. Zum Beispiel das Wort Euthanasie. Die unterstrichenen Wörter werden am Ende des Textes in einem Wörterbuch erklärt. 1 Informieren und Erinnern:
VORANSICHT. Eine vierte Amtszeit für Angela Merkel? Von Thomas Koch, Bad Grund. Themen:
 IV Politik Beitrag 38 Bundestagswahl 2017 1 von 30 Eine vierte Amtszeit für Angela Merkel? Die Bundestagswahl 2017 Von Thomas Koch, Bad Grund Themen: Wird es eine vierte Amtszeit für Angela Merkel geben?
IV Politik Beitrag 38 Bundestagswahl 2017 1 von 30 Eine vierte Amtszeit für Angela Merkel? Die Bundestagswahl 2017 Von Thomas Koch, Bad Grund Themen: Wird es eine vierte Amtszeit für Angela Merkel geben?
Der Deutsche Bundestag
 Der Deutsche Bundestag Hier kannst Du viel über den Deutschen Bundestag erfahren. Unten siehst du Stichpunkte. Diese Stichpunkte kannst du nach der Reihe anklicken. Probier es einfach aus. 1 In Deutschland
Der Deutsche Bundestag Hier kannst Du viel über den Deutschen Bundestag erfahren. Unten siehst du Stichpunkte. Diese Stichpunkte kannst du nach der Reihe anklicken. Probier es einfach aus. 1 In Deutschland
Presseberichte. zur Umbenennung der Eduard-Spranger-Schule. in Frankfurt/M
 Presseberichte zur Umbenennung der Eduard-Spranger-Schule in Frankfurt/M JUNI 2017 FR, 7. Juni 2017 http://www.rheinpfalz.de/lokal/landau/artikel/landau-namensgeber-fuer-schule-war-antisemit/ Mittwoch,
Presseberichte zur Umbenennung der Eduard-Spranger-Schule in Frankfurt/M JUNI 2017 FR, 7. Juni 2017 http://www.rheinpfalz.de/lokal/landau/artikel/landau-namensgeber-fuer-schule-war-antisemit/ Mittwoch,
Entschließung des Bundesrates zur Erklärung des 8. Mai als Tag der Befreiung zum nationalen Gedenktag
 Bundesrat Drucksache 420/10 07.07.10 Antrag des Landes Berlin In Entschließung des Bundesrates zur Erklärung des 8. Mai als Tag der Befreiung zum nationalen Gedenktag Der Regierende Bürgermeister von Berlin
Bundesrat Drucksache 420/10 07.07.10 Antrag des Landes Berlin In Entschließung des Bundesrates zur Erklärung des 8. Mai als Tag der Befreiung zum nationalen Gedenktag Der Regierende Bürgermeister von Berlin
Grußwort. von. Hartmut Koschyk MdB Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten
 Grußwort von Hartmut Koschyk MdB Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten anlässlich der 18. Hauptversammlung der Domowina am 25. März 2017 in Hoyerswerda Ich danke
Grußwort von Hartmut Koschyk MdB Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten anlässlich der 18. Hauptversammlung der Domowina am 25. März 2017 in Hoyerswerda Ich danke
willkommen im landtag Leichte Sprache
 willkommen im landtag Leichte Sprache Inhalt Vorwort 3 1. Das Land 4 2. Der Land tag 5 3. Die Wahlen 6 4. Was für Menschen sind im Land tag? 7 5. Wieviel verdienen die Abgeordneten? 7 6. Welche Parteien
willkommen im landtag Leichte Sprache Inhalt Vorwort 3 1. Das Land 4 2. Der Land tag 5 3. Die Wahlen 6 4. Was für Menschen sind im Land tag? 7 5. Wieviel verdienen die Abgeordneten? 7 6. Welche Parteien
Der Bayerische. Land-Tag. in leichter Sprache
 Der Bayerische Land-Tag in leichter Sprache Seite Inhalt 2 Begrüßung 1. 4 Der Bayerische Land-Tag 2. 6 Die Land-Tags-Wahl 3. 8 Parteien im Land-Tag 4. 10 Die Arbeit der Abgeordneten im Land-Tag 5. 12 Abgeordnete
Der Bayerische Land-Tag in leichter Sprache Seite Inhalt 2 Begrüßung 1. 4 Der Bayerische Land-Tag 2. 6 Die Land-Tags-Wahl 3. 8 Parteien im Land-Tag 4. 10 Die Arbeit der Abgeordneten im Land-Tag 5. 12 Abgeordnete
über das Maß der Pflicht hinaus die Kräfte dem Vaterland zu widmen.
 Sperrfrist: 16. November 2014, 13.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der
Sperrfrist: 16. November 2014, 13.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der
DOWNLOAD VORSCHAU. Kleines Politiklexikon. zur Vollversion. Politik ganz einfach und klar. Sebastian Barsch. Downloadauszug aus dem Originaltitel:
 DOWNLOAD Sebastian Barsch Kleines Politiklexikon Politik ganz einfach und klar Bergedorfer Unterrichtsideen Sebastian Barsch Downloadauszug aus dem Originaltitel: Politik ganz einfach und klar: Wahlen
DOWNLOAD Sebastian Barsch Kleines Politiklexikon Politik ganz einfach und klar Bergedorfer Unterrichtsideen Sebastian Barsch Downloadauszug aus dem Originaltitel: Politik ganz einfach und klar: Wahlen
Deutsch-polnische Beziehungen *
 Deutsch-polnische Beziehungen * 1939-1945 - 1949 Eine Einführung Herausgegeben von Wlodzimierz Borodziej und Klaus Ziemer A2001 3461 fibre Inhalt Einleitung (WLODZIMIERZ BORODZIEJ/KLAUS ZIEMER) 9 1. Die
Deutsch-polnische Beziehungen * 1939-1945 - 1949 Eine Einführung Herausgegeben von Wlodzimierz Borodziej und Klaus Ziemer A2001 3461 fibre Inhalt Einleitung (WLODZIMIERZ BORODZIEJ/KLAUS ZIEMER) 9 1. Die
Hören wir doch mal einem Gespräch zwischen einem Joschka-Fan und einem Fischer- Gegner zu 1 :
 Wenn die Deutschen gefragt werden, welchen ihrer Politiker sie am sympathischsten finden, steht sein Name immer noch ganz weit oben: Joschka Fischer. Bundesbildstelle Es gibt aber auch viele Leute, die
Wenn die Deutschen gefragt werden, welchen ihrer Politiker sie am sympathischsten finden, steht sein Name immer noch ganz weit oben: Joschka Fischer. Bundesbildstelle Es gibt aber auch viele Leute, die
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Holocaust-Gedenktag - Erinnerung an die Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau (27. Januar 1945) Das komplette Material finden Sie hier:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Holocaust-Gedenktag - Erinnerung an die Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau (27. Januar 1945) Das komplette Material finden Sie hier:
70 Jahre danach. Wie die Polen die deutsch-polnischen Beziehungen. und die deutsche Europapolitik beurteilen
 70 Jahre danach Wie die Polen die deutsch-polnischen Beziehungen und die deutsche Europapolitik beurteilen Forschungsbericht Am 1.September gedenken wir des 70. Jahrestages des Aufbruchs des Zweiten Weltkrieges.
70 Jahre danach Wie die Polen die deutsch-polnischen Beziehungen und die deutsche Europapolitik beurteilen Forschungsbericht Am 1.September gedenken wir des 70. Jahrestages des Aufbruchs des Zweiten Weltkrieges.
Gedenkveranstaltung am Lagerfriedhof Sandbostel
 Gedenkveranstaltung am 29. 4. 2017 Lagerfriedhof Sandbostel - Begrüßung zunächst möchte ich mich bei der Stiftung Lager Sandbostel bedanken, dass ich heute anlässlich des72. Jahrestages der Befreiung des
Gedenkveranstaltung am 29. 4. 2017 Lagerfriedhof Sandbostel - Begrüßung zunächst möchte ich mich bei der Stiftung Lager Sandbostel bedanken, dass ich heute anlässlich des72. Jahrestages der Befreiung des
Ist das Amt des Bundespräsidenten entbehrlich?
 Politik Sascha Jakobus Ist das Amt des Bundespräsidenten entbehrlich? Studienarbeit 1 Einleitung Meine Äußerungen zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr am 22. Mai dieses Jahres, sind auf heftige Kritik
Politik Sascha Jakobus Ist das Amt des Bundespräsidenten entbehrlich? Studienarbeit 1 Einleitung Meine Äußerungen zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr am 22. Mai dieses Jahres, sind auf heftige Kritik
Rede zur Bewerbung um die Kandidatur zum 16. Deutschen Bundestag im Wahlkreis 292 (Ulm/Alb-Donau-Kreis) bei der Mitgliederversammlung am 18.
 Annette Schavan Rede zur Bewerbung um die Kandidatur zum 16. Deutschen Bundestag im Wahlkreis 292 (Ulm/Alb-Donau-Kreis) bei der Mitgliederversammlung am 18. Juni 2005 I. Politik braucht Vertrauen. Ich
Annette Schavan Rede zur Bewerbung um die Kandidatur zum 16. Deutschen Bundestag im Wahlkreis 292 (Ulm/Alb-Donau-Kreis) bei der Mitgliederversammlung am 18. Juni 2005 I. Politik braucht Vertrauen. Ich
Ausflug zur Gedenkstätte für die ermordeten Juden Europas
 Ausflug zur Gedenkstätte für die ermordeten Juden Europas Wir als Profil Politik haben am 22.09.2016-23.09.2016 eine Projektfahrt nach Berlin gemacht. Im Rahmen der Kursfahrt haben wir die Gedenkstätte
Ausflug zur Gedenkstätte für die ermordeten Juden Europas Wir als Profil Politik haben am 22.09.2016-23.09.2016 eine Projektfahrt nach Berlin gemacht. Im Rahmen der Kursfahrt haben wir die Gedenkstätte
Ausführungen von Gert Hager, Oberbürgermeister der Stadt Pforzheim, anlässlich der Gedenkfeier am auf dem Hauptfriedhof
 Dezernat I Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Rats- und Europaangelegenheiten Pressereferent Tel: 07231-39 1425 Fax: 07231-39-2303 presse@stadt-pforzheim.de ES GILT DAS GESPROCHENE WORT Ausführungen von Gert
Dezernat I Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Rats- und Europaangelegenheiten Pressereferent Tel: 07231-39 1425 Fax: 07231-39-2303 presse@stadt-pforzheim.de ES GILT DAS GESPROCHENE WORT Ausführungen von Gert
Hashtags aus dem Bundestag
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Twitter 07.11.2016 Lesezeit 3 Min Hashtags aus dem Bundestag Barack Obama und Wladimir Putin tun es, ebenso François Hollande und Hillary Clinton:
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Twitter 07.11.2016 Lesezeit 3 Min Hashtags aus dem Bundestag Barack Obama und Wladimir Putin tun es, ebenso François Hollande und Hillary Clinton:
Das politische System der Bundesrepublik Deutschland
 1 Schwarz: UE Politisches System / Rikkyo University 2014 Das politische System der Bundesrepublik Deutschland Lesen Sie den Text auf der folgenden Seite und ergänzen Sie das Diagramm! 2 Schwarz: UE Politisches
1 Schwarz: UE Politisches System / Rikkyo University 2014 Das politische System der Bundesrepublik Deutschland Lesen Sie den Text auf der folgenden Seite und ergänzen Sie das Diagramm! 2 Schwarz: UE Politisches
Volkstrauertag ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert oder notwendiger denn je?
 Volkstrauertag ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert oder notwendiger denn je? Zugegeben: Die Überschrift ist provokativ. Das will sie bewusst sein, denn um den Begriff Volkstrauertag auch noch heute
Volkstrauertag ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert oder notwendiger denn je? Zugegeben: Die Überschrift ist provokativ. Das will sie bewusst sein, denn um den Begriff Volkstrauertag auch noch heute
Synopse zum Pflichtmodul Nationalstaatsbildung im Vergleich. Buchners Kolleg Geschichte Ausgabe Niedersachsen Abitur 2018 (ISBN )
 Synopse zum Pflichtmodul Nationalstaatsbildung im Vergleich Buchners Kolleg Geschichte Ausgabe Niedersachsen Abitur 2018 (ISBN 978-3-661-32017-5) C.C.Buchner Verlag GmbH & Co. KG Telefon +49 951 16098-200
Synopse zum Pflichtmodul Nationalstaatsbildung im Vergleich Buchners Kolleg Geschichte Ausgabe Niedersachsen Abitur 2018 (ISBN 978-3-661-32017-5) C.C.Buchner Verlag GmbH & Co. KG Telefon +49 951 16098-200
DIE FOLGEN DES ERSTEN WELTKRIEGES Im Jahr 1918 verlieren die Deutschen den Ersten Weltkrieg und die Siegermächte GROßBRITANNIEN, FRANKREICH und die
 DIE FOLGEN DES ERSTEN WELTKRIEGES Im Jahr 1918 verlieren die Deutschen den Ersten Weltkrieg und die Siegermächte GROßBRITANNIEN, FRANKREICH und die USA besetzten Deutschland. Deutschland bekommt im VETRAG
DIE FOLGEN DES ERSTEN WELTKRIEGES Im Jahr 1918 verlieren die Deutschen den Ersten Weltkrieg und die Siegermächte GROßBRITANNIEN, FRANKREICH und die USA besetzten Deutschland. Deutschland bekommt im VETRAG
Ansprache bei der Veranstaltung der Gemeinschaft Sant Egidio zum Gedenken an die Deportation der Juden aus Würzburg am 28.
 1 Ansprache bei der Veranstaltung der Gemeinschaft Sant Egidio zum Gedenken an die Deportation der Juden aus Würzburg am 28. November 2016 Begrüßung, namentlich - Dr. Josef Schuster, Vorsitzender des Zentralrats
1 Ansprache bei der Veranstaltung der Gemeinschaft Sant Egidio zum Gedenken an die Deportation der Juden aus Würzburg am 28. November 2016 Begrüßung, namentlich - Dr. Josef Schuster, Vorsitzender des Zentralrats
6.9 Zusammensetzung der Bundeskabinette Strukturdaten. Zahl der Regierungsmitglieder und der Abgeordneten im Vergleich
 DHB Kapitel 6.9 Zusammensetzung der Bundeskabinette Strukturdaten 12.03.2014 6.9 Zusammensetzung der Bundeskabinette Strukturdaten Stand: 10.2.2014 und der Abgeordneten im Vergleich 215 Personen würde
DHB Kapitel 6.9 Zusammensetzung der Bundeskabinette Strukturdaten 12.03.2014 6.9 Zusammensetzung der Bundeskabinette Strukturdaten Stand: 10.2.2014 und der Abgeordneten im Vergleich 215 Personen würde
ARD-DeutschlandTREND: August 2012 Untersuchungsanlage
 Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Stichprobe: Autor: Redaktion WDR: Wissenschaftliche Betreuung und Durchführung: Erhebungsverfahren: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren Repräsentative
Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Stichprobe: Autor: Redaktion WDR: Wissenschaftliche Betreuung und Durchführung: Erhebungsverfahren: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren Repräsentative
der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei
 der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei einer um am sind noch wie einem über einen so zum war haben nur oder
der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei einer um am sind noch wie einem über einen so zum war haben nur oder
die Jugendlichen aus Belgien und Deutschland, die ihr diese Gedenkfeier heute mitgestaltet.
 Gedenkrede Elke Twesten MdL Vorstandsmitglied des Volksbundes in Niedersachsen anlässlich des Volkstrauertages auf der Deutschen Kriegsgräberstätte Lommel (Belgien) Sonntag 17.11.2013 Sehr geehrte Exzellenzen,
Gedenkrede Elke Twesten MdL Vorstandsmitglied des Volksbundes in Niedersachsen anlässlich des Volkstrauertages auf der Deutschen Kriegsgräberstätte Lommel (Belgien) Sonntag 17.11.2013 Sehr geehrte Exzellenzen,
Denkmal für die ermordeten Oldersumer Juden
 Klaus Euhausen Waldrandsiedlung 28 16761 Hennigsdorf Tel. / Fax: 03302-801178 E-Mail: euhausen@aol.com DOKUMENTATION Denkmal für die ermordeten Oldersumer Juden Klaus Euhausen Wrangelstraße 66 10 997 Berlin
Klaus Euhausen Waldrandsiedlung 28 16761 Hennigsdorf Tel. / Fax: 03302-801178 E-Mail: euhausen@aol.com DOKUMENTATION Denkmal für die ermordeten Oldersumer Juden Klaus Euhausen Wrangelstraße 66 10 997 Berlin
Anmerkungen zum EU-Vertrag von Lissabon
 EUROPÄISCHES PARLAMENT RUTH HIERONYMI MITGLIED DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 01.08.2008 Anmerkungen zum EU-Vertrag von Lissabon I. Grundlagen des europäischen Einigungsprozesses aus deutscher Sicht 1. Die
EUROPÄISCHES PARLAMENT RUTH HIERONYMI MITGLIED DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 01.08.2008 Anmerkungen zum EU-Vertrag von Lissabon I. Grundlagen des europäischen Einigungsprozesses aus deutscher Sicht 1. Die
Und deshalb erinnere ich hier und heute wie im vergangenen Jahr zum Volkstrauertag an die tägliche Trauer hunderttausender Mütter, Väter und Kinder.
 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger Volkstrauertag im November 2010 wir verstehen heute den Volkstrauertag, wie das Wort sagt als einen Tag der Trauer auch mit zunehmendem Abstand vom Krieg Eigentlich müßte
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger Volkstrauertag im November 2010 wir verstehen heute den Volkstrauertag, wie das Wort sagt als einen Tag der Trauer auch mit zunehmendem Abstand vom Krieg Eigentlich müßte
Interview der Botschafterin für A1 TV aus Anlass des 60. Jahrestages der Verabschiedung des Grundgesetzes
 Interview der Botschafterin für A1 TV aus Anlass des 60. Jahrestages der Verabschiedung des Grundgesetzes (ausgestrahlt am 23. Mai 2009) 1. Deutschland feiert heute 60 Jahre Grundgesetz. Was bedeutet das
Interview der Botschafterin für A1 TV aus Anlass des 60. Jahrestages der Verabschiedung des Grundgesetzes (ausgestrahlt am 23. Mai 2009) 1. Deutschland feiert heute 60 Jahre Grundgesetz. Was bedeutet das
Das Schicksal der Juden in Polen: Vernichtung und Hilfe
 Das Schicksal der Juden in Polen: Vernichtung und Hilfe Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs lebten rund 3,3 Millionen Juden in Polen. Nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939
Das Schicksal der Juden in Polen: Vernichtung und Hilfe Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs lebten rund 3,3 Millionen Juden in Polen. Nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939
ARD-DeutschlandTREND: August ARD- DeutschlandTREND August 2013 Eine Studie im Auftrag der tagesthemen
 ARD- DeutschlandTREND August 2013 Eine Studie im Auftrag der tagesthemen Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual
ARD- DeutschlandTREND August 2013 Eine Studie im Auftrag der tagesthemen Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual
Schautafel-Inhalte der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Bremen zur Nakba-Ausstellung
 Schautafel-Inhalte der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Bremen zur Nakba-Ausstellung Die Nakba-Ausstellung will das Schicksal und das Leid der palästinensischen Bevölkerung dokumentieren. Wer ein Ende
Schautafel-Inhalte der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Bremen zur Nakba-Ausstellung Die Nakba-Ausstellung will das Schicksal und das Leid der palästinensischen Bevölkerung dokumentieren. Wer ein Ende
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Richard von Weizsäcker - "Zum 40. Jahrestag der Beendigung Gewaltherrschaft" (8.5.1985 im Bundestag in Bonn) Das komplette Material
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Richard von Weizsäcker - "Zum 40. Jahrestag der Beendigung Gewaltherrschaft" (8.5.1985 im Bundestag in Bonn) Das komplette Material
Es gilt das gesprochene Wort
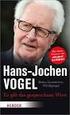 Es gilt das gesprochene Wort Grußwort von Oberbürgermeister Dr. Siegfried Balleis anlässlich des nationalen Gedenktages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27.1.2005, 19.30 Uhr, Hugenottenkirche
Es gilt das gesprochene Wort Grußwort von Oberbürgermeister Dr. Siegfried Balleis anlässlich des nationalen Gedenktages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27.1.2005, 19.30 Uhr, Hugenottenkirche
1918, 1938, 2008: Geschichte im Spiegel der Forschungsergebnisse von GfK Austria. Mag. Svila Tributsch und Univ.-Doz. Dr. Peter A.
 1918, 1938, 2008: Geschichte im Spiegel der Forschungsergebnisse von GfK Austria Mag. Svila Tributsch und Univ.-Doz. Dr. Peter A. Ulram GfK Austria Politikforschung Wien, den 29. Februar 2008 Zentrale
1918, 1938, 2008: Geschichte im Spiegel der Forschungsergebnisse von GfK Austria Mag. Svila Tributsch und Univ.-Doz. Dr. Peter A. Ulram GfK Austria Politikforschung Wien, den 29. Februar 2008 Zentrale
ARD-DeutschlandTREND: Oktober 2012 Untersuchungsanlage
 Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Stichprobe: Autor: Redaktion WDR: Wissenschaftliche Betreuung und Durchführung: Erhebungsverfahren: Fallzahl: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren
Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Stichprobe: Autor: Redaktion WDR: Wissenschaftliche Betreuung und Durchführung: Erhebungsverfahren: Fallzahl: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren
ARD-DeutschlandTREND: Januar ARD- DeutschlandTREND Januar 2013 Eine Studie im Auftrag der tagesthemen
 ARD- DeutschlandTREND Januar 2013 Eine Studie im Auftrag der tagesthemen Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Stichprobe: Autor: Redaktion WDR: Wissenschaftliche Betreuung und Durchführung: Erhebungsverfahren:
ARD- DeutschlandTREND Januar 2013 Eine Studie im Auftrag der tagesthemen Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Stichprobe: Autor: Redaktion WDR: Wissenschaftliche Betreuung und Durchführung: Erhebungsverfahren:
Lange Zeit war Bonn kein gutes Pflaster für Sozialdemokraten.
 Vollversammlung Landtagskandidaten Seite 1 Begrüßung Lange Zeit war Bonn kein gutes Pflaster für Sozialdemokraten. Mehr als eine Generation musste darum kämpfen, dass wir zunächst wenigstens zweistellige
Vollversammlung Landtagskandidaten Seite 1 Begrüßung Lange Zeit war Bonn kein gutes Pflaster für Sozialdemokraten. Mehr als eine Generation musste darum kämpfen, dass wir zunächst wenigstens zweistellige
ARD-DeutschlandTREND: Februar 2012 Untersuchungsanlage
 Februar 2012 Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Stichprobe: Autor: Redaktion WDR: Wissenschaftliche Betreuung und Durchführung: Erhebungsverfahren: Fallzahl: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland
Februar 2012 Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Stichprobe: Autor: Redaktion WDR: Wissenschaftliche Betreuung und Durchführung: Erhebungsverfahren: Fallzahl: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland
Gut für alle. Gerecht für alle. Frieden für alle.
 Die Leichte Sprache wurde geprüft von Menschen mit Lern-Schwierigkeiten Für diese Zukunft kämpfen wir: Gut für alle. Gerecht für alle. Frieden für alle. Wahl-Programm von der Partei DIE LINKE zur Bundestags-Wahl
Die Leichte Sprache wurde geprüft von Menschen mit Lern-Schwierigkeiten Für diese Zukunft kämpfen wir: Gut für alle. Gerecht für alle. Frieden für alle. Wahl-Programm von der Partei DIE LINKE zur Bundestags-Wahl
Frauen global. Das außenpolit ische J o ur n al
 Nr. 125 März 2017 Das außenpolit ische J o ur n al Frauen global Frauen übernehmen Macht Proteste in Polen Journalistinnen weltweit Gleichstellung in Ostasien Konservatismus in Russland WeltBlick Wechsel
Nr. 125 März 2017 Das außenpolit ische J o ur n al Frauen global Frauen übernehmen Macht Proteste in Polen Journalistinnen weltweit Gleichstellung in Ostasien Konservatismus in Russland WeltBlick Wechsel
Politisches System der Bundesrepublik Deutschland
 Inhalt und Konzept 1. Woraus setzt sich die Regierung zusammen? 2. Bundesrat, Bundestag, Präsident und Kanzlerin 3. Wahlsystem 4. Demokratie + Föderalismus 5. Die im Bundestag vertretenen Parteien 6. Legislative,
Inhalt und Konzept 1. Woraus setzt sich die Regierung zusammen? 2. Bundesrat, Bundestag, Präsident und Kanzlerin 3. Wahlsystem 4. Demokratie + Föderalismus 5. Die im Bundestag vertretenen Parteien 6. Legislative,
Wer hat denn jetzt das Sagen? Grundwissen Regieren in der Bundesrepublik VORANSICHT
 Grundwissen Regieren in D 1 von 20 Wer hat denn jetzt das Sagen? Grundwissen Regieren in der Bundesrepublik Ein Beitrag nach Ideen von Dr. Christine Koch-Hallas, Mannheim und Stefan Dassler, Bamberg Illustrationen
Grundwissen Regieren in D 1 von 20 Wer hat denn jetzt das Sagen? Grundwissen Regieren in der Bundesrepublik Ein Beitrag nach Ideen von Dr. Christine Koch-Hallas, Mannheim und Stefan Dassler, Bamberg Illustrationen
Die Vertreibung der Sudetendeutschen
 Geschichte Daniela Hendel Die Vertreibung der Sudetendeutschen Studienarbeit 1 Inhaltsverzeichnis Einführung 2-4 1. Vorgeschichte bis zum 2. Weltkrieg 1.1. Der tschechoslowakische Staat und die Sudetendeutschen
Geschichte Daniela Hendel Die Vertreibung der Sudetendeutschen Studienarbeit 1 Inhaltsverzeichnis Einführung 2-4 1. Vorgeschichte bis zum 2. Weltkrieg 1.1. Der tschechoslowakische Staat und die Sudetendeutschen
IM GARTEN DER POLITIK
 Dienstag, 18. Oktober 2016 IM GARTEN DER POLITIK Hallo, wir sind die Floristenklasse der 2. AF von der Berufsschule Gartenbau & Floristik. Heute bekamen wir einen kleinen Einblick in die Politik und ihre
Dienstag, 18. Oktober 2016 IM GARTEN DER POLITIK Hallo, wir sind die Floristenklasse der 2. AF von der Berufsschule Gartenbau & Floristik. Heute bekamen wir einen kleinen Einblick in die Politik und ihre
6215/J XXIV. GP. Dieser Text ist elektronisch textinterpretiert. Abweichungen vom Original sind möglich. ANFRAGE
 6215/J XXIV. GP - Anfrage 1 von 6 6215/J XXIV. GP Eingelangt am 09.07.2010 ANFRAGE der Abgeordneten Kitzmüller und weiterer Abgeordneten an den Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten
6215/J XXIV. GP - Anfrage 1 von 6 6215/J XXIV. GP Eingelangt am 09.07.2010 ANFRAGE der Abgeordneten Kitzmüller und weiterer Abgeordneten an den Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten
Eröffnung der Ausstellung Wissenschaft Planung Vertreibung: Der Generalplan Ost der Nationalsozialisten
 = Rede Eröffnung der Ausstellung Wissenschaft Planung Vertreibung: Der Generalplan Ost der Nationalsozialisten Prof. Dr.-Ing. Matthias Kleiner Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft Warschau 17.
= Rede Eröffnung der Ausstellung Wissenschaft Planung Vertreibung: Der Generalplan Ost der Nationalsozialisten Prof. Dr.-Ing. Matthias Kleiner Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft Warschau 17.
Inhaltsverzeichnis. Der Kritiker der Deutschen Erinnerungen an Marcel Reich-Ranicki
 Inhaltsverzeichnis Vorwort Liebe Leserinnen und Leser Der Kritiker der Deutschen Erinnerungen an Marcel Reich-Ranicki Die Liebe ist das zentrale Thema Zitate aus den SPIEGEL-Gesprächen mit Marcel Reich-Ranicki
Inhaltsverzeichnis Vorwort Liebe Leserinnen und Leser Der Kritiker der Deutschen Erinnerungen an Marcel Reich-Ranicki Die Liebe ist das zentrale Thema Zitate aus den SPIEGEL-Gesprächen mit Marcel Reich-Ranicki
BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG
 BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG Nr. 96-2 vom 23. September 2008 Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel beim Fundraising Dinner zugunsten des Denkmals für die ermordeten Juden Europas am 23. September
BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG Nr. 96-2 vom 23. September 2008 Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel beim Fundraising Dinner zugunsten des Denkmals für die ermordeten Juden Europas am 23. September
Vom Alliierten zum Gefangenen Das Schicksal Italienischer Militärinternierter Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, Berlin Schöneweide,
 1 Vom Alliierten zum Gefangenen Das Schicksal Italienischer Militärinternierter Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, Berlin Schöneweide, 12.09.2013 Grußwort Günter Saathoff, Vorstand der Stiftung EVZ
1 Vom Alliierten zum Gefangenen Das Schicksal Italienischer Militärinternierter Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, Berlin Schöneweide, 12.09.2013 Grußwort Günter Saathoff, Vorstand der Stiftung EVZ
Faire Perspektiven für die europäische Jugend sichern den sozialen Frieden in Europa Herausforderung auch für das DFJW
 Seite 0 Faire Perspektiven für die europäische Jugend sichern den sozialen Frieden in Europa Herausforderung auch für das DFJW Rede Bundesministerin Dr. Kristina Schröder anlässlich der Eröffnung des Festaktes
Seite 0 Faire Perspektiven für die europäische Jugend sichern den sozialen Frieden in Europa Herausforderung auch für das DFJW Rede Bundesministerin Dr. Kristina Schröder anlässlich der Eröffnung des Festaktes
Macht mehr möglich. Der Grüne Zukunfts-Plan für Nordrhein-Westfalen. Das Wahl-Programm von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
 Macht mehr möglich Der Grüne Zukunfts-Plan für Nordrhein-Westfalen Das Wahl-Programm von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN für die Land-Tags-Wahl 2010 in Nordrhein-Westfalen in leichter Sprache Warum Leichte Sprache?
Macht mehr möglich Der Grüne Zukunfts-Plan für Nordrhein-Westfalen Das Wahl-Programm von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN für die Land-Tags-Wahl 2010 in Nordrhein-Westfalen in leichter Sprache Warum Leichte Sprache?
Diese Sachen will DIE LINKE machen! Damit die Zukunft für alle Menschen besser wird
 Diese Sachen will DIE LINKE machen! Damit die Zukunft für alle Menschen besser wird In allen Betrieben wird heute mit Computern gearbeitet. Und es gibt viel neue Technik in den Betrieben. Maschinen, die
Diese Sachen will DIE LINKE machen! Damit die Zukunft für alle Menschen besser wird In allen Betrieben wird heute mit Computern gearbeitet. Und es gibt viel neue Technik in den Betrieben. Maschinen, die
Aufbau einer Rede. 3. Zweite Rede eröffnende Regierung - (gegebenenfalls Erläuterung zum Antrag) - Rebuttal - Weitere Pro-Argumente erklären
 Aufbau einer Rede 1. Erste Rede eröffnende Regierung - Wofür steht unser Team? - Erklärung Status Quo (Ist-Zustand) - Erklärung des Ziels (Soll-Zustand) - Antrag erklären (Was möchten wir mit welchen Ausnahmen
Aufbau einer Rede 1. Erste Rede eröffnende Regierung - Wofür steht unser Team? - Erklärung Status Quo (Ist-Zustand) - Erklärung des Ziels (Soll-Zustand) - Antrag erklären (Was möchten wir mit welchen Ausnahmen
ARD-DeutschlandTREND: April 2011 Untersuchungsanlage
 April 2011 Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Stichprobe: Autor: Redaktion WDR: Wissenschaftliche Betreuung und Durchführung: Erhebungsverfahren: Fallzahlen: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland
April 2011 Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Stichprobe: Autor: Redaktion WDR: Wissenschaftliche Betreuung und Durchführung: Erhebungsverfahren: Fallzahlen: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland
Stellungnahme zu den Anträgen auf symbolische Entschädigung noch lebender sowjetischer
 Stellungnahme zu den Anträgen auf symbolische Entschädigung noch lebender sowjetischer Kriegsgefangener von Professor Dr. Dres. h.c. Jochen A. Frowein Ich bin gebeten worden, zu den Vorschlägen auf eine
Stellungnahme zu den Anträgen auf symbolische Entschädigung noch lebender sowjetischer Kriegsgefangener von Professor Dr. Dres. h.c. Jochen A. Frowein Ich bin gebeten worden, zu den Vorschlägen auf eine
Dankesworte von. Hartmut Koschyk MdB Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten
 Dankesworte von Hartmut Koschyk MdB Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten anlässlich der Entgegennahme des Menschrechtspreises der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Dankesworte von Hartmut Koschyk MdB Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten anlässlich der Entgegennahme des Menschrechtspreises der Sudetendeutschen Landsmannschaft
ARD-DeutschlandTREND: Mai 2010 Untersuchungsanlage
 Mai 2010 Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Randomstichprobe Erhebungsverfahren: Computergestützte Telefoninterviews
Mai 2010 Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Randomstichprobe Erhebungsverfahren: Computergestützte Telefoninterviews
Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderungen. Wahlbroschüre Hessen. Einfach wählen
 Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderungen Wahlbroschüre Hessen Einfach wählen Wahlbroschüre Hessen Einfach wählen Impressum Herausgeber Redaktion Fotos Gestaltung Druck Text Seite
Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderungen Wahlbroschüre Hessen Einfach wählen Wahlbroschüre Hessen Einfach wählen Impressum Herausgeber Redaktion Fotos Gestaltung Druck Text Seite
Rede anlässlich der Gedenkfeier zum 50. Jahrestag der Ungarischen Revolution Budapest, 22. Oktober 2006
 Rede anlässlich der Gedenkfeier zum 50. Jahrestag der Ungarischen Revolution Budapest, 22. Oktober 2006 Sehr geehrte Damen und Herren! Ich danke Ihnen, Herr Staatspräsident, aufrichtig für die ehrenvolle
Rede anlässlich der Gedenkfeier zum 50. Jahrestag der Ungarischen Revolution Budapest, 22. Oktober 2006 Sehr geehrte Damen und Herren! Ich danke Ihnen, Herr Staatspräsident, aufrichtig für die ehrenvolle
VORANSICHT. Das Bundespräsidentenamt was macht eigentlich das Staatsoberhaupt? Von Dr. Anja Joest, Bergisch Gladbach. Themen:
 IV Politik Beitrag 39 Bundespräsidentenamt 1 von 26 Das Bundespräsidentenamt was macht eigentlich das Staatsoberhaupt? Von Dr. Anja Joest, Bergisch Gladbach Der aktuelle Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
IV Politik Beitrag 39 Bundespräsidentenamt 1 von 26 Das Bundespräsidentenamt was macht eigentlich das Staatsoberhaupt? Von Dr. Anja Joest, Bergisch Gladbach Der aktuelle Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
Die deutsch-polnischen Beziehungen bis Polnisch / Förderung des Erlernens kleiner europäischer Sprachen
 Die deutsch-polnischen Beziehungen bis 1990 Belastungen für die deutsch-polnischen Beziehungen Belastet werden die deutsch-polnischen Beziehungen nach dem zweiten Weltkrieg durch: 200 Jahre preußische
Die deutsch-polnischen Beziehungen bis 1990 Belastungen für die deutsch-polnischen Beziehungen Belastet werden die deutsch-polnischen Beziehungen nach dem zweiten Weltkrieg durch: 200 Jahre preußische
Vorlage zur Kenntnisnahme
 Drucksache 16/3394 30.07.2010 16. Wahlperiode Vorlage zur Kenntnisnahme Erklärung des 8. Mai als Tag der Befreiung zum nationalen Gedenktag Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses können über die Internetseite
Drucksache 16/3394 30.07.2010 16. Wahlperiode Vorlage zur Kenntnisnahme Erklärung des 8. Mai als Tag der Befreiung zum nationalen Gedenktag Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses können über die Internetseite
Aktive Leserlenkung in "Jeder stirbt für sich allein" (Hans Fallada)
 Germanistik Gabriela Augustin Aktive Leserlenkung in "Jeder stirbt für sich allein" (Hans Fallada) Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung Seite 1 2. Leserlenkung von Anfang an Seite 2 3. Die Helden
Germanistik Gabriela Augustin Aktive Leserlenkung in "Jeder stirbt für sich allein" (Hans Fallada) Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung Seite 1 2. Leserlenkung von Anfang an Seite 2 3. Die Helden
Wahlalter und Politikverständnis
 Wahlalter und Politikverständnis Sind 18 Jahre wirklich die magische Grenze für das Verstehen von Politik? Jan Kercher Universität Hohenheim Frage: Bestehen signifikante Unterschiede zwischen heutigen
Wahlalter und Politikverständnis Sind 18 Jahre wirklich die magische Grenze für das Verstehen von Politik? Jan Kercher Universität Hohenheim Frage: Bestehen signifikante Unterschiede zwischen heutigen
ANNE FRANK TAG JAHRE TAGEBUCH
 ANNE FRANK TAG 2017 75 JAHRE TAGEBUCH Am 12. Juni ist Anne Franks Geburtstag. Vor 75 Jahren, zu ihrem 13. Geburtstag, hat sie von ihren Eltern ein Tagebuch geschenkt bekommen. Darin schrieb sie ihre Erlebnisse,
ANNE FRANK TAG 2017 75 JAHRE TAGEBUCH Am 12. Juni ist Anne Franks Geburtstag. Vor 75 Jahren, zu ihrem 13. Geburtstag, hat sie von ihren Eltern ein Tagebuch geschenkt bekommen. Darin schrieb sie ihre Erlebnisse,
Rat der Europäischen Union DER EUROPÄISCHE RAT. Das strategische Organ der Union
 Rat der Europäischen Union DER EUROPÄISCHE RAT Das strategische Organ der Union DER EUROPÄISCHE RAT EIN STRATEGISCHES ORGAN Der Europäische Rat ist der Impulsgeber der Europäischen Union. Er legt die Zielvorstellungen
Rat der Europäischen Union DER EUROPÄISCHE RAT Das strategische Organ der Union DER EUROPÄISCHE RAT EIN STRATEGISCHES ORGAN Der Europäische Rat ist der Impulsgeber der Europäischen Union. Er legt die Zielvorstellungen
B
 . 1 BOTSCHAFT DER RUSSISCHEN FÖDERATION BÜRO FÜR KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE UND GEDENKARBEIT Unter den Linden 63-65, 10117 Berlin Tel. (030) 224 87 580,. Fax (030) 229 93 97 www.russische-botschaft.de. e-mail:
. 1 BOTSCHAFT DER RUSSISCHEN FÖDERATION BÜRO FÜR KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE UND GEDENKARBEIT Unter den Linden 63-65, 10117 Berlin Tel. (030) 224 87 580,. Fax (030) 229 93 97 www.russische-botschaft.de. e-mail:
Unser Nordrhein-Westfalen. Das Wahl-Programm der SPD für die Landtags-Wahl in Leichter Sprache
 1 Unser Nordrhein-Westfalen Das Wahl-Programm der SPD für die Landtags-Wahl in Leichter Sprache 2 Achtung: Das sind die wichtigsten Dinge aus dem Wahl-Programm in Leichter Sprache. Aber nur das Original-Wahl-Programm
1 Unser Nordrhein-Westfalen Das Wahl-Programm der SPD für die Landtags-Wahl in Leichter Sprache 2 Achtung: Das sind die wichtigsten Dinge aus dem Wahl-Programm in Leichter Sprache. Aber nur das Original-Wahl-Programm
1 Deutschland ist ein demokratisches Land
 1 Deutschland ist ein demokratisches Land Es gab Zeiten, das regierten in Deutschland Fürsten und Könige. Ihnen gehörten große Teile des Landes und die Menschen im Land wurden von ihnen als Untertanen
1 Deutschland ist ein demokratisches Land Es gab Zeiten, das regierten in Deutschland Fürsten und Könige. Ihnen gehörten große Teile des Landes und die Menschen im Land wurden von ihnen als Untertanen
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Buchpräsentation
 Sperrfrist: 8.Juni 2015, 15.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Buchpräsentation Sinti
Sperrfrist: 8.Juni 2015, 15.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Buchpräsentation Sinti
Widerstand und Überleben
 Widerstand und Überleben Die Poträts der 232 Menschen, die aus dem 20. Deportationszug in Belgien befreit wurden, am Kölner Hauptbahnhof 26./27.1. 2008 Eine Aktion der Gruppe Bahn erinnern GEDENKEN UND
Widerstand und Überleben Die Poträts der 232 Menschen, die aus dem 20. Deportationszug in Belgien befreit wurden, am Kölner Hauptbahnhof 26./27.1. 2008 Eine Aktion der Gruppe Bahn erinnern GEDENKEN UND
Baden-württembergische Beratungsstelle Anerkennung und Hilfe in VdK-Trägerschaft. Frank Hapatzky und Jutta Wehl beraten
 Einfache Sprache Neue Stiftung nahm im April ihre Arbeit auf Baden-württembergische Beratungsstelle Anerkennung und Hilfe in VdK-Trägerschaft. Frank Hapatzky und Jutta Wehl beraten Landesminister Manfred
Einfache Sprache Neue Stiftung nahm im April ihre Arbeit auf Baden-württembergische Beratungsstelle Anerkennung und Hilfe in VdK-Trägerschaft. Frank Hapatzky und Jutta Wehl beraten Landesminister Manfred
ALLGEMEINE FRAGEN ZU POLITIK:
 ALLGEMEINE FRAGEN ZU POLITIK: AUFGABEN A: Welche Politiker kennst Du? Bundeskanzlerin Angela Merkel Peer Steinbrück leistet seinen Eid als Bundesfinanzminister Wolfgang Tiefensee tritt sein Amt als Bundesminister
ALLGEMEINE FRAGEN ZU POLITIK: AUFGABEN A: Welche Politiker kennst Du? Bundeskanzlerin Angela Merkel Peer Steinbrück leistet seinen Eid als Bundesfinanzminister Wolfgang Tiefensee tritt sein Amt als Bundesminister
Kleine Anfrage. Deutscher Bundestag 13. Wahlperiode. Drucksache 13/8946. der Abgeordneten Ulla Jelpke und der Gruppe der PDS
 Deutscher Bundestag 13. Wahlperiode Drucksache 13/8946 29. 10. 97 Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke und der Gruppe der PDS Die Ludwig-Frank Stiftung für ein freiheitliches Europa e. V." und ihre
Deutscher Bundestag 13. Wahlperiode Drucksache 13/8946 29. 10. 97 Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke und der Gruppe der PDS Die Ludwig-Frank Stiftung für ein freiheitliches Europa e. V." und ihre
Die Rolle des Bundespräsidenten
 Politik Udo Krause Die Rolle des Bundespräsidenten Essay Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Fakultät für Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaften Institut für Politikwissenschaft Proseminar:
Politik Udo Krause Die Rolle des Bundespräsidenten Essay Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Fakultät für Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaften Institut für Politikwissenschaft Proseminar:
e his iş इ हम र Unsere Geschichte рия Наша исто ας
 Notr Umlando wet Naša povijest e his hu toire iz im iş ر ﯾ m ç e G स ह त इ हम र Unsere Geschichte 事 我们的故 Η рия ر istoria Наша исто ιστορία μ Nuestra h Our History ας Herzlich willkommen im Haus der Geschichte
Notr Umlando wet Naša povijest e his hu toire iz im iş ر ﯾ m ç e G स ह त इ हम र Unsere Geschichte 事 我们的故 Η рия ر istoria Наша исто ιστορία μ Nuestra h Our History ας Herzlich willkommen im Haus der Geschichte
Ostalgie in Tschechien?
 Ostalgie in Tschechien? Zur Rolle der Kommunistischen Partei Böhmens und Mährens im tschechischen politischen System 06.11.2014 Referent: Dr. Lukáš Novotný, Karls-Universität Prag Ostalgie in Tschechien?
Ostalgie in Tschechien? Zur Rolle der Kommunistischen Partei Böhmens und Mährens im tschechischen politischen System 06.11.2014 Referent: Dr. Lukáš Novotný, Karls-Universität Prag Ostalgie in Tschechien?
Leben von Oskar und Emilie Schindler in die Gegenwart geholt
 Leben von Oskar und Emilie Schindler in die Gegenwart geholt Schindler Biografin Erika Rosenberg zu Gast bei Gymnasiasten der Bereiche Gesundheit/Soziales und Wirtschaft Samstag, 13.11.2010 Theo Tangermann
Leben von Oskar und Emilie Schindler in die Gegenwart geholt Schindler Biografin Erika Rosenberg zu Gast bei Gymnasiasten der Bereiche Gesundheit/Soziales und Wirtschaft Samstag, 13.11.2010 Theo Tangermann
KZ-Gedenkstätten und andere Lernorte zur Geschichte des. Am 30. Januar kommenden Jahres werden 80 Jahre vergangen sein,
 Dr. Barbara Distel Ehemalige Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau KZ-Gedenkstätten und andere Lernorte zur Geschichte des nationalsozialistischen Terrors Überlegungen Am 30. Januar kommenden Jahres werden
Dr. Barbara Distel Ehemalige Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau KZ-Gedenkstätten und andere Lernorte zur Geschichte des nationalsozialistischen Terrors Überlegungen Am 30. Januar kommenden Jahres werden
Inhaltsverzeichnis. Vom Imperialismus in den Ersten Weltkrieg 10. Nach dem Ersten Weltkrieg: Neue Entwürfe für Staat und Gesellschaft
 Inhaltsverzeichnis Vom Imperialismus in den Ersten Weltkrieg 10 Ein erster Blick: Imperialismus und Erster Weltkrieg 12 Der Imperialismus 14 Vom Kolonialismus zum Imperialismus 15 Warum erobern Großmächte
Inhaltsverzeichnis Vom Imperialismus in den Ersten Weltkrieg 10 Ein erster Blick: Imperialismus und Erster Weltkrieg 12 Der Imperialismus 14 Vom Kolonialismus zum Imperialismus 15 Warum erobern Großmächte
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Das Amt des Bundespräsidenten - wichtiger Vermittler oder überflüssiges Amt?
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das Amt des Bundespräsidenten - wichtiger Vermittler oder überflüssiges Amt? Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das Amt des Bundespräsidenten - wichtiger Vermittler oder überflüssiges Amt? Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
- Archiv - Findmittel online
 - Archiv - Findmittel online Bestand: ED 359 Götze, Hellmut Bestand Götze, Hellmut Signatur ED 359 Zum Bestand Helmut Götze Forstamtmann Als ehemaliger Soldat der Wehrmacht, Stalingradkämpfer und sowjetischer
- Archiv - Findmittel online Bestand: ED 359 Götze, Hellmut Bestand Götze, Hellmut Signatur ED 359 Zum Bestand Helmut Götze Forstamtmann Als ehemaliger Soldat der Wehrmacht, Stalingradkämpfer und sowjetischer
Juni 2010 EXTRA "Zustand der Koalition"
 Juni 2010 EXTRA "Zustand der Koalition" Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Stichprobe: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren Repräsentative Zufallsauswahl/Randomstichprobe Erhebungsverfahren:
Juni 2010 EXTRA "Zustand der Koalition" Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Stichprobe: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren Repräsentative Zufallsauswahl/Randomstichprobe Erhebungsverfahren:
Leichte Sprache WAHL HILFE. Einfach wählen gehen! Bundestags wahl 2017 Was man wissen muss zur Bundestags wahl
 Leichte Sprache WAHL HILFE Einfach wählen gehen! Bundestags wahl 2017 Was man wissen muss zur Bundestags wahl 24. September 2017 Seite 2 Über das Heft Jeder kann Politik machen. Zum Beispiel bei der Bundestags
Leichte Sprache WAHL HILFE Einfach wählen gehen! Bundestags wahl 2017 Was man wissen muss zur Bundestags wahl 24. September 2017 Seite 2 Über das Heft Jeder kann Politik machen. Zum Beispiel bei der Bundestags
Karsten Hartdegen. Entstehung der Bundesrepublik Deutschland
 Mit der bedingungslosen Kapitulation am 08. Mai 1945 war der bis dahin furchtbarste Krieg, der 2. Weltkrieg (1939 1945), zu Ende. Deutschland war an der Stunde Null angelangt. Bereits seit 1941 befand
Mit der bedingungslosen Kapitulation am 08. Mai 1945 war der bis dahin furchtbarste Krieg, der 2. Weltkrieg (1939 1945), zu Ende. Deutschland war an der Stunde Null angelangt. Bereits seit 1941 befand
Karl IV. zugleich König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs ist eine Leitfigur und ein Brückenbauer.
 Sperrfrist: 27. Mai 2016, 11.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung der Ausstellung
Sperrfrist: 27. Mai 2016, 11.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung der Ausstellung
Inhaltsverzeichnis 1. Herzlich willkommen auf der Internet-Seite vom Auswärtigen Amt 3. Allgemeine Hinweise und Erklärungen 3
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Herzlich willkommen auf der Internet-Seite vom Auswärtigen Amt 3 Allgemeine Hinweise und Erklärungen 3 Was ist das Auswärtige Amt? 3 Wann ist diese Internet-Seite
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Herzlich willkommen auf der Internet-Seite vom Auswärtigen Amt 3 Allgemeine Hinweise und Erklärungen 3 Was ist das Auswärtige Amt? 3 Wann ist diese Internet-Seite
Russland und der Westen
 Russland und der Westen Wahrnehmungen und Einschätzungen der Deutschen 13. April 2018 q8356/36172 Gü/Le forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer Straße 30 10317 Berlin Telefon:
Russland und der Westen Wahrnehmungen und Einschätzungen der Deutschen 13. April 2018 q8356/36172 Gü/Le forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer Straße 30 10317 Berlin Telefon:
Video-Thema Manuskript & Glossar
 DIE RENTNER KOMMEN Bei der Bundestagswahl im September ist jeder dritte Wähler über 60 Jahre alt. Nun wollen die Senioren den Politikern zeigen, dass sie immer wichtiger werden. Es gibt über 20 Millionen
DIE RENTNER KOMMEN Bei der Bundestagswahl im September ist jeder dritte Wähler über 60 Jahre alt. Nun wollen die Senioren den Politikern zeigen, dass sie immer wichtiger werden. Es gibt über 20 Millionen
Rede von Herrn Oberbürgermeister Klaus Wehling anlässlich der Veranstaltung Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus Mittwoch, 27.
 Rede von Herrn Oberbürgermeister Klaus Wehling anlässlich der Veranstaltung Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus Mittwoch, 27. Januar 2009, 12:00 Uhr Schloß Oberhausen, Konrad Adenauer Allee
Rede von Herrn Oberbürgermeister Klaus Wehling anlässlich der Veranstaltung Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus Mittwoch, 27. Januar 2009, 12:00 Uhr Schloß Oberhausen, Konrad Adenauer Allee
ARD-DeutschlandTREND: Mai ARD- DeutschlandTREND Mai 2013 Eine Studie im Auftrag der tagesthemen
 ARD- DeutschlandTREND Mai 2013 Eine Studie im Auftrag der tagesthemen Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual
ARD- DeutschlandTREND Mai 2013 Eine Studie im Auftrag der tagesthemen Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual
