Seitenüberschriften. Die erste Seite bleibt leer
|
|
|
- Katja Hase
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Seitenüberschriften 1 Die erste Seite bleibt leer
2 2 Die zweite Seite bleibt leer
3 3 Vorwort Verarbeitet bewältigt erledigt? Vom Umgang mit Gedenkkultur Zwischen dem 29. Januar und dem 12. Februar 2006 fand in der Hauptkirche St. Jacobi eine Veranstaltungsreihe zu diesem Thema mit vier Vorträgen und drei Predigten statt. Die Texte dreier Vorträge sind in diesem Heft abgedruckt, in denen der Umgang mit Gedenkkultur von verschiedenen Seiten beleuchtet wird: Dr. Detlef Garbe schildert die Zustände im KZ Neuengamme, das in der Nachkriegszeit für viele Hamburger ein Tabuthema war, und belegt, dass dieses Lager sowohl von der Zahl der Inhaftierten als auch auf Grund besonderer Grausamkeiten in einer Reihe mit bekannteren KZs zu stehen hat. Sein Zahlenmaterial gibt einen Eindruck davon, dass Hamburg und Umgebung keineswegs ein weißer Fleck auf der Karte des NS-Terrors war. Victoria Overlack widmet sich dem Verhältnis von nationalsozialistischem Staat und Kirche in Hamburg, wobei ein Schlaglicht auf Pastoren und Kirchenvorsteher der Hauptkirche St. Jacobi fällt, von denen sich manche in deutlicher Weise der Ideologie des Dritten Reiches geöffnet haben. Prof. Wulf-Volker Lindner als Psychoanalytiker betrachtet Gedenkkultur auf den individuellen Menschen bezogen. Erinnern, wiederholen, durcharbeiten waren für Sigmund Freud Grundprinzipen seiner Arbeit und haben auch für heutige Psychotherapeuten Gültigkeit. Dabei geht Lindner vor allem auf den Aspekt von Verdrängung und Projektion der Schuldgefühle ein. Wir wünschen den Lesern dieses Heftes Anregungen zum Weiterdenken und Weiterfühlen. Dies lässt sich auch durch praktische Erfahrungen vertiefen, zum Beispiel durch Besuch der KZ-Gedenkstätte Neuengamme oder des Mahnmals für die Opfer der Operation Gomorrha auf dem Ohlsdorfer Friedhof.
4 4 Hamburg und Neuengamme: Eine Stadt und ihr KZ Hamburg und Neuengamme: Eine Stadt und ihr KZ Dr. Detlef Garbe Am 18. Oktober diesen Jahres jährt sich die Eröffnung des Dokumentenhauses in Neuengamme zum 25. Mal. Erst 1981 begann in Hamburg die Gedenkstättenarbeit am authentischen Ort im Sinne einer aktiven Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus. Heute befinden sich in Hamburg insgesamt vier Gedenkstätten in staatlicher Trägerschaft, eine weitere Gedenkstätte, die Gedenk- und Bildungsstätte Israelitische Töchterschule, ist Teil der Hamburger Volkshochschule. Es war allerdings auch in Hamburg ein langer und überaus beschwerlicher Weg, wie andernorts tat man sich in unserer Stadt sehr schwer mit der Annahme dieses historischen Erbes. Noch Ende der 1970er Jahre begannen die Flugblätter einer aus Mitgliedern der Aktion Sühnezeichen, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes gebildeten Initiative Dokumentationsstätte Neuengamme völlig zu Recht mit der Frage: Wie vielen Hamburgern ist bekannt, dass sich im Südosten der Stadt das Gelände eines der größten NS-Konzentrationslager auf deutschem Boden befindet? Diese Frage war noch vor 25 Jahren leider nur zu berechtigt. Anders als beispielsweise in den Niederlanden, Belgien und in Dänemark, wo Neuengamme als der Hauptdeportationsort für Angehörige der dortigen Widerstandsbewegungen gilt, war in Hamburg das in den eigenen Stadtgrenzen gelegene Konzentrationslager für lange Jahrzehnte kein Thema. Wie konnte es dazu kommen, dass die Geschichte dieses Ortes derart aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt werden konnte? Warum ist das KZ Neuengamme vergleichsweise unbekannt geblieben? Mit der rücksichtslosen Ausnutzung der Arbeitskraft von zumeist nichtjüdischen Häftlingen in der deutschen Kriegswirtschaft unter Bedingungen, die den Tod durch Entkräftung bewusst einkalkulierten, steht das KZ Neuengamme für den von der SS geprägten Begriff Vernichtung durch Arbeit. Obgleich Menschen aus ganz Europa nach Neuengamme deportiert wurden und es mit über Häftlingen und 86 Außenlagern zu den großen Konzentrationslagern der SS zählte, ist es bis heute weit unbekannter als die meisten anderen der insgesamt 22 Hauptlager, die der Inspektion der Konzentrationslager unterstanden. Dabei war die Zahl der Todesopfer unter den im KZ Neuengamme registrierten Häftlingen nicht geringer als in anderen Hauptlagern, etwa dem KZ Dachau; die Todesrate lag sogar höher als beispielsweise in Buchenwald oder Ravensbrück. Einer der Gründe dafür war sicherlich, dass die siebenjährige Geschichte dieses Lagers aufs Engste mit der Geschichte Hamburgs im Dritten Reich verknüpft ist. Schon die Gründung des Lagers, die in die 1936/37 einsetzende zweite Phase des KZ-Systems fällt, als die gezielte Nutzung der Häftlingsarbeitskraft für die Belange der SS zu einem wesentlichen Faktor der Konzentrationslager wurde, geht auf die Initiative der Hansestadt zurück.
5 5 Hamburg und Neuengamme: Eine Stadt und ihr KZ Im Herbst 1938 erwarb das SS-Unternehmen Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH am Rande des Dorfes Neuengamme eine seit Jahren stillgelegte Ziegelei und Grundstücke in einer Gesamtgröße von 50 Hektar, die für den Abbau von Ton geeignet waren. Am 12. Dezember 1938 trafen in Neuengamme 100 Häftlinge aus Sachsenhausen ein, die die Ziegelei wieder betriebsfertig machen sollten. Ein Vierteljahr nach Kriegsbeginn fiel die endgültige Entscheidung, Neuengamme zu einem großen Konzentrationslager auszubauen. Im Anschluss an einen Besuch von Heinrich Himmler wurden im Januar 1940 Verhandlungen zwischen der SS und der Stadt Hamburg aufgenommen, bei denen die Stadt im Hinblick auf die beabsichtigte Errichtung monströser Führerbauten ihr größtes Interesse an der Erweiterung des mit Häftlingen betriebenen Klinkerwerkes bekundete, um auf diese Weise die Baukosten erheblich reduzieren zu können. Die Hansestadt Hamburg und die Deutschen Erd- und Steinwerke schlossen im April 1940 einen Vertrag. Die Stadt Hamburg gewährte zum Bau eines größeren Klinkerwerkes ein Darlehen in Millionenhöhe und verpflichtete sich zur Herstellung eines Eisenbahnanschlusses, zur Regulierung der teilweise nicht schiffbaren Dove-Elbe und zum Bau eines Stichkanals mit Hafenbecken. Die SS sagte zu, für diese Vorhaben Häftlinge als Arbeitskräfte und die dann erforderlichen Bewachungsmannschaften unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Im Frühjahr 1940 wurde Neuengamme selbständiges Konzentrationslager. Der Bau der Lagerbaracken, der Wachtürme und der Umzäunung wurde in schnellem Tempo vorangetrieben. Misshandlungen, Entkräftung, Hunger und Arbeitsunfälle forderten schon bald die ersten Todesopfer. Die Häftlinge, deren Zahl schnell anstieg und zum Jahresende 1940 bereits ca betrug, arbeiteten im Lagerausbau, bei der Verbreiterung der Dove-Elbe, beim Bau des Stichkanals mit Hafenbecken, bei der Errichtung des neuen Groß-Klinkerwerkes und in den Tongruben. Seit dem Winter 1940/41 bestanden die im KZ Neuengamme eintreffenden Transporte mehrheitlich aus ausländischen Häftlingen. Schon bald überstieg ihre Zahl bei weitem die der Deutschen, unter denen sich neben politischen Gefangenen in großer Zahl auch Menschen befanden, die von der SS als Kriminelle oder Asoziale klassifiziert wurden. Die ausländischen Gefangenen waren hingegen von wenigen Ausnahmen abgesehen mit dem roten Winkel der Politischen gekennzeichnet. Im Verlauf des Krieges deportierten die Gestapo und der Sicherheitsdienst der SS Zehntausende aus allen besetzten Ländern Europas als KZ-Häftlinge nach Neuengamme. Es waren zumeist Menschen, die Widerstand gegen die deutsche Besatzungsherrschaft geleistet hatten, die Vergeltungsmaßnahmen von Wehrmacht und SS zum Opfer gefallen waren, die sich gegen verordnete Zwangsarbeit aufgelehnt hatten oder die als Juden aus Gründen des Rassismus und Antisemitismus verfolgt wurden. Zahlreiche Häftlinge waren Opfer willkürlicher Repressalien; zu ihnen gehörten beispielsweise mehrere tausend nach dem Warschauer Aufstand 1944 verhaftete Polinnen und Polen. Zu ihnen zählten auch um ein weiteres Beispiel zu nennen 589 Männer aus der niederländischen Gemeinde Putten, die im Oktober 1944 als Vergeltung für einen in der Nähe ausgeführten Überfall auf ein Wehrmachtsauto ins Konzentrationslager Neuengamme deportiert wurden. Von ihnen kehrten nur 49 in das später als Dorf der Witwen und Waisen bezeichnete Putten zurück.
6 6 Hamburg und Neuengamme: Eine Stadt und ihr KZ Aus der Unterschiedlichkeit der einzelnen Häftlingsgruppen ergaben sich für die Zwangsgesellschaft im Lager zahlreiche Probleme. Eine große Schwierigkeit bestand in dem Sprachenproblem, eine andere in den zum Teil konkurrierenden Gruppeninteressen. Die SS versuchte, die nationalen Ressentiments unter den Häftlingen und die zwischen den einzelnen Gruppen bestehenden Gegensätze zu schüren und zu verstärken. Trotz dieser schwierigen Bedingungen versuchten Häftlinge, sich dieser Hierarchie zu widersetzen, Verbindungen untereinander aufzunehmen und sich auch illegal zu organisieren. Es bildeten sich innerhalb der nationalen Gruppen kleine Widerstandszirkel, später auch ein internationales Lagerkomitee, dessen Einfluss aber weitgehend auf einen engeren Kreis politischer Funktionshäftlinge beschränkt blieb, während die Masse der Häftlinge davon weder Kenntnis erlangte noch unmittelbar daraus Nutzen zog. Bedeutungsvoll waren die Verbreitung abgehörter Rundfunknachrichten (auch mit Hilfe von selbstgebauten Empfängern) sowie die Zuteilung leichterer Arbeit für bereits stark Geschwächte. Aufgrund des Wirkens herausragender Persönlichkeiten sind von den Schreibstuben und Krankenrevieren spektakuläre Aktionen des Widerstandes überliefert, etwa der Diebstahl von Medikamenten aus SS-Beständen, das Verstecken von Kranken vor Selektionen oder die Fälschung von Angaben in den Lagerakten zur Rettung von Häftlingen. Die Einbeziehung in die Kriegswirtschaft und das System der Außenlager Mit der Kriegswende 1942 setzte eine neue Phase in der Entwicklung des KZ-Systems ein, die auf eine möglichst umfassende Ausnutzung des Arbeitskräftepotentials der Häftlinge zu Rüstungszwecken und anderen kriegswirtschaftlichen oder militärischen Vorhaben zielte. In Neuengamme wurden daraufhin mehrere Rüstungsbetriebe direkt beim KZ angesiedelt, wobei die Baumaßnahmen durch Häftlinge ausgeführt werden mussten. Anschließend hatten Häftlinge für die Firmen Messap und Jastram Zünder für Granaten und U-Boot-Teile herzustellen. Für den thüringischen Waffenhersteller Carl Walther GmbH wurde 1943/44 eine über Quadratmeter große Fabrikationsanlage erstellt; in den Metallwerken Neuengamme produzierten bis zu 1000 Häftlinge Gewehrteile. In einem ebenfalls 1943/44 errichteten großen Barackenkomplex, dem so genannten Industriehof der SS-eigenen Deutschen Ausrüstungswerke, wurden hauptsächlich Bedarfsartikel für die Waffen-SS, beispielsweise Kasernenmobiliar, Tarnnetze, Kisten und Patronenbehälter, hergestellt. Seit 1942 kamen Häftlingskommandos aus Neuengamme aber auch an auswärtigen Industriestandorten zum Einsatz. Nach und nach wurden bei Rüstungsfirmen in ganz Norddeutschland Dependancen errichtet. Zumeist wurden die Häftlinge zum Bau von Produktionsstätten oder zu Aufräumungsarbeiten nach Luftangriffen eingesetzt; in der Rüstungsfertigung selbst arbeitete nur der geringere Teil von ihnen. In vielen Außenlagern, so auf den Werften und beim Bau von U-Boot-Bunkern, arbeiteten Häftlinge für Rüstungsvorhaben der Kriegsmarine. Als sich gegen Kriegsende die militärische und kriegswirtschaftliche Lage zunehmend verschlechterte, hatte sich die nationalsozialistische Führung unter dem Druck des gravierenden Arbeitskräftemangels in Deutschland dazu entschlossen, auch aus dem Kreis der in die
7 7 Hamburg und Neuengamme: Eine Stadt und ihr KZ Vernichtungslager des Ostens deportierten und dort zur Ermordung bestimmten Juden Arbeitskräfte für den reichsweiten Einsatz bei Rüstungsvorhaben zu rekrutieren. In das KZ Neuengamme wies die SS vor allem aus Auschwitz insgesamt mehr als jüdische Häftlinge ein. Nur ein kleiner Teil von ihnen kam ins Hauptlager, die meisten in neu errichtete Außenlager, die oftmals ausschließlich für jüdische Gefangene bestimmt waren. Zwar blieb das Hauptlager in Neuengamme eine Haftstätte für Männer, doch von den insgesamt 86 Außenlagern waren 24 mit Frauen belegt. Die Belegung in den Frauenaußenlagern, die alle erst im letzten Kriegsjahr entstanden, unterschied sich stark von der allgemeinen Häftlingszusammensetzung. Unter den weiblichen Häftlingen befanden sich in der großen Mehrzahl polnische, tschechische und ungarische Jüdinnen. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Frauen unterschieden sich nicht sehr von denen der männlichen Häftlinge; auch sie mussten harte körperliche Arbeit im Schichtsystem leisten, so aus im Neuengammer Klinkerwerk produzierten Fertigungsteilen in Hamburg Plattenhäuser für Ausgebombte errichten. Große Veränderungen zeigten sich in der zweiten Kriegshälfte auch beim Kommandanturpersonal und der Wachtruppe, die aus drei, zeitweilig vier Kompanien der SS- Totenkopfverbände bestand. Anders als im Hauptlager und den ersten Außenlagern wurden nunmehr auch Kräfte zur Bewachung eingesetzt, die nicht der SS angehörten. In den Außenlagern, in denen Häftlinge für Bauprojekte der Wehrmacht arbeiten mussten, übernahmen Einheiten der Marine und der Luftwaffe Wachaufgaben. In den Frauenaußenlagern wurde in der Regel nur für die äußere Bewachung männliches Wachpersonal eingesetzt, bei dem es sich zumeist um zur Polizeireserve eingezogene Zivilisten (beispielsweise Zollbeamte) handelte, während innerhalb der Lager für die Überwachung der Häftlinge von der SS beschäftigte Aufseherinnen zuständig waren. Insgesamt stieg die Zahl der Wachkräfte im Gesamtbereich des Konzentrationslagers Neuengamme von wenigen hundert Mann im Jahre 1940 bis 1945 auf 4000 bis 5000, von denen bei Kriegsende aber nur noch knapp die Hälfte SS-Angehörige waren. Die Hamburger Außenlager Von den insgesamt 86 Außenlager, die zum KZ Neuengamme zählten, befanden sich allein 17 Lager, davon 7 für weibliche Häftlinge, im Hamburger Stadtgebiet. Nach den verheerenden Bombenangriffen vom Juli/August 1943 wurden KZ-Häftlinge im städtischen Auftrag zur Leichenbergung, Trümmerbeseitigung und Blindgängerentschärfung in den völlig zerstörten und zum Sperrgebiet erklärten Stadtteilen Hammerbrook und Rothenburgsort sowie zur Bestattung der Leichen auf dem Ohlsdorfer Friedhof eingesetzt. Zum Arbeitseinsatz von KZ-Häftlingen in der hamburgischen Rüstungsindustrie kam es erst im letzten Kriegsjahr. Hiergegen hatte es zunächst sowohl auf Seiten der SS als auch bei den Betrieben Vorbehalte gegeben. Ab Mai 1944 zeigte die Hamburger Gauwirtschaftskammer jedoch verstärktes Interesse an KZ-Arbeitskräften. Am 22. Juli wurde auf einer Sitzung des Rüstungskommandos neun Betrieben in Aussicht gestellt, dass ihnen jeweils 500 bis 600 Häftlinge zugeteilt würden. Einen Monat später überzeugte sich Rudolf Blohm als Lei-
8 8 Hamburg und Neuengamme: Eine Stadt und ihr KZ ter der Industrieabteilung der Gauwirtschaftskammer bei einer Besichtigung des Frauenaußenlagers der Drägerwerke in Wandsbek, in dem 500 zumeist Polinnen und Sloweninnen seit Juni 1944 Gasmasken produzieren mussten, von der sehr zufriedenstellend[en] Arbeitsleistung der Häftlinge. Da die Arbeitszeit länger sei und kaum Fehlzeiten anfielen, sei der Ausstoß an Gasmasken größer als mit der gleichen Zahl deutscher Arbeiter. Eine weitere Leistungssteigerung sei dann zu erzielen, wenn man die deutschen Vorarbeiter durch Kapos ersetze, da diese rigoroser durchgreifen. In der Folge kam es in zahlreichen Hamburger Rüstungsbetrieben zum Arbeitseinsatz von KZ-Häftlingen, so bei den Hanseatischen Kettenwerken, in der Gewehr- und Munitionsfabrik Ochsenzoll und bei den Werften Blohm & Voss, Deutsche Werft und Stülcken. Hinzu kam der Einsatz von Tausenden von Häftlingen zu Aufräumungs- und Bauarbeiten. Bei den durch Bombenangriffen schwer geschädigten Raffinerien der Firmen Rhenania Ossag (Shell), Ebano und Schindler mussten zur Produktionssicherung 1500 aus Auschwitz überstellte Jüdinnen und anschließend 2000 männliche Häftlinge Aufräumarbeiten ausführen. Die Jüdinnen wurden im September 1944 in Gruppen von jeweils 500 Häftlingen aufgeteilt und in Eidelstedt, Neugraben und Poppenbüttel zum Bau von Plattenhaussiedlungen eingesetzt. Die Bewachung der Häftlinge übernahmen Hamburger Zollbeamte, die zur SS abgeordnet worden waren. Ein sehr großes Außenlager, das zudem als Stützpunkt aller Hamburger Außenlager diente, errichtete die SS im Oktober 1944 im Sperrgebiet Hammerbrook. Die 2000 Häftlinge waren in einem ehemaligen Tabaklager in der Spaldingstraße 156/158 untergebracht. An wechselnden Einsatzorten mussten die Häftlinge Aufräumungsarbeiten verrichten und dabei aus Gebäuderuinen noch zu verwertendes Baumaterial zusammentragen. Die schwere körperliche Arbeit sowie die zum Teil lebensgefährlichen Einsatzorte der Häftlinge ließ die Todesrate rasch ansteigen. Allein für dieses Außenlager muss von mindestens 800 Toten ausgegangen werden. Mit der Einrichtung von inmitten der Stadt gelegenen Außenlagern, einzelnen Arbeitseinsätzen auch an belebten Orten, so zur Aufbereitung von Trümmersteinen am Heiligengeistfeld, und den täglichen Wegen zwischen den Einsatzorten und den Lagern, die teilweise in Marschkolonnen, aber auch mit LKWs, Hafenschiffen und sogar in der S-Bahn (die Wagen mit den Häftlingen waren an die normalen Züge angekoppelt) zurückgelegt wurden, waren die KZ-Häftlinge zunehmend auch für die Hamburger Bevölkerung wahrnehmbar. Wo die Arbeitsplätze nicht oder nur schwer abgrenzbar waren, so beispielsweise auf den Werften, kamen die Häftlinge auch mit ausländischen Zwangsarbeitern und deutschen Belegschaftsmitgliedern in Kontakt. Vereinzelt wird von kleinen Zeichen der Solidarität, etwa heimlich überlassenen Nahrungsmitteln, berichtet, doch werden die gewöhnlichen Reaktionen der durch eigene Leiderfahrungen in den letzten Kriegsjahren wohl ohnehin weitgehend abgestumpften Bevölkerung mit Verachtung, Gleichgültigkeit und Wegschauen beschrieben. Bei mehreren der Hamburger Außenlager fanden die Arbeitseinsätze im kommunalen Auftrag statt, die Zuständigkeit lag bei der Bauverwaltung. Auch die Einrichtung einiger außer-
9 9 Hamburg und Neuengamme: Eine Stadt und ihr KZ halb Hamburgs gelegener Lager lässt sich zumindest teilweise auf die Initiative des Hamburger Gauleiters und Reichsverteidigungskommissars Karl Kaufmann zurückführen, der aufgrund eines Hitler-Befehls vom 28. August 1944 zum Ausbau von Abwehrstellungen entlang der deutschen Nordseeküste mit Koordinierungsaufgaben betraut worden war. Er ließ umfangreiche Pläne für den Stellungsbau ausarbeiten, zu dem im Herbst 1944 mehrere tausend Häftlinge des KZ Neuengamme herangezogen wurden. Zum Bau von Panzergräben entstanden die Friesenwall-Lager Aurich-Engerhafe, Husum-Schwesing, Meppen-Versen und Dalum sowie Ladelund an der dänischen Grenze. Obgleich diese Lager bereits nach wenigen Wochen bzw. Monaten wieder aufgegeben worden waren, da mit einer Landung der Alliierten in der Deutschen Bucht kaum noch zu rechnen war, ist die Zahl der bei den Grabungsarbeiten zugrunde gerichteten Menschen enorm. Die Todesraten lagen hier monatlich bei bis zu oder sogar über 10 Prozent, eine der höchsten Raten aller Neuengammer Außenlager. Von den zeitweilig über 9000 Häftlingen, die beim Panzergraben-Bau für das wahnwitzige Friesenwall-Projekt eingesetzt wurden, starben zwischen 1700 und 2100 Häftlinge infolge schlechter Ernährung, Nässe, Kälte, mangelnder ärztlicher Versorgung und von Misshandlungen. Mit der starken Ausweitung des Außenlagersystems im letzten Kriegsjahr wurde auch die Zahl der Einweisungen um ein Vielfaches gesteigert. Vom Mai bis zum Dezember 1944 wurden ca Menschen zumeist aus anderen Konzentrationslagern nach Neuengamme deportiert und anschließend von dort auf die Außenlager verteilt. Von Januar bis April 1945 wurden nochmals über Häftlinge eingeliefert. Insgesamt wurden im KZ Neuengamme ca Männer und Frauen mit einer Häftlingsnummer registriert; weitere 5900 Menschen wurden in den Lagerbüchern nicht oder gesondert erfasst. Die Häftlinge kamen aus weit mehr als 20 Staaten. Die größten nationalen Gruppen unter den registrierten Häftlingen kamen aus der Sowjetunion (über einschl. der baltischen Staaten), aus Polen (15 700), Frankreich (11 650), Deutschland (9200), Ungarn (7200) und den Niederlanden (6850). Insgesamt kam über die Hälfte aller Häftlinge des KZ Neuengamme aus Osteuropa, ein Viertel aus westeuropäischen Staaten. Der Anteil der deutschen Häftlinge lag bei unter 10 Prozent. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen im Hauptlager und den Außenlagern verschlechterten sich gegen Kriegsende zusehends. Bezogen auf die Gesamtzahl aller Häftlinge des KZ Neuengamme und der Außenlager lag die Sterberate nach den allerdings unvollständigen Angaben der im Krankenrevier geführten Totenbücher im Jahre 1943 bei durchschnittlich 332 Toten pro Monat und stieg im Dezember 1944 auf 2675 an, d. h. auf durchschnittlich 86 Tote täglich. Außer den Häftlingen, die durch Arbeit zugrunde gerichtet wurden, fanden im KZ Neuengamme noch zahlreiche weitere Menschen den Tod. Das Lager diente der Staatspolizeileitstelle Hamburg als zentrale Hinrichtungsstätte. Gestapo und SS brachten bis 1945 ungefähr 1400 Personen zur Exekution nach Neuengamme, sie wurden am Schießstand bei der Kläranlage erschossen oder im Arrestbunker, dem Lagergefängnis, erhängt. Unter ihnen befanden sich Widerstandskämpfer verschiedener Nationalitäten. Im Herbst 1942 fanden in
10 10 Hamburg und Neuengamme: Eine Stadt und ihr KZ dem zu diesem Zweck gesondert abgedichteten Arrestbunker auch zweimal Mordaktionen mit Zyklon B statt, bei denen 448 sowjetische Kriegsgefangene vergast wurden. Mehrfach wurden in Neuengamme auch medizinische Experimente an Häftlingen vorgenommen. Im Anschluss an eine im Frühjahr 1942 ausgebrochene Fleckfieberepidemie führte das Hamburger Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten unter Leitung von Prof. Peter Mühlens Sulfonamidversuche an erkrankten Häftlingen durch. Ende 1944 ließ Prof. Ludwig Werner Haase von der Berliner Reichsanstalt für Wasser- und Luftgüte 150 Häftlinge wochenlang mit dem Gift Lost verseuchtes Wasser trinken, um Entgiftungsverfahren zu erproben. Zur gleichen Zeit infizierte der Lungenfacharzt Dr. Kurt Heißmeyer in Neuengamme über 100 Häftlinge mit Tbc-Erregern. Ca. 30 Häftlinge überlebten diese Versuche nicht. Zu den Opfern zählten später auch 20 jüdische Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren, die Heißmeyer im November 1944 aus Auschwitz kommen ließ, um an ihnen ebenfalls medizinische Experimente vorzunehmen. Um das Verbrechen zu verbergen, wurden die Kinder und die vier zur Betreuung eingesetzten Häftlingsärzte und -pfleger am 20. April 1945 in ein zuvor als Außenlager genutztes, nunmehr leer stehendes Schulgebäude am Bullenhuser Damm gebracht und in der folgenden Nacht von SS-Männern im Keller an Heizungsrohren erhängt. Die Räumung der Lager bei Kriegsende Kurz vor Kriegsende befanden sich noch über Häftlinge in den Händen der Neuengammer Lagerverwaltung, die weitaus meisten von ihnen in den Außenlagern. Wie der letzte Vierteljahresbericht des SS-Standortarztes vom 29. März 1945 ausweist, betrug die Belegstärke der Außenlager zu dieser Zeit insgesamt Häftlinge, davon Frauen. Zur gleichen Zeit befanden sich bis zu Gefangene im vollkommen überbelegten Hauptlager. Am 26. März 1945 begann mit der Räumung der beiden im Emsland gelegenen Außenlager Meppen-Versen und Dalum die Auflösung des Neuengammer Lagerkomplexes. Innerhalb von vier Wochen wurde dieser dann aufgelöst genauso rasch, wie die britischen und USamerikanischen Truppen vom Rhein an die Elbe vorrückten. Bis Mitte April 1945 war die Mehrzahl der damals noch bestehenden 57 Außenlager des KZ Neuengamme geräumt, die Häftlinge in Bahntransporten und auf Fußmärschen vor den herannahenden alliierten Truppen weggeführt worden. Mit Nahrung wenn überhaupt für ein bis zwei Tage versehen, waren manche Transporte über eine Woche unterwegs. Viele Häftlinge verdursteten und verhungerten; bei den Fußmärschen erschossen die SS-Wachmannschaften diejenigen, die nicht Schritt halten konnten. Teilweise schienen die Transporte ziellos herumzuirren, bis sie endlich einen Zielort erreichten. Die meisten Transporte führten die Häftlinge in Auffanglager : Zielort von 9000 Häftlingen, vor allem der meisten Bremer und einiger Hamburger Außenlager sowie kranker Häftlinge, wurde das Kriegsgefangenenlager Sandbostel bei Bremervörde Häftlinge, in ihrer Mehrzahl Jüdinnen sowie aus dem Hauptlager abgeschobene Kranke und Häftlinge aus dem Raum Hannover, kamen in das KZ Bergen-Belsen. Das seit Februar 1945 im Aufbau
11 11 Hamburg und Neuengamme: Eine Stadt und ihr KZ befindliche Außenlager Wöbbelin bei Ludwigslust wurde zur letzten Station für 5000 Häftlinge, die vor allem aus den Außenlagern im Raum Braunschweig-Salzgitter kamen. Diese drei Zielorte wurden zu Sterbelagern, in denen Tausende an Hunger und Krankheiten zugrunde gingen: 1000 in Wöbbelin und 3000 in Sandbostel wie hoch die Zahl der Opfer mit Neuengamme-Nummer unter den Toten ist, die in Bergen-Belsen kurz vor der Befreiung oder in den ersten Wochen danach starben, ist nicht bekannt. Mit der Auflösung des KZ Neuengamme verbinden sich darüber hinaus zwei historische Ereignisse, die aber in ihrer Wirkung und Wahrnehmung völlig gegensätzlich waren und den Zwiespalt zwischen Vernichtung und Befreiung besonders drastisch zeigen: die Rettung der skandinavischen KZ-Häftlinge durch das Schwedische Rote Kreuz und die Verbringung der in Neuengamme verbliebenen Häftlinge auf KZ-Schiffe. In den letzten sechs Kriegswochen wurde das KZ Neuengamme zum Sammelpunkt für alle in Deutschland gefangenen Norweger und Dänen. Die Einrichtung eines Skandinavierlagers hatte Heinrich Himmler dem Vizepräsidenten des Schwedischen Roten Kreuzes, Graf Folke Bernadotte, im Februar 1945 als Vorleistung für die erhofften Kontakte zu den Briten zugestanden, mit denen der oberste SS-Führer zur Abwendung der totalen Niederlage einen Waffenstillstand aushandeln wollte. Nachdem zuvor schon Kranke mit den berühmten Weißen Bussen über Dänemark nach Schweden gebracht worden waren, konnten am 20. April über 4000 dänische und norwegische Gefangene mit ca. 120 Bussen und anderen Fahrzeugen Neuengamme verlassen und der Freiheit entgegenfahren. Noch am gleichen Tag begann die vollständige Räumung des Hauptlagers. Auch in der Phase der Lagerräumung zeigte sich die enge Verflechtung zwischen Stadt und KZ, die in der Geschichte der Konzentrationslager beispiellos ist. Unter dem Einfluss maßgeblicher Vertreter der Wirtschaft, die eine weitere Zerstörung der nach den Bombenangriffen des Jahres 1943 schwer geschädigten Stadt bei einer militärischen Verteidigung fürchteten, hatten sich die örtlichen Führer von Partei und Wehrmacht dazu durchgerungen, die Stadt entgegen dem Befehl Hitlers kampflos an die Briten zu übergeben. Da die Verantwortlichen sowohl Plünderungen durch befreite Häftlinge nach dem Ende der Kampfhandlungen befürchteten als auch Repressalien der Sieger, sollten diese bei der Einnahme der Stadt auf halbverhungerte Häftlinge und Opfer von Massenverbrechen stoßen, wollte man die Stadt frei von KZ-Elendsgestalten wissen. Dies war das Hauptziel von Hamburgs Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar Karl Kaufmann und dem Höheren SS- und Polizeiführer Nordsee Georg Henning Graf von Bassewitz-Behr, der die Befehlsgewalt über das KZ Neuengamme im Fall alliierter Feindannäherung ausübte. Daraufhin brachte die SS die letzten 9000 Häftlinge, die sich noch in Neuengamme befanden, in den Tagen vom 21. bis 26. April nach Lübeck und von dort auf zwei Frachtschiffe sowie das vor Neustadt ankernde frühere Kreuzfahrtschiff Cap Arcona. Weil in der Kürze der Zeit keine Ausweichlager mehr zu organisieren waren, hatte Gauleiter Kaufmann in seiner Eigenschaft als Reichskommissar für die Seeschifffahrt die Schiffe als schwimmende Konzentrationslager requiriert. Aufgrund der Überfüllung und des Mangels an Nahrung und Trinkwasser herrschten auf den Schiffen unbeschreibliche Verhältnisse. Die Zahl der Toten stieg von Tag zu Tag an.
12 12 Hamburg und Neuengamme: Eine Stadt und ihr KZ Am Mittag des 3. Mai geschah dann die Tragödie: Im Rahmen eines von ca. 200 Flugzeugen der Royal Air Force in der Kieler und Lübecker Bucht geführten Großangriffs, der Absetzbewegungen deutscher Truppenteile über die Ostsee verhindern sollte und bei dem insgesamt 23 Schiffe versenkt und 115 Schiffe beschädigt wurden, nahmen britische Jagdbomber die Cap Arcona und die Thielbek unter Raketenbeschuss. Für die über 4200 auf der Cap Arcona und die ca auf der Thielbek eingepferchten Häftlinge wurde der Angriff zur Katastrophe. Die Thielbek und die Cap Arcona erhielten jeweils mehrere Volltreffer und gerieten in Brand. Die Thielbek sank innerhalb kürzester Zeit, die Cap Arcona kenterte, ragte aufgrund der geringen Wassertiefe aber mit der Steuerbordseite weiterhin aus dem Wasser und brannte aus. Da die meisten Häftlinge in den unteren Decks und Laderäumen eingesperrt waren, bestand für sie kaum eine Rettungsmöglichkeit. Die Häftlinge, die ins Wasser sprangen, hatten bei einer Wassertemperatur von 7 Grad und angesichts ihres geschwächten Zustands kaum eine Chance. Von Land aus gestartete Rettungsaktionen galten vor allen den Bewachungsmannschaften. Auf Häftlinge, die sich zu retten versuchten, wurde hingegen von SS und Marinesoldaten der Garnison Neustadt geschossen. Hinzu kam, dass ahnungslose britische Tiefflieger die Schiffbrüchigen ebenfalls beschossen. Nur etwa 400 Häftlinge überlebten den Angriff auf die Cap Arcona und die Thielbek, während 6600 Häftlinge wenige Stunden, bevor britische Truppen Neustadt erreichten an Bord verbrannten, in der Ostsee ertranken oder beim Rettungsversuch erschossen wurden. In der an Tragödien nicht armen Geschichte des Zweiten Weltkrieges hat ungeachtet der Verantwortung der SS der versehentliche Angriff auf die KZ-Schiffe eine besondere Bedeutung. Der Untergang der KZ-Häftlingsschiffe, bei dem es sich zugleich um eine der folgenschwersten Schiffskatastrophen aller Zeiten handelt, die Todesmärsche und die fürchterlichen Verhältnisse in den Sterbelagern Bergen-Belsen, Sandbostel und Wöbbelin das Ende des KZ Neuengamme war ein Inferno. Die Zahl der Häftlinge, die in den letzten drei Kriegswochen umkamen, lässt sich nur schätzen. Sie dürfte bei über liegen. Das Kriegsende, Nachnutzungen des Lagers und die Entwicklung zur Gedenkstätte Nachdem der Großteil der Häftlinge das Lager verlassen hatte, musste ein über 700 Mann starkes Kommando das Lager aufräumen. Gezielt ließ die SS die Spuren der Verbrechen verwischen. Häftlinge, die diesem Restkommando angehörten, berichten, dass sämtliche Baracken von Stroh und Unrat gereinigt, teilweise sogar die Wände frisch gekalkt und verräterische Gegenstände wie Galgen und Prügelbock beseitigt wurden. Neben Aufräumungs- und Demontagearbeiten ordnete die SS die Vernichtung sämtlicher Kommandanturakten, der Unterlagen der politischen Abteilung (Lager-Gestapo), der Karteien und alles weiteren, im Lager befindlichen Schriftgutes, an. Die letzten Häftlinge und SS-Leute verließen Neuengamme am 2. Mai Als britische Soldaten kurze Zeit später das Lager betraten, fanden sie zwar ein riesiges Gelände mit einer Vielzahl von Baracken vor, was sich dort zugetragen hatte, offenbarte der Ort jedoch nicht. Das sah in den Auffanglagern, die zu Sterbelagern geworden waren, ganz anders
13 13 Hamburg und Neuengamme: Eine Stadt und ihr KZ aus: Die Bilder, die britische Kameraleute vom KZ Bergen-Belsen nach der Übergabe des Lagers in den Tagen nach dem 15. April und in Sandbostel nach der Befreiung am 29. April festhielten sowie jene der amerikanischen Kameraleute vom 2. Mai aus Wöbbelin, dokumentieren für alle Zeit das Unfassbare, das sich damals zutrug: Sie zeigen Berge unbestatteter Leichen, zu Skeletten abgemagerte Überlebende und zutiefst erschütterte amerikanische und britische Soldaten. Im leeren Lager in Neuengamme, das die hier begangenen Verbrechen weitgehend verbarg, bot sich den alliierten Befreiern und damit der Nachwelt hingegen ein eher harmloses Bild. Das Kalkül war aufgegangen: Von Neuengamme, das als einziges der KZ-Hauptlager vollständig geräumt worden war, gingen keine Bilder des Schreckens um die Welt. Die hier vollzogenen KZ-Gräuel warfen auf Hamburg keinen nachhaltigen Schatten. Nur so konnte in den Nachkriegsjahrzehnten die Legende Widerhall finden, in der sich gern als weltoffen etikettierenden Hansestadt sei es während der Nazi-Herrschaft gemäßigter zugegangen als anderswo. Hierin liegt auch der Hauptgrund für die vergleichsweise geringe Bekanntheit des KZ Neuengamme. Dem Vergessen leistete auch die Nachkriegsnutzung des Konzentrationslagers Vorschub. Nachdem zunächst für einen Monat ehemalige sowjetische Zwangsarbeiter in Neuengamme untergebracht worden waren, nutzte die britische Militärregierung ab Anfang Juni 1945 das ehemalige KZ gemäß den Beschlüssen der Potsdamer Konferenz für drei Jahre als Internierungslager, in das anfangs vor allem SS-Angehörige, dann zunehmend zivile Funktionsträger des NS-Staates, mutmaßliche Kriegsverbrecher und aus Sicherheitsgründen Verhaftete eingewiesen wurden. Nach der Schließung des Internierungslagers übernahm die Stadt Hamburg im September 1948 das ehemalige KZ-Gelände und nutzte es fortan als Gefängnis. Während die Holzbaracken abgerissen und 1950 durch einen großen Neubau ersetzt wurden, wurden nahezu alle in der KZ-Zeit errichteten Steingebäude als Haft- und Verwaltungsgebäude oder Werkstätten weiter genutzt. Teile des SS-Lagers und das Kommandantenhaus dienten als Wohnungen für Gefängnisbedienstete. Eine Gedenkstätte konnte erst nach und nach entstehen und musste gegen starke Widerstände durchgesetzt werden. Auf Verlangen insbesondere französischer KZ-Überlebender erfolgte 1953 die Aufstellung einer ersten Gedenksäule im Bereich der am Rande des KZ- Geländes gelegenen ehemaligen Lagergärtnerei. Da die SS hier Asche der im Krematorium verbrannten Leichen verstreuen ließ, wurde diesem Ort Friedhofscharakter zugesprochen. Die Bemühungen der 1958 als Dachverband gegründeten Amicale Internationale de Neuengamme führten 1965 zur Einweihung einer neuen Mahnmalsanlage, die die Stadt Hamburg ebenfalls in der ehemaligen Gärtnerei errichten ließ. Das zu Vollzugszwecken genutzte ehemalige Häftlingslager blieb der Öffentlichkeit aber weiterhin verschlossen. Wenn die Überlebenden und Hinterbliebenen zu Totenehrungen, den so genannten Pelerinagen, nach Hamburg-Neuengamme reisten, waren sie lange Zeit keine gern gesehenen Gäste. Der Zugang zum ehemaligen Lagergelände und zum Ort des Krematoriums blieb ihnen versperrt. Sie hatten am Schlagbaum des Gefängnisses kehrt zu machen. Auch kirchli-
14 14 Hamburg und Neuengamme: Eine Stadt und ihr KZ cherseits fanden sie kein Verständnis. Einer französischen Gruppe, die in den 1960er Jahren einen Gedenkgottesdienst vor Ort durchführen wollte, wurde signalisiert, dass dafür die St. Johannis-Kirche zu Neuengamme nicht zur Verfügung stünde. Soweit bekannt, legte die örtliche Kirchengemeinde offiziell erstmals 1982 am internationalen Mahnmal einen Kranz nieder. Seither ist vieles anders geworden. Mit der Erweiterung der Mahnmalsanlage 1981 durch ein Dokumentenhaus wurden erstmals vor Ort Informationsangebote bereitgestellt, und in den folgenden Jahren entwickelte sich nach und nach eine aktive Erinnerungsarbeit, die immer größeren Zuspruch fand. Heute engagieren sich evangelische und katholische Christen aus den Vierlanden, aus Bergedorf und Hamburg im Rahmen eines Arbeitskreises für kirchliche Gedenkstättenarbeit ehrenamtlich in der Versöhnungsarbeit. Nordelbische Landeskirche, Sprengel und Kirchenkreis tragen seit 1992 eine Pfarrstelle für kirchliche Gedenkstättenarbeit, die gegenwärtig Pastor Veit Buttler innehat. Außerdem möchte ich Sie nachdrücklich ermutigen sofern sie es noch nicht getan haben, auch einmal nach Neuengamme zu kommen, um die Geländegestaltung und die neuen Ausstellungen zu besichtigen. Neben einer zunehmend großen Zahl von Angehörigen der Opfer aus dem benachbarten Ausland kommen noch immer jährlich viele ehemalige Häftlinge nach Neuengamme, um an ihrem Lebensabend noch einmal jenen Ort aufsuchen zu können, an dem sie die schwersten Jahre ihres Lebens verbringen mussten, und um sich von ihren Kameraden, die sie dort haben sterben sehen und denen sie zum Teil auch ihr eigenes Überleben verdanken, verabschieden zu können. Wer die Wiederbegegnung dieser Menschen mit dem ehemaligen Schreckensort einmal miterlebt hat, der ist tief ergriffen von bewegenden Szenen. Immer wieder ist von ihnen beim Gang über das Gelände zu hören, dass sie nunmehr sicher wüssten, dass nicht die Macht der SS, nicht Terror und Destruktivität sich durchgesetzt hätten. Die Erfahrung, dass ihre Geschichte und ihr Leid nicht vergessen sind, sondern dokumentiert zur Mahnung und Aufklärung der nachfolgenden Generationen, dies ist wie es ein KZ-Überlebender einmal formulierte für sie die beste Medizin, die es geben kann. Die 1989 vom Senat beschlossene, aber nach zahlreichen Schwierigkeiten und Zwischenschritten, zuletzt im Herbst 2001 sogar noch grundsätzlichen Infragestellungen erst 2003 vollzogene Schließung des Gefängnisses schuf vor zweieinhalb Jahren die Voraussetzungen für die Gestaltung einer Gedenk- und Dokumentationsstätte am Ort des ehemaligen Häftlingslagers. Die zum 60. Jahrestag der Befreiung im Mai 2005 eröffnete neue Gedenkstätte umfasst nunmehr nahezu das gesamte historische Lagergelände in einer Größe von 50 Hektar mit 15 aus der KZ-Zeit erhaltenen Gebäuden. Zentrale Elemente bilden im Außengelände die Markierung der Barackengrundflächen und archäologische Freilegungen, die in den ehemaligen Häftlingsblocks eingerichtete Hauptausstellung, eine Studienausstellung in den ehemaligen SS-Garagen zur SS sowie zwei weitere Ergänzungsausstellungen zur KZ- Zwangsarbeit in der Rüstungs- und Ziegelproduktion im ehemaligen Klinkerwerk bzw. in der früheren Gewehrfabrik der Walther-Werke, ferner ein Offenes Archiv und ein Studienzentrum für Seminarprogramme.
15 15 Evangelisches Leben in Hamburg zwischen 1933 und 1945 In diesen Tagen wird auch das zweite Gefängnis in Neuengamme, das Ende der 1960er- Jahre auf dem Gelände der Tongruben als Jugendhaftanstalt errichtet worden war, von Strafgefangenen geräumt. Der monströse Gefängnisbau in Neuengamme soll abgerissen und auch dieses Gelände der Gedenkstätte übergeben werden. Nach langen Jahrzehnten hat Hamburg damit heute einen Umgang mit diesem Ort gefunden, der der historischen Bedeutung dieses größten norddeutschen Konzentrationslagers gerecht wird. Dieser Ort wird zukünftig allein der Erinnerung an die über Menschen dienen, die von der SS hierher deportiert wurden und von denen ca. die Hälfte die Verfolgung nicht überlebten. Lange Jahrzehnte haben sich die in der Amicale Internationale KZ Neuengamme zusammengeschlossenen Überlebenden dafür eingesetzt. Die Ausgestaltung der Gedenkstätte zu einem die Erinnerung bewahrenden Lernort stellt gewissermaßen ihr Vermächtnis für die Nachwelt dar. Nicht für uns, alles für Christus und unser Volk! Evangelisches Leben in Hamburg zwischen 1933 und Victoria Overlack Einleitung Der vorliegende Text basiert auf einem am 25. Januar 2006 in der Gemeinde St. Jacobi gehaltenen Vortrag über das evangelische Leben in Hamburg, bei dem ein Schwerpunkt auf der Gemeinde St. Jacobi lag. Die Darstellung beruht zum einen auf den Ergebnissen meines laufenden Dissertationsprojekts zu den Hamburger Kirchengemeinden in der nationalsozialistischen Zeit, zum anderen auf der für den Vortrag vorgenommen vertiefenden Durchsicht der Gemeindeakten von St. Jacobi. Aus Zeitgründen musste auf einen wissenschaftlichen Anmerkungsapparat für die Ausarbeitung des Vortragsmanuskripts verzichtet werden. Die maßgeblichen Quellen für die folgenden Ausführungen sind zum einen die gemeindliche und die landeskirchliche Ü- berlieferung zu St. Jacobi sowie die Personalakten der relevanten Pastoren. Die übernommenen Zitate stammen fast ausschließlich aus den Gemeindeakten von St. Jacobi; Rechtschreibung und sachliche Fehler innerhalb der Zitate wurden nicht korrigiert. Als Literatur für den untersuchten Abschnitt Hamburger Kirchengeschichte können hier beispielhaft die ältere Kirchenkampfgeschichte Heinrich Wilhelmis sowie zahlreiche wissenschaftliche Aufsätze und biographische Lexikonartikel Rainer Herings angeführt werden. Eine detaillierte Diskussion der hier kurz angerissenen Schlaglichter Hamburger Kirchengeschichte zwischen 1933 und 1945 muss der ausführlicheren Darstellung meiner Dissertationsergebnisse vorbehalten bleiben, auf deren Publikation gegen Ende des Jahres 2006 in diesem Zusammenhang verwiesen wird. Das Dissertationsprojekt zur Geschichte der Hamburger Kirchengemeinden in der nationalsozialistischen Zeit ist Teil des von der Synode des Kirchenkreises Alt-Hamburg im November 2002
16 16 Evangelisches Leben in Hamburg zwischen 1933 und 1945 beschlossenen Projekts zur archivarischen und historisch-kritischen Aufarbeitung der Gemeindegeschichte im Raum der ehemaligen Hamburger Landeskirche seit 1976 der Kirchenkreis Alt-Hamburg innerhalb der Nordelbischen Landeskirche zwischen 1933 und Das Projekt endet im April Der protestantische Aufbruch 1933 In der ersten Ausgabe des Mitteilungsblattes der Deutschen Christen Hamburg vom 1. November 1933 schrieb der Gauführer der Glaubensbewegung und enge Mitarbeiter des Landesbischofs, Oberkirchenrat Franz Tügel: Wir suchen unser Volk mit heißem Herzen da, wo es zu finden ist, zuerst und immer wieder in der großen deutschen Bewegung. [Gemeint ist hier die nationalsozialistische Bewegung, V.O.] Die Stunde, die Gott uns gab, geht auch einmal vorüber. Nutzen wir sie, ehe sie dahin ist! Nicht für uns, alles für Christus und unser Volk! Diese Aufforderung des späteren Landesbischofs und Hauptpastors an St. Jacobi charakterisiert nicht nur die Bestrebungen der Glaubensbewegung Deutsche Christen, sie formuliert, was im entscheidenden Jahr 1933 viele und immer mehr Pastoren in der Hamburgischen Kirche dachten und zu fühlen meinten: Die so genannte nationale Erhebung und der damit verbundene propagandistisch gesteuerte, wie wir heute wissen mentale Aufschwung sollte und konnte auch ein Aufbruch für die Kirche sein. Der unbedingte Wille, zu einem historisch idealisiert gedachten Zustand der Deckungsgleichheit von Volk und Kirche zurück zu gelangen, stellte den Grundantrieb für eine weitgehende Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der neuen Regierung dar. Das Streben nach einer wahren Volksgemeinschaft konnte aus kirchlicher Perspektive nur gleichbedeutend mit der Rückgewinnung einer wahren Volkskirche sein. Die von Gott gegebene Stunde wie Tügel es in dem eingangs zitierten Abschnitt formulierte musste genutzt werden und zwar schnell und bedingungslos, da sie sonst dahin wäre. Dies alles jedoch keinesfalls im Interesse der kirchlichen Machterhaltung, sondern nur zum Besten des Volkes und zur Ehre Christi. Die Beteiligung der evangelischen Kirche an der Installierung der nationalsozialistischen Regierung 1933 wurde gewissermaßen als Mittel zur Volksmission verstanden. Politik und Kirche In St. Jacobi hatte sich der Kirchenvorstand aus dem gleichen volksmissionarischen Geist schon im März 1933 entschlossen, trotz bestehender gegenteiliger Empfehlungen durch den Hamburger Kirchenrat, die NSDAP als feste Größe und zukunftsgestaltende Kraft anzuerkennen und ihr Raum innerhalb der Kirche zu gewähren. Auf Betreiben eines Kirchenvorstehers und des Gemeindepastors Robert Stuewer, hatte der Kirchenvorstand mit 10:9 Stimmen einen Einzug der NSDAP in Zweierreihe in die Kirche genehmigt und mit 14:4 Stimmen sowie einer Enthaltung der NSDAP ebenfalls das Mitbringen von Fahnen gestattet, obwohl kurz zuvor eine Richtlinie des Kirchenrats ergangen war, in der alle Andeutun-
17 17 Evangelisches Leben in Hamburg zwischen 1933 und 1945 gen eines politischen Anspruchs sowie der geschlossene Besuch von politischen Formationen und das Zeigen ihrer Fahnen aus dem Gottesdienst fernzuhalten seien. Nur ein Kirchenvorsteher in St. Jacobi sprach sich gegen die Zulassung der NSDAP- Formationen und Fahnen am Volkstrauertag in der Kirche aus. Er argumentierte, dass die Kirche die Stätte bleiben sollte, die alle Bevölkerungsschichten unbeschwert aufsuchen könnten und die Gefahr gewaltsamer Auseinandersetzungen in der Kirche, wenn auch andere politische Formationen den Gottesdienst besuchen könnten, nicht riskiert werden sollte. Politische Abzeichen so der Kirchenvorsteher, würden von Andersdenkenden als Demonstration empfunden. Sie würden die innere Bereitschaft zum gottesdienstlichen Erleben der Kirchenbesucher stören können. Der Antrag stellende Kirchenvorsteher wurde zum Ende der Diskussion gebeten, zu erklären ob er eine Garantie dafür geben könne, dass es zu keinen unliebsamen Störungen des Gottesdienstes kommen würde, wenn die Teilnahme gestattet werde. Worauf der Kirchenvorsteher versicherte, dass er als Christ und als Kirchenvorsteher mit Ernst und Eifer seit Jahren das christliche und kirchliche Interesse der Parteimitglieder zu fördern bestrebt habe, dass er in diesem Sinne zur Teilnahme an der kirchlichen Feier des Volkstrauertages aufgefordert habe. Einen Widerstand der Kirche habe er hierbei nie erwartet, auch hätte er nicht befürchtet, dass man die Zumutung aussprechen würde, die Fahnen vor der Kirche zu lassen. In der Fahne sei das Symbol der Idee und der Gemeinschaft zu erblicken, für die sie sich auch als Christen eingesetzt hätten. Ein Kirchgang sei keine politische Demonstration, das habe die Partei nicht nötig, und auf den Gedanken seien sie niemals gekommen Der Antrag für eine Teilnahme der NSDAP am Abendgottesdienst zum Volkstrauertag wurde nach diesen Erklärungen von der überwiegenden Mehrheit angenommen und Pastor Stuewer der die Teilnahme der NSDAP ebenfalls befürwortete wies abschließend darauf hin, dass der Kirchenrat zwar mit der Aufstellung der Richtlinien das Beste für die Kirche bezweckt habe, dass seit den Reichstagswahlen vom 5. März 1933, die einen Tag vor der Kirchenvorstandssitzung die Übernahme der Regierung durch die NSDAP gebracht hatten, die Lage sich jedoch verändert habe. Eine Abweichung von den Richtlinien des Kirchenrats sei daher nicht nur zu verstehen, sondern sie erschiene geradezu erforderlich. Anhand dieses Beispiels wird deutlich, was für die Mehrheit der kirchenleitenden Elite also v. a. der Pastoren, aber auch aktiven Laienmitglieder in Gremien, Ausschüssen und Kirchenvorständen Hamburgs galt: Im März 1933 war bereits die Entscheidung gefallen, sich der neuen nationalen Bewegung nicht zu verschließen. In Jacobi war der Kirchenvorstand dabei sogar so weit gegangen, noch vor einer offiziellen landeskirchlichen Richtungsentscheidung, eine weitgehende Zusammenarbeit mit der neuen Regierung voranzutreiben, im Sinne der so dringend gewünschten Umkehrung der in der kirchlichen Wahrnehmung bedrohlich wachsenden gesellschaftlichen Entkirchlichung. Der Ursprung des unbedingten Willens zur Volkskirche Der Ursprung basierte auf zwei langfristigen Entwicklungen innerhalb des deutschen Protestantismus: Zum einen erwuchs er aus der von der kirchenleitenden Elite krisenhaft
18 18 Evangelisches Leben in Hamburg zwischen 1933 und 1945 wahrgenommenen Entkirchlichung. Dieser als Bedrohung empfundene Schrumpfungstrend in der nominellen kirchlichen Zugehörigkeit und der Beteiligung am gemeindlichen Leben, trat besonders massiv im Zusammenhang mit den Folgen der wirtschaftlichen Krisenjahre der Weimarer Republik Anfang der 1920er und 1930er Jahre auf. Auf der anderen Seite wurzelte der protestantische Aufbruchsgeist 1933 in der Nationalisierung des Protestantismus seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, die durch den Untergang der protestantischen Monarchie und den Sieg der ungeliebten gottlosen Demokratie einen zusätzlichen Impuls zur politischen Rechtsorientierung bekommen hatte. Auch in Hamburg waren diese beiden Phänomene zu beobachten. In Hamburg bestand seit der Reformation bis ins 20. Jahrhundert hinein eine sehr hohe konfessionelle Geschlossenheit. Um 1930 gehörten immer noch rund 80 Prozent der Bevölkerung der Evangelisch-lutherischen Kirche im Hamburgischen Staate an, dem Gebiet des Staates Hamburg vor dem Anschluss von Wandsbek, Altona und Harburg im Jahr Die Kirchlichkeit war unter der evangelischen Bevölkerung jedoch bei weitem nicht so hoch anzusetzen. Die Gottesdienste waren eher spärlich besucht, die Zahl der kirchlichen Eheschließungen ging stetig nach unten und auch der Anteil der Taufen an den Geburtenziffern nahm ab. Die Kirche und ihre Gemeinden verloren konstant praktizierende Christen, der Anteil der so genannten Weihnachtschristen an den Gemeindegliedern nahm immer weiter zu. Die Kirche hatte ihren Platz in der industrialisierten, modernen Großstadt nicht behaupten können. Durch die Auflösung der herkömmlichen Sozialverbände in Familie und Dorfgemeinschaft, die Anonymität der wachsenden Städte und dem damit einhergehenden Verlust der sozialen Kontrolle ging die überlieferte Frömmigkeitspraxis der Mehrheit verloren. Die Veränderung der Lebensrhythmen etwa die Herausbildung von Freizeit, Sonntags- und Schichtarbeit die Zunahme weltanschaulicher Pluralisierung und der durch die Urkatastrophe des Ersten Weltkriegs ausgelöste Säkularisierungsschub griffen auch den Bestand der Hamburgischen Kirche schwer an. Gemeinsam mit den Erfahrungen der Kriegsniederlage, dem Zusammenbruch des protestantischen Kaisertums, der Revolution und Inflation, die zu einer Ablehnung der Weimarer Demokratie führten, bildeten diese Entkirchlichungserfahrungen die Grundlage für das im deutschen Protestantismus vorherrschende Krisengefühl. Der Entkirchlichung versuchte man auch in Hamburg v.a. durch die Beibehaltung des so genannten Parochialprinzips entgegenzutreten, indem man davon ausging, dass es eine flächendeckende Versorgung der Menschen mit Gemeinden geben müsse, damit auch Gemeinden wachsen könnten. Dieses Festhalten am Parochialprinzip und der Volkskirchenidee führte in der Phase des rapiden Stadtwachstums zwischen etwa 1880 und dem Ersten Weltkrieg genau wie noch einmal nach Ende des Zweiten Weltkriegs in den 1950er Jahren zum Bau zahlreicher Kirchen. Auf die Probleme der modernen Großstadt hatte die Landeskirche strukturell bis zum Beginn der 1930er Jahre keine neuen Antworten gefunden, wenn auch gerade in der Weimarer Republik verstärkt neue Räume evangelischen Lebens erschlossen wurden, wie etwa durch die Einrichtung eines Evangelischen Presseamtes, der Einführung eines Jugend- sowie eines Sozialpfarramts.
19 19 Evangelisches Leben in Hamburg zwischen 1933 und 1945 Dennoch hatten auch die neuen Wege der Verkündigung nicht den Erfolg, den man sich von Kirchenseite aus wünschte, so dass das oben beschriebene Krisengefühl das beherrschende Moment der kirchenleitenden Elite blieb. Die kirchenleitende Elite Hamburgs entstammte fast durchweg Mittelstand oder gehobenem Bürgertum, war fast geschlossen männlich und politisch sowie kirchenpolitisch mehrheitlich konservativ. Trotz vereinzelter Ansätze zu einem so genannten Vernunftrepublikanismus hatte die kirchliche Führungsschicht überwiegend kein positives Verhältnis zum demokratischen Staat entwickeln können. Die Verflechtungen zwischen kirchlichen und profanen Kreisen der Gesellschaft waren insbesondere im Rahmen von Bürger- oder Militärvereinen sehr stark. Die Mehrheit der kirchlichen Führungsschicht teilte ihren geistigen und politischen Horizont mit konservativ-bürgerlichen, völkischantimodernistischen Kreisen, in denen auch häufig antisemitisches Gedankengut zu finden war. Auf Basis dieser mentalen Disposition erwuchs auch in Hamburg am Anfang der 1930er Jahre bei der Mehrheit der kirchenleitenden Elite das Bild einer stärker von oben nach unten und zentralistischer organisierten Kirche, mit fester formulierten Glaubenssätzen und einer verbindlichen, organisierten Frömmigkeitspraxis. Parallel zu der politischgesellschaftlichen Entwicklung der konservativ-bürgerlichen Mehrheit ins weiter rechts stehende und völkische Lager hinein, vollzog auch die Mehrheit der kirchenleitenden Elite in Hamburg eine Orientierung nach rechts. Dies führte dazu, dass in der Entscheidungsphase des Jahres 1933 ein Umbruch in der Hamburgischen Landeskirche vollzogen werden konnte, der zuvor nicht möglich gewesen war: die Einführung des Landesbischofsamtes und die hierarchische Umstrukturierung der vormals traditionell kollegial organisierten Landeskirche. Das zentrale Anliegen dieser kirchlichen Leitungsebene war wie eingangs beschrieben der unbedingte Wille, wieder zu einer wahren Volkskirche zu gelangen, wodurch wiederum starke Parallelen zur politischen Sphäre hergestellt wurden: Die große Koalition der konservativen Eliten 1933 hatte zum offiziellen Ziel die Gesundung des deutschen Staates mit Hilfe des propagandistischen Instruments der wahren Volksgemeinschaft. Von kirchlicher Seite war diese wahre Volksgemeinschaft nur durch eine Rückbesinnung auf christliche Grundsätze zu erreichen. Eine Sicht, die auf nationalsozialistischer Seite ihre Entsprechung zu haben schien, da der Programmpunkt 24 der NSDAP bezeugte, dass die Partei auf der Basis eines positiven Christentums stehe. Neue Wege der Verkündigung Auf Basis dieser Überzeugung war von kirchenleitender Seite, genauso wie aus Kreisen des ebenfalls stark konservativ geprägten evangelischen Vereinswesens eine grundsätzlich große Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der neuen Regierung nach Januar bzw. März 1933 vorhanden. Diese Bereitschaft dehnte sich auf alle Bereiche evangelischen Lebens aus: Sowohl in der evangelischen Jugend wie in der Wohlfahrtsarbeit, im täglichen Gemeindeleben wie in Verkündigung und Seelsorge kam man der neuen Zeit entgegen und bemühte sich
20 20 Evangelisches Leben in Hamburg zwischen 1933 und 1945 etwa durch große volksmissionarische Initiativen die Menschen dort abzuholen wo sie standen, um sie zurück zu gewinnen für die Kirche. Hier an St. Jacobi lassen sich diese Verflechtungen v. a. an der Person Pastor Stuewers aufzeigen. Robert Stuewer, geboren 1892 in Hamburg als Sohn eines Großkaufmanns und Fabrikbesitzers, besuchte das Hamburger Johanneum und studierte danach in Heidelberg, Berlin und Leipzig Theologie. Er nahm als Soldat am Ersten Weltkrieg teil und war 1925 als Gemeindepastor und Leiter des Kirchlichen Presseamtes im Nebenamt nach St. Jacobi berufen worden. Stuewer war Anfang der 1930er Jahre 1. Vorsitzender des Bürgervereins Altstadt und seit 1933 Mitglied der NSDAP. Seit Anfang 1933 engagierte er sich stark für den Auf- und Ausbau der Glaubensbewegung Deutsche Christen, die eine enge Verbindung von Nationalsozialismus und evangelischer Kirche anstrebten. In den Deutschen Christen sah Stuewer die zweifache Möglichkeit: 1. die Kirche im nationalsozialistischen Sinne zu beeinflussen und auf diesem Wege positive Veränderungen für die Kirche zu bewirken und 2. durch die Deutschen Christen in die nationalsozialistische Bewegung von kirchlicher Seite missionarisch hineinwirken zu können, so wie Stuewer dies bereits vor 1933 in den konservativen Bürgervereinskreisen betrieben hatte. Stuewer war einer der engagiertesten Deutschen Christen unter den Hamburger Pastoren, der v. a. in der Anfangszeit etliche Vorträge, auch in anderen Hamburger Gemeinden hielt, um die Gedanken und das Programm der Deutschen Christen in den Gemeinden zu verbreiten. Nach deren Einfluss- und Bedeutungsverlust hielt sich Stuewer nach 1937 zur Nationalkirchlichen Einung Deutscher Christen, dem losen Zusammenschluss einer extremen Richtung der Deutschen Christen, und beherbergte in seinem Pastorat deren Geschäftsstelle. Stuewer stritt zwar nach 1945 ab, sehr engagiert in dieser Vereinigung gewesen zu sein und betonte, dass dies nur ein sehr loser Zusammenschluss war, innerhalb dessen die einzelnen landeskirchlichen Gruppierungen ein sehr eigenständiges und selbstbestimmtes Leben pflegten, jedoch zeigen die von Pastor Stuewer vorgenommenen liturgischen Eingriffe in die bestehenden Regelungen an St. Jacobi, dass es ihm mit der von den extremen deutsch-christlichen Richtungen vorangetriebenen Ausmerzung des jüdischen Einflusses auf die evangelische Verkündigung sehr ernst war: Er weigerte sich nicht nur, Lieder zu singen in denen die Worte Jehova oder Zion vorkamen, er lehnte es auch zeitweise ab, seine Gebete mit Amen zu schließen allerdings wie er nach 1945 meinte aus linguistischen Gründen und um die Fremdworte aus der kirchlichen Sprache zu entfernen. Auch seine Konfirmanden ließ Pastor Stuewer eine ganz neue Form von Bekenntnis und Gelübde in ihrem Konfirmationsgottesdienst sprechen. Eine Veränderung, die Teile des Kirchenvorstandes dazu brachten, sich beim Landesbischof über Pastor Stuewer zu beschweren. Dies jedoch ohne Erfolg, da Landesbischof Tügel seit 1935 zunehmende Schwierigkeiten mit Regierung und NSDAP hatte und meinte Pastor Stuewer als Parteigenossen und Deutschen Christen nicht suspendieren zu können, ohne große Probleme mit der Partei bzw. dem Staat zu bekommen. Für die Konfirmation hatte Stuewer ganz neue Formen der kirchlichen Feier ausgearbeitet, für die er zum Teil auch eigene Texte verfasste. Ein Beispiel hierfür ist das Bekenntnis und
21 21 Evangelisches Leben in Hamburg zwischen 1933 und 1945 Gelübde, das er seine Konfirmanden Ende der 1930er Jahre sprechen ließ und das eher an einen Fahneneid erinnert: Pastor: Was unsern Vätern gross und tief ins Herz gebrannt, - Mit neuem Wort sei es von euch bekannt! Konfirmanden im Wechsel-Sprechchor: Alle: Wir stehen hier mit unserm jungen Blut. Wir grüssen Gott als unser höchstes Gut. Mädchen: Wir grüssen Gott, der uns den grünen Maien bringt Wir grüssen Gott, der uns aus Vogelliedern singt. Knaben: Wir grüssen Gott, der aus der Wolke auf uns regnet. Wir grüssen Gott, der uns mit seiner Sonne segnet. Mädchen: Wir danken Gott, der uns gesunden Leib gegeben. Wir danken Gott, für unser frisches, junges Leben. Knaben: Wir danken Gott in alle Ewigkeiten, dass wir als junge Menschen durch sein Deutschland schreiten. Pastor: Dies Deutschland hat uns Gott so tief ins Herz gesenkt,/ dass, wer es nennt, an alles Heilige, Grosse denkt,/ was in uns lebt und brennt und was uns Gott getan:/ Wir deutschen beten gläubig Gott, den Vater, an./ Und: Jesus Christus! Gottes Sohn und rechtes Kind Alle: Durch den wir alle Gottes Kinder worn sind. Pastor: Er kam in eine Welt voll Winternacht und Not.. Knaben: Und gab den Herzen Licht und Kraft und Gottesbrot! Pastor: Wo Wunden waren, heilte helfend seine Hand Mädchen: Der Heiland war er da mit frohem Mund genannt. Pastor: Das Herz griff gläubig auf die frohe Botschaft sein Alle: Des Himmels Herrschaft trug er in die Welt hinein! Pastor: Durch Kreuz und Sterben ging sein Gottesweg ins Licht. Mädchen: Wer diesen Weg nicht kennt, kennt Gottes Wunder nicht. Pastor: So ward er unser Heimweg an des Vaters Herz Knaben: Pastor: Alle: An seiner Hand find t alles Leben heimwärts. Die Welt ward jung aus seines Glaubens Sieg und kraft. / Ihr seid drum, junge Deutsche, seine Jüngerschaft./ Der Heiland ist des ewgen Vaters Erdgesicht,/ und auch sein Mund uns lauter Gottesworte spricht./ Er ist s der auf des Himmels Schleusen reisst,/ dass in die Herzen strömet Gottes heiliger Geist./ So lasset, junge Deutsche dieses Geistes Weh n/ Als starkes Leuchten über eurem Leben steh n. Was von deinen Erdgeschenken du uns gibst, ist heilig Gut/ Eltern, Brüder, - Volk und Freiheit, - heilig durch der Liebe Glut./ Wir aus Erde, - staubgeboren, - sind von heilger Lust durchbebt/ Durch das Licht der reinen Sehnsucht, - das aus deinem Wesen lebt.
22 22 Evangelisches Leben in Hamburg zwischen 1933 und 1945 Pastor: Ihr jungen Deutschen, die wir lieben und umschliessen/ Mit unsrer Herzen Wunsch und Hoffnung und Gebet:/ Wir haben euch des Glaubens hohen Weg gewiesen;/ Die Stunde ist, da ihr am Scheidewege steht./ Erkennt nun den Weg, den ihr erwählen sollt,/ und saget frei und fromm, dass ihr ihn gehen wollt./ Da euer Leben Lehen ist, das Gott gehört, -/ Wollt ihr ihm dienen treu und lebenslang? so sprecht:/ Wir wollen es! Alle: Wir wollen es! Pastor: Der euch auch liebte bis in seinen bittern Tod Wollt ihr ihn wiederlieben?, sprecht vor Gott: Wir wollen es! Alle: Wir wollen es! Die kirchliche Umstrukturierung und ihre Folgen Auf landeskirchlicher Ebene vollzog auch die Hamburger Landeskirche in der Folge der so genannten mentalen Machtergreifung im Frühjahr 1933, im Rahmen der reichsweiten Debatten eine weitgehende Umstrukturierung ihrer Organisation: Ein Ermächtigungsgesetz hob die geltende Verfassung zu Gunsten eines zentralen Führers auf, des neuen Landesbischofs Simon Schöffel. Alle bis dahin geteilten Kompetenzen von Synode, Kirchenrat und Senior wurden in einer Person vereinigt bis zu einer in Aussicht gestellten abschließenden Neuordnung der Kirche. Die Hamburger Kirche wurde ebenso wie die anderen 28 evangelischen Landeskichen im Deutschen Reich entsprechend dem politischen Führerprinzip autoritär umstrukturiert, das traditionell kollegiale Leitungsverständnis durch eine von Hauptpastor Heinz Beckmann so bezeichnete Kirchenrevolution beendet. Nachfolger des abgesetzten Seniors, des Hauptpastors von St. Jacobi Karl Horn, wurde der St. Michaelishauptpastor Schöffel. Er wurde aufgrund des wachsenden Drucks durch die Deutschen Christen 1934 durch deren Führer Tügel abgelöst, der bis 1945 Landesbischof der Hamburger Kirche blieb und seit Ende 1934 Nachfolger des ehemaligen Seniors Horn als Hauptpastor an St. Jacobi war. Die Umstrukturierung der Landeskirche zog auf allen Ebenen von Kirche, Gemeinden und evangelischen Vereinen Veränderungen nach sich, die sich bis ins tägliche evangelische Leben auswirkten. Die evangelische Jugend Hamburgs beispielsweise wurde zunächst im Juli 1933 zu einem Evangelischen Jugendwerk zusammengefasst und im Dezember 1933 durch einen reichsweiten Einigungsvertrag zwischen dem Reichsbischof Müller und dem Reichsjugendführer Baldur von Schirach gegen den Willen der evangelischen Jugendführer in die Hitlerjugend (HJ) eingegliedert. Faktisch bedeutete das für die Gruppen der Christlichen Jugendmännervereine, die weibliche evangelische Jugend Hamburgs oder die Pfadfinder, dass sie nur als Mitglieder der HJ auch einem evangelischen Jugendverband angehören durften. Für die Praxis evangelischer Jugendarbeit bedeutete das eine enorme Anpassung an die Dienstzeiten der HJ sowie den Verlust vieler Mitglieder, die entweder nicht in die HJ eingegliedert werden wollten, oder aus Zeitgründen oder weil die HJ attraktiver war, als das aller bündi-
23 Evangelisches Leben in Hamburg zwischen 1933 und schen und aufregenden Elemente beraubte evangelische Jugendleben, ausschieden. Das evangelische Jugendleben wurde zunehmend in seinen Möglichkeiten beschnitten: Zuerst wurde das Tragen von eigener Kluft und Wimpeln verboten und im Laufe der Zeit immer mehr Veranstaltungen untersagt. Ausflüge, Fahrten, Sport und Spiele, sogar das Singen von Volksliedern wurde verboten, da sich die evangelische Jugendarbeit nur auf den Bereich der Verkündigung und der Besprechung religiöser Inhalte beschränken sollte. Anders gestaltete sich die Eingliederung für die keinem Verband angeschlossenen freien Gemeindejugendgruppen: Sie mussten zunächst nicht in die HJ eingegliedert werden, erst mit der Einführung der Staatsjugend 1936 änderte sich auch für diese evangelischen Jugendgruppen der Alltag. Zur Eingliederung ist auch aus St. Jacobi ein Brief Pastor Ernst Fischers des zweiten Gemeindepastors an St. Jacobi neben Pastor Stuewer überliefert. Fischer teilte dem Landesbischof am 14. Februar 1934 kurz mit, dass die Jugendgruppen Stuewers und seine eigenen keinem Verband angeschlossen, dennoch viele seiner Jugendlichen bereits in die HJ eingetreten seien. Er habe das gegenüber den Jugendlichen befürwortet, da sie die Verbindung einer losen Zugehörigkeit zu uns nicht aufgaben. Fischer erläuterte: Ich empfehle meiner Jugend in die H.J. einzutreten und in freier loser Form bei uns zu bleiben. Das muss dann von Fall zu Fall von Jungens und Mädels in den nächsten Wochen selbst geschehen. Lose Gemeindegruppen können keinen Vertrag abschliessen. Von meinen über 18 Jahre alten Jungens habe ich kürzlich 12 in die SA angemeldet nach vorheriger Rücksprache mit einem Sturmhauptführer. Wie hier deutlich wird, gab es für die Hamburger evangelischen Gemeinden demnach zwei Möglichkeiten: Entweder sie lösten ihre Verbandsjugend auf, dann war es den Jugendlichen freigestellt, in die HJ einzutreten und sich an die Gemeinde in loser Form zu halten, oder die Gemeinden gliederten ihre Verbandsjugend geschlossen in die HJ ein. In manchen Fällen kam es auch vor, dass Jugendliche sich nicht eingliedern ließen und austraten, um der Eingliederung zu entgehen, in der Regel entschied aber der Pastor oder einer der jugendlichen Führer in den evangelischen Jugendgruppen mit ihrer Empfehlung oder Ablehnung gegenüber den Jugendlichen über den Eintritt oder Nicht-Eintritt in die HJ. Viele Hamburger Pastoren empfahlen den Jugendlichen in die HJ einzutreten, die Pastoren an St. Jacobi befürworteten eine Mitgliedschaft ausdrücklich, auch die von dem Eingliederungsvertrag nicht betroffenen über 18 Jahre alten Jugendlichen führten sie der SA zu. Trotz aller Einschränkungen und Umstrukturierungen fanden viele freundschaftlich verbundene evangelische Jugendgruppen in den Gemeinden einen Weg, um sich weiter treffen zu können. Viele Jugendliche bemühten sich, beides zu vereinen, sie waren zwar in der HJ, nahmen jedoch zugleich an evangelischen Jugendgruppen teil. Besonders die Konfirmation und der vorbereitende Unterricht wurde weiterhin von der überwiegenden Mehrheit der evangelischen Jugendlichen in Hamburg in Anspruch genommen. Die Konfirmandenzahlen hielten sich zwischen 1933 und 1945 auf einem hohen Niveau, auch wenn vermehrt jüngere HJ- oder Jungvolkführer den Konfirmanden Probleme machten, indem sie sie nicht dienstfrei stellten und ihnen damit die Teilnahme an den Sonntagsgottesdiensten oder den
24 24 Evangelisches Leben in Hamburg zwischen 1933 und 1945 verpflichtenden Konfirmandenstunden unmöglich machten. Eine große Zahl von Briefen, die sich mit diesem Problem beschäftigten, kann in den Archiven der Hamburger Kirche und ihrer Gemeinden gefunden werden. Zum Teil begrüßten die Pastoren aber auch die Einführung der HJ, da aus ihrer großteils militärisch geprägten Sicht der verlotterten Jugend ein wenig mehr Zucht und Ordnung nicht schaden konnte, was durch die vormilitärische Erziehung in der HJ gewährleistet war. Es kam aber auch vor, dass die in der Regel Jungen durch ihre HJ-Führer dazu angestachelt wurden, die Pastoren in ihrem Unterricht zu ärgern oder zu stören. Der Kirchenkampf Auf der Ebene der großen Kirchenpolitik entspann sich seit Ende 1933/Anfang 1934 eine innerkirchliche Auseinandersetzung zwischen den kirchenpolitischen Gruppierungen der Deutschen Christen und der aus Widerstand gegen die Einführung des Arierparagraphen in der Kirche entstandenen Bekennenden Kirche. In Hamburg nannte sich diese Gruppe Bekenntnisgemeinschaft und blieb organisatorisch relativ ungebunden. Diese als Kirchenkampf bezeichneten Auseinandersetzungen waren in Hamburg etwas anders ausgeprägt als in anderen Landeskirchen. Die Phasen der Auseinandersetzungen waren hier sehr stark von wenigen Personen und örtlichen Ereignissen bestimmt. So kam es etwa nach der skandalträchtigen Versammlung der Deutschen Christen im Sportpalast im November 1933 in Hamburg zunächst noch nicht zu großen Austrittswellen, sondern erst aus Solidarität zu dem von den Deutschen Christen angegriffenen Landesbischof Schöffel. Die kirchenpolitischen Auseinandersetzungen spielten zwar in der Folge noch eine Rolle innerhalb der kirchlichen Leitungsebenen, für die Räume evangelischen Lebens und somit die Frömmigkeitspraxis hatten sie jedoch nach 1934 weniger starke Auswirkungen. Landesbischofs Tügel, der noch auf der Welle des deutsch-christlichen Erfolges Anfang 1934 Landesbischof Schöffel im Amt des Landesbischofs gefolgt war, trat 1935 aus den Deutschen Christen aus und bemühte sich in der Folge intensiv darum, immer mehr Pastoren in seine kirchenpolitisch neutrale Ecke zu ziehen. Die Aufkündigung des theologischen Gehorsams, nicht aber des kirchenregimentlichen durch die Bekenntnisgemeinschaft in Hamburg Ende 1934 zeigt, wie wenig eindeutig die kirchenpolitische Lage sich in Hamburg gestaltete. Die Landeskirche war zwar nicht offiziell gespalten, aber auch nicht ganz einig. Durch den Befriedungskurs Tügels traten immer mehr Hamburger Pastoren in die neutrale Mitte und hielten sich aus den Streitigkeiten heraus. Unterhalb dieser von wenigen Pastoren ausgefochtenen kirchenpolitischen Auseinandersetzungen verlagerte sich die eigentliche Front jenseits der innerkirchlichen Parteien von Deutschen Christen und Bekennender Kirche Richtung Staat. Die von nationalsozialistischer Seite betriebene Entkonfessionalisierung des öffentlichen Lebens, die zunehmend Ausflüge, Fahrten oder Kaffekränzchen behinderte, bestimmte das tägliche Leben der meisten Gemeinden in viel stärkerem Maße, als die kirchenpolitischen Auseinandersetzungen. In einzelnen Kirchenvorständen wurden zwar noch heftige Kämpfe ausgetragen, hierbei dienten die Zugehörigkeiten zu Deutschen Christen oder Bekenntnis-
25 25 Evangelisches Leben in Hamburg zwischen 1933 und 1945 gemeinschaft jedoch häufig mehr als Mittel zur Fortsetzung alter Streitigkeiten. In St. Jacobi beispielsweise kam es zu heftigen Spannungen zwischen Pastor Stuewer und Pastor Fischer, die jedoch den bereits seit 1925 ausgetragenen Streitigkeiten sehr ähnlich waren und lediglich um eine politische Komponente erweitert wurden. Trotz der zunehmenden Einengung des evangelischen Lebens hielt die überwiegende Mehrheit der kirchenleitenden Elite an der Regierung fest. Die Entkonfessionalisierung des öffentlichen Lebens wurde überwiegend nicht als politische Verfolgung wahrgenommen. Im Gegenteil, die Mehrheit der Hamburger Pastoren war bis weit in den Krieg um eine positive Stellung zum Staat bemüht. Diese Vereinbarkeit von Protestantismus und Nationalsozialismus, die ihre Basis in der lutherischen Trennung der zwei Reiche hat und den nationalsozialistischen Staat bis zum Kriegsende als gottgesetzte Obrigkeit anerkannten, fand auch in der Abschiedspredigt Hauptpastor Horns vom 7. Oktober 1934 seinen Ausdruck: Das ist ja die letzte Sorge, das Vermächtnis des ehrwürdigen Vaters unseres Vaterlandes, Hindenburg, gewesen: Sorgen Sie, daß Christus im deutschen Volk gepredigt wird. Er hatte wahrlich Grund zu dieser Sorge. Denn Christus wird heute von weiten Kreisen gelästert oder doch beiseite geschoben und verachtet. Es ist wieder einmal eine tiefe Tragik in unserem deutschen Schicksal. Mit klopfendem Herzen, wie ein Wunder Gottes haben wir jetzt die völkische, die nationale und die soziale Erneuerung unseres Volkes erlebt. Aber zu der tiefsten, zuverlässigsten Erneuerung, der religiösen, kam es bei Unzähligen nicht. Von Gott ist uns der begnadete Führer gesandt; und in Demut und Dank hat er sich stets aufs neue zu seinem Gott bekannt. Aber so jubelnd ihm sonst die Massen folgen - zu Gott folgen ihm Unzählige nicht. [...] Wir nehmen den Kampf auf: Mit Hitler und gegen das moderne Heidentum! Die Kirche Christi hat schon andere Kämpfe bestanden. Und je weniger sie diesen Kampf politisch, und je mehr sie ihn rein religiös führt, desto gewisser ist ihr der schließliche Sieg. Deutsch-national und konservativ eingestellt, dem Gedanken der lutherischen Lehre von den Zwei-Reichen verhaftet, autoritär und patriarchalisch geprägt, befürwortete die Mehrheit der kirchenleitenden Elite die Politik des Staates und sah in den wachsenden Schwierigkeiten für die Kirche nach 1934 meist keinen Fehler des Staates der ja sich zu einem positiven Christentum bekannt hatte sondern in dem Abfall von Gott vieler Menschen, der sich in dem Zulauf zu den neu aufkommenden heidnischen Glaubensbewegungen niederschlug. Die wesentlichen Grundzüge des nationalsozialistischen Terrorregimes wurden somit von der Mehrheit bis Ende der 1930er Jahre mit getragen, da sie zumindest zu Beginn nicht als Terror, sondern als ordnungsstaatliche Maßnahmen angesehen wurden. Im Falle der politischen Verfolgung von Sozialdemokraten und Kommunisten etwa entsprach dies ja der politischen Einstellung der kirchenleitenden Mehrheit, die in den antikirchlichen Bolschewisten schon vor 1933 einen Hauptgegner sahen. Als die nationalsozialistische Unterdrückungsmaschinerie schließlich in eine gezielte Verfolgung und Vernichtung von Menschen umschlug, war es für einen offenen Widerspruch bereits in vieler Hinsicht zu spät.
26 26 Evangelisches Leben in Hamburg zwischen 1933 und 1945 Kirche und nationalsozialistische Verfolgung Inwiefern die Verfolgung, Unterdrückung und Vernichtung von Menschen während der nationalsozialistischen Zeit in evangelischen Kreisen wahrgenommen wurde, kann nicht belegt werden. Dass die Einrichtung von Konzentrationslagern, die Verfolgung und Unterdrückung bestimmter Menschen und Menschengruppen aus politischen, rassischen oder eugenischen Gründen wahrnehmbar war, ist mittlerweile hinreichend nachgewiesen worden. Ein Ergebnis der Untersuchung evangelischer Überlieferung dieser Zeit ist, dass es zu diesem Themenspektrum so gut wie keine Quellen, keine Aussagen, auch fast keine nach 1945 nachträglich aufgezeichneten Dokumente gibt. Dass das Thema aber auch unter den evangelischen Christen präsent gewesen sein muss, belegen die wenigen vorhandenen Quellen ausreichend. In St. Jacobi lässt sich dieses Schweigen der Akten ebenfalls beobachten. Als kleiner Splitter der dieses Kapitel evangelischer Kirchengeschichte streift, lässt sich im Archiv der Jacobigemeinde folgende Geschichte finden: In dem Protokoll der Sitzung des Kirchenvorstandes vom Februar 1933 heißt es: Der Vorsitzende teilt mit, dass eine Beschwerde seitens eines Herrn R. eingelaufen sei, dass im St. Jacobikirchenchor unter den Erwachsenen sonntäglich ein Jude mit Namen W. mitsänge. Erkundungen haben ergeben, dass der Beschwerdeführer R. aus der Kirche ausgetreten sei, dass er einen Prozess gegen W. verloren habe und dass bei dieser Beschwerde weniger Kirchliches Interesse als Motiv vermutet werden dürfe, als ein persönliches Rachebedürfnis. Herr W., der im Chor mitsingt, sei nach Angabe des Kantors Bertram eine wertvolle Stimme seines Chores, er sei tatsächlich Jude, aber seine Frau sei evangelisch, auch die Kinder seien evangelisch getauft und würden evangelisch erzogen. Auch wenn der Beschwerdeführer darauf hingewiesen hätte, dass er im Hamburger Tageblatt und in anderen Zeitungen den Vorfall veröffentlichen würde, falls er nicht geändert würde, bittet der Vorsitzende von einer Änderung abzusehen. Im Kirchenrecht befindet sich keine Bestimmung, die die konfessionelle Zugehörigkeit der Chorsänger zur Kirche verlange, ausserdem hätte kein Gemeindeglied bisher daran Anstoss genommen, ferner sei es wohl nicht richtig auf eine solche Beschwerde eines Aussenstehenden einzugehen, der keinerlei Beziehungen zur Jakobikirche habe. Pastor Stuewer bittet um eine grundsätzliche Klärung der Frage. Der Chor habe seine Darbietungen nicht nur als Kunst vorzutragen, sondern sie müssten im Gottesdienst betend von den Sängern erlebt werden. Pastor Fischer wendet sich dagegen, unser Jakobikirchenchor sei ein bezahlter Chor, Chöre, die betend im Gottesdienst mitwirkten, seien freiwillige Chöre. Von unserm Kirchenchor werden musikalische Leistungen verlangt, weiter nichts. Der Vorsitzende erwähnt, dass die Chormitglieder nicht zu den Ministranten eines Gottesdienstes zu rechnen seien. Der Kirchenvorstand beschließt auf die Beschwerde nicht einzugehen. Im Protokoll vom 6. März 1933 ist vermerkt, dass das Chormitglied W. zum 1. April seinen Austritt aus dem Chor angezeigt habe. Der Kirchenvorstand unterstützte die politisch und
27 27 Evangelisches Leben in Hamburg zwischen 1933 und 1945 rassistisch motivierte Anzeige eines Kirchenfernen gegen das jüdische Chormitglied zwar nicht, nahm aber auch nicht Stellung dazu. Dass das Chormitglied zum 1. April austrat, wird ebenfalls nicht kommentiert. Auch über die Familie des jüdischen Chormitglieds sind keine weiteren Informationen bekannt. In der Hamburgischen Landeskirche wurde während der nationalsozialistischen Zeit im Gegensatz zu anderen Landeskirchen kein so genannter Arierparagraph eingeführt. Obwohl Landebischof Tügel ein überzeugter Antisemit war, half er von Nürnberger Gesetzen betroffenen ihm persönlich bekannten Menschen, z. B. auch einem befreundeten Pastor, den er in der Hamburgischen Landeskirche beschäftigte. Auch für andere Pastoren ist eine eindeutig antisemitische Haltung und Einstellung belegbar, dadurch jedoch, dass es keine kirchenrechtlichen Bestimmungen über den Umgang mit evangelischen Christen jüdischer Herkunft gab, blieb die Behandlung dieser Frage überwiegend dem Einzelnen überlassen. Auch der Ausschluss der nichtarischen Christen aus den Landeskirchen 1941 wurde von Landesbischof Tügel nicht offiziell kommentiert oder kirchenrechtlich verankert, der Ausschluss dieser Gemeindeglieder aus den Gemeinden blieb daher jeder Gemeinde und ihrem Pastor selbst überlassen wie oft dies vorkam ist nicht nachvollziehbar wie oft es nicht vorkam aber auch nicht. In Bezug auf die Verfolgungs- und Vernichtungspolitik des nationalsozialistischen Systems bleibt jedoch festzuhalten, dass die evangelische Kirche in Hamburg keine offizielle Äußerung zu den politischen Verfolgungen, zu den Verhaftungen von Pastoren oder von nichtarischen Christen sowie den auch in den Alsterdorfer Anstalten durchgeführten Euthanasiemaßnahmen getätigt hat. Bis heute ist keine offizielle Stellungnahme zu dieser Frage aus der Hamburgischen Kirche zu vernehmen gewesen. Das vom Kirchenkreis Alt-Hamburg als Nachfolger der ehemaligen Hamburgischen Landeskirche angestoßene und finanzierte Projekt zur Aufarbeitung dieser Geschichte rund 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist die erste von der Kirche selbst in Auftrag gegebene zusammenhängende kritische Darstellung der eigenen Geschichte für die Öffentlichkeit. Ein Schuldbekenntnis auch das Stuttgarter Schuldbekenntnis von 1945 wurde von der Hamburgischen Kirche bis heute nicht offiziell verkündet oder veröffentlicht. Der Zweite Weltkrieg in den Gemeinden Ein Grund für die mangelnde Bereitschaft nach 1945 kritisch mit der eigenen Vergangenheit umzugehen ist der Zweite Weltkrieg und seine Folgen. Durch den Luftkrieg kam es zu einer weitgehenden Zerstörung vorhandener kirchlicher Strukturen und einer unter den Bedingungen des Krieges sich verschärfenden Beschränkung kirchlicher Wirkungsmöglichkeiten: Die kirchliche Presse wurde 1941 angeblich aus Papiermangel eingestellt, die Betreuung der an der Front stehenden Gemeindeglieder wurde beschränkt, die Mitwirkung kirchlichen Beistands bei öffentlichen Trauerfeiern wurde abgelehnt und anderes mehr. Diese Einschränkungen evangelischen Lebens bewirkten, dass ein großer Teil der evangelischen Christen in Hamburg seit 1943 eine Art vorgezogener Entnazifizierung durchlebten. Die
28 28 Evangelisches Leben in Hamburg zwischen 1933 und 1945 innere Distanz zum nationalsozialistischen Regime vergrößerte sich durch die schweren Folgen des Krieges. Die propagierte Volksgemeinschaft begann sich an den Rändern aufzulösen und die Mehrheit richtete sich in einer Zusammenbruchsgesellschaft ein, die bis weit nach dem Krieg Bestand hatte und im Bereich des Alltäglichen über die Zäsur von 1945 große Kontinuitätslinien spann. Wie sich im Krieg an Jacobi seit der Verschärfung des Luftkriegs das Leben gestaltete, schildert sehr plastisch ein Tätigkeitsbericht der Gemeindeschwestern Olga Brösen und Schwester Anni Glür für die Zeit vom 24. Juli bis zum 31. August Da er ein sehr eindringliches Bild davon gibt, wie sich der Bombenkrieg auf das tägliche evangelische Leben auswirkte, soll er hier in einer längeren Passage zitiert werden. Er zeigt aber darüber hinaus einen Aspekt gemeindlichen Lebens, der hier noch nicht zur Sprache kommen konnte, der aber insgesamt eines der Hauptstandbeine gemeindlichen Lebens bildete: die gemeindliche Liebestätigkeit. Ausgeübt wurde diese durch die Gemeindeschwestern. Ihnen zur Seite stand meist eine Gruppe aktiver evangelischer Christinnen, die über ihre Bindung an die gottesdienstliche Gemeinde hinaus im Rahmen der so genannten Gemeindepflege ihr Christentum auch praktisch durch ihr wohltätiges Engagement lebten. Sie bildeten in vielen Gemeinden einen wichtigen Kern, der allerdings im Rahmen der bislang gepflegten kirchenpolitisch geprägten und männlich dominierten Kirchengeschichte genau wie das Leben der Jugend in den Gemeinden nicht dargestellt wurde. Vor allem im Krieg bewährten sich diese Kreise häufig als Rückhalt und Zufluchtsstätte, auch in seelsorgerlicher Hinsicht, wie beispielsweise der Bericht der Gemeindeschwestern aus St. Jacobi zeigt: Am Sonnabend, den kam ich von der Reise zurück. Bei dem Alarm suchte ich den Bunker der Kirche auf. Es fielen verschiedene Brandbomben auf und um die Kirche, die von Herrn Pastor entdeckt und von den Wachen gelöscht wurden. Während des Angriffs wurde uns mitgeteilt, daß wir ungefähr 800 Obdachlose im Gemeindehaus aufnehmen müßten. Gleich nach der Entwarnung strömten die Leute zum Teil recht verletzt und beschmutzt ins Haus. Gas gab es nicht, sodaß wir im Keller den Herd heizten, um Kaffee und am Tag Suppen zu kochen. Wasser und Licht war zum Glück noch da. Frauenschaft und NSV stellten Hilfe. Es wurden Butterbrote gestrichen und Kaffee gereicht. Ich reinigte und verband die Verletzten, bettete die Elenden in meiner Wohnung. Die Leute konnten z. T. zu Bekannten und Verwandten angeschoben werden, wurden aber sofort durch Neue abgelöst, sodaß ich Tag und Nacht beschäftigt war. Von Dienstag auf Mittwoch, in der Nacht vom 27. zum 28. Juli kam dann der zweite schwere Angriff. Ich ging nicht in den Bunker, weil Fräulein Reese eine Reihe obdachloser Säuglinge und Kleinkinder im Hause hatte. Zunächst ließen wir sie schlafen, als aber das Sausen der Bomben einsetzte, und unsre Türen aufschlugen, hüllten wir sie in Decken und hielten sie auf dem Arm. Die Kinder schrien. Wir konnten kaum hören, was über uns vor sich ging. Plötzlich hörten wir Hilferufe. Im Landeskirchenamt brannte es. Wir schlugen die Durchbruchstelle ein, telephonierten zum Kirchenbunker, und Herr Pastor Boyens kam mit zwei jungen Leuten und bald war das Feuer gelöscht. Auch in der Kirche wurden zwei Brandbomben gelöscht. In der Bugenhagenstraße, uns gegenüber brannte der Dachstuhl des Klöp-
29 29 Evangelisches Leben in Hamburg zwischen 1933 und 1945 perhauss. Ich nahm die Gardinen vom Fenster, damit sie nicht Feuer fingen. Der Feuersturm war mächtig. Man konnte die Türen kaum öffnen. Eine Brandbombe fiel vor unserer Haustür auf die Straße. Nach der Entwarnung kamen wieder neue Obdachlose und Verletzte und dazu viele, die noch kein Unterkommen gefunden hatten und nur während des Alarms in Bunkern waren, zurück. Nun war auch kein Licht mehr. Wasser lief noch langsam aus einem einzigen Hahn im Keller. Die Arbeit wurde noch sehr erschwert durch die lange Dunkelheit und die Tagalarme. Der Abtransport wurde immer wieder dadurch verzögert. Dazu kamen aus allem Stadtteilen Schutzsuchende Mütter mit Kleinkindern und Säuglingen, für die wir besonders kochen mussten. Milch und Nährmittel wurden dafür geliefert. Da waren uns unsere Hauswartsfrau Frau Barwick und ihre Tochter eine große Hilfe. Aus der Gemeinde wurden uns Kohlen eimerweise geschenkt, die wir heranschleppen mußten. (...) Wir hatten inzwischen die gepackten Koffer aus unserm Keller in den Bunker getragen. Es stellte sich heraus, daß Balken durch die Brandmauern gelegt waren. So fingen bald rechts und links Landeskirchenamt und Pastor Stuewers Haus an zu brennen. Wir retteten aus Pastor Boyens Haus und aus dem Landeskirchenamt möglichst viel wertvolles und trugen es in die Kirche. Gegen 10 Uhr morgens war das Feuer zunächst gelöscht, flackerte aber immer wieder auf. Wir mussten Wasser schleppen und mit der Handspritze in den verschiedenen Häusern löschen. Wir beide schliefen im Bunker und ließen den Wecker alle zwei Stunden ablaufen um wieder zu löschen. Das war noch mehrere Tag und Nächte nötig. Am Sonnabend den kam Schwester Anni Glüer um uns zu helfen. Darüber waren wir sehr froh. Wir mußten viel Wasser schleppen, holten es aus allen Tonnen der Kirche und erbaten uns jeden Tag einen Wagen der Feuerwehr, der uns die Tonnen wieder füllte. Trinkwasser holten wir aus der Mönckebergstr von Karstadt. Pastor Stüwers Haus brannte ganz aus. Pastorat Boyens nur oben z. T. Als der Regen einsetzte, mußten Pastor Boyens und Schwester Anni oft stundenlang schippen und Möbel rücken, damit nicht durch Wasser verdorben würde, was das Feuer verschont hatte. Da der Keller des Gemeindehauses zu heiß war, zogen wir am Montag in die verlassene Webersche Wohnung, wo ein Kohleherd vorhanden war. Schwester Dora aus der Krippe kam täglich einige Stunden und kochte für uns. Tagsüber war auch als einziger vom Landeskirchenamt Herr Oberkirchenrat Pietzcker da und war unermüdlich beim Löschen tätig. Ab Mittwoch kamen Herrn vom Landeskirchenamt zu Nachtwachen, sodaß wir nachts schlafen konnten. Es waren einige Kranke in der Gemeinde zu versorgen. Für verschiedene arbeitende Gemeindeglieder kochten wir und trugen Essen aus. Schwester Anni machte sich daran, die Kirche auszuräumen und sauber zu machen, damit am 8.8. Gottesdienst gehalten werden konnte. Wir machten Plakate an die Trümmer der St. Georger und Stiftskirche. So fand sich eine kleine Gemeinde von reichlich 60 Leuten zusammen. Etwa 40 nehmen an der Abendmahlsfeier teil. (...)
30 30 Wiederholen, Durcharbeiten, Erinnern Warum sich mit der eigenen Geschichte beschäftigen? Wiederholen, Durcharbeiten, Erinnern Prof. Wulf-Volker Lindner Warum sich mit der eigenen Geschichte beschäftigen? Wenn wir fragen, warum sich Menschen mit ihren eigenen Biographien und Historiker sich wissenschaftlich mit Geschichte befassen, so muss die Antwort lauten: Gegenwartsfragen treiben sie, und die Beschäftigung mit der Geschichte soll diese Fragen beantworten. Der Baseler Neutestamentler und Psychoanalytiker Hartmut Raguse macht dies an einem Beispiel aus dem Alten Testament deutlich. 1 Bei der Landnahme befiehlt Josua den Trägern der Bundeslade, am Ufer des Jordan zwölf Steine niederzulegen, die dort verbleiben sollen und zur Zeit des Autors vielleicht noch zu sehen waren. (Josua 4,1ff.) Dort heißt es weiter: Wenn eure Kinder später einmal fragen: Was bedeuten euch diese Steine?, so sollt ihr ihnen sagen: Weil das Wasser des Jordan weggeflossen ist vor der Lade des Bundes des Herrn, als sie durch den Jordan ging, sollen diese Steine für Israel ein ewiges Andenken sein. (Josua 4,6b-7) Die zwölf für sich genommen bedeutungslosen Steine aus dem Jordan erhalten ihren Sinn nur als Zeichen für eine Geschichte: Gott hat sein Volk durch diesen Fluss geführt und so bewahrt. Es geht also darum, sich in der Gegenwart des Heils der Vergangenheit zu versichern, um die grundlegenden Tatsachen der Vergangenheit zu aktualisieren. Uns beschäftigen gegenwärtig individuell wie gemeinsam andere Fragen: Warum habe ich diese oder jene Krankheit bekommen? - Warum haben rechtsextreme Parteien auch unter jungen Menschen einen so großen Zulauf? - Warum gibt es zwischen Israelis und Palästinensern wechselseitig so viel Unversöhnlichkeit? Warum gibt es die Konflikte zwischen Schiiten und Sunniten im Irak? Wollen wir Antworten auf diese und andere Fragen haben, hoffen wir, dass wir in der Geschichte Antworten finden, die allein auf die Gegenwart bezogene Betrachtungen und Untersuchungen nicht hergeben. Der Arzt versucht, eine Vorstellung von unserer Krankengeschichte zu bekommen und sie mit den aktuellen Untersuchungen zu verbinden, um ein möglichst plastisches Bild von der Art und Schwere unserer Erkrankung zu gewinnen. Journalisten und Historiker fragen nach den geschichtlichen Zusammenhängen von brennend aktuellen, politischen Gegenwartsfragen, um die Gegenwart besser zu verstehen. Erinnerungen allerdings, die nur wie zwölf Steine an einem Fluss stehen, ohne dass wir ihre Geschichte kennen, bleiben stumm, sind wie tote Erinnerungsmale oder Denkmäler, ohne erkennbare Bedeutung zur Gegenwart. Solche Erinnerungsmale sind in individuellen Lebensgeschichten, aber auch in der erzählten und geschriebenen Geschichte von Völkern zu finden.
31 31 Wiederholen, Durcharbeiten, Erinnern Von der Wiederinszenierung vergessener Geschichten im Hier und Jetzt Menschen, ganz gleich aus welchen Kulturkreisen sie kommen oder welche Sozialisationen sie hatten, laufen mit so genannten Suchbewegungen herum und versuchen, ihre unbewusst gewordenen innerseelischen Konflikte und strukturellen Störungen, die alle einmal in Beziehungen entstanden sind, Beziehungen zu sich selbst und den bedeutsamen anderen der eigenen Lebensgeschichte, wieder in Szene zu setzen. Das tun Menschen ständig im Lebensalltag, in den Beziehungen zu denen, mit denen sie zusammen leben und arbeiten, in der Beschäftigung mit Themen und vielem anderen mehr. Warum tun sie dies? Sigmund Freud beantwortete diese Frage damit, dass er auf den Wiederholungszwang verwies, 2 Joseph Sandler nannte die Suche nach Sicherheit als Ursache 3 und Karl König und der Autor fügten diesen Antworten den Aspekt der Familiarität hinzu. 4 In unserem Zusammenhang ist wichtig, sich klar zu machen, das die Wiederinszenierungen unbewusst gewordener innerseelischer Konflikte auch stumme Erinnerungsleistungen sind. Wenn jemand mit seinem Verhalten andere im Hier und Jetzt in seine Lebensgeschichte hineinzieht, lässt er Vergangenes wieder lebendig werden. Das Prekäre dieser Erinnerungsleistung ist nur, dass die Beteiligten davon nichts wissen, weil das Wiederinszenierte solange unverstanden bleibt, wie seine Bedeutung nicht entschlüsselt werden kann. Es ist dann so, wie wenn Menschen am Jordan zwölf Steine herumstehen sehen, ohne die Geschichte aus dem Josuabuch dazu zu kennen. Die Psychoanalyse und Gruppenanalyse gibt solchen unbewussten Wiederinszenierungen Räume zur möglichst ungestörten Darstellung und versucht sie dann mit Hilfe psychoanalytischer Wahrnehmungseinstellung und Interpretation zu verstehen und zu deuten. Dadurch soll das im Hier und Jetzt zwar Anwesende, aber noch nicht wirklich Erinnerte verstanden, benannt und in Erinnerung überführt werden. Exkurs: Erinnern und Falsch-Erinnern. Perspektiven der Neurobiologie und Neurophysiologie Die moderne Hirnforschung macht deutlich, dass die Vorstellung vom Gedächtnis als einer Art Computer Festplatte, auf der einmal gespeicherte Daten im Originalzustand festgehalten werden, die seit Platos berühmten Ausführungen zum Erinnern das Denken geprägt haben, falsch ist. 5 Gedächtnisinhalte können sich vielmehr, während sie im Gehirn schlummern, in verschiedenster Weise verändern und werden dann in veränderter Form erinnert. Es können sogar Erlebnisse erinnert werden, die es gar nicht gab. Erinnertes wird in dem Augenblick, in dem es erinnert wird, jeweils neu in einem komplexen Prozess aus dem, was abgespeichert wurde, und Hinweisreizen aus dem aktuellen Erlebnisraum rekonstruiert. 6 Schon Sigmund Freud war übrigens davon überzeugt, dass Erinnerungen, die das Erinnerte aus einer Beobachterperspektive (z.b. mein erster Schultag) wiedergeben, modifizierte Versionen von Erinnerungen sind, an denen wir selbst als Handelnde teilgenommen haben. Im Hinblick auf das Langzeitgedächtnis unterscheidet man heute zwischen einem
32 32 Wiederholen, Durcharbeiten, Erinnern expliziten, autobiographisch episodischen und einem impliziten Gedächtnis, das Fertigkeiten, z.b. Fahrradfahren, Klavierspielen, aber auch andere Erfahrungen enthält, die nicht benannt, aber vorgeführt werden können oder sich im Verhalten darstellen. Viele unbewusst gewordene konflikthafte Erfahrungen aus den ersten Lebensmonaten, die nicht erinnert werden können, weil das Gehirn zum Zeitpunkt der Erfahrung noch gar nicht ausgereift und zu sprachlich symbolischer Kodierung in der Lage war, werden in diesem impliziten Gedächtnis aufbewahrt und über die Wiederinszenierung im Hier und Jetzt aktualisiert. Ein Prinzip, nach dem das Gedächtnis funktioniert, ist z.b. die Tiefenkodierung: Wenn sich ein neuer Inhalt mit vorhandenen Inhalten sinnvoll verbinden lässt, wird er eher eingebunden und leichter erinnert, als wenn das nicht der Fall ist. Dem Gehirn kommt es offenbar darauf an, die Komplexität des Wahrgenommenen in gestalthaften Zusammenhängen zu begreifen und auf diese Weise die Komplexität zu reduzieren. Ein anderes Prinzip ist das so genannte petites-madeleines Phänomen, benannt nach Marcel Prousts Beschreibung in seinem Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Die Mutter von Marcel Proust hatte ihm an einem Wintertag, als sie sah, dass er fror, einen Lindenblütentee angeboten. Er tauchte gedankenverloren ein Gebäck, eine petite madelaine, in den Tee und im selben Moment tauchte höchst lebendig eine Erinnerung an seine Tante Léonie in Combray auf, die ihm früher in seiner Jugend immer eben diesen Lindenblütentee mit petites madeleines angeboten hatte. Er sah, roch und fühlte die Wohnstube in Combray, und eine Fülle von Erinnerungen überschwemmten ihn. Die Eigenschaften eines Abrufreizes bestimmen also die Erinnerung wesentlich mit. Das Gehirn funktioniert offensichtlich auch nach dem Prinzip, dass es an Gewohntem festhält und damit die Wahrnehmung seiner aktuellen Umgebung manipuliert. Es wird also eher Bekanntes als Neues wahrgenommen. Irritierend sind auch diejenigen Studien der modernen Gedächtnisforschung, die die hohe Suggestibilität vieler Probanden belegen. Es gehört inzwischen zum Grundbestand der Erkenntnisse der modernen Hirnforschung, dass Gedächtnis und Erinnerung konstruktive, kreative, aber damit auch äußeren und inneren Einflüssen ausgesetzte, formbare Vorgänge sind. Nur eine genaue Analyse der Umstände, unter denen abgespeichert und erinnert wurde, vermag zu der Beurteilung beizutragen, ob das Erinnerte der Wahrheit entspricht oder nicht. Diese Erkenntnis ist von zentraler Bedeutung für die Psychotherapie, für die Geschichtsforschung und für die Rechtssprechung. Insofern belegt die moderne Neurobiologie und Neurophysiologie, was Alexander Mitscherlich 1975 den Kampf um die Erinnerung genannt hat. 7 Der Kampf um die Erinnerung - individuell Auch nach psychoanalytischer Auffassung hat die Wahrnehmung der Vergangenheit also mit Widerständen zu kämpfen. Die Psychoanalyse konzentriert sich auf die Untersuchung ihrer unbewussten Seiten. Wie sich dies vollzieht, schildert Thomas Auchter in einem Traum einer 36jährigen Patientin, die als Kind sexuelle Gewalterfahrungen erlitten hatte:
33 33 Wiederholen, Durcharbeiten, Erinnern Da ist ein Fluss oder ein Bach, mit ganz klarem Wasser. Man kann auf dem Grund jede Einzelheit erkennen. Ich laufe in dem Fluss oder Bach aufwärts in Richtung Quelle. Als ich schließlich an die Stelle komme, wo die Quelle ist, ist dort ein großer dunkler See. Das Wasser ist völlig undurchsichtig, man kann nicht auf den Grund sehen, es ist wie so eine schwarze glänzende Schicht auf der Oberfläche. 8 Auchter kommentiert den Traum seiner Patientin: Ihre Wanderung flussaufwärts symbolisiert die Spurensuche nach ihrer Vergangenheit. An der Quelle (ihres Traumas) angekommen, verdunkelt sich die Erinnerung und wird undurchsichtig, Wirkung ihrer seelischen Widerstände. 9 Diese Frau bringt in Erfahrung, was Grundbestand psychoanalytischer Einsichten ist. Alle Lebenserfahrungen werden als sinnliche Erlebnisse zunächst im Körper und ins Verhalten eingeschrieben, wie in die Jahresringe oder Rinde eines Baumes. Bei manchen Menschen ist das direkt in ihrem Gesicht, an ihrer Haut, an ihrer Haltung und ihren Bewegungsabläufen zu sehen, bei anderen aus ihren Krankengeschichten zu erfahren. Unbewusst inszeniert sie ihren traumatischen Konflikt in Traumbildern im Hier und Jetzt: Du darfst das Schreckliche nicht erinnern! Warum? Die Angst davor wäre in einer Psychoanalyse zunächst aufzuklären, denn an ihr vorbei gibt es kein Verstehen, keine Erinnerung und auch keine Überwindung des Traumas. - in der Gruppe der Besucher der Wehrmachtsaustellung am 14. Juni 1999 In der Zeit vom 1. Juni bis zum 11. Juli 1999 hatte ich für Besucher der Ausstellung Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht des Hamburger Instituts für Sozialforschung in den Ausstellungsräumen der Freien Akademie der Künste in Hamburg fünf Wochen nacheinander montags von bis Uhr eine offene Gesprächsgruppe angeboten. In ihr sollte den Besucherinnen und Besuchern Gelegenheit gegeben werden, sich über die Eindrücke, Erinnerungen und Fragen auszutauschen, die die Bilder der Ausstellung in ihnen hervorgebracht hatten. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war nicht begrenzt; man musste sich auch nicht dazu verpflichten, an allen Sitzungen teilzunehmen. Insgesamt nahmen 80 Personen an dieser Gesprächsgruppe teil, 10 von ihnen an drei Sitzungen. Montag, 14. Juni Diesmal sind überraschend viele Personen gekommen. Ich freue mich, dass wir diese Gruppensitzung in vorderen Ausstellungsraum in einer großen Runde von über 20 Personen machen können. Wir beginnen erst um Uhr, weil die letzten Besucherinnen und Besucher der Ausstellung gegangen sein müssen, bevor wir starten können. In der Zeit bis dahin fange ich an, Stühle in einen großen Kreis zu stellen. Dabei helfen mir spontan einige, die sich damit als Interessierte an der Gesprächsgruppe zu erkennen geben, was zur ersten gemeinsamen Aktion führt.
34 34 Wiederholen, Durcharbeiten, Erinnern Heute sind eine sechs Personen starke Eltern-Initiativ Gruppe Kosovokrieg und zwei junge Gymnasiasten mit dabei. Nach meiner Eröffnung wundert sich eine Frau aus der Elterninitiative, dass es Menschen gibt, die sich gegen diese Ausstellung hoch erregt und lauthals wehren würden. Am Wochenende habe doch eine Demonstration gegen die Ausstellung stattgefunden, oder nicht? Wieder ist es wie beim letzten Mal offenbar zunächst leichter möglich, in ein Gespräch ü- ber die Wirkung der Bilder hineinzukommen, wenn man erst einmal über die anderen spricht. Die Initiative der Frau wird von anderen aufgenommen, insbesondere von zwei weiblichen Mitgliedern dieser Eltern Initiativ Gruppe Kosovokrieg. Sie machen sehr deutlich, dass sie das auf den Bildern und in den Texten der Ausstellung Dargestellte sozusagen 1:1 mit dem parallelisieren möchten, was gerade im Kosovokrieg passiert. Auf der Beziehungsebene appellieren sie, deutlich moralisch entrüstet, an die Gewissen der Gruppenteilnehmerinnen und teilnehmer. Sie rufen zu politischem Handeln auf. Die beiden jungen Gymnasiasten parieren diesen Aufruf wohltuend sachlich und entkoppeln damit die beiden Zeiten und Juni Sie machen als 16-, 17jährige deutlich, dass sie sich selbst von den Bildern nicht so emotional angesprochen fühlen und dass sie das Schreckliche auf diesen Bildern auch nicht so unvermittelt mit dem Geschehen im Kosovo in Verbindung bringen wollen wie die beiden Frauen aus der Generation ihrer eigenen Eltern. Diese kühlere, rationalere Entgegnung der Jüngeren löst bei den beiden Mitvierzigerinnen eine Verstärkung ihrer Emotionen und Appelle aus. So gleitet das Gespräch zunächst zwischen und 1999 und zwischen beiden Generationen hin und her. Ich habe diese psychosoziale Kompromissbildung etwas später mit folgenden Worten angesprochen: Das Gespräch hat heute damit eingesetzt, dass sich jemand darüber wunderte, wie sich Fremde, die nicht hier sind, so emotional und lauthals gegen die Ausstellung wehren könnten. Dann steuerte das Gespräch auf die Parallele zwischen dem Vernichtungskrieg und dem Kosovo Krieg 1999 bzw. auf die Unterschiede zwischen beiden Kriegen hin. Mir kommt es so vor, wie wenn es zunächst leichter sein könnte, über die heftigen Gefühle und die heftige Abwehr gegen die Aussagen der Bilder und Texte dieser Ausstellung anderer zu sprechen als über das, was diese Bilder und Texte in uns selber auslösen. Daraufhin ergriff eine Teilnehmerin das Wort und erzählte in erstaunlicher Offenheit davon, dass sie Tochter eines Jagdfliegers sei. Sie habe in ihrer Jugend mit ihrem Vater nicht über seine Erfahrungen im Krieg sprechen können. Vater habe geschwiegen. Erst durch die Fernsehaufnahmen aus den Cockpits amerikanischer Bomber während des zweiten Irakkrieges ausgelöst, sei Vater, der die CNN Kriegsberichte davon nächtelang im Fernsehen verfolgt habe, regelrecht dekompensiert. Vater lebe nach dem Tode der Mutter allein in einem wunderschönen Haus am Rande einer Stadt und könne von seinem Zimmer aus auf einen Wald wie auf eine grüne Wand sehen. Ihr sei nun klar, warum Vater dieses Haus mit dieser (nicht vorhandenen) Aussicht auf die grüne Wand des Waldes gebaut habe. Nach einem CNN
35 35 Wiederholen, Durcharbeiten, Erinnern Bericht sei er eines Nachts beim Aufstehen von seinem Sofa gestürzt und habe sich das gesunde Bein gebrochen; im Kriege sei er abgeschossen worden und habe ein Bein verloren. Das gesunde Bein habe er sich nun am Oberschenkelhals gebrochen. Erst nach dem Unfall habe Vater sie, die Ärztin sei, angerufen und mit ihr über seine Kriegserlebnisse zu reden begonnen. Diese Gespräche mit Vater hätten sie als Tochter ihrem Vater wieder näher gebracht, so dass sie ihn deswegen jetzt noch mehr als früher liebe. Nach längerem Schweigen beginnt eine zweite Frau Mitte Vierzig zu sprechen. Auch sie ist Tochter eines Jagdfliegers und erzählt ähnliches wie ihre Vorrednerin. Sie macht darüber hinaus deutlich, dass sie es sei, die die Erzählungen ihres Vaters nicht hören könne und wolle, sie also das Reden des Vaters abwehre, weil sie fürchte, dadurch werde ihr inneres Bild von ihm zerstört. Die beiden Jagdflieger Töchter nicken einander mehrfach zu. Sie haben ihre Schicksalsgemeinschaft erkannt. Die zweite Rednerin sagt, sie sei in diese Ausstellung und in diese Gruppe gekommen, um andere zu finden, die vielleicht etwas Ähnliches erlebt hätten wie sie. Die Bilder und Texte der Ausstellung sind nun unabweisbar mitten in der Runde, sie haben zumindest zwei Gruppenteilnehmerinnen direkt erreicht und in ihnen Töchter Väter Geschichten ausgelöst. Ich habe den Eindruck, dass viele in der großen Runde von den ganz persönlichen und offenen Worten der beiden bewegt worden sind. Aber gegen dieses Persönlich Berührt Werden regt sich auch Opposition. Eine Frau, auch Mitvierzigerin, fragt die zweite Kampfflieger Tochter, wie ich finde, wenig einfühlsam und sehr direkt: Wann hat denn Ihr Vater zu sprechen angefangen?! Da ich die Gefragte schützen möchte, sage ich zu ihr, die direkt neben mir sitzt (sie hat sich sicherlich den Platz neben mir, dem Gruppenleiter, aus bestimmten Gründen gewählt): Achtung, passen Sie auf, ob sie auf diese Frage, die nach sehr Intimem fragt, antworten möchten. Das greift die Fragende, die vor sich einen Block auf den Knien hat, in dem sie sich Stichworte notiert (ich phantasiere: Sollte sie eine Journalistin sein?) etwas pikiert auf: Ich habe ja nur gefragt! Ob mein Gegenüber antworten möchte, kann sie ja selber entscheiden! Und die Gefragte antwortet: Mein Vater hat zu reden begonnen, als er zu sterben begann. Das macht die Initiantin aus der Eltern Initiativ-Gruppe Kosovokrieg sehr ärgerlich: So machen es die Alten. Müllen uns kurz vor ihrem Tod noch mit ihrer unbewältigten Vergangenheit zu! Und wir müssen dann zusehen, wie wir mit ihrem Unbewältigten fertig werden. Das macht mich richtig wütend! Eine längere Schweigepause entsteht. Ich habe den Eindruck, als ob in der Gruppe augenblicklich die Kräfte, die die Wirkung der Bilder und Texte der Ausstellung im eigenen Erleben und in der eigenen Familiengeschichte zur Sprache bringen möchten, gegen die Kräfte kämpfen, die sich davor schützen und darum abwehren müssen. Dieser Schutz und diese Abwehr haben eine wichtige Funktion. Das hat die Gruppenteilnehmerin, die zuletzt gesprochen hat, deutlich zum Ausdruck gebracht: Die Elterngeneration hat uns mit ihrer unbewältigten Schuld zugemüllt. Und wir sollen diese für sie tragen. Geben wir sie ihnen doch zurück!
36 36 Wiederholen, Durcharbeiten, Erinnern In diesem Sinne versuche ich, auf die Frau einzugehen. Mir kommt es so vor, als ob sie sich tatsächlich als Müll-Schuld Schluckerin ihrer Eltern erlebt hat bzw. vielleicht sogar von ihnen missbraucht worden ist und sich deswegen dagegen aggressiv wehren muss. Während ich ihr zugewandt mit ihr rede, nickt sie und signalisiert mir damit, dass ich vielleicht etwas von dem verstanden habe, was sie zum Ausdruck zu bringen versuchte. Das Thema der Schuld der Väter und der eigenen Schuld (Kosovo Krieg) wird nun noch einmal aufgegriffen, und zwar in dem Sinne, dass es vor dem Schuldig Werden offenbar kein Entrinnen gibt. Als ich nach einem längeren Schweigen das Wort ergreife und sage, dass nach meinen Erfahrungen diejenigen, die in einer Gruppe lange Zeit nichts gesagt haben, für alle anderen Wichtiges in sich bewahren und dass es für uns alle wertvoll sein könnte, wenn sie versuchten, zum Ausdruck zu bringen, was sie in der letzten halben Stunde gefühlt und gedacht hätten, sagt ein Mann, so um die 50, aus der Eltern Initiativ Gruppe Kosovokrieg, dass es offenbar sehr schwer sei, die eigene Wahrnehmung für die Wirklichkeit frei von Propaganda zu halten, damals wie heute. Darüber wird dann in der Gruppe bis zum Schluss zwischen den Generationen weiter gesprochen. - kollektiv Der israelische Psychologe Dan Bar-On, 1938 in Haifa als Sohn von Eltern geboren, die 1933 aus Deutschland geflohen waren, heute Professor an der Ben-Gurion Universität in Beer Sheva, hat sich in einer Reihe von Studien und Publikationen mit den Auswirkungen der Shoah auf die Kinder von Opfern und von Tätern auseinandergesetzt. 11 Mutig gegen den Strom einer bestimmten political correctness in Israel schwimmend, fragt Dan Bar-On danach, warum es nach Kriegsende nur in Ausnahmefällen Racheakte von verfolgten Juden an ihren Verfolgern gegeben hat, obwohl es damals zahlreiche Phantasien über Racheakte an den Deutschen gegeben habe. Auf diese Frage gibt es verschiedene Antworten. Eine lebenspraktische Erklärung antwortet: Die Holocaustüberlebenden waren von der Aufgabe, ihr Leben wieder aufzubauen so in Anspruch genommen, dass sie dafür keine Zeit und Kraft hatten. Eine moralisch motivierte Antwort lautet: Die Verfolgten wollten sich nicht auf das unmenschliche Niveau ihrer Verfolger herablassen und verzichteten deshalb auf Rache. Stattdessen seien sie gegenüber den Deutschen in Leidenschaftslosigkeit, Gleichgültigkeit und Tatenlosigkeit verfallen. Indirekte oder sublimierte Äußerungen von Rache hätten in keinem Verhältnis zur barbarischen Vernichtung der Juden gestanden. Dieser Tatbestand lässt Bar-On nun fragen: Wo sind die Wut- und Rachegefühle geblieben? In Anlehnung an den von Sigmund Freud beschriebenen Abwehrmechanismus der Identifikation mit dem Angreifer 12 führt Bar-On aus, dass es in einer stark asymmetrischen Machtbeziehung, in der der Unterdrückte in vollkommener und traumatischer Weise vom Unterdrücker abhängig ist, erstens zu solchen unbewussten Identifizierungen mit dem Aggressor
37 37 Wiederholen, Durcharbeiten, Erinnern kommt und zweitens ein anderes Opfer zur Abfuhr der eigenen Aggressionen gesucht wird. Letzteren Mechanismus bezeichnet Bar-On als Aggressionsverschiebung. Diese Einsichten in die Aggressionsabwehr und Aggressionsverschiebung seien von den Juden, so Bar-On, aufgrund der schwierigen moralischen und menschlichen Implikationen jahrelang verschwiegen worden. 13 Bis vor kurzem wäre ein solches Argument, besonders, wenn es von Nicht-Juden vorgetragen worden wäre, wahrscheinlich sofort als neue Form des Antisemintismus abgelehnt und dekonstruiert worden. 14 In zahlreichen Forschungsarbeiten, so kann Bar-On aufzeigen, wurde nachgewiesen, dass einige Überlebende ihre Aggressionen gegen ihre eigenen Kinder richteten. Andere Untersuchungen zeigen, dass afro asiatische Juden ihre internalisierten Aggressionen gegen die unterdrückte palästinensische Minderheit richteten, die sich in der Hackordnung der israelischen Gesellschaft noch weiter unten befand als sie selbst. 15 Auf dem Hintergrund dieser Untersuchungen stellt Bar-On nun die These auf, dass die entscheidende Zielgruppe der verschobenen Aggression jüdischer Israelis, die sich mit dem Holocaust konfrontiert sehen, die Palästinenser sind. 16 Vor allem die europäischen Juden hätten sich von Anfang an den Palästinensern überlegen gefühlt. Auf diese Weise sei es den vormals Verfolgten möglich geworden, in den Palästinensern eine minderwertige Gruppe auszumachen, an denen sie ihre kollektiv verschobene Aggression auslassen konnten. 17 Aufgrund einer solchen Konstruktion war es möglich, all die internalisierte Aggression, die sich nicht hatte gegen die eigenen Unterdrücker richten können, erfolgreich zu projizieren. Durch eine solche Rekonstruktion konnten Israelis auch völlig die Unterdrückung und das Leiden der Palästinenser ignorieren. Letztere reagierten auf diesen Prozess, indem sie das frühere Leiden der Juden ignorierten oder das, was den Juden von den Nazis während des Holocausts angetan worden war, dem gleichsetzen, was ihnen die Juden antaten. 18 Auf diese Weise werde aus dem ehemaligen Opferstatus der Gebrauch von Gewalt gerechtfertigt. Sowohl Israelis als auch Palästinenser tendierten dazu, den Schmerz im kollektiven Gedächtnis des jeweils anderen zu ignorieren. 19 In solchen Situationen ist es sinnlos, danach zu fragen, wer diesen Teufelskreis in Gang gesetzt hat. Überwunden werden kann er nur, wenn von Israelis wie Palästinensern gegenseitig beide kollektive Gedächtnisse anerkannt werden. Auf jeden Fall sollte dies zwischen den beiden Völkern im Nahen Osten geschehen, die beide Opfer dieses Prozesses geworden sind als Teil des Friedensprozesses und als Teil der eigenen Notwendigkeit, an den komplexen Nachwirkungen des Holocausts zu reifen, indem sich beide als Opfer des anderen erkennen lernen. 20 Zusammenfassung: Aus psychoanalytischer und gruppenanalytischer Perspektive wird ausgeführt, warum sich Menschen mit der eigenen Geschichte beschäftigen, auf welche Weisen sie im Hier und
38 38 Wiederholen, Durcharbeiten, Erinnern Jetzt ihre konflikthaften Vergangenheiten erinnern und welche Abwehr- und Verarbeitungsmechanismen dabei ins Spiel kommen. Dazu werden neuere Erkenntnisse der Neurobiologie und Neurophysiologie herangezogen. Der Kampf um die Erinnerung wird individuell angedeutet, vor allem aber am Beispiel der Verarbeitung der Wehrmachtsausstellung Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht des Hamburger Instituts für Sozialforschung durch eine Gruppe von Besucherinnen und Besucher am 14. Juni 1999 und an den Forschungen von Dan Bar-On zur notwendigen und schmerzlichen Erinnerungsarbeit von Israelis und Palästinensern dargestellt. 1 Hartmut Raguse, Erinnerung, Eingedenken und das Problem einer psychoanalytischen Hermeneutik, unveröffentlichter Vortrag auf der Tagung der Zeitschrift PSYCHE Vergangenes im Hier und Jetzt oder: Wozu noch lebensgeschichtliche Erinnerung im psychoanalytischen Prozeß? in Frankfurt/M. 2 Aus der Fülle der Belegstellen sei nur auf eine verweisen: Sigmund Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1917), Gesammelte Werke Bd. KI, London Joseph Sandler, The background of safety. International Journal of Psychoanalysis 41, S , Karl König und Wulff-Volker Lindner, Psychoanalytische Gruppentherapie, 2. Auflage Göttingen 1992, S. 56f. 5 Gerhard Roth, Fühlen, Denken, Handeln. Die neurobiologischen Grundlagen des menschlichen Verhaltens, Frankfurt Michael Huber, Erinnern und Falsch Erinnern. Perspektiven der Neurobiologie und Neurophysiologie, in: Thomas Auchter und Michael Schlagheck (Hg.): Theologie und Psychologie im Dialog über Erinnern und Vergessen, Paderborn 2004, S. 94ff. 7 Alexander Mitscherlich, Der Kampf um die Erinnerung. Psychoanalyse für fortgeschrittene Anfänger, München, Zürich Thomas Auchter, Die Fähigkeit zu erinnern und die Unfähigkeit zu erinnern. Eine psychoanalytische Perspektive, in Thomas Auchter und Michael Schlagheck (Hg.) a.a.o. S a.a.o. S s. Wulf-Volker Lindner, Von der Schwierigkeit, das Schweigen zu überwinden, in: Jahrbuch für Gruppenanalyse 1999, S Dan Bar-On, Die Last des Schweigens. Gespräche mit Kindern von Nazi Tätern, Frankfurt 1993; ders., Eine soziohistorische Diskussion dreier Fragen, in: Freie Assoziation 4, 2001, S : ders., Die Anderen in uns. Dialog als Modell der interkulturellen Konfliktbewältigung. Hamburg 2001 (Körber Stiftung); vgl. a. Thomas Auchter, Die Fähigkeit zu erinnern und die Unfähigkeit zu erinnern, in: Thomas Auchter und Michael Schlagheck (Hg.), a.a.o Sigmund Freud, Massenpsychologie und Ich Analyse ( 1921), Gesammelte Werke Bd. XIII, S. 121, London 1940f. 13 Dan Bar-On, Eine soziohistorische Diskussion dreier Fragen, a.a.o. S a.a.o. S a.a.o. S a.a.o. S a.a.o. S a.a.o.s a.a.o. S a.a.o. S.181
39 Die vorletzte Seite bleibt leer 39
40 40 Die letzte Seite bleibt leer
Arbeit und Vernichtung Das KZ Neuengamme, die Außenlager und der Häftlingseinsatz in der Kriegswirtschaft
 Detlef Garbe, Rede zur Eröffnung der Fotoausstellung in der Baracke 27 in Schwanewede anlässlich des 70. Jahrestag der Einrichtung des KZ-Außenlagers Bremen-Farge, 25.10.2013 Arbeit und Vernichtung Das
Detlef Garbe, Rede zur Eröffnung der Fotoausstellung in der Baracke 27 in Schwanewede anlässlich des 70. Jahrestag der Einrichtung des KZ-Außenlagers Bremen-Farge, 25.10.2013 Arbeit und Vernichtung Das
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Holocaust-Gedenktag - Erinnerung an die Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau (27. Januar 1945) Das komplette Material finden Sie hier:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Holocaust-Gedenktag - Erinnerung an die Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau (27. Januar 1945) Das komplette Material finden Sie hier:
Das Schicksal der Juden in Polen: Vernichtung und Hilfe
 Das Schicksal der Juden in Polen: Vernichtung und Hilfe Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs lebten rund 3,3 Millionen Juden in Polen. Nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939
Das Schicksal der Juden in Polen: Vernichtung und Hilfe Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs lebten rund 3,3 Millionen Juden in Polen. Nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939
Veranstaltungen der KZ-Gedenkstätte Neuengamme anlässlich des 70. Jahrestages des Kriegsendes und der Befreiung der Konzentrationslager
 Veranstaltungen der KZ-Gedenkstätte Neuengamme anlässlich des 70. Jahrestages des Kriegsendes und der Befreiung der Konzentrationslager 28. April 2015, 12.30-19.00 Uhr/29. April 2015, 10.00-20.30 Uhr/30.
Veranstaltungen der KZ-Gedenkstätte Neuengamme anlässlich des 70. Jahrestages des Kriegsendes und der Befreiung der Konzentrationslager 28. April 2015, 12.30-19.00 Uhr/29. April 2015, 10.00-20.30 Uhr/30.
Sinti und Roma im KZ Neuengamme
 Sinti und Roma im KZ Neuengamme Die erste Inhaftierungswelle von Sinti und Roma fand im Rahmen der im Sommer 1938 von der Polizei durchgeführten Aktion Arbeitsscheu Reich statt. Zunächst wurden Sinti und
Sinti und Roma im KZ Neuengamme Die erste Inhaftierungswelle von Sinti und Roma fand im Rahmen der im Sommer 1938 von der Polizei durchgeführten Aktion Arbeitsscheu Reich statt. Zunächst wurden Sinti und
Salzgitter-Drütte. KZ-Gedenkstätte Neuengamme Reproduktion nicht gestattet
 Salzgitter-Drütte Für die Granatenproduktion der Hütte Braunschweig richteten die Reichswerke Hermann Göring im Herbst 1942 ein Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme auf dem Werksgelände in Salzgitter
Salzgitter-Drütte Für die Granatenproduktion der Hütte Braunschweig richteten die Reichswerke Hermann Göring im Herbst 1942 ein Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme auf dem Werksgelände in Salzgitter
Arbeitsblätter zum Besuch der KZ-Gedenkstätte Sandhofen
 Arbeitsblätter zum Besuch der KZ-Gedenkstätte Sandhofen Die Handreichungen des Arbeitskreises Landeskunde/Landesgeschichte Region Mannheim erscheinen im Februar 2003. Vorab und mit Genehmigung des Stadtarchivs
Arbeitsblätter zum Besuch der KZ-Gedenkstätte Sandhofen Die Handreichungen des Arbeitskreises Landeskunde/Landesgeschichte Region Mannheim erscheinen im Februar 2003. Vorab und mit Genehmigung des Stadtarchivs
Livia Fränkel (links) und Hédi Fried
 Livia Fränkel (links) und Hédi Fried 1946 (Privatbesitz Hédi Fried) Hédi Fried, geb. Szmuk * 15.6.1924 (Sighet/Rumänien) April 1944 Getto Sighet; 15.5.1944 Auschwitz; von Juli 1944 bis April 1945 mit ihrer
Livia Fränkel (links) und Hédi Fried 1946 (Privatbesitz Hédi Fried) Hédi Fried, geb. Szmuk * 15.6.1924 (Sighet/Rumänien) April 1944 Getto Sighet; 15.5.1944 Auschwitz; von Juli 1944 bis April 1945 mit ihrer
Cap Arcona Die Schiffe
 Cap Arcona Die Schiffe Die Cap Arcona auf der Unterelbe. Postkarte der Reederei Hamburg-Süd (zwischen 1935 und 1939). (ANg, NHS 13-7-8-2) KZ-Gedenkstätte Neuengamme Reproduktion nicht gestattet 2 Cap Arcona
Cap Arcona Die Schiffe Die Cap Arcona auf der Unterelbe. Postkarte der Reederei Hamburg-Süd (zwischen 1935 und 1939). (ANg, NHS 13-7-8-2) KZ-Gedenkstätte Neuengamme Reproduktion nicht gestattet 2 Cap Arcona
Ausstellung Que reste t il de la Grande Guerre? Was bleibt vom Ersten Weltkrieg?
 Ausstellung Que reste t il de la Grande Guerre? Was bleibt vom Ersten Weltkrieg? Der Erste Weltkrieg: Ein Konflikt gekennzeichnet durch massenhafte Gewalt 1. Raum: Die Bilanz: eine zerstörte Generation
Ausstellung Que reste t il de la Grande Guerre? Was bleibt vom Ersten Weltkrieg? Der Erste Weltkrieg: Ein Konflikt gekennzeichnet durch massenhafte Gewalt 1. Raum: Die Bilanz: eine zerstörte Generation
Begleitprogramm zur Ausstellung in Hamburg vom 6. November bis zum 7. Dezember 2016 in der Hauptkirche St. Katharinen
 Vernichtungsort Malyj Trostenez Geschichte und Erinnerung Begleitprogramm zur Ausstellung in Hamburg vom 6. November bis zum 7. Dezember 2016 in der Hauptkirche St. Katharinen Zur Erinnerung an die Deportation
Vernichtungsort Malyj Trostenez Geschichte und Erinnerung Begleitprogramm zur Ausstellung in Hamburg vom 6. November bis zum 7. Dezember 2016 in der Hauptkirche St. Katharinen Zur Erinnerung an die Deportation
Friedrich-Wilhelm Rex
 Friedrich-Wilhelm Rex * 8.9.1912 (Berlin-Neukölln), nicht bekannt Hilfsarbeiter; 1933 Reichsarbeitsdienst; 1940 Ostfront; 1944 Waffen-SS, Wachmann im KZ Auschwitz; Januar 1945 KZ Mauthausen; Februar 1945
Friedrich-Wilhelm Rex * 8.9.1912 (Berlin-Neukölln), nicht bekannt Hilfsarbeiter; 1933 Reichsarbeitsdienst; 1940 Ostfront; 1944 Waffen-SS, Wachmann im KZ Auschwitz; Januar 1945 KZ Mauthausen; Februar 1945
Inhaltsverzeichnis. Das Ghetto von Kaunas in Litauen(Kovno) 3 Ghetto Kauen. 3 Besetzung. 4 Ghetto. 4 KZ-Stammlager
 Inhaltsverzeichnis Das Ghetto von Kaunas in Litauen(Kovno) 3 Ghetto Kauen 3 Besetzung 4 Ghetto 4 KZ-Stammlager Das Ghetto von Kaunas in Litauen(Kovno) Ghetto Kauen Das Konzentrationslager (KZ) Kauen entstand
Inhaltsverzeichnis Das Ghetto von Kaunas in Litauen(Kovno) 3 Ghetto Kauen 3 Besetzung 4 Ghetto 4 KZ-Stammlager Das Ghetto von Kaunas in Litauen(Kovno) Ghetto Kauen Das Konzentrationslager (KZ) Kauen entstand
Gerhard Poppenhagen. (BArch, BDC/RS, Poppenhagen, Gerhard, 26.9.1909)
 Gerhard Poppenhagen 1938 (BArch, BDC/RS, Poppenhagen, Gerhard, 26.9.1909) * 26.9.1909 (Hamburg), 6.1.1984 (Hamburg) Kaufmann; Angestellter der Kriminalpolizei; 1933 SS, SD; ab 1940 KZ Neuengamme: bis 1943
Gerhard Poppenhagen 1938 (BArch, BDC/RS, Poppenhagen, Gerhard, 26.9.1909) * 26.9.1909 (Hamburg), 6.1.1984 (Hamburg) Kaufmann; Angestellter der Kriminalpolizei; 1933 SS, SD; ab 1940 KZ Neuengamme: bis 1943
Widerstand und Überleben
 Widerstand und Überleben Die Poträts der 232 Menschen, die aus dem 20. Deportationszug in Belgien befreit wurden, am Kölner Hauptbahnhof 26./27.1. 2008 Eine Aktion der Gruppe Bahn erinnern GEDENKEN UND
Widerstand und Überleben Die Poträts der 232 Menschen, die aus dem 20. Deportationszug in Belgien befreit wurden, am Kölner Hauptbahnhof 26./27.1. 2008 Eine Aktion der Gruppe Bahn erinnern GEDENKEN UND
Der Prozess gegen Dr. Kurt HeiSSmeyer. Dokumente
 Der Prozess gegen Dr. Kurt HeiSSmeyer Dokumente Der Prozess gegen Dr. Kurt HeiSSmeyer Dokumente Schreiben des Ministeriums für Staatssicherheit Magdeburg, 22.11.1958. Im November 1958 ermittelte das Ministerium
Der Prozess gegen Dr. Kurt HeiSSmeyer Dokumente Der Prozess gegen Dr. Kurt HeiSSmeyer Dokumente Schreiben des Ministeriums für Staatssicherheit Magdeburg, 22.11.1958. Im November 1958 ermittelte das Ministerium
Es gilt das gesprochene Wort
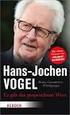 Rede OB in Susanne Lippmann anlässlich einer Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag am Sonntag, 13. November 2011, am Ehrenmal auf dem Münsterkirchhof Es gilt das gesprochene Wort 2 Anrede, es ist November,
Rede OB in Susanne Lippmann anlässlich einer Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag am Sonntag, 13. November 2011, am Ehrenmal auf dem Münsterkirchhof Es gilt das gesprochene Wort 2 Anrede, es ist November,
Josefine: Und wie wollte Hitler das bewirken, an die Weltherrschaft zu kommen?
 Zeitensprünge-Interview Gerhard Helbig Name: Gerhard Helbig geboren: 19.09.1929 in Berteroda lebt heute: in Eisenach Gesprächspartner: Josefine Steingräber am 21. April 2010 Guten Tag. Stell dich doch
Zeitensprünge-Interview Gerhard Helbig Name: Gerhard Helbig geboren: 19.09.1929 in Berteroda lebt heute: in Eisenach Gesprächspartner: Josefine Steingräber am 21. April 2010 Guten Tag. Stell dich doch
Anlage von Massengräbern für die Toten der Thielbek und Cap Arcona in Neustadt-Pelzerhaken, Mai Foto: unbekannt. (ANg)
 Das Schaufeln von Gräbern Anlage von Massengräbern für die Toten der Thielbek und Cap Arcona in Neustadt-Pelzerhaken, Mai 1945. Beisetzung Bei der Hebung der Thielbek" im Februar 1950 wurden auch menschliche
Das Schaufeln von Gräbern Anlage von Massengräbern für die Toten der Thielbek und Cap Arcona in Neustadt-Pelzerhaken, Mai 1945. Beisetzung Bei der Hebung der Thielbek" im Februar 1950 wurden auch menschliche
Kriegsgefangenenfriedhof Oerbke
 Kriegsgefangenenfriedhof Oerbke Foto: Peter Wanninger, 2010 Sie waren da draußen, ohne Baracken, Tag und Nacht waren sie da draußen im Februar, bei minus 20 Grad. Aus einem Gesprächsprotokoll v. G.Pierre
Kriegsgefangenenfriedhof Oerbke Foto: Peter Wanninger, 2010 Sie waren da draußen, ohne Baracken, Tag und Nacht waren sie da draußen im Februar, bei minus 20 Grad. Aus einem Gesprächsprotokoll v. G.Pierre
Entwicklung, Herrschaft und Untergang der nationalsozialistischen Bewegung in Passau 1920 bis 1945 Wagner
 Geschichtswissenschaft 9 Entwicklung, Herrschaft und Untergang der nationalsozialistischen Bewegung in Passau 1920 bis 1945 von Christoph Wagner Auflage Entwicklung, Herrschaft und Untergang der nationalsozialistischen
Geschichtswissenschaft 9 Entwicklung, Herrschaft und Untergang der nationalsozialistischen Bewegung in Passau 1920 bis 1945 von Christoph Wagner Auflage Entwicklung, Herrschaft und Untergang der nationalsozialistischen
DIE FOLGEN DES ERSTEN WELTKRIEGES Im Jahr 1918 verlieren die Deutschen den Ersten Weltkrieg und die Siegermächte GROßBRITANNIEN, FRANKREICH und die
 DIE FOLGEN DES ERSTEN WELTKRIEGES Im Jahr 1918 verlieren die Deutschen den Ersten Weltkrieg und die Siegermächte GROßBRITANNIEN, FRANKREICH und die USA besetzten Deutschland. Deutschland bekommt im VETRAG
DIE FOLGEN DES ERSTEN WELTKRIEGES Im Jahr 1918 verlieren die Deutschen den Ersten Weltkrieg und die Siegermächte GROßBRITANNIEN, FRANKREICH und die USA besetzten Deutschland. Deutschland bekommt im VETRAG
Meine Erfahrungen mit NS-Gedenkstätten
 Geschichte Patrick Hillegeist Meine Erfahrungen mit NS-Gedenkstätten oder über meinen Umgang mit einer deutschen Identität und Erinnerungskultur Essay Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig
Geschichte Patrick Hillegeist Meine Erfahrungen mit NS-Gedenkstätten oder über meinen Umgang mit einer deutschen Identität und Erinnerungskultur Essay Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig
I. KZ Dachau Die Mörderschule der SS
 Sperrfrist: 05.05.2013, 10:45 bis 12:30 Uhr Es gilt das gesprochene Wort Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Bernd Sibler, anlässlich der Gedenkfeier zum
Sperrfrist: 05.05.2013, 10:45 bis 12:30 Uhr Es gilt das gesprochene Wort Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Bernd Sibler, anlässlich der Gedenkfeier zum
Verbotsschild. Im Flugzeug
 Verbotsschild Der heutige Jean-Dolidier-Weg war bis in die 1960er-Jahre gesperrt. Der Besuch des ehemaligen Lagergeländes musste auch danach noch bei der Gefängnisbehörde beantragt werden. Foto: Ute Wrocklage,
Verbotsschild Der heutige Jean-Dolidier-Weg war bis in die 1960er-Jahre gesperrt. Der Besuch des ehemaligen Lagergeländes musste auch danach noch bei der Gefängnisbehörde beantragt werden. Foto: Ute Wrocklage,
DAS JAHRHUNDERT DER LAGER
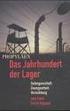 Joel Kotek/Pierre Rigoulot DAS JAHRHUNDERT DER LAGER Gefangenschaft, Zwangsarbeit, Vernichtung A 2002/3034 Propyläen INHALT Einführung 11 Lager oder Gefängnis? 12 Lager für Soldaten und Lager für Zivilisten
Joel Kotek/Pierre Rigoulot DAS JAHRHUNDERT DER LAGER Gefangenschaft, Zwangsarbeit, Vernichtung A 2002/3034 Propyläen INHALT Einführung 11 Lager oder Gefängnis? 12 Lager für Soldaten und Lager für Zivilisten
15 Minuten Orientierung im Haus und Lösung der Aufgaben, 30 Minuten Vorstellung der Arbeitsergebnisse durch die Gruppensprecher/innen.
 Vorbemerkungen A. Zeiteinteilung bei einem Aufenthalt von ca.90 Minuten: 25 Minuten Vorstellung der Villa Merländer und seiner früheren Bewohner durch Mitarbeiter der NS-Dokumentationsstelle, danach Einteilung
Vorbemerkungen A. Zeiteinteilung bei einem Aufenthalt von ca.90 Minuten: 25 Minuten Vorstellung der Villa Merländer und seiner früheren Bewohner durch Mitarbeiter der NS-Dokumentationsstelle, danach Einteilung
Schautafel-Inhalte der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Bremen zur Nakba-Ausstellung
 Schautafel-Inhalte der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Bremen zur Nakba-Ausstellung Die Nakba-Ausstellung will das Schicksal und das Leid der palästinensischen Bevölkerung dokumentieren. Wer ein Ende
Schautafel-Inhalte der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Bremen zur Nakba-Ausstellung Die Nakba-Ausstellung will das Schicksal und das Leid der palästinensischen Bevölkerung dokumentieren. Wer ein Ende
Fred Löwenberg. Januar 2000. (ANg, 2000-1231)
 Januar 2000 (ANg, 2000-1231) * 19.4.1924 (Breslau), 30.5.2004 (Berlin) Sozialistische Arbeiterjugend; 1942 Verhaftung; Gefängnis Breslau; KZ Buchenwald; 26.10.1944 KZ Neuengamme; Dezember 1944 Außenlager
Januar 2000 (ANg, 2000-1231) * 19.4.1924 (Breslau), 30.5.2004 (Berlin) Sozialistische Arbeiterjugend; 1942 Verhaftung; Gefängnis Breslau; KZ Buchenwald; 26.10.1944 KZ Neuengamme; Dezember 1944 Außenlager
über das Maß der Pflicht hinaus die Kräfte dem Vaterland zu widmen.
 Sperrfrist: 16. November 2014, 13.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der
Sperrfrist: 16. November 2014, 13.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der
Es erfüllt mich mit Stolz und mit Freude, Ihnen aus Anlass des
 Grußwort des Präsidenten des Sächsischen Landtags, Dr. Matthias Rößler, zum Festakt anlässlich des 10. Jahrestages der Weihe in der Neuen Synagoge Dresden am 13. November 2011 Sehr geehrte Frau Dr. Goldenbogen,
Grußwort des Präsidenten des Sächsischen Landtags, Dr. Matthias Rößler, zum Festakt anlässlich des 10. Jahrestages der Weihe in der Neuen Synagoge Dresden am 13. November 2011 Sehr geehrte Frau Dr. Goldenbogen,
Es war keinesfalls das Ende der Verluste. Die Einnahme von Schlüsselburg fiel mit heftigen Luftangriffen auf Leningrad selbst zusammen, bei welchen
 Es war keinesfalls das Ende der Verluste. Die Einnahme von Schlüsselburg fiel mit heftigen Luftangriffen auf Leningrad selbst zusammen, bei welchen unter anderem auch das größte Lebensmittellager der Stadt
Es war keinesfalls das Ende der Verluste. Die Einnahme von Schlüsselburg fiel mit heftigen Luftangriffen auf Leningrad selbst zusammen, bei welchen unter anderem auch das größte Lebensmittellager der Stadt
Schindlers Liste eine Annäherung an den Holocaust mittels eines Filmabends
 VI 20./21. Jahrhundert Beitrag 14 Schindlers Liste (Klasse 9) 1 von 18 Schindlers Liste eine Annäherung an den Holocaust mittels eines Filmabends Thomas Schmid, Heidelberg E uropa am Beginn der 40er-Jahre
VI 20./21. Jahrhundert Beitrag 14 Schindlers Liste (Klasse 9) 1 von 18 Schindlers Liste eine Annäherung an den Holocaust mittels eines Filmabends Thomas Schmid, Heidelberg E uropa am Beginn der 40er-Jahre
Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Schleswig-Holstein
 ACK-Richtlinien SH ACKSHRL 1.304-503 Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Schleswig-Holstein Stand 29. April 1999 1 1 Red. Anm.: Der Text der Neufassung wurde von der Kirchenleitung
ACK-Richtlinien SH ACKSHRL 1.304-503 Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Schleswig-Holstein Stand 29. April 1999 1 1 Red. Anm.: Der Text der Neufassung wurde von der Kirchenleitung
Die 1. Republik. erstellt von Alexandra Stadler für den Wiener Bildungsserver
 Die 1. Republik Die Österreicher waren traurig, weil sie den 1. Weltkrieg verloren hatten. Viele glaubten, dass so ein kleiner Staat nicht überleben könnte. Verschiedene Parteien entstanden. Immer wieder
Die 1. Republik Die Österreicher waren traurig, weil sie den 1. Weltkrieg verloren hatten. Viele glaubten, dass so ein kleiner Staat nicht überleben könnte. Verschiedene Parteien entstanden. Immer wieder
1806 Moisling wird ein Teil des Lübecker Stadtgebiets, aber die rund 300 Juden werden keine gleichberechtigten Bürger/innen der Hansestadt.
 Chronik 1656 Ansiedlung erster Juden in Moisling; in dem dänischen Dorf vor den Toren Lübecks entwickelt sich einen aschkenasisch-jüdische Gemeinde, die spätestens ab 1723 einen eigenen Rabbiner hat. Ab
Chronik 1656 Ansiedlung erster Juden in Moisling; in dem dänischen Dorf vor den Toren Lübecks entwickelt sich einen aschkenasisch-jüdische Gemeinde, die spätestens ab 1723 einen eigenen Rabbiner hat. Ab
21.März 1933 Juni/Juli 1933 Juli 1934
 21.März 1933 Die SA richtet in einem leer stehenden Fabrikgebäude im Stadtzentrum von Oranienburg das erste Konzentrationslager in Preußen ein. Anders als das spätere KZ Sachsenhausen lag das KZ Oranienburg
21.März 1933 Die SA richtet in einem leer stehenden Fabrikgebäude im Stadtzentrum von Oranienburg das erste Konzentrationslager in Preußen ein. Anders als das spätere KZ Sachsenhausen lag das KZ Oranienburg
Stoffverteilungsplan Schleßwig Holstein
 Stoffverteilungsplan Schleßwig Holstein mitmischen 3 Ausgabe A Lehrer: Schule: Lehrplan Geschichte, Hauptschule (Jahrgangsstufe 7-9) Inhalte mitmischen 3 Mein Unterrichtsplan Die gescheiterte Demokratie
Stoffverteilungsplan Schleßwig Holstein mitmischen 3 Ausgabe A Lehrer: Schule: Lehrplan Geschichte, Hauptschule (Jahrgangsstufe 7-9) Inhalte mitmischen 3 Mein Unterrichtsplan Die gescheiterte Demokratie
Predigt zu Philipper 4, 4-7
 Predigt zu Philipper 4, 4-7 Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich: Freut euch. Eure Güte soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe! Sorgt euch um nichts, sondern in allem
Predigt zu Philipper 4, 4-7 Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich: Freut euch. Eure Güte soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe! Sorgt euch um nichts, sondern in allem
ARBEITSBLÄTTER 13/16 ANNE FRANK UND DER HOLOCAUST
 ARBEITSBLÄTTER 13/16 ANNE UND ARBEITSBLATT 13 / Sätze ausschneiden Arbeitet in Gruppen. Schneidet die Sätze aus, ordnet sie und klebt sie unter den richtigen Text. Sätze zu Text 1 Sätze zu Text 2 Sätze
ARBEITSBLÄTTER 13/16 ANNE UND ARBEITSBLATT 13 / Sätze ausschneiden Arbeitet in Gruppen. Schneidet die Sätze aus, ordnet sie und klebt sie unter den richtigen Text. Sätze zu Text 1 Sätze zu Text 2 Sätze
Geschichte erinnert und gedeutet: Wie legitimieren die Bolschewiki ihre Herrschaft? S. 30. Wiederholen und Anwenden S. 32
 Stoffverteilungsplan Nordrhein-Westfalen Schule: 978-3-12-443030-4 Lehrer: Kernplan Geschichte 9. Inhaltsfeld: Neue weltpolitische Koordinaten Russland: Revolution 1917 und Stalinismus 1) Vom Zarenreich
Stoffverteilungsplan Nordrhein-Westfalen Schule: 978-3-12-443030-4 Lehrer: Kernplan Geschichte 9. Inhaltsfeld: Neue weltpolitische Koordinaten Russland: Revolution 1917 und Stalinismus 1) Vom Zarenreich
Helmstedt-Beendorf. (Männer)
 Helmstedt-Beendorf (Männer) In Beendorf bei Helmstedt wurden 1944 zwei Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme errichtet ein Männer- und ein Frauenlager. Die männlichen und die weiblichen Häftlinge
Helmstedt-Beendorf (Männer) In Beendorf bei Helmstedt wurden 1944 zwei Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme errichtet ein Männer- und ein Frauenlager. Die männlichen und die weiblichen Häftlinge
Es gilt das gesprochene Wort. Sperrfrist: Redebeginn
 Rede des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages anlässlich der Gedenkveranstaltung für Henning von Tresckow und die Opfer des 20. Juli 1944 am 21. Juli 2008 in Potsdam Es gilt das gesprochene Wort.
Rede des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages anlässlich der Gedenkveranstaltung für Henning von Tresckow und die Opfer des 20. Juli 1944 am 21. Juli 2008 in Potsdam Es gilt das gesprochene Wort.
Kinder und Jugendliche im KZ. Projekttag Kinder & Jugendliche
 Kinder und im KZ Kinder und im KZ Die kleinen Letten Kinder und im KZ Sowohl im Stammlager des KZ Neuengamme als auch in seinen Außenlagern waren Kinder und eingesperrt. Im April 1941 kam ein erster großer
Kinder und im KZ Kinder und im KZ Die kleinen Letten Kinder und im KZ Sowohl im Stammlager des KZ Neuengamme als auch in seinen Außenlagern waren Kinder und eingesperrt. Im April 1941 kam ein erster großer
Projektbeschreibung Februar 2011
 Projektbeschreibung Deutsch-polnisch-russisches Seminar für StudentInnen: Multiperspektivität der Erinnerung: deutsche, polnische und russische Perspektiven und gesellschaftliche Diskurse auf den Holocaust
Projektbeschreibung Deutsch-polnisch-russisches Seminar für StudentInnen: Multiperspektivität der Erinnerung: deutsche, polnische und russische Perspektiven und gesellschaftliche Diskurse auf den Holocaust
Johannes Nommensen. (BArch, BDC/RS, Nommensen, Johannes, )
 Johannes Nommensen 1937 (BArch, BDC/RS, Nommensen, Johannes, 26.12.1909) * 26.12.1909 (Sigumpar/Sumatra), 2.3.1967 (Kiel) Arzt, aus einer Missionarsfamilie stammend; 1933 SS, 1937 NSDAP; KZ Dachau; Frauen-KZ
Johannes Nommensen 1937 (BArch, BDC/RS, Nommensen, Johannes, 26.12.1909) * 26.12.1909 (Sigumpar/Sumatra), 2.3.1967 (Kiel) Arzt, aus einer Missionarsfamilie stammend; 1933 SS, 1937 NSDAP; KZ Dachau; Frauen-KZ
Faschismus und Anti-Faschismus in Großbritannien
 Englisch Florian Schumacher Faschismus und Anti-Faschismus in Großbritannien Studienarbeit Inhaltsverzeichnis I. Der Faschismus in Großbritannien vor 1936... 2 1. Die Ausgangssituation Anfang der zwanziger
Englisch Florian Schumacher Faschismus und Anti-Faschismus in Großbritannien Studienarbeit Inhaltsverzeichnis I. Der Faschismus in Großbritannien vor 1936... 2 1. Die Ausgangssituation Anfang der zwanziger
Wo einst die Schtetl waren... - Auf den Spuren jüdischen Lebens in Ostpolen -
 Wo einst die Schtetl waren... - Auf den Spuren jüdischen Lebens in Ostpolen - unter diesem Motto veranstaltete Zeichen der Hoffnung vom 13. 21. Aug. 2006 eine Studienfahrt nach Polen. Die 19 Teilnehmenden
Wo einst die Schtetl waren... - Auf den Spuren jüdischen Lebens in Ostpolen - unter diesem Motto veranstaltete Zeichen der Hoffnung vom 13. 21. Aug. 2006 eine Studienfahrt nach Polen. Die 19 Teilnehmenden
Festgottesdienst zur Einweihung des neuen evangelischen Gemeindehauses am (18. Sonntag nach Trinitatis) in der Stiftskirche
 Festgottesdienst zur Einweihung des neuen evangelischen Gemeindehauses am 25.09.2016 (18. Sonntag nach Trinitatis) in der Stiftskirche zu Windecken. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe
Festgottesdienst zur Einweihung des neuen evangelischen Gemeindehauses am 25.09.2016 (18. Sonntag nach Trinitatis) in der Stiftskirche zu Windecken. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe
VORANSICHT. Ein Fenstersturz mit Folgen: der Dreißigjährige Krieg
 Frühe Neuzeit Beitrag 7 Der Dreißigjährige Krieg 1 von 32 Ein Fenstersturz mit Folgen: der Dreißigjährige Krieg Silke Bagus, Nohra OT Ulla Dreißig Jahre Krieg was aber steckt dahinter? In der vorliegenden
Frühe Neuzeit Beitrag 7 Der Dreißigjährige Krieg 1 von 32 Ein Fenstersturz mit Folgen: der Dreißigjährige Krieg Silke Bagus, Nohra OT Ulla Dreißig Jahre Krieg was aber steckt dahinter? In der vorliegenden
Schweizer Auswanderung früher und heute
 Schweizer Auswanderung früher und heute Aufgabe 1 Betrachte die beiden Grafiken Schweizer Auswanderung zwischen 1840 und 1910 und Auslandschweizerinnen und -schweizer 2004 auf der nächsten Seite. Welches
Schweizer Auswanderung früher und heute Aufgabe 1 Betrachte die beiden Grafiken Schweizer Auswanderung zwischen 1840 und 1910 und Auslandschweizerinnen und -schweizer 2004 auf der nächsten Seite. Welches
Tschernobyl und Ilulissat verbindet
 . global news 3462 25-04-16: Was Auschwitz, Leningrad, Tschernobyl und Ilulissat verbindet Vier Plätze, die mich heute noch im Gedenken umtreiben: Auschwitz, der Piskarjowskoje-Gedenkfriedhof im damaligen
. global news 3462 25-04-16: Was Auschwitz, Leningrad, Tschernobyl und Ilulissat verbindet Vier Plätze, die mich heute noch im Gedenken umtreiben: Auschwitz, der Piskarjowskoje-Gedenkfriedhof im damaligen
Der Erste Weltkrieg. Abschiede und Grenzerfahrungen. Alltag und Propaganda. Fragen zur Ausstellung
 Der Erste Weltkrieg. Abschiede und Grenzerfahrungen. Alltag und Propaganda. Fragen zur Ausstellung Teil 1 Kriegsbeginn und Fronterlebnis Trotz seines labilen Gesundheitszustandes wurde der Mannheimer Fritz
Der Erste Weltkrieg. Abschiede und Grenzerfahrungen. Alltag und Propaganda. Fragen zur Ausstellung Teil 1 Kriegsbeginn und Fronterlebnis Trotz seines labilen Gesundheitszustandes wurde der Mannheimer Fritz
Deutschland nach dem Krieg
 Deutschland nach dem Krieg 6. Juni 2011 1945 endete der schlimmste Krieg, den die Menscheit jemals erlebt hatte. Das Ende des 2. Weltkrieges war aber auch gleichzeitig ein Anfang - für ein Nachkriegsdeutschland,
Deutschland nach dem Krieg 6. Juni 2011 1945 endete der schlimmste Krieg, den die Menscheit jemals erlebt hatte. Das Ende des 2. Weltkrieges war aber auch gleichzeitig ein Anfang - für ein Nachkriegsdeutschland,
der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei
 der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei einer um am sind noch wie einem über einen so zum war haben nur oder
der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei einer um am sind noch wie einem über einen so zum war haben nur oder
Sinai Feldzug (1956) 1.1 Ursachen des Konflikts:
 Sinai Feldzug (1956) 1.1 Ursachen des Konflikts: Nach dem Waffenstillstandsabkommen, das auf den Unabhängigkeitskrieg 1948 folgte, vertiefte sich die Kluft zwischen Israel und den arabischen Nachbarstaaten,
Sinai Feldzug (1956) 1.1 Ursachen des Konflikts: Nach dem Waffenstillstandsabkommen, das auf den Unabhängigkeitskrieg 1948 folgte, vertiefte sich die Kluft zwischen Israel und den arabischen Nachbarstaaten,
Sperrfrist: Uhr. Rede des Präsidenten des Nationalrates im Reichsratssitzungssaal am 14. Jänner 2005 Es gilt das gesprochene Wort
 Sperrfrist: 16.00 Uhr Rede des Präsidenten des Nationalrates im Reichsratssitzungssaal am 14. Jänner 2005 Es gilt das gesprochene Wort Meine Damen und Herren! Wir haben Sie zu einer Veranstaltung ins Hohe
Sperrfrist: 16.00 Uhr Rede des Präsidenten des Nationalrates im Reichsratssitzungssaal am 14. Jänner 2005 Es gilt das gesprochene Wort Meine Damen und Herren! Wir haben Sie zu einer Veranstaltung ins Hohe
Fotoausstellung zum Themenmonat Leben und Tod
 Fotoausstellung zum Themenmonat Leben und Tod von Wiebke Tigges Alter Friedhof Haaren (ohne Beschreibung) Erinnerung Dieses Bild zeigt das Eingangstor des Konzentrationslagers Auschwitz Birkenau, in das
Fotoausstellung zum Themenmonat Leben und Tod von Wiebke Tigges Alter Friedhof Haaren (ohne Beschreibung) Erinnerung Dieses Bild zeigt das Eingangstor des Konzentrationslagers Auschwitz Birkenau, in das
2017 weiter-sehen Initiativen zum Reformationsgedächtnis 2017 in der Erzdiözese München und Freising DR. F. SCHUPPE 1
 2017 weiter-sehen Initiativen zum Reformationsgedächtnis 2017 in der Erzdiözese München und Freising DR. F. SCHUPPE 1 Es stimmt hoffnungsvoll, dass mit dem 500. Jahrestag der Reformation erstmals ein Reformationsgedenken
2017 weiter-sehen Initiativen zum Reformationsgedächtnis 2017 in der Erzdiözese München und Freising DR. F. SCHUPPE 1 Es stimmt hoffnungsvoll, dass mit dem 500. Jahrestag der Reformation erstmals ein Reformationsgedenken
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Deutschland Die deutschen Staaten vertiefen ihre Teilung
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Deutschland 1949-1961 - Die deutschen Staaten vertiefen ihre Teilung Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Deutschland 1949-1961 - Die deutschen Staaten vertiefen ihre Teilung Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT
Im Rahmen unseres Projekts Spurensuche zur Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma in Duisburg
 Im Rahmen unseres Projekts Spurensuche zur Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma in Duisburg präsentieren wir hier einen Text, der das Schicksal der Duisburgerin Christine Lehmann schildert. Er stammt
Im Rahmen unseres Projekts Spurensuche zur Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma in Duisburg präsentieren wir hier einen Text, der das Schicksal der Duisburgerin Christine Lehmann schildert. Er stammt
Max Pauly. (BArch, BDC/SSO, Pauly, Max, 1.6.1907)
 1937 (BArch, BDC/SSO, Pauly, Max, 1.6.1907) * 1.6.1907 (Wesselburen/Dithmarschen) 7.10.1946 (Hinrichtung in Hameln) Selbstständiger Kaufmann; 1928 NSDAP und SA, 1930 SS; 1932 Gefängnisstrafe wegen schweren
1937 (BArch, BDC/SSO, Pauly, Max, 1.6.1907) * 1.6.1907 (Wesselburen/Dithmarschen) 7.10.1946 (Hinrichtung in Hameln) Selbstständiger Kaufmann; 1928 NSDAP und SA, 1930 SS; 1932 Gefängnisstrafe wegen schweren
Unter der lateinischen Formel Mons, Pons, Fons wird die Entstehung der Stadt Lüneburg zusammengefasst. Mons steht dabei für den Kalkberg, welcher auf
 Unter der lateinischen Formel Mons, Pons, Fons wird die Entstehung der Stadt Lüneburg zusammengefasst. Mons steht dabei für den Kalkberg, welcher auf dem Radweg bereits passiert oder sogar bestiegen wurde.
Unter der lateinischen Formel Mons, Pons, Fons wird die Entstehung der Stadt Lüneburg zusammengefasst. Mons steht dabei für den Kalkberg, welcher auf dem Radweg bereits passiert oder sogar bestiegen wurde.
Im Original veränderbare Word-Dateien
 Novemberrevolution und der Friedensvertrag von Versailles Aufgabe 1 Nennt die Gründe für die Meuterei der Matrosen in Wilhelmshaven. Aufgabe 2 Überlegt, warum sich auch Arbeiter den Aufständen in Kiel
Novemberrevolution und der Friedensvertrag von Versailles Aufgabe 1 Nennt die Gründe für die Meuterei der Matrosen in Wilhelmshaven. Aufgabe 2 Überlegt, warum sich auch Arbeiter den Aufständen in Kiel
Geraubte Kindheit Kinder und Jugendliche im Nationalsozialismus
 Bundesjugendvertretung (Herausgeberin) Geraubte Kindheit Kinder und Jugendliche im Nationalsozialismus 114 Selektiert und ausgemerzt. Kinder und Jugendliche als Opfer Jugendlicher KZ Häftling nach der
Bundesjugendvertretung (Herausgeberin) Geraubte Kindheit Kinder und Jugendliche im Nationalsozialismus 114 Selektiert und ausgemerzt. Kinder und Jugendliche als Opfer Jugendlicher KZ Häftling nach der
Was danach geschah -Weimarer Republik ( )
 Was danach geschah -Weimarer Republik (1919-1933) Parlamentarische Demokratie Vertreter: Phillip Scheidemann, Friedrich Ebert (SPD) Konzept: -Volk wählt Vertreter -Vertreter haben freies Mandat -bilden
Was danach geschah -Weimarer Republik (1919-1933) Parlamentarische Demokratie Vertreter: Phillip Scheidemann, Friedrich Ebert (SPD) Konzept: -Volk wählt Vertreter -Vertreter haben freies Mandat -bilden
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Richard von Weizsäcker - "Zum 40. Jahrestag der Beendigung Gewaltherrschaft" (8.5.1985 im Bundestag in Bonn) Das komplette Material
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Richard von Weizsäcker - "Zum 40. Jahrestag der Beendigung Gewaltherrschaft" (8.5.1985 im Bundestag in Bonn) Das komplette Material
2. Reformation und Macht, Thron und Altar. Widerständigkeit und Selbstbehauptung
 1517 2017 Reformationsjubiläum in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 2. Reformation und Macht, Thron und Altar Widerständigkeit und Selbstbehauptung Widerständigkeit und
1517 2017 Reformationsjubiläum in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 2. Reformation und Macht, Thron und Altar Widerständigkeit und Selbstbehauptung Widerständigkeit und
Bildungsplan 2004 Allgemein bildendes Gymnasium
 Bildungsplan 2004 Allgemein bildendes Gymnasium Niveaukonkretisierung für Geschichte Klasse Landesinstitut für Schulentwicklung Qualitätsentwicklung und Evaluation Weimarer Republik und Nationalsozialismus
Bildungsplan 2004 Allgemein bildendes Gymnasium Niveaukonkretisierung für Geschichte Klasse Landesinstitut für Schulentwicklung Qualitätsentwicklung und Evaluation Weimarer Republik und Nationalsozialismus
Verlauf Material Klausuren Glossar Literatur. Streit um Macht und Religion eine Unterrichts - einheit zum Dreißigjährigen Krieg
 Reihe 10 S 1 Verlauf Material Streit um Macht und Religion eine Unterrichts - einheit zum Dreißigjährigen Krieg Silke Bagus, Nohra OT Ulla Von einer Defenestration berichtet sogar schon das Alte Testament.
Reihe 10 S 1 Verlauf Material Streit um Macht und Religion eine Unterrichts - einheit zum Dreißigjährigen Krieg Silke Bagus, Nohra OT Ulla Von einer Defenestration berichtet sogar schon das Alte Testament.
Aufgabe 4. Wie war der holocaust möglich? Auf den Karten werden die einzelnen Phasen der Judenverfolgung im Dritten Reich geschildert.
 Aufgabe 4 Wie war der holocaust möglich? Lies dir die folgenden Textkarten aufmerksam durch. Auf den Karten werden die einzelnen Phasen der Judenverfolgung im Dritten Reich geschildert. Fasse nach der
Aufgabe 4 Wie war der holocaust möglich? Lies dir die folgenden Textkarten aufmerksam durch. Auf den Karten werden die einzelnen Phasen der Judenverfolgung im Dritten Reich geschildert. Fasse nach der
Karsten Hartdegen. Entstehung der Bundesrepublik Deutschland
 Entstehung der Bundesrepublik Deutschland Indoktrination Indoktrination Indoktrination Indoktrination Indoktrination Angriffskrieg Angriffskrieg Angriffskrieg Kriegsverbrechen Kriegsverbrechen Kriegsverbrechen
Entstehung der Bundesrepublik Deutschland Indoktrination Indoktrination Indoktrination Indoktrination Indoktrination Angriffskrieg Angriffskrieg Angriffskrieg Kriegsverbrechen Kriegsverbrechen Kriegsverbrechen
1. Warum war der Staatshaushalt (= die Staatsfinanzen) von Nazi-Deutschland Ende der 30er Jahre kurz vor dem Bankrott?
 1 Der Weg in den Zweiten Weltkrieg - Fragen FRAGEN ZU DER WEG IN DEN ZWEITEN WELTKRIEG 1. Warum war der Staatshaushalt (= die Staatsfinanzen) von Nazi-Deutschland Ende der 30er Jahre kurz vor dem Bankrott?
1 Der Weg in den Zweiten Weltkrieg - Fragen FRAGEN ZU DER WEG IN DEN ZWEITEN WELTKRIEG 1. Warum war der Staatshaushalt (= die Staatsfinanzen) von Nazi-Deutschland Ende der 30er Jahre kurz vor dem Bankrott?
Leben von Oskar und Emilie Schindler in die Gegenwart geholt
 Leben von Oskar und Emilie Schindler in die Gegenwart geholt Schindler Biografin Erika Rosenberg zu Gast bei Gymnasiasten der Bereiche Gesundheit/Soziales und Wirtschaft Samstag, 13.11.2010 Theo Tangermann
Leben von Oskar und Emilie Schindler in die Gegenwart geholt Schindler Biografin Erika Rosenberg zu Gast bei Gymnasiasten der Bereiche Gesundheit/Soziales und Wirtschaft Samstag, 13.11.2010 Theo Tangermann
Die Verfolgung der intellektuellen Eliten in Polen und in der Tschechoslowakei durch die Nationalsozialisten. Kontexte und Erinnerungskulturen
 Internationale Tagung Die Verfolgung der intellektuellen Eliten in Polen und in der Tschechoslowakei durch die Nationalsozialisten. Kontexte und Erinnerungskulturen Eine Tagung der Stiftung Brandenburgische
Internationale Tagung Die Verfolgung der intellektuellen Eliten in Polen und in der Tschechoslowakei durch die Nationalsozialisten. Kontexte und Erinnerungskulturen Eine Tagung der Stiftung Brandenburgische
Synopse zum Pflichtmodul Nationalstaatsbildung im Vergleich
 Synopse zum Pflichtmodul Nationalstaatsbildung im Vergleich Buchners Kolleg. Themen Geschichte Nationalstaatsbildung Wurzeln unserer Identität (ISBN 978-3-7661-7317-1) C.C.Buchner Verlag GmbH & Co. KG
Synopse zum Pflichtmodul Nationalstaatsbildung im Vergleich Buchners Kolleg. Themen Geschichte Nationalstaatsbildung Wurzeln unserer Identität (ISBN 978-3-7661-7317-1) C.C.Buchner Verlag GmbH & Co. KG
Krieg in der Geschichte Otto Dix Der Krieg (1923)
 Krieg in der Geschichte Otto Dix Der Krieg (1923) 1 Der Weg zum totalen Krieg Referenten: Sebastian Seidel, Nils Theinert, Stefan Zeppenfeld Gliederung Die Koalitionskriege 1792 1815 Der Amerikanische
Krieg in der Geschichte Otto Dix Der Krieg (1923) 1 Der Weg zum totalen Krieg Referenten: Sebastian Seidel, Nils Theinert, Stefan Zeppenfeld Gliederung Die Koalitionskriege 1792 1815 Der Amerikanische
Wir feiern heute die Wiedererrichtung unserer demokratischen Republik Österreich vor genau 60. Jahren, am 27. April 1945.
 Rede von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer beim Festakt anlässlich des 60. Jahrestages der Gründung der Zweiten Republik, am 27. April 2005, 11:00 Uhr, im Redoutensaal der Wiener Hofburg (Es gilt das gesprochene
Rede von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer beim Festakt anlässlich des 60. Jahrestages der Gründung der Zweiten Republik, am 27. April 2005, 11:00 Uhr, im Redoutensaal der Wiener Hofburg (Es gilt das gesprochene
Kirchengesetz zur Ordnung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
 Ordnung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 162 Kirchengesetz zur Ordnung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz Vom 4. November
Ordnung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 162 Kirchengesetz zur Ordnung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz Vom 4. November
Petrus und die Kraft des Gebets
 Bibel für Kinder zeigt: Petrus und die Kraft des Gebets Text: Edward Hughes Illustration: Janie Forest Adaption: Ruth Klassen Deutsche Übersetzung 2000 Importantia Publishing Produktion: Bible for Children
Bibel für Kinder zeigt: Petrus und die Kraft des Gebets Text: Edward Hughes Illustration: Janie Forest Adaption: Ruth Klassen Deutsche Übersetzung 2000 Importantia Publishing Produktion: Bible for Children
1.1. Zwangsarbeit eine Definition des Begriffs Es lassen sich grob skizziert vier Kategorien von Zwangsarbeitern unterscheiden:
 Sachanalyse 1.1. Zwangsarbeit eine Definition des Begriffs Es lassen sich grob skizziert vier Kategorien von Zwangsarbeitern unterscheiden: 1. Ausländische Zivilarbeiter, die in Deutschland landläufig
Sachanalyse 1.1. Zwangsarbeit eine Definition des Begriffs Es lassen sich grob skizziert vier Kategorien von Zwangsarbeitern unterscheiden: 1. Ausländische Zivilarbeiter, die in Deutschland landläufig
Konzentrationslager und Vernichtungslager Auschwitz Lisa, Jonas. Auschwitz
 Auschwitz 1. Einleitung Rudolf Höß ist als Kommandant von Auschwitz und Josef Mengele als Lagerarzt verantwortlich für die Ermordung von 1,1 Millionen Juden, 140.000 Polen, 20.000 Sinti und Roma, 10.000
Auschwitz 1. Einleitung Rudolf Höß ist als Kommandant von Auschwitz und Josef Mengele als Lagerarzt verantwortlich für die Ermordung von 1,1 Millionen Juden, 140.000 Polen, 20.000 Sinti und Roma, 10.000
Grabower Juden im 1. Weltkrieg
 Grabower Juden im 1. Weltkrieg Mitten im Ersten Weltkrieg, am 11. Oktober 1916, verfügte der preußische Kriegsminister Adolf Wild von Hohenborn die statistische Erhebung des Anteils von Juden an den Soldaten
Grabower Juden im 1. Weltkrieg Mitten im Ersten Weltkrieg, am 11. Oktober 1916, verfügte der preußische Kriegsminister Adolf Wild von Hohenborn die statistische Erhebung des Anteils von Juden an den Soldaten
Glaube kann man nicht erklären!
 Glaube kann man nicht erklären! Es gab mal einen Mann, der sehr eifrig im Lernen war. Er hatte von einem anderen Mann gehört, der viele Wunderzeichen wirkte. Darüber wollte er mehr wissen, so suchte er
Glaube kann man nicht erklären! Es gab mal einen Mann, der sehr eifrig im Lernen war. Er hatte von einem anderen Mann gehört, der viele Wunderzeichen wirkte. Darüber wollte er mehr wissen, so suchte er
Barriere-Freiheit. Der Behinderten-Beirat. der Stadt Cottbus informiert:
 Barriere-Freiheit Der Behinderten-Beirat der Stadt Cottbus informiert: UN-Behinderten-Rechts-Konvention (UN-BRK) hat Ziel-Stellung der Barriere-Freiheit als Bedingung für unabhängige Lebens-Führung Lebenshilfe
Barriere-Freiheit Der Behinderten-Beirat der Stadt Cottbus informiert: UN-Behinderten-Rechts-Konvention (UN-BRK) hat Ziel-Stellung der Barriere-Freiheit als Bedingung für unabhängige Lebens-Führung Lebenshilfe
Junge Theologen im >Dritten Reich<
 Wolfgang Scherffig Junge Theologen im >Dritten Reich< Dokumente, Briefe, Erfahrungen Band 1 Es begann mit einem Nein! 1933-1935 Mit einem Geleitwort von Helmut GoUwitzer Neukirchener Inhalt Helmut GoUwitzer,
Wolfgang Scherffig Junge Theologen im >Dritten Reich< Dokumente, Briefe, Erfahrungen Band 1 Es begann mit einem Nein! 1933-1935 Mit einem Geleitwort von Helmut GoUwitzer Neukirchener Inhalt Helmut GoUwitzer,
Stunk im Haus. Die Eingliederung der Vertriebenen in den Kreis Herford
 Stunk im Haus Die Eingliederung der Vertriebenen in den Kreis Herford 1945 1952 Im Juni 1949 berichtet ein Herforder Polizeimeister über das menschwidrige Wohnen im Hause einer Erbengemeinschaft in Herford:
Stunk im Haus Die Eingliederung der Vertriebenen in den Kreis Herford 1945 1952 Im Juni 1949 berichtet ein Herforder Polizeimeister über das menschwidrige Wohnen im Hause einer Erbengemeinschaft in Herford:
Wo ist das Warschauer Ghetto? Eine Neuentdeckung von Jugendlichen aus Bonn und Warschau
 Was war was wird? Projekt des Lyceums im Adama Mickiewicza (Warschau) und der Integrierten Gesamtschule Bonn-Beuel Projektarbeit 2004 (Teil 2) Wo ist das Warschauer Ghetto? Eine Neuentdeckung von Jugendlichen
Was war was wird? Projekt des Lyceums im Adama Mickiewicza (Warschau) und der Integrierten Gesamtschule Bonn-Beuel Projektarbeit 2004 (Teil 2) Wo ist das Warschauer Ghetto? Eine Neuentdeckung von Jugendlichen
Bildungsstandards für Geschichte. Kursstufe (4-stündig)
 Stoffverteilungsplan und Geschehen Baden-Württemberg 11 Band 1 Schule: 978-3-12-430016-4 Lehrer: und Geschehen und Geschehen 1. Prozesse der Modernisierung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft seit
Stoffverteilungsplan und Geschehen Baden-Württemberg 11 Band 1 Schule: 978-3-12-430016-4 Lehrer: und Geschehen und Geschehen 1. Prozesse der Modernisierung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft seit
Grußwort von Ortsvorsteher Hans Beser zum 50-jährigen Jubiläum der Christuskirche Ergenzingen am 16. Juni 2012
 Grußwort von Ortsvorsteher Hans Beser zum 50-jährigen Jubiläum der Christuskirche Ergenzingen am 16. Juni 2012 Sehr geehrte Frau Dekanin Kling de Lazer, sehr geehrte Herren Pfarrer Reiner und Huber, sehr
Grußwort von Ortsvorsteher Hans Beser zum 50-jährigen Jubiläum der Christuskirche Ergenzingen am 16. Juni 2012 Sehr geehrte Frau Dekanin Kling de Lazer, sehr geehrte Herren Pfarrer Reiner und Huber, sehr
Und deshalb erinnere ich hier und heute wie im vergangenen Jahr zum Volkstrauertag an die tägliche Trauer hunderttausender Mütter, Väter und Kinder.
 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger Volkstrauertag im November 2010 wir verstehen heute den Volkstrauertag, wie das Wort sagt als einen Tag der Trauer auch mit zunehmendem Abstand vom Krieg Eigentlich müßte
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger Volkstrauertag im November 2010 wir verstehen heute den Volkstrauertag, wie das Wort sagt als einen Tag der Trauer auch mit zunehmendem Abstand vom Krieg Eigentlich müßte
Konzentrationslager Auschwitz
 Konzentrationslager Auschwitz Gliederung Einleitung Seite 1 Stammlager Auschwitz I Seite 1-22 Gegenstände der Häftlinge Seite 8-10 Auschwitz Birkenau (Auschwitz II) Seite 23 29 Danksagung und Quellen Seite
Konzentrationslager Auschwitz Gliederung Einleitung Seite 1 Stammlager Auschwitz I Seite 1-22 Gegenstände der Häftlinge Seite 8-10 Auschwitz Birkenau (Auschwitz II) Seite 23 29 Danksagung und Quellen Seite
Weihbischof Wilhelm Zimmermann. Ansprache im Gottesdienst der Antiochenisch-Orthodoxen Gemeinde Hl. Josef von Damaskus
 Weihbischof Wilhelm Zimmermann Ansprache im Gottesdienst der Antiochenisch-Orthodoxen Gemeinde Hl. Josef von Damaskus in der Kirche St. Ludgerus, Essen-Rüttenscheid Sonntag, 19. Juni 2016 Sehr geehrter,
Weihbischof Wilhelm Zimmermann Ansprache im Gottesdienst der Antiochenisch-Orthodoxen Gemeinde Hl. Josef von Damaskus in der Kirche St. Ludgerus, Essen-Rüttenscheid Sonntag, 19. Juni 2016 Sehr geehrter,
Rede Volkstrauertag 2013
 Rede Volkstrauertag 2013 Braucht es einen Volkstrauertag noch? Ich gestehe, dass mir diese Frage jedes Mal durch den Kopf geht, wenn ich mich an die Vorbereitung meiner Rede mache. Doch bei den ersten
Rede Volkstrauertag 2013 Braucht es einen Volkstrauertag noch? Ich gestehe, dass mir diese Frage jedes Mal durch den Kopf geht, wenn ich mich an die Vorbereitung meiner Rede mache. Doch bei den ersten
der Polizei Die Radikalisierung im Krieg
 der Polizei Die Radikalisierung im Krieg Mit Kriegsbeginn kamen auf die Polizei neue Aufgaben zu. Im Deutschen Reich sollte sie den Zusammenhalt der Heimatfront mit allen Mitteln aufrechterhalten. Dazu
der Polizei Die Radikalisierung im Krieg Mit Kriegsbeginn kamen auf die Polizei neue Aufgaben zu. Im Deutschen Reich sollte sie den Zusammenhalt der Heimatfront mit allen Mitteln aufrechterhalten. Dazu
Es gilt das gesprochene Wort.
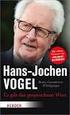 Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Teilnahme an der Veranstaltung Verteilung der Flugblätter der Weißen Rose Ausstellungseröffnung Ich
Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Teilnahme an der Veranstaltung Verteilung der Flugblätter der Weißen Rose Ausstellungseröffnung Ich
